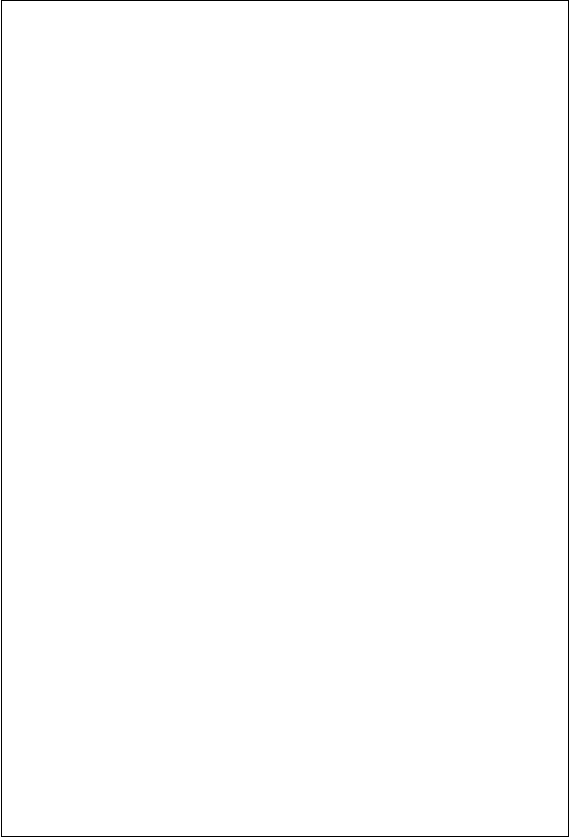Insbesondere die Volksanwaltschaft hat
selbständig in einigen Fällen Stellungnahmen abgegeben, die in die
Verhandlungen ebenso miteinbezogen wurden.
I. Der Berichtspflicht unterliegende Petitionen
und Bürgerinitiativen
Abstandnahme von
der weiteren Verhandlung im Sinne des § 100b Abs. 1 GOG
Petition Nr. 14
überreicht vom Abgeordneten Peter Rosenstingl
betreffend “Gerechtigkeit bei den Telefongebühren”
Mit der gegenständlichen Petition
überreichte der Abgeordnete Peter Rosenstingl ein Anliegen des Georg
Weißenberger dem Präsidenten des Nationalrates mit folgendem
Wortlaut:
“Diese Petition ist ein Appell an alle
Abgeordneten im Nationalrat, ihrer Verpflichtung als Volksvertreter endlich
nachzukommen, die berechtigten Beschwerden vieler Bürger über die
Mißstände bei der Post ernstzunehmen und im Bereich der
Telefongebührenabrechnung für Gerechtigkeit zu sorgen.
Gerade die in letzter Zeit verstärkt
auftretenden Betrügereien mit fingierten Telefongesprächen,
insbesondere im Zusammenhang mit den Übersee-Sex-Hotlines machen deutlich,
wie unbefriedigend in Österreich der Abrechnungsmodus für die
Telefongebühren ist: Nach wie vor ist es vielen Telefonbenützern
überhaupt nicht möglich, ihren Gebührenstand jederzeit zu
kontrollieren, da ein Anschluß der – kostenpflichtigen –
Gebührenzähler bei Viertelanschlüssen angeblich unmöglich
ist. Was bei Gas, Strom und Wasser selbstverständlich ist, geht beim
Telefon angeblich nicht oder man muß dafür extra bezahlen.
Außerdem ist es unzumutbar, dem
Telefonkunden für eine detaillierte Rechnung über seine Telefonate
– soweit dies derzeit überhaupt möglich ist –
zusätzliche Gebühren zu verrechnen. Man stelle sich etwa zum Vergleich
vor, wie Gäste im Wirtshaus – zu Recht – reagieren, wenn ihnen
der Kellner nur einen Pauschalpreis abverlangt, für die Ausfolgung einer
detaillierten Rechnung über die einzelnen Speisen und Getränke aber
einen Aufschlag verlangt!
Zu allem Überdruß ist die Post laut
Fernmeldegesetz auch noch gegenüber jedem anderen Dienstleistungsunternehmen
dadurch im Vorteil, daß sie im Zweifelsfall nicht die Richtigkeit ihrer
Rechnung beweisen muß, sondern der Kunde die Fehlerhaftigkeit. Der aber
kann hierfür keinerlei Beweismittel zur Verfügung haben, weil alle
ihm zugänglichen Meßgeräte, absurderweise inklusive der
gebührenpflichtigen Post-Gebührenzähler, nicht anerkannt
werden, sodaß auch berechtigte Reklamationen kaum berücksichtigt
werden.
Es ist unerhört, wie hier der Telefonkunde in
nahezu völliger Rechtlosigkeit gegenüber dem Monopolunternehmen
Post gehalten wird: Ein Zustand, der jedem Prinzip des Konsumentenschutzes
widerspricht und der im normalen Geschäftsleben undenkbar wäre, so
rücksichtslos kann nur ein staatliches Monopolunternehmen mit politischer
Rückendeckung durch die Regierenden agieren.
Besonders empörend ist diese kundenfeindliche
Vorgangsweise angesichts der ohnedies im internationalen Vergleich
außerordentlich hohen Telefongebühren, die sich maßgeblich aus
der Telefonsteuer des Fernmeldeinvestitionsgesetzes ergeben, mit dessen Hilfe
im vergangenen Jahr rund 10 Milliarden Schilling an Gebühren vom
Finanzminister kassiert wurden!
Bekanntlich darf dieser zwei Drittel der
Telefoneinnahmen nach seinem Gutdünken verwenden, während die Post
alles, was mit dem verbleibenden Drittel nicht bezahlbar ist, auf Kredit
finanzieren muß – kein Wunder also, daß sie trotz horrender
Telefongebühren fast pleite ist (der Schuldenstand beträgt
mittlerweile sagenhafte 100 Milliarden Schilling!) und versucht, sich am
Kunden schadlos zu halten.
Verantwortlich dafür aber ist die
Regierungspolitik, die seit Jahren dieser Entwicklung tatenlos zusieht und
hierfür auch noch die Grundlagen in Gestalt der entsprechenden Gesetze schuf.
Ich fordere daher die Abgeordneten aller Parteien
und den zuständigen Minister dringend auf, zur Lösung dieser Probleme
raschestmöglich folgende Maßnahmen zu setzen:
– Die Telefonkunden
müssen jederzeit, etwa über einen in jedem Telefon integrierten
Gebührenzähler, die Kontrolle über ihre Rechnung kostenlos
erhalten können, ebenso müssen alle Zusatzdienste, die die Abrechnung
betreffen, kostenlos sein und der Kunde automatisch eine detaillierte Rechnung
über seine Gespräche erhalten, wie dies in vielen Ländern
üblich ist.
– Die rechtliche Stellung der
Telefonkunden muß hinsichtlich der Beweislast im Reklamationsfall den
konsumentenschützenden Bestimmungen im normalen Geschäftsleben
angeglichen und damit gegenüber der derzeitigen Rechtlosigkeit wesentlich
verbessert werden.
– Die finanzielle Ausbeutung
der Post durch den Finanzminister muß ein Ende haben.
– Die Telefongebühren
müssen auf ein international übliches Maß reduziert
werden.”
Beschluß mit Stimmenmehrheit in der Ausschußsitzung am 17. Oktober 1996
Petition Nr. 17
überreicht von der Abgeordneten Brigitte Tegischer
betreffend “Berücksichtigung Osttirols (politischer Bezirk
Lienz) bei der Ausschreibung der Regionalradiolizenzen”
Mit der gegenständlichen Petition
überreichte die Abgeordnete Brigitte Tegischer ein Anliegen des
J. Robert Possenig an den Präsidenten des Nationalrates betreffend
die Berücksichtigung Osttirols bei der Ausschreibung der
Regionalradiolizenzen entsprechend dem Bundesgesetz, mit dem nach
Beschlußfassung und Inkrafttreten das Regionalradiogesetz
geändert wurde.
J. Robert Possenig nimmt zum entsprechenden
Gesetzentwurf Stellung und führt dazu aus, daß bezogen auf die
Versorgung des Bezirkes LIENZ-Osttirol mit einem flächendeckenden
Privatradio auf Grund der einzigartigen geographischen Situation des
angesprochenen Bezirkes, der als einziger Bezirk aller österreichischen
Bundesländer mit keinem Meter seiner Grenzen an das
“Mutter-Bundesland” Tirol angrenzt, daher als eigenständiger
Wirtschafts-, Kultur und Interessenbereich im Hinblick auf die Versorgung
dieses Bezirks mit dem elektronischen Medium RADIO anzusehen ist.
Weiters führt er aus:
“Aus diesem Grunde versteht sich der Bezirk
LIENZ als das “10. Bundesland” im Hinblick auf die Zuteilung
einer eigenen REGIONALRADIO-Lizenz, da sowohl eine ausreichende Versorgung in
redaktioneller Hinsicht als auch eine Nutzung des Mediums Privatradio als
Werbeträger für die heimische Wirtschaft mit einem REGIONALRADIO aus
NORDTIROL nicht oder nur sehr schwer möglich ist. Wenn es in WIEN ohne
geographische (damit auch technische) Probleme möglich ist, zwei Lizenzen
für REGIONALRADIO zu vergeben, muß dies auch für TIROL
möglich sein!
Zur effizienten Nutzung der nicht in
unbeschränkter Masse vorhandenen Sendefrequenzen schlage ich folgende
Ergänzung zu § 2 Abs. 1 vor:
,1. für den Österreichischen Rundfunk
eine Versorgung im Sinne des § 3 Rundfunkgesetz BGBl.
Nr. 379/1984 mit vier Programmen des Hörfunks gewährleistet ist,
wobei für das vierte Programm ein Versorgungsgrad von 90 Prozent
aller zum Betrieb eines Rundfunkempfangsgerätes (Hörfunk)
berechtigten Bewohner des Bundesgebietes ausreicht. Dabei sind die technischen
Möglichkeiten der Gewinnung von freien Frequenzen durch höhere Sendeleistung
einzelner Frequenzen in der Weise zu nützen, daß möglichst
keine ungenützten Frequenzen vergeben werden.‘
Erklärung:
Die ORF-Kette BDR (Blue Danube Radio) kommt zB in
Tirol mit neun Standorten (Frequenzen) aus, die Ketten Ö 2 und
Ö 3 haben jeweils 58 Frequenzen, Ö 1 hat
57 Frequenzen. Tatsächlich würden auch diese drei Ketten mit je
zirka 30 Frequenzen zu 98 Prozent flächendeckend arbeiten
können. Dabei würden wiederum 83 Frequenzen zur Nutzung für
Privatradio frei. Dieses Beispiel betrifft ausschließlich das Bundesland
TIROL – ähnlich verhält es sich mit Sicherheit auch in den
anderen Bundesländern.
Im besonderen Fall des Bezirkes LIENZ-Osttirol,
der vom Mutterland durch Gebirge und Grenzen vollkommen getrennt ist, ist nach
Maßgabe des Gleichheitsgrundsatzes und Art. 10 der EMRK zu urgieren,
daß – wenn für WIEN 2 Regionalradiolizenzen vorgesehen werden
– auch der abgeschnittene Bezirk LIENZ ein Recht auf eine eigene
REGIONALRADIOKETTE hat. Dies betrifft nicht eine allfällige weitere
Zuteilung auch einer Lokalradiokette – zumal die im Bezirk LIENZ
vorhanden freien Frequenzen ohne weiteres 3 (drei!) flächendeckende Ketten
zulassen würden.
Ich schlage deshalb vor, den § 2
Abs. 2 zu ergänzen:
,2. in jedem Bundesland eine Sendelizenz und in
Wien zwei Sendelizenzen sowie für den vom Mutterland
abgeschnittenen Bezirk LIENZ-Osttirol eine eigene Sendelizenz für
regionalen Hörfunk ermöglicht werden.‘
Schlußendlich wäre festzustellen,
daß die Erstellung der Frequenznutzungspläne durch den Bundesminister
für Wissenschaft, Verkehr und Kunst längst abgeschlossen sein sollte,
da durch die Verzögerung der Durchführung des Regionalradiogesetzes
durch die Aufhebung des § 2 Abs. 1 bis 3 und 5 des
Regionalradiogesetzes durch den Verfassungsgerichtshof genügend Zeit
für die technische Aufarbeitung des Problems geschaffen wurde.
Es sollte daher die Ausschreibung der REGIONAL-
und LOKALRADIO-Lizenzen – auch im Sinne des Gleichheitsgrundsatzes
– zu gleicher Zeit erfolgen, um eventuelle Wettbewerbsvorteile für
die Veranstalter von regionalem Hörfunk zu vermeiden.
Anmerkung:
Die Bevölkerung des Bezirkes LIENZ-Osttirol
hat bereits vor zwei Jahren mit der Übergabe von
6 000 Unterschriften an den Herrn Bundeskanzler und mit den in 19 von
33 Osttiroler Gemeinden vom Gemeinderat per Beschluß an den
damaligen Herrn Verkehrsminister Dr. Klima geschickten Resolutionen für
ein eigenes Osttiroler Privatradio ausreichend kundgetan, daß sie sich
für den vom Mutterland getrennten Bezirk aus kulturellen, gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Gründen ein eigenes Regionalradio zum
ehestmöglichen Zeitpunkt – spätestens aber mit Zuteilung der
Regionalradiolizenzen – wünscht.
Dieser Wunsch der Bevölkerung Osttirols
manifestiert sich nun in einer neuerlichen Unterschriftenaktion im Rahmen der
,BÜRGERINITIATIVE für ein eigenes RADIO OSTTIROL‘, welche
wiederum mit einer nicht zu übersehenden Anzahl von Unterschriften in
diesen Tagen dem österreichischen Nationalrat vorgelegt wird.
Im Namen der Bevölkerung unseres ohnehin
abgeschnittenen Bezirkes ersuche ich die Bundesregierung, in ihrem Entwurf zur
Änderung des Regionalradiogesetzes (Novelle) den mehrheitlichen Wunsch der
Osttirolerinnen und Osttiroler zu berücksichtigen.”
Einstimmiger Beschluß in der Ausschußsitzung am 7. Mai 1997
Bürgerinitiative
Nr. 1
eingebracht von Herrn Hansjörg Kirchmair
betreffend “Nein zur EU”
Die Unterzeichner dieser Bürgerinitiative
gemäß § 100 Geschäftsordnungsgesetz beantragen:
“Der Nationalrat möge
beschließen –
Bundesminister Dr. Wolfgang Schüssel hat
durch seine am 26. Februar 1996 in Brüssel abgegebene Erklärung
vor Presse und Fernsehen mit dem Wortlaut –
Ich gehe davon aus, daß Österreich
um eine WEU-Mitgliedschaft nicht herumkommt. Auch einen NATO-Beitritt kann ich
nicht ausschließen. Dieser Beitritt würde mich persönlich nicht
schrecken.
das
Bundesverfassungsgesetz vom 26. Oktober 1955, Artikel I, BGBl.
Nr. 211/1955, Neutralitätsgesetz verletzt.
Dieser Artikel I
besagt, daß Österreich seine immerwährende Neutralität mit
allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln aufrechtzuerhalten und zu verteidigen hat
und zur Sicherung dieser Zwecke in aller Zukunft keinen militärischen
Bündnissen beitritt.
Das staatsgerichtliche
Verfahren gemäß Artikel 142 Bundes-Verfassungsgesetz gegen
Bundesminister Dr. Wolfgang Schüssel wird daher eingeleitet.”
Für die Sitzung am
3. Juli 1996 wurde der Leiter des Völkerrechtsbüros im
Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten, Botschafter Dr.
Cede, als Experte geladen.
Einstimmiger Beschluß in der Ausschußsitzung am 3. Juli 1996
Bürgerinitiative
Nr. 4
eingebracht von Herrn
Georg Rom betreffend “Aufhebung der Immunität aller
Abgeordneten, Richter und Beamten wegen Mißbrauchs der Amtsgewalt,
Unterdrückung von amtlichen Beweisen, Vernachlässigung der
Amtspflicht, Verletzung der Menschenrechte”
Die gegenständliche Bürgerinitiative hat
folgenden Wortlaut:
“Der Nationalrat wird ersucht um ,Die
Aufhebung der Immunität aller Abgeordneten, Richter und Beamten wegen
Mißbrauchs der Amtsgewalt, Unterdrückung von amtlichen Beweisen,
Vernachlässigung der Amtspflicht, Verletzung der Menschenrechte‘.
Bei meinem Ansuchen wurden amtliche Beweise
vorgelegt, sogar eine eidesstattliche Erklärung. Meine Verfolgung lag bei
der Stadtgemeinde Feldkirchen, Erhebungsabteilung Klagenfurt und bei der
Bundespolizeidirektion Wien Registrieramt auf. Trotzdem wurde ich von einem
Landeshauptmann (SPÖ) um die Wiedergutmachung, die der deutsche Staat
zahlen muß, betrogen. Solche Betrügereien werden von Beamten des
hohen Bundesministeriums gedeckt! Durch diese Vorgangsweise muß ich wohl
annehmen, daß die Beamten Nazis sind und vom Staatsdienst zu entfernen
sind!
Meine Wiederaufnahme,
Zl. 248.015/3-5/94, ist bis heute nicht erledigt! Trotzdem laut
Bundesgesetz 183 § 4, mein Antrag vor jeder anderen Partei
bevorzugt zu erledigen ist! Somit ist der Tatbestand des Verbrechens des
Mißbrauchs der Amtsgewalt, Vernachlässigung der Amtspflicht gegeben.
Es ist eine bodenlose Frechheit, die Beamten glauben, die Gesetze gelten nur
für sie! Trotz amtlicher Beweise stand auf dem Bescheid, ,kein Rechtsmittel
zulässig‘! Bei meiner Vorsprache im hohen Bundesministerium für
Soziales wurde ich eingeschüchtert, mit der Bestrafung bedroht und belegt.
Mit solchen Tricks und Raffinessen werden Staatsbürger zum Schweigen
verurteilt.
Außerdem beantrage
ich im Namen der Bürgerinitiative, daß jeder Abgeordnete, hohe
Beamte und Richter, bei Verbrechen der Amtsgewalt, des Betruges,
Mißachtung der Gesetze, Vernachlässigung der Amtspflicht
Sühneabgaben monatlich für in Not befindliche Österreicherinnen
und Österreicher leisten muß.
Es ist fast nicht zu
glauben! Ich bekomme ab 1. November 1995 für meine Frau und mich eine
Mindestpension von 7 120 S. Ich habe 52 volle Versicherungsjahre,
sogar eineinhalb Jahre wird meine Pension zurückbehalten. Nun frage ich,
ob die Beamten so lange Zeit umsonst arbeiten? Eine schöne Leistung!
Außerdem habe ich schon viele Jahre eine schwerkranke Frau, da gab es
damals keinen Hilflosenzuschuß, geschweige eine Pflegebeihilfe! So werden
Staatsbürger, die sich für ein freies Österreich und Europa
einsetzen und dann in der Armutsgrenze leben müssen, behandelt!”
Einstimmiger
Beschluß in der Ausschußsitzung am
3. Juli 1996
Bürgerinitiative
Nr. 10
eingebracht von Herrn
Johann Grüner betreffend “§ 97 StGB,
Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruches; Schutz der ungeborenen
Kinder”
Mit der
gegenständlichen Bürgerinitiative wird der Nationalrat ersucht, sich
mit dem für “unser ganzes Volk” überlebenswichtigen Thema
des laufenden Massenmordes an ungeborenen Kindern gründlich
auseinanderzusetzen. Weiter wörtlich: “Es muß doch
möglich sein, über die katastrophalen Folgen der
,Fristenlösung‘ mit unseren Volksvertretern zu sprechen. Das
2. Vatikanische Konzil nennt die Ermordung der Ungeborenen ein verabscheuungswürdiges
Verbrechen. Der Standpunkt der Bürgerinitiative ,Pfarrer
Grüner‘ entspricht dem Naturrecht und den zehn Geboten Gottes.
Solche Verbrechen können von keinem Parlament ,entkriminalisiert‘
werden. Siehe Evang. Vitae 71, 72. Auch in naturwissenschaftlicher Hinsicht ist
der Mensch Mensch von Anfang an (Prof. Blechschmidt, Universität
Göttingen). Und nach internationaler Rechtsauffassung ist Mord die
vorsätzlich mit Überlegung ausgeführte Tötung eines
unschuldigen Menschen. Wir sind überzeugt, daß alle von Gott zur
Rechenschaft gezogen werden, die diesem Massenmorden untätig zuschauen.
Am 3. Juni 1996
durfte der österreichische Autor Peter Handke im Parlament aus seinem Buch
,Gerechtigkeit für Serbien‘ vorlesen. Wir meinen, daß unser
Anliegen für Österreich noch bedeutsamer ist und ersuchen die
Volksvertreter, auch uns anzuhören.
Gleiches Recht für
alle! Wir möchten unseren Abgeordneten den weltbekannten Kurzfilm ,Der
Stumme Schrei‘ vorführen. Wir setzen uns für Gerechtigkeit und
das Lebensrecht in Österreich ein.
Wir ersuchen die Sprecher
der Parlamentsklubs, uns einen Termin zu nennen, an dem wir den Abgeordneten
den Film zeigen dürfen.”
Der Ausschuß
für Petitionen und Bürgerinitiativen hat in seiner Sitzung am
7. Mai 1997 beschlossen, von der weiteren Behandlung der
gegenständlichen Bürgerinitiative Nr. 10 Abstand zu nehmen.
Weiters richtete die Obfrau des Ausschusses auf einstimmigen Beschluß
folgendes Schreiben an den Erstunterzeichner:
“Die von Ihnen
eingebrachte Bürgerinitiative Nr. 10 betreffend ,§ 97 StGB,
Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruches – Schutz der
ungeborenen Kinder‘ ist am 6. Dezember 1996 im Parlament eingelangt
und wurde am 9. Dezember 1996 durch den Präsidenten des Nationalrates
dem Ausschuß für Petitionen und Bürgerinitiativen zugewiesen.
Bereits in der XVII., XVIII.
und XIX. Gesetzgebungsperiode hat sich der Ausschuß für Petitionen
und Bürgerinitiativen mit Bürgerinitiativen der gegenständlichen
Thematik befaßt und zuletzt von einer weiteren Behandlung Abstand
genommen.
Aus diesem Grund hat der
Ausschuß für Petitionen und Bürgerinitiativen in seiner Sitzung
am 7. Mai 1997 einstimmig den Beschluß gefaßt, von einer
weiteren Behandlung der erwähnten Bürgerinitiative Nr. 10
Abstand zu nehmen.”
Einstimmiger
Beschluß in der Ausschußsitzung am
7. Mai 1997
II. Sonstiges
Nachstehend werden jene Petitionen und
Bürgerinitiativen aufgezählt, die der Ausschuß für
Petitionen und Bürgerinitiativen in Verhandlung genommen hat, und die
nicht unter dem Abschnitt I anzuführen sind. Dies betrifft diesfalls
jene Petitionen und Bürgerinitiativen, die auf Grund eines Ersuchens des
Ausschusses vom Präsidenten des Nationalrates einem anderen
Fachausschuß zugewiesen worden sind.
1. Petitionen
Ausschuß für Arbeit und Soziales
Petition Nr. 22
überreicht vom Abgeordneten Mag. Walter Guggenberger
betreffend “die gesetzliche Anerkennung des Berufes der
AltenfachbetreuerInnen und FamilienhelferInnen”
Die vorliegende Petition, mit welcher ein Anliegen
der Berufsvereinigung der Tiroler AltenfachbetreuerInnen und der
Berufsgemeinschaft der FamilienhelferInnen Tirols aufgegriffen wurde, fordert
eine gesetzliche Berufsanerkennung der FamilienhelferInnen und
AltenfachbetreuerInnen.
Dazu wird ausgeführt, daß die
notwendige verstärkte Inanspruchnahme sozialer Einrichtungen zur Betreuung
und Pflege älterer oder behinderter Menschen sowie die Zunahme
familiärer Betreuungsmaßnahmen im gesamten Bundesgebiet –
so auch in Tirol – zu einem größeren Bedarf an qualifiziertem
Betreuungspersonal geführt hat.
Weiter wörtlich:
“Die berufliche Tätigkeit verlangt
neben persönlichem Engagement entsprechende fachliche Kenntnisse und
Fähigkeiten, welche die AltenfachbetreuerInnen und qualifizierte
FamilienhelferInnen nachweislich erbringen. Deshalb ist auch für Tirol
– wie bereits in anderen österreichischen Bundesländern –
die gesetzliche Berufsanerkennung ,AltenfachbetreuerIn ‘ und
,FamilienhelferIn‘ durch die Schaffung eines entsprechenden Gesetzes
erforderlich.
Es sollen darin folgende Anliegen verwirklicht
werden:
– die Formulierung
eigenständiger und zeitgemäßer Berufsbilder für
AltenfachbetreuerInnen und qualifizierter FamilienhelferInnen;
– die Beschreibung allgemeiner
Befugnisse;
– die Festlegung von
geschützten Berufsbezeichnungen;
– die Regelung der
theoretischen und praktischen Ausbildung;
– die Möglichkeiten der
freiberuflichen Tätigkeit sowie
– allgemein gültige
kollektive Rahmenbedingungen für die Dienstverhältnisse.”
In der
Ausschußsitzung am 7. Mai 1997 hat der Ausschuß für
Petitionen und Bürgerinitiativen beschlossen, Stellungnahmen des Bundesministeriums
für Arbeit, Gesundheit und Soziales, des Bundesministeriums
für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten, des Bundesministeriums
für Umwelt, Jugend und Familie sowie des Bundesministeriums
für wirtschaftliche Angelegenheiten einzuholen.
Die Stellungnahme des
Bundesministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat nachstehenden
Inhalt:
“Die Regelung von
Berufsbild und Ausbildung der Altenbetreuer, Familienhelfer und Heimhilfen
fällt in die Zuständigkeit der Länder. Bisher haben Oberösterreich,
Steiermark, Niederösterreich und Wien entsprechende Gesetze erlassen.
Das Anliegen der
Berufsvereinigung der Tiroler AltenfachbetreuerInnen nach einer
Berufsanerkennung ist berechtigt und wird seitens des Bundesministeriums
für Arbeit, Gesundheit und Soziales befürwortet. Es ist nicht
nachvollziehbar, warum das Land Tirol nicht bereit ist, ein entsprechendes
Gesetz zu erlassen.
Der Bund ist
zuständig zur Regelung von Berufsbild und Ausbildung des diplomierten
Krankenpflegepersonals und der Pflegehelfer. Im Rahmen der
Begutachtungsverfahren zu den einschlägigen landesgesetzlichen Regelungen
im Altenbereich hat das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales stets darauf aufmerksam gemacht, daß entsprechende Regelungen nicht
in die Bundeskompetenzen und somit nicht in Berufsbilder dieser
bundesgesetzlich geregelten Pflegeberufe, denen die Pflege kranker Menschen und
somit auch alter kranker Menschen vorbehalten ist, eingreifen dürfen.
Außerdem ist darauf hinzuweisen, daß im Bereich der Kompetenz
,Schulen‘ eine Mitzuständigkeit des Bundesministeriums für
Unterricht und kulturelle Angelegenheiten sowohl bei ,Altenhelferausbildungsstätten‘
als auch bei ,Krankenpflegeschulen‘ gegeben ist.
Das Bundesministerium
für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat sich wiederholt positiv zur
Entwicklung in Richtung Kombinationsberufe ,Altendienste/Pflegehilfe‘,
die auf eine Doppelqualifikation ,AltenhelferIn/PflegehelferIn‘
abzielen, ausgesprochen. Die Ausbildungen in diesen Kombinationsberufen
integrieren zusätzlich zu den Ausbildungsinhalten der bisherigen Schulen
für Altendienste die Lehrpläne der in der Pflegehelferverordnung
geregelten Pflegehelferausbildung und vermitteln damit eine Doppelqualifikation
sowohl für den pflegerischen als auch für den sozialen Bereich.
Wenig zweckdienlich
erscheint die unterschiedliche Entwicklung in den einzelnen Bundesländern,
die sowohl die Mobilität des Personals wie auch die Rechtssicherheit der
Betroffenen nicht immer gewährleistet, da einerseits unterschiedliche Ausbildungsbedingungen
und andererseits unterschiedliche Berufszugangsbedingungen und
Berufsbezeichnungen normiert sind. Bemühungen zur Vereinheitlichung sind
vom Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales stets
unterstützt worden, haben aber bis dato zu keinen konkreten Ergebnissen
geführt.
Zu erwähnen ist
weiters, daß mehrfach angesichts der unterschiedlichen landesgesetzlichen
Regelungen im Altenbereich vorgeschlagen wurde, eine
,Art. 15a-Vereinbarung‘ zwischen den Bundesländern anzustreben,
um eine Vereinheitlichung in diesem Bereich zu erzielen. Eine solche
Vereinbarung würde die Mobilitätshindernisse für die
Berufsgruppe beseitigen und einheitliche Ausbildungsbedingungen und
Berufszugangsbedingungen sowie einheitliche Berufsbezeichnungen zwischen den
Bundesländern herbeiführen können.”
Das Bundesministerium
für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten verwies in seiner
Stellungnahme darauf, daß die in der Petition angesprochenen Punkte
Rechtsbereichen wie Gewerberecht, Krankenpflege (Kompetenztatbestände der
Bundesverfassung) zugeordnet seien und daher seitens des Bundesministeriums
für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten für diese
Rechtsmaterien keine Zuständigkeit bestehe.
Das Bundesministerium
für Umwelt, Jugend und Familie nahm wie folgt Stellung:
“Das
Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie befürwortet
grundsätzlich die gesetzliche Anerkennung der Berufszweige der
,AltenfachbetreuerInnen‘ und der ,FamilienhelferInnen‘.
In einem weiteren Schritt
wäre es wünschenswert, die Ausbildung in Form eines Modulsystems zu
organisieren, sodaß ein Wechsel zwischen den verschiedenen Pflegeberufen
jedenfalls möglich ist. Eine solche Regelung könnte beispielsweise
Pflegenden, die jahrelang in der Altenbetreuung tätig waren, den Wechsel
in eine andere Pflegearbeit ermöglichen und auch erleichtern.
In der Betreuung alter
pflegebedürftiger Menschen nimmt neben der medizinischen Versorgung die
allgemeine Pflege und besonders die fortlaufende, auf den vorhandenen
Fähigkeiten basierende Aktivierung, einen gleichwertigen Stellenwert ein.
Auf dem Sektor der
Altenbetreuung bedarf es, dem dänischen Modell des Sozial- und
Gesundheitshelfers bzw. Sozial- und Gesundheitsassistenten folgend, einer
Berufsgruppe, die die fachübergreifenden Funktionen des Beistandes, der
Pflege, Fürsorge und Aktivierung sowohl in der ambulanten wie auch
stationären Betreuung eigenständig und ohne Zuhilfenahme weiter
Professionen ausführen kann, um zu ermöglichen, daß in Zukunft
dem alten pflegebedürftigen Menschen nur eine primäre Bezugsperson
zur Abdeckung seiner gesamten alltäglichen Bedürfnisse beigestellt
werden kann.
Darüber hinaus ist
der professionelle Rat und Beistand von AltenfachbetreuerInnen und FamilienhelferInnen
für pflegende Familienangehörige unverzichtbar und wird künftig
von dieser Berufsgruppe zunehmend wahrgenommen werden müssen.
Die Forderung der Zukunft
wird es sein, Personen mit einer umfangreichen geriatrischen Ausbildung
auszustatten, die befähigt, selbständig und gemeinsam mit dem alten
Menschen Probleme aller Art aktiv und kritisch zu lösen. Ausgangspunkt
dabei muß immer die Gesamtsituation und die Sicherstellung einer
maximalen Lebensqualität darstellen.”
Seitens des
Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten wurde zur
gegenständlichen Petition ausgeführt:
“Im vorliegenden
Ausbildungskonzept für die Altenbetreuung und die Familienhilfe fällt
auf, daß es offensichtlich im Bereich des Krankenpflegegeldgesetzes
angesiedelt werden soll. Das bedeutet, daß die Ausbildung wahrscheinlich
ebenfalls schwerpunktmäßig im Krankenanstaltenbereich erfolgen soll.
Aus der Sicht des
Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten ist zu sagen,
daß ein solches Konzept jedenfalls auch eine Berufsausbildung
entsprechend dem Berufsausbildungsgesetz enthalten sollte, um auch
außerhalb des engen Krankenanstaltenbereiches Ausbildungen im Bereich der
Altenbetreuung und Familienhilfe vermitteln zu können.”
Einstimmiger Beschluß in der Sitzung am 26. November 1997:
Ersuchen um Zuweisung an den Ausschuß
für Arbeit, Gesundheit und Soziales.
Ausschuß
für Arbeit und Soziales
Petition Nr. 29
eingebracht vom Abgeordneten Johann Maier
betreffend “Dem Staat sein Geld – Dem Arbeitnehmer seine
Rechte”
Die erwähnte Petition hat folgenden Inhalt:
“Die Gewerkschaft Handel, Transport und
Verkehr und die Rechtsabteilung der Kammer für Arbeiter und Angestellte
müssen feststellen, daß vom Güterbeförderungsgewerbe
Österreichs und dem privaten Autobusgewerbe Österreichs laufend die
Bestimmungen der zutreffenden Kollektivverträge, des Arbeitszeit- und
Arbeitsruhegesetzes, des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes und des
Einkommensteuergesetzes massiv verletzt werden. Durch diesen
Mißstand entgehen einerseits der Republik Österreich Steuereinnahmen
(geringe Lohnsteuerbemessungsgrundlagen) und andererseits der Sozialversicherung
Beiträge (geringere Sozialversicherungsbemessungsgrundlagen).
Dies ist deshalb möglich, weil die Kontrolle
der Transportwirtschaft kompliziert und damit arbeitsintensiv ist. Deswegen
wurden nachweislich auch Absprachen zwischen einzelnen Gebietskrankenkassen und
Unternehmerverbänden getätigt, die sozusagen einen
sozialversicherungsrechtlichen ,Mindestlohn samt Überstunden‘
regelt. Ist in Salzburg zB ein Lenker mit 40 Normalstunden und
15 Überstunden mit einem Zuschlag von 50% versichert, so gilt er
sozialversicherungsgrechtlich als korrekt entlohnt, und es wird nicht mehr
näher geprüft. Die tatsächlich geleisteten Überstunden
werden nicht vergütet und Mehrleistungen häufig über steuer- und
sozialversicherungsfreie Diäten abgegolten.
Die Duldung dieses Systems führt zu
Wettbewerbsverzerrung und Mindereinnahme des Staates einerseits und zu
unterkollektivvertraglicher Entlohnung und geringeren arbeits- und
sozialrechtlichen Ansprüchen (einschließlich des Pensionsanspruches)
der Lenker andererseits.
Das Sündenregister im Einzelnen:
Die Höchstgrenzen der Arbeitszeit werden
laufend überschritten und die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten nicht
gewährt (EG-Verordnung 3820/85):
– Unzulässige
akkordähnliche Lohnsysteme, wie Kilometergeld, Tourengeld,
Umsatzbeteiligungen nach Fracht oder vereinbarte Pauschalentlohnung werden
angewandt. Diese werden über die Lohnverrechnung so
,manipuliert‘, daß der Anschein erweckt wird, dem Kollektivvertrag
und den sozial- und steuerrechtlichen Vorschriften zu entsprechen.
– Geleistete Überstunden
werden in Form von steuer- und sozialversicherungsfreien Diäten
abgerechnet.
Bei der Beweisführung zur Durchsetzung
arbeits- und sozialrechtlicher Ansprüche für die Lenker stoßen
die Interessenvertretungen, aber auch Arbeitsinspektion und Sozialversicherung
an die Grenzen des Machbaren, weil häufig
,Tachographenmanipulationen‘ den Nachweis über tatsächlich
geleistete Arbeitszeiten unmöglich machen. Durch die Vornahme
persönlichen und wirtschaftlichen Drucks werden die Lenker durch die
Gegend gehetzt und gezwungen, Manipulationen vorzunehmen, um allfälligen
Strafen zu entgehen.
Damit berauben sie sich selbst ihrer
sozialrechtlichen Absicherung. Da geht der Spruch um: ,Wenn’st nicht
weißt wie es geht, dann bist als Lenker untauglich.‘ Dadurch
verlieren die Lenker arbeits- und sozialrechtliche Ansprüche, wie
geringeres Urlaubsentgelt, Feiertagsentgelt, niedrigere Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfalle und geringere Abfertigung.
Krankengeld, Arbeitslosenunterstützung und
Pension sind durch niedrigere Anmeldung bei der Sozialversicherung auch noch
geschmälert. Der alleinige Vorteil liegt bei diesen Unternehmern. Sie
haben geringere Lohnnebenkosten! Geschädigt werden weiter die öffentliche
Hand sowie die Unternehmen, die korrekt ihre Abgaben bezahlen
(Wettbewerbsverzerrung).
Und zu alledem kommt, daß die
zuständigen Behörden trotz vieler Aufforderungen durch die
Gewerkschaft Handel, Transport und Verkehr und die Arbeiterkammern nicht
konsequent und effizient prüfen (Das Geld liegt auf der Straße, und
keiner will sich bücken!!!):
Um diesen Zuständen Abhilfe zu verschaffen,
müssen zumindest nachstehende Maßnahmen umgesetzt werden.
Forderungen
1. Der
Bundesminister für Finanzen und der Bundesminister für Arbeit und
Soziales werden aufgefordert, die ihnen unterstellten Dienststellen anzuweisen
und aufzufordern, unverzüglich im Rahmen einer ,Aktion scharf‘ das
österreichische Güterbeförderungs- und private Autobusgewerbe
auf die korrekte Anwendung der Bestimmungen des ASVG, des EStG und des
Arbeitszeit- und Arbeitsruhegesetzes zu überprüfen. Der
Überprüfung der Lohnverrechnung sind die Arbeitszeitaufzeichnungen
(Tachographenschaublätter) zugrunde zu legen. Nach Abschluß der
Aktion ist den jeweiligen Bundesministern von den einzelnen Behörden
Bericht zu erstatten und sind diese zu veröffentlichen.
2. Der
Bundesminister für Arbeit und Soziales wird aufgefordert, den Hauptverband
der Sozialversicherungsträger anzuweisen, Beitragsprüfungen in
den Betrieben nur auf Grundlage der von den Unternehmern vorzulegenden
Arbeitszeitaufzeichnungen (Tachographenschaublätter) vorzunehmen. Bei
Nichtvorlage der Arbeitszeitaufzeichnungen ist der jeweilige Betrieb
entsprechend einzuschätzen. Absprachen über die pauschale Abrechnung
von Überstundenvergütungen zur vereinfachten Beitragsprüfung
sind ausdrücklich zu untersagen und die Sozialversicherungen aufzufordern,
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen Beitragsprüfungen vorzunehmen.
3. Der
Bundesminister für Arbeit und Soziales und der Bundesminister für
Finanzen werden aufgefordert, die Arbeitsinspektorate und die
Beitragsprüfungsabteilungen personell aufzustocken. Durch das damit zu
erzielende Mehraufkommen an Sozialversicherungsbeiträgen und
Bußgeldern wären die damit verbundenen Kosten finanziert. Die
technische Ausstattung (zB Arbeitszeitkontrolle Kraftfahrer für
Windows) ist für die Arbeitsinspektorate und
Beitragsprüfungsabteilungen der Gebietskrankenkassen anzuschaffen,
was eine exaktere Prüfung möglich macht. Dies ist auch ein Beitrag im
Kampf gegen Wettbewerbsverzerrung.
4. Der
Bundesminister für Finanzen wird aufgefordert, für eine Änderung
des Strafrahmens im EStG für Abgabenhinterziehung oder bei der Anwendung
von steuer- und beitragsmindernden Lohnsystemen einzutreten und die Strafe
so zu erhöhen, daß die Rechnung mit dem erschlichenen Vorteil nicht
aufgeht.
5. Der
Bundesminister für Arbeit und Soziales wird aufgefordert, eine Vorlage
auszuarbeiten, wodurch der Strafrahmen im ASVG, AZG und ARG erhöht wird,
daß Übertretungen sich nicht rechnen können.
6. Die
zuständigen Bundesminister für Finanzen, Inneres und Arbeit und
Soziales werden aufgefordert, eine ministeriumsübergreifende, ständig
zusammenarbeitende ,schnelle Eingreiftruppe‘, bestehend aus Beitragsprüfern,
Lohnsteuerprüfern, Arbeitsinspektoren und Sicherheitskräften zu
bilden, die vor allem als Anlaufstelle der Bevölkerung bei
unterkollektivvertraglicher Bezahlung oder Schwarzarbeit dient. In beiden
Fällen werden Abgaben hinterzogen, was für den Staat und den
Bürger einen echten Nachteil bedeutet.
7. Der
Bundesminister für Arbeit und Soziales soll für die nächste
große ASVG-Novelle zwingend eine Bestimmung vorschlagen, die regelt,
daß der Arbeitnehmer eine Chipkarte oder ein Anmeldebuch mitführen
muß, dem die Anmeldung zur Sozialversicherung und der jeweilige
Dienstgeber zu entnehmen ist. Dies ist ein notwendiger Beitrag im Kampf gegen
,Schwarzarbeit‘.
8. Das
,Datenschutzgesetz‘ bzw. die sogenannte ,Amtsverschwiegenheit‘ darf
nicht als Vorwand dienen, den notwendigen Informationsaustausch zwischen
Behörden und Sozialversicherungsträgern zu unterdrücken (etwa
Arbeitsinspektorat Salzburg – Salzburger Gebietskrankenkasse oder
Zentrales Arbeitsinspektorat – Bundesprüfzug). Durch eine
ausdrückliche gesetzliche Regelung ist diese Zusammenarbeit und
Informationsaustausch sicherzustellen.
9. Die
derzeitige Beweisführung gegenüber den Unternehmen stellt sich als
äußerst schwierig dar. Beweisführungen scheitern an
mangelhaften oder bewußt manipulierten Aufzeichnungen – eine
Änderung der Beweislast in den einschlägigen Verfahren wird
gefordert.
10. Der
Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr wird aufgefordert, im
Kraftfahrgesetz (KFG) eine Bestimmung vorzusehen, die regelt, daß die Tachographenschaublätter
lenkerbezogen mit einer fortlaufenden Seriennummer auszustatten sind.”
Die Gewerkschaft Handel,
Transport und Verkehr ist im Rahmen der gegenständlichen Petition unter
dem Titel “Dem Staat sein Geld! Dem Lenker seine Rechte” für
die Einhaltung des Kollektivvertrages im Rahmen folgender Aktion eingetreten:
“HTV: Aktion
für die Einhaltung des KV!
Die Einhaltung des Kollektivvertrages
ist wohl das mindeste, was den Arbeitnehmern zusteht. In der
österreichischen Transportwirtschaft und im privaten Autobusgewerbe sieht
die Realität aber anders aus: an der Tagesordnung sind
– Überschreitungen der
Höchst-Arbeitszeit und Unterschreitungen der zwingend vorgeschriebenen
Ruhezeiten,
– unzulässige,
akkordähnliche Lohnsysteme,
– Abrechnung von Überstunden
als steuer- und sozialversicherungsfreie Diäten,
– und vieles mehr –
alles, was die Unternehmerkassen schont und zu Lasten der Beschäftigten
und des Staates geht.
,Das Geld liegt auf
der Straße, und keiner will sich bücken!‘
Deshalb fordern wir:
– ,nur‘ die
Einhaltung bestehender Gesetze (ASVG, EStG, Arbeitzeit- und Arbeitsruhegesetz);
– êine ,Aktion
scharf‘ durch Sozialversicherung, Arbeitsinspektion und
Finanzbehörden;
– keine gesetzwidrigen
Absprachen zwischen einzelnen Gebietskrankenkassen und Unternehmerverbänden
(zB Verbot von pauschalen Überstundenabrechnungen);
– Aufrüstung der
Beitragsprüfungsabteilungen der Gebietskrankenkassen und der
Arbeitsinspektorate mit personellen und technischen Ressourcen;
– härtere Strafen bei
Abgabenhinterziehung oder bei Anwendung von steuer- und beitragsmindernden
Lohnsystemen – die Strafe darf nicht billiger sein als der erschlichene
Vorteil;
– härtere Strafen bei
Verstößen gegen Arbeitszeit- und Arbeitsruhegesetz –
Gesetzesübertretung darf sich nicht lohnen!;
– schnelle Eingreiftruppe aus
Beitrags- und Lohnsteuerprüfern sowie Arbeitsinspektoren;
– Kampf der Schwarzarbeit:
jeder Lenker muß ein Anmeldebuch oder eine Chipkarte mit dem Dienstgeber
und Sozialversicherung bei sich haben.
Heute ist es die
Transportwirtschaft – wer ist es morgen?
Mit Deiner Unterschrift unterstützt Du die
Aktion:
HTV für die Einhaltung des KV!”
In seiner Sitzung am 26. November 1997 hat
der Ausschuß beschlossen, je eine Stellungnahme des Bundesministeriums
für Wissenschaft und Verkehr, des Bundesministeriums für Arbeit,
Gesundheit und Soziales, des Bundesministeriums für wirtschaftliche
Angelegenheiten, des Bundesministeriums für Finanzen, des
Bundesministeriums für Justiz und des Bundesministeriums für Inneres
einzuholen.
Das Bundesministerium für Wissenschaft und
Verkehr hat zu Punkt 10 der gegenständlichen Petition mitgeteilt,
daß nach seiner Ansicht auch derzeit schon die Schaublätter des
Fahrtenschreibers lenkerbezogen und nicht fahrzeugbezogen zu führen
sind.
“Die EG-Verordnung 3820/85/EWG über die
Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr und
die EG-Verordnung 3821/85/EWG über das Kontrollgerät im
Straßenverkehr enthalten auch Bestimmungen über das Schaublatt bzw.
die Schaublattführung. Da eine zusätzliche fortlaufende Seriennummer
nicht vorgesehen ist, würde der diesbezügliche Wunsch über die
Regelung in den EU-Verordnungen hinausgehen. Angesichts der bevorstehenden
Änderungen der EU-Verordnungen in Richtung digitales Kontrollgerät
mit vollautomatisierter Lenkzeitaufzeichnung erscheint eine Verwirklichung des
Vorschlages daher nicht mehr zielführend.”
Das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit
und Soziales nahm zu dieser Petition wie folgt Stellung:
“Soweit die Forderungen zu den
Punkten 1, 2, 3 und 6 darauf abzielen, daß das Bundesministerium
für Arbeit, Gesundheit und Soziales beziehungsweise die Frau
Bundesministerin den Sozialversicherungsträgern oder deren
Hauptverband Weisungen hinsichtlich einer bestimmten Vorgangsweise erteilt, ist
zunächst ganz allgemein auf das die Organisation der Sozialversicherung
bestimmende Prinzip der Selbstverwaltung hinzuweisen:
Die Träger der gesetzlichen
Sozialversicherung sind Körperschaften öffentlichen Rechts mit
eigener Rechtspersönlichkeit, die vom Gesetzgeber nach den
Grundsätzen der Selbstverwaltung eingerichtet sind und deren
Geschäftsführung durch autonome Verwaltungskörper wahrzunehmen
ist. Auf diese eigenverantwortliche Geschäftsführung kann das
Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales lediglich nach
Maßgabe der Bestimmungen des Abschnittes VI des Achten Teiles des
ASVG über die Aufsicht des Bundes Einfluß nehmen. Demnach haben die
zur Wahrung dieser Aufsicht des Bundes berufenen Behörden gemäß
§ 449 Abs. 1 ASVG die Gebarung der Versicherungsträger
dahin gehend zu überwachen, daß im Zuge dieser Gebarung nicht gegen
Rechtsvorschriften verstoßen wird. Die Aufsicht kann auf Fragen der
Zweckmäßigkeit erstreckt werden; sie soll sich in diesem Fall auf wichtige
Fragen beschränken und in das Eigenleben und die Selbstverantwortung der
Versicherungsträger nicht unnötig eingreifen. Keinesfalls kann aus
dem Aufsichtsrecht eine Befugnis zur Weisungserteilung beziehungsweise zu
einer Disposition in operativen Angelegenheiten der Sozialversicherungsträger
abgeleitet werden.
Zu Punkt 1:
Die Arbeitsinspektion führt ausreichende und
effiziente Kontrollen durch. Über die Kontrollen wird jährlich dem
Parlament berichtet, außerdem alle zwei Jahre der EU-Kommission. Zur
Rechtslage, zur Aufgabenteilung und zu den EU-Richtlinien siehe die beiliegende
Unterlage.
Die Arbeitsinspektion kontrolliert wesentlich
mehr Lenktage, als die EU-Richtlinie 88/599/EWG vorschreibt: Laut
EU-Richtlinie waren im Jahr 1996 in Österreich insgesamt mindestens
277 205 Lenktage zu kontrollieren, davon mindestens 69 307
durch Betriebskontrollen der Arbeitsinspektion. Die Arbeitsinspektion hat
tatsächlich 162 289 Lenktage überprüft, dazu
kommen noch 347 von den anderen Arbeitnehmerschutzbehörden kontrollierte
Lenktage. Polizei, Gendarmerie und Zollwache haben zusammen insgesamt
193 049 Lenktage kontrolliert, davon 133 855 von
österreichischen Lenkern. (Anmerkung: Diese Zahlen beziehen sich nur auf
Fahrzeuge, die unter die EG-Verordnungen 3820 und 3821 fallen, also im
wesentlichen LKWs und Busse).
Eine weitere Steigerung der Lenkerkontrollen der
Arbeitsinspektion wäre nicht vertretbar, weil sie die
Vernachlässigung anderer wichtiger Arbeitnehmerschutzaufgaben zur Folge
hätte.
Die Arbeitsinspektion stellt zahlreiche Übertretungen
fest und geht – entsprechend § 9 des Arbeitsinspektionsgesetzes
1993 (ArblG), BGBl. Nr. 27, in der Fassung BGBl. Nr. 871/1995, mit Aufforderungen
oder Strafanzeigen vor. Ergebnisse 1996:
10 806 Übertretungen von der Arbeitsinspektion festgestellt,
891 Strafanzeigen der Arbeitsinspektion gegen Arbeitgeber/innen.
Die Arbeitsinspektorate erstatten bereits derzeit
einen Bericht über ihre Kontrollen, der Tätigkeitsbericht wird
jährlich dem Parlament vorgelegt. Zu den Lenkerkontrollen wird
außerdem alle zwei Jahre ein Bericht an die EU-Kommission erstattet.
Dieser Bericht wird vom Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr
erstellt. Die Arbeitsinspektion liefert für diesen Bericht einen Beitrag
(Kontrollen, Ergebnisse usw.). Zusätzliche Berichte und
Veröffentlichungen erscheinen nicht notwendig.
Die Sozialversicherungsträger kommen
ihrer Aufgabe zur Überprüfung der korrekten Anwendung der
Bestimmungen des ASVG insbesondere in Form von Beitragsprüfungen nach. Die
Erstellung von Schwerpunkten hinsichtlich der Prüfungen von Dienstgebern
verschiedener Branchen liegt im Eigenbereich der
Sozialversicherungsträger. Aus der Sicht des Bundesministeriums für
Arbeit, Gesundheit und Soziales ist lediglich festzuhalten, daß eine
Verstärkung der Überprüfung von Unternehmen des Güterbeförderungs-
und Autobusgewerbes letztlich nicht zur einer Vernachlässigung der
erforderlichen Prüfung anderer Dienstgeber führen darf.
Zu Punkt 2:
Zur Klarstellung ist hier zunächst zu
bemerken, daß der Hauptverband keine Beitragsprüfungen vornimmt und
ihm auch keine Kompetenz hinsichtlich der Durchführung von
Beitragsprüfungen durch die Krankenversicherungsträger zukommt.
Zur Behauptung pauschaler Abrechnungen von
Überstundenvergütungen beziehungsweise entsprechender Vereinbarungen
zwischen der Salzburger Gebietskrankenkasse und dem Fachverband der
Güterbeförderungsgewerbe hat die Sektion II des
Bundesministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales unter einem eine
nähere Prüfung veranlaßt und zunächst die Salzburger
Gebietskrankenkasse zur Berichterstattung eingeladen.
Zu Punkt 3:
Die technische Ausstattung der Arbeitsinspektion
ist für die Lenkerkontrollen ausreichend.
Die Petition zielt vermutlich auf die Anschaffung
von Auswertgeräten durch die Arbeitsinspektion ab. Das
Zentral-Arbeitsinspektorat hat die Eignung solcher Auswertgeräte
geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, daß sie für die
Zwecke der Arbeitsinspektion nicht besonders geeignet sind, weil das
Arbeitsinspektorat – anders als die Sicherheitsbehörden – bei
den Auswertungen auf die Sonderregelungen und abweichenden Regelungen des
Arbeitszeitrechtes und der Kollektivverträge Bedacht nehmen muß.
Dispositionen über personelle Ressourcen und
Investitionen der Sozialversicherungsträger fallen in die autonome
Geschäftsführung der Versicherungsträger. In diesem Zusammenhang
ist darauf hinzuweisen, daß die Krankenversicherungsträger bis vor
kurzem mit einer prekären finanziellen Situation konfrontiert waren, die
erst durch das Maßnahmenpaket des Sozialrechts-Änderungsgesetzes
1996 (das ua. die 53. Novelle zum ASVG beinhaltet) entschärft werden
konnte. Als Teil dieser Maßnahmen waren auch Einsparungen bei den
Verwaltungskosten vorgesehen, die ua. durch einen mit der zuständigen
Gewerkschaft vereinbarten Einstellungsstopp für die Jahre 1996 und 1997
bewirkt werden sollten.
Zu Punkt 5:
Die Strafbestimmungen des
ASVG (§§ 111 ff. ASVG) wurden zuletzt mit dem
Antimißbrauchsgesetz, BGBl. Nr. 895/1995, empfindlich erhöht.
Nach Einschätzung vieler Experten ist jedoch die Effektivität der
Strafbestimmungen weniger durch die Höhe der Strafdrohung als durch die
vielfach als mangelhaft kritisierte Vollziehung dieser Bestimmungen durch die
hiefür zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden bestimmt.
Übertretungen von
Arbeitnehmerschutzvorschriften dürfen sich für den Arbeitgeber nicht
lohnen. Dies gilt umso mehr für Verstöße gegen die
Sonderbestimmungen für Lenker im Arbeitsruhegesetz (ARG) und Arbeitszeitgesetz
(AZG) beziehungsweise der Verordnungen (EWG) 3820/85 und 3821/85, weil die
Übermüdung eines Lenkers eine außergewöhnliche Gefahr
für Gesundheit und Leben des Lenkers, aber auch für andere
Verkehrsteilnehmer zur Folge hat. Verwaltungsstrafen wirken nur dann
abschreckend, wenn sie den wirtschaftlichen Vorteil aus der
Gesetzesübertretung zumindest ausgleichen. Durch die Novelle zum AZG und
ARG, BGBl. Nr. 446/1994, mit der Begleitmaßnahmen zu den
Verordnungen (EWG) 3820/85 und 3821/85 normiert wurden, erfolgte daher auch
eine wesentliche Erhöhung der Strafsätze in diesem Bereich
(Geldstrafen von 1 000 bis 25 000 S, bei Verstößen
gegen Vorschriften über das Kontrollgerät von 3 000 bis
30 000 S, im Wiederholungsfall von 5 000 bis
50 000 S). Damit bestehen für die Übertretung der
Sonderbestimmungen für Lenker wesentlich höhere Strafsätze als
für die Übertretung der übrigen Bestimmungen dieser
Gesetze.
Eine weitere
Erhöhung der Strafsätze war Gegenstand der Sozialpartnerverhandlungen
über die Novelle zum AZG und ARG, BGBl. I Nr. 46/1997, die am
1. Mai 1997 in Kraft getreten ist und durch die ua. einzelne lenkerspezifische
Bestimmungen geändert wurden. Diese Forderung der Arbeitnehmervertreter
scheiterte aber letztlich am Widerstand der Arbeitgeberseite. Wichtig für
eine effiziente Kontrolle wäre auch eine Aufnahme des Art. 15 der VO
(EWG) 3820/85 über die Harmonisierung der Sozialvorschriften im
Straßenverkehr in die Strafkataloge. Dies wurde jedoch auch von der
Arbeitnehmerseite abgelehnt.
Derzeit sind keine
weiteren gesetzlichen Änderungen der Arbeitszeit- und
Arbeitsruhevorschriften in Aussicht genommen. Die Verhältnismäßigkeit
der Sanktionen wird aber bei künftigen Änderungen wieder zur
Diskussion gestellt werden.
Zu Punkt 6:
Eine
“Eingreiftruppe” aus Beitragsprüfern, Lohnsteuerprüfern,
Arbeitsinspektoren und Sicherheitskräften in Arbeitnehmerschutzfragen
erscheint nicht sinnvoll:
Wesentlich effizienter
ist, wenn jede Behörde gesondert ihre Aufgaben wahrnimmt, also die
Sicherheitsbehörden entsprechend der EU-Richtlinie die Kontrollen auf den
Straßen und an den Grenzübergängen (gemeinsame Kontrollen
mit anderen EU-Staaten) durchführen und die Arbeitsinspektion entsprechend
der EU-Richtlinie die Betriebskontrollen durchführen. Bei den
Betriebskontrollen der Arbeitsinspektion in Arbeitnehmerschutzangelegenheiten
besteht keinerlei Bedarf nach einer Assistenzleistung der Sicherheitsbehörden.
Eine zeitgleich
durchgeführte Kontrolle durch Beitragsprüfer der Gebietskrankenkasse,
Lohnsteuerprüfer und Arbeitsinspektion in den Betrieben wäre für
die Arbeitsinspektion nicht effizient, weil die Arbeitsinspektion andere
Kontrollaufgaben (Lenkzeit, Ruhezeit, Lenkpausen) hat als die
Beitragsprüfer oder die Lohnsteuerprüfer und sich diese
Prüforgane nur gegenseitig behindern würden.
Zu Punkt 7:
Nach den derzeitigen
Plänen soll eine Chipkarte als (Daten)Sicherheitskarte, Servicekarte,
Schlüsselkarte bei der Arztverrechnung beziehungsweise Krankenscheinersatz
und nicht zuletzt als unbürokratisches Werkzeug zur Vereinfachung des
Verfahrens im Versicherungs-, Beitrags- und Melderecht der Sozialversicherung
fungieren. Hingegen wurden Vorschläge zu einer Verpflichtung der
Dienstnehmer, einen Sozialversicherungsausweis beziehungsweise eine Chipkarte
ständig bei sich führen zu müssen, bis dato aus grundsätzlichen
politischen Erwägungen stets abgelehnt. Eine derartige Verpflichtung
müßte nämlich im Hinblick auf den Gleichheitsgrundsatz alle
Dienstnehmer erfassen und könnte letztlich die illegale beziehungsweise
nicht ordnungsgemäß angemeldete Beschäftigung von Dienstnehmern
nicht verhindern, so daß die vorgeschlagene Maßnahme
überschießend erscheint.
Zu Punkt 8:
Die bestehenden
Regelungen über die Amtshilfe erscheinen für die Wahrnehmung des
Arbeitnehmerschutzes ausreichend. Für einen Informationsaustausch
zwischen Zentral-Arbeitsinspektorat und Bundesprüfzug besteht kein Bedarf.
Zu Punkt 9:
Auf Grund der Judikatur
des Verwaltungsgerichtshofes ist davon auszugehen, daß für alle
wesentlichen Übertretungen betreffend Kontrollgerät und Schaublatt nur
mehr die Lenker/innen zur Verantwortung zu ziehen sind, nicht die
Arbeitgeber/innen. Das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales hat sich bei der letzten AZG-Novelle um eine Änderung dieser
Rechtslage bemüht, damit für falsche Schaublätter auch die
Arbeitgeber/innen verantwortlich gemacht werden können. Das
Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales ist jedoch am
vehementen Widerstand der Interessenvertretungen – auch der
Arbeitnehmerseite – gescheitert.
Die Forderung nach
Änderung der Beweislast im Strafverfahren müßte generell durch
das Bundeskanzleramt behandelt werden. Eine Sonderregelung im
Strafverfahren gegen Arbeitgeber/innen wegen der Beschäftigung von Lenkern
wäre sicherlich verfassungswidrig.”
Dazu wurden
Übersichten über die Lenkerkontrollen der Arbeitsinspektion in den
Jahren 1995 und 1996 sowie die Unterlage “LENKERREGELUNGEN –
LENKERKONTROLLEN”, die seit 1996 allen interessierten Personen und
Stellen zur Verfügung gestellt wird, übermittelt, welche im folgenden
dargestellt wurden.
“LENKERKONTROLLEN
in den Betrieben und im Amt
im Jahr 1996
|
|
|
EG-VO FAHRZEUGE
|
|
|
|
|
Personenverkehr
|
Güterverkehr
|
|
|
|
|
Werkverkehr
|
Gewerblicher Kraftverkehr
|
Werkverkehr
|
Gewerblicher Kraftverkehr
|
Sonstige Fahrzeuge
|
|
Überprüfte
Lenker/innen
|
10 940
|
53
|
667
|
3 109
|
6 260
|
851
|
|
Überprüfte
Arbeitstage
|
170 253
|
750
|
11 555
|
37 537
|
112 447
|
7 964
|
|
Beanstandungen
|
|
|
Tageslenkzeit
|
1 182
|
1
|
78
|
200
|
879
|
24
|
|
Wochenlenkzeit
|
144
|
0
|
6
|
49
|
86
|
3
|
|
2-Wochen-Lenkzeit
|
78
|
0
|
0
|
2
|
76
|
0
|
|
keine
Lenkpause
|
744
|
7
|
24
|
149
|
541
|
23
|
|
zu
kurze Lenkpause
|
1 306
|
2
|
88
|
317
|
878
|
21
|
|
tägliche
Ruhezeit
|
870
|
0
|
76
|
73
|
691
|
30
|
|
wöchentliche
Ruhezeit
|
47
|
0
|
1
|
1
|
37
|
8
|
|
kein
Linienplan
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Mißbrauch
Linienplan
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
|
Einsatzzeit
|
916
|
1
|
59
|
118
|
705
|
33
|
|
Fahrtenbuch
und
Kontrollgerät
|
5 518
|
3
|
261
|
1 631
|
2 827
|
796
|
|
Gesamt
|
10 806
|
14
|
594
|
2 540
|
6 720
|
938
|
|
Arbeitstag
pro Lenker
|
16
|
|
Beanstandungen
pro Lenker
|
1
|
|
Beanstandungen
pro Tag
|
0,06
|
“LENKERREGELUNGEN –
LENKERKONTROLLEN
ÜBERSICHT
1. EG-Regelungen
2. Kraftfahrgesetz
2.1 Kontrollgerät
2.2 Lenkzeit, Ruhezeit, Lenkpause/Unterbrechung
2.3 Zwangsmaßnahmen
3. Arbeitszeitrecht
3.1 Geltungsbereich des Arbeitszeitgesetzes
3.2 EG-Anpassung
4. Kontrollen
4.1 Kontrollen nach dem Kraftfahrgesetz
4.2 Kontrollen der Arbeitsinspektion
1. EG-Regelungen
Mit Inkrafttreten des
EWR-Abkommens am 1. Jänner 1994 wurden in Österreich auf dem
Gebiet des Straßenverkehrs zwei EG-Verordnungen unmittelbar wirksam. Der
EU-Beitritt bewirkt auf diesem Gebiet keine Neuerungen.
Die EG-Verordnung
3820/85 über die Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im
Straßenverkehr regelt ua. das Mindestalter der Lenker, die
Lenkzeiten, die tägliche und wöchentliche Ruhezeit, die
Lenkpausen (Unterbrechungen genannt) und das Verbot bestimmter
Entgeltformen. Diese Verordnung verpflichtet zum Teil die Lenker (unabhängig
davon, ob sie Arbeitnehmer sind oder nicht), zum Teil die Unternehmer bzw.
Arbeitgeber. Diese Verordnung ist zum Teil dem Verkehrsrecht bzw.
Kraftfahrrecht zuzurechnen, zum Teil dem Arbeitnehmerschutzrecht.
Die EG-Verordnung
3821/85 über das Kontrollgerät im Straßenverkehr regelt die
Kontrollgerätepflicht, die Bauartgenehmigung, Einbau und Prüfung
sowie die Benützung des Kontrollgerätes. Diese Verordnung ist zum
Teil dem Kraftfahrrecht, zum Teil dem Arbeitnehmerschutzrecht zuzurechnen.
Außerdem ist die EG-Richtlinie
88/599 über einheitliche Verfahren zur Anwendung der Verordnung
Nr. 3820 und der Verordnung Nr. 3821 mit 1. Jänner 1995
umzusetzen. Diese Richtlinie wird nicht unmittelbar wirksam, sondern ist durch
innerstaatliche Rechtsvorschriften umzusetzen. Diese Richtlinie schreibt ein
Mindestausmaß der Kontrollen vor (mindestens 1% der Arbeitstage aller
Lenker), wobei davon mindestens 15% auf Straßen- und Grenzkontrollen und
mindestens 25% auf Betriebskontrollen entfallen müssen. Außerdem
sieht die Richtlinie umfassende Berichtspflichten vor. Für diese Berichte
hat die Kommission Berichtsformulare aufgelegt (getrennt nach
Straßenkontrollen und Betriebskontrollen, Aufschlüsselung der
Übertretungen, Berichte über Maßnahmen und Ahndung).
2. Kraftfahrgesetz
Durch die 15. KFG-Novelle
erfolgten insbesondere die erforderlichen Begleitregelungen zu den oben
angeführten Verordnungen, soweit sie dem Kraftfahrrecht zuzurechnen sind.
Diese Regelungen sind am 1. Jänner 1994 in Kraft getreten. Diese
Regelungen stellen kein Arbeitnehmerschutzrecht dar und sind nicht von der
Arbeitsinspektion zu vollziehen.
2.1
Kontrollgerät
Diese KFG-Novelle
enthält die erforderlichen Begleitregelungen betreffend das
Kontrollgerät (zB Bauartgenehmigung, Einbau, Plombierung und
Prüfung). Die Lenker haben dafür zu sorgen, daß der
Wegstreckenmesser und der Fahrtschreiber auf Fahrten in Betrieb sind und
daß im Fahrtschreiber ein ordnungsgemäß ausgefülltes
Schaublatt eingelegt ist. Pro Person und pro Einsatzzeit im Sinne des
§ 16 AZG darf nur ein Schaublatt im Fahrtschreiber eingelegt sein, in
das der Name des Lenkers einzutragen ist. Die Schaublätter der laufenden
Woche und das Schaublatt für den letzten Tag der vorangegangenen Woche, an
dem der Lenker gefahren ist, sind mitzuführen. Lenker müssen den
Sicherheitsorganen auf Verlangen die Schaublätter aushändigen
(§ 102 Abs. 1 KFG). Die Einhaltung dieser Vorschriften ist von
den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes und der
Straßenaufsicht (sowie von der Zollwache gemäß § 109
KFG) zu kontrollieren. Bei Übertretungen sind Strafen bis zu
30 000 S vorgesehen. Organstrafverfügungen sind bis zu
500 S zulässig (§ 134 Abs. 3 KFG).
2.2 Lenkzeit, Ruhezeit, Lenkpause/Unterbrechung
Unmittelbar auf Grund der
EG-Verordnung sind die Lenker zur Einhaltung der Lenkzeiten, Ruhezeiten und
Lenkpausen (in der EG-Verordnung als ,Unterbrechung‘ bezeichnet)
verpflichtet. Diese Lenkzeiten, Ruhezeiten und Unterbrechungen/Lenkpausen
stimmen nur zum Teil mit den einschlägigen Arbeitszeit- und
Arbeitsruheregelungen überein. Diese Regelungen richten sich nicht an die
Arbeitgeber, sondern an die Lenker. Dies gilt für alle Lenker der unter
die EG-Verordnung fallenden Fahrzeuge unabhängig davon, ob es sich bei den
Lenkern um Arbeitnehmer handelt oder nicht. Das KFG enthält die notwendigen
kraftfahrrechtlichen Begleitregelungen. Die Einhaltung der Lenkzeiten,
Ruhezeiten und Unterbrechungen/Lenkpausen ist seit 1. Jänner
1994 von den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes und der
Straßenaufsicht sowie der Zollwache zu kontrollieren. Wenn Lenker die
Lenkzeiten, Ruhezeiten oder Unterbrechungen/Lenkpausen nicht einhalten, sind
sie mit Strafen bis zu 30 000 S zu bestrafen,
Organstrafverfügungen bis zu 500 S sind zulässig.
2.3 Zwangsmaßnahmen
Wenn Lenker die
Regelungen der EG-Verordnung oder des AETR über die Lenkzeiten, die
Ruhezeiten oder die Unterbrechungen/Lenkpausen nicht einhalten, können die
Sicherheitsbehörden Zwangsmaßnahmen gemäß
§ 102 Abs. 12 KFG setzen (den Lenker am weiteren Lenken bzw. an
der Inbetriebnahme hindern). Gleiches gilt, wenn ein Lenker die erforderlichen
Schaublätter nicht mitführt, sie nicht ordnungsgemäß
ausgefüllt hat oder sie nicht aushändigt, oder wenn er die
Vorschriften der EG-Verordnung Nr. 3821/85 über die Benutzung des
Schaublattes verletzt. Bei diesen Maßnahmen kommt der Arbeitsinspektion
keine Kompetenz und auch keine Mitwirkungsbefugnis zu.
3. Arbeitszeitrecht
Die oben angeführten
EG-Verordnungen enthalten auch Arbeitnehmerschutzregelungen, deren Umsetzung
in die Zuständigkeit des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
fällt. Diese Arbeitnehmerschutzregelungen richten sich an die
Arbeitgeber, während die oben angeführten kraftfahrrechtlichen
Regelungen sich an die Lenker oder die Zulassungsbesitzer richten.
3.1 Geltungsbereich
des Arbeitszeitgesetzes
Das Arbeitszeitgesetz
gilt für die Beschäftigung von Lenkern durch Arbeitgeber, die ihren
Sitz bzw. Betriebsstandort in Österreich haben, und zwar unabhängig
von der Fahrtroute. Das Arbeitszeitgesetz gilt daher auch für Fahrten ins
Ausland. Die Einhaltung dieser Vorschriften ist von der Arbeitsinspektion zu
überwachen. Übertretungen sind nach dem Arbeitszeitgesetz strafbar.
Als Tatort ist jener (in Österreich gelegene) Ort anzunehmen, an dem der
Arbeitgeber (bzw. ein allfälliger verantwortlicher Beauftragter oder
Bevollmächtigter) gehandelt hat oder hätte handeln müssen.
Für Arbeitgeber, die
ihren Sitz bzw. Betriebsstandort nicht in Österreich haben, ist hingegen
das Arbeitszeitgesetz nicht anzuwenden, und zwar auch dann nicht, wenn Fahrten
durch oder nach Österreich durchgeführt werden. Wenn zB ein
Unternehmen mit Sitz in Bayern Lenker beschäftigt, und diese Lenker
Fahrten nach Österreich durchführen, gelten für die gesamte
Fahrt die einschlägigen Regelungen der BRD, also insbesondere das
Fahrpersonalgesetz und das Arbeitszeitgesetz. Die Einhaltung dieser
Vorschriften ist nicht von der Arbeitsinspektion zu überwachen, sondern
von den in der Bundesrepublik Deutschland für die Wahrnehmung des
Arbeitnehmerschutzes zuständigen Behörden.
Es besteht somit ein
wesentlicher Unterschied zwischen den kraftfahrrechtlichen Regelungen und den
arbeitszeitrechtlichen Regelungen: für den Bereich des Kraftfahrrechtes
haben die österreichischen Sicherheitsbehörden die Ruhezeit aller
Lenker unabhängig vom Herkunftsland (Zulassungsort) zu überwachen,
während die Arbeitnehmerschutzbehörden nur die Ruhezeit jener Lenker
zu kontrollieren haben, deren Arbeitgeber seinen Sitz bzw. seinen
Betriebsstandort in Österreich hat.
3.2 EG-Anpassung
Die
arbeitnehmerschutzrechtlichen Regelungen der EG-Verordnung wurden –
ebenso wie die kraftfahrrechtlichen Regelungen – mit Inkrafttreten des
EWR-Vertrages unmittelbar wirksam, ohne daß es einer innerstaatlichen
Umsetzung bedarf. Es mußten aber innerstaatliche Begleitregelungen
(Behördenzuständigkeit, Strafbestimmungen) erlassen werden.
Die in der EG-Verordnung
vorgesehenen Grenzen der Lenkzeiten, Ruhezeiten und Unterbrechungen/Lenkpausen
sind zum Teil weniger streng als die früher geltenden entsprechenden
Regelungen des Arbeitszeitgesetzes und Arbeitsruhegesetzes, zum Teil strenger.
Nach der EG-Verordnung 3820/85 kann jeder Mitgliedstaat längere Ruhezeiten
und Unterbrechungen/Lenkpausen sowie kürzere Lenkzeiten für die
Lenker von Fahrzeugen, die in seinem Hoheitsgebiet zugelassen sind, festlegen.
Die Anpassung des
Arbeitszeitgesetzes und des Arbeitsruhegesetzes erfolgte mit BGBl.
Nr. 446/1994. Diese Änderungen sind mit 1. Juli 1994 in Kraft
getreten. Die Sonderbestimmungen für Lenker wurden zum Teil gelockert,
soweit dies innerhalb der von der EG-Verordnung vorgegebenen Grenzen
zulässig war, zum Teil strenger gefaßt, um den EG-Regelungen
Rechnung zu tragen.
Diese AZG- und
ARG-Novelle ändert aber nichts daran, daß die EG-Verordnungen
grundsätzlich unmittelbar gelten und Vorrang gegenüber den
innerstaatlichen Rechtsvorschriften haben. Soweit daher das AZG und ARG keine
strengeren Regelungen vorsehen, gelten die Bestimmungen der EG-Verordnung
unmittelbar und verdrängen das AZG und ARG.
4. Kontrollen
Das Kraftfahrrecht ist
durch die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes und der
Straßenaufsicht zu kontrollieren, das Arbeitszeitrecht durch die
Arbeitsinspektion.
4.1 Kontrollen nach
dem Kraftfahrgesetz
Nach § 102
Abs. 11a und Abs. 11b KFG haben die Organe des öffentlichen
Sicherheitsdienstes und der Straßenaufsicht die Einhaltung der Verordnung
Nr. 3820/85 und der Verordnung 3821/85 sowie des AETR zu kontrollieren.
Die Kontrollen sind regelmäßig und in der Weise durchzuführen,
daß jedenfalls die Richtlinie 88/599 (siehe oben Punkt 1)
erfüllt wird.
Auf Grund der
15. KFG-Novelle und der oben dargestellten Anpassung im Arbeitszeitrecht
ist davon auszugehen, daß immer dann, wenn von einem Lenker die
kraftfahrrechtlichen Regelungen über die Lenkzeit, die Ruhezeit und die
Unterbrechungen/Lenkpausen übertreten werden, auch eine Übertretung
der Arbeitnehmerschutzvorschriften vorliegt, sofern es sich beim Lenker um
einen Arbeitnehmer handelt, und sofern für den Arbeitgeber dieses Lenkers
das Arbeitszeitgesetz bzw. Arbeitsruhegesetz gilt. Der umgekehrte Schluß
ist hingegen nicht zulässig, weil die Arbeitnehmerschutzvorschriften
strenger sein können, und daher zB bei einer unzulässigen Lenkzeit
nach dem Arbeitszeitgesetz noch keine unzulässige Lenkzeit nach dem
Kraftfahrrecht vorliegen muß.
In der
15. KFG-Novelle wurde auf diesen Umstand Bedacht genommen und eine
Mitteilungspflicht gegenüber dem Arbeitsinspektorat vorgesehen. Wenn die
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes oder der Straßenaufsicht
bei einem Lenker, der Arbeitnehmer ist, zB eine Überschreitung der
zulässigen Lenkzeit oder eine Unterschreitung der Mindestruhezeit oder die
Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Unterbrechungen/Lenkpausen feststellen,
haben sie hievon das zuständige Arbeitsinspektorat zu verständigen
(§ 102 Abs. 11c KFG). Diese Mitteilungspflicht stellt auf die
Lenkzeiten, Ruhezeiten und Unterbrechungen/Lenkpausen nach dem Kraftfahrrecht
(also EG-Verordnung und AETR) ab, nicht auf die Lenkzeiten, Ruhezeiten und Lenkpausen
nach dem Arbeitszeitgesetz.
Solche Mitteilungen an
das Arbeitsinspektorat sollen die Grundlage dafür bilden, daß das
Arbeitsinspektorat gegen die Arbeitgeber bzw. die sonst verantwortlichen
Personen wegen Übertretung des Arbeitszeitgesetzes nach § 9
ArbIG vorgehen kann. Die Arbeitsinspektorate leiten einlangende Mitteilungen,
für die sie örtlich unzuständig sind, unverzüglich direkt
an das örtlich zuständige Arbeitsinspektorat weiter.
4.2 Kontrollen
der Arbeitsinspektion
Für die Kontrollen
ist das Arbeitsinspektionsgesetz 1993 (ArbIG), BGBl. Nr. 27,
maßgeblich.
Im Rahmen der Kontrollen
der Arbeitsinspektion in den Betriebsstätten und auf den Baustellen wird
die Einhaltung der Sonderbestimmungen für Lenker überprüft
(Arbeitszeitgesetz, Arbeitsruhegesetz, Verordnung Nr. 3820/85 über
die Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr,
Verordnung Nr. 3821/85 über das Kontrollgerät im
Straßenverkehr). Die Kontrollen sind regelmäßig und in der
Weise durchzuführen, daß jedenfalls die Richtlinie 88/599 (siehe
oben Punkt 1) erfüllt wird. Bei Übertretungen ist mit
Aufforderung oder Strafanzeige gemäß § 9 ArbIG vorzugehen.
Über Ausmaß
und Ergebnis dieser Kontrollen wird dem Nationalrat jährlich ein Bericht
vorgelegt.”
Das Bundesministerium
für wirtschaftliche Angelegenheiten erstattete zur Petition betreffend
“Dem Staat sein Geld – dem Arbeitnehmer seine Rechte”
Leermeldung, da die Forderungen in dieser Petition nicht an sein Ressort
gerichtet seien.
Das Präsidium des
Bundesministeriums für Finanzen teilte zur Petition Nr. 29 betreffend
“Dem Staat sein Geld – dem Arbeitnehmer seine Rechte”
folgendes mit:
“Ziel der
Bundesregierung ist es, Beschäftigungsmöglichkeiten zu
ordnungsgemäßen Entgelt- und Arbeitsbedingungen sicherzustellen.
Dies setzt Chancengleichheit für alle selbständig und
unselbständig Erwerbstätigen voraus.
Eine ausreichende
Finanzierungsbasis für staatliche Aufgaben ist nur dann gesichert, wenn
die gesetzlich vorgeschriebenen Abgaben auch tatsächlich entrichtet
werden. Insbesondere soziale Sicherheit geht von korrekter Anmeldung aller
Beschäftigungen und von Ordnung am Arbeitsmarkt hinsichtlich der
Beschäftigung von ausländischen Staatsbürgern aus.
Die neue Aktion der
Bundesregierung ,Sauberer Arbeitsplatz‘ soll auf drei Ebenen zu Ergebnissen
führen, die eine merkbare Verbesserung der Anmelde- und
Beschäftigungsmoral in Österreich bewirken:
1. Durchsicht
und Verbesserung der entsprechenden Rechtsvorschriften (Sozialversicherungs-,
Steuer- und Gewerberecht, zB Verschärfung der Meldevorschriften,
Verbesserung der Strafbestimmungen)
2. Verbesserung
der diesbezüglichen Behördenorganisation und
Kontrollmöglichkeiten (zB Überprüfung der
Möglichgkeiten einer Behördenkonzentration, Schaffung von
Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit von aus verschiedenen
Behörden gebildeten ,Teams‘)
3. Aufklärungs-
und Meinungsbildungsarbeit – der ,saubere Arbeitsplatz‘ soll
,in‘ werden
Mit
Ministerratsbeschluß vom 28. Oktober 1997 wurde daher die Frau
Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und Soziales zur Umsetzung obiger
Ziele mit der Einsetzung einer Arbeitsgruppe unter Einbezug aller betroffenen
Bundesministerien, Vertretern der Bundesländer und der Sozialpartner
beauftragt, die Vorschläge zur Umsetzung des Programmes ausarbeiten
sollen.
Ein Projektzwischenbericht
soll der Bundesregierung im ersten Quartal 1998 vorgelegt werden.
Ergänzend wird
angemerkt, daß der Einkommensteuer (Lohnsteuer) nur das tatsächlich
zugeflossene Einkommen unterzogen werden kann, nicht aber Bezugsbestandteile,
auf die zwar ein arbeitsrechtlicher Anspruch besteht, die aber nicht ausbezahlt
werden. An diesem Grundprinzip des Einkommensteuerrechtes muß auch
in Zukunft festgehalten werden.”
Das Bundesministerium
für Justiz hält zur Petition Nr. 29 fest:
“Zunächst ist
darauf hinzuweisen, daß die in der Petition enthaltenen Anliegen
grundsätzlich in den Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums
für Arbeit, Gesundheit und Soziales, des Bundesministeriums für
Finanzen, des Bundesministeriums für Inneres und des Bundesministeriums
für Wissenschaft und Verkehr fallen. Der Wirkungsbereich des
Bundesministeriums für Justiz ist nur insoweit berührt, als eine
Änderung der Beweislast in ,einschlägigen‘ (arbeits- und
sozialgerichtlichen) Verfahren gefordert wird, wobei aber entsprechende
Regelungen nicht im Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz, sondern im
jeweiligen arbeitsrechtlichen Materiengesetz getroffen werden
müßten.
Grundsätzlich hat
das Bundesministerium für Justiz gegen Regelungen, die eine Umkehr der
Beweislast vorsehen, gewisse Vorbehalte. Eine Beweislastumkehr sollte
jedenfalls nur dann in Betracht gezogen werden, wenn – entgegen sonstigen
Grundsätzen – diejenige Partei, die auf Grund der
diesbezüglichen Umkehr die Beweislast treffen soll, typischerweise ,näher
am Beweis‘ und daher der Gegenpartei die Beweisführung nicht
zumutbar ist. Ob dies auch im vorliegenden Fall zutrifft, müßte
anhand der konkret vorgesehenen materiellrechtlichen Regelungen noch näher
geprüft werden.”
Das Bundesministerium
für Inneres nahm zur Petition Nr. 29 wie folgt Stellung:
“Die Beamten der
Sicherheitsexekutive führen laufend Kontrollen des Schwerverkehrs durch,
und es werden bei Unzukömmlichkeiten die entsprechenden Anzeigen gelegt.
Bei Übertretungen der einschlägigen Bestimmung der EG-VO 3820/85 und
3821/85 werden die entsprechenden Maßnahmen getroffen und auch das
zuständige Arbeitsinspektorat verständigt.
In diesem Zusammenhang
darf insbesonders auf den Art. 15 EG-VO 3820/85 hingewiesen werden, wo im
Abs. 1 eindeutig der Unternehmer dafür verantwortlich zeichnet,
daß der Fahrer die Bestimmungen der zitierten Verordnung auch einzuhalten
vermag.
Eine Abhilfe ist nur
möglich, wenn die Unternehmer verstärkt sowohl einer arbeits- wie
auch einer steuerrechtlichen Überprüfung unterzogen werden.
Bemerkt wird, daß
zu diesem Problembereich bereits ein Erlaß des Bundesministeriums
für Inneres, Zl. 15.004/20-II/18/91, vom 8. September 1991
ergangen ist, in dem die Vorgangsweise bei der Kontrolle von Lenkern von
Fahrzeugen bezüglich Übermüdung festgelegt wird, wobei die
dafür in Betracht kommenden Bestimmungen (§ 58 Abs. 1 StVO
1960, Arbeitszeitgesetz 1969, Arbeitsruhegesetz 1983 sowie das Europäische
Übereinkommen über die Arbeit des im internationalen
Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals, AETR, BGBl.
Nr. 518/1975) herausgearbeitet wurden.
Außerdem erging ein
Erlaß des Bundesministeriums für Wissenschaft und Verkehr,
Zl. 179.733/33-1/7/95, vom 21. Dezember 1995, zu den beiden oa.
EG-VO, wo insbesondere auf folgende Punkte bei Straßenkontrollen zu
achten ist:
Tageslenkzeiten,
Unterbrechungen, Ruhezeiten, Handhabung der Schaublätter und des
Kontrollgerätes.
Außerdem ist bei
jeder Kontrolle ein Formblatt auszufüllen. Diese Daten dienen dem
Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr zum erforderlichen Bericht
gemäß Art. 16 Abs. 2 EG-VO 3820/85 an die EG-Kommission.
Es wird darin auch auf
die Richtlinie 88/599/EWG hingewiesen, wo eine bestimmte
Kontrollintensität (1% der Arbeitstage gemäß Art. 2
Abs. 2 dieser Verordnung) gefordert wird.
Durch permanente
Kontrolltätigkeit der Exekutive wird dieses Mindestmaß an Kontrollen
bei weitem überschritten und dadurch die Verkehrssicherheit direkt positiv
beeinflußt.
Eine ,schnelle
Eingreiftruppe‘ – gemeinsame Kontrollen durch die Exekutive in
Zusammenarbeit mit dem Arbeitsinspektorat – ist nicht zielführend,
da einerseits die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes als Organe
der Straßenaufsicht bei Lenkerkontrollen über sämtliche
erforderlichen Befugnisse verfügen und bei Übertretungen die
erforderlichen Maßnahmen treffen können; die einzig
wünschenswerte Erweiterung, nämlich eine Klärung vor Ort
(Computeranfrage), ob eine Person sozialversichert ist, ist derzeit auch dem
Arbeitsinspektorat nicht möglich.”
Einstimmiger
Beschluß des Ausschusses für Petitionen und
Bürgerinitiativen am 1. Juli 1998:
Ersuchen um Zuweisung an
den Ausschuß für Arbeit und Soziales.
Bautenausschuß
Petition Nr. 21
überreicht von der
Abgeordneten Mag. Brigitte Ederer betreffend “Schutz der
Anrainer von Bundesstraßen”
Die vorliegende Petition
zum Schutz der Anrainer von Bundesstraßen hat eine Abänderung des
Bundesstraßengesetzes, insbesondere der §§ 7 und 7a
dieses Gesetzes zum Inhalt.
Wörtlich wird dazu
ausgeführt: “So sollen im letzten Halbsatz des § 7
Abs. 1 die Worte ,Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs‘
gestrichen und dieser Halbsatz wie folgt lauten:
,; hiebei ist auf die
Sicherheit des Verkehrs, die Verträglichkeit für Anrainer und die
Umweltverträglichkeit Bedacht zu nehmen.‘
Im § 7a
Abs. 1 soll der Satzteil ,. . . als dies durch einen im
Hinblick auf den erzielbaren Zweck wirtschaftlich vertretbaren Aufwand
errreicht werden kann.‘ gestrichen werden.
Im § 7a
Abs. 2 soll der letzte Halbsatz ,sofern die Erhaltung und allfällige
Wiederherstellung durch den Eigentümer oder einen Dritten sichergestellt
ist.‘ gestrichen werden.
Stattdessen sollen im
Bundestraßengesetz folgende Maßnahmen festgelegt werden:
Schallschutzbauten sind
beim Bau von Bundesstraßen und auch an bestehenden Bundesstraßen zu
errichten, wenn der von der WHO festgelegte Grenzwert von 55 dB bei Tag
und 45 dB bei Nacht (energieäquivalenter Dauerschallpegel)
überschritten wird, sofern dies technisch durchführbar ist.
Sind Schallschutzbauten
auf Grund der örtlichen Gegebenheiten technisch nicht durchführbar,
so sind über Anforderung von Anrainern Baumaßnahmen an
Gebäuden, Einbau von Schallschutzfenstern und dergleichen vorzusehen und
die Kosten hiefür, wie auch für die Wartung und deren
allfälliger Ersatz, durch den Straßenerhalter zu übernehmen.
Über Anforderung der Anrainer sind in diese Gebäude auch
Klimatisierungseinrichtungen einzubauen und die Kosten hiefür, wie auch
für deren Betrieb und Wartung, durch den Straßenerhalter zu
übernehmen.
Die durch die
geänderten Bestimmungen verursachten Kosten könnten nach dem
Verursacherprinzip durch zweckgebundene Zuschläge zur KFZ-Steuer und bzw.
oder zur Mineralölsteuer vom KFZ-Verkehr aufgebracht werden.
Begründung: Bei der Planung und beim Bau von Bundesstraßen wird stets
größter Wert auf die Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs
gelegt. Dies führt zu entsprechend hohen Fahrgeschwindigkeiten und
damit einer hohen Lärmbelastung für die Anrainer, die bei der Planung
und beim Bau von Bundesstraßen kaum ein Mitspracherecht haben.
Nach der entsprechenden
Dienstanweisung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten
werden Schallschutzbauten an Straßen nur dann als wirtschaftlich
vertretbar erachtet, wenn diese nicht mehr als die dreifachen Kosten von
Schallschutzfenstern verursachen. Dazu kommt noch, daß bei
straßenseitigen Schallschutzbauten den Anrainern durch diese
Maßnahmen keine Kosten, auch nicht aus dem Titel von Wartungsarbeiten an
diesen Bauten, erwachsen, wogegen beim Einbau von Schallschutzfenstern die
Anrainer einen beträchtlichen Teil der Kosten hiefür selbst tragen
müssen und für die Wartung der Fenster und deren allfälligen
Ersatz selbst aufkommen müssen.
Hiedurch ist eine
wesentliche Schlechterstellung jener Anrainer gegeben, in deren Bereich keine
straßenseitigen Schallschutzbauten errichtet werden.
Dabei ist es wohl
unbestreitbar, daß Schallschutzfenster eine erhebliche Einschränkung
der Lebensqualität darstellen, da insbesondere im Sommer ein Leben hinter
ständig geschlossenen Fenstern eine sehr erhebliche Belastung
darstellt und andererseits ein Öffnen der Fenster wegen der oft extremen
Lärmbelastung an Bundesstraßen von zB 80 dB und mehr kaum
möglich ist.
Aus diesen Gründen
sollen an Bundesstraßen, an denen die Lärmbelastung über dem
WHO-Wert liegt, wo immer dies möglich ist, straßenseitige
Baumaßnahmen getroffen werden. Wo dies nicht möglich ist, soll das
Leben der betroffenen Anrainer durch den Einbau von
Klimatisierungseinrichtungen entsprechend erleichtert werden und im Sinne einer
Gleichbehandlung die Kosten hiefür von der Allgemeinheit übernommen
werden.”
Der Ausschuß
für Petitionen und Bürgerinitiativen hat in seiner Sitzung am
7. Mai 1997 dazu beschlossen, Stellungnahmen des Bundesministeriums
für Arbeit, Gesundheit und Soziales, des Bundesministeriums für
Wissenschaft und Verkehr sowie des Bundesministeriums für wirtschaftliche
Angelegenheiten einzuholen.
Das Bundesministerium
für Wissenschaft und Verkehr teilt in seiner Stellungnahme mit, daß
gegen die vorgeschlagenen Änderungen des Bundesstraßengesetzes keine
Einwände bestehen.
Die Stellungnahme des
Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten lautet wie folgt:
“Der in der
Petition Nr. 21 der Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Brigitte Ederer
gewünschte neue Grenzwert für Lärmschutz an Bundesstraßen
würde eine Herabsetzung des geltenden Grenzwertes bei bestehenden
Bundesstraßen um 10 dB, bei neu gebauten Bundesstraßen um 5
bis 9 dB bedeuten. Da die Erhöhung einer Lärmschutzwand um 0,5 m
rechnerisch eine Lärmreduktion um ca. 1,5 dB bewirkt,
müßten die an bestehenden Bundesstraßen bereits vorhandenen
Lärmschutzmaßnahmen um ca. 3,5 m erhöht werden, die
Lärmschutzmaßnahmen an neu gebauten Bundesstraßen um ca.
2,0 m.
Unter der Annahme,
daß von den bisher in Österreich errichteten rund 600 km langen
Lärmschutzmaßnahmen zirka 50% an bestehenden und 50% an neu
gebauten Bundesstraßen liegen, errechnet sich der Erhöhungsbedarf
mit 1,65 Millionen m2. Bei Durchschnittskosten von 3 500 S/m2 Wanderhöhung
ergeben sich Kosten von 5,775 Milliarden Schilling allein für die
Adaptierung bereits gebauter Lärmschutzmaßnahmen.
Da in der Petition auch
ein Wegfall des Wirtschaftlichkeitskriteriums verlangt wird, ist weiters mit
Kosten von 2,0 Milliarden Schilling für die Erweiterung
(Verlängerung) bestehender Lärmschutzmaßnahmen und von
mindestens 2,0 Milliarden Schilling für neue
Lärmschutzmaßnahmen zu rechnen.
Insgesamt wird der
finanzielle Bedarf der aus dem Petitionsverlangen sich ergebenden
Maßnahmen auf 9,775 Milliarden Schilling geschätzt. In diesem
Betrag sind nicht Kosten für Lärmschutztunnel, Tieflagen,
Einhausungen, Brückentragwerksverstärkungen oder gestalterisch
aufwendigere Wandkonstruktionen (zB transparente oder künstlerisch
gestaltete Wandelemente) enthalten. Wenn sich selbst nur wenige solcher
aufwendigen Maßnahmen ergäben, würde sich der vorgenannte
Betrag auf das Drei- bis Fünffache erhöhen. Dieser Fall könnte
rasch eintreten, da die aus den geforderten neuen Grenzwerten resultierenden
beträchtlichen Wandhöhen kaum die Zustimmung des Natur- und
Landschaftsschutzes bzw. der für das Stadt- oder Ortsbild zuständigen
Stellen finden werden.
Unter der Voraussetzung,
daß bei der Realisierung des Petitionsbegehrens überwiegend
straßenseitige Lärmschutzmaßnahmen
(Lärmschutzwände/-dämme, Einhausungen, lärmdämmende
Fahrbahndecken) möglich sind, werden die Kosten für zusätzliche
Lärmschutzfenster mit rund 300 bis 500 Millionen Schilling
abgeschätzt. Für Schalldämmlüfter würde ein Bedarf von
200 bis 300 Millionen Schilling entstehen, wenn unter dem Begriff
,Klimatisierung‘ der Einbau von Schalldämmlüftern verstanden
wird. Der Erhaltungsaufwand für diese Lärmschutzfenster wird mit
zirka 1 Milliarde Schilling in 50 Jahren abgeschätzt.
Bei diesen Beträgen
handelt es sich nur um durch die Petition verursachten Kosten, zusätzlich
zu den Kosten der ohnehin schon geplanten Maßnahmen.
Im Hinblick auf die
bekannte finanzielle Situation des Bundesstraßenbaues kann daher den
Vorschlägen der Petition Nr. 21 nicht nähergetreten
werden.”
Eine Stellungnahme des
Bundesministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales langte nicht ein.
Folgende Stellungnahme
der Volksanwaltschaft konnte den Beratungen zugrunde gelegt werden:
“Immer wieder
wenden sich Anrainer von Bundesstraßen mit dem Ersuchen um Hilfestellung
bei der Errichtung von Lärmschutzmaßnahmen bzw. Maßnahmen zur
Verkehrssicherheit entlang von Bundesstraßen an die
Volksanwaltschaft. Einige dieser Fälle betreffen auch die Errichtung von
straßenseitigen Schallschutzbauten.
Besonders hervorzuheben
ist jener Fall, der auch im Bericht der Volksanwaltschaft an den
Österreichischen Nationalrat über das Jahr 1996 aufgezeigt
wurde. Die betroffenen Anrainer sahen sich mit der Situation konfrontiert,
daß eine nach jahrelanger Planungsarbeit vom Bundesministerium für
wirtschaftliche Angelegenheiten zugesagte Errichtung einer
Lärmschutzwand auf der A 2, Abschnitt Laßnitztal, vom Land
Steiermark im Ergebnis deswegen hinausgezögert wurde, weil seitens der
Gemeinde mit Unterstützung des Landes die Realisierung einer
Halbanschlußstelle in diesem Bereich mit Nachdruck betrieben wurde.
Zuletzt teilte der Bundesminister im Dezember 1996 der Volksanwaltschaft mit,
daß ,sich in der Zwischenzeit die Notwendigkeit ergeben hat, die
getroffene Entscheidung auf Grundlage eines neuen von der Bundesstraßenverwaltung
Steiermark vorgelegten Straßenprojektes nochmals zu überprüfen‘.
In einer ersten Baustufe soll nun nur jener Bereich der
Lärmschutzmaßnahme zur Ausführung gelangen, der nicht von der
eventuell zu errichtenden Anschlußstelle betroffen ist.
Weitere
Beschwerdefälle betreffen die Realisierung von Lärmschutzwänden
in Oberösterreich an der B 148, Altheimer Straße im Baulos
,Reichersberg‘, in Niederösterreich an der B 37, Gföhler
Straße auf dem Bauabschnitt ,Großmotten‘, in Salzburg-Stadt entlang
der Innsbrucker Bundesstraße, in Vorarlberg entlang der B 204,
Lustenauer Straße, sowie in Kärnten an der B 85, Rosental
Straße, Baulos ,Görtschach‘.
All den aufgezeigten
Fällen ist gemeinsam, daß die betroffenen Anrainer oft nur
unzureichend über ihre Möglichkeiten informiert sind. Sie sind
gezwungen, selbst aktiv zu werden, um sich über das Straßenbauvorhaben
und die Voraussetzungen für die Errichtung von Schallschutzbauten entlang
von Bundesstraßen informieren zu lassen. Die Volksanwaltschaft stellt
fest, daß die Betroffenen sich letztendlich selbst um die Lösung
ihres konkreten Problems kümmern müssen, da klare gesetzliche
Regelungen fehlen.
In diesem Sinne
begrüßt die Volksanwaltschaft Bemühungen zur Schaffung von
Regelungen auf gesetzlicher Ebene für die Errichtung von
Schallschutzbauten zum Schutz der Anrainer von Bundesstraßen. Der
Vorteil der gesetzlichen Verankerung entsprechender Maßnahmen zum Schutz
von Anrainern von Bundesstraßen basierend auf von der WHO festgelegten
Grenzwerten liegt darin, daß der betroffene Anrainer sich konkret auf die
gesetzliche Bestimmung stützen und ihre Vollziehung auch von der
Verwaltung erwarten kann.”
Einstimmiger
Beschluß in der Sitzung am 26. November
1997:
Ersuchen um Zuweisung an
den Bautenausschuß.
Familienausschuß
Petition Nr. 16
überreicht von der
Abgeordneten Brigitte Tegischer betreffend “die finanzielle
Gleichstellung der Fahrtkosten zwischen Heimschülern und
Fahrschülern”
Die Abgeordnete Brigitte
Tegischer überreichte mit dieser Petition ein Anliegen des Herrn Johann
Mair, das wie folgt begründet ist:
“Antrag auf
Schülerfreifahrten für Heimschüler
Die Schüler
entlegener Gebiete Österreichs beantragen die Schülerfreifahrten, um
eine finanzielle Gleichstellung mit den Fahrschülern zu erreichen.
Was ist das für ein
Lastenausgleich?
18 144 S
müssen Virger Heimschüler für die Erreichbarkeit der Schule aus
der eigenen Tasche zahlen. Dazu kommen noch die Heimkosten in Höhe von
40 000 S bis 60 000 S. Trotz dieser hohen Ausbildungskosten
bekommen Heimschüler aus dem Lastenausgleich nichts.
Fahrtkosten für
42 Schulwochen Virgen–Imst.
Über
18 000 S bekommen Virger Fahrschüler,
die daheim wohnen und daher keine Ausbildungskosten haben, als
Schülerfreifahrten Virgen–Lienz aus dem Lastenausgleich.
Auch wenn der Schulweg
nicht täglich (steht nicht im Familienlastenausgleichsgesetz)
zurückgelegt werden kann, müssen die Schüler aus entlegenen
Gebieten die Erreichbarkeit der Schule wie die Fahrschüler aus dem
Familienlastenausgleich bezahlt bekommen.
Die bestehende
Vergabepraxis diskriminiert Heimschüler aus entlegenen Gebieten, weil sie
sie aus dem Familienlastenausgleich ausschließt.
Sie verstößt
gegen:
– den Art. 7 unserer
Verfassung (Heimschüler und Fahrschüler sind gleich),
– gegen das
Gleichbehandlungsgesetz und
– gegen die guten Sitten.
Diese bestehende
Diskriminierung muß beseitigt werden!”
In seiner Sitzung am
7. Mai 1997 beschloß der Ausschuß, eine Stellungnahme des
Bundesministeriums für Finanzen einzuholen. Dieses nahm zur
gegenständlichen Petition wie folgt Stellung:
“Die in der
Petition angesprochene Problematik basiert auf der Außerkraftsetzung des
§ 30c Abs. 4 Familienlastenausgleichsgesetz. Die Vollziehung
dieses Gesetzes obliegt grundsätzlich dem Bundesminister für
Umwelt, Jugend und Familie, von dem auch eine allfällige Reform der von
den Petitionswerbern als unbefriedigend empfundenen Situation in die Wege
zu leiten wäre.
Auch wenn das
Bundesministerium für Finanzen auf Grund dieser Gegebenheiten keine
umgehende Änderung der Rechtslage bewirken oder in Aussicht stellen kann,
wird es bemüht sein, das Anliegen in die Diskussion um die Reform der
Familienförderung einzubringen und an einer auch budgetär vertretbaren
Lösung mitzuwirken.”
Weiters übermittelte
die Volksanwaltschaft eine an den Bundesminister Dr. Bartenstein gerichtete
Eingabe des Katholischen Familienverbands Tirol den Wegfall der
Heimfahrtbeihilfe betreffend:
“Im Rahmen des
Strukturanpassungsgesetzes 1995 wurde neben mehreren allgemeinen Belastungen
und etlichen Kürzungen im Familienbereich auch die Heimfahrtbeihilfe
gestrichen.
Bereits damals hat der
Katholische Familienverband auf die besondere Härte und Ungerechtigkeit
dieser Maßnahme hingewiesen. Trifft es hier genau die ärmsten
Familien aus entlegenen Gebieten, die zu den Internatskosten, die oft nur unter
größten Entbehrungen aufgebracht werden, jetzt auch noch die Kosten
für die Fahrt vom Schulort zum Heimatort aus der eigenen Tasche bezahlen
müssen. Würden diese Kinder täglich zur Schule fahren,
hätten sie natürlich Anspruch auf die Schüler,frei‘fahrt.
Eine Umfrage unter
betroffenen Tiroler Familien hat diese Tatsachen untermauert: Es sind
österreichweit zirka 25 000 Familien, größtenteils
Großfamilien, Bergbauern und Familien mit geringem Einkommen, die hier zu
den bekannten Sparmaßnahmen noch einmal getroffen werden!
Aus den eingegangenen
Fragebögen einige Beispiele:
– AlleinerzieherInnen:
monatliches Nettoeinkommen 11 000 S,
– Familie in Osttirol (vier
Kinder): monatliches Nettoeinkommen 21 000 S,
– Pensionist: monatliches Nettoeinkommen
13 000 S,
– Bergbauernfamilie:
Einheitswert 21 000 S.
Daß mit dieser
unsozialen Maßnahme die Chancengleichheit für alle Kinder verletzt
wird, ist offensichtlich!
Leider blieben unsere
bisherigen Interventionen bis jetzt ohne Echo. So wenden wir uns heute an Sie
in der Hoffnung, daß endlich etwas unternommen wird, diese unsoziale
Maßnahme zu entschärfen oder zurückzunehmen. Es ist absurd,
daß gerade Kindern aus einkommensschwachen Familien aus Gegenden mit
fehlender Infrastruktur überhaupt keine weiterführende Ausbildung
ermöglicht werden kann!”
Einstimmiger
Beschluß in der Sitzung des Ausschusses am
9. Juli 1997:
Ersuchen um Zuweisung an
den Familienausschuß.
Finanzausschuß
Petition Nr. 20
überreicht vom
Abgeordneten Dr. Alfred Gusenbauer betreffend “Initiative 96
Entschuldung”
Die vorliegende Petition
hat folgende Forderungen der “Initiative 96 Entschuldung” zum
Inhalt:
“1. Entschuldung
der ärmsten Entwicklungsländer
– durch Streichung aller
Schulden aus Entwicklungshilfe-Krediten gegenüber den ärmsten
Entwicklungsländern und
– durch Streichung von
Schulden aus öffentlich geförderten Exportkrediten gegenüber den
Schwerpunktländern der österreichischen Entwicklungshilfe.
Ein Teil der erlassenen
Devisenschulden soll im Schuldnerland in nationaler Währung
Sozialprojekten für die ärmsten Bevölkerungsschichten zugute
kommen (in Form von Gegenwertfonds).
2. Transparenz bei der
Vergabe von öffentlichen Mitteln für die Länder des Südens
– bei öffentlich
finanzierten bzw. geförderten Exportkrediten und
– bei Beiträgen
Österreichs an die multilateralen Finanzinstitutionen.
3. Gesetzlich verankerte
Kriterien für Umwelt- und Sozialstandards für Projekte, die durch
öffentlich geförderte bzw. finanzierte Exportkredite finanziert
werden. Damit soll sichergestellt werden, daß diese Projekte einer
nachhaltigen Entwicklung des jeweiligen Landes dienen.
4. Zusätzliche,
zweckgebundene Mittel für die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit
vorrangig für die Verdoppelung von Gegenwertmitteln im
Schuldnerland.”
Das Mitglied des
Ehrenschutz-Komitees der “Initiative 96 Entschuldung”,
Oberkirchenrat Univ.-Prof. Dr. Johannes Dantine, richtete in dieser
Angelegenheit ein Schreiben mit folgendem Wortlaut an den Präsidenten des
Nationalrates:
“Sehr geehrter Herr
Präsident!
Als Mitglied des
Ehrenschutz-Komitees der Initiative 96 Entschuldung möchte ich die
Gelegenheit der Überreichung der Unterstützungserklärungen von
mehr als 50 000 Personen wahrnehmen, diese Initiative nochmals
ausdrücklich zu unterstützen.
Auch wenn Österreich
gegenwärtig in einer Situation empfindlicher Sparmaßnahmen ist, kann
nicht daran vorbeigegangen werden, daß es einer der reichsten Staaten ist
und diesen Reichtum auch den günstigen Handelsbedingungen zur weiten Welt
verdankt, und zusätzlich Österreich bisher einen mehr als
bescheidenen Beitrag dafür geleistet hat, daß es in dieser Welt
gerechter zugeht.
Im konkreten Fall geht es
ja darum, dadurch einen wesentlichen Beitrag für die soziale Gerechtigkeit
und damit für den Frieden – der unser aller Lebensbedingung heute
und für die Zukunft darstellt – zu leisten, daß im Grunde
genommen schon längst abgeschriebene Schuldenlasten von den ärmsten
Ländern genommen werden, bzw. zu leistende Zahlungen in sinnvolle Projekte
jeweils ins eigene Land gesteckt werden sollen. Genau genommen geht es darum,
daß eindeutige Vorhaben, etwa des ,Pariser Clubs‘ und
internationaler Finanzgremien, durch das Parlament und die österreichische
Regierung schneller und umfassender durchgeführt werden.
Ich appelliere an Sie,
sehr geehrter Herr Präsident, diese Initiative positiv aufzunehmen und zu
vertreten.”
Ebenfalls war folgendes
Schreiben von Kardinal Dr. Franz König, Mitglied des Ehrenschutz-Komitees
der “Initiative 96 Entschuldung”, der gegenständlichen
Petition beigefügt:
“Sehr geehrter Herr
Präsident des Österreichischen Nationalrates!
Als Mitglied des
Ehrenschutz-Komitees der Initiative 96 Entschuldung erlaube ich mir,
eine Bitte zu befürworten, die – unterstützt durch mehr als
50 000 Unterschriften – dem Nationalrat und der
Österreichischen Bundesregierung vorgelegt wird. Damit schließe ich
mich indirekt auch einer Erklärung der Österreichischen
Bischofskonferenz zur internationalen Verschuldung der ärmsten Länder
der ,Dritten Welt‘ an.
Angesichts der
fortschreitenden Globalisierung der Völker und Staaten auf der Weltebene
geht es damit auch um eine Frage des Friedens in der Welt, der Sicherheit und
Völkerverständigung, die alle staatlichen Gemeinschaften angehen.
Aus diesem Grunde habe
ich mit entschlossen, eine solche Bitte zu unterstützen. Praktisch handelt
es sich darum, daß Österreich, das österreichische Parlament
und die österreichische Regierung, das vom ,Pariser Club‘ und von
internationalen Finanzgremien bereits beschlossene Vorhaben – schneller
und umfassender – durchführen als zunächst vorgesehen.
Ein solches Beispiel
grenzüberschreitender Solidarität durch ein kleines, wohlhabendes
Land würde das internationale Ansehen Österreichs stärken und
dem friedlichen Ausgleich zwischen reichen und armen Ländern
dienen.”
Einstimmiger
Beschluß in der Sitzung des Ausschusses am
7. Mai 1997:
Ersuchen um Zuweisung an
den Finanzausschuß.
Finanzausschuß
Petition Nr. 18
überreicht vom
Abgeordneten Mag. Johann Maier “Wider die
Parkplatzsteuer”
Die vorliegende Petition
wurde von knapp 10 000 Salzburger Arbeitnehmern initiiert, die in
einer Unterschriftenaktion in den Betrieben gegen die sogenannte
“Parkplatzsteuer” Partei ergriffen haben und einen weiteren
Ausnahmetatbestand im EStG fordern. Wörtlich führen sie dazu aus:
“Der
Sachverhalt:
Seit 1. Juli 1996
gilt nach § 4a Einkommensteuergesetz:
1. Besteht für den Arbeitnehmer die
Möglichkeit, das von ihm für Fahrten Wohnung–Arbeitsstätte
genutzte Kraftfahrzeug während der Arbeitszeit in Bereichen, die einer
Parkraumbewirtschaftung unterliegen, auf einem Abstell- oder Garagenplatz des
Arbeitgebers zu parken, ist ein Sachbezug von 200 S monatlich anzusetzen.
2. Abs. 1 ist sowohl bei
arbeitnehmereigenen Kraftfahrzeugen als auch bei arbeitgebereigenen Kraftfahrzeugen
(…) anzuwenden.
3. Parkraumbewirtschaftung im Sinne des
Abs. 1 liegt vor, wenn das Abstellen von Kraftfahrzeugen auf
öffentlichen Verkehrsflächen für einen bestimmten Zeitraum
gebührenpflichtig ist.
29 Befreiungen gibt es bereits laut § 3 Einkommensteuergesetz. Unter
anderem ,der geldwerte Vorteil aus der Benützung von Einrichtungen und
Anlagen, die der Arbeitgeber allen Arbeitnehmern oder bestimmten Gruppen seiner
Arbeitnehmer zur Verfügung stellt‘ (zB Sportanlagen), freie oder
verbilligte Mahlzeiten und Getränke, freiwillige soziale Zuwendungen, der
Haustrunk im Brauereigewerbe, Freizigaretten für Arbeitnehmer in
tabakverarbeitenden Betrieben, bei Auslandsbeamten die Zulagen und
Zuschüsse sowie Kostenersätze und Entschädigungen für den
Heimaturlaub …
Warum sollte es nicht
möglich sein, eine 30. Befreiung für Firmenparkplätze zu
formulieren, den Parkplatz als Anlage des Arbeitgebers zu interpretieren oder
wie in der BRD den Parkplatz nicht als Vorteil, sondern als ,bloße Annehmlichkeit‘
einzustufen?
Über einen Kamm
geschert haben die Finanzämter alle Betroffenen.
Egal wie oft ein Arbeitnehmer den Parkplatz in Anspruch nimmt, und sei es
einmal im Monat; egal, ob überhaupt genügend Parkplätze zur
Verfügung stehen; egal, ob sich die Arbeitszeit nur eine halbe Stunde mit
den Zeiten der Parkraumbewirtschaftung überschneidet oder zur
Gänze – die Arbeitnehmer werden zur Kasse gebeten!
Forderung
Die
Zurverfügungstellung eines Kfz-Abstellplatzes durch den Dienstgeber im
Nahbereich des Arbeitsplatzes soll als Vorteil aus dem
Dienstverhältnis von der Einkommensteuer befreit werden. Dazu wäre im
§ 3 EStG 1988 eine entsprechende Befreiungsbestimmung aufzunehmen!
Diese kann lauten:
§ 3 Abs. 1
Von der Einkommensteuer sind befreit:
Z 30 die
Möglichkeit des Arbeitnehmers, das von ihm für Fahrten
Wohnung–Arbeitsstätte genutzte Kraftfahrzeug während der
Arbeitszeit auf einem Abstell- oder Garagenplatz des Arbeitgebers zu
parken.”
Im Zusammenhang mit der
von der Petition aufgeworfenen Problematik hat der Ausschuß in seiner
Sitzung am 7. Mai 1997 den Beschluß gefaßt, Stellungnahmen des
Bundesministeriums für Finanzen sowie des Bundesministeriums für
Wissenschaft und Verkehr einzuholen.
Dazu ist folgende
Stellungnahme des Bundesministeriums für Finanzen mit der Mitteilung
eingelangt:
“Ein Prinzip
erfolgreicher und international anerkannter Steuerpolitik der letzten Jahre ist
es, die Ausnahmetatbestände sowie Steuerbefreiungen einzuschränken,
um damit Spielraum für die Gestaltung von Steuertarifen zu schaffen. Schon
aus diesem Grund ist die Einführung neuer Steuerbefreiungen
grundsätzlich abzulehnen.
Nach der
gegenwärtigen Rechtslage ist der Sachwert des unentgeltlich oder
verbilligt zur Verfügung gestellten Wohnraumes steuerpflichtig. Umso mehr
erscheint die Forderung nach Steuerbefreiungen für unentgeltlich zur
Verfügung gestellten Parkraum problematisch.
Hinzu kommt, daß
der Parkraum bei zunehmender Parkraumbewirtschaftung einen immer
größeren Wert erhält und somit die Gewichtigkeit als
Sachvorteil zunimmt. Auch wäre es ökologisch und verkehrspolitisch
bedenklich, die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte mit dem eignen
PKW dadurch indirekt zu fördern, daß dem Arbeitnehmer gratis und
steuerfrei Parkraum zur Verfügung gestellt wird.
Was den Vergleich mit den
erwähnten 29 Steuerbegünstigungen anbelangt, ist zu bemerken,
daß ein Großteil dieser Begünstigungen – anders als
kostenloser Parkraum – soziale Aspekte hat. In diesem Zusammenhang
möchte ich erwähnen, daß grundsätzlich alle bestehenden
Steuerbefreiungen sehr kritisch auf ihre Rechtfertigung zu überprüfen
sind.”
Das Bundesministerium
für Wissenschaft und Verkehr verwies zur gegenständlichen Petition
“Wider die Parkplatzsteuer” darauf, daß seinem Ressort in
dieser Angelegenheit keine Kompetenz zukommt.
Einstimmiger
Beschluß in der Sitzung des Ausschusses am
26. November 1997:
Ersuchen um Zuweisung an
den Finanzausschuß.
Gesundheitsausschuß
Petition Nr. 12
überreicht von den Abgeordneten Dr. Andreas Khol,
Edeltraud Gatterer und
Georg Wurmitzer betreffend “Erhaltung der Akutversorgung im
Krankenhaus Waiern”
Die gegenständliche Petition enthält
folgende Begründung:
“Das österreichische Bundesinstitut
für Gesundheitswesen hat im Zuge der Erstellung des österreichischen
Krankenanstaltenplans (ÖKAP) die Akutversorgung im Krankenhaus Waiern in
Frage gestellt. Der ÖKAP soll im Einvernehmen mit den Bundesländern
erstellt werden, wobei die Fakten für die Erhaltung der Akutversorgung
sprechen. Das Diakoniewerk Waiern bringt für das Krankenhaus in besonderer
Weise ein:
– Die Standortgarantie
für den Bereich Innere Medizin ist mit den Planungen für den Ausbau
und Neuerrichtung einer Dialyse gegeben.
– Unter Annahme einer
optimalen Versorgung von sechs Betten auf 1 000 Einwohner würde
dies für Waiern eine Standardkrankenanstalt mit 200 Betten bedeuten.
– Wirtschaftliche
Führung; überdurchschnittliche Wirtschaftlichkeit der konfessionellen
Krankenhäuser.
– Waiern ist das einzige
evangelische Krankenhaus in Kärnten.
– Steigende Ambulanzzahlen,
vorwiegend Erstversorgung, auch Ambulanz für Physiotherapie, geringe
Transportkosten.
– Bedeutung des Krankenhauses
in der Basis-Akutversorgung, zunehmende Verkürzung der Belagsdauer und
Steigung der Belegung, Erreichbarkeit, Transportkosten, Besuche von
Angehörigen.
– Bezirk Feldkirchen
40 000 Einwohner, Größe und Entfernungen.
– Es ist der eindeutige
politische Wille aller im Landtag vertretenen Fraktionen, daß ,der
Standort des Krankenhauses des Evangelischen Diakoniewerkes Waiern
aufrechterhalten und diese Spitalseinrichtungen zu einer wirtschaftlich
sinnvollen Einheit im Sinne der Zusage des Landes ausgebaut wird‘.
(Beschluß des Kärntner Landtages, 16. Februar 1995)
– Das Krankenhaus wird
rationell und kostengünstigst mit einer guten Auslastung (1994: 83,5% bei
einer Verweildauer von 11,8 Tagen; 1995: 88,03% bei einer Verweildauer von
10,7 Tagen) geführt.”
In seiner Sitzung am
3. Juli 1996 hat der Ausschuß für Petitionen und
Bürgerinitiativen den Beschluß gefaßt, eine Stellungnahme des
Bundesministeriums für Gesundheit und Konsumentenschutz einzuholen.
Das Bundesministerium
für Gesundheit und Konsumentenschutz nahm zu der gegenständlichen
Petition wie folgt Stellung:
“Ein zentrales
Anliegen der Gesundheitsreform ist die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung
der österreichischen Bevölkerung durch leistungsfähige,
bedarfsgerechte und in ihrem Leistungsspektrum aufeinander abgestimmte
Krankenanstalten.
Ziel des
gesamtösterreichischen Krankenanstaltenplanes – dessen Entwurf vom
Österreichischen Bundesinstitut für Gesundheitswesen ausgearbeitet
wurde – ist es, sinnvolle Standorte für einzelne Fachrichtungen
festzulegen, sodaß die Infrastruktur sowohl in wirtschaftlicher als auch
in medizinischer Sicht optimal genutzt werden kann. Neben wirtschaftlichen und
medizinischen Aspekten soll eine möglichst gleichmäßige und
bestmöglich erreichbare Versorgung der österreichischen
Bevölkerung gewährleistet werden.
So ist es auch eine
Zielsetzung des ÖKAP, im Bereich der öffentlichen und der
privat-gemeinnützigen Krankenanstalten die Errichtung und Vorhaltung
isolierter Fachabteilungen in dislozierter Lage, so wie sie beispielsweise
derzeit im Krankenhaus Waiern (Fachrichtung innere Medizin) gegeben ist, zu
vermeiden.
Neue
Funktionsbestimmungen von und Strukturveränderungen in Krankenanstalten
sind notwendig, um diesen Zielvorstellungen gerecht werden zu können. In
den Verhandlungen mit Vertretern des Bundeslandes Kärnten wird sich die
Frau Bundesministerin für eine vernünftige Lösung einsetzen, die
eine optimale Versorgung der Bevölkerung sicherstellt und von allen
Beteiligten mitgetragen werden kann.”
Einstimmiger
Beschluß in der Sitzung des Ausschusses am
17. Oktober 1996:
Ersuchen um Zuweisung an
den Gesundheitsausschuß.
Die Petition wurde mit
dem Bericht des Gesundheitsausschusses 432 der Beilagen mit Regierungsvorlage
382 der Beilagen, Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über
die Reform des Gesundheitswesens und der Krankenanstaltenfinanzierung für
die Jahre 1997 bis 2000 miterledigt.
Gesundheitsausschuß
Petition Nr. 30
überreicht von der
Abgeordneten Maria Rauch-Kallat betreffend “Der Gesetzgeber
soll handeln, bevor es zu spät ist!”
Von der “Aktion
Leben Österreich” wurde die folgende Unterschriftenaktion
durchgeführt und von Frau Grit Ebner als Bürgerinitiative
sowie von der Abgeordneten Maria Rauch-Kallat als Petition
Nr. 30 eingebracht:
“Bevor es zu
spät ist
Mensch mit Würde
oder Mensch als biologischer Rohstoff?
Sollen Kinder ins
Leben gerufen werden, um Ersatzteillager für andere zu sein?
Die Fortschritte der
Biomedizin lassen Entwicklungen wirklich werden, die noch vor kurzem nur in
utopischen Romanen und Filmen vorkamen:
– Menschen werden wie eine
Ware auf Vorrat hergestellt.
– Menschen werden als
Embryonen tiefgefroren, später zu Föten weitergezüchtet –
als bloßes Ersatzteillager.
– Menschen werden geklont (=
kopiert), vervielfältigt, nach Bedarf produziert.
– Menschen werden getestet,
verwertet, ausgeschlachtet.
– Föten und Embryonen
werden wie Abfall wiederverwertet.
Es stehen dramatische
Entwicklungen bevor, die jeden Menschen in seinem innersten Wesen betreffen!
Menschen werden der Willkür anderer total ausgeliefert: nicht nur, wenn
sie krank, alt, behindert oder hilfsbedürftig werden, sondern auch bei
ihrer Entstehung, als Ungeborene, als Frau und Mann.
Föten und Embryonen
werden als ,idealer biologischer Rohstoff‘ angesehen, nach dem eine rapid
wachsende Nachfrage besteht. Sie eignen sich für Transplantationen, als
Gewebeersatz, ja sogar zur Herstellung von Embryonen für einen
künftigen Bedarf!
Die Frau verstanden
als Lieferantin des Rohstoffes Mensch?
Klonen ermöglicht
die Herstellung völlig identischer Lebewesen. Die Vermischung der Gene von
Vater und Mutter nach dem Zufallsprinzip wird umgangen. Individualität und
Weiterentwicklung gehen verloren. Männer werden für die Fortpflanzung
überflüssig. Was mit dem Schaf ,Dolly‘ gelang, geht prinzipiell
auch beim Menschen. Von einem Menschen können gleich mehrere hergestellt
werden, als ,Arbeitstiere‘, Supersportler oder als Ersatzteillager
für andere und sich selbst. Wie verhält es sich dann noch mit
meiner Einmaligkeit und meiner Würde? Wer bin ich dann wirklich noch?
All diesen
Entwicklungen muß sofort Einhalt geboten werden! Wir fordern daher:
– Ein klares Verbot jeder
entgeltlichen wie unentgeltlichen Verwertung eines lebenden oder toten Embryos
oder Fötus, auch von seinen Teilen.
– Ein klares Verbot des
Eingriffs in die menschliche Keimbahn (Genmanipulation).
– Ein klares Verbot der
Erzeugung von Embryonen durch Klonung.
Wir richten diesen
Appell an alle Politikerinnen und Politiker Österreichs. Handeln ist
dringend geboten, bevor unverantwortliche Forschung und Profitgier vollendete
Tatsachen schaffen.
Begründung der
Forderungen
1. Die
Entwicklung rund um die sogenannte Biomedizin-Konvention des Europarates und
die Diskussionen im Rahmen des Symposiums des Europarates über Embryonen
vom Dezember 1996 ) haben gezeigt, daß auf europäischer Ebene derzeit kein
wirksamer Schutz gegen Forschung und Verwertung von Embryonen oder Föten
bzw. von ihren Teilen erzielbar ist. Gleichzeitig geht die Entwicklung der
Forschung rasant voran, wie die erfolgreiche Klonung eines Schafes in
Großbritannien, die Leihmutterschaft einer Großmutter in
Italien oder die Schaffung eines transgenen Schweines )
ebenfalls in Großbritannien beweisen. Erfolgreiche Versuche an Tieren
werden auf Menschen übertragen, wenn dem nicht durch Gesetze Einhalt
geboten wird. Jede anderslautende Behauptung hat sich bislang als Beschwichtung
oder Fehlbeurteilung erwiesen, denn die Methoden der künstlichen
Befruchtung oder der in-vitro-Fertilisation, die heute selbstverständlich
bei Menschen angewandt werden, wurden zunächst auch nur an Nutztieren
erprobt.
2. Unbestritten
kann national wie international derzeit der Bedarf an Organen für
Transplantationszwecke trotz großzügiger Regelung der
Organentnahme nicht befriedigt werden, was bereits zu kriminellen Praktiken wie
Organhandel, Tötung oder Ausschlachtung von Straßenkindern,
gewaltsame Organentnahme an Lebenden oder Organspenden aus Notlage geführt
hat. Neben der Übertragung von Genen auf Tiere und deren Nutzung bieten
sich vor allem menschliche Föten als Organquelle an. Die Vorteile
gegenüber Tieren oder auch fremden menschlichen Organspenden Geborener
sind gute Verträglichkeit (geringere Immunabwehr), rasches Wachstum, kaum
Gewebeschäden.
3. Im Fall eines
Schwangerschaftsabbruchs hat im Regelfall niemand Interesse, was mit dem
Fötus passiert. Der große Bedarf infolge Überalterung der
Bevölkerung, umweltbedingte Krankheiten, ungesunden Lebenswandel
läßt aber erwarten, daß aus dem Schwangerschaftsabbruch ein
Fötenverwertungsgeschäft wird, ja daß Kinder gezeugt werden, um
sie für Transplantationszwecke zu verwenden. Die Frau wird zur
Organlieferantin degradiert, möglicherweise auf Grund einer Notlage dazu
gezwungen.
4. Eine weitere
Möglichkeit zur Beschaffung von Organen bzw. menschlichem Gewebe ist die
Erzeugung von Embryonen durch Klonung. Zu einem Fötus oder gar zur
Geburtsreife herangezüchtet, ließen sich dessen Organe verpflanzen.
Damit wäre die Möglichkeit gegeben, sich selbst ein
Organersatzteillager aufzubauen, wobei der Embryo tiefgefroren aufbewahrt
würde und bei Bedarf in eine Leihmutter (vielleicht später auch in
Tiere) implantiert werden könnte, um zur erforderlichen Größe
gewachsen, nach Bedarf verwertet zu werden.
5. Die
gegenwärtigen österreichischen Vorschriften sind unzureichend:
a) Das
Fortpflanzungsmedizingesetz (FMedG), BGBl. Nr. 275/1992, erfaßt
nicht den Bereich der Erzeugung von Embryonen durch Klonung uä., sondern
stellt ausschließlich auf die Erzeugung durch Verschmelzung von Samen-
und Eizelle ab ). Die Herstellung von Embryonen ohne Verschmelzung von Ei- und
Samenzellen für Forschungszwecke ist durch das FMedG nicht erfaßt
und daher zulässig! Dies gilt sowohl für Geborene als auch für
Ungeborene oder Verstorbene ).
b) Durch
das Fortpflanzungsmedizingesetz werden indirekte Eingriffe in die Keimzellbahn
nicht erfaßt, wenn genetisch veränderte Zellen, die nicht Samen-
oder Eizellen sind, mit Samen- oder Eizellen verschmolzen werden ).
Dies wiegt umso schwerer, als das Gentechnikgesetz (GTG), BGBl.
Nr. 510/1994, bezüglich des Eingriffes in das Erbmaterial der
menschlichen Keimbahn (§ 64 GTG) auf § 9 Abs. 2 FMedG
verweist.
c) Was
mit abgestorbenen, abgetriebenen oder aus sonstigen Gründen anfallenden
Embryonen und Föten geschieht, ist teilweise in den Leichen- und
Bestattungsgesetzen der Länder geregelt bzw. sind diese als
Krankenhaussondermüll nach den Anstaltsordnungen zu entsorgen. Die abfallrechtlichen
Bestimmungen (Vermeidung, Wiederverwertung) zielen derzeit nicht auf
Fötal- und Embryonalgewebe. Dies wie auch ihre weitere Nichtunterstellung
unter die Organtransplantationsbestimmungen des Krankenanstaltengesetzes
ist durch ein Verbot abzusichern.
6. Das Verbot
der Verwertung von Embryonal- und Fötalgewebe muß deshalb strikt
gefordert werden, da ansonsten eine Verkommerzialisierung des
Schwangerschaftsabbruchs, eine Entwicklung zur Begünstigung des
Schwangerschaftsabbruchs wie ein vermehrter Druck auf Frauen, ihn
durchzuführen, unaufhaltsam erscheint. Nur ein Verbot erscheint auch
geeignet, die Ausnutzung des Körpers der Frau als Produktionsstätte
und des (lebenden) Menschen überhaupt als ausschlachtbares Ersatzteillager
für begehrte Gewebe zu verhindern.”
In seiner Sitzung am
26. November 1997 hat der Ausschuß beschlossen, je eine Stellungnahme
des Bundeskanzleramtes (Frauenangelegenheiten), des Bundesministeriums für
Arbeit, Gesundheit und Soziales, des Bundesministeriums für Wissenschaft
und Verkehr und des Bundesministeriums für Unterricht und kulturelle
Angelegenheiten einzuholen.
Das Bundeskanzleramt,
Sektion VI, hat zur angeführten Petition wie folgt Stellung genommen:
“Die Forderungen
der Unterschriftenaktion der ,Aktion Leben Österreich‘ nach einem
Verbot jeder entgeltlichen wie unentgeltlichen Verwertung eines lebenden oder
toten Embryos oder Fötus, einem Verbot des Eingriffs in die menschliche
Keimbahn und dem Verbot der Erzeugung von Embryonen durch Klonung sind aus
Sicht des für Gentechnik zuständigen Ressorts zur Kenntnis zu nehmen.
Es darf darauf
hingewiesen werden, daß in Österreich bereits derzeit auf Grund der
geltenden Rechtslage, nämlich auf Grund des § 64
Gentechnikgesetz, BGBl. Nr. 510/1994, und § 9 Abs. 2
Fortpflanzungsmedizingesetz, BGBl. Nr. 275/1992, jeglicher Eingriff
in die menschliche Keimbahn verboten ist.
Die in der Petition
angesprochene Problematik hängt eng zusammen mit Fragen der Bioethik, wie
sie insbesondere auch im Rahmen der Bioethikkonvention des Europarats geregelt
werden. Die Konvention enthält auch die Aufforderung an die
Mitgliedstaaten, ethische Grundsatzfragen der Biologie und Medizin
öffentlich zu diskutieren und entsprechende Konsultationen zu pflegen.
Dieser Bereich geht naturgemäß über die Gentechnik weit hinaus.
In diesem Zusammenhang
darf auf die diesbezüglichen Zuständigkeiten des Bundesministeriums
für Justiz bzw. des Bundesministeriums für Arbeit, Gesundheit und
Soziales und des Bundesministeriums für Wissenschaft und Verkehr verwiesen
werden.”
Der Bundesminister
für Wissenschaft und Verkehr Dr. Caspar Einem richtete an den
Präsidenten des Nationalrates zu dem als Petition überreichten
Anliegen der Unterschriftenaktion “Aktion Leben Österreich –
Der Gesetzgeber soll handeln, bevor es zu spät ist – Mensch mit
Würde oder Mensch als biologischer Rohstoff?” ein Schreiben mit
folgendem Inhalt:
“Zunächst ist
festzustellen, daß in der österreichischen Rechtsordnung ein
Verbot des Klonens im Bezug auf den Menschen besteht, weil generell
entwicklungsfähige Zellen nicht für andere Zwecke als für
medizinisch unterstützte Fortpflanzung verwendet werden dürfen. Eingriffe
in die Keimzellbahn sind unzulässig (Gentechnikgesetz,
Fortpflanzungsmedizingesetz). Auf die konkreten diesbezüglichen
Bestimmungen gehe ich bei den konkreten Forderungen der vorliegenden Petition
näher ein.
Im Zusammenhang mit der
Frage der Unterzeichnung des Europarats-Übereinkommens über Menschenrechte
und Biomedizin wird wegen der vor allem gegebenen Zuständigkeit des
Bundesministeriums für Justiz vorgeschlagen, auch eine Stellungnahme
des Bundesministers für Justiz einzuholen.
Österreich tritt
für einen größtmöglichen Schutz der Rechte des Menschen
und für die beste Wahrung der menschlichen Würde in Bereichen ein, in
denen der Mensch Forschung und Medizin gegenübersteht. Das
österreichische Recht sieht aber in vielen Punkten einen weit über
die Konvention des Europarates über Menschenrechte und Biomedizin
hinausreichenden Schutz vor. Die Europaratskonvention definiert nur einen
Mindeststandard, sodaß die Österreichische Bundesregierung das
Übereinkommen für Menschenrechte und Biomedizin zwar für
durchaus geeignet hält, das Verständnis für menschenrechtliche
Schutzstandards und das Erfordernis des Schutzes der Menschenwürde und der
menschlichen Identität im Bereich der Biomedizin und Biologie in allen
Mitgliedstaaten des Europarates zu fördern, aber es als unbefriedigend
empfinden muß, daß der in diesem Übereinkommen vorgesehene
Mindestschutzstandard hinter dem im nationalen österreichischen Recht
vorgesehenen Schutzstandard in vielen Punkten zurückbleibt.
Österreich hat daher
das genannte Übereinkommen am 4. April 1997 noch nicht unterzeichnet
und schon am 19. November 1996 die bestehenden Vorbehalte gegen das
Übereinkommen in einer Erklärung ausgesprochen. Für eine
Unterzeichnung des Übereinkommens über Menschenrechte und Biomedizin
und in weiterer Folge für eine Ratifizierung sieht die
Österreichische Bundesregierung derzeit keinen dringenden Handlungsbedarf,
solange es nicht gelingt, in Zusatzprotokollen doch deutlich höhere
Schutzstandards zu erzielen.
Ein wesentlicher Schritt
in diese Richtung ist das vom Europarat am 12. Jänner 1998 in Paris
angenommene und zur Unterzeichnung aufgelegte Zusatzprotokoll über ein
uneingeschränktes Verbot des Klonierens von Menschen.
Solange Österreich
das Menschenrechtsübereinkommen zur Biomedizin noch nicht unterzeichnet
hat, kann es allerdings auch das Zusatzprotokoll über das
Klonierungsverbot an Menschen nicht unterzeichnen.
Schließlich wurde
im Rahmen der 29. UNESCO-Generalkonferenz am 11. November 1997 die
vom UNESCO’s International Bioethics Committee (IBC) vorgelegte
,Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights‘ (Deklaration
über das menschliche Genom) angenommen. Dabei wurde für
Österreich (BMaA) eine interministeriell (BKA, BMWV und BMJ) erarbeitete
Erklärung abgegeben, die eine Reihe von sehr deutlichen die
Grundprinzipien der UNESCO-Deklaration spezifizierenden Aussagen enthält.
Vor allem müsse die Deklaration als Beginn eines großen intensiven
Diskussionsprozesses für ethische Grundsatzregelungen in Übereinstimmung
auch mit der Bioethikkonvention (Übereinkommen über Menschenrechte
und Biomedizin) des Europarates, nicht aber als ein final point verstanden
werden. Zu Art. 2 und 6 der UNESCO-Deklaration wurde auf Art. 11
des Europaratsdokumentes verwiesen, das nicht erst bei einer Verletzung
der Menschenrechte Genmanipulationen verbietet, sondern dies grundsätzlich
und wesentlich umfassender festhält. Zu Art. 5 der
UNESCO-Deklaration wurde betont, daß eine Intervention in die Keimbahn
ohne Bindung an zwingende ethische Kriterien abzulehnen ist. Zu Art. 11
wurde als österreichischer Vorbehalt angemeldet, daß jegliches
Klonen untersagt sein sollte. Im Zusammenhang mit Art. 23 der
UNESCO-Deklaration über das menschliche Genom wurde auf eine
Förderung einer kontinuierlichen öffentlichen Debatte verwiesen.
Es ist festzuhalten,
daß mit dieser Deklaration nunmehr eine Erklärung zu
Grundsatzprinzipien vorliegt, deren Fundament der Schutz der Menschenwürde
und des Genoms als Erbe der Menschheit ist.
Schon bisher war für
ethische Fragestellungen in der Biotechnologie von der EU-Kommission eine
Beratergruppe (Group of Advisers on the Ethical Implications of Biotechnology,
GAEIB) eingesetzt, welche kürzlich mit einem neuen (erweiterten) Mandat
für Fragen der Ethik, Wissenschaft und neuer Technologien ausgestattet und
personell erweitert wurde. Die Sachverständigengruppe für Ethik in
der Biotechnologie, das Europaparlament und der Europäische Rat haben das
Klonieren von Menschen eindeutig verurteilt.
Schließlich wurde
anläßlich der Auflage des Zusatzprotokolls des Europarates zur
Bioethik-Konvention über das Verbot des Klonens von Menschen eine
,European Conference of National Ethics Committees‘ eröffnet, welche
sich mit den ethischen Aspekten auseinandersetzen wird.
– Ein
klares Verbot jeder entgeltlichen wie unentgeltlichen Verwertung eines lebenden
oder toten Embryos oder Fötus, auch von seinen Teilen.
Österreich hat dem
geänderten Kommissionsvorschlag für eine Richtlinie des
europäischen Parlaments und des Rates über den rechtlichen Schutz
biotechnologischer Erfindungen (gemeinsamer Standpunkt) entsprechend dem
Beschluß des Hauptausschusses des Nationalrates am 18. November 1997
im EU-Rat auf Grund einer einschränkenden Protokolländerung zu Art. 16
am 20. November 1997 zugestimmt.
Der vorliegende
Richtlinienvorschlag bringt in vielen Bereichen Klarstellungen aber auch
Einschränkungen der gegenwärtig gegebenen patentrechtlichen
Möglichkeiten auf dem Gebiet der Biotechnologie und ist von einer
deutlichen Bemühung um eine Lösung für Forschungs- und
Verwertungstätigkeiten unter Bedachtnahme auf die ethischen Probleme
gekennzeichnet.
Der menschliche
Körper in den verschiedenen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung und
die einfache Entdeckung eines seiner Elemente, einschließlich die
Sequenzierung oder Teilsequenzierung eines Gens, kann nicht patentierfähig
sein. Der Entwuf der Richtlinie folgt auch der Erwägung, daß der
Schutz des Menschen und die Achtung der Würde und Unversehrtheit des Menschen
unveräußerliche Grundprinzipien darstellen und das Klonen bzw. die
Änderung der genetischen Keimlinienidentität von Menschen auch
eindeutig verurteilt wird (GAEIB, Europäischer Rat, Europarat).
Der Richtlinienvorschlag
wird nach der Behandlung im Rat dem Gesetzgebungsverfahren im EU-Parlament
weiter unterzogen werden. Mit der Richtlinie über den Schutz
biotechnologischer Erfindungen wird einerseits eine größere
Rechtssicherheit für Forschung und Wirtschaft durch Harmonisierung der
patentrechtlichen Bestimmungen erreicht und werden andererseits die
unerläßlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die die
Biotechnologie und im besonderen die Gentechnologie benötigen.
Dazu wird auch auf die
Beratungen in der Sitzung des Ausschusses zur Behandlung des
Gentechnik-Volksbegehrens am 24. Oktober 1997 hingewiesen und
vorgeschlagen, auch eine Stellungnahme des zuständigen Bundesministers
für wirtschaftliche Angelegenheiten einzuholen.
Auch wurden in
Übereinstimmung mit der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und der
Menschenwürde im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin
(Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin) auch in der
UNESCO-Deklaration zum Schutz des menschlichen Genoms die Schutzbestimmungen
verstärkt und die Zulässigkeit von Forschung, die das Genom nicht
zustimmungsfähiger Personen betrifft, stark eingeschränkt. Sie
muß unmittelbar der Gesundheit der betreffenden Person nützen.
Forschung, die der Gesundheit der betreffenden Person nicht unmittelbar
nützt (sog. ,Fremdnutzen‘), ist nur ausnahmsweise, mit äußerster
Zurückhaltung und nur dann zulässig, wenn die Person nur minimaler
Belastung oder minimalem Risiko ausgesetzt wird und diese Forschung intendiert,
zum gesundheitlichen Nutzen von Personen derselben Altersgruppe oder mit
demselben genetischen Leiden beizutragen.
Schließlich
enthält § 21 des österreichischen
Fortpflanzungsmedizingesetzes ein Vermittlungsverbot von
entwicklungsfähigen Zellen.
Gemäß
Art. 18 des Menschenrechtsübereinkommens des Europarates zur
Biomedizin ist die Erzeugung menschlicher Embryonen für Forschungszwecke
verboten. Österreich wird sich um einen effektiven Schutz von Embryonen im
Rahmen eines weiteren Zusatzprotokolls zur ER-Konvention bemühen.
Gemäß Art. 21 und 22 dürfen der menschliche Körper
und Teile davon nicht zur Erzielung eines finanziellen Gewinns verwendet
werden. Ähnliches statuiert Art. 4 der UNESCO-Deklaration über
den Schutz des menschlichen Genoms. Wenn auch die Europarats-Konvention bisher
von Österreich nicht unterzeichnet wurde, wendet die universitäre
Forschung diese ethischen Grundsätze doch schon an. Bei der
künstlichen In-vivo- und In-vitro-Befruchtung wird gemäß den
Bestimmungen des Fortpflanzungsmedizingesetzes, BGBl. Nr. 275/1992, und
den schon in der Entschließung des Europäischen Parlaments
Dok. A2-372/88 enthaltenen Grundsätzen vorgegangen. Für die
Vollziehung des Fortpflanzungsmedizingesetzes ist die Zuständigkeit des
Bundesministers für Justiz und der Bundesministerin für Arbeit,
Gesundheit und Soziales gegeben.
– Ein
klares Verbot des Eingriffs in die menschliche Keimbahn (Genmanipulation).
In Österreich
besteht ein klares und striktes Verbot von Eingriffen in die menschliche
Keimbahn (§ 64 im IV. Abschnitt des Gentechnikgesetzes, BGBl.
Nr. 510/1994, Genanalyse und Gentherapie am Menschen):
,Für Eingriffe in
die menschliche Keimbahn gilt das Verbot des § 9 Abs. 2
Fortpflanzungsmedizingesetz, BGBl. Nr. 275/1992.‘
§ 9 Abs. 2
des Fortpflanzungsmedizingesetzes, BGBl. Nr. 275/1992, lautet:
,Eingriffe in die Keimzellbahn sind
unzulässig.‘
– Ein
klares Verbot der Erzeugung von Embryonen durch Klonung.
Klonieren bzw. Klonen in
bezug auf den Menschen ist ethisch nicht mit den Prinzipien der Menschenwürde
vereinbar und durch die österreichische Gesetzgebung untersagt.
Weder Kerntransplantation
als Klonierungstechnik noch Embryonenteilung sind in Österreich in
Hinblick auf den Menschen zulässig. Entsprechend der Präambel der
vorliegenden Unterschriftenaktion der Aktion Leben Österreich ,Bevor es zu
spät ist, Mensch mit Würde oder Mensch als biologischer
Rohstoff?‘ wird in der vorliegenden Stellungnahme nur auf den Menschen
abzustellen sein.
Gemäß
§ 9 Abs. 2 Fortpflanzungsmedizingesetz, BGBl. Nr. 275/1992,
in Verbindung mit § 64 Gentechnikgesetz, BGBl.
Nr. 510/1994, besteht einerseits das Verbot des Eingriffs in das
Erbmaterial der menschlichen Keimbahn.
Andererseits geht jede
Klonierungstechnik eindeutig über die zur Herbeiführung einer
Schwangerschaft erforderliche Behandlung hinaus und ist daher auch aus
diesem Grunde untersagt (§ 9 Abs. 1 Fortpflanzungsmedizingesetz).
§ 9
Fortpflanzungsmedizingesetz:
,(1) Entwicklungsfähige Zellen dürfen
nicht für andere Zwecke als für medizinisch unterstützte
Fortpflanzungen verwendet werden. Sie dürfen nur insoweit untersucht und
behandelt werden, als dies nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft und
Erfahrung zur Herbeiführung einer Schwangerschaft erforderlich ist.
Gleiches gilt für Samen oder Eizellen, die für medizinisch
unterstützte Fortpflanzungen verwendet werden sollen.
(2) Eingriffe in die Keimzellbahn sind
unzulässig.‘
Methoden der medizinisch
unterstützten Fortpflanzung (das sind im Sinne des Fortpflanzungsmedizingesetzes
die Anwendung medizinischer Methoden zur Herbeiführung einer
Schwangerschaft auf andere Weise als durch Geschlechtsverkehr) sind im
§ 1 Abs. 2 des Fortpflanzungsmedizingesetzes beispielhaft
genannt. Das Klonen stellt keine Methode der medizinisch unterstützten
Fortpflanzung dar, weil sie keine zur Herbeiführung einer
Schwangerschaft erforderliche Behandlung im Sinne des Fortpflanzungsmedizingesetzes
ist.
Aus der Bestimmung des
§ 9 Fortpflanzungsmedizingesetz, daß entwicklungsfähige
Zellen nur insoweit untersucht und behandelt werden dürfen, als dies dem
Stand der medizinischen Wissenschaft und Erfahrung zur Herbeiführung einer
Schwangerschaft erforderlich ist, folgt, daß das Klonen von Menschen
nicht erlaubt ist.”
Das Bundesministerium
für Arbeit, Gesundheit und Soziales wies in seiner Stellungnahme zur
Petition Nr. 30 darauf hin, daß die führende Zuständigkeit
zur Beantwortung der gegenständlichen Petition dem Bundesministerium
für Justiz zukomme. Weiter wörtlich:
“Im gegebenen
Zusammenhang ist insbesondere auf das Fortpflanzungsmedizingesetz, BGBl.
Nr. 275/1992, aufmerksam zu machen, in dessen § 9 Regelungen zur
Verwendung, Untersuchung und Behandlung von Samen, Eizellen und
entwicklungsfähigen Zellen getroffen werden.
Nach § 9
Abs. 1 FMedG dürfen entwicklungsfähige Zellen nicht für
andere Zwecke als für medizinisch unterstützte Fortpflanzung
verwendet werden. Sie dürfen nur insoweit untersucht und behandelt werden,
als dies nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft und Erfahrung zur
Herbeiführung einer Schwangerschaft erforderlich ist. Gleiches gilt
für Samen und Eizellen, die für medzinisch unterstützte
Fortpflanzungen verwendet werden sollen.
Forschung an
entwicklungsfähigen Zellen ist ebenso wie die Verwendung zu anderen
Zwecken ausnahmslos verboten. Untersuchungen und Behandlungen, die die
neue Methode des ,nuclear transfer‘ erfordern würde, verstoßen
ebenso wie die im Vorfeld erforderlichen Forschungen gegen das umfassende
Forschungsverbot des FMedG.
Nach § 9
Abs. 2 FMedG sind Eingriffe in die Keimzellbahn unzulässig. Auch in
§ 64 Gentechnikgesetz wird auf das Verbot des § 9 FMedG
verwiesen.
Durch § 9 leg.
cit. sind auch die in der Petition angeführten ,indirekten Eingriffe in
die Keimzellbahn‘ durch Verschmelzung gentechnisch veränderter
somatischer Zellen mit Keimzellen erfaßt.
Im übrigen ist zu
den Forderungen der Petition auf zivilrechtliche Aspekte zu verweisen, wobei
für die umfassende Behandlung der Fragestellung auch landesgesetzlichen
Regelungen (Leichen- und Bestattungsgesetze der Länder) ebenso Relevanz
zukommt wie bundesgesetzlichen Normen, insbesondere hinsichtlich der Entsorgung
von Abfällen aus dem medizinischen Bereich.
Das Bundesministerium
für Arbeit, Gesundheit und Soziales betont abschließend, daß
der Schutz menschlichen Lebens – gerade vor dem Hintergrund leidvoller
historischer Erfahrungen – vordringlich sein muß und Forschungsfreiheit
und medizinischer Nutzen nur unter dem Aspekt der Würde und der Achtung
menschlichen Lebens gesehen werden können.”
Das Bundesministerium
für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten teilte unter Bezugnahme auf
die Petition Nr. 30 mit, daß ein Ressortbezug nicht gegeben sei und
sich eine Stellungnahme daher erübrige.
Einstimmiger Beschluß des Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen am
1. Juli 1998:
Ersuchen um Zuweisung an den
Gesundheitsausschuß.
Innenausschuß
Petition Nr. 8
überreicht von der Abgeordneten Mag. Terezija
Stoisits betreffend “Solidarität mit den Opfern des
österreichischen Asylgesetzes”
Die gegenständliche Petition betreffend
“Solidarität mit den Opfern des österreichischen
Asylgesetzes”, initiiert durch AusländerInnenberatungstelle der
Stadt Graz; Caritas; Verein ISOP; ÖIE; Verein ZEBRA sowie UTR, ruft zur
Solidarität mit den Opfern des österreichischen Asylgesetzes auf.
Dazu wird folgendes ausgeführt:
“Herr A. war Mitglied einer
Oppositionsbewegung in Ghana. Er wurde 1990 verhaftet und mehrere Tage lang
schwer gefoltert. Ende 1990 flüchtete er nach Österreich, wo er
politisches Asyl beantragte. Das Verfahren wurde 1993 negativ abgeschlossen,
die Behörden schenkten seinen Ausführungen keinen Glauben. Drei Jahre
lang hatte Herr A. versucht, eine Arbeit in Österreich zu finden. Obwohl
vier Firmen Herrn A. einstellen wollten und er über einen ordentlichen
Wohnsitz in Östereich verfügt, wurde für ihn nie eine
Beschäftigungsbewilligung vom Arbeitsamt erteilt. Mit dem Abschluß
des Asylverfahrens verlor Herr A. sein Aufenthaltsrecht in Österreich. Nun
droht ihm die Abschiebung in jenes Land, in dem er gefoltert wurde und die
schlimmsten Repressalien zu erwarten hat.
Herr A. ist einer von vielen Flüchtlingen,
die in Österreich Schutz vor Verfolgung suchten und nun Gefahr laufen, von
den österreichischen Behörden wieder den Verfolgern ausgeliefert zu
werden. Schon jetzt wehren sich österreichische MitbürgerInnen gegen
die Auswirkungen des unmenschlichen Fremdenrechts und gewähren
Flüchtlingen, die nicht mehr in ihre Heimatländer
zurückkönnen, Schutz und Unterkunft. Flüchtlinge, die sich in
Österreich keines Deliktes schuldig gemacht haben, werden in die
Illegalität abgedrängt und verlieren jegliche Basis einer
Existenzsicherung.
Die UnterzeichnerInnen rufen zur
Solidarität mit diesen ,doppelten‘ Opfern – Opfer von
staatlichem Terror im Heimatland und Opfer des österreichischen
Asylgesetzes – auf.
Die Hilfsaktionen für Bosnien signalisieren
uns, daß ein großer Teil der österreichischen BürgerInnen
sich gegen politische Gewalt und Verfolgung wendet und sich mit den Betroffenen
solidarisch erklärt. Deshalb appellieren wir an die BürgerInnen mit
politischer Zivilcourage, diesen Aufruf an die österreichische
Bundesregierung zu unterzeichnen und sich damit für die Einhaltung von
Menschenrechten auch in unserem Land einzusetzen.
Die UnterzeichnerInnen fordern von der
österreichischen Bundesregierung,
– denjenigen
Flüchtlingen, deren Fluchtgründe von den österreichischen
Behörden nicht anerkannt bzw. unter Berufung auf die Drittlandklausel
ignoriert worden sind und die dennoch nicht in ihre Heimatländer
zurückkehren können, ein Aufenthaltsrecht zu gewähren und damit
die Basis für ein menschenwürdiges Leben in Österreich zu
schaffen;
– Flüchtlingen bei der
Stellung eines Asylantrages auch ein vorläufiges Aufenthaltsrecht zu
gewähren und sie in Bundesbetreuung aufzunehmen;
– die inhaltliche
Überprüfung der Gründe für ein Rückschiebungsverbot
eines Flüchtlings durch ein unabhängiges RichterInnengremium und
nicht mehr wie bisher durch die Fremdenpolizei;
– eine Gesamtnovellierung des
österreichischen Fremdenrechts und dessen Vollzugspraxis im Sinne der
Menschenrechte, denn eine rein rhetorische Erfüllung von
Menschenrechtsstandards im Sinne politischer Lippenbekenntnisse
erschüttert die Idee der Menschenrechte auch in Österreich.”
Einstimmiger Beschluß in der Ausschußsitzung am 3. Juli 1996:
Ersuchen um Zuweisung an den Ausschuß
für innere Angelegenheiten.
Die Petition Nr. 8 wurde mit dem Bericht des
Ausschusses für innere Angelegenheiten 755 der Beilagen miterledigt.
Justizausschuß
Petition Nr. 11
überreicht von der Abgeordneten Hannelore Buder
betreffend “Abschaffung des § 188 des StGB”
Die gegenständliche Petition war in Form
einer Bürgerinitiative (Nr. 90 in der XVIII. GP) vom
Freidenkerbund Österreichs schon einmal eingebracht worden, ist aber durch
das Auslaufen der Legislaturperiode im Nationalrat sowohl 1994 als auch 1995
verfallen. Deshalb überrreichte die Abgeordnete Hannelore Buder
diese Initiative des Freidenkerbundes Österreichs in Form einer Petition
betreffend Abschaffung des § 188 StGB dem Präsidenten des
Nationalrates und fordert die ersatzlose Streichung dieses Paragraphen aus dem
Österreichischen Strafgesetzbuch mit folgender Begründung:
“Artikel 7 der
Bundesverfassung verbietet Vorrechte auf Grund des religiösen
Bekenntnisses. Trotz dieser eindeutigen Feststellung sind die
Religionsgemeinschaften in Österreich gegenüber den religionsfreien
Bürgern in finanzieller, aber auch in rechtlicher Hinsicht privilegiert.
So wurde der § 188 des Strafgesetzbuches (,Schutz vor
Herabwürdigung religiöser Lehren‘) in den letzten Jahren
regelmäßig vor allem gegen Kirchen- und Religionskritiker und
Kunstwerke (,Das Gespenst‘ von Herbert Achternbusch, ,Das Liebeskonzil‘
von Oskar Panizza, ,Tod und Teufel‘ von Peter Turrini, ,Habsburg
Recyclings Fröhliche X-Nacht‘ von Thomas Gratzer und Harald Posch
usw.) angewendet bzw. versucht anzuwenden. Dabei ist es immer wieder zu
Verboten und Verurteilungen gekommen.
Dieser an das Mittelalter
erinnernde Paragraph steht unserer Meinung nach im Widerspruch zu der in der
Verfassung garantierten Meinungs- und Kunstfreiheit. Keine anderen
Organisationen als die Kirchen genießen diesen Schutz.
Wir fordern daher die
ersatzlose Streichung des § 188 aus dem Österreichischen
Strafgesetzbuch!
Die Volkszählung
1991 und der § 188
Die Volkszählung
1991 hat ergeben, daß die traditionellen christlichen Kirchen Mitglieder
verloren haben, während etwa die Personen ohne Religionsangehörigkeit
sowie die, welche keine Angaben gemacht haben, zugenommen haben. Damit hat sich
dieser Trend, der schon in der Dekade von 1971 bis 1981 festgestellt worden
ist, weiter fortgesetzt.
Seit 1981 hat die
katholische Kirche in Österreich mehr als 5% ihrer Mitglieder verloren.
Dagegen ist die Zahl der Konfessionslosen in den letzten zehn Jahren um fast
die Hälfte auf 670 000 gestiegen (8,6% der Bevölkerung). Somit
liegen diese zahlenmäßig schon deutlich an zweiter Stelle, weit vor
der evangelischen Kirche (5%). Dazu kommen noch die 3,6% der Bevölkerung
(zirka 300 000), die keine Angaben über ihr Bekenntnis gegeben haben
und sich zu keiner Religionsgemeinschaft bekannt haben. Die Summe dieser beiden
Gruppen macht daher 12,2% aus, was ungefähr eine Million Menschen bedeutet.
Im Widerspruch zur
sinkenden Zahl der Kirchenmitglieder stehen die verschiedenen Privilegien der
Kirchen, angefangen vom Konkordat aus dem Jahr 1934, welches vom
austrofaschistischen Ständestaat mit einer ausländischen Macht
abgeschlossen wurde und zahlreiche Einflußmöglichkeiten dieser
ausländischen Macht auf österreichische Institutionen festlegt (zB
Ernennung der Bischöfe). Zugenommen haben auch die direkten und indirekten
Subventionen der Kirchen, ebenso auch deren Sendezeiten im öffentlich-rechtlichen
Rundfunk. Nach unseren schon vor Jahren angestellten Berechnungen beträgt
die Summe der Subventionen vom Bund heute etwa 7,2 Milliarden Schilling.
Davon sind zirka 500 Millionen auf Grund von Vermögensvertrags- und
Kirchengesetzen, 3 000 Millionen für Steuerprivilegien
(Absatzmöglichkeit des Kirchenbeitrags, Ausnahmeregelungen im
Grundsteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, Vermögensteuergesetz
usw.), 2 900 Millionen für die Bezahlung der Religionslehrer und
Erhaltung der Theologischen Fakultäten und 800 Millionen fiktiven
Werbetarif für die religiösen Sendungen im ORF. Dies bedeutet auch
die Nichteinhaltung der propagierten Trennung von Staat und Kirche, welche sich
auch immer wieder in der Einmischung von Kirchenvertretern in gesellschaftspolitischen
Fragen bemerkbar macht (Schul-, Erziehungs-, Frauenfragen usw.).
Den so mit diesen
Vorteilen ausgestatteten Religonsgemeinschaften werden auch eine Reihe von
rechtlichen Privilegien zugestanden. So besitzen rechtlich anerkannte
Religionsgemeinschaften durch den § 188 Schutz vor
Herabwürdigung ihrer religiösen Lehren. Diesen Schutz genießen
keine anderen Weltanschauungsgemeinschaften, seien es Parteien oder andere
Gruppierungen. Dieser Paragraph wird in regelmäßigen Abständen
anzuwenden versucht, um unbequeme Künstler und Kritiker zu kriminalisieren
und zum Schweigen zu bringen. Zuletzt wurde gegen die jungen Regisseure Thomas
Gratzer und Harald Posch nach Aufführung ihres letzten Theaterstückes
,Habsburg Recyclings Fröhliche X-Nacht‘ auf Grund von Anzeigen von
konservativer katholischer Seite ein Strafverfahren in Hinblick auf den
§ 188 eingeleitet. Inzwischen wurde gegen ein neues Stück der
beiden Kunstschaffenden, ,Neuevangelisierungstour 93‘, vom
katholischen Familienverband (Anzeige auch im oben genannten letzten Fall)
protestiert und die Absetzung nicht nur des Stückes, sondern auch der
zuständigen Person der Politik gefordert.
Die Einleitung des
erwähnten Strafverfahrens konnte leider nicht wie zuletzt im Fall gegen
den in der Öffentlichkeit bekannten Literaten Peter Turrini wegen dessen
Theaterstück ,Tod und Teufel‘ abgewendet werden. Der Freidenkerbund
Österreichs sieht daher den § 188 des Strafgesetzbuches im
Widerspruch zu der in der Verfassung garantierten Meinungs- und Kunstfreiheit.
Die Tatsache entspricht auch kaum mehr einem aufgeklärten demokratischen
Staat. Der Freidenkerbund als eine über 100 Jahre alte demokratische
Organisation protestiert daher gegen die Existenz dieses an das Mittelalter und
die Inquisition erinnernden Paragraphen und fordert seine ersatzlose
Streichung.
Es ist nicht einzusehen, warum ausgerechnet diese
Organsation diesen Schutz genießt, die in der Geschichte Millionen
Menschen verfolgt, gefoltert und umgebracht hat, oft nur wegen
geringfügigster Glaubensabweichungen, und allzu oft an der Seite
undemokratischer Regimes gestanden ist.”
Einstimmiger Beschluß in der Sitzung am 3. Juli 1996:
Ersuchen um Zuweisung an den Justizausschuß.
Justizausschuß
Petition Nr. 31
überreicht von den Abgeordneten zum
Nationalrat Brigitte Tegischer und Dr. Elisabeth Hlavac für eine
Novellierung des Adoptionsrechtes
“Die letzte Novelle zum
österreichischen Adoptionsrecht fand 1960 statt.
Inzwischen sind die UN-Deklaration aus 1986 zum
Kindeswohl mit besonderer Berücksichtigung von Pflegeverhältnis und
Adoption, die UN-Kinderrechtskonvention aus 1989 und die Haager Konvention von
1993 zum Schutz des Kindes bei Auslandsadoptionen beschlossen worden, deren
Grundgedanken ins österreichische Recht einfließen sollten.
Konkret ersuchen die Unterzeichner die Umsetzung
folgender Maßnahmen:
1. Dekretadoption
statt Vertragsadoption
Dies würde zu
schnelleren, unbürokratischeren Adoptionsverfahren führen.
2. Einführung
der Volladoption
Die jetzige Regelung
bewirkt keine vollständige familienrechtliche Loslösung von den
leiblichen Eltern, aber auch öffentliche Rechte werden Adoptivkindern im
Gegensatz zu leiblichen Kindern vorenthalten.
Unbestrittenermaßen
ist für das Kindeswohl primär die leibliche Familie verantwortlich.
Werden diese Pflichten
jedoch nicht wahrgenommen, ist die Adoption die nächstbeste Lösung im
Sinne dieses Kindeswohles, die dem Bedürfnis des Kindes nach stabilen
Beziehungen entspricht. Die Adoption ist daher auch unauflöslich. Im Sinne
der Rechtssicherheit des Adoptionsverhältnisses – sowohl für
die Wahleltern wie auch für das Wahlkind – sollten etwa unterhalts-
oder erbrechtliche Ansprüche der leiblichen Eltern hinkünftig nicht
mehr möglich sein.
3. ,Verlassenheitserklärung‘
Haben die Eltern trotz
mehrmaliger Aufforderung und schließlicher Verwarnung das Kind, das in
einem Kinderheim (oder einer anderen Fremdunterbringung) untergebracht ist,
für die Dauer eines Jahres nicht mehr besucht oder sonst kontaktiert, soll
das Gericht eine ,Verlassenheitserklärung‘ aussprechen können.
4. Haager
Konvention
Ratifizierung der
Haager Konvention (1993) zum Schutz des Kindes bei Auslandsadoptionen.”
In der Ausschußsitzung am 26. November
1997 wurde die Einholung je einer Stellungnahme des Bundesministeriums für
Justiz, des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie, des Bundeskanzleramtes
(Frauenangelegenheiten) und des Bundesministeriums für auswärtige
Angelegenheiten beschlossen.
Das Bundesministerium
für Justiz nahm zur gegenständlichen Petition wie folgt Stellung:
“I. Vorbemerkung
Das Bundesministerium für Justiz stellt
bereits seit längerer Zeit Überlegungen darüber an, das
österreichische Kindschaftsrecht, das zuletzt im Jahr 1989 einer
größeren Reform unterzogen wurde, erneut weiterreichend umzugestalten.
Die in diesem Kontext durch Jahre hindurch vorgenommene Stoffsammlung
ergab allerdings, daß konkrete Forderungen nach Änderungen auch im
Adoptionsrecht bis vor kurzem nicht erhoben wurden.
II. Zu den geforderten
Änderungen des Adoptionsrechts im einzelnen:
Zu 1. Dekretadoption statt Vertragsadoption:
Diese Forderung wird in der Petition damit
begründet, daß dies zu schnelleren, unbürokratischen
Adoptionsverfahren führen würde. Diese Begründung ist jedoch
nicht stichhältig. Mit der Ersetzung der Vertragsadoption durch die
Dekretadoption fiele lediglich der kaum formaufwendige Abschluß eines
Adoptionsvertrags weg, während der Umfang der vom Gericht im Verfahren zur
Bewilligung der Adoption zu ermittelnden und zu prüfenden Tatsachen, wie
etwa das Bestehen eines Eltern-Kind-Verhältnisses, die Wahrung des Wohles
des Kindes, der Altersunterschied oder die Statusverhältnisse des Kindes,
unverändert bliebe. Der Vorteil der Vertragsadoption liegt jedoch darin, daß
nach österreichischem Recht die Wirkungen der Adoption – im
Fall ihrer Bewilligung – mit dem Abschluß des Adoptionsvertrags
(§ 179a Abs. 1 zweiter Satz ABGB) und nicht erst wesentlich
später mit dem Eintritt der Rechtskraft des gerichtlichen Adoptionsdekrets
eintreten. Der Abschluß eines Adoptionsvertrags ist nach
österreichischem Recht der einfachen Schriftform vorbehalten. Der
Vertragsinhalt hat sich ausschließlich auf den Umstand der Annahme an
Kindes Statt – heute auch nicht mehr auf bestimmte namensrechtliche Folgen
– zu beziehen. Eine auch nur einigermaßen professionell
geführte Adoptionsvermittlungsstelle – wie etwa der
öffentliche Jugendwohlfahrtsträger oder die von diesem als freie
Träger zugelassenen Rechtsträger – sollte in der Lage sein, in
kürzester Zeit einen Adoptionsvertrag aufzusetzen.
Zu 2. Einführung
der Volladoption:
Zur Begründung dieser Forderung wird in der
Petition angeführt, daß die jetzige Regelung keine vollständige
familienrechtliche Loslösung von den leiblichen Eltern bewirke, aber auch
öffentliche Rechte Adoptivkindern im Gegensatz zu leiblichen Kindern
vorenthalten würden. Für das Kindeswohl sei unbestrittenermaßen
die leibliche Familie verantwortlich. Würden diese Pflichten jedoch nicht
wahrgenommen, sei die Adoption die nächstbeste Lösung im Sinn
des Kindeswohls, die dem Bedürfnis des Kindes nach stabilen Beziehungen
entspreche. Die Adoption sei daher auch unauflöslich. Im Sinn der
Rechtssicherheit des Adoptionsverhältnisses sollten unterhalts- und
erbrechtliche Ansprüche der leiblichen Eltern in Zukunft nicht mehr
möglich sein.
Hiezu ist zunächst auszuführen,
daß die Frage der Anknüpfung anderer Rechtsgebiete als des
Zivilrechts an die Adoption von der Frage einer Voll- oder Teiladoption
losgelöst zu betrachten ist. Wenn etwa das Staatsbürgerschaftsrecht
und auch das Aufenthaltsrecht an den bloßen familienrechtlichen Bestand
einer Adoption nicht sofort Rechtswirkungen knüpfen, so entspricht das
einer vom Justizressort bereits seit längerer Zeit befürworteten Art
und Weise der Bedachtnahme auf familienrechtliche Tatbestände. Es
erscheint vielfach nicht zweckmäßig, allein aus dem Bestehen eines
familienrechtlichen Rechtsverhältnisses ohne das Hinzutreten weiterer
Kriterien einen Anspruch auf staatliche Vorteile abzuleiten. An dieser
Überlegung würde auch ein Übergang zur Volladoption nichts
ändern.
Das geltende österreichische Adoptionsrecht
versucht den Ansprüchen der unterschiedlichen Altersgruppen von
Wahlkindern gerecht zu werden. Einerseits läßt es im Verhältnis
zu den Wahleltern und deren Nachkommen die gleichen Rechte wie zu leiblichen
Eltern entstehen, andererseits läßt es subsidiäre
Unterhaltsansprüche weiterhin zu und läßt auch die
erbrechtlichen Ansprüche des Wahlkindes gegenüber seinen leiblichen
Eltern unberührt (§§ 182 bis 182b). Darüber
hinausgehende familienrechtliche Bindungen zu den leiblichen Eltern im
persönlichen Bereich – wie etwa ein Besuchsrecht der leiblichen
Eltern – kennt das geltende Adoptionsrecht aber nicht. Eine Änderung
in Richtung Volladoption würde auf das in Österreich weiterhin
bestehende Bedürfnis an einer Adoption auch volljähriger Personen
(,Erwachsenenadoption‘) nur ungenügend Bedacht nehmen. Nach der
Statistik der Rechtspflege für das Jahr 1995 betrug der Anteil der
Volljährigen an Adoptionen immerhin 26%. Die Umstellung des herrschenden
österreichischen Systems auf eine Volladoption würde daher dem Wunsch
eines Teiles der an einer Adoption Interessierten nach einem Aufrechtbleiben
gewisser familien- und erbrechtlicher Beziehungen nicht entsprechen.
Im übrigen ist es
ein Irrtum in der Begründung der Petition, daß die Adoption
unauflöslich wäre. Das österreichische Recht kennt – etwa
bei bestimmten Fällen des Mißbrauchs dieses Rechtsinstituts sowie
bei groben Fehlern – den Widerruf, in anderen Fällen die Aufhebung
der Adoption. Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, daß
auch das deutsche Adoptionsrecht – ungeachtet der dort bestehenden
Volladoption – die Möglichkeit der Aufhebung der Adoption kennt
(§§ 1760, 1763 BGB).
Zu 3. Verlassenheitserklärung:
Als Begründung
für diese Forderung wird angeführt, daß das Gericht die
Möglichkeit haben soll, eine ,Verlassenheitserklärung‘
auszusprechen, wenn die Eltern trotz mehrmaliger Aufforderung und
schließlicher Verwarnung das in einem Kinderheim oder einer anderen Art
der Fremdunterbringung befindliche Kind für die Dauer eines Jahres nicht
mehr besucht oder sonst kontaktiert haben. Trotz dieser Begründung ist der
Sinn der Forderung unverständlich. Wenn es darum gehen sollte, eine
Verjährung der Elternrechte einzuführen, so scheint dies mit den
grundsätzlichen Wertungen des Familienrechts nur schwer vereinbar. Wenn es
aber darum gehen soll, Adoptionen zustande zu bringen, obwohl die leiblichen
Eltern ihre Zustimmung hiefür verweigern, ist auf § 181
Abs. 2 und 3 ABGB hinzuweisen, der bereits jetzt in angemessener Weise die
Möglichkeit vorsieht, daß Adoptionen trotz fehlender Zustimmung der
leiblichen Eltern zustande kommen.
Zu 4. Ratifizierung der Haager Konvention zum
Schutz des Kindes bei Auslandsadoptionen:
Die Ratifikation des Haager Übereinkommen vom
29. Mai 1993 über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der internationalen Adoption schien dem Justizressort bisher nicht
vordringlich, weil danach kein praktischer Bedarf bestand.
Was Adoptionen aus Rumänien betrifft, hat das
rumänische Adoptionskomitee den Verein Initiative Pflegefamilien
seinerzeit zwecks Vermittlung rumänischer Adoptivkinder nach
Österreich anerkannt. Als Folge einer Änderung des innerstaatlichen
rumänischen Adoptionsrechts durch die Anfang Juni 1997 erlassene
Dringlichkeitsverordnung der rumänischen Regierung hat das
Bundesministerium für Justiz vor kurzem die Arbeiten zur Vorbereitung der
Ratifikation des genannten Übereinkommens in Angriff genommen. Da einzelne
Bestimmungen des Übereinkommens einer näheren Ausführung durch
ein Durchführungsgesetz bedürfen und ein Gesetzentwurf dafür
zunächst mit den zur Vollziehung der Jugendwohlfahrt berufenen
Bundesländern besprochen und anschließend einem allgemeinen Begutachtungsverfahren
unterzogen werden muß, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden,
wann das Übereinkommen samt dem hiefür erforderlichen Entwurf eines
Durchführungsgesetzes dem Nationalrat zur Behandlung zugeleitet werden
kann.
III. Zusammenfassung
Zusammenfassend ergibt sich, daß derzeit nur
die Ratifikation des Haager Übereinkommens vom 29. Mai 1993 über
den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
internationalen Adoption sowie die Durchführung dieses Übereinkommens
durch ein Bundesgesetz erforderlich sind; darüber hinausgehende
Änderungen des Adoptionsrechts sind aus der Sicht des Bundesministeriums
für Justiz nicht erforderlich.”
Das Bundesministerium für Umelt, Jugend und
Familie bedauert in seiner Stellungnahme grundsätzlich, daß die Forderungen,
die kinder- und menschenrechtliche Fragen betreffen, in der Petition nicht
näher begründet bzw. die Begründungen nicht näher
ausgeführt sind.
“Zu Punkt 1: ,Dekretadoption‘
statt ,Vertragsadoption‘
a) Es ist nicht
ersichtlich, aus welchen Erwägungen die Einführung einer
,Dekretadoption‘ unbürokratischere Adoptionsverfahren bewirken
würde: Ausführungen darüber, bei welcher Behörde eine
solche ,Dekretadoption‘ angesiedelt sein würde, fehlen. Da auch im
Falle einer ,Dekretadoption‘ – auf Antrag anstelle des derzeitigen
bewilligungspflichtigen Adoptionsvertrags – eine Willenserklärung
der Eltern, und zwar deren Zustimmung, eingeholt werden müßte
(siehe unter Punkt 1/b und c), scheint eine Bürokratieersparnis auch
bei einer ,Dekretadoption‘ nicht gegeben.
Ferner ist in diesem
Zusammenhang darauf hinzuweisen, daß die notwendige behördliche
Sorgfalt in Adoptionsfällen in erster Linie dem Schutz des zu
adoptierenden Kindes dient.
b) Sollte im Sinne der Petition beabsichtigt
sein, in Adoptionsfällen generell auf eine Willenserklärung der
leiblichen Eltern, und zwar auf ihre Zustimmung zur Adoption des Kindes, zu
verzichten, um Adoptionsverfahren ,schneller und unbürokratischer‘
durchführen zu können, so bedeutete dies einen massiven und daher
bedenklichen Eingriff in die verfassungsgesetzlich gewährleisteten
Grund- und Menschenrechte: und zwar in das Recht, eine Familie zu
gründen (Art. 12 EMRK) sowie in das Recht auf Achtung des Privat- und
Familienlebens (Art. 8 EMRK).
c) Hingewiesen sei weiters darauf,
daß auch nach der jetzigen Rechtslage ein leiblicher Elternteil nicht
willkürlich durch die Verweigerung seiner Zustimmung die Adoption seines
Kindes verhindern kann, wenn dafür keine gerechtfertigten Gründe
bestehen: Gemäß § 181 Abs. 3 ABGB hat nämlich
das Gericht die – an sich notwendige – Zustimmung eines leiblichen
Elternteils zu ersetzen, wenn keine gerechtfertigten Gründe
für die Weigerung vorliegen.
d) Bereits nach der derzeitigen Rechtslage kommt
eine Adoption nicht allein durch das Handeln der abgebenden und annehmenden
Eltern (Adoptionsvertrag) zustande, denn sowohl für den Vorgang der
Vorbereitung einer Adoption wie auch für die Durchführung einer
solchen ist staatliches hoheitliches Handeln vorgesehen: Eine Adoption
darf, sofern es sich um minderjährige Wahlkinder handelt, nur durch den Jugendwohlfahrtsträger
(oder durch von diesem anerkannte freie Wohlfahrtsträger) vermittelt
werden, darüber hinaus bedarf der Adoptionsvertrag zu seiner Wirksamkeit
der Bewilligung des Gerichts. Beide Behörden sind bei ihren
Entscheidungen primär dem Kindeswohl verpflichtet (§ 24
Abs. 2 JWG, § 180a ABGB).
Zu Punkt 2 ,Einführung der
Volladoption‘
Aus dem Wortlaut der Petition läßt sich
nicht erkennen, welche ,öffentlichen Rechte‘ den Adoptivkindern im
Gegensatz zu den nichtadoptierten Kindern vorenthalten werden.
Zu den angesprochenen Fragen des Unterhalts-
bzw. Erbrechts der leiblichen Eltern gegenüber einem Adoptivkind
wird angemerkt, daß solche Problemlagen in der Realität kaum
vorkommen, was im folgenden nähert ausgeführt wird:
1. Sowohl allfällige unterhalts- als
auch erbrechtliche Ansprüche der leiblichen Eltern gegenüber dem
Adoptivkind sind von subsidiärer Natur, dh. sie kommen nur dann zum
Tragen, wenn es keine näheren unterhaltspflichtigen Angehörigen gibt
bzw. wenn die primär erbberechtigten Adoptiveltern und deren Nachkommen
weggefallen sind.
2. Unterhalts- bzw. erbrechtliche
Ansprüche der leiblichen Eltern kommen weiters nicht zum Zuge, wenn
diese ihre Unterhaltspflicht gegenüber ihrem unmündigen Kind
(§ 182 Abs. 2 ABGB, Unterhalt) bzw. ganz allgemein ihre
sonstigen aus dem Rechtsverhältnis zwischen Eltern und Kindern sich
ergebenden Pflichten gegenüber dem Erblasser (§ 540 ABGB,
Erbrecht) gröblich vernachlässigt haben.
3. Den – in der Realität kaum
vorkommenden – unterhalts- bzw. erbrechtlichen Ansprüchen der
leiblichen Eltern gegenüber dem Adoptivkind entsprechen umgekehrt
Ansprüche des Adoptivkindes gegenüber seinen leiblichen
Eltern: Soweit nämlich die Adoptiveltern – aus welchen
Gründen auch immer – zur Leistung des Unterhaltes des Adoptivkindes
nicht in der Lage sind, haben diese ihm Unterhalt zu gewähren
(subsidiärer Unterhaltsanspruch des Adoptivkindes); das Erbrecht
des Adoptivkindes gegenüber seinen leiblichen Verwandten bleibt sogar voll
bestehen. Zudem besteht noch ein subsidiärer Anspruch des Adoptivkindes
auf Ausstattung bzw. Heiratsgut.
Eine vollständige
familienrechtliche Loslösung, wie sie in der Petition gefordert
wird, würde zum Entfall all dieser Rechte des Adoptivkindes (nicht
nur der genannten Pflichten) führen; dies erscheint – gerade im
Hinblick auf die Rechte des Kindes im Sinne des 1989 verabschiedeten
,UN-Übereinkommens über die Rechte des Kindes‘ (KRK)
– problematisch.
Zu Punkt 3
,Verlassenheitserklärung‘
In der Petition wird nicht näher
ausgeführt, welche erwünschten Folgen eine solche ,Verlassenheitserklärung‘
nach sich ziehen sollte, wobei auch die bedenkliche psychologische
Wirkung, die es auf ein Kind haben kann, wenn es vom Gericht für
,verlassen‘ erklärt wird, in einer Gesamtbewertung
mitzuberücksichtigen ist.
Zu Punkt 4
,Ratifikation der Haager Konvention zum Schutz des Kindes bei
Auslandsadoptionen‘
Bezüglich der Ratifikation der Haager
Konvention zum Schutz des Kindes bei Auslandsadoptionen wird auf die
Zuständigkeit des Bundesministeriums für Justiz verwiesen.”
Seitens der Sektion VII im Bundeskanzleramt
erging nachstehende Stellungnahme:
“ad 1.
Dekretadoption statt Vertragsadoption:
Das österreichische Adoptionsrecht sieht vor,
daß die Annahme an Kindes Statt durch schriftlichen Vertrag zwischen dem
Annehmenden und dem Wahlkind und durch gerichtliche Bewilligung auf Antrag
eines Vertragsteiles zustande kommt.
Es handelt sich dabei um einen schriftlichen
Formalvertrag, dessen Inhalt vom Gesetz zwingend vorgegeben ist. Die vertragliche
Vereinbarung erfaßt nur das ,ob‘, nicht jedoch das ,wie‘,
weil die Wirkungen der Adoption nicht modifiziert werden können.
Bei der Bewilligung einer Adoption ist das Gericht
insbesondere an die in § 180a ABGB festgelegten Voraussetzungen und
die Wahrung der in §§ 181 und 181a ABGB vorgesehenen
Zustimmungs- und Anhörungsrechte gebunden.
Bei der in der Petition geforderten Dekretadoption
entscheidet die zuständige Behörde über die Adoption.
Die Unterzeichnerinnen der Petition führen
dazu aus, daß dies zu schnelleren, unbürokratischeren
Adoptionsverfahren führen würde.
Eine Beschleunigung der Adoptionsverfahren ist
jedoch durch Einführung einer Dekretadoption nicht zu erwarten.
Da eine Adoption in erster Linie dem Kindeswohl
des Wahlkindes zu dienen hat, sind zu dessen Sicherstellung Erhebungen
über das Umfeld, die konkreten Lebensumstände, die wirtschaftlichen
Verhältnisse und die persönliche Eignung der Wahleltern unabdingbar.
Ermittlungen und Erhebungen wären daher zur Sicherstellung des Kindeswohls
auch im Falle der Dekretadoption durchzuführen.
Weiters wären die gesetzlich vorgesehenen
Zustimmungsrechte, insbesondere der leiblichen Eltern, und die gesetzlich
vorgesehenen Anhörungsrechte, insbesondere des Jugendamtes bei der
Adoption minderjähriger Kinder, auch bei der Dekretadoption zu
wahren.
Dem Interesse der Wahleltern nach einer
möglichst raschen Durchführung des Adoptionsverfahrens kann daher
durch die Forderung nach Einführung der Dekretadoption nicht Rechnung
getragen werden.
ad 2. Einführung
der Volladoption:
Die Rechtssicherheit des
Adoptionsverhältnisses steht entgegen dem diesbezüglichen Wortlaut
der Petition in keinem Zusammenhang mit den unterhalts- oder erbrechtlichen
Ansprüchen der leiblichen Eltern.
Hinsichtlich der in der Petition gestellten
Forderung nach Abschaffung dieser Ansprüche der leiblichen Eltern wird
festgehalten, daß diesen Ansprüchen entsprechende Rechte des Kindes
gegenüberstehen.
Gemäß § 182a ABGB haben
nämlich die leiblichen Eltern und deren Verwandte weiterhin für den
Unterhalt, das Heiratsgut und die Ausstattung des Kindes aufzukommen, wenn die
Adoptiveltern dazu nicht in der Lage sind. Gemäß § 182b
ABGB bleibt auch das Erbrecht des adoptierten Kindes gegenüber den
leiblichen Eltern und deren Verwandten aufrecht. Das Wahlkind hat also sowohl
das Erbrecht gegenüber seinen Wahleltern als auch gegenüber
seinen leiblichen Verwandten.
Eine vollständige rechtliche Lösung der
Beziehungen des Wahlkindes zu seinen leiblichen Eltern hätte auch das
Erlöschen der Ansprüche des Kindes zur Folge. Ein Wegfall der
Ansprüche des Wahlkindes gegenüber den leiblichen Eltern wird jedoch
als Verschlechterung der Rechtsposition des Kindes nicht befürwortet.
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen,
daß durch die Adoption nur zwischen dem Annehmenden und dessen Nachkommen
einerseits und dem Wahlkind und dessen im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Annahme minderjährigen Nachkommen andererseits die gleichen Rechte, wie
sie durch eheliche Abstammung begründet werden, entstehen. Zwischen dem
Wahlkind und den übrigen Verwandten der Wahleltern existiert keine
Rechtsbeziehung, somit auch kein gesetzliches Erbrecht.
Was die erbrechtlichen Ansprüche der
leiblichen Eltern gegenüber dem Kind anlangt, ist festzuhalten, daß
im Konkurrenzfall die Adoptiveltern den leiblichen Eltern im Range vorgehen,
sodaß die leiblichen Eltern neben den Wahleltern nicht zum Zug kommen
können.
Hinsichtlich des Anspruchs der leiblichen Eltern
auf Unterhalt gegenüber dem Kind ist festzuhalten, daß dieser
gemäß § 182a Abs. 2 ABGB nur dann besteht, wenn diese
ihre Unterhaltspflicht gegenüber dem noch nicht 14 Jahre alten Kinde vor
dessen Adoption nicht gröblich vernachlässigt haben. Gemäß
Abs. 3 dieser Gesetzesstelle steht auch dieser Anspruch der leiblichen
Eltern dem der Wahleltern im Range nach.
ad 3.
,Verlassenheitserklärung‘:
Da der konkrete Inhalt und die rechtlichen
Konsequenzen einer solchen ,Verlassenheitserklärung‘ aus der
Petition nicht hervorgehen, wird von einer Stellungnahme abgesehen.
Es wird jedoch ausdrücklich auf die in
Art. 8 und Art. 12 MRK verankerten Menschenrechte hingewiesen, wonach
jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens bzw. das
Recht, mit Erreichen des heiratsfähigen Alters gemäß den einschlägigen
nationalen Gesetzen eine Ehe einzugehen und eine Familie zu gründen, hat.
ad 4. Ratifizierung
der Haager Konvention zum Schutz des Kindes bei Auslandsadoptionen:
Gegen die in der Haager
Konvention über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem
Gebiet der internationalen Adoption verankerten Ziele, Grundsätze und
Bestimmungen bestehen aus frauenpolitischer Sicht keine Bedenken.”
Das Bundesministerium
für auswärtige Angelegenheiten nahm wie folgt Stellung:
“Die Petition
Nr. 31 betreffend eine Novellierung des Adoptionsrechts berührt keine
Materien, die vom Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten
federführend wahrzunehmen wären, so daß eine substantielle
Stellungnahme seitens des ho. Ressorts nicht erfolgt.
Das Bundesministerium
für auswärtige Angelegenheiten befürwortet jedoch eine rasche
Ratifikation der Haager Konvention (1993) zum Schutz des Kindes bei
Auslandsadoptionen.”
Einstimmiger
Beschluß des Ausschusses für Petitionen und
Bürgerinitiativen am 1. Juli 1998:
Ersuchen um Zuweisung an
den Justizausschuß.
Justizauschuß
Petition Nr. 48
überreicht von den
Abgeordneten Mag. Terezija Stoisits, Dr. Volker Kier und Dr.
Irmtraut Karlsson betreffend “3 Forderungen zur rechtlichen
Verankerung von PartnerInnenschaften”
Durch die Abgeordneten
Mag. Terezija Stoisits, Dr. Volker Kier und Dr. Irmtraut Karlsson
wurde folgendes Anliegen des Österreichischen Lesben- und Schwulenforums
dem Präsidenten als Petition überreicht:
“3 Forderungen zur rechtlichen
Verankerung von PartnerInnenschaften
1. Eingetragene PartnerInnenschaften für
homosexuelle und heterosexuelle PartnerInnen
– Gemeinsamer Kauf von
Eigentumswohnungen,
– Aufenthaltsrecht für
ausländische PartnerInnen,
– Erbrecht,
– Auskunftsrecht und
Besuchsrecht im Krankenhaus (Intensivstation).
Im österreichischen
Recht fehlt eine Grundlage für gleichberechtigte, moderne Lebensformen.
Diese ist neu zu schaffen. Sie soll offen sein für alle PartnerInnen,
unabhängig von ihrem Geschlecht.
Wir wollen keine Kopie der Ehe, sondern die
rechtliche Verankerung einer PartnerInnenschaft, die sich an den realen
Bedürfnissen moderner Beziehungen orientiert. Diese PartnerInnenschaft
bedeutet nicht lebenslange Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft. Sie resultiert
aus dem Willen, für die Dauer einer eingetragenen PartnerInnenschaft füreinander
Verantwortung zu übernehmen.
2. Gleichstellung homosexueller mit
heterosexuellen Lebensgemeinschaften
– Gemeinsame
versicherungsrechtliche Absicherung,
– Zeugnisentschlagungsrecht im
strafgerichtlichen Verfahren und
– Eintrittsrecht in
Mietverträge auch für homosexuelle
Lebensgefährten/Lebensgefährtinnen.
Das österreichische
Recht definiert die Lebensgemeinschaft als das in wirtschaftlicher Hinsicht
eheähnliche Zusammenleben zweier Personen in einer Wohnung. Trotz
dieser neutralen Formulierung hat der Oberste Gerichtshof 1996 entschieden,
daß damit nur heterosexuelle Lebensgefährten/Lebensgefährtinnen
gemeint sind. Es ist rechtlich klarzustellen, daß auch Lesben und Schwule
ihre Rechte als Lebensgefährten/Lebensgefährtinnen erhalten.
3. Gleichheit aller Bürgerinnen und
Bürger vor dem Gesetz erfordert:
– Schutz vor Diskriminierung
auf Grund sexueller Orientierung und sexueller Identität in der Verfassung.
Zur Umsetzung diese
Katalogs fordern wir die Einsetzung einer Kommission, in die auch die
Betroffenen einzubeziehen sind.”
Einstimmiger
Beschluß in der Sitzung am 1. Juli 1998:
Ersuchen um Zuweisung an
den Justizausschuß.
Landesverteidigungsauschuß
Petition Nr. 15
überreicht vom
Abgeordneten Herbert Scheibner betreffend “Vorrang für
Österreichs Sicherheit durch eine österreichische Sicherheitsdoktrin
und die Anpassung des Landesverteidigungsplanes 85 (LVP 85)”
Durch den Abgeordneten
Herbert Scheibner wurde folgende Initiative des Österreichischen
Kameradschaftsbundes (Landesverband für Oberösterreich) als Petition
unter dem Titel “Vorrang für Österreichs Sicherheit durch eine
österreichische Sicherheitsdoktrin und die Anpassung des
Landesverteidigungsplanes 85 (LVP 85)” eingebracht:
“Trotz Zustimmung
aus dem Bereich der für Wehr- und Verteidigungsbereitschaft einstehenden
politischen Mandatare der drei staatstragenden Parteien im Jahre 1995 erfolgten
auch im Jahr der RK 96 keine konkreten Aussagen über eine
Neuanpassung des LVP 85. Stattdessen wird aus ,Kostengründen‘
an dringendst notwendigen Nachrüstungsschritten medial herumdiskutiert und
ideologie Standpunkte vertreten und ein Vierjahresprogramm erneut auf den
Herbst verschoben.
Unter
Berücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen
sicherheitspolitischen Strukturen (Innenpolitisch) und
militärstrategische Entwicklungen (Außenpolitisch) ist
a) die Teilnahme an der NATO-Partnerschaft
für den Frieden,
b) die Fixierung des Beobachterstatus bei der
Westeuropäischen Union
nur als erster Schritt zur
Integration und Solidarität Österreichs in einem föderativen
Europa der Regionen, Völker und Volksgruppen zu sehen. Ein Abwarten
über Aufgabenzuteilung seitens der Beschlüsse durch die laufende RK
ist daher nicht verantwortbar.
Die Abänderung, bzw.
Anpassung des Neutralitätsgesetzes kann und darf nur unter dem Aspekt der
eigenen, auf demokratischer Basis aufzubauenden sicherheitspolitischen
Stärke im Inneren und auf Wehr- und Verteidigungsbereitschaft
abgestützten Stärke nach außen erfolgen.
Denn:
Die europäische
Sicherheitspolitik befindet sich in einer Phase der Beratungen und des
Umdenkens (RK). Es wird in Zukunft keine Rolle spielen, wie das
europäische Sicherheitssystem nach der RK 96 aussehen mag. Welche
Stellung Österreich in diesem Sicherheitssystem einnehmen wird. Die
Umfassende Landesverteidigung (ULV) in allen ihren Facetten wird trotz dieser
Strukturen für Oberösterreich und Österreich
unerläßlich sein.
Ein
sicherheitspolitisches Trittbrettfahren und nach österreichischen
Lösungen ausgerichtetes taktierendes Lavieren wird nach dem Gemeinschafts-
und Solidaritätsgedanken und damit einer europäischen Friedensordnung
nicht zuträglich sein.
Es müssen die
Verteidigungsdoktrin und der neuzuerstellende Landesverteidigungsplan in den
Gesamtrahmen einer ,Österreichischen Sicherheitdoktrin‘
eingebunden sein. Auf Grund der gesellschaftlichen Veränderungen in
Osteuropa, der Balkankrise, der bedrohlich wachsenden organisierten
Kriminalität (O.K.) usw. und des wieder arbeitsfähigen Parlaments
fordert der OÖKB, mit dem demokratischen Recht der Petition, die ohnehin
nach einer zehnjährigen Geltungsdauer vorgesehene Anpassung des
LVP 85 in Angriff zu nehmen und trotz ausstehenden RK-Beschlüssen
umzusetzen.
Die gemeinsame
Außen- und Sicherheitspolitik der EU-Mitgliedstaaten wird in der
RK 96 erörtert und diskutiert. Österreichs
Regierungsverantwortliche müßten bereits wissen, was unser Land will
und kann. Eine einstimmig politische Akzeptanz aller staatstragenden und damit
politisch verantwortlichen Parteien sollte über Absichtserklärungen
und Positionspapiere bereits weit hinausgehen.
Forderung nach zehnjähriger
Überarbeitung
In dieser Petition wird
gefordert, daß in zeitlichen Abständen den sich ergebenden
Änderungen der Rechts- und Sachlage entsprochen wird und daher mindestens
alle zehn Jahre ein grundsätzliches Nachdenken und – wenn notwendig
– eine Überarbeitung des LVP und der als Basis dienenden
Sicherheitsdoktrin stattzufinden hat. Hat man im Jahre 1990 in Anbetracht der
Entwicklung im Osten und im Bestreben um den Beitritt Österreichs in die
EU von einer Überarbeitung Abstand genommen, so ist es jetzt höchst
an der Zeit, dies zu tun. Den Verhandlungen bei der RK 96 über die
gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU muß ein
maßgeschneidertes Konzept der österreichischen Wehr- und Verteidigungsbereitschaft
und Möglichkeiten des weiteren solidarischen Handelns zugrunde liegen.
Forderung nach politischer Verantwortung
Die österreichische
Position muß auf der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik im
Rahmen der nationalen inneren Sicherheit bei Beschäftigungspolitik sowie
Asyl- und Umweltfragen und Militärischer Landesverteidigung (MLV) liegen.
Wichtige Punkte sollten
sein:
– Die Mitwirkungsrechte
kleinerer und mittlerer Staaten müssen im Rahmen von föderativen
Strukturen, Regionen und freien Völkern gewahrt bleiben.
– Übergang zu einer
Mehrheitsentscheidung ist anzustreben, im Bereich der militärischen Landesverteidigung
sollte jedoch das Einstimmigkeitsprinzip gewahrt werden.
– Für die Petersburger
Aufgaben sollte der militärische Arm den Richtlinien der EU unterstellt
werden.
– Dem anzustrebenden
gesamteuropäischen Sicherheitsdialog muß auch ein geänderter
Landesverteidigungsplan LVP Neu) zugrunde liegen.
Festzustellen ist,
daß der militärische Teil des LVP zu überarbeiten ist und
seitens der Politik eine dementsprechende Aussage getroffen wird, damit auch
die notwendigen finanziellen Mittel für
a) Abfangjäger (nicht
Luftraumüberwachungsflugzeuge),
b) Ankauf vom Kampf- und Transporthubschraubern
langfristig zur
Verfügung stehen.
Denn:
Österreich verfügt
derzeit über 32 Mehrzweckflugzeuge Saab 105Ö (nach Abgang
von der Jabo- und Aufklärungsvariante nur mehr Schulungsflugzeug) und
24 Luftraumüberwachungsflugzeuge/Abfangjäger
Saab 35Ö-Draken. Im Bereich der Kampfflugzeuge bildet Österreich
das eindeutige Schlußlicht im internationalen Vergleich. Das Fehlen
von Kampfhubschraubern, trefferrobusten Erdkampfflugzeugen, Transporthubschraubern
bzw. Großraumtransporthubschraubern wird nur angeführt und nicht
einmal begründet.

Bedenkt man, daß
der ,Draken‘ ursprünglich als Luftraumüberwachungsflugzeug
eingeführt und nur durch Nachrüstung mit Luft-Luftlenkwaffen Typ
AIM 9 ,Sidewinder‘ als Abfangjäger brauchbar gemacht werden
konnte, so ist festzustellen, daß hier ein moderner Ersatz immer
dringender notwendig wird.
c) Vergrößerung der
Transportkapazität im Bereich der Transporthubschrauber, aber auch der
Flächenflugzeuge (Unabhängigkeit im Transportraum für die
Katastrophen und UN-Einsatzkräfte zu erlangen) ist eine dringende
Notwendigkeit, um logistische Kapazitäten nicht von langen Anmietungsprozeduren
und teuren Leasingkosten abhängig zu machen. Die dafür notwendigen
personellen Rahmenbedingungen sind einer langfristigen Planungs- und Personalpolitik
durch klare politische Auftragserteilung an die MLV zu unterwerfen.
d) Ausbau der Bodenluftabwehr bzw. die
Verdichtung in diesem Bereich ist durch Beschaffung von
– radargesteuerten
Rohrwaffen
– Fliegerabwehrlenkwaffen der
nahen, mittleren und großen Reichweite (2 000, 4 000, über
4 000 m) vehement fortzusetzen,
um die
Operationsfähigkeit der präsenten Kräfte auch im gepanzerten
Bereich mit analogen Waffensystemen übergreifend zu erhalten und
zivile sowie industrielle Ballungszentren ansatzweise abdecken zu können.
Denn:
Die Fliegerabwehr des
Bundesheeres war nie in der Lage, einen umfassenden Schutz vor Luftbedrohungen
zu gewährleisten. Derzeit sind im Bundesheer zwei Typen von
Fliegerabwehrgeschützen eingeführt. Die leichte Fliegerabwehrkanone
mit einem Kaliber von 2 cm und einer Reichweite von 2 000 m ist
vor allem zur Hubschrauberabwehr mit entsprechender Hartkernmunition (derzeit
nicht vorhanden) einsetzbar. Das radargesteuerte
Fliegerabwehrgeschütz mit einem Kaliber von 3,5 cm und einer
Reichweite von 4 000 m bietet nur einen örtlich ernstzunehmenden
Schutz vor tieffliegenden Kampfflugzeugen. Bedenklich ist vor allem,
daß die mechanisierten Truppen über keinen gepanzerten Schutz vor
Luftbedrohungen mehr verfügen. Gänzlich ungeschützt ist
Österreich – sowohl Soldaten als Zivilbevölkerung – vor
Luftangriffen aus großer Höhe oder größerer
Entfernung. Das Bundesheer hat keine mittleren oder schweren
Fliegerabwehrlenkwaffen zur Verfügung. Daran ändert auch die
begrüßenswerte Einführung der leichten Fliegerabwehrlenkwaffe
Mistral nichts, da auch dieses Waffensystem für den Truppenschutz nur eine
begrenzte Reichweite hat. Alle Nachbarstaaten Österreichs (ausgenommen
Slowenien) verfügen über eine umfangreiche Palette von schweren und
mittleren Fliegerabwehrlenkwaffen. So hat die Schweiz etwa
60 ,Rapir‘ und 64 ,Bloodhound‘ in Verwendung. Die Ungarn
verfügen über insgesamt 118 mittlere und 120 schwere
Fliegerabwehrsysteme. Prinzipiell muß festgehalten werden, daß die
Einführung der leichten Fliegerabwehrlenkwaffe ,Mistral‘ mit dem
bereits beschafften Wärmebildzielgerät und der noch zu beschaffenden
Radarausrüstung eine notwendige Ergänzung (im 2 000 m
Bereich) der Fliegerabwehrkanonen von 2 bis 3,5 cm darstellt.
Trotzdem besteht nach wie vor dringender Bedarf an entsprechenden
weitreichenden Systemen, die eine Abwehr von modernen Kampfflugzeugen
(Flächen, Rotor oder Propeller) ermöglichen und somit erst den Schutz
von Städten oder industriellen Einrichtungen erlauben.
e) Nachrüstung von schweren Waffen
für die mechanischen Kräfte, wie zB
– Panzer, Radpanzer,
Schützenpanzer, Radschützenpanzer, Artillerie und deren Logistik auf
europäischem Standard zu berücksichtigen und nicht
neutralitätsmäßigen Entscheidungen zu unterwerfen.
Unter den mechanisierten
Kräften werden vor allem Truppen (jetzige PzGrenBrigaden) verstanden, die
unter Panzerschutz von den jeweiligen Fahrzeugen aus kämpfen. Diese werden
nach Bauweise und Funktion unterteilt: in Kampfpanzer, Schützenpanzer,
Jagdpanzer, Panzerhaubitzen sowie gepanzerte Sonderfahrzeuge (zB: Bergepanzer,
Sanitätspanzer, Kommandopanzer usw.).

Das Österreichische
Bundesheer verwendet derzeit ausschließlich den mittleren Kampfpanzer M60.
Trotz der verschiedenen Modernisierungsmaßnahmen darf nicht vergessen
werden, daß der bereits 1964 eingeführte M60 letztlich auf
potentielle Gegner der sechziger Jahre ausgerichtet ist. Also Kampfpanzern, die
derzeit der Verschrottung zugeführt werden. Ersatzteile nach der
Jahrhundertwende werden nicht mehr erhältlich sein. Mit den Kampfpanzern
unserer Nachbarstaaten, wie dem Leopard 2 oder dem T 72, die
zusätzlich auch laufend modernisiert werden, kann der M60 hinsichtlich
seines Kampfwertes nicht mehr verglichen werden. Die Besatzungen sind nicht
mehr gefechtsfeldüberlebensfähig. Die nicht vorhandene
Durchschlagsleistung der vor kurzem an T72 erprobten Pfeilmunition ist Faktum
(hier wird mit politischem Restrisiko spekuliert). Die Kaufoption der NL Armee
zum Verkauf von modernisierten 114 Leopard 2A4 sollte so rasch als möglich
realisiert werden.
Noch dramatischer stellt
sich die Situation bei den Schützenpanzern dar. Sie dienen vor allem als
Transportfahrzeuge für Panzergrenadiere auf dem Gefechtsfeld und als
Waffenträger zum Aufbau eines Feuerschutzes. Die 480 österreichischen
Schützenpanzer sind bereits über 30 Jahre in Verwendung.
Panzerschutz (offener Kampfraum), Feuerkraft und die ergonomischen
Gegebenheiten entsprechen schon lange nicht mehr dem internationalen Standard
– wie auch die Erkenntnisse der österreichisch-schweizerischen
Übung ,Mobility 96‘ deutlich aufzeigten –, der etwa durch
die Typen ,Marder‘ (Deutschland) oder ,BMP‘ (Ungarn, Tschechien,
Slowakei) sowie ,M2-Bradley‘ (USA) repräsentiert wird. Die
Zuführung von 76 Stück Radpanzer ,Pandur‘ für
UN-Einsätze ist keine adäquate Nachrüstung für den
gepanzerten Schutz von Infanterie und Panzergrenadieren. Diese Schützenpanzer
– die dringend durch moderne ersetzt werden müssen – dienen
vor allem dem Schutz der Soldaten, dh. unseren jungen österreichischen
wehrbereiten Staatsbürgern, von denen wir gemäß ihres Eides den
Einsatz ihres Lebens erwarten.

Die Lage im Bereich der
Jagdpanzer unterscheidet sich nur unwesentlich von der der Kampf- und
Schützenpanzer. Der leicht gepanzerte Jagdpanzer ,Kürassier‘
ist mit einer 10,5 cm Kanone ausgestattet und wird hauptsächlich zur
Panzerabwehr eingesetzt. Wenn es auch möglich sein wird, die bereits mehr
als 20 Jahre im Dienst stehenden Jagdpanzer, insbesondere nach
entsprechenden Kampfwertsteigerungen (Restlichtverstärker usw.), noch
einige Jahre zu verwenden, so muß bereits jetzt die Beschaffung von
modernem Nachfolgegerät, etwa mit Lenkwaffen (2 000-m- und
4 000-m-Bereich), nicht nur geplant, sondern eingeleitet werden. Im
Panzerabwehrlenkwaffenbereich der Panzerartillerie erfolgte durch den Zukauf
von modernem Gerät, welche die bisherigen in Verwendung stehenden
Panzerhaubitzen M109A1 älterer Bauart ablösen, eine geringfügige
Qualitätssteigerung. Die vorgesehene Stückzahl erlaubt es jedoch auf
Grund des Fehlens von Mehrfachraketenwerfern nicht, jedem großen Verband
des Heeres die notwendige Artillerieunterstützung zuzuordnen.
Zusammenfassend ist in
diesem Bereich festzustellen, daß die mechanisierten Truppen unseres
Bundesheeres nur unzureichend ausgestattet sind. Das bedeutet nicht nur
eine Schwächung dieser Waffengattung, sondern auch ein unnotwendig hohes
Risiko für die wehrpflichtigen Bedienungsmannschaften in einem
Ernstfall.
f) Anpassung der Mannesausrüstung an
europäischen Standard (Bekleidung, Kampfgeschirr, Helm, Splitterschutz
usw.) und die Ausstattung für den gesamten Heeresbereich.
g) Die Kommunikationsmittel in ihrer breiten
Palette des Bedarfs und der Anwendungsnotwendigkeit bei und in den einzelnen
Waffengattungen sind dem Stand des Eurokorps anzupassen, um bei der bereits
stattfindenden europäischen Zusammenarbeit kostenintensive und zeitaufwendige
Nachrüstungen zu vermeiden.
h) Weitere qualitative Steigerung der
Kaderausbildung (UO und Offz) durch weitere Aufwertung der jeweiligen
Ausbildungsstätten,
– Unteroffiziersakademie HUAk,
– Milak durch zusätzliche
Einrichtung eines Fachhochschullehrganges,
mit bestmöglicher
logistischer Infrastruktur ist anzustreben, um unsere Bürger in Uniform
auf gegenwärtige und zukünftige Aufgabenbereiche im Rahmen eines
demokratischen Europäischen Sicherheits- und Friedenssystems bestmöglich
vorzubereiten.
i) Rascheste Realisierung (noch
1996) des in der Entwurfbearbeitung befindlichen Militärbefugnisgesetzes.
Damit dezidiertes Festlegen der Rechtsgrundlagen für die MLV in Frieden
und Einsatz.
Abschließend ist in
diesem Bereich festzustellen:
Die MLV im Rahmen der ULV
läuft Gefahr, bereits in naher Zukunft seiner Hauptaufgabe – dem
Schutz der Bevölkerung vor allen Bedrohungsformen – nicht mehr
nachkommen zu können. Die deutlichsten Auswirkungen der finanziellen
Aushungerungspolitik im Bereich des Wehrbudgets (Österreich hat im
europäischen Vergleich nach wie vor das geringste Wehrbudget,
0,8 Prozent für1996/97) sind bereits dramatisch zu erkennen. Wenn
nicht schnellstens in eine moderne Ausrüstung investiert wird (zB
Brückenlegegerät für Katastropheneinsatz), läuft die MLV
Gefahr, den internationalen Anschluß endgültig zu verlieren. Ein
Blick auf die Grafiken des Jahres 1994/95 zeigen die dramatische Situation auch
für die nächsten Jahre auf.

Wehrbudget: Österreich im
europäischen Vergleich (Quelle: CIA-World-Factbook 1994, Internet: world94.zip
auf mrcnet.cso.uiuc.edu)
Die ULV (GLV, ZLV, WLV, MLV) beruhend auf dem LVP
85 muß auf Grund der geänderten innen- und außenpolitischen
Situation und der Zugehörigkeit Österreichs zur EU als
gesamtpolitisch getragene österreichische Sicherheitspolitik gefaßt
sein. Ebenso sind Vorgaben zu friedenserhaltenden Maßnahmen bei der UNO
und der Mitwirkung an der Verteidigung der Europäischen Gemeinschaft
für den Krisen- und Konfliktfall in der Nachbarschaft Österreichs und
den Verteidigungsfall klar durch die Politiker aller staatstragenden Parteien
durch eine Verteidigungsdoktrin zu definieren und mitzutragen. Daher ist durch
Analysen auf Fragen, wie allgemeine Dienstpflicht, Dauer der
Präsenzdienstzeit, Milizdienst (Profimiliz) und die Aufnahme von Frauen
(Freiwilligenbasis) zum Heer und die Neutralität (ja oder nein) raschest
eine entsprechende Antwort zu finden.
Forderung für eine innere Sicherheit im
Rahmen der ZLV
Die Forderung nach entsprechender Umsetzung der
zivilen Landesverteidigung im Zivilschutz (Katastrophen- und Umweltschutz)
und Aufrechterhaltung der staatlichen Infrastruktur sind die Schwerpunkte in
diesem Bereich (zB wehrdienstuntauglich eingestufte Staatsbürger
können im Bereich des Zivilschutzes Wehrersatzdienst leisten). Eine
einmalige landesweite Sirenenprobe darf nicht alles gewesen sein.
Überarbeiten vieler unklarer und überholter gesetzlicher
Bestimmungen. Eine Neufassung ist unerläßlich, um Funktionalität
und Flexibilität zu gewährleisten. Überdies müssen in
vielen Bereichen klare Verantwortlichkeiten festgelegt werden, damit die
gesetzlichen Bestimmungen auch erfüllt und umgesetzt werden können.
Den für den innenpolitischen
Sicherheitsbereich zuständigen Behörden und Exekutivorganen sind jene
Mittel, zB:
– elektronische
Fahndungsmöglichkeiten (großer Lauschangriff),
– Beweislastumkehr bei der
Abschöpfung von Verbrechensgewinnen,
– die Kronzeugen-Regelung, die
eine besondere Strafmilderung für Täter vorsieht, die ihre Komplizen
preisgeben,
– eine intensive verdeckte
Fahndung, so etwa durch Kriminalbeamte, die mit anderer Identität in die
jeweilige Szene eintauchen, um Netze oder Hintergründe aufzuklären,
– Rasterfahndung zur
EDV-mäßigen Vernetzung gespeicherter, dem Datenschutz unterliegender
Daten,
– der Scheinkauf von Drogen,
radioaktiv strahlendem Material durch die Exekutive,
– dazu kommen noch neue
Observationsformen, verstärkter Schutz der Zeugen, ein Einschaurecht in
Datenbanken, die Überprüfung des Zahlungsverkehrs usw.,
gesetzmäßig
zuzuordnen, die es ihnen ermöglicht, die Sicherheit und den Schutz der
österreichischen Bevölkerung auf den Grundlagen rechtsstaatlicher
Gesetze und demokratischer Grundlagen sicherzustellen.
Denn:
Die Zeit drängt. Die Exekutive benötigt
mehr Rechte für die Wiedererlangung der innerstaatlichen Sicherheit zum
vorrangigen Schutz der eigenen Bürger gegen internationale organisierte
Verbrecherkartelle, Kriminaltourismus usw.
Forderung nach
Neuorientierung der GLV
Die Geistige Landesverteidigung sollte unter dem
Titel Kooperation und Solidarität laufen. Zielführend wäre, eine
hauptverantwortliche Persönlichkeit in jedem Bundesland zu bestellen,
welche die Agenden der Geistigen Landesverteidigung (GLV) wahrnimmt. Die
Umsetzung der Aufgaben und die Ziele der GLV in allen Wirkungsbereichen ist
unerläßlich und ist von jedem staatlich Verantwortlichen
entsprechend seiner Stellung mitzutragen und einzufordern.
Denn:
Die bisher gehandhabte Form des
österreichischen Bildungssystems gefährdet unsere
,demokratisch‘ aufgebaute Republik, wie zwei im Jahre 1995
veröffentlichte Umfragen verdeutlichen. Der Wehrwille ist in
Österreich auf ein gefährlich niedriges Niveau gesunken. Bereits
jetzt würde die Mehrheit der Österreicher nicht mehr zur Verteidigung
der Demokratie eintreten, also jener Staatsform, die den Einwohnern ein freies
und friedliches demokratisches Leben ermöglicht. Deshalb wird gefordert,
schnellstmöglich korrigierende Maßnahmen im Bereich der
österreichischen Bildungs- und Informationseinrichtungen zu setzen.
Ein Überdenken der österreichischen Bildungspolitik ist mehr denn je
ein Gebot der Stunde. Denn die Geschichte zeigt, daß alle Demokratien, in
denen die Bürger nicht bereit waren, notfalls auch mit dem eigenen Leben
zu deren Schutz einzutreten, über kurz oder lang dem Untergang
preisgegeben waren.
Nur 35 Prozent der männlichen und 25 Prozent der
weiblichen StaatsbürgerInnen würden im Ernstfall für
Österreich kämpfen. Von den 15- bis 25jährigen
ÖsterreicherInnen sind überhaupt nur 11,5 Prozent bereit,
für die Verteidigung der Demokratie zur Waffe zu greifen. Angesichts
dieser dramatischen Zahlen stellt sich die Frage:
1. Mit welchem Recht verlangen die
österreichischen Bürger, die mehrheitlich nicht bereit sind, selbst
für Demokratie und somit für ihr Recht auf Frieden und Freiheit zu
kämpfen, daß Bürger in Uniform unter potentiellem Lebensrisiko
für ihren Schutz und für ihre Hilfe eintreten? Diese Frage wiegt um
so schwerer, als die MLV nach wie vor finanziell ausgehungert wird, so
daß Wehrbürger im Ernstfall meistens ohne ausreichende
Ausrüstung, ohne ausreichenden Schutz für die Verneiner einer Wehr-
und Verteidigungsbereitschaft kämpfen müßten!
2. Der erschreckende Mangel an
Solidarität und Idealismus unter den jungen Österreichern, von denen
nur mehr jeder zehnte bereit ist, die Demokratie notfalls auch mit der Waffe zu
verteidigen, zeigt auf, daß die Ursache nur im Bereich der Bildungs- und
Informationspolitik liegen kann. Das Prinzip ,Geistige
Landesverteidigung‘ wurde praktisch nicht umgesetzt. Nur eine
verschwindend kleine Minderheit der an den österreichischen Schulen
unterrichtenden Lehrpersonen vermittelt den Schülern das Bewußtsein
um die Wichtigkeit einer starken Wehr- und Verteidigungsbereitschaft unserer
gemeinsamen Republik Österreich. Auch die öffentlich-rechtlichen
Medien tragen derzeit so gut wie nichts zur ,Geistigen
Landesverteidigung‘ bei. So werden dem Bereich MLV keine eigenen Belang-
oder Informationssendezeiten zur Verfügung gestellt, Jugendsendungen
fallen dadurch auf, daß deren Beiträge zum Themenbereich ULV (ZLV,
WLV, MLV) so gut wie nie dem Wehrwillen junger Mitbürger förderlich
sind und der … (Lücke im Original) nicht bzw. nur mangelhaft und
deshalb demokratie- und staatsgefährdend umgesetzt wird.
Forderung nach
effizienter Wirtschaftlicher Landesverteidigung
Die Wirtschaftliche Landesverteidigung (WLV) hat
der Meinung des wehrrelevanten überparteilichen OÖKB nach den
Handlungsbedarf in diesem Zusammenhang mit sozialem und wirtschaftlichem Wohlstand
zu sehende Teilbereiche besonders zu erkennen und zu berücksichtigen.
Früherkennung von Krisen, Analysen der geänderten Situation nach dem
EU-Beitritt Österreichs, Verkauf von Waren und Boden an mehrzahlende
EU-Nachbarn und fälschungssichere Bezugskarten zur Sicherstellung der
Grundversorgung der Bevölkerung in Krisenfällen sind nur ein kleiner
Teil.
Eine Verbesserung der rechtlichen Grundlagen ist
eine dringende Notwendigkeit. Die Energieversorgung, die Roh- und
Grundstoffversorgung gehören ebenfalls zu den vielfältigen Themen
einer vorsorglichen WLV. Ebenso ist eine Neufassung der Ausfuhrregelung von
Kriegsmaterial notwendig und gehört dem EU-Standard angepaßt.
Zusammenfassend ist festzustellen, daß die
qualitativen und quantitativen Mängel in allen Bereichen der auf dem
LVP 85 beruhenden ULV ein Ausmaß erreicht haben, welches die Wehr-
und Verteidigungsbereitschaft unseres gemeinsamen demokratischen
Vaterlandes Österreich entscheidend beeinträchtigt.
Deshalb fordert der 42 000 Mitglieder starke
OÖKB als Landesverband des 250 000 Mitglieder zählenden
Österreichischen Kameradschaftsbundes (ÖKB) als überparteiliche
wehrrelevante Organisation in dieser neuerlichen Petition die politisch
Verantwortlichen der drei staatstragenden Parteien auf, den LVP 85 durch
eine zu erstellende und gesamtpolitisch zu tragende Sicherheitsdoktrin
schnellstmöglich nachzujustieren. Mit politischem Restrisiko zum Nachteil
der gesamten österreichischen Bevölkerung zu spekulieren wird seitens
des OÖKB auf das schärfste verurteilt.
Stabilität und Berechenbarkeit der
österreichischen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik ist auch bei der
EU-RK 96 nachvollziehbar und glaubhaft auf das 21. Jahrhundert
ausgerichtet darzustellen, dies auch dann, wenn angesichts von veränderten
politischen Situationen und militärstrategischen Entwicklungen der
Landesverteidigungsplan durch Fachleute aller Teilbereiche der
Militärischen, Geistigen, Zivilen und Wirtschaftlichen Landesverteidigung
auf seine Anwendungen hin an neuen politischen Realitäten gemessen werden
muß und nicht durch ein, wenn auch noch so notwendiges, Sparpaket
unterlaufen werden darf.
Grunderlaß
,Politische Bildung in den Schulen‘ Wiederverlautbarung 1994 –
Auszug
1. Grundsätzliches:
Die österreichische Schule kann die
umfassende Aufgabe, wie sie ihr im § 2 des Schulorganisationsgesetzes
gestellt ist, nur erfüllen, wenn sie die Politische Bildung der
Schuljugend entsprechend berücksichtigt. Politische Bildung ist eine
Voraussetzung sowohl für die persönliche Entfaltung des einzelnen wie
für die Weiterentwicklung des gesellschaftlichen Ganzen. Sie ist in einer
Zeit, die durch zunehmende Kompliziertheit in allen Lebensbereichen
gekennzeichnet ist, ein aktiver Beitrag zur Gestaltung der Gesellschaft und zur
Verwirklichung der Demokratie. Wesentliche Anliegen der Politischen Bildung
sind die Erziehung zu einem demokratisch fundierten
Österreichbewußtsein, zu einem gesamteuropäischen Denken und zu
einer Weltoffenheit, die vom Verständnis für die existentiellen
Probleme der Menschheit getragen ist.
Politische Bildung ist einem
Demokratieverständnis verpflichtet, das in der Anerkennung legitimer
Herrschaft und Autorität keinen Widerspruch zur postulierten
Identität von Regierenden und Regierten sieht.
Im Mittelpunkt steht aber die Frage, wodurch
Herrschaft und Autorität von der Gesellschaft als rechtmäßig
anerkannt werden: In einem demokratischen Gemeinwesen wird unabänderliches
Merkmal sein, daß Autorität und Herrschaft aus der Quelle der freien
Bestellung, der freien Kontrolle und der freien Abrufbarkeit durch die
Regierten eingesetzten Organe geschöpft werden. Dabei wird ein
demokratisches Regierungssystem umso erfolgreicher arbeiten können, je
mehr der Gedanke der Demokratie auch in anderen Bereichen der Gesellschaft
anerkannt wird.
Politische Bildung in den Schulen wird davon
auszugehen haben, daß die politische Sphäre im Zeichen von
Wertvorstellungen steht. Friede, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit sind
Grundwerte, auf denen jede menschliche Gesamtordnung und somit jedes politische
Handeln beruhen muß. Dabei muß aber bewußt bleiben, daß
diese Grundwerte oft in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen und
daß auch bei gleichen ideellen Ausgangsvorstellungen verschiedene
Auffassungen über die Verwirklichung dieser Ideen in einer bestimmten
Situation bestehen können.
Politische Bildung soll
das Verständnis des Schülers für die Aufgaben der Umfassenden
Landesverteidigung im Dienste der Erhaltung der demokratischen Freiheiten
der Verfassung- und Rechtsordnung, der Unabhängigkeit und territorialen
Unversehrtheit unserer Republik wecken. Auf den defensiven Charakter unserer
Landesverteidigung und auf Fragen der zivilen Schutzvorkehrungen und
wirtschaftlichen Vorsorgemaßnahmen soll dabei besonders eingegangen
werden.
Erlaß des BMUK zum
Thema Zivildienst (Zl. 47.518/2-I/GLV/92):
Die Politische Bildung,
die als Unterrichtsprinzip für alle Lehrer Österreichs gilt,
verpflichtet auch, Fragen der Umfassenden Landesverteidigung, insbesondere
Vorsorgemaßnahmen für Krisenfälle, im Unterricht zu behandeln.
Als ein Teil der Umfassenden Landesverteidigung werden dabei in der Schule
sicherlich auch Fragen der militärischen Landesverteidigung, insbesondere
der Präsenzdienstzeit, diskutiert werden. Hier hat auch die Information
über den Zivildienst ihren Platz. Entgegen immer wieder vorgebrachten
Stellungnahmen ist jedoch der Zivildienst keine Alternative zum Wehrdienst,
sondern ein vom Gesetzgeber genau definierter Wehr-Ersatzdienst unter
bestimmten für den einzelnen wehrpflichtigen männlichen
Staatsbürger gegebenen Voraussetzungen. Eine Gleichstellung der
Information Umfassende Landesverteidigung – Zivildienst kann allein schon
aus diesem Grund nicht sinnvoll sein. Der schulische Unterricht hat sich
vielmehr an der Gesamtheit dieses Themas im Rahmen der Friedenserziehung
und Krisenvorsorge zu orientieren.
Natürlich bleibt es
zB den Schulgemeinschaftsausschüssen unbenommen, sich im Rahmen von
Aktionen zur Politischen Bildung auch Referenten aus dem Bereich des
Innenministeriums zusätzlich zur Information über den Zivildienst
einzuladen.”
In seiner Sitzung am
7. Mai 1997 beschloß der Ausschuß für Petitionen und
Bürgerinitiativen, Stellungnahmen des Bundeskanzleramtes sowie
folgender Ministerien einzuholen: Bundesministerium für Inneres,
Bundesministerium für Landesverteidigung, Bundesministerium für
auswärtige Angelegenheiten.
Das Bundeskanzleramt nahm
zur Petition Nr. 15 betreffend Österreichs Sicherheit wie folgt
Stellung:
“In einer Zeit
bewegter Übergänge und der noch unbestimmten Gestaltung der
europäischen Sicherheitsstrukturen wäre es wenig
zielführend, den Landesverteidigungsplan – der trotz aller neuen
Umstände nach wie vor eine trag- und konsensfähige Basis der
österreichischen Sicherheitspolitik und der umfassenden Landesverteidigung
ist – einzelnen und unter den gegebenen Bedingungen auch kurzfristigen
Änderungen zu unterziehen.
Gerade der allgemeine
Teil des LV-Planes versteht sich nicht als statische oder gar endgültige
sicherheitspolitische Doktrin, sondern stellt ,eine Gegenwartsanalyse von
Variablen dar, die sich in ständiger und zum Teil rascher Veränderung
befinden‘.
Schon aus diesem Grund
müssen die Entwicklung und ihre Auswirkungen ständig und systematisch
verfolgt werden, um – und auch das hebt der Landesverteidigungsplan
ausdrücklich hervor – ,rechtzeitig die erforderlichen
Adaptierungsvorschläge für die österreichische
Sicherheitspolitik erarbeiten zu können‘.
Es liegt auf der Hand,
daß ein umfassendes und weiträumigeres Verständnis des Begriffs
,Sicherheit‘ auch eine politische Konzeption erfordert, die geeignet ist,
den in mancher Hinsicht veränderten Ängsten, Sorgen und
Bedrohungsempfindungen der Bevölkerung wirksam zu begegnen.
Gleichzeitig muß
seit dem Beitritt Österreichs in die Europäische Union darauf Bedacht
genommen werden, daß die vereinbarte gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik in Abstimmung mit den Partnern konzipiert werden wird und
Österreich ein klares Bekenntnis zur aktiven und solidarischen Mitwirkung
beim Aufbau eines europäischen Sicherheitssystems abgelegt hat; unser Land
wird also seine eigenen Vorstellungen über die sicherheitspolitische
Zukunft nicht ohne intensive Konsultationen mit den Partnern in Europa
gestalten.
Nicht nur die in den
vergangenen Jahren für Österreich bereits eingetretenen
Veränderungen – Teilnahme an der ,Partnerschaft für den
Frieden‘, Beobachterstatus bei der WEU – sondern auch die aus den
Resultaten des bis spätestens zum ersten Quartal 1998 vorzulegenden Berichts
der Bundesregierung an den Nationalrat über die sicherheitspolitischen
Optionen abzuleitenden Folgerungen werden Grundlage dafür sein, die
geltende Verteidigungsdoktrin und den Landesverteidigungsplan einer eingehenden
Analyse zu unterziehen.
Es wäre daher nicht
zielführend, in einer so bedeutenden Frage den sicherheitspolitischen
Spielraum aufzugeben und sich zB auf eine einzige sicherheitspolitische Option
festzulegen. Auch gilt es die traditionelle Linie fortzusetzen, wonach die
österreichische Außen- und Sicherheitspolitik von einem größtmöglichen
innerösterreichischen Konsens getragen wird.”
Vom Bundesministerium
für Landesverteidigung ist folgende Stellungnahme eingelangt:
“Hinsichtlich der
sicherheitspolitischen Konzeption der Bundesregierung darf auf das
Koalitionsübereinkommen der Regierungsparteien vom 11. März
1996 verwiesen werden. Daraus geht insbesondere auch hervor, daß die
Bundesregierung alle sicherheitspolitischen Optionen einer umfassenden
Prüfung unterziehen und dem Parlament hierüber spätestens im
Laufe des ersten Quartals des Jahres 1998 berichten wird.
In kompetenzrechtlicher
Hinsicht ist zu bemerken, daß die Zuständigkeiten in der
gegenständlichen Materie entsprechend den Teilbereichen der Umfassenden
Landesverteidigung auf mehrere Ressorts verteilt sind, wobei die Koordinierungskompetenz
dem Bundeskanzleramt zukommt.
Seitens des ho. Ressorts,
dem der Teilbereich der Militärischen Landesverteidigung obliegt, werden
Entwicklungen des sicherheitspolitischen Umfeldes Österreichs laufend
analysiert. Veränderten Rahmenbedingungen wurde jeweils durch
Änderungen im Bereich der Struktur des Bundesheeres, zuletzt durch die
Heeresgliederung-Neu, Rechnung getragen. In diesem Zusammenhang ist auch auf
die im Dezember 1996 veröffentlichte Studie ,Sicherheitspolitisches Umfeld
und Streitkräfteentwicklung II‘, die allen Abgeordneten zum
Nationalrat und Mitgliedern des Bundesrates übermittelt wurde, zu
verweisen. Eine weitere aktuelle Analyse einschließlich der daraus
abzuleitenden Folgerungen, insbesondere auch in sicherheitspolitischer
Hinsicht, ist dem Situationsbericht 1996 (III-73 der Beilagen, XX. GP) zu
entnehmen, der vom Nationalrat am 27. Februar 1997 zur Kenntnis genommen
wurde.”
Das Bundesministerium
für Inneres nahm zum Punkt “Forderung für eine innere
Sicherheit im Rahmen der ZLV” der im Betreff genannten Petition wie folgt
Stellung:
“Zivilschutz
Die konkreten Aufgaben
der Zivilen Landesverteidigung sind in dem 1985 von der Österreichischen
Bundesregierung beschlossenen Landesverteidigungsplan mit
– Vorsorgen zum Schutz der
Bevölkerung, also dem sogenannten Zivilschutz und
– der Sicherung der
Funktionsfähigkeit der staatlichen Organe und sonstiger wichtiger
Einrichtungen umschrieben.
Unter den letztgenannten Bereich fallen
– die Aufrechterhaltung der
öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit,
– Vorkehrungen für die
Aufnahme von Flüchtlingen,
– der Objektschutz,
– die Sicherung der
Funktionsfähigkeit der staatlichen Organe in Krisenzeiten und
– der Kulturgüterschutz.
Der Bereich des eigentlichen Zivilschutzes
umfaßt
– Einsatzvorsorgen, also den
Katastrophenschutz,
– Selbstschutzmaßnahmen,
– den Warn- und Alarmdienst,
– den Schutzraumbau,
– Sanitätsvorsorgen,
– veterinärmedizinische
Vorsorgen und den
– Strahlenschutz.
Dies bedeutet, daß
sich der Zivilschutz in Österreich grundsätzlich in drei Bereiche
gliedern läßt:
Vorkehrungen der
Behörden
Die Angelegenheiten des
Zivilschutzes sind in Österreich nicht auf eine Gebietskörperschaft
beschränkt. Sowohl Bund, Land als auch Gemeinden haben Maßnahmen zur
Katastrophenabwehr getroffen, wobei der Warnung und der Information der
Bevölkerung eine ganz besondere Bedeutung zukommt. Die behördlichen
Maßnahmen stellen somit die erste Säule des österreichischen
Zivilschutzes dar.
Vorkehrungen der
Einsatzorganisationen
Die zweite Säule des
österreichischen Zivilschutzes baut auf dem Prinzip der Freiwilligkeit
auf. Die Hilfs- und Rettungsorganisationen stellen das Rückgrat des
österreichischen Zivilschutzes dar. Über 300 000 Helfer und
Helferinnen sind rund um die Uhr bereit, ihren Mitmenschen in Notsituationen
beizustehen.
Vorkehrungen im
Privatbereich
Der Selbstschutz ist die
dritte Säule des österreichischen Zivilschutzes. Organisierte Hilfe
kann bei Großkatastrophen nicht überall und gleichzeitig einsetzen.
Die Zeit bis zum Wirksamwerden dieser Hilfe muß daher durch
Selbstschutzmaßnahmen überbrückt werden. Selbstschutz aktiv
ausüben können, das heißt daher vor allem, die Bereitschaft zum
Lernen mitzubringen, die Bereitschaft, auch Zeit dafür aufzuwenden, um
später sich selbst und anderen rasch und richtig helfen zu können.
Die Tätigkeiten auf
dem Gebiet des Zivilschutzes gehen daher weit über eine einmalige
landesweite Sirenenprobe hinaus.
Innere Sicherheit
Das österreichische Parlament hat bereits
durch das Strafrechtsänderungsgesetz 1996, BGBl. Nr. 762/1996, und
das Bundesgesetz über ,besondere Ermittlungsmaßnahmen‘
(Bundesgesetz, mit dem zur Bekämpfung organisierter Kriminalität
besondere Ermittlungsmaßnahmen in die Strafprozeßordnung
eingeführt sowie das Strafgesetzbuch, das Mediengesetz, das
Staatsanwaltschaftsgesetz und das Sicherheitspolizeigesetz geändert
werden), BGBl. I Nr. 105/1997, umfangreiche Gesetzesänderungen
durchgeführt und hiedurch verbesserte Bedingungen für die Abwehr
und Verfolgung strafbarer Handlungen, insbesondere im Bereich der
Bekämpfung organisierter Kriminalität, geschaffen. Durch diese
Maßnahmen sollte es gelingen, den ohnehin hohen Standard in
Österreich auf dem Gebiet der inneren Sicherheit zu erhalten. In diesem
Bereich besteht daher kein Handlungsbedarf.”
Eine Stellungnahme des Bundesministeriums für
auswärtige Angelegenheiten ist nicht eingelangt.
Einstimmiger Beschluß in der Sitzung am 26. November 1997:
Ersuchen um Zuweisung an den
Landesverteidigungsausschuß.
Ausschuß
für Land- und Forstwirtschaft
Petition Nr. 28
überreicht von der Abgeordneten MMag. Dr.
Madeleine Petrovic betreffend “Kennzeichnungspflicht
genmanipulierten Saatguts (Saatgutgesetz 1997)”
Diese Petition betreffend “Kennzeichnungspflicht
genmanipulierten Saatguts (Saatgutgesetz 1997)” ist wie folgt
begründet:
“Durch das Fehlen der Kennzeichnungspflicht
für Genmanipulation im Saatgut ist dem unkontrollierten Eindringen
genmanipulierter Pflanzen in die Landwirtschaft Tür und Tor geöffnet
und stellt dadurch eine existentielle Bedrohung der tüchtigen Biobauern
dar; ebenso eine Gefahr für den gesamten Landbau, welche die Wissenschaft
nicht abschätzen oder gar ausschließen kann.
Die Einlagerung gentechnisch veränderter
Erbinformation in das Edaphon der Fläche eines Öko-Bauern würde
eine Substanzverletzung seines Eigentums darstellen, wenn zB von einem mit
gentechnisch verändertem Saatgut oder Pflanzgut arbeitenden Nachbarn etwas
überspringt. Dies würde zu Schadenersatz verpflichten, weil die
Erzeugnisse des Öko-Bauern nicht mehr als ,biologisch‘ verkauft
werden könnten. Aber der effektive Schaden für den Boden könnte
mit Geld gar nicht gutgemacht werden.
Für Landwirte, Gärtner und private
Kleingärtner, die ihr Saatgut nicht selbst erzeugen können, ist beim
zugekauften ohne Deklarationspflicht keine Gewähr, daß es nicht
genmanipuliert ist. Die sogenannte Nachbarschaftshilfe soll nun auch durch
Verordnung wieder eingeschränkt werden. Daher wird das Recht auf freie
Entscheidung mißachtet. Auch der Konsument von Lebensmitteln weiß
nicht, ob er genmanipulierte bekommt oder nichtgenmanipulierte Nahrung kaufen
kann, die er mit Recht erwartet.
Es ist völlig unverständlich, daß
einfach über 1,25 Millionen Bürger hinweggegangen wird, die sich
im Volksbegehren gegen Gentechnik aussprachen.
Österreich könnte die Forderung
,Feinkostladen Europas‘ zu werden nur verwirklichen, in dem Sie als
positive Vorreiter in der EU auftreten und damit Ihrer Verantwortung, auch
künftigen Generationen gegenüber, gerecht werden. Die
Bevölkerung würde es Ihnen danken, für die Sie ja arbeiten
wollen. In meinem ersten Brief vom 24. Mai 1997 an die Abgeordneten und an
den Landwirtschaftsminister konnte ich über 500 Unterstützungsunterschriften
beifügen (am 17. Juni 1997).
Daher die Forderung:
1. Gesetzesänderung: Kennzeichnung
allen genmanipulierten Saatguts (aber auch des Pflanzguts!)
2. Geeignetes Zulassungsverfahren für
sogenannte ,Landsorten‘ zur Erhaltung der pflanzengenetischen
Ressourcen zur Förderung der biologischen Vielfalt
3. Erhaltung und Förderung der
gegenseitigen bäuerlichen Nachbarschaftshilfe unter Einbeziehung von
Kleingartenvereinen u. dgl.”
Dazu wurde in der Ausschußsitzung am
9. Juli 1997 beschlossen, eine Stellungnahme des Bundesministeriums für
Land- und Forstwirtschaft einzuholen.
Vom Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft ging die nachstehende Stellungnahme zu den drei in der Petition
genannten Forderungen ein:
“1. Gesetzesänderung
(Saatgutgesetz) bzw. Gentechnikkennzeichnung:
Derzeit sind noch keine gentechnisch
veränderten Sorten und somit auch kein gentechnisch verändertes
Saatgut am EG-Binnenmarkt zugelassen.
Eine Kennzeichnung gentechnisch veränderter
Sorten wurde bereits in der österreichischen Sortenliste (in einer eigenen
Spalte) vorsorglich vorgesehen. Auf freiwilliger Basis (derzeit keine
Rechtsbasis gegeben) einigten sich die Vertreter der Mitgliedstaaten im
Ständigen Saatgutausschuß auf eine Kennzeichnung gentechnisch
veränderter Sorten in den gemeinsamen Sortenkatalogen der EU.
Da am amtlichen Etikett von Saatgutverpackungen
immer auch die Sortenbezeichnung stehen muß, wird empfohlen, sich
darüber zu informieren, ob die Sorte gentechnisch verändert ist. Wenn
die ersten gentechnisch veränderten Sorten auf den Binnenmarkt gelangen,
ist davon auszugehen, daß auf Grund der Kennzeichnung dieser in den
genannten Katalogen eine weitgehende Zugänglichkeit zu diesen
Informationen bestehen wird. Die österreichische Sortenliste ist über
das Internet (http://www.bfl.at) abrufbar. Generelle Informationen über
Sorten sind am Institut für Pflanzenbau im Bundesamt und Forschungszentrum
für Landwirtschaft erhältlich.
Die landwirtschaftlichen Zeitungen werden
sicherlich infolge des öffentlichen Interesses die Namen der ersten
transgenen Sorten veröffentlichen. Eine zusätzliche Kennzeichnung des
gentechnisch veränderten Saatgutes (auch Pflanzengutes) am amtlichen
Etikett wird ins Auge gefaßt, da die Kommission voraussichtlich im Herbst
1997 dem Rat einen diesbezüglichen Vorschlag vorlegen wird. Eine
Kennzeichnung wird voraussichtlich in den ,Methoden für Saatgut und
Sorten‘ gemäß § 5 Saatgutgesetz, BGBl. I
Nr. 72/1997, welche Verordnungscharakter haben, verbindlich festgehalten
werden.
2. Zulassungsverfahren
für Landsorten:
Das Europäische Parlament hat sich mit der
Kommission darauf geeinigt, daß diese dem Rat einen Vorschlag für
ein vereinfachtes Zulassungsverfahren für Landsorten vorschlagen wird; es
ist die Rede von ,Erhaltungssorten‘.
Darüber hinaus wird demnächst in
Österreich eine Saatgutverordnung in Kraft treten, wonach zur Erhaltung
pflanzengenetischer Ressourcen beschränkte Mengen Saatgut (entsprechen
etwa einem Flächenäquivalent von 1 bis 3 ha je nach Kulturart)
von den saatgutverkehrsrechtlichen Bestimmungen bzw. Auflagen befreit werden
sollen!
3. Nachbarschaftshilfe:
Die Nachbarschaftshilfe ist als Grundprinzip im
neuen obgenannten Saatgutgesetz (§ 2 Abs. 3) verankert und
ebenso von den saatgutverkehrsrechtlichen Verpflichtungen bereits jetzt
befreit! Sie bezieht sich gemäß § 7 Abs. 1 der
bereits genannten Saatgutverordnung auf Landwirte und Saatgutanwender (somit
auch auf Mitglieder von Kleingartenvereinen), die sich nicht mit dem
Saatguthandel oder der Vermehrung von Saatgut der auszutauschenden Sorte zu
Verkaufszwecken befassen. Der Austausch ist innerhalb der Gemeindegrenzen und
mit Nachbargemeinden möglich.”
Einstimmiger Beschluß in der Sitzung am 26. November 1997:
Ersuchen um Zuweisung an den Ausschuß
für Land- und Forstwirtschaft.
Umweltausschuß
Petition Nr. 5
überreicht von der Abgeordneten Theresia Haidlmayr
“gegen eine Änderung des Abfallwirtschaftsgesetzes und des
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes zum Nachteil der Bürgerinnen und
Bürger”
Nachdem diese Petition schon einmal in Form der
Bürgerinitiative Nr. 5 in der XIX. GP eingebracht worden ist,
aber durch das Auslaufen der Legislaturperiode nicht weiter behandelt werden
konnte, wurde diese Initiative in Form einer Petition dem Präsidenten des
Nationalrates überreicht. Wörtlich wurde dazu vorgebracht:
“Im Zusammenhang mit dem
Genehmigungsverfahren für eine geplante Giftmüllverbrennungsanlage in
Ranshofen wurden von Herrn Landesrat Dr. Pühringer
Änderungsvorschläge zum Allgemeinen Verwaltungsverfahrengesetz
ausgearbeitet, die von Herrn Nationalrat Mag. Kukacka auf parlamentarischer
Ebene eingebracht werden sollen.
Weiters sind Pläne bekannt, wonach
§ 29 des Abfallwirtschaftsgesetzes wesentlich geändert werden
soll.
Beide Maßnahmen zielen darauf ab, die Rechte
der Bürgerinnen und Bürger im Genehmigungsverfahren wesentlich zu
beeinträchtigen bzw. die im konkreten Fall erhobenen 60 000
Einwendungen in ihrem rechtlichen Wert zu schmälern.
Wir wenden uns daher an den Nationalrat und
erheben die Forderung, die geplanten Änderungen des AVG und des AWG zum
Nachteil der Bürgerinnen und Bürger nicht Gesetz werden zu lassen.
Erläuterungen
1. Abfallwirtschaftsgesetz
1.1 Probebetrieb
Nach den uns vorliegenden Informationen soll im
§ 29 Abs. 8 Abfallwirtschaftsgesetz die Möglichkeit des
Vorbehalts einer Betriebsbewilligung mit Anordnung eines Probebetriebes sowie
die Parteistellung des im Abs. 5 genannten Personenkreises für das
Betriebsbewilligungsverfahren entfallen.
1.2 Genehmigungsbescheid des Landeshauptmannes
Nach den Änderungsplänen für
§ 29 Abs. 10 AWG soll eine Anlage auch dann bereits vor Eintritt
der Rechtskraft des Genehmigungsbescheides errichtet oder betrieben werden
dürfen, wenn sie vom Landeshauptmann genehmigt wurde. Das heißt,
eine Errichtung und/oder Inbetriebnahme ist auch trotz fehlender Rechtskraft des
Genehmigungsbescheides des Landeshauptmannes möglich.
Bemerkung: Unter dem
Deckmantel der ,Vereinfachung‘ des Verfahrens, soll das
Betriebsbewilligungsverfahren entfallen, den Parteien soll dabei die
Mitsprachemöglichkeit genommen werden und Parteieneinwendungen bzw.
eingebrachte Rechtsmittel brauchen drei Jahre nicht berücksichtigt werden.
Dies soll eine dem Gleichheitsgrundsatz völlig widersprechende
Beschleunigung der Inbetriebnahme hochsensibler Anlagen, wie zB
Müllverbrennungsanlagen, zugunsten der Betreiber ermöglichen. Bedenkt
man, daß in Oberösterreich etwa nicht einmal mit dem Bau eines
Garagenobjektes von mehr als 12 m2 vor Rechtskraft des
Baubewilligungsbescheides begonnen werden darf, ist eine im Gesetzesentwurf
vorgesehene Zielsetzung bei derartigen Großanlagen mit entsprechender
Relevanz für Nachbarschaft und Umwelt völlig absurd. Die Zielsetzung,
die sich hinter der angestrebten Gesetzesänderung verbirgt, ist eindeutig
die geplante Giftmüllverbrennungsanlage Ranshofen.
Der massive Widerstand der Bevölkerung gegen
diese Anlage soll durch ein eigenes Gesetz gebrochen bzw. soll damit einer
nicht gerechtfertigten frühzeitigen Inbetriebnahme nach den Vorstellungen
der im französischen Eigentum stehenden Betreiberfirma Vorschub geleistet
werden (Lex Ranshofen).
Ein nachträgliches ,ordentliches‘
Rechtsmittelverfahren, nachdem eine Anlage bereits errichtet und in Betrieb
genommen wurde, kann man nur als Farce bezeichnen. Es werden kaum Milliarden
Schillinge in eine Anlage investiert, Mitarbeiter/innen aufgenommen und
Infrastrukturen aufgebaut, um dann letztendlich die Genehmigung im
Rechtsmittelverfahren nicht zu erteilen. Das Beispiel Zwentendorf dürfte
den Abgeordneten zum Nationalrat wohl kaum als Vorbild für ein
volkswirtschaftlich sinnvolles Handeln dienen.
Es ist also davon auszugehen, daß eine
einmal errichtete und in Betrieb gegangene Anlage in einer
Größenordnung von mehreren Milliarden Schilling auch in Betrieb
bleibt. Die geplanten Änderungswünsche im AWG sind daher weder
sinnvoll noch demokratiepolitisch vertretbar, außer man beabsichtigt
bewußt die Einschränkung der Bürgerrechte.
1.3 Inkrafttreten
Entwurf: ,Verfahren, die zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes noch nicht abgeschlossen sind, sind nach
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes abzuschließen.‘
Bemerkung: Für
die geplante Anlage in Ranshofen hätte dieser Passus eine ganz besonders
hinterhältige Auswirkung:
a) Obwohl ein Rechtsgutachten vom
Ordentlichen Universitätsprofessor Dr. Heinz Peter Rill eindeutig die
Notwendigkeit einer Standortverordnung gemäß § 26 AWG
nachweist, wird diese von der Umweltministerin nicht erlassen. Der Grund
ist klar: nach § 26 würden erweiterte Mitspracherechte der
BürgerInnen bestehen.
b) Der Antrag auf Bewilligung der
Giftmüllverbrennungsanlage in Ranshofen wurde kurz vor Inkrafttreten des
UVP-Gesetzes gestellt. Der Grund ist klar: es würden erweiterte
Mitspracherechte der BürgerInnen bestehen.
In diesem Zusammenhang
läuft ein Verfahren bei der EFTA-Überwachungsbehörde in
Brüssel gegen Österreich.
c) Die einzige rechtliche Möglichkeit
sich gegen die geplante Anlage zur Wehr zu setzen, waren Einwendungen
gemäß § 29 Abs. 5 AWG. Die erhobenen 60 000
Einwendungen sollen nun durch eine rückwirkende Gesetzesänderung
rechtlich wertlos gemacht werden.
Wird der Gedanke einer Anwendung der geplanten
Gesetzesänderung auf noch nicht abgeschlossene Verfahren weitergesponnen,
müßte konsequenterweise auf diese Verfahren das in der Zwischenzeit
in Kraft getretene UVP-Gesetz angewendet werden. Sonst ist die Anhäufung
von legistischen Nachteilen perfekt. Auf ein und dasselbe Verfahren werden die
Vorteile des UVP-Gesetzes noch nicht, die Nachteile einer AWG-Novelle jedoch
rückwirkend angewendet.
Daß durch solche offensichtlichen
rechtlichen Tricks das Vertrauen in eine demokratische Rechtsordnung nicht
gestärkt wird, das versteht sich von selbst.
2. Allgemeines
Verwaltungsverfahrensgesetz
2.1 Anberaumung einer
mündlichen Verhandlung
Nach den Vorstellungen von Landesrat Dr. Pühringer
soll die Zustellung der Einladung zur mündlichen Verhandlung nicht mehr zu
eigenen Handen erfolgen, sondern durch Ediktalkundmachung. Gesonderte
Einladungen sollen den Gemeinden oder Bürgerinitiativen überlassen
bleiben.
Bemerkung: Es
würden sich dadurch zwei Kategorien von Verfahren ergeben. Kleinere
Genehmigungsverfahren, bei denen wie bisher zu eigenen Handen zu laden
ist, und Großverfahren, bei denen eine zweite Klasse von Nachbarn
geschaffen wird, die zufällig – oder auch nicht – von einer
Verhandlung erfahren. Die Verantwortung dabei den Gemeinden oder
Bürgerinitiativen zu überwälzen, denen der Parteienkreis nicht
bekannt ist, stellt eine Zumutung dar. Was dann, wenn eine Gemeinde diesen
Informationsservice nicht anbietet, aus finanziellen Gründen nicht
anbieten kann, oder keine Bürgerinitiative besteht?
Zum Nachteil der Bürger würden sich
Kundmachungen über Weihnachten oder in der Urlaubszeit direkt einbieten.
2.2 Frist von schriftlichen Einwendungen oder
Anträgen
Laut Entwurf von Landesrat Dr. Pühringer
sollen schriftliche Einwendungen oder Anträge spätestens eine Woche
vor der Verhandlung eingebracht werden können. Als Begründung wird
angeführt, daß die Behörde dann ausreichend Zeit zur
Vorbereitung hätte.
Bemerkung: Dieser Passus wäre wohl für die Behörde kontraproduktiv,
denn diese kurzfristigen Anträge werden dann eben bei der Verhandlung als
mündliche Anträge vorgebracht. Dann ist die Zeit für die
Behörde noch knapper. Außerdem verfolgt die derzeitige Regelung,
daß schriftliche Anträge bis spätestens am Tag vor der
Verhandlung bei der Behörde einlagen müssen, ja bekanntlich nur das
Ziel, daß der Behörde bei der Verhandlung alle Anträge (dh.
vorher eingegangene schriftliche und während der Verhandlung eingebrachte
mündliche) vorliegen und alle Anträge behandelt werden können.
Von einer bisherigen Absicht des Gesetzgebers, bezüglich schriftlicher
Anträge der Behörde eine ,Vorbereitungszeit‘
einzuräumen, kann ohnedies nicht die Rede sein. Das Argument der
notwendigen Vorbereitung wird offensichtlich nur vorgeschoben, um den Zeitraum
für die Einbringung von Anträgen zum Nachteil der Parteien weiter
einzuschränken.
2.3 Mündliche
Verhandlung
Laut Entwurf von
Landesrat Dr. Pühringer sollen Großverfahren in Verfahrensschritte
aufgeteilt werden, in denen nur gewisse Einwendungen, die zum jeweiligen
Verfahrensschritt gelten, vorgebracht werden können.
Der Lokalaugenschein soll
praktisch abgeschafft werden.
Bemerkung: Die Vorschläge zum Ablauf der mündlichen Verhandlung in
Verbindung mit der Unterlassung der Einladung (die entsprechende
Informationen und Hinweise enthält) zu eigenen Handen zielen darauf ab,
die BürgerInnen von der Teilnahme an der Verhandlung abzuhalten und sie
nur mehr rechtskundigen Personen zugänglich zu machen.
2.4 Protokollführung
Laut Entwurf von
Landesrat Dr. Pühringer soll auf die stenographische Protokollführung
verzichtet werden.
2.5 Bescheidzustellung
Laut Entwurf Landesrat
Dr. Pühringer soll die Bescheidzustellung analog der Einladung zur
Verhandlung mittels Ediktalverständigung erfolgen. Der Bescheid und die
Verhandlungsschrift sollen bei der Behörde zur Einsichtnahme aufliegen.
Bemerkung: Es gelten hier die gleichen Bedenken wie zu der Ladung mittels
Ediktalverständigung. Wenn die BürgerInnen durch Zufall per Anschlag
an einer Informationstafel von der Bescheiderlassung erfahren haben,
müssen sie sich zu den Amtsstunden zur zuständigen Behörde zur
Einsichtnahme in den Bescheid begeben. Erst dann können sie von ihrem
Rechtsmittel Gebrauch machen – wenn nicht die zweiwöchige Berufungsfrist
bereits verstrichen ist. Wochenenden, Feiertage, Tage, an denen sich von der
Arbeit nicht freigenommen werden kann, sind für die Wahrnehmung eines
Rechtsmittels verloren. Die ohnedies kurze Rechtsmittelfrist von zwei Wochen
soll so zum Nachteil der BürgerInnen de facto noch weiter verkürzt
werden. Außerdem ist der Besitz einer eigenen Bescheidausfertigung
für die Parteien unbedingt erforderlich, um sich ordentlich mit der
Entscheidung und der Auswirkung auf die eigene Interessenslage befassen zu
können. Weiters wird eine eigene Bescheidausfertigung benötigt, um
sich mit einem Rechtsvertreter beraten zu können. Es müßte sich
somit jede Partei von der Gemeinde eine Kopie eines möglicherweise sehr
umfangreichen Bescheides anfertigen lassen. Herr Landesrat Dr. Pühringer
beabsichtigt offensichtlich, die Kosten von der Behörde auf die
Bürger zu verlagern. Abgesehen davon wäre diese Form der
Bescheidzustellung bei mehreren tausend Parteien innerhalb der
Rechtsmittelfrist administrativ nicht zu bewältigen.
2.6 Verlesung der
Verhandlungsschrift
Laut Entwurf von
Landesrat Dr. Pühringer soll von der Verlesung der Verhandlungsschrift
Abstand genommen werden können.
Bemerkung: Die Parteien in einem Verfahren sollen offensichtlich im unklaren
gelassen werden, was von der Behörde protokolliert wurde und was nicht.
Wenn die Verhandlungsschrift den Parteien auch nicht mehr zustellt werden soll
(siehe Punkt 2.5), kann dies nur als Versuch angesehen werden, die Rechte
der BürgerInnen zu schmälern.
Am Schluß seiner Vorschläge
schreibt Herr Landesrat Dr. Pühringer: ,Abschließend ist darauf
hinzuweisen, daß diese Veränderungen keinerlei
Schmälerungen der Rechte der Parteien beinhalten, aber doch einen
wesentlich zügigeren Ablauf des Verfahrens gewährleisten
würden.‘
Bemerkung: Insgesamt ist allerdings das Gegenteil der Fall. Mit den
vorgeschlagenen Gesetzesänderungen sollen Bürgerrechte massiv
beschnitten werden. Es wird hier ein Problem von hinten aufgerollt. Anstelle
gesetzliche Schlupflöcher für Anlagenbetreiber und Behörden zu
schaffen, um die BürgerInnen zu benachteiligen, wäre es sinnvoller,
bei Großprojekten mit Information und umfangreicher Bürgerbeteiligung
Vertrauen zu schaffen.
Für die Behörde würde sich eine
Entlastung bei der Verfahrensabwicklung dadurch ergeben, wenn die Kosten des
Verfahrens der Antragsteller zu tragen hätte. Dadurch wären die
Firmen von der Kostenseite her gezwungen, sich mit den Anliegen der
Bevölkerung auseinanderzusetzen und es nicht bei Scheinbeteiligungsmodellen
zu belassen. Wenn es wirklich darum geht, wie Herr Landesrat Dr. Pühringer
schreibt, ,Überlegungen anzustellen, wie man in Zukunft effizient und auch
Steuergelder sparend Großverfahren abwickeln kann‘, würde
eine Gesetzesänderung dahin gehend mehr bringen, als die von ihm vorgebrachten
Vorschläge. Seine Vorschläge gehen nämlich nur in die Richtung
einer Einschränkung der Bürgerrechte. Als Nebeneffekt wird durch die
diffusen Ladungs- und Zustellungsbestimmungen Rechtsunsicherheit
geschaffen.
Sollten trotz
Bürgerbeteiligung und Information für bestimmte Projekte die
BürgerInnen nicht zu gewinnen sein, sollte man den demokratiepolitischen
Gesichtspunkt in den Vordergrund rücken und dem Willen der
BürgerInnen entsprechen. Auch dieser Aspekt sollte berücksichtigt
werden, wenn wir in einer Demokratie – im wahrsten Sinne des Wortes
– leben wollen.
Wie in der Petition
angeführt, ersuchen daher die UnterzeichnerInnen den Nationalrat, die
geplanten Änderungen des AVG und des AWG zum Nachteil der Bürgerinnen
und Bürger nicht Gesetz werden zu lassen.”
Einstimmiger
Beschluß in der Sitzung am 3. Juli 1996:
Ersuchen um Zuweisung an
den Umweltausschuß.
Verfassungsausschuß
Petition Nr. 1
überreicht vom
Abgeordneten Dipl.-Kfm. Mag. Josef Mühlbachler betreffend “Änderung
des § 7 Abs. 1 Volksbegehrengesetz”
Mit dieser Petition, die
auf eine Initiative der Bürgermeisterkonferenz des Bezirkes Freistadt
erfolgt ist, wird der Österreichische Nationalrat aufgefordert, das
Volksbegehrengesetz im § 7 Abs. 1 zu ändern. Die
Änderung sollte darauf abzielen, daß die Gemeinden die
Zugänglichkeitszeiten der Gemeindebevölkerung zur
Unterschriftenleistung für ein Volksbegehren während der
achttägigen Auflagefrist im autonomen Bereich selbst festlegen
können.
Wörtlich wird dazu
weiter ausgeführt:
“Begründung:
Unbeschadet der
Einwohnerzahl und der Dienstzeiten der Kommunen haben diese im Bundesgesetz
exakt festgelegte Öffnungszeiten einzuhalten, wodurch bundesweit allein
durch Mehrdienstleistungsvergütungen Kosten in Höhe von
mindestens 25 Millionen Schilling je Volksbegehren verursacht
werden.”
In der
Ausschußsitzung am 3. Juli 1996 wurde beschlossen, Stellungnahmen
des Bundesministeriums für Inneres, des Bundeskanzleramtes sowie des
Städte- und des Gemeindebundes zu dieser Petition einzuholen.
Zur gegenständlichen
Petition nahm das Bundesministerium für Inneres wie folgt Stellung:
“Eine
Veränderung des § 7 Abs. 1 des Volksbegehrengesetzes 1973
zum Nachteil demokratischer Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürgerinnen
und Bürger wird für nicht zweckmäßig erachtet.
§ 7 Abs. 1 des Volksbegehrengesetzes 1973 enthielt in der
ursprünglichen Fassung der Wiederverlautbarung eine Regelung, die ziemlich
genau dem in der Petition enthaltenen Vorschlag entspricht. Diese Regelung
hatte seinerzeit dazu geführt, daß Eintragungswilligen in manchen
Gemeinden die Möglichkeit, ein Volksbegehren zu unterstützen,
auf Grund der knapp bemessenen Eintragungszeiten praktisch verwehrt war. Bei
der Novellierung des Volksbegehrengesetzes 1973 im Jahr 1982 (BGBl.
Nr. 233/1982) hat sich der Gesetzgeber daher dafür entschieden, die
Eintragungszeiten generell auf die geltende Länge festzulegen.
Zur vorliegenden
Problematik ist allgemein festzuhalten, daß der ,Andrang‘ bei
zurückliegenden Volksbegehren nicht notwendigerweise einen
Rückschluß auf den Zustrom bei Volksbegehren mit anderen Themen
zuläßt. Jedenfalls geht es aber bei der Möglichkeit, ein
Volksbegehren durch Unterschriften zu unterstützen, nicht nur um das
subjektive Recht jedes einzelnen Wahlberechtigten, seine Unterschrift zu leisten,
sondern vor allem um die Frage, zu welchen Bedingungen Proponenten eines
Volksbegehrens die für die Behandlung des Anliegens im Parlament
erforderlichen Eintragungen erreichen können. Jede Einschränkung der
in der kritisierten Bestimmung normierten Eintragungsfristen würde
jedenfalls die – bislang – bestehende Möglichkeit von
Proponenten eines Volksbegehrens schmälern, die erforderliche Zahl von das
Anliegen unterstützenden Unterschriften zu erhalten.”
Das
Bundeskanzleramt-Ministerratsdienst teilte zur gegenständlichen Petition
folgendes mit:
Ҥ 7
Abs. 1 letzter Satz des Volksbegehrengesetzes 1973 bestimmt, daß die
Eintragungslokale an Werktagen zumindest von 8.00 bis 16.00 Uhr, an zwei
Werktagen zusätzlich bis 20.00 Uhr, und an Samstagen sowie an Sonn- und
Feiertagen zumindest von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr offenzuhalten sind.
Dem Bundeskanzleramt ist
bewußt, daß diese Regelung auf Grund der anfallenden Mehrdienstleistungsvergütungen
nicht unbeträchtliche Kosten verursacht. Es weist jedoch darauf hin,
daß die in den Mindestöffnungszeiten gelegene Garantie der
Zugänglichkeit des Eintragungsverfahrens für die effektive
Ausübung der den Bürgern gewährleisteten direktdemokratischen
Mitwirkungsinstrumente von wesentlicher Bedeutung ist und daß sie
überdies eine gewisse Gleichbehandlung aller Volksbegehren sichert, die
bei einer ad hoc erfolgenden Festsetzung der Eintragungszeiten nicht
gewährleistet wäre. Außerdem sollte die Möglichkeit, ein
Volksbegehren auch am Abend und am Wochenende unterstützen zu können,
im Interesse der Berufstätigen und der Pendler unbedingt erhalten
bleiben.”
Der Österreichische
Städtebund bezog zur Petition Nr. 1 folgende Stellung:
“Aus der Sicht
größerer Städte ist eine Abänderung der derzeitigen
gesetzlichen Bestimmungen nicht erforderlich. Für kleinere Gemeinden
scheint jedoch eine autonome Festlegung der Öffnungszeiten für das
Eintragungsverfahren durchaus sinnvoll, sodaß eine jeweils
angepaßte flexible Eintragungszeit als alternative Regelung dem § 7
Abs. 1 Volksbegehrengesetz 1973 angefügt werden sollte.”
Der Österreichische
Gemeindebund übermittelt dem Ausschuß für Petitionen und
Bürgerinitiativen des Nationalrates folgende Stellungnahme zum
angeführten Gegenstand:
“Seitens des
Österreichischen Gemeindebundes wird die Petition Nr. 1 auf
Abänderung des § 7 Abs. 1 Volksbegehrengesetz
unterstützt.
Die Festsetzung der
Öffnungszeiten für das Eintragungsverfahren ist für alle
Magistrate und Gemeindeämter einheitlich vorgenommen worden. Dabei
wurde keinerlei Rücksicht auf strukturelle, geo- und demographische sowie
andere regionale und örtliche Umstände der Gemeinden genommen.
Die Praxis, vor allem in
kleinen Gemeinden, zeigt immer wieder, daß die bundesgesetzlich
festgelegten Öffnungszeiten vielfach an der Realität vorbeigehen und
für die Gemeinden mit erheblichen unnötigen Kosten verbunden sind.
Die bestehende Regelung ist daher völlig unbefriedigend, und eine
Flexibilisierung der Öffnungszeiten wird begrüßt.
Grundsätzlich
sollten jedoch die Gemeinden die erforderlichen Öffnungszeiten ohne
Unterschreitung selbst festlegen können, dies jedoch bei der
Gewährleistung von Mindestöffnungszeiten.
Auf Grund dieser
Erwägungen erachtet es der Österreichische Gemeindebund als sinnvoll,
die Eintragungsfrist mit maximal acht Stunden außerhalb der Amtszeit
zu beschränken. Dabei ist vorzusehen, daß während der Woche nur
einmal bis 20 Uhr die Eintragung möglich ist. Zusätzlich
wäre am Samstag und/oder Sonntag eine Eintragungsmöglichkeit
vorzusehen, die insgesamt vier Stunden nicht überschreiten soll.
Außerdem wird
angeregt, die derzeitige Regelung betreffend Auflage der
Wählerverzeichnisse am Wochenende auf deren Erforderlichkeit zu
überprüfen, da festgestellt wurde, daß von Privatpersonen am
Wochenende fast nie Einsicht genommen wurde.”
Einstimmiger Beschluß
in der Ausschußsitzung am 17. Oktober 1996:
Ersuchen um Zuweisung an
den Verfassungsausschuß.
Verfassungsausschuß
Petition Nr. 2
überreicht vom Abgeordneten Dkfm. Mag. Josef Mühlbacher
betreffend “Änderung des § 124 der
Nationalrats-Wahlordnung 1992”
Die auf Initiative der Bürgermeisterkonferenz
des Bezirkes Freistadt eingebrachte Petition hat zum Inhalt, Kostenersätze
für die Durchführung von Nationalratswahlen zukünftig pauschal,
gemessen an der im Wählerverzeichnis einer Gemeinde angeführten
Wählerinnen und Wähler, abzugelten.
Dies wird wie folgt begründet:
“Die Abrechnung der Wahlentschädigung
für Gemeinden und Magistrate verursacht nach derzeitiger Rechtslage im
Verhältnis zu den tatsächlich abgegoltenen Kosten einen
ungebührlich hohen Verwaltungsaufwand, der mit einer
Pauschalabgeltung je Wahlberechtigten vermieden werden könnte.
Darüber hinaus sollte durch eine Pauschalabrechnung eine rasche Auszahlung
der Wahlentschädigung gewährleistet sein. Es wird in diesem
Zusammenhang darauf verwiesen, daß ein Großteil der Gemeinden bis
zum heutigen Tag auf die Refundierung der Wahlausgabe anläßlich der
NR-Wahl 1994 harrt.
Im Sinne einer Verwaltungsvereinfachung hofft die
Bürgermeisterkonferenz des Bezirkes Freistadt auf eine positive Reaktion
des Nationalrates.”
In der Ausschußsitzung am 3. Juli 1996
wurde beschlossen, Stellungnahmen des Bundesministeriums für Inneres, des
Bundeskanzleramtes sowie des Städte- und des Gemeindebundes zu dieser
Petition einzuholen.
Das Bundesministerium für Inneres nahm zur
Petition Nr. 2 wie folgt Stellung:
“Die gemäß § 124 der
Nationalrats-Wahlordnung 1992 gegenwärtig bestehende Kostenersatzregelung
hat sich aus der Sicht des Bundesministeriums für Inneres in der
Vergangenheit gut bewährt. Im Hinblick auf das Gebot der Sparsamkeit
erscheint es vor allem zweckmäßig, daß die Gemeinden die ihnen
bei der Durchführung einer Nationalratswahl tatsächlich erwachsenden
Kosten nachweisen müssen, wenn diese die Bemessungsgrundlage für
einen Kostenersatz darstellen sollen.
Es steht außer Zweifel, daß
pauschalierte Kostenersätze unbürokratischer zu administrieren
wären, als dies bei der gegenwärtigen Kostenersatzregelung
möglich ist. Es bestehen seitens des Bundesministeriums für Inneres
gegen entsprechende Regelungen auch keine prinzipiellen Einwände, sofern
dem Bund keine Mehrkosten entstehen würden. Voraussetzung für die
Einführung von pauschalierten Kostenersätzen für
Nationalratswahlen wäre jedoch, daß die Länder sich auf einen
Vorschlag hinsichtlich der Höhe des Kostenersatzes einigen, der im
Gesamtergebnis für den Bund kostenneutral ist. Von dieser
Möglichkeit wurden die zuständigen Vertreter der Länder bereits
Anfang des Jahres in Kenntnis gesetzt.”
Zur gegenständlichen
Petition teilte das Bundeskanzleramt folgendes mit:
“Die gemäß
§ 124 der Nationalrats-Wahlordnung 1992 gegenwärtig bestehende
Kostenersatzregelung hat sich in der Vergangenheit gut bewährt. Im
Hinblick auf das Gebot der Sparsamkeit erscheint es vor allem
zweckmäßig, daß die Gemeinden die ihnen bei der
Durchführung einer Nationalratswahl tatsächlich erwachsenden Kosten
nachweisen müssen, wenn diese die Bemessungsgrundlage für einen
Kostenersatz darstellen sollen.
Es steht außer
Zweifel, daß pauschalierte Kostenersätze unbürokratischer zu
administrieren wären, als dies bei der gegenwärtigen
Kostenersatzregelung möglich ist. Es bestehen seitens des
Bundesministeriums für Inneres gegen entsprechende Regelungen auch keine
prinzipiellen Einwände, sofern dem Bund keine Mehrkosten entstehen
würden. Voraussetzungen für die Einführung von pauschalierten
Kostenersätzen für Nationalratswahlen wäre jedoch, daß die
Länder sich auf einen akkordierten Vorschlag hinsichtlich der Höhe
des Kostenersatzes einigten, welcher für den Bund jedenfalls kostenneutral
ist. Von dieser Möglichkeit wurden die zuständigen Vertreter der
Länder bereits Anfang des Jahres in Kenntnis gesetzt.”
Der Österreichische
Gemeindebund übermittelte dem Ausschuß für Petitionen und
Bürgerinitiativen zur angeführten Petition folgende Stellungnahme:
“Seitens des
Österreichischen Gemeindebundes wird die Petition Nr. 1 auf
Abänderung des § 124 NRWO 1992 vollinhaltlich unterstützt.
Die bestehende Regelung
auf Wahlkostenersatz für die Gemeinden ist
unverhältnismäßig niedrig. Sie ist darüber hinaus auch mit
großem administrativen Aufwand für den Antragsteller verbunden und
könnte viel einfacher gestaltet werden.
Es wird die Ansicht
vertreten, daß die Wahlentschädigung für Gemeinden auf Grund
einer Pauschalabgeltung entsprechend der Anzahl der Wahlberechtigten zu
erfolgen hat. Wir verweisen diesbezüglich auf bereits bestehende
entsprechende landesrechtliche Regelungen wie etwa im Burgenland oder in
Oberösterreich.”
Von seiten des
Österreichischen Städtebundes erging folgende Stellungnahme:
“Im Sinne des
Beschlusses des parlamentarischen Ausschusses für ,Petitionen und
Bürgerinitiativen‘ betreffend Änderung des § 124 der
Nationalratswahlordnung 1995 gibt der Österreichische Städtebund
folgende Stellungnahme ab:
Aus Gründen der
Verwaltungsvereinfachung wäre eine Pauschalierung von Ersätzen der
Wahlkosten durchaus zu begrüßen, jedoch analog Regelungen bei
statistischen Erhebungen lassen befürchten, daß die Ersätze
nicht dem gesetzlichen Auftrag entsprechend abgegolten werden. Es
müßte daher durch gesetzliche Regelungen gesichert werden,
daß infolge einer Pauschalierung keine Einnahmenminderung für die
Gemeinden entsteht. Die Voraussetzungen für eine pauschalierte
Kostenabgeltung wären jedenfalls mit der Interessensvertretung der
Gemeinden, dem Österreichischen Städtebund und dem Österreichischen
Gemeindebund, zu verhandeln und einvernehmlich festzulegen.”
Einstimmiger Beschluß in der Ausschußsitzung am 17. Oktober 1996:
Ersuchen um Zuweisung an den
Verfassungsausschuß.
Verfassungsausschuß
Petition Nr. 3
überreicht von den Abgeordneten Theresia Haidlmayr,
Dr. Volker Kier, Dr. Helene Partik-Pablé, Mag. Walter
Guggenberger und Dr. Gottfried Feurstein betreffend “Bus
und Bahn für alle – Resolution für ein
Gleichstellungsgesetz”
Die gegenständliche Petition ist in XIX. GP
als Bürgerinitiative Nr. 8 im Nationalrat durch das Auslaufen der
Legislaturperiode verfallen und nun in Form einer Petition neu eingebracht
worden. Sie hat folgenden Wortlaut:
“BUS UND BAHN FÜR ALLE!
RESOLUTION FÜR EIN GLEICHSTELLUNGSGESETZ
Behinderte Menschen (zB mit Rollstuhl) können
die öffentlichen Verkehrsmittel nicht benutzen. Deshab verlangen wir,
daß alle öffentlichen Verkehrsmittel (für den
Personennahverkehr und Personenfernverkehr) behindertengerecht
ausgestattet und mit Hubplattformen als Einstiegshilfe ausgerüstet werden.
Die Kosten dieser zukünftigen Ausstattung der öffentlichen
Verkehrsmittel sollen über die erhöhte Mineralölsteuer abgedeckt
werden.
Wir fordern auch eine gesetzliche Regelung, die
sicherstellt, daß Diskriminierungen von behinderten Menschen nicht nur im
Bereich Verkehr, sondern in allen Lebensbereichen – wie:
öffentlicher Raum, Wohnen, Ausbildung, Arbeit – verhindert werden.
Solche Regelungen zur Gleichstellung (Anti-diskriminierung) müssen
erreichen, daß behinderte Menschen aus keinem Lebensbereich
ausgeschlossen und mit allen anderen gleichgestellt werden; sie müssen
diese (Menschen-)Rechte auch einklagen können.
ERLÄUTERUNGEN ZUR PETITION
Menschen mit Behinderungen sind täglich in
vielen Lebensbereichen erheblicher Diskriminierung ausgesetzt. Sie werden nicht
gleich geachtet, in ihren Entfaltungsmöglichkeiten behindert, in ihren
Entscheidungen bevormundet, durch vielfältige Formen alltäglicher
Gewalt (durch Institutionen, aber auch durch einzelne Personen) diskriminiert.
Es gibt bisher kein rechtliches Instrumentarium, mit dem sich behinderte
Menschen zur Wehr setzen können.
Deshalb verlangen wir ein Gleichstellungs- oder
Antidiskriminierungsgesetz bzw. die verfassungsrechtliche Gleichstellung
behinderter Menschen in allen Lebenslagen. Wenn es um Menschenrechte und
Gleichberechtigung geht, müssen behinderte Menschen ihre Rechte
gerichtlich einfordern und durchsetzen können. Die amerikanische
Behindertenbewegung hat 1990 ein solches Gesetz bereits erkämpft. Seither
gibt es von Behinderten in ganz Europa immer wieder Aktionen und Versuche,
entsprechende gesetzliche Regelungen zu erreichen.
Was “Bus und Bahn für alle”
betrifft, so ist damit der gesamte öffentlich finanzierte Personenah- und
Personenfernverkehr, wie zB städtische Busse, Bundes- und Postbusse,
Schülertransporte, Linien im Schülerverkehr, Straßenbahnen,
U-Bahn, S-Bahn, Bundesbahn usw. gemeint. Es geht darum, die öffentlichen
Verkehrsmittel barrierefrei für alle Menschen zugänglich zu machen und
zB mit Hubplattformen (bzw. Hubliften) auszustatten. Als Vorbild kann auf
die amerikanischen Gesetze zur Antidiskriminierung verwiesen werden, die
bewirkt haben, daß in den gesamten USA die Busse mit Hubplattformen
ausgerüstet sind. Auch in Deutschland sind inzwischen schon viele hunderte
Niederflurbusse mit entsprechenden Einstiegshilfen im Einsatz.
Beispiele für Diskriminierung:
– Wenn
Gesetze und Verordnungen gelten, die Stufen bei
Fußgängerübergängen, vor Geschäften und
öffentlichen Gebäuden (Schule, Post usw.) zulassen, so ist dies
diskriminierend;
– wenn nicht genügend
barrierefreie und behindertengerechte Wohnungen gebaut und an Behinderte
vergeben werden und damit ein Zwang zu Heimeinweisungen erzeugt wird, so ist
dies diskriminierend;
– wenn Menschen aus Mangel an
Pflegegeld und ambulanten Diensten nicht wählen können, ob sie zu
Hause oder im Heim, Assistenzdienste und pflegerische Hilfen bekommen, so ist
dies diskriminierend;
– wenn Kinder für
bildungsunfähig erklärt werden, so ist dies diskriminierend;
– wenn behinderte Kinder in
Kindergarten und Schule nicht integriert werden, weil sich die
Kindergärten und Schulen nicht entsprechend organisieren, so ist dies
diskriminierend;
– wenn sich Ämter,
öffentliche und private Betriebe von der Pflicht, behinderte Menschen
anzustellen, freikaufen können oder behinderte Menschen schlechter bezahlt
werden als nichtbehinderte, so ist dies diskriminierend;
– wenn behinderte Menschen
ohne ihre Zustimmung sterilisiert werden können, so ist dies
diskriminierend.
Diese Resolution ist eine Initiative folgender
Vereinigungen:
Behinderten-Informationszentrum BIZEPS, Wien.
Evangelischer Diakonieverein, Salzburg. Initiative Minderheitenjahr 1994,
Österreich. Integration Österreich – Elterninitiativen für
gemeinsames Leben behinderter und nichtbehinderter Menschen.
Interessengemeinschaft privater Behinderteneinrichtungen, Tirol. Lebenshilfe
Salzburg. Mobiler Hilfsdienst, Dornbirn, Innsbruck, Salzburg.
Österreichischer Blindenverband. Österreichisches Forum der
Behinderten- und Krüppelinitiativen. Österreichische Gesellschaft
für Muskelkranke. Österreichischer Zivilinvalidenverband.
Sozialberatung für Menschen mit Behinderung, Tirol. Tiroler
Sozialparlament. Treffpunkt für Behinderte und Nichtbehinderte, Dornbirn.
Verein Arche, Tirol. Verein Domino, Linz. Verein i-Punkt, Hallein. Verein
Integriertes Wohnen IWO, Innsbruck. Verein Miteinander, Linz. Verein zur
Förderung körperbehinderter Menschen, Tirol. Verein zur Integration
geistig behinderter Menschen IGB, Tirol. Österreichische
Arbeitsgemeinschaft Rehabilitation ÖAR – Dachorganisation der
österreichischen Behindertenverbände. Unterstützer sind noch
viele weitere Vereine, die hier nicht einzeln erwähnt werden und die
Mitglieder der genannten überregionalen Verbände sind.”
In der Ausschußsitzung am 3. Juli 1996
wurde einstimmig beschlossen, ein Hearing zur gegenständlichen Petition
durchzuführen, welches für den 17. Oktober 1996 angesetzt worden ist.
Zum Hearing wurden folgende Experten geladen:
Univ.-Doz. Dr. Volker Schönwiese, Mag.
Silvia Oechsner, Martin Ladstätter, Andreas Oechsner,
Dr. Adolf Joksch, Dr. Klaus Voget, Prof. Dr. Heinz Barazon,
Manfred Srb.
Einstimmiger Beschluß in der Sitzung am 17. Oktober 1996:
Ersuchen um Zuweisung an den
Verfassungsausschuß unter Anschluß der folgenden Ausschußempfehlung:
Die in der Petition Nr. 3 angeführten Forderungen sind auf ihre
Durchsetzungsmöglichkeit zu überprüfen sowie konkrete
Vorschläge über eine Verwirklichung auszuarbeiten.
Verfassungsausschuß
Petition Nr. 9
überreicht von den Abgeordneten Mag. Johann Maier,
Rudolf Anschober und Mag. Helmut Peter betreffend “Aufhebung
des Fahrverbots für Fahrräder auf Forststraßen”
Da diese Petition als Bürgerinitiative
Nr. 2 in der XIX. GP bereits eingebracht wurde, durch das Auslaufen
dieser Legislaturperiode jedoch verfallen ist, wurde sie als Petition erneut
eingereicht. Zu dieser Petition ist anzumerken, daß eine gleichlautende
Petition Nr. 7
überreicht von der Abgeordneten Bruni Fuchs
eingelangt ist. Diese beiden Petitionen sind
folgenden Inhalts:
“Das Radfahren auf Forststraßen ist
gegenwärtig nur in Ausnahmefällen erlaubt. Laut Forstgesetz darf zwar
jeder den Wald zu Erholungszwecken betreten und sich dort auch aufhalten.
Für Radfahrer aber ist die Benützung der Forststraßen an die
Zustimmung der Waldeigentümer bzw. Straßenerhalter gebunden.
Wir meinen, daß jene Waldstraßen, die
zur Nutzung durch LKWs und Traktoren angelegt wurden, auch von Fahrrädern
befahren werden könnten. Radfahrer sollen – wie Fußgänger
auch – die Forststraßen zu Erholungszwecken nutzen können. Wir
fordern die Aufhebung des Fahrverbotes für Fahrräder auf
Forststraßen, zumal auch kein sachlicher Grund erkennbar ist, wie ein
ordnungsgemäßes Fahrradfahren die Interessen der Waldeigentümer
beeinträchtigen könnte.
Die Unterzeichner fordern den Nationalrat auf,
eine entsprechende Änderung des Forstgesetzes (§ 33) zu
beschließen.”
Hinsichtlich dieser beiden Petitionen wurde in der
Ausschußsitzung am 3. Juli 1997 der einstimmige Beschluß gefaßt,
den Präsidenten zu ersuchen, sie dem Verfassungsausschuß zuzuweisen.
Verfassungsausschuß
Petition Nr. 10
überreicht vom Abgeordneten Ing. Leopold Maderthaner
betreffend “Stopp der Gesetzesflut”
Der Abgeordnete Ing. Leopold Maderthaner hat mit
der Petition Nr. 10 betreffend “Stopp der Gesetzesflut”
ein Anliegen des Österreichischen Wirtschaftsbundes mit breiter
Unterstützung dem Präsidenten des Nationalrates überreicht.
Darin sind folgende Ziele ausformuliert:
“1. Die
Aufforderung an alle Bundes- und Landesregierungsmitglieder, in ihrem
Zuständigkeitsbereich eine bedarfsorientierte Rechtsbereinigung
durchzuführen.
2. Ausbau
bzw. Einrichtung eines Legislativdienstes in Parlament und Landtagen, der
Gesetzesvorlagen auf ihre Notwendigkeit, Verständlichkeit und
Wirtschaftlichkeit (Folgekosten für die Wirtschaft) überprüft.
3. Vereinfachung
und Beschleunigung von Behördenverfahren zur Kostensenkung für die
Wirtschaft.
4. Kundmachung
aller Gesetze sechs Monate vor Inkrafttreten.”
Am 4. Dezember 1996 fand zu dieser Petition
ein Hearing statt, an dem folgende Experten teilgenommen haben:
von seiten der Initiatoren der
gegenständlichen Petition:
Ing. MADERTHANER
Generalsekretär Dr.
MITTERLEHNER
Univ.-Prof. Dr. KYRER
von seiten der parlamentarischen Klubs:
Dr. SCHNIZER
Univ.-Prof. Dr. HENGSTSCHLÄGER
Univ.-Prof. DI PICHLER
Dr. STAUDINGER
von seiten des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Angelegenheiten:
Dr. HANDLER
Dr. FUCHS
von seiten des Bundeskanzleramtes:
Univ.-Doz. Dr. LACHMAYER
von seiten der Volksanwaltschaft:
Dr. MAUERER
Dr. PETERNELL
In dieser Sitzung beschlossen die
Mitglieder des Ausschusses einstimmig folgendes:
Ersuchen um Zuweisung an den
Verfassungsausschuß.
Verfassungsausschuß
Petition Nr. 23
überreicht vom Abgeordneten Dr. Volker Kier
betreffend “Anerkennung der Gebärdensprache”
Die gegenständliche Petition enthält die
Forderung des Gehörlosenbundes nach Anerkennung der Gebärdensprache.
Das Forderungsprogramm lautet:
“Früherziehung:
– Recht der Eltern
gehörloser Kinder auf Information über Gebärdensprache und
Gebärdensprachgemeinschaft;
– Recht der Eltern
gehörloser Kinder auf bezahlten Gebärdensprachunterricht;
– Recht der gehörlosen
Kinder auf Angebot der Gebärdensprache.
Schule:
– Recht der gehörlosen
Schüler auf zweisprachigen Unterricht;
– Recht der gehörlosen
Schüler auf qualifizierte bilinguale gehörlose Lehrer;
– Recht hörender Lehrer,
welche Gehörlose unterrichten, auf Gebärdensprachausbildung.
Berufsausbildung:
– Recht der gehörlosen
Schüler auf Gebärdensprachdolmetscher in Berufsschulen, AHS, BHS und
Universitäten;
– Recht auf entsprechend
aufgearbeitetes Lehr- und Unterrichtsmaterial für gehörlose
Schüler.
Dolmetscher:
– Finanzierung einer
Ausbildungsstätte für Gebärdensprachdolmetscher;
– Finanzierung von
Gebärdensprachforschung als Grundlage für die Ausbildung von
Dolmetschern und Lehrern;
– Recht der Gehörlosen
auf Dolmetscher vor Gericht, Verwaltungsbehörden und allen
öffentlichen Einrichtungen.
ORF (Österreichisches Fernsehen):
– Erfüllung der
Informationspflicht des ORF durch den Einsatz von Gebärdensprachdolmetschern;
– Eine feste Sendezeit
für Gehörlose und detaillierte Untertitel bei
Informationssendungen.”
Im Zuge der Beratungen am 7. Mai 1997 hat der
Ausschuß beschlossen, Stellungnahmen des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst,
des Bundesministeriums für Wissenschaft und Verkehr, des Bundesministeriums
für Arbeit, Gesundheit und Soziales, des Bundesministeriums für
Unterricht und kulturelle Angelegenheiten sowie des ORF einzuholen.
Das Bundeskanzleramt – Verfassungsdienst
wies in seiner Stellungnahme darauf hin, daß der Nationalrat “die
Bundesregierung mit Entschließung vom 28. Jänner 1993
(E 92-NR/XVIII) ersucht hat, alle Maßnahmen zu ergreifen, damit die
Lebenssituation von gehörlosen und schwerhörenden Personen in
Österreich verbessert werde, und daß die Bundesregierung hiezu an
den Nationalrat den Bericht betreffend Anerkennung der Gebärdensprache
Gehörloser in Österreich auf Grund der Entschließung des Nationalrates
vom 28. Jänner 1993, E 92-NR/XVIII. GP (III-188 BlgNR XVIII. GP)
erstattet hat.
Weiters ist darauf hinzuweisen, daß die
einzelnen Punkte des den Gegenstand der fraglichen Petition bildenden
Forderungsprogramms großteils in den Wirkungsbereich des
Bundesministeriums für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten, daneben
auch in den des Bundesministeriums für Wissenschaft und Verkehr
fallen. Im Hinblick auf die unter ,Früherziehung‘ geforderten
Rechte ist auch auf die Grenzen der Gesetzgebungskompetenz des Bundes
hinzuweisen, in die die Normierung eines Rechts der Eltern gehörloser
Kinder auf Information über Gebärdensprache und
Gebärdensprachgemeinschaft ebensowenig fällt wie etwa das
Kindergartenwesen und das Hortwesen (vgl. Art. 14 Abs. 4 lit. b
B-VG).
Was die unter ,Berufsausbildung‘ geforderten
Rechte betrifft, darf von einer Stellungnahme des Bundesministeriums
für Wissenschaft und Verkehr (GZ 5130/2-Pr/S/1997 vom 21. Mai
1997), die in einem vergleichbaren Zusammenhang erstattet wurde, Mitteilung
gemacht werden:
Demnach bietet das Institut für
Übersetzer- und Dolmetscherausbildung der Karl-Franzens-Universität
Graz bereits jetzt eine große Anzahl von Lehrveranstaltungen (als
Lehrveranstaltungen für alle Sprachrichtungen) an, die der Ausbildung
von Gebärdensprachdolmetschern dienen. Die Universität Graz habe
somit bereits erhebliche Vorarbeiten auf dem Sektor der
gebärdensprachlichen Ausbildung geleistet. Auch wird darauf hingewiesen,
daß die Universität für Bildungswissenschaften Klagenfurt,
Institut für Sprachwissenschaft und Computerlinguistik,
gebärdensprachliche Lehrveranstaltungen anbietet; im Sommersemester
1997 sei zB ein Seminar ,zur Grammatik der Österreichischen
Gebärdensprache‘ abgehalten worden. Über studienrechtliche
Konzeptionen der Zukunft könne allerdings derzeit noch keine Aussage
getroffen werden.
Zum unter ,Dolmetscher‘ geforderten
Recht der Gehörlosen auf Dolmetscher vor Gericht, Verwaltungsbehörden
und allen öffentlichen Einrichtungen ist auszuführen:
– Soweit ein Recht der
Gehörlosen auf Dolmetscher vor Gericht gefordert wird, ist primär
eine Zuständigkeit des Bundesministeriums für Justiz gegeben,
dies angesehen von Verfahren vor dem Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof
und vor dem Verwaltungsgerichtshof. § 62 Abs. 1 VwGG bestimmt,
daß im Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof, soweit das VwGG nicht
anderes vorsieht, das AVG (dazu sogleich) anzuwenden sei. Da entgegenstehende
Regelungen nicht vorhanden sind, ist im Verfahren vor dem
Verwaltungsgerichtshof insbesondere auch § 39a AVG anzuwenden.
Für Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof gelten in dieser Hinsicht die
Vorschriften der ZPO und des EGZPO.
Im Zusammenhang mit dem
gerichtlichen Verfahren darf von einer Stellungnahme des Bundesministeriums
für Justiz (GZ 11.850/73-I 6/97 vom 9. Mai 1997), die in
einem vergleichbaren Zusammenhang erstattet wurde, Mitteilung gemacht
werden:
Demnach führen die
Präsidenten der Gerichtshöfe erster Instanz gemäß dem
Bundesgesetz über den allgemein beeideten gerichtlichen
Sachverständigen und Dolmetscher (SDG), BGBl. Nr. 137/1975,
Sachverständigen- und Dolmetscherlisten, in die die allgemein beeideten
gerichtlichen Sachverständigen und Dolmetscher eingetragen werden. In
diese Listen werde die Taubstummensprache (Gebärdensprache) als eigene
Sprache geführt. Wie bei den listenführenden
Gerichtshofpräsidenten erhoben worden sei, gebe es bei der Verwendung der
Gebärdensprachdolmetscher keine praktischen Probleme. Die erforderliche
Sachkunde dieser Dolmetscher werde nach § 2 Abs. 2 Z 1
lit. a in Verbindung mit § 14 SDG vor der Eintragung in die
Listen geprüft. Zum Teil werden dabei Vorschläge bzw. Stellungnahmen
der betreffenden Landesgehörlosenverbände eingeholt, zum Teil werde
die Eignung des Bewerbers unter Heranziehung bereits in die Liste eingetragener
Dolmetscher für die Gebärdensprache geprüft. Teilweise handelt
es sich bei den eingetragenen Dolmetschern sogar um einschlägige
Fachpädagogen, teilweise auch um Personen, deren Angehörige selbst
taubstumm seien und die die Taubstummensprache erlernt haben. Nach Ansicht des
Bundesministeriums für Justiz seien daher die Rechte der Gehörlosen
im gerichtlichen Verfahren ausreichend gewährleistet. Weitere
Verbesserungen seien für die nahe Zukunft insofern geplant, als im Rahmen
einer SDG-Novelle, die demnächst zur allgemeinen Begutachtung versendet
werde, die nähere Vorgangsweise bei der Prüfung der Sachkunde der
Sachverständigen und Dolmetscher auf eine einheitliche gesetzliche Basis
gestellt werden solle.
– Soweit ein Recht der
Gehörlosen auf Dolmetscher vor Verwaltungsbehörden gefordert wird,
ist auf den § 39a AVG hinzuweisen. Nach dieser Bestimmung ist dann,
wenn eine Partei oder eine zu vernehmende Person insbesondere taub oder stumm
ist, erforderlichenfalls der der Behörde beigegebene oder zur Verfügung
stehende Dolmetscher beizuziehen. Die Kosten, die in Gestalt der einem
solcherart beigezogenen Gehörlosendolmetscher zustehenden Gebühren
anfallen, gelten gemäß § 76 Abs. 1 zweiter Satz AVG
nicht als Barauslagen und unterfallen daher der Regel des § 75
Abs. 1 AVG, wonach die Kosten für die Tätigkeit der
Behörden in Verwaltungsverfahren von Amts wegen zu tragen sind. Mit dieser
im Jahr 1995 geschaffenen Regelung wurde dem vorgetragenen Anliegen für
den Bereich der dem Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 unterliegenden
Verfahren entsprochen.
Dabei ist
einzuräumen, daß die Beiziehung eines Gehörlosendolmetschers im
Verwaltungsverfahren nur für einen bestimmten Abschnitt desselben,
nämlich das Ermittlungsverfahren, vorgesehen ist. Welche konkreten, wohl
weitergehenden Vorstellungen der gegenständlichen Petition zugrunde
liegen, ist dem Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst nicht klar erkennbar. Es
könnte an die Schaffung einer Regelung gedacht sein, wie sie in einem vor
allem territorial begrenzten Umfang für die slowenische und die kroatische
Sprache besteht. Dabei ist jedoch festzuhalten, daß es sich bei den
Benützern der Gebärdensprache nicht um eine Volksgruppe im Sinne des
Volksgruppengesetzes handelt: Unter Volksgruppen versteht nämlich § 1
Abs. 2 Volksgruppengesetz, BGBl. Nr. 396/1976, ,die in Teilen des
Bundesgebietes wohnhaften und beheimateten Gruppen österreichischer
Staatsbürger mit nicht deutscher Muttersprache und eigenem
Volkstum‘. Damit ist für den Begriff der Volksgruppe konstitutiv,
daß eine Beheimatung als Gruppe in (bestimmten) Teilen des Bundesgebietes
vorliegt (auch wenn man der Ansicht sein könnte, daß die
Gebärdensprache eine ,nicht deutsche‘ Sprache und ihr eine eigene
Kultur zugeordnet sei). Die Erlassung einer Amtssprachenverordnung auf der
Grundlage des Volksgruppengesetzes kommt daher nicht in Betracht.
Bereits im Zusammenhang
mit einer früheren Petition wurde auch an die Schaffung einer gesetzlichen
Regelung nach dem Vorbild der §§ 13 bis 17 des
Volksgruppengesetzes gedacht. Nach den Bestimmungen des
Volksgruppengesetzes haben die Träger der Behörden und Dienststellen
sicherzustellen, daß im Verkehr mit den Behörden und Dienststellen
nach Maßgabe näherer Bestimmungen die Sprache einer Volksgruppe
gebraucht werden kann (§ 13 Abs. 1). Eine Person, die in einer
Tagsatzung oder mündlichen Verhandlung von der Sprache einer Volksgruppe
Gebrauch zu machen beabsichtigt, hat dies unverzüglich nach Zustellung der
Ladung der Behörde oder Dienststelle bekanntzugeben, widrigenfalls ihr die
durch schuldhafte Unterlassung einer solchen Bekanntgabe verursachten Mehrkosten
auferlegt werden können (§ 15 Abs. 1). Wird entgegen den
Bestimmungen des Volksgruppengesetzes die Sprache einer Volksgruppe nicht
verwendet oder die Verwendung der Sprache nicht zugelassen, so gilt für
den betreffenden Verfahrensschritt der Anspruch derjenigen Partei auf
rechtliches Gehör als verletzt, zu deren Nachteil der Verstoß
unterlaufen ist; ein Verstoß gegen § 15 begründet
Nichtigkeit im Sinne des § 281 Abs. 1 Z 3 StPO bzw.
§ 68 Abs. 4 Z 4 AVG.
Wenngleich derartige
Regelungen für Gehörlose nicht unvorstellbar sind, so dürften
doch gesetzlichen Vorkehrungen, die über die im Jahr 1995 bereits
geschaffene, weiter oben skizzierte Regelung hinausgehen – etwa der
(Finanzierung der) Beiziehung von Dolmetschern zur Ermöglichung
mündlicher Anbringen – vor allen Dingen Schwierigkeiten praktischer
und finanzieller Natur entgegenstehen. Bereits nach der geltenden Rechtslage
ist es jedoch möglich, daß ein Gehörloser in Begleitung eines
Gehörlosendolmetschers vor einer Verwaltungsbehörde erscheint, dessen
er sich bei seinem Anbringen bedient.
– Eine Prüfung des in
Rede stehenden Anliegens für den Bereich anderer Verfahrensordnungen (zB
Bundesabgabenordnung, Landesabgabenordnungen, Abnahme mündlicher Prüfungen)
wäre vom jeweils zuständigen Bundesministerium bzw. den Ämtern
der Landesregierungen vorzunehmen. An dieser Stelle kann allerdings immerhin
auf eine Stellungnahme des Bundesministeriums für Finanzen
(GZ 61 2105/60-II/11/94 vom 21. November 1994) verwiesen werden.
Darin wird insbesondere ausgeführt, daß Abgabenverfahren vor den
Abgabenbehörden des Bundes durch den Grundsatz der Schriftlichkeit
geprägt seien und Mündlichkeit die Ausnahme bilde; so habe etwa die
Abgabenbehörde gemäß § 85 Abs. 3 BAO mündliche
Anbringen nur entgegenzunehmen, wenn dies in den Abgabenvorschriften
vorgesehen ist – was die Ausnahme und nicht die Regel bilde –, wenn
dies für die Abwicklung des Abgabenverfahrens zweckmäßig ist
oder wenn die Schriftform dem Einschreiter nach seinen persönlichen
Verhältnissen nicht zugemutet werden kann. Die Vernehmung eines
Gehörlosen als Auskunftsperson oder Zeuge könne auch schriftlich
geschehen (§ 143 Abs. 3 und § 173 Abs. 1 BAO),
womit die Beiziehung eines Gehörlosendolmetschers entbehrlich werde. Das
Bundesministerium für Finanzen räumte freilich ein, es
müsse für die Abgabenbehörde grundsätzlich die
Möglichkeit bestehen, in Abgabenverfahren auch mit gehörlosen
Parteien in mündlichen Kontakt zu treten, was aber nur durch die
Beiziehung von Gehörlosendolmetschern möglich sei. Das Bundesministerium
für Finanzen wolle sich daher einer Kostentragungsregelung in der Bundesabgabenordnung
zugunsten gehörloser Parteien keineswegs verschließen, wenngleich
die Schaffung einer solchen Regelung im Hinblick auf den für
Abgabenverfahren geltenden Grundsatz der Schriftlichkeit nicht von
höchster Priorität erscheine; es nehme eine diesbezügliche
Änderung der Verfahrensgesetze für die nächste erforderlich
werdende BAO-Novelle in Vormerkung.
Zum Abschnitt ,ORF (Österreichisches Fernsehen)‘:
Wenngleich das Anliegen des Österreichischen
Gehörlosenbundes durchaus verständlich erscheint, ist zu betonen,
daß die Tätigkeit des Österreichischen Rundfunks oder
seiner Organe keinen Bereich der Gesetzgebung oder eine Maßnahme der
Vollziehung darstellt. Die Organe des ORF sind keine Organe des Bundes. Ihnen
stehen in keinem Fall hoheitliche Befugnisse zu – sie handeln im Bereich
der Privatautonomie (vgl. VfSlg. 7593/1975, 7717/1975). Im Sinne der von Art. I
Abs. 2 des Bundesverfassungsgesetzes vom 10. Juli 1974 über
die Sicherung der Unabhängigkeit des Rundfunks, BGBl. Nr. 396/1974,
geforderten Unabhängigkeit wurde der ORF als selbständige Anstalt
öffentlichen Rechts durch das Rundfunkgesetz eingerichtet. Die verfassungsrechtliche
Unabhängigkeitsgarantie verbietet eine Ausgestaltung der Aufsicht in der
Weise, daß der Staat bestimmenden Einfluß etwa auf Programminhalte
bzw. Gestaltungsgrundsätze erhält. Dem Bundeskanzler ist entsprechend
diesen Ausführungen jede Einflußnahme auf die Tätigkeit des
Österreichischen Rundfunks verwehrt.
Der Vollständigkeit halber ist zu bemerken,
daß – wie dem Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst bekannt ist
– der ORF ein im Vergleich zu den öffentlich-rechtlichen
Veranstaltern in den Nachbarländern Deutschland und Schweiz hohes
Ausmaß seines Fernsehprogramms, nämlich rund 150 Stunden pro
Monat, untertitelt und auch teilweise Sendungen parallel durch einen
Gebärdendolmetsch präsentiert werden.”
Das Bundesministerium für Wissenschaft und
Verkehr nahm betreffend Anerkennung der Gebärdensprache wie folgt
Stellung:
“Das Institut für Übersetzer- und
Dolmetscherausbildung der Universität Graz bietet bereits jetzt eine
große Anzahl von Lehrveranstaltungen an, die der Ausbildung von
Gebärdensprachdolmetschern dienen. Ein Auszug aus dem Studienführer
der Universität Graz für das Sommersemester 1997 ist in der Anlage
angeschlossen.
Wie diesem Auszug aus dem Studienführer der
Universität Graz zu entnehmen ist, hat die Universität Graz somit
bereits erhebliche Vorarbeiten auf dem Sektor der gebärdensprachlichen
Ausbildung geleistet. Über studienrechtliche Konzeptionen der Zukunft kann
allerdings derzeit noch keine Aussage getroffen werden.
Ergänzend darf auch darauf hingewiesen
werden, daß die Universität Klagenfurt (Institut für
Sprachwissenschaft und Computerlinguistik) unter der Leitung von Univ.-Doz. Dr.
Franz Dotter gebärdensprachliche Lehrveranstaltungen anbietet. Im
Sommersemester 1997 wird zB ein Seminar ,zur Grammatik der Österreichischen
Gebärdensprache‘ abgehalten.”
Dieser Auszug wurde dem Schreiben als Anlage
beigelegt:
17. Übersetzer-
und Dolmetscherausbildung
Inst.: Merang. 70
Für die mit ANM bezeichneten
Lehrveranstaltungen ist eine eigene Anmeldung am Institut erforderlich. Für
die mit TZB bezeichneten Lehrveranstaltungen besteht zusätzlich eine
Beschränkung der Teilnehmerzahl. Beachten Sie auch die Anschläge
im Institut zu Beginn des Semesters.
Studierende, welche die erste Diplomprüfung
abgelegt haben, müssen sich für den StZw. Übersetzerausbildung
oder den StZw. Dolmetscherausbildung entscheiden und dies bei der Inskription
bekanntgeben.
Nähere Auskünfte über das Studium
sowie über die Anrechnung von Lehrveranstaltungen anderer
Studienrichtungen erteilt das Sekretariat. Außerdem bietet die
Studierendenvertretung zu Semesterbeginn eine Inskriptionsberatung an.
17.1.
Lehrveranstaltungen für alle Sprachrichtungen
520.772 Pruné E.: Einführung in die
Übersetzungswissenschaft (II), VO, 2st., Mi. 13.45–15.15, UR
33.1.010
520.920 Grbie/Stachl-Peier:
Übersetzungswissenschaftliches Proseminar (II), PS, 2st., Do.
10.15–11.45, SR 33.1.090, ANM, TZB
520.695 Pruné E./Grièé:
Übersetzungswissenschaftliches Sem. (II), SE, 2st., Mo. 17.15–18.45,
SR 33.1.090, ANM
520.696 Pruné E./Wolf: Seminar für Diss.
und Dipl. (II), SE, 2st., Mi. 17.15–18.45, SR 33.1.090, ANM
520.248 Mitteregger: Deutsche Stilistik (für
dt. Muttersprachler), VU, 2st., Di., 10.15–11.45, UR 33.1.006, ANM
520.479 Götz: Deutsche Stilistik (für
Deutsch, 1. Fremdsprache), VU, 2st., Mi. 13.45–15.15,
UR 33.1.102, ANM
520.983 Färber: Probleme des Konsekutivdolm.
inkl. Notizentechnik,VO, 2st. (Block), Z.u.O.n.V.
520.??2 Pacher: Einführung in Recht und
Wirtschaft (II), VO, 2st.,, Mi. 17.15–18.45, ÜR 33.1.010
520.896 Mittelberger I.: Internationale
Organisationen (II), VO, 1st., Fr. 12.00–12.45, ÜR 33.1.010
520.932 Balluch: Sprecherziehung und Stimmschulung
(II), VU, 2st., Di. 15.30–17.00, ÜR 33.0.5.030
520.883 Schubert: EDV für Sprachmittler/innen
(II), VU, 2St., Di. 17.15–18.45, ÜR 33.1.010
520.882 Schubert: UE zu EDV für
Sprachmittler/innen (II), UE, 1st., Mi. 17.00–18.30, EDV-Lehrsaal
520.506 Grbie: Linguistische Grundlagen der
Gebärdensprache (II), PS, 2st., Do. 8.30–10.00,
SR 33.1.090, ANM, TZB
520.641 Holzinger: Einführung in die Analyse der
Gebärdensprache, VU, 2st. (Block), Z.u.O.n.V
520.861 Hofstätter/Stalzer: Gebärdensprache
Grundkurs (II), UE, 4st., Mo. 17.15–18.45, UR 33.1.108, Do.
17.15–18.45, UR 33.1.108, ANM, TZB
520.860 Hofstätter/Stalzer: Gebärdensprache
Aufbaukurs (II), UE, 2st., Mi. 17.15–18.45, UR 33.1.108
520.853 Schodterer: Gebärdensprache Grammatik,
UE, 2st. (Block), Z.u.O.n.V.
520.503 Jedinger: Gebärdensprache Konversation (II),
UE, 2st., Di. 8.30–10.00, ÜR 33.0.5.026
520.505 Tischmann: Nonverbale Kommunikation für Gebärdensprachstud.
(II), UE, 2st., Mi. 15.30–17.00, SR 33.0.226
520.507 Mikulasek: Österr. Gebärdenspr.
– Community Interpreting (I), UE, 2st. (Block), Z.u.O.n.V.
520.481 Schodterer: Österreichische
Gebärdensprache – Simultandolm. (II), UE, 2st. (Block),
Z.u.O.n.V.”
Das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit
und Soziales gab zur Petition Nr. 23 folgende Stellungnahme ab:
“Bereits im Behindertenkonzept der
Österreichischen Bundesregierung vom Dezember 1992 wurde auf die Wichtigkeit
der Gebärdensprache als Mittel zur Kommunikation gehörloser Menschen
hingewiesen sowie festgestellt, daß es einen großen Bedarf an
Untertitelung von Fersehsendungen gibt. Gehörlose als sprachliche
Minderheit sollten daher mehr als bisher unterstützt werden.
Das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit
und Soziales ist bestrebt, in seinem Kompetenzbereich die Integration
gehörloser und hörbehinderter Menschen zu fördern:
In den Bundessozialämtern wird eine
qualifizierte Beratung gehörloser Menschen, zum Teil auch in
Gebärdensprache, angeboten. Sowohl im Rahmen der beruflichen als auch der
sozialen Rehabilitation können aus Mitteln des Ausgleichstaxfonds unter
bestimmten Voraussetzungen Zuschüsse oder Kostenersatz für
Kommunikationshilfsmittel sowie Dolmetschkosten geleistet werden.
Gemeinsam mit anderen Bundesministerien und dem
Land Oberösterreich fördert das Bundesministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales das Projekt ,MUDRA‘ das erste
österreichische Gebärdensprachlexikon auf CD-Rom.
Das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit
und Soziales unterstützt die Forderung nach Anerkennung der
Gebärdensprache. Gebärdensprachen sind komplizierte räumliche
Sprachen, die sich – wie andere Hörsprachen – in jeder Nation
unterschiedlich entwickeln. Für die Anerkennung der österreichischen
Gebärdensprache im Sinne der Amtssprachenverordnung ist allerdings das
Bundeskanzleramt zuständig.”
Das Bundesministerium
für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten wies darauf hin, daß
Fragen im Zusammenhang mit der Anerkennung der Gebärdensprache in
Österreich nach einem parlamentarischen Entschließungsantrag bereits
detailliert im Rahmen einer interministeriellen Arbeitsgruppe behandelt wurden.
Dabei wurde seitens des Bundeskanzleramtes festgestellt, “daß eine
Anerkennung der Gebärdensprache im Sinne der Sprache einer Minderheit
formalrechtlich nicht erfolgen könne, da Minderheiten verfassungsrechtlich
nur im ethnischen Sinne anerkannt werden. Gehörlose Menschen stellen keine
Minderheit im ethnischen Sinne dar.
Eine in anderen
Rechtsbereichen erfolgende Anerkennung der Gebärdensprache kann nicht nur
in einem Teilbereich des Lebens erfolgen, sondern erfordert konkret
Möglichkeiten und Maßnahmen, die dem Lebensabschnitt der
verpflichtenden Schulbildung voran- und auch nachgehen. Somit setzen generelle
Überlegungen und die notwendigen Konsequenzen für das
Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten erst nach
einer allfälligen allgemein rechtlichen Anerkennung der Gebärdensprache
an.
Vom derzeit rechtlichen
Status der Gebärdensprache abgehoben, hat das Bundesministerium für
Unterricht und kulturelle Angelegenheiten bereits mit der Lehrplannovelle
1976 für den Bereich der Schule für Gehörlose Formen der
Verwendung von Gebärden im Unterricht eröffnet. In der spezifischen
Lehrerbildung ist der Besuch eines Gebärdensprachkurses
verpflichtend; in der theoretischen Ausbildung ist ein eigenes Blockseminar
für Gebärdensprache integriert. Darüber hinaus sind bereits an
fast allen österreichischen Schulen für Gehörlose auch
gehörlose Lehrer, Sozialpädagoginnen und Unterrichtsassistentinnen
pädagogisch tätig. Nach einem Angebot oder einer entsprechenden
Förderempfehlung wird Gebärdensprache im Einvernehmen mit den
Schulpartnern im Unterricht berücksichtigt. Auf lexikalischer Ebene oder
bilingual.
Durch den
schwerpunktmäßigen Einsatz von tatsächlich
gebärdensprachkompetenten Pädagoginnen und Pädagogen
(Gehörlose oder aufgewachsen als Kinder mit gehörlosen Eltern), einer
einschlägigen Versuchstätigkeit und Evaluation sowie der Verwendung
von medialen Materialien und Hilfen (Gebärdensprachlexikon auf CD-Rom,
Motivationsvideos), wird an einer qualitativen Optimierung gearbeitet.
Das Interesse und
insbesondere die Annahme eines gebärdensprachlichen Angebots durch die
Eltern erlaubt derzeit nur die Umsetzung in einzelnen Klassen und Gruppen oder
in Form eines eigenen Unterrichtsgegenstandes als unverbindliche
Übung. In der Volks- und Hauptschule für gehörlose Kinder,
Klagenfurt, mit dem Schwerpunkt eines bilingualen Unterrichtsangebotes sind
für das kommende Schuljahr nur mehr vier (!) Kinder angemeldet.
Selbst gehörlose Eltern mit hörbehinderten Kindern bevorzugen
deutlich für den Bildungsweg ihrer Kinder Schulen ohne
Gebärdensprachangebot. Der Großteil der Eltern mit
hörbehinderten Kindern erwartet in den neuen technischen Hilfen
(Cochlea-Implantat) und in der Sprachrehabilitation eine den hörenden
Kindern angenäherte Entwicklung.
Zusammenfassend kann
bemerkt werden, daß das Bundesministerium für Unterricht und
kulturelle Angelegenheiten für den Bereich der verpflichtenden
Schulbildung die Gebärdensprache in verschiedenen Ausprägungen als
Kommunikationsform und als Sprachmittel zur kognitiven Bildung im
Einverständnis der Schulpartnerschaft berücksichtigt und somit in
einer praktischen Form anerkennt. Hingegen kann ein allgemeiner Rechtsanspruch
auf den Einsatz der Gebärdensprache im Unterricht für Kinder, deren
Eltern eine Integration in die Sprach- und Kulturgemeinschaft der
Gehörlosen wünschen, erst bei einer offiziellen Anerkennung als
Minderheitensprache erfolgen.”
Der
ORF-Generalsekretär, Gerhard Weis, verweist, was die gewünschte
Stellungnahme des Österreichischen Rundfunks zur Forderung nach
Anerkennung der Gebärdensprache angeht, auf die ausführliche
Beantwortung zu Petition Nr. 25 vom 9. Juni 1997 (Forderung nach mehr
Untertiteln im Fernsehen) (vgl. Seite 68 f).
Einstimmiger Beschluß in der Sitzung am 26. November 1997:
Ersuchen um Zuweisung an den
Verfassungsausschuß.
Verfassungsausschuß
Petition Nr. 25
überreicht vom Abgeordneten Dr. Volker Kier
mit der Forderung an den Österreichischen Rundfunk nach mehr
Untertiteln im Fernsehen.
Mit der gegenständlichen Petition
überreichte der Abgeordnete Dr. Volker Kier folgendes Anliegen des
Gehörlosenbundes:
“In dieser Unterschriftenaktion des
Österreichischen Gehörlosenbundes an den ORF geht es darum,
gehörgeschädigten bzw. gehörlosen Menschen das Verstehen von
Nachrichten- und wissenschaftlichen Sendungen durch Einblendung von Untertiteln
zu ermöglichen. (Untertitel sollen bei Bedarf dazugeblendet werden
können.)”
In der Ausschußsitzung am 7. Mai 1997 wurde
beschlossen, eine Stellungnahme des BKA sowie des ORF einzuholen.
Der Bundeskanzler nahm zu der in der Petition
genannten Forderung wie folgt Stellung:
“Wenngleich das Anliegen des
Österreichischen Gehörlosenbundes durchaus verständlich
erscheint, ist zu betonen, daß die Tätigkeit des
Österreichischen Rundfunks oder seiner Organe keine Maßnahme der
Vollziehung darstellt. Die Organe des Österreichischen Rundfunks sind
keine Organe des Bundes. Ihnen stehen in keinem Fall hoheitliche Befugnisse zu
– sie handeln im Bereich der Privatautonomie (vgl.
VfSlg. 7593/7717/1975). Im Sinne der von Art. I Abs. 2 des
Bundesverfassungsgesetzes vom 10. Juli 1974 über die Sicherung der
Unabhängigkeit des Rundfunks, BGBl. Nr. 396/1974, geforderten
Unabhängigkeit wurde der Österreichische Rundfunk als
selbständige Anstalt öffentlichen Rechts durch das Rundfunkgesetz
eingerichtet. Die verfassungsrechtliche Unabhängigkeitsgarantie verbietet
eine Ausgestaltung der Aufsicht in der Weise, daß der Staat bestimmenden
Einfluß etwa auf Programminhalte bzw. Gestaltungsgrundsätze
erhält. Dem Bundeskanzler ist entsprechend diesen Ausführungen jede
Einflußnahme auf die Tätigkeit des Österreichischen Rundfunks
verwehrt.
Der Vollständigkeit halber ist zu bemerken,
daß – wie mir der Verfassungsdienst mitteilt – der ORF pro
Monat im Vergleich zu den öffentlich-rechtlichen Veranstaltern in den
Nachbarländern Deutschland und Schweiz in hohem Ausmaß, nämlich
rund 150 Stunden, Fernsehprogramm untertitelt und auch teilweise Sendungen
parallel durch einen Gebärden-Dolmetsch präsentiert werden.
Ferner weise ich darauf hin, daß dem der
Petition zugrundeliegenden Anliegen durchaus auf Grund einer entsprechenden
Empfehlung der gemäß § 15 des Rundfunkgesetzes zur Wahrung
der Interessen der Hörer und Seher eingerichteten Hörer- und
Sehervertretung Rechnung getragen werden müßte. Gemäß
Abs. 3 leg. cit. hat der Generalintendant innerhalb einer angemessenen
Frist der Hörer- und Sehervertretung zu berichten, ob und in welcher Form
der Empfehlung entsprochen worden ist oder aus welchen Gründen der
Empfehlung nicht gefolgt wird. Die Hörer- und Sehervertretung ist
überdies gemäß § 16 Abs. 2 befugt, den
Generalintendanten über alle zu besorgenden Aufgaben des
Österreichischen Rundfunks zu befragen und alle einschlägigen
Auskünfte zu verlangen.”
Vom Generalsekretär des ORF ging zur Petition
Nr. 25 nachstehendes Schreiben ein:
“Ich schicke der guten Ordnung halber voraus,
daß diese Stellungnahme nur für die vom ORF veranstalteten und
verantworteten Fernsehprogramme ORF 1 und ORF 2 gilt. Diese
Erklärung erscheint mir deswegen angebracht, weil in den
österreichischen Fernsehhaushalten eine Vielzahl vor allem auch deutschsprachiger
Fernsehprogramme zu empfangen sind, die nicht dem ORF zugeordnet werden
können.
1980 hat der ORF mit der Einführung von
TELETEXT in Österreich mit seinem Service für Gehörlose und
Gehörbehinderte begonnen und diesen Dienst konsequent erweitert und verbessert.
Heute untertitelt der ORF pro Monat rund
150 Stunden Fernsehprogramm. Zum Vergleich: das Schweizer Fernsehen
untertitelt 130, ARD und ZDF untertiteln gemeinsam 110 Stunden.
Kommerzielle TV-Anstalten untertiteln keine Fernsehprogramme. Auf Grund von
Untersuchungen der Bedürfnisse von Hörbehinderten hat der ORF
schwerpunktmäßig die Untertitelung von Informationssendungen
forciert. Mit Beginn 1997 wurde auch die Untertitelung im Bereich der
Unterhaltungsprogramme sowie Spielfilme und Serien beträchtlich
ausgeweitet. Seit März 1996 wird das TV-Magazin “Wochenschau”
parallel durch einen Gebärdendolmetsch präsentiert.
1997 setzt der ORF für die Untertitelung von
Sendungen ein Jahresbudget von rund 11 Millionen Schilling ein und
für den Gebärdendolmetsch etwa eine halbe Million Schilling.
Ich füge eine Graphik bei, die die
Entwicklung der Untertitelung in unseren Fernsehprogrammen ausgehend vom Jahr
1985 bis heute veranschaulicht.
Angesichts des Umfanges der Untertitelung unserer
Fernsehprogramme im Vergleich zu anderen, vor allem öffentlich-rechtlich
veranstalteten Fernsehprogrammen aus dem benachbarten Ausland, nimmt der ORF
daher diesbezüglich eine führende Stellung ein. Dessen ungeachtet
sind wir nach Maßgabe der technischen Entwicklung, der programmlichen
Eignung, aber auch der wirtschaftlichen Tragbarkeit bestrebt, diese Form der
Versorgung mit Untertiteln weiterhin auszubauen.”
Diesem Schreiben waren
folgende Tabellen beigefügt:
UT-Entwicklung von
1985 bis 1997
(1997 als Prognose)
|
|
Alle
Angaben
|
|
|
in
Stunden
|
|

|
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
|
473
548
857
871
1020
1070
1111
1154
1419
1526
1644
1589
1878
|
Vergleich FI–FP seit 1990

Einstimmiger
Beschluß in der Ausschußsitzung am 26.
November 1997:
Ersuchen um Zuweisung an den
Verfassungsausschuß.
Verfassungsausschuß
Petition Nr. 26
überreicht von der Abgeordneten Mag. Terizija
Stoisits betreffend “Rassismus; Presseförderung, Anregung
eines Initiativantrages uä.”
Mit der gegenständlichen Petition
überreicht die Abgeordnete Mag. Terezija Stoisits folgendes Anliegen von
Freda Meissner-Blau und Gerhard Oberschlick:
“Rassismus; Presseförderung. Anregung eines Initiativantrages uä.
Das von der Europäischen Union für 1997
mit Entschließung des EU-Ministerrates ausgerufene ,Europäische Jahr
gegen Rassismus‘ gibt Gelegenheit, die Bundesregierung, den National- und
Bundesrat sowie die Kommission für die Presseförderung an einige
völkerrechtliche Verpflichtungen der Republik zu erinnern:
Mit dem ,Internationalen Übereinkommen zur
Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung‘ vom 7. März
1966 (BGBl. 1969 II S. 962 Art. 2 Abs.1b, d, e) hat sich
Österreich ua. verpflichtet,
b) eine Rassendiskriminierung durch Personen
oder Organisationen weder zu fördern noch zu schützen noch zu
unterstützen,
d) jede durch Personen, Gruppen oder
Organisationen ausgeübte Rassendiskriminierung mit allen geeigneten
Mitteln einschließlich der durch die Umstände erforderlichen
Rechtsvorschriften zu verbieten und zu beendigen,
e) alle eine Rassenintegration
anstrebenden vielrassischen Organisationen und Bewegungen zu unterstützen.
,Die ,Neue Kronen Zeitung‘ ist die
Speerspitze einer politischen und gesellschaftlichen Entwicklung, die sich in
den letzten drei bis vier Jahren in Österreich etabliert hat. Seit dem
Ausländervolksbegehren beobachten wir, daß der rassistische Rand,
der früher in rechtsradikalen Zeitschriften vertreten war, in die
politische und gesellschaftliche Mitte eingebrochen ist.‘ So Martin
Schenk, ehemaliger Obmann von ,SOS Mitmensch‘, beim Hearing zur
,Medienfreiheit in Österreich‘, am 25. September 1996. Wie und
mit welchen Folgen die ,Neue Kronen Zeitung‘ ihre Marktmacht für die
Verbreitung von Rassismus, AusländerInnenfeindlichkeit,
Frauendiskriminierung, Sexismus und Homosexuellenfeindlichkeit
mißbraucht, haben beim genannten Hearing neben Martin Schenk auch die
Beiträge von Fritz Hausjell, Chucks Ugbor, Kilian Okanwikpo, Sintayahu
Tsehay, Susi Riegler und Christian Michelides eindrucksvoll gezeigt
(Dokumentation in: Impuls. Das grüne Monatsmagazin, 8. Jahrgang
Nr. 7, Dezember 1996, S. 39–49).
Schon aus diesen Gründen verbietet sich jede
Förderung, jeder Schutz und jede Unterstützung rassistischer Medien,
zB der ,Neuen Kronen Zeitung‘, aus Budgetmitteln, insbesondere der Presseförderung
des Bundes (1996: ,Neue Kronen Zeitung‘ 4,9 Millionen) und der
Länder (Land Steiermark: ,Neue Kronen Zeitung‘ 5,6 Millionen).
Um diese Beträge könnten
a) die für Initiativen gegen
Rassendiskriminierung im Europäischen Jahr gegen Rassismus vorgesehenen
Mittel erhöht werden; oder
b) die Förderungsbeträge für
Zeitschriften erhöht werden; oder
c) die jeweiligen Presseförderungen
zum Zwecke der Budgeteinsparung gekürzt und damit Kürzungen zu Lasten
würdigerer Zeitungen ungefähr vermieden werden.
Die ,Neue Kronen Zeitung‘ dürfte sich
darüber schon deshalb nicht einmal aufregen, weil sie sich –
ungeachtet der von ihr selbst beantragten und genossenen Zuwendungen –
immer wieder über die Presseförderung mokiert hat. Sie verdient aber
auch deshalb keine wie immer geartete Förderung aus öffentlichen
Mitteln, weil sie
– seit Jahren mit weitem
Abstand am öftesten vom Österreichischen Presserat verurteilt wird;
weil sie
– sich diesen Verfahren unter
Mißachtung des Presserates und des Ehrenkodex der Österreichischen
Journalisten kaum jemals stellt, und weil sie am 23. März 1997, Seite 2 f.,
– bezeichnenderweise im
Einklang mit der FPÖ, die österreichische Bevölkerung dagegen
aufzuhetzen versucht hat, daß das Wissenschaftsministerium Geld ,für
den ,Kampf gegen Rassismus‘ lockermacht.‘
So verteidigen sie ihre parteipolitische bzw. Blattlinie;
so decouvrieren sie sich; und so beweisen sie ihre absolute
Förderungsunwürdigkeit. Dafür wäre die schelmische
Zustimmung des tonangebenden Kolumnisten zu Le Pen (,Neue Kronen
Zeitung‘, 2. April 1997, S. 10) schon nicht mehr nötig
gewesen.
Daher bitten wir und schlagen wir vor, daß
alle nichtrassistischen Mitglieder der Bundesregierung, Abgeordneten zum
Nationalrat, Mitglieder der Kommission für die Presseförderung bzw.
die entsendenden Organisationen den obigen Vorschlägen (oder ihren
Zielen noch besser) entsprechende Beschlüsse fassen bzw.
Initiativanträge einbringen bzw. Initiativen ergreifen.”
Der Ausschuß hat in
seiner Sitzung am 9. Juli 1997 beschlossen, eine Stellungnahme des BKA
einzuholen.
Das
Bundeskanzleramt/Verfassungsdienst nahm zu dieser Petition wie folgt Stellung:
“Der
gemäß § 4 Abs. 3 leg. cit. eingerichteten
Presseförderungskommission wurde der Text der Petition Nr. 26 in Form
eines mit der Petition identischen offenen Briefes vorgelegt und bei der
Gutachtenserstellung mitberücksichtigt. Das Kommissionsgutachten
sprach sich bezüglich des Antrages der ,Neuen Kronen Zeitung‘ auf
Allgemeine Presseförderung für eine Förderung aus. In ihrer
Sitzung am 8. Juli 1997 ist die Bundesregierung dem Gutachten der
Presseförderungskommission gefolgt.
Zu der ebenfalls in der
Petition angeführten steirischen Landespresseförderung kann keine
Stellungnahme abgegeben werden, da diese nicht der Vollziehung durch den Bund
unterliegt.”
Einstimmiger Beschluß in der Ausschußsitzung am 26. November 1997.
Ersuchen um Zuweisung an
den Verfassungsausschuß.
Verfassungsausschuß
Petition Nr. 27
überreicht von den
Abgeordneten Mag. Walter Guggenberger und Dr. Günther Kräuter
betreffend “Österreichische Note – Präzisierung des
Rundfunkgesetzes”
Diese Petition
enthält folgende Punkte:
“1. Der
Nationalrat wird ersucht, das Rundfunkgesetz dahin gehend zu präzisieren,
– daß der ORF
verpflichtet wird, nicht nur allgemein Kunst, Kultur und Wissenschaft, sondern
inbesonders lebende österreichische Kunst, Kultur und Wissenschaft
ausgewogen zu fördern;
– daß
öffentlich-rechtliche und private Hörfunk- und
Fernsehprogrammanbieter, die in Zukunft von österreichischem Hoheitsgebiet
Programme verbreiten werden, Auflagen hinsichtlich einer dem europäischen
Standard entsprechenden Berücksichtigung des heimischen Kunstschaffens
erfüllen müssen;
– daß die Einhaltung
dieser Auflagen jährlich überprüft wird und ein grober
Verstoß bis zum Entzug der Sendelizenz führen kann.
Der einzuhaltende,
europäische Durchschnittswert soll im Amtsblatt zur Wiener Zeitung
veröffentlicht werden und für das jeweils kommende Jahr gelten. Die
dazu erforderlichen Daten kann die Verwertungsgesellschaft der Autoren,
Komponisten und Musikverleger (AKM) sowie das European Music Office (EMU)
liefern.
2. Hinsichtlich der
Behandlung dieser Initiative fordern die Bevollmächtigten:
– der Ausschuß für
Bürgerinitiativen möge die vorliegende Initiative gesondert
behandeln;
– deren Behandlung noch vor
dem Erscheinen der neuen AKM-Statistik für 1997;
– deren Weiterleitung nach der
Vorberatung an den Verfassungsausschuß;
– der Ausschuß soll als
Ergebnis die Bundesregierung auffordern, auf den ORF-Generalintendanten
einzuwirken, in den Programmen des ORF unverzüglich deutlich mehr
österreichische Gegenwartskunst einzusetzen.
3. Die Betreiber der
Initiative wünschen:
– eine
Ausschußfeststellung hinsichtlich der Erhöhung des Anteils
österreichischer Gegenwartskunst vor allem im Bereich der Musik zumindest
auf den in Europa üblichen Standard;
– diese Erhöhung soll bei
allen Musiksparten unter besonderer Berücksichtigung des Nachwuchses und
der weltweit ständig steigenden wirtschaftlichen Bedeutung der Musik- und
Urheberrechtsindustrie erfolgen.
4. Zu den
Ausschußsitzungen sollen eingeladen werden und während der gesamten
Dauer der Veranstaltungen das Wort ergreifen dürfen:
– der Erstunterzeichner;
– bis zu sechs
Sachverständige, die vom Erstunterzeichner nominiert werden;
– der ORF-Generalintendant;
– der
ORF-Generalsekretär;
– der zuständige Minister
(Bundeskanzler);
– der zuständige
Staatssekretär;
– die Mediensprecher der im
Parlament vertretenen Parteien;
– die Kultursprecher der im
Parlament vertretenen Parteien.”
In der Ausschußsitzung am 9. Juli 1997
wurde einstimmig beschlossen, je eine Stellungnahme des ORF und des
Bundeskanzleramtes einzuholen. Auch erfolgte in dieser Sitzung der
Beschluß auf Durchführung eines Hearings und auf Ladung von
Experten.
Das Bundeskanzleramt – Verfassungsdienst nahm
dazu wie folgt Stellung:
“Einleitend darf bemerkt werden, daß
das Anliegen der Petition im Hinblick auf ihren Titel unklar erscheint: Das
Rundfunkgesetz bezieht sich ausschließlich auf die Tätigkeit des
Österreichischen Rundfunks. Zugleich verfolgen die Einbringer aber auch
die Intention, bestimmte Verpflichtungen für private Rundfunkveranstalter
zu schaffen, was aber systematisch nicht Gegenstand einer allfälligen
Novellierung des Rundfunkgesetzes sein könnte.
Im weiteren ist nicht klar, welchen Inhalt die in
der Petition erwogenen ,Auflagen‘, die den aus Österreich sendenden
Rundfunkveranstaltern aufzuerlegen wären, nach Auffassung der Einbringer
haben sollten: So zielt die Petition darauf ab, daß Hörfunk- und
Fernsehprogrammanbietern in Österreich die Verpflichtung aufzuerlegen
wäre, einen ,europäischen Standard … des heimischen
Kunstschaffens‘ zu berücksichtigen, wobei im Falle der
Nichteinhaltung dieser Auflagen Sanktionen greifen sollen.
Zunächst ist unverständlich, welcher
,europäische Standard‘ angesprochen wird. Denkbar erscheint
allenfalls, daß die Einbringer die Regelungen Kapitel III der
EU-Richtlinie ,Fernsehen ohne Grenzen‘ (89/552/EWG in der Fassung der
Richtlinie 97/36/EG) in Erwägung gezogen haben, wonach die Mitgliedstaaten
im Rahmen des praktischen Durchführbaren und mit angemessenen Mitteln
dafür Sorge zu tragen haben, daß die ihrer Hoheitsgewalt
unterliegenden Fernsehveranstalter den Hauptteil ihrer Sendezeit
europäischen Werken vorzubehalten haben. Art. 6 der genannten
Richtlinie definiert dabei in umfassender Weise den Begriff der
,europäischen Werke‘, demzufolge darunter Werke aus den
Mitgliedstaaten der Europäischen Union und unter bestimmten Bedingungen
auch aus europäischen Drittländern verstanden werden. Diese
Bestimmungen sind in der österreichischen Rechtsordnung hinsichtlich der
Programme des ORF in § 2b des Rundfunkgesetzes, BGBl.
Nr. 379/1984 in der Fassung BGBl. Nr. 917/1993, sowie hinsichtlich
der Programme der Kabel- und Satellitenrundfunkveranstalter in den
§§ 33 bis 36 des Kabel- und Satellitenrundfunkgesetzes,
BGBl. I Nr. 42/1997, umgesetzt. Der Anteil der von den
Fernsehveranstaltern ausgestrahlten europäischen Werke wird vom
Bundeskanzleramt alle zwei Jahre auf Grund einer in der Richtlinie festgelegten
Verpflichtung an die Europäische Kommission übermittelt.
Aus dem Gemeinschaftsrecht ergibt sich hingegen
keine Anordnung, daß Fernsehveranstalter in einem Mitgliedstaat einen
bestimmten Anteil von Produktionen aus ihrem jeweiligen Heimatstaat
auszustrahlen hätten. Zweck der Quotenregelungen in der Richtlinie
,Fernsehen ohne Grenzen‘ ist vielmehr eine Förderung der
gesamteuropäischen Programmindustrie. Eine nationale Vorschrift, die rein
auf die Förderung österreichischer Programme abzielt, könnte
somit im Konflikt mit dem Gemeinschaftsrecht stehen, da sie dem genannten Zweck
der Richtlinie entgegenstünde.
Darüber hinaus ist zu bedenken, daß die
geforderten Maßnahmen für die Hörfunk- und Fernsehveranstalter
einen wesentlichen Eingriff in die Programmveranstaltungsfreiheit und damit in
die verfassungsrechtlich gewährleistete
Meinungsäußerungsfreiheit im Sinne des Art. 10 der
Europäischen Menschenrechtskonvention bedeuten würden. Ein
Eingriff in diese Freiheiten ist nur im Rahmen des Art. 10 Abs. 2
EMRK denkbar, wobei keiner der Eingriffstatbestände dieser
Gesetzesbestimmung geeignet erscheint, die in der Petition geforderten
Maßnahmen zu rechtfertigen. Ebenso dürfte auch die Rundfunkklausel
des Art. 10 Abs. 1 Satz 3 EMRK keinen adäquaten
Eingriffstatbestand enthalten. Im besonderen würden die geforderten
Maßnahmen eines Lizenzentzuges im Widerspruch zum
Verhältnismäßigkeitsgebot bei Grundrechtseingriffen stehen.
Diese Auffassung wird auch dadurch
bekräftigt, daß bereits den Quotenregelungen in der zitierten
Richtlinie ,Fernsehen ohne Grenzen‘ vielfach Bedenken im Hinblick auf die
Vereinbarkeit mit Art. 10 EMRK entgegengebracht wurden und diese letztlich
nur auf Grund einer Kompromißlösung in der Formulierung Eingang in
die Richtlinie gefunden haben.”
In der Stellungnahme des Generalintendaten des ORF
zur Bürgerinitiative “Österreichische Note” wird
einleitend ausgeführt, “daß die in der Petition
angeführten Prämissen
1. europäischer Standard
2. ,österreichische
Gegenwartskunst‘
3. Änderung des RFG
von falschen
Voraussetzungen ausgehen:
EUROPÄISCHER STANDARD
Zur Frage, ob es einen europäischen Standard
überhaupt gibt, kann ich zunächst auf mein Schreiben vom
10. Juni 1997 an den Herrn Nationalratspräsidenten verweisen, das
sich ausführlich mit diesem Thema auseinandersetzt. Solche Standards, die
die Petition wiederholt fordert, haben sich nämlich weder in anderen
Ländern bewährt, noch wären Quoten einzelner
österreichischer Musikschaffender in einem bestimmten Sender einem
Rundfunkveranstalter oder seinen Hörern zumutbar. Es besteht ein
gefestigte Rechtsprechung der Kommission zur Wahrung des Rundfunkgesetzes,
daß niemandem Anspruch auf Präsenz in einer bestimmten Sendung des
ORF zukommt. Wenn die Proponenten hier protektionistische Maßnahmen in
Form von Quotenregelungen, also Proporzradio einzelner Interpreten fordern, so
kann ich dies aus den in meinem oben genannten Schreiben genannten Gründen
nur zurückweisen.
Soweit die Petition die Belebung der
österreichischen Popszene vor Augen hat, so bitte ich nicht zu
übersehen, daß die Vertreter des Austropop in den letzten Jahren vor
allem in den ORF Regional- und Lokalprogrammen (Ö2) ein neues Zuhause
gefunden haben und sich aus heutiger Sicht dieser Trend weiter verstärken
dürfte. Auf dem österreichischen Radiomarkt hat insofern bloß eine
Verlagerung stattgefunden. Für österreichische Musikschaffende kann
diese Entwicklung nur von Vorteil sein, sind doch die Regional- bzw.
Lokalprogramme, infolge ihres erwiesenermaßen höheren Marktanteils
und größerer Tagesreichweite, im Vergleich zu Ö3, die
wirklichen Marktführer der österreichischen Radiolandschaft.
Andererseits gehören gerade neuere Produktionen österreichischer
Musiker auch zum festen Repertoire von Ö3.
Daneben ist es ein Anliegen des ORF, gemeinsam mit
der österreichischen Musikszene erfolgversprechende Talente zu
entdecken und ihnen professionelle qualitätsvolle Studioproduktionen zu
ermöglichen. Zuletzt waren bei zahlreichen Open-Air-Veranstaltungen von
Ö3, wie etwa bei dem ,U 2‘-Konzert (16. 8. 1997) von 72 000 Zuschauern,
österreichische Gruppe wie ,Paradise Now‘ als Vorgruppen zu
hören. Solche Chancen, sich vor entsprechendem Publikum zu
präsentieren, werden mit durchaus erfolgversprechenden Ergebnissen
genutzt.
Weitere Beispiele zu den Aktivitäten des ORF,
mit denen heimisches Musikschaffen unterstützt werden soll, sind in
Anhang 1 angeschlossen.
Ich bitte auch nicht zu übersehen, daß
gerade die vorliegende AKM-Studie für das Jahr 1996 nicht den immer
behaupteten Einbruch des Anteils österreichischer Künstler in den
Radioprogrammen des ORF – auch nicht in Ö3 – ausweist. Der
Österreicher-Anteil ist vielmehr relativ stabil geblieben, gerade weil es
in der Vergangenheit wie auch in Zukunft immer ein Anliegen der
Geschäftsführung des ORF gewesen ist, sich um einen möglichst
hohen Anteil österreichischer Komponisten in allen Programmen des Radios
– daher auch in Ö3 – zu bemühen.
Hinter diesem Dauerstreit stecken aber auch
handfeste materielle Interessen, die nichts mit dem ORF zu tun haben. Da es in
Österreich für die kleinen musikalischen Rechte zwei Gesellschaften
gibt, nämlich AKM und Austro-Mechana, wohingegen in der Schweiz und in
Deutschland die kleinen musikalischen Rechte und die kleinen
mechanisch-musikalischen Rechte jeweils von einer Gesellschaft verwaltet werden
und da überdies der ORF an AKM und Austro-Mechana
verhältnismäßig viel bezahlt hat, ist es zu einer Reduktion des
Entgeltanspruches im Vertrag ORF/AKM gekommen. Diese Verhandlungen sind sehr
schwierig gewesen, schlußendlich hat man sich auf einen Kompromiß
geeinigt.
Die damals unterlegene Meinung versucht nun immer
wieder, über eine Erhöhung des Anteils österreichischer
Musik in den Radioprogrammen dieses Verhandlungsergebnis gewissermaßen
nachzubessern. Der ORF hat wiederholt angeboten, die von österreichischen
Komponisten stammenden Werke höher zu bewerten, dafür aber die
Hintergrundmusik bei Filmen und Serien niedriger. Sein Bestreben ist es also
gewesen, bei gleicher Belastung für den ORF finanziell mehr für die
österreichischen Komponisten zu tun. Derartige Vorschläge sind aber
immer wieder abgelehnt worden. Auch diese Hintergründe muß man
kennen, wenn man über die Frage des Anteils österreichischer
Komponisten in den Programmen des ORF diskutiert und der
ORF-Geschäftsführung dabei implizite eine benachteiligende
Einstellung zu österreichischer Musik unterstellt.
DEFINITION ,ÖSTERREICHISCHER
GEGENWARTSKUNST‘
Unklar bleibt, was die Petitionsbetreiber mit der
Umschreibung ,Österreichische Gegenwartskunst vor allem im Bereich der
Musik‘ verstanden haben wollen. Ist ein Werk dann
,österreichisch‘, wenn dessen Schöpfer (Komponist, Autor usw.)
ÖsterreicherIn ist/in Österreich seinen Hauptwohnsitz hat oder sich
das Werk inhaltlich mit Österreich beschäftigt/in Österreich
produziert/geschaffen wurde? Ist im Bereich der Musik erforderlich, daß
der Text deutschsprachig ist?
Ebenso scheint der Wortlaut der Petition
Österreichische Gegenwartskunst und österreichische
zeitgenössische Musik zu vermischen. Unter Punkt 1 wird darauf
hingewiesen, daß die AKM bzw. das European Music Office die Daten zur
jährlichen Überprüfung liefern könne, ob die geforderte
Berücksichtigung des heimischen Kunstschaffens erfolgt ist. Die AKM
verfügt jedoch nur über die Daten aus dem Bereich der Musik und nicht
zB der Literatur oder bildenden Kunst. Da auch die Unterstützer dieser
Petition allein aus dem Bereich der Musik kommen, ist die Petition – wie
auch aus deren Titel ersichtlich – im Grunde ausschließlich auf die
Förderung der Musik und wie sich aus den im Vorfeld dieser Petition
geführten Diskussionen und ihren Teilnehmer ergibt, in erster Linie auf
U-Musik im (ORF) Hörfunk beschränkt.
RUNDFUNKGESETZ (RFG)
Eine Änderung des Rundfunkgesetzes
(Punkt 1 der Petition) würde nur den ORF betreffen, nicht aber wie
von den Petitionsbetreibern gefordert sämtliche öffentlich-rechtliche
und private Hörfunk- und Fernsehanbieter, die Programme von
Österreich aus verbreiten.
Abgesehen davon, daß der Entzug der
Sendelizenz des ORF im Falle der Nichteinhaltung des geforderten
Österreich-Anteils am Programm wohl etwas überzogen erscheint, ist
diese Maßnahme im Rundfunkgesetz nicht vorgesehen (wohl aber im
Regionalradiogesetz und im Kabel-Satelliten-Rundfunkgesetz).
Der ORF als Unternehmen, das den öffentlichen
Auftrag ernst nimmt, ist an einer konstruktiven Zusammenarbeit mit allen
österreichischen Künstlern und dabei natürlich auch den
Musikschaffenden außerordentlich interessiert. Er braucht und will Erfolg
gemeinsam mit den Künstlern. Wir sind allerdings überzeugt, daß
polemische Auseinandersetzungen nichts fruchten und letztlich beiden Seiten
nicht dienlich sein können. Der bereits eingeschlagene Weg des Dialogs
soll daher im Sinne einer gedeihlichen Zusammenarbeit beibehalten
werden.”
Anhang 1 zum Schreiben vom 19. August
1997/Petition Nr. 27
“Übersicht über einige
Aktivitäten des ORF zur Unterstützung des heimischen Musikschaffens
Musik bildet in den Hörfunkprogrammen des ORF
einen integralen Bestandteil. Im Sinne des öffentlichen Auftrages, zu dem
sich das Unternehmen in vollem Umfang bekennt, ist der ORF ein wesentlicher
Träger und Vermittler österreichischer Identität im
Medienzeitalter. Eine Abwägung zwischen adäquater Förderung
heimischer Musikschaffender durch vermehrten Einsatz auf der einen und
Publikumswünschen gerecht werdender Programmgestaltung auf der anderen
Seite muß Tag für Tag getroffen werden. Punkt 1.5 der
Programmrichtlinien des ORF gesteht österreichischer Musik – grob
gesprochen – Heimvorteil zu, der in allen Programmen des ORF gilt. Im
Zweifelsfall werden sich alle Verantwortlichen für österreichische
Produktionen entscheiden. Das Unternehmen ist sich aber auch der Tatsache
bewußt, daß es sein Angebot am Interesse seiner Hörer
orientieren muß, weil ansonsten nicht zuletzt ökonomische Nachteile
zu befürchten wären, die der Aufrechterhaltung des kostenintensiven
öffentlichen Auftrags entgegenstehen würden. Dennoch ist der Anteil
österreichischer Musik hoch, was die folgenden Ausführungen über
die einzelnen Programme des ORF belegen.
Ö1
Der Anteil österreichischer Musik an der
Programmgestaltung des Senders ist in den letzten Jahren angestiegen. 1996 wude
bei weitem mehr E-Musik österreichischer lebender Komponisten gespielt als
vergleichbarer ausländisch lebender.
In diesem Zusammenhang darf auch die Existenz des
Radio-Symphonieorchesters (RSO) nicht vergessen werden, für dessen
Bestehen der ORF jährlich zirka 140 Millionen Schilling aufwendet. Es
nimmt im Programm des ORF und darüber hinaus im österreichischen
Musikleben einen zentralen Platz ein. Neben den Aufgaben eines
Medienorchesters, die durch den Programmauftrag des ORF und die Pflege
österreichischer Musik – nicht zuletzt der zeitgenössischen
– gegeben sind, und einer wechselnden Präsenz im Fernsehen wird das
RSO von Konzertveranstaltern in Wien bzw. den großen
österreichischen Festspielen mehr und mehr zu speziellen Aufgaben
herangezogen. In den letzten Jahren wurden mit vielen Aufführungen
bedeutender Werke des 20. Jahrhunderts und zahlreicher Uraufführungen
wesentliche Akzente für das heimische zeitgenössische Musikschaffen
gesetzt.
Für die Saison 1997/98 sind immerhin
22 Kompositionsaufträge für österreichische Komponisten
vorgesehen, deren Gesamtvolumen fast 600 000 Schilling beträgt.
Weitere Kompositionsaufträge prägen das Programm des Festivals
,Musikprotokoll‘ beim Steirischen Herbst, das österreichischen Musikschaffenden
als internationale Plattform dient. Rechnet man die drei Orchesterwerke hinzu,
die bereits vor längerer Zeit bei heimischen Komponisten bestellt wurden,
kommt man auf ein Gesamtauftragsvolumen von rund einer Million Schilling.
Ö1 wird auch durch Uraufführungen dafür sorgen, daß eine
adäquate Veröffentlichung gewährleistet ist. Darüber hinaus
wird auf die CD-Reihe verwiesen, die diese österreichischen Kompositionen
einer breiten Öffentlichkeit nahebringen wird. Konzerte des RSO sowie
weitere Mitschnitte und Produktionen bilden die Grundlage der umfangreichen
Präsenz der österreichischen zeitgenössischen Musik auf
Österreich 1.
Regionalprogramme
Die neun lokalen Radioprogramme des ORF, die zur
Hauptsendezeit in jedem Bundesland ein lokales Vollprogramm ausstrahlen und das
bzw. die regionalen Programme, sind als föderalistisches und
identitätsförderndes Instrument unerläßlich geworden.
Gelegentlich hat es jedoch den Anschein, als würde die Bedeutung der
Landesstudios unterschätzt. Die Regional- bzw. Lokalprogramme erreichten
1996 eine Tagesreichweite (Hörerschaft, die pro Tag erreicht wird; dies
bei einer Mindestverweildauer von 15 Minuten) von 40,9%; wohingegen
Ö3 auf 35,5% kam. Noch klarer ist das Ergebnis, was den Marktanteil
(Anteil des Senders an den pro Tag von allen Hörern vor den Geräten
verbrachten Minuten) betrifft. Dieser lag für die Lokalradios bei 47%,
für Ö3 bei 36%. Die Bundesländerstudios sind somit die
eigentlichen Marktführer der österreichischen Radiolandschaft. Das
Programm der Lokalradios umfaßt neben spezifischen Informationen,
Unterhaltung und Landeskultur auch Musik, wobei der Österreicher-Anteil an
den neun Lokalprogrammen des ORF ungebrochen hoch ist.
Insbesondere die Vertreter des Austropop im strengen
Wortsinne, also große Namen wie Wolfgang Ambros, Georg Danzer oder Peter
Cornelius, haben in den letzten Jahren auf den ORF-Lokalsendern ein neues
Zuhause gefunden. Aus heutiger Sicht dürfte sich dieser Trend in den
kommenden Jahren weiter verstärken. Durch die großen
Veränderungen auf dem österreichischen Radiomarkt, die sich in den
schrittweise vollzogenen Justierungen der Programm- und Musikfarben ebenso
widerspiegeln wie in der veränderten Publikumszusammensetzung der einzelnen
Stationen, wurden Interpreten, die man zum Zeitpunkt ihrer ersten großen
Erfolge zum Repertoire von Ö3 zählen mußte, nach und nach zu
Kernkünstlern der Lokal- wie der Regionalprogramme (das sind solche, die
von mehreren Bundesländerstudios gemeinsam produziert werden).
Das inhaltliche Erscheinungsbild der Lokalsender
war und ist einem ständigen Wandel unterworfen. Für den Bereich der
heimischen Popmusik bedeutet dies große Chancen. Denn der noch genauer zu
erörternden Neupositionierung des Senders Ö3 zufolge wird der klassische
Austropop dort nicht mehr jene große Berücksichtigung finden
können, die man bisher gewohnt war; diese Tendenz ist einzig und allein
auf die Wünsche des Ö3-Publikums zurückzuführen, die sich
durch großangelegte Analysen belegen lassen. Dies bedeutet, daß die
Regional- und Lokalprogramme des ORF vermehrt zur Heimat der
österreichischen Popmusik werden. Für heimische Musikschaffende kann
diese Entwicklung nur von Vorteil sein, sind doch die Ö2-Programme –
wie bereits erwähnt – die wirklichen Marktführer der
österreichischen Radiolandschaft.
Ö3
Prinzipiell wird bei der Programmgestaltung von
Ö3 von der Prämisse ausgegangen, daß beim Einsatz
österreichischer Musik dieselben Kriterien angewendet werden, wie für
das ausländische Repertoire. Der jeweilige Titel wird ausschließlich
nach musikalischen Eigenschaften eingestuft. Ist er jenen Genres zuzuordnen,
die Ö3-Hörer gerne hören? Ist die Tonalität eine, die in
das von Ö3 abgedeckte Spektrum paßt? Eine lediglich untergeordnete
Rolle spielen in diesem Zusammenhang etwaige Charts-Plazierungen. Somit wird
gegenüber heimischen Künstlern keine restriktive oder feindliche
Haltung eingenommen; im Gegenteil: gemäß Punkt 1.5 der
Programmrichtlinien des ORF werden österreichische Titel vergleichbaren
ausländischen vorgezogen. Grundbedingung für den Einsatz bleibt aber
eine gewisse Mindestakzeptanz bei der Zielgruppe des Senders.
Der ORF ist in dieser Richtung bestrebt,
heimischen Nachwuchs zu fördern und einem breiteren Publikum
näherzubringen. Im Herbst 1995 wurde die Initiative ,Ich will auch‘
gestartet, bei der Nachwuchsmusikern die Möglichkeit geboten wurde,
eingesandte Demos in den Digitalstudios des ORF zu produzieren. Junge Musiker
haben somit die Möglichkeit, jene Hürde zu überspringen, die in
anderen Ländern nur mit der Hilfe von Plattenfirmen genommen wird.
Darüber hinaus wurden durch verstärkten Einsatz in den
Hörfunkprogrammen des ORF die Nachwuchsbands einem breiteren Publikum
präsentiert. Der kommerzielle Erfolg war nicht übermäßig
groß, dennoch fördert der ORF diese Aktion durch die Produktion
eines zweiten Demobandes.
Eine Zwischenbilanz der Aktion ,Ich will
auch‘, die den Zeitraum vom Beginn im Oktober 1995 bis Mai 1997
umfaßt, zeigt folgendes: Bisher haben 27 Bands bzw. Solo-Interpreten
im Studio RP2 des Wiener Funkhauses Aufnahmen gemacht. Insgesamt wurden
etwa 180 Studiotage, das entspricht etwa 1 600 Studiostunden,
aufgewendet. Auf dem freien Markt wären hiefür, selbst wenn man
dieser Überlegung einen sehr bescheidenen Tarif zugrunde legt, Kosten von
ungefähr 4,3 Millionen Schilling zu kalkulieren, die der ORF für
österreichische Musikschaffende aufgewendet hat.
Als erster zählbarer Erfolg kann gewertet
werden, daß die Künstler Eichhorn und Steve Nick von zwei
österreichischen Major Labels unter Vertrag genommen wurden. Die Bands
,Loose Lips‘ und ,H-Ant-Orange‘ wurden aus den ,Ich will
auch‘-Samplern auf Single gekoppelt. Durch starkes Airplay auf Ö3
bzw. FM4 wurde beiden Gruppen ermöglicht, einen Promotion- bzw.
Management-Vertrag abzuschließen.
Anfragen von Plattenfirmen, zum Teil auch aus dem
Ausland, gelten derzeit folgenden Künstlern, denen ,Ich will auch‘
eine erste Plattform geboten hat: ,Loose Lips‘, ,H-Ant-Orange‘,
,Hertz‘, ,Between‘, ,The Next‘. Bei der Band ,Clarence‘
geben sich zur Zeit die Talentesucher und Produzenten quasi die Klinke in die
Hand. Diese erfolgreiche Aktion wird nun unter dem Titel ,POP!‘
weitergeführt.
Hierfür wurde vor kurzem zwischen der
Gesellschaft zur Förderung österreichischer Musik (GFÖM), der
AKM und dem ORF eine Vereinbarung geschlossen, die die Durchführung des
Projektes ,POP!‘ zum Gegenstand hat. Ziel dieser Idee ist es, Produktion
und Verbreitung österreichischer Popmusik zu unterstützen und (neben
einer Verbesserung des Stellenwertes in der Öffentlichkeit) der Popmusikszene
neue Impulse zu geben. Es wird eine Kontakt- und Servicestelle für
österreichische Musikschaffende eingerichtet, die einerseits der
Kontaktaufnahme zwischen Musikern, Musikindustrie und Verwertungsgesellschaften
erleichtern und andererseits Beratungstätigkeit im Hinblick auf
Möglichkeiten von (Demo-)Aufnahmen leisten soll.
Ein weiteres Ziel dieser Aktion ist die Produktion
von sendefertigen Aufnahmen von Werken, die in hiefür veranstalteten
Wettbewerben ausgewählt werden. Diese Produktionen können auch mit
einer Nachbetreuung durch die Veranstalter rechnen, die aus Presse- und
PR-Arbeit und der Vermittlung von Live-Auftritten besteht.
Der ORF unterstützt diese Aktion darüber
hinaus durch kostenlose Zurverfügungstellung seiner Aufnahmestudios im Ausmaß
von zumindest 80 Arbeitstagen und der Übernahme der Gesamtkosten
für Presseaussendungen, Pressekonferenzen und ähnliche
Veranstaltungen. Zudem verpflichtet er sich, Trailer und redaktionelle
Beiträge über das Projekt oder aus dem Projekt hervorgehender
Produktionen in den Programmen des ORF zu senden und die auflaufenden Kosten zu
übernehmen.
Des weiteren hat die konkrete Planungsphase des
Projektes ,Live Music Award 98‘ eingesetzt. In vier Kategorien (Pop/Rock,
Jazz, Volksmusik, E-Musik) soll jungen Musikern die Möglichkeit
eröffnet werden, sich bei Live-Auftritten für die jeweilige
Schlußveranstaltung zu qualifizieren, im Zuge derer eine Fachjury (in
Anwesenheit der wichtigsten Musikkritiker) die Sieger auswählt. Diese Schlußveranstaltungen
sollen in das Donauinselfest integriert werden und somit eine breite
Publikumsresonanz garantieren.
FM4
Die Förderung zeitgemäßer
österreichischer Pop- und Rockmusik war eine der Hauptgründe für
die Einführung der Sendeleiste FM4 auf den Frequenzen von Blue Danube Radio
am 16. Jänner 1995. Durch das breite Spektrum des
FM4-Programmangebotes sind dabei auch keine genrespezifischen Grenzen gesetzt.
Von ,Experimental House‘ bis ,Death Metal‘ können auf FM4 alle
Untergruppen zeitgemäßen Musikschaffens beleuchtet werden. Hier
übernehmen vor allem die Musik-Spezialsendungen, die werktags zwischen 22
und 24 Uhr ausgestrahlt werden, den Hauptteil der Verantwortung. Die
Musikexperten des Senders sind bemüht, möglichst viele beachtenswerte
Interpreten zu fördern.
Die bereits etablierten Szenestars, die nicht
zuletzt durch FM4 diesen Status erlangen konnten, bleiben auf FM4 auch
weiterhin präsent. Hier seien vor allem das Magazin ,Homebase‘, von
Künstlern selbst gestaltete Gästesendungen oder auch Live-Konzert-Mitschnitte
erwähnt. Die Duos ,Kruder & Dorfmeister‘ sowie ,Pulsinger &
Tunakan‘ haben es so zu internationaler Anerkennung gebracht. Auch
Interpreten wie Heinz oder Hans Platzgumer sind im deutschsprachigen Ausland
nicht nur in Fachkreisen ein Begriff.”
In der Sitzung des Ausschusses für Petitionen
und Bürgerinitiativen fand am 26. November 1997 ein Hearing zu dieser
Petition statt, zu dem folgende Experten geladen waren:
Dipl.-Kfm. Nikolaus
Kalita (Austro Mechana Vorstand)
Prof. Wolfgang Arming
(früherer Geschäftsführer der Polygram)
Manfred Brunner
(AKM-Generaldirektor)
Dr. Heinz Wittmann
(Verlag “Medien und Recht”)
Prof. Dr. Hannes
Tretter (Ludwig-Boltzmann-Institut)
Peter Vieweger
(Austrian Music Office)
Peter Paul Skrepek
(Musiker-Komponisten-Autorengilde/KMfB)
Bogdan Roscic
(Ö3-Chef)
Andy Baum
(Austropop-Musiker)
Gerhard Weis
(ORF-Hörfunkintendant)
Gerhard Zeiler
(ORF-Generalintendant)
Mag. Werner Dujmovits
(Hörfunkintendanz)
Mehrheitlicher Beschluß in dieser Sitzung:
Ersuchen um Zuweisung an den Verfassungsausschuß.
Verkehrsausschuß
Petition Nr. 24
überreicht vom
Abgeordneten Peter Rosenstingl betreffend “Tariferhöhung
im Verkehrsverbund Ostregion”
Der Abgeordnete Peter Rosenstingl
überreichte mit gegenständlicher Petition ein Anliegen der
Freiheitlichen Bürgerinformation Wien Penzing mit folgenden
Forderungen:
“STOPP für
alle Planungs- und Vorarbeiten im Zusammenhang mit der geplanten Parkgarage in
Hütteldorf (Hannappistadion).
NEIN zur geplanten
Verkehrshölle Hütteldorf
stattdessen:
Entlastung Hütteldorfs
durch
– Errichtung einer
Park-&-Ride-Anlage in Auhof,
– Verlängerung der U4
nach Auhof.
Eine Protestaktion der Freiheitlichen –
Bezirk Wiental:
PENDLER
MELKKÜHE des VOR?
(Verkehrsverbund Ost-Region)
Ab. 1. Februar
1996 Tariferhöhung bis zu 20%
WIR SIND DAGEGEN!
Wien baut das
Verkehrsnetz aus – die Tarife bleiben gleich!
Wer soll die Zeche
für Wien zahlen?
Die Pendler sollen
zahlen!
Die Folge davon:
– Pendler steigen wieder auf
das Auto ,zurück‘, daher
– noch längere Staus an
den Einfahrtsstraßen,
– noch weniger Parkplätze
in Wien,
– noch mehr Umweltschäden
durch Abgase.
Wir fordern:
– sofortige Senkung des
VOR-Tarifes,
– attraktive
Umsteigemöglichkeiten,
– mehr Parkplätze bei
allen Bahnhöfen,
– U-Bahn-Verlängerung
zumindest bis Auhof,
– Parkraumschaffung im Auhof,
– mehr Kapazitäten zu
Spitzenzeiten,
– ,keine
Stehplätze!‘ ”
Der Ausschuß hat in
seiner Sitzung am 7. Mai 1997 beschlossen, Stellungnahmen des Bundesministeriums
für Wissenschaft und Verkehr sowie der Verbindungsstelle der
Bundesländer einzuholen.
Die Verbindungsstelle der
Bundesländer hat folgende Stellungnahmen von Bundesländern dem
Ausschuß übermittelt:
Stellungnahme der Steiermärkischen Landesregierung:
“Zur gegenständlichen Petition wird aus
steirischer Sicht folgende Stellungnahme abgegeben:
In der Steiermark sind die Tarife der
Verbundkarten nicht hoch. Es kann nachgewiesen werden, daß fast jede
Fahrtrelation im Verbundgebiet pro Kilometer weniger als 1 S kostet und
die finanzielle Situation der Verkehrsverbünde und Verkehrsunternehmen
immer angespannter werden läßt. Das bedeutet, daß zur
Verbesserung der Ertragssituation einerseits und zur Entlastung der
öffentlichen Haushalte andererseits ,gebündelte
Tariferhöhungen‘ notwendig und sinnvoll sind, wenn gleichzeitig die
Angebote wirksam verbessert werden, wie zB Bedienungshäufigkeit,
Ausstattung der öffentlichen Verkehrsmittel, Betriebslogistik, usw. Die
Argumentation der Petition kann daher aus unserer Sicht nicht nachvollzogen
werden.”
Zur gegenständlichen Petition konnte von der
Tiroler Landesregierung direkt keine Stellungnahme abgegeben werden, da der
Tiroler Landesregierung die Umstände im VOR im Detail nicht bekannt sind.
Weiter wörtlich:
“Grundsätzlich besteht jedoch bei den
Verkehrsverbünden in Österreich überall dieselbe Situation dahin
gehend, daß zur Attraktivierung des ÖPNV ua. auch wesentliche
Zuschüsse für die Tarife erforderlich sind. Dabei übernimmt im
Bereich des VOR – und nur im Bereich des VOR – der Bund 50%
der Kosten. Bei den übrigen Länderverbünden werden vom Bund nur
33% getragen. Da wahrscheinlich alle Verbünde hinsichtlich der Abgeltungen
an die Verkehrsunternehmen eine Wertsicherungsklausel enthalten, müssen
die den Verbund unterstützenden Gebietskörperschaften laufend
höhere Beträge aufwenden, die über Tariferhöhungen
wenigstens teilweise hereingebracht werden sollten. In Tirol erfolgt daher
jährlich eine moderate Tarifanpassung, die jedoch leider auch nicht
ausreicht, um die aus der Wertanpassung und der Alteinnahmensicherung
entstehenden laufenden Mehrkosten für die Gebietskörperschaften
abdecken zu können.
Da die Verbundregelungen und die daraus
entstehende ÖPNV-Finanzierung auf keiner gesetzlichen Grundlage aufbauen
und die Zuschüsse der Länder (und eventuell Gemeinden) im
Finanzausgleich bisher nicht geregelt sind, muß aus der Sicht der
Länder und Gemeinden nach wie vor darauf gedrängt werden, daß
endlich das sogenannte ,Nahverkehrsfinanzierungsgesetz‘ geschaffen
wird.”
Das Amt der Wiener Landesregierung gab folgende
Stellungnahme bekannt:
“Die letzte Tariferhöhung der Wiener
Stadtwerke – Verkehrsbetriebe erfolgte mit Wirksamkeit vom
1. Jänner 1994 für die Kernzone 100 des VOR. Seit diesem
Zeitpunkt wurde von einer weiteren Tariferhöhung Abstand genommen, obwohl
seither zahlreiche Verbesserungen des Verkehrsangebotes sowohl in quantitativer
als auch in qualitativer Hinsicht vorgenommen wurden, die entsprechende
Kostensteigerungen zur Konsequenz hatten. Anmerkungsweise sei nur erwähnt,
daß – neben zahlreichen Verbesserungen im Oberflächenverkehr
– die U3 am 3. September 1994 vom Westbahnhof zur Johnstraße
sowie die U6 am 15. April 1995 von der Philadelphiabrücke nach
Siebenhirten und am 4. Mai 1996 nach Floridsdorf verlängert wurden.
Hinsichtlich der Begründung für die
Erhöhung der Tarife in den VOR-Außenzonen darf auf die
beigeschlossene Stellungnahme des VOR vom 28. Februar 1996 (Beilage)
verwiesen werden.
Zu den die Wiener Stadtwerke –
Verkehrsbetriebe betreffenden Forderungen der Petition wird folgendes bemerkt:
1. U-Bahn-Verlängerung zumindest bis
Auhof:
Im Rahmen der Wiener
Stadtplanung (Magistratsabteilung 18) wurde hinsichtlich der in Zukunft zu
errichtenden Verlängerungen von U-Bahn-Strecken eine Reihung nach
Ausbauprioritäten vorgenommen.
Demnach erweist sich
eine U4-Verlängerung nach Auhof unter den derzeitigen strukturellen
Gegebenheiten gegenüber anderen Linienverlängerungen als nachrangig.
Eine Weiterverfolgung wurde daher von der Magistratsabteilung 18 unter den
gegebenen Umständen nicht in Aussicht genommen.
2. Mehr Kapazitäten zu Spitzenzeiten
(,keine Stehplätze‘):
Im allgemeinen weisen
die Fahrzeuge der Wiener Stadtwerke – Verkehrsbetriebe einen
Sitzplatzanteil von zirka 30% der gesamten angebotenen Plätze auf. Diese
Aufteilung stellt einen Kompromiß zwischen Komfort und Wirtschaftlichkeit
dar. Außerhalb der Spitzenzeiten ist es damit möglich, dem
Großteil der Fahrgäste einen Sitzplatz anzubieten, in den
Spitzenzeiten hingegen müssen einige Fahrgäste stehen. Es darf aber
darauf hingewiesen werden, daß für behinderte Fahrgäste, gebrechliche
Personen oder Personen mit Kleinkindern besonders gekennzeichnete
Sitzplätze zur Verfügung stehen. Bei Fahrzeiten, beispielsweise von
Hütteldorf bis zum Karlsplatz, von unter 20 Minuten erscheinen
Stehplätze durchaus zumutbar. Vor allem dann, wenn man bedenkt, daß
die mittlere Auslastung des gesamten Platzangebotes in Spitzenzeiten zirka 60%
beträgt. Die Erfüllung der Forderung, ausschließlich
Sitzplätze anzubieten, hätte eine Halbierung der Intervalle zur
Voraussetzung, was zur Folge hätte, daß doppelt so viele Fahrzeuge
als derzeit eingesetzt werden müßten. Dies ist aus wirtschaftlichen
Gründen nicht vertretbar.”
Das Bundesministerium für Wissenschaft und
Verkehr teilte zur gegenständlichen Petition – nach Einholung einer
Stellungnahme der Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen
– mit, “daß die Erhöhung der VOR-Tarife mit
1. Februar 1996 vor allem auf Grund gestiegener Kosten bei den ÖBB
durchgeführt werden mußte. Da diese Tarifmaßnahme nunmehr
allerdings mehr als ein Jahr zurückliegt, erscheint ein
ausführlicheres Eingehen auf diese Maßnahme nicht mehr sinnvoll.
Was die anderen Forderungen – die aber
ebenfalls in das Jahr 1996 zurückreichen – anlangt, so darf
angemerkt werden, daß die ÖBB zur Erleichterung des Umsteigens vom
Individual- auf den öffentlichen Verkehr die Errichtung von
Park-and-Ride-Flächen in Zusammenarbeit mit den Gebietskörperschaften
forcieren.
Der Bau einer Park and Ride-Anlage in Auhof ist
derzeit weder seitens der ÖBB noch seitens der Stadt Wien vorgesehen, auch
eine Verlängerung der U4 bis Auhof durch die Stadt Wien wird nach ho.
Informationen mittelfristig nicht realisiert werden.
Im Raum Hütteldorf ist die Errichtung einer
herkömmlichen Park-and-Ride-Anlage auf Grund der örtlichen Bebauung
nicht realisierbar. Die ÖBB haben aber im Nahbereich des Bahnhofes Wien
Hütteldorf (Kreißlergasse, Deutschordensstraße) auf eigenem
Grund PKW-Stellplätze im Straßenniveau geschaffen. Diese sind jedoch
kostenpflichtig (Monatsmiete zirka 500 S) und an das polizeiliche
Kennzeichen des Fahrzeuges des jeweils berechtigten Benützers gebunden.
Im Bereich der Pendlerachse Wien West–St.
Pölten wird aber insbesondere das sich in Realisierung befindliche
Parkdeck St. Pölten eine spürbare Entlastung bringen. Das
Projekt umfaßt zirka 1 000 PKW-Stellplätze und erfordert
einen Investitionsaufwand von rund 100 Millionen Schilling. Geplanter
Fertigstellungstermin ist der Mai 1998.
Weitere Park-and-Ride-Anlagen werden nach
Maßgabe der Bereitschaft der Gemeinden zur Mitfinanzierung bzw.
Übernahme der Erhaltung und Betriebskosten errichtet.”
In seiner Sitzung am 26. November 1997 hat
der Ausschuß den einstimmigen Beschluß gefaßt:
Ersuchen um Zuweisung an den
Verkehrsausschuß.
Verkehrsausschuß
Petition Nr. 19
überreicht von der Abgeordneten MMag. Dr. Madeleine
Petrovic betreffend “Das Österreichische
Tiertransportgesetz muß bleiben!”
Mit gegenständlicher Petition
überreichte die Abgeordnete MMag. Dr. Madeleine Petrovic ein Anliegen des
Vereins gegen Tierfabriken folgenden Wortlauts:
“Die Österreichischen
Tierschutzorganisationen fordern:
Das
österreichische Tiertransportgesetz muß bleiben!
Das österreichische Tiertransportgesetz ist
wesentlich besser als die Tiertransportrichtlinien der Europäischen
Union. Daher fordere ich mit meiner Unterschrift die Bundesregierung auf,
dafür zu sorgen, daß das österreichische Tiertransportgesetz im
EU-Land Österreich vollinhaltlich aufrecht bleibt und endlich exekutiert
wird.
Die Regierung darf sich auch durch die Androhung
einer Klage vor dem europäischen Gerichtshof nicht zum Nachgeben zwingen
lassen.”
In der Ausschußsitzung am 7. Mai 1997
wurde beschlossen, je eine Stellungnahme des Bundesministeriums für
Wissenschaft und Verkehr sowie der Europäischen Kommission einzuholen:
Das Bundesministerium für Wissenschaft und
Verkehr antwortete dahin gehend, daß seitens seines Ressorts nicht die
Absicht besteht, das Tiertransportgesetz-Straße zu novellieren, “es
wird vielmehr die Ansicht vertreten, daß die Bestimmungen des
Tiertransportgesetzes-Straße vorbildlich für die gesamte
Europäische Union sind.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, daß
sich derzeit auch ein Entwurf eines Tiertransportgesetzes-Eisenbahn betreffend
den Bahntransport lebender Tiere in Begutachtung befindet. Mit dem
Inkrafttreten dieses Gesetzes wird auch der Verkehrsträger Schiene in das
System des Schutzes der Tiere beim Transport einbezogen.”
Von seiten der
Europäischen Kommission langte hinsichtlich der Petition Nr. 19 eine
Stellungnahme des Kommissionsmitgliedes Dr. Franz Fischler ein, der in seinem
Schreiben ausführt, daß die Kommission den Inhalt dieses Dokumentes
sorgfältig geprüft hat und dem Ausschuß für Petitionen und
Bürgerinitiativen des Nationalrates für die Möglichkeit, dazu
Stellung zu nehmen, dankt.
Er führt in seinem
Schreiben weiters aus:
“Die Kommission
begrüßt das Engagement der Tierschutzorganisationen in Ihrem Land
für angemessene Bedingungen beim Tiertransport sowie die Tatsache,
daß Österreich bereits vor dem Beitritt zur Union wirksame
Bestimmungen für den Schutz von Tieren beim Transport erlassen hat.
Darüber hinaus respektiert die Kommission die Kompetenz des
österreichischen Nationalrates, Petitionen im Zusammenhang mit dem Wohlergehen
von Tieren zu beurteilen.
Dessenungeachtet
müssen die Mitgliedstaaten die Bestimmungen der Richtlinie 91/628/EWG des
Rates über den Schutz von Tieren beim Transport, geändert durch die
Richtlinie 95/29/EG, einhalten. Diese Richtlinie enthält genaue Standards,
die die Mitgliedstaaten in nationales Recht umsetzen müssen. Es handelt
sich dabei nicht um eine Richtlinie mit Mindestanforderungen, weshalb die
Mitgliedstaaten insbesondere in den grundlegenden Bereichen wie Fahrzeiten,
Fütterungs- und Tränkanforderungen usw. keine strengeren nationalen
Bestimmungen erlassen dürfen.
In diesem Zusammenhang
möchte ich Sie darauf hinweisen, daß Österreich die Kommission
bis heute noch nicht vollständig über die Umsetzung der genannten
Richtlinie in nationales Recht informiert hat. Die Kommission war daher
gezwungen, in dieser Angelegenheit gemäß Artikel 169 EG-Vertrag
ein Verstoßverfahren einzuleiten.”
Einstimmiger
Beschluß in der Ausschußsitzung am 26.
November 1997:
Ersuchen um Zuweisung an
den Verkehrsausschuß.
Verkehrsausschuß
Petition Nr. 13
überreicht vom
Abgeordneten Josef Edler betreffend “20 Jahre
Fluglärm sind genug – Die Donaustadt fordert ihr Recht”
Die Initiatoren dieser
Petition ersuchen den Nationalrat, der permanent zunehmenden
Fluglärmbelastung in der Donaustadt endlich Maßnahmen
entgegenzusetzen.
“Die Piste 16/34
wurde von der betroffenen Bevölkerung von Anfang an massiv abgelehnt.
40 000 Bürger bekundeten dies mit ihrer Unterschrift. Alle
für die Entscheidung des Baus vorliegenden Gutachten sprachen sich
ebenfalls gegen den Bau der Piste aus.
Die seinerzeitigen
Befürchtungen wurden durch die tatsächliche Entwicklung noch bei
weitem übertroffen.
Als besonders belastend
wird von der ansässigen Bevölkerung empfunden:
1. Die seinerzeit von den zuständigen
Ministern zugesagte Belastungsgrenze von maximal 17% des Gesamtflugverkehrs
wird nachweislich permanent überschritten. Ebenso wird das Versprechen,
keine Starts in Richtung Donaustadt durchzuführen, in zunehmendem
Maße gebrochen.
2. Die verbindlichen Zusagen aller politischen
Gruppierungen zur Einführung eines Nachtflugverbotes wurden nie
erfüllt.
3. Die vorgeschriebene Mindesthöhe
beim Anfliegen wird fast nie eingehalten.
Aus den oben angeführten Gründen hat
sich die Bürgerinitiative ,20 Jahre Fluglärm sind genug –
Die Donaustadt fordert ihr Recht‘ entschlossen, den Nationalrat dringend
aufzufordern, folgende Sofortmaßnahmen zu beschließen:
1. Einhaltung der zugesagten
Belastungsgrenze von maximal 17% des Flugaufkommens und des Verbots von Starts
in Richtung Donaustadt.
2. Einführung eines
,Schönwetter-ILS‘, das eine Verschwenkung des Anflugverfahrens bei
Errichtung eines eigenen Radarsystems ermöglicht.
3. Sofortige Einführung eines
Nachtflugverbotes in der Zeit zwischen 22 Uhr und 6 Uhr, wie es in
anderen Großstädten Europas bereits selbstverständlich ist.
4. Lückenlose Kontrolle der
Einhaltung der vorgeschriebenen Anflugverfahren (zB Mindestflughöhe) und
Einführung von Sanktionen bei Nichteinhaltung.
5. Zur
Vermeidung von Gesundheitsschäden durch Lärmbelästigung sind anstelle
der derzeit üblichen Durchschnittswerte ausschließlich die
Spitzenwerte zur Beurteilung heranzuziehen, zu kontrollieren und deren
Überschreitung zu sanktionieren.
Einstimmiger Beschluß in der Ausschußsitzung am 17. Oktober 1996:
Ersuchen um Zuweisung an den
Verkehrsausschuß.
Dem Bericht 621 der Beilagen des
Verkehrsausschusses vom 7. März 1997 wurde ein Entschließungsantrag
beigedruckt, welcher in der 67. Sitzung des Nationalrates am
20. März 1997 mit Stimmenmehrheit angenommen wurde.
Wirtschaftsausschuß
Petition Nr. 4
überreicht von den Abgeordneten Dr. Gottfried
Feurstein, Mag. Walter Guggenberger, Klara Motter und Dr.
Helene Partik-Pablé betreffend “die berufliche
Eingliederung von lernbehinderten Jugendlichen”
Die Abgeordneten Dr. Gottfried Feurstein, Mag.
Walter Guggenberger, Klara Motter und Dr. Helene Partik-Pablé haben
folgendes Anliegen des Berufsausbildungswerkes Wien als Petition eingebracht:
“Die berufliche
Eingliederung von lernbehinderten Jugendlichen
(Reform in der Rehabilitation)
I. Ihre Situation
1. Lernbehinderte Jugendliche im System der
beruflichen Eingliederung
In Österreich beginnen jedes Jahr zirka
5 000 lernbehinderte Jugendliche ) den
schwierigen Weg der sozialen und beruflichen Eingliederung. Für viele
dieser jungen Männer und Frauen verläuft dieser Weg hoffnungsvoll.
Sie nehmen an unserem gesellschaftlichen Leben teil, sind in den Arbeitsmarkt
eingegliedert und ihre ursprüngliche Behinderung hat ihre
Einschränkung weitgehend verloren. Die gesetzlichen Regeln und die
vorhandenen Hilfen und Bedingungen genügen als Grundlagen, diesen jungen
Menschen einen Einstieg ins Berufsleben und damit eine soziale Integration zu
ermöglichen.
Unser System der beruflichen Rehabilitation kann
einen großen Teil der jugendlichen Rehabilitanden in das Arbeitsleben
eingliedern. Für einen beachtlichen Teil dieser jungen Schulabgänger
greift aber das System der Rehabilitation noch nicht ausreichend. Teile in der
Eingliederungskette fehlen gänzlich oder sind nicht immer organisch
miteinander verbunden. Ziele und Instrumente der Rehabilitation müssen
daher ergänzt und angepaßt werden, um auch diesen Jugendlichen die
Perspektive eines erfüllten und möglichst selbständigen Lebens
zu eröffnen. Immerhin bleiben etwa 30% der ehemaligen Sonderschüler,
besonders die Leistungsschwächeren unter ihnen, langfristig arbeitslos.
Vor diesem Hintergrund und aus langjährigen
Erfahrungen lassen sich Grundlagen erarbeiten, die das System der beruflichen
Rehabilitation der Schulabgänger mit Lernproblemen abrunden und die
für jenen Rehabilitanden Hilfe bedeuten, denen das heutige Eingliederungsbemühen
noch nicht befriedigt.
In Bayern bewähren sich folgende Instrumente
der beruflichen Rehabilitation – sie könnten bei uns Ansätze
bieten:
Eine behinderungsgerechte Ausrichtung der Berufswahlvorbereitung
durch Schule und Berufsberatung kann die Probleme der Jugendlichen beim
Übertritt von der Schule in die Arbeitswelt wesentlich verringern.
Gezielte Bildungsmaßnahmen einer Berufsvorbereitung
können vielen jungen behinderten Menschen nach der Schulentlassung helfen,
ihre vorläufigen Arbeits- und Ausbildungsprobleme abzubauen. Diese
Maßnahmen bewähren sich in Bayern.
Sozialpädagogische Hilfen an den Nahtstellen zeigen – wie zB beim Übergang zum
Arbeits- und Berufsleben oder beim Lernen für die Berufsschule –,
daß Maßnahmen der persönlichen Förderung zu einem sinnvollen
und notwendigen Bestandteil der beruflichen Rehabilitation werden können.
Die Berufsausbildung Lernbehinderter in
Betrieben hat in Bayern in den vergangenen Jahren, insbesondere auch durch
den Einsatz begleitender sozialpädagogischer Hilfen, durch die
Lernförderungen in den Berufsschulen oder durch Kombination einer
Ausbildung von Betrieb, Berufsschule und Bildungswerken zu eindrucksvollen
Ergebnissen geführt.
Die Berufsausbildung von Sonderschülern in
Lehrwerkstätten entwickelte sich in Österreich in den letzten
zwanzig Jahren sehr positiv. Rund 90% von ihnen verlassen nach gesetzlich
vorgeschriebener Ausbildungszeit und nach bestandener
Lehrabschlußprüfung in einem anerkannten Beruf diese Einrichtungen.
Leider sind diese Ausbildungsplätze in Wien stark zurückgegangen,
anstatt sie dem wirklichen Bedarf entsprechend zu erhöhen.
In der Europäischen Union ist die
berufliche Qualifizierung von Randgruppen und daher auch von behinderten
Jugendlichen bereits seit geraumer Zeit ein bedeutendes Anliegen der
europäischen Sozialpolitik.
Der Europäische Sozialfonds (ESF)
fördert solche Vorhaben unter der Voraussetzung der innerstaatlichen
Mitfinanzierung mit beträchtlichen Mitteln. Nach ersten Schätzungen
sollte Österreich im Falle eines Beitrittes jährlich etwa
1,5 Milliarden aus diesem Fonds erhalten, sodaß im Sinne der Verwirklichung
des Prinzips der Chancengleichheit auch behinderte Jugendliche an diesen
Mitteln beteiligt werden können.
Wir besitzen langjährige Erfahrungen als
Eltern, Lehrer und Fachleute der beruflichen Rehabilitation mit
Sonderschülern und haben ernste Sorgen um die Zukunft dieser unversorgten
jungen Menschen. Wir beabsichtigen jetzt, Vorschläge zur Verbesserung des
derzeitigen Systems der beruflichen Eingliederung von Jugendlichen mit Lernproblemen
einzubringen.
Zusammen mit Politikern, Beamten und
Sozialpartnern wollen wir uns konzentriert an einer verbesserten
Berufseingliederung dieser benachteiligten Gruppe beteiligen.
2. Beschreibung der
Personengruppe
Welche junge Menschen meinen wir, wenn wir von
Jugendlichen sprechen, die Lernprobleme erleben und daher Lernförderung
brauchen? Zunächst sind hier Schüler der Allgemeinen Sonderschulen zu
nennen. Zur Zeit besuchen zirka 40 000 Schüler diese Schulform.
Außerdem finden wir unter den Hauptschülern mit und ohne
Abschluß zunehmend solche, die ebenfalls vielfältige Formen von
Lernstörungen und Lernbehinderungen aufweisen.
Nach den Unterlagen der Schulen und
Arbeitsämter müßten jährlich allein in Wien etwa
1 000 förderungsbedürftige Schulabgänger eine berufliche
Rehabilitation erhalten. Der Begriff ,lernbehindert‘ ist bei uns kein
schulrechtlicher Begriff. Wir wollen ihn daher kurz umschreiben. In Bayern
gelten solche Kinder als lernbehindert, die in ihrem Lernen schwerwiegend, umfänglich,
langandauernd beeinträchtigt sind und in den allgemeinen Pflichtschulen
nicht ausreichend gefördert werden können. Lernbehinderungen
drücken sich unter anderem dadurch aus, daß die Betroffenen
oftmals Schwierigkeiten bei der Aufnahme von komplexen Sachverhalten haben,
daß sie langsamer lernen und klare überschaubare Instruktionen
benötigen. In der Regel sind Motorik und Wahrnehmung zu fördern.
Lernbehinderung ist eine nicht direkt sichtbare
Form von Behinderung, die oft von den Betroffenen selbst nicht akzeptiert wird.
Ihre Symptome sind Mangel an Selbstvertrauen und Kritikfähigkeit
gegenüber der eigenen Leistung, in Problemen der Motivation und Ausdauer
sowie des Verhaltens und Selbstvertrauens. Diese Merkmale können auf
unterschiedliche Ursachen zurückgeführt werden, zB hirnorganische
Schädigungen, genetische Bedingungen sowie ungünstige
Sozialisationsbedingungen.
Damit wird deutlich, daß Lernbehinderung
kein einheitliches Schädigungsbild darstellt. Fähigkeiten,
Fertigkeiten und und somit der individuelle Förderungsbedarf müssen
vielmehr exakt diagnostiziert werden. Bei zutreffender Diagnose und
zielgerichteter Förderung werden heute in der Rehabilitation oft
Lernfortschritte und Abschlüsse erreicht, die ursprünglich nicht
erwartet und vorausgesagt werden konnten.
3. Hemmnisse auf dem Weg zur beruflichen
Qualifikation
Der Zugang zu einer dauerhaften
Berufstätigkeit führt in unseren Überlegungen in der Regel
über eine qualifizierte Berufsausbildung im dualen System, deren
Grundlagen in Berufsausbildungsgesetz (BAG) im wesentlichen festgelegt sind. In
Deutschland gelten auch gesetzliche Regelungen für Behinderte. In den
Inhalten und Abschlüssen nehmen die Sozialpartner neben anderen
Beteiligten einen entscheidenden Einfluß. Das Ziel aller Bemühungen
um eine berufliche Eingliederung Lernbehinderter muß eine berufliche
Qualifikation sein, die die Leistungsfähigkeit des Lernbehinderten
ausschöpft und Chancen zu einer dauerhaften und krisenfesten
Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eröffnet.
Für dieses wichtigste Ziel, das sich die
gesamte Rehabilitation zu eigen machen sollte, werden heute bei uns noch viel
zu wenig Anstrengungen gemacht und im Verhältnis zu anderen Bereichen nur
unbeträchtliche Budgetmittel aufgewendet.
Allerdings gibt es derzeit auf dem Weg zur
qualifizierten Ausbildung Hindernisse, deren Abbau im Sinne des
Rehabilitationsgedankens notwendig ist. Diese Hemmnisse tragen dazu bei,
daß jahrelange sonderpädagogische Förderung und begonnene
Eingliederungsmaßnahmen nicht zur dauerhaften Eingliederung, sondern zur
Ausgliederung, zu einem Leben mit Sozialhilfe und zu Arbeitslosigkeit
führen.
Die wichtigsten Gesichtspunkte wollen wir hier
anführen:
3.1 Unzureichende
Berufsvorbereitung durch die Sonderschule
Die Vorbereitung auf die Berufswelt gehört
unter anderem auch zum Auftrag der Schule. Bis heute fehlt es häufig an
einem angemessenen berufswahlvorbereitenden Unterricht. In Deutschland wurde
dazu die fächerübergreifende ,Arbeitslehre‘ eingeführt,
die die Zusammenarbeit von Schule, Berufsberatung und Eltern regelt.
Aus Industrie, Handel und Gewerbe sowie
Berufsschulen wird vielfach die Kritik vorgetragen, daß die abgebenden
Schulen zu wenig und zu unrealistisch auf eine Berufsausbildung vorbereiten.
3.2 Mangelnde Hilfen
beim Übergang Schule/Beruf
Die Jugendlichen mit Lernproblemen sind in der
Regel überfordert, eigene fundierte Entscheidungen über ihren
Berufsweg zu treffen. Obwohl sich die Berufsberater in vielfältiger Weise
um diese Jugendlichen bemühen, bleibt bis heute für
Förderungsbedürftige das Angebot an Vorbereitungsmaßnahmen und
Überbrückungslehrgängen relativ klein und individuell wenig
angepaßt.
Zudem verfügen die Jugendlichen und ihre
Familien auch nicht über die Fähigkeit, die Informationen sinnvoll
und unter Berücksichtigung ihrer Möglichkeiten und Grenzen
auszuwerten. Hier fehlt es an Ansprechpartnern, die in Zusammenarbeit mit
Elternhaus, Berufsberatung und Schule den Jugendlichen bei der
Berufswahlvorbereitung, Berufswahlentscheidung und Berufsausbildung begleiten
können.
3.3 Zu wenig
Ausbildungsplätze für Sonderschüler
In der gegenwärtigen Lage auf dem
Ausbildungsstellenmarkt sind Vorbehalte der Betriebe gegenüber der
Leistungsfähigkeit von Lernbehinderten besonders groß. Dabei wurden
zB in Wien vor allem im Handwerk gute Erfahrungen bei der Berufsausbildung mit
diesen Jugendlichen gemacht.
3.4 Hohe theoretische Anforderungen in den
Ausbildungsberufen
Viele Ausbildungsberufe sind heute mit hohen
theoretischen Anforderungen verbunden. Sie verlangen von den Auszubildenden ein
großes Abstraktionsvermögen und fundierte schulische Kenntnisse. Es
hat den Anschein, daß durch Hochtechnologie immer mehr Ausbildungsberufe
für Lernbehinderte ausfallen.
3.5 Probleme in
beruflichen Schulen
Die Berufsschulen als Teil des dualen Systems sind
unter normalen Bedingungen nicht in der Lage, lernbehinderten Schülern die
vorgegebenen Lerninhalte zu vermitteln. Wir empfehlen daher, hier
Maßnahmen zu setzen, wodurch auf Grund verschiedener
Beeinträchtigungen die Schülerzahlen in Integrationsklassen von Berufsschulen
herabgesetzt und die Lehrer mit sonderpädagogischen Kenntnissen
ausgestattet werden. Jeder Schüler soll ein individuelles
Förderangebot erhalten.
3.6.
Eingeschränktes Ausbildungsangebot
Wie bereits erwähnt haben sich heutzutage die
Anforderungen einer qualifizierten Berufsausbildung in vielen Berufen so
verändert, daß nur noch eine geringe Anzahl an Ausbildungsberufen
zur Verfügung steht, die von Lernbehinderten erfolgreich abgeschlossen
werden können. Noch kleiner ist das Angebot für weibliche Jugendliche,
die fast ausschließlich zur Ausbildung in die Bereiche Hauswirtschaft,
Textil und Verkauf abgedrängt werden.
3.7 Ungenügende
Ausbildungsregelungen, die auch für Lernbehinderte geeignet sind
Für Lernbehinderte, deren Behinderung so
umfangreich ist, daß sie den theoretischen Anforderungen der Ausbildung
nach dem Berufsausbildungsgesetz nicht genügen können, müssen
qualifizierende Möglichkeiten mit Schwerpunkt auf fachpraktische
Ausrichtung geschaffen werden.
In Deutschland bestehen bereits konkrete Regelungen
im § 48 BBiG und im § 42b HwO, die zu Abschlüssen in
anerkannten Ausbildungsberufen führen. Bei uns gibt es zwar Ansätze
derartiger Maßnahmen, aber keine durchdiskutierte und gesetzlich
geregelten Ausbildungsangebote. Dieses Vakuum verführt zu unfertigen
Projekten, die die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllen
können. Die Nachteile sind offensichtlich.
3.8 Starke
Ausprägung der Lernbehinderung
Unter den Abgängern der Sonderschule gibt es
darüber hinaus Jugendliche, die auf Grund ihrer umfassenden Behinderung
und trotz aller Bemühungen und Förderung nicht oder mittelfristig
noch nicht in der Lage sind, eine Berufsausbildung im Sinne eines reformierten
Berufsausbildungsgesetzes anzutreten (mit Regelungen wie für Punkt 3.7). Für
sie sind auch qualifizierende Regelungen zu setzen. Unter den jetzigen
Bedingungen sind sie vom Erwerb als Arbeitnehmer völlig ausgeschlossen.
II. Vorschläge
Verbesserung der beruflichen Eingliederung
Damit das System der beruflichen Rehabilitation
stärker als bisher die nicht ausreichend versorgten Jugendlichen unter
lernbehinderten Rehabilitanden erfaßt werden, haben wir
Verbesserungsvorschläge erarbeitet. Sie werden allen Beteiligten und der
Öffentlichkeit unterbreitet werden. Wichtig erscheint dabei, daß
nicht jeder Lösungsvorschlag an jedem Ort in Österreich verwirklicht
werden kann. Selbstverständlich müssen zusätzlich die regionalen
Bedingungen berücksichtigt werden.
Wir vom Berufsausbildungswerk Wien richten einen
dringenden Appell an alle in Österreich bestehenden Parteien und an die
Sozialpartnerschaft, aber auch an die Ressortminister der Bundesregierung und
an die Landesregierungen, an die Organe der Behörde und Verwaltung. Wir
übergeben vor allem unseren Volksvertretern im Parlament diese vorliegende
Petition:
Im Interesse der betroffenen jungen Menschen
fordern wir von Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, Unterstützung und
appellieren dringend, sich dafür einzusetzen:
– den Anspruch der
beschriebenen Personengruppe auf eine geeignete berufliche Qualifikation und
eine berufliche Rehabilitation nicht nur anzuerkennen, sondern auch zu
verwirklichen,
– alle ordnungsrechtlichen
Möglichkeiten des Berufsausbildungsgesetzes auszuschöpfen, um jungen
Menschen mit einer starken Ausprägung der Lernbehinderung zu einem
beruflichen Abschluß zu verhelfen.
In unsere Arbeit setzen wir die Hoffnung,
daß sich die Politiker und Verantwortlichen schon heute mit den
wahrscheinlichen Entwicklungen der kommenden Jahre auseinandersetzen. Ihre
entsprechenden Entscheidungen werden die Zukunft vieler benachteiligter
Menschen berühren. Und nur sie werden schließlich die Verantwortung
für ihre verbesserte und gesicherte Lebensqualität tragen. Wir
können Sie mit unserem Wissen und einer großen Erfahrung nachhaltig
unterstützen.”
In der Ausschußsitzung am 3. Juli 1996
haben die Mitglieder des Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen
beschlossen, zu der gegenständlichen Petition je eine Stellungnahme des
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, für wirtschaftliche Angelegenheiten
und für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten einzuholen.
Das Bundesministerium für Unterricht und
kulturelle Angelegenheiten beruft sich in seiner Stellungnahme auf die
Beantwortung der gleichlautenden Petition Nr. 5 der XIX. GP.
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
führt aus, daß der Inhalt dieser Petition ident sei mit dem Inhalt
der Petition Nr. 5 aus dem Jahre 1995 und bereits damals eine
Stellungnahme ergangen sei. Das Ministerium legt diese Stellungnahme daher
neuerlich vor:
“In Entsprechung des Beschlusses des
Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen vom 27. April
1995 nimmt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales zur Petition
Nr. 5 ,Die berufliche Eingliederung von lernbehinderten
Jugendlichen‘ wie folgt Stellung:
Einleitend muß festgestellt werden,
daß einige der angesprochenen Problembereiche nicht in den
Wirkungsbereich des Bundesministers für Arbeit uns Soziales fallen. So
bestehen insbesondere in den Bereichen der schulischen Ausbildung und der
betrieblichen Berufsfortbildung bzw. Berufsausbildung Zuständigkeiten
anderer Bundesminister.
Für die berufliche Eingliederung von
lernbehinderten Jugendlichen sind jedoch Maßnahmen des
Arbeitsmarktservice von großer Bedeutung. Dabei werden im Jahr 1995 die
Grundlagen für die Verbesserung der Qualifizierung behinderter Personen
sowie der Verbesserung der Berufswahl von lern- und geistig behinderten
Personen weiterentwickelt. Als Leitlinie dient hierbei insbesondere
Punkt 5 – ,Berufsausbildung‘ – des Behindertenkonzeptes
der Bundesregierung, das sich im wesentlichen mit den Ausführungen und
Zielsetzungen der gegenständlichen Petition deckt.
Im Zuge dieses Vorhabens wurde bei der Abteilung
für Angewandte und Klinische Psychologie der Universität Wien eine
Studie ,Arbeitsintegration lern- und geistig behinderter Menschen‘ in
Auftrag gegeben; der Endbericht der Studie wird in den nächsten Tagen
erwartet. Weiters werden Einrichtungen zur Qualifizierung behinderter Personen
evaluiert und die Ergebnisse in die weitere Planung eingebaut. Um die
Berufswahl von lern- und geistig behinderten Jugendlichen zu unterstützen,
werden Handlungsanleitungen für BeraterInnen im Arbeitsmarktservice
sowie LehrerInnen ausgearbeitet.
Speziell für die RehaberaterInnen wurde ein
Lehrgang für die Weiterentwicklung der Beratungskompetenz im Bereich
der beruflichen Rehabilitation erstellt. Die einzelnen Module des Lehrgangs
umfassen Themen wie ,Organisation der beruflichen Rehabilitation für
NeueinsteigerInnen in der Reha-Beratung‘, ,Medizinische Grundlagen auf
dem Gebiet der Rehabilitation‘ sowie ,Berufskunde für
RehaberaterInnen‘. Der Lehrgang und die einzelnen Module werden laufend
evaluiert und den erforderlichen Gegebenheiten angepaßt.
Für die berufliche Eingliederung von
lernbehinderten Jugendlichen ist besonders das Konzept der
,Arbeitsassistenz‘ relevant, das bundesweit umgesetzt werden soll. Die
bisher stattgefundene Evaluierung der Arbeitsassistenz hat sich auf psychisch
Beeinträchtigte konzentriert und wird auf lernbehinderte Jugendliche
ausgedehnt.
Das Arbeitsmarktservice fördert (bis zu 100%)
eine Reihe von Organisationen, die sich mit der beruflichen Integration
von lernbehinderten Jugendlichen befassen. Innerhalb des Budgets des
Europäischen Sozialfonds (ESF) zur Förderung von jugendlichen
Behinderten sind auch spezielle Maßnahmen für lernbehinderte
Jugendliche vorgesehen, deren Konkretisierung noch verhandelt wird. Dadurch
wird eine Ausweitung der entsprechenden Programme ermöglicht.
Da laut Behindertenkonzept der
österreichischen Bundesregierung grundsätzlich dem Zugang zu
allgemeinen Ausbildungsplätzen Vorrang gegenüber Sondereinrichtungen
gegeben wird, wird das Arbeitsmarktservice die Flexibilisierung der Aus- und
Weiterbildung auch in den nächsten Jahren betreiben, um dadurch Qualifizierungsmaßnahmen
zu erhalten, die auf die indivudellen Bildungsbedürfnisse der
SchulungsteilnehmerInnen abgestellt sind.
Eine laufende Überprüfung und Anpassung
der Angebote an die Erfordernisse des Arbeitsmarktes ist für alle
Maßnahmen im Auftrag des Arbeitsmarktservice verpflichtend und wird in
Zukunft durch die Entwicklung eines Controllingsystems noch verstärkt
werden.”
Vom Bundesministerium für wirtschaftliche
Angelegenheiten ist zur Petition Nr. 4 folgende Stellungnahme
eingelangt:
“1. Dem Bundesministerium für
wirtschaftliche Angelegenheiten ist bewußt, daß die
Möglichkeit der Erlangung eines rechtlich anerkannten
Ausbildungsabschlusses von wesentlicher Bedeutung für die berufliche
Eingliederung von lernbehinderten Jugendlichen ist. Derzeit fehlen im
Berufsausbildungsgesetz rechtliche Vorkehrungen zur Einrichtung
spezifischer Ausbildungsgänge, die auch lernschwächeren Personen
die Absolvierung einer anerkannten Berufsausbildung ermöglichen.
2. Das Bundesministerium für wirtschaftliche
Angelegenheiten hat daher in einem vorerst für den internen Gebrauch
ausgearbeiteten Entwurf einer Berufsausbildungsgesetz-Novelle auch eine
rechtliche Grundlage für die Ausbildung von Lehrlingen in
Ausbildungsstufen mit der Möglichkeit der Ablegung von Zwischenprüfungen
nach dem zweiten Lehrjahr vorgesehen. In dieses System einer Modulausbildung
könnte dann auch die ,Anlehre‘ integriert werden. Damit stünde
auch lernschwächeren Personen der Erwerb eines gesetzlich geregelten,
formalisierten, jedoch etwas niedrigeren Ausbildungsabschlusses offen.
Im allgemeinen Begutachtungsverfahren der
Berufsausbildungsgesetz-Novelle wird sich herausstellen, ob diese
Vorschläge für eine entsprechende Adaptierung des
Berufsausbildungsgesetzes politisch durchsetzbar sind.
3. Von einer Übermittlung der betreffenden
Textpassagen des Entwurfes zur Berufsausbildungsgesetz-Novelle wird abgesehen,
um dem Begutachtungsverfahren nicht vorzugreifen und allfällige
Irritationen der politischen Willensbildung in dieser Frage zu vermeiden.”
Einstimmiger Beschluß in der Ausschußsitzung am 17. Oktober 1996:
Ersuchen um Zuweisung an den
Wirtschaftsausschuß.
Der Wirtschaftsausschuß hat die
gegenständliche Petition Nr. 4 am 10. Juni 1998 in Verhandlung
genommen und in seinem Bericht an den Nationalrat (1268 der Beilagen) dem
Präsidenten des Nationalrates eine Zuweisung an den Ausschuß
für Arbeit und Soziales empfohlen.
2.
Bürgerinitiativen
Ausschuß
für Arbeit und Soziales
Bürgerinitiative
Nr. 5
eingebracht von Dr. Andreas Stippler
betreffend “Arbeitszeit für Ärzte in Krankenanstalten”
Mit dieser
Bürgerinitiative wird darauf hingewiesen, daß sich auf Grund der
derzeitigen Rechtslage betreffend die Arbeitszeit für Ärzte in
Krankenanstalten grundsätzlich eine sachlich nicht gerechtfertigte
Differenzierung nach dem Rechtsträger der Krankenanstalt (Dienstgeber)
ergibt.
“So gilt für
private Rechtsträger, wie Sozialversicherungsträger, Orden usw. das
Arbeitszeitgesetz, BGBl. Nr. 461/1969. Für Krankenanstalten von
Gebietskörperschaften gelten jedoch keine geregelten Arbeitszeitbegrenzungen
für Ärzte.
Durch diesen
,regelungsfreien Raum‘ bedingt, werden Spitalsärzte vielfach weit
über ein sozial vertretbares Ausmaß zur Dienstleistung herangezogen.
Unabhängig von den persönlichen Konsequenzen der betroffenen
Spitalsärzte kann diese übermäßige Inanspruchnahme auch
dazu führen, daß für Patienten nicht mehr die optimale
medizinische Versorgung gewährleistet werden kann. Darüber hinaus,
neben diesen ,patientenfeindlichen‘ Arbeitsbedingungen, die EU-Richtlinie
über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung unter anderem die
Realisierung einer durchschnittlichen wöchentlichen Höchstarbeitszeit
von 48 Stunden ab 23. November 1996 auch für Ärzte in
Österreich, unabhängig vom Rechtsträger, vorschreibt.
Die nunmehr von
niederösterreichischen Spitalsärzten gesammelten Unterschriften zur
Unterstützung der parlamentarischen Bürgerinitiative sollen dazu
beitragen, ein bundeseinheitliches Arbeitszeitgesetz für Ärzte an Krankenanstalten
entsprechend den Bestimmungen der EU-Richtlinien fristgerecht durch den
Nationalrat zu verabschieden, um dadurch einerseits die Vital-EU-Integration
Österreichs zu dokumentieren und andererseits den Patienten
österreichischer Krankenanstalten eine tatsächlich patientengerechte
ärztliche Betreuung im ausreichenden Maß zu gewährleisten.
Ein wesentlicher
Bestandteil eines Arbeitszeitgesetzes für Ärzte ist, daß den
betroffenen Dienstnehmern/Ärzten die Gestaltungskompetenz
bezüglich der Einteilung der Arbeitszeit zuerkannt wird. Wie in den
diversen Vorentwürfen zu einem Arbeitszeitgesetz für Ärzte
enthalten, dürfen Regelungen für ,verlängerte Dienste‘,
also jene Dienste, die über die normale tägliche Arbeitszeit von
13 Stunden hinausgehen, von Vertretern der jeweiligen Ärzteschaft mit
dem Dienstgeber vereinbart werden.
Um entsprechend den demokratischen
Grundsätzen derartige ,Betriebsvereinbarungen‘ schließen zu
können, ist es erforderlich, daß in den einschlägigen Gesetzen
(wie Arbeitsverfassungsgesetz und Personalvertretungsgesetz) den Ärzten
ein eigenständiges Vertretungsrecht eingeräumt wird. Nur durch diese
gesetzliche Verankerung von ,Ärzte-Betriebsräten‘ mit
entsprechender Kompetenz zur Vereinbarung von menschenwürdigen
Arbeitszeitbedingungen für Ärzte und für eine optimale Patientenversorgung,
erscheint eine bundeseinheitliche und sozial vertretbare Arbeitszeitgestaltung
für Ärzte möglich.
Da eine detaillierte Darstellung aller Argumente
und Anliegen im Zusammenhang mit der vorliegenden parlamentarischen
Bürgerinitiative im Korrespondenzwege nicht möglich ist und ich
gleichermaßen an sämtlichen Aspekten bzw. offenen Fragen der im
Ausschuß vertretenen Parlamentarier interessiert bin, darf ich mit dem
Wunsch auf entsprechende Information auch die Bitte an den Vorsitzenden des
Ausschusses richten, mich zu der Beratung mit den hochgeschätzten
Abgeordneten einzuladen, um im persönlichen Gespräch die Problematik
erörtern zu können.”
Einstimmiger Beschluß in der Ausschußsitzung am 3. Juli 1996:
Ersuchen um Zuweisung an den Ausschuß
für Arbeit und Soziales.
Der Ausschuß für Arbeit und Soziales
hat die gegenständliche Bürgerinitiative in Verhandlung gezogen und
dem Nationalrat am 4. Dezember 1996 berichtet (siehe 538 der Beilagen).
Dieser Bericht wurde in der 53. Sitzung des Nationalrates am
13. Dezember 1996 mit Stimmenmehrheit zur Kenntnis genommen.
Ausschuß
für Arbeit und Soziales
Bürgerinitiative Nr. 8
eingebracht von Herrn
Josef Bürger betreffend “gesetzliche Anerkennung des
Blindenführhundes als Hilfsmittel und Diensthund in Österreich”
Die Bürgerinitiative
wurde mit folgendem Inhalt eingebracht:
“Führhunde
für Blinde, Partnerhunde für Rollstuhlfahrer und schwer
Körperbehinderte, sowie Signalhunde für Gehörlose und
Gehörbehinderte, zusammengefaßt unter dem Überbegriff
Rehabilitationshunde, vermögen durch ihre spezielle Ausbildung die
Selbständigkeit behinderter Menschen und somit deren soziale Integration
zu erhöhen. Dieser wichtigen Funktion trägt die derzeitige Gesetzeslage
nur in höchst ungenügender Weise Rechnung, sodaß sich die
Halter von Rehabilitationshunden zahlreichen Hindernissen rechtlicher und
tatsächlicher Natur gegenübersehen.
An den Nationalrat wird
daher der Antrag gestellt:
Der Nationalrat möge
die erforderlichen legistischen und politischen Rahmenbedingungen schaffen, um
die Anerkennung des Rehabilitationshundes herbeizuführen. Er möge
insbesondere in folgender Hinsicht alle erforderlichen Schritte setzen:
I. Anerkennung als
Hilfsmittel durch die Krankenkassen
Der Rehabilitationshund ist als Hilfsmittel im
Sinne der Sozialversicherungsgesetze, zB § 154 ASVG, anzuerkennen.
Darüber hinaus sollte zur Vereinheitlichung der Finanzierung dieses
Hilfsmittels eine gesetzliche Pflichtleistung eingeführt werden, um die Gewährung
von Zuschüssen durch die Sozialversicherungsträger nicht der
Entscheidung im Einzelfall vorzubehalten. Die derzeitige Praxis ist extrem
uneinheitlich.
II. Anerkennung als
Diensthund
a) Verankerung des
weißen Führgeschirres in der Straßenverkehrsordnung als
Verkehrsschutzzeichen:
Das weiße Führgeschirr soll dem
weißen Blindenstock gleichgestellt und im § 3 der
Straßenverkehrsordnung (Ausnahmen von Vertrauensgrundsatz)
ausdrücklich verankert werden.
b) Zutrittsrecht zu
allen öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen
Der Rehabilitationshund befähigt den
Behinderten, sich ohne Begleitperson auch außerhalb seiner Wohnung zu
bewegen. Diese Möglichkeit endet für ihn allerdings an der
Eingangstür öffentlicher Gebäude, wie zB Schulen, Gerichte,
Ämter, kulturelle Einrichtungen, da deren Hausordnungen keine Ausnahmen
für Rehabilitationshunde vorsehen. Auch hier ist dringend Abhilfe zu
schaffen, damit auch behinderte Staatsbürger ihren Bürgerpflichten
nachkommen und ihre kulturellen Rechte wahrnehmen können.
c) Verankerung der
Mitnahmepflicht in den Beförderungsrichtlinien (Bus, Bahn)
öffentlicher und privater (Taxi) Beförderungsunternehmen
Sowohl in öffentlichen Verkehrsmitteln als
auch bei privaten Fuhrunternehmen stößt die Mitnahme von
Rehabilitationshunden auf Schwierigkeiten, auf deren Beseitigung hinzuwirken
wäre.
d) Zutrittsrecht in
allen Geschäften des täglichen Bedarfes
Es soll nach Möglichkeit ein Rahmen
geschaffen werden, der Behinderten das Betreten von Geschäften mit ihrem
Rehabilitationshund erlaubt.”
In der Ausschußsitzung am 17. Oktober
1996 beschloß der Ausschuß, je eine Stellungnahme des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales, des Bundeskanzleramtes, des Blindenverbandes
sowie der Volksanwaltschaft einzuholen.
Die Stellungnahme des Bundesministeriums für
Arbeit und Soziales lautete folgendermaßen:
“Ad I.
Anerkennung als Hilfsmittel durch die Krankenkassen:
Die Frage der Anerkennung
des Blindenführhundes und des Partner-, Therapie- bzw. Rehabilitationshundes
als Hilfsmittel im Sinne des ASVG sowie die Forderung nach einer
Kostenübernahme als medizinische Maßnahme der Rehabilitation in der
Krankenversicherung wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach behandelt. Im
folgenden werden diese Problemkreise zusammenfassend dargestellt:
1.
Blindenführhund als Hilfsmittel im Sinne des ASVG:
Aus der Sicht der
Sozialversicherung ist zur Frage der Anerkennung des Blindenführhundes als
Hilfsmittel im Sinne der sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen festzuhalten,
daß das Bundesministerium für Arbeit und Soziales – entgegen
der Rechtsmeinung des Hauptverbandes der österreichischen
Sozialversicherungsträger – stets die Auffassung vertreten hat,
daß Blindenführhunde bei extensiver Auslegung dem gesetzlichen
Hilfsmittelbegriff des § 154 ASVG unterstellt werden können.
Nach § 154 ASVG (,Hilfe bei körperlichen Gebrechen‘) kann
die Satzung der Krankenversicherungsträger bei Verstümmelungen,
Verunstaltungen und körperlichen Gebrechen, welche die Gesundheit, die
Arbeitsfähigkeit oder die Fähigkeit, für die lebenswichtigen
persönlichen Bedürfnisse zu sorgen, wesentlich beeinträchtigen,
Zuschüsse für die Anschaffung der notwendigen Hilfsmittel sowie
für deren Instandsetzung vorsehen. Nach der Legaldefinition des
§ 154 ASVG sind als Hilfsmittel solche Gegenstände oder
Vorrichtungen anzusehen, die geeignet sind, die Funktion fehlender oder
unzulänglicher Körperteile zu übernehmen oder die mit einer
Verstümmelung, Verunstaltung oder einem Gebrechen verbundene
körperliche oder psychische Beeinträchtigung zu mildern oder zu
beseitigen. Die durch die Satzung festzulegende Höhe der
Kostenzuschüsse für Hilfsmittel ist durch gesetzliche
Höchstbeträge begrenzt.
Das
Sozialversicherungsrecht stellt also lediglich eine Definition des Begriffes
Hilfsmittel auf und überläßt die nähere Ausgestaltung
dieses Leistungsbereiches den Satzungen der Krankenversicherungsträger.
Auch die geltende Mustersatzung 1994 des Hauptverbandes für die
Krankenversicherungsträger sieht zur Regelung von Zuschüssen für
Hilfsmittel durch die Träger der Krankenversicherung keine verbindliche
Bestimmung vor. Damit obliegt die konkrete Regelung des Anspruches auf einen
Kostenzuschuß für ein Hilfsmittel infolge der
diesbezüglichen Satzungsermächtigung der Selbstverwaltung der
Krankenversicherungsträger. Die diesbezüglichen Satzungsbestimmungen
der einzelnen Versicherungsträger stellen durchwegs auf die
gesetzliche Definition der notwendigen Hilfsmittel ab und nehmen von einer
Aufzählung der einzelnen Hilfsmittel Abstand, was angesichts der Vielzahl
in Betracht kommender Hilfsmittel wohl als zweckmäßig angesehen
werden muß.
Zur Durchsetzung eines
vermeintlichen Anspruches auf einen von der anzuwendenden Satzung vorgesehenen
Kostenzuschuß für ein Hilfsmittel kann der sozialgerichtliche
Klageweg beschritten werden.
2. Partner-, Therapie-
oder Rehabilitationshunde als Hilfsmittel:
In den letzten Jahren
wird verstärkt für verschiedene Behinderungsformen die Beistellung
eines speziell trainierten Hundes propagiert, der unter den Bezeichnungen
Partnerhund, Therapiehund oder neuerdings Rehabilitationshund firmiert. Dieses
Angebot richtet sich insbesondere an Rollstuhlfahrer, Gehörlose sowie
geistig und körperlich behinderte Menschen. In Salzburg gibt es ein
diesbezügliches Ausbildungszentrum ,Partnerhunde für
Behinderte‘ unter der Leitung von Frau Elisabeth Färbinger.
Aus Sicht der Sektion II ist zur
sozialversicherungsrechtlichen Beurteilung dieser Hunde zunächst auf die
obigen Ausführungen zum Hilfsmittelbegriff zu verweisen.
Ungeachtet der einzelnen Satzungsbestimmungen
setzt die Leistung eines Zuschusses für ein Hilfsmittel nach der
Bestimmung des § 154 ASVG jedenfalls voraus, daß es sich um ein
notwendiges Hilfsmittel handelt. Dies folgt dem allgemeinen, für
die Krankenbehandlung ausdrücklich gesetzlich festgelegten Grundsatz,
wonach diese ausreichend und zweckmäßig sein muß, das
Maß des Notwendigen jedoch nicht überschreiten darf. Damit ist die
Feststellung der Notwendigkeit einerseits am individuellen, durch die
vorliegende Erkrankung bzw. Behinderung bedingten Bedarf und andererseits an
der Verwendung des jeweils zweckmäßigsten und kostengünstigsten
Mittels zur erforderlichen Hilfe zu messen. Unter Berücksichtigung dieser
gesetzlichen Voraussetzungen kann angesichts der beschränkten Einsatzmöglichkeiten
eines Partner-, Therapie- oder Rehabilitationshundes die Leistung eines
Kostenzuschusses für einen solchen Hund (mit Ausnahme eines
Blindenführhundes) aus Mitteln der Krankenversicherung aus ho. Sicht nicht
befürwortet werden.
Vielmehr scheint die vorrangige Zielsetzung der
Beistellung eines Partnerhundes wohl im Bereich der sozialen Rehabilitation zu
liegen. In diesem Sinne hat auch der Hauptverband in einem Schreiben an Frau
Volksanwältin Horätin Mag. Messner vom 20. Jänner 1994
mitgeteilt, daß nach seiner Auffassung die gesetzlichen Voraussetzungen
für eine Kostenübernahme durch die Versicherungsträger nicht
erfüllt werden. Durch den Partnerhund würde aber sicherlich die
gesellschaftliche Integration des behinderten Menschen gefördert. Der
Partnerhund werde daher als soziale Eingliederungshilfe anzusehen sein. Daraus
ergebe sich, daß nicht die Krankenversicherungsträger, sondern die
Länder auf Grund der Sozialhilfegesetze leistungszuständig
wären.
3.
Blindenführhund oder Rehabilitationshund als medizinische Maßnahme
der Rehabilitation in der Krankenversicherung
Mit ha. Schreiben vom 30. Mai 1994,
Zl. 26 060/5-5/94, hat das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales zur Bürgerinitiative Nr. 103 betreffend Anerkennung des Mobilitätstrainings
für Blinde und von geprüften Blindenführhunden als medizinische
Rehabilitation eine Stellungnahme an die Parlamentsdirektion abgegeben,
aus der im folgenden die zur sozialversicherungsrechtlichen Fragestellung
hinsichtlich des Blindenführhundes relevanten Passagen auszugsweise wie
folgt wiedergegeben werden:
,Aus der Sicht der Sozialversicherung ist zu den
bestehenden gesetzlichen Bestimmungen über Maßnahmen der
medizinischen Rehabilitation hinsichtlich des Blindenführhundes und des
Mobilitätstrainings für Blinde zunächst festzuhalten,
daß das gegenständliche Anliegen der Bürgerinitiative
Nr. 103 offenbar auf die mit der 50. Novelle zum ASVG, BGBl.
Nr. 676/1991, sowie die entsprechenden Novellierungen der Parallelgesetze
mit 1. Jänner 1992 neu eingeführten ,medizinischen
Maßnahmen der Rehabilitation in der Krankenversicherung‘
gemäß § 154a ASVG Bezug nimmt. Nach dieser Bestimmung
gewähren die Krankenversicherungsträger, um den Erfolg der Krankenbehandlung
zu sichern oder die Folgen der Krankheit zu erleichtern, im Anschluß an
die Krankenbehandlung nach pflichtgemäßem Ermessen und nach
Maßgabe des Ökonomiegebotes des § 133 Abs. 2 ASVG
(,die Krankenbehandlung muß ausreichend und zweckmäßig sein,
darf jedoch das Maß des Notwendigen nicht überschreiten‘)
medizinische Maßnahmen der Rehabilitation. Das Ziel der medizinischen
Rehabilitationsmaßnahmen besteht nach dem Gesetzeswortlaut darin, den
Gesundheitszustand der Versicherten und ihrer Angehörigen so weit
wiederherzustellen, daß sie in der Lage sind, in der Gemeinschaft einen
ihnen angemessenen Platz möglichst dauernd und ohne Betreuung und Hilfe
einzunehmen.
Als Maßnahmen der medizinischen
Rehabilitation sieht das Gesetz die Unterbringung in vorwiegend der
Rehabilitation dienenden Krankenanstalten, die Gewährung von
Körperersatzstücken, orthopädischen Behelfen und anderen
Hilfsmitteln sowie damit im Zusammenhang stehende ärztliche Hilfe und
Reisekosten vor.
…
Zur Anerkennung von geprüften
Blindenführhunden als Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation
wird folgendes ausgeführt: Wie aus den der Bürgerinitiative
Nr. 103 beigelegten Unterlagen (insbesondere den ho. Schreiben vom
27. Mai 1993, Zl. 26 060/11-5/92) ersichtlich ist, hat das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales – entgegen der Rechtsmeinung
des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger
– stets die Auffassung vertreten, daß Blindenführhunde bei
extensiver Auslegung dem gesetzlichen Hilfsmittelbegriff des
§ 154 ASVG unterstellt werden können. Nach § 154 ASVG
(,Hilfe bei körperlichen Gebrechen‘) kann die Satzung der Krankenversicherungsträger
bei Verstümmelungen, Verunstaltungen und körperlichen Gebrechen,
welche die Gesundheit, die Arbeitsfähigkeit oder die Fähigkeit,
für die lebenswichtigen persönlichen Bedürfnisse zu sorgen,
wesentlich beeinträchtigen, Zuschüsse für die Anschaffung der
notwendigen Hilfsmittel sowie für deren Instandsetzung vorsehen. Die durch
die Satzung festzulegende Höhe der Kostenzuschüsse für
Hilfsmittel ist durch gesetzliche Höchstbeträge begrenzt. Damit
obliegt die konkrete Ausgestaltung des Anspruches auf einen Kostenzuschuß
für ein Hilfsmittel infolge der diesbezüglichen
Satzungsermächtigung der Selbstverwaltung der Krankenversicherungsträger.
Zur Durchsetzung eines vermeintlichen Anspruches auf einen von der anzuwendenden
Satzung vorgesehenen Kostenzuschuß für ein Hilfsmittel kann der
sozialgerichtliche Klageweg beschritten werden.
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
spricht also dem Blindenführhund die Qualifikation als Hilfsmittel im
Sinne des § 154 ASVG nicht ab und hält daher eine
Zuschußgewährung nach Maßgabe der jeweils anzuwendenden
Satzung für zulässig. Allerdings kann sich das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales dem Anliegen der gegenständlichen
Bürgerinitiative, die Beistellung eines Blindenführhundes müsse
als Maßnahme der medizinischen Rehabilitation in der Krankenversicherung
gelten, nicht anschließen, weil damit den im § 154a ASVG
normierten Voraussetzungen und Zielsetzungen der medizinischen Rehabilitationsmaßnahmen
in der Krankenversicherung, wie sie eingangs bereits dargelegt wurden, nicht
entsprochen wird.
Der über do. Auftrag ebenfalls mit der
gegenständlichen Bürgerinitiative befaßte Hauptverband der
österreichischen Sozialversicherungsträger hat sich im wesentlichen
folgendermaßen geäußert: Zwar neigt der Hauptverband nach wie
vor der Meinung zu, ein Blindenführhund könne im Hinblick auf die
Legaldefinition des § 154 ASVG nicht als Hilfsmittel angesehen
werden, doch ist er bestrebt, eine Gesamtlösung zu finden, die nicht zu
Lasten der betroffenen Menschen geht. Er will daher im Hinblick auf die
verfassungsmäßige Zuständigkeit der Länder für
Angelegenheiten der Behindertenhilfe mit den Soziallandesräten
Gespräche aufnehmen, um eine Gesamtfinanzierung von Blindenführhunden
unter Kostenbeteiligung der Krankenversicherung sowie der Länder zu
erreichen. Der Qualifikation des Blindenführhundes als medizinische
Rehabilitationsmaßnahme steht der Hauptverband ablehnend gegenüber
und begründet seine Haltung damit, daß mit der Beistellung eines
Blindenführhundes die gesetzlich definierte Zielsetzung der medizinischen
Rehabilitationsmaßnahmen nicht erreicht werden kann und es sich hiebei
überdies primär um eine soziale bzw. allenfalls eine berufliche
Rehabilitationsmaßnahme handelt.
Der Vollständigkeit halber sei noch
erwähnt, daß auch seitens der Versicherungsanstalt öffentlich
Bediensteter – entgegen den Ausführungen im Anliegen der
gegenständlichen Bürgerinitiative – keine Finanzierung von
Blindenführhunden als medizinische Rehabilitationsmaßnahme
vorgenommen wird. Eine Kostenübernahme für Blindenführhunde in
der Krankenversicherung erfolgt durch die genannte Anstalt lediglich unter dem
Titel der erweiterten beruflichen Rehabilitation gemäß
§ 70b B-KUVG. Leistungen der erweiterten Rehabilitation durch die
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter entsprechen im Bereich der
übrigen Sozialversicherungsträger den beruflichen und sozialen
Rehabilitationsmaßnahmen der Pensionsversicherungsträger. Diese
leistungsrechtliche Sonderstellung der Versicherungsanstalt
öffentlich Bediensteter resultiert daraus, daß öffentlich
Bedienstete im Hinblick auf ihren Ruhegenußanspruch keiner
Pensionsversicherung unterliegen, weshalb die Erbringung beruflicher und
sozialer Rehabilitationsmaßnahmen der Versicherungsanstalt
öffentlich Bediensteter übertragen wurde. Dementsprechend erfolgt die
Finanzierung der Maßnahmen der erweiterten Rehabilitation durch einen
zweckgebundenen Beitragszuschlag.
Auch aus einem Vergleich mit den von Trägern
der Unfallversicherung erbrachten Leistungen läßt sich für das
Anliegen der gegenständlichen Bürgerinitiative nichts gewinnen, weil
der Gesetzgeber den Leistungsumfang der gesetzlichen Unfallversicherung aus in
der Eigenart dieses Versicherungszweiges liegenden Gründen besonders weit
definiert hat. Analoges gilt für die Leistungen nach den
Versorgungsgesetzen des Bundes.
Zusammenfassend vertritt das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales daher den Standpunkt, daß eine
Kostenübernahme für Blindenführhunde und für das
Mobilitätstraining für Blinde aus Mitteln der Krankenversicherung als
Maßnahme der medizinischen Rehabilitation in der Krankenversicherung
nicht in Betracht kommt. Eine diesbezügliche Gesetzesänderung kann aus
ho. Sicht nicht befürwortet werden, weil damit der Aufgabenbereich der
Krankenversicherung auf Leistungen erstreckt würde, die als
Maßnahmen der beruflichen und sozialen Rehabilitation anzusehen
sind.‘
Diese Auffassung wird seitens der Sektion II
aufrechterhalten. Umso mehr gilt diese ablehnende Haltung den sonstigen
Partner-, Therapie- bzw. Rehabilitationshunden, zumal diese – in
Übereinstimmung mit der Haltung des Hauptverbandes – auch nicht als
notwendige Hilfsmittel gemäß § 154 ASVG angesehen werden
können. Wie telefonisch eruiert werden konnte, hält auch der
Hauptverband an seiner oben ausgeführten Haltung fest; weiters wurde
mitgeteilt, daß sich seither keine wesentliche Änderung der Sachlage
ergeben habe; insbesondere sei nach wie vor keine Bereitschaft der Länder
zu einer substantiellen Mitfinanzierung erkennbar.
Zusammenfassend wird zu der konkret erhobenen
Forderung folgendes festgestellt:
Ein Blindenführhund kann nach ho.
Rechtsauffassung unter den Hilfsmittelbegriff des § 154 ASVG subsumiert
werden. Hinsichtlich anderer Rehabilitationshunde scheint die Notwendigkeit und
Zweckmäßigkeit zumindest fraglich. Zuschüsse für
Hilfsmittel sind in den Satzungen der einzelnen Krankenversicherungsträger
zu regeln. Die Einführung einer gesetzlichen Pflichtleistung
bezüglich Blindenführhunden oder Rehabilitationshunden ist als
systemwidrig abzulehnen, weil sie dem Konzept des Gesetzgebers
widerspräche, wonach die Leistung von Kostenzuschüssen für
(alle) Hilfsmittel den Satzungen der einzelnen Krankenversicherungsträger
– und damit der jeweiligen Selbstverwaltung – überlassen ist.
In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, daß Leistungen der
Krankenversicherung für Hilfsmittel als ,Hilfe bei körperlichen
Gebrechen‘ nach dem Willen des Gesetzgebers nur beschränkt
möglich sind, zumal es sich hiebei um keine Kernaufgabe der
Krankenversicherung handelt und eine Reihe weiterer Kostenträger –
insbesondere aus dem Bereich der Behindertenhilfe – für derartige
Leistungen zuständig ist.
Eine Übernahme der Kosten für Rehabilitationshunde
als medizinische Maßnahme der Rehhabilitation in der Krankenversicherung
wird aus ho. Sicht nicht befürwortet, weil sie den gesetzlich normierten
Voraussetzungen und Zielsetzungen der medizinischen Rehabilitationsmaßnahmen
in der Krankenversicherung nicht entspricht, sondern als primär
soziale (allenfalls berufliche) Rehabilitationsmaßnahme anzusehen ist.
Ad II. Anerkennung als
Diensthund:
Durch eine entsprechende
erlaßmäßige Regelung wurde sichergestellt, daß Blinden
und hochgradig sehbehinderten Menschen im Behindertenpaß gemäß
§§ 40 ff. des Bundesbehindertengesetzes auf Antrag
zusätzlich zur Eintragung ,blind‘ bzw. ,hochgradig
sehbehindert‘ der Vermerk ,Ist auf den Blindenführhund
angewiesen‘ angebracht werden kann.
Diese Eintragung im Behindertenpaß bewirkt
allerdings keinen Rechtsanspruch auf Mitnahme des Hundes in alle
öffentlich zugänglichen Lokalitäten (zB
Lebensmittelgeschäfte), da nach der derzeitigen Rechtslage
berechtigte Interessen des behinderten Menschen mit anderen (zB sanitätspolizeilichen)
Vorschriften kollidieren können.”
Das Bundeskanzleramt teilte auf der Grundlage der
Stellungnahmen der Bundesministerien folgendes mit:
“Ad 1:
Anerkennung als Hilfsmittel durch die
Krankenkassen
Die Frage der Anerkennung des Blindenführerhundes
und des Partner-, Therapie- bzw. Rehabilitationshundes als Hilfsmittel im
Sinne des ASVG sowie die Forderung nach einer Kostenübernahme als
medizinische Maßnahme der Rehabilitation in der Krankenversicherung wurde
in der Vergangenheit bereits mehrfach behandelt.
1.1
Blindenführhund als Hilfsmittel im Sinne des ASVG
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
hat – entgegen der Rechtsmeinung des Hauptverbandes der
österreichischen Sozialversicherungsträger – stets die
Auffassung vertreten, daß Blindenführhunde bei extensiver Auslegung
dem gesetzlichen Hilfsmittelbegriff des § 154 ASVG unterstellt werden
können. Nach § 154 ASVG kann die Satzung der
Krankenversicherungsträger bei Verstümmelungen, Verunstaltungen
und körperlichen Gebrechen, welche die Gesundheit, die
Arbeitsfähigkeit oder die Fähigkeit, für die lebenswichtigen
persönlichen Bedürfnisse zu sorgen, wesentlich beeinträchtigen,
Zuschüsse für die Anschaffung der notwendigen Hilfsmittel sowie für
deren Instandsetzung vorsehen. Die durch die Satzung festzulegende Höhe
der Kostenzuschüsse für Hilfsmittel ist durch gesetzliche
Höchstbeträge begrenzt. Damit obliegt die konkrete Ausgestaltung des
Anspruches auf einen Kostenzuschuß für ein Hilfsmittel in Folge der
diesbezüglichen Satzungsermächtigung der Selbstverwaltung der
Krankenversicherungsträger.
Das Sozialversicherungsrecht stellt lediglich eine
Definition des Begriffes Hilfsmittel auf und überläßt die
nähere Ausgestaltung dieses Leistungsbereiches den Satzungen der
Krankenversicherungsträger. Auch die geltende Mustersatzung 1994 des
Hauptverbandes für die Krankenversicherungsträger sieht zur Regelung
von Zuschüssen für Hilfsmittel durch die Träger der
Krankenversicherung keine verbindliche Bestimmung vor. Damit obliegt die
konkrete Regelung des Anspruches auf Kostenzuschuß für ein
Hilfsmittel in Folge der diesbezüglichen Satzungsermächtigung der
Selbstverwaltung der Krankenversicherungsträger. Die
diesbezüglichen Satzungsbestimmungen der einzelnen
Versicherungsträger stellen durchwegs auf die gesetzliche Definition der
notwendigen Hilfsmittel ab und nehmen von einer Aufzählung der einzelnen
Hilfsmittel Abstand, was angesichts der Vielzahl in Betracht kommender
Hilfsmittel vom Bundesministerium für Arbeit und soziales als zweckmäßig
angesehen wird.
Zur Durchsetzung eines vermeintlichen Anspruchs
auf einen von der anzuwendenden Satzung vorgesehenen Kostenzuschuß
für ein Hilfsmittel kann der sozialgerichtliche Klageweg beschritten
werden.
1.2 Partner-,
Therapie- oder Rehabilitationshunde als Hilfsmittel
Aus der Sicht des Bundesministeriums für
Arbeit und Soziales ist zur sozialversicherungsrechtlichen Beurteilung dieser
Hunde auf die Definition des Hilfsmittelbegriffes zu verweisen. Ungeachtet
einzelner Satzungsbestimmungen setzt die Leistung eines Zuschusses für ein
Hilfsmittel nach der Bestimmung des § 154 ASVG jedenfalls voraus,
daß es sich um ein notwendiges Hilfsmittel handelt. Der
Hauptverband der Sozialversicherungsträger ist der Auffassung, daß
die Voraussetzungen für eine Kostenübernahme durch die
Versicherungsträger nicht erfüllt werden. Durch den Partnerhund
würde aber sicherlich die gesellschaftliche Integration des behinderten
Menschen gefördert. Daher wäre der Partnerhund als soziale
Eingliederungshilfe anzusehen, was bedeutet, daß nicht die
Krankenversicherungsträger, sondern die Länder auf Grund der
Sozialhilfegesetze leistungszuständig wären.
1.3 Der
Blindenführhund oder Rehabilitationshund als medizinische Maßnahme
der Rehabilitation in der Krankenversicherung
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
kann sich allerdings dem Anliegen der gegenständlichen
Bürgerinitiative, die Beistellung eines Blindenführhundes müsse
als Maßnahme der medizinischen Rehabilitation in der Krankenversicherung
gelten, nicht anschließen, weil damit den in § 154a ASVG
normierten Voraussetzungen und Zielsetzungen der medizinischen
Rehabilitationsmaßnahmen in der Krankenversicherung nicht entsprochen
wird.
Der mit der gegenständlichen
Bürgerinitiative befaßte Hauptverband der österreichischen
Sozialversicherungsträger neigt nach wie vor der Meinung zu, ein
Blindenführhund könne im Hinblick auf die Legaldefinition des
§ 154 ASVG nicht als Hilfsmittel angesehen werden. Er ist jedoch
bestrebt, eine Gesamtlösung zu finden, die nicht zu Lasten der betroffenen
Menschen geht. Daher will er im Hinblick auf die verfassungsmäßige
Zuständigkeit der Länder für Angelegenheiten der
Behindertenhilfe mit den Soziallandesräten Gespräche aufnehmen, um
eine Gesamtfinanzierung von Blindenführhunden unter Kostenbeteiligung der
Krankenversicherung sowie der Länder zu erreichen. Der Qualifikation des
Blindenführhundes als medizinische Rehabilitationsmaßnahme steht der
Hauptverband allerdings ablehnend gegenüber und begründet seine
Haltung damit, daß mit der Beistellung eines Blindenführhundes
die gesetzlich definierte Zielsetzung der medizinischen
Rehabilitationsmaßnahmen nicht erreicht werden kann und es sich hiebei
überdies vornehmlich um eine soziale bzw. allenfalls eine berufliche
Rehabilitationsmaßnahme handle.
Abschließend kann also festgehalten werden:
Ein Blindenführhund kann nach der
Rechtsauffassung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales unter den
Hilfsmittelbegriff des § 154 ASVG subsumiert werden. Hinsichtlich
anderer Rehabilitationshunde scheint die Notwendigkeit und
Zweckmäßigkeit zumindest fraglich. Zuschüsse für
Hilfsmittel sind in den Satzungen der einzelnen Krankenversicherungsträger
zu regeln. Die Einführung einer gesetzlichen Pflichtleistung
bezüglich Blindenführhunden oder Rehabilitationshunden wird als
systemwidrig abgelehnt, weil sie dem Konzept des Gesetzgebers widerspreche,
wonach die Leistung von Kostenzuschüssen für (alle) Hilfsmittel
den Satzungen der einzelnen Krankenversicherungsträger – und damit
der jeweiligen Selbstverwaltung – überlassen ist.
Eine Übernahme der Kosten für
Rehabilitationshunde als medizinische Maßnahme der Rehabilitation in der
Krankenversicherung wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales
nicht befürwortet, weil sie den gesetzlich normierten Voraussetzungen und Zielsetzungen
der medizinischen Rehabilitationsmaßnahmen in der
Krankenversicherung nicht entspricht, sondern als primär soziale
(allenfalls berufliche) Rehabilitationsmaßnahme anzusehen ist.
Ad 2:
Anerkennung als Diensthund
Durch eine erlaßmäßige Regelung
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales wurde sichergestellt,
daß Blinden und hochgradig sehbehinderten Menschen im
Behindertenpaß gemäß §§ 40 ff. des Bundesbehindertengesetzes
auf Antrag zusätzlich zur Eintragung ,blind‘ bzw. ,hochgradig
sehbehindert‘ der Vermerk ,Ist auf den Blindenführhund
angewiesen‘ angebracht werden kann. Diese Eintragung im
Behindertenpaß bewirkt allerdings keinen Rechtsanspruch auf Mitnahme des
Hundes in alle öffentlich zugänglichen Lokalitäten (zB
Lebensmittelgeschäfte), da nach der derzeitigen Rechtslage berechtigte
Interessen des behinderten Menschen mit anderen (zB sanitätspolizeilichen)
Vorschriften kollidieren können.
2.1 Hinsichtlich der
Aufnahme des weißen Führgeschirres in § 3 der
Straßenverkehrsordnung ist laut Stellungnahme des Bundesministeriums
für Wissenschaft, Verkehr und Kunst eine genaue sachliche Prüfung
dahin gehend anzustellen, inwieweit die Verwendung eines solchen Behelfes zur
Zeit tatsächlich üblich ist. Die Aufnahme des weißen
Führgeschirres in die Straßenverkehrsordnung erscheint erst dann
sinnvoll, wenn der Bekanntheitsgrad dieses Behelfes so groß ist,
daß für einen durchschnittlichen Straßenbenützer die
Assoziation zu sehbehinderten Straßenbenützern herstellbar ist.
Seitens des genannten Ressorts werden in dieser Angelegenheit sachliche
Ratschläge und Erkundigungen eingezogen und eine allfällige Aufnahme
in die Straßenverkehrsordnung bei deren nächster Novellierung zur
Diskussion gestellt werden.
2.2 Zutrittsrecht zu
allen öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen
Laut Stellungnahme aller Bundesministerien ist der
Zutritt für blinde Personen in Begleitung von Blindenhunden jederzeit
möglich. Das Bundesmininisterium für Justiz weist in diesem
Zusammenhang darauf hin, daß für das der Anfrage zugrundeliegende
Anliegen unter Umständen auch die Bestimmungen des Zivilrechts mittelbar
nutzbar gemacht werden können. Der Oberste Gerichtshof hat nämlich
– in anderem Zusammenhang – in seinem Erkenntnis vom
24. Oktober 1990 ausgesprochen, daß selbst außerhalb des
eigentlichen ,Kontrahierungszwangs‘ jeder diffamierende Ausschluß
von der Inanspruchnahme einer Leistung unzulässig sei, sofern nicht
eine hinreichende sachliche Rechtfertigung gegeben sei. Das Höchstgericht
hat diese Ausführungen mit der ,mittelbaren Drittwirkung‘ des
Grundrechts auf Ehre und dem Gebot der verfassungskonformen Auslegung
zivilrechtlicher Bestimmungen begründet. Demnach kann ein
unbegründeter und diffamierender (also diskriminierender) Ausschluß
Behinderter und insbesondere auch blinder Menschen von Leistungen –
selbstverständlich unvorgreiflich der unabhängigen
Rechtsprechung – den guten Sitten im Sinne des § 879
Abs. 1 ABGB widersprechen. Bei einer solchen Beurteilung der
Sittenwidrigkeit eines allfälligen (Lokalverbots) wird entscheidend auf
die Umstände des Einzelfalls abzustellen sein.
2.3
Verankerung der Mitnahmepflicht in den Beförderungsrichtlinien
öffentlicher und privater Beförderungsunternehmen
Wie das Bundesministerium für Wissenschaft,
Verkehr und Kunst mitteilt, sind bei den ÖBB bereits folgende Regelungen
im Tarif verankert: Bei Lösen eines Halbpreispasses für Zivilblinde
(mit Ausweis des jeweiligen Landesverbandes) können Behinderte eine
Fahrkarte zum halben Preis lösen sowie einen Führhund und eine
Begleitperson gratis befördern. Beim Kraftwagendienst können aus
Platzgründen nur entweder ein Führhund oder eine Begleitperson
gratis befördert werden.
Abschließend wird festgehalten, daß
nach dem Dafürhalten des Bundesministeriums für Justiz die
allgemeinen zivilrechtlichen Regelungen für die legitimen Anliegen
behinderter und insbesondere auch blinder Menschen einen ausreichenden Schutz
bieten. Es scheint auch fraglich, ob und inwieweit ein
,Antidiskriminierungsgesetz‘ dem in der Bürgerinitiative behaupteten
Mißstand abhelfen kann. Auch ein solches Gesetz wird nämlich nicht
umhinkönnen, diejenigen Fälle ausdrücklich oder zumindest
erschließbar zu umschreiben, in denen ein Verbot der Mitnahme von Hunden
– und damit auch von Blindenhunden – sachlich gerechtfertigt
ist.”
Betreffend die gesetzliche Anerkennung des
Blindenführhundes als Hilfsmittel und Diensthund in Österreich nahm
die Volksanwaltschaft wie folgt Stellung:
“1. Anerkennung
des Blindenführhundes als Hilfsmittel durch Krankenkassen
Die Volksanwaltschaft war mit der hier
angesprochenen Problematik der Finanzierung der Anschaffung für
Blindenhunde bereits befaßt und hat zur Frage der Qualifikation von
Blindenhunden als Hilfsmittel im Zusammenhang mit der Bürgerinitiative
Nr. 103/1994, betreffend die Anerkennung des Mobilitätstrainings
für Blinde und von Blindenführhunden als Teil der medizinischen
Rehabilitation, Stellung genommen.
Nach § 154 Abs. 1 lit. a und b
ASVG in der geltenden Fassung sind als Hilfsmittel Gegenstände oder
Vorrichtungen anzusehen, die geeignet sind, die Funktion fehlender oder
unzulänglicher Körperteile zu übernehmen oder die mit einer
Verstümmelung, Verunstaltung oder einem Gebrechen verbundene
körperliche oder psychische Beeinträchtigung zu mildern oder zu
beseitigen. Mit Schreiben vom 27. Mai 1993 zu Zl. 26 060/11-5/92
und vom 30. Mai 1994 zu Zl. 26 060/5-5/1994 hat das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales festgestellt, daß
Blindenführhunde unter die zitierte Legaldefinition des § 154
ASVG subsumierbar sind und daher als Hilfsmittel im Sinne des Gesetzes
angesehen werden können (vgl. auch: Gehrmann – Rudolph –
Teschner – Fürböck, ASVG, § 154 Anm. 4). Diese
auf die Grundsätze der Wortinterpretation und der sozialen
Rechtsanwendung gestützte Auffassung wird von der Volksanwaltschaft
vollinhaltlich geteilt.
Die gegenteilige Rechtsauffassung des
Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger, wonach
Blindenführhunde keine Hilfsmittel im Sinne des § 154 ASVG in
der geltenden Fassung seien, zumal in jener Bestimmung von körperlichen
Sachen (,Gegenstände oder Vorrichtungen‘) die Rede sei, Tiere aber
gemäß § 285a ABGB nicht (mehr) als Sachen gelten
könnten, erachtet die Volksanwaltschaft als nicht tragfähig. Dies
insbesondere deshalb, weil die besondere teleologische Ausrichtung und Einbettung
des § 285a ABGB keine Rückschlüsse auf die inhaltliche
Determinierung des Heilmittelbegriffes nach § 154 ASVG erlaubt.
Im Sinne der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit
würde es die Volksanwaltschaft aber jedenfalls begrüßen, wenn
die Legaldefinition des Hilfsmittels in § 154 ASVG und der
korrespondierenden Bestimmungen in den sozialversicherungsrechtlichen
Parallelgesetzen (§ 93 Abs. 6 GSVG, § 96 Abs. 1
BSVG, § 65 Abs. 1 B-KUVG) durch eine ausdrückliche
Einbeziehung des Tierbegriffes ergänzt würde.
Zum besonderen Problem einer Vereinheitlichung der
Gewährung von Zuschüssen durch die Krankenversicherungsträger
zu den Kosten der Anschaffung eines Blindenführhundes ist festzuhalten,
daß gemäß § 154 ASVG in der geltenden Fassung ein
Anspruch eines Versicherten auf Kostenzuschuß für die Anschaffung
von Hilfsmitteln nur dann und – innerhalb bestimmter gesetzlicher
Höchstgrenzen – insoweit besteht, als der zuständige
Krankenversicherungsträger einen solchen in seiner Satzung
ausdrücklich normiert. Kostenzuschüsse für Hilfsmittel liegen
daher weithin im Ermessen der zuständigen Krankenversicherungsträger
und damit im Verantwortungsbereich der Selbstverwaltung. Ohne eine
entsprechende Novellierung des § 154 ASVG könnte eine
verpflichtende bundesweite Vereinheitlichung der Finanzierung von Hilfsmitteln
durch die Krankenversicherungsträger daher nur über eine verbindliche
Regelung im Rahmen der Mustersatzung des Hauptverbandes der
österreichischen Sozialversicherungsträger gemäß
§ 453 in Verbindung mit § 455 Abs. 2 ASVG erfolgen. In
diesem Zusammenhang wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß der
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
gemäß § 455 Abs. 1 erster Satz ASVG Bestimmungen der
Mustersatzung für verbindlich zu erklären hat, insoweit dies zur
Wahrung der Einheitlichkeit der Durchführung
sozialversicherungsrechtlicher Bestimmungen notwendig erscheint.
Eine allfällige Novellierung des
§ 154 ASVG im Sinne der Schaffung eines unmittelbar ex lege
bestehenden Anspruches auf Kostenzuschuß zu Hilfsmitteln unter
Ausschaltung oder unter weitgehender Beschränkung des bestehenden
Ermessens der Krankenversicherungsträger dürfte nach Ansicht der
Volksanwaltschaft nicht isoliert nur für Blindenhunde erfolgen, sondern
müßte sich aus Gleichheitsgründen auf den gesamten
Hilfsmittelbereich erstrecken.
2. Ausdrückliche
Verankerung des weißen Führgeschirrs im Rahmen der
Vertrauensgrundsatzregelung des § 3 StVO
Ein derartiges Anliegen war bisher noch nicht
Gegenstand eines Prüfverfahrens der Volksanwaltschaft.
Gemäß § 3 Abs. 1 StVO in
der geltenden Fassung sind unter anderem sehbehinderte Menschen mit
weißem Stock oder gelber Armbinde vom Vertrauensgrundsatz ausgenommen.
Unterläßt es ein sehbehinderter Mensch, sich solcherart zu
kennzeichnen, darf unter der Voraussetzung, daß nicht aus seinem
sonstigen Gehaben geschlossen werden muß, daß er unfähig ist,
die Gefahren des Straßenverkehrs einzusehen oder sich dieser Einsicht
gemäß zu verhalten, darauf vertraut werden, daß er die
für die Benützung der Straße maßgeblichen
Rechtsvorschriften befolgt (vgl. K. Glassl, Der Vertrauensgrundsatz, ZVR 1961,
77; Dittrich – Veit, Straßenverkehrsordnung, 3. Auflage,
§ 3 StVO, Anm. 20). Vor dem Hintergrund der bestehenden
Rechtslage kann daher nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, daß
ein blinder Mensch ohne weißen Stock und Armbinde, der mit seinem
Blindenhund am Verkehrsgeschehen teilnimmt, vom Vertrauensgrundsatz
ausgenommen ist.
Die Verankerung des weißen
Führgeschirrs des Blindenhundes als ex lege Ausnahmetatbestand vom
Vertrauensgrundsatz gemäß § 3 StVO erscheint der
Volksanwaltschaft im Hinblick auf die sachliche Rechtfertigung einer derartigen
Regelung nicht unproblematisch. Blindenhunde werden sehr umfassend und
kostenintensiv gerade dazu ausgebildet und trainiert, den blinden Menschen
sicher zu führen und insbesondere auch durch das Verkehrsgeschehen zu
geleiten. Es ist daher nicht ohne weiteres nachvollziehbar, warum das
weiße Führgeschirr des Blindenhundes gesetzlich gleichsam als Signal
dafür festgelegt werden soll, daß der/die Blinde nicht in der Lage
ist, die maßgeblichen Rechtsvorschriften im Straßenverkehr zu
befolgen. Für die Volksanwaltschaft stellt sich im vorliegenden
Zusammenhang die Frage, ob eine derartige Regelung tatsächlich geeignet
wäre, die Verkehrssicherheit von blinden Menschen zu erhöhen oder
letztlich nur dazu führen würde, die haftungsrechtliche
Verantwortlichkeit für eine sorgfältige Schulung und Ausbildung der
Blindenführhunde vom Hundeausbildner bzw. Hundetrainer auf die an
§ 3 StVO gebundenen Verkehrsteilnehmer zu überwälzen. Wenn
der Nationalrat beabsichtigen sollte, das weiße Führgeschirr in
§ 3 StVO in der geforderten Form einzufügen, wäre es aus
der Sicht der Volksanwaltschaft jedenfalls erforderlich, genaue Vorschriften
für die Gewährleistung einer guten optischen Erkennbarkeit des
Führgeschirrs (zB fluoreszierender Anstrich oder Reflektoren) zu schaffen.
3. Zutrittsrecht zu
öffentlichen Gebäuden, Einrichtungen und Geschäften des
täglichen Bedarfs
Bei der Volksanwaltschaft hat eine
Beschwerdeführerin, die auf Grund ihrer starken Sehbehinderung auf einen
Blindenführhund angewiesen ist, ausgeführt, daß sie
gelegentlich Schwierigkeiten habe, mit ihrem Blindenführhund Zutritt zu
diversen öffentlichen Einrichtungen zu erhalten. Die
Beschwerdeführerin legte dar, daß ein behördlicher Ausweis, aus
dem hervorgeht, daß ihr Hund ein geprüfter Blindenführhund ist,
von dem keine Gefahr ausgeht, den Zutritt erheblich erleichtern würde.
Die Volksanwaltschaft hat in diesem Zusammenhang
mit dem Bundesminister für Arbeit und Soziales Kontakt aufgenommen und
konnte erreichen, daß seitens des Bundesministeriums für Arbeit und
Soziales mit Erlaß vom 24. Jänner 1996 zu
Zl. 45 360/1-7/96 die Möglichkeit der Eintragung eines ,Blindenhundevermerkes‘
im Behindertenpaß vorgesehen und die Voraussetzungen hiefür
festgelegt wurden. Der gegenständliche Erlaß stützt sich auf
§ 42 Abs. 1 Bundesbehindertengesetz (BBG) in Verbindung mit
§ 1 Abs. 2 der Verordnung des Bundesministers für Arbeit
und Soziales über die Ausstellung von Behindertenpässen, BGBl.
Nr. 86/1991. Auf Antrag eines blinden oder stark sehbehinderten Menschen,
der einen Blindenführhund besitzt, ist demnach vom zuständigen
Bundessozialamt zusätzlich zur Eintragung ,Blind oder stark
Sehbehindert‘ ohne gesonderte Befassung des Ärztlichen Dienstes die
Eintragung ,Ist auf den Blindenführhund angewiesen‘ in den
Behindertenpaß vorzunehmen. Kann für das Tier eine positive
Bewertung durch die Blindenführhundkommission nachgewiesen werden, so ist
ohne weiteres davon auszugehen, daß für den behinderten Menschen der
Blindenführhund erforderlich ist.
Aus der Sicht der Volksanwaltschaft wird durch den
,Blindenhundevermerk‘ im Behindertenpaß die besondere Qualität
und Zuverlässigkeit des Tieres amtlich dokumentiert und zugleich die
Notwendigkeit des Hundes für den blinden Menschen im Rahmen einer
öffentlichen Urkunde bescheinigt. Durch den ,Blindenhundevermerk‘
dürfte der Zutritt für Blindenführhunde zu öffentlichen
Gebäuden und Einrichtungen grundsätzlich gewährleistet sein,
wenngleich der Bundesminister für Arbeit und Soziales der
Volksanwaltschaft gegenüber darauf hingewiesen hat, daß die
Eintragung des Vermerks keinen Anspruch auf die Mitnahme des Hundes in alle
öffentlich zugänglichen Lokalitäten (zB Lebensmittelgeschäfte)
vermitteln könne, da gegebenenfalls berechtigte Interessen behinderter
Menschen mit anderen (zB sanitätspolizeilichen) Rechtsvorschriften
kollidieren könnten.
Der Bundestheaterverband hat der Volksanwaltschaft
jedenfalls zugesichert, daß in den ihm unterstehenden Theatern der
Zutritt für Blinde und deren Blindenführhunde gewährleistet
wird.
4.
Beförderungspflicht von Verkehrsträgern für blinde Menschen mit
Blindenführhund
Auch zu diesem Punkt der Bürgerinitiative
wurde bei der Volksanwaltschaft bisher noch keine Beschwerde eingebracht.
Grundsätzlich ist dazu von der
Volksanwaltschaft festzuhalten, daß die Verankerung einer besonderen
Mitnahmepflicht im Rahmen des Verkehrsrechts keine systemwidrige Besonderheit
darstellen würde. In allgemeiner Form besteht für die
linienmäßige Personenbeförderung eine Beförderungspflicht
bereits in § 8 Z 2 Kraftfahrliniengesetz sowie in § 3
Eisenbahnbeförderungsgesetz. Für den Bereich des Taxigewerbes
eröffnet § 10 Abs. 1b Gelegenheitsverkehrsgesetz dem
zuständigen Landeshauptmann die Möglichkeit, durch Verordnung eine
ausdrückliche Beförderungspflicht vorzuschreiben. Eine entsprechende
Regelung wurde beispielsweise durch § 24 Abs. 1 Wiener Taxi-,
Mietwagen- und Gästewagen-Betriebsordnung, LGBl. Nr. 71/1993, geschaffen,
wobei aber nach § 9 Abs. 1 leg. cit. Hunde, die keinen
Maulkorb tragen, und ,bösartige oder beschmutzte Tiere‘ von der
Beförderung ausgeschlossen werden können. Hinzuweisen ist auch auf
die bestehende Judikatur des Obersten Gerichtshofes zum Kontrahierungszwang,
der insbesondere auch im Bereich von Verkehrsunternehmen, die den
Personenverkehr in einer bestimmten Region als Monopolisten besorgen,
angenommen wird (zB OGH 30. November 1993 WBL 1994, 169); ist im konkreten
Fall Kontrahierungszwang dem Grunde nach anzunehmen, so kann die Verweigerung
eines Vertragsabschlusses nur aus sachlich gerechtfertigten Gründen
erfolgen (zB OGH 7. November 1990 EvBl 1991/66).
Nach Ansicht der
Volksanwaltschaft müßte daher bereits bei bestehender Rechtslage die
Beförderung von blinden Menschen mit Blindenführhund durch
öffentliche Verkehrsmittel und private Fuhrunternehmen weitestgehend
sichergestellt sein. Dies insbesondere dann, wenn etwa durch den
Behindertenpaß mit eingetragenem ,Blindenhundevermerk‘ die Notwendigkeit
und Zuverlässigkeit des Hundes dargetan werden kann.
Gleichwohl würde die
Volksanwaltschaft eine ausdrückliche Verankerung einer
Beförderungspflicht von blinden bzw. stark sehbehinderten Menschen mit
Blindenführhund im Rahmen der bereits bestehenden gesetzlichen Regelungen
über die allgemeine Beförderungspflicht unter dem Aspekt der
Rechtssicherheit positiv beurteilen.
Der Volksanwaltsschaft
ist zur Kenntnis gelangt, daß die Führhundreferentin des
Österreichischen Blindenverbandes, Frau MR. Dr. Wanecek, mit
Schreiben vom 11. September 1996 zur gegenständlichen
Bürgerinitiative Stellung genommen hat.
In diesem Zusammenhang
wurde gegenüber der Volksanwaltschaft sowohl von ihr als auch von MR
Dipl.-Ing. Gloria Petrovics (p. A. Bundesministerium für Land-
und Forstwirtschaft, 1010 Wien, Stubenring 1) das Ersuchen um Einladung zu
den Beratungen in die zu erfolgenden Erörterungen im Ausschuß als
Auskunftsperson bzw. Expertin herangetragen. Diesem Ersuchen könnte aus
der Sicht der Volksanwaltschaft auf Grund des Engagements und der
Fachkenntnisse beider Damen nähergetreten werden.”
Der Österreichische
Blindenverband hat Stellung genommen wie folgt:
“Die im Rahmen der
vorliegenden Bürgerinitiative der Blindenführhundfirma Josef
Bürger in großer Anzahl abgegebenen Unterschriften zeigen, daß
sich viele Menschen für die Probleme blinder Hundeführer
interessieren und eingesetzt haben. Wenn auch die Pflichten der
Hundeführer und ihrer Hunde (objektiver Nachweis einer entsprechenden
Ausbildung und Zusammenschulung der Gespanne) vom Einbringer weggelassen
wurden, ist die Notwendigkeit einer sauberen gesetzlichen Regelung
unumstritten. Der Österreichische Blindenverband versucht bereits seit
Jahren, eine solche zu erreichen, jedoch war das Sozialministerium bisher auf
keine Weise dazu zu bewegen, in diesem Zusammenhang Verantwortung zumindest
mitzutragen. Daß eine ungeheure Rechtsunsicherheit besteht, zeigt sich
auch darin, daß gegenwärtig vier langwierige Verfahren bei Gerichten
bzw. Verwaltungsbehörden anhängig sind, wobei die
Entscheidungsträger große Schwierigkeiten haben, Rechtsgrundlagen zu
finden.
1. Allgemeines
Obwohl die Begriffe
,Blindenführhunde‘ und ,Rehabilitationshunde‘ in der
Präambel korrekt definiert werden, fällt auf, daß sie in der
Folge alternierend gebraucht werden, so daß aus der Initiative nicht
schlüssig hervorgeht, ob nur Blindenführhunde oder alle
Rehabilitationshunde gesetzlich verankert werden sollen. Die Forderung nach
Zutrittsrecht zu Geschäften zB betrifft alle Rehabilitationshunde, die
Verankerung des weißen Führgeschirrs in der StVO nur die
Blindenführhunde.
2. Anerkennung als
Hilfsmittel
Für die Anerkennung
der Blindenführhunde sowie der übrigen Rehabilitationshunde als
Hilfsmittel ist keine Gesetzesänderung notwendig, sondern lediglich eine
Aufnahme in den Hilfsmittelkatalog des Hauptverbandes der Österreichischen
Sozialversicherungsträger. Gleichzeitig wäre natürlich bei
dieser Gelegenheit zur Qualitätssicherung der Begriff
,Rehabilitationshund‘ zunächst im Erlaßwege genau zu
definieren, solange die unter Punkt 3 unserer Stellungnahme
angeführte angestrebte gesetzliche Regelung noch nicht erfolgt ist. In
diesem Zusammenhang wird auch auf die Bürgerinitiative des ÖBV aus
1994 hingewiesen, in der gefordert wurde, das Mobilitäts-(Restsinnen-)Training
und geprüfte Blindenführhunde als Maßnahme der
medizinischen Rehabilitation durch alle Kostenträger anzuerkennen. Diese
Initiative wurde vom Petitionsausschuß nach Einholung aller
Stellungnahmen dem BMG zugewiesen und ruht seither dort trotz mehrfacher
Urgenzen durch den Einbringer.
3. Anerkennung der
Rehabilitationshunde als Diensthunde
Die gesetzliche
Verankerung aller Gruppen von Rehabilitationshunden ist aus der Sicht des
ÖBV die einzige Möglichkeit, sowohl den auf diese Hunde angewiesenen
behinderten Menschen als auch den in rechtlicher Hinsicht mit den Hunden
konfrontierten Personen Rechtssicherheit zu geben. Ist die Aufgabe der
einzelnen Hundeberufe gesetzlich festgelegt, ist auch eher einsichtig,
daß der Hund fast überallhin mitgenommen werden können
muß. Es ist so zu erwarten, daß die dazu erforderlichen
Gesetzesänderungen auch in der Bevölkerung eine gute Akzeptanz
finden werden. Ebenso können Personen, die nach der derzeitigen
Gesetzeslage in bestimmten Situationen unweigerlich in Konflikte geraten (zB
ein Blinder möchte mit seinem Führhund in ein
Lebensmittelgeschäft gehen – der Geschäftsführer
mußte ihn unmenschlicherweise nach dem Lebensmittelgesetz hinausweisen),
menschlich handeln und trotzdem gesetzeskonform agieren. Gleichzeitig wird
dadurch sichergestellt, daß wirklich nur die Besitzer entsprechend
ausgebildeter Rehabilitationshunde die eingeräumten Rechte in Anspruch
nehmen können.
Die Bezeichnung von Rehabilitationshunden als
Diensthunde sieht der ÖBV jedoch als bedenklich an. In Österreich
wird die Bezeichnung ,Diensthund‘ wahllos sowohl für den völlig
unausgebildeten Wachhund an der Kette als auch für den gut ausgebildeten
Sprengstoff-, Suchtgift- oder Polizeihund oder vereinzelt auch für
Rettungs- und Blindenführhunde verwendet. Eine rechtliche Definition ist
uns jedoch nicht bekannt. Unserer Meinung nach sollte demnach der Ausdruck
,Diensthund‘ den im Eigentum der öffentlichen Hand stehenden
für einen bestimmten Zweck ausgebildeten Hunden vorbehalten bleiben.
Im übrigen wird mit der Entwicklung von immer
mehr ,Hundeberufen‘ durch mehr oder weniger geschulte Trainer die
Begriffsvielfalt für die gleiche Tätigkeit auch international gesehen
immer verwirrender. Wesentlich zielführender wäre es daher, den Begriff
,Rehabilitationshund‘ mit seinen Untergruppen Blindenführhund,
Partnerhund für Körperbehinderte und Signalhund für
Hörbehinderte sowie Kombinationshund für mehrfach Behinderte
gesetzlich, beispielsweise im Bundesbehindertengesetz, zu definieren und
zu verankern. Erst im Anschluß daran ist es sinnvoll, die notwendigen
Rechte und Pflichten des Hundeführers in den einzelnen Rechtsvorschriften
festzulegen.
Die sogenannten ,Therapie-‘ und
,Sozialhunde‘ fallen nicht unter den Oberbegriff Rehabilitationshund,
weil sie vom Ausbildungsstand sowohl des Hundes als auch des Hundeführers
nicht geeignet sind, ausgefallene Körper- oder Sinnesfunktionen
kompensieren zu helfen und benötigen daher grundsätzlich keine
besonderen Rechte.
Aus der Sicht des ÖBV muß unbedingt
festgelegt werden, daß der Ausbildungsstand sowohl des Hundes als auch
des Hundeführers in einer speziellen Prüfung nachgewiesen wird.
Für Blindenführhunde, für die Zuschüsse aus
öffentlicher Hand gewährt werden, geschieht dies durch eine seit
sieben Jahren beim Österreichischen Blindenverband eingerichtete
provisorische Prüfungskommission, deren Mitglieder öffentlich
Bedienstete sind, die jedoch ohne gesetzliche Grundlage oder
erlaßmäßige Absicherung agiert. Die Erfahrungen zeigen von
Anfang an die dringende Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung der
Prüfung. So hat zB eine Hundeschule, die mit Entscheidungen der Kommission
nicht einverstanden war, einen Verein gegründet, die Prüfung
jahrelang boykottiert und eine eigene Prüfungsordnung mit einer ,objektiven‘
Kommission präsentiert, die auch gleich die Hunde der anderen diese Schule
konkurrenzierenden Schulen prüfen wollte. Weiters ist die Bezahlung auch
nicht geprüfter Hunde aus öffentlichen Mitteln trotz Erlasses des
BMAS wiederholt erfolgt. Die dienstrechtliche Stellung der Kommissionsmitgelider
in Ausübung ihrer Tätigkeit als Führhundprüfer ist bisher
ungeklärt. Im übrigen gibt es gegen die Entscheidungen der
Prüfungskommission kein Rechtsmittel.
Die derzeitige erlaßmäßige
Regelung (Eintragung des geprüften Blindenführhundes mit
Zeugnisnummer in den Bundesbehindertenausweis) ist zwar schon ein gewisser
Fortschritt, das Ziel muß aber ein weltweit, aber mindestens EU-weit
anerkannter Ausweis mit Foto des Rehabilitationshundes mit Tätowiernummer
bzw. elektronischer Identifizierung sein.
Was die in der Bürgerinitiative verlangten
Zutrittsrechte betrifft, ist zu bemerken, daß dies bereits ein
langjähriges Anliegen des Österreichischen Blindenverbandes
darstellt. Allerdings zeigt ein Blick über unsere Grenzen, daß die
Vorgangsweise, Zutrittsrechte ohne vorherige Definition der Hunde zuzugestehen,
mit großen Problemen verbunden ist.
Wie aus einem bestimmten
Buch hervorgeht, hat die USA eine beachtliche Tradition auf dem Gebiet des
Rehabilitationshundewesens. Tausende von Hunden sind im Einsatz, die Bedeutung
der Tiere hat ihren Niederschlag sogar im amerikanischen Behindertengesetz, dem
,American with Disabilities Act‘ (ADA) gefunden, das den behinderten
Hundeführern mit ihren Rehabilitationshunden ein einklagbares Zutrittsrecht
zu Orten garantiert, an denen Hunde ansonsten verboten sind. Ein
ungelöstes Problem jedoch, das gerade jetzt heftig USA-weit diskutiert
wird, ist die Definierung und einwandfreie Identifizierung eines
Rehabilitationshundes. Die Zutrittsrechte gelten natürlich nur für
ausgebildete Hunde, jedoch ist der Nachweis der Ausbildung nicht einheitlich
geregelt. In manchen Staaten dürfen bzw. müssen die Hunde von
gewissen Ausbildungsstätten zertifiziert werden, wobei deren Hunde selbst
von keiner unabhängigen Stelle kontrolliert werden und es dabei oft zu
Monopolstellungen der größeren Stiftungen kommt, wobei diese
großteils überhaupt nicht interessiert sind, Zertifizierungen
für kleinere Schulen oder private Trainer durchzuführen. Je nach Bundesstaat
werden für die Hunde unterschiedliche, manchmal auch gar keine
Identifizierungen verlangt: meist ein Führgeschirr für den
Blindenführhund, ein Brustgeschirr in einer bestimmten Farbe für den
Partnerhund, Leine und Halsband in Orange für den Signalhund, ein Ausweis
von einer Ausbildungsstätte, ein Ausweis von der Gemeinde, dem
Bundesstaat …
Dieses Durcheinander
führt trotz an sich vorbildlicher Zutrittsregelungen zu einer Vielzahl von
Problemen für die Hundeführer, aber auch für alle anderen
Betroffenen. Wenn ein Geschäftsinhaber einen Behinderten mit Hund in sein
Lebensmittelgeschäft hereinläßt, riskiert er eine Anzeige nach
dem Hygienegesetz, wenn der Hund kein Rehabilitationshund ist. Läßt
er dagegen einen Reha-Hund nicht herein, riskiert er eine Verurteilung nach dem
ADA.
4. Vorgeschlagene Vorgangsweise
Es wolle ein
Initiativantrag zur Aufnahme des Begriffes ,Geprüfter
Rehabilitationshund‘ mit den einzelnen oben angeführten Untergruppen
und deren jeweiliger Definition in die Österreichische Rechtsordnung
(beispielsweise ins Bundesbehindertengesetz) im Nationalrat eingebracht werden.
Aus den bisherigen Erfahrungen mit den einschlägigen Bundesbehörden
(Bundesministerium für Arbeit und Soziales und Bundesministerium für
Gesundheit) hat sich nämlich ergeben, daß sie sich entweder für
unzuständig erklären oder mit den bestehenden Rechtsvorschriften das
Auslangen zu finden glauben. Wie das amerikanische Beispiel zeigt, sollte eine
bundeseinheitliche Regelung getroffen werden. Da es bisher keine
einschlägigen Regelungen in den Ländern gibt, werden keine besonderen
Widerstände seitens der Länder zu erwarten sein, umso mehr sich die
meisten Ämter der Landesregierungen im Falle der
Blindenführhundprüfungen an dem Erlaß des BMAS orientieren.
Abschließend darf
der ÖBV ersuchen, ihn bei der weiteren Behandlung der Materie ebenfalls
einzubinden.”
Der Österreichische
Blindenverband erstattete weiters folgenden Bericht über die Kongresse
für Rehabilitationshunde vom 10. bis 14. Jänner 1997 in den USA:
“Bericht über
die Kongresse für Rehabilitationshunde vom 10. bis 14. Jänner
1997 in den USA.
Vom 10. Jänner
1997 bis 14. Jänner 1997 fanden in Orlando, Florida, zwei
internationale Kongresse über Rehabilitationshunde (Blindenführhunde,
Partnerhunde für Körperbehinderte, Signalhunde für Hörbehinderte)
statt:
1. International Association of Assistance Dog
Partners (IAADP), das ist die Vereinigung der Rehabilitationshundehalter
und
2. Assiostance Dogs International (ADI), das ist
die Vereinigung der Rehabilitationshundeschulen.
Frau Dipl.-Ing. Petrovics (die Leiterin der
Prüfungskommission für Blindenführhunde) und ich
(Dr. Wanecek) waren von beiden Organisationen eingeladen, Vorträge zu
halten. Die Hundehalter wollten über die Entwicklung und den Stand des
Rehabilitationshundewesens in Österreich informiert werden, die Schulen
interessierten sich für die Durchführung der
Blindenführhundeprüfung in Österreich.
Wilson Hulley,
President’s Committee On Employment Of People With Disabilities (Komitee
des Präsidenten zur Beschäftigung Behinderter) und selbst
Partnerhundeführer, gab einen Überblick über die Zutrittsrechte
und die damit verbundenen Probleme. Die Zutrittsrechte sind an die Behinderung
des Hundeführers gebunden, nicht aber an eine Zertifizierung, das heißt,
Nachweis der Eignung und Ausbildung des Hundes einschließlich der
Zusammenschulung mit dem Hundeführer. Seit Inkrafttreten des ADA
(Americans with Disabilities Act) ist eine wirklich weitgehende
Bewegungsfreiheit für Schwerstbehinderte gewährleistet: Stufenlose
und barrierefreie Zugänge für Rollstuhlfahrer sowie
Braillebeschriftungen bzw. erhabene tastbare Buchstaben für Sehbehinderte
und Blinde sind in öffentlichen und privaten Gebäuden
selbstverständlich. Wir wurden mit dem Blindenführhund überall
freundlich und zuvorkommend behandelt, und das Zutrittsrecht für den Hund
wurde als selbstverständlich betrachtet.
Trotz dieser erfreulichen
Situation kam in den Diskussionen, die die Frage der nationsweiten
Zertifizierung berührten, zum Ausdruck, daß in den USA noch immer
angestrengt nach einer für alle Teile brauchbaren Lösung dieses
Problems gesucht wird. Es gibt eine Vielzahl von einzelstaatlichen Regelungen,
die Kennzeichnung der Hunde oder Vergabe von Ausweisen betreffend, die
häufig auch zu Gerichtsverfahren führen, insbesondere bei Personen
mit einer nicht auf den ersten Blick sichtbaren Behinderung. In solchen
Verfahren wird häufig die Frage releviert, ob dieser betreffende Hund
wirklich ordnungsgemäß ausgebildet und als Rehabilitationshund zu
behandeln ist. Die Hundeführer haben, sofern sie Hunde aus kleineren
Schulen oder von privaten Trainern beziehen, oft große Schwierigkeiten,
ihre Hunde zertifizieren zu lassen, da die Überprüfung in vielen
Bundesstaaten nicht von unabhängigen Stellen, sondern von großen
,anerkannten‘ Schulen durchgeführt werden muß, die aber oft
kein Interesse daran haben, nicht von ihnen ausgebildete Hunde anzuerkennen.
Die Schulen
äußerten große Besorgnis darüber, daß die
sogenannte Delta-Society, eine Organisation, die sich mit Tierschutz, der Verwendung
von Tieren und der Mensch-Tier-Beziehung beschäftigt, dabei ist, in
Schnellsiederkursen Trainer auszubilden (Einnahmequelle für umstrittene
Ausbildner, die für einen Sechswochenkurs 6 000 $ verlangen),
Hunde massenhaft auf den Markt zu werfen und überdies noch die
Zertifizierung sämtlicher Hunde nationsweit übertragen bekommen
möchte. Eine der wesentlichen Triebfedern ist dabei Dr. Bonita Bergin, die
auch Europa (Holland, Schweiz, Italien, Österreich) mit den von ihr im
Kurzverfahren ausgebildeten Trainern beglückt. Ob man in sechs Wochen
lernen kann, Hunde ordentlich auszubilden, sei dahingestellt, die
pädagogische Qualifikation für eine gründliche Zusammenschulung
der Teams und die medizinischen Kenntnisse über verschiedenste Krankheiten
und Behinderungen der zu schulenden Klienten wird man in der kurzen Zeit
sicher nicht erreichen können.
Eine interessante
Umfrage, die während der Tagung der Schulen durchgeführt wurde,
ergab, daß mit überwältigender Mehrheit festgestellt wurde,
daß die Ausbildung des Hundes 30% Anteil am Erfolg des Teams hat, die
Zusammenschulung jedoch 70%. Dies war eine Bestätigung für unsere
Erfahrungen im Laufe der seit sieben Jahren bestehenden österreichischen
Führhundprüfung und unterstreicht auch die Notwendigkeit einer individuellen
Schulung sowohl am Ort der Hundeschule als auch unbedingt am Wohnort. Betont
wurde auch die Wichtigkeit einer qualifizierten Nachbetreuung durch erfahrene
Gebietstrainer.
Äußerst
positiv ist zu bemerken, daß beide Konferenzen für die jeweils andere
Gruppe offen waren und die Meinung der Betroffenen von den seriösen
Schulen äußerst ernstgenommen wurde. Die fachlichen
Ausführungen über ein tiergerechtes Taining mit der ,Click and
Treat-Methode‘ und eine Methode zum Beruhigen und Konzentrieren der Hunde,
beispielsweise beim Tierarzt oder nach einem beunruhigenden Erlebnis, brachten
viele Gedankenanstöße.
Die ausführlichen
Darstellungen, daß man sich schon bei der Übernahme eines Tieres,
sei es als Patenfamilie für Junghunde, als Hundehalter für pensionierte
Hunde oder als Rehabilitationshundeführer selbst, über den Verlust
und das Ende der Beziehung Gedanken machen sollte, war für alle Anwesenden
von großem Interesse und machten Aspekte bewußt, die man eigentlich
lieber verdrängt.
Wir haben den Kongreß
auch zum Anlaß genommen, die aus ganz Amerika zusammengekommenen
Hundeführer mit den verschiedensten Behinderungen zu befragen, wo sie ohne
ihren Hund Probleme hätten. Aus der Vielzahl der Antworten möchten
wir einige markante Beispiele vorstellen:
Mrs. Joan Froling, die
Obfrau des IAADP, leidet an multipler Sklerose, wäre ohne ihren
Partnerhund nicht in der Lage, einen Handrollstuhl zu benützen,
könnte daher kein Taxi nehmen, wenn sie ihren PKW nicht zur Verfügung
hat, auch ist mit dem Elektrorollstuhl die Benützung eines Flugzeuges
äußerst erschwert bis unmöglich. Der Arztbesuch ohne
menschliche Begleitung ist auch nur möglich, weil der Partnerhund die
schwere Eingangstüre zum Haus des Arztes öffnet und ihr die Lifttüre
aufhält. Bei größeren Einkäufen ist sie anschließend
so erschöpft, daß sie nicht in der Lage wäre, ihre Waren selbst
vom Wagen ins Haus zu befördern, wobei zB die Kühlkette unterbrochen
wird. Daher hat sie spezielle Tragtaschen anfertigen lassen, die ihr der Hund
der Reihe nach bringt.
Mrs. Jean Levitt, die
Pressereferentin des IAADP, hatte vor einigen Jahren einen schweren Autounfall.
Ihr linker Arm ist gebrauchsunfähig, auf Grund einer
Wirbelsäulenverletzung versagen ihr ganz plötzlich und unerwartet
alle Muskeln, und sie fällt zusammen. Ihr Collie ist in der Situation
darauf trainiert, sich parallel so hinzustellen, daß sie sich auf ihn
stützen und dadurch wieder hochrappeln kann. Da sie nicht in der Lage ist,
Gegenstände über weitere Entfernung zu tragen, hat der Hund
Packtaschen bzw. zieht mit einem Wägelchen größere
Einkäufe vom Auto ins Haus.
Mrs. Kris Baker ist nach
einer Verschlechterung ihrer Kinderlähmung, die erst Jahre nach der
Ersterkrankung auftrat, auf den Rollstuhl angewiesen und fand sich eines Tages
ohne Treibstoffe zirka drei Kilometer von der nächsten Tankstelle entfernt
auf einer ziemlich schwach befahrenen Straße wieder. Ohne ihren Golden
Retriever wäre es ihr unmöglich gewesen, eine Tankstelle zu
erreichen. Der gut trainierte Partnerhund zog sie mit dem Rollstuhl über die
ganze Entfernung zur Tankstelle, wo sie Treibstoff bekam und zu ihrem Auto
zurückgebracht wurde.
Dr. Miriam Clifford ist
schwer hörbehindert und hat eine kleine Signalhündin, die ihr
verschiedene Geräusche anzeigt. Als ihr Mann im Nebenzimmer einen Herzanfall
erlitt, konnte sie seine schwachen Rufe natürlich nicht hören, die
Hündin alarmierte sie jedoch sofort, und die Rettung konnte rechtzeitig
verständigt werden.
Die ganze Problematik
einer fehlenden Zertifizierung zeigte sich im übrigen auch im Zusammenhang
mit der Partnerhundeschule ,New Horizons Service Dogs‘ aus Orlando, von
welcher wir einige Trainer mit ihren Hunden auf dem Kongreß trafen. Sie
hat sich von der großen und USA-weit bekannten Schule ,Canine Companions
for Independence (CCI)‘ abgespalten und bildet Hunde aus, die von CCI
wegen ihres problematischen Wesens ausgeschieden wurden. Der gut ausgebildete
und vollkommen friedfertige Partnerhund Austin von Mrs. Levitt wurde von einem
dieser Hunde während des Kongresses angefallen, ein weiterer Hund zeigt
sich sehr ängstlich. Wenn diese Tiere bereits bei ihren Trainern ein
derartiges Verhalten zeigten, bedarf es keiner ausgeprägten Phantasie,
sich vorzustellen, wie sie sich bei behinderten Hundeführern verhalten
werden.
Anschließend an den Kongreß besuchten
wir Ausbildungsstätten für Rehabilitationshunde, und zwar:
die
Blindenführhundschule ,Southeastern Guide Dogs‘ in Palmetto,
Florida,
die Partner- und
Signalhundeschule ,Paws with a Cause‘ in Michigan und
die
Blindenführhundschule ,Leader Dogs‘ in Rochester, Michigan.
Der geplante Besuch bei
der Signalhundeschule ,Florida Dog Guides for the Deaf‘ konnte nicht
stattfinden. Wir hatten uns telefonisch und per Fax angemeldet. Zwei
Absolventen der Schule waren auch bei der Konferenz, ein Gespräch mit
Verantwortlichen der Schule, die an sich anwesend sein sollten, kam jedoch
nicht zustande. Eine weitere telefonische Nachfrage ergab, daß die Schule
selbst keine Hunde hat, sondern die Trainer nur den Hörbehinderten
behilflich sind, selbst einen Hund aus einem Tierheim auszuwählen. Der
neue Besitzer muß den Hund allein auf sich gestellt zunächst
30 Tage bei sich sozialisieren und dann mit dem Tier in einem lokalen
Hundeverein Unterordnung üben. Dann zeigen die Trainer dem Hundeführer,
wie man den Hund zur Geräuscharbeit ausbildet. Das bedeutet, daß das
volle Risiko beim Behinderten liegt. Der Hund kann trotz Beratung durch den
Trainer ungeeignet sein, wenn man jedoch bedenkt, daß die Hunde in den
Tierheimen in den USA meist getötet werden, so wird ein tierliebender
Mensch ein solches Tier dann doch nicht zurückgeben.
Dieses Beispiel zeigt,
welche Auswüchse auf dem Rehabilitationshundegebiet möglich sind.
Auch in Österreich gab es bereits mehrere ähnliche Fälle bei
Blindenführhunden. Nachdem die Führhundeprüfung noch immer nicht
gesetzlich vorgeschrieben ist, gaukeln gewissenlose Trainer ahnungslosen
Behinderten vor, ihnen einen Hund ,herzurichten‘ – ohne Rechnung
und Garantie, daß eine Ausbildung auch abgeschlossen wird, und
natürlich auch ohne Prüfung. Einer dieser ,hergerichteten‘
Hunde ließ seine Besitzerin in den Presseggersee stürzen,
sodaß sie sich den Arm brach.”
Einstimmiger Beschluß in der Ausschußsitzung am 9. Juli 1997:
Ersuchen um Zuweisung an den Ausschuß
für Arbeit und Soziales.
Der Ausschuß
für Arbeit und Soziales hat die gegenständliche Bürgerinitiative
Nr. 8 am 10. Juni 1998 in Verhandlung genommen und nach der
Kenntnisnahme seines Berichtes (1264 der Beilagen) auch die Zustimmung zu einer
Entschließung beantragt. Diese Anträge hat der Nationalrat in seiner
Sitzung am 16. Juni 1998 mit Stimmenmehrheit angenommen.
Gesundheitsausschuß
Bürgerinitiative Nr. 6
eingebracht von Dr. med. Lothar Krenner
betreffend “Gentechnologie – nein danke!”
Die Bürgerinitiative
“Gentechnologie – nein danke!” fordert:
1. Eine klare, eindeutige
und umfassende Kennzeichnungspflicht für alle genmanipulierten
Lebensmittel und Zusatzstoffe.
2. Einen
Gesetzesbeschluß, der für die Dauer von zehn Jahren jede
gentechnologische Anwendung – mit Ausnahme spezieller medizinischer
Forschungsprojekte – untersagt (10-Jahres-Moratorium).”
In der
Ausschußsitzung am 17. Oktober 1996 wurde der Beschluß
gefaßt, eine Stellungnahme des Bundesministeriums für Gesundheit und
Konsumentenschutz einzuholen.
Das Bundesministerium
für Gesundheit und Konsumentenschutz teilte zur Bürgerinitiative
Nr. 6 betreffend “Gentechnologie – nein danke!”
folgendes mit:
“Zu Punkt 1
(Eine klare, eindeutige und umfassende Kennzeichnungspflicht für alle
genmanipulierten Lebensmittel und Zusatzstoffe):
Das Bundesministerium
für Gesundheit und Konsumentenschutz hat sich von Anfang an für eine
umfassende Kennzeichnung von Lebensmitteln oder Lebensmittelzutaten, die aus
gentechnisch veränderten Organismen bestehen oder aus solchen hergestellt
werden, ausgesprochen, um dem mündigen Konsumenten die
Wahlmöglichkeit für eine bewußte Kaufentscheidung zu geben.
Auch bei den
Vermittlungsverhandlungen zur Schaffung einer Europäischen Verordnung
über neuartige Lebensmittel und Lebensmittelzusatzstoffe, der sogenannten
,Novel-Food-Verordnung‘, vertrat Österreich gemeinsam mit
Deutschland, Dänemark und Schweden diesen Standpunkt.
Frau Bundesministerin Dr.
Christa Krammer hat mehrmals bei EU-Abgeordneten interveniert, um eine
weitestgehende Kennzeichnungsregelung auf EU-Ebene zu erreichen. Da aber noch
nicht abzusehen war, ob und wann eine EU-Kennzeichnungsregelung kommen wird,
hat sie zwei Verordnungen unterschrieben, die auf Grund des
Lebensmittelgesetzes bzw. des Gentechnikgesetzes eine eindeutige Kennzeichnung
von gentechnisch veränderten Lebensmitteln und anderen Produkten anordnen.
Diese beiden Verordnungen setzen allerdings das Einvernehmen des
Wirtschaftsministers bzw. des Umweltministers voraus. Im
Vermittlungsausschuß in Brüssel wurde am 28. November 1996 ein
Einvernehmen über eine weitgehende Kennzeichnung von Lebensmitteln und
Lebensmittelzutaten, die aus gentechnisch veränderten Organismen
hergestellt sind, erzielt. Damit ist – die formelle Zustimmung des
EU-Ministerrates und des EU-Parlaments vorausgesetzt – die Frage der
Kennzeichnungspflicht positiv gelöst.
Zu Punkt 2
(Forderung nach einem Gesetzesbeschluß, der für die Dauer von zehn
Jahren jede gentechnologische Anwendung – mit Ausnahme spezieller
medizinischer Forschungsprojekte – untersagt ,10-Jahres-Moratorium‘):
Ein solcher Schritt
wäre weder rechtlich möglich noch faktisch sinnvoll. Zum einen
verpflichtet uns das Gemeinschaftsrecht der EU (im konkreten die
Richtlinien 90/219/EWG und 90/220/EWG), Arbeiten mit GVO im geschlossenen
System, deren Freisetzung in die Umwelt und das Inverkehrbringen von Produkten,
die aus GVO bestehen oder solche enthalten, nach eigens dafür vorgesehenen
Zulassungsverfahren unter Beachtung der in den Richtlinien festgelegten
Sicherheitsmaßstäbe zu genehmigen.
Diese Richtlinien fanden
ihre innerstaatliche Umsetzung im Gentechnikgesetz, BGBl. Nr. 510/1994,
welches mit 1. Jänner 1995 in Kraft getreten ist und das Verfahren
für die obengenannten Bereiche der Gentechnik sowie auch den Bereich der
Gentherapie und Genanalyse regelt.
Ein zehnjähriges
Moratorium, das heißt, die Aussetzung aller gentechnologischen
Anwendungen mit Ausnahme medizinischer Forschungsprojekte, würde dem
Gesetz als solchem sowie vor allem dem darin normierten
,Zukunftsprinzip‘, das heißt, der Förderung der Forschung auf
diesem Gebiet, zuwiderlaufen und eine Nutzung der positiven Aspekte der
Gentechnik, die nicht nur im Bereich der Medizin zu finden sind, unmöglich
machen.
Zum anderen würden
wir uns dadurch auch die Chance nehmen, durch Forschung und wissenschaftliche
Tätigkeit im Bereich der Gentechnik am internationalen
Entwicklungsprozeß beteiligt zu sein und dadurch jene immer wieder
diskutierten Risken der Gentechnik genauer einschätzen und durch
entsprechende Sicherheitsmaßnahmen vermeiden zu können.”
Am 7. Mai 1997 wurde
vom Ausschuß für Petitionen und Bürgerinitiativen der einstimmige
Beschluß gefaßt:
Ersuchen um Zuweisung an
den Gesundheitsauschuß.
Der
Gesundheitsausschuß hat die gegenständliche Bürgerinitiative in
seiner Sitzung vom 25. Juni 1997 in Verhandlung gezogen und sodann einen
Unterausschuß mit der Vorbehandlung dieser Bürgerinitiative betraut.
Gesundheitsausschuß
Bürgerinitiative Nr. 13
eingebracht von Frau
Monika Zöhrer betreffend “Klonierungsverbot von
Tieren”
Das Tierhilfswerk Austria
hat die Bürgerinitiative zum Thema Klonierungsverbot von Tieren initiiert
und bringt folgende Punkte vor:
“– Das
Klonen von Tieren ist bis zum heutigen Tag nicht gesetzlich geregelt.
– Das
Klonen von Tieren erfordert eine einheitliche Regelung, gleichermaßen
gültig für alle Bundesländer, wie dies bereits beim
Klonierungsverbot von Menschen (geregelt im Fortpflanzungsgesetz) der Fall ist.
– Ein
Klonierungsverbot von Tieren kann nur ein endgültiges Verbot sein, welches
keine Abstufungen bezüglich seiner Explizität haben darf und deshalb
durch ein für alle Bundesländer einheitliches Gesetz geregelt werden
muß, wie dies beim Tierversuchsgesetz bereits der Fall ist.
– Eine
unterschiedliche Regelung von den Ländern hätte zur Folge, daß
Forschungsinstitute und Konzerne, die an der Anwendung dieser Technologie
Interesse haben, sich in den Bundesländern mit der offensten Regelung,
ansiedeln werden.
– Aus den
gleichen Gründen ist es wünschenswert, wenn sich die Bundesregierung
auch auf EU-Ebene für ein Klonierungsverbot von Tieren einsetzt.
ARGUMENTE GEGEN DIE
ANWENDUNG DES KLONENS VON TIEREN
1. Klonen in der Viehwirtschaft
– Die
herrschende Überproduktion von Fleisch und Milch im EU-Raum steht im
Widerspruch zu den Ambitionen der Wissenschaft, gentechnische Manipulation und
Klonierung im Sinne einer Leistungssteigerung bei Tieren in der
Viehwirtschaft einzusetzen.
– Klonierung
von Tieren in diesem Bereich ist ein Schritt hin zur Massentierhaltung, da
durch vorhergehende genetische Manipulation die Tiere an
Haltungsbedingungen und Krankheiten (hervorgerufen durch die in der
Massentierhaltung herrschenden schlechten Lebensbedingungen) angepaßt und
ihre Produktivität gesteigert werden sollen.
– Die
Patentierung von Tieren – hergestellt durch Klonierungsverfahren –
führt zur Abhängigkeit der Bauern von einigen wenigen
Großkonzernen.
– Das
Kreuzen von Arten und Rassen, die bis dato einer natürlichen Artenschranke
unterlagen, und deren Vervielfältigung durch Klonierung, öffnet der
Übertragung von Krankheiten Tür und Tor (eine Herde genetisch identer
Tiere kann durch einen einzigen Virus getötet werden).
2. Medizin und Forschung
– Bei
der Klonierung von Tieren handelt es sich um eine Biotechnologie, deren
Anwendung unabsehbare Folgewirkungen haben kann. Es gibt keine Kenntnisse
über Auswirkungen vor allem in bezug auf die Übertragung von
Krankheiten!
Bei der Klonierung handelt es sich um eine
Biotechnologie, deren Auswirkungen auf die Evolution nicht absehbar und vor
allem nicht umkehrbar sind, weshalb eine Nicht-Regelung nicht verantwortet
werden kann!
Deshalb fordert das TIERHILFSWERK AUSTRIA eine
umgehende Regelung dieser Problematik und fordert die Bundesregierung auf, ein
Klonierungsverbot, verankert im Tierversuchsgesetz, zu erlassen.”
In der Ausschußsitzung am 26. November
1997 wurde betreffend diese Bürgerinitiative beschlossen, eine
Stellungnahme des Bundeskanzleramtes (Konsumentenschutz), des Bundesministeriums
für Land- und Forstwirtschaft und des Bundesministeriums für
Wissenschaft und Verkehr einzuholen.
Das Bundeskanzleramt führte zur
gegenständlichen Bürgerinitiative folgendes aus:
“Frau Bundesministerin Mag. Barbara Prammer
unterstützt grundsätzlich die Forderung nach einem Klonierungsverbot,
sei es in der Landwirtschaft oder in der Industrie. Die Zuständigkeit
für diesen Bereich liegt jedoch nicht bei ho. Ressort. Wir
übermitteln Ihnen zu dieser Fragestellung ein Gutachten des Verfassungsdienstes
betreffend die kompetenzrechtliche Zuständigkeit einer allfälligen
Regelung für das Klonieren von Tieren.”
Diesem Schreiben war folgende Stellungnahme des
Bundeskanzleramtes beigefügt:
“Das Bundesministerium für Wissenschaft
und Verkehr trat an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst mit dem Ersuchen
heran, die kompetenzrechtliche Zuständigkeit einer allfälligen
Regelung für ,Klonieren‘ bzw. ,Klonen‘ von Tieren zu
klären:
Bezugnehmend auf die gegenständliche Anfrage
nimmt das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst zur Frage der Zuständigkeit
einer allfälligen Regelung des Klonierens wie folgt Stellung:
1. Ausgangssituation:
Der Ausgangspunkt der kompetenzrechtlichen
Einordnung ist der Begriff des Klonierens. Wie in der zitierten Note des
Bundesministeriums für Wissenschaft und Verkehr dargelegt ist, wird unter
Klonieren eine Methode verstanden, die auf eine ungeschlechtliche, identische
Vermehrung genetischer Informationen auf zellulärer, organischer und
molekularer Ebene abzielt. Die Naturwissenschaften definieren einen Klon als
eine ungeschlechtlich aus einem Organismus entstandene erbgleiche
Nachkommenschaft. Man kann verschiedene Techniken des Klonierens unterscheiden,
insbesondere die Monozygot-Klonierung, die Chimären-Klonierung, die
Embryo-Klonierung, die Züchtungsklonierung und die Individualklonierung
(Adulte-Klonierung).
Klonieren ist deutlich von der Gentechnik zu
unterscheiden; es fällt nicht unter den Geltungsbereich des
Gentechnikgesetzes (vgl. § 2 GentechnG).
Das Klonieren kann sich auf Pflanzen, Tiere und
Menschen beziehen. Das menschliche Klonieren ist bereits im § 9 des
Fortpflanzungsmedizingesetzes, BGBl. Nr. 275/1992, mittelbar geregelt
(verboten; vgl. RV 216 der Beilagen XVIII. GP, 20). Aus Art. 13 des
Europäischen Übereinkommens über Menschenrechte und
Biomedizin (Verbot der Eingriffe in menschliches Erbgut) könnte ein
Klonierungsverbot menschlicher Lebewesen erschlossen werden. Derzeit wird
allerdings ein ausdrückliches Klonierungsverbot menschlicher
Lebewesen im Zuge eines Zusatzprotokolls zum Europäischen
Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin beraten. Im
gegenständlichen Fall wird ein mögliches Klonierungsverbot
für Tiere diskutiert. Es ist offensichtlich derzeit nicht daran gedacht,
die Regelung auch auf das Klonieren von Pflanzen auszuweiten. Gegenstand der
rechtspolitischen Diskussion ist somit ausschließlich das Klonieren
von Tieren.
Ein grundsätzliches Problem bei der
gegenständlichen Kompetenzbeurteilung ist jedoch der Umstand, daß
derzeit die Technik des Klonierens sich teilweise noch im Stadium der
wissenschaftlichen Erprobung befindet, sodaß die möglichen
Entwicklungslinien des Klonierens keineswegs absehbar sind. Einzelne Techniken
des Klonierens werden zum Teil schon erfolgreich zu landwirtschaftlichen
Zuchtzwecken verwendet. Insbesondere der Embryonaltransfer wird bereits im
größeren Umfang im Rahmen der Tierzucht eingesetzt (vgl. dazu das
Gutachten von Prof. Brem). Die nachstehenden Ausführungen sind daher auf
den derzeitigen Stand der Entwicklung bezogen zu sehen.
2. Zur kompetenzrechtlichen Einordnung des
Klonierens:
Bei neu auftretenden Sachmaterien, wie etwa dem
Klonieren von Tieren, stellt sich die grundsätzliche Frage, ob diese
Angelegenheiten im Sinne des Enumerationsprinzipes den Bundeskompetenzen zugeordnet
werden können, oder ob nicht vielmehr die Generalklausel des
Art. 15 Abs. 1 B-VG zugunsten der Länderkompetenzen in
Betracht zu ziehen ist. Dabei ist insbesondere zu untersuchen, ob die
betreffende neue Sachmaterie nicht auf schon bestehende Bundes- und
Länderkompetenzen verteilt ist [vgl. dazu insbesondere Funkt, das System
der bundesstaatlichen Kompetenzverteilung im Lichte der
Verfassungsrechtsprechung (1980), 84 ff.]. Solche geteilten Materien sind
entweder grundsätzlich allen Kompetenztatbeständen akzessorisch
(echte Annexmaterie) oder nur im Anhang einiger Hauptmaterien anzutreffen
(sogenannte Querschnittsmaterie). Dabei können folgende
Kompetenztatbestände des Bundes in Betracht gezogen werden:
a) Kompetenztatbestand Veterinärwesen
(Art. 10 Abs. 1 Z 12 B-VG):
Im Zusammenhang mit den Klonieren von Tieren
wäre zunächst zu untersuchen, ob der Kompetenztatbestand
,Veterinärwesen‘ eine ausreichende Grundlage bietet. Zu diesem Zweck
ist der Begriff des Veterinärwesens vermittels der juristischen Methodik,
insbesondere der Versteinerungstheorie, näher zu ermitteln.
Der Inhalt des Begriffes Veterinärwesen im
Sinne des Art. 10 Abs. 1 Z 12 B-VG bestimmt sich nach dem Stand
der Bundesgesetzgebung im Zeitpunkt des Wirksamkeitsbeginns des
Kompetenztatbestandes (Versteinerungszeitpunkt), in diesem Fall am
1. Oktober 1925. Veterinärwesen umfaßte alle staatlichen
Normen, die den Zweck verfolgten, die Heilung kranker Tiere zu fördern,
sowie den Ausbruch ansteckender Tierkrankheiten zu verhüten und die
ausgebrochenen möglichst rasch zu tilgen [vgl. Mayerhofer/Pace, Handbuch
für den politischen Verwaltungsdienst5 VI (1900), 534]. Eine
deutliche Abgrenzung des Begriffes der Veterinärangelegenheiten wurde mit
der Verordnung betreffend die Bestimmung des Wirkungskreises des Ministeriums
des Inneren bzw. des Ackerbauministeriums in Veterinärangelegenheiten,
RGBl. Nr. 174/1906, vorgenommen. Die dem Ackerbauministerium zugeordneten
Agenden des Veterinärwesens umfaßten demnach insbesondere
Bestimmungen über die Gefahrenabwehr und Tilgung verschiedener
Tierkrankheiten, betreffend die Organisation des öffentlichen
Sanitätsdienstes, sofern Fragen des Veterinärdienstes in Betracht
kommen, sowie Regelungen der staatlichen Veterinärverwaltung. Der
Wirkungsbereich dieses Ministeriums wurde mit Art. 9 Z 4 des Gesetzes
über die Staatsregierung, StGBl. Nr. 180/1919, beim Staatsamt
für Land- und Forstwirtschaft belassen und galt nach der auf Grund
ausdrücklicher verfassungsrechtlicher Ermächtigung erlassenen
Verordnung der Bundesregierung über die Besorgung der Geschäfte der
Bundesverwaltung vom 9. April 1923, BGBl. Nr. 199, am 1. Oktober
1925 mittelbar weiter. Dieser Begriff lag somit auch noch zum
Versteinerungszeitpunkt dem Begriff des Veterinärwesens zugrunde. Im
Zentrum des Komplexes des Veterinärwesens standen somit Maßnahmen,
welche die Verhütung und Tilgung der ansteckenden Tierkrankheiten zum
Gegenstand hatten, dh. die Abwendung der aus der Nutztierhaltung resultierenden
Gefahren, und nur mittelbar Regelungen bezüglich des Veterinärpersonals
sowie einiger mit dem Veterinärwesen verbundener Gewebe (vgl.
Mayrhofer/Pace, a.a.O., 535; Mischler/Ulbrich, Österreichisches
Staatswörterbuch VI, 819). Wesentlich für den Begriff
,Veterinärwesen‘ ist somit jener der Gefahrenabwehr hinsichtlich der
menschlichen Gesundheit.
Veterinärwesen umfaßt nach
ständiger Rechtsprechung des VfGH die Maßnahmen, die zur Erhaltung
des Gesundheitszustandes von Tieren und zur Bekämpfung der sie befallenden
Seuchen sowie zur Abwendung der aus der Tierhaltung und der bei der Verwertung
der tierischen Produkte mittelbar der Volksgesundheit drohenden Gefahren
erforderlich sind (VfSlg. 2073/1950, 4817/1964, 8466/1978, 12 331/1990
ua.; Mayer, B-VG Kurzkommentar, 45).
Soweit durch das Klonieren von Tieren derartige
oben beschriebene Gefahren ausgehen können, wäre die Technik des
Klonierens als eine Angelegenheit der Veterinärpolizei zu betrachten und
somit in dieser Hinsicht unter den Kompetenztatbestand Veterinärwesen
einzuordnen. Der Eingriff der zum Klonieren notwendigen Entnahme des
Zellmaterials wird offensichtlich von einem Veterinär durchgeführt.
Es ist jedoch angesichts des Erkenntnisses VfSlg. 2073/1950 eher
zweifelhaft, den Kompetenztatbestand des Veterinärwesens gemäß
Art. 10 Abs. 1 Z 12 B-VG als Kompetenzgrundlage für das
Klonieren generell heranzuziehen, soweit es bloß um den Eingriff beim
Spendertier geht. der VfGH hat nämlich anläßlich des genannten
Erkenntnisses festgestellt, daß rein tierzüchterische
Maßnahmen, wie etwa die künstliche Befruchtung von Rindern durch
Tierärzte, nicht zum Veterinärwesen im Sinne des Art. 10
Abs. 1 Z 12
B-VG zu rechnen sind. Derartige mit tierzüchterischen Maßnahmen in
Verbindung stehende Eingriffe sind demnach nicht Angelegenheiten des
Veterinärwesens, sondern Angelegenheiten der Tierzucht, welche in
Gesetzgebung und Vollziehung Landessache sind.
b) Kompetenztatbestand Gesundheitswesen
(Art. 10 Abs. 1 B-VG):
Wegen der engen Verbindung des Klonierens mit
Gesundheitsrisiken ist auch der Begriff ,Gesundheitswesen‘
heranzuziehen. Der Inhalt des Begriffes ,Gesundheitswesen‘ im Sinne des
Art. 10 Abs. 1 Z 12
B-VG bestimmt sich nach dem Stand der Bundesgesetzgebung im Zeitpunkt des
Wirksamkeitsbeginns des Kompetenztatbestandes (Versteinerungszeitpunkt), in
diesem Fall am 1. Oktober 1925. Zu dieser Zeit galt noch das den
medizinischen Bereich regelnde Generalsanitätsnormativum vom
2. Jänner 1770. Es enthielt einerseits sanitätspolizeiliche
Vorschriften zur Seuchenbekämpfung, welche durch das Reichssanitätsgesetz,
RGBl. NR. 68/1870, materiell derogiert wurden, andererseits Regelungen der
Pflichten der Wundärzte und Bader, der Medici, der Apotheker und der
Hebammen, die erst mit der Ärzteordnung, BGBl. Nr. 430/1937,
aufgehoben wurden. Weitere Anhaltspunkte für die Auslegung des Begriffes ,Gesundheitswesen‘
lassen sich aus der Anlage zur Kundmachung des Ministeriums für
Volksgesundheit vom 8. August 1918, RGBl. NR. 297, entnehmen. Der
darin umschriebene Wirkungsbereich des Ministeriums umfaßte alle
Maßnahmen der Volksgesundheit, insbesondere sanitätspolizeiliche
Maßnahmen, aber auch die Vollziehung im Bereich des Ärztewesens, des
ärztlichen Hilfspersonals, der Apotheker und der Hebammen. Der
Wirkungsbereich dieses Ministeriums ging später auf das Staatsamt für
soziale Verwaltung über (Art. 9 Z 6 des Gesetzes über die
Staatsregierung, StGBl. Nr. 180/1919) und galt nach der auf Grund
ausdrücklicher verfassungsrechtlicher Ermächtigung erlassenen
Verordnung der Bundesregierung über die Besorgung der Geschäfte der
Bundesverwaltung vom 9. April 1923, BGBl. Nr. 199, am 1. Oktober
1925 mittelbar weiter. Zum Begriff ,Gesundheitswesen‘ im Sinne des
Art. 10 Abs. 1 Z 12 B-VG zählen demnach Maßnahmen der
Sanitätspolizei – also die Abwehr von Gefahren für den
allgemeinen Gesundheitszustand der Bevölkerung (Volksgesundheit) –
es sei denn, daß eine für eine bestimmte Kompetenzmaterie allein
typische Abart dieser Gefahr bekämpft wird (vgl. VfSlg. 3650/1959,
7582, 8035 ua.).
Klonieren gehörte natürlich noch nicht
zum ,Versteinerungszeitpunkt‘ nicht zum Gegenstand einschlägiger
Regelungen. Hinsichtlich der von der Methode des Klonierens von Tieren
ausgehenden Gefahren für die Volksgesundheit ist jedoch nicht daran zu
zweifeln, daß unter diesem Aspekt Klonieren sich im ,institutionellen
Rahmen‘ des Gesundheitswesens befindet. Ein derartiger Bezug genügt
nach herrschender Lehre den Kriterien der intrasystematischen Fortentwicklung
des Kompetenztatbestandes [vgl. Schäffer, Verfassungsinterpretation in
Österreich (1971), 109 f.]. Somit kann die Abwehr von Gefahren
für die menschliche Gesundheit, die durch das Klonieren von Tieren
entstehen können, auf Art. 10 Abs. 1 Z 12 B-VG
gestützt werden, da derartige Gefahren für die Volksgesundheit
sachlich mit dem Regelungsinhalt der ,Angelegenheiten des Gesundheitswesens‘
zusammengehören.
c) Kompetenztatbestand Hochschulwesen
(Art. 14 Abs. 1 B-VG):
Hinsichtlich der wissenschaftlichen Erforschung
der Technik des Klonierens kommt auch der Kompetenztatbestand des
Hochschulwesens in Betracht. Grundlage hiefür bildet in erster Linie
Art. 14 Abs. 1 B-VG (Schulwesen, Teil des Erziehungswesens). Nach
ständiger Lehre und Rechtsprechung [vgl. Walter/Mayer, Grundriß des
besonderen Verwaltungsrechts2 (1987) 178; Klecatsky/Morscher, Bundesverfassungsrecht3 (1982),
202 f.; VfSlg 2604/1953; 4020/1961; 8136/1977] sind Angelegenheiten
der Universitäten auch von diesem Kompetenztatbestand erfaßt, obwohl
der Begriff ,Hochschulwesen‘ nicht ausdrücklich in Art. 14
Abs. 1 B-VG erwähnt ist. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auch
auf Art. 17 StGG für die kompetenzrechtliche Beurteilung zu achten,
da die Garantie der Freiheit von Wissenschaft und Lehre eine materielle
Schranke für die Regelung der Forschung Lehre durch die Gesetzgebung
bildet, die es Bund und Ländern verbietet, in diesen geschützten
Bereich vorzudringen [vgl. dazu insbesondere auch Koja, Wissenschaftsfreiheit
und Universität (1976); Schäffer, a.a.O., 113]. In Fragen der
Forschungs- und Lehrfreiheit – und nur in diesem eng begrenzten Rahmen –
besteht demnach gar keine einfachgesetzliche Regelungskompetenz. Zudem liefert
Art. 17 StGG in seinen Abs. 2 bis 5 Einschränkungen hinsichtlich
des Unterrichts- und Erziehungswesens, die für die Interpretation des
Art. 14 Abs. 1 B-VG von Bedeutung sind. Art. 17 Abs. 5 StGG
normiert die Aufsicht und oberste Leitung des Staates für das gesamte
Unterrichts- und Erziehungswesen. Diese Einschränkung bezieht sich nur auf
die Lehre, nicht aber auf die Forschungstätigkeit, was auch in der
einfachgesetzlichen Rechtsordnung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des
Kompetenztatbestandes des Art. 14 Abs. 1 B-VG am 18. Juli 1962
zum Ausdruck kommt. Geregelt werden die Errichtung von Universitäten,
Hochschulen, Fakultäten, Instituten usw., die Voraussetzungen für die
Verleihung akademischer Grade sowie Organisationsvorschriften usw. Auch wenn
organisatorische Regelungen der Lehre zum Teil in auch Einfluß auf die
Forschung haben, fehlt dennoch jeder Anhaltspunkt für die
kompetenzrechtliche Möglichkeit, inhaltliche Regelung für die
Forschungstätigkeit zu treffen, also etwa Regelungen über
anzuwendende Methoden zu treffen.
Art. 14 Abs. 1 B-VG betrifft somit nicht
Zulässigkeit der Forschung des Klonierens, sondern vielmehr die
organisatorische Seite, zB die Einrichtung von Instituten, welche sich mit dem
Klonieren beschäftigen sollen oder entsprechende Ausbildungvorschriften.
Nur die organisatorischen Einrichtungen zur Erforschung des Klonierens von
Tieren, nicht aber die materielle Regelung, können daher – innerhalb
des Hochschulwesens – auf Art. 14 Abs. 1 B-VG gestützt
werden.
d)
Kompetenztatbestand der wissenschaftlichen Einrichtungen des Bundes
(Art. 10 Abs. 1 Z 13
B-VG):
Art. 10 Abs. 1 Z 13 B-VG schafft
die Kompetenz des Bundes, wissenschaftliche Einrichtungen hoheitlich zu bilden,
zu fördern usw. Die einschlägigen Normen, die zum
Versteinerungszeitpunkt (1. Oktober 1925) dem Kompetenztatbestand
,wissenschaftliche Einrichtungen des Bundes‘ zuzuordnen sind, betrafen
Organisationsrechtliches [Schlag, Verfassungsrechtliche Aspekte der künstlichen
Fortpflanzung (1990), 76; vgl. auch VfSlg. 2670/1954]. Zum
,Versteinerungszeitpunkt‘ bestanden zB folgende wissenschaftliche
Einrichtungen des Bundes: die Akademie der Wissenschaften (kaiserliches Patent
vom 14. Mai 1847); veterinärmedizinische Forschungsanstalten
(§ 3a des Gesetzes betreffend die Abwehr und Tilgung von Tierseuchen,
RGBl. Nr. 177/1909); das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
(BGBl. Nr. 550/1923, BGBl. Nr. 613/1923) ua.
Die Vorschriften, welche derartige
wissenschaftliche Einrichtungen regeln, enthalten nur Bestimmungen über
die Errichtung, den Aufbau, das Personal und deren Dienstpflichten sowie deren
Besoldung und Dotation. Die Forschungstätigkeit derartiger
wissenschaftlicher Einrichtungen wird dagegen nicht geregelt.
Der Bund könnte somit – gestützt
auf Art. 10 Abs. 1 Z 13 B-VG – etwa eine ,Versuchsanstalt
für die Klonierung von Tieren‘ einrichten, deren Aufgaben festlegen
und sie organisieren. Die wissenschaftliche Tätigkeit der dort Beschäftigten
kann aber nicht auf diesen Kompetenztatbestand gestützt werden.
e) Länderkompetenzen:
Was die Länderkompetenzen betrifft, so ist in
diesem Zusammenhang auf mehrere Regelungsbereiche hinzuweisen:
aa) Tierzucht:
In erster Linie ist auf die Angelegenheiten der Tierzucht
aufmerksam zu machen, welche grundsätzlich dem Kompetenzbereich der
Länder zugeordnet werden (vgl. zB VfSlg. 2073/1950; vgl. Mayer,
a.a.O., 85). Das Klonieren könnte unter gewissen Gesichtspunkten sehr wohl
der Züchtung und der Reproduktionsgenetik der Tiere zugeordnet
werden. So kann insbesondere der Zuchtfortschritt durch die Vervielfältigung
gentechnisch besonders profilierter Tiere, die anschließend in der
konventionellen Zucht eingesetzt werden, beschleunigt werden, um eine in
Neukombination der Erbanlagen optimierten Genotypen zu erhalten (vgl. dazu das
Gutachten von Prof. Brem, Klonieren und Klone 2). Bestimmte Arten des
Klonierens, zB der Embryonaltransfer, werden schon derzeit
zuchtmäßig im größeren Stil angewendet (geschätzte
Anzahl EU-weit bei zirka 112 000 durchgeführten Embryonaltransfers).
Eine derartige Vorgangsweise, die gewisse Ähnlichkeiten mit der
künstlichen Besamung aufweist, würde dementsprechend unter den
Überbegriff der Tierzucht fallen und daher – was den Aspekt der
Tierzucht anbelangt – vom jeweiligen Landesgesetzgeber zu regeln sein.
bb) Tierschutz:
Der Tierschutz fällt nach der derzeitigen
Kompetenzlage in den Bereich der Länder. Die Entnahme einer Zelle ist dann
kein Tierschutzproblem, sofern dies schmerzfrei durchgeführt wird. Beim
Klonieren kommen zwei verschiedene Tiere in Betracht: einerseits das
Spendertier, dem die Zelle entnommen wird, und andererseits das Leihmuttertier,
welches das geklonte Tier austrägt. Wenngleich auch die Entnahme einer
Zelle beim Spendertier möglicherweise nicht mit Schmerzen verbunden ist,
kann eine weiter Tierschutzproblematik möglicherweise bei dem
Leihmuttertier gegeben, zumal die Geburt des geklonten Tieres für das
Leihmuttertier mit Problemen verbunden sein kann. Insbesondere könnte sich
die artgerechte Haltung der Tiere als Problem herausstellen, wenn durch den
Eingriff beim Spendertier bzw. Leihmuttertier unnötige Qualen
zugeführt werden.
3.
Résumé: Fehlen bzw. Schaffen eines ausdrücklichen
Kompetenztatbestandes:
Ein ausdrücklicher Kompetenztatbestand
,Klonieren‘ findet sich nicht in der geltenden Bundesverfassung.
Es wäre jedoch theoretisch denkbar, einen
solche ausdrücklichen Kompetenztatbestand im B-VG zu schaffen, wie dies
etwa hinsichtlich der Angelegenheiten des ,geschäftlichen Verkehrs mit
Saat- und Pflanzgut‘ geschehen ist (vgl. Art. 10 Abs. 1
Z 12 in der Fassung der B-VG-Novelle BGBl. Nr. 445/1990) oder als
Verfassungsbestimmung. Doch ist in einem solchen Falle zu beachten, daß
diese Verfassungsänderung nicht isoliert zu sehen ist, sondern im Kontext
der Bundesstaatsreform. So etwa wurde im Zusammenhang mit dem diskutierten
Kompetenztatbestand ,Tierschutz‘ von den Ländern (zB vom
Verfassungsdienst des Landes Steiermark) sehr deutlich auf diese
verfassungspolitische Situation hingewiesen.
Im Zusammenhang mit dem Klonieren ist
offensichtlich jedoch nicht daran gedacht, die Verfassung, also das B-VG,
direkt zu novellieren oder eine eigene Verfassungsbestimmung zu schaffen.
4. Vergleichbare
Technologiegesetze:
In den letzten Jahren sind wiederholt neue
Regelungsbereiche auf medizinisch-naturwissenschaftlichem Gebiet aufgetreten,
die kompetenzrechtlich als Querschnittsmaterien qualifiziert wurden. Die diesbezüglichen
Bundesgesetze stützen sich auf eine Reihe unterschiedlicher
Kompetenztatbestände. Im einzelnen ergibt sich diesbezüglich folgende
Übersicht:
Fortpflanzungsmedizingesetz, BGBl. Nr. 275/1992 (RV 216 der Beilagen XVIII GP, AB 4255
Seite 553):
– Angelegenheiten des
Zivilrechtswesens (Art. 10 Abs. 1 Z 6 B-VG)
– Angelegenheiten des
Gesundheitswesens (Art. 10 Abs. 1 Z 12 B-VG).
Tierversuchsgesetz, BGBl. Nr. 501/1989 (gemäß § 1 TVG, RV 707
der Beilagen XVII GP, AB 1019 Seite 111):
– Angelegenheiten des
Hochschulwesens (Art. 14 Abs. 1 B-VG)
– Angelegenheiten der
wissenschaftlichen Einrichtungen des Bundes (Art. 10 Abs. 1 Z 13
B-VG)
– Angelegenheiten des Gewerbes
und der Industrie (Art. 10 Abs. 1 Z 8 B-VG)
– Angelegenheiten des
Gesundheitswesens, des Veterinärwesens und des Ernährungswesens
einschließlich der Nahrungsmittelkontrolle (Art. 10 Abs. 1
Z 12 B-VG)
– Angelegenheiten betreffend
Maßnahmen des Umweltschutzes, soweit der Bund gemäß
Art. 10 Abs. 1 Z 12 B-VG zuständig ist (Art. 10
Abs. 1 Z 12 B-VG).
Soweit das Klonieren rechtlich als Tierversuch
qualifiziert werden kann, gelten hinsichtlich der Zuständigkeitsregelungen
die gleichen Bestimmungen wie für den Tierversuch. Die rechtliche
Qualifizierung des Klonierens als Tierversuch gemäß dem
Tierversuchsgesetz kommt wohl nur insofern in Betracht, als dies für die
wissenschaftliche Forschung unerläßlich ist und dem Tier Belastungen
im Sinne des § 2 TVG mit sich bringt. Möglicherweise jedoch
kommt dem Klonieren von Tieren eine andere Finalität zu, als dies bei den
Tierversuchen der Fall ist. Das legistische Problem, ob eine solche Regelung in
das Tierversuchsgesetz selbst aufgenommen werden sollte oder ob es legistisch
zweckmäßiger wäre, dieses Problem gesondert zu regeln, ist
demgegenüber sekundär.
Gentechnikgesetz, BGBl. Nr. 510/1994 (RV 1465 der Beilagen XVIII GP, AB 1730):
– Angelegenheiten des
Gesundheitswesens (Art. 10 Abs. 1 Z 12 B-VG)
– Angelegenheiten des Gewerbes
und der Industrie (Art. 10 Abs. 1 Z 8 B-VG)
– Angelegenheiten des
Wasserrechtes (Art. 10 Abs. 1 Z 10 B-VG)
– Angelegenheiten des
Hochschulwesens (Art. 14 Abs. 1 B-VG)
– Angelegenheiten der Luftreinhaltung
und der Abfallwirtschaft, soweit der Bund gemäß Art. 10
Abs. 1 Z 12 B-VG zuständig ist (Art. 10 Abs. 1
Z 12 B-VG).
5. Grundrechtsproblematik:
Unabhängig von der Kompetenzzuordnung
eröffnet sich die Frage, inwieweit Grundrechtsprobleme auftreten können.
Insbesondere geht es uns um die Freiheit der Wissenschaft. Maßgebliche
Ausführungen finden sich diesbezüglich bereits in den Materialien zur
Erlassung des Tierversuchsgesetzes.
6. Ressortzuständigkeit:
Von der Kompetenzfrage der Verteilung der Angelegenheiten
zwischen Bund und Ländern ist die Frage nach der Ressortzuständigkeit
zu trennen. Hier geht es weniger um vorgefundene verfassungsrechtliche
Strukturen als vielmehr um das rechtspolitische Problem, welches
Bundesministerium in dem allenfalls zu schaffenden Bundesgesetz mit der
Vollziehung betraut werden soll bzw. welche Einvernehmensregelungen zu
schaffen sein werden.
7. Zusammenfassung:
Abschließend kann gesagt werden, daß
– neben der theoretisch bestehenden Möglichkeit einer
Verfassungsbestimmung – vor allem ein Bundesgesetz in Betracht kommt,
welches sich auf die (im Sinne einer Querschnittsmaterie) bestehenden,
obengenannten Bundeskompetenzen stützt und demnach nur Teilsaspekte des
Klonierens zu regeln vermag. Dieser zweite Weg scheint insbesondere deshalb
gangbar zu sein, weil es bereits eine Reihe moderner Technologiegesetze gibt,
welche sich kompetenzrechtlich auf die Bundesaspekte der jeweiligen
Querschnittsmaterie stützen.”
Das Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft nahm zur Bürgerinitiative betreffend “Klonierungsverbot
von Tieren” wie folgt Stellung:
“1. Unter
einem Klon ist die ungeschlechtlich (= asexuell) entstandene, erbgleiche
Nachkommenschaft aus einem Mutterorganismus zu verstehen. Als Beispiel
wäre etwa die Vermehrung der Erdäpfel mittels Anbau der Knollen zu
nennen. Diese Form der Fortpflanzung wird darüber hinaus von vielen
Mikroorganismen und Einzellern praktiziert. Bei niederen Tieren ist die
Regeneration sogar aus Teilstücken möglich. ,Natürliche
Klone‘ bei den Säugern – und somit auch beim Menschen
– sind die eineiigen Zwillinge bzw. Mehrlinge.
2. In der Humanmedizin liegen die Erwartungen für das Klonen in der
Nutzung transgener Tiere zur Erzeugung von Hormonen, Impfstoffen usw. sowie in
der Xenotransplantation.
In
der Tierzucht kann durch den Einsatz dieser Technologie kaum Fortschritt
erzielt werden, da durch das Klonen nur der momentane Zustand eingefroren und
somit keine züchterische Weiterentwicklung möglich ist. Es ist daher
auch nicht zu erwarten, daß die Klonierung in die Züchtung Eingang
finden wird.
3. Für ein einheitliches Bundesgesetz besteht keine Kompetenzgrundlage;
beim Klonieren handelt es sich vielmehr um eine Querschnittmaterie, die je nach
der Zuständigkeit für die Hauptmaterie vom Bund oder von den
Ländern geregelt werden kann.
4. Abschließend wird bemerkt, daß nach wie vor Zweifel am Bericht
des wissenschaftlichen Journals ,Nature‘ (Nature, Volume 385,
810–813, February 27, 1997 ,Viable offspring derived from fetal and adult
mammalian cells‘), wonach es möglich sein soll, auch Kerne von Feten
und adulten Zellen durch Kerntransfer zur Entwicklung von Embryonen und in
weiterer Folge zu lebensfähigen Individuen anzuregen (,Schaf
Dolly‘), bestehen, da Körperzellen bereits ,ausdifferenziert‘
sind und ihnen erst in einem speziellen Verfahren die Undifferenziertheit
(Totipotenz) von Embryonalzellen zurückgegeben werden muß.
In ihrer Position vom 4. März 1997 bzw.
22. April 1997 hat die Bundesregierung festgehalten, daß in jedem
Fall Österreich an der internationalen Diskussion zur Frage der Klonierung
von Tieren aktiv mit dem Ziel teilnehmen wird, auf EU-Ebene einheitliche,
ethisch begründete Richtlinien zu erarbeiten und umzusetzen. Weiters wird
Österreich auf internationaler Ebene für ein mehrjähriges
Moratorium bei der Anwendung der Klonierung im Nutztierbereich
eintreten.”
Der Bundesminister für Wissenschaft und
Verkehr, Dr. Caspar Einem, richtete hinsichtlich Bürgerinitiative
Nr. 13 betreffend “Klonierungsverbot von Tieren” an den
Präsidenten des Nationalrates eine Stellungnahme folgenden Inhalts:
“Es ist richtig, daß auf Grund der
österreichischen Rechtsordnung kein generell abstraktes Klonierungsverbot
für Tiere besteht. Zu der von den Einbringern der Bürgerinitiative
behaupteten Bundeskompetenz anläßlich einer materiellen Regelung des
Klonierens von Tieren (einschließlich eines Verbotes hiefür) stellt
sich die grundsätzliche Frage, ob diese Angelegenheit im Sinne des
Enumerationsprinzipes den Bundeskompetenzen zugeordnet werden kann, oder ob
nicht vielmehr die Generalklausel des Art. 15 Abs. 1 B-VG zugunsten
der Länderkompetenzen in Betracht zu ziehen ist. Dabei ist insbesondere zu
untersuchen, ob die betreffende neue Sachmaterie nicht auf schon bestehende
Bundes- und Länderkompetenzen verteilt ist. Solche geteilten Materien
sind entweder grundsätzlich allen Kompetenztatbeständen
akzessorisch oder nur im Anhang einiger Hauptmaterien anzutreffen
(,Querschnittsmaterie‘). Von der Kompetenzverteilung der Angelegenheiten
zwischen Bund und Ländern ist die Ressortzuständigkeit zu
trennen. Sie stellt sich (nur) im Falle einer (eindeutigen) Bundeskompetenz, zB
im Falle der Inanspruchnahme einer Bundeskompetenz auf Grund des Vorliegens
einer ,Querschnittsmaterie‘. Im letzteren Fall würde allerdings auch
die Federführung und das Zusammenwirken mehrerer Bundesministerien
bei einer allfälligen Gesetzesvorbereitung noch zu klären sein.
Die Tierversuchskommission im Bundesministerium
für Wissenschaft und Verkehr (Kommission gemäß § 13
Tierversuchsgesetz) ist gegenwärtig damit befaßt, die erforderlichen
Prüfungen vorzunehmen und Stellungnahmen der mitzubefassenden Stellen
einzuholen. Die Tierversuchskommission hat ihre diesbezüglichen
Tätigkeiten noch nicht abgeschlossen.
Es ist weiters auch festzuhalten, daß auch
auf EU-Ebene bisher noch keine das Klonen von Tieren betreffenden
gemeinschaftlichen Regelungen bestehen und kein Klonierungsverbot für
Tiere erlassen wurde.
Auf Grund der unterschiedlichen Bewertung der
neuen Technik wird die EK eine gründliche Analyse der möglichen
Auswirkungen dieser Entwicklungen vornehmen, um die aufgeworfenen Fragen
objektiv und zuverlässig zu struktruieren und zu bewerten. Die neuen
Entwicklungen werden auch dahin gehend zu prüfen sein, welche grundlegenden
neuen Erkenntnisse über die Vorgänge der Zeitdifferenzierung und
Regenerationsfähigkeit von Geweben damit verbunden sind, ob und welche
Beiträge zur Erhaltung der genetischen Vielfalt gefährderter
Tierarten geleistet werden und Therapien für bisher nicht behandelbare
Krankheiten oder Verletzungen entwickelt werden können. Dies wird ua. auch
Aufgabe der von der EK Eingesetzten neuen ,Europäischen Gruppe‘
(Sachverständigengruppe) für Ethik der Naturwissenschaften und der
Neuen Technologien sein, welche die Arbeiten der schon bisher befaßten
Beratergruppe (Group of Advisers to the European Commission on the Ethical
Implication of Biotechnology – GAEIB) fortsetzen wird.
1. Klonen in der Viehwirtschaft
Zur Beurteilung der Frage, ob und inwieweit
,Klonieren‘ als etablierte Methode der Fortpflanzungsbiologie im
Rahmen der Züchtung von Tieren bereits zur Anwendung kommt, ist auf
Bundesebene das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft
zuständig. Da bei der Zuordnung des ,Klonierens‘ bzw.
,Klonens‘ von Tieren von der jeweiligen Finalität auszugehen sein
wird, wäre in diesem Fall als Angelegenheiten der Tierzucht die Kompetenz
der Länder in Gesetzgebung und Vollziehung gegeben.
2. Medizin und Forschung
Auch mit den im Zusammenhang damit auftretenden
Fragen setzt sich derzeit die Tierversuchskommission gemäß
§ 13 Tierversuchsgesetz im Bundesministerium für Wissenschaft
und Verkehr auseinander. Die Diskussion hierüber ist noch nicht
abgeschlossen. Das Verhältnis der Klonierung zum Tierversuch einerseits
und der Klonierung zur landwirtschaftlichen Nutzung, etwa zum Zwecke der
Züchtung von Tieren andererseits, wird dabei zu untersuchen sein. Als
erstes Ergebnis könnte davon ausgegangen werden, daß es sich dann um
einen Tierversuch handeln dürfte, wenn unter der Voraussetzung des
§ 2 Tierversuchsgesetz, BGBl. Nr. 501/1989, experimentelle
Eingriffe an oder Behandlungen von lebenden Wirbeltieren vorgenommen werden,
die für das Tier belastend, insbesondere mit Angst, Schmerzen, Leiden oder
dauerhaften Schäden verbunden sind und das Ziel haben, eine
wissenschaftliche Annahme zu prüfen, Informationen zu erlangen, einen
Stoff zu gewinnen oder zu prüfen oder die Wirkung einer bestimmten
Maßnahme am Tier festzustellen.
Zusammenfassung:
Ein ausdrücklicher Kompetenztatbestand
,Klonieren‘ findet sich nicht in der geltenden Bundesverfassung. Bei
einer Schaffung eines solchen Kompetenztatbestandes im B-VG
(Verfassungsbestimmung) dürfte eine solche Maßnahme nicht isoliert
gesehen werden, sondern wäre im Kontext der Bundesstaatsreform zu
diskutieren. Im Zusammenhang mit dem diskutierten Kompetenztatbestand
,Tierschutz‘ wurde von den Ländern sehr deutlich auf diese
verfassungspolitische Situation hingewiesen.
Sofern in der Bundeskompetenz eine spezielle
(nicht als Tierversuch zu subsumierende) materielle Regelung des
,Klonierens‘ bzw. ,Klonens‘ erfolgen soll, so müßte dies
einem Gutachten des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst zufolge durch
eine bundesgesetzliche Regelung unter Inanspruchnahme der möglichen zur
Regelung einer Querschnittsmaterie in Betracht kommenden
Kompetenztatbestände vorgenommen werden, wobei für diesen Fall in
formaler Hinsicht sich ein eigenes neues Bundesgesetz anböte. Das
Fortpflanzungsmedizingesetz bezieht sich nur auf Human-Fortpflanzung, das
Gentechnikgesetz regelt Gentechnik, wobei Klonieren nicht der Gentechnik
zuzuordnen ist, und das Tierversuchsgesetz könnte entsprechend seinem
Regelungsinhalt nur zur Regelung des ,Klonierens‘ im Zusammenhang
mit einem Tierversuch (nämlich in Vollziehung des Tierversuchsgesetzes) in
Betracht kommen. Wie schon oben ausgeführt, kommt die rechtliche
Qualifizierung des Klonierens als Tierversuch gemäß dem
Tierversuchsgesetz wohl nur insofern in Betracht, als dies für die
wissenschaftliche Forschung unerläßlich ist (§ 3
Tierversuchsgesetz, BGBl. Nr. 501/1989) und dem Tier Belastungen im Sinne
des § 2 Tierversuchsgesetz. BGBl. Nr. 501/1989, mit sich bringt.
Sofern ,Klonieren‘ mit der Finalität
des § 2 Tierversuchsgesetz Anwendung finden soll (siehe oben zu
Z 2), würde schon jetzt ,Klonieren‘ unter das
Tierversuchsgesetz mit seinen inhaltlichen und verfahrensrechtlichen
Bestimmungen fallen und ist die Zulässigkeit bis hin zum Verbot der
Klonierung von Tieren ausschließlich unter den Kriterien des
Tierversuchsgesetzes nach den Voraussetzungen für die Genehmigung eines
Tierversuches von den zuständigen Behörden entsprechend den im
Tierversuchsgesetz festgelegten strengen ethischen Regeln zu beurteilen.
Hiefür – und nur hiefür – ist die Zuständigkeit
entsprechend dem Tierversuchsgesetz (§ 1 bzw. § 21
Tierversuchsgesetz) in dessen Vollziehung gegeben.”
Einstimmiger Beschluß des Ausschusses für Petition und Bürgerinitiativen am
1. Juli 1998:
Ersuchen um Zuweisung an den
Gesundheitsausschuß.
Ausschuß
für innere Angelegenheiten
Bürgerinitiative Nr. 2
eingebracht von Felix M. Bertram betreffend
“ein Bundesgesetz über ein umfassendes Verbot von
Antipersonenminen (Verbot von Erzeugung, Lagerung, Beschaffung, Einsatz,
Handel, Aus-, Ein- und Durchfuhr)”
Zum Anliegen der gegenständlichen
Bürgerinitiative wurde folgendes ausgeführt:
“Mit der Beschlußfassung eines
Bundesgesetzes über ein umfassendes Verbot von Antipersonenminen
würde der Nationalrat einen wichtigen Beitrag zu den weltweiten
humanitären Bemühungen für ein Verbot dieser grausamen und
heimtückischen Waffen leisten, und Österreich würde damit zu den
ersten Ländern gehören, die durch nationale Gesetzgebungen in diesem
Sinn wirkungsvolle Maßnahmen ergreifen.
In den Schriften der ,Österreichischen
Kampagne gegen Personenminen‘ und in vielen Artikeln und Fernsehberichten
sind die entsetzlichen Auswirkungen von Antipersonenminen auf die
Zivilbevölkerung in vielen Teilen der Welt beschrieben worden, und die
Dringlichkeit von nationalen und internationalen Verboten ist begründet
worden.
Auf dem beiliegenden Blatt wird durch Hinweis auf
entsprechende österreichische Bundesgesetze der Nachweis erbracht,
daß ein Verbot von Antipersonenminen in Gesetzgebung und Vollziehung eine
Bundessache ist.
Die Initiatorinnen und Initiatoren der Bürgerinitiative
haben einige Bemerkungen zur Ausarbeitung des beantragten Bundesgesetzes
verfaßt. Dabei wurde auf den vor kurzem fertiggestellten Entwurf des
Österreichischen Roten Kreuzes Bezug genommen. Diese Bemerkungen werden
als Beilage übermittelt. Sie sind als Unterlage für die Behandlung
der Bürgerinitiative im Ausschuß des Nationalrates für
Petitionen und Bürgerinitiativen bzw. in einem Fachausschuß
gedacht.”
Der Bürgerinitiative war folgender Text
beigefügt:
“Bemerkungen zur Ausarbeitung eines Bundesgesetzes
über ein umfassendes Verbot von Antipersonenminen, vorgelegt von der
Österreichischen Kampagne gegen Personenminen in Verbindung mit der
Einbringung der Bürgerinitiative im Nationalrat am 29. März
1996.
1. Die
,Österreichische Kampagne gegen Personenminen‘ (im folgenden kurz:
,Kampagne‘) erachtet den ,Entwurf des Österreichischen Roten Kreuzes
für ein österreichisches Bundesgesetz über das Verbot von
Antipersonenminen‘ (überarbeitete Fassung, März 1996) für
eine sehr geeignete Grundlage, um in dem damit betrauten
Parlamentsausschuß mit der Ausarbeitung des Gesetzes zu beginnen. Diese
Einschätzung ergibt sich insbesondere auf Grund der in § 2
Abs. 1 des Entwurfes formulierten Verbotsbestimmung, die ,Beschaffung,
Verkauf, Ein-, Aus- und Durchfuhr, Gebrauch und Besitz von Antipersonenminen
und Antiortungsmechanismen sowie von Teilen derselben‘ betrifft.
2. Die Kampagne
macht auf die Notwendigkeit aufmerksam, bei der Ausarbeitung der Definition von
,Antipersonenminen‘ (§ 1 Abs. 1) die Frage der Richtsplitterladungen
zu berücksichtigen. In Österreich wurden bzw. werden einige Arten von
Richtsplitterladungen erzeugt. Hinsichtlich der im Bundesgesetz festzulegenden
Definitionen sind die Unterschiede im Auslösungsmechanismus wesentlich.
Folgende Arten von Auslösemechanismen sind zur Anwendung gekommen:
Stolperdraht, Infrarotsensoren, Zündung durch Fernsteuerung, dh. bei
Beobachtung der Annäherung einer Person (von Personen) an die aufgestellte
Richtsplitterladung wird der Befehl zur Zündung ausgesendet.
Nach
den in internationalen Abkommen verwendeten Definitionen (siehe
,Übereinkommen über das Verbot oder die Beschränkung bestimmter
konventioneller Waffen, BGBl. Nr. 464/1983‘) gehören
Vorrichtungen, die bei Berührung oder Annäherung einer Person
detonieren, zu den ,Antipersonenminen‘, hingegen gelten
ähnliche Waffen, deren Detonation durch Fernsteuerung ausgelöst wird,
als ,andere Vorrichtungen‘. Aus den international verbreiteten
Handbüchern und Dokumentationen ist ersichtlich, daß in Österreich
längere Zeit Richtsplitterladungen erzeugt wurden, bei denen
Auslösung auf verschiedene Weise möglich war, zB sowohl durch
Stolperdraht wie durch Fernbefehle. Derartige Waffen sind gewiß als
Antipersonenminen zu klassifizieren.
Von
den Vertretern der Erzeugerfirmen wird nun in letzter Zeit behauptet, daß
jetzt nur noch Richtsplitterladungen mit Detonation durch Fernbefehl erzeugt
werden, daß es sich bei der österreichischen Erzeugung also nicht um
Antipersonenminen handle. Hier ist aber darauf hinzuweisen, daß ein Umbau
von Richtsplitterladungen mit einem Auslösemechanismus einer Art (zB durch
Fernbedienung) in eine mit einem anderen Mechanismus (durch Stolperdraht oder
Infrarotsensoren) in praktisch allen Fällen ohne großen Aufwand
möglich wäre. Die in einem österreichischen Werk gefertigten
Richtsplitterladungen könnten das Werk oder österreichisches Gebiet
also in Form einer ,anderen Vorrichtung‘ verlassen, dann aber in
Antipersonenminen umgebaut werden und in dieser Form zum Einsatz gelangen.
Daraus
folgt: Soll ein wirklich umfassendes Verbot von Antipersonenminen ausgearbeitet
werden, das natürlich auch einen Export der betreffenden
Militärtechnik zu verbieten hätte, so muß die Definition von
Antipersonenminen im Gesetz so formuliert werden, daß alle Arten von Richtsplitterladungen
unter das Verbot fallen. Es dürften keine Formulierungen verwendet werden,
bei denen zwischen mehr oder weniger einfachen Formen der Anbringung eines
Auslösemechanismus bzw. der Modifikation einer Richtsplitterladung
unterschieden wird.
Die
entsprechende Stelle im Gesetzentwurf des Roten Kreuzes bedarf unter diesem
Gesichtspunkt einer genauen Überprüfung bzw. Korrektur. Jedenfalls
wäre die Streichung der Worte ,ohne weiteres‘ (in § 1
Abs. 1 4. Zeile) und die Weglassung der Ausnahmebestimmung in
§ 3 Abs. 1 letzter Satz, zu empfehlen.
Nach
Meinung der Kampagne ist die Frage dieser Formulierungen auch in Zusammenhang
mit der Absicht zu sehen, ein österreichisches Bundesgesetz mit
Vorbildwirkung für die Gesetzgebung anderer Staaten zu schaffen. Dies wird
nur erreicht werden, wenn das Verbot von Antipersonenminen wirklich umfassend
ist und nicht der Eindruck entstehen kann, daß der österreichische
Gesetzgeber den Wünschen erzeugender Firmen nachgekommen ist, indem
Bestimmungen so formuliert wurden, daß es sich nicht mehr um ein wirklich
umfassendes Verbot von Antipersonenminen handelt.
3. Eine bestimmte Anzahl von
,Antipersonenminen‘ und ,Antiortungsmechanismen‘ für Zwecke
der Ausbildung zur Minendetektion, Minenräumung und Minenvernichtung in Österreich
zur Verfügung zu haben, ist eine berechtigte Forderung der für diese
Tätigkeiten verantwortlichen staatlichen Stellen. Dies wird in
§ 3 Abs. 2 des vom Roten Kreuz ausgearbeiteten Gesetzentwurfes
berücksichtigt. Der Wortlaut dieses Absatzes sollte jedoch unter
Berücksichtigung einiger Gesichtspunkte überprüft werden:
a) Der Zweck dieser
Ausnahmeregelung vom umfassenden Verbot (des § 2) sollte klarer
ausgedrückt werden. Es soll sich nicht um die Zurverfügungstellung
für ,Ausbildungs, Übungs- und Testzwecke‘ handeln,
vielmehr geht es um Ausbildung für Zwecke der Minendetektion,
Minenräumung und Minenvernichtung bzw. Unschädlichmachung (Zerlegung)
von Minen.
b) Solche Ausbildungsaufgaben sind nicht
nur als Aufgabe des Bundesheeres anzusehen, sie können auch sehr wohl von
anderen staatlichen Stellen bzw. unter deren Anleitung durchgeführt
werden. Hier ist insbesondere an Lehrgänge für Minendetektion und
Minenräumung in den heute von ungeräumten Minen am meisten
betroffenen Entwicklungsländern zu denken. Die heute dort tätigen
Minenräumer sind vor allem in nichtmilitärischen Einrichtungen
ausgebildet worden. Daher sollten in diesem Absatz des Gesetzes andere
staatliche Organe ausdrücklich genannt werden.
c) Der Gesetzgeber sollte eine
zahlenmäßige Begrenzung für den Besitz von Antipersonenminen
und Antiortungsmechanismen im Gesetz festlegen und nicht durch die Worte ,in
angemessener Stückzahl‘ auf eine solche Festlegung verzichten. Dabei
wird zu berücksichtigen sein: Es werden kleine Stückzahlen ausreichend
sein, insbesondere weil die Ausbildung in Minendetektion und Minenräumung
in erster Linie mit Attrappen erfolgen kann, dh. mit Vorrichtungen ohne Sprengstoff,
die jedoch mit einer geeigneten Anzeige über das Wirksamwerden des
Auslösemechanismus ausgestattet sein können. Solche Anzeigen
können so konstruiert werden, daß durch sie keine mit der Attrappe
hantierende Person verletzt wird. Auf diese Möglichkeit wäre in den
Erläuterungen zum Gesetz ausdrücklich hinzuweisen.
4. Der
Gesetzgeber wird wie bei jeder Waffenbegrenzung bzw. jedem Waffenverbot zu
prüfen haben, was die Auswirkung des hier beantragten Gesetzes auf die
Sicherheitslage Österreichs sein werden. Da Antipersonenminen vom
Bundesheer überhaupt nicht zur Verwendung vorgesehen sind und auch die in
Punkt 2 dieser Stellungnahme erörterten Richtsplitterladungen mit
Fernauslösung nur eine ganz nebensächliche Rolle in den Plänen
des Bundesheeres spielen, wird das umfassende Verbot von Antipersonenminen und
Antiortungsmechanismen keine negativen Auswirkungen auf die Sicherheit des
Landes haben. Vielmehr wird der Beschluß des Gesetzes beweisen, daß
Österreich mit Konsequenz zur Abschaffung derartig grausamer, vor allem
die Zivilbevölkerungen treffender Waffen beitragen will, und es wird so
den weltweiten Bemühungen für ein Verbot der Antipersonenminen einen
wichtigen Dienst erweisen.”
Einstimmiger Beschluß in der Ausschußsitzung am 3. Juli 1996:
Ersuchen um Zuweisung an den Ausschuß
für innere Angelegenheiten.
Ausschuß
für innere Angelegenheiten
Bürgerinitiative Nr. 9
eingebracht von Christian Mokricky
betreffend “Freiheit für das Gewissen”
Für die Neufassung des Zivildienstgesetzes
fordern die UnterzeichnerInnen dieser Bürgerinitiative von den
Parlamentsabgeordneten:
“– Keine
Einschränkung der Gewissensfreiheit. Die Abgabe einer
Zivildiensterklärung muß jederzeit möglich sein!
– Gleiche Dauer von Wehr- und
Zivildienst (= acht Monate)!
– Der Aufschub aus Gründen
der Berufsausbildung muß bleiben – jetzige Regelung beibehalten!
– Gleiche Entlohnung von Wehr-
und Zivildienern!”
Der gegenständlichen Bürgerinitiative
war folgende “Politische Vorbemerkung” und sogenannte
“Rechtliche Begutachtung” angeschlossen.
“Politische Vorbemerkung
Der vorliegende Beamtenentwurf zu einer
ZDG-Novelle entspricht dem Koalitionsübereinkommen. Insgesamt wird damit
die Schlechterstellung der Zivildiener institutionalisiert. Der um die
Hälfte längere Dienst, die schlechtere Bezahlung und die Schikanen im
Zugang zum Zivildienst sind die offensichtlichsten Punkte dieser Benachteiligung
der Gewissensverweigerer. Aber auch zahlreiche Bestimmungen im Detail
befestigen den Zivildienst als Ersatzwehrdienst und geben keinen Raum für
die Entwicklung alternativer Ansätze zu militärischer
Konfliktlösung, die den Gewissensgründen vieler Wehrdienstverweigerer
entgegenkämen.
Zugang und Antragfristen:
Die Wehrpflichtigen, die aus Gewissensgründen
den Wehrdienst verweigern wollen, werden mit einem Fristendschungel
konfrontiert, der nur für juristisch vorgebildete Personen
verständlich ist:
– neu gemusterte
Wehrpflichtige sind mit einem unbestimmten Fristende konfrontiert. Der Erhalt
des Einberufungsbefehls zum Wehrdienst ist keinem Betroffenen bekannt. Der Tag
vor Erhalt des Einberufungsbefehls als Ende der Zivildienstantragsfrist schafft
ein unerträgliches Informationsgefälle zwischen Behörde und
Staatsbürger. In jedem anderen Behördenverfahren ist eine derartige
unbestimmte Frist unvorstellbar.
– Die Regelung betreffend der
im Aufschub befindlichen wehrpflichtigen Gewissensverweigerer ist völlig
willkürlich. Nicht die Gewissensgründe geben den Ausschlag für
die Zugangsmöglichkeit, sondern sogenannte militärische
Notwendigkeiten. Altfälle, die vor dem 1. Jänner 1992 gemustert
wurden, sind von jedem Antragsrecht ausgeschlossen. Jene, die nach dem
1. Jänner 1992 tauglich wurden, können genau fünf Jahre
nach dem Tauglichkeitsbescheid sechs Wochen lang erneut eine
Zivildiensterklärung einbringen. Sie müssen allerdings erfahren wann.
Das heißt, alle die älter als 22 bis 23 Jahre alt sind, bleiben
von der Gewissensfreiheit ausgeschlossen.
Die Informationspflicht über die
Antragsfristen hat in den Beamtenentwurf Eingang gefunden. Kommen die
Militärbehörden dieser nicht oder nur mangelhaft nach, fehlt jedoch
jegliches Durchsetzungsinstrument für den Betroffenen.
Verlängerung des Zivildienstes auf
zwölf Monate:
De facto wird der Zivildienst auf zwölf
Monate verlängert. Sowohl die Einrichtung von Dienstfreistellungen
als auch von kurzen Krankheiten in den 14tägigen Urlaubsanspruch führt
diesen Anspruch selbst ad absurdum. Der 14tägige Urlaub ist die
Mogelpackung, um die drohende Zivildienstdauer von zwölf Monaten zu
verdecken.
Wir rufen in Erinnerung, welche
Verschärfungen des Zivildienstrechtes von der SPÖ in Kauf genommen
wurden, um eine Zivildienstdauer von zwölf Monaten zu verhindern. Vor
diesem Hintergrund ist das Resultat jetzt als niederschmetterndes Ergebnis
visionsloser sozialdemokratischer Rückzugsstrategien zu würdigen. Der
europäische Vergleich der Relationen von Wehr- und Zivildienstlänge
unterstreicht dieses Urteil. In diesem Lichte wird das weitergehende
Drängen der ÖVP, insbesondere von Verteidigungsminister
Fasslabend, auf weitere Zivildienstverlängerungen als illiberal und
rückschrittlich entlarvt.
Die Erweiterung der Einsatzgebiete auf Umwelt,
Kinder und Jugendliche ist als Ansatz für einen alternativen Zivildienst
zu begrüßen. Solange es jedoch gleichzeitig Dienstleistungen bei der
Polizei gibt, kann keineswegs von einem alternativen Friedensdienst, wie ihn
der Internationale Zivildienst seit langem fordert, gesprochen werden.
Rechtliche Begutachtung
Zugang, Fristen, Gewissensfreiheit
(§§ 2, 76a, 5, 5a)
Das Grundrecht auf Befreiung von der Wehrpflicht
durch Einbringung einer Zivildiensterklärung wird wieder grundsätzlich
allgemein und unbefristet gewährleistet (§ 2 Abs. 1). Das
Recht kann aber – einfachgesetzlich – ausgeschlossen werden
(§ 2 Abs. 3); es ruht in einer Frist, die frühestens sechs
Monate nach Rechtskraft des Stellungsbeschlusses, sonst am Tag vor einer Einberufung
zum Präsenzdienst beginnt und mit dem Ende der Einberufung endet
(§ 2 Abs. 2). Das Grundrecht wird weiters erheblich dadurch
eingeschränkt, daß Wehrpflichtige, die vor 1992 für
,tauglich‘ befunden wurden und seither tauglich sind, überhaupt
ausgeschlossen sind und Wehrpflichtige, die danach bis 1. Jänner 1994
,tauglich‘ wurden, das Grundrecht nur innerhalb einer bestimmten
Sechswochenfrist ausüben können (§ 76a Abs. 1).
Damit wird, wie auch die Erläuterungen
bemerken, die Möglichkeit der Befreiung von der Wehrpflicht nach einer
Gewissensentwicklung durch eine Verfassungsbestimmung ausgeschlossen, um die
Überprüfung durch den Verfassungsgerichtshof zu verhindern. Das
zeugt nicht nur von einem geringen Verfassungsethos, sondern auch von einem
leichtfertigen Umgang mit Grundrechten und mit dem Grundsatz der
Rechtsstaatlichkeit.
Eine Frist, die durch eine rückläufige
Frist ausgelöst wird, ist ungewöhnlich und führt zu erheblicher
Rechtsunsicherheit. Das fristauslösende Ereignis ist für den
Berechtigten nicht vorhersehbar. Daran ändert auch die – im
übrigen sanktionslose – Informationspflicht der Stellungskommission
(§ 5 Abs. 1) nichts, da ihr schon durch die Angabe
,frühestens in vier Wochen, in der Regel bis zu Vollendung Ihres 30.,
spätestens Ihres 35. Lebensjahres haben Sie mit der Einberufung
zu rechnen‘ genügt wird. Überhaupt ist das Abstellen auf die
,Einberufung‘ problematisch. ,Einberufung‘ ist der Vorgang, mit dem
der Wehrpflichtige verpflichtet wird, zu einem bestimmten Zeitpunkt
(Einberufungstermin) und an einem bestimmten Ort seinen Präsenzdienst
anzutreten (§ 35 WG). Sie erfolgt durch Bescheid des
Militärkommandos (Einberufungsbefehl) oder Verordnung des
Bundesministers für Landesverteidigung (allgemeine Bekanntmachung).
Nur ausnahmsweise, bei kurzfristigen Truppen- oder Kaderübungen, wird die
Dauer des Präsenzdienstes im Einberufungsbefehl verfügt, in der Regel
endet der Präsenzdienst durch einen gesonderten Bescheid
(Entlassungsbefehl; § 39 WG). Der vorliegende Entwurf läßt
offen, ob das Grundrecht ab Einleitung des Verfahrens zur Erlassung des
Einberufungsbefehls, mit dessen Rechtskraft oder dem Inkrafttreten der
allgemeinen Bekanntmachung oder aber mit dem Einberufungstermin ruht und ob es
mit dem dem Einberufungstermin folgenden Tag oder erst mit der Entlassung aus
dem Präsenzdienst wieder ausgeübt werden kann. Daß diese
Bestimmung im Verfassungsrang steht, hat wohl auch den Grund, eine
Überprüfung durch den Verfassungsgerichtshof in Hinblick auf das
Bestimmtheitsgebot des Art. 18 Abs. 1 B-VG auszuschließen. Das
wird zu einer vermeidbaren Belastung des Verfassungsgerichtshofes, der
über die Interpretation zu entscheiden hat, führen.
Auch die Möglichkeit, das Recht auf
Einbringung der Zivildiensterklärung durch einfaches Gesetz auszuschließen,
birgt erhebliche Probleme. Es stellt sich nämlich die Frage nach dem
Wesensgehalt des Rechts auf Befreiung von der Wehrpflicht. Über diesen
wird – vermeidbar – der Verfassungsgerichtshof zu entscheiden
haben. Die derzeitige Regelung, die Angehörige von Wachkörpern, auch
unbewaffnete, erfaßt, den Exekutivdienst versehende, bewaffnete
rechtskundige Beamte der Sicherheitsbehörden jedoch nicht (§ 5a
Abs. 1 Z 2), ist jedenfalls unsachlich.
Die Möglichkeit, Zivildienstwerber, die den
Grundwehrdienst vollständig geleistet haben, innerhalb eines Jahres
ausschließlich im Verteidigungs- oder Bürgerkriegsfall
(Einsatzpräsenzdienst) und zur Drohung mit dem kriegerischen Einsatz durch
Manöver (außerordentliche Übungen) einzuberufen (§ 5
Abs. 2), steht in auffallenden Widerspruch zum Zweck der Befreiung von der
Wehrpflicht, nämlich der Vermeidung von Straftaten aus der Gewissensnot
bei Anwendung von Waffengewalt gegen Menschen.
Dauer des ordentlichen
Zivildienstes (§ 7)
Der ordentliche Zivildienst dauert ein Jahr
(§ 7 Abs. 2), also um die Hälfte länger als der
ordentliche Präsenzdienst. Damit wird gegen die völkerrechtliche
Verpflichtung des Verbotes der Zwangs- und Pflichtarbeit (Art. 4 EMRK)
verstoßen. Ersatzdienst der Verweigerer aus Gewissensgründen
für verpflichtenden Wehrdienst ist zwar vom Verbot ausgenommen, jedoch
darf der Verweigerer nur für die Dauer des Wehrdienstes zu Zwangsarbeit
angehalten werden. Der Zivildienst ist, da strafsanktioniert, jedenfalls
Pflichtarbeit, deren längerer Dauer wegen der Möglichkeit des
außerordentlichen Zivildienstes auch keinerlei Vorteile gegenüber
den Wehrdienst bringt und daher nicht als freiwillig angesehen werden kann.
Die Regelung über die Dauer des ordentlichen
Zivildienstes jener Zivildienstpflichtigen, die bereits Präsenzdienst
geleistet haben (§ 7 Abs. 2), ist außerordentlich schwer
verständlich und vage. Das ist im Lichte des Bestimmtheitsgebotes des
Art. 18 Abs. 1 B-VG aber auch des Gleichheitssatzes des Art. 7
Abs. 1 B-VG bedenklich.
Sonstiges
Zuweisung (§ 8)
An die Stelle des bisherigen Rechts auf Erlassung
des Zuweisungsbescheides mindestens vier Wochen vor dem Zuweisungstermin
(parallel zu § 35 Abs. 1 Z 1 WG) tritt eine
Ordnungsvorschrift, nach der der Zuweisungsbescheid sechs Wochen vor dem Zuweisungstermin
zu genehmigen und unverzüglich die Zustellung zu verfügen sei
(§ 8 Abs. 2). Ein schriftlicher Bescheid wird erst durch seine
Zustellung erlassen (§§ 62 Abs. 1, 18 Abs. 3, 21 AVG).
Dabei kommt es darauf an, daß der Bescheid dem Adressaten überhaupt
zugänglich werden kann, mithin stellt das Zustellgesetz auf die
regelmäßige Benutzung der Abgabestelle ab und rechnet die
Tätigkeit des Zustellorgans der bescheiderlassenden Behörde zu.
Weiters ist die Bescheiderlassung, sohin die Zustellung, alleine
maßgebend für den Eintritt der Rechtskraft (§§ 63
Abs. 5, 68 Abs. 2 bis 5, 69 Abs. 1, 71 Abs. 1 AVG). Ein
Instanzschluß wie in § 416 Abs. 2 ZPO ist im AVG
nicht vorgesehen, die Verwaltungsbehörde soll sich rasch auf
veränderte Bedingungen einstellen können. Für diese Grundsätze
des Verwaltungsverfahrens erachtete der Bundesgesetzgeber ein Bedürfnis
nach einheitlichen Vorschriften als gegeben. Er darf daher in seinen
Materiegesetzen nur dann davon abweichen, wenn dies zur Regelung des
Gegenstandes durch besondere Umstände unerläßlich ist. Davon
kann im Fall des Zuweisungsbescheides nicht die Rede sein. Die vorgesehene
Bestimmung verstößt daher gegen Art. 11 Abs. 2 B-VG. Zudem
ist der Eintritt der Rechtsfolge des Zuweisungsbescheids, nämlich des
Antritts und der Leistung des Zivildienstes, in hohem Maße von bloß
manipulativen Umständen (Postlauf) abhängig, damit steht diese
Regelung in Widerspruch zum Sachlichkeitsgebot des Art. 7 Abs. 1
B-VG.
In gleicher Weise ist das Abstellen auf die
Genehmigung des Zuweisungsbescheides für andere Zivildienstpflichtige
beim Antrag des Rechtsträgers auf Zuweisung (§ 10 Abs. 2)
verfassungsrechtlich bedenklich.
Versetzung (§ 19)
In Zweifelsfällen hat sich die
Bezirksverwaltungsbehörde über die gesundheitliche Eignung des
Zivildienstleistenden vor dessen Versetzung zu äußern
(§ 19 Abs. 2). Sie hat damit an der Willensbildung des
Bundesministers für Inneres mitzuwirken. Ihre Stellung im
Versetzungsverfahren ist unklar, sie könnte – ohne den erforderlichen
Sachverstand des den Willen bildenden Organs – Sachverständiger,
Organpartei oder aber zweite bescheiderlassende Behörde sein. Das ist im
Licht der Kompetenzbestimmungen des § 1 und des Art. 102
B-VG aber auch des einheitlichen Verwaltungsverfahrens nach Art. 11
Abs. 2 B-VG bedenklich. Die bisherige gesetzliche Regelung des dem
Bundesminister für Inneres zur Verfügung stehenden
Amtssachverständigen (§ 52 Abs. 1 AVG) ist vorzuziehen.
Urlaub
(§ 23a)
Über den Zeitraum des Erholungsurlaubes ist
ein Vertrag zwischen dem Zivildienstleistenden und seinen Vorgesetzten, nicht
aber ein Recht des Zivildienstleistenden vorgesehen (§ 23a
Abs. 3). Das erscheint in Hinblick auf das hoheitliche Verhältnis
zwischen dem durch den Vorgesetzten handelnden Rechtsträger und dem
Zivildienstleistenden verfassungsrechtlich bedenklich.
Vertrauensarzt
(§ 23c)
Die Pflicht, die Weisung, sich im Falle jedweder
Dienstverhinderung der Untersuchung durch den Vertrauensarzt – der
weiterhin der Verschwiegenheitspflicht unterliegt – der Einrichtung zu
unterziehen (§ 23c Abs. 2 Z 3), zu befolgen, ist sachlich
nicht gerechtfertigt. Damit könnte auch unmenschliche oder erniedrigende
Behandlung verbunden sein. Beides ist verfassungsrechtlich bedenklich.
Verpflegungsabfindung
(§ 28)
Die Bezirksverwaltungsbehörde hat der
Abfindung für die Verpflegung des Zivildienstleistenden bei einer
Dienstverhinderung durch Krankheit über vier Tage mit Bescheid zuzustimmen
(§ 28 Abs. 3). Da die Rechtskraft dieses Bescheides von
manipulativen Umständen abhängt und bis dahin der Zivildienstleistende
die Kosten seiner Verpflegung selbst zu tragen hat, erscheint diese Bestimmung
im Licht des Gleichheitssatzes (Art. 7 Abs. 1 B-VG) bedenklich.
Reinigung der
Bekleidung (§ 30)
Daß für die Reinigung der Bekleidung
des Zivildienstleistenden der Bund oder Rechtsträger der Einrichtung nur
in den Fällen außergewöhnlicher Verschmutzung durch die
Dienstleistung oder den Einsatz aufzukommen hat (§ 30), ist, da
einerseits zufallsabhängig und andererseits Präsenzdienern die
Dienstkleidung in jedem Fall gereinigt wird, ebenfalls gleichheitswidrig.
Übergangsbestimmungen
(§§ 76b, 76c)
Durch einfaches Gesetz (§ 76b
Abs. 2) wird die Anwendung der Verfassungsbestimmungen des Ruhens des
Rechts auf Einbringung der Zivildiensterklärung und Eintritt der
Zivildienstpflicht von Wehrpflichtigen, die den Grundwehrdienst
vollständig geleistet haben, erst binnen Jahresfrist sowie der
Ausschluß vom Recht auf Befreiung von der Wehrpflicht von vor 1994
für ,tauglich‘ befundenen Wehrpflichtigen angeordnet. Das ist einerseits
unklar und andererseits außerhalb der Kompetenz des einfachen
Gesetzgebers. Damit wird gegen Art. 18 Abs. 1 B-VG verstoßen.
Rückwirkend wird das Inkrafttreten der
ZDG-Nov 1994, die am 10. März 1994 im Bundesgesetzblatt herausgegeben
und versendet worden ist und somit am 11. März 1994 seine verbindende
Kraft erhalten hat, mit 10. März festgesetzt (§ 76c
Abs. 1 und 2). Damit soll das vom Verfassungsgerichtshof festgestellte
Ende der Monatsfrist zur Einbringung der Zivildiensterklärung von
Wehrpflichtigen, die vor 1994 ,tauglich‘ wurden, um einen Tag
verkürzt werden. Das ist ein Mißbrauch der Kompetenz zu
Verfassungsänderungen.”
In der Ausschußsitzung am 7. Mai 1997
wurde bezüglich der gegenständlichen Bürgerinitiative
beschlossen, je eine Stellungnahme des Bundesministeriums für Inneres
sowie des Bundesministeriums für Landesverteidigung einzuholen.
Zu der
gegenständlichen Bürgerinitiative betreffend “Freiheit für
das Gewissen!” wurde vom Bundesministeriums für Inneres wie
folgt Stellung genommen:
“Durch die mit
Jahresbeginn in Kraft getretene umfassende Novellierung des Zivildienstgesetzes
ist eine weitgehende Liberalisierung des Zuganges zum Zivildienst erfolgt. Das
Recht, eine Zivildiensterklärung abzugeben, besteht nun zumindest sechs
Monate ab Abschluß des Stellungsverfahrens. Auch danach können
Wehrpflichtige eine Zivildiensterklärung bis zwei Tage vor einer
Einberufung zum Präsenzdienst abgeben. Im Anschluß daran ruht das
Erklärungsrecht und lebt nach Behebung des Einberufungsbefehls oder nach
Entlassung aus dem Präsenzdienst wieder auf. Auch für
“Altfälle” – also Wehrpflichtige, deren Tauglichkeit vor
dem 1. Jänner 1994 festgestellt worden ist – wurde eine
nochmalige Möglichkeit zur Abgabe einer Zivildiensterklärung
vorgesehen.
Diese Regelungen der
ZDG-Novelle 1996, BGBl. Nr. 788, tragen somit einem nach der Stellung
eingetretenen Gewissenswandel Rechnung. Ein während des
Präsenzdienstes bestehendes Erklärungsrecht ist jedoch unter
Bedachtnahme auf Erfordernisse der militärischen Landesverteidigung nicht
möglich und daher auch in den meisten anderen europäischen Staaten
nicht vorgesehen.
Durch die Liberalisierung
des Zuganges zum Zivildienst wurde jedenfalls – wie auch zahlreiche dem
Bundesministerium für Inneres zugegangene Schreiben beweisen – einem
wesentlich größeren Anliegen entsprochen, als es die Angleichung der
Dauer von Zivildienst und Präsenzdienst darstellt. Diese gleiche Dauer war
im übrigen nur zur Zeit der “Gewissensprüfung” durch die
Zivildienstkommission möglich, deren Rückkehr jedoch von niemandem
mehr gewünscht wird.
In der ZDG-Novelle 1996
ist zwar – für Präsenzdiener und Zivildiener in gleicher Weise
– eine Beschränkung der Aufschubmöglichkeit vorgesehen worden,
durch entsprechende Ausrichtung der auch weiterhin bestehenden Aufschubmöglichkeit
wurde aber sichergestellt, daß in die Lebensplanung des Betroffenen so
wenig wie möglich eingegriffen wird. Die durch diese Neuordnung
angestrebte möglichst rasche Umsetzung der nach Abschluß der
Stellung vom Wehrpflichtigen getroffenen Entscheidung ist nicht zuletzt im
Interesse der Betroffenen selbst gelegen, da die Dienstleistung im Alter der
Stellungspflicht offensichtlich leichter fällt, als in späteren
Jahren, etwa nach Abschluß eines Hochschulstudiums. Häufig werden
dann nach in der Zwischenzeit erfolgten Familiengründungen auch
Angehörige durch die Verzögerung der Erfüllung der Dienstpflicht
in Mitleidenschaft gezogen. Für den Fall, daß eine rasche Zuweisung
aus vom Zivildienstpflichtigen nicht zu vertretenden Gründen nicht
möglich ist, besteht auch weiterhin die Möglichkeit, für den
Abschluß einer mittlerweile begonnenen Ausbildung Aufschub zu erhalten.
Eine generelle Anhebung
der den Zivildienstleistenden gebührenden Pauschalvergütung und somit
auch eine zuletzt nicht mehr im vollen Umfang gegebene Gleichstellung in
finanziellen Belangen gegenüber den Präsenzdienstleistenden ist
jedenfalls wünschenswert und angesichts der im ordentlichen Zivildienst
erbrachten Leistungen auch als gerechtfertigt anzusehen. Das Bundesministerium
für Inneres wird um eine solche Erhöhung, die leider im Zuge der
parlamentarischen Behandlung der letzten ZDG-Novelle nicht durchgesetzt werden
konnte, weiterhin bemüht sein.”
Vom Bundesministeriums
für Landesverteidigung ist zu der Bürgerinitiative betreffend
“Freiheit für das Gewissen” wie folgt Stellung genommen
worden:
“Die in der
gegenständlichen Bürgerinitiative enthaltenen Anliegen wurden im
Rahmen der Begutachtung bzw. der parlamentarischen Behandlung der
Zivildienstgesetznovelle 1996 im Herbst 1996 erschöpfend erörtert und
letztlich einer – im Gegensatz zu früheren ZDG-Novellen – unbefristeten
gesetzlichen Regelung zugeführt, die am 30. Dezember 1996 unter
der BGBl. Nr. 788 kundgemacht wurde.
Die gegenständliche,
im Juni 1996 unterzeichnete Bürgerinitiative erscheint somit durch den
vorerwähnten Gesetzesbeschluß obsolet. Eine inhaltliche
Stellungnahme zu den einzelnen Forderungen der Unterzeichner dieser Initiative
erübrigt sich daher.”
In der
Ausschußsitzung am 26. November 1997 wurde hinsichtlich dieser
Bürgerinitiative der einstimmige Beschluß gefaßt:
Ersuchen um Zuweisung an
den Ausschuß für innere Angelegenheiten.
Justizausschuß
Bürgerinitiative Nr. 3
eingebracht von Herrn
Heinz Schubert betreffend “die rechtliche und soziale
Gleichstellung homosexueller Menschen”
Die gegenständliche
Bürgerinitiative war wie folgt dargestellt:
“Seitens der
EinbringerInnen wird das Vorliegen einer Bundeskompetenz in folgender Hinsicht
angenommen:
Vorschriften, die die Gleichbehandlung von
Minderheiten und Angehörigen der Mehrheit gebieten bzw. die
Diskriminierungen verbieten, stellen sich im wesentlichen als spezifische
Ausprägungen des Gleichbehandlungsgrundsatzes gemäß Art. 7
B-VG dar. Schwule Männer und lesbische Frauen sind als qualifizierte
Minderheit anzusehen, da davon auszugehen ist, daß rund 6% bis 10% aller
Menschen eine ausschließlich homosexuelle Orientierung aufweisen.
Obwohl außer Streit
steht, daß eine homosexuelle Orientierung weder ein
(psycho-)pathologischer oder genetischer Defekt (die
Weltgesundheitsorganisation WHO hat mit Wirkung vom 1. Jänner 1993
,Homosexualität‘ endgültig aus ihrem Krankheitskatalog
eliminiert) noch eine soziokulturelle Fehlleistung ist, gibt es in der
österreichischen Rechtsordnung noch unzählige Rechtsnormen, die
homosexuell empfindende Menschen nur auf Grund ihrer sexuellen Orientierung
diskriminieren.
Derartige, die
Menschenwürde mißachtende, Regelungen finden sich noch immer im
Zivil-, Arbeits-, Verwaltungs-, Verfassungs-, Steuer- und insbesondere im
Strafrecht. Es ist vehement zu bedauern, daß die österreichische
Rechtsordnung in diesem Bereich weder den gesellschaftspolitischen
Anforderungen noch dem internationalen Standard Rechnung trägt. Gerade im
Hinblick auf den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union vom
1. Jänner 1995 sollte dafür Sorge getragen werden, daß
hier umgehend die längst notwendigen Rechtsanpassungen in die Wege
geleitet werden.
Ausdrücklich genannt
werden darf die Entschließung des Europäischen Parlaments vom
13. März 1984, in der jede Diskriminierung von Homosexuellen am
Arbeitsplatz ausdrücklich verboten wird. In dieser Entschließung
wird darüber hinaus die Kommission beauftragt, alle Mitgliedstaaten
aufzufordern, so bald wie möglich eine Übersicht über alle in
den einschlägigen Rechtsvorschriften enthaltenen Bestimmungen, die speziell
homosexuelle Menschen betreffen, aufzustellen. Auf der Grundlage dieser
Übersichten sind die Fälle von Diskriminierungen von
Homosexuellen zu ermitteln und gemäß Art. 122 des EWG-Vertrages
ein Bericht über die Beschäftigung, das Wohnrecht und andere soziale
Bereiche auszuarbeiten.
Verwiesen sei auch auf
die Resolution des Europäischen Parlaments vom 8. Februar 1994,
in der die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, jede Diskriminierung auf Grund
der sexuellen Orientierung zu beseitigen und insbesondere einheitliche
Mindestaltersgrenzen, die Zulassung zu eheähnlichen Rechtsinstituten
sowie gleiche Rechte im Adoptions- und Pflegschaftsrecht zu schaffen.
In diesem Zusammenhang
darf demonstrativ auch auf die Landesverfassungen der bundesdeutschen
Länder Brandenburg (Art. 12 Abs. 2) und Thüringen
(Art. 2 Abs. 3) verwiesen werden, in denen die Nichtdiskriminierung
als soziales Grundrecht verfassungsrechtlich abgesichert ist.
Art. 12 Abs. 2
der Landesverfassung Brandenburg lautet:
,Niemand darf wegen
seiner Rasse, Abstammung, Nationalität, Sprache, seines Geschlechtes, seiner
sexuellen Identität, seiner sozialen Herkunft oder Stellung, seiner
Behinderung, seiner religiösen, weltanschaulichen oder politischen
Überzeugung bevorzugt oder benachteiligt werden.‘
Art. 2 Abs. 3
der Landesverfassung Thüringen lautet:
,Niemand darf wegen
seiner Herkunft, seiner Abstammung, seiner ethnischen Zugehörigkeit,
seiner sozialen Stellung, seiner Sprache, seiner politischen, weltanschaulichen
oder religiösen Überzeugung, seines Geschlechtes oder seiner
sexuellen Orientierung bevorzugt oder benachteiligt werden.‘
Verwiesen sei auch auf
die am 8. Juni 1995 mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit
verabschiedeten Berliner Landesverfassung, die ua. die Benachteiligung
Homosexueller untersagt und im Oktober dieses Jahres einer Volksabstimmung
zugeführt wird.
Daraus folgt, daß
es im internationalen Vergleich geradezu erschreckend ist, wie homosexuelle
Menschen im EU-Mitgliedstaat Österreich nicht nur sozial, sondern auch
rechtlich behandelt werden.
Anliegen betreffend
die rechtliche und soziale Gleichstellung homosexueller Menschen
Der Nationalrat wird
ersucht,
1. alles
in seiner Macht Stehende zu unternehmen, damit jede Diskriminierung homosexuell
orientierter Menschen sowohl in rechtlicher als auch in sozialer Hinsicht
möglichst umgehend beseitigt wird,
2. die
Bestimmung des Gleichheitsgrundsatzes gemäß Art. 7 B-VG derart
auszugestalten, daß jede Diskriminierung auf Grund der sexuellen
Orientierung als verfassungswidrig zu qualifizieren ist,
3. einen
Unterausschuß zu etablieren, der eine Evaluation aller Rechtsnormen
vorzunehmen hat, die geeignet sind, eine rechtliche, wirtschaftliche, soziale
oder sonstige faktische Benachteiligung homosexueller Menschen zu bewirken.
Dieser Unterausschuß hat insbesondere die geltenden Bestimmungen des
Familien- und Erbrechtes, des Wohnungseigentums- und Mietrechtes, des Arbeits-
und Sozialrechtes, des Steuerrechtes, des Strafrechtes sowie des
Verfahrensrechtes einer kritischen Überprüfung zu unterziehen,
4. folgende
Rechtsbereiche im Sinne eines Antidiskriminierungsgebotes einer sofortigen
Lösung zuzuführen:
a) Im
Strafgesetzbuch sind die Bestimmungen der §§ 209, 220 und 221
StGB ersatzlos zu streichen.
b) Es
ist dafür Sorge zu tragen, daß homosexuelle Lebensgemeinschaften
denselben Schutz wie heterosexuelle Lebensformen genießen. Daraus folgt,
daß umgehend eine adäquate Novellierung des ABGB nach
dänischem Muster sowie eine Adaptierung aller Verfahrensbestimmungen
(zB: Legaldefinition: Angehöriger) forciert werden muß.”
Der Ausschuß für Petitionen und
Bürgerinitiativen hat in der Sitzung am 3. Juli 1996 den
einstimmigen Beschluß gefaßt:
Ersuchen um Zuweisung an den Justizausschuß.
Der Justizausschuß nahm die
gegenständliche Bürgerinitiative in seiner Sitzung vom
20. November 1996 in Verhandlung, wobei die von der Bürgerinitiative
gestellten Anliegen nicht die Zustimmung der Ausschußmehrheit fanden, und
berichtete darüber dem Nationalrat (456 der Beilagen). Der Nationalrat hat
diesen Bericht in seiner 47. Sitzung am 27. November 1996 mit
Stimmenmehrheit zur Kenntnis genommen.
Verfassungsausschuß
Bürgerinitiative Nr. 12
eingebracht von Frau
Hilde Edinger betreffend “Wiederholung der
EU-Volksabstimmung”
Die gegenständliche
Bürgerinitiative ist folgenden Inhalts:
Bürgerinitiative
betreffend die Wiederholung der EU-Volksabstimmung
“Der Nationalrat
wird ersucht, die EU-Werbung nach dem Wahrheitsgehalt zu überprüfen.
In den Printmedien kann man nachlesen:
Dr. Mock
(Außenminister): ,Neutralität in EU voll gewahrt‘.
Dr. Vranitzky
(Bundeskanzler): ,Neutralität auch in der EU‘.
Diese Schlagzeilen sind
der Beweis, daß die Österreicher absichtlich getäuscht worden
waren, um die Mehrheit für den EU-Beitritt zu erhalten. Zwei Juristen (ein
Wiener und ein Tiroler) hatten an den Verfassungsgerichtshof den Antrag
gestellt, das EU-Beitrittsgesetz auf seine Gültigkeit zu prüfen
– vergebens.
Beide Politiker haben
sich der Verantwortung entzogen (Dr. Mock und Dr. Vranitzky). Im Parlament
haben die Abgeordneten die Möglichkeit (unabhängig von der Meinung
der Regierung und von der eigenen Meinung), die Wiederholung der
EU-Volksabstimmung zu erwirken. Damit wäre ein klarer Volksentscheid
gewährleistet – und ein Sieg der Wahrheit. 80 Prozent der
Österreicher wollen die Beibehaltung der Neutralität. Als Herr Dr.
Mock als Außenminister in Moskau war, um die Zustimmung der Russen zu
Österreichs EU-Beitritt zu erhalten, hatten die Russen NEIN gesagt
(Übertragung in FS 1 um Mitternacht). Aber im Morgenjournal am
nächsten Tag hatte Herr Dr. Mock gesagt: ,Die Russen haben nichts
dagegen.‘ War die Übersetzung falsch? Es wäre zu prüfen.
Der österreichische Staatsvertrag vom 15. Mai 1955 kann nur von den
Signatarstaaten geändert werden – nicht von der österreichischen
Regierung.”
In der
Ausschußsitzung am 9. Juli 1997 wurde beschlossen, eine
Stellungnahme des Bundeskanzleramtes zur gegenständlichen
Bürgerinitiative einzuholen.
Das Bundeskanzleramt
(Verfassungsdienst) hält im Hinblick auf den Umstand, daß am
12. Juni 1994 eine Volksabstimmung über den Beitritt zur
Europäischen Union stattgefunden hat, aus verfassungsrechtlicher Sicht
folgendes fest:
“Die
Bundesverfassung schließt zwar eine neuerliche Abstimmung über
denselben Gegenstand nicht grundsätzlich aus; im vorliegenden Fall ist
aber von der in Art. I des Bundesverfassungsgesetzes, BGBl.
Nr. 774/1994, über den Beitritt Österreichs zur
Europäischen Union enthaltenen Ermächtigung zum Abschluß des
Staatsvertrages über den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union
bereits Gebrauch gemacht worden, und das in Art. II vorgesehene
parlamentarische Verfahren hat ebenfalls schon stattgefunden. Beide Ereignisse
könnten nicht mehr ungeschehen gemacht werden.
Der Bürgerinitiative
Nr. 12 ist nicht zu entnehmen, wie sich die Initiatoren im
einzelnen die Wiederholung der EU-Volksabstimmung vorstellen, insbesondere aber
nicht, wie sie sich die Gestaltung eines einer solchen Volksabstimmung zugrunde
gelegenen Gesetzesbeschlusses des Nationalrates vorstellen. Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst
ist daher nicht in der Lage, sich näher zu dieser Frage zu
äußern.”
Der Ausschuß
für Petitionen und Bürgerinitiativen hat in seiner Sitzung am
26. November 1997 den einstimmigen Beschluß gefaßt:
Ersuchen um Zuweisung an
den Verfassungsausschuß.
Der
Verfassungsausschuß hat die gegenständliche Bürgerinitiative am
28. Jänner 1998 in Verhandlung gezogen und mit der Vorberatung einen
Unterausschuß betraut. Nach Abschluß der Vorberatung des
Unterausschusses erstattete der Verfassungsausschuß Bericht an den
Nationalrat (1252 der Beilagen). Das Anliegen der Bürgerinitiative
Nr. 12 hatte nicht die Zustimmung der Mehrheit des Verfassungsausschusses
gefunden. Diesen Bericht nahm der Nationalrat in seiner 129. Sitzung am
17. Juni 1998 zur Kenntnis.
Verkehrsausschuß
Bürgerinitiative Nr. 7
eingebracht von Herrn Dipl.-Ing. Erhard Scheffenegger
betreffend “Tieflegung der Verbindungsbahn im 13. Wiener
Gemeindebezirk anstatt Bau des ,Lainzer Tunnels‘ ”
Die Initiative “Hietzing ohne
Schranken”, welche die Einbringung der gegenständlichen
Bürgerinitiative zum Ziel hat, hält folgendes Forderungsprogramm
fest:
“– STOPP DER ARBEITEN FÜR DAS
PROJEKT DES LAINZER TUNNELS;
– ERSTELLUNG EINES VERNETZTEN
INFRASTRUKTURKONZEPTES: REGIONALER (NAH)VERKEHR – ÜBERREGIONALER
VERKEHR – PERSONENVERKEHR – GÜTERVERKEHR;
– AUSBAU DER VORHANDENEN
VERBINDUNGSBAHN DURCH EINE VIERGLEISIGE TIEFLEGUNG UND EINDECKUNG ZUM
ZWECK DER HERSTELLUNG EINER HOCHLEISTUNGSSTRECKE GEMÄSS § 3
Abs. 1 DES HL-GESETZES, BGBl. Nr. 135/1989, NOVELLE 1994 ZWISCHEN
WEST- UND SÜDBAHN UND EINER STRECKE FÜR DEN REGIONALVERKEHR.
A. Die Verbindungsbahn
trennt den gesamten 13. Bezirk in zwei Teile. Sechs schienengleiche
Straßenübergänge, verteilt auf eine Länge von zirka
3,0 km, sind durch täglich mindestens acht Stunden dauernde
Schrankenschließzeiten unterbrochene Bindeglieder der zwei
Bezirkshälften.
Wartende
Autokolonnen vor geschlossenen Schranken kosten volkswirtschaftlich ein
Vermögen. Diese Vergeudung wird durch den Bau des Lainzer Tunnels noch
verstärkt. Denn die derzeitige Frequenz der Verbindungsbahn durch
Güterzüge soll zwar zum Teil vom Lainzer Tunnel aufgenommen werden.
Aber anstelle dessen soll der Schnellbahnverkehr auf der Verbindungsbahn
mindestens mit der Frequenz des verlagerten Güterzugverkehrs geführt
werden.
Güterzüge
fahren vermehrt zu nächtlicher Zeit, die Schnellbahn – für
Personenverkehr – fährt aber tagsüber. Der verdichtete
Schnellbahnverkehr zusammen mit Personen- und Güterzügen bedeutet
noch längere Schrankenschließzeiten bei Tag, noch mehr wartende
Autos vor geschlossenen Schranken.
Die
Lärm- und Abgasbeeinträchtigung der Anrainer der Verbindungsbahn wird
somit tagsüber stärker als bisher sein.
Der
Bau des Lainzer Tunnels bringt nur scheinbar eine Verbesserung, in Wirklichkeit
aber eine deutliche Verschlechterung für den 13. Bezirk. –
Unterführungen sind untaugliche Notlösungen.
Eine
nachträgliche Tieflegung der Verbindungsbahn wird durch den Lainzer Tunnel
äußerst erschwert, wenn nicht sogar vereitelt.
B. Der Lainzer Tunnel wurde
bereits vor 1989, also vor der Ostöffnung, ohne Rücksicht auf die
Wiener städtebauliche Situation und die Anbindungsmöglichkeiten an
das öffentliche Verkehrsnetz – mit Ausnahme des zu errichtenden
Zentralbahnhofes – geplant und stellt demnach eine isolierte Planung dar.
ZB wird der Bahnhof Hütteldorf nicht als Vorbahnhof genutzt.
Der
Bahnhof Hütteldorf ist aber als Vorbahnhof voll funktionsfähig. Eine
Vernetzung mit der Verbindung zwischen West- und Südbahn würde seine
Bedeutung verstärken. Ein zusätzlicher Vorbahnhof ist dann nicht
erforderlich.
C. Das
Hochleistungsstreckengesetz stützt sich auf das ÖBB-Planungskonzept
,Die Neue Bahn‘ 1986, das auf Hochgeschwindigkeitszüge abgestellt
ist. ,Bei Planungen änderte die HL-Gesellschaft oft die Trassenführung‘
(Zitat: Tätigkeitsbericht des Rechnungshofes über das Jahr 1993,
S. 356, 10.1), was auch im Falle des Lainzer Tunnels zum Nachteil des
Projekts geschah: nach der Bewertung von neun Varianten wurde eine davon im
Februar 1992 als günstigste beurteilt. Zur Auflage gelangte eine zehnte
schließlich verordnete Trasse mit längeren kritischen Strecken unter
verbautem Gebiet und mit kleineren Krümmungsradien, wodurch man vom
Planungsziel der hohen Geschwindigkeiten abging. Somit liegt aber eine zusammen
mit der Verbindungsbahn tiefgelegte und eingedeckte Trassenführung der
HL-Strecke zwischen West- und Südbahn ebenfalls im gesteckten Rahmen.
Die Unterzeichneten
fordern von der Bundesregierung,
1. die Arbeiten für die Planung und
den Bau des Lainzer Tunnels einzustellen,
2. ein Konzept für ein vernetztes
großräumiges Schienen-, Wasserstraßen- und
Straßenverkehrswegenetz sowie
3. ein Bahninfrastruktur-Netz, welches die
Verknüpfung des Regional-(Nah-)Verkehrs, des Fernverkehrs, des Personen-
und Güterverkehrs beinhaltet, zu erstellen und
4. dementsprechend eine neuerliche Planung
der Herstellung einer Verbindung der Westbahn mit der Südbahn, unter
Einbeziehung der städtebaulichen Lösung, welche auch die Tieflegung
der Verbindungsbahn beinhaltet, an eine unabhängige Institution in
Auftrag zu geben.
Da die Kosten des Lainzer
Tunnels zur Gänze vom Bund bzw. ÖBB zu tragen sind, ein unter
Punkt 4 bezeichnetes Projekt jedoch größtenteils bahneigenen
Grund betrifft, geringes Risiko infolge weniger direkter Anrainer birgt und in
preisgünstigerer Bauweise bei Vergabe von Baulosen an unterschiedliche
Firmen ausgeführt werden kann, ist die neuerliche Planung und
Ausführung des Projektes gemäß Punkt 4 in Zusammenarbeit
von Bund, Land (Gemeinde) und ÖBB, nicht nur ein Beitrag mit
höchstmöglicher Effizienz im Sinne des Sparpaketes, sondern
entspricht auch § 3 Abs. 1 der HL-Gesetz-Novelle 1994 (BGBl.
Nr. 655/1994), in welchem neben einer ,leistungsfähigen‘ auch
eine ,wirtschaftliche Eisenbahn‘ gefordert wird.”
In der Ausschußsitzung
am 17. Oktober 1996 wurde beschlossen, eine Stellungnahme des Bundesministeriums
für Wissenschaft, Verkehr und Kunst einzuholen.
Das Bundesministerium
teilte zur gegenständlichen Bürgerinitiative mit, daß die
“Eisenbahn-Hochleistungsstrecken AG per Verordnung BGBl.
Nr. 107/1990 mit der Planung einer Hochleistungsstrecke
St. Pölten–Raum Wien einschließlich einer
Verbindungsstrecke zur Südbahn beauftragt wurde.
Die betreffende
Bürgerinitiative wurde an die HL-AG weitergeleitet und nachstehende
ausführliche Sachverhaltsdarstellung der Stellungnahme angeschlossen:
“ad
A. Die sechs Eisenbahnkreuzungen sind
nicht wie behauptet auf zirka 3 km, sondern auf zirka 1,8 km Abstand
verteilt.
Schrankengesicherte
Eisenbahnkreuzungen dienen der Verkehrssicherheit ebenso wie die über
1 000 VLSA’s in Wien. Der angebliche Verlust von
volkswirtschaftlichem Vermögen durch ,wartende Autokolonnen vor
geschlossenen Schranken‘ ist somit klein (mathematische Ausdrucksweise),
nicht meßbar (physikalisch) bzw. vernachlässigbar (realistisch) im
Vergleich zur Summe der Wartezeiten vor ,roten Ampeln‘ (vgl. Ergebnis der
Gürtelkommission kurz gefaßt: kein Tunnel, Ampeln reichen aus, Stau
bleibt!).
Daß
die Abgasbeeinträchtigung der Anrainer durch vorschriftswidriges Verhalten
der Verkehrsteilnehmer (Laufenlassen des Motors) begründet wird,
scheint den Einwendern zu entgehen. Darüber hinaus ist klar und
nachweisbar, daß Schrankenschließzeiten zufolge S-Bahn-Verkehr
wesentlich geringer sind als beim Güterverkehr (Länge S-Bahnzug 75
bis 150 m, Länge Güterzug bis 700 m, dh. Faktor
1 : 5 bis 1 : 9).
Warum
Unterführungen ,untaugliche Notlösungen‘ darstellen sollen, ist
nicht nachvollziehbar. Die einfachsten Lösungen
–
Öffnen des ,Mauseloches‘ bei der Beckgasse bzw.
–
Brücke Schrutkagasse/Titlgasse
werden
offenbar bewußt negiert, um eine kunstfertige Argumentation gegen den
Lainzer Tunnel aufrechtzuerhalten.
Der
letzte Satz von Punkt A ist schlichtweg falsch: Gerade durch den Lainzer
Tunnel wird jede Umbaumöglichkeit der Verbindungsbahn geschaffen
und das dann ausschließlich auf Bahngrund!!!
ad
B. Gedanken über eine
neue Verbindungsstrecke gehen in die 30er Jahre zurück, eine Zeit, in der
der Osten nicht erst geöffnet werden brauchte. Der Lainzer Tunnel stellt
somit keine ,isolierte Planung‘ dar.
Daß
Hütteldorf als Vorbahnhof unverändert bestehenbleibt, ist sonnenklar,
ebenso wie die Tatsache, daß Güterzüge, die nach Kledering
fahren, einen solchen nicht benötigen. Was mit einen ,zusätzlichen
Vorbahnhof‘ gemeint ist, können wir nicht nachvollziehen.
ad
C. Das Zitat aus dem
Rechnungshofbericht ist in unzulässiger Weise aus dem Zusammenhang
gerissen.
Zur
Auflage gelangte nicht eine zehnte, sondern die optimierte Variante ,HaWei
tief-Maxing‘, die jedoch noch weniger Anteile unter verbautem Gebiet
aufweist. Die Krümmungsradien (insbesondere im Bereich des Speisinger
Bogens) sind selbstverständlich so gewählt, daß auch die
ursprüngliche Entwurfsgeschwindigkeit beibehalten werden konnte. Der aus
dieser aufgestellten Behauptung gezogene Schluß ist somit falsch.
Abschließend ist zu bemerken, daß
entlang der Verbindungsbahn nicht weniger, sondern mehr direkte Anrainer
ein wieder herbeigeredetes Risiko zu tragen hätten als beim Lainzer
Tunnel. Und daß Vergaben von Baulosen an unterschiedliche Firmen möglich
sind, ist ho. bekannt.”
In der Ausschußsitzung am 7. Mai 1997
wurde hinsichtlich der Bürgerinitiative Nr. 7 der einstimmige
Beschluß gefaßt:
Ersuchen um Zuweisung an den
Verkehrsausschuß.
Nach Aufnahme der Verhandlungen im
Verkehrsausschuß am 25. November 1997 wurden diese vertagt.
Verkehrsausschuß
Bürgerinitiative Nr. 11
eingebracht von Herrn Franz Schauer
betreffend “Schutz vor alkoholisierten Fahrzeuglenkern”
Die Aktionsgemeinschaft gegen Alkohol am Steuer
fordert den Schutz vor Alkoholtätern durch
1. wirksame Verhinderung der
Inbetriebnahme eines Fahrzeuges durch einen alkoholisierten Lenker wegen der
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit;
2. die Herabsetzung der Höchstgrenze
der tolerierbaren Alkoholisierung auf 0,5 Promille und die Durchführung
der notwendigen Überwachung;
3. Punkteführerschein: kein
Führerschein für Alkoholkranke, die sich nicht ärztlich
behandeln lassen.
In der
Ausschußsitzung am 7. Mai 1997 wurde beschlossen, zu dieser
Bürgerinitiative Stellungnahmen folgender Stellen einzuholen:
Bundesministerium
für Inneres, Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr,
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten, Bundesministerium
für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie Kuratorium für
Verkehrssicherheit.
Das Bundesministerium
für Inneres übermittelte folgendes Schreiben des Herrn
Bundesministers für Inneres betreffend “Plattform für
0,5 Promille”:
“Das
Bundesministerium für Inneres hat bereits anläßlich des im
Sommer 1996 durchgeführten Begutachtungsverfahrens betreffend den vom
Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr versendeten Entwurf
einer Novelle zur Straßenverkehrsordnung 1960, in dem die von Ihnen
angesprochene 0,5-Promille-Regelung vorgesehen war, keine Einwände gegen
diese beabsichtigte Änderung geäußert.
Darüber hinaus sind
die Vertreter meines Ressorts bei verschiedensten Anlässen – unter
anderem auch bei der am 15. Oktober 1996 im Parlament stattgefundenen
Enquete zum Thema ,Möglichkeiten zur Verbesserung der Verkehrssicherheit durch
weitere Maßnahmen gegen die Fahruntüchtigkeit auf Grund von Alkohol-
oder Drogenkonsum‘ – dem gegenständlichen
Novellierungsvorhaben durchaus aufgeschlossen gegenübergestanden.
Diese grundsätzlich
befürwortende Haltung ist vor allem vor dem Hintergrund einer –
durch diese (Gesetzgebungs-)Maßnahme zu erwartenden – weiteren
Verbesserung der Verkehrssicherheit zu sehen.
Daneben besteht für
mich kein Zweifel, daß die Exekutive auch in Zukunft durch ihre
Kontrollmaßnahmen und den Einsatz der ständig erweiterten
technischen Ausrüstung zur effizienten Verkehrsüberwachung ihren
Beitrag zur Sicherheit auf Österreichs Straßen leisten wird.”
Das Bundesministerium
für Wissenschaft und Verkehr nahm zur gegenständlichen
Bürgerinitiative wie folgt Stellung:
“Die
Regierungsvorlage der 20. Novelle zur Straßenverkehrsordnung sieht
eine Änderung des § 5b StVO vor. Diese Bestimmung enthält
eine – nicht abschließende – Aufzählung der
möglichen Zwangsmaßnahmen, die von der Exekutive gesetzt werden
können, um zu verhindern, daß alkoholisierte Fahrzeuglenker ihre
Fahrt fortsetzen. In diese Aufzählung wird nunmehr das Anlegen technischer
Sperren, sogenannter Radklammern, ausdrücklich aufgenommen. Obwohl diese
Möglichkeit rechtlich gesehen bereits bisher bestand, soll durch die ausdrückliche
Erwähnung in § 5b StVO das Augenmerk der
Straßenaufsichtsorgane verstärkt auf diese Möglichkeit gelenkt
werden.
Die Herabsetzung auf 0,5 Promille wird
voraussichtlich Gegenstand einer parlamentarischen Abstimmung sein.”
Vom Bundesministerium für wirtschaftliche
Angelegenheiten erging folgende Stellungnahme:
“Im Rahmen der dem Bundesministerium
für wirtschaftliche Angelegenheiten eingeräumten Kompetenz des
Bundesstraßenbaues wird der Verkehrssicherheit ein hoher Stellenwert
eingeräumt. Ein großes Spektrum an entsprechenden baulichen und
organisatorischen Maßnahmen wird umgesetzt.
Die Durchsetzung der von der Bürgerinitiative
angesprochenen Maßnahmen:
– wirksame Verhinderung der
Inbetriebnahme von Fahrzeugen,
– Herabsetzung der
Höchstgrenze der tolerierbaren Alkoholisierung auf 0,5 Promille,
– kein Führerschein
für Alkoholkranke,
fallen jedoch in den
Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Wissenschaft und
Verkehr und
– die notwendige
Überwachung
in die Zuständigkeit
des Bundesministeriums für Inneres.”
Das Kuratorium für Verkehrssicherheit
führte aus, daß die Aktionsgemeinschaft gegen Alkohol am Steuer, ins
Leben gerufen von Frau Sigrid Benesch und deren Eltern, Sieghilde und Franz
Schauer, dem KfV bestens bekannt sind.
“Der tragische Unfalltod von Sigrun Benesch,
der Tochter von Frau Sigrid Benesch, hervorgerufen durch einen alkoholisierten
Autolenker, hat zu zahlreichen Reaktionen von Politikern und den Medien
geführt.
Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV)
unterstützt diese Bürgerinitiative Nummer 11 vollinhaltlich und
verweist auf die vielen Unterschriften, die aus der Bevölkerung in Form
von Unterstützungserklärungen spontan eingetroffen sind.
Das ,Rote Dreieck‘, eine Initiative
österreichischer Unfallopfer, hat sich ebenfalls dieser
Bürgerinitiative der Aktionsgemeinschaft gegen Alkohol am Steuer
angeschlossen und bemüht sich um präventive Maßnahmen zur
Vorbeugung derart tragischer Unfälle, die durch Alkohol am Steuer
verursacht werden.”
Des weiteren liegt eine Stellungnahme der
Volksanwaltschaft vor, die sich zur genannten Initiative wie folgt
geäußert hat:
“Die Volksanwaltschaft spricht sich positiv
zum Anliegen der gegenständlichen Bürgerinitiative, die von –
wie ausgeführt ist – über 45 000 Unterschriften
unterstützt ist, aus und teilt dazu mit, daß es nach Ansicht der
Volksanwaltschaft durch die vorgeschlagenen Maßnahmen zu einer Reduktion
der Anzahl von Unfällen und Unfallopfern kommen könnte.
Die Senkung der zulässigen Alkoholisierung
von 0,8 auf 0,5 Promille hat nach Ansicht der Volksanwaltschaft sicherlich
eine positive Signalwirkung. Eine solche Maßnahme, die bereits im Entwurf
zur 20. Novelle zur Straßenverkehrsordnung enthalten war, wirkt
generalpräventiv und bringt zum Ausdruck, daß die Gesellschaft das
Lenken von Kraftfahrzeugen auch bei einer geringfügigeren als der derzeit
geltenden Grenze der Alkoholisierung verurteilt.
In die gleiche Richtung weist die Anregung der
Bürgerinitiative zur Einführung eines Punkteführerscheines.
Auch eine derartige Regelung ist bereits vom Bundesministerium für Verkehr
in einem Begutachtungsentwurf vorgeschlagen worden. Es sollte für ein
System des Punkteführerscheines nach Ansicht der Volksanwaltschaft ein
möglichst einfaches transparentes und für Behörden sowie
Bürger klares Punktesystem geben, das bundesweit anzuwenden ist.
Abschließend weist die Volksanwaltschaft
darauf hin, daß bereits nach der geltenden Rechtslage konkrete
Maßnahmen der Exekutive möglich sind, um das Weiterfahren des
Lenkers im alkoholisierten Zustand zu vermeiden. Dazu gehören nicht nur
die Abnahme der Fahrzeugdokumente, sondern auch die Abnahme der Schlüssel
sowie die Anbringung technischer Sperren (Radklammern).”
Eine Stellungnahme des Bundesministeriums für
Arbeit, Gesundheit und Soziales ist nicht eingelangt.
Einstimmiger Beschluß in der Ausschußsitzung am 26. November 1997:
Ersuchen um Zuweisung an den
Verkehrsausschuß.
Der Ausschuß für Petitionen und
Bürgerinitiativen hat die gegenständlichen Petitionen und Bürgerinitiativen
in seinen Sitzungen am 3. Juli, 17. Oktober und 4. Dezember
1996, 7. Mai, 9. Juli und 26. November 1997 sowie am
1. Juli 1998 in Verhandlung genommen.
An den Debatten
beteiligten sich die Abgeordneten Dipl.-Ing. Maximilian Hofmann, Paul Kiss,
Mag. Walter Guggenberger, Dr. Gottfried Feurstein, Theresia
Haidlmayr, Dr. Helene Partik-Pablé, Maria Schaffenrath,
Rainer Wimmer, Dr. Alfred Brader, Edeltraud Gatterer, Dr.
Robert Rada, Franz Stampler, Dr. Günther Kräuter, Manfred
Lackner, Brigitte Tegischer, Mag. Cordula Frieser, Franz Koller,
Hermann Mentil, Dr. Sonja Moser, Ing. Leopold Maderthaner,
Anton Blünegger, Franz Morak, Dr. Johannes Jarolim, MMag.
Dr. Madeleine Petrovic, Johann Kurzbauer, Klara Motter,
Dr. Günther Leiner sowie die Obfrau des Ausschusses Brunhilde Fuchs.
Zum Berichterstatter
für das Haus wurde der Abgeordnete Franz Stampler gewählt.
Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der
Ausschuß für Petitionen und Bürgerinitiativen somit den Antrag,
der Nationalrat wolle den gegenständlichen Bericht zur Kenntnis
nehmen.
 Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis Petition Nr. 8
Petition Nr. 8 Petition Nr. 21
Petition Nr. 21