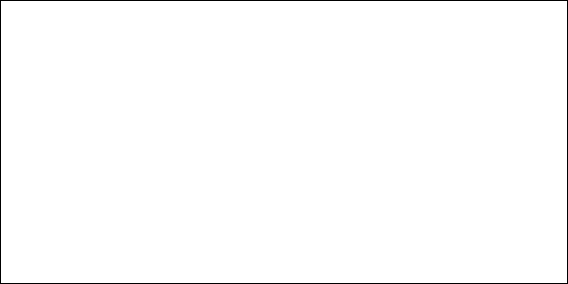über die Petitionen
Nr. 21, 26, 35 bis 91, 94 und 95 sowie über die Bürgerinitiativen
Nr. 23, 25 und 26
über die Petitionen
Nr. 21, 26, 35 bis 91, 94 und 95 sowie über die Bürgerinitiativen
Nr. 23, 25 und 26
Inhaltsverzeichnis
I. Der Berichtspflicht
unterliegende Bürgerinitiativen
|
Abstandnahme von der weiteren Verhandlung im Sinne des § 100b Abs. 1 GOG.................................................................................................................................. |
Seite 7 |
|
Erledigung durch Kenntnisnahme des Ausschussberichtes.................................. |
Seiten 7 bis 33 |
II. Sonstiges
|
1. Petitionen................................................................................................................... |
Seiten 33 bis 54 |
|
2. Bürgerinitiativen....................................................................................................... |
Seiten 54 bis 58 |
|
Anlage.................................................................................................................................... |
Seiten 59 bis 90 |
VERZEICHNIS
der im Bericht enthaltenen Petitionen und Bürgerinitiativen
|
Petition Nr. 21 |
|
|
überreicht von der Abgeordneten Mag. Barbara Prammer betreffend „Eine Chance auf Familienleben – auch den im Handel Beschäftigten“................................. |
Seiten 46 bis 54 |
|
Petition Nr. 26 |
|
|
überreicht von der Abgeordneten Mag. Gisela Wurm „zur Erhaltung des Wachzimmers Reichenau in Innsbruck“............................................................................ |
Seiten 7 bis 8 |
|
Petition Nr. 35 |
|
|
überreicht von den Abgeordneten Theresia Haidlmayr und Dr. Helene Partik-Pablé betreffend „Nein zur Biomedizin-Konvention des Europarates“........................ |
Seiten 34 bis 39 |
|
Anlage zu Petition Nr. 35..................................................................................................... |
Seiten 59 bis 90 |
|
Petition Nr. 36 |
|
|
überreicht vom Abgeordneten Anton Heinzl betreffend „Senkung ungerechtfertigt hoher Treibstoffpreise“........................................................................................................ |
Seiten 8 bis 20 |
|
Petition Nr. 37 |
|
|
überreicht von den Abgeordneten Anton Heinzl und Beate Schasching betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3211 Loich“.............................................. |
Seiten 39 bis 46 |
|
|
|
|
überreicht von den Abgeordneten Anton Heinzl und Beate Schasching betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3125 Statzendorf“.................................... |
Seiten 39 bis 46 |
|
Petition Nr. 39 |
|
|
überreicht von den Abgeordneten Anton Heinzl und Beate Schasching betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3384 Groß Sierning“................................ |
Seiten 39 bis 46 |
|
Petition Nr. 40 |
|
|
überreicht von den Abgeordneten Anton Heinzl und Beate Schasching betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3074 Michelbach“................................... |
Seiten 39 bis 46 |
|
Petition Nr. 41 |
|
|
überreicht von den Abgeordneten Anton Heinzl und Beate Schasching betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3072 Kasten“........................................... |
Seiten 39 bis 46 |
|
Petition Nr. 42 |
|
|
überreicht von den Abgeordneten Anton Heinzl und Beate Schasching betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3131 Getzersdorf“.................................... |
Seiten 39 bis 46 |
|
Petition Nr. 43 |
|
|
überreicht von den Abgeordneten Anton Heinzl und Beate Schasching betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3104 Harland“.......................................... |
Seiten 39 bis 46 |
|
Petition Nr. 44 |
|
|
überreicht von den Abgeordneten Anton Heinzl und Beate Schasching betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3105 Radlberg“........................................ |
Seiten 39 bis 46 |
|
Petition Nr. 45 |
|
|
überreicht von den Abgeordneten Anton Heinzl und Beate Schasching betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3212 Schwarzenbach“............................ |
Seiten 39 bis 46 |
|
Petition Nr. 46 |
|
|
überreicht von den Abgeordneten Anton Heinzl und Beate Schasching betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3144 Wald“.............................................. |
Seiten 40 bis 46 |
|
Petition Nr. 47 |
|
|
überreicht von den Abgeordneten Anton Heinzl und Beate Schasching betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3061 Ollersbach“..................................... |
Seiten 40 bis 46 |
|
Petition Nr. 48 |
|
|
überreicht von den Abgeordneten Anton Heinzl und Beate Schasching betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3051 St. Christophen“............................ |
Seiten 40 bis 46 |
|
Petition Nr. 49 |
|
|
überreicht von den Abgeordneten Anton Heinzl und Beate Schasching betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3052 Innermanzing“................................ |
Seiten 40 bis 46 |
|
Petition Nr. 50 |
|
|
überreicht vom Abgeordneten Gerhard Reheis betreffend „für die Realisierung des Tschirganttunnels“............................................................................................................... |
Seiten 20 bis 22 |
|
Petition Nr. 51 |
|
|
überreicht von der Abgeordneten Inge Jäger „zur schrittweisen Erhöhung der Mittel für die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit auf 0,7% des Bruttoinlandsprodukts (BIP)“............................................................................................. |
Seite 33 |
|
|
|
|
überreicht vom Abgeordneten Dipl.-Ing. Werner Kummerer betreffend „für die Erhaltung der Postämter im Bezirk Mistelbach“............................................................... |
Seiten 40 bis 46 |
|
Petition Nr. 53 |
|
|
überreicht vom Abgeordneten Dr. Robert Rada betreffend „für die Erhaltung der Postämter im Bezirk Gänserndorf“...................................................................................... |
Seiten 40 bis 46 |
|
Petition Nr. 54 |
|
|
überreicht vom Abgeordneten Dipl.-Kfm. Dr. Hannes Bauer betreffend „für die Erhaltung der Postämter im Bezirk Hollabrunn“............................................................... |
Seiten 40 bis 46 |
|
Petition Nr. 55 |
|
|
überreicht vom Abgeordneten Mag. Johann Maier betreffend „gegen die Abschaffung steuerlicher Begünstigung für gemeinnützige Vereine“......................... |
Seiten 22 bis 25 |
|
Petition Nr. 56 |
|
|
überreicht von den Abgeordneten Günter Kiermaier und Gabriele Binder betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3362 Mauer-Öhling“............................... |
Seiten 40 bis 46 |
|
Petition Nr. 57 |
|
|
überreicht von den Abgeordneten Günter Kiermaier und Gabriele Binder betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3344 St. Georgen/Reith“......................... |
Seiten 40 bis 46 |
|
Petition Nr. 58 |
|
|
überreicht von den Abgeordneten Günter Kiermaier und Gabriele Binder betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3342 Opponitz“........................................ |
Seiten 40 bis 46 |
|
Petition Nr. 59 |
|
|
überreicht von den Abgeordneten Günter Kiermaier und Gabriele Binder betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 4441 Behamberg“.................................... |
Seiten 40 bis 46 |
|
Petition Nr. 60 |
|
|
überreicht von den Abgeordneten Günter Kiermaier und Gabriele Binder betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3312 Oed“................................................. |
Seiten 40 bis 46 |
|
Petition Nr. 61 |
|
|
überreicht von den Abgeordneten Günter Kiermaier und Gabriele Binder betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3311 Zeillern“........................................... |
Seiten 40 bis 46 |
|
Petition Nr. 62 |
|
|
überreicht von den Abgeordneten Günter Kiermaier und Gabriele Binder betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3313 Wallsee“.......................................... |
Seiten 40 bis 46 |
|
Petition Nr. 63 |
|
|
überreicht von den Abgeordneten Günter Kiermaier und Gabriele Binder betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3322 Viehdorf“......................................... |
Seiten 40 bis 46 |
|
Petition Nr. 64 |
|
|
überreicht von den Abgeordneten Günter Kiermaier und Gabriele Binder betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3325 Ferschnitz“...................................... |
Seiten 40 bis 46 |
|
Petition Nr. 65 |
|
|
überreicht von den Abgeordneten Günter Kiermaier und Gabriele Binder betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3332 Rosenau“........................................ |
Seiten 41 bis 46 |
|
|
|
|
überreicht von den Abgeordneten Günter Kiermaier und Gabriele Binder betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3333 Böhlerwerk“.................................... |
Seiten 41 bis 46 |
|
Petition Nr. 67 |
|
|
überreicht von den Abgeordneten Günter Kiermaier und Gabriele Binder betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 4432 Ernsthofen“.................................... |
Seiten 41 bis 46 |
|
Petition Nr. 68 |
|
|
überreicht von den Abgeordneten Günter Kiermaier und Gabriele Binder betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3354 Wolfsbach“.................................... |
Seiten 41 bis 46 |
|
Petition Nr. 69 |
|
|
überreicht vom Abgeordneten Dr. Peter Wittmann betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 2724 Hohe Wand/Stollhof“....................................................................... |
Seiten 41 bis 46 |
|
Petition Nr. 70 |
|
|
überreicht vom Abgeordneten Dr. Peter Wittmann betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 2492 Eggendorf“......................................................................................... |
Seiten 41 bis 46 |
|
Petition Nr. 71 |
|
|
überreicht vom Abgeordneten Dr. Peter Wittmann betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 2803 Schwarzenbach“................................................................................ |
Seiten 41 bis 46 |
|
Petition Nr. 72 |
|
|
überreicht vom Abgeordneten Dr. Peter Wittmann betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 2770 Gutenstein“........................................................................................ |
Seiten 41 bis 46 |
|
Petition Nr. 73 |
|
|
überreicht vom Abgeordneten Dr. Peter Wittmann betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 2802 Hochwolkersdorf“............................................................................. |
Seiten 41 bis 46 |
|
Petition Nr. 74 |
|
|
überreicht vom Abgeordneten Dr. Peter Wittmann betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 2833 Bromberg“.......................................................................................... |
Seiten 41 bis 46 |
|
Petition Nr. 75 |
|
|
überreicht vom Abgeordneten Dr. Peter Wittmann betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 2812 Hollenthon“........................................................................................ |
Seiten 41 bis 46 |
|
Petition Nr. 76 |
|
|
überreicht vom Abgeordneten Dr. Peter Wittmann betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 2723 Muthmannsdorf“............................................................................... |
Seiten 41 bis 46 |
|
Petition Nr. 77 |
|
|
überreicht vom Abgeordneten Anton Heinzl betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3172 Ramsau“..................................................................................................... |
Seiten 42 bis 46 |
|
Petition Nr. 78 |
|
|
überreicht vom Abgeordneten Anton Heinzl betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3222 Annaberg“................................................................................................. |
Seiten 42 bis 46 |
|
Petition Nr. 79 |
|
|
überreicht vom Abgeordneten Anton Heinzl betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3223 Wienerbruck“............................................................................................ |
Seiten 42 bis 46 |
|
|
|
|
überreicht vom Abgeordneten Anton Heinzl betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3162 Rainfeld an der Gölsen“........................................................................... |
Seiten 42 bis 46 |
|
Petition Nr. 81 |
|
|
überreicht vom Abgeordneten Anton Heinzl betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3171 Kleinzell“.................................................................................................... |
Seiten 42 bis 46 |
|
Petition Nr. 82 |
|
|
überreicht vom Abgeordneten Anton Heinzl betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3195 Kernhof“.................................................................................................... |
Seiten 42 bis 46 |
|
Petition Nr. 83 |
|
|
überreicht vom Abgeordneten Anton Heinzl betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3153 Eschenau“.................................................................................................. |
Seiten 42 bis 46 |
|
Petition Nr. 84 |
|
|
überreicht von der Abgeordneten Inge Jäger betreffend „zur Stärkung des Fairen Handels in Österreich“......................................................................................................... |
Seiten 25 bis 26 |
|
Petition Nr. 85 |
|
|
überreicht von der Abgeordneten Gabriele Heinisch-Hosek betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 2431 Klein Neusiedl“............................................................... |
Seiten 42 bis 46 |
|
Petition Nr. 86 |
|
|
überreicht von der Abgeordneten Ludmilla Parfuss betreffend „für die Erhaltung der Postämter der Bezirke Deutschlandsberg und Leibnitz“.......................................... |
Seiten 44 bis 46 |
|
Petition Nr. 87 |
|
|
überreicht von den Abgeordneten Mag. Werner Kogler und Heidrun Silhavy betreffend „zur Aufnahme bisher nicht genannter Opfergruppen im Opferfürsorgegesetz“........................................................................................................... |
Seiten 26 bis 27 |
|
Petition Nr. 88 |
|
|
überreicht von der Abgeordneten Gabriele Heinisch-Hosek betreffend „für die Erhaltung der Postämter 2354 Guntramsdorf 2, 2531 Gaaden und 2381 Laab im Walde“.................................................................................................................................... |
Seiten 45 bis 46 |
|
Petition Nr. 89 |
|
|
überreicht von den Abgeordneten Manfred Lackner und Dr. Gottfried Feurstein betreffend „für den Frieden in der Welt, gegen Krieg, Terror und Gewalt“................. |
Seiten 27 bis 28 |
|
Petition Nr. 90 |
|
|
überreicht von der Abgeordneten Mag. Gisela Wurm betreffend „für ein Polizei-Wachzimmer am Innsbrucker Hauptbahnhof“................................................................. |
Seiten 28 bis 29 |
|
Petition Nr. 91 |
|
|
überreicht vom Abgeordneten Dipl.-Ing. Wolfgang Pirklhuber betreffend „Nulltoleranz für Gentechnik-Saatgut – Gentechnikfreies Österreich“......................... |
Seiten 29 bis 30 |
|
Petition Nr. 94 |
|
|
überreicht vom Abgeordneten Rainer Wimmer betreffend „für die Erhaltung der Postämter 4831 Obertraun, 4821 Lauffen, 4820 Pfandl, 4823 Steeg, 4817 St. Konrad, 4662 Steyrermühl“................................................................................................................. |
Seiten 45 bis 46 |
|
|
|
|
überreicht vom Abgeordneten Rudolf Parnigoni betreffend „gegen die Schließung des Postamtes 3961 Waldenstein im Waldviertel“.......................................................... |
Seiten 45 bis 46 |
|
Bürgerinitiative Nr. 23 |
|
|
eingebracht von Herbert Adam betreffend „Einforderung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für die Müllaufbereitungsanlage der DIVITEC-GesmbH in Oberpullendorf, Mittelburgenland“.............................................. |
Seiten 31 bis 33 |
|
Bürgerinitiative Nr. 25 |
|
|
eingebracht von Mag. Nicolas Reischer betreffend „Gleichstellung für Zivildiener“................................................................................................................................................. |
Seiten 54 bis 58 |
|
Bürgerinitiative Nr. 26 |
|
|
eingebracht von Mag. Christine Recht betreffend „Unverzügliche Neuwahlen, ermöglicht durch ein Bundesgesetz, mit dem die XXI. Gesetzgebungsperiode des Nationalrates vorzeitig beendet wird“............................................................................... |
Seite 7 |
Der Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen hat sich zur Vorbereitung der Entscheidungen über die einzelnen Anliegen an die Bundesministerien, die Volksanwaltschaft und andere Behörden bzw. Organisationen mit dem Ersuchen um Stellungnahmen gewandt.
I. Der Berichtspflicht unterliegende Bürgerinitiativen
Abstandnahme von der weiteren Verhandlung im Sinne des § 100b Abs. 1 GOG
Bürgerinitiative Nr. 26
eingebracht von Mag. Christine Recht betreffend „Unverzügliche
Neuwahlen, ermöglicht durch ein Bundesgesetz, mit dem die XXI. Gesetzgebungsperiode
des Nationalrates vorzeitig beendet wird“
Das Anliegen der Bürgerinitiative wurde wie folgt formuliert:
„Der Nationalrat wird ersucht, die XXI. Gesetzgebungsperiode des Nationalrates durch Bundesgesetz vorzeitig und unverzüglich zu beenden und derart eine Überprüfung des WählerInnenwillens durch Neuwahlen zu ermöglichen.
Von Anfang an stieß die Regierungsbeteiligung der FPÖ auf heftigen, breiten Protest. Mit ihr wurde eine Partei an die Macht geholt, die nationalistische und rassistische Hetze, Lügen, Herabwürdigung und Drohung zu ihren politischen Instrumenten zählt und stark totalitäre, demokratiefeindliche Züge trägt.
Von Anfang an war fraglich, ob die Bildung der ÖVP-FPÖ-Koalition auch dem WählerInnenwillen vom Oktober 1999 entsprach, da im Wahlkampf anderes zugesichert worden war.
Inzwischen sind 33% der ÖsterreicherInnen für sofortige Neuwahlen, eine Fortsetzung der schwarz-blauen Koalition nach Wahlen befürworten nur 28% (siehe Gallup-Umfrage vom Jänner 2002). Das ist für eine demokratische Republik unhaltbar.
Inzwischen sind schwerwiegende Eingriffe in das soziale und demokratische System Österreichs durchgesetzt worden, weitere sind in Planung. Die Koalition setzt ihre Maßnahmen gegen massivsten Protest, auch der Interessenvertretungen, trotz Warnungen vor Verfassungsbruch und Bruch der Menschenrechte durch. Es zeigen sich immer mehr Merkmale einer Willkürherrschaft.
Die Präambel (Voraussetzung für die Angelobung durch den Bundespräsidenten) ist in mehreren Punkten gebrochen, sogar die Bindung der Regierung an die Verfassung wirkt brüchig. Der demokratische Rechtsstaat, der immer auch ein Sozialstaat ist, ist in Gefahr.
Aus all diesen Gründen fordern wir sofortige Neuwahlen.
(Wir ersuchen um geheime Abstimmung im Nationalrat)“
Beschluss mit Stimmenmehrheit in der Sitzung des Ausschusses am 3. April 2002:
Abstandnahme von der weiteren Verhandlung.
Erledigung durch Kenntnisnahme des Ausschussberichtes
Petition Nr. 26
überreicht von der Abgeordneten Mag. Gisela
Wurm „zur Erhaltung des
Wachzimmers Reichenau in Innsbruck“
Die Abgeordnete Mag. Gisela Wurm überreichte folgendes Anliegen:
„Wiederholten Medienberichten zufolge werden die Kürzungen des Budgets für den Sicherheitsbereich in Innsbruck neben diversen Planposteneinsparungen auch zur Schließung von Wachzimmern, darunter auch das Wachzimmer in der Reichenau führen.
Der Stadtteil Reichenau zählt zu einem stets expandierenden Stadtteil in Innsbruck, mit derzeit etwa 5 000 Haushalten mit insgesamt 16 000 Einwohnern.
Auch der stets zunehmende Verkehr ist für die Bewohner und natürlich auch für die Kinder eine starke Sicherheitsbelastung geworden, dem nur mit einer stärkeren polizeilichen Überwachung begegnet werden kann.
Dazu kommt die ständige Ausweitung des Reichenauer Gewerbegebietes Rossau mit dem damit verbundenen zunehmenden Verkehrsaufkommen.
Sollte das Reichenauer Wachzimmer geschlossen werden, fehlt eine kompetente Anlaufstelle für die Reichenauer Bevölkerung. Die da oder dort kolportierte Alternative, dass es dafür in anderen Wachzimmern zu einer Personalvermehrung kommt, ist auf Grund der gesamtpolitischen Philosophie sehr unwahrscheinlich und für den Stadtteil Reichenau keine Alternative.
Außerdem zählt es zu den politischen Aufgaben der Verantwortungsträger eines Staates, neben einer sparsamen Budgetpolitik auch auf die Sicherheit der Bevölkerung Rücksicht zu nehmen.
Als sichtbares Zeichen
des Protestes haben über 1 300 Menschen in der Reichenau mit ihrer
Unterschrift gegen die Schließung des Wachzimmers Reichenau protestiert.
Weiters geben wir grundsätzlich zu bedenken, dass auch die Schließung von anderen Wachzimmern durch die Mehrheit der Bevölkerung nicht goutiert wird. Gerade in einer Stadt, wo der Fremdenverkehr ein starker Wirtschaftsfaktor ist, ist eine gute und kompetente Überwachung des Verkehrs und die Sicherheit der Gäste und Bewohner als oberstes Gebot zu betrachten.
Wir fordern den Herrn
Bundesminister für Inneres Dr. Ernst Strasser daher auf, von seinem ministeriellen Weisungsrecht
Gebrauch zu machen, um den Weiterbestand des Wachzimmers Reichenau zu sichern.“
In seiner Sitzung am 21. Juni 2001 hat der Ausschuss einstimmig beschlossen, eine Stellungnahme des Bundesministeriums für Inneres einzuholen.
Das Bundesministerium für Inneres teilt dazu Folgendes mit:
„Im Bereich der Gruppe Bundespolizei beschäftigt sich das Projekt ,Wachzimmerstruktur – Reformkonzept‘ unter dem Gesichtspunkt einer möglichsten Qualitätssicherung mit der Optimierung der Aufbauorganisation bzw. der Straffung der Ablauforganisation, um so im Bereich der Bundespolizeidirektionen eine entsprechende Output/Input-Relation in punkto Personal- und Sachmittelressourceneinsatz herbeizuführen.
Inwieweit Zusammenlegungen von Wachzimmern vernünftig erscheinen, wird sich am Ergebnis des Konzeptes orientieren. Jedenfalls wird eine etwaige strukturelle Änderung einerseits von der Zielrichtung einer Erhöhung der Außendienstpräsenz und somit der Hebung des Sicherheitsstandards getragen sein und andererseits den berechtigten Anspruch der Bevölkerung auf sicherheitsdienstliche Betreuung zu erfüllen haben.“
Beschluss mit Stimmenmehrheit in der Sitzung des Ausschusses am 3. April 2002:
Erledigung durch Kenntnisnahme des Ausschussberichtes.
Petition Nr. 36
überreicht vom Abgeordneten Anton Heinzl betreffend „Senkung
ungerechtfertigt hoher Treibstoffpreise“
Die vorliegende Petition hat folgende Forderungen zum Inhalt:
„Die in Österreich tätigen Mineralölkonzerne und Tankstellenpächter veranstalten seit geraumer Zeit eine Treibstoffpreisrally. Treibstoffpreise werden oft zweimal täglich geändert und die Preisniveaus sind regional stark unterschiedlich.
Auf Grund der außerordentlich starken kurzfristigen Preisschwankungen ist es für Konsumenten ohne hohen Aufwand für Informationsbeschaffung nicht mehr ersichtlich, ob das Angebot an der nächstgelegenen Tankstelle preiswert oder teuer ist.
Vor allem in den Ballungszentren liegen die Treibstoffpreise merklich über dem Preisniveau des Umlandes. An den Zapfsäulen der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten bezahlen die Konsumenten um mehr als zehn Prozent höhere Preise als bei den Tankstellen im ländlichen Raum. Der Gemeinderat von St. Pölten hat bereits eine Resolution an den Justizminister verabschiedet und eine gerichtliche Untersuchung der vermuteten Preisabsprachen verlangt.
In den Lokalzeitungen kursieren bereits Bauanleitungen für Diesel-Tankstellen für den Eigenbedarf, damit auch Endverbraucher in den Genuss der Treibstoff-Großhandelspreise kommen können. Dieser Trend ist nicht zuletzt aus umwelttechnischer Sicht bedenklich. Ordentliche Preise an ordentlichen Tankstellen sind gefragt. Der derzeitige Zustand ist unhaltbar.
Die Landeshauptstadt St. Pölten hat deshalb in einer Notwehrmaßnahme Dieseltreibstoff über die vorhandene Betriebstankstelle des Wirtschaftshofes St. Pölten zu günstigen Konditionen verkauft. Die Tankstelle verfügt über alle notwendigen behördlichen Genehmigungen und erfüllt alle Bescheidauflagen.
Eine in St. Pölten tätige Mineralölhandelsfirma hat die Stadt auf Unterlassung wegen unlauteren Wettbewerbs geklagt, obwohl dieselbe Firma zur selben Zeit außerhalb von St. Pölten Dieseltreibstoff zu einem niedrigeren Preis verkauft hat. Auf Grund einer vorläufigen Verfügung des Gerichts wurde der Verkauf an der Betriebstankstelle vorerst gestoppt.
Das ist eine bodenlose Ungerechtigkeit! Warum sollen die Konsumenten die Unvollkommenheit des ,freien‘ Mineralölmarktes bezahlen? Letztendlich konnte mit dieser Aktion der Dieselpreis in St. Pölten gesenkt werden. Es bedarf offensichtlich öffentlicher Intervention, um Marktverzerrungen zu beseitigen.
Marktwirtschaft funktioniert nur dann, wenn die Konsumenten über die verlangten Preise informiert sind. Wenn aber, wie bei den Treibstoffpreisen derzeit üblich, die Tankstellenpreise mehrmals täglich und je nach Lage einer Tankstelle unterschiedlich geändert werden, dann funktioniert der Markt auch nicht mehr und die Konsumenten sind zu Recht verärgert, weil sie diese ,Freuden‘ der freien Marktwirtschaft aus der eigenen Tasche blechen müssen.
Ich fordere deshalb:
– Beseitigung der räumlichen Wettbewerbs- und Preisverzerrungen an den österreichischen Zapfsäulen, wenn notwendig eine Verordnung, die die Mineralölfirmen verpflichtet, österreichweit die gleichen Preise zu verlangen.
– Eine Untersuchung auf Preisabsprachen bei St. Pöltner Tankstellen durch die Preiskommission.
– Eine Verordnung, die die Betreiber von Tankstellen verpflichtet, neben ihren aktuellen Angebotspreisen für die diversen Treibstoffsorten auch die aktuellen österreichischen Mittelpreise den Konsumenten bekannt zu geben, damit eine Wettbewerbsverzerrung auf Grund unvollständiger Information ausgeschlossen werden kann.
– Eine Rahmenverbesserung im Tankstellen-Shopgeschäft, um die Treibstoffpreise um 20 bis 25 Groschen pro Liter zu verbilligen.
– Eine Ausdehnung der unbefristeten Vereinbarung der 40-Groschen-Bandbreitenregelung bei den Nettotreibstoffpreisen auch von der neuen Nummer 1 in Österreich, der BP.
– Eine neue Bandbreitenregelung von 20 Groschen. Es ist nicht einzusehen, dass ein 40-Groschen-Differenzbetrag für ewige Zeiten vereinbart und damit auch genutzt werden kann.
– Eine kontinuierliche Angleichung der Nettopreise an den EU-Durchschnitt.“
In seiner Sitzung am 15. Februar 2002 hat der Ausschuss einstimmig beschlossen, je eine Stellungnahme des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit, der Verbindungsstelle der Bundesländer sowie aller Verkehrsklubs (ÖAMTC, ARBÖ, VCÖ) einzuholen.
Vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit langte folgende Stellungnahme ein:
„Aus wirtschaftspolitischer Sicht wird den Mechanismen der freien Marktwirtschaft durch die von der Petition geforderten Höchst- bzw. Fixpreisregelungen widersprochen und der Wettbewerb behindert. Aus diesen Gründen wurde nicht zuletzt auf Betreiben aller Sozialpartner die bundeseinheitliche Preisregelung aufgehoben.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit hat zur Erhöhung der Markttransparenz und unter gleichzeitiger Förderung des Wettbewerbs den ,Benzinpreis-Monitor‘ auf seiner Homepage-Seite (www.bmwa.gv.at) eingerichtet. Dieser bietet dem Konsumenten umfassende Informationen über die nationale und internationale Preissituation auf dem Treibstoffmarkt. Durch die erweiterte Zusammenarbeit zwischen dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit und den beiden österreichischen Autofahrerverbänden ARBÖ und ÖAMTC, kann sich der Letztverbraucher auf dieser Internetseite auch über billige Tankmöglichkeiten informieren.
So zeigt das Preisband für Diesel am 1. März in der Ostregion Preise zwischen 0,609 € und 0,770 €. Während sich die Preise in St. Pölten zwischen 0,623 € und 0,653 € bewegten, lagen sie zB in Krems zwischen 0,727 € und 0,730 €, in Melk lag der Preis bei 0,696 € und in Herzogenburg bei 0,649 €. Es ist also nicht von einem im Vergleich zum Umland höheren Preis auszugehen.
Im Zusammenhang mit den festzustellenden Preisunterschieden innerhalb des Bundesgebietes wäre darauf aufmerksam zu machen, dass es sich dabei keineswegs um ein österreichisches Phänomen handelt. Regional unterschiedliche Marktgegebenheiten mit gleichzeitig lokalen Besonderheiten bedingen auch in anderen vergleichbaren europäischen Staaten zum Teil nennenswerte Preisdifferenzen.
Im europäischen Vergleich zählt Österreich bei den Letztverbraucherpreisen für Eurosuper 95 und Dieselkraftstoff zu den billigsten Ländern innerhalb der EU.
Im Rahmen einer Monitoring-Gruppe, welcher auch die Sozialpartner angehören, wurde die aktuelle Preisentwicklung wöchentlich überwacht und analysiert. Aus der derzeitigen Beobachtung der Preise lassen sich keine Preisentwicklungen ablesen, die in einem ungewöhnlichem Maße die internationalen Preisentwicklungen gemäß Preisgesetz 1992 übersteigen.
Im Lichte des dargestellten Sachverhalts und unter Bedachtnahme der erreichten Markttransparenz erscheint eine Untersuchung auf Preisabsprache nicht zielführend. Dies insbesondere unter dem Aspekt, dass die derzeitige Preissituation am österreichischen Treibstoffmarkt durch verstärkten Wettbewerb und zusätzlich durch einen ausgeprägten Kampf um Marktanteile gekennzeichnet sind.
Die Angabe des aktuellen österreichischen Mittelpreises für die Treibstoffe ist aus technisch-organisatorischen sowie statistischen Gründen nicht durchführbar. Als Grundvoraussetzung müssten alle Tankstellen elektronisch verknüpft sein. Die Daten müssten in weiterer Folge von einem Zentralcomputer berechnet und mit der abgegebenen Menge gewichtet werden, um statistisch abgesicherte Mittelwerte zu erhalten. Die Kosten für die Errichtung der notwendigen Infrastruktur und den hohen administrativen Aufwand wären entweder von der Mineralölindustrie oder den Konsumenten zu tragen. Dies würde eine zusätzliche Kostenbelastung bzw. Treibstoffpreiserhöhung bedeuten.
Es wird weder nach § 32 UWG, BGBl. Nr. 448/1984, noch nach § 1 in Verbindung mit § 14 Preisauszeichnungsgesetz, BGBl. Nr. 146/1992, die Möglichkeit gesehen, eine Verordnung mit derartigem Inhalt zu erlassen. Diese Bestimmungen sehen einerseits gar nicht die Möglichkeit vor, eine Verordnung für die verpflichtende Angabe von Preisen zu erlassen (§ 32 UWG), andererseits erstreckt sich der Geltungsbereich des Preisauszeichnungsgesetzes (§ 1 PrAG) auf die Angabe von Verkaufspreisen und nicht auf die Angabe von Mittelpreisen, die keinen ,Verkaufspreis‘ darstellen.
Um den Konsumenten über die jeweiligen Preise zu informieren, ist in § 5 der Verordnung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit eine Verpflichtung zur Treibstoffpreisauszeichnung vorgesehen. Darin haben die Betreiber von Tankstellen die Preise für Normal- und Superbenzin sowie für Dieselkraftstoff auf dem Tankstellenareal auf eine solche Art auszuzeichnen, dass motorisierte Straßenbenützer von der Fahrbahn aus bei einer für das Zufahren zur Tankstelle entsprechend reduzierter Geschwindigkeit die Preise leicht lesen und zuordnen können.
Die Differenz von 0,0291 € der österreichischen Nettopreise für Treibstoffe zum jeweiligen EU-Durchschnitt ergibt sich auf Grund von im EU-gemeinschaftlichen Vergleich aufwendigeren Versorgungskosten (zirka 0,0182 €/l) und restriktiveren gewerberechtlichen Rahmenbedingungen für österreichische Tankstellenshops (zirka 0,0109 €/l). Für diesen 0,0291 € Abstand, welcher eine Empfehlung des Wirtschaftsministeriums darstellt, gibt es seitens der OMV die Zusage, ihn unbefristet einzuhalten. Wie die Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit aber zeigen, halten sich auch die anderen in Österreich tätigen Firmen an diese Empfehlung.
Der 0,0291-€-Abstand wurde mit den Sozialpartnern akkordiert. Weitere Kostennachteile in der Höhe von rund 0,0182 €/l ergeben sich durch strengere Umweltauflagen und Baubestimmungen für Tankstellen in Österreich gegenüber dem europäischen Ausland. Dieser Betrag ist aber in der 0,0291-€-Begrenzung nicht enthalten.“
Die Verbindungsstelle der Bundesländer legt zur gegenständlichen Petition folgende Stellungnahmen vor:
Vom Amt der Wiener Landesregierung:
„Nach der Verfassungsbestimmung des § 5a Preisgesetz 1992 hat der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten von Amts wegen zu untersuchen, ob bei Erdöl und seinen Derivaten der geforderte Preis oder die vorgenommene Preiserhöhung auf eine ungerechtfertigte Preispolitik eines oder mehrerer Unternehmen zurückzuführen ist. Es müssen aber auch Vergleiche mit den Preisen dieser Produkte in vergleichbaren europäischen Staaten gezogen werden, sodass sich der Höchstpreis an diesen orientieren kann.
Dem Bundesminister wird die Befugnis eingeräumt, im Falle einer ungerechtfertigten Preispolitik für die Dauer von sechs Monaten einen Höchstpreis festzusetzen, wenn volkswirtschaftlich nachteilige Folgen zu erwarten sind.
Bei den in der Petition angeführten Treibstoffpreisunterschieden handelt es sich offenbar um solche, die im Raum St. Pölten aufgetreten sind, über dessen Marktsituation in Wien keine Informationen vorliegen. Der Stadt Wien stehen auch keine die Treibstoffpreise in Wien betreffenden Vergleichsdaten zur Verfügung.“
Vom Amt der Tiroler Landesregierung:
„Es ist eine Tatsache, dass die Treibstoffpreise in Österreich auf einem sehr hohen Niveau angesiedelt sind. Das Preisniveau im Westen Österreichs ist zum Teil noch höher als das Preisniveau in den östlichen Bundesländern. In Tirol werden die Vorschriften für die Preisauszeichnung bei Tankstellen eingehalten. Dies bedeutet, dass die Preise für jedermann transparent sind.
Zu einzelnen Forderungen in der obgenannten Petition wird Folgendes festgestellt:
Erlassung einer Verordnung mit österreichweit gleichen Preisen:
Gemäß § 5a Preisgesetz 1992, BGBl. Nr. 145/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 50/1999 besteht nur unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, bei Erdöl oder seinen Derivaten Höchstpreise zu bestimmen. Die Festlegung volkswirtschaftlich gerechtfertigter Preise im Sinne des § 2 Preisgesetz 1992 ist für Erdölderivate nicht möglich. Die Festlegung von Höchstpreisen ist an strenge Vorgaben gebunden. So ist dies nur möglich, wenn einerseits der inländische Preis
– das Preisniveau in vergleichbaren europäischen Ländern in ungewöhnlichem Maß übersteigt,
– auf eine ungerechtfertigte Preispolitik zurückzuführen ist und
– volkswirtschaftlich nachteilige Auswirkungen hat.
Diese Voraussetzungen müssen alle kumulativ vorliegen. Ebenso muss das Vorliegen dieser Voraussetzungen nachvollziehbar ermittelt werden, wobei dies dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit obliegt. Der nach § 5a Abs. 2 Preisgesetz vorgesehene Höchstpreis hat sich weiter
– an der Preisentwicklung in vergleichbaren europäischen Ländern zu orientieren und
– allfällige besondere volkswirtschaftliche Verhältnisse des betreffenden Wirtschaftszweiges zu berücksichtigen.
Unter diesen Voraussetzungen erscheint die Festlegung eines Höchstpreises zumindest sehr aufwändig, wobei fraglich ist, ob dies überhaupt verwirklichbar ist.
Untersuchung von Preisabsprachen:
Die Preiskommission nach dem Preisgesetz 1992 ist für die Untersuchung von Preisabsprachen nicht zuständig. Derartige Untersuchungen sind im Rahmen der kartellrechtlichen Bestimmungen abzuhandeln.
Verordnung für Betreiber von Tankstellen:
Ebenso fehlt einer Verordnung, die die Betreiber von Tankstellen verpflichtet, neben ihren aktuellen Angebotspreisen für die diversen Treibstoffsorten auch die aktuellen österreichischen Mittelpreise dem Konsumenten bekannt zu geben, ist keine Rechtsgrundlage vorhanden. Die Preisauszeichnungsvorschriften beruhen auf dem Preisauszeichnungsgesetz, BGBl. Nr. 146/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 55/2000 sowie der Verordnung BGBl. Nr. 813/1992 in der Fassung BGBl. I Nr. 180/2001 betreffend Preisauszeichnung für bestimmte Leistungen und für Treibstoffe bei Tankstellen. Das Preisauszeichnungsgesetz sieht keine weitergehende Verordnungsermächtigung vor.“
Vom Amt der Niederösterreichischen Landesregierung:
„Zur Festlegung amtlicher Höchstpreise hat anlässlich einer entsprechenden Resolution des Landtages von Niederösterreich vom 19. Juni 2001, Lt.-Zl. 770/V-9, der dafür zuständige Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit folgende Stellungnahme abgegeben:
,Unter Bedachtnahme auf versorgungspolitische Aspekte vertrete ich die Auffassung, dass der vom Niederösterreichischen Landtag beschlossene Resolutionsantrag der Abgeordneten Haberler, Ing. Hofbauer und Schabl, bezüglich einer behördlichen Preisregelung für Treibstoffe weder zeitgemäß noch zweckmäßig ist. Gerade in einer Ära der zunehmenden Globalisierung der Weltwirtschaft ist dem Einsatz marktwirtschaftlicher Instrumente gegenüber ökonomisch überholten Maßnahmen der staatlichen Eingriffsverwaltung eindeutig der Vorzug einzuräumen. Zur Festlegung, wonach die Freigabe der Treibstoffpreise dazu geführt habe, dass deren Niveau regional unterschiedlich, dafür aber gebietsweise einheitlich ist, möchte ich darauf hinweisen, dass dieses Faktum auf Grund marktwirtschaftlicher sowie lokaler Wettbewerbsmechanismen auch zu Zeiten der behördlichen Höchstpreisregelung gegeben war. In diesem Zusammenhang ist darauf aufmerksam zu machen, dass es sich dabei keineswegs um ein österreichisches Phänomen handelt. Regional unterschiedliche Marktgegebenheiten führen auch in anderen vergleichbaren europäischen Staaten zu den gleichen Effekten.
Als Beispiel sei Deutschland genannt, in dem seit jeher bundesländerweise, in Abhängigkeit von der geographischen Lage, unterschiedliche Treibstoffpreise an der Tagesordnung sind und darüber hinaus lokale Gegebenheiten eine Rolle spielen.‘
Für eine Untersuchung auf Preisabsprachen ist die Kartellbehörde zuständig.
Für eine Verordnung, die die Betreiber von Tankstellen verpflichtet, neben den von ihnen verlangten Preisen auch die aktuellen Mittelpreise bekannt zu geben, fehlt nach unserer Auffassung die gesetzliche Grundlage. Darüber hinaus würde das auch noch einen zusätzlichen bürokratischen Aufwand erfordern.
Beschränkungen hinsichtlich der Shopflächen in Tankstellen (80 m2) sowie der Shop-Artikel befinden sich in § 279 der Gewerbeordnung 1994.
Mit dem derzeit im Begutachtungsstadium befindlichen Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem die Gewerbeordnung 1994 geändert wird, soll § 279 GewO 1994 entfallen, wodurch eine Rahmenverbesserung für das Tankstellen-Shopgeschäft verwirklicht würde.
Anzumerken ist, dass am 8. Oktober 1999 eine Sitzung der Arbeitsgruppe zur Treibstoffnettogestaltung beim Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit stattfand. In dieser Sitzung wurde von der Mineralölwirtschaft der Preisnachteil wegen der Beschränkungen bei Shop-Flächen, Shop-Artikel und Öffnungzeiten gegenüber Ländern, in denen die Nettotreibstoffpreise weit niedriger sind, mit 15 g/l quantifiziert.“
Vom Amt der Salzburger Landesregierung:
„Zur übermittelten Petition kann festgestellt werden, dass die angesprochenen regionalen Unterschiede auch im Bundesland Salzburg festgestellt werden können. Regionale Unterschiede gibt es sowohl im Hinblick auf Stadt/Land Salzburg als auch innerhalb der Gaue. Aktuelle Preise würden auf Grund der häufigen Schwankungen eine tägliche Überprüfung notwendig machen. Im Hinblick auf die in allen Bundesländern gegebenen Personalknappheit und die Freigabe der Preise wurden derartige Erhebungen nur mehr auf besonderen Auftrag bzw. aus besonderen Anlässen getätigt. Auf Grund des vorliegenden sporadisch erhobenen Zahlenmateriales können keine detaillierten Aussagen über die derzeitige Preissituation gemacht werden. Die regional gegebenen Unterschiede werden auf Anfrage von Seiten der Mineralölhändler bzw. Tankstellenpächter mit den besonderen geografischen Gegebenheiten des Bundeslandes Salzburg begründet.
Aufgefallen ist, dass der Preisunterschied zwischen Normalbenzin (95 Oktan) und Superbenzin (98 Oktan) immer geringer wird. Die Preisunterschiede zwischen den einzelnen Marken werden ebenfalls immer unbedeutender. Lediglich so genannte Billigtankstellen (Diskonter) weichen geringfügig von den Markentankstellen ab.“
Vom Amt der Burgenländischen Landesregierung langte eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt ein:
„Zur übermittelten Petition kann festgestellt werden, dass die Erfahrungen bei der Vollziehung preisrechtlicher Bestimmungen in der Vergangenheit wiederholt gezeigt haben, dass die Grenzen des Freien Marktes, vor allem aber des Mineralölmarktes, dort enden, wo offensichtlich Kartellabsprachen diese Mechanismen zunichte machen.
Es scheint mehr als verwunderlich, dass exakt zur gleichen Tages- und Nachtzeit die verschiedenen Mineralölanbieter deren Zapfsäulen den geänderten Preisen anpassen. Durch die laufende Änderung der Treibstoffpreise funktioniert zweifelsohne der Informationsfluss zu den Konsumenten auch nicht mehr. Zu dem ist der Konsument nicht gewillt, wegen geringfügiger Ersparnisse Umwege, die sich zu dem in Folge zusätzlicher Präferenzen, wie Zeitersparnis oder freundliche Bedienung für ihn subjektiv betrachtet nicht rechnen, in Kauf zu nehmen. Abhilfe könnte daher nur ein Musterprozess vor einem Kartellgericht oder eine amtliche Preisregelung im Verordnungsweg bringen.“
Das Amt der Steiermärkischen Landesregierung teilt dazu mit, dass aus ressortmäßiger Sicht zur gegenständlichen Petition keine Stellungnahme abgegeben werden kann.
Vom ÖAMTC traf eine Stellungnahme mit folgendem Wortlauf ein:
„– Die Situation der Kraftstoffpreise in Österreich im Vergleich zum EU-Durchschnitt
Bis zum Jahr 1996 wurden verschiedene Methoden angewandt, die Kraftstoffpreise in Österreich zu kontrollieren. Nach Phasen der Preisregelung war es zuletzt das so genannte ,Prinzip der gläsernen Taschen‘. Da letztendlich keines dieser Preisregelungssysteme für den Konsumenten, aber auch für die Mineralölfirmen, zufriedenstellend war, wurde ab 22. April 1996 der ,Markt freigegeben‘.
Die Konsumenten erhofften sich durch die Liberalisierung sinkende Preise und dies mit gutem Grund: mehr Wettbewerb bedeutet nach den Gesetzen der Marktwirtschaft sinkende Preise (bis hin zum Grenzkostenbereich). Dieser Mechanismus funktioniert in Österreich jedoch mangels tatsächlich freien Wettbewerbs nur sehr beschränkt.
Aufschlüsse darüber gibt die Preisbeobachtung im Vergleich zum EU-Durchschnitt. Seitens der EU wird wöchentlich (meist montags) eine Preiserhebung der durchschnittlichen (gewichteten) Netto- und Bruttopreise in allen Mitgliedsländern durchgeführt und veröffentlicht.
Ab der Preisfreigabe in Österreich 1996 wurden die Vergleichsdaten besonders genau beobachtet. Dabei zeigte sich bis ins Jahr 1999, dass Superbenzin (95 Oktan, unverbleit) in Österreich netto stets um rund 80 Groschen/5,8 Cent, Diesel um etwa 60 Groschen/4,4 Cent teurer war als im EU-Durchschnitt.
Die Minerealölwirtschaft versuchte diesen ,Österreich-Preisaufschlag‘ wie folgt zu begründen:
– höhere Transportkosten,
– höhere Umweltstandards,
– höhere Tankstellendichte,
– geringere Umsatzmöglichkeiten in den Shops.
Die Interessenvertreter der Konsumenten konnten diesen Argumenten nur zu einem Teil zustimmen. Der ÖAMTC vertritt jedenfalls die Meinung, dass die in verschiedenen Ländern bestehenden Wettbewerbsnachteile sich in der großen Zahl der Mitgliedsländer und darin vertretenen Tankstellenpreise egalisieren. Daher stellt nach Ansicht des ÖAMTC der Vergleich der österreichischen Nettopreise mit Nettopreisen im EU-Durchschnitt ein brauchbares Maß dar. Auch in anderen Branchen werden Produktpreise jenen des EU-Durchschnitts gegenübergestellt.
Beim ersten ,Benzinpreisgipfel‘ im September 1997 (mit BM Farnleitner) wurde erstmals vage das Ziel des EU-Niveaus der österreichischen Netto-Kraftstoffpreise angesprochen, ähnlich beim zweiten ,Gipfel‘ im April 1998. Aber erst nach dem dritten Gespräch im März 1999 und einer Änderung des Preisgesetzes, die eine sofortige Preisregelung ermöglicht hätte, einigte sich die Mineralölwirtschaft mit dem Wirtschaftsminister darüber, künftig pro Liter nicht um mehr als 40 Groschen/2,9 Cent teurer sein zu wollen als im EU-Durchschnitt.
Nach neuerlichen Diskussionen und Protesten des ÖAMTC wegen wiederholter Nichteinhaltung wurde die 40-Groschen-Vereinbarung im September 2000 auch mit BM Bartenstein verlängert. Gleichzeitig wurde seitens der Konsumentenvertreter eine stufenweise Absenkung auf vorerst 20 Groschen/1,5 Cent Differenz verlangt, bei gleichzeitiger Angabe einer Frist bis zur Erreichung der Null-Differenz = österreichische Nettopreise auf EU-Niveau.
Derzeit (2002) liegen die österreichischen Nettopriese im Durchschnitt um diese rund 20 Groschen/1,5 Cent über dem EU-Durchschnitt. Das bedeutet, dass sich die österreichischen Autofahrer gegenüber der Situation vor einigen Jahren (bis zu 80 Groschen/5,8 Cent Differenz) rund 4 Milliarden Schilling/290 Millionen Euro pro Jahr ersparen. Gleichzeitig aber auch, dass sie im Vergleich zum EU-Durchschnitt noch immer mehr als eine Milliarde Schilling/73 Millionen Euro zuviel bezahlen müssen.
Der ÖAMTC verlangt daher ab sofort (März 2002 – drei Jahre nach der ersten Vereinbarung) eine Fixierung der 1,5-Cent-Grenze/20-Groschen-Grenze (anstatt 40 Groschen) und innerhalb eines Jahres das Erreichen der Null-Differenz!
– Die Wettbewerbssituation am Kraftstoffmarkt innerhalb Österreichs
Der ÖAMTC bietet den Konsumenten auf seiner Internet-Homepage unter http://www.oeamtc.at/sprit tagesaktuelle Preisübersichten von Tankstellen in ganz Österreich. Die Preise werden von Tankstellen selbst und/oder von interessierten Konsumenten gemeldet. Diese Übersichten verfolgen zwei Funktionen: die Konsumenten über günstige Tankmöglichkeiten zu informieren und damit zu mehr Markttransparenz und Wettbewerb beizutragen. Rund ein Drittel aller österreichischen Tankstellen wird repräsentiert. Auf Grund dieser Zielsetzung sind günstige Tankstellen überproportional vertreten.
Der ÖAMTC ist mit Hilfe dieser Übersichten in der Lage, tagesaktuell einen Überblick über die Preissituation nach verschiedenen Kriterien zu schaffen – geordnet nach Kraftstoffsorte, Billigst- und Höchstpreis, Mittelwert; aber auch regionale Unterschiede festzustellen, nach Bundesländern, und die Ortung von so genannten ,Trichtern‘.
Generell lässt sich ein starkes West-Ost-Gefälle bemerken. Die westlichsten Bundesländer weisen eine starke Preiskonzentration auf hohem Preisniveau auf (insbesondere Vorarlberg, Tirol, auch Salzburg). Gleichzeitig ist der Anteil der Majors in diesen Bundesländern sehr hoch. In den östlichsten Bundesländern (Wien, Burgenland) sind häufig die günstigsten Preise zu finden. Grund dafür ist die große Anzahl an Diskontern und teilweise starke Konkurrenz (insbesondere in bestimmten Bezirken Wiens).
Benzinpreis – Stichtagsvergleich vom 5. Februar 2002
|
|
Super+ |
Super |
Normal |
Diesel |
||||||||
|
Bundesland |
von |
bis |
Diff. |
von |
bis |
Diff. |
von |
bis |
Diff. |
von |
bis |
Diff. |
|
Burgenland |
0,819 |
0,941 |
0,122 |
0,740 |
0,876 |
0,136 |
0,739 |
0,861 |
0,122 |
0,653 |
0,749 |
0,096 |
|
Kärnten |
0,889 |
0,956 |
0,067 |
0,759 |
0,873 |
0,114 |
0,758 |
0,858 |
0,100 |
0,639 |
0,746 |
0,107 |
|
Niederösterreich |
0,819 |
0,964 |
0,145 |
0,749 |
0,890 |
0,141 |
0,739 |
0,880 |
0,141 |
0,690 |
0,790 |
0,100 |
|
Oberösterreich |
0,802 |
0,956 |
0,154 |
0,744 |
0,890 |
0,146 |
0,730 |
0,876 |
0,146 |
0,629 |
0,785 |
0,156 |
|
Salzburg |
0,819 |
0,970 |
0,151 |
0,749 |
0,890 |
0,141 |
0,729 |
0,880 |
0,151 |
0,629 |
0,790 |
0,161 |
|
Steiermark |
0,854 |
0,960 |
0,106 |
0,779 |
0,880 |
0,101 |
0,770 |
0,899 |
0,129 |
0,624 |
0,749 |
0,125 |
|
Tirol |
0,860 |
1,010 |
0,150 |
0,767 |
0,940 |
0,173 |
0,689 |
0,930 |
0,241 |
0,657 |
0,820 |
0,163 |
|
Vorarlberg |
0,936 |
0,941 |
0,005 |
0,869 |
0,880 |
0,011 |
0,856 |
0,861 |
0,005 |
0,761 |
0,770 |
0,009 |
|
Wien |
0,851 |
0,956 |
0,105 |
0,760 |
0,890 |
0,130 |
0,754 |
0,876 |
0,122 |
0,659 |
0,785 |
0,126 |
In den großen Bundesländern Niederösterreich, Oberösterreich und Steiermark sind beide Strömungen vertreten – Preistrichter mit günstigen Preisen ebenso wie (teilweise eng begrenzte) Regionen mit gleichmäßig hohem Preisniveau. In Niederösterreich gehört die Region südlich von Wien (Raum Baden usw.) meist zu den günstigsten (vergleichbar Wien, Burgenland). Im nördlichen Niederösterreich (Waldviertel allgemein, Korneuburg, Gänserndorf, Hollabrunn), aber auch in den Städten (Krems, St. Pölten) sind die Preise allgemein höher. Dies geht zu Lasten jener Autofahrer, vor allem Pendler, für die sich die weite Anfahrt zu einer Tankstelle in einer günstigeren Region nicht auszahlt.
Der ÖAMTC fordert Maßnahmen zur Belebung des Wettbewerbs. Insbesondere sollte überprüft werden, ob Outsider dieselbe Zugangsmöglichkeit zum Markt haben wie die Majors. Unter anderem sollte zum Beispiel auch die Rolle des Großhandels überprüft werden. Nur mittels unabhängigen Großhandels erscheint es möglich, die Belieferung der Outsider sicherstellen zu können, die das Preisgefüge zugunsten der Konsumenten in Bewegung bringen könnten (Preisbrecherfunktion). Das Zurückdrängen der Outsider im Einzelhandel und im Großhandel minimiert den freien Wettbewerb.
Die geringere Anzahl der Nicht-Majors ist unserer Meinung nach einer der Gründe dafür, dass der freie Wettbewerb in Österreich nicht in der erwünschten Form zugunsten der Konsumenten funktioniert. Diese Meinung vertritt auch der österreichische Wirtschaftswissenschafter Dr. Wilfried Puwein (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung), der im Jahr 1999 eine Studie über den Kraftstoffmarkt in Österreich erstellt hat. Darin führt er einige Argumente bezüglich des ,dominanten Oligopols‘ der Majors aus, sowie über deren Strategie, Outsiders aufzukaufen.
– Zusammenfassung – Forderungen des ÖAMTC
– Sofortiger Ersatz der bisherigen ,40-Groschen-Grenze‘ durch eine ,1,5-Cent-Grenze‘, um welche die österreichischen Nettopreise nicht jene im EU-Durchschnitt überschreiten dürfen;
– Angabe einer Frist seitens der Mineralölwirtschaft, zu welchem Zeitpunkt die ,Null-Differenz‘ zwischen österreichischen und EU-Nettopreisen erreicht werden soll;
– Förderung des Wettbewerbs innerhalb der österreichischen Anbieter durch verschiedene Maßnahmen, insbesondere
– Überprüfung der Marktzugangsmöglichkeiten für Outsider,
– Maßnahmen zur Beseitigung des massiven Ost-West-Gefälles,
– einfacheren (anonymen) Zugang zu kartellrechtlichen Untersuchungen für von Repressalien (zB Lieferstopps) bedrohte Outsider.“
Vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ) langte eine Stellungnahme samt der letzten Pressemitteilung zum Thema Treibstoffpreise ein:
„Zur Forderung nach stabilen Treibstoffpreisen
Die Mineralölkonzerne haben in früheren Jahrzehnten kurzfristige Preisschwankungen des Rohöls nicht sofort weitergegeben und so für eine Verstetigung der Preisentwicklung gesorgt.
Diese Vorgangsweise hat ihnen von Seiten der Autoklubs den Vorwurf der ,Preistreiberei‘ eingetragen, wenn ein Rückgang des Rohölpreises nicht sofort in Form niedrigerer Treibstoffpreise an die Konsumenten weitergegeben wurde. Wie weit dieser Vorwurf berechtigt war, soll hier nicht beurteilt werden.
Der VCÖ findet, dass die daraufhin eingeführte rasche Anpassung der Preise an geänderte Marktbedingungen eine legale und marktkonforme Vorgangsweise ist. Dieses gilt auch, wenn die Treibstoffpreise die 40-Groschen-Bandbreitenregelung überschreiten. Im Vergleich zu anderen Verbrauchsgütern hat Treibstoff eine sehr klare Preisauszeichnung (der Preis kann schon außerhalb der Tankstellen erfahren werden), wodurch den Konsumenten eine reale Wahl gewährleistet ist.
Trotz höheren Preisen in Ballungsräumen kann Österreich derzeit ohne Übertreibung als Treibstoffdiskonter der EU bezeichnet werden. Bei Diesel liegt Österreich um 10 Cent unter dem EU-Durchschnitt, bei Super 95 sogar um 18 Cent [1]). Der VCÖ schlägt vor, dass dieser Preisvorsprung gegenüber den anderen EU-Staaten für die Einführung einer Energiesteuer auf Treibstoffe genutzt wird. Denn derzeit zahlt nur die ökologisch verträglichere und auch ökonomisch effizientere Bahn Energiesteuer. Die Energiesteuer für Treibstoffe wäre ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und zur Erreichung der Kyoto-Ziele. Wie umfangreiche Untersuchungen des VCÖ ergaben, stellen die CO2-Emissionen des Verkehrs in Österreich ein wachsendes Problem dar.
Zur Forderung nach Angabe aktueller Treibstoff-Durchschnittpreise
Es ist Aufgabe des Staates für klare Preisauszeichnung zu sorgen. Diese ist im Treibstoffhandel gegeben. Der VCÖ findet dagegen nicht, dass es Aufgabe des Staates ist, die Händler darüber hinaus zur Bekanntgabe irgendwelcher Durchschnittspreise zu verpflichten.
Zum geäußerten Verdacht der Preisabsprachen
Der Staat hat keinen Grund in die Preisbildung auf einem funktionierenden Markt einzugreifen (auch nicht in Form von ,Bandbreiten-Regelungen‘). Aufgabe des Staates ist es jedoch, das Funktionieren des Marktes sicherzustellen, um den freien Marktzugang für in diesem Fall alle Treibstoffproduzenten sicherzustellen und um Preisabsprachen zu verhindern.
Der Schutz des Konsumenten vor illegalen Preisabsprachen und vor marktbeherrschenden Oligopolen ist ein berechtigtes Anliegen, das vom VCÖ unterstützt wird.“
„VCÖ-MEDIENINFORMATION
Wirtschaft/Benzinpreis/EU-Preisvergleich
EU-Preisvergleich zeigt: Österreich ist der Treibstoffdiskonter in der EU
VCÖ (Wien, 6. März
2002) – Der Preisvergleich der Treibstoffpreise innerhalb der EU zeigt, dass
Österreich ein Billigbenzinpreisland ist. Diesel und Super 95 kosten in
Österreich um 10 Cent bzw. 18 Cent weniger als im EU-Durchschnitt.
Diese Preisdifferenz sollte für die Einführung einer Energiesteuer auf Treibstoffe
genutzt werden. Der VCÖ schlägt eine Abgabe von 7 bis 9 Cent pro Liter
vor. Derzeit zahlt nur die umweltfreundlichere Bahn Energiesteuer.
Der Euro-Preisvergleich führt ein für viele überraschendes Ergebnis zu Tage: Benzin und Diesel kosten in Österreich deutlich weniger als in den meisten anderen EU-Staaten. Für 20 Euro erhält man in Österreich 28,5 Liter Diesel, in Italien nur 24 Liter und in Großbritannien überhaupt nur 16,5 Liter. Ähnliches gilt für Super 95: Für 20 Euro fließen in Österreich 24 Liter Super 95 in den Tank, in Italien 20 Liter und in Großbritannien nur 17 Liter.
,Österreich kann ohne Übertreibung als Treibstoffdiskonter der EU bezeichnet werden. Bei Diesel liegen wir um 10 Cent unter dem EU-Durchschnitt, bei Super 95 sogar um 18 Cent. Diesen Preisvorsprung gegenüber den anderen EU-Staaten sollten wir für die Einführung einer Energiesteuer auf Treibstoffe nutzen. Denn derzeit zahlt nur die ökologisch verträglichere und auch ökonomisch effizientere Bahn Energiesteuer. Und das ist absurd‘, stellt Dipl.-Ing. Wolfgang Rauh vom VCÖ-Forschungsinstitut fest.
Der VCÖ schlägt eine Energiesteuer für einen Liter Benzin in der Höhe von 7 Cent vor und für Diesel auf Grund des höheren Energieinhalts von 9 Cent pro Liter. ,Die billigen Treibstoffpreise sind ungerecht. Sie bevorzugen den LKW-Güterverkehr und die Vielfahrer. Angesichts des enormen Verkehrswachstums und des Zieles Nulldefizit können wir uns diese Förderung nicht leisten‘, betont VCÖ-Experte Rauh.
Treibstoffpreise in Euro/Liter in der EU (Quelle: Benzinpreismonitor des BMWA)
|
Land |
Super
95 |
Diesel |
Land |
Super
95 |
Diesel |
|
Großbritannien |
1,22 |
1,15 |
Frankreich |
0,96 |
0,74 |
|
Niederlande |
1,1 |
0,76 |
Belgien |
0,93 |
0,69 |
|
Dänemark |
1,03 |
0,78 |
Portugal |
0,86 |
0,65 |
|
Finnland |
1,02 |
0,79 |
Österreich |
0,83 |
0,7 |
|
Deutschland |
1,01 |
0,82 |
Irland |
0,82 |
0,76 |
|
EU-Durchschnitt |
1,01 |
0,8 |
Spanien |
0,77 |
0,67 |
|
Italien |
1 |
0,83 |
Luxemburg |
0,74 |
0,6 |
|
Schweden |
0,97 |
0,81 |
Griechenland |
0,7 |
0,59“ |
Die Stellungnahme des ARBÖ lautet wie folgt:
„Der ARBÖ beobachtet laufend die Entwicklung der Treibstoffpreise. Die Preisgestaltung beim Benzin- und Dieselpreis ist abhängig vom Rohölpreis, dem Dollar-Wechselkurs und hinsichtlich Fertigprodukte von internationalen Märkten (vor allem Rotterdam-Markt).
Ein Vergleich der Preise ohne Steuern (= Produktpreis ab Raffinerie) in Österreich zu allen anderen EU-Staaten ist geeignet. Der Bruttopreis (= Pumpenpreis inklusive Mineralölsteuer, Lagerkostenanteil und Mehrwertsteuer) zeigt, dass Österreich im letzten Drittel der europäischen Pumpenpreise liegt.
Vergleicht man die österreichischen Nettopreise zum EU-Durchschnitt für das Jahr 2001, lag die Nettodifferenz beim Eurosuper insgesamt 20-mal unter 30 Groschen bzw. 6-mal unter 20 Groschen. Beim Diesel lag die Nettopreisdifferenz 42-mal unter 30 Groschen bzw. 21-mal unter 20 Groschen.
Im Jahresschnitt 2001 liegt die Nettopreisdifferenz beim Eurosuper bei 0,30 Groschen und beim Diesel bei 0,20 Groschen. Diese Entwicklung lässt erkennen, dass die österreichische Mineralölwirtschaft einerseits eine Preisgestaltung durchführen kann, bei der die Differenz zum EU-Durchschnitt gering gehalten ist. Die Nettopreise sollten sich kontinuierlich an den EU-Durchschnitt angleichen, an der Obergrenze der derzeit vereinbarten 40-Groschen-Bandbreitenregelung muss daher nicht mehr festgehalten werden.
Die Erwartungshaltung der Kraftfahrer ist sehr stark auch von der Haltung des zuständigen Wirtschaftsministers geprägt. Ein erster Schritt bei dem längst diskutierten Stufenplan ist erforderlich. 0,014 Euro (20 Groschen) als Orientierungsgröße im Vergleich zum Durchschnitt in allen EU-Staaten gehören aus Sicht des ARBÖ von Wirtschaftsminister Dr. Martin Bartenstein deutlich gemacht.
Was Konsumenten nicht verstehen, sind die großen Preisschwankungen innerhalb einer Stadt, eines Bezirkes bzw. Bundeslandes. Fehlender Wettbewerb infolge Fehlen von aktiven Diskonttankstellen sind beispielsweise in St. Pölten mit ein Grund für hohe Treibstoffpreise.
Österreichweit sind nach wie vor Preisdifferenzen bis zu 0,182 Euro (2,50 S) pro Liter Treibstoff festzustellen. Es ist aber auch erkennbar, dass in jenen Bezirken, in denen vermehrt Diskonttankstellen angesiedelt sind, die Treibstoffpreise auch an den Markentankstellen wesentlich günstiger sind (so genannte Trichterlösung).
Das österreichische Tankstellennetz mit rund 3 000 Stationen ist zu umfangreich und zu modernisieren, die Mineralölwirtschaft selbst erklärt mit 2 000 Stationen auskommen zu können. Der Fachverband der Mineralölindustrie kann jedoch keine nennenswerte Netzbereinigung vorweisen. Die Zahl der Tankstellenschließungen in Österreich betrug im Jahr 2000 gerade noch 1,6 Prozent. In den Jahren davor hatte die Schließungsrate im heimischen Tankstellennetz vier bis fünf Prozent betragen.
Es ist abzuwarten, welche Auswirkungen die Ökoauflagen für das zu ,bereinigende‘ Tankstellennetz hat, wie viele Tankstellen geschlossen werden und welche Auswirkungen dies auf die Treibstoffpreisgestaltung haben wird. Auch darauf kann der Wirtschaftsminister, als Zuständiger für die Gewerbeordnung, den Kraftfahrern Antwort geben.
Nicht einzusehen ist, dass in Österreich höhere Vertriebskosten als in anderen EU-Staaten entstehen, der Verkauf in Tankstellen-Shops durch Auflagen behindert wird und insgesamt zu viele Tankstellen bestehen. Die Konsumenten haben kein Verständnis dafür, dass in diesen Jahren nicht allzu viel an Verbesserungen der Vertriebsstrukturen und der Durchsetzung von vermehrten Tankstellenshops erfolgte. Nach Angaben von Vertretern der Mineralölwirtschaft würde alleine eine Rahmenverbesserung im Tankstellengeschäft die Treibstoffpreise um bis zu 0,018 Euro (25 Groschen) je Liter billiger werden lassen.
Die Verpflichtung der österreichischen Mineralölwirtschaft auch gegenüber ausländischen Shareholdern ist bekannt, trotzdem sollte der Konsument in Österreich im Vordergrund stehen. An der Mineralölwirtschaft liegt es zu beweisen, dass sie eine Strukturbereinigung vorantreibt. Auf Dauer sind die höheren Nettopreisdifferenzen gegenüber andern EU-Staaten nicht gerechtfertigt, die sich aus Strukturproblemen ergeben.
Internationale Entwicklungen bei Rohölpreisen sind eine Sache, hausgemachte Probleme der österreichischen Mineralölwirtschaft im Vertrieb eine andere. Probleme infolge eines dichten Tankstellennetzes und im Bereich der Tankstellen-Shops in Österreich können nach Ansicht des ARBÖ auf Dauer daher nicht auf dem Rücken der Kraftfahrer ausgetragen werden.“
„Tabelle 9:
Differenz österreichischer Nettopreise zum EU-Durchschnitt 2001
Angaben in Groschen je Liter
Stand: 15. März 2002
|
lfd. Nr. |
Monat |
Eurosuper |
Diesel |
Monats- |
Monats- |
ÜS der OG |
ÜS der OG |
|
1. |
8. Jänner |
0,44 |
0,38 |
|
|
|
|
|
2. |
10. Jänner |
0,27 |
0,32 |
|
|
|
|
|
3. |
23. Jänner |
0,32 |
0,32 |
|
|
|
|
|
4. |
31. Jänner |
0,28 |
0,16 |
0,32750 |
0,29500 |
1 |
0 |
|
5. |
5. Februar |
0,18 |
0,14 |
|
|
|
|
|
6. |
12. Februar |
0,21 |
0,09 |
|
|
|
|
|
7. |
21. Februar |
0,40 |
0,17 |
|
|
|
|
|
8. |
27. Februar |
0,38 |
0,25 |
0,29250 |
0,16250 |
0 |
0 |
|
9. |
6. März |
0,33 |
0,18 |
|
|
|
|
|
10. |
13. März |
0,34 |
0,15 |
|
|
|
|
|
11. |
20. März |
0,41 |
0,29 |
|
|
|
|
|
12. |
27. März |
0,31 |
0,21 |
0,34750 |
0,20750 |
1 |
0 |
|
13. |
3. April |
0,25 |
0,24 |
|
|
|
|
|
14. |
10. April |
0,20 |
0,20 |
|
|
|
|
|
15. |
24. April |
0,27 |
0,25 |
0,24000 |
0,23000 |
0 |
0 |
|
16. |
2. Mai |
0,34 |
0,37 |
|
|
|
|
|
17. |
8. Mai |
0,28 |
0,37 |
|
|
|
|
|
18. |
15. Mai |
0,29 |
0,28 |
|
|
|
|
|
19. |
22. Mai |
0,37 |
0,38 |
|
|
|
|
|
20. |
29. Mai |
0,32 |
0,28 |
0,32000 |
0,33600 |
0 |
0 |
|
21. |
7. Juni |
0,25 |
0,28 |
|
|
|
|
|
22. |
13. Juni |
0,34 |
0,22 |
|
|
|
|
|
23. |
19. Juni |
0,34 |
0,22 |
|
|
|
|
|
24. |
27. Juni |
0,41 |
0,25 |
0,33500 |
0,24250 |
1 |
0 |
|
25. |
3. Juli |
0,31 |
0,16 |
|
|
|
|
|
26. |
10. Juli |
0,32 |
0,08 |
|
|
|
|
|
27. |
17. Juli |
0,37 |
0,24 |
|
|
|
|
|
28. |
24. Juli |
0,32 |
0,15 |
|
|
|
|
|
29. |
31. Juli |
0,35 |
0,23 |
0,3340 |
0,1720 |
0 |
0 |
|
30. |
7. August |
0,27 |
0,22 |
|
|
|
|
|
31. |
14. August |
0,22 |
0,15 |
|
|
|
|
|
32. |
21. August **) |
0,16 |
0,07 |
|
|
|
|
|
33. |
28. August |
0,29 |
0,19 |
0,2350 |
0,1575 |
0 |
0 |
|
34. |
4. September |
0,19 |
0,17 |
|
|
|
|
|
35. |
11. September |
0,16 |
0,18 |
|
|
|
|
|
36. |
18. September |
0,18 |
0,16 |
|
|
|
|
|
37. |
25. September |
0,09 |
–0,03 |
0,1550 |
0,1200 |
0 |
0 |
|
38. |
2. Oktober |
0,24 |
0,07 |
|
|
|
|
|
39. |
10. Oktober |
0,33 |
0,15 |
|
|
|
|
|
40. |
17. Oktober |
0,37 |
–0,02 |
|
|
|
|
|
41. |
24. Oktober |
0,38 |
0,00 |
|
|
|
|
|
42. |
30. Oktober |
0,37 |
0,21 |
0,3380 |
0,0820 |
0 |
0 |
|
43. |
6. November |
0,41 |
0,26 |
|
|
|
|
|
44. |
13. November |
0,39 |
0,28 |
|
|
|
|
|
45. |
20. November |
0,32 |
0,19 |
|
|
|
|
|
46. |
27. November |
0,33 |
0,25 |
0,3625 |
0,2450 |
1 |
0 |
|
47. |
4. Dezember |
0,23 |
0,22 |
|
|
|
|
|
48. |
11. Dezember |
0,33 |
0,25 |
|
|
|
|
|
49. |
18. Dezember |
0,35 |
0,34 |
0,3033 |
0,2700 |
0 |
0 |
Jahreswert 2001
|
|
Jahreswert 2001 |
0,30224 |
0,20755 |
|
|
4 |
0 |
|
1. |
Höchstwert |
0,44 |
0,38 |
|
|
|
|
|
2. |
Niedrigstwert |
0,09 |
–0,03 |
|
|
|
|
|
3. |
über 40 Groschen |
4 |
0 |
|
|
|
|
|
4. |
zw. 31 und 40 Groschen |
25 |
7 |
|
|
|
|
|
5. |
zw. 20 und 30 Groschen |
14 |
21 |
|
|
|
|
|
6. |
unter 20 Groschen |
6 |
18 |
|
|
|
|
|
7. |
gleich Durchschnitt |
0 |
1 |
|
|
|
|
|
8. |
unter Durchschnitt |
0 |
2 |
|
|
|
|
Tabelle 9:
Differenz österreichischer Nettopreise zum EU-Durchschnitt 2002
Angaben in Groschen je Liter
Stand: 15. März 2002
|
lfd. Nr. |
Monat |
Eurosuper |
Diesel |
Monats- |
Monats- |
ÜS der OG |
ÜS der OG |
|
1. |
9. Jänner |
0,27 |
0,24 |
|
|
|
|
|
2. |
16. Jänner |
0,26 |
0,17 |
|
|
|
|
|
3. |
23. Jänner |
0,37 |
0,35 |
|
|
|
|
|
4. |
29. Jänner |
0,28 |
0,27 |
0,2950 |
0,2575 |
|
|
|
5. |
5. Februar |
0,19 |
0,22 |
|
|
|
|
|
6. |
12. Februar |
0,26 |
0,26 |
|
|
|
|
|
7. |
19. Februar |
0,26 |
0,27 |
|
|
|
|
|
8. |
26. Februar |
0,19 |
0,24 |
0,2250 |
0,2475 |
|
|
|
9. |
5. März |
0,09 |
0,16 |
|
|
|
|
|
10. |
13. März |
0,06 |
0,14 |
|
|
|
|
|
11. |
19. März |
|
|
|
|
|
|
|
12. |
26. März |
|
|
|
|
|
|
|
13. |
2. April |
|
|
|
|
|
|
|
14. |
9. April |
|
|
|
|
|
|
|
15. |
16. April |
|
|
|
|
|
|
|
16. |
2. Mai |
|
|
|
|
|
|
|
17. |
8. Mai |
|
|
|
|
|
|
|
18. |
15. Mai |
|
|
|
|
|
|
|
19. |
22. Mai |
|
|
|
|
|
|
|
20. |
29. Mai |
|
|
|
|
|
|
Zwischenstand vom 26. Februar 2002
|
|
Zwischenwert 2002 |
0,26000 |
0,25250 |
|
|
0 |
0 |
|
1. |
Höchstwert |
0,37 |
0,35 |
|
|
|
|
|
2. |
Niedrigstwert |
0,19 |
0,17 |
|
|
|
|
|
3. |
über 40 Groschen |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
4. |
zw. 31 und 40 Groschen |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
5. |
zw. 20 und 30 Groschen |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
6. |
unter 20 Groschen |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
7. |
gleich Durchschnitt |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
8. |
unter Durchschnitt |
0 |
0 |
|
|
|
|
Tabelle 9:
Differenz österreichischer Nettopreise zum EU-Durchschnitt 2002
Angaben in Groschen je Liter
Stand: 15. März 2002
|
lfd. Nr. |
Monat |
Eurosuper |
Diesel |
Monats- |
Monats- |
US der OG |
US der OG |
|
21. |
7. Juni |
|
|
|
|
|
|
|
22. |
13. Juni |
|
|
|
|
|
|
|
23. |
19. Juni |
|
|
|
|
|
|
|
24. |
27. Juni |
|
|
|
|
|
|
|
25. |
3. Juli |
|
|
|
|
|
|
|
26. |
10. Juli |
|
|
|
|
|
|
|
27. |
17. Juli |
|
|
|
|
|
|
|
28. |
24. Juli |
|
|
|
|
|
|
|
29. |
31. Juli |
|
|
|
|
|
|
|
30. |
7. August |
|
|
|
|
|
|
|
31. |
14. August |
|
|
|
|
|
|
|
32. |
21. August |
|
|
|
|
|
|
|
33. |
28. August |
|
|
|
|
|
|
|
34. |
4. September |
|
|
|
|
|
|
|
35. |
11. September |
|
|
|
|
|
|
|
36. |
18. September |
|
|
|
|
|
|
|
37. |
25. September |
|
|
|
|
|
|
|
38. |
2. Oktober |
|
|
|
|
|
|
|
39. |
10. Oktober |
|
|
|
|
|
|
|
40. |
17. Oktober |
|
|
|
|
|
|
|
41. |
24. Oktober |
|
|
|
|
|
|
|
42. |
30. Oktober |
|
|
|
|
|
|
|
43. |
6. November |
|
|
|
|
|
|
|
44. |
13. November |
|
|
|
|
|
|
|
45. |
20. November |
|
|
|
|
|
|
|
46. |
27. November |
|
|
|
|
|
|
|
47. |
4. Dezember |
|
|
|
|
|
|
|
48. |
11. Dezember |
|
|
|
|
|
|
|
49. |
18. Dezember |
|
|
|
|
|
“ |
Beschluss mit Stimmenmehrheit in der Sitzung des Ausschusses am 4. Juli 2002:
Erledigung durch Kenntnisnahme des Ausschussberichtes.
Petition Nr. 50
überreicht vom Abgeordneten Gerhard Reheis betreffend „für die
Realisierung des Tschirganttunnels“
Vom Abgeordneten Gerhard Reheis wurde folgende Petition samt anschließender Resolution der Bürgermeister des Bezirkes Imst überreicht:
„Die B 314 Fernpass-Straße ist sehr stark frequentiert, was für die Bewohner der Gemeinden von Nassereith bis Imst, aber auch am Mieminger Plateau eine erhebliche Belastung darstellt. Staus und Verkehrsbehinderungen gehören dort vor allem in verkehrsstärkeren Zeiten (Ferienbeginn in angrenzenden Ländern, Feiertage) zum gewohnten Bild. Um diese Belastung zu verringern, wurde schon vor einiger Zeit das Projekt ,Tschirganttunnel‘, mit dem der Verkehrsfluss direkt vom Fernpass auf die A 12 Inntalautobahn geleitet werden könnte, ins Auge gefasst und von der Bevölkerung gewünscht (siehe beiliegende Resolution), dann aber vom zuständigen Ministerium als ,nicht vorrangiges Bauvorhaben‘ eingestuft.
Nun wurde bekannt, dass Deutschland einen Lückenschluss der A 7 zur Tiroler Grenze plant und mit einer Zunahme von 62% des LKW- und 20% des PKW-Verkehrs rechnet. Baubeginn soll 2003 sein.
Eine Mehrbelastung der B 314 ist für die anliegende Bevölkerung nicht mehr tragbar. Die Realisierung des schon lange geplanten Projekts ,Tschirganttunnel‘ ist daher eine notwendige und vorrangige Maßnahme, um die anliegenden Gemeinden zu entlasten.
Der Tschirganttunnel ist die einzige Möglichkeit den zunehmenden
Verkehr aufzunehmen, ohne ihn droht dem Tiroler Oberland ein Verkehrsinfarkt.
DIE ZUSTÄNDIGE BUNDESMINISTERIN WIRD DAHER AUFGEFORDERT, EINEN VORSCHLAG
ZUR ÄNDERUNG DES BUNDESSTRASSENGESETZES IN DEN NATIONALRAT EINZUBRINGEN, UM DIE
ASFINANG MIT DER PLANUNG UND ERRICHTUNG DES TSCHIRGANTTUNNELS BEAUFTRAGEN ZU
KÖNNEN.“
„Resolution der Bürgermeister des Bezirkes Imst
Die Bürgermeister des Bezirkes Imst haben bei ihrer Konferenz vom 20. September 1999 in der Frage ,Tschirganttunnel‘ einstimmig folgende
RESOLUTION
beschlossen.
,Die Bürgermeister des Bezirkes Imst sind der Meinung, dass zur Lösung der häufig vor allem im Raum Nassereith–Imst aber auch am Mieminger Plateau bis Telfs herrschenden Verkehrsprobleme, die nicht nur für die Verkehrsteilnehmer, sondern auch für die Bevölkerung in diesem Gebiet zu argen Belastungen führen, mit dem Bau des schon seit Jahren in Rede stehenden Tschirganttunnels, mit dem der Verkehrsfluss vom Fernpass direkt auf die Inntalautobahn geleitet werden könnte, dringend begonnen werden sollte. Des Weiteren wird entschieden für einen den verkehrssicherheitstechnischen Anforderungen entsprechenden Ausbau der Fernpassstraße mit einer Untertunnelung der Scheitelstrecke eingetreten.
Durch den Tschirganttunnel und den Ausbau der Fernpassstraße dürfen aber nicht die Weichen für eine Transitroute gestellt werden. Die Straße muss zwar leistungsfähiger werden, darf dabei aber ihren Charakter als zweispurige Straße nicht verlieren, und es muss auch weiterhin bei den bestehenden Verkehrsbeschränkungen bleiben.‘
Diese Resolution darf deshalb zur Kenntnis gebracht werden.
Ergeht an:
1. Herrn
Landeshauptmann von Tirol
Dr. Wendelin Weingartner
Amt der Tiroler Landesregierung
Eduard-Wallnöfer-Platz 3
6020 Innsbruck
2. Herrn
LR Konrad Streiter
Amt der Tiroler Landesregierung
Eduard-Wallnöfer-Platz 3
6020 Innsbruck
3. Herrn
Landesbaudirektor
Dipl.-Ing. Rupert Amann
Herrengasse 1–3
6020 Innsbruck
4. Herrn
LAbg. Walter Jäger
Arbeiterkammer Imst
Kramergasse 11
6460 Imst
5. Herrn
LAbg. Mag. Ernst Schöpf
Gemeinde Sölden
6450 Sölden
6. Herrn
Bezirkshauptmann
HR Dr. Hubert Hosp
Bezirkshauptmannschaft Reutte
6600 Reutte
7. Herrn
Bezirkshauptmann
HR Dr. Erwin Koler
Bezirkshauptmannschaft Landeck
6500 Landeck
8. Wirtschaftskammer
Tirol
Bezirksstelle Imst
Meraner Straße 11
6460 Imst
9. Herrn
Dir. Dr. Peter Unterholzner
Alpenstraßen AG
Rennweg 10a
6020 Innsbruck
10. An alle
Gemeinden
des Bezirkes Imst“
In seiner Sitzung am 15. Februar 2002 hat der Ausschuss beschlossen, eine Stellungnahme des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie einzuholen.
Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie teilte dazu mit, dass bereits im Bundesstraßen-Übertragungsgesetz, welches dem Parlament zur Beschlussfassung vorliegt, der Tschirganttunnel als Teil A 12 Inntalautobahn enthalten ist und nach Beschlussfassung im Parlament werden damit alle beim Bund verbleibenden Bundesstraßen Mautstrecken und somit obliegt die weitere Zuständigkeit für Planung und Errichtung der ASFINAG.
Beschluss mit Stimmenmehrheit in der Sitzung des Ausschusses am 3. April 2002:
Erledigung durch Kenntnisnahme des Ausschussberichtes.
Petition Nr. 55
überreicht vom Abgeordneten Mag. Johann Maier betreffend „Gegen die
Abschaffung steuerlicher Begünstigungen für gemeinnützige Vereine“
Der Abgeordnete Mag. Johann Maier überreichte folgendes Anliegen:
„Das Bundesministerium für Finanzen beabsichtigte vorerst mit 1. Jänner 2002 die steuerliche Behandlung von Vereinen zu novellieren. Konkret war im Entwurf des Ministeriums zu den Vereinsrichtlinien eine entscheidende Änderung der steuerlichen Begünstigungen für Vereine vorgesehen. Nun wurde dies bis zur Vorlage eines Vereinsgesetzes ruhend gestellt.
Viele Sport-, Sozial- und Kulturvereine veranstalteten zur Erreichung des Vereinszweckes Feste. Hier beabsichtigt das Bundesministerium für Finanzen ua., die Kriterien für die steuerliche Betrachtung dieser Vereinsfeste massiv zu verschärfen. Unterschieden wird in ,kleine‘ und ,große‘ Vereinsfeste. Unter Letzteren versteht das Finanzministerium Feste, bei denen die Besucherzahl doppelt so hoch ist wie die Zahl von Vereinsmitgliedern.
Veranstaltet ein Verein ein ,großes Vereinsfest‘, droht der Verlust der generellen Steuerbegünstigung. Von Bedeutung ist vor allem der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von 10 Prozent bei diversen Vereinsaktivitäten. Führt ein Verein ein ,großes Vereinsfest‘ durch, kann er damit steuerrechtlich seine Gemeinnützigkeit verlieren und muss alle Vereinsaktivitäten höher versteuern!
Es ist schon jetzt absehbar, dass durch diese fiskalische und bürokratische Hürde die Durchführung von Vereinsfesten erschwert und damit die Gewinnung von finanziellen Mitteln für die Vereinstätigkeit entscheidend beschnitten wird.
Die gemeinnützige Tätigkeit von zahlreichen Vereinen in Österreich, angefangen von Kulturinitiativen über Sportvereine bis hin zu sozialen Vereinen, darf nicht in Frage gestellt werden. Die Vereine sind ein wichtiges Element des gesellschaftlichen Lebens. Sie sollen auch weiterhin die Möglichkeiten zur Erfüllung ihrer umfangreichen Aufgaben vorfinden.
In der Anlage finden Sie zahlreiche ,Protestresolutionen Salzburger Vereine gegen die Abschaffung steuerlicher Begünstigungen‘; eine Aktion, die von Landeshauptmann-Stellvertreterin Mag. Gabriele Burgstaller initiiert wurde. Aus den oben genannten Gründen protestierten diese Vereine daher entschieden gegen die vom Bundesministerium für Finanzen geplanten neuen Vereinsrichtlinien.
Der Bundesminister für
Finanzen wird aufgefordert,
1. die Arbeit der Vereine
zu würdigen und von der geplanten Änderung der Vereinsrichtlinien Abstand zu
nehmen und
2. die rechtlichen
Grundlagen für ein Kultur- und Sportsponsoring vorzusehen.“
„Resolution
Wie wir verschiedenen Medienberichten entnommen haben, plant die Bundesregierung die so genannten Vereinsrichtlinien zur Besteuerung von Vereinen zu ändern.
Sozialvereinen, die befristete Arbeitsplätze zur Reintegration von Langzeitarbeitslosen bereitstellen, soll die Gemeinnützigkeit entzogen werden. Dies bedeutet für diese Sozialbetriebe, dass sie in Hinkunft um zehn Prozent mehr Mehrwertsteuer zahlen müssen. Auch bei Sport-, Musik- und Kulturvereinen ist eine Verschärfung geplant. Hier beabsichtigt das Finanzministerium die Kriterien für die steuerliche Betrachtung von Vereinsfesten massiv zu verschärfen, wodurch ein Verein steuerrechtlich seine Gemeinnützigkeit verlieren könnte und alle Vereinsaktivitäten höher versteuern müsste.
Es ist schon jetzt absehbar, dass durch diese bürokratischen und fiskalischen Hürden die Vereinsfinanzen allgemein zurückgehen werden und durch die wegfallenden finanziellen Mittel zahlreiche Vereine gezwungen sein werden, ihre Vereinstätigkeiten stark einzuschränken!
Durch die geplanten Änderungen der Vereinsrichtlinien sehen wir unsere künftige Arbeit entscheidend gefährdet! Wir geben weiters zu bedenken, dass die geplanten Maßnahmen gerade im ,Jahr des Ehrenamts‘ für uns unverständlich sind und sich auf Sicht kontraproduktiv auf das Engagement von ehrenamtlichen Vereinsmitarbeiterinnen und Vereinsmitarbeitern auswirken werden.
Aus den oben genannten
Gründen protestieren wir daher entschieden gegen die vom Bundesministerium für
Finanzen geplanten neuen Vereinsrichtlinien. Der Finanzminister wird ersucht, die
Arbeit der Vereine zu würdigen und in diesem Sinne die geplante Änderung der
Vereinsrichtlinien zu überdenken.“
In seiner Sitzung am 15. Februar 2002 hat der Ausschuss einstimmig beschlossen, eine Stellungnahme des Bundesministeriums für Finanzen einzuholen.
Vom Bundesministerium für Finanzen wurde wie folgt ausgeführt:
„Die Annahme, dass die neuen Vereinsrichtlinien eine erhebliche Schlechterstellung von Sozialvereinen und Festveranstaltungen von Vereinen nach sich ziehen würden, trifft nicht zu. Die seit vielen Jahren geltenden Vereinsrichtlinien 1982 sind im Wesentlichen inhaltlich unverändert in die neuen Vereinsrichtlinien 2001 übernommen worden. Die Befürchtungen einer drohenden Schlechterstellung der Behandlung der begünstigten Zwecke verfolgenden Vereine hat dazu geführt, dass es auf parlamentarischer Ebene Gespräche über eine einerseits den Interessen der Vereine und andererseits den Interessen der betroffenen Wirtschaftszweige (gewerbliche Gastronomie) Rechnung tragende Lösung gegeben hat, die inzwischen abgeschlossen sind.
Die bisherige erlassmäßige Auffassung der Vereinsrichtlinien 1982 wird unverändert in die Vereinsrichtlinien 2001 übernommen. Es wird daher für Feste weiterhin der Grundsatz gelten, dass diese als entbehrlicher Hilfsbetrieb anzusehen sind. Folge dieser Zuordnung ist wie bisher die grundsätzliche Steuerpflicht dieses Betriebes, ohne dass die begünstigten Zwecke an sich beeinträchtigt sind, wobei bei der Gewinnermittlung die unentgeltliche Mitarbeit der Vereinsmitglieder bei der Ausrichtung der Veranstaltung mit einem Betriebsausgabenpauschale von 20% des Umsatzes verbunden ist und ein Veranlagungsfreibetrag von 7 300 Euro zusteht. Umsatzsteuerrechtlich gilt für diesen Festbetrieb wie bisher die Liebhabereivermutung, sofern sie nicht im Einzelfall widerlegt wird.
Nur solche Veranstaltungen, bei denen die Allgemeinheit breit angesprochen wird und die auf Grund ihrer Organisation und des Programms einem begünstigungsschädlichen Gewerbebetrieb nahe kommen, sind wie bisher gesondert zu betrachten. Folge dieser Zuordnung ist, dass der Verein seinen Status als begünstigte Körperschaft verliert und diesen nur durch einen Ausnahmebescheid der zuständigen Finanzlandesdirektion wieder erlangen kann. In diesem Fall bleibt aber die Körperschaftsteuerpflicht des Festbetriebes bestehen, es steht bei der Gewinnermittlung das Betriebsausgabenpauschale nicht zu, wohl aber der Veranlagungsfreibetrag. Umsatzsteuerrechtlich besteht diesbezüglich Unternehmereigenschaft.
Der für die steuerliche Einordnung maßgebende Umfang wird wie bisher nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse von der Finanzbehörde erster Instanz zu beurteilen sein.
Für Sozialvereine (zB Rotes Kreuz usw.) enthalten die Vereinsrichtlinien 2001 nicht nur keine Verschlechterung, sondern insofern eine Besserstellung gegenüber den bisherigen Richtlinien, als für diese Sozialvereine die jährlich einmalige Veranstaltung eines ,grundsätzlich als schädlicher Geschäftsbetrieb zu betrachtenden Vereinsfestes‘ unter besonderen Voraussetzungen jedenfalls steuerfrei gestellt wird (Rz 389f VereinsR 2001).
Bezüglich des zusätzlich angesprochenen Kultur- und Sportsponsorings ist darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeiten der steuerlichen Berücksichtigung von Sponsorzahlungen (unter anderem für Sport- und Kultursponsorzahlungen) in den Einkommensteuerrichtlinien 2000 (Randzahl 1643) im ABC der Werbungskosten ausführlich erörtert werden. Zur Information wird im Folgenden der diesbezügliche Richtlinienpassus wiedergegeben:
Sponsorzahlungen
Freiwillige Zuwendungen sind grundsätzlich nicht abzugsfähig, und zwar auch dann nicht, wenn sie durch betriebliche Erwägungen mitveranlasst sind. Sponsorzahlungen eines Unternehmers sind aber dann Betriebsausgaben, wenn sie nahezu ausschließlich auf wirtschaftlicher (betrieblicher) Grundlage beruhen und als eine angemessene Gegenleistung für die vom Gesponserten übernommene Verpflichtung zu Werbeleistungen angesehen werden können. Der Sponsortätigkeit muss eine breite öffentliche Werbewirkung zukommen.
Einzelfälle von Sponsorzahlungen:
– Sportler und Vereine müssen Werbeleistungen zusagen, die erforderlichenfalls auch durch den Sponsor rechtlich erzwungen werden können. Der gesponserte Sportler oder Künstler muss sich als Werbeträger eignen und Werbeaufwand und Eignung müssen in einem angemessenen Verhältnis stehen. Die vereinbarte Reklame muss ersichtlich sein (etwa durch Aufschrift am Sportgerät oder auf der Sportkleidung, Führung des Sponsornamens in der Vereinsbezeichnung). Die Werbefunktion wird auch durch eine Wiedergabe in den Massenmedien erkenntlich. Die Sponsorleistung darf nicht außerhalb jedes begründeten Verhältnisses zur Werbetätigkeit stehen. Ist der Verein nur einem kleinen Personenkreis bekannt, fehlt es an der typischen Werbewirksamkeit (VwGH 25. 1. 1989, 88/13/0073, betreffend Tennisanzüge für einen Tennisverein).
– Sponsorzahlungen für kulturelle Veranstaltungen: Hier hat der gesponserte Veranstalter allerdings nur eingeschränkte Möglichkeiten, für den Sponsor als Werbeträger aufzutreten.
So ist bei beispielsweise die Aufnahme des Sponsornamens in die Bezeichnung der Kulturveranstaltung im Allgemeinen ebenso wenig möglich wie das Anbringen des Sponsornamens auf der Bühne, der Kulisse oder den Kostümen. Deshalb wird es für die Frage der Werbewirkung einer Kulturveranstaltung in besonderem Maße auch auf die Bedeutung der Veranstaltung und deren Verbreitung in der Öffentlichkeit ankommen. Aus dieser Sicht bestehen keine Bedenken, Sponsorleistungen für kulturelle Veranstaltungen (insbesondere Opern- und Theateraufführungen, sowie Kinofilme) mit entsprechender Breitenwirkung als Betriebsausgaben anzuerkennen, wenn die Tatsache der Sponsortätigkeit angemessen in der Öffentlichkeit bekannt gemacht wird. Von einer solchen Bekanntmachung wird dann ausgegangen werden können, wenn der Sponsor nicht nur anlässlich der Veranstaltung (etwa im Programmheft) erwähnt wird, sondern auch in der kommerziellen Firmenwerbung (zB Inserat- oder Plakatwerbung) auf die Sponsortätigkeit hingewiesen oder darüber in den Massenmedien redaktionell berichtet wird.
– …
Für eine darüber hinausgehende steuerliche Absetzbarkeit des Sponsorings (zB durch Privatpersonen) besteht angesichts des beschrittenen Budgetkonsolidierungskurses derzeit kein Spielraum.“
Beschluss mit Stimmenmehrheit in der Sitzung des Ausschusses am 4. Juli 2002:
Erledigung durch Kenntnisnahme des Ausschussberichtes.
Petition Nr. 84
überreicht von der Abgeordneten Inge Jäger betreffend „zur Stärkung des
Fairen Handels in Österreich“
Die gegenständliche Petition hat folgenden Inhalt:
„Der Faire Handel (Fair Trade) erfuhr durch den Entschließungsantrag des Europaparlamentes zum Fairen Handel vom 26. Mai 1998 (A4-0198/98 vom 26. Mai 1998) und in Folge durch zahlreiche Aktivitäten österreichischer EntscheidungsträgerInnen und Gremien (nicht zuletzt durch den österreichischen Nationalrat) eine zunehmende Bedeutung in der Entwicklungszusammenarbeit.
Als Instrument der wirtschaftlichen und sozialen Zusammenarbeit zwischen Nord und Süd verfolgt Fair Trade das Ziel einer nachhaltigen Verbesserung der Situation in ProduzentInnenländern hinsichtlich sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Faktoren. Die hohe Wirksamkeit und Sinnhaftigkeit dieses Systems der fairen Handelsbeziehungen wird dabei in Studien und Stellungnahmen nationaler und internationaler Gremien nachdrücklich hervorgehoben.
Trans Fair Österreich, eine gemeinnützige Initiative zur Förderung des Fairen Handels in Österreich, in Übereinstimmung mit Nicht-Regierungs-Organisationen der österreichischen Zivilgesellschaft (AGEZ – Arbeitsgemeinschaft Entwicklungszusammenarbeit, CARE Österreich, Caritas, Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar Österreichs, Katholische Frauenbewegung Österreich, UNICEF Österreich, WWF), legt den MitgliederInnen des Österreichischen Nationalrates und in Folge den österreichischen EntscheidungsträgerInnen folgende Forderungen zur weiteren Förderung des Fairen Handels vor:
Für eine langfristige Stärkung des Fairen Handels, die Etablierung im öffentlichen Bewusstsein und Verankerung in den öffentlichen Beschaffungsprozessen sind über die Fortsetzung der bisher erfolgten und schon wirksamen Maßnahmen zur Förderung des Fairen Handels in Österreich folgende weitere Schritte notwendig:
Kurzfristig:
– Die ehest mögliche Behandlung des dem Nationalrat am 5. Dezember 2001 übergebenen Berichts zur Entschließung 310/A(E) betreffend die ,Förderung des Fairen Handels‘ im zuständigen Unterausschuss, um ein öffentlich wahrnehmbares Bekenntnis zur Umsetzung desselben abzulegen.
– Initiativen zur Verwendung von Fair-Trade-Produkten in den Räumlichkeiten des Parlaments und angegliederter Einrichtungen sowie eine geeignete öffentliche Darstellung dieser Verwendung als positives Beispiel für weitere öffentliche Einrichtungen.
– Öffentliche Empfehlung an österreichische EntscheidungsträgerInnen, ebenfalls bevorzugt Fair-Trade-Produkte zu beschaffen, auf Fair Trade Produkte umzusteigen sowie regelmäßige Berichte an die österreichische Öffentlichkeit über die erreichte Fair-Trade-Quote im öffentlichen Beschaffungswesen zu legen.
– Offensive öffentliche Darstellung der Wirkungsweisen und Erfolge des Fairen Handels und der gesetzten sowie zu erfolgenden Schritte zur Förderung des Fairen Handels.
– Setzung von Maßnahmen zur Förderung der entwicklungspolitischen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit zum Fairen Handel.
Mittelfristig:
– Umsetzung des Berichts an den Nationalrat zur Entschließung 310/A(E) durch geeignete Initiativen, im öffentlichen Beschaffungswesen bevorzugt Produkte aus dem Fairen Handel anzukaufen.
– Einsetzung einer länderübergreifenden Koordinierungsstelle für Beschaffung und Verwendung fair gehandelter Produkte im öffentlichen Beschaffungswesen Österreichs.
– Beauftragung durch den Österreichischen Nationalrat zur Erstellung von technischen Spezifikationen analog zur ON-Regel 141001 vom 1. August 2000 (Produkt Kaffee) für alle weiteren Produktgruppen des Fairen Handels, um auch für diese die Voraussetzung für eine Beschaffung durch Institutionen öffentlicher Hand zu schaffen.
Langfristig:
– Beauftragung zuständiger Gremien zur Überprüfung der Möglichkeit einer Verankerung des Fairen Handels und der positiven Wirkung des Fairen Handels in Lehrplänen, Lehrbehelfen und Lehrmitteln an österreichischen Schulen und Universitäten.
– Setzung geeigneter Maßnahmen in nationalen und internationalen Gremien, Produkten aus dem Fairen Handel generell zoll- und quotenfreien Zugang zu allen Märkten zu gewähren.
– Weitere Intensivierung der Informations- und Lobbyingaktivitäten in entsprechenden nationalen wie internationalen Gremien, insbesondere der Europäischen Union, zur Förderung des Fairen Handels.“
Beschluss mit Stimmenmehrheit in der Sitzung des Ausschusses am 15. Februar 2002:
Erledigung durch Kenntnisnahme des Ausschussberichtes.
Petition Nr. 87
überreicht von den Abgeordneten zum
Nationalrat Mag. Werner Kogler und Heidrun Silhavy betreffend „zur Aufnahme
bisher nicht genannter Opfergruppen im Opferfürsorgegesetz“
Die Abgeordneten Mag. Werner Kogler und Heidrun Silhavy überreichten folgendes Anliegen, welches durch den Landesverband Steiermark der österreichischen Widerstandskämpfer und Opfer des Faschismus (KZ-Verband) und durch den Bund sozialdemokratischer Freiheitskämpfer und Opfer des Faschismus – Graz getragen wird:
„Die Geschichte der letzten 55 Jahre zeigt, dass einige Opfergruppen des Nationalsozialismus erst sehr spät von gesetzlichen Regelungen erfasst wurden. Damit war es Angehörigen dieser Gruppen auch erst sehr spät möglich, einen Anspruch auf diverse Leistungen in Anspruch nehmen zu können. Es ist auch davon auszugehen, dass zahlreiche Opfer des Nationalsozialismus die Anerkennung ihres Schicksals als Opferstatus nicht mehr erlebt haben.
Vor allem in den 80er und den frühen 90er Jahren gerieten bisher ,vergessene NS-Opfer‘ vermehrt in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Diesem Umstand wurde von der Republik Österreich 1995 mit der Schaffung eines Nationalfonds anlässlich des 50. Jahrestages der Errichtung der Zweiten Republik Rechnung getragen. Es sollte ,an das unermessliche Leid erinnert werden, das der Nationalsozialismus über Millionen von Menschen gebracht hat und der Tatsache gedacht werden, dass auch Österreicher an diesen Verbrechen beteiligt waren‘, heißt es dazu im Bericht des Verfassungsausschusses wörtlich.
NR-Präsident Dr. Heinz Fischer erklärte damals: ,Durch die Errichtung des Nationalfonds soll die moralische Mitverantwortung und das Leid, das den Menschen in Österreich durch den Nationalsozialismus zugefügt wurde, anerkannt werden und den Opfern in besonderer Weise Hilfe zukommen, wobei wir natürlich wissen, dass das zugefügte Leid nicht ,wiedergutgemacht‘ werden kann.‘
Mit dem Nationalfonds wurden erstmals jene Opfer gewürdigt, die aus Gründen der sexuellen Orientierung (Homosexuelle), auf Grund einer körperlichen oder geistigen Behinderung oder auf Grund des Vorwurfes der so genannten Asozialität verfolgt wurden.
Auch der neu geschaffene Versöhnungsfonds erwähnt diese drei Gruppen und bezieht zusätzlich jene Personen ein, welche ,im Zusammenhang mit medizinischen Experimenten‘ Leid widerfahren ist.
Nach dem Stand der Forschung waren zB in den Konzentrationslagern des Dritten Reiches etwa 15 000 homosexuelle Männer inhaftiert. Rund 10 000 von ihnen sind von den Nationalsozialisten ermordet worden. Unter dem Vorwurf der ,Asozialität‘ sind – völlig willkürlich – tausende Frauen, Männer und auch Kinder in Konzentrationslager oder psychiatrische Einrichtungen verschleppt worden. Etwa 6 000 Menschen wurden in Österreich zwischen 1940 und 1945 zwangssterilisiert.
Es wäre nur konsequent, wenn das Leid, das diesen Menschen durch den Nationalsozialismus zugefügt wurde, auch im Opferfürsorgesetz seine Anerkennung finden würde.
Als Opfer der
politischen Verfolgung sollten im Opferfürsorgegesetz auch jene gelten, die aus
Gründen der sexuellen Orientierung, auf Grund einer Behinderung oder als
,asozial‘ Verfolgte oder durch Zwangssterilisationen durch Maßnahmen eines
Gerichtes, einer Verwaltungs- (im Besonderen einer Staatspoli-
zei-)Behörde oder durch Eingriffe der NSDAP einschließlich ihrer Gliederungen
in erheblichem Ausmaß zu Schaden gekommen sind.
Das in den letzten Jahren vorgebrachte Argument, dass es von Angehörigen aus diesen Gruppen keine Anträge gäbe, darf dabei keine Rolle spielen. Dies ist einerseits 56 Jahre nach dem Sturz des NS-Regimes nicht verwunderlich, andererseits ist zu berücksichtigen, dass eine Antragsstellung ohne Rechtsgrundlage auch nicht zu erwarten ist und dass hier auch von Opfergruppen die Rede ist, deren Angehörige bis in die Gegenwart teilweise mit erheblichen Vorurteilen zu kämpfen haben.
Es ist höchst an der Zeit, dass mit der Aufnahme der genannten Opfergruppen im Opferfürsorgegesetz – welches in der Kompetenz des Bundes liegt – das Leid dieser Menschen, wenn auch spät, Anerkennung findet.“
In seiner Sitzung am 3. April 2002 hat der Ausschuss beschlossen, eine Stellungnahme des Bundesministeriums für soziale Sicherheit und Generationen einzuholen.
Vom Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen langte eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt ein:
„1. Auf Grund der mit 1. Jänner 1995 in Kraft getretenen Novelle zum Opferfürsorgegesetz (OFG), BGBl. Nr. 433/1995, wurden Personen, die auf Grund einer Behinderung verfolgt wurden, in den § 1 Abs. 2 OFG einbezogen, sodass Opfer der Euthanasie und Zwangssterilisierung sowie ihre Hinterbliebenen bereits nach der geltenden Rechtslage Ansprüche auf Grund des OFG haben.
2. Personen, die vom nationalsozialistischen Regime auf Grund des Vorwurfes der so genannten Asozialität verfolgt wurden (zB Einlieferung in die Anstalt ,Spiegelgrund‘), werden als Opfer auf Grund von Nachsichtserteilungen anerkannt, sofern nicht bereits gemäß § 1 Abs. 2 OFG eine Anerkennung im Wege des Rechtsanspruches vorzunehmen ist.
3. Die Frage einer Einbeziehung von unter dem Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen in das OFG wurde mehrmals einer eingehenden Prüfung durch das Bundesministerium unterzogen.
Zwischen 1982 und 1994 wurden von einem Homosexuellenverein zwei Fälle von Betroffenen an das Bundesministerium herangetragen, die beide verstorben sind und von denen einer bereits vor der Okkupation Österreichs aktiver illegaler Nationalsozialist war. Weitere Personen, die auf Grund ihrer Homosexualität verfolgt wurden, sind bis heute dem Bundesministerium nicht bekannt gegeben worden.
Jeder weitere allenfalls an das Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen herangetragene Fall eines Betroffenen würde – wie in der Vergangenheit – geprüft werden, wobei eine Anerkennung als Opfer im Wege des Rechtsansspruches bereits nach der geltenden Rechtslage dann vorzunehmen wäre, wenn der Vorwurf der Homosexualität einer politischen Verfolgung diente. Darüber hinaus kann eine Überprüfung der Voraussetzungen für eine Nachsichtserteilung vorgenommen werden.
Davon unabhängig wurden Personen, die auf Grund des Vorwurfes der so genannten Asozialität oder ihrer sexuellen Orientierung verfolgt wurden, in das Bundesgesetz über den Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus (BGBl. Nr. 432/1995) aufgenommen.“
Beschluss mit Stimmenmehrheit in der Sitzung des Ausschusses am 4. Juli 2002:
Erledigung durch Kenntnisnahme des Ausschussberichtes.
Petition Nr. 89
überreicht von den Abgeordneten Manfred Lackner und Dr. Gottfried Feurstein
betreffend „für den Frieden in der Welt, gegen Krieg,
Terror und Gewalt“
Die Abgeordneten Manfred Lackner und Dr. Gottfried Feurstein übermittelten folgendes Anliegen, welches von Landtagsabgeordneter Dr. Elke Sader initiiert wurde:
„Jeder Krieg in der Geschichte der Menschheit ist bisher im Namen des Guten gegen das Böse geführt worden. Jeder Krieg hat letztlich unendliches Leid und Zerstörung hinterlassen. Einige wenige haben davon profitiert.
Es ist wichtig, gegen den Krieg aufzustehen. Für soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit, sowohl innerhalb der einzelnen Staaten als auch zwischen den Staaten selbst einzutreten.
Die Bundesregierung wird ersucht:
– Für einen dauerhaften Frieden einzutreten. Durch Völkerverständigung, durch Gleichbehandlung der Nationen, durch eine sozial ausgleichende Politik, durch ein friedliches Nebeneinander der Religionen und durch eine humane Wirtschaftspolitik.
– Für ein wirkungsvolles Verbot biologischer Waffen und einen raschen Ausstieg aus der Atomenergie einzutreten.
– Gegen die Bedrohung durch tödliche Seuchen einzutreten, die eine Veränderung des Erbguts und bleibende Schäden an uns und uns nachfolgenden Generationen verursachen.
– Für eine lebendige, bunte und freie Demokratie einzutreten.
– Für eine aktive Neutralität, für eine humanitäre Auslandshilfe und ein humanes Asylrecht einzutreten.
– Sich gegen eine ausländerfeindliche Politik zu wehren.
– Sich entschieden gegen die Beschneidung persönlicher Freiheiten gegen Fingerprints für alle und gegen eine Registrierung auf einer Chipcard zu wehren.“
Beschluss mit Stimmenmehrheit in der Sitzung des Ausschusses am 3. April 2002:
Erledigung durch Kenntnisnahme des Ausschussberichtes.
Petition Nr. 90
überreicht von der Abgeordneten Mag. Gisela
Wurm betreffend „für ein
Polizeiwachzimmer am Innsbrucker Hauptbahnhof“
Die Abgeordnete Mag. Gisela Wurm hat dem Nationalrat folgendes von 7 000 BürgerInnen unterzeichnete Anliegen überreicht:
Petition für ein Polizeiwachzimmer am Innsbrucker Hauptbahnhof
März
2002
„Nach wie vor ist es unklar, ob das Wachzimmer am Hauptbahnhof auf Grund der Sparmaßnahmen der Bundesregierung weiter fortgeführt wird. In anderen Städten Österreichs ist ein Polizeiwachzimmer am Bahnhof eine Selbstverständlichkeit – nicht so in Innsbruck. Doch gerade dort, wo sich pro Tag mehr als 30 000 Menschen bewegen, ist Sicherheit besonders wichtig. Deshalb ist die Weiterführung oder noch besser die Verlegung des Wachzimmers in das neue, gerade jetzt im Bau befindliche Bahnhofsgebäude dringend notwendig. Es ist für die Fahrgäste der ÖBB und der Postbusse unzumutbar, dass sie fast einen Kilometer zu Fuß gehen müssen, wenn sie Polizeihilfe benötigen. Außerdem ist es unbestritten, dass ein Polizeiwachzimmer am Bahnhof, wie es derzeit noch existiert, die Sicherheit eines so neuralgischen Punktes erhöht und gewährleistet.
Wie wichtig der
Bevölkerung dieses Wachzimmer ist, zeigt die Tatsache, dass in kurzer Zeit mehr
als 7 000 Unterschriften für den Erhalt eines Polizeiwachzimmers am
Hauptbahnhof abgegeben wurden. Auch der Tiroler Landtag fordert in einer
einstimmigen Entschließung, dass im neuen Innsbrucker Bahnhofsgebäude die
Errichtung eines Polizeiwachzimmers vorgesehen wird.
Weiters geben wir grundsätzlich zu bedenken, dass die Schließung von Wachzimmern von der Mehrheit der Bevölkerung nicht goutiert wird. Gerade in einer Stadt, wo der Fremdenverkehr ein starker Wirtschaftsfaktor ist, ist die Sicherheit der Gäste und der Bewohner als oberstes Gebot zu betrachten.
Wir fordern den Herrn
Bundesminister für Inneres Dr. Ernst Strasser daher auf, von seinem
ministeriellen Weisungsrecht Gebrauch zu machen, um den Fortbestand des
Wachzimmers am Innsbrucker Hauptbahnhof in derzeit vorhandener Größe und Stärke
zu sichern und, wenn möglich, im neuen Bahnhofsgebäude unterzubringen.“
Der gegenständlichen Petition war folgende Entschließung vom Tiroler Landtag angeschlossen:
ENTSCHLIESSUNG
„Die Tiroler Landesregierung wird aufgefordert, sich bei den zuständigen Stellen dafür einzusetzen, dass im Zuge des Neubaues des Innsbrucker Hauptbahnhofes unmittelbar im neuen Bahnhofsgebäude die Einrichtung eines Polizeiwachzimmers vorgesehen wird.
Es wird beurkundet, dass der Tiroler Landtag diese Entschließung in seiner Sitzung vom 7. Februar 2002 mit der verfassungsmäßigen Mehrheit beschlossen hat.
Der Landtagspräsident:
(Prof. Ing. Helmut Mader)“
In seiner Sitzung am 3. April 2002 hat der Ausschluss beschlossen, eine Stellungnahme des Bundesministeriums für Inneres einzuholen.
Das Bundesministerium für Inneres nimmt dazu wie folgt Stellung:
„Im Bereich der Gruppe Bundespolizei beschäftigt sich das Projekt ,Wachzimmerstruktur – Reformkonzept‘ unter dem Gesichtspunkt einer möglichsten Qualitätssicherung mit der Optimierung der Aufbauorganisation bzw. der Straffung der Ablauforganisation, um so im Bereich der Bundespolizeidirektionen eine entsprechende Output/Input-Relation in punkto Personal- und Sachmittelressourceneinsatz herbeizuführen.
Um eine angemessene polizeiliche Präsenz auch im Bereich des neuen Hauptbahnhofes sicherzustellen, wurden zwischenzeitig Verhandlungen zwischen den ÖBB und der Bundespolizeidirektion Innsbruck aufgenommen, deren Ziel darin besteht, am Bahnhof ein so genanntes Dienstzimmer zu etablieren. Dieses soll den bisherigen Planungen zur Folge organisatorisch vom Wachzimmer ,Innere Stadt‘ betreut werden. Durch die dadurch erzielte Verflachung der Kommandostrukturen und die Erhöhung der personellen Dispositionsmöglichkeiten kann auf die Bedürfnisse am Bahnhof flexibler und effektiver reagiert werden.“
Beschluss mit Stimmenmehrheit in der Sitzung des Ausschusses am 4. Juli 2002:
Erledigung durch Kenntnisnahme des Ausschussberichtes.
Petition Nr. 91
überreicht vom Abgeordneten Dipl.-Ing.
Wolfgang Pirklhuber betreffend „Nulltoleranz
für Gentech-Saatgut – Gentechnikfreies Österreich“
Die vorliegende Petition wurde von mehr als 1 900 Personen unterstützt und hat folgende Forderung zum Inhalt:
„Kein gentechnisch verändertes Saatkorn in unsere Erde!
Über Jahrtausende haben die Bauern bewiesen, dass sie ohne die künstliche Manipulation des Erbgutes auskommen. Auch wirtschaftlich bringt die Gentechnik den Bauern nichts. Die Produktivitätsgewinne stecken die Saatgutfirmen und der Handel ein.
Saatgutkonzerne wollen den Bauern Gentechnik aufzwingen
Unter dem Schlagwort ,Wahlfreiheit‘ wollen Saatgutkonzerne genmanipuliertes Saatgut in den Umlauf bringen. Nur: Die überwiegende Mehrzahl der Bauern, die sich gegen Gentechnik ausspricht, hat dann keine Wahlfreiheit mehr. Es kommt zu Auskreuzungen von Gentechnik-Feldern und Verunreinigungen des Saatgutes.
Die geplante Gentechnik-Saatgut-Verordnung ist ein Skandal!
Bei Einführung einer Toleranzgrenze für gentechnisch verunreinigtes Saatgut kann ein Auskreuzen von Gentechnik nicht mehr verhindert werden. ,Deswegen bekämpfen wird die neue Gentechnik-Saatgut-Verordnung von Minister Molterer‘, erklärt Landwirtschaftssprecher Wolfgang Pirklhuber.
Molterers Vorschlag, dass Felder mit gentechnisch verunreinigtem Saatgut 450 m von biologisch bewirtschafteten Feldern entfernt sein müssen, erweist sich in der Praxis als undurchführbar. Wer muss wem ausweichen? Trifft es den Biobauern, wird biologischer Ackerbau schlichtweg unmöglich. Trifft es die konventionellen, haben diese ein Problem: Denn dann ist ein zentraler Informationskataster notwendig, um zu wissen, wo die Biofelder überhaupt liegen.
Jede neue Gentechnik-Konstruktion bringt eine neue Gefahr
Wir stehen erst am Anfang: Ständig kommen neue Gentechnik-Konstruktionen auf den Markt mit neuen Risiken. Heute sind es Allergien und Antibiotika-Resistenzen durch Gentechnik, morgen können die Auswirkungen aber noch viel katastrophaler ausfallen.
Die Bauern brauchen Sicherheit
Die KonsumentInnen fordern von den Bauern einwandfreie Produkte und Gentechnik-Freiheit. Die Bauern wollen von den Saatgutkonzernen dieselben Garantien: Die Herstellen müssen garantieren, dass das Saatgut gentechnikfrei ist. Die Behörde muss durch lückenlose Kontrollen vor dem Verkauf dafür sorgen, dass sich die Bauern auch auf die Gentechnik-Freiheit des Saatguts verlassen können.
Gentechnikfreie Zone Österreich
Als Grüne treten wir für die umgehende Umsetzung des Gentechnik-Volksbegehrens ein, das mehr als 1,2 Millionen ÖsterreicherInnen unterzeichnet haben und fordern daher eine ,Gentechnikfreie Zone Österreich‘.
Unterschreiben Sie jetzt!
Nulltoleranz für Gentech-Saatgut
Gentechnikfreies Österreich
Die KonsumentInnen fordern von den Bäuerinnen und Bauern einwandfreie Produkte. Österreichs Bauern wollen dieselbe Sicherheit: Das Saatgut muss garantiert gentechnikfrei sein.
Deshalb fordern wir:
– Beibehaltung
der Null-Toleranzgrenze für GVO-Verunreinigungen
– Einführung
eines lückenlosen Saatgut-Kontrollprogramms
– Aufbau
eines eigenen Programms für gentechnikfreies Saatgut.“
In seiner Sitzung am 3. April 2002 hat der Ausschuss beschlossen, eine Stellungnahme des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft einzuholen.
Vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft langte folgende Stellungnahme ein:
„Die vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft erlassene Saatgut-Gentechnik-Verordnung, BGBl. II Nr. 478/2001, verpflichtet die In-Verkehr-Bringer von Saatgut zu einer umfassenden Vorsorge und Planung, um ausschließlich gentechnikfreies Saatgut in Österreich zu vermarkten. Die im Vorjahr aufgetretenen Probleme sollen im Sinne des Vorsorgeprinzips durch die Vorgabe einer wissenschaftlich fundierten Methodik zur Untersuchung auf GVO-Verunreinigungen sowie durch umfassende Kontrolle und Überwachung vermieden werden.
Mit der Saatgut-Gentechnik-Verordnung darf jedwedes in Österreich in Verkehr gebrachtes Saatgut bei der Erstkontrolle keine Verunreinigung mit GVO aufweisen, bei der Nachkontrolle wird ein Wert bis 0,1% toleriert. In Verfahren nach dem SaatG 1997 ist die Einhaltung dieser Verordnung durch die Abgabe einer schriftlichen Bestätigung zu gewährleisten.
Diese Bestimmungen gelten in gleicher Weise für Saatgut, das in Österreich anerkannt oder zugelassen wurde und für Saatgut, das aus EU-Mitgliedstaaten nach Österreich verbracht oder aus Drittstaaten importiert wird. Der In-Verkehr-Bringer hat dabei sicherzustellen, dass die Bestimmungen der Saatgut-Gentechnik-Verordnung eingehalten werden. Für Saatgut, das aus Drittstaaten importiert wird, muss bereits in der Einfuhrbescheinigung gemäß § 35 SaatG 1997 die Einhaltung der Anforderungen der Saatgut-Gentechnik-Verordnung bestätigt werden.
Mit der obligatorischen Bestätigung über die Einhaltung der Bestimmungen der Saatgut-Gentechnik-Verordnung durch den Antragsteller in Verbindung mit einem umfassenden Kontroll- und Monitoringsystem einschließlich der Saatgutverkehrskontrolle durch die Saatgutanerkennungs- und Sortenzulassungsbehörde, wird für die österreichische Landwirtschaft gewährleistet, dass kein mit GVO verunreinigtes Saatgut in Verkehr gebracht wird.
Im Rahmen dieses umfassenden Kontroll- und Überwachungsauftrages wird in die Untersuchungsergebnisse der Antragsteller Einsicht genommen, es werden Stichproben gezogen und diese werden auf GVO-Verunreinigungen untersucht. In jedem österreichischen Saatgutunternehmen wird in Überwachungs- und Kontroll-Audits stichprobenartig die gesamte Saatgut-Produktionskette – vom Ausgangssaatgut beginnend, über das Feld, die Transportwege, die Saatgutbearbeitung und Lagerung bis hin zur Absackung – auf ihre Nachvollziehbarkeit (,Traceability‘) überprüft. Weiters wird bereits zugelassenes oder anerkanntes sowie nach Österreich verbrachtes oder importiertes Saatgut im Rahmen der Saatgutverkehrskontrolle stichprobenartig kontrolliert, Proben werden gezogen und diese auf GVO-Verunreinigung untersucht.
Im Zuge dieses Kontroll- und Monitoringsystems einschließlich der Saatgutverkehrskontrolle wurden per Stand Anfang Mai 2002 zirka 140 Proben gezogen und zirka 100 Proben davon untersucht. Die betroffenen Firmen legten die geforderten Unterlagen, insbesondere die Bestätigungen über die Einhaltung der Saatgut-Gentechnik-Verordnung, bisher weitgehendst zeitgerecht und vollständig vor. In insgesamt 31 Überwachungs- und System-Audits wurden Saatgutunternehmen überprüft. Bei all diesen Kontrollen und Untersuchungen konnten bisher keine Verunreinigungen von Saatgut mit GVO festgestellt werden.
Anzumerken ist, dass derzeit in der EU weder in der Landwirtschaft noch im Gemüsebau GVO-Sorten zugelassen sind, sodass in der gesamten Europäischen Union kein Saatgut solcher GVO-Sorten in Verkehr gebracht werden darf.“
Beschluss mit Stimmenmehrheit in der Sitzung des Ausschusses am 4. Juli 2002:
Erledigung durch Kenntnisnahme des Ausschussberichtes.
Bürgerinitiative Nr. 23
eingebracht von Herbert Adam betreffend „Einforderung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für die Müllaufbereitungsanlage der
DIVITEC-GesmbH in Oberpullendorf, Mittelburgenland“
Der Einbringer überreichte die gegenständliche Bürgerinitiative mit 759 Unterschriften und folgendem Anliegen an den Nationalrat:
„BÜRGERINITIATIVE gegen MÜLLZENTRUM
Sprecher: Herbert ADAM, Erwin ZEICHMANN,
Unterpullendorf
An den
Nationalrat der
Republik Österreich
Parlament
1010 Wien Unterpullendorf, 28. September 2001
Betreff: Ansuchen um Beurteilung der Genehmigung der Abfallbehandlungsanlage der Divitec Projektentwicklungs GmbH in 7350 Oberpullendorf;
Sehr geehrte
Damen und Herren!
Vorstellung der
Bürgerinitiative (BI):
Die BI wurde gegründet, da obiges Projekt ohne Vorinformation der Bevölkerung und ohne Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchgezogen werden soll.
Hinter der Initiative stehen mehr als 90% der betroffenen Bevölkerung, die Gemeinde Unterpullendorf, der örtliche Tourismusverband sowie sämtliche Vereine der Großgemeinde.
Warum sind so viele Leute aufgebracht?
1. Weil wir überzeugt sind, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung politisch nicht gewollt war und daher geschickt ,umgangen‘ wurde.
2. Weil durch die Medienpolitik die betroffene Bevölkerung bewusst vor vollendete Tatsachen gestellt wurde.
3. Weil die Anlage in einem Sumpfgebiet, nur wenige hundert Meter von Wohnhäusern entfernt, über dem Trinkwasserreservoir der Bezirkshauptstadt, ohne Schienenanbindung und ohne ausgereiftem Verkehrskonzept und mitten in der Thermen- und Tourismusregion ,Mittleres Burgenland‘ errichtet werden soll.
4. Die Anlage soll genau dort errichtet werden, wo bereits eine Müllverarbeitungsanlage besteht, die vor zirka 20 Jahren zwischen drei Ortschaften, die überwiegend von Angehörigen der Volksgruppen der burgenländischen Kroaten, Ungarn und Roma errichtet wurde. Die bestehende Anlage hat die Konzessionen für gefährliche und nicht gefährliche Abfälle und verbreitet bereits seit Jahren unerträglichen Gestank.
Warum kam es zu keiner UVP?
Die UVP wurde beantragt von der Betreiberfirma. Letztendlich hat dies dazu geführt, dass nunmehr ein Bescheid des Umweltsenates der Republik Österreich vorliegt, der die Notwendigkeit einer UVP verneint. Dabei wurde der Umweltsenat dazu ,gezwungen‘, die Entscheidung nach dem alten UVP-Gesetz zu treffen. Die UVP-Richtlinie, welche bereits am 14. März 2000 umgesetzt hätte werden sollen, wurde tatsächlich erst per 11. August 2000 wirksam. Wie aus beiliegendem Schaubild [Beilage 1 *)] ersichtlich ist, wurde am 20. Juli 2000 die Einreichung nach dem AWG getätigt, welche unserer Meinung nach äußerst unüblich und ungewöhnlich ist. Die BI steht nun vor vollendeten Tatsachen und hat somit keine Möglichkeiten mehr, in ein UVP-Verfahren einzusteigen. Der Feststellungsbescheid [Beilage 3 *)] weist außerdem einen (eigenartigen) ,Fehler‘, eine Schlamperei sowie einen Widerspruch auf.
Festzuhalten ist, dass nach jetziger UVP-Rechtslage nach unserem Dafürhalten eine Verpflichtung zur Durchführung einer UVP besteht, weil die bestehende Anlage in das Verfahren miteinzubeziehen wäre (Kumulierungsprinzip)!
Wie aus den Beilagen 2a und 2b *) zu ersehen ist, kamen Sachverständige der Burgenländischen Landesregierung zur Ansicht, dass auch nach der alten UVP-Rechtslage eine UVP vorgeschrieben wäre!
Herstellungskosten:
Die Herstellungskosten werden sich auf zirka 310 Millionen Schilling (22,5 Millionen Euro) belaufen.
Zusätzliche Förderungen:
(EU, Land Burgenland) zirka 100 Millionen Schilling (7,3 Millionen Euro).
Neu geschaffene Arbeitsplätze:
Zirka 40, großteils minder qualifiziert.
Nach dem AWG-Verfahren [Bescheid Beilage 5 *)] besteht nun voraussichtlich keine Möglichkeit mehr, die relevanten Einwendungen geltend zu machen.
Hinweisen möchten wir auch noch auf das ,Einheitliche Programmplanungsdokument II 2000 bis 2006‘, das das Land Burgenland mit der EU abgeschlossen hat, wo sich dieses verpflichtet, das strengere EU-Recht speziell im Umweltbereich anzuwenden, wenn es zu Förderzusagen kommt. [Beilage 4 *)].
Wir ersuchen daher, auch die Förderwürdigkeit dieses Projektes zu überprüfen.
Für weitere Auskünfte und Informationen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Mit der Bitte um ehestmögliche Bearbeitung verbleiben wir
mit freundlichen Grüßen
ADAM Herbert ZEICHMANN Erwin
Beilagen: *) 1. Schaubild UVP – AWG;
2. Gutachten Dr. Fritz und Dr. Prath;
3. Feststellungsbescheid UVP – nein;
4. Auszug aus EPPD II;
5. AWG-Bescheid.“
In seiner Sitzung am 15. Februar 2002 hat der Ausschuss beschlossen, eine Stellungnahme des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft einzuholen.
Die Stellungnahme lautet wie folgt:
„Am 24. November 1999 wurde seitens der Divitec Projektentwicklungs GesmbH gemäß § 4 Abs. 1 UVP-G die Errichtung und der Betrieb einer Abfallbehandlungsanlage in Oberpullendorf angezeigt.
Beim gegenständlichen Projekt handelt es sich um eine Anlage zur Sortierung und Aufbereitung von Abfällen im Vorfeld zur bereits bestehenden Abfallbehandlungsanlage des Umweltdienstes Burgenland (UDB).
Auf Grund unterschiedlicher Beurteilungen der UVP-Pflicht der gegenständlichen Abfallbehandlungsanlage durch die einzelnen Abteilungen des Amtes der Burgenländischen Landesregierung wurde von Amts wegen ein Feststellungsverfahren gemäß § 3 Abs. 6 UVP-G eingeleitet.
Mit Bescheid der Burgenländischen Landesregierung vom 4. Mai 2000, Zl. 5-N-B1815/7-2000, wurde festgestellt, dass für das gegenständliche Anlagenprojekt keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen sei.
Auf Grund dieses Bescheides beantragte die Projektwerberin am 20. Juli 2000 die Erteilung einer abfallrechtlichen Genehmigung gemäß § 29 Abs. 1 Z 3 AWG beim Landeshauptmann des Burgenlandes. Ungeachtet dessen erhob sie aber auch – zur endgültigen Klärung der UVP-Frage – Berufung gegen den Bescheid der Burgenländischen Landesregierung.
In weiterer Folge wurde mit Bescheid vom 6. November 2000, Zl. US 3/2000/10/12, seitens des Umweltsenates als Berufungsbehörde festgestellt,
1. dass es sich bei dem geplanten Vorhaben um eine Anlage zur mechanisch-physikalischen Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen handelt,
2. dass nach dem UVP-G 1993 keine UVP-Pflicht bestand,
3. dass die UVP-Richtlinie durch das UVP-G 1993 ausreichend umgesetzt wurde und daher nicht unmittelbar anwendbar war und
4. dass im Hinblick auf die Einbringung des abfallrechtlichen Genehmigungsantrages vor dem 11. August 2000 (Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des UVP-G 2000) und auf Grund des Vorliegens von 2. und 3. auch keine UVP-Pflicht nach dem UVP-G 2000 besteht (vgl. § 46 Abs. 9 UVP-G 2000).
Mit Bescheid des Landeshauptmannes von Burgenland vom 12. Juni 2001, Zl. 5-W-AW1095/63-2001, wurde der Projektwerberin in weiterer Folge die abfallrechtliche Anlagengenehmigung erteilt.
Mit Schreiben vom 18. September 2001 wurde seitens des Landeshauptmannes des Burgenlandes eine Vielzahl von Berufungen übermittelt, mit welchen ua. auch weiterhin die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gefordert wird.
Die Prüfung des Vorliegens der Voraussetzungen für die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung oblag in letzter Instanz dem Umweltsenat, welcher rechtskräftig entschieden hat, dass das gegenständliche Anlagenprojekt nicht UVP-pflichtig ist.
Da dieser Bescheid von den Parteien nicht mehr durch ordentliche Rechtsmittel bekämpft werden kann, ist er unanfechtbar und damit verbindlich für Parteien und Behörden (vgl. in diesem Sinne VwGH vom 17. Mai 2001, 99/07/0064).
Da auch kein Hinweis darauf vorliegt, dass etwa in der Zwischenzeit neue Tatsachen oder Beweismittel hervorgekommen wären, kommt auch eine Wiederaufnahme des Verfahrens durch die Parteien gemäß § 69 AVG nicht in Betracht.
Abschließend darf jedoch darauf hingewiesen werden, dass auch in einem Verfahren nach dem UVP-G keine anderen subjektiv-öffentlichen Rechte von den Nachbarn geltend gemacht werden können als in einem Verfahren gemäß § 29 AWG.“
Einstimmiger Beschluss in der Sitzung des Ausschusses am 4. Juli 2002:
Erledigung durch Kenntnisnahme des Ausschussberichtes.
II. Sonstiges
Nachstehend werden jene Petitionen und Bürgerinitiativen aufgezählt, die der Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen in Verhandlung genommen hat und die nicht unter dem Abschnitt I anzuführen sind. Dies betrifft diesfalls jene Petitionen und Bürgerinitiativen, die auf Grund eines Ersuchens des Ausschusses vom Präsidenten des Nationalrates einem anderen Ausschuss zugewiesen worden sind.
1. Petitionen:
Finanzausschuss
Petition Nr. 51
überreicht von der Abgeordneten Inge Jäger „zur schrittweisen Erhöhung der Mittel für die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit auf 0,7% des Bruttoinlandsprodukts (BIP)“
Die gegenständliche Petition hat folgenden Inhalt:
„Österreich liegt bei Entwicklungshilfe an drittletzter Stelle!!
Österreich liegt bei der öffentlichen Entwicklungshilfe mit Aufwendungen von 0,25% des Bruttoinlandsprodukts im Schlussfeld der OECD-Staaten. Im EU-Raum geben nur noch Portugal und Griechenland weniger für Entwicklungshilfe aus.
Wir sind der Meinung, dass Österreich als eines der reichsten Länder der Erde, solidarische Pflichten gegenüber Entwicklungsländern wahrzunehmen hat.
Wir fordern daher
die Aufnahme des Passus in das neue Gesetz für Entwicklungszusammenarbeit ,Die Republik Österreich beabsichtigt, ihre Mittel für die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit schrittweise zu erhöhen, um bis 2010 das internationale Ziel von 0,7% des BIP zu erreichen.‘
Mit meiner Unterschrift fordere ich die gesetzmäßige Verankerung der
Erhöhung der öffentlichen Entwicklungshilfe auf 0,7% des BIP bis 2010.“
Einstimmiger Beschluss in der Sitzung des Ausschusses am 15. Februar 2002:
Ersuchen um Zuweisung an den Finanzausschuss.
Justizausschuss
Petition Nr. 35
überreicht von den Abgeordneten Theresia Haidlmayr und Dr. Helene Partik-Pablé betreffend „Nein zur Biomedizin-Konvention des Europarates“
Die Abgeordneten Theresia Haidlmayr und Dr. Helene Partik-Pablé sprechen sich entschieden gegen eine Ratifizierung der Biomedizin-Konvention des Europarates aus und überreichten folgende Petition, welche von mehr als 11 000 Personen unterschrieben wurde:
„Nein zur Biomedizin-Konvention des Europarates“
Delegation des ÖAR bei Parlamentspräsident Fischer
„Am 19. November
1996 beschloss das Ministerkomitee des Europarates die ,Biomedizin-Konvention‘.
Damit sollte erstmals ein Mindeststandard zum ,Schutz der Menschenrechte und
Menschenwürde im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin‘ auf
multilateraler Ebene, gültig für alle 40 Mitgliedstaaten des Europarates,
geschaffen werden.
In dieser Konvention sind Bestimmungen enthalten, durch die ,einwilligungsunfähige‘ Personen schwer diskriminiert werden. Laut diesem ,Mindeststandard‘ darf in ,Ausnahmefällen‘ an Kleinkindern, geistig und psychisch behinderten Menschen, an altersdementen Menschen und an Koma-Patienten Forschung betrieben werden, auch wenn diese Forschung diesen Personen keinen Nutzen bringt, ja sogar Risken birgt.
Die ,Biomedizin-Konvention‘ betrifft uns alle. Denn jeder kann heute nach einem Autounfall ins Koma fallen; denn niemand ist davor gefeit, an Alzheimer zu erkranken; und jeder wäre damit morgen schon ein mögliches Opfer für medizinische Experimente.
Im Mai 1998 überreichten Abgeordnete aller im Nationalrat vertretenen Parteien dem Präsidenten des Nationalrates die Petition ,Nein zur Biomedizin-Konvention‘. Gleichzeitig wurden die gesammelten 50 000 Unterschriften übergeben. Die genannte Petition (Nr. 45) behandelte in Folge der zuständige Ausschuss am 1. Juli 1998 sowie am 19. März 1999. In letztgenannter Sitzung wurde die Angelegenheit dem Justizausschuss zugewiesen. Durch Vertagung sowie die Auflösung des Nationalrates kam es in der vorigen Legislaturperiode zu keiner Behandlung unserer Petition.
Nachdem unsere Bemühungen um Reaktivierung dieser Petition keinen Erfolg zeitigten, werden wir diese mit zusätzlichen 11 384 Unterschriften erneut einreichen.
Wien, 23. Oktober 2001“
„Das Ministerkomitee des Europarates – ein Zusammenschluss von 40 demokratischen europäischen Staaten – beschloss nach mehr als fünfjähriger Beratung der ,Bio-Ethik-Konvention‘ am 19. November 1996 diese Konvention unter dem Titel ,Bio-Medizin-Konvention‘. Österreich hat im Ministerkomitee dieser Konvention zugestimmt. Sie wurde bislang von Österreich nicht ratifiziert.
Helfen Sie mit zu verhindern, dass diese diskriminierende und menschenverachtende Konvention von Österreich ratifiziert wird!
Sinn und Inhalt der Bio-Medizin-Konvention
Diese Konvention sollte erstmals Mindeststandards auf multilateraler Ebene festlegen zum ,Schutz der Menschenrechte und Menschenwürde im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin‘.
Es bleibt jedem Mitgliedstaat des Europarates vorbehalten, darüber hinausgehende Schutzbestimmungen gesetzlich zu verankern. Enthalten sind Regelungen
– zur medizinischen Forschung,
– zur Organentnahme zu Transplantationszwecken bei lebenden Personen,
– zur Embryonenforschung.
In manchen Bereichen hat Österreich in der nationalen Gesetzgebung wesentlich strenger formulierte Schutzbestimmungen.
Gefahren der Konvention und mögliche negative Folgewirkungen
Die Gefahr dieser Konvention wird erst klar, wenn man die Folgen der einzelnen Bestimmungen überlegt. Als Beispiel der Artikel 17 über ,Protection of persons not able to consent to research‘ (einwilligungsunfähige Personen), Absatz 2: ,Exceptionally and under the protective conditions prescribed by law (…) such research may be authorised …‘ (,In Ausnahmefällen und nach Maßgabe der gesetzlich vorgeschriebenen Schutzbestimmungen kann Forschung (…) zugelassen werden …‘). Eine ähnliche Formulierung findet sich auch im Artikel 20 über die ,Entnahme regenerierbaren Gewebes‘.
Durch diese Artikel wird in ,Mindeststandards‘ Forschung und Organentnahme an einwilligungsunfähigen Personen zugelassen. Die Forschung selbst muss für die betroffenen Personen nicht zwangsläufig nutzbringend sein, sondern darf – im Gegenteil – sogar gesundheitliche Risken bergen. Zu diesen Personen zählen Kinder, altersdement, geistig und psychisch behinderte Menschen und Komapatienten.
Noch verhindern Österreichs Gesetze, dass diese beiden Artikel an ,einwilligungsunfähigen‘ Personen Forschung und Organentnahme zulassen.
Utopie oder Zukunft der Forschung?
Eine Skizzierung der schlimmsten möglichen Folgen liest sich wie grausamste Science-fiction: Mitgliedstaaten des Europarates ohne bestehende Schutzbestimmungen ratifizieren diese Konvention nicht und anerkennen damit keine ,Mindeststandards‘. Sie bekommen dadurch einen ,Forschungsvorsprung‘ gegenüber Ländern wie Österreich. Die medizinische Forschung in Österreich will nicht ,diskriminiert‘ werden und übt Druck auf die Regierung aus.“
„Bio-Medizin-Konvention des Europarates:
Factsheet der Lebenshilfe Österreich
Grundsätzliches:
– Es wird prinzipiell gutgeheißen, dass auf dem Weg einer Konvention des Europarates erstmal einheitliche Regelungen zum Schutz der Menschenrechte und der Menschenwürde im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin geschaffen werden sollen.
– Kritisiert wird zunächst die Vorgangsweise der Entstehungsgeschichte dieser Konvention. Von den Inhalten der Konvention sind weite Bevölkerungsteile betroffen. Deren Interessenvertretungen (NGO’s) wurden von den Beratungen weder informiert, noch wurden sie miteinbezogen. Ähnlich verhält es sich mit den derzeit in Verhandlung befindlichen Zusatzprotokollen bzw. dem bereits vorgestellten Zusatzprotokoll über Klonen.
– Nicht nur in Österreich, auch in anderen Mitgliedstaaten wird von Befürwortern gerne auf bessere nationale Gesetzgebung hingewiesen, die durch die Konvention nicht geändert würde. Die wechselseitige Beeinflussung der Staaten, die Internationalisierung von Wirtschaft und Forschung wird in diesen Argumentationen nicht berücksichtigt oder unterschätzt.
– Konventions-Befürworter weisen darauf hin, dass von anderen Staaten der Mindeststandard nicht abverlangt werden dürfe, solange Österreich nicht mit dem positiven Beispiel einer Ratifizierung voranginge. Wir sind dagegen überzeugt, dass Österreich durch eine Verweigerung der Ratifizierung einen internationalen Denkprozess auslösen kann und die Konvention selbst in den kritisierten Punkten verbessert werden kann.
Die Argumente im Detail:
Es ist richtig, dass in wenigen Punkten die österreichische Rechtsordnung im Fall einer Ratifizierung verbessert werden müsste. Diese Tatsache muss nicht zwangsläufig als Argument für die Konvention bzw. ihre Ratifizierung interpretiert werden. Man könnte daraus ebenso ein Versäumnis des österreichischen Gesetzgebers ablesen. Als Beispiele seien folgende Passagen der Konvention genannt:
– Artikel 2: ,Vorrang des menschlichen Lebewesens gegenüber dem bloßen Interesse der Gesellschaft oder Wissenschaft‘.
– Artikel 11: ,Jede Form von Diskriminierung einer Person wegen ihres genetischen Erbes ist verboten‘.
– Artikel 21: ,Verbot des finanziellen Gewinns bei Organentnahmen‘.
Artikel 17 – Schutz einwilligungsunfähiger Personen bei Forschungsvorhaben
Abs. 2: In Ausnahmefällen und nach Maßgabe der durch die Rechtsordnung vorgesehenen Schutzbestimmungen darf Forschung, deren erwartete Ergebnisse für die Gesundheit der betroffenen Person nicht von unmittelbarem Nutzen sind, zugelassen werden, wenn (…)
ii) die Forschung bringt für die betroffene Person nur ein minimales Risiko und eine minimale Belastung mit sich.
– Pro-Argument: Das österreichische Arzneimittelgesetz verhindert für viele Personengruppen fremdnützige Forschung.
– Kritik 1: Das Arzneimittelgesetz umfasst nicht alle Personengruppen, die als ,einwilligungsunfähig‘ definiert werden können (etwa Komapatienten).
– Kritik 2: Solange die Konvention diese juristischen Schlupflöcher offenlässt, haben Forschungsunternehmen die Möglichkeit, in andere Staaten mit weniger strengen innerstaatlichen Gesetzen auszuweichen.
– Kritik 3: Die Begriffe ,minimales Risiko‘ und ,minimale Belastung‘ sind nicht näher definiert. Als Beispiel für diese Begriffe wurde die psychische Belastung jener Personen angeführt, die vor einer herkömmlichen Impfung Angst haben. Es ist allerdings ungeklärt, ob eine Maßnahme an einem schwerstverletzten Patienten, die das Leben möglicherweise um einige Tage verkürzen könnte, ebenfalls unter ,minimales Risiko‘ oder ,minimale Belastung‘ fällt.
– Pro-Argument: Manche Krankheiten/Behinderungen könnten nur an jenen Menschen erforscht werden, die an dieser Krankheit leiden/mit dieser Behinderung leben.
– Kritik 1: Auch diese Personen haben Menschenrechte und Menschenwürde, diese Argumentation macht sie zu Menschen zweiter Klasse.
– Kritik 2: Nicht nur die medizinische Forschung selbst, auch die Forschungsmethoden unterliegen einem Fortschritt. Wäre Forschung an einwilligungsunfähigen Personen zugelassen, gäbe es für die Forschung keine Veranlassung, nach neuen Methoden zu suchen.
– Kritik 3: Die Menschheit wird zunehmend mit der Frage konfrontiert, ob all jenes tatsächlich in der Praxis angewandt werden müsse, was Forschung und Wissenschaft (theoretisch) bereits ermöglichen. Im Sinne der Menschenrechte sollte sich auch die Forschung Grenzen setzen.
Artikel 18, Abs. 2: Die Erzeugung menschlicher Embryonen zu Forschungszwecken ist verboten.
– Pro-Argument: Die österreichische Rechtsordnung verbietet jegliche Forschung an Embryonen.
– Kritik 1: Die Konvention ist nicht ausreichend. Bei jeder In-vitro-Fertilisation entstehen mehrere Embryonen. Diese wurden zwar nicht für Forschungszwecke eigens erzeugt, können aber nach der Konvention verwendet werden.
– Kritik 2: Auch in diesem Fall gilt: Was in Österreich verboten ist, kann in anderen Staaten zugelassen bleiben. Ein Ausweichen der Forschung auf andere Staaten ist damit möglich.
Datenschutz bei genetischen Tests
– Pro-Argument: Das österreichische Gentechnikgesetz verbietet die Weitergabe von genetischen Analysen an Arbeitgeber, Versicherer und deren Beauftragte und Mitarbeiter.
– Kritik 1: Der Datenschutz ist nicht ausreichend, Bestimmungen über Aufbewahrung und Vernichtung der Ergebnisse fehlen.
– Kritik 2: erneut der internationale Aspekt.
Zusatzprotokoll über das Verbot des Klonens von Menschen
– Pro-Argument: Das Verbot ist eindeutig und sogar klarer formuliert als ein US-Gesetzesvorschlag, der nur eine bestimmte Art des Klonens verbietet.
– Kritik 1: Das Zusatzprotokoll verbietet ,Eingriffe, die auf die Schaffung eines Menschen, der genetisch identisch ist mit einem anderen lebenden oder toten Menschen‘. Das Gesetz verbietet jedoch nicht, die Schaffung einer Variation eines Menschen durch genetische Veränderungen.
– Pro-Argument: Österreich muss die Konvention insgesamt ratifizieren, um das Zusatzprotokoll ratifizieren zu können.
– Kritik 1: Die vermeintlich positiven Aspekte eines Zusatzprotokolls dürfen die negativen Aspekte der gesamten Konvention nicht aufheben.
– Kritik 2: Ein umfassendes Klonierungs-Verbot kann auch über den Weg eines innerstaatlichen Gesetzes erreicht werden.
Zusammenfassung:
Österreich darf die Konvention in der bestehenden Fassung keinesfalls ratifizieren. Der ,Schutz der Menschenrechte und der Menschenwürde im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin‘ ist nicht ausreichend formuliert.
Ein internationaler Mindeststandard – so wünschenswert er wäre – darf keinesfalls Personen zu Menschen zweiter Klasse degradieren.
Mangelnde Definitionen dürfen im Zusammenhang mit dem leiblichen Wohlbefinden nicht dazu führen, dass zum Beispiel erst im Nachhinein ausjudiziert werden muss, ob ein bereits durchgeführtes Forschungsvorhaben rechtlich einwandfrei war.
Lebenshilfe Österreich
Birgit Primig-Eisner
Bereichsleitung Kommunikation
Mai 1998“
„PRESSEINFORMATION
Biomedizin-Konvention
So denken Österreichs PolitikerInnen
Die Plattform ,Nein zur Biomedizin-Konvention‘ spricht sich klar gegen ein Ratifizierung der Konvention in der bestehenden Form aus. Ob die Konvention ratifiziert wird, entscheidet der Nationalrat. Obwohl noch nicht absehbar ist, wann die Konvention im Nationalrat debattiert wird, ist sie bereits für viele PolitikerInnen ein Thema. Etliche Abgeordnete zum Nationalrat, aber auch zum Bundesrat haben sich bereits zur Konvention geäußert. Mehrere Landtage haben ihr klares ,Nein‘ zur Konvention ausgedrückt. Vor allem von Seiten der ÖVP scheint eine Ratifizierung aber angestrebt zu werden.
Einige Zitate aus Schreiben an die Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, Dachorganisation der Behindertenverbände:
Abg. z. NR Brigitte Tegischer (SPÖ) 26. Februar 1998: ,Als Volksvertreterin und Sozialarbeiterin ist es mir immer ein besonderes Anliegen, gegen Diskriminierungen und Missbrauch von wehrlosen Menschen zu kämpfen und unterstütze selbstverständlich Ihre Plattform.‘
Abg. z. NR Mag. Kurt Gaßner (SPÖ), 3. März 1998: ,Ihre Ziele decken sich inhaltlich auch mit meinen Ansichten, und ich habe bereits meine Unterschrift zur Unterstützung Ihres Anliegens abgegeben. (…) Ich hoffe, dass wir gemeinsam verhindern können, dass Menschen für medizinische Versuche missbraucht werden und bin mir einer baldigen Lösung Ihrer Anliegen sicher.‘
Klubsekretärin Dr. Gabriele Vollnhofer (SPÖ): 20. April 1998: ,Dieses Übereinkommen wurde am 4. April 1997 in Oviedo zur Unterzeichnung aufgelegt. Im Hinblick auf die bestehenden innerstaatlichen Vorbehalte gegenüber dem Übereinkommen wurde von einer Unterzeichnung abgesehen. (…) Durch diese Stellungnahme hat die Österreichische Bundesregierung klar zum Ausdruck gebracht, dass ein Beitritt zu dem Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin nicht in Frage kommt. Eine Ratifizierung dieses Übereinkommens und damit ein Abgehen von den hohen österreichischen Schutzstandards steht überhaupt nicht zur Diskussion.‘
Abg. z. NR Mag. Dr. Heide Schmidt (LIF), 16. April 1998: ,Wir nehmen Ihre Bedenken (…) sehr ernst, und die Liberalen würden der Ratifizierung der Konvention in der vorliegenden Fassung daher auch nicht zustimmen. (…) Ich gebe jedoch zu, dass es außerordentlich schwierig ist, einen Konsens von zirka 50 verschiedenen Staaten mit sehr stark unterschiedlich ausgeprägten Strukturen und Rechtssystemen herbeizuführen. Wir werden daher sehr genau abwägen müssen, ob die dann gefundenen Mindeststandards ausreichen, auch wenn sie nicht das österreichische Niveau erreichen (können), oder ob es vertretbar ist zu riskieren, dass auf Grund mangelnder international verbindlicher Mindeststandards Firmen in jene Länder ausweichen, die keinerlei oder nur sehr geringe Beschränkungen vorsehen. Das vorliegende Papier ist jedoch unbestritten zu wenig.‘
Abg. z. NR Maria Schaffenrath (LIF), 19. März 1998: ,Beiliegend übermitteln wir Ihnen einige Unterschriften zur Unterstützung Ihrer Plattform. Ich werde mich dort, wo es mir möglich ist, gegen eine diesbezügliche Ratifizierung einsetzen.‘
Abg. z. NR MMag. Dr. Madeleine Petrovic (G), 18. März 1998: ,Die Bioethik wertet Menschen mit Behinderungen oder Alterserkrankungen ab und degradiert sie zu Forschungsobjekten und Materiallagern für Transplantate. Sie macht Sterbende zu Kostenfaktoren und Embryonen zur Sache. (…) Für uns Grüne ist eine derartige Haltung mit den Menschenrechten unvereinbar und wir werden alles daransetzen, dass es zu keiner Ratifizierung der Biomedizin-Konvention durch Österreich kommt.‘
Abg. z. NR Karl Öllinger (G), 6. März 1998: ,Danke für Ihre Aktivitäten. In einem Land, das erst vor wenigen Jahrzehnten mit der Eugenik bei der Euthanasie von behinderten Menschen gelandet ist, sollten die geschichtlichen Erfahrungen eine sehr bewusste und sensible Grundlage für den Schutz der Menschenrechte und der Menschenwürde bei medizinischer Forschung und Anwendung bilden. Ich teile Ihre Auffassung, dass dies bei der in Diskussion stehenden Biomedizin-Konvention nicht der Fall ist. (…) Ich werde die Ratifizierung der Konvention sicher nicht mittragen.‘
Abg. z. NR Dr. Jörg Haider (FPÖ), 9. März 1998: ,Die Notwendigkeit einer Bioethik-Konvention wird von uns Freiheitlichen anerkannt, Ihre konkreten inhaltlichen Bedenken hinsichtlich der Möglichkeit, Forschung an nicht einwilligungsfähigen Personen vorzunehmen, (…) finden aber unsere Zustimmung. Wir treten daher für eine Nichtunterzeichnung der Bioethik-Konvention (…) ein.‘
Abg. z. NR Dr. Alois Pumberger (FPÖ), 2. März 1998: ,Mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen mitteilen, dass auch ich schon des öfteren auf die Gefahren hingewiesen habe, die die Biomedizin-Konvention beinhaltet. Aus diesem Grund kann ich die politische Position der ÖAR sowohl aus ärztlicher als auch aus politischer Sicht voll inhaltlich unterstützen.‘
Abg. z. NR Mag. Johann Ewald Stadler (FPÖ), 9. März 1998: ,Die derzeitigen Mindeststandards der Bioethik-Konvention sind nicht geeignet, demente Personen, geistig Behinderte und Koma-Patienten ausreichend zu schützen.‘
Zweiter Präsident des Nationalrates Dr. Heinrich Neisser (ÖVP), 10. März 1998: ,Eine ausführliche und sachliche Diskussion vor Abschluss der Ratifikation ist meiner Meinung nach – schon aus demokratiepolitischen Überlegungen heraus – unbedingt notwendig. Die Bedenken der Betroffenen (…) müssen ernst genommen werden. (…) Abschließend möchte ich meiner Überzeugung Ausdruck verleihen, dass die Biomedizin-Konvention ein international verbindliches Rechtsinstrument zum Schutz der Menschenrechte und der Menschenwürde im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin darstellt.‘
Abg. z. NR Dr. Gottfried Feurstein (ÖVP), 20. März 1998: ,Ich möchte Sie informieren, dass ich bereits vor längerer Zeit Ihre Initiative unterschrieben habe. Ich versichere Ihnen, dass ich von meiner Seite alles unternehmen werde, so dass es zu keiner Ratifizierung dieser Konvention im österreichischen Nationalrat kommt.‘
Abg. z. NR Bgm. Johann Kurzbauer (ÖVP), 20. März 1998: ,Ein Beitritt Österreichs kommt sicher nur in Frage, wenn gewährleistet ist, dass keine Diskriminierung von nicht einwilligungsfähigen Personen stattfindet, sondern gerade für diese Personen ein höchstmöglicher Schutz erreicht wird.‘
Abg. z. NR Ingrid Tichy-Schreder (ÖVP), 11. März 1998: ,Eine Verbesserung und Weiterentwicklung der Konvention (…) kann jedenfalls nur durch solche Staaten erreicht werden, die Vertragspartner der Konvention sind.‘
Vizepräsident des Bundesrates Dr. Jürgen Weiss (ÖVP), 5. März 1998: ,Wie Ihnen vielleicht aus den Medien bekannt ist, zeichnet sich im Vorarlberger Landtag eine klare Willensäußerung gegen die Ratifizierung der Biomedizin-Konvention ab und es ist für mich sowohl selbstverständlich, im konkreten Fall auch ein persönliches Anliegen, in Wien den Standpunkt meines Landes zu vertreten.‘
Abg. z. NR Dr. Walter Schwimmer (ÖVP), 2. März 1998: ,Ich habe mich immer davon leiten lassen, – und stehe nach wie vor dazu –, dass Rechtsvorschriften in einer demokratischen Gesellschaft im Zweifel immer dazu da sind, den Schwächeren und Hilflosen zur Seite zu stehen. Eine Gesellschaft, die die Schwachen und Hilflosen in ihren Dienst stellen möchte, aus welchen ,hehren‘ Gründen auch immer, wäre weder eine demokratische noch eine soziale.‘
… ,Von einer Weiterentwicklung der Konvention und den Beitritt zu den Protokollen wären wir ausgeschlossen, wenn wir die Konvention selbst nicht ratifizieren.‘
Abg. z. NR Dipl.-Kfm. Dr. Günther Puttinger (ÖVP), 27. März 1998: ,Ein Beitritt Österreichs kommt sicher nur in Frage, wenn feststeht, dass keine Diskriminierung von nicht einwilligungsfähigen Personen stattfindet, sondern gerade für diese Personen ein höchstmöglicher Schutz erreicht wird.‘
NEIN zur Bio-Medizin-Konvention!!
Am 19. November 1996 beschloss das Ministerkomitee des Europarates die ,Bio-Medizin-Konvention‘. Damit sollte ein Mindeststandard für 40 europäische Staaten geschaffen werden, wie Menschenrechte und Menschenwürde auch in Biologie und Forschung zu schützen sind.
Aber Kleinkinder, geistig und psychisch behinderte Menschen,
altersdemente Personen, Alzheimer-Patienten, Menschen im Koma sind laut dieser
Konvention für Forschungszwecke freigegeben – nicht etwa für Forschung, die der
jeweiligen Person hilft, sondern Forschung, die nur für andere Menschen von
Nutzen ist, aber für die betroffene Person sogar mit gesundheitlichen Risken
verbunden sein kann.
Österreich hat im Europarat dieser Bio-Medizin-Konvention zugestimmt. Mit unserer Unterschrift fordern wir den Nationalrat auf, die Konvention in der vorliegenden Fassung abzulehnen.
Die Bio-Medizin-Konvention betrifft uns alle. Denn jeder kann heute nach einem Autounfall ins Koma fallen; denn niemand ist davor gefeit, an Alzheimer zu erkranken; und jeder wäre damit morgen schon ein mögliches Opfer für medizinische Experimente.
NEIN zu menschlichen Versuchskaninchen!“
In der Sitzung des Ausschusses am 3. April 2002 wurde einstimmig beschlossen, ein Expertenhearing im Rahmen einer allgemeinen Ausschusssitzung abzuhalten, welches am 11. Juni 2002 stattfand.
In der Sitzung des Ausschusses am 4. Juli 2002 erfolgte ein einstimmiger Beschluss über einen Antrag der Abgeordneten Mag. Gisela Wurm, Dr. Gerhard Kurzmann, Edeltraud Gatterer und Theresia Haidlmayr auf folgende Ausschussfeststellung:
Der Auschuss stellt hiermit fest, dass eine auszugsweise Darstellung des Hearings der Experten vom 11. Juni 2002 zur gegenständlichen Petition dem Sammelbericht beigedruckt werden soll (Anlage).
Weiters erfolgte ein einstimmiger Beschluss in der Sitzung des Ausschusses am 4. Juli 2002:
Ersuchen um Zuweisung an den Justizausschuss
Verkehrsausschuss
Petition Nr. 37
überreicht von den Abgeordneten Anton Heinzl und Beate Schasching betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3211 Loich“
Petition Nr. 38
überreicht von den
Abgeordneten Anton Heinzl und Beate Schasching betreffend „für die
Erhaltung des Postamtes 3125 Statzendorf“
Petition Nr. 39
überreicht von den
Abgeordneten Anton Heinzl und Beate Schasching betreffend „für die
Erhaltung des Postamtes 3384 Groß Sierning“
Petition Nr. 40
überreicht von den
Abgeordneten Anton Heinzl und Beate Schasching betreffend „für die
Erhaltung des Postamtes 3074 Michelbach“
Petition Nr. 41
überreicht von den
Abgeordneten Anton Heinzl und Beate Schasching betreffend „für die
Erhaltung des Postamtes 3072 Kasten“
Petition Nr. 42
überreicht von den
Abgeordneten Anton Heinzl und Beate Schasching betreffend „für die
Erhaltung des Postamtes 3131 Getzersdorf“
Petition Nr. 43
überreicht von den
Abgeordneten Anton Heinzl und Beate Schasching betreffend „für die
Erhaltung des Postamtes 3104 Harland“
Petition Nr. 44
überreicht von den
Abgeordneten Anton Heinzl und Beate Schasching betreffend „für die
Erhaltung des Postamtes 3105 Radlberg“
Petition Nr. 45
überreicht von den
Abgeordneten Anton Heinzl und Beate Schasching betreffend „für die
Erhaltung des Postamtes 3212 Schwarzenbach“
Petition Nr. 46
überreicht von den Abgeordneten Anton Heinzl und Beate Schasching
betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3144 Wald“
Petition Nr. 47
überreicht von den Abgeordneten Anton Heinzl und Beate Schasching
betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3061
Ollersbach“
Petition Nr. 48
überreicht von den Abgeordneten Anton Heinzl und Beate Schasching
betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3051 St.
Christophen“
Petition Nr. 49
überreicht von den
Abgeordneten Anton Heinzl und Beate Schasching betreffend „für die
Erhaltung des Postamtes 3052 Innermanzing“
Petition Nr. 52
überreicht vom Abgeordneten Dipl.-Ing.
Werner Kummerer betreffend „für
die Erhaltung der Postämter im Bezirk Mistelbach“
Petition Nr. 53
überreicht vom Abgeordneten Dr. Robert Rada betreffend „für die Erhaltung der
Postämter im Bezirk Gänserndorf“
Petition Nr. 54
überreicht vom Abgeordneten Dipl.-Kfm. Dr.
Hannes Bauer betreffend „für die
Erhaltung der Postämter im Bezirk Hollabrunn“
Petition Nr. 56
überreicht von den Abgeordneten Günter Kiermaier und Gabriele Binder
betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3362
Mauer-Öhling“
Petition Nr. 57
überreicht von den Abgeordneten Günter Kiermaier und Gabriele Binder
betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3344 St.
Georgen/Reith“
Petition Nr. 58
überreicht von den Abgeordneten Günter Kiermaier und Gabriele Binder
betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3342 Opponitz“
Petition Nr. 59
überreicht von den
Abgeordneten Günter Kiermaier und Gabriele Binder betreffend „für die Erhaltung
des Postamtes 4441 Behamberg“
Petition Nr. 60
überreicht von den
Abgeordneten Günter Kiermaier und Gabriele Binder betreffend „für die Erhaltung
des Postamtes 3312 Oed“
Petition Nr. 61
überreicht von den
Abgeordneten Günter Kiermaier und Gabriele Binder betreffend „für die Erhaltung
des Postamtes 3311 Zeillern“
Petition Nr. 62
überreicht von den
Abgeordneten Günter Kiermaier und Gabriele Binder betreffend „für die Erhaltung
des Postamtes 3313 Wallsee“
Petition Nr. 63
überreicht von den
Abgeordneten Günter Kiermaier und Gabriele Binder betreffend „für die Erhaltung
des Postamtes 3322 Viehdorf“
Petition Nr. 64
überreicht von den Abgeordneten Günter Kiermaier und Gabriele Binder
betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3325
Ferschnitz“
Petition Nr. 65
überreicht von den
Abgeordneten Günter Kiermaier und Gabriele Binder betreffend „für die Erhaltung
des Postamtes 3332 Rosenau“
Petition Nr. 66
überreicht von den
Abgeordneten Günter Kiermaier und Gabriele Binder betreffend „für die Erhaltung
des Postamtes 3333 Böhlerwerk“
Petition Nr. 67
überreicht von den
Abgeordneten Günter Kiermaier und Gabriele Binder betreffend „für die Erhaltung
des Postamtes 4432 Ernsthofen“
Petition Nr. 68
überreicht von den
Abgeordneten Günter Kiermaier und Gabriele Binder betreffend „für die Erhaltung
des Postamtes 3354 Wolfsbach“
Petition Nr. 69
überreicht vom
Abgeordneten Dr. Peter Wittmann betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 2724 Hohe Wand/Stollhof“
Petition Nr. 70
überreicht vom
Abgeordneten Dr. Peter Wittmann betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 2492 Eggendorf“
Petition Nr. 71
überreicht vom
Abgeordneten Dr. Peter Wittmann betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 2803 Schwarzenbach“
Petition Nr. 72
überreicht vom
Abgeordneten Dr. Peter Wittmann betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 2770 Gutenstein“
Petition Nr. 73
überreicht vom
Abgeordneten Dr. Peter Wittmann betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 2802 Hochwolkersdorf“
Petition Nr. 74
überreicht vom
Abgeordneten Dr. Peter Wittmann betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 2833 Bromberg“
Petition Nr. 75
überreicht vom
Abgeordneten Dr. Peter Wittmann betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 2812 Hollenthon“
Petition Nr. 76
überreicht vom
Abgeordneten Dr. Peter Wittmann betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 2723 Muthmannsdorf“
Diese Petitionen haben folgenden Inhalt:
„In der jüngsten Vergangenheit werden in den Medien laufend so genannte ,Schwarze Listen‘ veröffentlicht, aus denen hervorgeht, welche Postämter in Zukunft geschlossen werden sollen.
Auch das Postamt in XXXX *)
wird in diesen Berichten genannt.
Es braucht nicht näher erläutert zu werden, welch tiefer Einschnitt in die ländliche Infrastruktur durch die Schließung eines Postamtes vorgenommen wird.
Dort wo Postämter geschlossen werden, werden sich viele Menschen mit zusätzlichen Schwierigkeiten konfrontiert sehen. Nicht alle sind so mobil, dass sie viele Kilometer ins nächstgelegene Postamt fahren können.
Jene, die kein Auto haben, keinen Führerschein besitzen oder aus anderen Gründen nicht so leicht von zuhause weg können, sind die Leidtragenden dieses Postämterkahlschlages. Sie müssen mehr Geld für öffentliche Verkehrsmittel und auch mehr Zeit investieren, um so profane Dinge zu erledigen, wie einen eingeschriebenen Brief oder ein Paket abzuholen.
Die Unterzeichner dieser Petition fordern die Bundesregierung im Allgemeinen und die zuständige Ministerin für Infrastruktur und Verkehr im Besonderen auf, dem Versorgungsauftrag gegenüber der Bevölkerung nachzukommen und dafür Sorge zu tragen, dass es zu keiner Schließung des Postamtes XXXX *) kommt, da durch eine weitere Zerstörung der bestehenden Infrastruktur nicht nur die Lebensqualität im ländlichen Raum deutlich gemindert wird, sondern auch der Landflucht Tür und Tor geöffnet wird.“
Petition Nr. 77
überreicht vom
Abgeordneten Anton Heinzl betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3172 Ramsau“
Petition Nr. 78
überreicht vom
Abgeordneten Anton Heinzl betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3222 Annaberg“
Petition Nr. 79
überreicht vom
Abgeordneten Anton Heinzl betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3223 Wienerbruck“
Petition Nr. 80
überreicht vom
Abgeordneten Anton Heinzl betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3162 Rainfeld an der Gölsen“
Petition Nr. 81
überreicht vom
Abgeordneten Anton Heinzl betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3171 Kleinzell“
Petition Nr. 82
überreicht vom
Abgeordneten Anton Heinzl betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3195 Kernhof“
Petition Nr. 83
überreicht vom
Abgeordneten Anton Heinzl betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 3153 Eschenau“
Petition Nr. 85
überreicht von der
Abgeordneten Gabriele Heinisch-Hosek betreffend „für die Erhaltung des Postamtes 2431 Klein Neusiedl“
Die Petition Nr. 77 trägt beispielsweise folgende Formulierung:
„Petition für die Erhaltung des Postamtes 3172 Ramsau
Das Postamt Ramsau wird auf Grund von ungerechtfertigten Einsparungen geschlossen, ebenso wie sechs weitere Postämter im Bezirk Lilienfeld. Die Schließung dieses Postamtes bedeutet für die Gemeinde Ramsau einen wesentlichen Verlust an Lebensqualität und ist ein weiterer tiefer Einschnitt in die, ohnehin gefährdete, Infrastruktur unseres Bezirkes.
Die Bevölkerung, allen voran ältere Menschen, wird dadurch mit massiven Schwierigkeiten in alltäglichen Dingen konfrontiert. Die Verrichtung einfacher Postwege, wie das Abholen eines Päckchens, werden immens erschwert, zumal der Bezirk auch von massiven Verschlechterungen im öffentlichen Verkehr betroffen ist.
Der Unterzeichner dieser Petition fordert daher die Bundesregierung und die zuständige Bundesministerin für Infrastruktur und Verkehr auf, dem Versorgungsauftrag gegenüber der Bevölkerung nachzukommen und dafür Sorge zu tragen, dass das Postamt 3172 Ramsau nicht geschlossen wird.
Die Schließung dieses Postamtes würde einen weiteren, massiven Schritt in der Zerstörung der Infrastruktur und der Lebensqualität der Region darstellen.“
Die Petitionen 78 und 79 sind folgendermaßen formuliert:
„Resolution der Gemeinde Annaberg
In Niederösterreich will die Post AG rund 200 Postämter schließen. Diese Schließungspläne bedeuten einen massiven Anschlag auf die Lebensqualität in den ländlichen Regionen. Insbesondere in Regionen, die zurzeit schon mit infrastrukturellen Problemen zu kämpfen haben, ist die Schließung eines Postamtes eine bedeutende Schwächung der gesamten Region. Jedes Postamt stellt für jede Gemeinde eine wichtige öffentliche Einrichtung dar und leistet dadurch einen wesentlichen Beitrag für die Lebensqualität und Nahversorgung der Gemeindebürger. Vor allem für ältere Menschen und Gemeindebürger, die nicht so mobil sind, wäre ein Verlust der Postämter eine grobe Verschlechterung in der Gemeinde Annaberg.
Darüber hinaus ist die Schließung jedes Postamtes auch ein weiterer Standortnachteil für ansässige Betriebe und gefährdet die vorhandenen Arbeitsplätze in unserer Gemeinde. Außerdem müssen durch die Schließung der Postämter viele Mitarbeiter um ihren Arbeitsplatz zittern. Auf Grund unserer geographischen Lage (langer Winter, weite Anfahrtswege, Straßenverhältnisse) ergeben sich für die Mitarbeiter der Post AG schwierige Arbeitsbedingungen, die nicht sein müssten.
Der Gemeinderat der Gemeinde Annaberg fordert die Bundesregierung daher auf, auf das Management der Post AG einzuwirken, um von der geplanten Schließung der Postämter Annaberg und Wienerbruck Abstand zu nehmen.
Weiters fordert der Gemeinderat der Gemeinde Annaberg die Bundesregierung auf, ihre Verantwortung für die Einhaltung der Infrastruktur im ländlichen Bereich wahrzunehmen, die Übertragung von Aufgabengebieten der Post an Private zu stoppen, um die Sicherheit des Postdienstes und das Vertrauen in das Postgeheimnis nicht zu unterminieren.
Für den Gemeinderat der Gemeinde Annaberg
Der Bürgermeister“
Der Text betreffend die Petition Nr. 80 lautet wie folgt:
„Marktgemeinde St. Veit an der Gölsen
Resolution
In unserer Marktgemeinde sichern derzeit die beiden Postämter 3161 St. Veit an der Gölsen und 3162 Rainfeld an der Gölsen alle Postdienstleistungen für die Bevölkerung.
Laut verschiedenen Medienberichten sind in Niederösterreich rund 200 kleinere Postämter von der Schließung bedroht.
Postvorstand Josef Halbmayr vertritt die Meinung, dass Postämter mit einen oder zwei Schalterbeamten nicht wirtschaftlich zu führen sind. Daher sollen sie geschlossen bzw. in Postagenturen umgewandelt werden.
Das bedeutet, dass Private, zB Trafikanten, Lebensmittelhändler, … die Postdienste übernehmen sollen.
Hier gibt es vor allem bezüglich des Post- und Briefgeheimnisses große Bedenken. Weiters gehen durch die Zustellkonzentration Arbeitsplätze in den Regionen verloren.
Die Aushöhlung der Infrastruktur im ländlichen Raum muss endlich gestoppt werden!
Der Gemeinderat der Marktgemeinde St. Veit an der Gölsen spricht sich daher gegen eine Zerschlagung des Unternehmens Post AG und die daraus resultierende Schließung von Postämtern aus, damit die Bevölkerung weiterhin zu gleichen Konditionen alle Dienstleistungsangebote der Post in Anspruch nehmen kann.“
Die Petitionen 82 und 83 tragen diesen Text:
„Resolution
Das Postamt Eschenau wird auf Grund von ungerechtfertigten Einsparungen geschlossen, ebenso wie sechs weitere Postämter im Bezirk Lilienfeld. Die Schließung dieses Postamtes bedeutet für die Gemeinde Eschenau einen wesentlichen Verlust an Lebensqualität und ist ein weiterer tiefer Einschnitt in die ohnehin gefährdete Infrastruktur unseres Bezirks.
Die Bevölkerung, allen voran ältere Menschen, wird dadurch mit massiven Schwierigkeiten in alltäglichen Dingen konfrontiert. Die Verrichtung einfacher Postwege, wie das Abholen eines Päckchens, werden immens erschwert, zumal der Bezirk auch von massiven Verschlechterungen im öffentlichen Verkehr betroffen ist.
Der Gemeinderat der Gemeinde Eschenau fordert daher die Bundesregierung und die zuständige Bundesministerin für Infrastruktur und Verkehr auf, dem Versorgungsauftrag gegenüber der Bevölkerung nachzukommen und dafür Sorge zu tragen, dass das Postamt 3153 Eschenau nicht geschlossen wird.
Die Schließung dieses Postamtes würde einen weiteren massiven Schritt in der Zerstörung der Infrastruktur und der Lebensqualität der Region darstellen.“
Petition Nr. 86
überreicht von der Abgeordneten Ludmilla Parfuss betreffend „für die Erhaltung
der Postämter der Bezirke Deutschlandsberg und Leibnitz“
„Als Grundlage liegt eine Petition von Bürgermeistern der Bezirke Deutschlandsberg und Leibnitz vor, die sich gegen die Benachteiligung des ländlichen Raumes und gegen die Schließung von Postämtern richtet.
Ziel ist es, den weiteren Betrieb von Postämtern in den oben genannten Bezirken durch entsprechende Verordnungen der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie oder andere geeignete rechtliche Mittel sicherzustellen.
Die Begründung liegt in der Tatsache, dass die Schließung eines Postamtes tiefe Einschnitte in die ländliche Infrastruktur zur Folge hat und gerade jene Personen, die kein Auto besitzen, Leidtragende des ,Postämterkahlschlages‘ sind. Durch eine weitere Zerstörung der bestehenden Infrastruktur wird nicht nur die Lebensqualität im ländlichen Raum deutlich gemindert, sondern auch der Landflucht Tür und Tor geöffnet.“
„PETITION
BÜRGERMEISTERINITIATIVE DER BEZIRKE DEUTSCHLANDSBERG UND LEIBNITZ GEGEN DIE BENACHTEILIGUNG DES LÄNDLICHEN RAUMES UND GEGEN DIE SCHLIESSUNG VON POSTÄMTERN
Nach der kolportierten Schließung einer großen Anzahl von Postämtern im ländlichen Raum fand am 22. November 2001 eine Zusammenkunft der Bürgermeister der Bezirke Deutschlandsberg und Leibnitz statt.
Dabei wurde einstimmig beschlossen, gegen die immer schwerwiegender werdende Benachteiligung des ländlichen Raumes zu protestieren.
Mit der Schließung von Postämtern tritt eine bedeutende weitere Verschlechterung ein. Wenn auch gewisse Reformen und Strukturbereinigungen unumgänglich sind, dürfen diese doch keinesfalls soweit gehen, dass großen ländlichen Gebieten ein wesentliches Standbein der Infrastruktur geraubt wird.
Um über die zukünftigen Strukturen im Bereich der Postämter objektiv verhandeln zu können, wird die Beachtung folgender Punkte vorausgesetzt:
– Die
Erlassung einer Universaldienstverordnung durch das Bundesministerium für
Verkehr, Innovation und Technologie, welches die Postdienste in Form von
Postämtern für einen großen Bevölkerungsanteil auch in den Landgemeinden
erhält.
– Die
Vorlage eines Gesamtkonzeptes über die Festlegung der zukünftigen
Postamtsstandorte.
– Echte
Verhandlungen der Postdirektion mit den Gemeinden, Offenlegung bzw.
Überprüfungsmöglichkeit der vergleichbaren Wirtschaftlichkeitsberechnung,
welche über die Schließung von Postämtern herangezogen wurden.
– Suche
nach Möglichkeiten, die den weiteren Betrieb der Postämter sicherstellen.
– Für
die Schließung eines Postamtes darf nicht ausschließlich dessen Rentabilität
entscheidend sein, sondern es sind alle damit im Zusammenhang stehenden
Faktoren, vor allem im ländlichen Raum, zu berücksichtigen.
Die versammelten Bürgermeister verlangen die Berücksichtigung ihrer Standpunkte, da Reformen für eine positive Gestaltung der Entwicklung unseres Landes nur mit Beteiligung der Betroffenen erfolgreich sein können.“
In seiner Sitzung am 15. Februar 2002 hat der Ausschuss beschlossen, eine Stellungnahme des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie einzuholen.
Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie gibt zu den gegenständlichen Petitionen zur Erhaltung der Postämter folgende Stellungnahme ab:
„Das geltende Postgesetz 1997 verpflichtet die Österreichische Post AG, eine bundesweite, flächendeckende Versorgung der Kunden mit Postdienstleistungen im Rahmen des Universaldienstes zu allgemein erschwinglichen Preisen und entsprechender Qualität zu gewährleisten. Bereits durch diese gesetzliche Vorgabe ist die Versorgung mit Postdienstleistungen im Rahmen des Universaldienstes rechtlich garantiert. Eine nähere Ausführung ist durch die Universaldienstverordnung erfolgt, die am 31. März 2002 in Kraft getreten ist.
Die Festlegung von Standorten einzelner Postämter oder die Schließung von Postämtern im Detail ist nicht Gegenstand dieser Verordnung.
Es war immer eine klare Forderung des BMVIT an die Österreichische Post AG, dass der ländliche Raum bei den Maßnahmen besondere Berücksichtigung finden muss und eine abgestimmte Vorgangsweise der Österreichischen Post AG mit den Landeshauptleuten und Gemeinden sicherzustellen ist.
In den operativen Bereich der Österreichischen Post AG – und dazu zählt die Struktur des Vertriebsnetzes eines Unternehmens, zB auch Anzahl und Ausstattung der Postämter – kann und wird das BMVIT nicht direkt eingreifen.“
Petition Nr. 88
überreicht von der Abgeordneten Gabriele Heinisch-Hosek betreffend „für die Erhaltung der Postämter 2354 Guntramsdorf 2, 2531 Gaaden und 2381 Laab im Walde“
Petition Nr. 94
überreicht vom Abgeordneten Rainer Wimmer betreffend „für die Erhaltung
der Postämter 4831 Obertraun, 4821 Lauffen, 4820 Pfandl, 4823 Steeg, 4817 St.
Konrad, 4662 Steyrermühl“
Diese Petitionen formulieren ihr Anliegen folgendermaßen:
„Petition
für die
Erhaltung der Postämter 2354 Guntramsdorf 2, 2531 Gaaden und
2381 Laab im Walde
In der jüngsten Vergangenheit werden in den Medien laufend so genannte ,Schwarze Listen‘ veröffentlicht, aus denen hervorgeht, welche Postämter in Zukunft geschlossen werden sollen.
In diesen Berichten werden folgende Postämter im Bezirk Mödling genannt: Guntramsdorf 2, Gaaden und Laab im Walde.
Die Schließung dieser Postämter bedeutet für die betroffenen Gemeinden einen wesentlichen Verlust an Lebensqualität und ist ein weiterer tiefer Einschnitt in die Infrastruktur unseres Bezirkes.
Die Bevölkerung, allen voran ältere Menschen, wird dadurch mit massiven Schwierigkeiten in alltäglichen Dingen konfrontiert. Die Verrichtung so profaner Dinge, wie das Abholen eines Paketes oder das Aufgeben eines eingeschriebenen Briefes, werden dadurch immens erschwert und nehmen mehr Zeit in Anspruch.
Die Unterzeichnerin dieser Petition fordert daher die Bundesregierung im Allgemeinen und den zuständigen Bundesminister für Infrastruktur und Verkehr im Besonderen auf, dem Versorgungsauftrag gegenüber der Bevölkerung nachzukommen und dafür Sorge zu tragen, dass die Postämter Guntramsdorf 2, Gaaden und Laab im Walde nicht geschlossen werden.
Die Schließung dieser Postämter würde einen weiteren, massiven Schritt in der Zerstörung der Infrastruktur und Lebensqualität der Region darstellen.“
Petition Nr. 95
überreicht vom Abgeordneten Rudolf Parnigoni betreffend „gegen die Schließung des Postamtes 3961 Waldenstein im Waldviertel“
Dieser Petition liegt folgende Unterschriftenaktion zugrunde:
„UNTERSCHRIFTENAKTION
gegen die Schließung des POSTAMTES 3961 WALDENSTEIN im Waldviertel
Im März 2002
Wir Unterfertigten ersuchen, unser POSTAMT, das seit 1897 besteht, weiterhin in Betrieb zu lassen, da unsere aufstrebende Gemeinde ein MARIEN-WALLFAHRTSORT ist, der im Durchschnitt jährlich von zirka 20 000 Wallfahrern besucht wird. Außerdem zeigt die letzte VOLKSZÄHLUNG, dass die Bevölkerung um 9,2% angewachsen ist. Durch die Schließung des POSTAMTES würde die Infrastruktur WALDENSTEINS stark beeinträchtigt.
Auf Unverständnis stößt auch die Anordnung der POSTDIREKTION aus dem Jahre 2001, den Postkasten vor dem Postamt nur einmal täglich zu entleeren. Wenn die POST, so wie in den vergangenen 100 Jahren, auch um 7.30 Uhr ausgehoben wird und die Karten und Briefe für den POSTSPRENGEL WALDENSTEIN aussortiert und von den um 8 Uhr in die Dörfer ausfahrenden Briefträgern zugestellt werden, würde der Versand in die 1, 2, 3 oder 4 km entfernten acht Orte (mit etwa 1 500 Einwohnern) nicht mehr zwei, drei, ja sogar vier Tage dauern – wie in den letzten Monaten.
Wir ersuchen daher nochmals höflich, das POSTAMT WALDENSTEIN nicht
zu schließen.“
Einstimmiger Beschluss in der Sitzung des Ausschusses am 4. Juli 2002:
Ersuchen um Zuweisung an den Verkehrsausschuss.
Wirtschaftsausschuss
Petition Nr. 21
überreicht von der Abgeordneten Mag. Barbara Prammer betreffend „Eine Chance auf Familienleben – auch den im Handel Beschäftigten“
„Die UnterzeichnerInnen dieser Petition ersuchen den Nationalrat der Republik Österreich gesetzlich folgende Forderungen sicherzustellen:
– NEIN zu noch längeren Öffnungszeiten.
– NEIN zur Ladenöffnung am Sonntag.
– NEIN zum Plan der Bundesregierung, das derzeitige Recht der Handelsangestellten auf einen freien Samstag alle zwei Wochen abzuschaffen.“
In seiner Sitzung am 17. April 2001 hat der Ausschuss beschlossen, je eine Stellungnahme des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit, des Bundesministeriums für soziale Sicherheit und Generationen, der Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte, der Wirtschaftskammer Österreichs, des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs, des Katholischen Familienverbandes, der Kinderfreunde, des Familienbundes und des Freiheitlichen Familienverbandes einzuholen.
Der Katholische Familienverband unterstützt die Petition Nr. 21 vorbehaltslos und übermittelte folgende Stellungnahme samt anliegender Presseaussendung:
„Die Beibehaltung des arbeitsfreien Sonntags ist eines unserer zentralen Themen. Um die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit des arbeitsfreien Sonntags zu unterstreichen, haben wir im vergangenen Sommer die österreichweite Postkartenaktion ,101 Argumente für einen arbeitsfreien Sonntag‘ durchgeführt. Von Burgenland bis Vorarlberg wurden insgesamt 300 000 Gratispostkarten verteilt.
Wir sind überzeugt davon, dass sowohl die Ausweitung der Ladenöffnungszeiten als auch eine Aufweichung der derzeit geltenden Sonntagsruhebestimmungen negative Auswirkungen auf das Familienleben und das Vereinsleben haben werden. Wie soll Familienleben stattfinden, wenn es keinen einheitlichen, für alle freien Tag in der Woche gibt?“
„Presseaussendung
Die Frage um längere Öffnungszeiten ist keine Einbahnstraße
Werden die Ladenöffnungszeiten auf die Abend- und Nachtstunden ausgeweitet, geht die Tür zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf wieder einen Spalt zu.
Wien, 15. Jänner
2001. ,Längere Ladenöffnungszeiten bedingen a priori keine steigende
Lebensqualität; vor allem dann nicht, wenn die Handelsangestellten Familie
haben‘, sagt Johannes Fenz, Präsident des Katholischen Familienverbandes
Österreichs. Geht es nach Wirtschaftsminister Martin Bartenstein, könnten die
Ladenöffnungszeiten von 66 auf 72 Stunden pro Woche ausgeweitet werden. Den
Händlern soll es außerdem freigestellt sein, wann sie zwischen Montag null und
Samstag 17 Uhr die Geschäfte geöffnet halten wollen.
,Die Frage um längere Ladenöffnungszeiten ist keine Einbahnstraße‘, sagt Fenz. ,Es ist rücksichtlos, in dieser Sache nur die Interessen der Großkonzerne im Handel zu vertreten, nachdem der Bedarf nach längeren Ladenöffnungszeiten nachweislich beschränkt ist.‘ Der Präsident des Familienverbandes verweist auf eine Market-Studie vom August 2000. Dieser Studie zufolge sind 87 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher mit den geltenden Öffnungszeiten zufrieden. Für Fenz ist es daher nicht nachvollziehbar, warum die Ladenöffnungszeiten um den Preis einer geringeren Lebensqualität für Handelsangestellte und deren Familien ausgeweitet werden müssen. ,Offenbar macht Wirtschaftsminister Martin Bartenstein hier einen Kniefall vor den Großkonzernen‘, so der Präsident des Familienverbandes.
Zudem führen liberale Ladenöffnungszeiten dazu, dass die leicht geöffnete Tür zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf wieder einen Spalt zugeht. ,Die Handelsangestellten sind großteils Frauen. Es ist ein bedauerliches Faktum, dass die Organisation der Kinderbetreuung vorwiegend Frauensache ist‘, sagt Johannes Fenz. ,Was machen die Frauen mit den betreuungspflichtigen Kindern, wenn sie am Abend oder in der Nacht vor der Supermarktkassa sitzen müssen?‘ Abgesehen davon, dass es wohl kaum wünschenswert wäre, die Kinder während der Abend- bzw. Nachtstunden in Horte und Kindergärten zu stecken, müssen die Öffnungszeiten der Betreuungseinrichtungen den geänderten Ladenschlusszeiten angepasst werden. Dass Großeltern oder andere Betreuungspersonen jederzeit einspringen können, ist sicherlich der Ausnahmefall. Fenz fordert den früheren Familienminister Martin Bartenstein auf, in der Diskussion um eine Verlängerung der Ladenöffnungszeiten auch die Situation der Handelsangestellten zu berücksichtigen.
Mag. Rosina Baumgartner
KFÖ-Pressedienst“
Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftkammern Österreichs teilen dazu Folgendes mit:
„Die Unterzeichner der Petition ersuchen den Nationalrat gesetzlich sicherzustellen, dass es keine längeren Öffnungszeiten sowie keine Ladenöffnung am Sonntag geben soll und treten für den Erhalt des Rechts der Handelsangestellten auf einen freien Samstag alle zwei Wochen ein.
Die wesentlichen Bestimmungen zur Regelung der Öffnungszeiten finden sich im Öffnungszeitengesetz 1991. Gemäß § 1 Absatz 1 findet dieses Gesetz Anwendung auf Unternehmungen, die der Gewerbeordnung 1994 unterliegen. Durch Absatz 3 sind auch Kleinverkaufsstellen der land- und forstwirtschaftlichen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (siehe § 2 Abs. 1 Z 4 GewO) in den Geltungsbereich einbezogen. Ausdrücklich ausgenommen ist beispielsweise der ,Marktverkehr‘.
Von den Regelungen der Gewerbeordnung ausgenommen sind unter anderem die Land- und Forstwirtschaft, die Nebengewerbe der Land- und Forstwirtschaft sowie bestimmte bäuerliche Nebentätigkeiten. Die Land- und Forstwirtschaft als solche ist demnach lediglich im Bereich der unselbständigen Beschäftigung bei land- und forstwirtschaftlichen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften betroffen. Die Petition zielt folglich auf die Erhaltung bestimmter Rechte der Arbeitnehmer in Handelsunternehmen ab.
Die Präsidentenkonferenz bekennt sich zum Ziel, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sicherzustellen und auch weiter zu verbessern. Konkrete Maßnahmen, die nicht bloß die Rechte von Arbeitnehmern, sondern auch die Führung von Betrieben und deren Konkurrenzfähigkeit wesentlich beeinflussen, sollten vom Konsens der jeweiligen Sozialpartner auf betrieblicher und kollektiver Ebene getragen sein. In diesem Sinne sollte – auf Grund der wirtschaftlichen Bedeutung dieser Themen – bei allenfalls geplanten gesetzlichen Änderungen auf die Lösungsvorschläge der betroffenen Sozialpartner Bedacht genommen werden.“
Vom Österreichischen Gewerkschaftsbund langte dazu eine Stellungnahme betreffend den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Öffnungszeitengesetz 1991, das Arbeitsruhegesetz und die Gewerbeordnung 1994 geändert werden, ein:
„Im Vorblatt zum Gesetzentwurf wird dieser Entwurf unter der Überschrift ,Problem‘ nicht mit Bedürfnissen der Konsumenten/innen begründet, sondern es wird unterstellt, dass die gegenwärtigen Ladenöffnungszeiten ,zum Teil nicht den wirtschaftlichen Erfordernissen‘ entsprechen.
Unter ,Alternativen‘ liest man, dass der derzeitige Zustand ,wenig effizient und konsumentenfreundlich‘ ist. Belegt wird dies nicht.
Dass die Konsumenten/innen in Umfragen, die nach der letzten Erweiterung der Öffnungszeiten durchgeführt wurden, mit den bestehenden Öffnungszeiten zufrieden sind und bei weitem das Auslangen finden, wird ignoriert und lässt darauf schließen, dass es bei dem vorliegenden Gesetzentwurf in Wirklichkeit nicht um die Bedürfnisse der Konsumenten/innen geht, sondern um die Bedürfnisse der Handelsgiganten, die mit der Möglichkeit längerer und zeitlich anders verlagerter Öffnungszeiten Marktanteilsgewinne auf Kosten der Konkurrenz erlangen wollen.
Schon von den letzten Öffnungszeitenerweiterungen profitierten in erster Linie die großen Handelsketten. Das ergab die im Oktober 1998 im Auftrag des Wirtschaftsministeriums erstellte Studie ,Auswirkungen der Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten‘ von Christina Burger. ,Rund 60% der kleinen und mittelständischen Einzelhandelsunternehmen machen von den verlängerten Öffnungszeiten keinen Gebrauch. Die großen Ketten hingegen übernehmen eine Vorreiterrolle‘. (Burger 1998, S 80)
Auf Seite der Konsumenten/innen wies eine Umfrage (AC Nielsen 1998) aus, dass bei den bestehenden Öffnungszeiten 93% ihre Einkäufe problemlos durchführen können (1995 86%). Nur 6% haben Probleme ihre Einkäufe zu erledigen. Sicher, dieser Wert ließe sich auf 0% reduzieren, wenn alle Geschäfte sieben Tage lang 24 Stunden geöffnet halten und vorausgesetzt der Konzentrationsprozess führt nicht zu einer Verschlechterung der Nahversorgung.
Das verdrängte Grundproblem in der Diskussion um die Öffnungszeiten liegt in der Tatsache, dass ein längeres Offenhalten der Geschäfte für den Handel nicht die Umsätze, sondern die Kosten erhöht. Und über kurz oder lang können manche, vor allem kleinere Anbieter, mit den Angeboten nicht mehr mithalten und werden aus dem Markt gedrängt. Das Resultat ist eine Ausdünnung der Nahversorgung. Nach einer ,Marktbereinigung‘ droht dann ein Anziehen der Preise seitens der Großen. Eine Deregulierung der Ladenöffnungszeiten würde den laufenden Konzentrationsprozess weiter anheizen.
Die durch den Preisdruck favorisierte Strategie der ,dünnen Personaldecke‘ erhöht in vielen Bereichen Stress und Hektik der Angestellten. Immer flexiblere Arbeitszeiten machen es zunehmend schwierig, das Berufs- und Familienleben sowie persönliche Interessen zu koordinieren. Zu Lasten der Beschäftigten geht auch der immer wieder vorkommende strategisch geplante Rechtsbruch bei der Entlohnung.
Diesbezüglich ist die im Oktober 1998 im Auftrag des Wirtschaftsministeriums erstellte Studie ,Auswirkungen der Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten‘ von Christina Burger sehr aufschlussreich. Diese hat die seit Anfang 1997 neue Öffnungszeitenregelung analysiert und gezeigt, dass die längeren Öffnungszeiten für viele Handelsangestellten eine Verschlechterung und Probleme geschaffen haben.
– 24% der Arbeitnehmer/innen erhalten keine Zuschläge, wie sie im Öffnungszeiten-KV vereinbart sind.
– 34% wird die gesetzliche Freizeit am Samstag verweigert.
– ,Arbeitnehmer/innen, die in Geschäften beschäftigt sind, welche die längeren Öffnungszeiten nützen, sehen die Ladenschlussliberalisierung negativer als andere.‘
– ,Für die Kinderbetreuung zu Hause ergaben sich für 86% der Befragten mit Kindern eher Nachteile. Für Beschäftigte mit Kindern im Schulalter ergeben sich besondere Nachteile.‘
– ,81% der verheirateten Personen bzw. der Personen in Lebensgemeinschaften ergeben sich eher Nachteile.‘
– Alleinstehende sehen zu 100% Nachteile in der Kinderbetreuung.
– Bei Kinderbetreuung durch Kindergarten, Hort oder Schule ergeben sich für 80% Nachteile.
– Für 16%, auf deren Arbeitszeiten sich die längeren Öffnungszeiten ausgewirkt haben, ergeben sich Vorteile, für 46% Nachteile.
– 77% sehen Nachteile auf die Haushaltführung, gemeinsame Zeit der Familie am Wochenende und unter der Woche.
Auch AC Nielsen hat in einer eingehenden Untersuchung der Auswirkungen der liberalisierten Öffnungszeiten 1997 nicht nur eine Zufriedenheit der Konsumenten von 93% festgestellt, sondern auch dramatische Auswirkungen auf die Arbeitssituation der Arbeitnehmer/innen im Einzelhandel erhoben. 16% der Vollzeit- und 13% der Teilzeitkräfte bekommen Mehrleistungen überhaupt nicht abgegolten.
1997 (Einführung des langen Samstages bis 17 Uhr) hat der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen den Beschäftigungseffekt untersucht und Folgendes festgestellt: Im ersten Quartal 1997 hat die Beschäftigungszahl im Einzelhandel um 6 575 gegen dem Quartal des Vorjahres zugenommen (+2,9%), davon waren 4 474 geringfügig Beschäftigte. Ein starker Trend zur Teilzeit wurde festgestellt, Vollzeitarbeitsplätze wurden verdrängt. Durch diesen negativen Nettobeschäftigungseffekt wurde auch auf die bedrohliche Aushöhlung der Finanzierungsgrundlage der Sozialversicherung durch geringfügige Beschäftigung in Folge der Liberalisierung hingewiesen. Seit 1998 ist das Arbeitsvolumen im Einzelhandel rückläufig. In einzelnen Branchen (Lebensmittelhandel) beträgt der Anteil der Teilzeitbeschäftigten bis zu 70%. Im Handel sind derzeit über 40 000 geringfügig Beschäftigte gemeldet.
Bezeichnenderweise wird die Evaluierung bei der Begründung des Gesetzentwurfes beharrlich ignoriert und es werden unbelegte Behauptungen als Anlass für die Gesetzesänderung aufgestellt.
Aus den genannten Gründen steht für den ÖGB fest, dass dieser Gesetzentwurf den Interessen der im Handel Beschäftigten zuwiderläuft, durch die Bedürfnisse der Konsumenten/innen nicht fundiert begründet werden kann und den Verdrängungswettbewerb und bereits dramatisch hohen Konzentrationsgrad des Handels in Österreich zu verschärfen droht.
Zu den Bestimmungen im Einzelnen:
Der ÖGB lehnt diesen Gesetzentwurf entschieden und strikt ab. Die Einwände und unerwünschten Effekte der einzelnen Änderungen werden im Folgenden angeführt:
Öffnungszeitengesetz
Zu § 2 Abs. 1, 2 und 3:
Durch diese vorgesehene Änderung sollen die derzeitigen Öffnungszeiten für den Einzelhandel praktisch abgeschafft werden. Durch die für die Landeshauptleute vorgesehene Möglichkeit, per Verordnung regionale Öffnungszeiten festzulegen, spielt der Gesetzgeber den Ball weiter. Zu dieser Regelung bestehen in höchstem Ausmaß verfassungsrechtliche Bedenken. Es ist außerdem zu erwarten, dass es in jedem Bundesland zu differenzierten Gesamtregelungen kommt. Das voraussehbare Chaos könnte zur Beseitigung der Restbestände des Öffnungszeitengesetzes führen.
Zu § 3 Abs. 1 und 2:
Aus den vorgeschlagenen Änderungen ergibt sich, dass Verkaufsstellen für Naturblumen, Süßwaren, für Obst im Bereich von Krankenanstalten, am Samstag faktisch unbegrenzte Öffnungsmöglichkeiten hätten. Nach der bestehenden Regelung können diese Verkaufsstellen bis 19.30 Uhr offen halten.
Zu § 4 Abs. 3 und § 6 Abs. 2 lit. b:
Die beabsichtigte Streichung von Abs. 3 würde zur Folge haben, dass an einem 24. Dezember, der auf einen Samstag fällt, die Geschäfte um 14 Uhr (derzeit 13 Uhr) zu schließen wären, fällt der 31. Dezember auf einen Samstag, wäre ein Offenhalten bis 17 Uhr möglich (bisher 13 Uhr). Zusätzlich ermöglicht die vorgeschlagene Fassung generell eine Stunde für Abschlussarbeiten, was bedeutet, dass Handelsangestellte an einem 24. Dezember, der auf einen Samstag fällt, bis 15 Uhr beschäftigt werden könnten, fällt der 31. Dezember auf einen Samstag, würde sich eine Beschäftigungsmöglichkeit bis 18 Uhr auftun.
Zu § 5:
Aus diesem Änderungsvorschlag würde sich ergeben, dass in den genannten Verkaufsstellen, Bahnhöfen, usw. in Zukunft das gesamte Lebensmittelsortiment verkauft werden sollte, statt wie bisher Reiseproviant. Verkaufsflächen, die diesem Warenverkauf gewidmet sind, dürfen 200 m2 nicht überschreiten. Abgesehen von den verfassungsrechtlichen Bedenken gegen diese Beschränkung, sind nach dieser Formulierung weitaus größere Verkaufsflächen zB im Bahnhofsbereich möglich.
Mit dieser Änderung ist auch mit einer starken Zunahme der Nacht-, Sonn-, und Feiertagsarbeit in den angesprochenen Verkaufsstellen zu rechnen. In diesen Verkaufsstellen soll Vollversorgung betrieben werden.
Mit dieser Änderung wird allen Rechtsbrechern, die in der letzten Zeit den § 5 ÖZG übertreten haben und denen auf Grund unseres Betreibens Beugestrafen vorgeschrieben wurden, faktisch die Mauer gemacht. Man kann hier berechtigterweise von Anlassgesetzgebung sprechen.
Die Abgrenzung von Verkaufsflächen mit unterschiedlichen Öffnungszeiten wird ebenfalls ersatzlos gestrichen (§ 8 Abs. 2 und 3 ÖZG).
Weiters werden in Kinos, Kongressgebäuden, Zirkussen, Sporthallen und Sportplätzen faktisch unbegrenzte Öffnungszeiten eingeführt. Auch hier ist eine starke Zunahme der Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit zu erwarten (zB Multiplex usw.).
Zu § 5a:
Bei den Messen und messeähnlichen Veranstaltungen wird der Beginn der Öffnungszeiten derzeit mit 9 bzw. 10 Uhr gestrichen, der Begriff Fachmesse entfällt.
Das Verbot auf Abhaltung von ,Hausmessen‘ wird eliminiert. Damit ist ein weiterer Einbruch der Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit programmiert.
Zu § 8a Abschlussarbeiten:
Diese geltende Regelung, wonach Frauen nach 20 Uhr nur für 15 Minuten für Abschlussarbeiten herangezogen werden können, soll ersatzlos gestrichen werden.
Diese Bestimmung wurde auf betrieblicher Ebene seit ihrer Einführung 1991 missbraucht. In Zukunft sollen Abschlussarbeiten mit einer Stunde festgelegt werden. Obwohl die Bundesregierung in ihrem Arbeitsüberkommen angekündigt hat, entsprechend der Vereinbarung mit der EU im Jahr 2001, eine geschlechtsneutrale Nachtarbeitsregelung zu realisieren, wird die Nachtarbeit für Frauen mit diesem Entwurf vorweg schon festgeschrieben.
Gewerbeordnung
Zu § 279 Tankstellen:
Durch diese vorgesehene Änderung könnten Tankstellen in Zukunft ein Vollsortiment führen. Ausgenommen sein sollen nur mehr Waffen, Munition und sonstige Sprengmittel. Tankstellen bleiben weiters aus dem ÖZG ausgenommen, dh. Tankstellen würden somit rund um die Uhr, Sonn- und Feiertags Vollversorgung betreiben können. Es ist wahrscheinlich und absehbar, dass die Begrenzung der Verkaufsflächen verfassungsrechtlich nicht lange halten würde. Mit dieser Änderung erfolgt ein weiterer Vorstoß zur Forcierung der Sonn- und Feiertagsarbeit.
Arbeitsruhegesetz
Zu § 22d:
Die seit Anfang 1997 geltende Bestimmung, wonach jeder zweite Samstag arbeitsfrei sein muss, soll de facto abgeschafft werden!
Diese Regelung war ein Teil des Kompromisses zur Gesamtregelung für die Einführung des langen Samstages im Einzelhandel. Die Arbeitnehmer/innen haben hier materiell einen entscheidenden Beitrag leisten müssen. Als Bedingung für die Einführung des § 22d wurden im Kollektivvertrag die Zuschläge bei den verlängerten Öffnungszeiten von Bezahlung in Zeitausgleich umgestellt. Weiters wurden diese Zuschläge bei attraktiver Abgeltung der Zeitguthaben von 70% bis auf 30% reduziert. Die Unternehmen haben sich durch diese Regelung Milliarden Schilling eingespart! Mit diesem Gesetzentwurf soll die von der GPA erreichte Samstagregelung auf Wunsch der WKÖ abgeschafft werden, was einen Affront gegenüber den Beschäftigten bedeutet.
§ 22d ist also eine reine Bestimmung für den Einzelhandel, sie soll in der dramatisch verschlechterten Form in Zukunft auch für Dienstleistungsbetriebe, die mit dem Handel vergleichbar sind, gelten. Im Klartext bedeutet dies die Beseitigung des Beginns der Wochenendruhe (derzeit 13 Uhr), auch bei Banken, Reisebüros, Frisören usw.
Auch bei den Abholmärkten soll in Zukunft die Beschäftigung von Arbeitnehmer/innen an Samstagnachmittagen möglich sein (nach KV mit Überstundenentlohnung).
Weiters ist geplant, dass Arbeitnehmer/innen, die zu einem erheblichen Teil in Form von Provisionen entlohnt werden, nicht mehr in die Samstagsregelung fallen. Der OGH hat entschieden, dass ein Drittel des Entgelts aus Provisionen schon als erheblich zu bezeichnen ist. Das lässt folgendes Szenario äußerst wahrscheinlich werden: In Zukunft wird es keine Verkäuferin geben, bei der das KV-Gehalt nicht in eine ,Garantieprovision‘ umgewandelt wird. Alleine mit dieser wird der freie Samstag abgeschafft.
Weiters ist die Regelung für Teilzeitkräfte nicht nur unsozial, sondern auch nicht administrierbar. Von dieser dramatischen Verschlechterung sind im Einzelhandel überwiegend Frauen betroffen. Im Handel sowie in den anderen Branchen wird diese Verschlechterung ohne jedes Gespräch mit den KV-Partnern eingeführt, obwohl die Bundesregierung im Arbeitsübereinkommen festgelegt hat, dass korrespondierende arbeitsrechtliche Konsequenzen und flankierende Maßnahmen zwischen den KV-Partnern zu verhandeln sind.
Liquidierung des Beginns der Wochenendruhe für Branchen außerhalb des Einzelhandels
Besonders abgelehnt wird die Liquidierung des Beginns der Wochenendruhe für Branchen außerhalb des Einzelhandels. Diese werden nun in eine ursprüngliche Sonderbestimmung für den Einzelhandel sang- und klanglos einbezogen, die geplante Änderung könnte zB für eine Bankangestellte bedeuten, dass sie unter Hinweis auf die Bestimmungen des ÖZG, unter Berücksichtigung der Abschlussarbeit von einer Stunde, bei Vorliegen einer Verordnung des Landeshauptmannes am Samstag bis 19 Uhr beschäftigt werden kann!
Zusammenfassend lässt sich daher festhalten, dass der ÖGB dafür eintritt von der Beschlussfassung des vorliegenden Entwurfes Abstand zu nehmen.“
Die Stellungnahme des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit lautet wie folgt:
„Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit geht davon aus, dass die geplante Liberalisierung der Öffnungszeiten keine negativen Auswirkungen auf das Familienleben der im Handel beschäftigten Arbeitnehmer haben wird. Im Begutachtungsentwurf ist die Verlängerung der Rahmenöffnungszeit von 66 auf 72 Stunden vorgesehen. Die durch das Arbeitszeitgesetz oder den Kollektivvertrag festgesetzten Höchstgrenzen für die Dauer der individuellen Arbeitszeit werden durch diese Maßnahmen überhaupt nicht berührt.
Auch die Lage der Arbeitszeit kann nicht einseitig durch den Arbeitgeber geändert werden, dazu bedarf es einer Betriebs- oder Einzelvereinbarung. Jene Betriebe, die die künftigen Möglichkeiten einer Flexibilisierung der Lage ihrer Öffnungszeiten in Anspruch nehmen wollen, werden dabei entweder solche Arbeitnehmer einsetzen, die freiwillig etwa nach 19.30 Uhr arbeiten wollen, oder aber zusätzliche Arbeitnehmer einstellen.
Im Regierungsprogramm wurde im Abschnitt ,Stärkung des Wirtschaftsstandortes‘ unter Punkt 10.2 festgehalten, dass die Sonntagsruhe beibehalten werden soll. Daran wird sich auch weiterhin nichts ändern und auch der ausgesandte Entwurf sieht keine Ausweitung der schon bestehenden Sonntagsöffnung vor.
Bezüglich der Arbeit am Samstag Nachmittag soll es keineswegs zu einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen für Handelsangestellte kommen. Es wird lediglich das derzeitige starre System, wonach jeder zweite Samstag arbeitsfrei zu sein hat, durch ein flexibleres System ersetzt werden. In Hinkunft haben die Arbeitnehmer das Recht auf 26 arbeitsfreie Samstage pro Kalenderjahr. das bedeutet keinesfalls, dass künftig alle Handelsangestellten immer an 26 Samstagen hintereinander ganztägig arbeiten müssen, sondern der Arbeitgeber kann das Personal nunmehr besser entsprechend dem Arbeitsanfall einsetzen. Dies bringt einerseits eine arbeitsmäßige Entlastung der Arbeitnehmer in Spitzenzeiten, andererseits wird es den Arbeitnehmern dadurch auch ermöglicht, in einer arbeitsschwächeren Periode (zB in den Sommerferien) mehrere arbeitsfreie Wochenenden hintereinander zu konsumieren. Diese flexible Regelung kann daher sehr wohl auch im Interesse der Arbeitnehmer liegen. Außerdem kommt es zu einer Lockerung zugunsten jener Arbeitnehmer, die gerade am Samstagnachmittag arbeiten wollen, weil sie finanziell profitieren. Es darf auch auf zahlreiche Berufe hingewiesen werden, die oft rund um die Uhr Dienst machen müssen, damit die Infrastruktur unseres Gemeinschaftswesens funktioniert und darüber hinaus auch die Annehmlichkeiten der Freizeitwirtschaft konsumiert werden können.“
Die Kinderfreunde nahmen zur gegenständlichen Petition wie folgt Stellung:
„Familienfreundliche Arbeitsbedingungen
Das menschliche Leben besteht nicht nur aus Leistung im Arbeitsbereich, sondern auch aus sozialen Beziehungen, aus der Freude an Sport, Kunst und Kultur, aus der Lust am Lernen und aus dem Leben mit Kindern. Familien stehen heute unter einem massiven Druck, der mit dem Wachsen der Globalisierung und des Neoliberalismus zunehmend verstärkt wird. Flexible Arbeitszeiten haben sich nach den Bedürfnissen von Eltern und Kindern zu orientieren und nicht umgekehrt. Die Wirtschaft muss in die Pflicht genommen werden und auf die veränderten Lebensbedingungen reagieren. Neue Arbeitszeitkonzepte sollen auf die gesamte Lebensarbeitszeit bezogen werden und mehr Flexibilität zulassen.
Der Sonntag muss den Familien erhalten bleiben
Die Sonntagsruhe ist oberste Priorität für die Österreichischen Kinderfreunde, denn das Familienleben darf nicht gestört werden. Zum Recht auf Familienleben gehört der arbeitsfreie Sonntag, denn das ist in vielen Familien der einzige Tag, an dem alle Zeit für gemeinsame Aktivitäten haben. Mindestens ein Tag in der Woche muss schul- und arbeitsfrei sein. Schulpflichtige Kinder können sonst kaum mit ihren Eltern gemeinsam ihre Freizeit verbringen. Die Familie ist mehr als nur die Eltern: Onkeln, Tanten, Omas, Opas, Freunde, Bekannte. Wenn alle gemeinsam etwas unternehmen wollen, geht das nur an einem gemeinsamen arbeitsfreien Tag.
Keine Verlängerung der Öffnungszeiten
Die Verlängerung der Öffnungszeiten bringt für Familien enorme Belastungen. Wenn am Abend oder am Wochenende gearbeitet werden muss, gibt es keine Kinderbetreuung für diese Zeiten. Wenn die Betreuungseinrichtungen ihre Öffnungszeiten für einige Kinder verlängern müssen, wer soll dann für die zusätzlichen Betreuungskosten aufkommen? Längere Öffnungszeiten erschweren für die betroffenen Angestellten des Handels die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, da sie von Abend- und Wochenendereignissen ausgeschlossen sind. Das Recht auf einen freien Samstag alle vierzehn Tage für die Handelsangestellten muss bleiben, damit sie dann ein reguläres Wochenende mit ihrer Familie verbringen können.“
Die Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte unterstützt grundsätzlich alle drei Forderungen der vorliegenden Petition und führte dazu Folgendes aus:
„Eine weitgehende Freigabe der Ladenöffnung auch in der Nacht ist nicht nur ein massiver Eingriff in das Familienleben und die sonstige Lebensführung von über 300 000 Arbeitnehmern im Handel, die in keiner Weise bei ihrer Berufswahl mit Nachtarbeit rechnen mussten, sondern gleichzeitig ein gesellschafts- und kulturpolitischer Umbruch, der von der Mehrheit der Österreicher nicht gewünscht wird. Das derzeitige Öffnungszeitenrecht verfolgt in Übereinstimmung mit dem Arbeitsruhegesetz und dem Sonn- und Feiertagsbetriebszeitengesetz das Ziel, gewisse ,Zeitfenster‘ nichtkommerziellen, also insbesondere familiären und gesellschaftlichen Aktivitäten, vorzubehalten. Dadurch, dass kommerzielle Aktivitäten in den Nächten, an den Wochenenden und den Feiertagen durch die bisherige Gesetzeslage sehr weitgehend eingeschränkt werden, wird den Arbeitnehmern, aber auch den Selbständigen in Österreich in den besagten Zeiträumen die grundsätzliche Gelegenheit geboten, Zeit gemeinsam mit ihren Familien zu verbringen. Weitgehend vereinheitlichte, also synchrone Ruhezeiträume stellen damit eine grundlegende gesellschafts- und kulturpolitische Richtungsentscheidung dar: In einer Rund-um-die-Uhr-Gesellschaft ohne solche synchronen Zeitfenster ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass der einzelne Mensch über ein gleich hohes Freizeitausmaß verfügt; die Chance, diese Freizeit gemeinsam mit der Familie oder anderen Kontaktpersonen seiner Wahl zu verbringen, ist aber in einer Gesellschaft mit strukturierten Öffnungszeiten ungleich größer. Der Einwand, dass anderen Staaten liberalere Öffnungsregelungen haben als Österreich, rechtfertigt nicht, die Idee synchroner Freizeit – die den nicht kommerziellen Aspekten des gesellschaftlichen Lebens einen bestimmten Mindestspielraum garantieren will und eben tief in österreichischen kulturellen und religiösen Traditionen wurzelt – gegen die erklärte Ablehnung aller wesentlichen politischen Lager über Bord zu werfen (vgl. etwa die einstimmigen Landtagsbeschlüsse zu diesem Thema).
Für die Bundesarbeitskammer sind punktuelle Erweiterungen der derzeitigen Öffnungszeitengesetzgebung, soweit ein echter Bedarf erkennbar und nachgewiesen wird, nicht ausgeschlossen. Ein Verlassen des bisherigen österreichischen Grundkonsens über synchrone Ruhezeiträume in Richtung einer durchgehenden Kommerzialisierung der Zeit ist für die Bundesarbeitskammer nicht akzeptabel.
Ebenso strikt wird eine Aufweichung der Samstagsregelung im Arbeitsruhegesetz für die im Handel beschäftigten Arbeitnehmer abgelehnt. Die derzeitige Rechtslage, wonach grundsätzlich für die an den langen Samstagen im Verkauf eingesetzten Arbeitnehmer jeder zweite Samstag arbeitsfrei zu sein hat (großzügige Flexibilisierungsmöglichkeiten bestehen ohnehin), ist essentieller Bestandteil des seinerzeit von den Sozialpartnern ausgehandelten Kompromisses rund um die Einführung der langen Einkaufssamstage. Wenn mit allfälligen Änderungswünschen betreffend diese Regelung – übrigens entgegen dem Koalitionsübereinkommen – nicht die Sozialpartner befasst werden, sondern eine Regelung einseitig aufoktroyiert würde, läge darin nicht nur eine massive Verschlechterung der Wochenendfreizeit der Arbeitnehmer im Handel, sondern auch ein Affront gegen die Sozialpartnerschaft. Besonders betroffen wären von der im Entwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit formulierten Aushöhlung der Samstagsfreizeit die Teilzeitbeschäftigten, also ganz überwiegend Frauen: Für sie soll nach dem Entwurf der gesetzliche Anspruch auf die Samstagsfreizeit vollständig entfallen! Damit würde noch dazu gleichzeitig ein Anreiz für die Unternehmen gesetzt, Vollzeitarbeitsplätze abzubauen und durch Teilzeitarbeitsplätze zu ersetzen.
Klar geregelte Ladenöffnungszeiten sind seit langem ein bewährtes Rechtsinstrument zur Sicherung eines fairen und Chancengleichheit wahrenden Wettbewerbs, ebenso wie zur Gewährleistung fundamentaler sozial- und familienpolitischer Ziele in unserer Gesellschaft. Auch der Verfassungsgerichtshof hat klargestellt, ,… sowohl die Festlegung einer höchstzulässigen Gesamtoffenhaltezeit wie auch das Gebot einer Mindestnachtruhe ab 19.30 Uhr sind für sich und in ihrem Zusammenwirken taugliche Mittel, den Ausgleich zwischen den Interessen der Verbraucher, der Gewerbetreibenden und der Arbeitnehmer herbeizuführen‘ (VfGH 17. 12. 1992, G 308/91). Zur Samstagregelung im Handel führte das Höchstgericht aus: ,… schon das Verbot des Offenhaltens an Samstagnachmittagen (wurde) angesichts der besonderen Funktion des Wochenendes für Freizeit, Erholung und soziale Integration als verfassungsmäßig erkannt. (…) Mit solchen Regelungen (werden) keineswegs nur gesundheitspolitische, sondern in verfassungsrechtlich unbedenklicher Weise auch sozial- und familienpolitische Ziele verfolgt. (…) Vorschriften über die Begrenzung der Arbeitszeit und die Gewährung einer Wochenruhe dienen ganz allgemein dem Schutz der Arbeitnehmer vor einer übermäßigen Beanspruchung durch den Arbeitgeber, dessen wirtschaftlich begründetem Verlangen sie regelmäßig keinen hinreichenden Widerstand entgegensetzen können. Ein solcher Schutz ist nur durch ein generelles Verbot möglich und dieses Verbot wird jenen, die ein Interesse an der Arbeit am Samstagnachmittag haben, aus Gründen der Solidarität zugemutet‘ (VfGH 14. 10. 1998, G 439/97).
Es wäre nicht einsichtig, den Interessen von zirka 10 Prozent aller Verbraucher (vgl. Meinungsumfrage von ,Market‘, Linz, 28. 8. 2000) und den Interessen einiger weniger Branchenriesen gegenüber den Interessen von über 300 000 Arbeitnehmern im Einzelhandel und deren Familien und der bei weitem überwiegenden Mehrzahl der Handelstreibenden den Vorzug zu geben. Alle Umfragen zeigen, dass nicht nur die Mehrheit der Konsumenten, sondern auch der Handelstreibenden mit der derzeitigen Regelung zufrieden ist und sich gegen eine weitere Liberalisierung der Öffnungszeiten ausspricht. So ergab eine Umfrage der WK Oberösterreich im Oktober 1999, dass 94% der befragten Unternehmer mit den derzeitigen Öffnungszeiten zufrieden sind, 83% sprechen sich gegen eine völlige Liberalisierung aus.
Durch den vorgeschlagenen radikalen Liberalisierungsschritt bestünde weiters die Gefahr, dass sich der bereits vorhandene problematische Strukturwandel im österreichischen Handel verschärft: So weist eine Studie (1999) des deutschen ifo-Institutes darauf hin, dass die Änderung des deutschen Ladenschlussgesetzes von 1996 dazu führte, dass größere Handelsunternehmen ihre Wettbewerbsposition zu Lasten der kleinen und mittleren Unternehmen verbessern konnten. Begründet wird dies damit, dass die KMU vor allem auf Grund ihrer Betriebs- und Kostenstrukturen die verlängerten Öffnungszeiten nicht nutzen können. Hingegen bedienen sich die großen Handelsunternehmen verstärkt der neuen Öffnungszeiten, die verbunden mit den übrigen Einflussfaktoren der hohen Strukturdynamik im Einzelhandel (wie zB verstärkte Niedrigpreisstrategien und Werbeaktivitäten in den Filialsystemen) zu einem Ausbau ihrer Wettbewerbsposition führt.
Eine weitere massive Liberalisierung der Öffnungszeiten dürfte diese Effekte wohl um ein Vielfaches erhöhen. Aus österreichischer Sicht wäre dies vor allem im Zusammenhang mit den aus wettbewerbspolitischer Sicht bereits bestehenden bedenklichen Konzentrationsgraden in vielen Branchen zu sehen, die durch die öffnungsstimulierenden Regelungen forciert werden. Bezogen auf das Jahr 2000 weisen die fünf größten Marktteilnehmer im Lebensmittelhandel bzw. im Sporthandel einen Konzentrationsgrad von 90% auf, im Drogeriebereich liegt dieser bei 86%, bei den Baumärkten bei 67%. Bei der geplanten Liberalisierung ist davon auszugehen, dass die Öffnungszeiten von den großen Handelsunternehmen als neues Wettbewerbsinstrument im Kampf um Marktanteile eingesetzt werden. Im Gegensatz zu den KMU verfügen die großen Handelsunternehmen über die ausreichende Kapitalkraft, um jenes Kostenrisiko, das mit verlängerten Öffnungszeiten grundsätzlich verbunden ist, zu tragen. Ob es hingegen den KMU gelingt, wie immer wieder von den Befürwortern einer völligen Liberalisierung postuliert wird, durch Ausnutzung von Zeitnischen am Umsatzkuchen mitzunaschen, ist fraglich. Wie allgemein bekannt ist, führen erweiterte Öffnungszeiten kaum zu einer Nachfrage- und somit Umsatzsteigerung, sondern vielmehr zu einer Umsatzverlagerung.
Gesetzliche Maßnahmen, die die Gefahr in sich bergen, die Marktposition der großen Handelsunternehmen weiter zu stärken, können auch zu massiven Nachteilen für Konsumenten (eingeschränkte Produktauswahl, überhöhte Preise) und zu einem verstärkten Druck auf Konkurrenz- und Zulieferbetriebe bis hin zur Verdrängung vom Markt führen und haben damit langfristig auch negative Auswirkungen auf die ArbeitnehmerInnen (vom Lohndruck bis hin zum Verlust der Arbeitsplätze).
Auch raumordnungspolitisch hätte eine starke weitere Ausdehnung der Öffnungszeiten fatale Folgen. Sie würde vor allem großen Filialisten zugute kommen, die sich in Einkaufszentren, meist außerhalb bzw. am Rand von Ballungsräumen, etablieren. Auf diese Weise würde kleineren Gewerbetreibenden in den Orts- und Stadtzentren mittelfristig eine Konkurrenz erwachsen, die zu einem fundamentalen Strukturwandel in den öffentlichen Räumen führen könnte. Das Schlagwort von der ,Verödung‘ der Innenstädte, das sich bereits ansatzweise in bislang wichtigen und beliebten Einkaufsstraßen in österreichischen Städten manifestiert, könnte hiedurch nur allzu leicht Realität werden.
Dass Nachtarbeit medizinisch höchst problematisch ist, braucht wohl nicht eigens erwähnt zu werden; die langfristigen Folgen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts sind in der medizinischen Literatur ausführlichst dokumentiert. Auch Anrainer von Geschäften, die in Zukunft die ganze Nacht offen halten können sollen, würden unter der geplanten Regelung leiden.
Schließlich ist die nächtliche Ladenöffnung auch unter Sicherheitsaspekten abzulehnen. Die Datenlage aus Dänemark und Schweden spricht Bände: Seit Beginn der Deregulierung der Ladenöffnungszeiten in den späten Siebzigerjahren nahm die Zahl der Raubüberfälle drastisch zu. 1976 wurden in Schweden 275 Ladenüberfälle, 1993 dagegen 562 Überfälle registriert. Über die Hälfte davon erfolgte in den Abendstunden; bei jedem zweiten Überfall wurden außerdem Schusswaffen benützt. Allein arbeitende Frauen sind eine besonders gefährdete Gruppe. In Dänemark ist eine ähnliche Entwicklung zu beobachten: Über 70 Prozent der Überfälle auf Geschäfte und Handelsangestellte, die die Tageslosung abliefern, werden nach 20 Uhr begangen.
Die im Entwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit enthaltene Freigabe des Sonntags für bestimmte Anbieter (Tankstellenshops, Lebensmittelhandel in Bahnhöfen, Flughäfen u. dgl.) würde mittelfristig eine beträchtliche Gefährdung des Grundsatzes der Sonntagsruhe bedeuten. Diese sektorelle Freigabe würde den regulären Einzelhandel beträchtlichem Wettbewerbsdruck aussetzen, von dem eine starke Sogwirkung in Richtung der Freigabe der Sonn- und Feiertage für die allgemeine Ladenöffnung ausgehen würde: Insbesondere die großen Einzelhandelsketten würden auf die Konkurrenzierung durch die Tankstellensshops an den Sonn- und Feiertagen und in den Nächten ohne jede Begrenzung des Gesamtausmaßes der Offenhaltezeiten sicherlich mit der Forderung nach der völligen Freigabe der Ladenöffnung zu allen Zeiten reagieren.
Aus all den dargelegten Gründen unterstützt die Bundesarbeitskammer nachdrücklich die gegenständliche Petition. Dem formalen Anliegen der Petition, die dargestellten Forderungen ,gesetzlich sicherzustellen‘, kann der Nationalrat insbesondere dadurch entsprechen, dass dem beschriebenen Entwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit, sollte dieser dem Nationalrat als Gesetzentwurf zugeleitet werden, die Zustimmung verweigert wird.“
Vom Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen ist folgende Stellungnahme eingelangt:
„Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Väter und Mütter ist mir ein großes Anliegen. Dazu gehört für mich, dass für beide Bereiche ausreichend Zeit zur Verfügung steht. Da Familienleben nur dann möglich ist, wenn ein gewisses Mindestmaß an gemeinsamer Zeit gesichert ist, sind die in unserer Kultur institutionalisierten arbeitsfreien Sonntage und Stunden am Wochenende ein zu schützendes Gut.
Ich halte die bestehenden Ladenöffnungszeiten für ausreichend, die Bedürfnisse der Konsumentinnen und Konsumenten zu befriedigen und auch geeignet, dass die im Handel Beschäftigten Familie leben können.
Für mich ist des Weiteren unbestritten, dass Handelsangestellte auch zukünftig die Hälfte der Samstage des Jahres arbeitsfrei haben sollen.“
Die Wirtschaftskammer Österreichs legte dazu folgende Stellungnahme vor:
„Zur Forderung: ,Nein zu noch längeren Öffnungszeiten‘
Die Wirtschaftskammer Österreich tritt nicht für ,noch längere‘ Öffnungszeiten ein, sondern für eine Lösung, die es den Handelsbetrieben erlaubt, ihre Öffnungszeiten flexibel an die jeweils gegebenen Kundenbedürfnisse anzupassen. Dabei sind insbesondere die Interessen der berufstätigen Wohnbevölkerung, die Interessen der Touristen, die Vermeidung von Kaufkraftabflüssen über die Grenze und die Aufrechterhaltung der Nahversorgung zu beachten.
Im Interesse der kleinen Nahversorgungsbetriebe muss eine Überdehnung der wöchentlichen Gesamtöffnungsdauer, die derzeit 66 Stunden beträgt, vermieden werden.
Die WKÖ tritt daher dafür ein, dass der Gesetzgeber den Landeshauptleuten die Möglichkeit einräumt, innerhalb einer klar definierten Bandbreite sowohl die täglichen Öffnungszeiten als auch die wöchentliche Gesamtöffnungsdauer festzusetzen.
Zur Forderung: ,Nein zur Ladenöffnung am Sonntag‘
Eine generelle Ladenöffnung am Sonntag steht nicht zur Diskussion. Vielmehr gib es schon jetzt als Ausnahme von der Regel die Möglichkeit der Sonntagsöffnung in Fremdenverkehrsgebieten sowie für den Bedarf von Reisenden auf Bahnhofsstandorten und bei Tankstellen.
Zur Forderung: ,Nein zum Plan der Bundesregierung, das derzeitige Recht der Handelsangestellten auf einen freien Samstag alle zwei Wochen abzuschaffen‘
Die Wirtschaftskammer Österreich begrüßt eine Lockerung des Arbeitsverbotes für Handelsangestellte an jedem zweiten Samstag, weil flexiblere Öffnungszeiten nur bei gleichzeitiger Flexibilisierung auch des Arbeitszeitrechts möglich sind.“
Beschluss mit Stimmenmehrheit in der Sitzung des Ausschusses am 4. Juli 2002:
Ersuchen um Zuweisung an den Wirtschaftsausschuss.
2. Bürgerinitiativen
Ausschuss für innere Angelegenheiten
Bürgerinitiative Nr. 25
eingebracht von Mag. Nicolas Reischer betreffend „Gleichstellung für Zivildiener“
Der Einbringer überreichte die gegenständliche Bürgerinitiative mit folgendem Anliegen an den Nationalrat:
Seitens der Einbringer wird das Vorliegen einer Bundeskompetenz in folgender Hinsicht angenommen: Zivildienst im Allgemeinen ist Bundeskompetenz.
„Ich schätze die Arbeit, die Österreichs Zivildiener für unsere Gesellschaft leisten, und bin der Meinung, dass die Arbeit der Zivildiener von Seiten des Gesetzgebers unzureichend honoriert wird. Sich für den Zivildienst entscheiden darf nicht bedeuten, Existenzängste auf sich nehmen zu müssen.
Ich ersuche den Nationalrat, die entsprechenden gesetzlichen Regelung für eine existenzsichernde Entlohnung und finanzielle Unterstützung der Zivildiener zu treffen.
Dies bedeutet insbesondere: leichterer Zugang zur Wohnkostenbeihilfe und gleiches Essensgeld von staatlicher Seite wie für Präsenzdiener (= 172 S/Tag, 11,30 Euro/Tag; Stand: Juni 2001).“
1. KOMPETENZ des BUNDES
Zivildienst ist gemäß Art. 10 Abs. 1 Z 15 in Verbindung mit Art. 9a B-VG in Verbindung mit § 1 ZDG Bundeskompetenz in Gesetzgebung und Vollziehung.
2. Warum eine Bürgerinitiative?
Mit der ZDG-Novelle 2001 (BGBl. I Nr. 133/2000) wurde der Verpflegungsanspruch der Zivildienstleistenden wieder eingeführt. Zwischenzeitlich war er durch die ZDG-Novelle 2000 (BGBl. I Nr. 28/2000) zwischen 1. Juni 2000 und 31. Dezember 2000 aufgehoben worden.
Am 6. Dezember 2001 hat der Verfassungsgerichtshof nachträglich die Aufhebung des Verpflegungsanspruches als verfassungswidrig bezeichnet. (BGBl. I Nr. 29/2002 vom 15. Jänner 2002)
Dieser Anspruch auf Verpflegung ist nicht durchsetzbar. Das ZDG 1986 idF 2001 mag eine Privatisierung der Rechtsbeziehung zwischen Zivildienstleistenden und Rechtsträger der Zivildiensteinrichtung vorgeschwebt sein, wie man den erläuternden Bemerkung zur Regierungsvorlage entnehmen kann:
„Wie die Verpflegung des Zivildienstleistenden erfolgt, ist eine Entscheidung der Einrichtung im Einvernehmen mit dem Zivildienstleistenden. Sie hat in jedem Fall angemessen zu sein, also auch der Inanspruchnahme des Zivildienstleistenden zu entsprechen. Hiezu kann auf bestehende Erfahrungswerte zurückgegriffen werden.“ (Zu § 28)
„[§ 28a] Abs. 2 soll sichern, dass Zivildienstleistende in den Fällen, wo Einrichtungen ihren Verpflichtungen nach § 28 nicht oder nicht in ausreichendem Maß nachkommen, rasch eine Aushilfe durch den Bundesminister für Inneres erhalten können. Dies ändert nichts an der verwaltungsstrafrechtlichen Konsequenz für den Rechtsträger. Ebenso werden in diesen Fällen die Bestimmungen über die Versetzung von Zivildienstpflichtigen zu greifen haben.“ (Zu § 28a).
Obwohl das Innenministerium selbst der Ansicht ist, dass auch eine unangemessene Verpflegung unter § 28a Abs. 2 ZDG fällt und somit der Bund ermächtigt wäre, bis zur Höhe der Pauschalvergütung dem Zivildienstleistenden eine Aushilfe zu gewähren (Siehe vor allem den zurückweisenden Bescheid vom Innenminister für Mag. Maderbacher, S 3), ist diese Ansicht anzuzweifeln.
1. § 28 Abs. 1 normiert einige Verpflichtungen, § 28a Abs. 2 hingegen spricht nur von einer einzigen.
2. Die Begrenzung mit der Höhe der Pauschalvergütung spricht dafür, dass der Gesetzgeber eben diese Verpflichtung gemeint hat. Da somit eine grammatikalische und auch eine systematische Interpretation zum Resultat führen, dass der Bund lediglich für eine einzige nicht erfüllte Verpflichtung eine Aushilfsmöglichkeit bieten kann – nämlich jener der Zahlung der Pauschalvergütung –, hat diese Interpretation einer historischen vorzugehen.
Diese Meinung vertritt auch o. Univ.-Prof. Dr. Heinz Peter Rill in seiner Stellungnahme vom 10. Oktober 2000 im Begutachtungsverfahren zur ZDG-Novelle 2001 (S 3 der Stellungnahme), und schließt, dass: „Für den praktisch bedeutsamen Fall, dass der Rechtsträger dem Zivildienstleistenden keine angemessene Verpflegung leistet, würde [eher: wurde] also keine Vorsorge getroffen.“
In dieser Stellungnahme des Instituts für Verfassungs- und Verwaltungsrecht der Wirtschaftsuniversität Wien steht allerdings auf Seite 2 zu § 28 ZDG ebenfalls zu lesen, dass die Ansprüche auf Verpflegung und Pauschalvergütung von öffentlich-rechtlichen zu privatrechtlichen würden und diese gegen den Rechtsträger der Einrichtung am Zivilrechtsweg geltend zu machen wären.
Dem widerspricht die rechtskräftige Entscheidung des LGZ Wien vom 21. August 2001:
„Hätte der Gesetzgeber gewollt, dass auch das Verhältnis zwischen Zivildienstleistenden und den Rechtsträgern der Einrichtungen von den ordentlichen Gerichten im Streitverfahren zu beurteilen ist, dann hätte er wohl eine entsprechende Bestimmung ins Gesetz aufgenommen. (…) Es erweist sich sohin, dass das Rechtsverhältnis zwischen Zivildiener und Rechtsträger der Einrichtung nicht privatrechtlicher Natur ist. (…)“ (Seite 5 und 6 des Urteils)
Weiter heißt es in der Stellungnahme des Instituts für Verfassungs- und Verwaltungsrecht (S 3): „für angemessene Verpflegung zu sorgen“ – sei im Hinblick auf Art. 18 B-VG undeterminiert.
3. Rechtsschutzdefizit seit (spätestens) 1994
Die Regelung vor der ZDG-Novelle 2000 sah eine Verpflichtung der Rechtsträger der Einrichtung vor, die Zivildienstleistenden unentgeltlich zu versorgen (§ 28 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 1 ZDG 1986 in der alten Fassung, BGBl. I Nr. 679/1986). § 41 Abs. 2 ZDG 1986 in der alten Fassung sah vor, dass der Bund den Rechtsträgern der Einrichtungen (ausgenommen: während des Grundlehrganges gemäß § 18a ZDG 1986) die Kosten zu ersetzen hatte, die diesen durch Leistungen nach § 28 Abs., 2 (unter anderem) entstehen.
1992 erließ Innenminister Löschnak die erste Verpflegungsverordnung (BGBl. Nr. 224/1992) für den Ausnahmefall, dass der Rechtsträger der Einrichtung eine Naturalverpflegung nicht gewährleisten konnte oder der Zivildienstleistende wegen dienstlicher Verhinderung nicht an dieser Verpflegung teilnehmen konnte.
1993 erließ der Innenminister dann auf Grund es § 41 Abs. 5 ZDG die Verordnung des über die Grundsätze für Vergütung nach § 41 des ZDG 1986 (verlautbart im Verlautbarungsblatt für den Zivildienst, Jahrgang 1993, Folge 2 vom 23. Februar 1993; im Verlautbarungsblatt für den Zivildienst, Jahrgang 1994, Folge 2 vom 8. April 1994; Amtblatt zur Wiener Zeitung vom 16. April 1994). Für die volle Verpflegung des Zivildienstleistenden bekam der Rechtsträger vom Bund gemäß § 5 Abs. 2 Z 2a pro Monat 4 260 S (also: 142 S pro Tag).
Mit BGBl. Nr. 288/1994 kam dann die „klassische“ Verpflegungsverordnung des Bundesministers für Inneres (letzte Fassung: BGBl. II Nr. 25/2000).
In dieser wurden erstmals die Verpflegsmarken eingeführt.
1994 musste der Rechtsträger der Einrichtung gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung – „Sofern die Verpflegung des Zivildienstleistenden zur Gänze durch Vertragsabschluss sichergestellt [wurde],
[…] dem Zivildienstleistenden täglich Verpflegsmarken im Wert von mindestens 140 S, sonst
1. für das Frühstück Marken im Wert von mindestens....................................................... 30 S,
2. für das Mittagessen Marken im Wert von mindestens................................................... 70 S,
3. für das Abendessen Marken im Wert von mindestens.................................................. 40 S aus[.]folgen.
Mit BGBl. Nr. 123/1995 vom 22. Februar 1995 wurden daraus dann 145 S
(Frühstück: 31, Mittagessen: 72, Abendessen: 42)
Mit BGBl. II Nr. 64/1998 vom 27. Februar 1998 wurden daraus dann 148 S. (Mittagessen: 75 S)
Mit BGBl. II Nr. 3/1999 vom 8. Jänner 1999 wurden daraus dann 152 S. (Frühstück: 32 S; Mittagessen: 75 S; Abendessen: 45 S)
Mit BGBl. II Nr. 25/2000 vom 28. Jänner 2000 wurden daraus dann 155 S. (Frühstück: 35 S)
Mit BGBl. I Nr. 28/2000 (ZDG-Novelle 2000) wurde der Anspruch auf Verpflegung gänzlich gestrichen und die Pauschalvergütung um rechnerisch 43 S pro Tag angehoben.
Mit BGBl. I Nr. 133/2000 (ZDG-Novelle 2001) wurde der Anspruch auf Verpflegung wieder eingeführt (Diesmal nicht mehr auf „unentgeltliche“ sondern auf „angemessene“ Verpflegung), allerdings weder eine Verpflegungsverordnung erlassen noch ein Rückvergütungsanspruch des Rechtsträgers der Einrichtung gegenüber dem Bund wieder eingeführt, so wie er vorher in § 41 Abs. 2 ZDG normiert war.
ERGEBNIS: Bei der Verpflegung hat es schon seit spätestens 1994 ein Dreieck zwischen Bund, Rechtsträger und Zivildienstleistendem gegeben. Die Verpflichtung zur Verpflegung des Zivildienstleistenden traf somit schon vor dem 1. Jänner 2001 alleine die Rechtsträger der Einrichtungen, den Bund traf lediglich die Verpflichtung, den Rechtsträgern hierfür eine Entschädigung zu zahlen.
Was wäre gewesen, wenn ein Rechtsträger dieser
Verpflegungsverpflichtung nicht nachgekommen wäre?
§ 32 ZDG in der alten Fassung:
(1) Die nach den
§§ 25a, 27 und 31 Abs. 1 Z 1 bis 7 und Abs. 8 gebührenden
Beträge sind vom Bund zu tragen. Das Bundesministerium für Inneres hat sie zu
berechnen, zahlbar zu stellen, auszuzahlen und zu verrechnen. Auf Verlangen des
Bundesministeriums für Inneres ist der Rechtsträger der Einrichtung
verpflichtet, die Auszahlung durchzuführen.
(4) Auf Antrag des
Zivildienstleistenden hat der Bundesminister für Inneres über die nach den
§§ 25a, 27 und 31 gebührenden Geldbeträge mit Bescheid zu erkennen.
[§ 32 in der neuen Fassung, BGBl. I Nr. 133/2000 reduziert diese Ansprüche auf die Fahrtkostenbeihilfe]
Schon damals hatte der Bundesminister für Inneres nicht mit Bescheid über die Höhe des Verpflegungsgeldes abzusprechen. Der Zivilrechtsweg war ganz sicherlich ausgeschlossen, weil es sich zweifelsohne um ein hoheitliches Verhältnis handelte und die Verpflegung des Zivildieners auch nicht im Zusammenhang mit seiner Leistung in der Einrichtung stand, sondern – ganz im Gegenteil – auch dann zu gewährleisten war, wenn der Zivildienstleistende dienstunfähig war.
Dieses Rechtsschutzdefizit wurde mit der ZDG-Novelle 2000 offenkundig, da durch den Spruch des Verfassungsgerichtshofes vom 6. Dezember 2001 die bereinigte Rechtslage für die obsiegenden Kläger ergibt, dass sie zwar formell Anrecht auf 155 S pro Tag ihres Zivildienstes hätten, es aber de facto nirgends einklagen können – außer beim VfGH selbst. Der Innenminister kann jedenfalls nicht über die Höhe der unentgeltlichen Verpflegung absprechen, und noch weniger kann er über die angemessene Verpflegung im Sinne des ZDG 2001 einen Bescheid erlassen, da dies in § 32 Abs. 4 nicht vorgesehen ist.
Auf Seite 27 des Erkenntnisses G 212/2001 vom 6. Dezember 2001 sagt der Verfassungsgerichtshof treffend: „Es kommt entscheidend darauf an, dass der Zivildienstleistende einen Rechtsanspruch auf die Leistung hat.“
Ergebnis einer ao. Beschwerde gemäß § 37 Abs. 1 ZDG: „Eine Reihe von Rechtsträgern vergütet österreichweit an ihre Zivildienstleistenden die Verpflegungskosten zu einem Tagessatz von 80 S und damit kann das Auslangen gefunden werden. Ihre Behauptung, darin keinen angemessenen Tagsatz zu ersehen, war zu allgemein gehalten, um daraus auf begründete Mehraufwendungen wegen eines anderen Preisgefüges an ihrem Standort schließen zu können.“ Zivildienstrat, 22 August 2001.
Ergebnis des Zivilrechtsweges: Unzulässigkeit des Zivilrechtsweges. LGZ Wien, 21. August 2001.
Ergebnis des Verwaltungsrechtsweges: Zurückweisung des Antrages. Bundesminister für Inneres, 23. Oktober 2001.
Ergebnis eines Auskunftsverlangens: Die Frage kann nicht beantwortet werden. Bundesministerium für Inneres, Dr. Seibert, 21. Dezember 2001.
Dies belegt, dass ein solcher Rechtsanspruch im ZDG in der Fassung BGBl. Nr. 133/2000 nicht gegeben ist. Es kann nicht sein, dass jeder Zivildienstleistende einzig und allein dadurch zu seinem Recht kommen kann, dass er den Verfassungsgerichtshof gemäß Art. 137 B-VG anruft.
Deshalb wäre es zu begrüßen, wenn der Bundesgesetzgeber diese – vielleicht gewollte, aber einem Rechtsstaat unwürdige – Verwaltungsrechtslücke wieder schlösse.
4. Leichterer Zugang zur Wohnkostenbeihilfe
Ebenso wäre es zu begrüßen, wenn der Bundesgesetzgeber den Umstand berücksichtigen würde, dass jeder Zivildienstleistende gemäß § 27 Abs. 2 ZDG bei einer geringeren täglichen Fahrt als zwei Stunden die eigene Wohnung zu benützen hat und dass ihm für diese auch Kosten entstehen.
Die derzeitige rechtliche Situation nimmt nämlich allen Zivildienern, die in einer Wohn- oder Lebensgemeinschaft wohnen, die Möglichkeit, Wohnkostenbeihilfe zu beziehen. Für diese Situation gibt es keinen triftigen Grund. § 34 ZDG verweist auf § 26 und das V. Hauptstück des HGG, welches im Fall der Wohnkostenbeihilfe darauf abstellt, welche Kosten zur BEIBEHALTUNG der eigenen Wohnung anfallen. Es geht explizit nicht um die Wohnmöglichkeit, sondern um die Vorbeugung des Verlustes einer eigenen Wohnung.
§ 31 Abs. 1 HGG: Mit der Wohnkostenbeihilfe sind Anspruchsberechtigten jene Kosten abzugelten, die ihnen nachweislich während des Wehrdienstes für die erforderliche Beibehaltung jener eigenen Wohnung entstehen, in der sich nach den Bestimmungen des Meldegesetzes 1991 (MeldeG), BGBl. Nr. 9/1992, gemeldet sind. (…)
§ 31 Abs. 2 HGG bestimmt, was als erhaltenswerte Wohnung zu verstehen ist:
„Als eigene Wohnung gelten Räumlichkeiten, die eine abgeschlossene Einheit bilden und in denen der Anspruchsberechtigte einen selbständigen Haushalt führt. Gehören die Räumlichkeiten zu einem Wohnungsverband, so müssen sie eine selbständige Benützbarkeit ohne Beeinträchtigung der anderen im Wohnungsverband liegenden Wohnungen gewährleisten.“
Der Gesetzgeber hat mit BGBl. I Nr. 31/2001 die Worte des Verwaltungsgerichtshofes in den § 31 HGG übernommen, der die Vollziehung des HGG nicht mit seiner Verträglichkeit mit den Zielsetzungen des ZDG geprüft hat. (Beispiel: VwGH Erkenntnis vom 23. Jänner 2001, Zl. 2001/11/0002, Zivildienstpflichtiger wohnt in Wohnung von Lebensgefährtin – mit der er sich die Kosten teilt):
„Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichthofes können, wie die belangte Behörde zutreffend ausführte, unter einer ,eigenen‘ Wohnung nur solche Räumlichkeiten angesehen werden ,die der Wehrpflichtige auf Grund eines ihm zustehenden (dinglichen oder schuldrechtlichen) Rechtes benützen kann. Steht dieses Recht zur Benützung einer Wohnung einer anderen Person als dem Wehrpflichtigen zu, liegt keine ,eigene‘ Wohnung des Wehrpflichtigen vor, auch wenn es sich bei dem Berechtigten um einen nahen Angehörigen des Wehrpflichtigen handelt. Dies gilt auch dann, wenn der Wehrpflichtige zu dem vom Berechtigten (zB Eigentümer oder Mieter) zu bezahlenden Kostenbeiträge leistet oder sie zur Gänze ersetzt (vgl. das hg. Erkenntnis vom 19. Mai 1998, Zl. 98/11/0101). Infolge des Verweises in § 34 Abs. 1 ZDG gilt diese Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes auch für Zivildienstpflichtige.“
Der Umstand, dass ein nicht unmaßgeblicher Teil der Zivildiener in einer Wohn- oder Lebensgemeinschaft lebt, welche zumeist deutlich günstiger ist als eine alleinige Hauptmiete, gerade weil Zivildienstleistende eine günstige Wohnmöglichkeit während der Zeit ihres Zivildienstes benötigen und diese auch von Gesetzes wegen bewohnen MÜSSEN, kann meines Erachtens nicht unberücksichtigt bleiben.
Aus welchem Grund sollte das Innenministerium dem Zivildienstleistenden eher eine teurere Einzelmietwohnung als eine billigere Wohnmöglichkeit in einer Wohn- oder Lebensgemeinschaft finanzieren können?
Das ZDG sollte aus diesem Grund wohl besser eine eigene Regelung für eine Beihilfe zu den Wohnkosten vorsehen, die diesen unterschiedlichen Rahmenbedingungen Rechnung trägt.
Beschluss mit Stimmenmehrheit in der Sitzung des Ausschusses am 3. April 2002.
Ersuchen um Zuweisung an den Ausschuss für innere Angelegenheiten.
Der Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen hat die gegenständlichen Petitionen und Bürgerinitiativen in seinen Sitzungen am 17. April 2001, 21. Juni 2001, 10. Oktober 2001, 15. Februar 2002, 3. April 2002, 11. Juni 2002 und am 4. Juli 2002 in Verhandlung genommen.
An den Debatten beteiligten sich die Abgeordneten Bernd Brugger, Mag. Dr. Theresia Fekter, Hermann Gahr, Edeltraud Gatterer, Theresia Haidlmayr, Dr. Kurt Heindl, Gabriele Heinisch-Hosek, Anton Heinzl, Paul Kiss, Anton Knerzl, Dipl.-Ing. Werner Kummerer, Johann Kurzbauer, Dr. Gerhard Kurzmann, Manfred Lackner, Mag. Christine Lapp, Walter Murauer, DDr. Erwin Niederwieser, Dr. Helene Partik-Pablé, Dipl.-Ing. Wolfgang Pirklhuber, Mag. Barbara Prammer, Nikolaus Prinz, Dr. Alois Pumberger, Dr. Robert Rada, Hermann Reindl, Johannes Schweisgut, Mag. Ulrike Sima, Astrid Stadler, Rainer Wimmer, Roland Zellot sowie die Obfrau des Ausschusses Mag. Gisela Wurm.
Zur Berichterstatterin für das Haus wurde die Abgeordnete Gabriele Heinisch-Hosek gewählt.
Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen somit den Antrag, der Nationalrat wolle den gegenständlichen Bericht zur Kenntnis nehmen.
Wien, 2002 07 04
Gabriele Heinisch-Hosek Mag. Gisela Wurm
Berichterstatterin Obfrau
Anlage
Ausschuss
für Petitionen und Bürgerinitiativen
Expertenhearing
Petition betreffend „Nein zur Biomedizin-Konvention des Europarates“, überreicht von den Abgeordneten Theresia Haidlmayr und Dr. Helene Partik-Pablé (35/PET)
Auszugsweise Darstellung
(verfasst vom Stenographenbüro)
Dienstag, 11. Juni 2002
9.14 Uhr bis
12.22 Uhr
Lokal VI
Beginn der
Sitzung: 9.14 Uhr
Obfrau Mag. Gisela Wurm eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Teilnehmer.
Hearing zu Punkt 1 der Tagesordnung:
Petition betreffend „Nein zur Biomedizin-Konvention des Europarates“, überreicht von den Abgeordneten Theresia Haidlmayr und Dr. Helene Partik-Pablé (35/PET)
Univ.-Prof. Dr. Holger Baumgartner (Bioethik-Kommission beim Bundeskanzleramt): Kurze Vorstellung meiner Person: Ich bin Arzt an der Medizinischen Fakultät der Universität Innsbruck, Stellvertreter der dortigen Fakultätsethikkommission und Mitglied der Bioethik-Kommission beim Bundeskanzleramt. Ich habe bei der World Federation of Neurology und bei der European Federation of Neurology Funktionen in deren Ethikkommissionen. Weiters möchte ich noch auf Folgendes hinweisen. Meine Frau ist aus Kanada, ich habe in Nordamerika gelebt und habe daher eine Sicht aus Kanada ebenso aus den USA zur europäischen Situation.
Wir sind heute Zeitzeugen einiger gleichzeitig ablaufender Prozesse: einer biologisch-medizinischen Revolution, einer politischen Neuordnung unseres Kontinents und einer tiefgreifenden globalen sozio-ökonomischen, kulturellen und politischen Umgestaltung.
Entsprechende Kräfte wirken daher global, sie wirken in Europa auch auf Österreich ein. In diesem Zusammenhang geht es mit der biologisch-medizinischen Revolution darum, dass der Fortschritt in diesem Bereich nicht zu einer erneuten Quelle der Spannung und Entzweiung auf einem Kontinent wird, der mühsam um Einheit und Zusammenarbeit ringt.
Angesichts dieser dramatischen Umordnungsprozesse lautet die Herausforderung daher, im Sinne unserer europäischen humanitären, sozialen und kulturellen Werte den Prozess so zu gestalten, dass auch spezifische österreichische Eigenheiten gewahrt bleiben, wir aber wirtschaftlich und wissenschaftlich, vor allem gegenüber den USA – und das ist ein eindeutiges EU-Anliegen –, aber auch gegenüber anderen EU-Mitgliedsländern, nicht ins Hintertreffen gelangen. Da sind langfristiges Denken und vorausschauendes Handeln notwendig. Ein Versuch, diesem Prozess im Bereich des biologisch-medizinischen Fortschritts einen geordneten Rahmen zu geben, und zwar im Einklang mit den europäischen Menschenrechtskonzepten, ist eben die Biomedizin-Konvention des Europarates. Dabei werden auch Belange angesprochen, die vielfach Unbehagen und Opposition ausgelöst haben, ganz besonders in Österreich und in Deutschland.
Ich will mich in meinen Ausführungen auf Artikel 17 der Menschenrechtskonvention zur Biomedizin konzentrieren, bei dem es um den Schutz einwilligungsunfähiger Personen bei Forschungsvorhaben geht – ein Punkt, der in besonderer Sorge Ablehnung hervorgerufen hat; insbesondere Absatz 2 – Forschung ohne individuellen Nutzen, fremdnützige Forschung – ist dabei umstritten. In zahlreichen Gesprächen mit Vertretern von Behindertenverbänden und Selbsthilfegruppen hat sich für mich folgendes Bild ergeben:
Erstens: Es gibt wichtiges Schutzinstrument, welches offenbar nicht hinreichend als solches wahrgenommen wird, und zwar die Forschungsethikkommission. Dieser Kommission sind humanmedizinische Forschungsvorhaben vorzulegen, und diese Kommission hat solche Projekte von vornherein auf ihre ethische und rechtliche Vertretbarkeit zu beurteilen.
Die Kommission hat zwei zentrale Aufgaben: Schutz des Patienten und Gewährleistung der Qualität in der Forschung.
Zweitens: Forschung an Personen, die nicht selbst in der Lage sind, zuzustimmen, kann aus meiner Sicht ethisch gerechtfertigt sein, und zwar auch dann, wenn die Forschung nicht den unmittelbaren individuellen Nutzen des Betroffenen zum Ziele hat, sofern bestimmte Ziele und Schutzbedingungen eingehalten werden.
Drittens: Wäre das nicht so, dann könnte es für bestimmte Personengruppen keinen spezifischen medizinischen Fortschritt geben. So ist beispielsweise die Notfallsforschung – Forschung zur Verbesserung der Wiederbelebung, Forschung bei akuten Vergiftungen, Forschung zur Verbesserung von Bergebedingungen und der Rettung von Schwerverletzten, Forschung zur Verbesserung intensivmedizinischer Behandlung oder Forschung bei Früh-Neugeborenen und bei dementen Patienten – nur dann möglich, wenn für den Nutzen dieser Patientengruppen neue Maßnahmen systematisch erforscht werden können.
Ist dies nicht möglich, dann werden diese Personengruppen unter Umständen von der Teilnahme am medizinischen Fortschritt ausgeschlossen, das heißt, sie werden schlimmstenfalls diskriminiert, ohne dass sie sich dagegen wehren können.
Was jedoch absolut verhindert werden muss, ist, dass diese Gruppen als Forschungsobjekte für Forschungsvorhaben missbraucht werden, die anderen Personengruppen, die zustimmen können, zugute kommen. – Dies wäre gröbster Missbrauch.
In einer Reihe von Gesprächen mit Vertretern von Behindertenverbänden und Selbsthilfegruppen kam ich zu folgendem Schluss:
Es gibt in Österreich kein umfassendes einheitliches biomedizinisches Forschungsgesetz; so etwas gibt es in Dänemark und in Frankreich. Die Regelungen sind verstreut, spezifische Regelungen betreffend Arzneimittel und Medizinproduktebereich sind besonders auf die Bedürfnisse der Industrie abgestimmt. Die Weiterentwicklung vollzieht sich auf europäischer Ebene und international – und Österreich ist letztlich gezwungen, die von dort kommenden Impulse umzusetzen. Das trifft zum Beispiel auf die EU-Richtlinie, die hier demnächst umgesetzt werden wird, zu.
Es gibt Lücken und Graubereiche. Die „Menschenrechtskonvention zur Biomedizin“ hat uns aber gezwungen, uns mit diesen Materien auseinanderzusetzen. Eine Lösung, die wir vorgeschlagen haben, war, dass Vertreter aus Behindertenverbänden und aus Selbsthilfegruppen in Ethikkommissionen aufgenommen werden. Dies zeichnet sich in § 8c der Novelle des Krankenanstaltengesetzes ab, in dem es heißt: ein Vertreter der organisierten Behinderten. – Meiner Meinung nach sollten aber auch Selbsthilfegruppen berücksichtigt werden.
Ich meine, Ethikkommissionen sind wichtige Sicherheits- und Schutzinstrumente und ein Garant für die Qualität in der Forschung. Wir müssen eine bessere und umfassendere Forschungskultur entwickeln; dafür ist jedoch Zeit notwendig.
Im Moment sehe ich zwei Probleme – und da geht es um Weichenstellungen –: Im § 30 des Entwurfs des Universitätsgesetzes 2002 steht zum Beispiel, dass die Geschäftsordnung der Ethikkommission vom Universitätsrat zu bewilligen ist. – Der Universitätsrat hat etwas mit Strategie und Ausrichtung der Universität zu tun. Die Sicherheitsaspekte, wie etwa beim Patientenschutz, sollten nicht vom Universitätsrat, sondern von einer Stelle genehmigt werden, die weiß, was sich die Republik unter Patientenschutz und Forschung vorstellt.
In § 8c Krankenanstaltengesetz würden meiner Meinung nach noch die Selbsthilfegruppen verankert gehören; weiters ist die Infrastruktur der Ethikkommission sicherzustellen.
Es kommt zur Entwicklung von Leit-Ethikkommissionen im Rahmen einer EU-Richtlinie. Darauf sollten wir gleichfalls unser Augenmerk richten.
Im Bereich der akademischen Forschung gibt es Defizite und Strukturprobleme. So ist jetzt zum Beispiel seitens des Gesundheitsministeriums ein Labor in Innsbruck geschlossen worden. Das geschah zwar zu Recht, aber es gibt, wie gesagt, Strukturprobleme. Beispiel: Versicherung akademischer Studien, das heißt, Ärzte, die an der Universität forschen müssen, müssen selbst die Mittel für die Versicherung dieser Forschungsvorhaben auftreiben. Das ist ein Forschungshindernis!
Letztlich gibt es noch einen Missstand, dass nämlich Forschungsvorhaben ohne Befassung der Ethikkommission durchgeführt werden.
Ich hatte Gelegenheit, in diesem Hause darauf hinzuweisen, dass es rechtlich äußerst bedenklich ist, wenn der Herr Bundespräsident als höchster Repräsentant des Rechtsstaates jemanden ernennt oder Ehrungen für Leistungen verleiht, die eigentlich unter Verletzung österreichischer Gesetze erbracht wurden.
Es wäre daher zu verlangen, dass wissenschaftlichen Arbeiten, die vorgelegt werden, eine Unbedenklichkeitserklärung der zuständigen Ethikkommission beigelegt wird.
Dr. Robert Gmeiner (Bioethik-Kommission beim Bundeskanzleramt): Ich darf mich kurz vorstellen: Seit 1. Februar leite ich die Geschäftsstelle der beim Bundeskanzleramt eingerichteten Bioethik-Kommission. Diese Klarstellung ist deshalb wichtig, weil ich damit auch andeuten möchte, was Sie von mir nicht erwarten dürfen: dass ich Stellung nehme aus der Sicht des Verfassungsdienstes des Bundeskanzleramtes zu beispielsweise verfassungsrechtlichen Fragen.
Die Bioethik-Kommission, die seit Herbst letzten Jahres eingerichtet ist, hat am 11. Februar 2002 eine Empfehlung für einen Beitritt Österreichs zur Biomedizin-Konvention des Europarates gefasst. Hiezu können Ihnen die einzelnen Mitglieder der Kommission, die anwesend sind, nähere Informationen geben. Aus Sicht der Geschäftsstelle – und deshalb bin auch ich anwesend – ist wichtig zu betonen, dass die Bioethik-Kommission bestimmte Punkte im Zusammenhang mit dem Dokument „Biomedizin-Konvention“ hervorgehoben und für sich auch quasi zur weiteren Behandlung notiert hat, insbesondere die Artikel 17 und 22 der Menschenrechtskonvention zur Biomedizin. Meine Aufgabe ist es, sozusagen diese Diskussion hier heute mitzuverfolgen, um die weiteren Beratungen der Bioethik-Kommission zu diesen Punkten, die auch im Zusammenwirken mit VertreterInnen von Behindertenorganisationen und Selbsthilfeorganisationen durchgeführt werden sollen, entsprechend zu koordinieren.
Dr. Hubert Hartl (Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen): Zu meiner Person darf ich sagen, dass ich Arzt bin; seit vielen Jahren auch Patientenvertreter, und aus diesem Grunde wurde ich wahrscheinlich auch ausgesucht, an diesem Hearing teilzunehmen.
Wir sind uns alle dessen bewusst, dass die Bioethik-Konvention sehr viele Bereiche regelt, die bisher auch in Österreich nicht geregelt waren. Das trifft insbesondere auf das Gentechnikgesetz und das Fortpflanzungsmedizingesetz zu, deren Regelungen veraltet beziehungsweise nicht novelliert sind. Das eine stammt aus dem Jahre 1995, das andere aus dem Jahre 1992.
Wir kommen nicht umhin, festzuhalten, dass insbesondere die Artikel 17 und 20 der Menschenrechtskonvention zur Biomedizin zu regeln sind. Sie sollen in Österreich, insbesondere auf Wunsch des Herrn Bundesministers, in Verfassungsrang erhoben werden, also als Verfassungsbestimmungen gelten. Andernfalls kann eine Zustimmung zur Ratifizierung seitens des BMSG nicht gegeben werden.
Univ.-Prof. DDr. Christian Kopetzki (Bioethik-Kommission beim Bundeskanzleramt): Ich darf mich kurz vorstellen: Ich bin Professor für Verfassungsrecht und Medizinrecht im Institut für Ethik und Recht in der Medizin am Juridicum in Wien sowie Mitglied der Bioethik-Kommission beim Bundeskanzleramt. Ich möchte versuchen, Ihnen in einigen kurzen Worten zu erläutern, warum die Kommission – und das einstimmig – die Ratifikation der Biomedizin-Konvention empfohlen hat. Ich werde das in Stichworten tun, um Zeit zu sparen.
Erstens: Die Biomedizin-Konvention ist der erste Versuch einer internationalen Regulierung und einer Schaffung von Mindeststandards für die Biomedizin, was eine einleuchtende Strategie ist. Die Medizin agiert heute übernational und international. Eine sinnvolle Regulierung und eine Verhinderung von Biotech-Tourismus in die Orte des jeweils schwächsten Schutzes lassen sich nur in den Griff bekommen, wenn auch das Recht entsprechend übernational agiert und sich nicht auf nationale Bestimmungen beschränkt.
Eine Teilnahme an diesen Mindeststandards führt dazu, dass der europäische Gedanke insgesamt gestärkt wird oder – wenn Sie es anders herum betrachten –: Jeder Staat, der sich dieser Teilnahme verweigert, schädigt im Grunde auch den Versuch, europaweite Mindeststandards herzustellen.
Zweitens: Die Biomedizin-Konvention ist eine Rahmenkonvention, die in vielen Punkten lückenhaft ist – das ist unbestritten –, wobei durch Zusatzprotokolle versucht wird, nach und nach weitere Terrains zu regeln und Lücken zu schließen. Einige dieser Zusatzprotokolle gibt es ja schon; die Teilnahme an dieser Fortentwicklung steht naturgemäß nur Vertragsstaaten offen. Österreich würde sich dieser Mitarbeit entziehen, wenn es diese Konvention nicht ratifiziert.
Drittens: Die Biomedizin-Konvention als Recht des Europarates wird in Zukunft eine interessante Bedeutung auch als Schutzinstrument gegen das Gemeinschaftsrecht der Europäischen Union haben. Ich weise darauf hin, dass in vielen Punkten – gerade in umstrittenen Fragen wie Forschung an einwilligungsunfähigen Personen – das Gemeinschaftsrecht, nämlich konkret die Arzneimittelrichtlinie der EU, die bereits in Kraft ist, wesentlich permissivere Regelungen vorsieht, ohne dass wir das verhindern können. Das Gemeinschaftsrecht müssen wir nicht ratifizieren, das kommt automatisch; da wäre das Recht des Europarates durchaus auch eine Art „Bollwerk“, das einem wesentlich stärkeren Menschenrechtsgedanken verpflichtet ist als das EU-Recht, das bekanntlich stärkere wirtschaftsliberale Auswirkungen hat.
Viertens: Eines der wesentlichen Elemente, die das neue Zusatzprotokoll über Forschung zur Biomedizin-Konvention enthält, ist eine so genannte Drittstaatsklausel. Das bedeutet, dass Sponsoren oder forschende Unternehmen, die in einem Vertragsstaat angesiedelt sind, auch dann an die Konventionsgrundsätze gebunden sind, wenn sie in einem Nichtvertragsstaat forschen. Im Klartext: Wenn sich die Firma X in Österreich ansiedelt und in Shanghai forscht, wäre sie trotzdem an die Grundsätze der Biomedizin-Konvention gebunden. – Das ist im jetzigen Recht nicht der Fall. Es wäre also durchaus möglich, dass, wenn wir nicht beitreten, Österreich selbst zum Schlupfloch des internationalen Biotech-Tourismus wird.
Fünftens – und vor allem –: Die Biomedizin-Konvention würde, wenn wir sie ratifizieren – insbesondere wenn wir sie im Verfassungsrang ratifizieren, was ich persönlich für richtig hielte –, zu einem wesentlichen Zuwachs an ganz neuen Grundrechten führen; zwar nicht zu allen, die wir uns wünschen würden, aber die österreichische Verfassung ist bekanntlich nicht sehr reich mit Grundrechten gesegnet. Ich sage nur Stichwort „Menschenwürde – Embryonenschutz“. Da würde die Biomedizin-Konvention, verglichen mit dem österreichischen B-VG, immer noch einen wesentlichen Fortschritt bedeuten.
Ich weise auch darauf hin, dass die Regelungen der Biomedizin-Konvention in vielen Punkten wesentlich stärker und strenger sind als das österreichische Recht. Es gibt aber auch Gegenbeispiele, es gibt Regelungen, in denen die Konvention strenger ist, es gibt jedoch auch Regelungen, in denen sie weniger streng ist.
Das Entscheidende ist, dass Österreich nur verpflichtet ist, die strengeren umzusetzen, aber nicht verpflichtet ist, das Schutzniveau dort herunterzusetzen, wo die Regelungen nicht strenger sind. Es ist also im Grunde eine Einbahnstraße, deren Befolgung nur Vorteile, aber keine Nachteile haben kann.
Die Kommission hat sich sehr ausführlich mit den Gegenargumenten beschäftigt. Wir haben auch sehr fruchtbare Gespräche mit Behindertenorganisationen geführt. Ich will auf zwei, drei Punkte kurz eingehen. Persönlich glaube ich, dass sehr viele Missverständnisse in der Diskussion vorgekommen sind, was die rechtliche Bedeutung der Konvention betrifft.
Ich will auf Folgendes eingehen: Stichwort „Dammbruch“. Die Konvention enthält dort, wo sie die umstrittenen Erlaubnisse betreffend Forschung an Einwilligungsunfähigen oder Embryonenforschung enthält, ein schwächeres Schutzniveau als das österreichische Recht. – Das ist unbestritten. Das hat damit zu tun, dass es im internationalen Konzert der Länder und im Konzert der unterschiedlichen Moralen einfach nicht möglich war, in diesen heißen Punkten einen Konsens herzustellen; das ist im Völkerrecht ebenso.
Entscheidend ist, dass Österreich nicht verpflichtet ist, in jenen Bereichen, in denen der Schutz schwächer ist, als er uns gefallen würde, auf dieses Niveau herunterzugehen. Es gibt eine ausdrückliche Bestimmung in der Konvention, die das verhindert. Ich will es in einem knappen Satz zusammenfassen: Nichts von dem, was heute in Österreich verboten ist, wird am Tag nach der Ratifikation erlaubt sein!
Es kommt immer der Einwand, es gäbe dann eine Art „politischer Dammbruchphänomene“, dass eben durch den Druck der internationalen Pharmalobby so etwas wie eine Absenkungsbewegung auf das unterste Niveau stattfinden würde. – Das kann Recht nie ausschließen, und dagegen kann man nur sagen: Die Entscheidung, was wir absenken wollen, bleibt eine souveräne österreichische Entscheidung. Ganz konkret: Es bleibt die Entscheidung des Parlaments! Der Druck wird mit der Ratifikation um nichts größer als ohne Ratifikation.
Ich weise auf ein Beispiel hin, das sehr strapaziert wird, das aber vielleicht zeigt, was ich meine. Österreich hat 1958 die Europäische Menschenrechtskonvention des Europarates ratifiziert, die heute das Grundrechtsdokument in Europa ist. Diese Menschenrechtskonvention hat bekanntlich die Todesstrafe nicht verboten. Warum? – Man wollte einigen Ländern den Beitritt nicht verunmöglichen, die die Todesstrafe noch in ihrem Rechtsbestand hatten. – Selbstverständlich hat Österreich deswegen die Todesstrafe nicht eingeführt. Das wurde nicht einmal ansatzweise diskutiert und erst später, Jahrzehnte später, wurde im Europarat durch Zusatzprotokolle auch die Todesstrafe abgeschafft.
Sie sehen also an diesem Beispiel, dass die Lückenhaftigkeit eines Dokuments nicht bedeutet, dass alle auf das unterste Niveau zurückgehen.
Was man sich vor Augen führen muss, ist, dass sich die Frage einer inhaltlichen Revision nicht stellt. Wir haben ein Dokument, dem mittlerweile 31 von 44 Staaten des Europarates ihre Zustimmung gegeben haben. Die Vorstellung, wir könnten inhaltliche Verbesserungen des Hauptdokuments erzwingen, ist an sich naiv – so wichtig ist Österreich nicht. Die Frage ist nur: Ratifizieren wir es insgesamt oder lehnen wir es insgesamt ab? – Da spricht nach meiner persönlichen Meinung und auch nach der Meinung, die sich in der Kommission durchgesetzt hat, nach Abwägung aller Umstände, alles dafür zu ratifizieren.
Univ.-Prof. Dr. Ulrich Körtner (Bioethik-Kommission beim Bundeskanzleramt): Ich darf mich kurz vorstellen: Ich bin im Hauptberuf evangelischer Theologe, beschäftige mich auch mit Fragen der Ethik im Allgemeinen, der Medizinethik im Besonderen, unter anderem bin ich Vorstand des Instituts für Ethik und Recht in der Medizin an der Universität Wien und deshalb wohl auch zum Mitglied der Bioethik-Kommission beim Bundeskanzleramt bestellt worden.
Ich kann mich relativ kurz fassen, weil ich die Punkte, die von meinem Vorredner angesprochen wurden, nachdrücklich unterstreichen möchte. Ich darf noch einmal aus der Sicht der Ethik kurz zusammenfassen: Es sind im Wesentlichen fünf Punkte, die hier genannt wurden.
Erstens: Man soll sich an der Etablierung europaweiter Mindeststandards beteiligen. Das ist angesichts der Internationalisierung der medizinischen Forschung meines Erachtens unabdingbar.
Zweitens: Wir beteiligen uns auch aktiv an der Möglichkeit der Weiterentwicklung – Stichwort „Zusatzprotokolle“.
Drittens: In manchen Bereichen würde eine Ratifizierung zur Verbesserung des österreichischen Schutzniveaus führen. – Dazu ist schon einiges ausgeführt worden.
Viertens – das
möchte ich unterstreichen – sehe ich eine Verbesserung
des Grundrechtsschutzes.
Fünftens: mehr Transparenz und Rechtssicherheit im Medizinrecht.
Zum Grundrechtsschutz zwei Punkte. Es kreist ja im Wesentlichen um den Artikel 17 des Menschenrechtsübereinkommens zur Biomedizin, in dem die Möglichkeit fremdnütziger Forschung an nicht zustimmungsfähigen Menschen der eigentliche Stein des Anstoßes ist. Für uns in der Kommission war das ganz entscheidende Argument, dass dieser Artikel 17 Österreich unmittelbar nicht berührt, wenn eine Ratifizierung vorgenommen würde, weil uns niemand dazu zwingt, bestehende Gesetze, die ein strengeres Niveau vorsehen, zu ändern. Das heißt, wenn ich es richtig sehe, man kann, vereinfacht gesagt, die ganze Frage des Artikels 17 und der Materie, die darin behandelt wird, wenn es um die Ratifizierung als solche geht, ausklammern.
Dass die Frage der Forschung – Professor Baumgartner hat es schon gesagt – und des vielleicht auch gelegentlichen Missverhältnisses von Theorie im Recht und der tatsächlichen Praxis dringend diskutiert gehören, ist unbestritten, hat aber mit der Frage der Ratifizierung überhaupt nichts zu tun. Das heißt, man kann und sollte sich diesen Fragen widmen; dazu bedarf es aber nicht der Ratifizierung. Und umgekehrt: Wenn wir nicht ratifizieren, werden wir uns wahrscheinlich dieser Thematik widmen müssen.
Wenn man Artikel 17 in der Frage der Ratifizierung praktisch ausklammern kann, stellt sich zunächst die Frage: Was spricht denn beim Punkt Grundrechtsschutz für die Ratifizierung? – Da ist es meines Erachtens gerade der Artikel 18. Das klingt vielleicht auf den ersten Blick überraschend, wenn ich das sage, denn dieser regelt, dass es unter bestimmten Voraussetzungen unter Umständen Forschung an Embryonen oder an embryonalem Material geben könnte, sofern menschliche Embryonen nicht eigens für Forschungszwecke hergestellt werden.
Die ganze Diskussion über die Stammzellenforschung, insbesondere auch die Diskussion über das 6. Rahmenprogramm der EU zur Forschungsförderung, das bekanntlich gerade beschlossen worden ist – auch gegen die Neinstimme Österreichs –, hat deutlich gemacht, dass es in puncto Lebensbeginn keine Grundrechtsbestimmung in Österreich gibt. Mir persönlich – gerade von Seiten der Ethik – wäre es ein großes Anliegen, wenn man in irgendeiner Weise überhaupt einmal den Gesichtspunkt Embryonenschutz, ja überhaupt nur den Begriff „Embryo“ in die österreichische Rechtsordnung hineinbringen könnte.
Das Fortpflanzungsmedizingesetz ist auf den ersten Blick ein relativ strenges Gesetz. Ich weise aber darauf hin, dass das eine einfachgesetzliche Regelung ist, die jederzeit geändert werden könnte. Wir brauchen die Biomedizin-Konvention nicht zu ratifizieren, wenn es dem Gesetzgeber opportun erschiene, das Fortpflanzungsmedizingesetz zu ändern. Im Übrigen spricht das Fortpflanzungsmedizingesetz nicht einmal legistisch von „Embryonen“ oder „Präembryonen“, sondern es spricht von „entwicklungsfähigen Zellen“.
Es steht einerseits eine Novelle des Fortpflanzungsmedizingesetzes an und andererseits ist vorgesehen, dass im Zusammenhang mit dem 6. Rahmenprogramm der EU europaweit Forschungen zumindest an existierenden human-embryonalen Stammzelllinien etabliert werden. Österreich wird wenigstens bei der Finanzierung mitbeteiligt sein. Da es keine Forschungsverbote auf diesem Gebiet gibt, wird es auch Forschungen in Österreich geben dürfen. Ich halte es für eine ungute Entwicklung, wenn jetzt der biomedizinischer Fortschritt, den ich im Einzelnen hier nicht weiter bewerten will, seinen Lauf nimmt, wir aber noch nicht einmal ein Minimum an Grundrechtsschutz am Beginn des menschlichen Lebens haben.
Das heißt, gerade dieser Artikel 18 scheint mir auf der Grundrechtsschutzebene ein starkes Argument für die Ratifizierung zu sein; der Artikel 17, weil man ihn eben ausklammern kann, spricht aber nicht dagegen. Das wollte ich noch einmal besonders hervorheben, weil gerade auf dem Gebiet der Embryonenforschung und der Stammzellenforschung die Entwicklung im Moment sehr rasant voranschreitet.
Birgit Primig (ÖAR/Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation): Ganz kurz zu meiner Person: Ich befasse mich seit 1996 im Auftrag der Behindertenverbände in unterschiedlichen Funktionen mit den – damals – ersten Entwürfen der Biomedizin-Konvention, damals noch „Bioethik-Konvention“ genannt, und bin seit August des Vorjahres Vorsitzende der Ethikkommission für die Österreichische Bundesregierung.
Ganz grundsätzlich zur Biomedizin-Konvention: Die österreichischen Behindertenverbände halten es prinzipiell für gut, dass versucht wird, europaweit gültige einheitliche Standards einzuführen, die Forschungsvorhaben in allen Staaten nach gleichen Rechten regeln. Die österreichischen Behindertenverbände sind alles andere als forschungsfeindlich. Forschung ist in manchen Bereichen absolut notwendig und durchaus positiv zu bewerten.
Jetzt kommt das große Aber: Die Biomedizin-Konvention erscheint uns nach wie vor nicht als das wirklich geeignete Mittel, um diese einheitlichen Standards einzuführen, zumal sie in einigen Punkten unserer Meinung nach in einem Menschenrechtsdokument ungeeignet sind, da genau dieses Dokument einige Menschenrechte durchaus verletzt.
Es ist schon der Begriff „Einwilligungsunfähigkeit“ gefallen. Das ist ein Bereich, bezüglich dessen wir massive Bedenken haben, weil Personen, die einwilligungsunfähig erscheinen, in diesem Papier nach wie vor tatsächlich diskriminiert werden, auch wenn es im Zusatzprotokoll leichte Verbesserungen gegeben hat. Wichtig dabei ist auch, dass die Einwilligungsunfähigkeit ein sehr gutes Beispiel für eine nicht differenzierte Betrachtungsweise der Forschung durch die Biomedizin-Konvention und auch durch die zu Grunde liegenden begleitenden Gesetze, die es in Österreich zu diesem Thema gibt, ist. Einwilligungsunfähige Personen sind ein sehr großer Bereich an Personengruppen, die unter einem Begriff zusammengefasst werden und unserer Meinung nach keinesfalls gleich behandelt werden dürfen.
Herr Professor Baumgartner hat unter
„einwilligungsunfähige Personen“ Notfallpatienten genannt. Das ist sicher eine
andere Art der Forschung an Notfallpatienten, als wenn man jene Personengruppe
nimmt, für die wir von der ÖAR in erster Linie sprechen, wenn es um
Einwilligungsunfähigkeit geht: Das sind zum Beispiel Menschen mit geistiger
Behinderung, Menschen mit psychischer Behinderung, Menschen, die auf Grund
ihrer Behinderung eine Handlung selbst nur schwer oder gar nicht beurteilen und
deren Folgen nicht abschätzen können. Da, so denke ich, sollte man sehr stark
differenzieren – die Biomedizin-Konvention tut das nicht.
Das „ungeregelte Österreich“ wird uns immer wieder als Argument dafür genannt, warum man die Biomedizin-Konvention ratifizieren sollte. Ich meine, es ist gerade hier in diesem Hause doch eigentlich ein Leichtes, ein „ungeregeltes Österreich“ mit einem Regelwerk zu versehen, das Personen tatsächlich vor Forschungseingriffen oder anderen Dingen schützt. Die Lücken, die es da im österreichischen Gesetz gibt, müssen nicht zwangsläufig durch die Ratifikation einer internationalen Konvention behoben werden, sondern das sollte eigentlich auch auf anderem gesetzlichen Weg möglich sein.
In den letzten Jahren ist sehr viel auf diesem Sektor passiert. Wir sind mittlerweile in der etwas seltsamen Situation, dass uns eine Biomedizin-Konvention, von der wir in einigen Punkten absolut nicht überzeugt sind, tatsächlich als geeignetes Schutzinstrument vor Europarecht erscheint. Es wäre höchst an der Zeit, folgende Frage auch international zu diskutieren: Wie kommt es, dass unterschiedliche multinationale Gremien unterschiedliche Regelungen entwickeln, die einander zum Teil widersprechen?
Die Ethikkommission für die Östereichische Bundesregierung und damit die österreichischen Behindertenverbände sprechen sich daher nach wie vor gegen eine rasche Ratifikation der Biomedizin-Konvention aus, bevor nicht in Österreich sämtliche Gesetzeslücken geschlossen sind und bevor nicht international diskutiert wird. Wir sind nicht so naiv zu glauben, dass wir die Konvention inhaltlich ändern könnten, aber die Konvention selbst hat eine Art erstes Ablaufdatum ab dem Zeitpunkt, ab dem man inhaltliche Änderungen eventuell erwägt. Diesen Zeitpunkt könnte Österreich als nicht beigetretener Staat durchaus nutzen, um noch einmal Diskussionen auch auf europäischer Ebene anzufachen.
Dr. Max Rubisch (Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen): Ich darf mich kurz vorstellen: Ich bin der zweite Vertreter des Sozialministeriums, und zwar aus der Sektion Behindertenangelegenheiten; ich leite dort die Abteilung für grundsätzliche Fragen in der Behindertenpolitik.
Wir halten die Biomedizin-Konvention grundsätzlich für positiv, weil ein einheitlicher Mindeststandard an Menschenrechten geschaffen wird. Allerdings haben wir Bedenken hinsichtlich der Artikel 17 und 20. Wenn wir uns die Artikel 1 und 2 der Konvention anschauen, sehen wir, dass im Artikel 1 die Rede davon ist, dass die Vertragsparteien die Würde und die Identität aller Menschen schützen und jedem ohne Unterschied die Wahrung seiner Integrität gewährleisten. – Es geht hier um körperliche Integrität.
Im Artikel 2 ist Folgendes festgehalten: „Die Interessen und das Wohlergehen des Menschen haben Vorrang vor dem alleinigen Interesse von Gesellschaft oder Wissenschaft.“
Meiner Ansicht nach widersprechen die beiden Bestimmungen in den Artikeln 17 und 20 diesen beiden ersten Grundsätzen der Konvention.
Im Artikel 17 Abs. 2 steht, dass die Forschung an einwilligungsunfähigen Personen auch möglich ist, wenn kein Eigeninteresse vorliegt. – Und diese Bestimmungen widersprechen Artikel 20, in dem es um die Organentnahme bei einwilligungsunfähigen Personen geht. – Ich spreche hier also für den Personenkreis von Menschen mit geistigen oder psychischen Behinderungen.
Weiters möchte ich daran erinnern, dass im Jahre 1997 in Österreich eine Verfassungsbestimmung folgenden Inhalts beschlossen wurde: Niemand darf auf Grund seiner Behinderung benachteiligt werden.
Es stellt sich auch die Frage, ob eine Ratifizierung der Bestimmungen der Artikel 17 und 20 nicht eine Verfassungswidrigkeit darstellen würden. Diese Frage möchte ich aufwerfen.
Die Haltung des Sozialministeriums ist folgende: Es müsste gelingen, die Schutzbestimmungen, die es im österreichischen Recht bereits gibt und die strenger als die entsprechenden Artikel dieser Konvention sind, verfassungsrechtlich abzusichern. Wenn dies nicht gelingt, dann spricht sich das Sozialministerium gegen die Ratifizierung dieser Konvention aus.
Leitender Staatsanwalt Dr. Michael Stormann (Bundesministerium für Justiz): Ich darf die Gelegenheit ergreifen, mich kurz vorzustellen: Ich bin seit 1975 im Bundesministerium für Justiz, und zwar in der Abteilung für Personenrecht und Familienrecht sowie teilweise in der Abteilung für Immaterialgüterrecht tätig und bin mit der Produktion von Gesetzen, aber immer wieder auch mit der Ausarbeitung von internationalen Übereinkommen befasst.
Nach dem unerwarteten Tod meiner Vorgängerin habe ich die Verhandlungsführung im Leitungskomitee des Europarates für Bioethik angetreten. Das war gerade zu jener Zeit, als in diesem Leitungskomitee der Gedanke aufgekeimt ist, eine Rahmenkonvention auszuarbeiten, die die moderne Medizin, zunächst primär die Fortpflanzungsmedizin, völkerrechtlich verbindlichen Regelungen zuführt.
Meine Damen und Herren! Das Bemerkenswerte ist, dass das Übereinkommen, über das hier gesprochen wird, nicht ein medizinisches Papier ist, das mehr oder weniger Empfehlungscharakter hat, sondern ein völkerrechtlicher Vertrag mit Bindungswirkung. Es wurde damals der Plan gefasst, ein Rahmenübereinkommen auszuarbeiten, das Bestimmungen enthält, die für eine Vielzahl von Staaten des Europarates akzeptabel sein sollten – und dann Zusatzprotokolle zu einzelnen Bereichen auszuarbeiten, die, verkürzt ausgedrückt, nur für „High-standard-Staaten“ zugänglich sein sollten, um eben auch Staaten, die diese Entwicklungen in Europa noch nicht in dem Maße mitgemacht haben, die Möglichkeit zur Teilnahme eröffnen.
Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass bei Abstimmungen im Bereich von Leitungskomitees des Europarates die Zweidrittelmehrheit gilt. Verkürzt gesagt: Das, was nicht von zwei Dritteln sämtlicher Mitgliedstaaten des Europarates unterschrieben werden kann, entsteht gar nicht. Da Abstimmungen zu jedem einzelnen Artikel erfolgen, sind natürlich Bestimmungen nicht akzeptabel, die auf entsprechenden Widerstand stoßen.
In Österreich war es so, dass eine vom Europarat vorweg ausgearbeitete Fassung einer so genannten Bioethik-Konvention vom Justizministerium einem allgemeinen Begutachtungsverfahren zugeführt wurde. Dieses Begutachtungsverfahren hat, wie ich festgestellt habe, in der österreichischen Öffentlichkeit leider keinen nennenswerten Widerhall gefunden. Außer einer Pflichtmeldung von zwei Zentimeter Höhe in der „Wiener Zeitung“ war keine öffentliche Reaktion zu bemerken. Dementsprechend war auch der Rücklauf an Stellungnahmen ein eher bescheidener.
Bei den weiteren Verhandlungen ist von verschiedenen Organisationen in Österreich sogar von „Geheimverhandlungen“ gesprochen worden: völlig zu Unrecht, und teilweise kam das sogar von Organisationen, die wir im Begutachtungsverfahren angeschrieben hatten.
Wir haben nicht geheim verhandelt, sondern haben uns auch der Öffentlichkeit gestellt. Dennoch haben uns aber der Rücklauf und die Methode, Meinungen einzuholen, die Möglichkeit gegeben, zusammen mit anderen so genannten Hardliner-Staaten – dazu gehörten vor allem Deutschland und teilweise auch die Schweiz – den Standard des Entwurfes des Übereinkommens wesentlich zu verbessern.
Was schließlich in Oviedo zur Unterzeichnung aufgelegt wurde, lässt sich in zahlreichen Punkten in der Tat nicht mit dem vergleichen, was vorher veröffentlicht wurde. Teilweise ist der schlechte Ruf des Übereinkommens eben darauf zurückzuführen, dass man in alte Internetseiten, in alte Berichte schaut – und die endgültig beschlossene Fassung mit jener verwechselt, die der Begutachtung, die vom Europarat vorweg freigegeben wurde, zugeführt wurde.
Der große Vorteil des Übereinkommens ist nun, dass Zusatzprotokolle ausgearbeitet werden. Es gibt solche bereits für ein umfassendes Klonverbot, also nicht bloß betreffend reproduktives Klonen, sondern auch therapeutisches Klonen.
Es gibt ein weiteres Zusatzprotokoll betreffend Transplantationen. Meine Damen und Herren! Ich möchte daran erinnern, dass das österreichische Transplantationsgesetz die Lebendspende nicht regelt. Das Herausschneiden von Organen oder Teilen eines Menschen aus einem lebenden Menschen ist in der österreichischen Rechtsordnung etwas absolut Ungeregeltes. Würden wir dieses Zusatzprotokoll ratifizieren wollen, dann müssten wir Mitglied der Konvention sein. Eine andere Möglichkeit steht nach dieser Konvention nicht offen; es wäre natürlich sehr sinnvoll, das zu tun.
In Ausarbeitung befindet sich weiters ein Zusatzprotokoll, das medizinische Forschung regelt. Dabei geht es vor allem darum, jene Bereiche medizinischer Forschung zu verschärfen, die bereits im Übereinkommen geregelt worden sind.
Ich bitte, sich Folgendes zu vergegenwärtigen: Es ist nicht so, dass das Übereinkommen bestimmte Bereiche von Forschung erlaubt, und es ist auch nicht so, dass das Übereinkommen bestimmte angebliche Organentnahmen an Einwilligungsunfähigen erlaubt. Das Übereinkommen erlaubt dem einzelnen Forscher gar nichts. Das Übereinkommen erlaubt Mitgliedstaaten, nachdem sie entsprechende schützende Regelungen erlassen haben, in diesen Bereichen Forschung zuzulassen. Es ist also nicht per se eine Erlaubnis. Macht ein Staat von der Regelung nicht Gebrauch, dann findet eine derartige Forschung nicht statt. Ich weise auf Folgendes hin: Was an nichteigennütziger Forschung an Einwilligungsunfähigen durch dieses Übereinkommen angeblich zugelassen ist, ist Forschung, die dem so genannten „Minimal-risk- und Minimal-burden-Prinzip“ unterliegt.
Verkürzt heißt das: Grundlagenforschung mit geringem Risiko und geringer Belastung. Bei den Arbeiten am Zusatzprotokoll wurde das präzisiert und im Erläuternden Bericht zum Zusatzprotokoll wurde gesagt, dass es sich dabei maximal um eine Röntgenaufnahme ohne Kontrastmittel oder bei einer Blutabnahme maximal um die Entnahme einer zusätzlichen geringfügigen Blutmenge an einem kleinen Kind handeln kann.
Jetzt werden Sie vielleicht sagen: Fürchterlich! – Da kann ich nur sagen: aus österreichischer Sicht ja! – Nach österreichischem Kindschaftsrecht, nach österreichischem Recht der gesetzlichen Vertretung, komme ich zum Schluss, dass Forschung an Einwilligungsunfähigen, die den Betroffenen keinen Nutzen bringt, vom gesetzlichen Vertreter nicht genehmigt werden darf und vor allem nicht genehmigt werden kann. Es geht gar nicht. Er kann nicht eine Vertretungshandlung setzen, bei der seinem Gegenüber klar ist, dass sie keinen Vorteil hat.
Meine Damen und Herren! Damit Klarheit besteht. Der einzige Staat, der mit dieser österreichischen Argumentation auf Europaratsebene, also von 42 anderen Staaten, noch mitgeht, ist Deutschland. Nicht einmal die Schweiz wäre da zu einem Mitgehen zu bewegen.
Damit Sie sich im Klaren sind: Wir bräuchten für eine Änderung dieser Punkte eine Zweidrittelmehrheit, könnten aber bestenfalls einen anderen Staat mit Sicherheit gewinnen. Und möglicherweise gelingt es mir als altem, erfahrenem Verhandlungsfuchs auch noch den einen oder anderen UdSSR-Nachfolgestaat sozusagen an Land zu ziehen. Aber bitte: Das ist alles! Da die Illusion zu haben, wir könnten Verbesserungen erzielen, halte ich für nicht sinnvoll.
Weiters bietet das Übereinkommen die Möglichkeit, für Staaten schützende Bestimmungen vorzusehen, wenn es um die Entnahme von regenerierbarem Gewebe aus Einwilligungsunfähigen geht.
Meine Damen und Herren! Das ist eine auch in Österreich nach Auffassung des Bundesministeriums für soziale Sicherheit und Generationen und auch nach Auffassung unseres Hauses tolerierte Möglichkeit, dass etwa Geschwistern geholfen wird.
Ein Beispiel: Zwei Geschwister, eines davon ist an Leukämie erkrankt. Es müsste nun ein Kind zusehen, wie sein Geschwisterteil elend stirbt. Da erlaubt auch die österreichische Rechtsordnung – selbstverständlich mit Kollisionskurator und ähnlichen Dingen, und vor allem auch wenn die betreffende Person schon ein gewisses Bewusstsein entwickelt hat, um diese Situation für das Familienleben zu begreifen – die Knochenmarkspende, die für den Geschwisterteil lebensrettende Knochenmarkspende.
Und um hier einmal Farbe zu bekennen: So ganz böse, wie das auf den ersten Blick ausschaut, ist es nicht; da wurde auch Rufmord begangen.
Was ich für sehr wichtig halte, ist das von Herrn Professor Kopetzki gebrachte „Loch-Agument“. Ist Österreich im ganzen System und im Forschungsprotokoll nicht Mitglied, dann würde Österreich Sitz aller Forscher werden, die auf europäischer Ebene im Ausland – im afrikanischen Ausland, in Entwicklungsländern – hochproblematische Forschung betreiben, weil sie dann nicht unter die Drittstaatklausel des Protokolles fallen.
Das heißt, es gibt einen ganz massiven Grund, dass Österreich Mitglied wird, wobei die Wege so aussehen sollten: Zunächst das innerstaatliche Recht anpassen, darüber nachdenken, welche Teile verfassungsrechtlich abgesichert werden sollten – auch da bin ich dafür, darüber nachzudenken –, und bitte nicht die von Behindertenvertretern als kritisch betrachteten Artikel in Verfassungsrang zu erheben, sondern ich glaube, man müsste den höheren österreichischen Standard in Verfassungsrang erheben. Dieses Gesamtpaket soll dann dem Nationalrat zur Ratifikation vorgelegt werden, damit man weiß, was letztendlich als Ganzes herauskommt.
Dr. Heinz Trompisch („Lebenshilfe Österreich“): Zu meiner Person: ich bin seit 23 Jahren bei der „Lebenshilfe Österreich“ im Bereich „Juristerei“ und Gesellschaftspolitik beschäftigt und bin auch Mitglied der Ethikkommission für die Österreichische Bundesregierung.
Zur vorliegenden Biomedizin-Konvention des Europarates ist sicherlich festzustellen, dass ein gemeinsamer europäischer Mindeststandard grundsätzlich zu begrüßen ist. Allerdings sehe ich in dieser Konvention in Form der schon mehrfach angesprochenen Artikel 17 und 20 einiges an gefährlichem Gedankengut, besonders in Richtung einwilligungsunfähige Personen; stellvertretend dafür betrachte ich jetzt Menschen mit geistiger Behinderung oder psychischer Erkrankung, aber auch altersdemente Personen.
Die hier bereits mehrfach angesprochenen Zusatzprotokolle – und ich beziehe mich auf jenes zur Forschung – haben meines Erachtens keine wesentliche Verbesserung in der Umgangsweise oder in den Möglichkeiten, die einwilligungsunfähigen Personen drohen, gebracht.
Ich sehe aber keine Möglichkeit, dass die bestehenden Texte geändert werden. Das heißt, die Frage ist, inwieweit Österreich mit diesem vorliegenden Dokument umgeht. Ich sehe eine Möglichkeit, dass die angesprochenen Artikel 17 und 21 auch im Zusammenhang mit den Artikeln 1 und 2, aber auch mit allfällig jetzt schon bereits vorhandenen Schutzbestimmungen – ich denke da etwa an das Kindschaftsrecht und an das Sachwalterrecht – innerösterreichisch entsprechend abgesichert werden.
Herrn Professor Kopetzki stimme ich zu, wenn er meint, es zwinge uns niemand, bestehende Schutzbestimmungen abzusenken. – Dann muss ich aber auch umgekehrt sagen, wenn dieses stimmt: Es hindert uns aber auch niemand, diese Schutzbestimmungen entsprechend, etwa mit Zweidrittelmehrheit, abzusichern, um allfälligen Wünschen – beispielsweise von der forschenden Pharmaindustrie – vorgreifen zu können.
Ich stimme auch Herrn Dr. Stormann dahin gehend zu: Bevor die Ratifikation ernsthaft überlegt werden sollte, müsste ein Gesamtpaket erstellt werden, das diese Schutzbestimmungen in entsprechender Form absichert. Erst dann wäre der Zeitpunkt reif, um über die Frage der Ratifikation ernsthaft entscheiden zu können.
Univ.-Prof. Dr. Günter Virt (Bioethik-Kommission beim Bundeskanzleramt): Ich darf mich auch kurz vorstellen: Ich bin Professor an der Katholisch-Theologischen Fakultät für Ethik und Moraltheologie, habe seit 1993 das Institut für Ethik und Recht in der Medizin als interdisziplinäres Institut begonnen aufzubauen; mein lieber Freund Ulrich Körtner ist dort nun Vorstand. Ich bin Mitglied der Ethik-Kommission im AKH, seit ich 1986 nach Wien berufen wurde, bin Mitglied der Ethik-Kommission beim Bundeskanzleramt und auch in der Beratergruppe der Europäischen Union in Brüssel: in der European Group on Ethics.
Ich darf mit folgender Bemerkung beginnen: Ethische Vorentscheidungen fallen oft schon in der Sprache. Dr. Stormann hat schon darauf hingewiesen, dass immer noch der Ausdruck „Bioethik-Konvention“ herumgeistert, der natürlich nicht geeignet ist, denn über Ethik kann man nicht abstimmen, kann man keine Konvention machen. Es handelt sich also um eine Menschenrechtskonvention zur Biomedizin, meist abgekürzt MRB.
Ich würde auch bitten, nicht von „Behinderten“ zu sprechen – damit bezeichnen wir den Menschen als einen Fall einer allgemeinen Gruppe –, sondern von „Menschen mit Behinderung“. Menschen in den verschiedenen Situationen werden zunächst als Menschen – und dann erst mit ihrer Situation bezeichnet.
Ebenso der Ausdruck „therapeutisches Klonen“, der gefallen ist: Embryonen gezielt zu vernichten, heißt dann plötzlich therapeutisches Klonen – in völliger Umkehrung aller bisherigen traditionellen Sprachgebräuche, noch dazu, wo derzeit überhaupt keine Hypothesen in Sicht sind!
So viel zur Semantik, wo immer schon ethische Vorentscheidungen fallen.
Die Gründe für die Unterzeichnung der MRB und die Gründe dagegen sind von den Kollegen Baumgartner, Kopetzki, Körtner und vielen anderen genannt worden; ich brauche sie nicht zu wiederholen. Ich möchte nur noch ein paar Punkte ansprechen, beispielsweise das Missverständnis, das es in weiten Kreisen immer noch gibt: Sorgen vor einem ethischen Sog nach unten. Diese Sorgen sind aber in vielen, vielen Bereichen berechtigt.
Welche Bedeutung hat die Unterzeichnung oder Nichtunterzeichnung der MRB? – Diesen Sog nach unten gibt es mit und ohne Unterzeichnung, nur sind mit der Unterzeichnung zumindest gewisse Grenzen und Mindeststandards eingezogen, deren wir uns durch Nichtunterzeichnung begeben.
Die Frage der Forschung an nicht einwilligungsfähigen Personen in den verschiedenen Situationen ist international in vielen Regelwerken in Diskussion. Die europäische Beratergruppe für Ethik hat gerade begonnen, die nächste Opinion über die Forschung auszuarbeiten, die von der Europäischen Union gemeinsam mit Entwicklungsländern vorangetrieben wird. Bezüglich der ganz schwierigen Frage: Nach welchen Standards soll das stattfinden, wie werden sie eingehalten?, gibt es große Unsicherheit. In der WHO ist diesbezüglich ein Papier in Ausarbeitung; ich habe es in Brüssel jetzt erst bekommen. Es sind die unterschiedlichen Meinungen verschiedener Länder genannt, aber es gibt noch keine Einigung.
Wir haben die schon genannte EU-Richtlinie 20/2001 über die Forschung, wir haben das Zusatzprotokoll des Europarates. Wir haben in Brüssel etliche dicke Dokumente auf den Tisch bekommen, kiloweise Dokumente von englischen und amerikanischen Kommissionen, die sich damit befassen, also wir befinden uns hier in einem ganz großen internationalen Diskussionsprozess.
Zum Schluss kommend: Persönlich bin ich der Meinung, dass wir auch wegen des internationalen Standes Österreichs im Europarat aus Solidarität, um Schlupflöcher zuzumachen, unterzeichnen sollten. Es würde die österreichische Position auch in einem ganz wichtigen anderen Bereich im Europarat unterstützen, nämlich das von Frau Abgeordneter Gatterer eingebrachte und mit überwältigender parlamentarischer Mehrheit angenommene Dokument über die Menschenrechte und den Schutz der Menschenwürde terminal Kranker und Sterbender.
Wenn Österreich dieses Dokument vorantreiben will – wichtige Vorentscheidungen werden wahrscheinlich heuer noch fallen –, dann macht es kein gutes Licht, wenn Österreich abseits steht bei der MRB.
Ein zweiter Grund: Es kann die Unterzeichnung – sie kann ja nur der erste Schritt sein – ein Anstoß sein für die österreichische Gesetzgebung dort, wo wir anheben müssen, also dort, wo Österreich niedrigere Standards hat. Das könnte eine wichtige Motivation sein, diese Gesetzgebung in Österreich anzukurbeln und voranzutreiben.
Deshalb möchte ich auch hier die Bitte äußern – in der Kanzlerkommission habe ich sie bereits geäußert –, dass man nicht erst Gesetze ausarbeitet und nachträglich die advokatorischen Gruppen einlädt, sondern dass man von vornherein die advokatorischen Gruppen einbindet und sie bittet, selber Vorschläge zu machen, wie denn dieser schmale Grat ausschauen kann, dass wir auf der einen Seite einen optimalen Schutz von Menschen haben, die aus verschiedenen Situationen nicht zustimmungsfähig sind, auf der anderen Seite aber auch diese Menschen vom medizinischen Fortschritt nicht ausschließen, der nun einmal auch auf Forschung beruht und in manchen Situationen an anderen Personen nicht vorangetrieben werden kann.
Ich würde Sie auch bitten, sehr differenziert ans Werk zu gehen bezüglich jener Menschen, die nicht zustimmungsfähig sind. Ich habe gerade in den letzten Tagen wieder mit Kollegen von den Kinderkliniken telefoniert: Mehr als 50 Prozent aller Medikamente und über 80 Prozent der Medikamente in Intensivstationen, die Kindern verabreicht werden, sind wissenschaftlich nicht für Kinder erprobt. Das heißt also, jedes Kind, das in einer Minderdosis ein Medikament bekommt, das normalerweise Erwachsene bekommen, ist ein Versuchskaninchen. Da ist dringendster Forschungsbedarf zum Schutz der Kinder gegeben; Kinder können eben vor allem im frühkindlichen Alter nicht zustimmen.
Ich würde Sie bitten, da wirklich sehr konkret und genau die unterschiedlichen Situationen zu berücksichtigen, wie etwa: nicht zustimmungsfähig, weil Kind oder Notfallpatient. Ich könnte Ihnen etliche Beispiele aus Ethikkommissionen berichten: Psychisch Kranke, Demente und auch Embryonen können bekannterweise nicht zustimmen. Erst dann, wenn sozusagen die österreichische Gesetzgebung dort in Einklang gebracht wird, wo wir anheben müssen, wäre in einem letzten Schritt überhaupt erst die Ratifizierung zu bedenken.
Also: Schritt eins Unterzeichnung, Schritt zwei Anstoß für die österreichische Gesetzgebung, wo es nötig ist – und erst dann könnte man die Ratifizierung überlegen.
Nicht nur die Zustimmung, auch die Ablehnung der Unterzeichnung muss genauso ethisch verantwortet werden. Also nicht nur die Zustimmung, sondern auch die Ablehnung bedarf guter ethischer Gründe, und deswegen sind wir hier beisammen.
Univ.-Prof. Dr. Rotraud Perner (Wiener Internationale Akademie für Ganzheitsmedizin): Ich möchte diese Gelegenheit nützen, zu sagen, aus welcher Position ich heute hier spreche: Ich spreche hier als Dozentin an der Akademie für Ganzheitsmedizin; Präsident ist Univ.-Prof. Dr. Stacher. Das ist die Trägerorganisation, die die Fortbildung der Ärzte in Ganzheitsmedizin durchführt. Ich unterrichte dort Methodik und Ethik. Ich spreche auch als langjährige Supervisorin von Ärzten und Pflegepersonen und habe vor allem immer dort mein Betätigungsfeld, wo juristische Fragestellungen mitspielen, weil ich im Ursprungsberuf Juristin bin. Ich bin eine multidisziplinär ausgebildete Psychotherapeutin und freue mich, den bis jetzt fehlenden psychotherapeutischen Blickwinkel einbringen zu können.
Ich beziehe mich auf meine eigenen Erfahrungen: Ich bin seit fast 40 Jahren beratend und therapeutisch tätig, unter anderen mit Komapatienten im Rahmen der AUVA, und habe mich sehr viel mit basaler Stimulation beschäftigt. Ich verstehe mich als Forscherin, als Gewalt- und Methodenforscherin. Gewalt definiere ich im Sinne von Johann Galtung als jedes Verhalten gegen den Willen einer anderen Person, das das Potenzial dieser Person schädigt.
Ich möchte mich in diesem Zusammenhang Herrn Professor Virt anschließen, der auf die Sprache aus psychotherapeutischer Sicht hingewiesen hat. Aus tiefenpsychologischer Sicht gibt es keine nicht zustimmungsfähigen Personen, sondern es gibt nur Personen, deren Widerstand von anderen nicht wahrgenommen wird, weil sie sich nicht die Zeit nehmen und die Wahrnehmung nicht verfeinern.
In diesem Zusammenhang möchte ich darüber informieren, dass wir im Psychotherapiebereich selbstverständlich bereits entsprechende Forschungen haben. Beim letzten Weltkongress vor drei Jahren hat die französische Psychoanalytikerin Dr. Anne Ancelin Schützenberger berichtet, dass auch Embryonen, Föten, die im Ultraschall beobachtet werden, deutliche Widerstandszeichen setzen, zum Beispiel, bei der Fruchtwasserentnahme in der 16. Schwangerschaftswoche. Diese Forschungen werden leider nicht betrieben, weil es keine finanziellen Interessen gibt; es werden jene Forschungen betrieben, mit denen man einen Markt aufbauen kann. Es wird nicht geforscht, wie wir zum Beispiel auch im Medizinbereich simulieren können, obwohl die Computertechnik da sehr viele Ansatzmöglichkeiten bietet. Darauf hinweisen möchte ich, dass wir unsere Augen nicht davor verschließen sollen, dass es auch andere Methoden gibt, als am lebenden Menschen zu forschen.
Schon Einstein hat das Wort geprägt, man kann die Dinge nur am Beobachter beobachten. Es ist eine Illusion zu glauben, es gäbe keine Eigeninteressen. Dass es nationale wirtschaftliche Interessen oder individuelle wirtschaftliche Interessen gibt, ist wohl allen klar: Es gibt aber auch Interessen, sich als Forscher zu profilieren; dieser Verlockung unterliegen wir alle. Und es gibt vor allem auch das Interesse, in Gruppenprozessen nicht als Außenseiter dastehen zu müssen – ein Problem, das Österreich offensichtlich im Augenblick international hat.
Aus psychotherapeutischer Sicht besteht ein Mensch nicht nur aus Denkprozessen, sondern auch aus Fühlprozessen, als Empfindungsprozessen und aus Intuitionsprozessen. Wir konzentrieren uns auf Intellektualität und Äußerungsfähigkeit – die anderen drei Bereiche werden ignoriert. Ich denke, dass es darum geht, sich darüber im Klaren zu sein, dass aus psychotherapeutischer Sicht Folgen eintreten, mit denen wir dann in unserer Arbeit konfrontiert sind.
Ich möchte das Geschwisterbeispiel hier ansprechen. Wir wissen aus der Arbeit mit Überlebenden von Katastrophen, wie schwer sie daran tragen, dass sie überlebt haben. Nicht berücksichtigt wird, was es für die Menschen bedeutet, die durch Spenden anderer am Leben gehalten werden. Auch das ist ein Aspekt, der unbedingt berücksichtigt gehört. Ich möchte daher davor warnen, vorschnell, unter Druck Entscheidungen zu treffen, die vor allem durch wirtschaftliche Interessen oder durch Gruppendruck motiviert sind.
Univ.-Prof. Dr. Jochen Taupitz (Universität Mannheim, Fakultät für Rechtswissenschaft): Dass Sie mich als deutschen Juristen eingeladen haben, hängt sicherlich damit zusammen, dass die Diskussion in Deutschland ganz ähnlich geführt wird wie in Österreich, soweit ich das verfolgt habe.
Ein paar Worte zu meiner Person. – Ich bin Jurist, wie ich gerade gesagt habe. Ich leite das Institut für Medizinrecht, Gesundheitsrecht und Bioethik der Universitäten Heidelberg und Mannheim. Ich bin Mitglied des deutschen Nationalen Ethikrates, der „Pendant“-Organisation zu Ihrer Ethikkommission. Ich bin Mitglied der Zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer und bin auch an vorderster Front der Ethikkommission der Universität Heidelberg tätig, die sich mit konkreten Forschungsvorhaben beschäftigt.
Zur Sache selbst ist nach so vielen hochkarätigen Wortbeiträgen natürlich nur noch wenig ergänzend zu sagen. Ich möchte deshalb auch ein wenig auf einige der Stellungnahmen der vor mir sprechenden Sachverständigen eingehen.
Es ist gefragt worden, ob eine Ratifikation der Konvention möglicherweise zu einem Verfassungsverstoß führt. Diese Frage ist gestellt worden aus dem Blickwinkel: verfassungswidrig, weil gegen die Menschenrechte der in die Forschung einzubeziehenden Einwilligungsunfähigen. – Aus meiner Sicht ist diese Frage so nicht richtig gestellt, denn da die Konvention, wie schon mehrfach ausgeführt wurde, nur Mindestschutzstandards enthält, ist kein nationaler Gesetzgeber durch die Konvention verpflichtet, irgendeine Regelung zu Lasten von Einwilligungsunfähigen in sein eigenes nationales Recht einzuführen.
Die Frage ist eher umgekehrt zu stellen – und sie wird in Deutschland mittlerweile auch sehr intensiv gestellt –: ob die Konvention beziehungsweise insbesondere das jetzt darauf aufbauende Forschungsprotokoll, das in einem ersten Entwurf vorliegt, nicht zur Verfassungswidrigkeit deshalb führen, weil die Forschungsfreiheit zu sehr beeinträchtigt wird. Die Forschungsfreiheit ist in beiden Verfassungen, in der österreichischen und in der deutschen, verankert, und es müssen tragfähige Gründe dafür sprechen, dass die detaillierten Verbote und Gebote, die sich in der Konvention beziehungsweise in dem Forschungsprotokoll ausschließlich gegen die Forschung richten, nur Mindestschutzstandards für die einwilligungsunfähigen und die übrigen Personen darstellen, aber insofern eben handfeste Forschungsverbote darstellen. Es ist also die Frage, ob sie verfassungskonform sind.
Noch einmal: Dadurch, dass die Konvention nur Mindeststandards enthält, ist kein Staat verpflichtet, irgendetwas zu Lasten von in die Forschung Einbezogenen zu tun.
Das Konventionspapier versucht sogar dem „Slippery-slope“-Argument, dem Argument der „schiefen Ebene“, des „ethischen Sogs“ gerecht zu werden, in dem es in Artikel 27 nicht nur heißt – wie es sonst in internationalen Regelwerken üblich ist –, dass nationale Regelungen unberührt bleiben, sofern sie einen höheren Schutzstandard enthalten, sondern das Konventionspapier sagt sogar darüber hinaus, dieses Übereinkommen darf nicht so ausgelegt werden, als beschränke oder beeinträchtige es die Möglichkeit einer Vertragspartei im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin, einen über dieses Übereinkommen hinaus gehenden Schutz zu gewähren.
Das ist ein gewisser Auslegungsimperativ – etwas völlig Ungewöhnliches! –, durch den verhindert werden soll, dass dieser „ethische Sog“, dieses Argument der „schiefen Ebene“ zum Tragen kommen kann.
Nächster Punkt: Die Schutzkriterien, die in der Konvention enthalten sind, wirken ja kumulativ zusammen. Es ist nicht so, dass das Kriterium „minimal risk“, „minimal burden“ das einzige Kriterium zum Schutz der Einwilligungsunfähigen ist, sondern es ist die Ethikkommission einzuschalten, es sind zahlreiche weitere objektive Kriterien einzuhalten, und insbesondere ist die Einwilligung des gesetzliches Vertreters erforderlich. In beiden Rechtsordnungen ist doch der gesetzliche Vertreter derjenige, der an Stelle des Einwilligungsfähigen entscheiden soll – selbstverständlich zu seinem Wohl entscheiden soll.
Aber wie weit das „Wohl“ zu fassen ist, sehen Sie alle, wenn Sie überlegen, welche große Entscheidungsfreiheit Eltern bezüglich ihrer Kinder haben. Ich glaube, dass die Eltern in Bezug auf das „normale“ Leben der Kinder, Schule und so weiter, sehr viel größere belastende Entscheidungen treffen können, als hier im Bereich der Forschung möglich ist, weil ja da zusätzlich das minimale Risiko beziehungsweise die minimale Belastung eine absolute Grenze einziehen. Dass innerhalb dieses wirklich minimal belastenden Bereichs eine Menschenwürdeverletzung vorliegen soll, leuchtet mir, ehrlich gesagt, nicht ein.
Gerade umgekehrt ist zu fragen – Herr Virt hat es bereits angesprochen –, ob es nicht eine Menschenrechtsverletzung der zahlreichen Kinder darstellt, die tagtäglich durch unverantwortliche medizinische Versuche zu Versuchskaninchen gemacht werden, weil nämlich die Medikamente nicht ausreichend und unter kontrollierten Bedingungen an ihnen getestet worden sind. Wenn zwischen 50 und 80 Prozent aller Arzneimittel nicht für Kinder zugelassen sind, dann bedeutet das, dass jeder „Feld-, Wald- und Wiesenarzt“, der ein Medikament einem Kind verschreibt, einen Heilversuch vornimmt, ohne dass er die Risiken – und das unterstelle ich einmal für viele Ärzte – wirklich überblicken kann. Man kann beim kindlichen Körper nicht einfach vom Gewicht her herabrechnen und sagen: halbe Größe, also halbe Dosis. Die kindlichen Reaktionen sind ganz anders als im erwachsenen Körper, sodass das aus meiner Sicht eine unverantwortliche Versuchsreihe ist, die letztlich in allen westlichen Staaten durchgeführt wird.
Die USA gehen übrigens inzwischen in eine ganz andere Richtung: Sie versuchen, die Forschung dazu zu veranlassen, mehr für die Minderjährigen-Forschung zu tun. Es gibt Patentvorteile, wenn sich Pharmaunternehmen bereit erklären, auf diesem Gebiet zu forschen.
Die Frage der Menschenrechtsverletzung kann aus beiden Blickwinkeln gestellt werden: Einmal natürlich und berechtigterweise aus dem Blickwinkel derjenigen, die in die Forschung einbezogen werden, aber auch genauso gut aus dem Blickwinkel derjenigen, die nicht von dieser Forschung profitieren, nicht von den kontrollierten Bedingungen der zuvor durchgeführten klinischen Versuche profitieren.
Frau Primig hat angeregt, dass auf internationaler Ebene doch stärker darüber diskutiert werden solle, inwieweit diese Menschenrechtskonvention vielleicht sogar über den Europarat hinaus wirken könnte. Wir haben in Heidelberg vor einiger Zeit eine große Tagung veranstaltet; Herr Kopetzki und andere in diesem Raum waren daran beteiligt. Gerade vor drei Tagen sind die Ergebnisse herausgekommen: 24 Landesberichte zeigen, dass diese Menschenrechtskonvention tatsächlich eher das Minimum dessen darstellt, was man auf der Welt endlich unbedingt einfordern sollte. In vielen Staaten herrschen so große Missstände, dass Europa da ein Signal aussenden sollte. In den meisten Ländern geht es nicht um die Frage, ob das zu wenig ist, was vorgeschlagen wird an Schutz, sondern ob es nicht zu strikte Regelungen sind zu Lasten der Forschungsfreiheit. Zahlreiche europäische Länder stehen deshalb abseits, weil sie sich den strengen Regeln dieser Konvention und später dann des Forschungsprotokolls nicht unterwerfen wollen.
Also: Nicht das Zuwenig ist das Thema dieser Konvention, sondern eher die Frage, ob da nicht zu strikte Regeln zu Lasten der Forschung eingezogen werden.
Fragerunde
Abgeordnete Dr. Helene Partik-Pablé (Freiheitliche): Zuerst einmal möchte ich mich bei allen Experten sehr herzlich bedanken. Ich glaube, Sie haben wesentlich dazu beigetragen, dass unser Wissensstand erweitert worden ist, wenngleich ich nicht allem beistimmen kann – aber das werden Sie wahrscheinlich ohnehin nicht erwarten.
Es ist uns heute schon mehr oder weniger klar von einigen Experten vor Augen geführt worden, dass wir Österreicher in Wirklichkeit gar nicht viel auf europäischer Ebene mitreden können, weil wir eben nur ein kleines Land sind im Verhältnis zu vielen anderen und weil ein Großteil dieser Bioethik-Konvention schon zugestimmt hat.
Meiner Überzeugung nach ist es notwendig, dass man auch auf Europaebene gerade das Thema Einwilligungsunfähige viel stärker diskutiert und jenen Ländern, die sich von Lobbys der Forschungsindustrie treiben lassen, klar macht, dass es eben nicht so selbstverständlich ist, alle diese Forderungen zu erfüllen.
Wir können möglicherweise nicht sehr viel ändern, was Zustimmungen und so weiter betrifft, aber wir können als Österreicher schon dazu beitragen, dass die Diskussion in Gang bleibt und es nicht selbstverständlich ist, dass man diese strengen Regeln nicht akzeptieren möchte, sondern – ganz im Gegenteil! – noch in eine ganz andere Richtung geht.
Im Übrigen finde ich die Ausführungen von Herrn Staatsanwalt Stormann auch sehr interessant, alle Argumente, warum man eigentlich zustimmen sollte, aber bezüglich des einen Geschwisterbeispiels kann ich Ihnen wirklich nicht Recht geben, denn die Knochenmarktransplantation muss ja nicht unbedingt von dem Geschwisterteil des Einwilligungsunfähigen gemacht werden, sondern da muss man eben nach einem anderen Knochenmarkspender suchen. Das war, finde ich, kein gutes Beispiel.
Ich akzeptiere den Forschungsbedarf und auch die Notwendigkeit, Medikamente zu testen und so weiter – habe aber noch nie gehört, dass diese Konvention die Pharmaindustrie dazu bringen würde, Medikamente besser auszutesten oder dahin gehend, ob diese überhaupt kinderadäquat sind. – Jedenfalls meine ich, dass diese Frage auf Europaebene thematisiert werden muss, insbesondere was die Einbindungsfähigkeit betrifft.
Weiters würde mich interessieren, ob die Experten – unabhängig von den Artikeln 17 und 20 – nicht eine Gefahr darin sehen, dass es in dieser Konvention eine Unzahl unbestimmter Begriffe gibt. Es ist zum Beispiel darauf hingewiesen worden, dass es eine Ethikkommission gibt, in der von ungebührlicher Einflussnahme und so weiter gesprochen wird. Was ist eine „ungebührliche Einflussnahme“? Solch unbestimmte Begriffe führen zu dem Ergebnis, dass die notwendige Rechtssicherheit nicht gewährleistet ist, sondern ein übergroßer Interpretationsspielraum erlaubt wird.
Abgeordnete Theresia Haidlmayr (Grüne): Wir Grünen fordern, dass die Bestimmungen, sollte es zu einer Ratifizierung kommen, selbstverständlich in Verfassungsrang zu heben sind. Vor einer Ratifizierung müssten jedenfalls die österreichischen Schutzbestimmungen ebenfalls durch ein Verfassungsgesetz abgesichert werden. Herr Dr. Kopetzki hat gesagt, es sei niemand verpflichtet, die höheren Standards herunterzubrechen. – Natürlich ist niemand dazu verpflichtet, aber es ist jeder berechtigt, das zu tun, und es geht darum, dass niemand so leicht die Berechtigung erhält, diese Standards auf Kosten einwilligungsunfähiger Personen nach unten zu revidieren.
Wogegen wir uns aussprechen, ist die fremdnützige Forschung an einwilligungsunfähigen Personen. Das muss klar herauskommen!
Wir werden alles tun, damit es in Österreich eben nicht dazu kommt, dass zum Beispiel Menschen mit einer geistigen Behinderung für wissenschaftliche Zwecke herangezogen werden. Das darf nicht passieren, dagegen werden wir uns daher wehren! Wir wollen auch, dass ein Medizinforschungsgesetz verabschiedet wird, das entsprechend hohe Schutzbestimmungen vorsieht, also entsprechende Regelungen trifft.
Erst dann, wenn all diese Punkte in österreichischen Gesetzen geklärt sind, können wir uns über eine Ratifizierung eines Biomedizingesetzes unterhalten. Vorher kommt dies für uns nicht in Frage!
Abgeordnete Edeltraud Gatterer (ÖVP): Einserseits muss es die Bemühung geben, zu europäischen Standards zu kommen, woran wir alle arbeiten müssen – andererseits sind jedoch auch die Ängste der Leute, vor allem auch der Einbringer dieser Petition, ernst zu nehmen.
Ich kann das, was Kollegin Haidlmayr gesagt hat, nur unterstützen: Die fremdnützige Forschung soll bei einwilligungsunfähigen Personen ausgeschlossen werden. Es geht in diesem Fall aber auch um andere Punkte; so zum Beispiel nützt diese Forschung auch Erkrankten.
Eine Frage an die Experten: Wie könnte man „minimal burden/minimal risk“ besser beschreiben, eventuell an einigen konkreten Fällen? Das wäre meiner Ansicht nach schon wichtig, um eben Ängste, die es unbestrittenerweise gibt, zu nehmen. Das war auch die Motivation für uns, ein Hearing über Parteigrenzen hinweg abzuhalten, weil wir eben alle mit diesen Ängsten konfrontiert sind.
Herr Dr. Stormann, vielleicht könnten Sie noch einmal Folgendes konkretisieren: Wie ist die Rechtslage jetzt, wenn es eben in genau dieser Gruppe der nicht zustimmungsfähigen Personen, der Kinder, der Personen mit Altersdemenz oder geistiger Behinderung, einen Krankheitsfall gibt? Wir bekennen uns alle dazu, dass es gerade für nicht zustimmungsfähige Personen zu keiner Verschlechterung kommen darf. Wir wollen gemeinsam mit den Gruppen, die eben diese Befürchtungen haben, zu einer Regelung kommen, dass wir sagen, das können wir gesetzlich festschreiben, das können wir zusichern.
Es ist auch gesagt worden, dass es nicht nur die Gefahr nach Artikel 17 gibt, was viele befürchten, sondern auch die Gefahr, dass wir, wenn wir nicht ratifizieren und uns eben nicht zu dieser Konvention bekennen, im Grunde die Türe öffnen für verschiedene Forschungen, die wir eigentlich überhaupt nicht wollen. Vielleicht könnten Sie, Herr Professor Kopetzki, dazu noch Näheres ausführen und dazu, welche Gesetze zum Beispiel in Österreich erlassen werden müssten, die durchaus Verschärfungen bedeuten würden.
Was die Kinder betrifft, muss ich sagen, es ist ja Eltern überhaupt nicht bewusst – und ich habe erwachsene Kinder –, dass unsere Kinder im Grunde genommen fast keine Medikamente erhalten, die für sie zugeschnitten sind. Ich weiß leider von traurigen Fällen bei Alkoholismus bei Kindern, dass Alkoholkonsum bei Kindern ganz andere Auswirkungen hat als zum Beispiel beim Erwachsenen. In meinen Augen ist, was die Frage der Medikamente betrifft, großer Handlungs-, aber auch Aufklärungsbedarf gegeben.
Abgeordnete Mag. Barbara Prammer (SPÖ): Als sozusagen gemeinsamen Tenor habe ich aus den Ausführungen herausgehört, dass es ganz wichtig ist, dass gerade bei diesen neuen Technologien große Transparenz und Informiertheit gegeben sind. Schlimm ist es, wenn Menschen uninformiert sind, denn dann entstehen Vermutungen und auch Vorurteile. Dies führt dann wahrscheinlich auch zu Verhaltensweisen, die vielleicht in die eine oder andere Richtung gehen und wahrscheinlich auch nicht logisch sind.
Da möchte ich eine Frage anknüpfen und diese ganz gezielt an die beiden Vertreter des Sozialministeriums richten. Es ist zwar von Ihnen beiden gesagt worden, es werde die Ratifizierung der Konvention abgelehnt, wenn nicht gleichzeitig der Status quo in den Verfassungsrang erhoben werde, aber ich frage schon auch, wo die Vorschläge für eine Verbesserung des österreichischen Rechts sind. Es wurde auch von mehreren Expertinnen und Experten gesagt, dass es nicht nur darum geht, dass wir in Österreich den Status quo beibehalten, sondern dass es im Falle einer Ratifizierung durchaus auch zu Verbesserungen in einzelnen Gesetzesmaterien kommt.
Mich würde in erster Linie interessieren, wie die Bundesregierung jetzt ganz konkret in dieser Sache weiter vorgehen will, welchen Beschluss sie fassen wird und in welchem Zeitraum der Nationalrat damit wieder konfrontiert werden wird.
Eine zweite Frage: Was bedeutet letztendlich eine Nichtratifizierung? Wie würde ein österreichischer Weg ohne Ratifizierung weitergehen?
Abgeordneter Dr. Alois Pumberger (Freiheitliche): Wenn man weiß, dass die Experten aus den verschiedensten Fachbereichen kommen – von der Wissenschaft bis zur Moraltheologie sind alle Fachbereiche vertreten – und dass trotzdem eine einhellige Stellungnahme in Richtung Befürwortung der Ratifizierung abgegeben wurde, kann man daraus zweifellos schließen, dass viele Kompromisse eingegangen wurden. Ich hoffe, dass sich die Kompromisse nicht in dem einen Satz, den Professor Virt gesagt hat, zusammenfassen lassen: Ein Nichtbeitritt zu dieser Konvention würde kein gutes Bild auf Österreich werfen, da Österreich abseits stehen würde. Auch Bischof Körtner war dafür.
Wir haben auch schon über biomedizinische Angelegenheiten diskutiert: Stammzellenforschung, Präimplantationsdiagnostik, Embryonalstammzellen und so weiter. Da sind so viele Probleme – auch in dieser Konvention – angesprochen, die man schwer unter einen Hut bekommt, worüber wir noch eingehend diskutieren müssen. Es handelt sich um viele Begriffe, die vielen nicht ganz klar sind. Auch ich als Mediziner musste mich einlesen und kann noch immer nicht behaupten, dass ich mich überall auskenne. Die Entwicklung geht gerade auf europäischer Ebene rasant weiter. Meiner Meinung nach würden wir uns schwer tun, in kurzer Zeit einen Beschluss zu fassen. Das bedarf sicher noch eingehender Diskussionen auch auf Regierungsebene.
Ich habe gehört, dass heute sowieso kein Beschluss gefasst werden soll, vielleicht auch noch nicht am 4. Juli. Ich weiß selbst noch nicht genau, wie die weitere Vorgangsweise sein wird. Meiner Ansicht nach eilt es auch nicht. Es wäre auch keine Zeit verloren, würden diese Diskussionen auch im Sommer fortgesetzt.
In der Konvention finden sich teilweise auch Allgemeinplätze. So findet sich in Artikel 3 zum Beispiel der Passus: „gleicher Zugang zu Gesundheitsleistungen“. – Wenn alle Mitgliedstaaten des Europarates den Passus aufnehmen sollten: „... unter Berücksichtigung der medizinischen Erfordernissse un der verfügbaren Ressourcen geeignete Maßnahmen ... zu Gesundheitsleistungen von angemessener Qualität“ usw., dann, muss ich sagen, handelt es sich da um Allgemeinplätze, die unter dem Strich überhaupt nichts aussagen.
Wir haben in Österreich gute Standards. Wenn jetzt alle 43 Mitgliedsländer unter einen Hut gebracht werden, dann fürchte ich, dass wir zum Schluss unter Druck gesetzt werden könnten, unseren Standard zu senken, was wir nicht möchten.
Abgeordnete Mag. Dr. Maria Theresia Fekter (ÖVP): Die überwiegende Zahl der Experten hat sich dafür ausgesprochen, dass die besseren österreichischen Bestimmungen verfassungsrechtlich abgesichert werden sollten. Ohne Zustimmung der Sozialdemokraten gibt es allerdings gar keine Verfassungsbestimmung. Daher ist die Frage nicht an die Bundesregierung zu richten, sondern an Kollegin Prammer, wie weit die SPÖ einer Verfassungsbestimmung überhaupt ihre Zustimmung geben würde. Frau Kollegin Wurm, diesbezüglich habe ich noch keine Signale von sozialdemokratischer Seite erhalten.
Auch ich bin der Meinung, dass man sich das sehr genau anschauen muss im Hinblick auf die Absicherung der besseren Standards in Österreich und im Hinblick auf eine Verfassungsbestimmung.
Herr Dr. Virt und auch Frau Primig haben gesagt, dass man bezüglich einwilligungsunfähiger Personen wesentlich besser differenzieren muss, als das die Konvention macht, nämlich im Hinblick auf Kinder, Notfall, Demente, psychisch Behinderte et cetera. Herr Dr. Virt, es ist mir nicht klar, worin diese differenzierte Betrachtung bestehen soll, denn wenn man die Kriterien Individualnutzen, Gruppennutzen, Fremdnutzen als Differenzierungsmerkmale nimmt, dann muss das doch wieder für alle Gruppen gelten. Könnten Sie bitte erläutern, worin diese Differenzierung bestehen soll.
Eine Frage an die Experten, die in den EU-Gremien sitzen, Dr. Virt oder Dr. Stormann: Wie ist die Diskussion auf EU-Ebene? Würde uns die Konvention vor Dingen schützen, wo in Österreich Konsens herrscht, dass wir nicht unter einen gewissen Standard gehen wollen?
Eine Frage bezüglich der Zusatzprotokolle – es wurden die beiden bereits in Kraft stehenden erwähnt, nämlich das Klonverbot- und Transplantations-Zusatzprotokoll; ebenso erwähnt wurde, dass die medizinische Forschung das Nächste ist, was kommen wird, aber es sind derzeit auch noch andere in Diskussion bezüglich des Gesamtwerkes –: Welche Protokolle werden da in welche Richtung auch noch derzeit diskutiert, wo wir dann nicht in dem Ausmaß dabei sind, wo es vielleicht aus unserer Sicht dringend notwendig wäre, uns da hineinzureklamieren?
Gesagt wurde auch, dass wir doch in vielen Bereichen Handlungsbedarf haben, wo unser Schutzniveau wesentlich geringer ist als jenes in der Konvention. Das heißt, wenn Österreich diese Konvention nicht ratifiziert, müssten wir uns schleunigst auf den Weg machen, Schutzmechanismen zu verbessern. Vielleicht kann mir ein Experte sagen, wo wir diesbezüglich den größten Handlungsbedarf haben.
Abgeordnete Mag. Christine Lapp (SPÖ): Auf der einen Seite geht es darum, Gesetzeslücken zu schließen. Die Differenzierung für unterschiedliche Personengruppen ist auch ein wesentlicher Bestandteil. Dass die Schutzbestimmungen, die wir in Österreich haben, abgesichert werden sollen, ist meiner Meinung nach auch ein konkreter Handlungsvorschlag, dem wir als GesetzgeberInnen schleunigst nachkommen sollten.
Mich würde interessieren: Was wurde in der Bioethik-Kommission beim Bundeskanzleramt vereinbart? Wie wird mit den unterschiedlichen Darstellungsweisen und Haltungen weiter umgegangen? Oder ist es so, dass es den Beschluss gegeben hat, dass ratifiziert werden soll, wodurch die Diskussionen an einem Ende angelangt wären?
Abgeordneter Manfred Lackner (SPÖ): Frau Kollegin Fekter, der elegante Versuch, das Gesetz des Handelns der Opposition zuzuschieben, war sehr nett, aber ich meine, in dieser Sache wäre jetzt die Bundesregierung gefragt. (Abg. Dr. Fekter: Legt etwas vor! Was ist mit der Verfassungsbestimmung? – Seid ihr dafür?) Wenn die Position der Bundesregierung klar ersichtlich ist, dann können wir uns darüber unterhalten. Aber so kann es nicht sein, dass die Opposition jetzt anfängt, die Arbeit für die Bundesregierung zu machen!
Herr Professor Kopetzki hat bereits angeführt, dass am 11. Februar 2002 die Bioethik-Kommission empfohlen hat, dass auch Österreich der Biomedizin-Konvention des Europarates beitreten möge – und er hat eine Reihe von Gründen angeführt, die dazu geführt haben, dass dieser Beschluss in der Bioethik-Kommission einstimmig gefallen ist: europaweite Mindeststandards, Verbesserung des österreichischen Schutzniveaus und dergleichen.
Herr Professor Kopetzki: Hat es neben den von Ihnen angeführten Gründen auch noch andere gegeben, dass dieser durchaus erfreuliche einstimmige Beschluss zustande gekommen ist?
Mich würde weiters interessieren – weil heute immer wieder gerade das stärkere österreichische Recht im Hinblick auf Artikel 17 und 20 zur Sprache gekommen ist –, ob Sie Möglichkeiten sehen, dieses stärkere österreichische Recht so abzusichern, dass in dieser Richtung nichts passieren kann.
Obfrau Mag. Gisela Wurm: Herr Professor Kopetzki, Sie waren es, der die Arzneimittel-Richtlinie, die EU-Recht wird, erwähnt hat – und auch, dass da schon Mindeststandards mehr oder weniger ins österreichische Recht fließen werden bzw. geflossen sind. Meine Frage dazu: Was ist da auf EU-Ebene schon in Vorbereitung, was kommt da noch auf uns zu?
Antworten der Experten
Leitender Staatsanwalt Dr. Michael Stormann (Bundesministerium für Justiz): Das Übereinkommen ist ein völkerrechtlicher Vertrag, und dieser ist inhomogen. Er hat teilweise Bestimmungen, die sehr generell sind, die so generell sind, dass man mit ihnen relativ wenig anfangen kann – enthält aber auch Bestimmungen, die oft ungeheuer diffizil und differenziert sind. Eine derartige Bestimmung eignet sich natürlich nicht dazu, unmittelbar angewandt zu werden, denn zu generelle Regelungen könnte man nicht in das österreichische Recht transformieren; das würde dem Bestimmtheitsgebot widersprechen.
Andererseits: Zu detaillierte Regelungen eignen sich wieder nicht zur Transformation in Verfassungsrang, weil dann diese Details auf der höchsten Normstufe des Staates „verewigt“ würden. – Das heißt, hier müsste man eine gewisse Selektion betreiben, was man wirklich auf Verfassungsebene haben möchte.
Die Interpretation des Übereinkommens ist natürlich nicht dem einzelnen agierenden Forscher, dem einzelnen agierenden Arzt überlassen, sondern das Übereinkommen ist ein völkerrechtlicher Vertrag. Ich würde fast sagen: Lesen durch Praktiker verboten – lesen in diesen Hallen dringend erwünscht! Es richtet sich eigentlich an die Gesetzgeber der Mitgliedstaaten.
Primär ist daher natürlich die Regel des Völkerrechts zu beachten, dass die Staatenpraxis der Mitgliedstaaten für die Interpretation maßgeblich ist, aber – und dieses Aber ist ein ganz wichtiger Punkt, meine Damen und Herren! – es handelt sich um ein Europaratsübereinkommen, und bei einem solchen steht uns als eine der wichtigsten Einrichtungen europäischer Rechtsentwicklung der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte zur Verfügung.
Es ist bei diesem Übereinkommen Sache des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte, angerufen von einem Mitgliedstaat, Interpretation zu bestimmten Fragen zu geben. – Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Das ist vielleicht auch einer der Punkte, wo eine Abänderung des Übereinkommens möglicherweise zielführend sein könnte oder vielleicht sogar noch eine Verschärfung des Übereinkommens im Zusatzprotokoll zielführend sein könnte, nämlich die bereits im Bereich der Rechtsdurchsetzung auf dem Gebiet der Menschenrechte übliche Direktanrufungsmöglichkeit des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte.
Eine Direktanrufungsmöglichkeit sieht dieses Übereinkommen jedoch deshalb nicht vor, weil es in einer Phase geschaffen wurde, in der der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Umorganisation begriffen war und man keine Entscheidung treffen konnte, mit der man ihn mit weiteren Aufgaben belastet – außer eben mit der Interpretation. – Jetzt aber, nach der Umorganisation, lässt sich die Frage der Einzelbeschwerdemöglichkeit durchaus wieder relevieren.
Ganz wichtiger Punkt: Dieses Übereinkommen richtet sich an die Mitgliedstaaten, es ist durch nationale Gesetze zu erfüllen.
Daher: Österreich kann gar nicht diesem Übereinkommen beitreten, ohne seine nationalen Gesetze zumindest auf jenen Stand zu bringen, den das Übereinkommen vorsieht. Ich darf dazu etwas ganz Wichtiges sagen: Auf dem Forschungssektor haben wir – auf Grund des Staatsgrundgesetzes – die von Herrn Professor Taupitz bereits dargelegte Forschungsfreiheit. Das Übereinkommen sieht aber vor, dass jedes Forschungsvorhaben nicht nur von einer Ethikkommission überprüft wird, sondern auch von einer zuständigen Behörde zu genehmigen ist.
Meine Damen und Herren! Vorzensur für Forschungsvorhaben ist in diesem Übereinkommen kodifiziert. Wir müssten es im nationalen Recht umsetzen. Es geht also gar nicht nur um die Lückenfüllung, sondern es geht auch um die – verkürzt ausgedrückt – Einführung von Verbotsregelungen, die wir derzeit dort, wo Ethikkommissionen agieren, nicht haben. In bestimmten Bereichen – im Arzneimittelrecht, im Gentechnikrecht, im Medizinprodukterecht – gibt es behördliche Befugnisse, die auf eine Verbotsregelung hinauslaufen, in anderen Bereichen jedoch nicht.
Und dann gibt es die Lückenfüllung. Österreich ist ein Staat mit einem ungeheuer großen Anteil am Alpinsport. Die Forschung der Erstversorgung im Akja ist in Österreich überhaupt nicht gesetzlich geregelt. Wir müssten da eine Lücke füllen.
Dann ein anderer Punkt, und da, glaube ich, muss man schon vorsichtig sein: Forschung an Einwilligungsunfähigen ist in der Tat in dem Übereinkommen und im Zusatzprotokoll auf den ersten Blick nicht differenziert. Es zeigt sich aber bei der Entwicklung des Zusatzprotokolls Forschung, dass die Forschung in Notfallsituationen – Forschung mit Wiederbelebungsgeräten und ähnlichen Dingen – anders zu sehen ist als die Forschung, die, verkürzt ausgedrückt, nicht unter diesem Zeitdruck steht, mögen auch die Gruppierungen Einwilligungsunfähige in ihrer rechtlichen Definition auf den ersten Blick gleich ausschauen, denn bei den anderen Forschungen kann man ja eine Zustimmung einholen.
Was das österreichische Recht anlangt: Das Arzneimittelgesetz sagt – damit komme ich auf eine Frage von Frau Abgeordneter Gatterer –, dass im Zuge einer Notfallforschung derartige Patienten „in eine Studie einbezogen werden dürfen“; ich zitiere das ausdrücklich. Das gibt Anlass zu Interpretationen: Der eine Teil der österreichischen Lehre sagt: Ja, die können in die Studie einbezogen werden, das heißt, sie dürfen wissenschaftlich sozusagen beforscht werden, natürlich nur, wenn der gesetzliche Vertreter eingewilligt hat. Wie die Leute das rasch genug zustande bringen, das will ich einmal sehen. Das heißt also in Wirklichkeit, das kann nicht stattfinden. – Andere wiederum meinen, die Worte „dürfen in eine Studie einbezogen werden“ stellten eine gesetzliche Erlaubnis der Notfallforschung im Arzneimittelrecht dar.
Das heißt, da wäre es vielleicht dann an der Zeit, Klarheit zu schaffen. Im Medizinproduktegesetz, dem nächstfolgenden Gesetz, hat man diese Frage ausgeklammert. Man hat die Notfallforschung mit Medizinprodukten in Österreich nicht mehr eröffnet, was allerdings auch bedauert wird.
Was die fremdnützige Forschung an Einwilligungsunfähigen betrifft: Ich habe Ihnen klar gesagt, ich kann mich als Dogmatiker des österreichischen Handlungsfähigkeitsrechts in keiner Weise einer Forschung an Einwilligungsunfähigen, die diesen individuell nichts bringt, öffnen. Das ist über die Dogmatik österreichischen bürgerlichen Rechts nicht möglich. Man müsste da Änderungen treffen.
Aber Sie müssen natürlich berücksichtigen, dass zum Beispiel ein Forschungsprojekt, das sich bloß mit der Frage befasst, wie groß die körperliche Belastung bei Übergabe eines Kindes in eine Pflegeeinrichtung ist, bei Abnahme eines Kindes durch Bedienstete der Jugendwohlfahrt – es soll also die körperliche Belastung gemessen werden, vielleicht auch die psychische, wie Frau Professor Perner gesagt hat –, dem einzelnen Kind gar nichts bringt, denn die Abnahme findet so statt, wie sie geplant war. Man will nur herausfinden, ob sie eine Blutdrucksteigerung haben, ob sie psychisch erregt sind. – Das ist also eine – nach der Definition und unserer Sprachregelung – fremdnützige Forschung.
Dieses Forschungsvorhaben wäre, wenn wir in Österreich zu unserem Grundsatz stehen, dass wir Forschungen an Einwilligungsunfähigen nur zulassen, wenn sie auch zum Individualnutzen des Betreffenden ist, gar nicht möglich, obwohl die Blutdruckmessung nach Auffassung aller Experten eindeutig nur „minimal risk“ und „minimal burden“ wäre.
Ich will nicht sagen, dass man diese Forschung öffnen sollte. Ich habe schon gesagt, das geht nach derzeitiger Rechtslage nicht. Andere Staaten meinen, man sollte sich das positiver ansehen.
Frau Abgeordnete Haidlmayr sagte etwas, was ich für die Widerstandsfront für sehr essentiell halte: Wir wollen nicht, dass die Behinderten sozusagen zu Forschungsobjekten werden! – Sowohl die Konvention als auch das Zusatzprotokoll arbeiten mit einem System der Subsidiarität. Die nicht eigennützige Forschung an Einwilligungsunfähigen steht unter einer doppelten Subsidiarität: Forschung an Menschen nur dann, wenn andere, gleich effektive Forschung – etwa Forschung an Geweben –, nicht zur Verfügung steht. Das ist die erste Subsidiaritätsregel. Die zweite Subsidiaritätsregel: Forschung an Einwilligungsunfähigen nur dann, wenn für diese Forschung eine gleich effektive Forschung an nicht Einwilligungsunfähigen nicht möglich ist.
Damit ist nicht gemeint, dass sich keiner finden würde, der da einwilligt, weil das zu riskant ist, sondern damit ist nur gemeint, dass das konkrete Forschungsprojekt voraussetzt, dass da Einwilligungsunfähige tätig sind, dass das eben eine Forschung ist, die geistig behinderten Menschen zugute kommt, die nur an ihnen gemacht werden kann.
Das heißt, sie sollen nicht zu „Versuchskaninchen der Nation“ gemacht werden, sondern es soll an ihnen Forschung ermöglicht werden, und zwar geht es da um Grundlagenforschung. Das sind nach dem „minimal risk/minimal burden“-Konzept Blutdruckmessungen, geringfügige Blutentnahmen bei Erwachsenen, zusätzliche Kleinmengenblutentnahmen bei kleinen Kindern – oder etwa die Röntgenaufnahme.
Das ist sozusagen der gemeinsame Nenner, zu dem man sich derzeit im Leitungskomitee durchgerungen hat, und das ist in der deklassifizierten Fassung des Erläuternden Berichtes nachzulesen.
Wie gesagt: In Österreich würde nach derzeitiger Rechtslage nicht einmal das zugelassen werden. Daher müssen wir vorsichtig sein, das Übereinkommen, insbesondere die Artikel 17 und 20, in den Verfassungsrang zu transformieren, denn damit würden wir die Erleichterungen, die darin vorgesehen sind und die ja hinter unserem Schutzniveau stehen, kodifizieren. Das heißt, wir müssten, wenn man es wirklich ernst angeht, ein höheres Schutzniveau, nämlich das derzeitige, kodifizieren, weshalb ich eigentlich dafür wäre, nicht den Verfassungsrang zu wählen.
Der Verfassungsrang hätte aber – und das möchte ich jetzt sehr zynisch sagen – einen ganz wesentlichen Vorteil, denn wir haben, ich würde fast sogar sagen, noch in stärkerer Weise als Deutschland einen „verfassungsrechtlichen Schutz der Forschung“: Die Transformation auf Verfassungsrang würde die von mir bereits erwähnte Vorzensur problemfreier ermöglichen. Das heißt, würden wir dem ganzen System überhaupt beitreten wollen, dann müssten wir gleichzeitig mit der Ratifikation nationale Gesetze in Kraft setzen, die schon vorher vorbereitet werden müssten, um das Übereinkommen überhaupt anwenden zu können. Diese Gesetze müssten unter Umständen sogar Verfassungsrang haben, weil sie auf eine Einschränkung der Forschungsfreiheit hinauslaufen.
Ich könnte mir vorstellen, dass man folgende Vorgangsweise wählt: Man arbeitet zunächst auf den ministeriellen Ebenen die entsprechenden Gesetze aus, die zur Anpassung in Österreich erforderlich sind, unter Einbeziehung der betroffenen Gruppierungen. Die Bundesregierung legt dann dem Nationalrat in einem Zug jene Gesetzentwürfe, die entwickelt worden sind, vor, zusammen mit den Übereinkommen und den bis dahin fertigen Zusatzprotokollen. Gleichzeitig mit diesem Vorlagebeschluss an den Nationalrat könnte in der Bundesregierung der Beschluss auf Unterzeichnung fallen. Unterzeichnung heißt nicht, dass man beitritt: Unterzeichnung ist bloß die völkerrechtlich völlig unbeachtliche Erklärung, dass man zum Geist eines Übereinkommens steht, dass man es vielleicht einmal ratifizieren möchte. – Der Nationalrat könnte dann in einem Gesamtpaket sowohl die nationalen Aus- und Durchführungsgesetze als auch die Ratifizierung des Übereinkommens und der Zusatzprotokolle beschließen.
Was die Vorgangsweise der Bundesregierung betrifft, darf ich Folgendes sagen: Es ist in der Vergangenheit, und zwar jetzt schon vor einigen Jahren, zwischen den beteiligten Ressorts eine Grundsatzeinigung erzielt worden, die wie folgt aussieht: Im Hinblick auf bestimmte Ablehnungsmomente gegen Teile des Übereinkommens wird zunächst in Österreich die Frage der Unterzeichnung, also, wie gesagt, jenes völkerrechtlich nicht besonders beachtlichen Aktes, gar nicht releviert, sondern es wird zunächst in den Zusatzprotokollen auf eine Erhöhung des Schutzstandards gedrungen, was nicht ganz einfach ist, aber ich habe den Eindruck, dass das gelingt. – Und erst dann, wenn eine absehbare Menge von Zusatzprotokollen fertiggestellt wird und man sozusagen den Nutzen sieht, geht man an jene Überlegung, die überhaupt zur Unterzeichnung erst führt; und das ist der Weg, den ich vorhin dargestellt habe.
Zur Frage: Welche Zusatzprotokolle sind weiter in Ausarbeitung? – Weiter in Ausarbeitung ist ein Zusatzprotokoll, dass das Zusatzprotokoll über medizinische Forschung ergänzen soll. Die derzeitigen Arbeiten am Zusatzprotokoll über medizinische Forschung umfassen ja nur, verkürzt ausgedrückt, die Arbeit am Menschen, die Arbeit am Fötus, die Arbeit am lebenden Menschen, nicht aber die heute sehr bedeutende Forschung an Daten – denken Sie an die ungeheure Quantität von Krankengeschichten! – und auch die Forschung an Geweben. Denken Sie etwa daran, dass in Österreich ein hoher Prozentsatz aller Menschen obduziert wird und daher eine ungeheure Quantität von Gewebsproben lagert; ein weites Forschungsfeld. Auch da wären, meine ich, Regelungen dringend erforderlich; es gibt jetzt so gut wie kaum welche dafür.
Weiters ist in Ausarbeitung ein Zusatzprotokoll über Genforschung, Forschung am Genom; ebenso ein Zusatzprotokoll über menschliches Embryo und Fötus; da werden auch Grundaussagen zur Fortpflanzungsmedizin zu erwarten sein.
Eines lässt sich jetzt schon sagen: Die Arbeiten – das wirft sich das Komitee leider selbst immer wieder vor – werden permanent von der wissenschaftlichen Forschung überholt. Das heißt, es könnte durchaus der Fall eintreten, dass in den nächsten ein, zwei Jahren weitere Pläne zu weiteren Zusatzprotokollen gefasst werden, sodass unser österreichisches Konzept, das zunächst einmal darauf abgestellt war, alle Zuatzprotokolle abzuwarten, nicht eingehalten werden kann, weil seit der Fassung des Grundkonzeptes zwischen den beteiligten Ressorts immerhin zwei weitere Zusatzprotokolle in der Arbeit kreiert worden sind, nämlich das Zusatzprotokoll über Klonen, das es seinerzeit noch gar nicht gegeben hat, weil „Dolly“ noch nicht da war; das hat wirklich die gesamte Fachwelt überrascht. Und der Plan eines Zusatzprotokolles über Forschung an Daten und Geweben war auch noch nicht vorhanden.
Das heißt, die Entscheidung, die letztlich – das ist ein ganz wichtiger Punkt! – der österreichische Gesetzgeber zu treffen hat, wird vermutlich in irgendeiner Weise mit einem Gesetzesbeschluss in Zusammenhang stehen, der im Verfassungsrang steht. Egal, ob es um Transformation im Verfassungsrang, um Einschränkung der Forschungsfreiheit im Verfassungsrang oder um Sonderregelungen im Verfassungsrang geht: Es wird kein Weg an einer Verfassungsbestimmung vorbeiführen – es sei denn, wir unterschreiten bei der Ratifikation des Übereinkommens das Schutzniveau des Übereinkommens und erklären Vorbehalte.
Ratifiziert Österreich nicht auf Verfassungsebene, erklären sich nicht auch Teile von Nichtregierungsparteien mit dem Konzept einverstanden, dann könnten die Regierungsparteien unter Umständen keine andere Wahl haben, als Vorbehalte zum Übereinkommen zu erklären. Aber bitte Vorbehalte sind nicht Rügen am zu niedrigen Schutzniveau, sondern sind Erklärungen eines Staates, nicht einmal ein bestimmtes Schutzniveau, das im Übereinkommen vorgezeichnet ist, in einem bestimmten Punkt einhalten zu wollen.
Und das sollte meines Erachtens aus zwei Gründen vermieden werden: erstens, weil wir in Österreich zu einem hohen Schutzniveau stehen – und andererseits, weil ich glaube, dass ab einem solchen Moment die Verhandlungsposition der österreichischen Delegation einfach unmöglich würde, denn wir können nicht auf Hochniveau verhandeln und dann desavouiert uns der nationale Gesetzgeber, indem er sagt: Aber jetzt müssen wir unter das Schutzniveau herunter! Entschuldigen Sie, dass ich das sehr lapidar sage, aber es ist so.
Univ.-Prof. Dr. Günter Virt (Bioethik-Kommission beim Bundeskanzleramt): Es werden auch in der internationalen ethischen Literatur vier verschiedene Gruppen von Nützlichkeit unterschieden.
Das eine ist der individuelle Nutzen, ein therapeutischer Versuch. Ich glaube, darüber besteht ja auch Übereinstimmung.
Die zweite Gruppe wären Personen, vor allem Kinder, aber auch andere, die nicht unmittelbar in den Genuss der Forschung kommen, aber selbst, persönlich vielleicht in Zukunft in den Genuss des Forschungsergebnisses kommen. Also: künftiger Nutzen.
Die dritte Gruppe wären solche, die selber in Zukunft wahrscheinlich nicht in den Nutzen dieser Forschung kommen, sondern die Gruppe der Gleichaltrigen; die Kinder in diesem frühen Alter würden dann in den Genuss dieser Forschung kommen. Also: die Gruppennützlichkeit.
Das Vierte wäre dann die wirkliche Fremdnützlichkeit. Die Fremdnützlichkeit der Forschung wird in Artikel 17 ausdrücklich ausgeschlossen. Es gibt keine absolute fremdnützliche Forschung in der MRB. Aber es wird eben die zukünftige Nützlichkeit als eine Begründung in Artikel 17 – und die Gruppennützlichkeit eröffnet.
Die zweite Einschränkung, die Dr. Stormann schon genannt hat, die Frage: Was ist denn nun „minimal burden/minimal risk“? Ich glaube, es besteht Einhelligkeit darüber, dass die normalen Überlegungen bei Zustimmungsfähigen in einer Ethikkommission: Je höher der Nutzen, desto höher kann auch das Risiko sein!, hier auf keinen Fall gelten dürfen; da besteht Einhelligkeit. Es darf also ein minimales Risiko auf keinen Fall überschritten werden. Nun stellt sich die Frage: Wer bestimmt das minimale Risiko? – Das Zusatzprotokoll in der Nummer 97 hat da eine ganze Liste exemplarisch aufgezählt: Erhebung von Daten durch Befragen, Beobachten, Messen und Wiegen – das alles dürfte man sonst auch nicht –, Gewinnen von Körperflüssigkeiten ohne invasive Intervention, Speichel-, Urinproben, Abstriche und so weiter, Entnehmen von kleinen Gewebsproben, wenn für eine medizinische Intervention ohnedies bereits eine Gewebsprobe entnommen wird. Weiters: Blutprobe aus einer peripheren Vene oder Entnehmen einer Blutprobe aus Kapillargefäßen, Entnehmen einer kleinen zusätzlichen Blutmenge, geringfügiges Erweitern nichtinvasiver Diagnosemaßnahmen, wie etwa Ultraschalluntersuchungen, Abnahme eines EKG in Ruhe, Anfertigung einer „einzigen“ Röntgenaufnahme und einer „einzigen“ Computertomographie.
Und dann heißt es zusätzlich noch: Bei bestimmten Teilnehmern könnten diese Verfahren mehr als ein minimales Risiko oder eine minimale Belastung darstellen, und es muss dann eine Bewertung im Einzelfall erfolgen.
Nun steht das leider nur in den Zusatzbemerkungen. Der Ökumenische Rat der Kirchen in Österreich – Professor Körtner und ich haben hier mitgewirkt – hat daher eine Bitte im Rahmen der Begutachtung geäußert, nämlich dass diese Nummer 97, wo das konkretisiert wird, was „minimal burden“ und „minimal risk“ ist, durch einen Verweis als verbindliche Interpretation in den Text selber aufgenommen wird. Das heißt, dass das nicht nur im Recital hinten steht und keinerlei Bedeutung hat, wo man dann, wenn man sich darauf beruft, in Brüssel zur Antwort bekommt: Darüber haben sie sich nicht einigen können, daher steht es nur in den Erläuternden Bemerkungen! – Daher die Bitte, dass diese Nummer 97 wirklich auch ausdrücklich im Zusatzprotokoll benannt wird, dass das der Interpretationsschlüssel ist und sein soll.
Noch eine Bemerkung: Die Zeichen des Widerstandes bei einer nicht einwilligungsfähigen Person sind zur Kenntnis zu nehmen. Das steht ausdrücklich in Artikel 17: Wenn eine nicht zustimmungsfähige Person Zeichen des Widerstandes gibt, darf die Forschung nicht durchgeführt werden.
Die Frage betreffend Unterschiede zwischen der EU-Richtlinie 20/2001 und der Konvention möchte ich gerne an Professor Baumgartner oder Professor Kopetzki weitergeben.
Letzte Bemerkung: Wo ich persönlich besonders wichtigen, vorrangigen Handlungsbedarf sehe, wo wir ansetzen müssen, das sind diese prädiktiven Tests. Das schafft wirklich enorme existentielle und persönliche Probleme für Menschen, mit dem Wissen leben zu können: Ich könnte mich testen lassen und eine Krankheit, die vielleicht in Jahren einmal ausbrechen wird, oder nur eine Disposition erfahren. Soll ich das tun? An sich fühle ich mich gesund! – Das schafft ganz enorme existentielle Probleme. Wir haben in Österreich nur die molekularbiologischen Tests im Gentechnikgesetz geregelt. Die ganze Palette von Testmöglichkeiten, die die gleichen Probleme schaffen, ist nicht geregelt! Ich darf das zum wiederholten Male in diesem Hause noch einmal bittend sagen.
Univ.-Prof. DDr. Christian Kopetzki (Bioethik-Kommission beim Bundeskanzleramt): Die Frage ist: Womit vergleichen wir die Konvention? Wenn Sie sie vergleichen mit dem Standard von Gesetzen, wie wir ihn in Österreich haben – Stichworte: Legalitätsprinzip, Bestimmtheitsgebot –, dann ist sie selbstverständlich höllisch unbestimmt; das ist überhaupt keine Frage. Damit darf man aber die Konvention, streng genommen, nicht vergleichen, weil sie ein Grundrechtsdokument ist. Und wenn Sie sie vergleichen mit der Europäischen Menschenrechtskonvention, mit der Europäischen Sozialcharta, mit den UN-Weltpakten über bürgerliche und politische Rechte, dann werden Sie feststellen, dass sie in diesem Vergleichsmaßstab, bezogen auf die Biomedizin, wesentlich präziser ist, denn die Vorläuferbestimmungen haben diese Dinge überhaupt nicht explizit angesprochen – und wenn, dann nur in ganz vagen Generalklauseln.
Wenn man also das Richtige miteinander vergleicht, sieht man, dass die Biomedizin-Konvention ein erheblicher Zuwachs an Präzision ist. Allerdings – und da gebe ich Herrn Dr. Stormann Recht – ist dieser immer noch nicht geeignet, anwendbares Recht für Ärzte, für Forscher, für Unternehmer zu sein. Das ist umsetzungspflichtig, und deshalb kann man den Satz nur unterstreichen: Adressat der Biomedizin-Konvention ist nicht der einzelne Staatsbürger, sondern das sind Sie, ist der Gesetzgeber! Und das Parlament hat – wie bei allen anderen Gesetzesvorbehalten und Grundrechtsbestimmungen – eine Konkretisierungsaufgabe. Sie werden daher bestimmen, was „minimal burden“, was „minimal risk“ ist, wenn Sie es überhaupt zulassen wollen! Wenn Sie sagen: Wir wollen die Forschung an Einwilligungsunfähigen gar nicht!, dann brauchen Sie es auch nicht zu konkretisieren, denn dann ist der ganze Artikel 17 (2) in Österreich totes Recht. Das kann man nur immer wieder betonen.
Zur Frage: Wo ist denn der schärfere Schutz der Biomedizin-Konvention? Eines hat Professor Virt erwähnt, und das scheint mir auch ein ganz wichtiger Punkt zu sein; ich nenne jetzt vier, fünf, aber ich könnte die Liste verlängern. Prädiktive Gentests, also Gentests, die auf die Vorhersage künftiger genetisch bedingter Krankheiten abzielen, sind nach der Biomedizin-Konvention nur für Gesundheitszwecke zulässig. – Diese Einschränkung kennt das österreichische Recht nicht! Wir haben zwar zwei besonders verpönte Formen im Gentechnikgesetz verboten, nämlich Gentests für Versicherungszwecke und für Arbeitnehmer, aber da fällt mir noch vieles andere ein: Gentests für Dopingzwecke und so weiter. Das ist in Österreich nicht verboten. – Die Biomedizin-Konvention verbietet das sehr wohl. Da müssen wir also nachbessern.
Wir haben einen ganz extrem engen Begriff von Gen-Analyse, nämlich molekulargenetische Analysen. Es gibt ganz andere Techniken, die in Österreich nicht geregelt sind – und nicht geregelt heißt: Sie sind erlaubt. – Da müssten wir auch wesentlich nachbessern, um Artikel 12 zu entsprechen.
Zu Artikel 16 und 17 der Komvention. Wenn wir uns einmal loslösen von diesem einen Sonderproblem „Einwilligungsunfähige“, enthalten diese Artikel für die Forschung eine Fülle von Kautelen, die wir nicht flächendeckend eingeführt haben. Wir haben Regelungen ausschließlich für klinische Prüfungen an Arzneimitteln und Medizinprodukten – und der „Rest“ der biomedizinischen Forschung ist in Österreich nicht explizit geregelt, und das ist ein weites Feld.
Wir haben nicht einmal dort, wo wir explizite Regelungen haben, alle Bestimmungen erfüllt. Die Biomedizin-Konvention gibt Personen, die nicht einwilligungsfähig sind – ich betone: die nicht einwilligungsfähig sind! –, sogar ein Vetorecht. Wenn sie sich dagegen wehren, ist es aus. – Das kennt die österreichische Rechtsordnung nicht. Wir kennen auch keine umfassende Subsidiarität der Forschung am Menschen. – All das müsste nachgebessert werden. Ich glaube, die Bereiche, wo wir nachbessern müssten, wären viel mehr als jene, wo der Schutz schwächer ist.
Weiters: Wir haben keine kodifizierte Lebendspende im Transplantationsrecht; da müsste man wohl nachbessern.
Wir haben in Österreich kein umfassendes Gewinnverbot für den Handel mit Körpersubstanzen. Das berühmte Beispiel – einmal im Jahr taucht es auf –: Es bietet jemand aus der Slowakei, aus Polen für viel Geld eine Niere an. Das kommt dann immer zur Staatsanwaltschaft, und die Staatsanwaltschaft muss das Verfahren einstellen, denn das ist in Österreich nicht strafbar! Das ist vielleicht sittenwidrig, aber das interessiert Barzahler nicht. Es ist jedenfalls nicht strafbar! – Da müssten wir wesentliche Anpassungen vornehmen. – Das zum Artikel 21 der Konvention: Gewinnverbot bezüglich Körpersubstanzen.
Zum Artikel 22: Die Konvention verbietet grundsätzlich die Nutzung von Körpersubstanzen für andere Zwecke ohne Einwilligung: zum Beispiel von OP-Abfall, der für andere Zwecke umgewidmet werden soll, etwa in Form eines Konsensprinzips. – In Österreich ist das nicht geregelt, und daher ist es strittig, so wie vieles dieser Dinge. Da müssten wir einfach Farbe bekennen und eine Regelung erlassen.
Ich stimme schon zu, dass das Klonen in Österreich verboten ist, nur: Da muss man weit weniger Interpretationen machen, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Und wenn man dazu kommt, dann stellt man fest: Strafbarkeit bis zu 500 000 S. – Dazu kann ich nur sagen, das wird die Firma X nicht abhalten! – Auch da gilt: Wir müssten im Sanktionsbereich wesentlich schärfere Schutzstandards einziehen.
Ich könnte diese Liste noch fortsetzen; das waren zumindest ein paar Beispiele.
Ein Punkt war auch die Frage der Drittstaatsklausel, Frau Abgeordnete Gatterer. Ich möchte das noch einmal kurz fokussieren, weil mir das als ein ganz wichtiger Punkt erscheint. Mit Drittstaatsklausel ist jene Bestimmung gemeint, die Sponsoren und Unternehmen mit dem Sitz im Vertragsstaat der Konvention auch dann an die Konvention bindet, wenn sie Forschungen woanders, nämlich in einem Staat, der nicht Vertragsstaat ist, betreiben. Beispiel: Firma X mit Sitz in Basel; der Vorstand sitzt in Shanghai. – Das wäre in einem Vertragsstaat der Biomedizin-Konvention nicht mehr so ohne weiteres möglich. Shanghai ist derzeit übrigens das Hoffnungsgebiet der Biotech-Industrie, weil es dort überhaupt keine Regelungen gibt.
Es besteht die Gefahr – und diese sehe ich ganz real –, wenn Österreich als eines der wenigen Europaratsländer der Konvention nicht beitritt, dass sich dann Unternehmen aus jenen Ländern, wo sie die Drittstaatsklausel haben, in Österreich ansiedeln, nicht weil man hier alles darf, sondern weil man von hier aus ganz gemütlich in Shanghai – nichts gegen Shanghai! – arbeiten kann und in diesen anderen Ländern alles darf, weil die österreichische Rechtsordnung ihre Verbote eben nur auf österreichisches Bundesgebiet beschränkt.
Das hätte eine gewisse Sogwirkung: Österreich könnte als Schlupfloch für die Auslagerung von Forschung gewissermaßen zu einer „Attraktion“ werden; aber vielleicht auch nicht. Das sind natürlich Szenarien, die man nicht beweisen kann; aber es sprechen sehr gute Gründe dafür.
Zur Frage: Was passiert, wenn wir nicht ratifizieren? – Dann bleibt zunächst einmal alles so, wie es ist. Es wird an der österreichischen Rechtsordnung insofern keine Änderung eintreten. Den Nachteil sehe ich allerdings darin, dass wir uns aus einer Rechtsentwicklung auskoppeln, die sich europaweit angebahnt hat und die durchaus verwandt ist mit der Entwicklung der Europäischen Menschenrechtskonvention.
Man kann natürlich sagen: Dann klinken wir uns halt aus! – Natürlich ist das möglich. Es ist das eine politische Frage, wie man das bewertet.
Meine persönliche Meinung ist: Ich halte es schon für sehr eigentümlich, dass gerade die deutsche und die österreichische Gesellschaft, die natürlich ein schweres Erbe zu tragen hat, was etwa die Forschung im Nationalsozialismus betrifft, so vorgehen soll. Es ist schon eine gewisse Ironie der Geschichte, dass gerade die deutsche und die österreichische Bioethik gewissermaßen dem „Rest“ von Europa erklärt, was ein „richtiger Standard“ ist. Ich finde, das hängt im europäischen Konzert irgendwie schief.
Zweitens: Wenn wir nicht ratifizieren, dann besteht die erwähnte Schlupflochgefahr, weil wir dann die Drittstaatsklausel nicht haben und sich dann unter Umständen Unternehmen bei uns ansiedeln, um im Ausland konventionswidrige Forschung zu betreiben.
Drittens: Es fehlt uns dann der Impuls – ich glaube, dass es ein guter Impuls wäre –, diese Dinge endlich alle durchzudiskutieren und eine systematische Durchforstung dieses Dschungels, in dem ja die Hälfte gar nicht geregelt und die zweite Hälfte strittig ist, endlich in Angriff zu nehmen.
Natürlich kann man das alles auch ohne Biomedizin-Konvention machen, aber: Machen wir uns doch nichts vor! So etwas sind gute Signale, um solche Dinge zu tun. Das Beispiel Europäische Menschenrechtskonvention zeigt doch: Jeder, der das sieht, weiß doch, zu welcher unglaublichen Fortentwicklung des Menschenrechtsschutzes das geführt hat, ohne dass wir dort, wo das schwächer war – Stichwort „Todesstrafe“ –, in irgendeiner Weise bedroht worden sind.
Herr Abgeordneter Lackner hat die Frage gestellt, ob es noch andere Gründe für die Bioethik-Konvention gibt. – Ich hoffe, ich habe im Wesentlichen die zentralen Argumentationspunkte, die eine Rolle gespielt haben, angeführt, aber ich lasse mich gerne korrigieren. – Sicherlich keine Rolle hat das Argument gespielt, dass wir ein schlechtes Ansehen haben könnten.
Es gab einfach die Abwägung Pro und Contra, wobei das Pro relativ klar war und das Contra, abgesehen von Befürchtungen, die zwar verständlich sind, letztlich aus juristischer Sicht nicht wirklich entscheidend war. Diese Befürchtungen kann man entkräften.
Es war insgesamt eine Abwägung der Sachargumente, und ich hoffe, ich habe keines unter den Tisch fallen lassen. Da gab es nichts Geheimnisvolles. Das ist wahrscheinlich einer der wenigen Beschlüsse, die dort einstimmig gefasst werden.
Die zweite Frage war: Wie kann man das stärkere österreichische Recht absichern? – Bevor ich darauf eingehe, möchte ich betonen: Die größere Aufgabe ist es, das Schwächere anzuheben, denn das müssen wir wirklich tun. Ich glaube, dass der Blick im Moment in die falsche Richtung geht. Zuerst müssen wir einmal dort anheben, wo wir anheben müssen.
Zur Absicherung des stärkeren Rechtes – Stichwort Artikel 17. Darauf kann man zwei Antworten geben. Wenn Sie mich als Juristen fragen, dann würde ich sagen: Da ist nichts abzusichern, weil keine Bedrohung stattfindet. Da der Artikel 17 weder unmittelbar anwendbar ist, noch uns verpflichtet, das zu tun, brauchen wir auch nichts abzusichern. Wir brauchen einfach nichts zu tun, und alles bleibt in diesem Punkt beim Alten. – Das ist die juristische Antwort.
Wenn man aus politischen Gründen – die anders sind, und das akzeptiere ich natürlich auch – hier eine Art von Sicherheit auch zur Befriedung von Interessensgegensätzen will, dann kann man natürlich in dem einen oder anderen Punkt überlegen, das abzusichern und diese Absicherung kann natürlich nur heißen: Verfassung. Wenn man es vor Mehrheiten absichern will, dann kann es nur heißen: Verfassungsrang.
Meine persönliche Meinung ist, dass ich da sehr skeptisch bin. Ich warne vor einer allzu wahllosen Absicherung von Bestimmungen in Verfassungsrang. Was hat man davon? – Man hat dann eine Fülle von verfassungsrechtlich zementierten Symbolbestimmungen, die eigentlich keinen juristischen Wert haben, die aber die Rechtsentwicklung in Zukunft stark beeinflussen.
Vor allem gebe ich zu bedenken: Das sind oft sehr dynamische Bereiche. Man braucht dann immer wieder große Mehrheiten – und sei es auch nur, um kleine Modifikationen durchzubringen. Das scheint in einem Gebiet, in dem sich alle Vierteljahre alles Mögliche ändert, nicht wirklich klug zu sein. – Aber das ist nur meine persönliche Einschätzung dazu.
Die letzte Frage betraf GCP. Darauf kann ich nur ganz grob eingehen. Man kann die Dinge zunächst nur vergleichen und stellt dann fest: GCP, Good Clinical Practice, ist die Arzneimittelrichtlinie der Europäischen Gemeinschaft, die seit 1. April 2001 in Kraft ist und die thematisch die klinische Arzneimittelprüfung regelt, also nur einen ganz kleinen Teilausschnitt von dem, was die Biomedizin-Konvention regelt.
Es ist sehr schwer: Wenn man die Texte vergleicht, stellt man fest: Sie sind ganz anders aufgebaut. In einigen Punkten ist die Richtlinie der EG ein bisschen stärker – in anderen Punkten ist die Biomedizin-Konvention ein bisschen stärker. In einem entscheidenden Punkt, der hier in der Diskussion eine sehr große Rolle spielt, nämlich betreffend Einwilligungsunfähige, kann man unter dem Strich sagen. Da ist die EU-Richtlinie wesentlich permissiver. Sie macht das zur Regel, was in der Biomedizin-Konvention nur die ganz eng limitierte Ausnahme ist, nämlich Artikel 17 Abs. 2: nichttherapeutische Forschung bei bloßem Gruppennutzen an Einwilligungsunfähigen. – Das macht die EU-Richtlinie zur Regel, und zwar ganz explizit bei den Kindern. Da wird überhaupt kein individueller Nutzen mehr zwingend verlangt, sondern der Gruppennutzen für die Patientengruppe.
Bei den Erwachsenen ist es etwas verwaschener, aber es ist wesentlich liberaler, auch im Sinne von wirtschaftsfreundlicher; das ist ja auch kein Geheimnis. Das dient der Vereinheitlichung des Wirtschaftsrechtes, zumindest schaut es in diesen Punkten unter Umständen danach aus.
Allerdings – um das jetzt wieder ein bisschen herunterzuschrauben –: Auch die GCP-Richtlinie enthält eine Klausel, wonach das höhere nationale Schutzniveau aufrechterhalten werden kann. – Das heißt, wir sind auch da nicht verpflichtet, das nachzumachen, abgesehen von Verfahrensbestimmungen; dort müssen wir es nachmachen.
Also insofern bedroht uns das auch nicht unbedingt. Aber es zeigt schon, wie schief meiner Meinung nach die Diskussion läuft. Wir starren völlig gebannt auf diesen Artikel 17 Abs. 2 und überlegen, unter welchen Kautelen wir ihn vielleicht ratifizieren. – Und während wir darüber reden, hat das Gemeinschaftsrecht durch die Hintertür eine bereits geltende Richtlinie bereits erlassen. Der brauchen wir gar nicht zuzustimmen, denn das Gemeinschaftsrecht bindet unmittelbar, und wenn wir das bis 2004 nicht umsetzen, dann stellt sich sogar die Frage, ob sie unmittelbar anwendbar werden könnte oder nicht. Und wir sitzen noch immer beim Artikel 17 Abs. 2 – und es ist dann im Grunde eine wesentlich lockerere Regel im Gemeinschaftsrecht bereits in Geltung. – Das scheint mir also eine nicht sehr zielführende Richtung zu sein.
Univ.-Prof. Dr. Holger Baumgartner (Bioethik-Kommission beim Bundeskanzleramt): Zunächst zur Frage der Zusammenarbeit zwischen den Behindertenverbänden, Selbsthilfegruppen und der Bioethik-Kommission. Diese Zusammenarbeit hat, wie Sie wissen, stattgefunden und hat auch zu Empfehlungen geführt, die sich zum Beispiel in § 8c Krankenanstaltengesetz-Novelle niederschlägt, wodurch Behinderten-Vertreter in die Ethik-Kommission hineinreklamiert werden. Das ist nun gesetzlich geregelt.
Was mir dabei fehlt, ist die, wie bereits eingangs betont, ausdrückliche Einbindung von Vertretern von Selbsthilfegruppen. Ich glaube, da geht es um einen zunehmend großen Personenkreis, etwa angesichts der Tatsache, dass wir älter werden und so weiter.
Weiterführende Gespräche sind vereinbart. Es gibt eine Kontaktpflege zwischen einer Subarbeitsgruppe der Bioethik-Kommission und Vertretern der Ethikkommission für die Österreichische Bundesregierung. Die Geschäftsstelle ist dabei auch eingebunden, und es gibt Gespräche zwischen den Vorsitzenden beider Gremien. Ich glaube, da entwickelt sich so etwas wie eine Gesprächs- und Kommunikationskultur.
Zur Frage Nichtratifizieren. Ich bin kein Jurist, aber auf Grund meiner praktischen Erfahrung in der Ethikkommission – 20 Jahre Forschungsethik – meine ich: Ob wir ratifizieren oder nicht, ändert gar nichts an der Tatsache, dass rundherum das weitergeht, was ohnehin im Laufen ist, nämlich eine biologisch-medizinische Revolution. Jeden Tag sieht man das. Schlagen Sie eine Zeitung auf! Sie werden täglich mit etwas Neuem konfrontiert werden. Dem müssen wir einen zeitgemäßen Rahmen geben. Dabei geht es einerseits um den Schutz für die Versuchspersonen, andererseits um die Sicherstellung einer hochqualitativen Forschung.
Es geht um den Schutz der Patienten nach unseren rechtlichen, ethnischen, kulturellen und sozialen Vorstellungen. Wenn wir das nicht machen, dann stellen sich andere Regelungen ein, wie wir schon gehört haben – und die können wir dann nur mehr zähneknirschend zur Kenntnis nehmen. Oder wir koppeln uns ab. Mit oder ohne Biomedizin-Konvention müssen wir also agieren!
Ein wichtiges Schutzinstrument ist die Forschungs-Ethik-Kommission. Diese muss auch weiterhin funktionieren, auch wenn jetzt diese Prozesse und Überlegungen über längere Zeit laufen.
Dabei sehe ich zwei Dinge: Erstens das UG-2002, das meiner Ansicht nach eine Verschlechterung in dem Punkt darstellt, dass die Geschäftsordnung der Ethikkommission durch den Universitätsrat festgelegt wird. Damit wird meiner Ansicht nach der Bock zum Gärtner gemacht! – Zweitens: Eine Verbesserung wird durch § 8c Krankenanstaltengesetz erreicht. Nun sind Behindertenvertreter dabei.
Die EU-Richtlinie ändert die Qualität der Tätigkeit der Ethikkommission. Das sind zwar sehr abstrakte Dinge – die Ethikkommission ist ja letztlich unmittelbar vor Ort tätig –, aber sie ändern die Qualität der Forschung am Ort des Geschehens. Sie könnten jetzt schon Missbrauch verhindern, indem Forschung betrieben wird, die nicht der Ethikkommission vorgelegt wird, indem Sie Maßnahmen setzen, die diese Groteske verhindern, dass Leute befördert, belohnt und was weiß ich was alles werden, für Handlungen, die sie letztlich unter Missachtung der österreichischen Gesetze und auch der Menschenrechte begehen.
Worum geht es? – Als jemand, der seit fast 20 Jahren einer Forschungs-Ethik-Kommission angehört und über 2 000 Forschungsprotokolle – industrieller Art oder aus universitärer Forschung – mitbeurteilt hat, habe ich den Eindruck, dass wir hier teilweise über Dinge reden, die sich eigentlich nicht mit dem decken, was in den Krankenanstalten und in den Forschungseinrichtungen geschieht. Forschung wird offenbar bis zu einem gewissen Grad als „Bedrohung“ empfunden. Dabei verdanken, ganz ehrlich gesagt, viele der hier Sitzenden wahrscheinlich nicht nur ihre Gesundheit, sondern teilweise auch ihr Leben letztlich auch der Forschung.
Ich kann die Forschung nur bejahen. Gleichzeitig muss man aber sicherstellen, dass sie richtig betrieben wird: ethisch und rechtlich vertretbar. Ein Weg dazu ist eben, das Vertrauen zu erhöhen, indem man die Zusammensetzung der Kommissionen ändert, Mitglieder austauscht, indem man eben auch Leute aus dem nicht unmittelbaren Forschungsbereich in diese Kommissionen hineinnimmt.
In der Ethikkommission befinden sich ohnehin nicht nur Ärzte; es sind darin Juristen, Patientenvertreter, Theologen, Pharmazeuten, Biostatistiker und Pflegeberufe vertreten. Das ist ja kein akademisches Selbstberatungsgremium. Es tut diesem Gremium auch sicher nicht schlecht, wenn auch Betroffene mit eingebunden werden. Das hätte aus meiner Sicht auch den Vorteil, dass möglicherweise Impulse für die Richtung der Forschung erfolgen – und letztlich ist die biomedizinische Forschung doch eigentlich sozial dienlich, und sie sollte vor allem jenen dienen, die es brauchen. – Die industriell und akademisch betriebene Forschung orientiert sich nämlich nicht unbedingt nur an Patientennöten und -bedürfnissen. Also insofern beginnt sich hier vielleicht ein Feedback zu entwickeln.
Hinweisen möchte ich auch noch auf die Wichtigkeit der Grundlagenforschung, die ja die Voraussetzung dafür ist, dass man überhaupt etwas weiterentwickeln kann, um etwas zu verbessern, zu lindern. Es geht oft um ganz geringfügige Eingriffe. Stellen wir uns vor, es wird Blut analysiert, routinemäßig – und es bleibt etwas übrig. Diese routinemäßige Untersuchung erfolgt zur Sicherheit, ist aus irgendeinem Grund absolut gerechtfertigt. Und es bleiben, zwei, drei Milliliter Blut übrig. Was geschieht damit? – Das wird weggeworfen. Alternativ könnte man, und zwar ohne Belastung und ohne Risiko, aus diesem Blut Informationen über die Krankheit an sich gewinnen und so weiter. So ist das ja immer gemacht worden.
Ich glaube, von diesem Ausgangspunkt sollte man schrittweise vorgehen – bis dorthin, wo man sagt, da geht es nicht mehr. Aber man muss sich darüber im Klaren sein: Es gibt auch Forschung ohne Risiko und ohne Belastungen. Es geht letztlich dann um die Grenzen, die man da zieht. – Wir kommen ohnehin nicht darum herum, uns mit dem gesamten Komplex der biomedizinischen Forschung auseinanderzusetzen und ein umfassendes Regelwerk zu schaffen; das wird wahrscheinlich lange dauern.
Was die EU-Richtlinie betrifft, sage ich jetzt ganz frei weg, wie ich das sehe. – Bei der EU muss man sich zunächst fragen: Wer ist dort federführend? – Das ist das Generaldirektorat III, das heißt: gewerbliche Wirtschaft und Industrie. Professor Kopetzki hat schon gesagt, das Ganze diente der Vereinheitlichung und Vereinfachung des Binnenmarktes und so weiter. – Ich sehe aber noch etwas anderes aus der EU und aus anderen Gremien: Eigentlich versucht die EU krampfhaft, zu verhindern, dass uns das passiert, was im Informationstechnologiebereich passiert ist, nämlich dass wir kollektiv gegenüber den USA abdriften. Man will bei diesem biomedizinischen Innovationsschub mit dabeibleiben. Und da kann es leicht sein, dass ein Instrument, mit dem wir agieren, das Senken ethischer Standards ist.
Die USA haben sehr niedrige soziale Standards. – Diese Standards können wir bei uns nicht senken, aber das ist aus meiner Sicht das große Problem. In den USA wird aus meiner Sicht Sozialdumping betrieben – und bei uns besteht die Gefahr, dass wir, um konkurrenzfähig zu bleiben, möglicherweise ethisches Dumping betreiben.
Einer der Hauptzielpunkte der EU-Richtlinien ist die Ethikkommission; diese will man „industriegefügiger“ machen. Es gibt dabei auch sicherlich positive Seiten, aber ich sehe darin ein Problem. Das Motto wird wohl sein: Schneller am Markt – und weniger Widerstand und Reflexion!
Was die fremdnützige Forschung betrifft, finde ich, dass das schon sehr gut herausgearbeitet worden ist. An sich ist der Gruppennutzen in der Bioethik-Konvention/in der Menschenrechtskonvention für die Biomedizin etwas ganz Elementares. Fremdnützige Forschung in dem Sinne, dass man Behinderte, dass man Menschen, die nicht zustimmen können, dazu verwendet, um für uns Vorteile zu erzielen, das wäre wohl völlig falsch – und ich habe in der Ethikkommission in 20 Jahren kein derartiges Projekt gesehen.
Es geht viel mehr darum, an diesen bestimmten Personengruppen Erkenntnisse zu gewinnen, die uns helfen, die Krankheit und deren Umstände besser zu verstehen – sowie darum, darauf aufzubauen. Daher: minimiale Belastung, minimales Risiko. Das kann auch das Nichtverwerfen einer wertvollen Probe sein. Da gehören halt Regeln her, die wir jedoch teilweise nicht haben.
Meiner Ansicht nach würde die Sicherheit durch das wachsen, was ohnehin schon beginnt, nämlich dass Personengruppen dieser Art durch Vertreter – sofern sie nicht selbst dazu in der Lage sind – in den Entscheidungsgremien, Beurteilungsgremien wie Ethikkommissionen und so weiter mit eingebunden werden. – So würde ich die Entwicklung einer neuen Forschungskultur sehen.
Konkret geht es darum, dass die Ethikkommission durch das UG nicht Schaden erleidet, sowie darum, dass man, abgekoppelt davon, auch auf ein paar andere Punkte, die ich aufgezählt habe, ein Auge hat.
Ethikkommissionen sind ein ganz wichtiges Instrument, um den Schutz des Patienten, die Qualität in der Forschung und eine entsprechende Forschungskultur zu gewährleisten und zu vermitteln.
Univ.-Prof. Dr. Jochen Taupitz (Universität Mannheim, Fakultät für Rechtswissenschaft): Ich möchte auch noch einmal auf das Problem der unbestimmten Begriffe eingehen, weil das ja doch ein Hauptvorwurf gegen die Bioethik-Konvention ist, dass diese in vielen Bereichen unbestimmt und ungenau sei.
Dazu: Es gibt bestimmte begriffliche Unschärfen, die schlichtweg durch nationale Unterschiede in den potentiellen Mitgliedstaaten bedingt sind. Wenn beispielsweise in Artikel 6 Abs. 2, der ja in der Vergangenheit heftig kritisiert wurde, vorgesehen ist, dass für eine minderjährige Person der gesetzliche Vertreter oder eine von der Rechtsordnung dafür vorgesehene Behörde, Person oder Stelle einwilligen kann, dann entspricht das natürlich nicht dem österreichischen Recht und auch nicht dem deutschen Recht, wo eben der gesetzliche Vertreter die einzige mögliche Person oder Stelle hiefür ist.
Aber es gibt nun einmal Rechtsordnungen – wie zum Beispiel jene in England –, die das Prinzip des gesetzlichen Vertreters nicht kennen. Da wird für die jeweiligen Bereiche ein Vertreter eingesetzt – oder es gibt eben eine staatliche Stelle, nämlich das Gericht, das für den Betroffenen zu entscheiden hat. England könnte sich natürlich einer Formulierung nicht anschließen, die den gesetzlichen Vertreter – den man, wie gesagt, nicht kennt – hier vorsieht.
Zweite Bemerkung zum Vorwurf Ungenauigkeit und fehlende Präzision: Häufig stecken dahinter politische Kompromissformen; auch das muss man sehr deutlich sagen. Wenn die Begriffe „jedermann“, „Mensch“, „Lebewesen“ und so weiter in der Konvention und auch in dem Zusatzprotokoll nicht näher definiert sind, so liegt das schlichtweg daran, dass man auf politischer Ebene keine einheitliche Bestimmung inhaltlicher Art finden konnte.
Und dann gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder man diskutiert ewig lange weiter und kommt vielleicht doch nicht zum Schluss, oder man sagt irgendwann einmal: Okay, wir sehen, dass wir da einen Dissens haben, wir benennen diesen Dissens auch offen, aber wir sorgen wenigstens dafür, dass die anderen Punkte, die unstrittig sind, in Kraft gesetzt werden können. – Das ist doch das Abwägen auf internationaler Ebene, wenn man eine solche Konvention erarbeitet.
Der dritte Punkt, der Ungenauigkeiten betrifft, und zwar sachlich bedingte Ungenauigkeiten – und da meine ich gerade, dass das Kriterium des minimalen Risikos oder der minimalen Belastung hier hinzuzuzählen ist –: Das ist keine politische Kompromissformel, sondern das kann man schlichtweg aus juristischer Sicht nicht abschließend formulieren.
Herr Dr. Stormann hat ja bereits darauf hingewiesen, dass die Arbeiten von der wissenschaftlichen Forschung ständig überholt werden. Aus diesem Blickwinkel heraus habe ich ohnehin Zweifel, ob es sinnvoll ist, auf internationaler Ebene, in diesem unendlich schwierigen – und auch unendlich schwierig abänderbaren – Verfahren so detaillierte Vorschriften zu formulieren, wie es in der Konvention und erst recht im Forschungsprotokoll der Fall ist. Wenn schon während der Ausarbeitung die Dinge ständig über den Haufen geworfen werden, dann wird das doch nach In-Kraft-Treten erst recht der Fall sein!
Nehmen Sie nur ein ganz kleines Beispiel aus diesem umfangreichen Katalog von minimal belastenden beziehungsweise minimal risikoreichen Tätigkeiten, nach dem Entwurf des Forschungsprotokolls und seinem Erläuterungsbericht. Da heißt es: Erheben von Daten durch Befragen, Beobachten, Messen und Wiegen. – Gehört das Fotografieren oder Filmen der Person auch dazu? Das fällt nämlich nicht unter diese Begriffe. – Also, wenn man es wörtlich nimmt – und das ist ja offenbar geplant, denn Präzision verlangt, dass sich natürlich in beiden Richtungen daran festhalten lässt –, dann heißt das, dass das Fotografieren oder Filmen nicht darunter fällt. Das kann aber nicht richtig sein, will ich ganz deutlich sagen.
Deswegen ist es also sehr sinnvoll, dass man sich mit etwas allgemeineren Begriffen begnügt. Und das ist doch auch gerade die Arbeitsteilung in jeder modernen Rechtsordnung, dass zwischen der Gesetzgebung und der Rechtssprechung eine Balance stattfindet und der Gesetzgeber nicht dem Versuch unterliegt, alles und jedes, jede Situation im vorhinein sozusagen festzurren zu wollen. Das würde zu einer unerträglichen Versteinerung und Verkrustung der Rechtsordnung führen.
Es zu Recht noch einmal auf das Problem der Gruppennützigkeit beziehungsweise Fremdnützigkeit hingewiesen worden. – Ja, darum geht es in der Tat in den hier problematischen Fällen, dass der Betroffene/die Betroffene nicht unmittelbar von der Maßnahme Nutzen hat. Aber führt es nicht auch zu einer unglaublichen, ich möchte fast sagen, Zwiespältigkeit, wenn man auf der einen Seite sagt, es dürfen Maßnahmen durchgeführt werden, die dem Betroffenen möglicherweise im Laufe seines Lebens vielleicht doch einmal nützen werden? – Das heißt, dass gerade die vital Gefährdeten, die Unfallopfer, damit von jeder forschungsmäßigen Verbesserung ihrer Situation ausgeschlossen sind, denn die haben im allgemeinen nur noch kurz zu leben und damit keinen Profit mehr von dieser Forschung. Also die Unfallforschung wäre dann von vornherein, wenn man es ernst nimmt, ausgeschlossen.
Im Übrigen geht es
ja – ich sage es noch einmal – um die minimal
belastenden beziehungsweise minimal
risikoreichen Forschungsmaßnahmen, neben all den anderen Kriterien, die
jetzt immer wieder und zu Recht hervorgehoben wurden. Es ist aber doch gerade
ein Prinzip der Grundlagenforschung,
dass man auch an Gesunden zunächst einmal die Parameter kennen muss, um dann
herausfinden zu können, was die Krankheit ist. Der Sauerstoffmangel bei
Frühgeborenen kann nur dann angemessen behandelt werden, erforscht werden, wenn
man zunächst einmal weiß, welchen Sauerstoffgehalt das Blut eines gesunden
Säuglings, Frühgeborenen aufweist. Da muss man doch erst einmal
Vergleichsmöglichkeiten, Vergleichsdaten haben. Und um diese Vergleichsdaten gewinnen zu können, ist es aus
meiner Sicht in manchen Fällen – in seltenen Fällen! – unerlässlich, dass auch nicht Einwilligungsfähige einbezogen werden,
allerdings – und das ist der ganz zentrale Punkt; abgesehen von den vielen
objektiven Kriterien, abgesehen von der wichtigen Kommissionskontrolle durch
die Ethikkommission – nur mit Einwilligung des
gesetzlichen Vertreters.
Es wird – unterschwellig offenbar – in der Diskussion immer so getan, als ob die gesetzlichen Vertreter da leichtfertig mit dem Wohl und Wehe ihres Schützlings umgingen. – Das ist doch wohl in der Regel nicht der Fall! Wenn wir in unseren Rechtsordnungen ein generelles Misstrauen gegenüber dem gesetzlichen Vertreter hätten, dann dürften wir den Eltern auch nicht mehr diese große Macht überlassen, gegebenenfalls für oder zu Lasten ihrer Kinder zu entscheiden. Wir gehen doch wohl offenbar davon aus, dass die gesetzlichen Vertreter im wohlverstandenen Interesse ihrer Schützlinge handeln und dass sie sehr genau abwägen, ob das Risiko beziehungsweise die Belastung wirklich minimal ist.
Aber man muss das einmal auf die Spitze treiben. Was ist eigentlich mit einer Mutter, die zu einem Arzt sagt: Kann nicht das Schicksal meines lebensgefährlich erkrankten Kindes wenigstens anderen Kindern dasselbe Schicksal ersparen? Soll dieser Arzt dann wirklich sagen: Tut mir leid, unsere Rechtsordnung verbietet das! Dann haben die anderen Kinder eben Pech gehabt. Ihr Kind darf selbst mit Ihrer Zustimmung, selbst mit Einwilligung der Ethikkommission, selbst unter Einhaltung aller weiteren Schutzkriterien nicht dazu beitragen, dass anderen Kindern dasselbe Schicksal erspart wird!? – Das kann doch eigentlich nur zynisch sein!
Es wurde die mögliche Differenzierung zwischen den verschiedenen betroffenen Gruppen angesprochen, also den verschiedenen Gruppen von Einwilligungsunfähigen. – Ein wichtiges Kriterium, nach dem man unterscheiden kann, ist beispielsweise die mutmaßliche oder die antizipative Einwilligung. Ein erwachsener Mensch, der im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist, soll doch wohl die Möglichkeit haben, für die Zukunft eine Vorausverfügung zu treffen, und sagen beziehungsweise niederlegen können, dass er sich, wenn er einmal in einem einwilligungsunfähigen Zustand ist, unter bestimmten Voraussetzungen für Forschungszwecke zur Verfügung stellen möchte! Das muss doch wohl Ausfluss seines Selbstbestimmungsrechtes sein können – und dann muss man später auf diese Vorausverfügung doch selbstverständlich auch eine Forschungsmaßnahme stützen können, wenn die Person in dieser Situation einwilligungsunfähig ist und wenn zusätzlich der gesetzliche Vertreter zustimmt!
Zur Frage, was eine Nichtunterzeichnung bedeuten würde. – Eine Nichtunterzeichnung hätte im formalen Sinne keine Nachteile für Deutschland oder Österreich. Die Vertreter sind in den Gremien weiter beteiligt und haben Mitspracherecht. Allerdings haben diese beiden Länder und andere Nichtunterzeichnerstaaten nicht das eigene förmliche Vorschlagsrecht, das sich auf Änderungen der Konvention beziehungsweise auf Zusatzprotokolle erstreckt, die gegebenenfalls zusätzlich formuliert werden.
Politisch bringt man natürlich damit im internationalen Bereich zum Ausdruck, dass man nicht einmal dieses angeblich so niedrige Schutzniveau mittragen möchte. – Wenn man das Schutzniveau für zu niedrig hält, dann kann man das sehr wohl bei der Unterzeichnung oder Ratifikation zum Ausdruck bringen. Es gibt nämlich nicht nur die Möglichkeit, einen Vorbehalt zu erklären, indem man sagt: Diese Bestimmung soll für uns nicht gelten, weil unser Recht dem entgegensteht!, sondern es gibt auch die Möglichkeit einer Interpretationserklärung, indem man bei der Unterzeichnung beziehungsweise bei der Ratifikation erklärt: Wir machen mit, aber was bezogen auf Einwilligungsunfähige hier geregelt ist, das bleibt hinter unserem nationalen, österreichischen Recht zurück, und wir hoffen, wir regen an, dass sich auch andere Staaten unserem hohen Schutzniveau anschließen!
Das ist eine Interpretationserklärung, durch die man zum Ausdruck bringt, dass man nicht sagt: Das gilt für uns nicht!, sondern dass man sagt: Andere sollen unserem Vorbild folgen!
Die Frage nach dem Verhältnis zum EU-Recht ist eine rechtlich sehr schwierige Frage. Ich will es insofern ganz einfach formulieren, als ich nicht differenzieren möchte zwischen der Frage, ob die EU der Konvention beitritt oder nicht; was sie machen kann. Grundlage ist jedenfalls, dass das EU-Recht gegenüber nationalem Recht vorrangig, also höherrangig ist. Nationales Recht darf nicht gegen EU-Recht verstoßen. – Wenn es doch dagegen verstößt, dann ist das nationale Recht unanwendbar.
Von daher ist es also eine Frage, ob das nationale Recht wirklich gegen das EU-Recht – in unserem Fall hier zum Beispiel gegen die Arzneimittelrichtlinie – verstößt. Aus dem Blickwinkel der Konvention sehe ich keine Konflikte, weil die Arzneimittelrichtlinie zum Schutz der in die Forschung Einbezogenen ausdrücklich ein höheres nationales Schutzniveau erlaubt. Also sowohl die Konvention als auch die EU-Richtlinie bieten nur einen Mindestschutz, sodass letztlich dann also im Vergleich das von beiden dargestellte höchste Schutzniveau gewährleistet werden muss.
Zu einem Konflikt könnte es nur dann kommen, wenn die EU-Richtlinie bestimmte Vorgaben strikt vorschreibt, dass sie bestimmte Regelungen vorgibt, von denen nicht abgewichen werden darf. Dann würde in der Tat ein entgegenstehendes nationales Recht, das dem höheren Schutzniveau der Konvention folgen würde, unanwendbar sein.
Das führt auf politischer Ebene aus meiner Sicht nun wiederum dazu, dass sich ein Vertragsstaat der Konvention in der Europäischen Union politisch darauf berufen und die Position vertreten kann: Wir dürfen in der EU nicht ein so niedriges Schutzniveau einziehen, weil das gegen die Konvention verstößt, der wir selbst – soweit man Vertragsstaat ist – verpflichtet sind! – Man hat also politisch gegenüber der EU-Kommission beziehungsweise den dortigen Gremien ein sehr viel „schlagkräftigeres“ Argument an der Hand, wenn man darauf verweisen kann: Auch in der EU muss das Schutzniveau der Konvention eingehalten werden, weil wir uns als Vertragsstaat gegenüber der Konvention dazu verpflichtet haben, dieses hohe Schutzniveau in unserem Land beizubehalten!
Von da her spricht also auch aus europäischer Sicht sehr viel dafür, dass möglichst viele EU-Staaten der Konvention beitreten, weil dadurch auch innerhalb der EU der politische Druck größer wird, das hohe Schutzniveau – das, um das ganz deutlich zu sagen, in einigen Bereichen der Konvention auch über dem nationalen deutschen Recht liegt – europaweit durchzusetzen.
Univ.-Prof. Dr. Ulrich Körtner (Bioethik-Kommission beim Bundeskanzleramt): Es ist deutlich geworden, welche Dynamik da auf der gesamteuropäischen Ebene zu beachten ist. – Ich möchte aber zunächst bei einem Verdacht anknüpfen und diesen entkräften: Es ist nicht so gewesen, wie man vielleicht vermuten könnte, dass die Bioethik-Kommission beim Bundeskanzleramt ein politisches Gremium ist, in dem man lange gerungen hätte, um zu irgendeinem politischen Kompromiss zu kommen. Dieser Verdacht stand vorhin ein bisschen im Raum: Wenn man so einstimmig ist, da kann etwas nicht stimmen! – Das mag vielleicht die parlamentarische Erfahrung sein. Bei dieser Kommission aber ist es wirklich so, dass in seltener Einmütigkeit von Beginn der Kommissionsarbeit an das Desiderat gesehen wurde, sich vorrangig mit der Frage der Ratifizierung der Konvention zu befassen, und dass hier wirklich von den verschiedenen Fachrichtungen her große Einmütigkeit herrschte und die möglichen Einwände gegen die Ratifizierung eigentlich von allen Beteiligten als nicht so durchschlagend angesehen wurde, dass man da auch nur eine dissenting opinion gehabt hätte. Ich möchte das hier noch einmal ausdrücklich zu Protokoll geben, denn wenn Sie sich schon vielleicht von Argumenten der Kommission nicht überzeugen lassen, so sollten Sie zumindest das Wissen um die Tatsache mitnehmen, dass das ein starkes Votum ist, hinter dem man nicht ein großes Gerangel vermuten sollte. Das wäre wirklich ein falscher Eindruck! – Sie können die Begründung, die wir geliefert haben, im Übrigen auch auf der Homepage nachlesen.
Zweiter Punkt: Wir haben intensiv mit Vertreterinnen und Vertretern der Ethikkommission für die Österreichische Bundesregierung gesprochen – und wir wollen diese Gespräche weiter fortsetzen. Ich möchte das von Professor Baumgartner hiezu bereits Gesagte durch folgenden Hinweis ergänzen:
Wir haben in der Bioethik-Kommission des Öfteren auch schon über die Rolle dieser Kommission reflektiert. Sie ist kein Ersatzparlament! Unser Auftrag war nicht und ist nicht, mit advokatorischen Gruppen politische Kompromisse auszuhandeln, sondern: Was wir getan haben und weiter tun wollen, ist, uns wechselseitig zu informieren, anzuhören, die verschiedensten Argumente möglichst umfassend zu beleuchten, damit wir als Kommission zu einem möglichst umfassend begründeten Votum kommen. – Das entbindet aber Sie, die Parlamentarierinnen und Parlamentarier, nicht davon, im Zuge allfälliger Gesetzgebungsverfahren, der Ratifizierung oder was sonst noch ansteht, die üblichen Anhörungen und so weiter durchzuführen. Ich bitte sehr darum, die Existenz der Bioethik-Kommission nicht so zu verstehen, dass man allfällige Gespräche, Verhandlungen, das Suchen von Kompromissen sozusagen dahin delegieren könnte. – Das wäre wohl nicht unsere Aufgabe.
Jetzt aber noch einmal zu den Gründen, die für die Ratifizierung sprechen: Ich meine, dass die Diskussion, die im Laufe dieses gesamten Vormittags stattgefunden hat, noch einmal unterstrichen hat, in welcher Dynamik sich die biomedizinische Entwicklung und Forschung befindet. Wir beziehungsweise Sie haben über so viele Details gesprochen, die gerade noch einmal unterstreichen, dass da eine Dynamik im Gange ist, die mit starren, statischen Kodifizierungen offensichtlich nicht mehr gehandhabt werden kann, sondern wofür man ein Instrument braucht, das seinerseits dynamisch ist.
Genau das will die Biomedizin-Konvention sein: Sie ist ein Framework, ein Rahmen, innerhalb dessen einerseits fortlaufend durch Zusatzprotokolle agiert werden soll – und andererseits auch durch ein permanentes Monitoring, das vorgesehen ist, die Tauglichkeit der Instrumente, die man bis dahin entwickelt hat, wieder überprüft werden soll.
Es ist dies also ein dynamischer Prozess, und die Entscheidung für Unterzeichnung oder Ratifizierung bedeutet, sich konstruktiv, energisch an einem solchen Menschenrechtsprozess beteiligen zu wollen.
Es wurde hier auch die Frage in den Raum gestellt, ob ein Nein, ein dauerhaftes Nein Österreichs nicht gerade der Stachel sein könnte, um die Diskussion auf der gesamteuropäischen Ebene in Gang zu halten. – Dies ist eine politische Einschätzung; ich wage das zu bezweifeln. Ich sehe es eher so – weil das Ganze ja nicht eine statische Angelegenheit ist, bei der es nur darum ginge, einem einmal fix kodifizierten Text zuzustimmen, sondern weil man sich mit der Ratifizierung ja in einen Prozess hineinbegibt –, dass eine Nichtratifizierung auf die Dauer bedeuten würde, dass man sich eher immer in der Außenseiterposition befindet, in der die anderen über seinen eigenen Standpunkt sozusagen hinwegsteigen können.
Um es deutlich zu machen: Im deutschsprachigen Raum sind Deutschland und Österreich Länder mit einer besonderen Geschichte und deshalb besonders sensibel – das wurde bereits angesprochen. Die Schweiz gehört mit zu den Ländern, die sich bislang auch relativ restriktiv geäußert haben. Bezeichnenderweise hat die Schweiz – als Nicht-EU-Land – inzwischen unterzeichnet.
Und um noch einmal auf den Punkt Embryonenforschung zu sprechen zu kommen: Sowohl Deutschland als auch die Schweiz haben entweder ein Stammzellgesetz oder sind – im Falle der Schweiz, die diesbezüglich weiter geht – gerade dabei, in einem beschleunigten Gesetzgebungsverfahren ein Embryonenforschungsgesetz auf den Weg zu bringen, das sogar die Herstellung neuer embryonaler Stammzelllinien vorsieht.
Ich will damit nur Folgendes sagen: Wenn wir glauben, jetzt in einer Koalition der ständigen Bedenkenträger und deshalb sozusagen die „Wächter“ zu sein, dann sollten wir aufpassen, dass wir – auch innerhalb des deutschsprachigen Raumes – nicht plötzlich in eine Sondersituation hineingeraten, in der wir ein Stück weit übersehen, welche Dynamik anderenorts bereits stattfindet.
Was die EU betrifft, möchte ich auf Folgendes hinweisen: Die EU könnte beitreten, ist bis jetzt aber der Konvention noch nicht beigetreten. Sie beruft sich aber jetzt immer auf diese Konvention, wenn es darum geht, auf EU-Ebene so genannte ethische Prinzipien für die Biomedizin zu formulieren. So werden zum Beispiel im 6. Rahmenprogramm in den entsprechenden Präambelpassagen ethische Prinzipien genannt, und dann heißt es: Menschenrechtskonvention zur Biomedizin.
Es wurde also einerseits gesagt, dass möglicherweise die Ratifizierung der Konvention durch möglichst viele Mitgliedstaaten der EU befördert, dass die entsprechenden Standards auch im EU-Recht beachtet werden; auf der anderen Seite ist es die EU selbst, die, in Ermangelung anderer Texte, in dieser Konvention einen wichtigen Anknüpfungspunkt sieht. Deshalb sind wir als ein Mitgliedstaat der EU meines Erachtens – das ist wiederum eine politische Einschätzung – gut beraten, gerade weil wir uns als Mitglied aktiv einschalten wollen, hier auch mitzutun.
Was den Grundrechtsschutz betrifft, so möchte ich das von mir heute Gesagte noch einmal in Erinnerung rufen, weil es sonst von niemandem mehr aufgegriffen wurde: Aus meiner Sicht – neben allem, was hier gesagt wurde und was ich jetzt nicht zu wiederholen brauche – sollte auch dem Status von Embryonen und dem Embryonenschutz in Österreich erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet werden. Ich glaube, dass die Unterzeichnung und der Prozess hin zur Ratifizierung ein wichtiger Impuls sein könnte, um in diesem Punkt etwas zu tun.
Ich darf noch einmal in Erinnerung rufen: Eine Novelle des Fortpflanzungsmedizingesetzes in Österreich steht unmittelbar bevor. Noch wird darüber diskutiert, ob es eine „kleine“ oder „große“ Novelle werden soll. Wie immer man die Embryonenforschung oder die Forschung mit embryonalem Material im Einzelnen auch bewertet – und ich will hier auch nicht die Position, die in Brüssel dann schlussendlich eingenommen wurde, kommentieren –, das Ergebnis ist: Das 6. Rahmenprogramm ist beschlossen; Forschung auf diesem Gebiet wird es geben. – Wir haben einen mehr oder weniger nicht geregelten Zustand. Klar ist: Wir dürfen nicht klonen – obwohl es hier möglich ist, sich sozusagen gewisser Umwegsargumente zu bedienen. Wir dürfen keine neuen Stammzelllinien in Österreich herstellen – wir können aber zumindest importieren und an Importiertem forschen; dem würde kein Gesetz entgegenstehen.
Wir könnten also – ich spreche damit noch einmal die Drittstaatsklausel und ähnliche Dinge an – in diesem Bereich schon sehr bald von einer großen Dynamik betroffen sein, die sich, so glaube ich, zu wenige klar machen. Darum ist es mir persönlich wirklich ein großes Anliegen, hier noch einmal zu unterstreichen, dass, gerade was den Lebensbeginn betrifft, eine Verbesserung des Grundrechtsschutzes vonnöten ist.
Ich glaube, dass viele auch in der öffentlichen Diskussion eine falsche Vorstellung davon haben, was Grundrechtsschutz am Lebensbeginn in Österreich betrifft, weil man quasi meint, das sei gleichsam common sense. – Rein rechtspositivistisch betrachtet ist dem nicht so.
Als letzten Punkt nochmals zur Forschung an nicht zustimmungsfähigen Personen: Auch ich – das ist jetzt zugegebenermaßen auch nur eine politische Einschätzung, und ich bin zudem kein Jurist – hielte es für problematisch, im Verfassungsrang einfach den Status quo zu fixieren, nicht nur deshalb, weil jede Änderung dann auch einer Zweidrittelmehrheit im Parlament bedürfte, sondern weil die Bioethik-Kommission ausdrücklich festgehalten hat – und das hat mit der Ratifizierung der Menschenrechtskonvention zur Biomedizin wirklich gar nichts zu tun –, dass es notwendig ist, einmal realistisch zu sehen, wo in der derzeitigen Praxis der Forschung allenfalls Probleme bestehen.
Ich gehöre selbst zum Beispiel der Ethikkommission der Medizinischen Fakultät der Universität Wien an. Wenn es dann um bestimmte Forschungsvorhaben geht, werden Sie immer irgendwelche Gründe finden, warum ein Fiebermessen und Pulsmessen auch noch irgendwie ein Nutzen für Personen sein kann, die man in die Forschung einbeziehen will.
Das heißt, da gibt es offensichtlich Probleme, die in jedem Fall gelöst werden müssen. Wenn man – ohne wirklich einmal ein Update über den, auch legistischen, Handlungsbedarf vorzunehmen – einfach den Status quo gesetzlich fixiert, dann würde das eine Diskussion geradezu abwürgen, von der die Bioethik-Kommission beim Bundeskanzleramt gerade gesagt hat, dass wir diese führen müssten, und zwar – ich betone dies nochmals ausdrücklich, und wir haben das auch zugesagt – mit den Vertreterinnen und Vertretern von Selbsthilfegruppen oder Behindertenverbänden oder Vertretern der Ethikkommission für die österreichische Bundesregierung.
Da besteht also großer Handlungsbedarf, aber das ist auf der Ebene der Gesetzgebung deutlich zu unterscheiden von Grundrechtsfragen oder Menschenrechtsformulierungen allgemeiner Art. Auch hier, glaube ich, wäre das Parlament am Zug, sich diesen Fragen zu widmen, auch im Gespräch mit der Bioethik-Kommission. Eine vorschnelle Fixierung von Ist-Zuständen wäre da vielleicht eher hinderlich und würde in der Realität vielleicht eher zur Verschleierung von Grauzonen führen, die in der Praxis vielen bekannt sind.
Dr. Hubert Hartl (Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen): Das BMSG ist überhaupt nicht gegen die Biomedizin-Konvention oder die Entwicklung von Zusatzprotokollen – das möchte ich an dieser Stelle festhalten! –, jedoch muss bei allen Regelungen, die Angst oder Furcht bei Menschen mit chronischen Krankheiten oder Menschen mit Behinderung hervorrufen, besonders sorgfältig vorgegangen werden.
Prinzipiell ist deshalb für das Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen nur ein Stufenplan vorstellbar, der zuerst eine Regelung eindeutiger Schutzbestimmungen, auch zum Beispiel der Artikel 18 und 21, danach eine Unterzeichnung, also einen Beitritt, und dann eine Ratifizierung und Inkraftsetzung vorsieht.
Eine Einbindung der Behinderten und Selbsthilfeverbände erfolgt bereits in den Sektionen des Hauses. Sowohl Selbsthilfeorganisationen und deren Dachverbände als auch die Behindertenorganisationen sind in regelmäßiger Art und Weise in die Entscheidungsfindung und Meinungsbildung eingebunden.
Zur weiteren Vorgangsweise: Herr Bundesminister Haupt hat eine Gegenüberstellung des Übereinkommens über Menschenrechte und Biomedizin und der geltenden Gesetzeslage, bereits unter Berücksichtigung der von mir zitierten Gesetze, welche zur Novellierung anstehen, in Auftrag gegeben. Danach erfolgt eine legistische Ausarbeitung der heute hier bereits mehrfach angesprochenen, kontrovers diskutierten Schutzbestimmungen. – Als Zeitraum hiefür wurde vom Herrn Minister ein Jahr vorgesehen.
Heute hier mehrfach angeführte Vergleiche, wie zum Beispiel die Therapie von Kindern mit Arzneimitteln, die Chemotherapie im eigentlichen Sinne, sind nicht wirklich zutreffend, da klinische Prüfungen an Kindern über lange Zeit in der Medizin tabu waren und man daher gar nicht daran denken durfte, Arzneimittel an Kindern auszuprobieren. Ähnlich ist es in der Arzneimittelforschung bei Schwangeren, wo sich erst im Zuge der Patientenemanzipierung im Zusammenhang mit HIV und AIDS eine Meinungsänderung ergeben hat. – Heute sind bereits internationale Regelungen auch dafür getroffen, dass kindgerechte Arzneimittel produziert und in Umlauf gebracht werden.
Zum zeitlichen Verlauf und zu den Auswirkungen einer Ratifizierung der oder eines Beitrittes zur Biomedizin-Konvention und auch zu der hier heute mehrfach angeführten Drittstaatsklausel ist dennoch auch anzumerken, dass erst 31 von 41 Staaten beigetreten sind – von den fünf Nichtmitgliedern keines – und dass erst 13 Staaten ratifiziert haben. Was die Zusatzprotokolle betrifft, so hat etwa das erste zum Thema Klonen aus dem Jahre 1998 erst 29 Beitritte und elf Ratifizierungen zu verzeichnen.
Univ.-Prof. Dr. Rotraud Perner (Wiener Internationale Akademie für Ganzheitsmedizin): Da Professor Körtner es dahin gehend formuliert hat, dass wir gut beraten seien, mitzutun, stelle ich die Frage: Wobei tun wir mit? – Ich möchte hier zeigen, dass wir aus dem Blickwinkel der Gewaltforschung dabei sind, unsere eigene Gewalttätigkeit zu legitimieren. Legitimation auch von Berufen heißt noch lange nicht, dass die jeweiligen Personen qualifiziert sind.
Ich warne in diesem Zusammenhang vor der Phantasie, dass Eltern immer das Wohl der Kinder im Auge haben. Das Beispiel, das Dr. Stormann gebracht hat und bei dem es um die Blutdruckmessung bei einem Kind ging, ist natürlich auch ein manipulatives. Die anwesenden Ärzte werden wissen, dass jede Blutdruckmessung bereits ein Stressor ist und den Blutdruck erhöht. Man müsste, wenn man hier eine Aussage haben wollte, die Immunglobulinwerte im Ruhezustand und nach erfolgter Intervention vergleichen, dann würde man sehen, welche Stressoren wirksam geworden sind. – Ich denke, die Lösung dieser juristischen Frage ist sicher eine, die den Elternteilen, jeweils dem einen oder dem anderen, nützt, aber nicht dem Kind.
Daher ist es mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass es wieder einmal an der Sprache und an der Definition liegt, was wir wahrnehmen – oder eben nicht.
Selbstverständlich haben Professor Virt und auch Professor Baumgartner Recht, wenn sie darauf hinweisen, dass Angst vor Forschung besteht. – Aus psychotherapeutischer Sicht ist Angst ein körperliches Warnsignal, das ernst zu nehmen ist.
Ich möchte darauf hinweisen, dass das, was wir als richtig empfinden, kulturspezifisch und bildungsabhängig ist und dass es nach wie vor in den Bildungs-, Gesundheits- und Sozialberufen nicht üblich ist, die eigene Betroffenheit oder Unbetroffenheit, insbesondere Abwehr zu hinterfragen, dass es noch immer eine Minderheit in der Ärzteschaft ist, die sich mit ihrer toxischen Wirkung auf die Patienten auseinandersetzt, dass es daher sehr wichtig ist, auf Formulierungen wie etwa „ungebührlich“ zu achten. Es bedarf unbedingt einer Definition dessen, was „ungebührlich“ ist.
Insofern möchte ich mich in Opposition zum Hinweis von Professor Virt setzen: Ich habe die Formulierung in der mir vorliegenden Übersetzung nicht gefunden. Jedes Zeichen von Widerstand ist zu berücksichtigen – das steht in dem Text, den ich zur Verfügung habe, nicht drinnen. Man kann das sinngemäß herausinterpretieren, man kann aber auch etwas ganz anderes herausinterpretieren.
Aus meiner Tätigkeit als Gerichtssachverständige weiß ich – und es fällt mir beim Lesen von Hauptverhandlungsprotokollen immer wieder auf –, wie mit Sprache manipuliert wird. Auch die Konzentration auf Begriffe wie „Nutzen“ oder „Nützlichkeit“ in den verschiedenen Variationen und, als Gegenteil dazu, das Sprechen von „Risiko“ und „Belastung“ verschweigt die Tatsache, dass es Schädigungen gibt.
Damit ich nicht auch manipuliere, nenne ich ein konkretes Beispiel: Ich habe jahrelang mit einer Patientin gearbeitet, die eine Klaustrophobie hatte. Diese Frau ist Juristin und ist im technischen Bereich zuständig für die Abnahme von technischen Einrichtungen, die klein sind, in die sie hineingehen müsste. Diese Frau hat eine leitende Funktion. – Nach ungefähr einem Jahr Therapie haben wir das Trauma gefunden: Die Frau war herzkrank und war als Kind in der Eisernen Lunge.
Ich möchte Sie wirklich bitten, sich der Erfahrungen der Psychotherapie, der tiefenpsychologischen Psychotherapie zu bedienen, um überhaupt eine Ahnung zu bekommen, welche Schädigungen da möglich sind. Es gibt hier keine Ausbildungen, es gibt nach wie vor keine regelmäßigen Supervisionen, durch die man vieles an Ausbildung nachholen könnte. Ich habe selbst auch im Sachwalterverein supervidiert, und ich weiß, wie sich die Kollegen und Kolleginnen gewehrt haben, als Unternehmensberater versucht haben, die Zeit der Erfahrung, der Wahrnehmung zu verkürzen. Ich weiß aus der Supervision von Turnusärzten und -ärztinnen, dass diese sagen: Wir haben keine Zeit mehr zu diagnostizieren; wir sind auf technische Daten angewiesen, weil wir gar nicht mehr wahrnehmen können!
Es finden also Veränderungen statt, die überhaupt nicht berücksichtigt werden. Ich denke, wir müssen vor allem auch darauf achten, welche Fehler wir bei all dem machen, was wir dabei übersehen können. Ich denke, dass es hier die Aufgabe Österreichs – und auch Deutschlands – aus unserer historischen Betroffenenkompetenz wäre, darauf zu achten, dass nicht nur die Utopie der Beglückung gesehen wird, sondern dass diese auch ergänzt wird durch die Horrorvision des Missbrauchs, der Oberflächlichkeit und der Ignoranz.
Obfrau Mag. Gisela Wurm erinnert daran, dass, nachdem die Konvention 1996 vom Ministerkomitee des Europarates beschlossen worden ist, im Jahre 1998 bereits eine Petition mit mehr als 50 000 Unterschriften im Parlament eingebracht und dem Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen zugewiesen wurde. Diese Petition sei im Mai 1998 in Verhandlung genommen und im Jahre 1999 dem Justizausschuss zugewiesen worden, habe aber auf Grund des Auslaufens der Legislaturperiode nicht mehr im Justizausschuss behandelt werden können.
Im Oktober 2001, nachdem durch die Abgeordneten Haidlmayr und Dr. Partik-Pablé eine weitere Petition eingebracht worden sei, diesmal mit mehr als 11 000 Unterschriften, sei der Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen neuerlich mit dieser Problematik konfrontiert worden.
Die Obfrau erachtet es als „sehr wertvoll, dass die teilnehmenden Experten und Expertinnen ihre Sichtweise zu dieser Thematik und ihr Expertenwissen zur Verfügung gestellt haben“, und bringt ihre Überzeugung zum Ausdruck, dass deren Ausführungen Eingang in den politischen Diskussionsprozess finden werden. Dies gelte auch für die von Dr. Stormann wiederholt hervorgehobene Erkenntnis, dass es im Zusammenhang mit der Ratifizierung dieser Konvention eines Paketes von einfachgesetzlichen oder auch verfassungsgesetzlichen Begleitgesetzen bedürfe.
Die Obfrau dankt den Expertinnen und Experten herzlich für ihren wertvollen Beitrag (allgemeiner Beifall), schließt das Hearing zum Tagesordnungspunkt 1 und leitet zur Fortsetzung der Ausschussverhandlungen über.
Schluss dieser Beratungen: 12.22 Uhr