III-104 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXI. GP
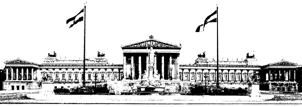
„Die Universitätsreform“
Parlamentarische Enquete
Donnerstag, 26. April 2001
(Stenographisches Protokoll)
III-104 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXI. GP
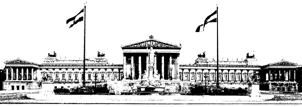
„Die Universitätsreform“
Parlamentarische Enquete
Donnerstag, 26. April 2001
(Stenographisches Protokoll)
Gedruckt auf 70g chlorfrei gebleichtem Papier
Parlamentarische Enquete
Donnerstag, 26. April 2001
(XXI. Gesetzgebungsperiode des Nationalrates)
Thema
„Die Universitätsreform“
Dauer der Enquete
Donnerstag, 26. April 2001: 10.11 – 13.50 Uhr
14.49 – 17.58 Uhr
*****
Tagesordnung
Einleitungsreferat:
Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur Elisabeth Gehrer: „Uni-Reform – ein Schwerpunkt der Bundesregierung“
Impuls-Referate:
Univ.-Prof. Dr. Klaus Landfried, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz Deutschland: „Reformen in Deutschland“
Prof. Dr. theol. Ulrich Gäbler, Rektor der Universität Basel: „Autonomie-Erfahrungen aus der Schweiz“
Univ.-Prof. Dr. Werner Welzig, Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften: „Qualitätssicherung, Evaluierung und Schwerpunktsetzung an den Universitäten“
Generaldirektor Dipl.-Ing. Albert Hochleitner, Siemens AG Österreich: „Die Erwartungen der Wirtschaft an Universitäts-Absolventen“
Univ.-Prof. Dr. Günther Bonn, Universität Innsbruck: „Die Reformnotwendigkeit aus der Perspektive der Naturwissenschaft“
Univ.-Prof. Dr. Friederike Hassauer, Universität Wien: „Meine Idealvorstellungen einer modernen Universität“
Univ.-Prof. Dr. Franz Marhold, Universität Graz: „Dienstrecht neu für moderne Universitäten“
Dr. Christian Joksch, IMADEC University: „Die Rolle der Privatuniversitäten in der Bildungslandschaft der Zukunft“
Univ.-Prof. DDr. Johannes Michael Rainer, Universität Salzburg: „Die Uni-Reform in Österreich vor dem Hintergrund der europäischen Universitätslandschaft“
Dr. Gerald Bast, Rektor der Universität für angewandte Kunst: „Die erweiterte Autonomie aus Sicht der Kunstuniversitäten“
Ao. Univ.-Prof. Dr. Klaus Zelewitz, Universität Salzburg: „Vollrechtsfähigkeit und Dienstrecht“
Univ.-Prof. Dr. Edith Saurer, Universität Wien: „Universitätsreform – Chancen und Gefahren“
Univ.-Prof. DDr. Hans Winkler, Senatsvorsitzender der Universität Innsbruck: „Die Universitäten befinden sich im Reformprozess – brauchen wir jetzt eine zweite Reform?“
*****
Einleitungsreferat
Bundesministerin Elisabeth Gehrer ............................................................. 5
Impuls-Referate
Univ.-Prof. Dr. Klaus Landfried ................................................................... 8
Univ.-Prof. Dr. theol. Ulrich Gäbler ............................................................ 12
Univ.-Prof. Dr. Werner Welzig ................................................................... 15
Generaldirektor Dipl.-Ing. Albert Hochleitner ............................................ 18
Univ.-Prof. Dr. Günther Bonn .................................................................... 20
Univ.-Prof. Dr. Friederike Hassauer ........................................................... 24
Univ.-Prof. Dr. Franz Marhold ................................................................... 29
Dr. Christian Joksch ................................................................................. 31
Univ.-Prof. DDr. Johannes Michael Rainer ................................................. 33
Dr. Gerald Bast ......................................................................................... 37
Ao. Univ.-Prof. Dr. Klaus Zelewitz ............................................................. 40
Univ.-Prof. Dr. Edith Saurer ...................................................................... 42
Univ.-Prof. DDr. Hans Winkler ................................................................... 46
Diskussion
Abg. DDr. Erwin Niederwieser ................................................................... 51
Abg. Mag. Dr. Udo Grollitsch .................................................................... 52
Abg. Dr. Gertrude Brinek ................................................................... 53, 90
Abg. Dr. Kurt Grünewald .......................................................................... 55
Univ.-Prof. Dr. Ina Wagner ........................................................................ 57
Univ.-Prof. Dr. Horst Seidler ...................................................................... 58
Mag. Martha Eckl ..................................................................................... 59
Univ.-Prof. Dr. Axel Borsdorf ..................................................................... 60
Univ.-Prof. Dr. Richard Otto Uher-März ..................................................... 61
Univ.-Doz. Dr. Veith Risak ......................................................................... 62
Univ.-Prof. Dr. Paul Kellermann ................................................................ 63
Ao. Univ.-Prof. Dr. Reinhard Folk ............................................................. 64
Dagmar Hemmer ....................................................................................... 65
Rektor Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Peter Skalicky ......................................... 66
Ass.-Prof. Dr. Peter Unfried ....................................................................... 67
Rektor Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pöhl .......................................................... 69
Univ.-Prof. Dr. theol. Ulrich Gäbler ............................................................ 70
Univ.-Prof. Dr. Friederike Hassauer ........................................................... 71
Univ.-Prof. DDr. Hans Winkler ................................................................... 72
Dr. Gerald Bast ......................................................................................... 73
Dr. Andrea Eisenmenger-Pelucha ............................................................. 75
Martin Faißt .............................................................................................. 76
Michael Hausenblas .................................................................................. 78
Mag. Johannes Öhlböck ........................................................................... 78
Dr. Gerhard Riemer ................................................................................... 80
Michaela Köberl ....................................................................................... 81
Dr. Erwin Bundschuh ................................................................................ 82
Dipl.-Ing. Silke Petsch ............................................................................... 83
Dipl.-Ing. Hans Mikosch ............................................................................ 84
Univ.-Prof. Dr. Georg Winckler ................................................................. 85
Univ.-Prof. Dr. Dieter Lukesch ................................................................... 86
Anita Weinberger-Prammer ...................................................................... 88
Karina Korecky ......................................................................................... 88
Univ.-Prof. Dr. Brigitte Winklehner ............................................................ 89
Abg. Dr. Sylvia Papházy, MBA ................................................................. 90
Geschäftsbehandlung
Wortmeldung des Abgeordneten DDr. Erwin Niederwieser in Bezug auf einen an dieser Enquete teilnehmenden Referenten .................................................................................. 4
Unterbrechung der Sitzung ............................................................................. 50
Antrag im Sinne des § 98a Abs. 5 GOG, das Stenographische Protokoll dieser Enquete dem Nationalrat als Verhandlungsgegenstand vorzulegen – Annahme ......................................... 56, 57
Beginn der Enquete: 10.11 Uhr
Vorsitzender: Abgeordneter Dr. Martin Graf.
*****
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Sehr geehrte Frau Bundesminister! Sehr geehrte Damen und Herren Magnifizenzen, Spektabilitäten, Professoren, Standesvertreter! Sehr geehrte Damen und Herren der Presse! Sehr geehrte Damen und Herren Experten!
Ich eröffne die parlamentarische Enquete zum Thema „Die Universitätsreform“, die auf Grund eines vom Hauptausschuss des Nationalrates gefassten Beschlusses durchgeführt wird, und begrüße an dieser Stelle alle Anwesenden nochmals sehr herzlich.
Meine Damen und Herren! Sie wissen, dass der Nationalrat das Anliegen der Universitätsreform sehr ernst nimmt. Es gibt schon seit einigen Jahren eine intensive öffentliche Diskussion zu diesem Themenkomplex. Bereits vor zwei Jahren hat der Nationalrat eine parlamentarische Enquete zum Thema „Qualitätssicherung für Lehre und Forschung an den heimischen Universitäten“ durchgeführt. Nachdem in den vergangenen Jahren verschiedene, zum Teil sehr weit reichende Veränderungen im Studien- wie im Organisationsrecht der Universitäten beschlossen worden sind, soll die heutige Enquete ein Forum für den Informationsaustausch und Dialog zwischen Parlamentariern und Fachleuten bilden, um die Entwicklungsperspektiven der Universitätsreform beleuchten zu können.
Meine Damen und Herren! Gestatten Sie mir noch einige Hinweise zur heutigen Enquete: Die Enquete ist nach § 98a Abs. 2 der Geschäftsordnung für Medienvertreter zugänglich. Personen, die berechtigt sind, Sitzungen der Ausschüsse des Nationalrates beizuwohnen, dürfen jedenfalls als Zuhörer anwesend sein. Über die Zutrittsmöglichkeiten wurde nach Maßgabe der räumlichen Möglichkeiten entschieden.
Bevor wir in die Diskussion über das Thema der Enquete eintreten, möchte ich kurz den geplanten Ablauf der Veranstaltung angegeben skizzieren: Zunächst werde ich die Referenten in der Reihenfolge wie in der Tagesordnung angegeben einladen, eine Stellungnahme in der Dauer von jeweils 15 Minuten abzugeben. Im Anschluss an die Referate ist eine einstündige Mittagspause vorgesehen. Alle Anwesenden sind zu einem kleinen Buffet im Sprechzimmer neben der Säulenhalle herzlich eingeladen. Nach Ende der Mittagspause werden wir in die Debatte eintreten. Zwischen den Parlamentsfraktionen ist vereinbart worden, dass die einzelnen Wortmeldungen die Dauer von jeweils 5 Minuten nicht übersteigen sollen.
Gibt es hiezu Wortmeldungen? – Wie ich sehe, gibt es eine Wortmeldung zur Geschäftsordnung von Kollegem Niederwieser. Ich erteile ihm das Wort.
10.13
Abgeordneter DDr. Erwin Niederwieser (SPÖ) (zur Geschäftsbehandlung): Herr Vorsitzender! Geschätzte Damen und Herren! An sich hätten wir den Reichsratssaal nehmen müssen, um alle einladen zu können, die sich für diese Enquete interessieren; in diesem hätten ungefähr 600 Personen Platz. Das Interesse ist sehr groß.
Der Grund dafür, dass ich mich zu Wort gemeldet habe, ist, dass wir im Hauptausschuss des Nationalrates über die in Betracht kommenden Referentinnen und Referenten für die Impulsreferate beraten haben. Das ist Sache des Hauptausschusses. Über einen dieser Referenten haben wir in mehreren Hauptausschusssitzungen beraten. Es ging darum, dass vom Institut oder von der Institution, der dieser Referent angehört, SMS mit eindeutig rassistischem Inhalt verschickt worden sind. Wir wollten das bis zur heutigen Enquete geklärt haben. Ich habe im Hauptausschuss ausdrücklich festgestellt, dass wir erwarten, dass bis heute eine Klärung erfolgt. Diese Klärung wurde jedoch bis dato nicht im ausreichenden Maß vorgenommen.
Ich möchte diese Enquete jetzt aber nicht weiter aufhalten, denn das Thema ist zu wichtig, sondern nur ankündigen, dass wir das zum Gegenstand der nächsten Präsidialsitzung machen werden.
10.15
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Bevor wir dem ersten Referenten das Wort erteilen, möchte ich noch einen technischen Hinweis geben: Entsprechend der Geschäftsordnung des Nationalrates wird über die heutige Enquete ein Stenographisches Protokoll verfasst. Ich ersuche daher die Referenten, für die Referate das auf der Regierungsbank verfügbare Mikrophon zu verwenden, und die Teilnehmer der Enquete, ihre Wortmeldungen in der Debatte vom Rednerpult aus abzugeben.
Weiters ersuche ich im Hinblick auf die große Teilnehmerzahl diejenigen, die sich im Rahmen der Debatte zu Wort melden wollen, dies nicht durch Handzeichen, sondern unter Verwendung der ausgegebenen Formulare persönlich beziehungsweise durch die Klubsekretäre beim Präsidium zu tun, wo die Mitarbeiter der Parlamentsdirektion die Meldungen entgegennehmen werden.
Einleitungsreferat
„Uni-Reform – ein Schwerpunkt der Bundesregierung“
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Ich erteile nunmehr der Frau Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur Elisabeth Gehrer als erster Referentin das Wort.
10.16
Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur Elisabeth Gehrer: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich bedanke mich beim Parlament und beim Hauptausschuss, der die Initiative zu dieser Enquete ergriffen hat. Auch ich stelle fest, dass das Interesse an der Entwicklung der Universitäten in Österreich sehr groß ist. Vermutlich hätten wir tatsächlich auch den Reichsratssaal füllen können. Ich halte das für gut, und jeder, der mich kennt, weiß, dass mir daran gelegen ist, mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen, viele Meinungen zu hören, mit vielen zu diskutieren, um möglichst eine gemeinsame Stimmung für eine Weiterentwicklung zu erreichen.
Gerade das Interesse der Medien und die Beiträge, die wir in den letzten Wochen und Monaten in den Zeitungen, im Fernsehen, im ORF gehört und gesehen haben, zeigen, dass die Modernisierung der Universitäten für alle Österreicherinnen und Österreicher ein ganz wichtiges Thema ist. Dieses Thema ist keine Erfindung von Politikern, und es wird auch nicht nur an den Universitäten, also von den 250 000 unmittelbar Betroffenen, diskutiert, sondern es wird in einer breiten Bevölkerungsschicht und mit viel Interesse und Engagement diskutiert. Deswegen meine ich, dass dieses wichtige Thema der Modernisierung der Universitäten über parteipolitische Zielsetzungen hinausgehen und von einem breiten politischen Konsens getragen werden sollte.
Ich möchte in meinem Einführungsstatement darstellen, was aus meiner Sicht der Ist‑Stand ist und was wir erreichen wollen. Eine Enquete ist eine Veranstaltung, in der ein Weg gesucht wird, den wir miteinander gehen können, und deswegen ist es wichtig, alle Ihre Meinungen zu hören. Daher möchte ich zunächst die Ist‑Situation darstellen, die Ausgangssituation, wie sie sich aus unserer Sicht, aus der Sicht des Ministeriums darstellt, und berichten, was wir bereits gemacht haben.
Wir haben gute Universitäten, wo gute beziehungsweise hervorragende Leistungen erbracht werden, was in der allgemeinen Diskussion leider manchmal unter den Tisch fällt. Von den 18 Universitäten mit 20 000 Bediensteten und 230 000 Studierenden wird viel geleistet, und das müssen wir auch anerkennen. Aber man kann auch alles noch verbessern.
Bei uns beträgt die durchschnittliche Studiendauer 7,5 Jahre, der OECD‑Schnitt liegt bei 4,5 Jahren. Laut allgemeiner Berechnung haben wir eine Drop-out-Rate von 50 Prozent, wobei man diese Zahl mit Vorsicht genießen muss, weil dabei nicht berücksichtigt ist, dass zahlreiche Personen das Studium wechseln beziehungsweise mit guten Berufschancen in einen Beruf gehen.
Im Zusammenhang mit dem Dienstrecht und seinem Vollzug verhält es sich derzeit so, dass immer weniger junge Menschen die Chance auf eine Wissenschafterkarriere haben. Vor fünf Jahren konnten noch 42 Prozent der Stellen nachbesetzt werden. Wenn wir so weitermachen, werden wir in fünf Jahren aber höchstens noch 20 Prozent der Stellen nachbesetzen können und in zehn Jahren wahrscheinlich keine mehr – und das ist nicht gut! Die Personalstruktur im internationalen Vergleich zeigt: Es gibt zu wenig Professoren, einen zu großen Mittelbau und zu wenig hoch qualifizierte Wissenschafter, die den Dauerbetrieb sichern.
Unser Budget für Wissenschaft und Forschung kann sich im OECD-Schnitt sehen lassen: Wir liegen an der dritten Stelle. Nationaler und internationaler Wettbewerb ist bei uns Realität, ob wir es wollen oder nicht, ich nenne in diesem Zusammenhang die Fachhochschulen, die Privatunis, die virtuellen Angebote und die internationale Entwicklung. Was an den Universitäten immer wieder bedauert wird, ist die nicht mehr zeitgemäße und hinderliche Trennung zwischen Entscheidungsebene und Verantwortung dafür.
Was wollen wir nun erreichen? – Wir wollen mit unseren Universitäten in der Weltklasse spielen, wir wollen in Forschung und Lehre Weltklasse sein, und das bedarf gemeinsamer Anstrengungen. Wir wollen die Leistungsfähigkeit im Bereich Forschung und Lehre erhöhen und die Effizienz des Mitteleinsatzes verbessern. Dazu sage ich ganz klar: All diese Aktivitäten stehen nicht in Zusammenhang mit einem Sparprogramm, sondern es geht darum, mit den vorhandenen Mitteln noch mehr zu erreichen, und wenn es notwendig ist, muss man um weitere Mittel verhandeln. Es gibt die 7 Milliarden für verstärkten Forschungseinsatz, von welchen die Universitäten viel haben können. – Ich möchte also noch einmal ganz klar feststellen: Es handelt sich nicht um ein Einsparungsprogramm.
Im Rahmen der universitären Ausbildung muss zeitgemäßer und gezielter ein schnellerer und besserer Studienfortgang angeboten werden, und es muss richtungsweisende Forschungsschwerpunkte geben. Mein Anliegen ist es, dass die Vielfalt der Studien gesichert sein muss. Wir brauchen ein breites, buntes, vielfältiges Geistesleben in unserem Land, es soll aber nichts doppelt und mehrfach angeboten werden. Dies sollte durch neue Formen der Zusammenarbeit erreicht werden.
Wir wollen die internationale Wettbewerbsfähigkeit steigern, wir wollen Flexibilität und Freiräume schaffen, die Universität soll sich als aktiv handelnde Institution etablieren. Das meinen wir mit Vollrechtsfähigkeit beziehungsweise erweiterter Autonomie. Es soll eine eigene Profilentwicklung geben. Verträge über zu erbringende Leistungen sollen an die Stelle von gesetzlichen Regelungen und Vorgaben treten. Die Universität soll zum Dienstgeber des eigenen Personals gemacht werden.
Ich möchte auch die Gelegenheit wahrnehmen, um zu einem sehr aktuellen Thema Stellung zu nehmen und Ihnen den aus meiner Sicht letzten Stand darzulegen, nämlich zur Frage des neuen, modernen, flexiblen Dienstrechts. Eine neue Universität braucht ein neues Dienstrecht, welches jungen und leistungswilligen Menschen im Wissenschaftsbereich neue Chancen gibt. Deswegen hat das spätestens heute Abend oder morgen in Begutachtung gehende neue Universitätslehrerdienstrecht folgende Zielsetzungen:
An die Stelle der Pragmatisierung tritt das Modell des Vertragsbedienstetensystems mit All-inclusive-Gehältern und einer Neuverteilung in gewissen Bereichen: Anheben der Anfangsgehälter und dann ein Abflachen. In Zukunft sind Assistenten jene, die bereits ein Doktorat erworben haben und sich um eine Assistentenstelle bewerben. Diese Assistentenstellen sind grundsätzlich auf sechs Jahre befristet, universitäre Tätigkeiten im Ausland werden auf diesen Zeitraum nicht angerechnet.
In der neuen Professorenkarriere gibt es befristete und unbefristete Stellen für Professoren. Diese Stellen müssen ausgeschrieben werden, und deren Besetzung erfolgt nach einem modernen Auswahlverfahren mit einem besonderen Schwerpunkt auf der Qualitätssicherung. Eine durchgängige Professorenkarriere ist also möglich. Durch ein internationales Peer-review-Verfahren kann nämlich eine befristete Professur auch in eine unbefristete umgewandelt werden.
In der ersten Stufe, nämlich bei den Assistenten, den jetzigen Doktoranden, wird es sich künftig um Ausbildungsverhältnisse handeln, und Flexibilität im ganzen Dienststellenbereich soll durch ein Punktesystem erreicht werden, das an die Stelle der starren Dienstposten-Stellenpläne treten wird. Im Rahmen dieses Gesamtpunktesystems wird die Universität sich bewegen und selbst die für sie wichtigen Positionen festlegen können.
Um alle prophylaktischen und sonstigen Ängste, die herumgeistern, auszuräumen, möchte ich sagen: Die gegenwärtigen Universitätsassistenten in der zweiten Phase können aufhören, sich zu fürchten. Sie bleiben bei entsprechender Qualität im alten System. Das heißt: Wer jetzt als Universitätsassistent in der zweiten Phase tätig ist und sich habilitiert, wird nach altem Recht pragmatisiert. Wer sich nicht habilitiert, kann im Rahmen eines verstärkten Qualifizierungsverfahrens ebenfalls die Pragmatisierung erreichen. Für dieses Qualifizierungsverfahren sind zwei externe Gutachten notwendig. Für die Post-Docs in der ersten Phase der derzeitigen Assistentenausbildung ist dieselbe Regelung vorgesehen. Damit ist sichergestellt, dass diejenigen, die sich jetzt in diesem Assistentensystem befinden, die Sicherheit, die sie sich wünschen, auch haben.
Wie internationale Beispiele zeigen, bedarf es an Universitäten aber auch exzellenter wissenschaftlicher Fachkräfte, welche nach der Zeit der Ausbildung und Sammlung von Erfahrungen als Universitätsassistenten auf Dauerpositionen ihre wissenschaftliche Funktion ausüben können. Diese Funktion umfasst die Aufgabe der hoch qualifizierten Betreuung der Geräte wie auch der Mitarbeit in Forschung und Lehre. Viele Fachleute haben mir gesagt, dass das notwendig ist, und dafür wollen wir eine neue Kategorie im Dienstrecht schaffen, und es wird dann die Aufgabe der Universität sein, die Notwendigkeit eines derartigen Dienstpostens festzustellen. Wenn es diese Notwendigkeit gibt, dann kann ein Universitätsassistent einen derartigen Dienstposten erhalten, er ist aber kein Professor. – Ich glaube, dass solche hoch qualifizierten Mitarbeiter international gesehen üblich und notwendig sind, und wir wollen auch in Österreich diese Möglichkeit schaffen.
Damit ist der Weg zu einem neuen, modernen und flexiblen Dienstrecht an Universitäten auf höchstem Level geebnet. Ich meine, dass wir gerade im Zuge der Begutachtung die Frage dieser wissenschaftlichen Spezialkräfte noch gemeinsam klären können.
Unsere Zielsetzung ist es, gemeinsam mit Ihnen eine Weiterentwicklung einzuleiten, in der unsere Universitäten, unsere Forschung, unsere Studierenden und Lehrenden in Europa eine neue Position bekleiden, in der wir in der Weltklasse mitspielen. Der Zeitplan dafür stellt sich wie folgt dar: Das Dienstrecht wird vom 27. April bis 18. Mai 2001 in Begutachtung sein, wir werden dann alle Einwendungen genau prüfen und mit den Vertretern der verschiedenen Gruppierungen entsprechende Veränderungen vornehmen. Am 29. Mai 2001 soll es im Ministerrat vorgelegt werden, darauf wird die parlamentarische Behandlung folgen. Am 1. Oktober 2001 soll das neue Dienstrecht schließlich in Kraft treten.
Für die volle Rechtsfähigkeit wird es im Sommer eine Punktation geben, die bis November einem allgemeinen großen Begutachtungsverfahren unterworfen wird. Erst dann wollen wir einen Gesetzentwurf erstellen und eine richtige Begutachtung vornehmen. Auch diesbezüglich halten wir uns an unser Angebot: Arbeiten Sie mit, sagen Sie uns Ihre Meinung! Wir wollen eine Vorbegutachtung machen, dass möglichst viele eingebunden und möglichst viele wichtige Meinungen gehört werden.
Ich danke Ihnen für die Bereitschaft zur Teilnahme und freue mich auf die einzelnen Beiträge, aus denen wir sicherlich viele interessante Schlüsse ziehen können werden! (Beifall.)
10.28
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Ich danke der Frau Bundesminister für das Einleitungsreferat.
Impuls-Referate
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Ich leite gleich über zu den Impuls-Referaten und erteile Herrn Universitätsprofessor Dr. Klaus Landfried das Wort. – Bitte.
„Reformen in Deutschland“
10.28
Referent Univ.-Prof. Dr. Klaus Landfried (Präsident der Hochschulrektorenkonferenz Deutschland): Herr Vorsitzender! Frau Bundesminister! Meine Damen und Herren! Reformen in Deutschland: Wieso denn um alles in der Welt? Hochschulreformen: Hat sich denn die über 600 Jahre alte kultivierte, privilegierte, inzwischen auch bürokratisierte und in ihrer heutigen Struktur aus dem 19. Jahrhundert tradierte deutsche Universität als pädagogische Provinz nicht bewährt? – Ja, sie hat sich schon bewährt, aber bei weitem nicht genug.
Wer sich nicht bemüht, besser zu werden, hört auf, gut zu sein. – Das hat kürzlich Hans Zehetmair, der bayrische Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst gesagt.
Kluge Hochschulen und kluge Politiker haben auch schon längst gehandelt. Und dabei hat – ich gestehe es – die Hochschulrektorenkonferenz als Vereinigung von 257 Hochschulen in Deutschland – Theologischen Hochschulen, Universitäten, Fachhochschulen, Kunst- und Musikhochschulen und einigen privaten Hochschulen – eine aktive, konzeptionell gestaltende Rolle gespielt, und zwar im Dialog mit der Politik in Bund und Ländern, was bei uns ein bisschen komplizierter ist, denn wie Sie wissen, sind in Deutschland die Länder im Wesentlichen dafür zuständig und tragen rund 92 Prozent der Finanzen bei. Ferner kam es selbstverständlich zu einem Dialog mit Vertretern der Wissenschaft und der Wirtschaft. – Dass dieser Dialog zum Teil kontroversiell verläuft, wird Sie nicht überraschen.
Unschwer könnte ich Sie nun zum Thema für die Dauer der Aufführung von Beethovens „Fidelio“ informieren oder auch erzählend unterhalten. Sie haben mir 15 Minuten gegeben, und diese will ich einhalten, obschon manche Hochschulmenschen den sorgsamen Umgang mit der Lebenszeit anderer nicht als ihr Markenzeichen führen, insbesondere dann nicht, wenn es sich um Sitzungen so genannter demokratischer Gremien an den Hochschulen handelt. Aber Kürze verkürzt, und für manche dadurch bedingte Schärfe erbitte ich vorweg Pardon!
Meine Damen und Herren! Auf drei Fragen will ich eingehen.
Erstens: Wieso und was wurde in Deutschland reformiert?
Zweitens: Was sind Kernpunkte der Konzeption für die Zukunft des gesamten tertiären Bildungssektors? Wobei hinzugefügt werden muss, dass dieser weit mehr umfassen muss als die Universitäten, und zwar im Rahmen – und das ist ganz wichtig – der sich erweiternden Europäischen Union. Genauer: Wo müssen wir reformieren, um alte wie neue Kernaufgaben erfüllen und – auch das ist wichtig – Grundwerte der alteuropäischen Universitäten im 21. Jahrhundert bewahren zu können?
Drittens: Was antworten wir denen, die aus echter Sorge, aber eben nicht gut informiert, denen, die aus meist unberechtigten, aber umso heftiger artikulierten Ängsten, weil noch weniger gut informiert, und denen, die in berechtigter Sorge um den Erhalt nicht leicht zu rechtfertigender Besitzstände, meist ebenso wenig gut informiert, nicht immer harmonisch im polyphonen Chor der Bedenkenträger mitsingen?
Zur Frage: Wieso und welche Reformen? – Ich rede jetzt nur über die letzten zehn Jahre.
Erstens: Die große und überfällige Bildungs‑ und Ausbildungsexpansion der sechziger und siebziger Jahre – in Deutschland stehen insgesamt 91 Prozent des Altersjahrgangs 19 bis 21 entweder in beruflicher oder in einer wissenschaftlichen Ausbildung oder haben diese schon durchlaufen – hatte eine mit ihr zeitlich einhergehende Verwandlung der alten Universität hervorgebracht, und zwar von einer dem Anspruch nach auf gleichberechtigte Kollegialität gegründeten, sehr kleinen und im Selbstverständnis ständisch elitären Korporation des 19. Jahrhunderts in eine sich demokratisch gerierende, zahlenmäßig große, in Ständen fragmentierte Anstalt von Gnaden der Ministerialbürokratie. Viele, darunter auch die Hochschulrektorenkonferenz, hielten diese Entwicklung für nicht mehr zukunftsfähig.
Zweitens: Die dramatische Steigerung des Anteils der Studierenden an einer Altersgruppe von unter fünf Prozent noch vor 25 oder 30 Jahren auf über 30 Prozent schlug sich nicht im individuellen Selbstverständnis vieler Lehrender und auch nicht im institutionellen Selbstverständnis der meisten Universitäten nieder. Von rühmlichen Ausnahmen in einigen naturwissenschaftlichen und vor allem in den technischen Fächern abgesehen, herrschte Elfenbeinturm-Mentalität, sowohl aus pseudo‑progressiven wie aus traditionalistisch-ideologischen Motiven.
Drittens: Der wachsende Bedarf nach Aufgaben, Qualifikationsniveau und fachlicher Vielfalt differenzierter Bildung und Ausbildung – immer beides zusammen – wie auch Forschung und Entwicklung fand zu wenig Resonanz. Die Universitäten waren überwiegend an ihrem eigenen Nachwuchs interessiert. Insbesondere zwischen Universitäten und Wirtschaft gab es statt Dialog auf gleicher Augenhöhe Sprachlosigkeit und wechselseitige Verdächtigung.
Kurz: Die Organisations‑ und Entscheidungsstrukturen bedurften und bedürfen, vor allem in Fragen der Ressourcenverteilung, trotz vieler Fortschritte in einigen Ländern – das ist in den Ländern bisher nämlich ganz unterschiedlich gelaufen – ebenso einer Modernisierung wie die Lehr‑ und Lerninhalte, die Gestaltung der Studienstrukturen und auch die früher fast nur entlang der Fächergrenzen organisierte Forschung und die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, von einem mit der Härte und zugleich unflexiblen Sprödigkeit des Betons vergleichbaren, leistungsfremden, an Anreizen zu Engagement und nachhaltigem – das heißt übrigens auch: ökologischem – Wirtschaften freien, das heißt museumsreifen Haushalts-, Dienst- und Tarifrecht ganz zu schweigen. – Ich rede von Deutschland.
In allen drei Feldern wurde und wird, länderweise zum Teil unterschiedlich, reformiert und gestritten. Manche vergessen beim Streit um diese Reformen leider, dass es sich hiebei um internationalen Wettbewerb handelt, nämlich den Wettbewerb der Kultur-, Wissenschafts- und Wirtschaftsregionen, und da wollen auch wir Deutsche, wie Sie, vorne mitspielen.
Was haben wir erreicht? – Wir haben vor allem einen Aufbruch in den Wettbewerb erreicht. Wettbewerb ist das Element der Bewegung. Wir haben etwas mehr, aber noch nicht genug institutionelle Eigenverantwortung der Hochschulen erreicht. Es gibt da und dort flexibilisierte, sogar globalisierte Haushalte. Es gibt bereits Kosten- und Leistungsrechnung und teilweise auf differenzierte, wissenschaftsadäquate Indikatoren gestützte Ressourcenzuteilung sowie seit kurzem auch eine – ich bin jetzt ganz vorsichtig – auf etwas mehr Arbeitsmarktorientierung und gewisse materielle Leistungsanreize setzende Dienstrechtsreform. Das ist bei uns – wie bei Ihnen auch – noch in Bewegung, die Reform gilt zunächst für Professorinnen und Professoren, aber wir wollen solche Neuerungen natürlich auch für die anderen. Schließlich streben wir auch einen international vergleichbaren, unabhängigen Qualifizierungsweg für den wissenschaftlichen Nachwuchs außerhalb der Habilitation an.
Es gibt inzwischen viele fachübergreifende Graduiertenkollegs und Forschungszentren – Forschung gibt es nicht mehr nur an den Fakultäten –, schnellere Entscheidungswege und klare, persönlich zurechenbare Verantwortung der Rektorate – nicht des Rektors, sondern der Rektorate! – bei der Ressourcenentscheidung. Entsprechend dem Bologna-Prozess gibt es die Wiedereinführung – die Wiedereinführung, meine Damen und Herren! – der bis ins 19. Jahrhundert hinein existierenden zweistufigen Studiengänge: Bakkalaureus-Bachelor und Magister neuer Art, Master.
Über 600 Programme dieser Art laufen jetzt an Universitäten wie Fachhochschulen, allerdings hapert es – das will ich offen zugeben – noch mit der lange vom Wissenschaftsrat empfohlenen neuen, quantitativen Verteilung der Studienplätze im Tertiärbereich, etwa nach dem Vorbild der Niederlande. Nach meiner Auffassung müssten etwa zwei Drittel der Studierenden in auf Berufsfelder orientierten, von Praxisphasen durchzogenen Studiengängen an Berufsakademien und/oder Fachhochschulen und ein Drittel in den durch Vertiefung der Forschungsmethodik und durch einen Vorrang der auf zunächst zweckfreie und selbstbestimmte Erkenntnis gerichteten Forschung gekennzeichneten Universitäten studieren. Davon sind wir noch weit weg.
Meine Damen und Herren! Mit dieser sinnvollen quantitativen Neuorientierung der Studienanfänger hat es aus Gründen, die sehr viel mit dem Standesdenken juristisch vorgebildeter Ministerialbeamter zu tun haben, noch nicht so recht geklappt. Immerhin werden jetzt aber in mehr Ländern die dualen Studiengänge – halb Berufsbildung, halb Studium – gefördert. Die Absolventen dieser Berufsakademien haben praktisch eine Arbeitsplatzgarantie.
Auch Fachhochschulabsolventen haben durchschnittlich ein deutlich besseres Beschäftigungspotential als Universitätsabsolventen. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz befinden sich inzwischen mehr als 40 Prozent der Studienanfänger im Fachhochschulbereich.
Es gibt an vielen Hochschulen Carreer-Centers und Existenzgründer-Trainings, um Leute, welche die Hochschulen verlassen, auf die Arbeit draußen in der Wirtschaft vorzubereiten. Es gibt Evaluations- und Akkreditierungsagenturen, um die im Wettbewerb zentrale Aufgabe der Qualitätssicherung – das ist das Thema auch in Europa – zu erfüllen.
With the permission of the president I paraphrase and extend a sentence of the American Declaration of Independence: „In God we trust. But all others have to prove their quality.“
Auch die seit den achtziger Jahren heruntergewirtschaftete finanzielle Förderung bedürftiger Studenten, BAföG, ist Gott sei Dank ein Stück weit verbessert worden und hat wieder mehr Mittel erhalten. Dialog und Kooperation mit den Unternehmen, aber auch mit den Gewerkschaften haben überall spürbar zugenommen. Privatleute wie Unternehmen engagieren sich, zum Teil über Stiftungen, mit Stiftungsprofessuren und anderen gemeinnützigen Investitionen. Verglichen mit den Steuermitteln sind diese Beträge freilich winzig.
Das heißt, dass Bildung und Ausbildung, Forschung und Entwicklung in Deutschlands Hochschulen unterschiedlichen Typs ganz überwiegend öffentliche Aufgaben in staatlicher Verantwortung bleiben und bleiben sollen, was allerdings bei entsprechender Gestaltung von Leistungsverträgen zwischen Staat und eigenverantwortlicher Hochschule – diese muss aber wirklich eigenverantwortlich sein – privatrechtliche Organisationsformen in öffentlichem Eigentum nicht nur nicht ausschließt, sondern erst richtig sinnvoll macht.
Ich habe bewusst die Frage nach dem Wieso und nach dem Inhalt der Reformen ausführlicher behandelt, weil damit implizite die Umrisse unserer zwischen den politischen Parteien in Deutschland wenig strittigen Konzeption für den Tertiärbereich schon deutlich wurden. Auch sind Ansätze für eine sachliche Auseinandersetzung mit den Bedenkenträgern daraus leichter zu gewinnen. Daher kann ich mich für die integrierte Beantwortung der beiden noch offenen Fragen – auch der Zeit halber – auf gewisse Pointierungen beschränken. Wem solche Pointierungen nicht genügen, der findet dazu mehr zum Beispiel in meinem englischen Beitrag auf dem Kongress der Europäischen Universitätsvereinigung in Salamanca vor vier Wochen, und zwar auf der Homepage der HRK unter http://www.HRK.de, Stichwort „Salamanca“.
Neun Bemerkungen zum Abschluss:
Erstens: Nur ein nach Aufgaben und theoretischen Anforderungsgraden differenzierter Tertiärbereich ist in diesem Wettbewerb zukunftsfähig.
Zweitens: Aufgabe der Hochschulen ist und bleibt es, neues Wissen zu schaffen, altes Wissen kritisch zu bewerten und damit zu bewahren, junge und ältere Lernende – die älteren Lernenden bitte unter dem Motto „Lebenslanges Lernen“ nicht vergessen! – zu unterrichten, wie man vollzeitlich oder nebenberuflich selbst lernt – nicht Nürnberger Trichter! –, übrigens auch am weltweit vernetzten Bildschirm.
Aufgabe der Hochschulen ist es, sich um ihre Absolventen zu kümmern.
Aufgabe der Hochschulen ist es, institutionell wie individuell ethischen Leitlinien zu folgen, für deren Entwicklung im Dialog die Hochschule ein Forum bietet und bieten muss. Aufgabe der Hochschulen ist es, im Dialog mit den Unternehmen die wirtschaftliche Nutzung neuen Wissens und Könnens dort zu ermöglichen und zu unterstützen, wo ethische Verantwortung dies erfordert oder doch wenigstens zulässt. – Und all dies ohne Rücksicht auf nationale Grenzen!
Drittens: Es gibt die von Forschenden – möglichst mit etwas weniger hierarchischer Organisation als bisher – selbstbestimmte, vor allem an Erkenntnis orientierte Forschung ebenso wie zielorientierte Auftragsforschung. Die Unterscheidung von Grundlagenforschung und Anwendungsforschung ist nicht zukunftsfähig. Gerade die selbstbestimmte Forschung braucht die Freiheit, in Erwartung des Unerwarteten zu arbeiten.
Viertens: Die Freiheit der Inhalte wissenschaftlicher Lehre wie Forschung von Frage‑ wie Antwortverboten bleibt konstitutiv für die Innovationskraft der Hochschulen als Zukunftswerkstätten der Gesellschaft, wie unser Bundeskanzler das in seiner Regierungserklärung gesagt hat.
Die Sicherung dieser Freiheit, auch gegen die meist selbstgerechte „political correctness“, hängt mehr von persönlicher Zivilcourage – das heißt: Charakter – ab und weniger, aber auch, vom Funktionieren des Rechtsstaates. Diese Freiheit hängt nicht ab von total unkündbaren beamteten oder ähnlichen Dienstverhältnissen oder auch von zeitlich unbeschränkten Studienzeiten auf Kosten der Steuerzahler. Das zum Teil beschämende und zum Teil mutige Handeln deutscher Wissenschaftler in den vergangenen 100 Jahren hatte mit ihrer dienstrechtlichen Stellung überhaupt nichts zu tun.
Ich erlaube mir auch, die Frage zu stellen, wieso kreative HandwerkerInnen und Facharbeiter, Anwälte und UnternehmerInnen durch Wettbewerb und Unsicherheiten der Marktentwicklung in ihrer Leistungsfähigkeit eher gestärkt denn geschwächt werden, Menschen in der Wissenschaft aber auch bei mangelnder Leistung praktisch bedingungslos unkündbar sein sollen.
Fünftens: Leistungsverträge, zum Beispiel zwischen Staat und Hochschule, erfordern Qualitätsbeurteilung im Vergleich. Es ist eine Chimäre zu behaupten, diese zerstöre die Freiheit oder führe zu einem Evaluations-Leviathan. Gesunder Menschenverstand reicht aus, um das zu verhindern.
Sechstens: Natürlich lassen sich die vielfältigen Aufgaben von Hochschulen nicht mit Begriffen wie „Käufer-“ oder „Verkäufer-Markt“ angemessen abbilden, aber dies entbindet unsere künftig eigenverantwortlichen Einrichtungen nicht von der Pflicht, in transparenter, nachvollziehbarer Weise über ihren sorgfältigen Umgang mit Steuermitteln Rechenschaft vor entsprechend kompetenten Prüfern – das muss man dazusagen – abzulegen, denn die formale Beachtung von Haushaltsvorschriften genügt dafür überhaupt nicht.
Siebentens: Hochschulen sind Dienstleistungs-Unternehmen in der Wissenschaft, also Unternehmen eigener Art, aber doch Unternehmen, und deshalb brauchen sie ein professionelles Management durch hiefür speziell trainierte – das lernen die nämlich nicht in der Wissenschaft – Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und nicht durch mehr oder weniger erfolgreiche Banker, Automobil- oder auch Tourismus-Manager. Nur Wissenschaftler wissen, wie Wissenschaft geht.
Achtens: Es gibt keine Garantien, dass all diese schönen neuen Strukturen alle Probleme lösen – überhaupt nicht! –, vielmehr gibt es auch eine Menge Risiken, wie immer im Leben, wenn man etwas ändert. Vor der falschen Idealisierung der Vergangenheit, selbst der von manchen so gerühmten Universität Wilhelm von Humboldts, sollten wir uns jedoch hüten: Ein Blick in die Geschichte deutscher Universitäten des 19. und des 20. Jahrhunderts bringt mindestens so viel – wenn Sie mir noch einen englischen Ausdruck gestatten – „Vanity Fair“ und Schlimmeres ans Tageslicht wie wissenschaftliche und charakterliche Spitzenleistungen.
Neuntens und unvermeidlich: „Sans argent tout l’honneur est seulement une maladie.“ So oder ähnlich heißt es bei Jean Racine. Im Klartext: Angemessene Betreuungsrelationen bei vernünftigen Strukturen sind die Voraussetzung für den Erfolg. Unsere Schweizer Freunde und Nachbarn investieren pro Kopf und als Anteil im Budget ungefähr doppelt so viel wie Bund und Länder in Deutschland in ihre Hochschulen, das heißt: in ihre Zukunft. Sie haben damit auf jene Frage geantwortet, die Sir Winston Churchill einst an seine Landsleute richtete – mit Ihrer Erlaubnis, Herr Präsident, werde ich noch einmal Englisch zitieren –:
„If you think education is too expensive, why don’t you try ignorance?“ – Vielen Dank. (Beifall.)
10.45
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Ich möchte nur der Ordnung halber feststellen: Ich bin nicht Präsident, sondern nur der Vorsitzende des Wissenschaftsausschusses.
Ich darf nunmehr Herrn Professor Dr. Ulrich Gäbler um sein Referat bitten.
„Autonomie-Erfahrungen aus der Schweiz“
10.46
Referent Univ.-Prof. Dr. theol. Ulrich Gäbler (Rektor der Universität Basel): Herr Vorsitzender! Frau Bundesminister! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Zuerst möchte ich sagen, dass ich mich, was die Schweizer Situation betrifft, sowohl der Analyse von Herrn Kollegen Landfried wie auch den meisten seiner Schlussfolgerungen und seiner Forderungen anschließen kann.
Wenn es um Autonomie geht, dann sitzt der Teufel im Detail beziehungsweise im Konkreten. Aus diesem Grunde werde ich, wenn Sie gestatten, etwas ins Konkrete gehen. Ich möchte zuerst allgemein etwas zum schweizerischen Universitätssystem sagen, dann werde ich mir die Freiheit nehmen, etwas zu meiner eigenen Universität zu sagen, weil sie die Autonomie sehr weit vorangetrieben hat, und schließlich werde ich, wie es sich gehört, ein paar Schlussfolgerungen ziehen.
Ich beginne mit dem schweizerischen Universitätssystem: Wie es der eidgenössischen Verfassung entspricht, ist auch das Universitätssystem nach Bund und Kantonen zweigeteilt. Es gibt kantonale Träger und Bundesträger. Seit dem 19. Jahrhundert finanziert der Bund eine Universität, und zwar die Technische Universität Zürich, im 20. Jahrhundert ist eine zweite Universität, die Technische Universität Lausanne, hinzugekommen. Die beiden Eidgenössischen Technischen Hochschulen in Zürich und Lausanne werden also direkt vom Bund finanziert. Daneben gibt es zehn kantonale Universitäten, maximal eine Universität pro Kanton, und in jüngster Zeit sind zwei dazugekommen, nämlich im Tessin und im Kanton Luzern.
Steuerung und Finanzierung hängen aufs Engste zusammen. Im Bereich der eidgenössischen technischen Hochschule werden die beiden technischen Hochschulen und die vier wissenschaftlichen Anstalten durch ein eigenes Bundesgesetz gesteuert, das festhält, dass ein eigener Rat, nämlich der Rat der Eidgenössischen Technischen Hochschulen, sozusagen im Auftrage des Parlaments und des Bundesrates – welcher in der Schweiz das Kabinett oder der Ministerrat ist – die beiden technischen Universitäten und die vier wissenschaftlichen Anstalten steuert.
Im Rahmen dieses ETH-Bereiches sind die Universitäten mehr oder weniger autonom. Sie haben mittlerweile einen vierjährigen Leistungsauftrag bekommen, und sie sind autonom sowohl betreffend das Personalrecht als auch betreffend die Mittelallokation und die Verfügungsgewalt über die Immobilien. Der vierjährige Leistungsauftrag wird in jährlichen Tranchen durch die Finanzierung realisiert, und der ETH-Rat ist verpflichtet, dem Bundesrat jährlich respektive dem Parlament alle vier Jahre zu rapportieren.
Um Ihnen eine Idee von den Größenordnungen zu geben: Der ETH-Bereich kostet jedes Jahr etwa 1,6 Milliarden Franken. Schnell umgerechnet – die Kurse schwanken ja nicht sehr – sind das etwa 15 Milliarden Schilling für diese beiden technischen Hochschulen und die vier wissenschaftlichen Anstalten.
Daneben gibt es den kantonalen Bereich, die zehn Universitäten der Kantone: Zu der Finanzierung dieser zehn kantonalen Universitäten trägt der Bund bei. Er hat ein eigenes Universitäts-förderungsgesetz gemacht – aus verfassungsmäßigen Gründen kann er kein Universitätsgesetz machen, sondern nur ein Universitätsförderungsgesetz –, und jeder Kanton, der eine Hochschule trägt, hat ein eigenes Universitätsgesetz. – Das ist die gesetzliche Grundlage für die kantonalen Universitäten. Die Steuerung dieser Universitäten erfolgt durch den jeweiligen Kanton einerseits und auf Grund der Bundesbeiträge andererseits. Das schaut relativ einfach aus, ist aber doch etwas komplizierter.
Damit komme ich zu den Details. – Um Ihnen die Zahlen präzis zu nennen: Meine eigene Universität hat ein Budget von etwa 320 Millionen Franken im Jahr. Wir sind eine sehr kleine Universität, und das ist jetzt ohne die medizinische Fakultät gerechnet. Das Budget bewegt sich also in der Gegend von 3 Milliarden Schilling. Diese Finanzierung erfolgt aus verschiedenen Quellen: Etwa 50 Prozent kommen aus dem Kanton, in unserem Fall sind es zwei Kantone, der Kanton Basel Stadt und der Kanton Basel Land. Gesteuert werden wir von Seiten des Kantons durch einen Leistungsauftrag, der relativ global formuliert ist. 50 Prozent kommen also von den beiden Kantonen, und die restlichen 50 Prozent setzen sich aus ganz verschiedenen Quellen zusammen.
Vom Bund bekommen wir gemäß Universitätsförderungsgesetz 30 Millionen Franken. Das sind weniger als 10 Prozent des Gesamtaufwandes, und dies ist bereits leistungsbezogen, denn dieser Bundesbeitrag ist abhängig von der Anzahl der Studierenden und von der Einwerbung der Forschungsmittel: Je mehr Forschungsmittel wir einwerben, desto höher ist der Bundesbeitrag.
Außerdem tragen zur Finanzierung der Universität auch jene Kantone bei, die Studierende an unsere Universität schicken. Da gibt es eine Kopfprämie: Für ein Landeskind an unserer Universität, das Geisteswissenschaft studiert, muss ein Kanton 10 000 Franken bezahlen, für eines aus dem naturwissenschaftlichen Bereich etwa 20 000 Franken und für eines aus dem medizinischen Bereich etwa 40 000 Franken. All diese Beträge sind allerdings für die Universität nicht kostendeckend.
Schließlich gibt es Beiträge aus der nationalen Forschungsförderung, dem Schweizerischen Nationalfonds, und zwar noch einmal in der Höhe von 30 Millionen Franken. Das ist ein wichtiger Teil!
Ein mit der Zeit immer wichtiger werdender Teil – Herr Landfried hat darauf hingewiesen – sind die eingeworbenen Drittmittel auf Grund von Kooperation mit der Industrie oder auf Grund von Sponsoring. Das macht bei uns 46 Millionen Franken aus, ist also höher als der Bundesbeitrag, der Beitrag der anderen Kantone und der Beitrag aus nationalen Stiftungsmitteln.
Schließlich machen die Universitäten noch selbst Einnahmen aus Studiengebühren, die, um das gleich zu sagen, etwa dieselbe Höhe haben wie die in Österreich geplanten. Außerdem ist die Universität dabei, Eigenkapital aufzubauen, und aus den Kapitalerträgen unseres Eigenkapitals finanzieren wir auch Teile der Universität. – So viel zur Finanzierung.
Wenn Sie sich diese Finanzierungssituation anschauen, dann wird klar, dass es eine ganze Reihe von Mitspielern an der Universität gibt, dass aber keiner dieser Mitspieler die Universität majorisieren kann, sicherlich nicht der Bund – die da oben in Bern, wie wir immer wieder zu sagen pflegen – mit seinem 10-Prozent-Anteil. In der Sprache der Wirtschaft sagen wir dann: Der Bund ist ein Minderheitsaktionär und soll uns nicht so viel hineinreden.
Die Universität selbst wird in Analogie – ich sage das allerdings eher zurückhaltend, damit keine Missverständnisse aufkommen – zum schweizerischen Aktienrecht mit einem Universitätsrat und einem Rektorat geleitet und gesteuert. In der Schweiz ist dann von Verwaltungsrat und Direktion oder Geschäftsleitung die Rede, Sie würden es Aufsichtsrat und Vorstand nennen. Ich füge allerdings gleich hinzu, dass in der Schweiz Aufsichtsrat und Vorstand generell sehr viel enger zusammenarbeiten als in Deutschland oder in Österreich. So sind etwa bei den beiden großen Pharmafirmen Basels, sowohl bei der Novartis als auch bei der Hoffmann La Roche Aktiengesellschaft, der Vorsitzende des Vorstandes und der Vorsitzende des Aufsichtsrates identisch, das ist jeweils dieselbe Person. Umgelegt auf die Universität heißt das, dass es eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Universitätsrat und Rektorat gibt.
Der Universitätsrat an unserer Universität setzt sich aus zwölf Persönlichkeiten zusammen, von welchen neun durch die beiden kantonalen Regierungen des Kantons Basel Stadt und des Kantons Basel Land gewählt sind, und zwar im Verhältnis 2:1. Sie dürfen nicht Mitglieder der Universität sein, sie sind alle extern. Und ich sage es hier in diesem Haus mit großer Freude, dass der Vorsitzende des Universitätsrates meiner Universität der CEO der JungbunzlauerGruppe, also dieses österreichischen Unternehmens, ist und aus diesem Grunde besonders viel Verständnis für einen aus Österreich kommenden Rektor hat.
Abgesehen von diesen neun gewählten Mitgliedern hat der Universitätsrat bei uns drei so genannte sitzende Mitglieder, nämlich den Rektor selbst, den Verwaltungsdirektor der Universität – Sie würden sagen: Kanzler – und den Sekretär des Universitätsrates.
Der Universitätsrat ist bei uns an die Stelle der Politik getreten. Er hat sozusagen alle Rechte des Ministeriums übernommen, von den Berufungen über eine eigene Personalordnung, den Schwerpunkt Bildung bis zum Budget und zur Rechnung. Wir haben eine extern geprüfte Rechnung durch eine unabhängige Kontrollstelle wie ein normaler Industriebetrieb. Die Rechnung ist glücklicherweise wieder abgenommen worden und wird demnächst veröffentlicht werden. Ich kann Ihnen in diesem Zusammenhang – wie Kollege Landfried – auch eine Homepage empfehlen. Die Wahl der Professoren und Professorinnen und die Etablierung und Aufhebung von Studiengängen liegen ebenfalls in der Kompetenz dieses Universitätsrates.
Für alle, die um die akademische Freiheit fürchten, füge ich hinzu: Der Universitätsrat darf allerdings nichts beschließen, ohne dass er das Rektorat gehört hat. Und das ist die andere Seite der Medaille: Das Rektorat beziehungsweise die Geschäftsleitung, also die operative Leitung, besteht aus dem Verwaltungsdirektor – wir haben jetzt einen Ökonomen – und drei bis vier Professorinnen oder Professoren aus der eigenen Universität. Das Rektorat ist zuständig für alle gesamtuniversitären Geschäfte, die Repräsentation der Universität nach außen, die Organisation und Verwaltung der Universität, für die Vorbereitung der Geschäfte und die Berufungsverhandlungen. Es besteht also eine Analogie zu einem aktiennotierten beziehungsweise börsennotierten Unternehmen. Ich betone allerdings nochmals: Es besteht eine Analogie, es ist aber nicht identisch, denn wir im Rektorat, die wir für die Wissenschaft und für die akademische Kultur an der Universität verantwortlich sind, tun auch alles dazu, dass der Unterschied zu einem Industrieunternehmen deutlich bleibt.
Nunmehr ziehe ich vier oder fünf Schlüsse auf Grund unserer Erfahrungen mit dieser Art von Autonomie.
Als Erstes ist wichtig, dass diese Art der Autonomie, wie wir sie an unserer Universität haben und wie sie mehr oder weniger auch an anderen Universitäten in der Schweiz besteht, sowohl auf den verfassungsmäßigen Voraussetzungen der Schweiz, auf dem Zueinander von Bund und Kantonen als auch auf der politischen Kultur des Landes gründet. Es gibt bei uns eine ganz bestimmte politische Kultur, die auf Ausgleich, Pragmatismus, Konkordanz und Konsens ausgerichtet ist. All das ist Ihnen vielleicht vertraut. Sie ist aber auch auf möglichst geringe Regeldichte ausgerichtet: Der Staat soll so wenig wie möglich eingreifen. Das gehört zur politischen Kultur der Schweiz und ist ein hohes Gut.
Zweitens: Diese Autonomie ist auf Grund von wirtschafts- und sozialpolitischen Voraussetzungen gewachsen. Ich habe vom Aktienrecht gesprochen, und es geht hiebei um ein hohes Maß an Flexibilität in der Personalordnung. Der Beamtenstatus ist an allen schweizerischen Universitäten abgeschafft. Es gibt die Kündigungsmöglichkeit für Professorinnen und Professoren auch an unserer Universität. Es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit einer Kündigung die Chancen bei Berufungen wesentlich schlechter mache. – Ich kann Ihnen dazu einfach meine eigene Erfahrung weitergeben: Ich habe etwa 30 bis 40 Berufungsverhandlungen geführt, und zwar meistens mit Menschen aus Ländern, in welchen die Professorinnen und Professoren einen Beamtenstatus haben, und ich kann Ihnen sagen, dass sich die Kündigungsmöglichkeit in keinem einzigen Fall als Nachteil herausgestellt hat. Im Gegenteil: Professorinnen und Professoren werden an der Universität sehr häufig selber zu Leiterinnen oder Leitern von Seminaren und Instituten und begrüßen dann die Möglichkeit einer flexiblen Personalpolitik am eigenen Institut und im eigenen Seminar, denn nicht nur sie sind kündbar, sondern auch diejenigen in ihrer Umgebung.
Die dritte Erfahrung: Wir haben an unserer Universität die Autonomie nicht mit einem Schlag eingeführt. Autonomie ist ein gewachsener Zustand beziehungsweise mehr noch: Autonomie wird. Voraussetzung ist, dass sich Universität und Politik über die Zielvorstellung einig sind. Die Zielvorstellung der Autonomie als Zielvorstellung des Universitätswesens muss deutlich sein, und sie kann nur darin liegen – wie Herr Landfried schon ausgeführt hat –, bessere Lehre, bessere Forschung, bessere Wissenschaft zu erreichen. Darüber muss Einigkeit herrschen, und dann haben sich Politik und Universität über den Weg zu verständigen.
Vierter Punkt: Der hohe Grad der Autonomie der Schweizer Universitäten – ich nehme jetzt wieder etwas auf, was Herr Landfried gesagt hat – fördert den Wettbewerb der Universitäten untereinander. Ich bekenne mich ausdrücklich zu diesem Wettbewerb, obwohl wir an unserer Universität Wettbewerbsnachteile in Kauf nehmen müssen. Es handelt sich hiebei um einen Wettbewerb um mehr Ressourcen und um mehr Geld, aber auch, je länger, desto mehr, um den Wettbewerb um die besten Köpfe, seien es die besten Wissenschafter und Wissenschafterinnen, seien es die besten Studenten.
Schließlich ist unbestritten: Universitäten wollen und sollen kein Elfenbeinturm sein. Aber dazu gehört eben auch, dass sie sich den Bedingungen unterwerfen, die in der sie umgebenden Gesellschaft selbstverständlich sind. – Ich danke Ihnen. (Beifall.)
11.02
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Das nächste Referat hält Herr Professor Dr. Welzig. – Bitte.
„Qualitätssicherung, Evaluierung und Schwerpunktsetzung an den Universitäten“
11.02
Referent Univ.-Prof. Dr. Werner Welzig (Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften): Herr Vorsitzender! Frau Bundesminister! Geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Sehr geehrte Anwesende! 13 Impulsreferate sind weniger als ein Impuls. Da bei dieser Enquete aber nun einmal 13 Referate vorgesehen sind, will ich auf dreizehntelfältige, somit ungewollt auf hoffentlich nicht allzu einfältige Weise versuchen, einen gemeinsamen Impuls entwickeln zu helfen.
Unsere Hohen Schulen bedürfen eines solchen Impulses. Sie bedürfen eines starken Impulses von innen wie von außen. Dass diese Veranstaltung als eine Enquete des Gesetzgebers im Hause des Souveräns stattfindet, ist ein gutes Zeichen. Der Gesetzgeber hat die Verantwortung, die Grundsätze und Aufgaben der Hochschulen so zu fassen, dass sie den Arbeitsweisen und Erfordernissen der Wissenschaft, den Erfordernissen der Gesellschaft, den politischen Gegebenheiten unseres Kontinents und den ökonomischen Möglichkeiten unseres Staates entsprechen.
Die Tatsache, dass heute viele Wanderprediger in Universitätsangelegenheiten, mit Klageliedern über die Institution ihr persönliches Ansehen mehrend, unterwegs sind, darf nicht darüber hinweg täuschen, dass das Fundament des Hauses der Wissenschaft und ihrer Lehre von der Politik gelegt wird oder jedenfalls zunächst einmal von der Politik gelegt wird.
In diesem Sinne erlaube ich mir als Bürger dieser demokratischen Republik, deren Recht vom Volk ausgeht, und auch als akademischer Bürger, fünf Sätze zu Materien vorzulegen, die mir wichtiger erscheinen als alle Fragen des Dienstrechtes. – Im Unterschied zu meinem Herrn Nachbarn zur Linken gebe ich kein Gelöbnis ab, die Redezeit einzuhalten. Ich kann Ihnen aber versichern, dass ich davon nicht zur Gänze Gebrauch machen werde.
Erstens: Da ich nach einem evangelischen Theologen auf die Tagesordnung gesetzt worden bin, will ich die Worte eines anderen evangelischen Theologen an den Anfang stellen. Theologen und Literarhistoriker haben den Gebrauch des Zitats gemeinsam. Daher sei auch mir erlaubt, zu zitieren: „Acht und dreißig (Universitäten) zu besitzen, wie die deutsche Nation bis jezt geduldet hat, mag freilich ein großes Unglükk sein, und die Ursach, warum so wenige zu etwas tüchtigem gediehen sind: aber wie soll nun das rechte Maaß gefunden werden?“ – Zitatende.
Was Friedrich Schleiermacher auf diese Weise im Jahre 1808 gesagt hat, würde aus dem Mund eines Zeitgenossen in den Ohren von Zeitgenossen und auf heutige Zahlen übertragen wahrscheinlich als pure Polemik empfunden werden. Dass derselbe Schleiermacher mit der Bemerkung fortfährt, man sollte sich nicht anstrengen – Zitat –, „Leichen frisch zu halten“ – Ende des Zitats –, geht unserem Verständnis nach über den Anstand hinaus, den auch Polemik zu wahren hat.
Dennoch darf man der von Schleiermacher gestellten Frage nicht ausweichen: Brauchen wir hier in Österreich tatsächlich all jene Anstalten, die wir Universitäten nennen? Vor allem aber: Brauchen wir sie als Universitäten?
Zweitens: Von der Prämisse des Satzes aus der Ferne ausgehend, den ich zitathaft und nur zu einer Frage führend aufzunehmen gewagt habe, sei aus meiner Raum- und Zeitgenossenschaft ein zweiter, eigener Satz als Aussagesatz formuliert: Wir brauchen – so behaupte ich – nicht alle Fakultäten, die es an österreichischen Universitäten gibt, und wir brauchen nicht alle Fakultäten in der Gestalt, in der es sie heute gibt. Keine Argumente außer dem, dass Ruhe die erste Bürgerpflicht ist, sprechen dafür, um nur drei Beispiele anzuführen, a) dass das Nebeneinander der naturwissenschaftlichen Fakultäten an den Technischen Universitäten und Universitäten in Graz und in Wien in der gegenwärtigen Form aufrecht erhalten wird, b) dass die gesamte Zahl der heute in Österreich bestehenden universitären Architektureinrichtungen – das sind drei Fakultäten und zwei zusätzliche Studienrichtungen – aufrecht erhalten wird, c) dass alle vier staatlichen katholisch-theologischen Fakultäten aufrecht erhalten werden.
Drittens: Die geistes- oder kulturwissenschaftlichen Fakultäten dieses Landes – so behaupte ich – könnten ihre Studienfächer weit besser verteilen, nämlich schwerpunktorientiert, sparsamer und zugleich ergiebiger. Für die zurzeit maßgebliche Maxime, dass möglichst allenthalben alles angeboten werden soll, gibt es keinen guten Grund, das heißt, keinen in der Sache der Fächer liegenden Grund. Es ist einfach nicht wahr, dass beispielsweise Alte Geschichte und Altertumskunde oder Klassische Archäologie in Österreich an vier Standorten gepflegt werden müssen. Selbst das scheinbare studentische Grundrecht, dass man eine Fächerkombination jeweils am selben Ort studieren können muss, ist meiner Überzeugung nach nicht begründbar. Was spräche beispielsweise dagegen, Slawistik und Romanistik an zwei verschiedenen Orten zu studieren, wenn dies in geeigneter Abfolge möglich ist?
Viertens: Der österreichische Gesetzgeber muss seine Verantwortung für die Universitäten dieses Landes – so behaupte ich – heute grundsätzlich in anderer Weise wahrnehmen als in vergangenen Zeiten. Die Einrichtung von Fakultäten, Universitäten und Studienrichtungen kann nicht mehr nur auf nationale Notwendigkeiten und Angebote Rücksicht nehmen. Es ist geradezu absurd, wenn eine so exemplarisch europäische Institution wie die Universität heute nur einzelstaatlich konzipiert und fortentwickelt wird. „Einzelstaatlich“ ist übrigens vielleicht gar nicht zutreffend. Realistischerweise müsste man sagen, dass Österreichs neuere Universitätsgründungen vor allem den Bedürfnissen von Landeshauptleuten Rechnung tragen: Kein Tunnel, aber eine Universität! – Das mag eine regionalpolitisch brauchbare Forderung sein. Forschungspolitisch sinnvoll ist sie jedoch nicht, auch wenn es vielleicht den gegenteiligen Anschein hat.
Fünftens: Da ich vor einem Mann der Industrie auf die Tagesordnung gesetzt wurde, der über die Erwartungen sprechen wird, die die Wirtschaft an die Universität richtet, will ich mit einer Bitte schließen.
Meine Bitte lautet, darüber nachdenken zu wollen, ob wir das Mühlespiel, das hierzulande mit Konstellationen wie „akademischer Bereich versus Industrie“ eröffnet wird, wirklich weiter spielen müssen. Was ist mit „Mühlespiel“ gemeint? – Ich meine das Hin und Her zwischen den Ansprüchen von Ökonomie und Industrie auf der einen und der Verteidigung der universitären Freiräume auf der anderen Seite. Ich meine mit anderen Worten den Konflikt zwischen Nutzen und Neugier.
Auf der Basis der Verfassung dessen, was wir heute Universität nennen, ist dieser Konflikt nicht zu lösen. Wir haben in den vergangenen Jahren nahezu alles, was „oberhalb“ der Schule der Weitergabe des Wissens dient, in den Stand von Universitäten erhoben. Offenbar waren wir prestigegetrieben! Anders ist es nicht erklärbar, dass wir jene Institution, deren Motor Neugier und Mitteilung – vor allem auch zwischen den Generationen – bleiben muss, wenn wir sie nicht überhaupt aufgeben wollen, zur Generalinstanz der Weitergabe und Weiterentwicklung allen höheren Wissens gemacht haben.
Ich will an dieser Stelle nicht auf die Frage eingehen, was denn eine Universität ausmacht, die sich in der europäischen Tradition dieser Institution weiß. Ich will an dieser Stelle auch nicht proklamieren, dass wir die Institution der Universität weiterhin brauchen werden. Ein Punkt muss uns aber so rasch und entschieden wie möglich bewusst werden: Wie der österreichische Gesetzgeber heute „Universität“ definiert und was er alles darunter versammelt, passt mit den Aufgaben, die man heute an Hohe Schulen stellt, nicht zusammen. Man sehe sich die leitenden Grundsätze an, die dem Universitäts-Organisationsgesetz 1993 vorangestellt sind.
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Unbeschadet Ihrer Parteizugehörigkeit werden Sie erkennen, wie altertümlich diese Zielvorgaben neben den ökonomischen und industriellen Notwendigkeiten unserer Tage wirken! Wenn da beispielsweise von der „Vielfalt der Lehrmeinungen“ oder von der „Lernfreiheit“ als elementare Voraussetzungen die Rede ist, dann könnte man glauben, Höhlenkinder im Pfahlbau rufen uns ihre Losungsworte zu, als ginge es um Meinungen und angenehme Prüfer.
Wir werden um eine tief greifende Entscheidung über das Nebeneinander von Hohen Schulen unterschiedlichen Typs nicht herumkommen. Die Universitäten werden nur dann Brennpunkte im geistigen Leben dieses Landes und dieses Kontinentes bleiben, wenn neben ihnen anders organisierte und anders arbeitende Hohe Schulen Aufgaben der Weitergabe und der Vermehrung des Wissens übernehmen.
Ich bin überzeugt davon, dass die Universitäten sich in dieser Auseinandersetzung bewähren können. Ich bin überzeugt davon, dass das zum Schimpfwort gewordene Wort „akademisch“ seinen Glanz wiedergewinnen kann. Ich bin aber ebenso davon überzeugt, dass dieser schwerfällige, mit Gütern unterschiedlichster Qualität beladene und von einander mit Eifersucht beäugenden Weichenstellern und Lokführern besetzte Güter- und Personenzug, als der sich die Gesamtheit der österreichischen Universitäten heute mühselig dahinbewegt, kein Transportmittel in die Zukunft ist.
Der Gesetzgeber – so wage ich zu schließen – ist gefordert. Er ist rasch gefordert. Er ist in einer schwierigen Materie gefordert. Er ist gefordert, wenn wir die Zukunft gestalten wollen. Auch – mein Nachbar zur Linken verzeihe mir das! – wenn größere europäische Nachbarn in dieser Materie nichts wesentlich Besseres geleistet haben, ist das für uns kein Alibi, untätig zu bleiben.
„Das ist der Fluch von unserm edeln Haus: Auf halben Wegen und zu halber Tat mit halben Mitteln zauderhaft zu streben. Ja oder nein, hier ist kein Mittelweg.“ – Die meisten von Ihnen kennen diese Grillparzer-Stelle oder zitieren sie jedenfalls. Doch es geht nicht um dieses geflügelte Wort aus „Ein Bruderzwist in Habsburg“: „... auf halben Wegen und zu halber Tat mit halben Mitteln ...“.
Mir geht es um das, was daran anschließt. Ferdinand sagt abwehrend zu Mathias – Zitat –: „Wenn man uns drängt, das ist nicht Brauch noch Sitte.“ – Österreichs Gesetzgeber und Österreichs Administration werden einen akademischen Funktionär in gleicher Weise abwehren: „Wenn man uns drängt, das ist nicht Brauch und Sitte.“ Tatsächlich! Doch was der Bruder des Kaisers darauf seinerseits erwidert, sollte uns gemeinsam gegenwärtig sein: „Es drängt die Zeit; wir selbst sind die Bedrängten.“ (Beifall.)
11.15
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Ich darf nunmehr Herrn Generaldirektor Dipl.-Ing. Hochleitner um seine Ausführungen bitten.
„Die Erwartungen der Wirtschaft an Universitäts-Absolventen“
11.15
Referent Generaldirektor Dipl.-Ing. Albert Hochleitner (Siemens AG Österreich): Herr Vorsitzender! Frau Minister! Meine Damen und Herren! Zunächst möchte ich meiner Zufriedenheit Ausdruck verleihen, dass wir die diesjährige Enquete nicht mehr in einem Nebenraum dieses Parlamentes abhalten, sondern im Plenarsaal, der zwar noch immer nicht brechend voll ist, was wir aber vielleicht bei der nächsten Sitzung, die wahrscheinlich in ein bis zwei Jahren folgen wird, doch erreichen können.
Ich glaube, dass schon sehr viel mit dieser Diskussion über die Universitätsreform erreicht worden ist. Wenn ich hier eingeladen bin, gehe ich davon aus, dass ich nicht nur als Leiter von Siemens eingeladen wurde, sondern auch wegen meiner Mitgliedschaft im Rat für Forschung und Technologie, und ich meine, dass zwischen diesen beiden Themen, eben der Universitätsreform und der Tätigkeit des Rates für Forschung und Technologie, ein sehr enger Zusammenhang besteht.
Wenn ich höre, dass gestern die Verhandlungen über das Dienstrecht vorläufig abgebrochen wurden, dann darf ich mit einem kleinen Zahlenspiel beginnen, weil ich glaube, dass es verhältnismäßig hilfreich sein könnte, diese Zahlen einmal auf den Tisch zu legen: Wir reden in Österreich davon, dass wir unsere Forschungsquote von derzeit 1,8 Prozent auf etwa 2,5 Prozent mittelfristig, also bis zum Jahr 2005, anheben wollen. In der Wirtschaft, in der Industrie, sind bei diesen 1,8 Prozent – das entspricht etwa einem Aufwand von 50 Milliarden Schilling – 18 000 Mitarbeiter beschäftigt; und es macht mich in diesem Zusammenhang immer auf der einen Seite stolz und auf der anderen Seite etwas betroffen, wenn ich dazusagen muss, dass 5 000 davon bei Siemens oder der Siemens-Gruppe beschäftigt sind. Wenn man davon ausgeht, dass im Jahr 2005 rund 90 Milliarden Schilling für Forschung und Technologie auszugeben sein werden und bis dahin das Verhältnis von fast 50 Prozent aus der öffentlichen Hand und 50 Prozent aus der privaten Wirtschaft verlassen werden muss und die private Wirtschaft wesentlich mehr zu „verforschen“ haben wird, dann bedeutet das, dass wir dann mit Sicherheit eine Verdopplung der diesbezüglichen Zahl der Mitarbeiter in der Wirtschaft zu erwarten haben, also zusätzliche 18 000 Mitarbeiter.
Das ist auf der Basis der heutigen Zahl der Absolventen der heutigen Hochschulen, insbesondere natürlich der Technischen Hochschulen, gar nicht realisierbar, denn heute gehen rund 1 800 Absolventen jährlich von den Technischen Universitäten ab, und diese Zahl wird im Wesentlichen schon dafür erforderlich sein, die natürlichen Abgänge bei den Unternehmen zu ersetzen.
Ich glaube, vor diesem Hintergrund könnte man die Dienstrechtsdiskussion an den Universitäten etwas entspannter und weniger angstvoll und verunsichert betreiben, denn die notwendigerweise von den Hochschulen abgehenden Mitarbeiter des Mittelbaus werden mit hoher Wahrscheinlichkeit dringendst in der Privatwirtschaft benötigt werden. Ich hoffe, das ist ein wichtiger Hinweis bei den doch sehr ängstlich geführten Diskussionen.
Mein Thema lautet: „Die Anforderungen der Wirtschaft an die Universitäten“. Was sind die wesentlichen Gründe dafür, warum überhaupt Veränderungen notwendig sind? – Viele davon wurden bereits angezogen.
Punkt eins ist die wesentlich zu lange Studiendauer, und das hat wiederum etwas mit der Anzahl der Absolventen zu tun. Die durchschnittliche Studiendauer beträgt 7,4 Jahre in Österreich und 3,5 Jahre in Großbritannien, um nur die beiden Pole dieser Entwicklung zu nennen. Das kann nicht gut sein, und das muss sich dramatisch verändern! Die viel zu hohe Drop-out-Rate von 50 Prozent kann weder für die Studenten noch für die Hochschulen, noch für die Wirtschaft, die diese Absolventen dringend benötigen würde, ein zukunftsverheißender Weg sein.
Dazu kommt eine mit Sicherheit verbesserungswürdige – lassen Sie es mich so sagen – Aufstellung der Universitäten. Als Mann der Wirtschaft steht es mir nicht zu, gegen die Geisteswissenschaften zu sprechen, und ich tue das auch gar nicht, weil ich sie im hohen Maße für erforderlich halte. Wenn man aber weiß, dass von den 360 Studienrichtungen in Österreich rund 40 Prozent insgesamt weniger als zehn Absolventen in zehn Jahren erzeugen – wenn ich das so technisch sagen darf – und 50 Studienrichtungen in den letzten zehn Jahren überhaupt keine Absolventen generieren konnten, dann ist hier einfach irgendetwas falsch. Das hat wiederum mit dem 50-prozentigen Anteil der öffentlichen Hand zu tun, der im Wesentlichen in die Universitäten fließt, bei denen Österreich mit der finanziellen Ausstattung durchaus im europäischen Spitzenfeld oder zumindest im ersten Drittel liegt.
Es ist keine Rede davon, dass diese Fächer abgeschafft werden sollen. Aber ich schließe mich in diesem Punkt Herrn Präsidenten Welzig an: Es müssen diese nicht mehrfach in Österreich angeboten werden. Vielmehr soll diesbezüglich eine Konzentration vorgenommen werden, wie es überhaupt grundsätzlich bei dieser Steigerung von 1,8 auf 2,5 Prozent im Zusammenhang mit der Forschungs- und Technologieentwicklung um Fokussierung und Konzentration geht. Es geht im Wesentlichen darum, sich in der angewandten Forschung der Stärken bewusst zu werden und die Stärken zu verstärken. Aber natürlich darf sich auch die Grundlagenforschung ein bisschen an den Notwendigkeiten der angewandten Forschung orientieren.
Natürlich muss es auch möglich sein, dass sich die Universitäten an den Erfordernissen dieses Landes, an seiner Stellung in Europa und seiner Stellung auf den Weltmärkten orientieren.
Was wünschen wir uns von den Absolventen? – Neben der Fachkompetenz, zu der es nicht viel zu sagen gibt, denn Österreich erzeugt nach wie vor hervorragende Absolventen mit einer guten Ausbildung, wünschen wir uns die immer wieder geforderten social skills. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Halbwertszeit des Wissens ständig sinkt, ist es erforderlich, auch die Methoden entsprechend zu verändern. Wir brauchen neugierige Leute, wir brauchen Leute, die gelernt haben, zu lernen. Wir brauchen teamfähige Mitarbeiter, wir brauchen Innovationsbereitschaft, wir brauchen – um es so auszudrücken – neugierige Teamplayer und nicht solche, die durch ein viel zu langes, im Durchschnitt eben siebeneinhalbjähriges Studium an den Universitäten bereits verbogen sind.
Was erwarten wir uns von den Universitäten? – Ohne jetzt den Ergebnissen des Rates für Forschung und Technologie vorgreifen zu wollen, sage ich, dass etwas ganz sicher ist: Es muss eine viel größere Kooperationsbereitschaft der Hochschulen mit der österreichischen Wirtschaft eingefordert werden. Wir alle wissen, dass die österreichische Wirtschaft im Wesentlichen klein- und mittelständisch strukturiert ist und für diese klein- und mittelständische Wirtschaft natürliche Barrieren im Zugang zu den Universitäten bestehen. Es ist also von den Universitäten zu fordern, dass sie auf die österreichische Wirtschaft zugehen – und nicht umgekehrt!
Zu dieser Kooperation gehört auch eine wesentlich größere Durchlässigkeit im personellen Bereich. Es wird notwendig sein, zu einem intensiven Austausch zwischen Mitarbeitern der Universitäten und der Wirtschaft zu kommen. Ich kann Ihnen sagen: Die Wirtschaft ist dazu bereit. Die Universitäten müssen ihre Aufgaben aber erst erbringen.
Lassen Sie mich mit einigen Punkten schließen, die ich kurz zusammenfassen möchte.
Wir müssen darauf bedacht sein, bereits auf den Vorstufen des tertiären Bereiches in breiter Front eine Verbesserung des Technikinteresses der Jugend vorzubereiten. Das bedeutet auch, dass wir die Volks- und Mittelschulen im hohen Maße mit einzubeziehen haben. Möglicherweise ist es für viele Maßnahmen an den Hochschulen bereits deutlich zu spät.
An dieser Stelle möchte ich noch eine kleine Anmerkung zu den Fachhochschulen machen: So erfreulich diese Entwicklung ist, so unverständlich ist es für mich, dass sich die Universitäten so leicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Es ist nicht einzusehen, warum man es hinnimmt, dass an den Fachhochschulen schon wesentlich früher Studiengebühren verlangt werden durften, und warum Fachhochschulen bereits von Anfang an Aufnahmsprüfungen durchführen konnten, die den Universitäten vorenthalten wurden.
Ich glaube, wir kommen hier zu einer sehr gefährlichen Entwicklung. Darüber hinaus muss ich noch anmerken, dass sich Österreich eines Assets gar nicht wirklich bewusst ist: Unsere Höheren Technischen Lehranstalten haben eine hervorragende Struktur, und die Relation zwischen HTL, Fachhochschulen und Universitäten ist in jedem Fall noch zu überdenken und zu optimieren.
Zweitens: Für die Verkleinerung der Lücke zwischen Angebot und Bedarf sind die Verkürzung der Studiendauer, die Erhöhung des Fachhochschulanteils, die Senkung der Drop-out-Raten, aber auch die Erhaltung der HTL wichtige Voraussetzungen.
Die Vielfältigkeit des Berufslebens sollte sich auch in der Ausbildung beispielsweise durch eine Kombination von Hardware- und Softwarewissen widerspiegeln. So wie wir in den Unternehmen versuchen, „Kaminkarrieren“ zu vermeiden, so sollten auch an den Hochschulen die „Kaminstudien“ im Abnehmen begriffen sein.
Studenten sollten für die Praxis sensibilisiert werden. Die Anwendung von Wissen darf kein schlechteres Image als das Erzielen von Forschungsresultaten haben. In Summe müssen die Universitäten ihre Schnittstellen zur Wirtschaft öffnen, und zwar Schnittstellen für Menschen, für Themen und für Technik. Wir sollten uns immer dessen bewusst sein, dass letzten Endes die Forschungs- und Technologierate eines Landes ein ganz wesentlicher Faktor im Standortwettbewerb Europas und der Welt sein werden. – Danke schön. (Beifall.)
11.28
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Ich möchte der Ordnung halber hinzufügen: Die gestrigen Verhandlungen mit der Gewerkschaft sind nicht abgebrochen, sondern unterbrochen worden. Das ist gerade in dieser sensiblen Situation wichtig. Die Verhandlungen gehen sicherlich noch weiter.
Nächster Referent ist Herr Universitätsprofessor Dr. Bonn. – Bitte.
„Die Reformnotwendigkeit aus der Perspektive der Naturwissenschaft“
11.29
Referent Univ.-Prof. Dr. Günther Bonn (Universität Innsbruck): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Frau Bundesminister! Meine Damen und Herren! Mein Thema betrifft – wie ich glaube – die Naturwissenschaften besonders.
Was bedeutet „Reform“? – Wenn man nachschaut, stellt man fest, dass „Reform“ „Umgestaltung“, „Verbesserung des Bestehenden“ und „Neuordnung“ bedeutet. Das sollte uns klar sein, wenn wir über Reform sprechen.
Das, was ich Ihnen im Folgenden sagen möchte, bezieht sich meines Erachtens auf alle Fachgebiete, insbesondere aber auf die Naturwissenschaften, und zwar deshalb, weil wir es in diesem Bereich mit raschen Veränderungen in der internationalen Forschungslandschaft zu tun haben und mit Flexibilität antworten müssen.
Warum soll man Österreichs Universitäten, wenn sie so gut sind, reformieren? – Ich nenne zwei Punkte dafür: Erstens sind Umgestaltungen und Neuordnungen in Abhängigkeit von der Zeit notwendig, um sich den neuen Gegebenheiten des Umfeldes, der Gesellschaft in der gesamten Breite zu stellen. Zweitens – und das scheint mir hier sehr wichtig zu sein – ist Reform oft notwendig, um auftretende Probleme, seien es lang- oder kurzfristig entstandene, zu beseitigen. – Ich glaube, auf die Naturwissenschaft treffen beide Fälle zu.
Ich möchte mein kurzes Referat in drei Punkte einteilen:
Erstens: Wir haben eine Reform in der Lehre durchzuführen.
Zweitens: Reform der Personal- und Forschungsstrukturen.
Drittens: Reform der gesamten Organisation, schlichtweg: Autonomie.
Lassen Sie mich zunächst einige Worte zu den Verbesserungen im Bereich der Lehre aus naturwissenschaftlicher Sicht sagen: Ich glaube, dass diese Reform aus Sicht der Naturwissenschaft bereits in der Schule beginnen muss. Die naturwissenschaftlichen Fächer wie zum Beispiel Physik und Chemie gehören heute nach internationalen Umfragen zu den unbeliebtesten. Insbesondere besteht das Problem, dass diese Fächer in der breiten Gesellschaft als nicht attraktiv angesehen werden. Das merken wir im Übrigen an unseren Studentenzahlen drastisch.
Diesem Umstand hat – und das sei hier erwähnt, weil ich Mitglied dieses Beirates bin – das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Rechnung getragen und ein großes Projekt namens „IMST – Innovation in Mathematics, Science and Technology“ an die Universität Klagenfurt mit dem Auftrag vergeben, dieses Thema zu hinterfragen. Dabei soll versucht werden, diese Probleme, aber auch die internationalen Zusammenhänge aufzurollen, und es soll auch geklärt werden, warum zum Beispiel so wenige Mädchen naturwissenschaftliche Studien absolvieren wollen. Die Ergebnisse dieser Studie sollen letztlich in die Reform der Universitäten, in erster Linie aber selbstverständlich in entsprechende Modifikationen des Schulsystems einfließen.
Bei der Lehre an den Universitäten haben wir in nahezu allen Fächern, insbesondere aber in den naturwissenschaftlichen und technischen Fächern das Problem, dass die mittlere Studiendauer – das haben wir heute schon gehört – viel zu lang ist. Die durchschnittliche Studiendauer in naturwissenschaftlichen Fächern beträgt in Österreich 15 bis 17 Semester, in Chemie durchschnittlich genau 15,5 Semester. An der ETH Zürich beträgt die Studiendauer für dasselbe Fach durchschnittlich 9 bis 10 Semester. – Ich glaube, dass die neuen Studienpläne, die jetzt in Ausarbeitung sind, aber auch die Studiengebühren – und das wird sich, glaube ich, sehr schnell zeigen – diese Situation verbessern werden.
Ich lege auch sehr großen Wert darauf, zu erwähnen, dass das gesamte Schul- und Hochschulsystem im Rahmen des Ausbildungssystems durchlässig sein muss – von der Schule und Lehrlingsausbildung über die Fachhochschule bis zur Universität. Diese Durchlässigkeit scheint mir sehr wichtig und ein hoher Wert zu sein, den wir beibehalten beziehungsweise anstreben sollten. Als langjährigem Mitglied des Fachhochschulrates liegt mir sehr viel daran.
Meine Damen und Herren! Hinsichtlich der Reformen in der Personal- und Forschungsstruktur werde ich jetzt sicherlich etwas emotioneller: Hervorragende Universitäten auf dieser Welt – wie etwa Stanford, Yale, die Karolinska in Stockholm oder die ETH in Zürich, um nur einige zu nennen, mit welchen unser Institut in Innsbruck kooperiert und wo ich selbst arbeiten durfte – sind geprägt von Leistungskriterien und Schwerpunktsetzung. Dies wiederum setzt, wie in einem erfolgreichen Betrieb, Leitungs- und Verantwortungsstrukturen voraus, insbesondere aber auch, dass nicht jeder tun und lassen kann, was er will. Wir brauchen also eine neue Personalstruktur, die auf Leistung und Verantwortung aufgebaut ist, beziehungsweise wir brauchen schlichtweg ein neues Dienstrecht. Es muss gewährleistet sein, dass der Automatismus in der Karriereleiter durch Leistungsorientiertheit ersetzt wird. Wir brauchen mehr Flexibilität für alle Bereiche und Positionen, und ich glaube, dass das vorgeschlagene Dienstrecht einen ersten – ich betone: einen ersten – Schritt in die richtige Richtung darstellt.
Gestatten Sie mir, die Zahlen des Stellenplanes ein bisschen genauer anzuschauen: Wir haben zurzeit 1 635 Universitätsprofessoren, zirka 4 400 im provisorischen und definitiven Dienstverhältnis stehende Universitätsassistenten und -dozenten und zirka 2 200 Stellen, die zeitlich befristet sind. Das ist momentan die Stellensituation an unseren Hochschulen. Das heißt, der Großteil dieser Stellen ist nicht oder nur erschwert für unsere jungen Kolleginnen und Kollegen zugänglich. Diese Tatsache und nicht das neue Dienstrecht, das den Weg für den Nachwuchs öffnet, sollte meines Erachtens eigentlich Anlass für Demonstrationen sein!
Im Übrigen wird sich bei den Professorenstellen – und das ist eine sehr interessante Analyseergebnis – in absehbarer Zeit ein Wechsel ergeben, da bis zum Jahre 2005 390, bis zum Jahre 2010 570 und bis zum Jahre 2015 330 von den rund 1 600 Professoren die Universitäten letztlich verlassen werden. Aus Sicht der Naturwissenschaft ist nicht unbedeutend, dass so neben der Eröffnung von Karrierechancen für die jüngeren Kollegen dem raschen Technologiefortschritt zusätzlich Rechnung getragen werden kann. Im Mittelbau haben wir leider eine Altersstruktur, die dieser Situation entgegensteht.
Als Universitätslehrer ist es mir ein wichtiges Anliegen, dass man im Rahmen dieser Reform auch zu dem Ergebnis kommt, dass hervorragende Kollegen des so genannten Mittelbaus – übrigens ein scheußliches Wort! – eine Chance bekommen, die Professorenkarriere einzuschlagen. In diesem Zusammenhang sei aber vehement betont, dass nur die Besten diesen Weg gehen können! Es muss Limits geben. Es kann nicht jeder Universitätsprofessor werden, wie nicht jeder Generaldirektor werden kann.
Die bereits jetzt Pragmatisierten müssen allerdings in die Aufgaben von Forschung und Lehre des Instituts oder einer Abteilung eingegliedert werden können, damit wieder gezielte Forschungsschwerpunkte gesetzt und die bereits vorhandenen Personalressourcen fokussiert werden können. Ich glaube, dass das Mehrsäulenmodell mit Verträgen und der Möglichkeit einer Neubewerbung eine Möglichkeit darstellt. Jede Stufe muss evaluiert werden, und es müssen Konsequenzen einhergehen. Auch Professoren müssen sich selbstverständlich dieser Evaluation stellen, weil die Zuweisung von zusätzlichen Personalpositionen und Geldmitteln nur so gesteuert werden kann und soll.
Das neue Dienstrecht, verbunden mit neuer Struktur und Organisation, muss aber auch wiederum echte Leitungs- und Verantwortungsstrukturen schaffen.
Meine Damen und Herren! Sie haben in diesem Hohen Haus beschlossen, dass die im alten System aufwendig durch Berufungsverfahren bestellten Ordentlichen Universitätsprofessoren mit den Außerordentlichen Universitätsprofessoren, in deren Lebenslauf in den meisten Fällen kein Berufungsverfahren zu finden ist, zu den so genannten „Universitätsprofessoren“ zusammengefasst werden. Das ist der Ist-Stand, und zumindest ich habe, nachdem der Titel „Außerordentlicher Professor“ frei geworden ist, das Gefühl, dass nun alle Dozentinnen und Dozenten ohne weitere Leistungsbeurteilung, Evaluierung oder gar Berufung quasi über Nacht zu Außerordentlichen Universitätsprofessoren mit den gesetzlich gleichen Rechten in Lehre und Forschung wie berufene Professoren – und es sei mir als Naturwissenschafter genehmigt, das so zu formulieren – mutiert sind. Das heißt, dass Schwerpunkte, wie sie ein berufener Professor eigentlich vorgeben soll, weshalb er auch berufen wird, und wie dies an den leistungsorientierten Universitäten der Welt der Fall ist, nicht mehr geschaffen werden können. Dies wird sogar, gesetzlich gedeckt, blockiert, da vorhandene Personalressourcen nicht mehr fokussiert genutzt werden können. – Dies ist eine Folge der letzten Reform.
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass den Damen und Herren Abgeordneten die Realität dargestellt wird. Daher sage ich: Die Position von Institutsvorständen, um die kleinste Einheit anzusprechen, aber auch andere wichtige leitende Funktionen der jetzigen Universitätsstruktur werden zurzeit paritätisch vergeben. Nicht Leistung und Qualität stehen bei vielen Entscheidungen im Vordergrund, sondern oft, wenn auch nicht immer – ich bitte, mich nicht misszuverstehen! –, auch andere Interessen, die für das Ansehen der Universität nicht immer von Vorteil sind. Die Folge ist, dass der Weg des geringsten Widerstandes gegangen beziehungsweise – in vielen Fällen, nicht in allen! – eine negative Auslese getroffen wird. Ich bin mir dieser Worte bewusst! Anders gesagt: Insbesondere in den naturwissenschaftlichen Fächern, in welchen auf Grund der Schnelllebigkeit Flexibilität, höchste Fachkompetenz verbunden mit gutem Management wichtig sind, ist das eine unannehmbare Situation.
Dies wird vor allem in den Naturwissenschaften – auch das möchte ich in Anwesenheit unserer auswärtigen Gäste sagen – auch von den diese Situation sehr genau beobachtenden Kolleginnen und Kollegen im Ausland nicht goutiert. Das führt dazu, dass wir diese Kollegen aus dem Ausland nicht für Berufungen an unsere Universitäten bekommen, und umgekehrt führt es dazu, dass unsere guten österreichischen Wissenschafter den Weg nach außen suchen, zum Beispiel an die ETH Zürich, wofür ich einige Beispiele nennen könnte.
Im Übrigen wird mir als Stellvertretendem Vorsitzenden des Rates für Forschung und Technologieentwicklung von sehr vielen österreichischen Wissenschaftern an namhaften Universitäten im Ausland immer gleich im ersten Gespräch die Frage gestellt: Habt ihr noch immer dieses Dienstrecht, nach welchem die Professoren keine Entscheidung treffen können?
Meine Damen und Herren! Stellen Sie sich vor, der Pilot eines Passagierflugzeuges muss vor der Landung alle Mitglieder der Besatzung – ist gleich: Institutskonferenz – fragen, wann, wo und wie er landen darf! – In etwa so pilotiert zurzeit ein Institutsvorstand ein Institut, und zwar ohne wirkliche Entscheidungsvollmacht und angesichts der Wahrscheinlichkeit, bei leistungsorientierter Vorgangsweise zum Wohle des Instituts nach zwei Jahren von dieser so genannten Verantwortung zwangsweise, nämlich durch Abwahl, entbunden zu werden.
Dies ist mir persönlich, das sei hier angeführt, bisher erspart geblieben. Als Referent des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung und als Beteiligter an vielen Begutachtungen an allen Universitäten Österreichs sehe ich diese Probleme österreichweit. Daher ist meine Forderung, dass wieder Verantwortungsstrukturen für Personal und Forschung eingeführt werden. Meine Damen und Herren Abgeordneten! An allen internationalen Spitzenuniversitäten erfolgt die Auswahl der Position von Rektoren, Präsidenten, Dekanen, Institutsvorständen und Abteilungsleitern niemals paritätisch!
Vielmehr entscheiden die bereits berufenen Professoren in erster Instanz, dann wird jeweils unterschiedlich vorgegangen wie etwa in der Schweiz – jedenfalls aber unter Mitwirkung und Anhörung anderer Gruppen wie Mittelbau, Studenten und sonstigen Personals. Diese treffen ihre Entscheidung aber als Verantwortungsträger hinsichtlich der Gestaltung der Universität, und das ist auch der Grund dafür, warum der Rat für Forschung und Technologie hier zu anderen Strukturen geraten hat.
Zur Autonomie: Wenn Lehre und Forschung diskutiert werden, muss selbstverständlich auch das ganze Umfeld diskutiert werden, insbesondere aus naturwissenschaftlicher Sicht. Die autonome Verwaltungsstruktur ist daher eine international angewandte Möglichkeit, um im internationalen Wettbewerb mit den Besten der Welt bestehen zu können. Diese ermöglicht – ich sage das jetzt bezogen auf Österreich und insbesondere auf die Naturwissenschaften – die Schaffung von Selbständigkeit für Rektor, Dekan, Institutsvorstand und Abteilungsleiter bei Personalentscheidungen, bei der Geldmittelvergabe und der Akquirierung von Geldmitteln. Es ist wichtig, dass Verträge mit Dritten keiner Kommissionen für Entscheidungen bedürfen, sondern dass rasche Entscheidungen getroffen werden können.
Die Möglichkeit zur Schaffung und Auflassung von Studienrichtungen entsprechend dem Bedarf und letztendlich auch die Schaffung und Auflassung von Forschungsschwerpunkten ist vor allem für uns in den Naturwissenschaften auf Grund der Schnelllebigkeit wichtig. Gerade im Bereich der Naturwissenschaften ist es von großer Bedeutung, dass das unbürokratisch vor sich geht.
Ich erinnere an das Beispiel Bioinformationstechnologie: In Stanford und im Karolinska Institut in Stockholm wurden diese Möglichkeiten innerhalb kurzer Zeit unbürokratisch geschaffen. Das ist bei der jetzigen Konstellation an österreichischen Universitäten unvorstellbar! Ich glaube deshalb, dass wir uns jetzt nicht bemühen sollen, im weltweiten Wettbewerb im Mittelfeld zu bestehen, dann da liegen wir ohnedies nicht schlecht. Wir haben auch gute Erfolge erzielt, wir dürfen das nicht krankbeten. Vielmehr müssen wir, wenn wir eine Reform anstreben wollen, gegen die Spitzenuniversitäten dieser Welt – Stanford, Yale, Harvard oder MIT – bestehen!
Die österreichischen Universitäten müssen wieder für Berufungen interessant werden. Zurzeit sind wir für die Welt nicht mehr interessant. Wir müssen allgemein für den internationalen Austausch interessant werden, wir müssen attraktiv werden, und wir müssen auch für die Wirtschaft interessant werden. Wir müssen dem Wettbewerb gegen den Fachhochschulbereich, private Universitäten, aber auch außeruniversitäre Einrichtungen standhalten. Wir müssen besser sein!
Erlauben Sie mir, eine Minute meiner Redezeit als Stellvertretender Vorsitzender des Rates für Forschung und Technologie aufzuwenden. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass bereits sehr viel im Umfeld getan wurde, um dieser Reform letztlich zum Erfolg zu verhelfen. Wenn man heute in der Tagespresse liest – was einige Abgeordnete hier offensichtlich nicht zur Kenntnis nehmen wollen –, dass für Forschung bereits viel Geld ausgegeben wurde, dann möchte ich das hiermit im Hohen Hause noch einmal wiederholen.
Meine Damen und Herren! Der Rat für Forschung und Technologie hat für die Grundlagenforschung in Österreich für das Jahr 2001 zusätzlich 250 Millionen Schilling für den Forschungsfonds zur Verfügung gestellt. Der Forschungsfonds in Österreich, dessen Präsident hier anwesend ist, hat für die Grundlagenforschung noch nie ein derart hohes Budget gehabt wie jetzt. Es wurde gegenüber dem Vorjahr um zirka 28 Prozent erhöht. Das heißt, es besteht die einmalige Situation, dass wir genug Geld haben, um gute Grundlagenprojekte und auch Schwerpunkte in Österreich gefördert werden können!
Weiters wurde geraten, die direkt universitätsbezogenen Programme für die Wirtschaft, nämlich die Kompetenzzentren K ind, K net und K plus, mit 730 Millionen Schilling zu dotieren. Der Finanzminister hat das bereits vollzogen. Letztlich – und auch daran liegt mir sehr viel, weil die Universitäten unmittelbar betroffen sind – gibt es für die Nachwuchsförderung, für Stipendien und für Frauenförderung über 100 Millionen Schilling.
Meine Damen und Herren! Es ist viel Geld im Spiel! Auch Sie sollten das wissen, auch wenn es nicht auf der ersten Seite einer Zeitung steht!
Ich glaube – und damit schließe ich ab –, dass wir gemeinsam eine starke leistungsfähige Universität in Organisations-, Personal- und Forschungsstrukturen erhalten werden, die den Wettbewerb nicht nur im weltweiten Mittelfeld, sondern mit den Spitzenuniversitäten dieser Welt nicht mehr zu scheuen braucht. Und ich hoffe, dass wir, und zwar für Alt und Jung, wieder den Zustand erreichen, dass man stolz sein kann, an einer österreichischen Universität lehren und forschen zu dürfen.
Im Übrigen wären wir es unserer Tradition – etwa Persönlichkeiten wie Schrödinger, Pregel oder Boltzmann, um nur einige Naturwissenschafter aus der Vergangenheit zu nennen – schuldig, wenn wir nicht Verwässerung und Mittelmäßigkeit, sondern auch ein bisschen die Elite und leistungsorientierte Ausbildung, auch im Zusammenhang mit Forschung und Technologie, an unseren Hohen Schulen anstrebten. – Danke schön. (Beifall.)
11.46
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Als Nächste bitte ich Frau Universitätsprofessor Dr. Hassauer um ihr Referat.
„Meine Idealvorstellungen einer modernen Universität“
11.47
Referentin Univ.-Prof. Dr. Friederike Hassauer (Universität Wien): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Frau Bundesminister! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Die Liebe zum Wissen – amór a la sabiaduría – wollen wir von ihr erfüllt haben. Den süßen Geschmack des Studiums – doulx goût d’estude – wollen wir von ihr zu kosten bekommen. Die Sehnsucht nach Philosophie – desiderium philosophiae – soll sie uns stillen. Und die Herzensneigung zu den Wissenschaften – inclinación a las letras – soll sie uns befriedigen. Sie: Das ist die alte und die neue, die verrottete und die moderne, die niedergezwungene und die wehrhafte, die ewig junge Universität, die Universitas Magistrorum et Scholarium.
Für mich ist das, worüber wir heute hier verhandeln, eine Herzensangelegenheit. – Also lassen Sie uns diese Universität zunächst mit eiskaltem Verstand ansehen: Es geht um das Ideal einer modernen Universität. Versinken wir daher nicht im Lamento über den Jahrzehnte alten Reformstau und über beweinenswerte Ist-Zustände! Es geht heute um einen großen neuen Wurf, es geht um eine Vision, die unbedingt Wirklichkeit werden muss. Lassen Sie diese Vision also nicht im Klein – Klein von Verwaltungsgestrüpp, Dienstrechtsgezerr und korporatistischen Filz verenden!
Was soll eine Universität, und wann taugt sie etwas? – Sie haben es gehört: Liebe zum Wissen, Süße des Studiums, Sehnsucht nach Philosophie, Neigung zu den Wissenschaften! Etwas altertümlich, was da aus Stimmen von vor acht Jahrhunderten zu uns herüberklingt! In den Worten unserer Zeit heißt das: Die genuine Leistung von Universitäten ist die Wissenschaft in vier Gestalten: Forschung, Lehre, Ausbildung des Nachwuchses, Wissenstransfer an die Gesellschaft. Unter den Bedingungen der globalen Gesellschaft heißt das, dass es einen globalen Wettbewerb um die Exzellenz dieser Wissenschaft, um die Exzellenz von Forschung, Lehre, Ausbildung und Wissenstransfer gehen muss.
Die Zeiten sind vorbei, in welchen diese Leistungen trotz der berühmten widrigen Umstände erbracht werden konnten, gegen die Absurditäten des hiesigen Dienstrechtes, gegen die Ungunst des kameralistischen Rechnungswesens, gegen die Lähmung durch obrigkeitlich-ministerielle Führung als nachgeordnete Dienststelle und vor allem gegen eine nun hoffentlich beendete nationale Tradition der strukturellen Unterbudgetierung. Konkurrenzfähig exzellente Leistungen können heute nur unter konkurrenzfähig exzellenten Rahmenbedingungen erbracht werden. Darum brauchen wir die Reform der Universität ebenso wie die Reform der Rahmenbedingungen.
Die Gegenfrage kommt immer noch: Muss das wirklich sein? Und: Warum die Eile? Geht nicht auch ein bisserl und das „bisserl“ vielleicht ein bisserl später? – Die Antwort ist: Nein! Österreich steht im internationalen Hochschulvergleich nicht an der Startlinie, sondern Österreich steht in einigen Punkten im internationalen Hochschulvergleich zehn Meter hinter der Startlinie. Und deswegen ist es meiner Meinung nach heute nicht fünf vor zwölf, sondern eins vor zwölf!
Die Zeiten des Mottos „Mir san mir!“ sind vorbei. Mit nationalen Sonderwegen hört es sich schlagartig auf, wenn der Vergleich mit den führenden internationalen Reformuniversitäten von der Schweiz bis zu den Niederlanden, von England über Deutschland bis zu den USA angestellt werden muss, wenn also das klare Licht des Benchmarking, des Vergleichs mit den jeweils Besten im Feld, auf die Dekaden hausgemachter Defizitverschleppung fällt.
Meine Idealvorstellung einer modernen Universität lautet also erstens: Die Reformuniversität bekommt politische Top-Priorität betreffend Modernisierung von überständigen nationalen Infrastrukturen. Warum? – Weil die Politik, die ich mir wünsche, versteht, dass die Universität der zentrale Standortfaktor im globalen Wettbewerb der internationalen Wissensgesellschaft ist.
Wenn die dringlich überfällige Reform also ins Werk gesetzt werden muss, dann gilt gleichzeitig: Eine solche Reform ist nichts für parteipolitische Hahnenkämpfe! Diese Regierung ist die Reform angegangen, aber keine Regierung hätte meiner Meinung nach die Freiheit gehabt, diese Reform sein zu lassen. Die Reform ist eine nationale Aufgabe, und ich denke, dass das in Ordnung ist. Lassen Sie uns nicht vergessen, dass der vorliegende Reformentwurf von den ursprünglichen Koalitionsgesprächen zwischen SPÖ und ÖVP nahezu unverändert auf die spätere ÖVP/FPÖ-Regierung übergegangen ist. Jetzt müssen auch andere Stimmen gehört werden. Es muss die Stimme der Grünen gehört und dann rasch entschieden werden. Es muss die regierungsferne Intelligenz in Think tanks für den weiteren Prozess gezogen werden, und es muss weiterhin internationales Know-how eingekauft werden. Würde man heute wieder nur fallweise parteipolitisch entscheiden, dann ginge morgen das Drama mit jeder Veränderung der momentanen parteipolitischen Gewichte weiter.
Meine Idealvorstellung einer modernen Universität lautet daher zweitens: Ich wünsche mir eine stabile politische Neuordnung des Wissenschaftssystems. In diese neue Ordnung wird die neue Reformuniversität gestellt und bekommt so endlich Planungssicherheit. Damit tritt die Universität in den neuen Raum dieser Planungssicherheit, nämlich in den staatsferneren Raum der Autonomie, ein. Es ist dies ein Raum der Freiheit ebenso wie ein Raum der Pflicht. Die Universität muss neue Studienstrukturen und neue Leitungsstrukturen erbringen.
Für die Erbringung von neuen Studienstrukturen und neuen Leitungsstrukturen müssen in diesem Land ein paar heilige Kühe geschlachtet werden. Diese wurden schon genannt.
Ich nenne in diesem Zusammenhang zunächst die paritätische Mitbestimmung: Ich versichere Ihnen, dass an den österreichischen Universitäten nicht prestissimo die Apokalypse ausbrechen wird, wenn die Liturgie lieb gewordener, aber funktionsschädlicher Sozialpartnerschaftsrituale nicht mehr zelebriert wird! Das ist Gräuelpropaganda! Es sind andere, bessere Formen von demokratischer Partizipation zu finden, und es ist ein billiger semantischer Taschenspielertrick, andere Demokratieformen als „keine Demokratie an der Universität“ zu verkaufen.
Meine Idealvorstellung einer modernen Universität lautet daher drittens: Es müssen solche neuen Partizipationsformen entwickelt werden, und zwar je nach Entscheidungsebene, wie international üblich. – Ich nenne Ihnen dazu zwei Best-practice-Beispiele.
In Konstanz hat der Lehrausschuss wesentlich mehr studentische Anteile, als es heute hier Standardquote ist, der Forschungsausschuss hat dagegen deutlich weniger.
Zweites Beispiel – ich denke, das gilt international, von der FU Berlin bis Stanford –: Es darf keine Mitbestimmung von minder Qualifizierten über höher Qualifizierte geben. Schluss mit dem Sündenfall der Mitbestimmung von Non-Peers über Peers!
Eine weitere „heilige Kuh“, die zu schlachten ist, ist die Pragmatisierung. Es bricht an den österreichischen Universitäten ebenfalls nicht prestissimo die Apokalypse aus, wenn der nationale Sonderweg der flächendeckenden Pragmatisierung abgeschafft wird. Die de facto vom Leistungsnachweis abgekoppelte Belohnung ausreichender Verweildauer degeneriert zum Rechtsanspruch auf Regelbeförderung, und ein Dienstrecht im größtmöglichen Sicherheitsabstand vom Leistungsnachweis ist der zweite Sündenfall, der zu tilgen ist. – Sie hören das nicht nur von mir, sondern Sie haben es auch von meinem Vorredner gehört: Mit dem UOG unter dem Arm und mit dem Dienststellenausschuss im Rücken können Sie jedes Institut mühelos sprengen. Ich habe es aufgegeben.
Meine Idealvorstellung einer modernen Universität heißt daher viertens: Entwicklung von Karrieremodellen mit zwei Schnittstellen nach internationalem Muster. Ziel muss sein, im Wettbewerb um die besten Köpfe danach zu trachten: Wie behalte ich die Guten beziehungsweise die Besten, und wie werde ich die Schlechten los?
Die dritte „heilige Kuh“, die zu schlachten ist, ist die lokale, regionale, nationale Selbstre-krutierung als Dauerselbstrekrutierung des Professorats. Nach internationalen Maßstäben ist der Verbleib von der Wiege bis zur Bahre an einer Universität heute kein Gütesiegel. Was der heute vor den Toren der Alma Mater ausgesperrte exzellente österreichische Nachwuchs längst erworben hat, nämlich international konkurrenzfähige Mobilität, das muss – um Athenae willen – jetzt endlich in die Universität hineingebracht werden!
Deswegen meine Idealvorstellung Nummer fünf: Internationalität muss ein Leistungsindikator werden, und er muss ganz klar finanziell gratifiziert werden. Das heißt: Internationalisierung für die einzelnen Menschen in der individuellen Stellenbewerbung wie in der Berufungskultur einer gesamten Universität. – Dazu ein Best-practice-Beispiel: An der FU Berlin werden internationale Berufungen als Leistungsindikator mit ganz massiv spürbaren Mittelzuweisungen honoriert.
Amore scientiae facti exules: Seit 850 Jahren sind die Topuniversitäten ein Sozialraum für Topleute, die aus Liebe zur Wissenschaft exules – also Exilanten – sind: heimatlos, mobil im Exil. Seit 850 Jahren sind die Universitäten auf diese Art und Weise Membran eines Landes für den freizügigen Zugang zum internationalen Science space. Dieser Zugang ist in der internationalen Wissensgesellschaft für jedes Land überlebensnotwendig geworden. Dieser Zugang zum weltweiten Wissenschaftsraum in Prozessen von Incoming und Outgoing braucht einen seriösen politischen Raum. Blaulicht ist tödlich, nicht nur für die Universität. Antisemitismus und Ausländerwahn sind Prescription for Disaster für das ganze Land, für Wissenschaft und Wirtschaft, für Renten und Demographie.
Sechstens lautet daher meine Idealvorstellung einer modernen Universität, dass Österreich gerade jetzt, da die Schweiz und Frankreich mit neuen Einwanderungsgesetzen im internationalen Benchmarking der Standortfaktoren einen Punkt nach dem anderen hereinholen, einen neuen Aufbruch in der Politik und neue Ressortbudgets dort braucht, wo Kulturkontakt und Kulturkonflikt erforscht wird, nämlich in den Kulturwissenschaften.
Es bedarf eines neuen Aufbruchs draußen, bei den äußeren Rahmenbedingungen, und eines neuen Aufbruchs drinnen, im Innern des Wissenschaftssystems, also einer Reform an Haupt und Gliedern. Was Not tut in diesem Land einer traditionellen „Kulturkultur“, ist eine neue Wissenschaftskultur. – Damit zitiere ich den Präsidenten der Akademie. Was zweitens Not tut in diesem Land, ist eine Kultur der Leistungsbewertung, die es völlig neu zu schaffen gilt. – Damit zitiere ich Magnifizenz Gäbler. Was wir hingegen nicht brauchen in diesem Land, ist das alte Selbstmitleid und die neue Weinerlichkeit.
Ich wünsche mir daher – und das ist meine siebente Idealvorstellung –, dass sich diese neue, moderne Reformuniversität den Spiegel vorhält, dass sie in Selbstwürdigung selbstbewusst neue Ansprüche stellt und dass sie auch selbstbewusst in Selbstkritik neue Nehmerqualitäten entwickelt. Das heißt, dass sie sich endlich und viel grundsätzlicher öffnet, und zwar für Selbstevaluierung und Fremdevaluierung.
Als Reformuniversität ist die ideale Universität, die ich mir wünsche, semper reformanda, wenn wir sie als Reformuniversität ernst nehmen, sie ist also ein selbst lernendes und selbst steuerndes System im Prozess. Dieses System muss vom Staat dazu in die Lage versetzt werden, dann darf dieses System in der Dynamik seiner Selbstheilungskräfte aber nicht mehr behindert werden!
Dazu braucht es drei Treibsätze: die Autonomie, den wissenschaftlichen Nachwuchs und die Frauen.
Autonomie bedeutet meiner Meinung nach zuerst Abschied vom Einheitsmodell und von einem Rezept für alle. Autonomie bedeutet eine differenzierte Landschaft und differenzierte Strukturen. Autonomie muss also – und das ist meine achte Wunschvorstellung – maßgeschneidert sein, und die Universität muss sich vom Universitätsmarketing bis zur Auswahl der Studenten neue Gebiete erobern, und zwar gestellt auf ein professionelles Verwaltungspersonal.
Ich möchte ein sehr markantes Best-practice-Beispiel erwähnen, das Sie alle – wie ich hoffe; ich habe versucht, das zu organisieren – in Form einer Broschüre vor sich liegen haben: Knapp 25 Millionen D-Mark der VolkswagenStiftung gehen an zehn Strukturreformuniversitäten im Programm „Leistungsfähigkeit durch Eigenverantwortung“. Dort werden Systeme für die Erstellung von Leistungs- und Belastungsindikatoren, Marketingsysteme, Informationssysteme sowie neue Typen von Kosten- und Leistungsrechnung entwickelt, wobei ein massiver Schwerpunkt auf Personalentwicklung liegt.
Der zweite Treibsatz ist der wissenschaftliche Nachwuchs: Wissenschaftlichen Nachwuchs zu erzeugen und zu pflegen ist profilbildende Kernaufgabe der Universitäten und wird in diesem Land an einigen Punkten schwer vernachlässigt. Insbesondere fehlen mir die international erfolgreichen Instrumente der Nachwuchsgruppenförderung.
Dass es gelingt – das ist meine Idealvorstellung Nummer 9 –, die besten Leute, auch diejenigen, die heute als ganz Junge vor den Toren der Institution stehen, ins neue System hinüberzubringen, ist mein Wunsch. Ich warne davor, die Ressourcen durch die gesetzeskonforme Überleitung der personellen Altlasten so zu erschöpfen, dass für das Risikokapital des Nachwuchses nichts mehr bleibt!
Ich bitte das Hohe Haus um die Gnade der Umwidmung der von meinen exakteren Vorrednern eingesparten vier Minuten und bitte auf dem Gnadenweg nur um eine einzige davon!
Nach mittlerweile 25 Jahren an der Front, bald zehn Jahre davon als „O. Prof.“ in Wien, vorher von Bochum bis Berkeley, von Mainz bis Madrid, wünsche ich mir schlussendlich eine Universität, die weibliche Exzellenz willkommen heißt – und ich meine damit wirklich willkommen, und nicht zähneknirschend den Nacken unters Joch irgendeiner Quote oder Vorschrift beugt.
Ich meine vielmehr eine Universität, die aus der Einsicht des Herzens geschlechtergerecht ist. Sie werden mich für naiv halten, aber so wünsche ich sie mir, meine Reformuniversität! Und wenn sie schon nicht aus der Einsicht des Herzens geschlechtergerecht ist, dann möchte ich, verdammt noch mal, ein Kalkül des Verstandes, denn Männerorden rechnen sich nicht mehr! Diese Zeiten sind vorbei. „Old Boys Networks sind schädlich“, sagte mir Gerhard Casper, zehn Jahre lang Präsident von Stanford. Männeruniversitäten, die Frauen fern halten, sagte er mir, stürzen mittelfristig unweigerlich in die Mittelmäßigkeit ab. Und diese wollen und können wir uns doch auch in Österreich nicht mehr leisten!
Wir brauchen Exzellenz, und diese ist ohne weibliche Exzellenz nicht zu haben! Daher sage ich: HOMO.Academica – ja! Aber bitte kein Opferfeminismus und keine Zwangsbewirtschaftung von Einzelstellen. Exzellente Forscherinnen brauchen exzellente und intelligente Autonomiestrukturen, in denen sie entdeckt, herangebildet, betreut, gefördert und gefordert werden, um ihre geschlechterungerechte Benachteiligung auszugleichen.
Auf der einen Seite muss also der Staat via Zielvereinbarungen die Absicht verfolgen, den Frauenanteil zu erhöhen, auf der anderen Seite muss die Universität ihr Personalkontingent autonom geschlechtergerecht zu exzellenter Qualität entwickeln. Dazu gibt es internationale Strukturmodule, aber das Kapitel Frauen und Hochschule ist „Frust von tausend Jahren“!
Und auch die vorliegenden Reformpläne müssen reflektiert werden. Sie geben Anlass zur Sorge hinsichtlich völlig unkontrollierter side-effects und ungewollter negativer Lenkungseffekte, bei denen – das wäre die Gefahr – der weibliche Nachwuchs wieder überproportional ausgesteuert werden würde.
Deswegen steht jetzt auf der Basis von Genderstudies die Gender-Folgenabschätzung auf der Tagesordnung. Das muss gleichrangig mit Technikfolgenabschätzung als Top-Priorität verfolgt werden Ich stelle mich gerne nachher noch zu einer Diskussion und für Auskunft über ein Best-practice-Beispiel zu Verfügung: Im genannten 25-Millionen-Programm der Volkswagenstiftung bekommt Dortmund ein Struktur-Autonomieprojekt „Geschlechtergerechtigkeit“ mit der Fragestellung „Neue Steuerung der Gleichstellungsfragen unter den Bedingungen universitärer Autonomie“ finanziert.
Erinnern wir uns – ich komme zum Schluss –: „Desiderium philosophiae“, „doulx goût d’estude“ und „amór a la sabiaduría“ – Wissensdurst und Erkenntnisdrang in den Stimmen der Vergangenheit sind: weibliche Stimmen! – Es spricht Heloisa, die brillante Schülerin des bedeutendsten Universitätslehrers Petrus Abaelardus im Paris des 12. Jahrhunderts. Es spricht Christine de Pisan aus Frankreich, die erste Schriftstellerin modernen Typs, die wir überhaupt haben. Und es spricht Sor Juana Inés de la Cruz, die bedeutendste Barockdichterin der hispanoamerikanischen Welt.
Sorgen wir endlich dafür, dass die Exzellenz einer Heloisa, einer Christine und einer Juana Inés heute nicht mehr ausgegrenzt wird! Willkommen heißen soll sie die ideale Alma Mater! So wünsche ich mir meine Reformuniversität! – Ich danke Ihnen. (Beifall.)
12.05
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Nun spricht Herr Universitätsprofessor Dr. Marhold. – Bitte.
„Dienstrecht neu für moderne Universitäten“
12.05
Referent Univ.-Prof. Dr. Franz Marhold (Universität Graz): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Frau Bundesministerin! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Frau Kollegin Hassauer! Auch wenn ich als Vorstand des Instituts für Arbeitsrecht an der Universität Graz von der Profession dazu bestimmt bin, mich mit dem „Dienstrechtsgezerre“ zu befassen, werde ich mich dennoch bemühen, die Zeit wieder hereinzubringen.
Mein Thema lautet „Dienstrecht neu für moderne Universitäten“: Das signalisiert bereits vom Konzept her etwas völlig anderes, als dieses Hohe Haus in den vergangenen 35 Jahren gemacht hat. Bislang sind Organisationsänderungen und Dienstrechtsänderungen immer isoliert voneinander behandelt worden, und zwar mit enormen Verzerrungen, die dadurch eingetreten sind, dass beispielsweise das Hochschulassistentengesetz 1966, das noch dem Typus der Ordinarienuniversität entsprochen hat, noch bis in die Periode der Mitbestimmungsuniversitäten nach dem UOG 1975 mit der Konsequenz gegolten hat, dass 1988 ein Dienstrecht verabschiedet wurde, das den Zeitgeist von 1975 mit einem BDG noch einmal nachvollzog, das ganz strikt an der Beamtenstruktur orientiert war.
Jetzt legt sich das Ministerium – und wie ich hoffe auch das Hohe Haus – die Aufgabe vor, ein Dienstrecht zu konzipieren, das eine dienende Funktion für eine Neukonzeption der Aufgaben und der Struktur der Universitäten hat. Wenn dieses Thema nun gesamthaft angegangen wird, dann scheint mir das ein ganz entscheidender Qualitätsunterschied zur bisherigen Vorgangsweise zu sein.
Ich werde in meiner kurzen Stellungnahme versuchen, auch noch die Ausnahme zu erklären, die offenbar auf Sie zukommt, weil Sie jetzt schon eine Änderung des Dienstrechts verabschieden sollen, obwohl die Vollrechtsfähigkeit mit dem In-Kraft-Treten dieses Dienstrechtes noch nicht gewährleistet ist. Warum das so sein soll, darauf werde ich auch noch zu sprechen kommen.
Wen es im Detail interessiert – und es ist offenbar modisch, „http://www“ zu zitieren –, zu welchen Verwerfungen das Auseinanderklaffen von Organisationsrecht und Dienstrecht in der Vergangenheit geführt hat, der kann das auf der Homepage der Österreichischen Forschungsgemeinschaft in einem diesbezüglichen Referat von mir im Detail nachlesen. Daher kann ich mir diesbezügliche Ausführungen jetzt sparen.
Welche Bedürfnisse einer modernen Universität gibt es denn eigentlich, die es erfordern, dass vom gegenwärtigen Dienstrecht abgewichen wird? Gerade in Zeiten der geringeren Regulierungsdichte sollte sich ein Gesetzgeber die Frage stellen: Warum mache ich das eigentlich? Welche Defizite gibt es? – Ich möchte etwas konkreter auf die Dinge eingehen, die schon genannt wurden.
Die gegenwärtige Planstellenbewirtschaftung im Rahmen eines kameralistisch organisierten Dienstrechts verhindert es, dass sogar dann, wenn Geldmittel vorhanden sind, diese Geldmittel zur Besetzung von Planstellen in anderen Einheiten vorgesehen werden können als für diejenigen, für die sie ursprünglich gewidmet waren. Das heißt, der Zusammenhang von Budgetrestriktionen und Planstellenrestriktionen verhindert unter öffentlich-rechtlichen Dienstrechtsstrukturen eine flexible Einsetzbarkeit von Mitteln selbst dann, wenn die Mittel vorhanden sind.
Wir befinden uns zweitens aber auch in der Situation, dass bei verfestigten Personalstrukturen mit dauerhaft verfestigten Aufgaben – und jetzt rede ich über alle Planstellenkategorien, nicht als Professor über die Assistenten, sondern auch über die Professoren selbst – alle Planstellenkategorien einen bestimmten Erkenntnisstand der Wissenschaftsdisziplinen auf die Lebensdauer des Stelleninhabers festschreiben. Das heißt: Ist eine Professur für Rechtsgeschichte mit einem 30-Jährigen besetzt, dann gibt es 38 Jahre Rechtsgeschichte.
Selbst wenn etwas in einer bestimmten Form nicht mehr gebraucht wird, besteht in den gegenwärtigen Strukturen die Schwierigkeit, dass wir immer an den Geldgeber herantreten müssen, wenn wir etwas Neues machen wollen, weil wir intern nicht umschichten können. Und selbst wenn wir einmal die Kraft aufbringen, intern umzuschichten, wie beispielsweise – damals war ich noch nicht in Graz, sondern als Wanderarbeitnehmer an der Universität Konstanz – ein Institut für Kirchenrecht in ein Institut für Europarecht umzuwidmen, dann hört der dafür zuständige Geldgeber nur den ersten Teil, dass nämlich kein Kirchenrecht mehr gebraucht wird, zieht diesen Teil ein und vergibt stattdessen nicht das Europarecht. Dann – und jetzt rede ich nicht von Stanford oder vergleichbaren Orten –, im Jahre 1997, bekam die Universität Maribor eine Planstelle für Europarecht. Wir müssen auf die nächste frei werdende Stelle aus dem Römischen Recht warten, damit wir jetzt – unter verbesserten Autonomiebedingungen – diese Umwidmung erfolgreich herbeiführen können.
Das trage ich vor, weil ich Jurist bin und diese Verhältnisse kenne. Jeder redet von seiner eigenen Prägung aus, das soll man nicht verschweigen. Aber ich schaue mich auch um und stelle fest, dass es an den Technischen Universitäten noch 20 Jahre lang Lehrstühle für Lokomotivbau gegeben hat, obwohl schon lange keine Dampflokomotive mehr gebaut wurde.
Das sind die Gründe dafür, warum wir eine Flexibilisierung und eine Loslösung der Planstellenbewirtschaftung von öffentlich-rechtlichen Strukturen brauchen.
Dazu kommt, dass ein solches System die wissenschaftliche Durchlässigkeit – und ich rede jetzt wieder von allen Ebenen, nicht als Professor über Assistenten – nicht erleichtert, nicht fördert und damit die Internationalisierung hemmt. Es ist enorm schwierig, eine Berufung aus dem Ausland durchzusetzen, wenn der Forscher, mit dem man auch Inhalte einkaufen will – wir sind immer so personalrechtlich geprägt, dass wir meinen, wir tun jemandem irgendeine Gnade an, wenn wir ihn nach Österreich berufen; in Wirklichkeit kaufen wir ihn ja ein, weil wir einen Inhalt einkaufen wollen! –, einen gewissen Inhalt an einem vorgegebenen Institut nicht verwirklichen kann, es sei denn, man schießt wieder zusätzliche Mittel zu. – Es sollte sich auch der Gesetzgeber, der Steuermittel verwaltet, überlegen, ob er ein solches System, in welchem immer nur die Hand aufgehalten wird, weiterhin fördern will oder ob er nicht den Entscheidungsträgern zusätzliche Möglichkeiten geben sollte.
Warum aber brauchen wir jetzt, wenn wir noch keine Vollautonomie haben, ein Übergangsdienstrecht? – Wir brauchen es deswegen, weil – Kollege Bonn hat es schon gesagt – die Personalstruktur so gelagert ist, dass Sie, wenn Sie – ich spreche Sie als Gesetzgeber an – dieses Dienstrecht weiterfahren, auch die Autonomie nicht mehr zu verabschieden brauchen. Dann gibt es nämlich nichts mehr autonom zu entscheiden, dann haben wir bereits die Überleitung von den befristeten Dienstverhältnissen in die provisorisch definitiven, welche – das sage ich als Jurist – verfassungsrechtlich gewährleisteten Vertrauensschutz haben, an welchem nicht zu rütteln ist. Dann haben Sie eine weitere Etappe absolviert, um diejenigen Maßnahmen zu begünstigen, die ich jetzt als so negativ kritisiert habe.
Man braucht das Übergangsdienstrecht also deswegen, um den autonomen Universitäten in der Folge die Luft zu geben, die sie für eine autonome Personalverwaltung brauchen, das heißt, um sie nicht von vornherein personell zu zementieren.
Noch ein paar Bemerkungen zur dann voll autonomen Universität: Diese wird ein anderes Dienstrecht brauchen, und zwar wird sie ein Dienstrecht brauchen, das dem allgemeinen Arbeitsrecht entspricht. Das heißt, wir werden kollektivvertragsfähige Einheiten auf Dienstgeberseite haben, wobei ich nicht empfehle, dieses Recht auf einzelne Universitäten zu beziehen. Das wäre nach geltendem Recht zwar die Rechtsfolge, weil die Universität dann Anstalt des öffentlichen Rechts und als solche selbst als Einzeluniversität kollektivvertragsfähig wäre. Ich halte das aber nicht für günstig. Ich meine, wir brauchen den Ausgleich über die Universitäten hinweg.
Es wird möglich sein, Betriebsvereinbarungen auf Universitätsebene abzuschließen. Das sollte dort geschehen und nicht auf einer überbetrieblichen Ebene. Wenn Sie diesen Schritt gehen wollen – und das setze ich einmal als Aktion fest und bewerte es zunächst noch nicht –, dann bedingt das aber auch eine andere Form der sozialpartnerschaftlichen Konfliktaustragung an den Universitäten, als es jetzt der Fall ist. Dann wird es nämlich nicht möglich sein, dass man gleichzeitig mitbestimmte Entscheidungsstrukturen und zusätzlich noch eine wesentlich aufgewertete Personalvertretung in Gestalt eines Betriebsrates hat, denn dieser verfügt ja über wesentlich mehr Zähne als eine öffentlich-rechtliche Personalvertretung.
Wenn Sie den Weg gehen wollen, vollrechtsfähige Universitäten einzurichten und diese der allgemeinen Ordnung des Arbeitsrechts zu unterwerfen, dann werden Sie dort allgemeine Interessenvertretungen der Arbeitnehmer in Gestalt von Betriebsräten haben. Wenn Sie aber den gegenwärtigen Zustand der Paritäten aufrechterhalten, dann kommen Sie zu einer Überbestimmung, denn traditionellerweise – da brauchen wir uns nichts vorzulügen – sind die Mittelbauvertreter gleichzeitig auch die Personalvertreter. Das kann man derzeit hinnehmen, weil die Personalvertretung ja in Wirklichkeit beratende Organe hat. Ist sie aber ein echtes Mitbestimmungsorgan, dann warne ich davor, die gegebenen Paritäten so aufrechtzuerhalten! Man kann sich dann noch immer dazu entscheiden, die korporatistisch verfasste Universität mit den einzelnen Gruppen aufrechtzuerhalten; dann kann man sie aber nicht in das System einer Betriebsverfassung eingliedern.
Noch ein kurzes Wort zur Frage der Anwendung des allgemeinen Arbeitsrechts und Kündbarkeit. In diesem Zusammenhang wird immer wieder die Vorstellung eines Hire-and-fire-Systems und des fehlenden Gewissensschutzes für unabhängig arbeitende Forscher perhorresziert. Dazu sage ich: Das Arbeitsrecht hat es locker schon in vielen Bereichen geschafft, einen Motivkündigungsschutz – etwa in § 105 Arbeitsverfassungsgesetz – einzubauen, und zwar mit dem Inhalt, dass man wegen der Erarbeitung, Publikation und Verbreitung von Forschungsergebnissen oder wegen der Berufung auf bestimmte Lehrmeinungen nicht gekündigt werden kann. Das sollte also niemanden davor abschrecken, ein derartiges System ins Auge zu fassen!
Zuletzt möchte ich gerade als Arbeitsrechtler auf einen Punkt hinweisen: Ich meine, dass gegenwärtig der Ausbau des Stipendienwesens – also eines Bereiches außerhalb des reglementierten Arbeitsrechtes – an den Universitäten von größter Wichtigkeit ist, und zwar nicht nur deswegen, weil auf diese Art und Weise wissenschaftliche Nachwuchsförderung betrieben werden kann, die ja erforderlich ist, wenn wir uns dazu entschließen, Dauerstellen im Wettbewerbsverfahren zu vergeben. Dann müssen wir uns nämlich auch überlegen, woher wir die Leute nehmen, die dann in einem Wettbewerb um die Stellen stehen. Geht das innerhalb des Universitätssystems nicht, dann brauchen wir eine wirklich massive Stipendieninitiative; und die sollte nicht mit den rigiden Einengungen des Arbeitsrechtes belastet sein. Ein sozialrechtlicher Schutz wird sicherlich zu gewährleisten sein.
Frau Kollegin! Ich hoffe, ich habe jetzt ein bisschen von der Zeit eingebracht. – Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. (Beifall.)
12.18
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Als Nächsten bitte ich Herrn Dr. Joksch um seine Ausführungen.
„Die Rolle der Privatuniversitäten in der Bildungslandschaft der Zukunft“
12.19
Referent Dr. Christian Joksch (IMADEC University): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Frau Bundesminister! Sehr geehrte Damen und Herren! Es ist für mich eine große Ehre, hier zu sein, denn die Privatuniversitäten sind bei uns ja erst vor kurzem entstanden. Sie werden zwar oft zitiert, heute haben Sie Stanford, Harvard, Yale, Cornell und so weiter schon öfters genannt, und es ist eigentlich ganz toll, dass man, wenn man sich um Reformen bemüht, in Wirklichkeit die Privaten als Muster heranzieht, aber trotzdem erst relativ spät private Universitäten geschaffen hat.
Am 24. Juli 2000 hat man das Bildungsmonopol zerbrochen: Die päpstliche Katholisch-Theologische Hochschule in Linz wurde als erste Privatuniversität Österreichs akkreditiert. Ende November hat man dann in Österreich die Webster University und die IMADEC University auf fünf Jahre akkreditiert. Die International University wurde für drei Jahre akkreditiert.
Damit gibt es jetzt vier private Universitäten in Österreich, und diese vier privaten Universitäten sind natürlich absolut nicht mächtig. Sie umfassen ein Studentenvolumen von rund 2 000 Studenten im Jahr. Das ist verglichen mit den staatlichen Institutionen keine große Studentenzahl.
Das, was ich heute hier betreffend österreichische Reformbereitschaft gehört habe, war schon ganz gut, etwas ist mir jedoch abgegangen: Es wird vom Markt, vom Wettbewerb und vom Dienstrecht gesprochen. Kein einziger Referent – und ich bin jetzt der Neunte – hat aber vom Kunden gesprochen. Eigentlich ist jedoch der Kunde das Entscheidende, jedenfalls für die privaten Universitäten. Ich selbst war Student an einer heimischen staatlichen Universität, und es ist nicht alles schlecht, was dort angeboten wird. Im Gegenteil: Es ist recht gut und gehört nur ein bisschen reformiert.
Was mich aber damals gestört hat, war die Kundenbeziehung: Ich wurde zum Beispiel Verfassungsrecht auf dem Weg zum Flughafen geprüft. Wenn Sie sich vorstellen, dass es sich um eine Kundenbeziehung handelt, im Rahmen welcher Sie vielleicht Studiengebühren einheben, dann muss diesbezüglich ein Umdenken erfolgen!
Ich denke: Der Kunde ist König, der Kunde bestimmt Angebot und Nachfrage, und der Kunde hat auch ein Recht auf eine bestimmte Leistung. Darum achten wir als private Unis in Österreich sehr auf die Output-Orientierung und auf diese Kundenbeziehung.
Aber auch die Wirtschaft ist für uns Kunde. Der Staat kümmert sich eigentlich sehr, sehr wenig um die wirklichen Wünsche der Wirtschaft. Den Ausführungen des Herrn Generaldirektors Hochleitner konnte ich sehr deutlich entnehmen, dass er sich mehr Zusammenarbeit wünscht. – Das ist sicherlich ein wesentlicher Punkt.
Ich möchte noch etwas zum Humboldt’schen Bildungssystem sagen: Ich bin eigentlich ein Fan von Humboldt, wenn ich bedenke, dass Humboldt 1792 „Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen“ geschrieben hat. Leider Gottes hat Humboldt seine Ideen dann dramatisch widerrufen. Ursprünglich hat Humboldt nämlich gesagt: Öffentliche Erziehung scheint mir ganz außerhalb der Schranken zu liegen, in welchen der Staat seine Wirksamkeit halten muss. – Damit kann man wirklich voll einverstanden sein!
Leider hat sein Gedankengut aber, wie man so schön sagt, den Zugang zur Macht nicht überlebt. Humboldt wurde 1809 Direktor der Sektion Kultur und Unterricht im preußischen Ministerium, und ab dann habe ich natürlich meine Schwierigkeiten, und ich bitte Sie, dafür zu sorgen, dass ich mich nicht selbst dem Schicksal aussetzen muss, meinen Prinzipien untreu zu werden!
Es gibt einige Punkte, die dafür sprechen, dass der Staat mit den privaten Universitäten ein gutes Miteinander und nicht ein Gegeneinander haben sollte. Daher appelliere ich jetzt an Sie: Für die Zukunft der Privatuniversitäten in Österreich sollte es einige wesentliche Rahmenbedingungen geben.
Punkt eins: Eine der wesentlichen Rahmenbedingungen für die Privaten ist, dass das Dienstrecht dem Arbeitsrecht entspricht und sehr flexibel bleiben sollte. Darüber hinaus fordere ich die Freiheit der Wissenschaft – wie es ja üblich ist – und die Freiheit der Organisation der Lehre, und zwar Letztere aus folgendem Grund: Viele unserer Kunden haben den Wunsch, sich auch am Samstag oder Sonntag fortzubilden, und wir haben zum Beispiel größte Erfolge damit erzielt, dass wir Kurse von Donnerstag bis Sonntag spät am Abend anbieten. Und es ist offensichtlich auch machbar, wenn man auf den Kunden hört, dass es Blockveranstaltungen gibt, bei denen man acht oder zwölf Stunden lang ununterbrochen in einem Raum sitzt.
Darüber hinaus wünsche ich mir geeignete Rahmenbedingungen im Steuerrecht für die Zuwendungen an private Universitäten. Heute sind laut § 4 Z 5 nur beschränkte Zuwendungen an Universitäten möglich. Aber das Einkommensteuerrecht wurde zu einem Zeitpunkt geschrieben, zu dem es noch keine privaten Universitäten gegeben hat. Jetzt erhebt sich Frage, ob man nicht auf § 4 Z 6 in der Form ausweichen könnte, dass man sagt, dass es neben der Subjektförderung auch die Objektförderung durch die Wirtschaft gibt. Das wäre nämlich ein ganz wichtiger Punkt, weil es in diesem Zusammenhang auch um die Fragen von Stiftungsprofessuren, von Zuwendungen für Schulen und Departments von privaten Universitäten geht.
Die Frage der Leistungsverträge auch mit öffentlichen Einrichtungen ist ebenfalls ein ganz wesentlicher Punkt. Es geht dabei nicht darum – und ich hoffe, Sie verstehen mich nicht falsch –, dass wir vom Staat Geld wollen, sondern es geht in erster Linie darum, dass wir im Wettbewerb mitspielen können. In § 8 Akkreditierungsgesetz steht zum Beispiel, dass Leistungen des Staates zugekauft werden können, sofern sie der Staat nicht anbietet. „Im Wettbewerb mitspielen“ bedeutet aber eigentlich, vielleicht auch in Konkurrenz zu gewissen Leistungen des Staates zu treten.
Jetzt komme ich zu einem ganz wesentlichen Punkt: Ich habe zuerst erwähnt, dass die Akkreditierung der ersten privaten Universität in Österreich relativ lange gedauert hat. Wir werden nach wie vor durch die Akkreditierungsbehörde überprüft, und man hat oft den Eindruck, dass die Akkreditierungsbehörde versucht, Dinge nicht zu ermöglichen, statt Dinge zu ermöglichen. Daher würde ich mir wirklich wünschen, dass es möglich wird, im Hinblick auf neue Produkte ähnlich behandelt zu werden wie der Staat. Wenn wir nämlich ein neues Produkt einführen, dann müssen wir wiederum zur gleichen Akkreditierungsbehörde und haben ein gleiches Verfahren, während beim Staat ein Nichtuntersagungsbescheid erteilt wird. Wenn sich etwa die Wirtschaftsuniversität in Wien das Ziel setzt, eine neue Studienrichtung „Wirtschaft und Recht“ einzuführen, dann geht es nur um eine Nichtuntersagung, nicht aber um eine neuerliche Akkreditierung.
Ich wünsche mir ganz einfach, dass Staat und Privat in Zukunft ein gesundes Nebeneinander haben! Die Privaten können sicherlich in manchen Bereichen zur Entlastung des Staates beitragen, nämlich dann, wenn es ohnedies das Diktat der leeren Kassen gibt. – Herzlichen Dank. (Beifall.)
12.28
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Nächster Referent ist Herr Universitätsprofessor Dr. Rainer. – Bitte.
„Die Uni-Reform in Österreich vor dem Hintergrund der europäischen Universitätslandschaft“
12.28
Referent Univ.-Prof. DDr. Johannes Michael Rainer (Universität Salzburg): Verehrter Herr Vorsitzender! Verehrte Frau Bundesministerin! Werte Teilnehmer dieser Enquete! Vieles von dem, was ich hier ex novo bringen wollte, wurde bereits vorgebracht. Daher ist es nun meine Aufgabe, vieles bereits Vorgebrachte durch meinen internationalen Vergleich der Universitäten im EU-Bereich zu unterstreichen.
Erstens: Wichtig erscheint mir eine vorgezogene Bestandsaufnahme. Wenn wir von Autonomie sprechen und diese Autonomie haben wollen – darauf werde ich sogleich zu sprechen kommen –, so gilt es, eine Bestandsaufnahme zu machen, denn seit der Wiedereröffnung österreichischer Universitäten durch Kaiser Franz I. nach den napoleonischen Kriegen leben wir in einer Phase des dauernden Fortschreibens der Unorganisiertheit und des nicht systematischen Auf- oder Abbaus. Da ist nie ein Schlussstrich gezogen worden, und daher ist nun der Augenblick gekommen, in dem wir, bevor die Universitäten in die Autonomie entlassen werden, einen Schlussstrich ziehen sollten, um einen Neubeginn zu gewährleisten.
Ich plädiere entschieden dafür, dass die österreichische Universitätslandschaft zuerst dieser Bestandsaufnahme unterzogen werden muss, beginnend mit einer Selbstevaluierung an den einzelnen Universitäten, gefolgt natürlich von national-internationalen Evaluierungsmaßnahmen, die uns Folgendes aufzeigen sollen: Was brauchen wir eigentlich? Was können wir uns leisten? Wie können wir unser Geld effizienter einsetzen? Wie können wir diese hohen Beträge, die tatsächlich für das Universitätswesen aufgewendet werden, vor dem Steuerzahler, dem eigentlichen Sponsor dieses Unternehmens, rechtfertigen? – Es muss also eine präventive Bestandsaufnahme vorgenommen werden.
Nachdem diese durchgeführt worden ist, sollte man die – auf diese Weise sozusagen nicht nur reduzierten, sondern möglicherweise auch gewachsenen – Universitäten in eine Autonomie entlassen. Diese Autonomie – und hier scheiden sich möglicherweise die Geister – soll aber nicht bedeuten, dass der Staat seiner allgemeinen Bildungsrolle, seiner Bildungsfunktion entbunden wird.
Im Gegensatz zu manch anderem meiner Vorredner bin ich durchaus der Ansicht, dass der Staat weiterhin eine verantwortungsvolle Rolle im Bereich der Universitäten spielen soll. Das soll jedoch nicht im Sinne eines Josephinischen Kameralismus sein, sodass es darum ginge, jeden Dienstposten umzuwandeln, mit präventiven Anfragen und x Kontrollen, vielmehr geht es darum, dass der Staat gewisse Regeln fixiert, sowohl was die Organisation der Universitäten als auch was das Dienstrecht anbelangt. Da teile ich also nicht die Auffassung meines Vorredners. Ich bin durchaus der Meinung, dass ein staatliches, ein besonderes Dienstrecht für Universitäten vonnöten ist.
Ich glaube auch, dass staatliche Rahmenbedingungen vorgegeben werden sollen – nicht ins Detail gehend, wohlgemerkt, aber Rahmenbedingungen sollten vorgegeben werden, und zwar insbesondere – und das bedeutet erhöhte Flexibilität – die Möglichkeit der Universitäten, über die Verteilung der zugewiesenen Gelder zu befinden. Selbstverständlich sollten diese Gelder den einzelnen Universitäten auf dem Wege eines Globalbudgets zugewiesen werden. Es sollte sich auch nicht um Jahresbudgets handeln, sondern darum, eine langfristige oder zumindest längerfristige Planung zu gewährleisten, mit Budgets für vier oder fünf Jahre.
Doch um diese Globalbudgets nach diesen Perioden konkret und sinnvoll zuweisen zu können, bedarf es eines Controllings. Das gibt es allenthalben in den Universitäten, die in die Autonomie entlassen werden, ein Controlling, wie auch immer wir es aufbauen wollen, staatlich oder privat gelenkt. Allerdings bedarf es klarer Vorgaben. Es geht nicht um postwendende Entscheidungen, sondern hiefür müssen klare Maßstäbe vorliegen.
Wie bereits meine Vorrednerin gemeint hat, ist es, um diese Budgets im Wesentlichen zu erfüllen, besonders wichtig, dass in den Evaluierungen auch die Internationalisierung in Betracht gezogen wird. Die internationale Dimension der Universität soll im Rahmen dieser Evaluierungsmaßnahmen einen ganz wesentlichen Bereich darstellen. Es soll dargetan werden, wie sehr sich die österreichischen Universitäten im internationalen Profil behaupten und wie sehr sich die einzelnen Mitarbeiter der Universitäten international engagieren.
Heute wird das keineswegs gewürdigt. Es gibt nur sehr wenige, die sich in äußerst verantwortungsvoller Weise und bis zur Erschöpfung um die Internationalisierung der österreichischen Universitäten bemühen. Das schlägt nirgendwo zu Buche, sondern man hält ihnen im Gegenteil noch vor, sie würden sozusagen auf Kosten der Allgemeinheit ins Ausland fahren und dort möglicherweise einen Tag nach dem anderen in Feiertagsstimmung verbringen. Wer nicht persönlich miterlebt hat, wie schwierig das ist – sich von einer Situation in die andere, von einem Land in das andere zurechtzufinden, bei jeweils völlig anderem Benehmen und Verhalten, völlig anderen Dimensionen –, der wird das nie begreifen.
Auf jeden Fall bedarf es einer Kontrolle dieser Globalbudgets durch eine Evaluierung, deren Maßstäbe von vornherein feststehen müssen, damit auf Grund dieser Evaluierung die Budgets neu zugeteilt werden können. Es gibt im europäischen Vergleich bei der budgetären Anpassung inzwischen Schwankungen der Budgets im Ausmaß von 10 bis 20 Prozent, was eine nicht unwesentliche Veränderung darstellt.
Das heißt, ich plädiere für die Form einer „Soft“-Autonomie. Ich sage ja zur Autonomie, aber einer Autonomie, deren Rahmenbedingungen gesetzlich feststehen müssen und deren Haushalte durch allgemeine Evaluierungsverfahren gewährleistet werden.
Diese Autonomie erfordert schnelle und flexible Entscheidungsgremien. Hiefür gibt es eine Reihe von Modellen, anhand derer man sich informieren kann. Der Kollege aus der Schweiz hat bereits das Schweizer Modell dargestellt. Ebenso lobenswert wäre es, hier das niederländische Modell hervorzuheben, da es offenbar besonders gut funktioniert.
Ich konnte mich an der Universität von Utrecht selbst davon überzeugen. Dort wird die Universität von einem so genannten Verwaltungsrat geleitet. Diesem Verwaltungsrat gehören nicht mehr als drei Herren an, der Rektor und zwei Gewählte. Der Verwaltungsrat bestimmt tatsächlich das tägliche Geschehen an der Universität, er ist der „Dienstherr“, und so weiter und so fort. Kontrolliert wird der Verwaltungsrat von einem Aufsichtsrat, der aus nur fünf Persönlichkeiten besteht. Dort können Sie sehen, wie kleine Gremien ein schnelles, flexibles Funktionieren der Universitäten gewährleisten.
Hingegen ist hier mit den heute zur Verfügung stehenden Gremien, mit riesenhaften, mammuthaft aufgeblasenen Senaten und Kommissionen überhaupt kein Staat mehr zu machen. Das muss man sich einmal ganz dick hinter die Ohren schreiben.
Ebenso bedarf es, wenn man Universitäten verwalten möchte – jeder, der aus der Wirtschaft, aus einem funktionierenden Betrieb kommt, weiß von diesem Bedarf –, für diese Aufgaben ausgebildeter Verwalter. Es kann also nicht – so wie heute – die Aufgabe von Professoren, Mittelbau und Studenten sein, die Universitäten zu verwalten. Dazu sind sie überhaupt nicht in der Lage, dafür sind sie nicht ausgebildet. Das ist eine Verschwendung von öffentlichen Geldern, weil diese Leute für ganz andere Zwecke als fürs Verwalten einzusetzen sind. Sie vergeuden nur von früh bis spät ihre Zeit, indem sie verwalten müssen.
Was sollen wir da verwalten? – Das ist nicht unsere Aufgabe! Dazu bedarf es eigener Experten, das wäre viel billiger. Andererseits würde dadurch die Dauer der Studienzeiten sinken und zudem zweifellos der wissenschaftliche Output der Professoren steigen – ein ganz einfaches Rechenbeispiel!
Schließlich zeigt sich im internationalen und europäischen Vergleich auch etwas, was fast alle meiner Vorredner bereits erwähnt haben; ich muss es dennoch ein weiteres Mal unterstreichen. Es geht um die Kriterien der Auswahl der Nachfolger, sozusagen um unsere eigene Ergänzung im universitären Bereich, zu Deutsch: um die Berufung der Professoren sowie die Bestellung unserer Mitarbeiter, der Assistenten. Es ist völlig einmalig in ganz Europa – so etwas gibt es kein zweites Mal! –, dass jeder, der dafür tatsächlich nicht ausgebildet ist, hierzulande glaubt, dabei mitreden zu können.
Es gibt Regeln, die überall in Europa zur Anwendung kommen und die besagen, dass sozusagen nur Gleichrangige über die Qualifikation entscheiden können. Das ist überall in Europa ein klarer Grundsatz – ziehen Sie selbst daraus die Konsequenzen! Es ist überall so, dass Professoren wieder Professoren berufen, dass – wenn Sie so wollen – Habilitierte und Professoren eben Assistenten, junge Wissenschafter habilitieren. Es ist klar, dass nur der Qualifizierte die Entscheidung darüber fällen kann, wer dazu berufen ist, in einer bestimmten Funktion der Universität weiter zu dienen.
Das soll aber keineswegs bedeuten, dass die Evaluierung der Lehrveranstaltungen nicht durch die Studierenden erfolgen soll! Ich halte das vielmehr für außerordentlich wichtig, das gibt es auch allenthalben in Europa, und es wird in anderen Ländern in weit stärkerem Ausmaß durchgeführt. Es gibt viele Länder, in denen jede Lehrveranstaltung zu evaluieren ist. Selbstverständlich sollte den Studierenden auch bei Berufungen und Habilitationsverfahren eine wichtige Stimme zukommen. Sie können ja erkennen, wie der Betreffende, der sie in Zukunft lehren wird, als Lehrer auftritt; das kann der Professor manchmal gar nicht. In dieser Hinsicht hat den Studierenden tatsächlich ein wichtiges und gewichtiges Wort zuzukommen.
Weiters gibt es in Österreich ein unseliges Gesetz, welches das Ausmaß desjenigen Stoffes, der vorzutragen ist, auf eine bestimmte Anzahl von Stunden pro Studienrichtung eingeschliffen hat. Auch das halte ich im internationalen Vergleich für völlig einzigartig. Wichtig wären hier vielmehr Rahmenbedingungen, also Minimal-Erfordernisse, und über diese Minimal-Erfordernisse hinaus sollten die Universitäten völlig autonom im Hinblick darauf sein, wie sie ihre Studienpläne erweitern und ergänzen. Ein möglichst umfangreiches Angebot ist wesentlich angebrachter, eine umfangreiche Bildung ist in weitaus höherem Ausmaß angebracht als das Beschneiden der Möglichkeiten, auch den Studierenden gegenüber.
Es sind in den letzten Jahren immer nur Lehrveranstaltungen eingespart worden, es dürfen keine Übungen und keine Seminare mehr gehalten werden. Und warum? – Weil kein Geld da ist; darauf beruft man sich.
Also geht es hier um eine Lösung im internationalen Vergleich, vor allem für jene Studienrichtungen, die für den Staat von eminenter Bedeutung sind. Von jenen Studienrichtungen, von denen der Staat Leute übernehmen soll oder wo der Staat eine wichtige Aufgabe sieht – in der medizinischen Versorgung, in den Rechtswissenschaften, in all jenen Studien, die zur Ausbildung von Mittelschulprofessoren führen –, muss es Grund-Studienpläne geben, also Minimal-Erfordernisse, auf deren Basis sich die Universitäten völlig frei entfalten können. Das ist viel vernünftiger, als wenn man sagt: Ihr dürft nur so und so viele Stunden lehren, und sonst nichts. – Auch das, scheint mir, ist abzulehnen.
Ich habe von den Rahmenbedingungen gesprochen – später werde ich noch auf die Europäische Universität an und für sich zu sprechen kommen –, und diese betreffen drei Aspekte. Dazu gehört, wie gesagt, zunächst das Dienstrecht. Ich befürworte den mir im Augenblick vorliegenden Entwurf einer Änderung des Dienstrechts.
Zum anderen geht es um die Universitätsorganisation. Hier möchte ich auch zusammen mit anderen Kollegen, die das bereits getan haben, einen Hilferuf an die Parlamentarier richten. Wir sind durch das System, das fälschlicherweise auf demokratische Mitbestimmung ausgerichtet ist, völlig geknebelt. Es ist kein demokratisches System, das kann man an vielen Stellen belegen. Die Unterteilung der Universitäten, diese starre und strikte Kurienuniversität ist ein Relikt aus der Vergangenheit. In Italien, wo ich beheimatet bin, hat man dies immer mit Entsetzen verfolgt. Derartige Dinge, derartige korporativistische Züge hat man dort spätestens mit dem Ende des Faschismus abgelegt.
Dass ein derartiges System bei uns noch herumgeistert, ist völlig absurd. Es fördert die Gegensätzlichkeiten. Es hetzt die verschiedenen Gruppen gegeneinander auf. Es knebelt uns im wahrsten Sinne des Wortes. Es führt zu dem, was es ist: zu einer – auf gut Österreichisch – einzigen Packelei und Freunderlwirtschaft. Befreien Sie uns von einem Gesetz, das uns zur Freunderlwirtschaft, zum do ut des zwingt!
Wie oft hat das jeder von uns gemacht, wir Professoren genauso wie alle anderen! Wir müssen uns dafür schämen! Aber wir sind durch dieses System dazu gezwungen worden, wir mussten Offerte machen. Do ut des – wie oft bin ich selbst in die Situation gekommen, anzubieten, damit ich irgendwann später wieder etwas bekomme! Ich schlage mir selbst auf die Brust. Ein solches System ist im höchsten Ausmaß reformbedürftig. Es gehört schlicht und einfach weg, es ist nicht demokratisch. Wer auch immer sich darauf beruft, es sei demokratisch: Es ist schlicht und einfach nicht demokratisch!
Das ist keineswegs gegen die Studierenden gerichtet, die Kunden unserer Universität, denen gegenüber wir die Verpflichtung haben, sie zu kontrollieren. Es ist auch nicht gegen den Mittelbau gerichtet. Stellen Sie sich vor, als hervorragender Universitätsdozent hängen Sie immer noch in der Mittelbaukurie drin, mit 60, mit 65 Jahren, und längst haben Sie die Qualifikation des Professors! Sie sind möglicherweise viel besser als der Professor, der neben Ihnen steht. Das ist doch eine absurde Situation, mit der aufgeräumt gehört. Es ist absurd!
Was mir vorschwebt, ist Folgendes: Wenn durch die Großzügigkeit des Finanzministers oder auch von Privaten Gelder zur Verfügung gestellt werden können und diese Möglichkeit besteht, würde ich mich sehr dafür aussprechen, in Österreich vorbildhaft eine Europa-Universität zu gründen, eine internationale Europäische Universität, die europäische Studienabschlüsse vergibt. Ein Weg dazu könnte sein – und der ist in Österreich auch noch nicht beschritten worden –, dass einzelne Universitäten, Fakultäten oder Studienrichtungen mit Partnern im Ausland nun Abkommen schließen, um gemeinsame Diplome im erhöhten Ausmaß zu vergeben.
Ich habe an derartigen Verhandlungen im Auftrag der Universität Rom III teilgenommen. Es gibt derartige gemeinsame, internationale europäische Studien, und darauf sollten wir unsere Kräfte konzentrieren: Europäisierung der Universität, gemeinsame Studienabschlüsse und Internationalität. – Vielen Dank. (Beifall bei den Freiheitlichen und der ÖVP.)
12.46
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Als Nächsten bitte ich Herrn Dr. Bast um seine Ausführungen.
„Die erweiterte Autonomie aus Sicht der Kunstuniversitäten“
12.46
Referent Dr. Gerald Bast (Rektor der Universität für angewandte Kunst): Herr Vorsitzender! Frau Bundesministerin! Meine Damen und Herren! Am 1. Jänner 2000, also vor knapp 16 Monaten, ist an der Universität für angewandte Kunst – deren Rektor ich sein darf – ein neues Gesetz in Kraft getreten. Mit diesem Gesetz wurden die gesamte Aufbau- und Ablaufstruktur innerhalb der Universität sowie das Verhältnis zum Ministerium total verändert. Deregulierung, Dezentralisierung, mehr Autonomie und mehr Verantwortung für die Kunstuniversitäten waren und sind die Schlüsselbegriffe dieser Reform.
Meine Damen und Herren! Von diesem Saal aus hat man den Leuten an den Kunstuniversitäten aufmunternd zugerufen, sie mögen diese einmalige Chance nutzen und durch ihr Engagement in diesen neuen Strukturen die Reform zum Leben bringen.
Stellen Sie sich vor, das tun wir jetzt! – Es wird engagiert und konzentriert gearbeitet an langfristigen Entwicklungsplanungen, an Evaluierungsmethoden und deren Anwendung, an Kostenrechnungs- und Controlling-Systemen, an nachhaltigen Ressourcenplanungen, an neuen Angeboten im Post-Graduate- und im Weiterbildungssektor, an der Erstellung neuer Studienpläne – und: es wird Kunst produziert. Es wird geforscht, gelehrt und studiert, mehr und besser denn je! Es wird an den Kunstuniversitäten intensiv und höchst produktiv gearbeitet, und das trotz Budgetkürzungen und trotz einer überfallsartigen Einführung von Studiengebühren. Kurz: Wir sind dabei, die Reform umzusetzen und vom Papier zum Leben zu bringen.
Aber mittendrin in diesem laufenden Reformprozess sagt die Regierung: Wir machen jetzt eine Totalreform der Universitäten. Wir beheben nicht die – zweifellos vorhandenen – Mängel, nein, eine Totalreform muss es sein! Eine ganz neue Universität mit ganz neuer Struktur soll die bisherige ersetzen.
Was steckt wirklich hinter dem totalen Reformeifer der Regierung? – Viel Konkretes hat man dazu leider noch nicht verlauten lassen. Dennoch zeichnen sich bestimmte Tendenzen ab.
Ausgliederungen kosten zunächst zusätzliches Geld, viel Geld. Der Bundeskanzler hat vor etwas mehr als einem Jahr im Fernsehen die Ausgliederung der Universitäten im Zusammenhang mit der Budgetsanierung genannt. Allerorten wird gespart, um das Nulldefizit zu erreichen. Es gibt einen Zeitplan, der das In-Kraft-Treten der Ausgliederung für Oktober 2002 vorsieht. Ein Konzept für die Finanzierung dieser Ausgliederung gibt es jedoch nicht. Woher soll das zusätzliche Geld kommen?
Die Universitätsgebäude wurden trotz der Einwände der Rektoren bereits der BIG übereignet. Wie passt das zur Vollautonomie?
Die eben erst eingerichteten Universitätsorgane werden ohne Evaluierung ihrer Tätigkeit weitgehend als überflüssig oder schädlich qualifiziert. Glauben Sie mir: Zumindest an den Kunstuniversitäten existiert dieses Zerrbild einer wild gewordenen Mitbestimmung, wie es hier zum Teil gezeichnet wurde, nicht. Wer das Geld an einem Institut verteilt und wie es verteilt wird, entscheidet der Institutsvorstand und nicht die Institutskonferenz. Welche Verträge abgeschlossen werden, entscheidet der Institutsvorstand und allenfalls der Rektor, aber nicht die Institutskonferenz.
Flugkapitäne sollten bisweilen auch in Bordbücher schauen, damit sie wissen, was sie sich trauen dürfen. Zivilcourage ist eine wichtige Eigenschaft von Flugkapitänen, egal, in welchem Flugzeug sie sitzen.
Die Pläne für das so genannte Übergangsdienstrecht lassen ebenfalls wenig Tendenz zur Stärkung der eigenen, der universitären Verantwortung erkennen.
Die Verteilung der aus den Studienbeiträgen eingenommenen Mittel erfolgt zentralistisch und auf Einzelprojekte bezogen. Dies ist das genaue Gegenteil von Globalbudgets.
Zwischen den Universitäten und dem Ministerium soll ein Universitätsrat als zusätzliches Aufsichts- und Steuerungsorgan eingezogen werden, das nicht unwesentlich vom Staat beeinflusst werden soll.
Das sind die Rahmenbedingungen, unter denen die totale, die volle Autonomie der Universitäten jetzt diskutiert wird.
Vieles spricht dafür, dass eine Totalreform für die Universitäten folgende Ergebnisse brächte: weniger Geld, undemokratischere Strukturen, mehr staatlichen Einfluss und demotivierte Mitarbeiter.
Den Universitätsangehörigen, die derzeit viel Energie in die Umsetzung der aktuellen Reform investieren und Zweifel an der jetzt geplanten Totalreform äußern, wird rasch vorgeworfen, sie seien ängstlich und reformunwillig. Karl Popper hat derartige Argumentationsketten als Immunisierungsstrategie geschlossener Gesellschaften gegeißelt.
Muss man wirklich die Universitäten ausgliedern und neu konstruieren, weil die staatlichen Vorschriften für die Personal- und Budgetverwaltung zu kompliziert und zu schwerfällig sind? Ist das wirklich die Ultima Ratio, mit der die Politik an die Lösung der Probleme des Staates herangeht?
Die Universitäten können innerhalb der bestehenden staatlichen Regelungen nicht effizient arbeiten – daher heraus mit den Universitäten aus dem Staat! Macht man das als Nächstes auch mit den Schulen so? – Die Sachlage ist dort ganz ähnlich. Also Ausgliederung aller staatlichen Schulen?
Wie ist das mit der Anschaffung von Computern und der Einstellung von Schreibkräften an den Gerichten? – Auch sehr schwerfällig, die Bürokratie dort! Also auch die Gerichte ausgliedern? Sie meinen, das führt denn doch zu weit?
Totalreform und Ausgliederung – oder alles so lassen, wie es ist. Sind das die einzigen Alternativen? Ist das Politik mit Phantasie, Politik mit Herz?
Wenn das Ziel der Regierung und des Parlaments wirklich lautet, autonomen Universitäten eine flexiblere und effizientere Personal- und Budgetverwaltung zu ermöglichen, und wenn es denn der Staat nicht übers Herz bringt, Vorschriften zu erlassen, die es ermöglichen, Personal einzustellen, wenn man Geld dazu hat, dann gibt es doch einen Weg, der rasch und mit geringem legistischem Aufwand zu diesem Ziel führen kann:
Der Bund weist der Universität Budgetmittel im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit zu. Die Universität verwendet diese Budgetmittel für die Erfüllung ihrer Aufgaben in der Lehre, der Forschung und der Kunstentwicklung. Die Budgetzuweisung erfolgt auf Grund einer mehrjährigen Leistungsvereinbarung. Neues Personal wird nur noch nach dem Angestelltengesetz – ergänzt durch Kollektivverträge und Betriebsvereinbarungen – eingestellt. Das Haushaltsrecht des Bundes ist nicht anzuwenden, die Universität hat jährlich eine Bilanz und einen Leistungsbericht zu erstellen. Der bestehende, von der Universität eingerichtete Universitätsbeirat wird gestärkt.
Wir erreichten damit die Beibehaltung der Motivation der Universitätsangehörigen zur Fortsetzung des Reformprozesses, den Ausstieg aus der Planstellenverwaltung des Bundes und eine effizientere Budgetgebarung außerhalb der Normen des Bundeshaushaltsrechts.
Meine Damen und Herren! Die teilrechtsfähigen Universitäten existieren seit mittlerweile mehr als 14 Jahren und haben sich bewährt. Im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit wird an den Universitäten jährlich mehr als 1 Milliarde Schilling eingenommen und für Forschung und Lehre verwendet. Mehrere hundert Angestellte werden im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit beschäftigt.
Wenn das Ziel mehr Personal- und Budgetverantwortung für die Universität ist, dann sollte man das – und nur das! – so rasch und einfach wie möglich umsetzen. Die Universität für angewandte Kunst steht für diesen Weg zur Verfügung. Wenn das Ziel aber billigere Kunstuniversitäten mit autoritären Strukturen und mehr indirektem Staatseinfluss sind – dann ohne uns!
Wer die öffentlichen Debatten über die Universitäten regelmäßig beobachtet, muss insbesondere in letzter Zeit den Eindruck haben, die Hauptaufgabe der Universität bestehe darin, eine immer noch bessere Organisationsform zu finden, drohenden Budgeteinsparungen entgegenzutreten und die Details der Übergangsregelungen zu einem Übergangsdienstrecht zu verhandeln.
Verstehen Sie mich richtig: Natürlich sind die formalen Rahmenbedingungen, unter denen eine Kunstuniversität existiert, wichtig. Aber man sollte doch auch auf die Wahrung der Verhältnismäßigkeit achten. Die Hauptaufgabe einer Kunstuniversität und der dort tätigen Personen ist es, zu studieren, zu lehren, die Entwicklung der Künste voranzutreiben und zu forschen. Dafür sind die Kunstuniversitäten da, dafür werden sie von unserer Gesellschaft unterstützt.
Permanente Diskussionen über kaskadenartig sich überschlagende Pläne für Reformen, Übergangsreformen, Totalreformen, die noch dazu durch eine eher zögerliche Informationspolitik am Kochen gehalten werden, sind eine Verschwendung von Zeit und Energie aller Beteiligten. Wollen wir, dürfen wir uns diese Art von Beschäftigungsstrategie in einer Zeit ohnedies knapper Ressourcen im Universitätsbereich wirklich leisten? – Sagen Sie jetzt bitte nicht: Sollen sie an den Universitäten halt weniger diskutieren!
Lassen Sie mich zum Schluss noch eines betonen: Diese sehr aufwendige Enquete zur Reform der Universitäten ist gut und richtig. Aber wann gab es zuletzt eine ähnlich prominent besuchte Veranstaltung in diesem Haus, bei der es nicht um die Organisation und Administration, sondern um den inhaltlichen Stellenwert der Kunstuniversitäten in unserer Gesellschaft gegangen ist? Wann gab es zuletzt einen Dialog zwischen den Kunstuniversitäten und der Politik darüber, wie man die innovative Kraft der Kunstuniversitäten für unser Land am besten einsetzen kann, ein gemeinsames öffentliches Nachdenken darüber, was die Gesellschaft von den Kunstuniversitäten erwartet und welchen Einfluss Kunstuniversitäten auf die Entwicklung unserer Gesellschaft haben, haben könnten oder haben sollten?
Diesen längst überfälligen Dialog kann die heutige Enquete nicht ersetzen. Diesen Dialog müssen wir noch führen, und wir müssen die Schlüsse daraus ziehen.
Meine Damen und Herren! Die Zukunft unseres Landes entscheidet sich nicht im Wettbewerb um die häufigsten und spektakulärsten Universitätsreformen und auch nicht allein im Wettbewerb um neue technologische Entwicklungen. Die Zukunft unseres Landes entscheidet sich auch und nicht zuletzt am Erfolg und am nationalen wie internationalen Stellenwert unserer künstlerischen Entwicklungslabors: der Universitäten der Künste. – Danke. (Beifall.)
13.01
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Als Nächsten bitte ich Herrn Professor Dr. Zelewitz um seine Ausführungen.
„Vollrechtsfähigkeit und Dienstrecht“
13.01
Referent Ao. Univ.-Prof. Dr. Klaus Zelewitz (Universität Salzburg): Herr Vorsitzender! Frau Bundesminister! Meine Damen und Herren! Ich gestatte mir, konservativ zu sein. Für mich gehören nicht nur die Bereiche innere und äußere Sicherheit, Justiz und einiges andere, sondern für mich gehört auch der Bereich Bildung – und in unserem Zusammenhang insbesondere der Bereich Universitäten – nach wie vor zu den staatlichen Kernaufgaben.
In einer Welt, die immer undurchdringlicher zu werden scheint, in der immer mehr Entscheidungen expertengestützt und wissenschaftsgestützt getroffen werden, ist es mir sehr wichtig, dass es möglichst viel an Wissenschaftsfreiheit gibt, die auch Spielräume für wirklich ethisch getragene Entscheidungen übrig lässt.
Es geht nicht nur darum, dass unter Umständen ein Wissenschaftler im Nachhinein diszipliniert werden könnte. Da stimme ich mit dem Kollegen Marhold überein, dass man einen entsprechenden Kündigungsschutz vorsehen könnte. Es geht vielmehr darum, dass private Financiers – ich könnte es mir zum Beispiel, mit Blick auf meinen Nachbarn zur Rechten (in Richtung Univ.-Prof. DDr. Winkler), gleich von der Pharmaindustrie vorstellen – Wissenschaftsmeinungen eher befördern oder eher verhindern, die an der Universität entstehen dürfen oder eben nicht. – Sie mögen sagen, das gibt es heute schon. Ja, das gibt es heute schon, aber es besteht kein Anlass dazu, dieses Instrument weiter auszubauen.
Ein kleiner „Seitenschwenker“ auch Richtung Staat: Dieser Staat ist nicht nur Österreich, sondern er ist auch die Europäische Union. Der Teletext hat nach dem EU-Beitritt Österreichs sehr schnell umgeschwenkt und seine Orientierungsseite Inland, Österreich und EU zusammengefasst. Wir hingegen machen hier ständig Wissenschaftsplanung, als wären wir nach wie vor ein völlig bündnisfreies Land. Das bestimmt die Standortplanung, das bestimmt den Sprachgebrauch, wie ich ihn auch heute gehört habe: Wenn ich in Konstanz war, dann war ich ohne Wenn und Aber im Ausland, und so weiter. Ich bitte hier auch um ein verstärktes Umdenken und Umformulieren in Richtung Europa.
Die derzeit aktive Universitätsreform ist noch nicht umgesetzt. Rektor Bast hat soeben gesagt, dass man an den Kunstuniversitäten eigentlich erst damit begonnen hat. An kaum einer Universität ist das Instrumentarium wirklich ausgeschöpft, das das UOG 1993 und das entsprechende KUOG bieten, und schon geht man – ohne noch Erfahrungen darüber zu haben, was gut funktioniert oder was allenfalls nicht funktioniert – wieder daran, die nächste Reform, die nächste Totalreform in Angriff zu nehmen.
Das bezieht sich auch auf das Dienstrecht. Mir kommt das so vor wie ein Boot auf einem Fluss, natürlich mit Plätzen erster, zweiter und dritter Klasse. Ich sitze wahrscheinlich eher auf einem der ersten Klasse, und am Ufer stehen Leute, die in dem Boot mitfahren wollen. Da entschließt man sich jetzt, solche, die in der dritten Klasse am Rande des Bootes sitzen, ins Wasser zu werfen. Die Zeit ist abgelaufen, es sind auf dieser Flussfahrt vier Kilometer – oder was auch immer – vergangen. Man lässt andere einsteigen, die man allerdings nach vier Kilometern wieder hinauswirft.
Wenn man zum Beispiel von einem Kirchenrechtler spricht, bin ich ebenfalls dafür: Hier muss es auch Europarecht und nicht nur Kirchenrecht geben. Aber man muss auch die Frage stellen, was mit dem Kirchenrechtler, mit dem Personal an dem Institut passiert, wenn es an der Universität kein Kirchenrecht mehr gibt. Das ist ja nicht einfach etwas zu Entsorgendes; und die Stiftung Volkswagenwerk gibt es bei uns leider noch nicht. (Univ.-Prof. Dr. Hassauer: VolkswagenStiftung!) – VolkswagenStiftung, danke.
Das österreichische Konzept für die Vollrechtsfähigkeit ist eigenartig vage skizziert. Wann immer man irgendwo hineinsticht, bekommt man als Antwort, so sei es nicht gemeint, es würde noch beraten. – Es scheint mir als jemandem, der sich sehr dafür zu interessieren versucht, so zu sein, dass hier im Moment eigentlich nicht viel an Konzept vorhanden ist und dass man diese Konzeptlosigkeit als das Modell offener Planung weiszumachen versucht.
Es kann aber nicht so sein – das höre ich in letzter Zeit immer wieder; auch heute war es schon zu hören –, dass jemand, der Sorge um die Entwicklung hat, die die Universitäten in unserem Land zu nehmen scheinen, als uninformiert bezeichnet wird. Das wäre eine einfache Gleichung: Diejenigen, die – wo auch immer – dafür sind, sind informiert, und diejenigen, die dagegen sind, sind nicht informiert.
Ich bin also dazu gehalten, mich bei dieser Vision – die auch ein bisschen etwas von einer Apokalypse haben wird –, wie die dienstrechtliche Wirklichkeit in Hinkunft ausschauen könnte, auf Analogien und Annahmen zu stützen, und bitte Sie dafür um Verständnis.
Die äußeren Eckpunkte sind relativ einfach zu zeichnen. Es würde in dieser vollrechtsfähigen Universität der Zukunft an Personal – sowohl was die allgemein Bediensteten als auch was die Wissenschaftler betrifft – Beamte geben, die übernommen werden – das wäre einer davon –, weiters Vertragsbedienstete, und es gäbe dazu aller Wahrscheinlichkeit nach Angestellte, freie Dienstnehmer und andere in prekären Arbeitsverhältnissen Tätige. Dann gäbe es ein paar kleinere Dinge, die unterschiedlich sind, etwa hier die 40-Stunden-, dort die 38,5-Stunden-Woche.
Diese Liste könnte man verlängern, und das könnte Kollege Marhold sicherlich wesentlich genauer und besser als ich tun. Das alles schafft ein paar mäßige Schwierigkeiten, die im Prinzip zu verwalten sind.
Aber wo diese Ideen hinführen, wie sie jetzt schon vorweggenommen werden, zeigt sich mir, wenn ich den Tiroler Landesrat Günther Platter mit seiner Aussage von vorgestern zitiere, und zwar mit seiner Vorstellung von einer neuen Innsbrucker Kunstuniversität. Ich zitiere nach APA: Hohes Niveau und große Flexibilität sollen die neue Uni auszeichnen. International anerkannte Experten, ein hoher Anteil von Gastprofessoren und Lehrbeauftragten – Wissenschaftler, Künstler, Kunstmanager, Medienexperten – sollen mit individuellen Lehrverträgen gewonnen werden und ein jederzeitiges Reagieren auf jeweils neueste Entwicklungen ermöglichen.
Das heißt, da kommt ein Stammpersonal praktisch nicht mehr vor. Da ist sehr wohl eine starke Verschiebung zum Zukauf von Leistungen, zu Kurzzeitverträgen und so weiter im Gange.
Jetzt versuche ich aber, dieses Modell der Vollrechtsfähigkeit und der zu erwartenden arbeitsrechtlichen Wirklichkeiten etwas zu verbinden. Ich behaupte, dass sich die neuen Rechtsstrukturen bei wirtschaftsnahen Universitäten einerseits und bei den übrigen Universitäten andererseits in der Praxis sehr unterschiedlich ausbilden werden. Den wirtschaftsnahen Universitäten wird es stärker und noch besser als jetzt gelingen, Mittel zu werben und Sponsoren zu gewinnen. Sie werden auch bei der Höhe der Studiengebühren, die ja, wie man allseits hört, nicht mit diesen 5 000 S eingefroren werden sollen – Rektor Hansen von der WU hat gestern einmal 25 000 S in die Öffentlichkeit „tropfen“ lassen –, eine höhere Akzeptanz auf dem Markt finden und einen höheren Preis verlangen.
Insgesamt wird also bei einzelnen Universitäten möglicherweise eine akzeptable und vielleicht sogar verbesserte Finanz- und Budgetsituation vorhanden sein. Bei anderen wird es nach hinten losgehen. Die Grundfinanzierung wird, nehme ich an, auf der Basis eines Ziel- und Leistungsvertrages erfolgen, der etwa in Richtung der Zielvereinbarung mit den Fachhochschulen zu suchen ist. Er wird hoffentlich nicht dort landen, aber er wird, so behaupte ich, in diese Richtung gehen.
Wenn heute auf der gleichen Berechnungsbasis ein Absolvent meiner Universität Salzburg im Durchschnitt 1,3 Millionen kostet und wenn es an der Montanuniversität, glaube ich, 2,4 Millionen Schilling sind, dann liegen bei dieser Berechnung – Herr Pöhl, ich anerkenne diese Berechnungsform nicht, aber so wird bei Total-Budgetierung der Universitäten gerechnet – die Kosten für einen Fachhochschulabsolventen bei drei bis vier Jahren in einer Größenordnung von 300 000 S bis 400 000 S. In diese Richtung soll es gehen.
Das wird aber für viele Universitäten, die diese Grundlagenfächer – sei es im technischen oder im kulturwissenschaftlichen Bereich – stark in ihrem Portefeuille haben, die Finanzierung schlechthin sein. Dann werden sich diese Dinge ausprägen. Plötzlich hat man dann Beamte, die per Bundesgesetz ihr Gehalt und vielleicht auch einmal eine Anpassung bekommen – das geht vom Budget weg –, und ich habe den Rest. Die anderen werden Kollektivvertrag mit „schiefen“ Einstufungen, freie Dienstnehmerverträge und alles, was nicht gut und nicht schön ist, erhalten.
Diese Universitäten, die armen Universitäten, werden bei ihrer Rekrutierung gehalten sein, Kollegen und Kolleginnen der zweiten und dritten Garnitur einzustellen, weil sie sich die erste Garnitur nicht mehr leisten können. Das betrifft dann auch die Lehr- und Lernqualität für die Studierenden: schlechter werdende Lehrende, schlechte Infrastruktur – woher soll sie bezahlt werden? – und schlechte Betreuungsverhältnisse. Dieser Teil der österreichischen Universitäten wäre in Richtung des Niveaus einer mittleren US-amerikanischen staatlichen Universität unterwegs.
Die Planungen sind sehr kurzfristig geworden, und sie werden mit dieser Reform noch kurzfristiger werden. Es wird, denke ich, nicht nur die längerfristig orientierte Forschung, die auch über die normalen Finanzierungszeiträume der EU-Programme hinausgeht, verschwinden. Es wird diese dann wahrscheinlich auch über staatliche Organisationen oder ausgelagerte Institutionen finanzierte Forschung – ich denke an die von Finanzminister Grasser erwähnten 7 Milliarden Schilling an Forschungsmitteln – meiner Ansicht nach sehr stark über Projektvergabe gesteuert laufen. Da wird vieles an direkt verwertbaren, angewandten Produkten entstehen.
Bildung insgesamt wird durch Umlagerung der Forschung, durch eine wesentliche Verkleinerung des Angebots im kulturwissenschaftlichen Bereich betroffen. Ich meine, das wird viel weiter gehen. Das wird über einige vernünftige Konzentrationen, über die man durchaus sprechen darf, muss und soll, hinausgehen. Das wird nicht nur das endgültige Ende der Humboldt’schen Universität sein, sondern das wird die Universitäten als zentralen Ort von Bildung insgesamt stark beschädigen. – Danke. (Beifall bei der SPÖ und den Grünen.)
13.15
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Als Nächste bitte ich Frau Universitätsprofessor Dr. Saurer um ihre Ausführungen.
„Universitätsreform – Chancen und Gefahren“
13.15
Referentin Univ.-Prof. Dr. Edith Saurer (Universität Wien): Herr Vorsitzender! Frau Bundesministerin! Meine Damen und Herren! Zu dem Thema „Chancen und Gefahren der Universitätsreform“ möchte ich Ihnen den Vorschlag unterbreiten, eine produktive Pause einzuschalten, die die Möglichkeit gibt, die Erfahrungen mit den eigenen Universitätsreformen und jenen anderer Länder zu erheben und zu vergleichen. In dieser Pause sollten jene Vorteile, die das UOG 1993 gebracht hat, ausgelotet und verwertet werden.
Weiters möchte ich Ihnen vorschlagen, das Doktoratsstudium zu fördern, eine Pilotstudie für die Einrichtung von Praktika für Studierende und Lehrende zu initiieren und schließlich zugunsten der Universitäten und zur Erprobung des Sponsorwillens des vermögenden Teils der Gesellschaft Anreize zur Errichtung von Stiftungsprofessuren zu schaffen.
Darüber hinaus werde ich auf die Regierungsvorschläge zur Universitätsreform eingehen.
Wir mögen heute in einer postindustriellen und einer postmodernen Gesellschaft leben, aber wir leben gewiss in keiner Post-Bildungs- und Post-Wissensgesellschaft. Im Gegenteil, der internationale Wettbewerb beruht auf Wissensvorsprüngen. Wissen ist zur wichtigsten ökonomischen Ressource geworden. Dieser Umstand, nämlich die Produktivität des kognitiven Wissens, steigert die Erwartungen in allen Teilen der Gesellschaft und erzeugt dennoch ein eigentümliches Spannungsverhältnis dieser Teile zu den Trägern und Trägerinnen dieses Wissens, den Forschenden, den Hochschullehrenden und ihrer Arbeitsweise. Es fehlt ein Einblick in die Tätigkeit der Hochschullehrenden und in die Aktivitäten des universitären Feldes. Ich schlage die Einrichtung eines Tages der offenen Tür an den österreichischen Universitäten vor, um diesem Manko abzuhelfen.
Kommunikation ist der Schlüsselbegriff der Forschungs- und Lehrtätigkeit, heute verstärkt durch die Praxis und Notwendigkeit der Teamarbeit. Wissenschaftlicher Fortschritt bedarf in verschiedener Form einer solidarischen Zusammenarbeit, und wenn diese auch nur in der korrekten Lektüre der Texte und Zitierung des anderen beruht. Im Team arbeiten jüngere und ältere Forschende zusammen, beschäftigen sich mit denselben Problemen und kommunizieren über diese. Das ist der Grund dafür, warum in der Wissenschaft die Hierarchien zumindest idealiter schwächer ausgeprägt sind als in den anderen Bereichen der Gesellschaft, die gerne zitiert werden, wenn es um Begabtenförderung geht.
Gewiss, es gibt die „besten“ Köpfe auch in der Wissenschaft, aber diese sind nicht mit Sängern in der Titelpartie zu vergleichen, auf die jüngst in einem „Standard“-Artikel rekurriert wurde. Sie wissen, dass sie Kommunikation und Zusammenarbeit mit den anderen, nur Besseren, vielleicht auch nur Seriösen, Fleißigen und Korrekten, und den anderen wieder Besten brauchen, um zu ihren Ergebnissen zu kommen. Vor allem aber wissen sie, wie viele brav oder nicht brav, auf jeden Fall oft nicht viel versprechend begonnen haben, um schließlich zu den Besten zu gehören – Stichwort: Lernen.
Die kleinste Forschungseinheit bleibt dennoch der/die Forschende selbst. Denn er/sie hat immer noch seine/ihre spezifischen Interessen und Kenntnisse. So ist denn auch die Meinung zurückzuweisen, dass – ich zitiere Herrn Consemüller – „der Institutschef als Leiter der operativen Organisation der Unis den ihm gebührenden Platz in der Lenkung der Forschungsziele zurückbekommen müsse“. – Diese Auffassung ist auch hier vertreten worden.
Die Forschungsgruppen, die sich an den Universitäten bilden, sind nicht mit den Instituten identisch. Sie sind oft inter- und transdisziplinär, und das garantiert Innovation, internationale Konkurrenzfähigkeit und Vernetzung. Es wäre auch eine sonderbare Entwicklung, wenn an den Universitäten die Hierarchien – Stichworte: Chefsache, Institutschef, Aufgabe der Mitbestimmung – zu einem Zeitpunkt wieder eingeführt werden sollten, in dem moderne Unternehmen ihre Hierarchien verflachen, eben weil sie Teamarbeit fördern und brauchen.
An den Hochschulen gibt es Lehrende und Lernende, aber auch die Lehrenden sind Lernende. Es hätte ja keinen Sinn, zu forschen, wenn es nichts zu lernen gibt. Vom Lernen, Erfahren und Verstehen ist der Forschungsprozess gekennzeichnet, ebenso auch von Unsicherheiten und Risken. Die Forschenden arbeiten an den Grenzen des Wissens, und das Produkt, eine Form neuen Wissens, ist nicht immer schnell herzustellen. Dies braucht vor allem kontinuierliche Forschergruppen, einen offenen Diskurs, offene Debatten, Kritik und Meinungspluralismus.
Der Forschungsprozess bedarf daher der Kontinuität und der Zeit – ein Zustand, der heute als geschützter Bereich wahrgenommen und angeprangert wird. Ja, meine Damen und Herren, die Forschung und die Universitäten brauchen einen geschützten Bereich. Die Freiheit von Forschung und Lehre beruht auch darauf, Arbeitsprozesse nach eigenen Frage- und Problemstellungen beginnen und beenden zu können. Diesen Schutz muss es geben! Die Universität braucht aber auch eine ungeschützte Flanke. Als diese würde ich eine intensive Beziehung zu außeruniversitären Räumen bezeichnen; diese sollte auf jeden Fall ausgebaut werden. Darauf möchte ich später noch zurückkommen.
Ich komme aber nun auf die Regierungsvorschläge zur Universitätsreform zu sprechen.
Eine intensivere Beziehung zum außeruniversitären Bereich ist auch ein Ziel der geplanten Universitätsreform. In einem vierseitigen Papier werden schlagwortartig die Leitlinien vorgestellt: Das Ziel der Universitätsreform – ich folge dem Text – ist eine erweiterte Autonomie. Ehe diese praktiziert werden kann, wird die Struktur der künftigen Universität jedoch vorgegeben, und zwar in folgenden Punkten – ich greife einige heraus –:
Einschränkung der Mitbestimmung – jene der Studierenden auf Studienfragen, „Konzentration der Mitbestimmung“ genannt –; Ausstieg aus dem Beamten-Dienstrecht; Einrichtung eines Universitätsrates, der neben Rektor und Senat die Universitätsleitung übernimmt; mehrjährige globale Finanzierungsvereinbarung; Abhängigkeit von Studiengebühren.
Die Universität findet demnach eine Struktur vor, die ihr eine Autonomie nur eingeschränkt ermöglicht. Wer entscheidet über das Budget? – Der Universitätsrat, dessen Mitglieder teilweise vom Ministerium ernannt werden?
Die Universität befindet sich neuerlich, allerdings ganz anders als zuvor, am staatlichen Gängelband. Darüber habe ich persönlich allerdings keineswegs nur Negatives zu sagen, zumal ich der Auffassung bin, dass zum Beispiel das Frauenstudium, das 1897 an der Philosophischen Fakultät als der ersten Fakultät österreichischer Universitäten mit einem Erlass des Unterrichtsministeriums eingeführt wurde, erst viel später realisiert worden wäre, hätten die Universitäten darüber selbst befunden.
Ähnliches lässt sich über die Gleichbehandlungsgesetzgebung und die Förderung neuer Studienrichtungen sagen. Christine de Pisan, wie überdies auch Mary Wollstonecraft, Olympe de Gouges, Elisabeth Martinengo – und ich könnte dies fortführen – waren nämlich vom Studium ausgeschlossen. Alle diese Frauen haben ihr großes Wissen in einem Selbststudium erreicht. Sie wollten auch an der höheren Bildung teilnehmen können und haben für diesen Zugang zur höheren Bildung gekämpft.
Die frühere Abhängigkeit war Ausdruck der Verpflichtung des Staates für Bildung und Forschung. Aus dieser Verantwortung enthebt sich nun die Regierung, indem sie die Universitäten aus der Bundesverwaltung ausgliedert und die Finanzierung bis auf ein globales Budget den Universitäten selbst überlässt. Der Staat wird schlank auch gegenüber Bildung und Forschung und vertraut auf die Gesetze des Marktes in Form von Drittmitteln.
Damit Drittmittel fließen, wäre es zunächst notwendig, eine volle steuerliche Absetzbarkeit der gesponserten Mittel durchzuführen. Ich erinnere nur daran, dass dadurch dem Finanzminister mindestens 30 Prozent der gespendeten Summe als Steuerbasis entgehen. Ich weiß nicht, ob der Finanzminister unter dem Motto „Sparen“ diese volle steuerliche Absetzbarkeit verfolgen möchte. Wenn sie aber nicht eingeführt wird, wird es auch keine Sponsoren in einem größeren Ausmaß geben.
Die amerikanischen Universitäten, die für diesen Rückzug des Staates und die Praxis der Drittmittel das Vorbild abgeben, verfügen seit ihrer Gründung über andere Voraussetzungen als die österreichischen. In den USA gab es nicht nur seit jeher fromme Bürger und Bürgerinnen, die mit ihrem Vermögen Universitäten gründeten, etwa mit dem ausschließlichen Zweck, dass auch Frauen eine geeignete universitäre Ausbildung zukommen sollte, und zwar ohne weitere Auflagen – das gilt zum Beispiel für die Gründung des Smith College –, sondern die Universitäten selbst verfügen über eine breite Palette von Instrumentarien, von Alumnae-Organisationen bis hin zu Sportvereinigungen, über die sie Gelder lukrieren, die sie von der Auftragsforschung unabhängig machen.
Schließlich gibt es noch die Studiengebühren, die in den Vereinigten Staaten bekannterweise höher sind als jene, die an den österreichischen Universitäten ab dem Herbst eingehoben werden.
Wollen wir das, meine Damen und Herren? – Früher oder später wird es höhere Studiengebühren auch in Österreich geben. Dies ist umso mehr zu erwarten, als die Gerätekosten rapide ansteigen werden – ich nenne hier die Lizenzgebühren für die PCs –, die Gehälter nach Aufhebung des Beamtenstatus steigen werden und sich als der schnellste und vielleicht einzige Ausweg aus der Finanzmisere die Gebührenerhöhung anbieten wird. Die Studiengebühren von 10 000 S im Jahr – das scheint eine geringe Summe zu sein – werden sich schon jetzt auf die Angehörigen der Unterschichten, Berufstätige und Senioren auswirken. Das steht nebstbei im Widerspruch zu einem Memorandum der Europäischen Kommission zu lebenslangem Lernen, in dem von – ich zitiere – „Erwerb und Aktualisierung von Qualifikationen als Voraussetzung für eine dauerhafte Teilnahme an der Wissensgesellschaft“ geschrieben wird.
Ich sehe nicht, dass Seniorenstudierende Stipendien erhalten werden. Für Berufstätige sind die ab dem Wintersemester 2001/2002 fälligen Studiengebühren schon jetzt eine denkbar erhebliche Belastung. Nur ein Viertel der Studierenden weist heute eine studentische Normalbiographie auf, die mit 18 Jahren, nach der Matura, beginnt. 40 Prozent der Studierenden gehen einer Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigung nach. Was machen sie dann, wenn die Studiengebühren empfindlich erhöht werden? – Unter diesen Umständen wird die Akademikerquote, die in Österreich im OECD-Vergleich bereits sehr gering ist, noch weiter verringert werden, außer die Stipendien werden drastisch erhöht – was aber unter der Devise „Sparen“ nicht zu erwarten ist.
Ehe die österreichischen Universitäten ein System übernehmen, für das es in diesem Land keine Tradition gibt – es gibt nationale Traditionen auch ungeachtet unseres, ich würde sagen, sehr positiven Wunsches einer Internationalisierung, aber Internationalisierung und nationale Traditionen heben sich nicht auf – und das die Studiengebühren in die Höhe treiben wird, ist es nötig, eine Pause einzuschalten. Es werden ja auch die Drittmittel, falls sie fließen sollten, via Auftragsforschung neue Prioritäten an den österreichischen Universitäten setzen, die zu Ungunsten der Geistes- und Kulturwissenschaften ausgehen werden, denen aber in unserer komplexen Gesellschaft die wichtige Aufgabe der Erklärung von Zusammenhängen und Entwicklungen zufällt.
Der Einzug der Marktwirtschaft stellt zwar eine Verbindung mit einem universitären Außen her, greift jedoch in die Forschung mit einem Kalkül ein, das für die Universität nur eine beschränkte Geltung haben kann, nämlich der Kommerzialisierbarkeit der Forschung. Wir sind auf dem Weg, von Verkehr bis Bildung, bis Gesundheit und Umwelt alle jene Güter kommerziell verwerten zu wollen, die zu den sozialen und kulturellen Staatsbürgerrechten zählen. Es gibt ein Recht auf Bildung, und für dieses Recht muss der Gesetzgeber einstehen.
Was tun wir in der Pause? – Wir sehen, dass es in Österreich ein UOG 1993 gibt, das an der Universität Wien – wie auch an der Universität für angewandte Kunst – erst im Jahr 2000 implementiert wurde und dessen Evaluierung noch aussteht. Ausständig ist auch die Evaluierung der Universitätsreformen in anderen Ländern, von England zum Beispiel, von dem wir wissen, dass die Reformen Margaret Thatchers die Spitzenkräfte das Land verlassen ließen. Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen in der europäischen Universitätslandschaft bringt den Vorteil mit sich, dass von den Erfahrungen der anderen gelernt werden kann.
Im Übrigen schließe ich mich den Vorschlägen von Rektor Bast an, der für eine Aufwertung der teilrechtsfähigen Universität eintritt. Dieser Vorschlag hat neben den schon genannten Vorteilen denjenigen, dass er Kontinuität mit Innovation und Sparsamkeit kombiniert.
Die Pause sollte sich auch auf das Dienstrecht erstrecken, das in Europa allerdings nicht so übereinstimmend gestaltet ist, wie manchmal der Eindruck entsteht. Warum sollte das Vier-Säulen-Modell ein Dienstrecht zur Förderung der Jugend darstellen, wenn sich diese nach sechs Jahren ungeachtet ihrer Qualifizierung oder Bewährung wieder entfernen muss – nur eben sechs Jahre älter als zuvor?
Ich möchte die Aufmerksamkeit des Hohen Hauses auch auf den Umstand lenken, dass bei einer radikalen Durchführung des geplanten Dienstrechts – ich habe zwar von der Frau Bundesministerin gehört, dass das nicht geplant ist, möchte es aber trotzdem erwähnen – 60 Prozent der an der Universität tätigen Wissenschaftlerinnen die Universität hätten verlassen müssen, weil ja vor allem Frauen vor noch nicht allzu langer Zeit als Wissenschaftlerinnen an die Universitäten gekommen sind und daher vorzugsweise im provisorischen Dienstverhältnis beziehungsweise im befristeten Dienstverhältnis angestellt sind. Hiermit wären die Anstrengungen der letzten Jahre, den Frauenanteil an den österreichischen Hochschulen zu erhöhen, vergebens gewesen.
Ich komme zu den Chancen einer Universitätsreform. Kein Zweifel, die Universität braucht eine Erneuerung.
Dies gilt erstens für das Doktoratsstudium. Die Doktoranden an den österreichischen Universitäten haben, von wenigen Ausnahmen abgesehen, keinerlei Förderung. Das behindert die internationale Konkurrenzfähigkeit auch der zukünftigen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Zum Vergleich für eine mögliche Förderung erwähne ich das italienische System des Doktoratsstudiums, das eine Art Graduiertenkolleg darstellt, für das sich Studierende aus dem ganzen Land bewerben können, die für das spezifische Thema ausgewiesen sind. Sie erhalten ein drei- bis vierjähriges Stipendium und eine intensive Betreuung durch nationale und internationale ForscherInnen.
Zweitens soll die Universität eine intensive Beziehung zu außeruniversitären Räumen pflegen; ich habe das schon zu Beginn gesagt. Ich schlage vor, ein Pilotprojekt einzurichten, dass für Studierende und Lehrende die Möglichkeit von Praktika sondiert und realisiert, wie es sie in manchen Studienrichtungen schon gibt; ich denke da an die Medizin. Diese sollten in einer engeren und weiteren Beziehung zur Studienrichtung und zum Forschungsgebiet der Studierenden/Lehrenden stehen und könnten im In- und Ausland absolviert werden. Das wäre eine Möglichkeit, der Wirtschaft näher zu kommen.
Drittens sollte die Einrichtung von Stiftungsprofessuren gefördert werden. Es gibt ja schon welche; ich habe gehört, in Innsbruck gibt es mehrere Stiftungsprofessuren; es gibt auch an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien eine Käthe-Leichter-Gastprofessur. Die Anregung, Stiftungsprofessuren nach den universitären Regeln einzurichten, könnte ein Prüfstein für das gesellschaftliche und ökonomische Interesse an einem Forschungs-Mäzenatentum sein, das in Österreich jedenfalls bisher kaum zur Geltung gekommen ist. – Danke. (Beifall.)
13.32
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Als Nächsten bitte ich Herrn Universitätsprofessor Dr. Winkler um seine Ausführungen.
„Die Universitäten befinden sich im Reformprozess – brauchen wir jetzt eine zweite Reform?“
13.33
Referent Univ.-Prof. DDr. Hans Winkler (Senatsvorsitzender der Universität Innsbruck): Herr Vorsitzender! Frau Bundesminister! Sehr geehrte Abgeordnete! Meine Damen und Herren! Ich spreche heute nicht als akademischer Funktionär. Das war ich immer nur vorübergehend und wenn es absolut notwendig zu sein schien. Ich spreche auch nicht für eine Partei; ich gehöre keiner an und bin keiner verpflichtet.
Ich spreche heute als Wissenschaftler, der nun schon fast vierzig Jahre lang international tätig gewesen ist. Für einen naturwissenschaftlich-medizinisch orientierten Wissenschaftler bedingt dies aber auch eine gewisse Methodik. Es steht die Suche nach Fakten im Vordergrund, nicht diffuse Formulierungen und nicht Ankündigungen. Dies bedingt eine sehr klare Sprache. Wenn manche diese als hart oder unhöflich empfinden, bitte ich, dies dem naiven Wissenschaftler, der diesen Stil in Oxford gelernt hat, zu entschuldigen. Ich werde sicherlich keinen Ordnungsruf bekommen, dafür ist das Niveau in diesem Hause zu hoch. Aber vielleicht ist es am späten Vormittag – zumindest ich bin schon etwas erschöpft – sehr gut, wenn man zu stimulieren versucht.
Lassen Sie mich zuerst mit einigen Fiktionen, Unterstellungen und Unwahrheiten aufräumen, die in der Diskussion der letzten Monate immer wieder aufgetaucht sind. Es hat geheißen, die Universitäten sind reformunwillig oder – wie Fachleute sagen – haben Angst vor Veränderungsprozessen. Da muss man einmal sagen: Wo wären die österreichischen Universitäten heute, wenn sich nicht schon seit Jahrzehnten eine Generation von österreichischen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen – allerdings zu wenige, Frau Professor Hassauer – unter schwierigsten finanziellen Bedingungen täglich verändert und aktiv den internationalen Erfordernissen angepasst hätte?
Wir waren schon europareif und konnten uns Berufungen in Europa aussuchen, da waren manche Ministerien noch auf einer „Insel“. Ich kann mit Kollegem Bonn nicht darin übereinstimmen, dass er sagt, er muss erst wieder stolz werden, österreichischer Professor zu sein. Ich bin immer noch stolz, österreichischer Professor zu sein, und habe das sehr überzeugend dargelegt, indem ich Rufe nach Deutschland oder an das Biozentrum in Basel abgelehnt habe.
Damit die Wissenschaft floriert, braucht es auch aktive Leute – die haben wir. Man braucht genügend Geld – das fehlt zum Teil. Man braucht eine gewisse Grundstruktur – die ist da. Vor allem braucht man auch eine gewisse Ruhe und die Möglichkeit, sich auf die Wissenschaft zu konzentrieren – die wird uns laufend genommen. Darauf werde ich noch zurückkommen.
Natürlich kann und muss man über weitere Möglichkeiten der Wissenschaftsförderung diskutieren. Wir befinden uns allerdings in den letzten zwei, drei Jahren in einem aktiven Reformprozess. Frau Minister, es hat mich gewundert, dass Sie das am Anfang nicht betont haben. An diesem ganzen Vormittag ist es eigentlich erst Rektor Bast gewesen, der hier aufgestanden ist und gesagt hat: Wir sind aktiv in diesem Reformprozess tätig.
Was heißt das in Innsbruck? – In Innsbruck stehen wir erst seit ein bis zwei Jahren mitten in einer Reform. Diese Reform ist nicht abgeschlossen. Die Resultate dieser Reform sind in keiner Weise evaluiert worden. Es ist unwissenschaftlich, solche Daten nicht zu erheben, bevor man weiter reformiert. Zumindest in der Medizin gehört die verlässliche Diagnose vor die Therapie, Patienten können sonst sehr rasch versterben. Aber auch Universitäten können erkranken.
Die Rektorenkonferenz und die Senatsvorsitzenden haben vorgestern beschlossen, dass die derzeitige Reform, die laufende Reform zu evaluieren ist, um sie in der Weiterentwicklung berücksichtigen zu können. Daher zur Fiktion eins, der Reformunwilligkeit, ein Satz: Wer Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die laufend zur Veränderung beigetragen haben, wer einer Universität, die sich voll in einem aktiven Reformprozess befindet, Reformunwilligkeit vorwirft, der handelt unseriös!
Herr Direktor Hochleitner! Ihre wichtigen Forderungen, die Sie erhoben haben und mit denen ich eigentlich in allem übereinstimme – Studienzeitverkürzung, Fächerkonzentration, Zugehen auf die Wirtschaft –, das alles sind Dinge, die in der jetzigen Reform jederzeit durchgeführt werden können und sollen. Dazu brauchen wir kein neues Gesetz.
Eine weitere Fiktion ist aufgetaucht – ganz kurz jetzt –: dass die geplanten Strukturreformen zur Verkürzung der Studienzeit beitragen können. Darf ich daran erinnern, dass die Reform der Studien von der letzten Regierung bereits geplant und gesetzlich durchgeführt wurde? – Das ist ein wenig das Problem der politischen Amnesie dieser Tage, dass man vergisst, was früher bereits beschlossen wurde. Als Pharmakologe muss ich sagen: Ich kann manches gegen Amnesie anbieten; gegen politische Amnesie habe ich noch kein Medikament.
In den meisten Fächern wird es bereits im Herbst neue Studienpläne geben. In Innsbruck und in ganz Österreich bedeutet das zum Beispiel für die Medizin, dass wir in allen drei Fakultäten eine grundlegende Reform mit starker Praxisorientierung planen. Durch diese Maßnahme können jetzt bereits die Studienzeiten sinken. Dies bedeutet aber auch eine enorme Belastung für die Fakultät, für die Organisation, für die Lehrenden. Wenn wir allerdings gezwungen werden, massiv in neuerliche Reformdiskussionen und in einen neuerlichen strukturellen Reformumsturz einzutreten, dann wird alles vergeblich sein. Die Studenten und Studentinnen werden das erste Opfer sein.
Im ORF-Bericht aus dem Ministerrat von vorgestern, vom 24. April, steht die Aussage von Bundeskanzler Schüssel: Die geplante Universitätsreform bringe jüngere Menschen schneller auf den Arbeitsplatz. – Ich bitte doch, dem Herrn Bundeskanzler mitzuteilen, dass die geplante Strukturreform die Durchführung der bereits laufenden Studienreform gefährdet, sodass die Situation tatsächlich umgekehrt ist.
Die dritte Fiktion ist der völlig negativ besetzte Begriff „Zementierung“ durch den pragmatisierten Mittelbau. Es ist sehr gut, dass sich jemand findet, der heute etwas gegen diesen Begriff sagt, vor allem jemand, der selbst kein Trauma hat. Ich war nur acht Jahre Assistent und bin seit 30 Jahren Professor. Wenn man positiv unter „Zement“ versteht, dass das Gebäude der Universität zusammenbricht, wenn man ihn entfernt, dann würde ich dem zustimmen. Wenn man aber insinuiert, dass auf den Universitäten saturierte, desinteressierte Typen nichts anderes tun, als den jungen Leuten ihre Berufschancen zu blockieren, kann man nur erschrecken. Die gleiche fahrlässige Vorgangsweise liegt vor, wenn man wegen 5 Prozent tatsächlich vorhandener Sozialschmarotzer das in Österreich gute Sozialsystem in Frage stellt.
Wo sind eigentlich die Evaluierungsdaten von Professoren und Mitgliedern des Mittelbaues – großteils Dozenten –, die beweisen, dass diese nicht ausreichend publizieren und lehren, dass diese trotz hoher Qualifikation besser alle vier Jahre durch jüngere Mitarbeiter zu ersetzen sind?
Es werden laufend falsche Zahlen bezüglich der Pragmatisierungsquote verwendet. In Innsbruck sind 43,5 Prozent aller Mittelbau-Stellen definitiv besetzt. Wenn man alle provisorisch-rechtlichen Stellen dazu nimmt, sind es auch erst 55 Prozent. Allerdings ist diese Zahl zu hoch, da erfahrungsgemäß nicht alle in diese Definitivstellung kommen. Pro Jahr scheiden in Innsbruck 14 Prozent des Mittelbaus aus.
Der negative Begriff „Zementierung“ ist eine Fiktion. Hingegen ist es ein Faktum, dass wir einen dauerhaft angestellten, hoch qualifizierten Mittelbau brauchen. Für mich sind 50 Prozent der Stellen dafür zweckmäßig. Damit ich ganz klar verstanden werde: Wir brauchen auch einen flexiblen Pool an Assistenten- und Ausbildungsstellen. Dieser Pool sollte bis zu 50 Prozent dieser Stellen betragen. Um dies sicherzustellen – und da haben wir im Augenblick ein Problem –, könnte man dafür ein Gesetz machen. Das wäre eine sinnvolle Reform, und sie wäre auch konsensfähig.
Allerdings hat im Rahmen der Dienstrechts-Diskussion das Ministerium, die Regierung geplant, Personen, die sich im provisorisch-rechtlichen Dienstverhältnis befinden, plötzlich, auch wenn sie die Bedingungen erfüllen, nicht mehr zu pragmatisieren, ja zum Teil auch nicht mehr dauernd zu beschäftigen. Man war dann bereit, darauf zu verzichten, weil man nach Befassung von vier Gutachtern nicht einmal Unterlagen gefunden hat, dass dies überhaupt rechtlich möglich ist. Wenn man allerdings so etwas vertritt und über längere Zeit propagiert, dann, so muss ich sagen, hat jemand in meinem persönlichen Wertesystem einen Anspruch auf soziale Verantwortung schon etwas verloren.
Ich sehe mit Schrecken, dass die Dienstrechts-Diskussion immer noch in einer Weise weitergeht, die einfach nicht zu akzeptieren ist. Gestern Nachmittag wurde uns mitgeteilt, es gebe eine gewisse Einigung, man sehe einen Weg. Das war um drei Uhr Nachmittag. Als man um sechs Uhr versucht hat, dies niederzuschreiben, hat man festgestellt, dass das alles in der Luft hängt. So kann man doch nicht mit Hunderten und Tausenden von Menschen und mit Dienstrechtsfragen umgehen! Heute höre ich nun, dass trotz dieser Situation die Begutachtungsfrist für das neue Gesetz nur bis 18. Mai dauern wird – das sind zwei Wochen für eine so wichtige Frage, meine Damen und Herren! Die Rektorenkonferenz hat bereits am Montag beschlossen, dass zwei Monate das Mindeste sind, um ein solches Thema seriös zu behandeln.
Wir können mit Menschen nicht in dieser Weise umspringen! Es darf niemanden verwundern, Frau Minister, wenn im Rahmen der Universität – das berichte ich Ihnen als einfacher Wissenschaftler aus Innsbruck – über diese Vorgangsweise, über diese „Speed“-Methode einfach tiefste Unzufriedenheit herrscht. Das ist der falsche Weg und die falsche Methode! Da kann im Inhalt manches richtig sein, aber die Methode ist falsch. – Daher ist auch diese Fiktion weg, dass alles nur dem „dummen“ Mittelbau zuzuschreiben sei.
Noch eine letzte Fiktion sei angesprochen. Es wird vom Ministerium immer wieder propagiert, dass die Universitäten den geplanten Strukturreformen zugestimmt haben. Diese Zustimmung als Blankoscheck ist nie erfolgt. Die Rektoren und Senatsvorsitzenden haben mehrheitlich einem Weg zur Vollrechtsfähigkeit, aber mit klaren Auflagen und Bedingungen, zugestimmt. Inzwischen hat sich, als mehr Informationen bezüglich der Reform bekannt wurden, aber gezeigt, dass dies derzeit wohl nicht zweckmäßig ist. Es liegt ein Bündel von fundierten und negativen Stellungnahmen aus allen Universitäten vor. An der Universität Innsbruck wurde eine Befragung durchgeführt – und das sind nun wieder Fakten –: 70 Prozent antworteten, 88 Prozent waren gegen das neue Dienstrecht, wie es von der Regierung geplant ist, und 80 Prozent gegen die Vollrechtsfähigkeit, wie sie derzeit geplant wird. – Die Fiktion „Zustimmung“ ist weg.
Nach dieser Flurbereinigung, nach dieser Elimination von Fiktionen, nun zu der Frage: Was leistet die derzeitige Reform, der derzeitige Reformprozess, in dem wir uns befinden?
Da die Rektoren und Senatsvorsitzenden eine Evaluierung der laufenden Reform fordern und dann klare Fakten auf dem Tisch werden liegen müssen, nur ein paar kurze Feststellungen: In dem für die Universität zentralen Bereich der Berufungsverfahren, der früher beim Ministerium lag, ist zumindest in Innsbruck heute eine bessere Transparenz gegeben. Politische Interventionen sind jetzt erfolglos. Diese Verfahren können viel zügiger abgewickelt werden.
Stichwort Evaluierung: Eine umfassende Evaluierung der Lehre und Forschung wurde begonnen. Nun kann man dazu übergehen, die Daten entsprechend zu verwenden. – All das sind Dinge, die heute gefordert und jetzt laufend durchgeführt werden.
Zu den Stichworten Wechselwirkung, Exekutive, strategische Organe, Mitbestimmung: Das UOG 1993 hat den Studiendekanen, Dekanen und Rektoren – und bitte, Kollege Bonn, auch den Institutsvorständen; das ist das neue Gesetz, Sie haben zum Teil aus dem UOG 1975 zitiert! – relativ große Machtbefugnisse gegeben. Diese exekutiven Organe treffen auch zügig die notwendigen Entscheidungen. Die Wechselwirkung zwischen Exekutive und strategischen Organen wie Senat und Fakultätskollegium hat bis jetzt kein offensichtliches Problem ergeben. Rektor Moser sitzt dort, der Senatsvorsitzende steht hier – das sind Fakten.
Es gibt auch kein Problem mit der Mitbestimmung in Kollegium und Senat. Wer dieser Behauptung nicht zustimmt, kann – so wie ich gerade jetzt – eine objektive Evaluierung der jetzigen Reformprozesse fordern. Dann wird sich zeigen, wo die Tatsachen liegen, dann hört endlich dieses Insinuieren auf. Wenn allerdings zum Frühstück beim Bundeskanzler „Stars of Science“ Sätze von sich geben wie „Wissenschaft kennt keine Demokratie“, kann einem nur noch angst und bange werden. Gerade als Naturwissenschaftler, als Biowissenschaftler würde ich sagen: Die Wissenschaft muss Demokratie kennen, nämlich eine demokratische Kontrolle. Zu sagen, „Wissenschaft kennt keine Demokratie“, ist erschreckend.
Wenn nun in den neuen Reformplänen der Regierung die demokratischen Vorgänge an den Universitäten reduziert werden sollen und die Mitbestimmung in die Ecke gedrängt werden soll, dann ist mir dies zutiefst suspekt. An der Intention der Pläne besteht kein Zweifel, auch wenn diese noch etwas versteckt wird, da man nur davon spricht, Mitbestimmung auf einer Ebene zu konzentrieren. Dies bedingt gleichzeitig die Etablierung eines weitgehend autoritär regierenden Rektors, bei dessen Ernennung dann auch politische Kräfte mitsprechen. Das heißt heute so schön „doppelte Legitimation“.
Zur Begründung dieser Pläne wird immer argumentiert, dass Mitbestimmung und demokratische Vorgänge nicht effizient sind und daher an den Universitäten nichts zu suchen haben. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich heute an diesem zentralen Ort der Demokratie Österreichs folgenden Appell vorbringen kann: Wehren wir den Anfängen! Erhalten Sie den hohen Schulen das Prinzip der Demokratie! Das ist nicht immer effizient, das funktioniert manchmal nicht – ja, kein Zweifel –, aber auch dieses Parlament ist nicht immer effizient, ein „starker Mann“ könnte das alles viel effizienter machen. Ich appelliere an alle Parteien, dieses Prinzip der Demokratie für einen wesentlichen Bereich unserer österreichischen Nation nicht so leichtfertig zu nehmen!
Wie soll es nun weitergehen? – Konzentrieren wir uns im Herbst auf die Durchführung der jetzt laufenden Studienreform! Die Studenten, die nun bezahlen müssen, haben ein Recht auf ein effizientes und kurzes Studium. Ein Strukturumsturz gefährdet dieses wichtige Ziel, das ist für mich kein Zweifel. Die Kapazität der Universität ist dann einfach erschöpft, wenn wir in den nächsten zwei Jahren nicht die Zeit haben, diese wirklich revolutionierenden Lehrpläne durchzusetzen.
Konzentrieren wir uns weiter auf die Durchführung der jetzt laufenden Strukturreform! Beginnen wir die Evaluierung dieser Reform sofort, wie die Rektoren und Senatsvorsitzenden es fordern! Das kann rasch zu gezielten Novellen zum Beispiel für den wichtigsten Punkt einer zusätzlichen Reform, dem Budget, führen: zu einem langjährigen Budget, zu größerer Budgetflexibilität, zu stärkerer Budgetautonomie. Machen wir im Dienstrecht einen Konsensschritt in der Weise, dass wir jede frei werdende Assistentenstelle in einen Pool flexibler Ausstellungspläne geben.
Die Regierung muss sich entscheiden, ob sie große Reformen an die Tafel schreiben will und dann große Gesetze abhaken kann. Dies würde dem Prinzip „Speed“ entsprechen. Die Rektoren und Senatsvorsitzenden haben vorgestern beschlossen, dass der Reformprozess ohne Zeitdruck durchgeführt werden muss. Das spricht ganz klar gegen „Speed“. Das Vorgehen der Regierung würde, da die Zustimmung fehlt, auch „Force“ entsprechen. Eine vernünftige Alternative wäre eine Evaluierung der Reform, dann Novellen zur Budgetautonomie und zusätzlich eine Langzeit-Planung. Das ist nichts für politische Schaukämpfe, aber ein Dienst an den hohen Schulen Österreichs.
Zum ersten Mal – damit bin ich am Schluss – in meiner 40-jährigen Tätigkeit im Dienste dieses Landes habe ich wirklich große Sorge. Der jetzige Plan, innerhalb eines Jahres eine neue Strukturreform durchzuführen, gefährdet in der kritischsten Phase, in der wir uns befinden, die Studienreform. Das erste Opfer werden die Studenten und Studentinnen sein. Dieser Plan gefährdet den reformbedürftigen, aber gut funktionierenden Wissenschaftsbetrieb – das Opfer sind wir –, und er gefährdet letztlich die Universitäten – das Opfer ist die Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden.
Van der Bellen hat einmal gesagt: „Speed kills quality.“ Ich würde sagen: „Speed kills university“ und „Force kills university“. Wir sollten – und ich bitte alle, dazu beizutragen – die Universitäten vor diesem unheilvollen Zwilling „Speed and force“ retten und uns langzeitig in aller Zusammenarbeit für schrittweise und vernünftige Reformen einsetzen. – Danke. (Beifall.)
13.50
*****
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Ich danke. – Ich werde nunmehr die Sitzung bis 14.30 Uhr unterbrechen und lade – wie bereits angekündigt – die Anwesenden in das Sprechzimmer neben der Säulenhalle ein, wo es Stärkungen und Erfrischungen gibt.
Ich bitte die Teilnehmer, sich pünktlich um 14.30 Uhr zur Fortsetzung der Enquete wieder hier einzufinden.
Die Sitzung ist unterbrochen.
(Die Sitzung wird um 13.50 Uhr unterbrochen und um 14.49 Uhr wieder aufgenommen.)
*****
14.49
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich nehme die unterbrochene Sitzung wieder auf.
Bevor wir zum ersten Diskussionsredner kommen, gebe ich zum Procedere Folgendes bekannt: Wir werden jetzt eine Abgeordnetenrunde machen, quer durch alle Fraktionen, allerdings jeweils nur mit einem Redner. Ferner hat sich schon eine große Zahl von Experten gemeldet; und dann noch weitere Abgeordnete. Ich möchte Sie ersuchen, sich wirklich an das Zeitlimit zu halten.
Bevor ich dem ersten Diskussionsredner das Wort erteile, möchte ich die Damen und Herren Abgeordneten ersuchen, dass wir nach der Abgeordnetenrunde die entsprechende geschäftsordnungsmäßige Beschlussfassung vornehmen, damit wir das Stenographische Protokoll an den Nationalrat weiterleiten können. Daher mögen meine Kollegen danach trachten, dass für die Abstimmung das erforderliche Quorum sichergestellt ist.
Diskussion
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Herr Abgeordneter Niederwieser, ich erteile Ihnen das Wort. Die Redezeit ist auf 5 Minuten eingestellt. – Bitte.
14.51
Abgeordneter DDr. Erwin Niederwieser (SPÖ): Geschätzte Damen und Herren! Zunächst herzlichen Dank für die vielen wertvollen Ausführungen und Klarstellungen. Eine solche ist auch von meiner Seite aus notwendig. Ich bin von mehreren Persönlichkeiten hier auf der Regierungsbank darauf angesprochen worden, dass sie sich zu Unrecht von meiner einleitenden Bemerkung betroffen fühlen. Das verstehe ich auch. Ich dachte, das wäre vielleicht weitgehend bekannt, aber es ist insbesondere den ausländischen Gästen überhaupt nicht bekannt. Die Institution, um die es in meiner einleitenden Bemerkung gegangen ist, ist die Firma IMADEC, über deren Handys diese SMS verschickt wurden, und darum habe ich dazu Stellung genommen. – Das nur, damit Sie hier nicht in falschen Verdacht geraten.
Von Reform als permanentem Prozess hat Frau Professor Hassauer gesprochen. Das ist uns durchaus bewusst, wenngleich man sich immer überlegen muss, welche Reformen gerade im Gange sind und was die Kapazität einer Institution ist, um Reformen durchzuführen. Die neuen Studienpläne sind aus unserer Sicht etwas sehr Wichtiges – das betrifft das Gesetz von 1997 mit einer Novelle aus dem Jahr 1999.
Im Bereich des Dienstrechtes gibt es an sich schon länger Unbehagen. Kollege Lukesch ist ja auch hier – wir haben vor ungefähr vier Jahren einen einstimmigen Beschluss betreffend Grundstrukturen für ein neues Dienstrecht im Parlament gefasst. Da wurde recht ausführlich dargelegt, was der Wille des Gesetzgebers in dieser Richtung wäre. Was allerdings jetzt vorgelegt worden ist, ist nicht dieses Dauer-Dienstrecht, sondern ein Übergangs-Dienstrecht, das durchaus seine Tücken hat.
Die Internationalisierung, die neuen Medien – ich denke, das sind besonders wichtige Bereiche, mit denen sich die Universitäten, die Hochschulen, die Bereiche der Forschungslandschaft zu beschäftigen haben. Daher verstehen wir auch, dass, wenn man unmittelbar in einem Reformprozess ist, der sehr gut läuft, dann, wenn der Eindruck erweckt wird, jetzt müsste man noch einmal etwas ganz Neues machen, die Einsicht dafür nicht unbedingt vorhanden ist. Dafür haben wir großes Verständnis.
Ich kann nicht zu allem Stellung nehmen, aber das Verhältnis Staat – privat ist hier offensichtlich angesprochen worden. Was sind die Aufgaben des Staates? – Wir von der sozialdemokratischen Fraktion glauben, dass es unbestritten eine Aufgabe des Staates ist, ein Bildungsangebot von wirklich höchster Qualität zur Verfügung zu stellen, das aber gleichzeitig dafür garantiert, dass niemand, der die Fähigkeit hat, dieses wahrzunehmen, davon ausgeschlossen wird, sei es aus sozialen Gründen, sei es aus regionalen Gründen oder auch aus Altersgründen. Das ist gerade in einer Zeit lebensbegleitenden Lernens unwahrscheinlich wichtig.
Im Wesentlichen wird dieses Angebot finanziert, soll es und muss es finanziert werden aus dem, was der Staat an Steuereinnahmen erwirbt. Dass Drittmittel und dergleichen auch immer eine wichtige Rolle spielen, ist unbestritten. Aber das völlige Loslassen, indem man sagt, wir beschließen jetzt de facto ein Gesetz, oder sollten eines beschließen, durch das die Politik die Verantwortung für alle weiteren Steuerungsfragen abgibt und auch für das Angebot dessen, was in Österreich studiert werden kann – wenngleich dies durchaus in Abstimmung mit dem, was man in anderen Ländern anbietet, gestaltet werden soll; diese Sichtweise ist schon wichtig –, kann doch nicht der richtige Weg sein. So wird, was zum Beispiel dieses Angebot betrifft, niemand die Politik aus der Verantwortung entlassen, wenn auf einmal 50 neue Lehrstühle für Informatik eingerichtet werden und es keinen einzigen Philosophen mehr gibt. Das ist etwas, das Wissenschaftspolitik sicherlich nicht zulassen kann. Da braucht es Steuerungsinstrumente.
Ein Zweites, was mir, was uns sehr deutlich geworden ist: Es kann nicht darum gehen, dass die alte Ordinarien-Universität, mit der ich mich als Jugendlicher, als Student beschäftigt habe, Wiederauferstehung feiert. Ich habe gewisse Probleme mit dem, was hier – nicht nur von Frau Hassauer, sondern auch von anderen – betreffend die Qualifikation zur Mitbestimmung gesagt wurde. Wir werden, wenn das so ist, das Gesetz nicht beschließen können, denn ich kann mir – wenn ich Ihren Worten hier folgen möchte – nicht vorstellen, dass ein HTL-Ingenieur oder jemand, der nicht einmal diese Ausbildung hat, hier über Fragen des Dienstrechtes der Professoren abstimmt.
Ich habe studentische Mitbestimmung viele Jahre miterlebt und aktiv praktiziert, und ich verfolge das auch weiterhin. Es kann nicht ausreichend sein, dass Mitbestimmung auf eine Führungsebene beschränkt wird, quasi wie bei einem Konzern, in dem eben ein Aufsichtsrat besteht, und dort darf noch mitbestimmt werden. Das ist für die Universitäten völlig unpassend.
Zum Dienstrecht hätte ich eine Frage, die ich eigentlich an Herrn Generaldirektor Hochleitner richten wollte, aber er ist jetzt nicht im Saal; vielleicht kann jemand anderer, der durchaus praktische Erfahrungen aus einem Betrieb hat – weil heute sehr oft dieser Vergleich mit den Privatunternehmen gezogen wird –, sie mir beantworten: Wie wird es in einem erfolgreichen Unternehmen gehandhabt, was die Kontinuität von Dienstverhältnissen anlangt?
Ich habe den Eindruck, dort ist man froh, wenn man die guten Leute halten kann. Das ist durchaus ein Merkmal eines guten und innovativen Betriebes. Selbstverständlich gehört die Kehrseite – man muss sie offen ansprechen – auch dazu: nämlich dass sich ein Unternehmen, eine Einrichtung von jemandem auch trennen kann, wenn die Leistung nicht passt. Das gehört beides dazu. Aber von dem Grundsatz auszugehen, es sei die beste aller Personalführungen, wenn man sich nach bestimmten Phasen einfach generell von allen Leuten trennt – gleichgültig, ob sie gut oder schlecht sind –, kann meiner Ansicht nach kein Erfolg versprechendes Zukunftsmodell sein.
Das wollte ich noch hinzufügen. Wenn jemand diese Frage beantworten kann, bitte ich, das auch zu tun. – Danke.
14.58
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Als Nächster gelangt Herr Abgeordneter Grollitsch zu Wort. – Bitte.
14.58
Abgeordneter Mag. Dr. Udo Grollitsch (Freiheitliche): Herr Vorsitzender! Frau Bundesminister! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenn ich die Meinung der Sceptici und Cunctatores und sonstigen Tiroler zunächst ein bisschen in den Hintergrund rücke, dann hat meiner Ansicht nach dieser Vormittag das Ergebnis gebracht, dass die österreichischen Universitäten reformiert gehören, und zwar jetzt.
Eine durchgreifende Reform des Universitätswesens ist seit langem im Gespräch. Seit 1962 – daran erinnere ich mich als Studentenvertreter persönlich – wurde auf allen Ebenen, ganz im Humboldt‘schen Sinne, laut „Weg vom Staat!“ gerufen. Aber es hat sehr lange gedauert und vieler Vorbilder aus anderen Ländern bedurft, bis man sich dazu entschlossen hat, sich auch hier im Lande mit, wie es scheint, entsprechender Durchsetzungskraft diesem Projekt zu nähern.
Über die Methode lässt sich streiten. Was wäre passiert, hätte man Ihnen ein Hochschullehrer-Dienstrecht in Form einer Regierungsvorlage präsentiert und hätte man ein fertiges Papier vorgelegt? – Frau Bundesminister, ich glaube, Sie haben sich beim offenen Zugang zu diesem Thema richtig verhalten. Wir haben das auch unterstützt.
Es wurde beklagt, dass reformiert wird und die Reform jetzt schon wieder reformiert wird. Herr Professor Winkler, ich frage Sie: Warum hat die Uni Innsbruck Jahre gebraucht, um etwa das UOG 1993 umzusetzen?
Wir Leobner – unser Rektor sitzt hier – waren die Ersten auf diesem Sektor. Der damalige Rektor hat gesagt: Es ist kein Gesetz so schlecht, als dass wir Leobner nicht etwas daraus machten – und das wurde ernst genommen. Wir haben uns auch vom ersten Tag an daran gemacht, den Studiengebühren, für die nicht alle waren und heute nur mehr die wenigsten sind, die Kanten zu brechen und ein Finanzierungsmodell zu erarbeiten. Drittmittelverträge sind bei uns an der Tagesordnung, Industriekontakte die Normalität, Institute und Professoren von Stiftungen sind bei uns Usus. Das heißt, die UOG-Umsetzung, die wir vorgenommen haben und die nur ein erster Schritt, ein Teilschritt zu einer Teilautonomie war, wird – um bei diesem Beispiel zu bleiben – mit Ernst fortgesetzt.
Am Vormittag wurde – und das finde ich bemerkenswert – kein einziges Mal der Ruf nach mehr Geld laut. Die Frau Bundesminister hat sogar gemeint, es habe nichts mit Sparen zu tun, dass jetzt reformiert werde. Der Redlichkeit zuliebe, Frau Bundesminister, würde ich doch sagen, dass die Not auch ein bisschen erfinderisch macht und im Zusammenhang mit der Forcierung der Universitätsautonomie mit Sicherheit auch eine Rolle spielt. Die Vermehrung der Dienstposten samt Biennalsprüngen, wie sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten stattgefunden hat, ist einfach auf Sicht nicht finanzierbar. Es gab also mit Sicherheit auch von dieser Seite her Handlungsbedarf.
Positiv erwähnt wurde – ich unterstütze das; es ist auch in den heutigen Zeitungen zu lesen –, dass wir mit dieser Universitätsreform eine öffentliche Diskussion ausgelöst haben. Über Jahrzehnte hat die Universität in der Bevölkerung und auch in den Medien nur eine sehr untergeordnete Rolle gespielt. Ganz selten waren Veränderungen in den Universitäten Anlass für Medien, zu berichten. Nunmehr tun sie es stark. Werten wir doch diese Diskussion in der Bevölkerung und in den Medien positiv!
Ich ersuche Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren von den Universitäten: Bringen Sie sich im Sinne dessen, was die Regierung als Punktation vorgegeben hat, weiterhin konstruktiv ein! Haben Sie keine Angst vor Geschwindigkeit – gezaudert wurde lange genug. – Danke schön. (Beifall.)
15.03
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Frau Abgeordnete Brinek, bitte.
15.03
Abgeordnete Dr. Gertrude Brinek (ÖVP): Werte Expertinnen und Experten! Werte Teilnehmer! Ich kämpfe gleich zu Beginn gegen die These von der politischen Amnesie an, die hier von Professor Winkler aufgestellt wurde. Ich bin imstande, sie zu falsifizieren, indem ich mich erinnere, dass doch er es war, der in ähnlichen oder fast denselben Worten gegen das UOG 1993 angetreten ist. Ich stelle das einmal in den Raum und bitte um Unterstützung und Aufklärung.
Ich wende mich zur Linken, in Richtung Rektor Bast, dem Baumeister des UOG 1993, damals noch in seiner Funktion als Ministerialbeamter. (Abg. Dr. Grünewald: Er war doch nicht Minister!) – Ich erinnere an den „Bast-Entwurf“, wie ich ihn sympathisch konnotiert nennen möchte, der von einer AG sprach, von der Ausgliederung, der in radikaler Konsequenz viel weiter ging als das, was uns jetzt als Punktation vorliegt. – Haben Sie von diesen Ideen Abstand genommen, Herr Rektor? Woher wissen Sie, dass die Autonomie, zu der es eine Punktation gibt, mehr kosten und weniger Geld für die Universitäten bringen wird, dass der Uni-Rat die Abhängigkeit verstärken wird, obwohl damit ein neues Verhältnis der Universitäten zur Politik gestiftet werden soll und obwohl sich anderswo bereits erwiesen hat, dass er genau das Gegenteil einer verstärkten Abhängigkeit bewirkt?
Woher wissen Sie, dass die Studiengebühren erhöht werden und dass das automatisch, weil es noch nicht grundsätzlich ausgeschlossen ist, eine Sünde wider den akademischen Geist ist? Wissen Sie es nicht beziehungsweise warum sagen Sie nicht dazu, dass Karl Poppers Thesen auch gegen die Feinde der offenen Gesellschaft gerichtet waren? Und zur offenen Gesellschaft gehört nun einmal das Denken – zur akademisierten und gelehrten Gemeinschaft ganz sicher.
Ich habe weiters offene Fragen, die sich vor allem auch an Professor Winkler im Zusammenhang mit seinem Verweis auf Beschlüsse der Rektorenkonferenz richten. – Ich bitte um Aufklärung.
Ich merke auch mit Blick auf meine geschätzte Mitstreiterin aus der Gewerkschaft an, dass wir gegenwärtig bezüglich der Aussendung des Entwurfes einer Dienstrechts-Novelle eigentlich nur um einen einzigen Punkt kämpfen. – In der Sache bin ich an Ihrer Seite, vielleicht nicht beim Kämpfen, aber beim Erstreiten einer guten Möglichkeit. Wir haben heute noch ein paar weitere hilfreiche Assoziationen dazu gehört. Ich hoffe, dass wir diesen einen Punkt in der vorgegebenen, mit der Gewerkschaft vereinbarten Zeit erledigen werden können.
Ich habe bereits einige Fragen gestellt, auf die ich auch Antworten erhalten möchte; ich füge noch eine an: Ich habe ein wissenschaftstheoretisches Problem mit der These: Lasst uns einmal das UOG 1993 evaluieren, das heißt empirisch erheben. Wenn die Empirie eine ernst zu nehmende Wissenschaft sein soll, dann muss sie zugeben, dass sie aus dem „so ist“ kein „so soll sein“ ableiten kann, vor allem dann nicht, wenn bereits jetzt offenkundige, strukturelle, durch sachkundige Analyse erhebbare Mängel des UOG 1993 erkennbar sind und diese Mängel sogar 1993 vorweg identifiziert worden sind, und zwar nicht nach dem Motto „Wir verabschieden ein Mängelgesetz“, sondern: Wir verankern erste Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung der Autonomie.
Wir haben also schon beim Beschluss 1993 – auch das richtet sich wieder gegen die These von der politischen Amnesie – die Weiterentwicklung des UOG 1993 samt Dienstrecht und Studienrecht ins Auge gefasst. Wir bewegen uns nun schlüssig auf diesem Pfad. Im Rahmen dieser Weiterentwicklung wurde 1998 eine erste Vollrechtsfähigkeitsnovelle vorgelegt. Das Universitätenkuratorium hat dazu befunden: Richtung stimmt! – Feinabstimmung notwendig! – Weiter daran arbeiten!
Also nicht von heute auf morgen, überfallsartig und so weiter – nichts davon ist richtig.
Wir brauchen auch mehr Klarheit bezüglich Leitungs- und Verantwortungsstrukturen, eine echte Autonomie und alles, was hier angesprochen wurde, auch um eine Verbesserung der Qualität für die Studierenden zu erreichen.
Zum Abschluss noch eine Bemerkung zu den sich vielfach in Bedrängnis wähnenden Kultur- und Geisteswissenschaften: Ich meine, dass es die Universität selbst – ein Ort der Fachkundigkeit und der Kompetenz –, das heißt, gerade sie in ihrer Exzellenz verstehen muss, das Konzert der Disziplinen zu verteidigen und damit auch den Stand, die notwendige Funktion und – ich spreche es aus – die Leistungsfähigkeit der Geisteswissenschaften. Diese muss aber selbst ständig argumentiert werden, und das wird bei Fortsetzung der Konzentration auf den „Tod“-, „Krise“- und „Ende“-Diskurs sicherlich nicht gelingen.
Noch eine letzte Bemerkung: Wenn wir im Sinne von Welzig die Unterscheidung in nutzenorientiert und neugierorientiert – im Sinne der epistemischen, intellektuellen Neugierde – treffen wollen, müssen wir sicherlich auch darüber nachdenken, wie sich der tertiäre Bildungssektor strukturieren und inhaltlich transparent gestalten soll. Dann sind aber diejenigen Personen, die in diesem Bereich arbeiten und studieren, nicht jene, die auf der Schifffahrt von Passau nach Wien aus dem Boot geschmissen werden, um beim Bild meines Vorredners zu bleiben. Im Boot sitzen vielmehr solche, die ein Ticket von Passau nach Melk haben, andere haben eines von Passau nach Wien, andere wollen in Melk umsteigen und ein anderes Schiff nehmen, und wieder andere wollen ihr Ticket in Melk bis nach Wien verlängern. Für all diese Wünsche soll es transparente Maßgaben geben. Niemand wird aus dem Boot geschmissen. Dafür verbürge ich mich als ÖVP-lerin und FCG-lerin! – Danke. (Beifall.)
15.09
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Als Nächster gelangt Herr Abgeordneter Grünewald zu Wort. – Bitte.
15.09
Abgeordneter Dr. Kurt Grünewald (Grüne): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Frau Minister! Meine Damen und Herren! Nach dieser Bootsfahrt auf der Donau möchte ich Ihnen meinen Eindruck von der Debatte der letzten Monate und von einigen Beiträgen des heutigen Tages mitteilen und daran meine Fragen knüpfen.
Die Frage von Kollegem Grollitsch, warum Innsbruck so lange gebraucht hat und Leoben so schnell war, lässt sich relativ einfach beantworten: Innsbruck hat zumindest fünf Fakultäten und 30 000 Studenten. Beides hat Leoben nicht. Etwas Kleineres lässt sich eben schneller reformieren als etwas Größeres.
Zu Kollegin Brinek: Dass Bast an einem Gesetz geschrieben hat, ist schon klar, aber Sie werden doch wohl nicht annehmen, dass ein Beamter nicht das schreibt, was ihm vom Minister oder von der Ministerin gesagt wird. (Abg. Dr. Brinek: Ich habe seine Verteidigungsrede gehört!) Und daher würde ich doch meinen, dass man das nicht alles gleichsetzen kann.
Heute wurde kritisiert, dass viele der Reformkritiker oder vielmehr der Kritiker der Art dieser Reform die Vergangenheit idealisieren würden. Wer die Geschichte idealisiert, setzt sich einer sehr einfach anzustellenden Überprüfung aus: Die Geschichte ist bekannt, sie lässt sich studieren, und die Idealisierungen lassen sich falsifizieren. Wenn Sie aber die Zukunft der Universitäten infolge dieser Reform idealisieren und behaupten, es werde alles hervorragend und besser werden, tut man sich bei der Falsifizierung schon etwas schwerer, weil die Zukunft eben noch nicht eingetreten ist. Und bis sie eingetreten sein wird, wird wahrscheinlich selbst das Protokoll dieser Enquete bereits in den Schränken verstauben. Idealisierungen der Zukunft sind also nicht so ohne weiteres gutzuheißen, wie man hier glauben machen will.
Ich komme daher auf die Wissenschaftlichkeit beziehungsweise Redlichkeit der Argumentation zu sprechen. Wenn ich Erwartungen in Reformen setze, wäre dreierlei anzugeben: Welches Ziel hat die Reform? Warum soll sie kommen, also was ist die Motivation? Und letztlich bedarf es auch einer Analyse des Ist-Standes. Wenn ich von Zielen spreche und vom Weg dorthin, sollte ich nämlich auch wissen, wo ich stehe. Wenn man das nicht beherzigt, wenn man keine Evaluierung, keine Stärken- und Schwächenanalyse vornimmt und auch relativ wenig an Worten über Leitbild und Aufgaben der Universitäten verliert, dann fehlt natürlich auch Entscheidendes im Motivenbericht.
Ich erinnere mich an den Reformdialog in den Redoutensälen, zu dem Kanzler Schüssel und die Frau Vizekanzler eingeladen haben. Auf die schüchterne Frage: „Warum glauben Sie, dass auf Grund dieses Reformkonzepts alles besser werden wird?“ gab es dort sinngemäß die Antwort: „Weil es im Regierungsprogramm steht.“ – Das ist auch nicht gerade die intrinsische Logik, die ich mir in einer Wissenschaftsdebatte über die Universitäten erwarte.
Ich habe gehört, dass der Bundeskanzler als Motiv der Reform angibt, es fände sich keine deutschsprachige – es sind Gäste aus Deutschland anwesend – Universität – und da hat er natürlich Österreich inkludiert, wenn auch nicht politisch, so hoffe ich – unter den besten 50 der Welt. Wenn gleichzeitig behauptet wird, Universitäten müssten Unternehmen immer ähnlicher werden, frage ich Sie: Welcher österreichische Betrieb ist denn unter den 50 besten der Welt? Sie werden darauf wahrscheinlich keine Antwort finden.
Wenn ich höre, dass, wenn schon das Herz bei der Reform versage oder man sein Herz der Reform nicht schenken wolle, man mit eiskaltem Verstand darangehen müsse, dann erinnere ich mich an meine Ausbildung als Naturwissenschafter, und ich sage: Wenn Sie anerkennen, dass der Verstand ein biologisches System ist – und das ist so –, dann sollten Sie bedenken, dass es für biologische Systeme gewisse optimale Bedingungen gibt, unter denen sie auch optimal arbeiten, und dass die Nulltemperatur dazu jedenfalls nicht gehört – außer Sie wollen die österreichischen Universitäten in die Arktis verlegen, was ich ja doch nicht vermute.
Ein weiterer Argumentationsfehler ist, zu behaupten, in fünf Jahren wären alle Stellen vergeben. Das kann nicht sein bei einem Turnover von 14 Prozent in Innsbruck und vielleicht 10 Prozent an anderen Universitäten. Da müsste die Molekularbiologie zuvor das ewige Leben erfunden haben, damit dann alles zu sein kann. Also auch das ist nicht ganz richtig.
Wenn man über ein neues Dienstrecht redet, sollte man wissen, was die Universitäten sein sollen, was ihre Aufgaben und Ziele sind, und danach sollte sich dann das Dienstrecht richten. Ich würde auch meinen, dass nicht jedes Argument an den Haaren herbeigezogen werden soll. Es ist beispielsweise nicht sehr legitim, Linz, Klagenfurt, Wien, Innsbruck und Salzburg jeweils mit Stanford, Harvard und MIT zu vergleichen. Ich erinnere mich auch noch gut an die Äußerung des ehemaligen Präsidenten der Österreichischen Rektorenkonferenz, Skalicky, der einmal gesagt hat: Wir sind ganz gleich wie die ETH – wir sind gleich groß, haben gleich viele Studenten und haben auch das gleiche Budget, nur haben die es in Schweizer Franken. – Also bitte überlegen Sie doch, wenn Sie schon Vergleiche bringen, ob auch die jeweiligen Bedingungen fair und chancengerecht ausgewertet oder evaluiert worden sind.
Wenn ich höre, die Grundlagenforschung müsse sich mehr an den Bedürfnissen der angewandten Forschung orientieren, so darf ich darauf hinweisen, dass dem einige Experten widersprechen, die sagen, dass diese Trennung zwischen Grundlagen- und angewandter Forschung überholt sei, ganz zu schweigen vom Beispiel Japan, wo man inzwischen von der angewandten Forschung retour „geswitcht“ ist in eine viel bessere Dotierung der Grundlagenforschung.
Wenn ich weiters höre, und zwar nicht nur hier, sondern auch beim Reformdialog der Bundesregierung, dass sich die Universitäten viel stärker am Markt ausrichten sollen, so ist da etwas daran. Ich bin auch nicht dagegen, praxisnahe, wirtschaftsnahe auszubilden, neue Ressourcen zu erschließen und neue Kooperationen einzugehen. Andererseits habe ich Sie bereits einmal gefragt: Wo war der Markt für die Ideen Galileis, wo war der Markt für die Relativitätstheorie Einsteins, und wo war der Markt für Oskar Kokoschka, der vertrieben wurde oder geflüchtet ist? Das müssen Sie mir vielleicht auch noch erklären.
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Herr Abgeordneter Grünewald, darf ich um den Schlussgedanken bitten!
Abgeordneter Dr. Kurt Grünewald (fortsetzend): Ich komme schon zum Schluss: Für mich ist die Universität ein Ort der Auseinandersetzung. Gegen den Vorwurf, man dürfe die Universität nicht mit einem Schonraum verwechseln, möchte ich ins Treffen führen, dass „Schonraum“ ein ambivalenter Begriff ist. Wenn man von Schlagzeilen, flotten Sprüchen und nicht sehr wissenschaftlichen Argumenten, von modischen Trends und einer nicht angemessenen Hektik verschont bleibt, kann ich „Schonraum“ nicht mehr als Beschimpfung empfinden. – Danke.
15.16
Antrag gemäß § 98a Abs. 5 GOG
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Bevor Frau Professor Wagner zu Wort gelangt, werde ich schnell die Abstimmung durchführen, denn jetzt passt das Präsenzquorum.
Die Abgeordneten Dr. Graf und Kollegen haben den Antrag gestellt, das Stenographische Protokoll dieser Enquete dem Nationalrat als Verhandlungsgegenstand vorzulegen.
Der Antrag hat folgenden Wortlaut:
Antrag
betreffend die Parlamentarische Enquete zum Thema „Die Universitätsreform“
Gemäß § 98a (5) GOG wird ersucht, das Stenographische Protokoll als Verhandlungsgegenstand dem Nationalrat vorzulegen.
*****
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Die Beschlussfassung über diesen Antrag obliegt gemäß § 98a Abs. 5 der Geschäftsordnung den dem Teilnehmerkreis der Enquete angehörenden Abgeordneten.
Ich lasse daher über diesen Antrag abstimmen, und ich bitte diejenigen Abgeordneten, die sich dafür aussprechen, um ein entsprechendes Handzeichen. – Das ist die Mehrheit. Der Antrag ist angenommen.
*****
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Wir gelangen nunmehr zum Beitrag von Frau Professor Dr. Wagner. – Bitte.
15.17
Univ.-Prof. Dr. Ina Wagner (Technische Universität Wien): Ich komme von der Technischen Universität Wien und aus einem Fachbereich, der viele sozial gewünschte Merkmale aufweist: die Informatik. Sie ist international relativ erfolgreich, verfügt über einen sehr hohen Drittmittelanteil und sehr viele Industriekooperationen. Trotzdem möchte ich mich sehr stark gegen eine Ausgliederung der Universitäten aussprechen und habe dafür eine ganze Reihe von Gründen. Zwei davon möchte ich besonders hervorheben: Der eine ist, dass die geplante Ausgliederung der Universitäten aus meiner Sicht sehr stark auf einem falsch angelegten Vergleich der Universitäten mit Industrieunternehmen beruht. Der zweite Grund besteht darin, dass diese Ausgliederung offenkundig – das haben wir heute bereits mehrfach gehört – mit der Einführung von mehr Hierarchie, gebündelten Entscheidungsstrukturen und der Zurücknahme von Mitbestimmung verbunden ist. Beides halte ich für sehr problematisch.
International erfolgreiche Wissenschaft kann in hierarchischen, autoritären Strukturen gewiss nicht gut gedeihen; das hat bereits Edith Saurer sehr schön ausgeführt. Wissenschaft braucht sehr offene Strukturen, braucht sehr viel Diskurs, sehr viel Kommunikation und blüht eben am besten in dieser sehr eigenen Mischung von einerseits Mentoring und Vorbild, andererseits Peer-Review, Kritik, Konkurrenz und Kooperation.
Mein zweites Argument gegen die Ausgliederung bezieht sich darauf, dass Universitäten auf bestimmten Ebenen wesentlich komplexere Organisationen sind als Industrieunternehmen. Das hängt mit der großen Vielzahl von Disziplinen zusammen, die an einer Universität beheimatet sind. Auf Grund dieser Vielfalt ist ein hohes Ausmaß an Mitbestimmung der einzelnen Fachbereiche unabdingbar und auch ein breiter Diskurs über einzuschlagende Entwicklungspfade, Entwicklungsmöglichkeiten und Schwerpunktsetzungen notwendig.
Ich habe heute auch ein bisschen die Tendenz herausgehört, dass es bei den Reformplänen doch auch um eine Schwächung der Universitäten geht, und zwar einerseits generell gegenüber stärker berufsorientierten Studien- und Lehrgängen und andererseits auch speziell in den nicht wirtschaftsnahen und marktnahen Disziplinen. Das halte ich für außerordentlich problematisch.
Ich möchte dezidiert an der Möglichkeit des Zugangs zu einer offenen, an Erkenntnis orientierten Form der Bildung für alle festhalten. Ich meine, dass das etwas ungeheuer Wichtiges ist. Dazu gehört meines Erachtens auch eine Vielfalt der Zugänge und Lehrmeinungen. Deswegen war ich auch über die Bemerkungen von Herrn Kollegen Welzig über die Notwendigkeit von sehr starken Konzentrationen ziemlich entsetzt. Woher soll denn Widerspruch, woher soll Innovation, woher soll die Fähigkeit kommen, Dinge anders und neu zu sehen, wenn nicht aus einer Vielfalt von Zugängen und Lehrmeinungen? Das zu garantieren, sollten die Universitäten weiterhin imstande sein.
Zusammenfassend: Ich denke, dass viele der Dinge, die notwendig sind, um die Qualität von Forschung und Lehre und die Effizienz der Universitäten zu erhöhen, im Rahmen einer verstärkten Teilautonomie möglich sind und zum Teil doch auch bereits in Angriff genommen werden. Dazu gehört eine leistungsgerechtere und bessere, vernünftigere Verteilung von Ressourcen – an der TU Wien wird das bereits ansatzweise praktiziert – und sicherlich auch laufende Evaluierungen von Angeboten und Fachrichtungen. Dagegen kann und will sich auch niemand wehren. Anspruchsvollere Doktoratsstudien – das würde ich gerne betonen –, die auch international vergleichbar sind, wären wichtig und könnten viel zur wissenschaftlichen Nachwuchsbildung beitragen. Es geht aber auch um neue Formen der Lehre. Die Reform der Lehre ist mit den neuen Studienplänen noch nicht zu ihrem Ende gekommen. Gerade in den so genannten Massenstudien, wie etwa auch in der Informatik, gibt es einen entsprechenden Reformbedarf. Und da gesagt wurde, niemand schreie nach mehr Ressourcen, möchte ich betonen, dass für eine Erhöhung der Qualität der Lehre gerade in diesen Bereichen beziehungsweise auch nur für die Garantie der bestehenden Qualität sehr viele zusätzliche Ressourcen notwendig wären. – Danke.
15.22
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Als Nächster ist Herr Professor Dr. Seidler zu Wort gemeldet. – Bitte.
15.23
Univ.-Prof. Dr. Horst Seidler (Universität Wien): Frau Bundesministerin! Herr Vorsitzender! Sehr verehrte Damen und Herren! Es wäre sehr beruhigend, würden die Vorträge der Herren Bonn und Marhold sowie von Frau Hassauer, unbeschadet Ihrer Zustimmung oder Nichtzustimmung, dem Hohen Haus zugänglich gemacht werden, damit Sie ein bisschen etwas von der Problematik sehen, die uns das UOG 1993 eingebrockt hat und die wir reflektieren müssen, um die Idee der Notwendigkeit einer Dienstrechtsreform überhaupt erst plausibel werden zu lassen.
Magnifizenz Bast! So wie wir es immer verstanden haben, war das UOG 1993 doch eigentlich ein Übergangsrecht – ein Übergangsrecht in die Vollrechtsfähigkeit. Wenn ich mich recht erinnere, dann war das nicht so, wie Herr Grünewald behauptet hat, nämlich dass Sie von einem Minister den Auftrag bekommen hätten, sondern Sie sind mit Leib und Seele dahinter gestanden und haben 1997 auch einen entsprechenden Entwurf für eine Vollrechtsfähigkeit oder Ähnliches mitformuliert. (Abg. Dr. Brinek: So war es! Und ihn auch vorgestellt!) Das heißt, das UOG 1993 war für uns alle immer die Wende in eine neue Zukunft. Was aber haben wir aus dem UOG 1993 gelernt?
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenn das neu zu formulierende Dienstrecht heute kritisiert wird, dann möchte ich jene, die betriebswirtschaftlich versiert sind beziehungsweise Interesse haben, bitten, sich doch einmal die Altersstrukturen der Universitäten anzusehen. Wenn es – ich spreche jetzt nur von meiner Fakultät – ein Institut gibt, ohne es jetzt nennen zu wollen, dessen jüngster Mitarbeiter, habilitiert oder nicht habilitiert, 56 oder 57 Jahre alt ist, und wenn es ein Mitbestimmungsrecht gibt, das die Wahl zum Institutsvorstand von der Akzeptanz durch die Institutskonferenz abhängig machen wird, dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, geraten wir in eine Situation, in der der berufene Professor oder die Professorin aus dem Ausland nicht mehr zum Institutsvorstand gewählt wird, sondern ein Mittelbauvertreter.
Angesichts dessen fordere ich tatsächlich, dass wir das, was wir als professorale Verantwortlichkeit in einer Verantwortungsstruktur einzufordern haben, auch wieder zurückbekommen. Das ist kein Verstoß gegen demokratische Grundregeln. Sicherlich nicht! Aber wenn wir beispielsweise eine Dame an eine medizinische Fakultät in Österreich berufen, sie zur Ordinaria machen, um sie dann ein Dreivierteljahr später durch die Institutskonferenz abwählen zu lassen, womit dann Mittelbauvertreter die Möglichkeit erhalten, Ressourcen zu streichen, über die Nutzung von Räumen anders zu befinden und dergleichen mehr, dann kann der Wissenschaftsstandort Österreich wirklich nicht mehr attraktiv sein.
Ein anderes Beispiel: An einem anderen Institut hat man einen älteren Mittelbauvertreter zum Vorstand gemacht, mit dem Ergebnis, dass dieser Assistent seinem Professor nun Kraft der Möglichkeit als Institutsvorstand die Exkursionsmittel um 40 Prozent gekürzt hat und 60 Prozent der Exkursionsmittel jenen Damen und Herren zugeteilt hat, die ihn zum Institutsvorstand gewählt haben. So etwas wird tatsächlich auch im Ausland zur Kenntnis genommen, und das gehört mit zu den Problemen, die den Standort Österreich für Berufungen als nicht mehr besonders attraktiv erscheinen lassen.
Ich war von einigen Referaten schon auch sehr irritiert. Wenn das neue Dienstrecht, wenn der Übergang in die Vollrechtsfähigkeit, die ja bereits im Mittelpunkt des Interesses der vorigen Regierung gestanden ist, sogar mit dem Begriff „Apokalypse“ bedacht wird, wenn ganz einfach in die Zukunft hinein prognostiziert wird, das neue Dienstrecht führe dazu, dass man – wörtlich – „nach sechs Jahren entfernt“ würde, dann ist dem entgegenzuhalten, dass es ganz einfach keinen einzigen Text in einem Gesetzentwurf gibt, der solche Aussagen rechtfertigen würde, und auch nicht die Behauptung, dass die Ernennung eines Rektors politisch motiviert sein werde.
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben eigentlich die Aufgabe, den Reformprozess – und da stimme ich mit allen anderen überein – in Gang zu halten, nicht stillzustehen. Das UOG 1993 startete die Entwicklung zu einer neuen Autonomie der Universitäten, und ich weiß ganz einfach nicht, weshalb diese Entwicklung in die Autonomie, in mehr Freiheit, in mehr Selbstständigkeit mit so viel Angst attribuiert und mit so vielen negativen Argumenten bedacht wird.
Ich denke, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, Sie sollten noch einmal wertfrei und unabhängig davon, welcher politischen Fraktion Sie angehören, die Altersstrukturen der Universitätsinstitute reflektieren und sich noch einmal ansehen, was das UOG 93 an negativen Entwicklungen ausgelöst hat. – Danke.
15.28
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Als Nächste ist Frau Mag. Eckl zu Wort gemeldet. – Bitte.
15.28
Mag. Martha Eckl (Kammer für Arbeiter und Angestellte): Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ein gut Teil der Vortragenden hat uns die Ausgliederung quasi als Königsweg präsentiert, das bringe nur Vorteile: Man könne sich die Studierenden aussuchen, man könne das Personal leichter kündigen und Gebühren und Drittmittel lukrieren.
Ich denke, man müsste die Perspektive der als „Kunden“ Bezeichneten, nämlich der Studierenden sowie deren Eltern und derer, die studieren wollen, genauer betrachten. Wenn auch die Eckpunkte des Ministeriums de facto nur Überschriften bieten, so gibt doch die Tendenz Anlass zur Sorge. Es wird nämlich eindeutig klargestellt, dass die Barriere Studiengebühren bleiben wird und damit auch deren negative Auswirkungen. Bessere Bedingungen, wie kürzere Studienzeiten, wird es nur mehr für jene geben, die sich das auch leisten können. Und auch wenn das jetzt noch nicht so klar ausgesprochen wird, wird es zu einer Erhöhung der Studiengebühren kommen müssen: Die Erfahrung zeigt uns allen, dass es nicht ausreichend Mittel gibt. Wenn nicht genug staatliche Mittel zur Verfügung stehen, dann wird der Druck auf die Institutionen steigen, und sie werden versuchen, das über die Einnahmequelle Gebühren auszugleichen.
Zweiter Kritikpunkt aus der Perspektive der so genannten Kunden ist, dass die Mitbestimmung „konzentriert“ – so wird das bezeichnet – werden soll. Das heißt doch nichts anderes, als dass die Mitsprache der Studierenden in der gegenwärtigen Form ein bisschen lästig fällt und künftig nur mehr diejenigen das Recht zur Mitsprache beziehungsweise die Entscheidungsbefugnis haben sollen, die an der Spitze stehen. Aus der Perspektive der Studierenden sind das negative Auswirkungen, und man muss das auch mit den Betroffenen in ausreichendem Maße diskutieren.
Wenn die von der Frau Ministerin betonte Dialogbereitschaft tatsächlich ernst gemeint ist, dann muss man sich auch die Zeit nehmen, das nicht nur auf Rektorenebene genauer zu diskutieren, sondern mit allen Betroffenen. Man muss die Diagnose vor die Therapie stellen, wie heute schon erwähnt worden ist, und man muss sich auch über alternative Lösungsmodelle Gedanken machen, und das, wie gesagt, unter Einbeziehung aller Betroffenen. Die Einbeziehung im Rahmen dieser Enquete genügt sicherlich nicht. – Danke.
15.31
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Als Nächster ist Herr Professor Dr. Borsdorf zu Wort gemeldet. – Bitte.
15.31
Univ.-Prof. Dr. Axel Borsdorf (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Stadt- und Regionalforschung): Meine Damen und Herren! Ich bin zu dieser Enquete von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften nominiert worden; ich spreche aber nicht als deren Vertreter, sondern auf der Basis meiner Erfahrungen als Lehrender an der Universität Innsbruck, als Forschender und Leiter eines Forschungsinstituts an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und – das sage ich in Bezug auf die Ausführungen meiner Vorrednerin – als Vater dreier in Ausbildung befindlicher Kinder, von denen eines an einer österreichischen Universität studiert, die anderen im Ausland.
Frau Bundesminister, ich möchte Ihnen sehr herzlich zu Ihrem Mut gratulieren, mit diesen neuen Gesetzen einen Weg zu beschreiten, der unumgänglich ist. Es gibt viele gute Argumente, die ich heute Morgen gehört habe. Sie decken sich mit den Erfahrungen, die ich selbst in diesen unterschiedlichen Funktionen gemacht habe, aber auch gemacht habe bei meinen Auslandsaufenthalten in den USA und in Lateinamerika, und natürlich auch mit meinen Erfahrungen in Deutschland.
Mir ist jedoch an diesem Gesetz, so wie es mir bisher bekannt ist, manches nicht weitgehend genug. Ich denke, es sollte unbedingt einen Ausschluss von Hausberufungen beinhalten. Ich sehe immer wieder und bin immer wieder konfrontiert mit einem Filz von Kollegen, die seit der Sandkastenzeit zusammenspielen und gegen die man in diesem Spiel als von außen Berufener kaum eine Chance hat.
Ich bin für ein unbedingtes und sofortiges Ende des Unsinns mit den Kolleg- und Prüfungsgeldern. Dieser Unsinn hat dazu geführt, dass es aus pekuniären Interessen um eine Maximierung der Lehre geht, die eine Vernachlässigung der Forschung zur Folge hat, und zwar bis dahin – ich weiß nicht, Frau Minister, ob Sie darüber informiert sind –, dass der Gehaltsbestandteil Lehrgelder für Assistenten die dreifache Höhe der Kolleggelder von Professoren erreicht. Das ist ein Unsinn, mit dem aufgehört werden muss. Hier kann durch Einführung fester Lehrdeputate und natürlich Abgeltungen dieser, die dann allerdings geringer sind, eine Menge Geld und vor allem Verwaltungsaufwand gespart werden. Der hierbei und bei der Abrechnung von Prüfungsgeldern auch bei all den Modellen, die jetzt entwickelt worden sind, immer noch anfallende Verwaltungsaufwand könnte viel besser in eine Ausstattung der Professuren mit wissenschaftlichen Hilfskräften investiert werden, sprich mit Möglichkeiten für unsere Studierenden, in die Forschungsarbeit der Forschenden einbezogen zu werden und hiemit auch einen Teil ihres Studiums finanzieren zu können, damit sie nicht mehr in Kaffeehäusern und als Schilehrer tätig sein müssen.
Ich bin auch unbedingt für eine Professionalisierung der Universitätsleistung. Ich bin etwa mit einem Fall aus einer österreichischen Universität konfrontiert, wo vor vier Jahren Berufungszu-sagen auf Räume zur Einrichtung eines Labors gegeben worden sind. Diese Räume stehen bis heute leer, weil der dafür zuständige Vizerektor nicht in der Lage ist, seine Unterschrift unter eine entsprechende Raumzuweisung zu setzen.
Ich denke, dass damit sowohl den Studierenden etwas Gutes getan würde als auch die Forschung gefördert würde. Aber, Frau Minister, ich meine, wir müssen auch ein Argument durchaus ernst nehmen: Die Warnung vor zu großer Eile. Die rasche Sukzession unterschiedlicher Reformvorhaben, mit denen wir konfrontiert waren, insbesondere das unselige UOG 93, haben eine gewisse Müdigkeit, wenn nicht gar Erschöpfung an den Universitäten entstehen lassen. Wir müssen hier differenzieren: Das Dienstrecht muss sofort her, weil es nämlich eigentlich erst in 20 Jahren wirklich wirksam wird. Die Vollrechtsfähigkeit ist eine Sache, von der ich überzeugt bin und meine, dass sie kommen muss, aber sie kann noch erwogen werden, sie kann noch reflektiert werden.
Insgesamt aber, so meine ich, gibt es zur Reform keine Alternative oder vielleicht nur eine: Die bestehenden Universitäten in Fachhochschulen umzuwandeln, denn sie haben bereits jetzt vielfach den Charakter von Fachhochschulen mit einem auf die Lehre fixierten und völlig einzementierten Lehrpersonal, und zugleich die Schaffung einer modernen Universität, die international wettbewerbsfähig ist. Die Alternative dazu ist das, was Sie sich vorgenommen haben, Frau Bundesminister, nämlich die Umwandlung aller Universitäten in solche moderne Dienstleistungszentren von Forschung und Lehre. Ich kann Ihnen dazu nur viel Erfolg und weiterhin viel Mut wünschen. (Beifall.)
15.36
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Professor Uher-März. – Bitte.
15.36
Univ.-Prof. Dr. Richard Otto Uher-März (Universität Wien, Medizinische Fakultät): Guten Tag! Ich bin von der Medizinischen Fakultät der Universität Wien und einer von den Leuten, die in die von Professor Winkler apostrophierte Studienreform involviert sind. – Eine hohe Latte, die Sie uns da gelegt haben!
Es wird ein Gesetz diskutiert, das eine Neuverteilung der Orte bringen soll, an denen Entscheidungen gefällt werden, und es ist im Prinzip richtig, dass eine solche Diskussion stattfindet. Sie ist angebracht, denn Entscheidungen sollen dort fallen, wo auch die Kompetenzen vorhanden sind.
Ich meine jedoch – wenn wir uns schon an einem solchen Ort befinden –, es gibt Entscheidungen, die sind einfach politischer Natur und die müssen eben dort gefällt werden, wo die dafür Zuständigen sind; es gibt einfach Entscheidungen, vor denen sich die Politik nicht drücken sollte. Ein Beispiel dafür, und das wurde heute bereits einige Male angeführt: die Zusammenlegung von Studienrichtungen, die Straffung von Studienangeboten. Um Gottes willen! Das ist doch zurzeit gesetzlich klar geregelt, wer dafür zuständig ist. Wo ist da das Problem? – Mir kommt das sehr danach vor, dass man unangenehme Entscheidungen in den Autonomiebereich verlagern will, damit jemand anderer daran schuld ist. Da bin ich strikt dagegen.
Gleich daran anschließend zum Thema der Finanzierung der Universitäten: Das ist ganz klar im überwiegenden Ausmaß eine Frage des Parlaments. Die finanziellen Mittel dafür müssen bereitgestellt werden. Ob das direkte Steuern sind oder Studiengebühren, das zu entscheiden ist eine Frage der Politik. Ich möchte ganz klar sagen, dass ich strikt gegen Studiengebühren, wie sie jetzt eingeführt werden sollen, bin. Damit ist dieses Thema jedoch nicht vom Tisch, dieses Thema wird uns ständig begleiten. Dieses Thema gehört jedoch hier im Haus verhandelt. Das ist ein weiteres Beispiel für etwas, das keinesfalls in den Autonomiebereich der Universitäten ausgelagert werden sollte, sodass diese frei sind, ihre eigenen Studiengebühren einzuheben. Beim Zugang zum Studium dürfen soziale Kriterien keine Rolle spielen. Diese Forderung entspricht nicht nur einem allgemeinen politischen Anliegen, es ist auch im Sinne dieser Republik, dass ein gut ausgebildeter Kader vorhanden ist, und dabei dürfen soziale Kriterien eben keine Rolle spielen. Es ist wiederum eine Angelegenheit der Politik, dass das gewährleistet bleibt.
Ich meine, eine der Vorgaben, die wir mit dem neuen Studienrecht bekommen haben, ist sehr sinnvoll: dass das Studium wirklich in der Regelstudiendauer zu absolvieren sein muss und die neuen Studienpläne sich daran zu orientieren haben. Aber, damit das möglich wird, müssen Randbedingungen erfüllt sein:
Die Universitäten müssen mit Ressourcen ausgestattet werden, damit sie das wirklich bewältigen können – und, keine Frage, diese Ressourcen sind an die Kapazitäten, die Anzahl der Auszubildenden zu knüpfen, das kann davon wohl nicht unabhängig sein. Das ist die eine Bedingung, die erfüllt werden muss, damit die Studiendauer wirklich gesenkt werden kann.
Die andere Bedingung ist, dass die Studierenden in die Lage versetzt werden müssen, wirklich ein Vollzeitstudium durchzuführen, das heißt, sie müssen über die finanziellen Ressourcen verfügen, damit sie eben nicht neben dem Studium in einem signifikanten Ausmaß arbeiten müssen. Wie das zu lösen ist, welche Mischung von Stipendien oder Darlehen dafür bereitzustellen ist, ist eine politische Entscheidung, die hier im Hause zu treffen ist. Das kann wohl nicht Aufgabe der autonomen Universitäten sein.
Ich bin zurzeit in Fragen des Studienrechts involviert, und in diesem Bereich begrüße ich sehr, dass den Universitäten eine gewisse Autonomie gegeben wurde. Das war längst überfällig! Wenn man sich das aber dann genauer ansieht, stößt man überraschend schnell an Grenzen der Autonomie, wobei ich gar nicht glaube, dass das durch Bösartigkeit verursacht ist. Ich meine, es gibt einfach so viele verschiedene Regelungen, dass man erst draufkommen muss, wo überall die Haken drinnen sind.
Ich erwähne als ein Beispiel die Übergangsbestimmungen, die merkwürdigerweise nicht im Autonomiebereich der Universität sind. Diese werden in einem Satz des Gesetzes für alle Universitäten, alle Studienrichtungen Österreichs geregelt, wobei es noch ein hübsches Schmankerl gibt: Im UniStG wird das anders geregelt als im AHStG. Das ist für einen Nicht-Juristen wirklich sehr überraschend. Ein anderes Beispiel: Die Zulassungserfordernisse zu den Studien werden nicht im Studiengesetz geregelt, sondern in irgendeiner anderen Verordnung, worauf man als Nicht-Jurist erst mühsam kommen muss. Unsinnig! Auch das wäre im Autonomiebereich der Universitäten zu regeln.
Vielleicht noch ein paar ganz kurze Kommentare zu Dingen, die heute angesprochen worden sind: Es wurde gefordert, dass nur Peers über Peers entscheiden sollten. – In dieser Form bin ich dagegen, denn das würde heißen, dass in den Berufungskommissionen nur Ordinarii sitzen dürften. Das wäre sicher kontraproduktiv. Das würde auch bedeuten, dass es keine studentische Evaluation von Lehrveranstaltungen mehr geben dürfte, sondern dass das Professoren tun müssten. Auf der ganzen Welt hat man entschieden, dass das kein vernünftiges Modell ergibt. Auf einen anderen Bereich übertragen, müssten beispielsweise Zeitungen Virtuosen als Konzertkritiker anstellen. Es ist also ein unsinniges Ansinnen.
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Herr Professor, darf ich Sie um einen Schlussgedanken bitten!
Univ.-Prof. Dr. Richard Otto Uher-März (fortsetzend): Das, was Sie vorhin über die Kolleggelder gehört haben, ist für mich in dieser Dimension überhaupt nicht nachvollziehbar. Es gibt hierbei aber auch zwei Aspekte: Es ist einerseits ein enormer Verwaltungsaufwand, keine Frage, aber andererseits ist das der einzige leistungsbezogene Gehaltsbestandteil, den wir zurzeit haben. Und den wollen Sie abschaffen? – Danke.
15.42
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Als Nächster spricht Herr Universitätsdozent Dr. Risak. – Bitte.
15.42
Univ.-Doz. Dr. Veith Risak (Universität Wien): Meine Damen und Herren! Zunächst möchte ich festhalten, dass sowohl die Universitäten als auch die Fachhochschulen unabdingbare Spitzen der Aus- und Weiterbildung sind, und sie sollen das auch weiterhin bleiben. Sie sollen das weiterhin sein auf Grund einer sehr guten Vorbereitung im Sekundarbereich.
Zur Lehre an den Universitäten: Ich meine, es bedeutet eine sehr hohe Motivation und eine große Verantwortung, an einer Universität lehren zu dürfen und damit Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen. Ich meine auch, dass diese Motivation zur Lehre, zur Forschung vor den Details des Dienstrechts kommen soll und dass die Besten, an denen wir uns doch orientieren sollten, vom neuen Dienstrecht nichts zu befürchten haben. Ich meine aber auch, dass das jetzt bestehende Dienstrecht gegenüber dem „Vier-Säulen-Modell“ zu wenig flexibel und verbesserungsfähig ist. Es geht mir dabei nicht um ein Hire and Fire. Welche vernünftige Firma würde gute Leute hinauswerfen, wenn es zu wenige gibt? Es geht mir aber sehr wohl darum, eine „wasserdichte“ Unbeweglichkeit zu verhindern. Die Besten sollen ihre Chancen bekommen.
Ich bin daher für das „Vier-Säulen-Modell“ mit seinen Befristungen. Es soll allerdings möglich sein, dass sich jemand für die nächsthöhere Stufe im gleichen Arbeitsfeld, am gleichen Institut bewerben kann. Das hat nichts mit einem Kettenvertrag zu tun, weil die neue Aufgabenstellung doch schließlich höhere und neue Anforderungen stellt. Durch die Konkurrenz unter denen, die sich bewerben, wird dann der Beste gefunden werden. Wenn jemand einen Hausvorteil hat, also an einem Projekt beteiligt ist, das alles bereits kann und das gut nützt – warum nicht? Kommt ein Nobelpreisträger, der es machen will: Warum der nicht auch?
Die Universitäten müssen natürlich auch in der Lage sein – und das ist eine ziemlich schwierige Sache –, die jeweils Besten anzuziehen. Und dazu, würde ich meinen, ist auch die Motivationsfrage auf allen Ebenen, wirklich von der Mittelschule beginnend bis zum Nobelpreis hinauf, entscheidend.
Ich möchte aber auch noch eines zu bedenken geben: Die bisherige Diskussion ist für mein Gefühl zu sehr angstbetont. Die Angst des Mittelbaus verstehe ich eigentlich nicht. Ich kenne aus eigener Erfahrung die Lehrenden an Fachhochschulen, ich kenne aus eigener langjähriger Erfahrung die Verhältnisse in der Software-Entwicklung – beides Bereiche, in denen es keinerlei Schutz gibt –: Die guten Leute setzen sich durch, die schlechten werden an den Rand gedrängt. Haben unsere Mittelbauvertreter denn eine so schlechte Meinung von ihrer eigenen Leistung, dass sie sich so sehr fürchten müssen? Ich meine, wir sollten uns in der gegebenen Situation nicht immer nur zu Tode fürchten, sondern die neuen Chancen sehen und diese einfach auch anpacken, auch wenn einzuräumen bleibt, dass mit Chancen immer auch Risken verbunden sind. Wenn man dabei Pech hat, hat man wenigstens alles getan. – Danke. (Beifall.)
15.46
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Nächster Redner ist Herr Professor Dr. Kellermann. – Bitte.
15.46
Univ.-Prof. Dr. Paul Kellermann (Universität Klagenfurt, Institut für Soziologie): Mitbürgerinnen und Mitbürger! In Vorbereitung auf diese Enquete habe ich zwei Dinge gemacht: Ich habe mir zunächst einmal die Stenographischen Protokolle der parlamentarischen Enquete zur Universitätsreform von 1982 angeschaut. Sie können sich vorstellen, dass bereits damals eine ganze Menge von Dingen gesagt worden sind, die auch heute wieder gesagt wurden. Ich habe darüber hinaus ein Papier geschrieben. Mit diesem Papier wollte ich insbesondere zwei Dinge vermitteln: Das eine war eine noch unvollständige Liste der einseitigen Blicke auf die Uni-versität. Ich bin bisher erst auf elf Blicke gekommen, aber das will ich Ihnen hier ersparen.
Das Zweite, was ich wollte, war, einen Beitrag zur Beantwortung der Frage zu liefern: Wie ist es eigentlich erklärbar, dass sich diese Institution, die seit Jahrhunderten Wissen zur Verfügung stellt, über die verschiedenen Gesellschaftssysteme vom Mittelalter bis zur Neuzeit und Gegenwart, über Diktaturen und Demokratien hinweg hat halten können? Ich bin auf eine Antwort gestoßen, die ich das Strukturprinzip der Universität nenne: die Counterbalance, die eine Flexibilität hervorgerufen hat, die es den Universitäten durch all die Wirren der Jahrhunderte hindurch ermöglicht hat, zu überleben, und ihre Attraktivität auch für Länder bewahrt hat, die sich jetzt erst anschicken, sich industriell zu entwickeln: Neben dem Flughafen ist die Universität das zweite Symbol dafür, auf dem Pfad der Entwicklung zu sein.
Mit Counterbalance oder dem Prinzip der Gegengewichte meine ich beispielsweise, was bereits im Namen „universitas magistrorum et scolarium“ zum Ausdruck kommt – „der Lehrenden und Studierenden“; nehmen Sie das volle Engagement einer Seite für die Universität weg, ist es keine Universität mehr. Die Studierenden von dem auszuschließen, was die Universität als ihren zumindest zeitweiligen Lebensort, der sehr wichtig ist, angeht, nähme die Berechtigung, von einer „universitas“ zu sprechen. Counterbalance betrifft aber genauso Forschung und Lehre, Theorie und Praxis oder eben auch, was häufig übersehen wird, Berufsvorbildung und Allgemeinbildung. Schon 1088 ist Bologna gegründet worden, um der entstehenden bürgerlichen Gesellschaft Juristen zur Verfügung zu stellen, damals auf Basis der Philosophie als Allgemeinbildung, was für die Theologen und Mediziner genauso gegolten hat.
Aber all das wollte ich Ihnen ersparen. Ich wollte sozusagen eine Metaebene betreten, und das geht zurück auf die Enquete von 1982: Was ich gelesen habe, ist alles wohlformuliert, ich habe aber nicht finden können, was daraus gemacht worden ist. Deswegen fingiere ich einmal, irgendeine Gruppe bekäme den Auftrag, mit Methoden der empirischen Sozialforschung zu analysieren, was hier vorgebracht worden ist. Das Ziel wäre, meiner Vorstellung nach, herauszubekommen: Welche Universitätsbilder haben eigentlich die Leute, die sich hier zu diesem Thema äußern? Grob gesagt, hypothetisch: Diese Universitätsbilder sind sehr fragmentiert, sie sind in hohem Maße widersprüchlich.
Um nach den Handwerkskünsten dieser Zunft, der empirischen Sozialforschung, vorgehen zu können, muss man Hypothesen formulieren. In diesem Sinne wäre die erste Hypothese: Es wurden immer wieder Keywords, Schlüsselwörter, verwendet: Evaluation, internationaler Vergleich, Autonomie, Drop-out, Absolventenzahl, Studiendauer, Mitbestimmung, Kundenorientierung, Dienstrecht, Konkurrenz, Studiengebühren, Hausberufungen und dergleichen mehr. Da ich schon seit langer Zeit Hochschulforschung betreibe, können Sie sich sicherlich vorstellen, dass ich zu jedem dieser Keywords sehr gerne etwas sagen würde. Davon muss ich Abstand nehmen – Sie sehen hier (der Redner weist auf das bereits blinkende Lämpchen beim Rednerpult) das Lichtchen!
Zweite Hypothese: Es wurde hauptsächlich normativ argumentiert, nicht empirisch fundiert und auch nicht ursächlich argumentierend. Es wurden sehr häufig Mittel und Zwecke verwechselt. Erlauben Sie mir dazu ein kurzes Beispiel – heute sind bereits die Transportmittel auf der Donau angesprochen worden; da sich die ÖBB gerade in einem Reformprozess befinden, will ich mich auf die ÖBB beziehen –: Ich bin hierher nach Wien mit dem Zweck gekommen, vor Ihnen zu sprechen. Das Ziel war Wien. Wie ich hierher kam, möglichst effizient und effektiv, war eben preiswert und schnell – aber Effizienz und Effektivität sind nicht die Zwecke meines Besuchs gewesen.
Als Letztes: Sehr häufig wird verwechselt, was transitive und intransitive Bildung bedeutet. Es wurde praktisch nur von transitiver Bildung, das heißt von Schulung, gesprochen, nur überlegt, was man gleichsam mechanisch einrichten muss, um den Studierenden zu einer Bildung zu verhelfen. Ich mache Sie darauf aufmerksam: Bildung hat beide Bedeutungen! „Ich bilde jemanden“, aber genauso wichtig ist: „Ich bilde mich“! Das Intransitive ist genauso wichtig, und das kam heute praktisch überhaupt nicht zur Sprache. Um diese intransitive Bildung zu ermöglichen, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Die wesentlichen Voraussetzungen dafür an der Universität sind: intrinsische Motivation und anregende Klimata. – Danke. (Beifall.)
15.52
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Als Nächster spricht Herr Professor Dr. Folk. – Bitte.
15.52
Ao. Univ.-Prof. Dr. Reinhard Folk (Vorsitzender der Bundeskonferenz des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals): Meine Damen und Herren! Ich bin Vorsitzender der BUKO, das ist die Bundeskonferenz des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals der österreichischen Universitäten mit Ausnahme der Professoren. Aus diesem Grund beschäftige ich mich auch mit der Universitätsreform, mit der Dienstrechtsreform und allen Fragen, die die Universität betreffen. Wir haben uns als BUKO gegen die Reform, so wie sie die Regierung vorsieht, ausgesprochen, und dies nicht, weil wir schlecht oder überhaupt nicht informiert sind, sondern gerade deshalb, weil wir informiert sind. Wir denken, dass eine Novellierung des UOG 93 viel zielführender wäre, weil wir die politischen Rahmenbedingungen kennen.
Es ist bereits von konkurrenzfähigen Rahmenbedingungen auch für eine Reform der Universitäten gesprochen worden, und die Universität Basel wird immer wieder als Beispiel herangezogen. Dazu kann ich nur feststellen, dass die Rahmenbedingungen in der Schweiz andere sind als in Österreich, aber ich muss auch feststellen, dass die Reform in Basel anders verlaufen ist – nämlich schrittweise, in verschiedenen Etappen –, als das in Österreich geplant ist.
Wir haben auch Vorschläge gemacht, was wir sehr rasch an den Universitäten verbessern können, und das basiert auf den Erkenntnissen einiger Universitäten, die schon länger im UOG 1993 sind. Ich erwähne nur zwei Punkte: ein Globalbudget und ein mehrjähriges Budget, was das effektive Wirtschaften an den Universitäten weitgehend erleichtern würde.
Ich möchte aber, weil das Dienstrecht doch ein sehr aktuelles Thema ist und auch in der heutigen Diskussion eine große Rolle spielt, auch einige Bemerkungen zum Dienstrecht machen: Ich habe hier nur gehört, wir müssten das Dienstrecht reformieren, weil alles verstopft sei, weil unfähige Mittelbauvertreter pragmatisiert auf ihren Posten sitzen. Ich möchte bei einer Dienstrechtsänderung ganz andere Worte hören. Ich meine, eine Änderung des Dienstrechtes muss mit Blick auf den wissenschaftlichen Nachwuchs erfolgen, und in dieser Hinsicht sind frühe Entscheidungen in der Karriere sehr wichtig, aber ganz besonders auch eine frühe Selbstverantwortung des Universitätslehrers in der wissenschaftlichen Tätigkeit. Wenn wir uns international umsehen und etwa nach Deutschland schauen, dann sind es diese Ziele, die zu einer Dienstrechtsreform führen. Es wird versucht, den jungen Universitätslehrern an den Universitäten mehr Rechte und mehr Entfaltungsmöglichkeiten zu geben.
Ich meine auch, dass es für die Identitätsstiftung und Profilbildung der österreichischen Universitäten ganz wichtig ist, dass es Karrieren im Haus gibt und keine Hausberufungsverbote. Wenn wir ins Ausland schauen, insbesondere in die USA, dann finden wir das dort auch in sehr starkem Ausmaß.
Ein wesentlicher Punkt dieser Identitätsstiftung ist für mich auch die Mitbestimmung und Mitwirkung in den wesentlichen Fragen der Universität auf allen Ebenen. Dies ist Ausdruck der demokratischen Struktur der Universität. Und diese demokratische Struktur hängt zusammen mit dem individuellen Prozess der freien Forschung und der freien Lehre. Zur Freiheit der Forschung und Lehre zählt auch die Freiheit der Studienwahl. Ein Universitätslehrer bildet junge Wissenschaftler aus, er führt sie auch zur Wissenschaft, und dies, Herr Bonn, kann nicht durch weisungsgebundene Forschung und Lehre geschehen. Ich dachte, dies sei ein Element, das man in der heutigen Zeit als überwunden betrachten könne. Die Forschung an den Universitäten, die wir brauchen, muss frei und individuell geprägt sein – nur so kann Österreich auch international konkurrenzfähig sein.
Standortfragen sind auch nicht durch bloße Zahlen zu klären: Ob es elf oder acht Institute oder Standorte gibt, das kann nicht entscheidend sein. Entscheidend sind die Inhalte! Dieser Prozess der Betrachtung der Standorte und der Feststellung allfälligen Veränderungsbedarfs im Studien- und Forschungsangebot ist sehr diffizil und kompliziert, und in diesen schwierigen Prozess müssen die Universitäten gemeinsam mit dem Ministerium eintreten.
Beschäftigungsmöglichkeiten, die die Industrie älteren Universitätslehrern bietet, sind in Österreich noch nicht entwickelt – das mag in anderen Ländern anders sein, in Österreich sind sie das jedenfalls nicht. Die österreichische Industrie sollte sich im Modernisierungsprozess, den wir in diesem Bereich brauchen, intensiv und viel mehr als bisher bemühen, die industrielle Forschungsquote zu erhöhen. Dann werden wir auch diese Arbeitsplätze bekommen. – Danke schön. (Beifall.)
15.58
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Hemmer. – Bitte.
15.58
Dagmar Hemmer (Verband Sozialistischer StudentInnen): Meine Damen und Herren! Ich möchte einige Aspekte aus dem Blickwinkel einer Studierenden-Vertreterin beleuchten. Ich bin einige Jahre lang in der studentischen Kurie der Universität in den verschiedensten Gremien gesessen und habe unter anderem an der Umsetzung des UOG 1993 mitgewirkt. Ich bin erstaunt darüber, dass einige hier im Saal schon ganz genau wissen, dass das UOG 1993 gescheitert ist und dass das alles weg gehört, obwohl es doch erst seit einigen Jahren implementiert ist.
Ich möchte mich wirklich entschieden dagegen verwahren, dass das derzeitige Mitbestimmungssystem in Bausch und Bogen als ineffizient und verkrustet dargestellt wird – ich habe es auf jeden Fall ganz anders erlebt. Ich denke, wir müssen akzeptieren, dass demokratische Mitbestimmung Diskussion und Auseinandersetzung braucht und schließlich, dass Mitbestimmung einfach auch das Miteinander der einzelnen Gruppen an der Universität braucht.
Im Zusammenhang mit der Mitbestimmung möchte ich noch eine Frage an die VertreterInnen am Podium anfügen, speziell an jene, die sich so sehr gegen die Mitbestimmung ausgesprochen haben, insbesondere aber auch an die Frau Ministerin: Wie halten Sie es denn mit der gesetzlichen Interessenvertretung der Studierenden, mit der Österreichischen Hochschülerschaft? Ich denke, dass eine Reduzierung dieser Vertretung auf das Ausfüllen von Fragebögen, auf Evaluierung, sicher nicht akzeptiert werden kann. Die ÖH muss weiterhin auch eine politische Interessenvertretung bleiben und darf keine Evaluierungsagentur werden.
Ein Wort noch zum Begriff „Kunden“: Ich bin ganz und gar nicht der Auffassung, dass die Studierenden an den österreichischen Universitäten zu Kunden werden sollen, zu passiven KonsumentInnen ihrer Ausbildung. Ich möchte keine Kundin sein, die Tausende Schilling zahlt, um studieren zu dürfen, und der gleichzeitig jegliches Mitspracherecht vorenthalten wird. Ich denke, das ist alles andere als ein gutes Angebot.
Zweifellos befinden sich Universitäten in einem ständigen Weiterentwicklungsprozess. Doch die derzeit angedachte Universitätsreform, die mit der Einführung der Studiengebühren begonnen hat, die mit finanziellem Druck auf die Universitäten weitergeht und die schlussendlich mit der Abschaffung der Mitbestimmung enden wird, ist auf jeden Fall ein deutlicher Rückschritt. – Danke. (Beifall.)
16.01
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Als Nächster spricht Herr Professor Skalicky. – Bitte.
16.01
Rektor Univ.-Prof. Mag. Dr. Peter Skalicky (Technische Universität Wien): Herr Vorsitzender! Frau Bundesministerin! Ich oute mich hier als Befürworter einer Vollrechtsfähigkeit – oder nennen wir es Ausgliederung – nicht deswegen, weil alles so furchtbar schlecht wäre, und auch nicht deswegen, weil das UOG 1993 aus dem Ruder gelaufen und daher nicht mehr brauchbar sei, sondern weil ich meine, dass die Anforderungen, die heute an eine moderne Universität international gestellt werden, innerhalb des doch sehr engen Rechtssystems, das wir in Österreich haben, und unter der Führung einer Ministerialbürokratie nicht mehr erfüllbar sind. Man muss den Universitäten daher mehr Handlungsspielraum einräumen.
Ich orte allerdings in dieser Reformdiskussion ziemlich viel Sand im Getriebe. Aus meiner Sicht kommt dieser Sand daher, dass von Regierungsseite den Universitäten nicht genügend Vertrauen entgegengebracht wird, mit diesen Herausforderungen und mit einer solchen Selbststrukturierung, die die Reform beinhalten muss, auch wirklich fertig zu werden. Man muss, wenn man den Universitäten Vollrechtsfähigkeit geben will, auch bereit sein, loszulassen, ihnen zum Beispiel auch die Personalentwicklung bis zu einem gewissen Grad zu überlassen. Es ist nicht erklärbar, warum ein Dienstrecht für eine vollrechtsfähige Universität nahezu so eng gefasst sein soll wie das jetzige Dienstrecht, warum es dort genaue Vorschriften geben soll, wer unter welchen Bedingungen einen dauernden Dienstvertrag bekommt und wer nicht, welche Amtstitel die Betroffenen haben und welcher Personalkategorie sie angehören. Ich finde, das muss man den Universitäten selbst überlassen.
Das ist zwar mit einer gewissen Gefahr verbunden – und damit möchte ich auf das zurückkommen, was Frau Prof. Wagner gesagt hat –, aber ich denke nicht, dass dann hierarchische, mitbestimmungsfeindliche, undemokratische Strukturen entstehen werden. Ich wüsste nicht, warum das so sein sollte. Warum sollten denn die Universitäten mitbestimmungsfeindliche Strukturen erfinden? Auch hundertprozentig börsennotierte Unternehmen kennen bekanntlich eine Mitbestimmung.
Das gegenwärtigen System zeugt jedenfalls davon, dass man den Universitäten nicht das Vertrauen entgegenbringt, die eigene Personalentwicklung selbst in die Hand zu nehmen. Das jetzige Dienstrecht ist dazu nicht geeignet. Wenn man das Dienstrecht weiterhin so eng fassen will, dann zeigt das nur, dass man ihnen auch in Zukunft dieses Vertrauen nicht entgegenbringen will.
Was die Organisation betrifft, so meine ich doch, dass man den Universitäten auch eine Strukturierungsfreiheit einräumen muss, man muss etwas zur Drittmittelfähigkeit sagen, und man muss etwas zur Finanzierung des ganzen Systems, zur Eröffnungsbilanz, zur Eigenkapitalausstattung einer solchen Universität sagen; und zur Eigenkapitalausstattung gehört auch die Ausstattung mit Vertrauenskapital.
Im Studienrecht wird es selbstverständlich Änderungen geben müssen. Die bisherigen Maßnahmen sind allerdings zum Teil nicht nachvollziehbar und auch nicht geeignet, als vertrauensbildende Maßnahmen angesehen zu werden. Die Einführung von Studiengebühren zum Beispiel, die nicht an der Universität verbleiben, ist eine solche Maßnahme, und auch das In-Kraft-Treten des Bundesimmobiliengesetzes ist eine solche Maßnahme. Eine Universität, die in die Vollrechtsfähigkeit übergeführt werden soll, ohne Eigenkapital, ohne Eigentümer der Liegenschaften zu sein, und die obendrein noch sehr enge dienstrechtliche Vorschriften für die Personalentwicklung hat, wird nicht reüssieren, wird keinen Erfolg haben.
Zusammenfassend: Ich sehe derzeit nicht ausreichend viele, nachvollziehbare, klare, vertrauensbildende Maßnahmen, die es den Universitäten erlauben würden, sich gänzlich mit dieser Vollrechtsfähigkeit zu identifizieren. Ich appelliere daher an die Regierung, den Universitäten eine Eigenkapitalausstattung an Vertrauen zu geben. Ich bin fest davon überzeugt, dass sie absolut imstande sind, mit dieser Vollrechtsfähigkeit in der Personalentwicklung, in der Studienentwicklung und auch in finanzieller Hinsicht fertig zu werden. Das Trojanische Pferd der Auftragsforschung – das wird häufig bedauert – wird die Universitäten mit Sicherheit nicht umbringen – im Gegenteil! Das funktioniert derzeit doch eigentlich sehr gut. Rektor Bast hat darauf hingewiesen, dass nahezu eine Milliarde Schilling an Drittmitteln akquiriert wird. – Danke. (Beifall.)
16.05
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Nächster Redner ist Herr Dr. Unfried. – Bitte.
16.05
Ass.-Prof. Dr. Peter Unfried (Universität Wien): Sehr geehrte Frau Minister! Hoher Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Gleich zu Anfang des heutigen Tages fiel als eine der ersten Bemerkungen ein Satz, der meines Erachtens sehr merkenswürdig – nicht merkwürdig, sondern des Merkens würdig – war. Es war ein Ausspruch von Professor Landfried: „Wer sich nicht bemüht, besser zu werden, hört auf, gut zu sein.“ – Das habe ich mir sofort notiert, das ist ein ganz wichtiger, guter und zutreffender Satz für die Situation der Universität insgesamt.
Ich behaupte: Wenn nicht sofort etwas Gravierendes unternommen wird, läuft die Universität Wien, die Universität insgesamt nicht nur Gefahr, nicht gut zu sein, sondern läuft Gefahr, schlecht zu werden. Daher ist es absolut begrüßenswert, dass endlich einmal eine Regierung den Mut findet, einschneidende Maßnahmen zu setzen, die nicht Jahre brauchen, bis sie überhaupt einmal entwickelt sind und dann implementiert werden oder eben auch nicht. Man versucht stattdessen – auch auf die Gefahr hin, dass vielleicht nicht alles so optimal läuft –, das so rasch wie möglich durchzuziehen.
Das größte Übel, das die gegenwärtige Situation an den Universitäten so eklatant und massiv veränderungswürdig macht, ist meines Erachtens die Einführung des neuen Dienstrechtes 1988. Zur Erinnerung: Vorher war es notwendig, wenn man an der Universität bleiben wollte – und das hat jeder gewusst, der diesen Weg eingeschlagen hat –, sich zu habilitieren. Mit der Habilitation, das war eben ein Spezifikum in Österreich, war eine anschließende Pragmatisierung verbunden. Wenn ein Institut Systemerhalter brauchte – in der Naturwissenschaft zum Beispiel für Großgeräte –, hat es die wissenschaftlichen Beamteten gegeben.
Mit dem Dienstrecht 1988 wurde alles anders: Sozialfälle, die sich nicht habilitiert haben und bei denen auch keine Aussicht darauf bestand, warum auch immer, die auch nicht wissenschaftliche Beamtete wurden, wurden über Nacht mit oder ohne Übergangsphase pragmatisiert.
Ich behaupte, es gibt viele Institute, die von unten bis oben zubetoniert sind, und ich betone: im wahrsten Sinne des Wortes zubetoniert. Ein neu berufener Ordinarius, der Institutsvorstand wird, hat keine Chance, am Institut irgendetwas zu verändern. Heute ist ein guter Satz gefallen, der auch sehr merkenswürdig war, nämlich: Mit dem Dienstrecht, mit dem UOG in der Hand und dem Dienststellenausschuss im Rücken kann man ein Institut kaputt machen. – Ich denke, das geht sehr leicht, wenn man es nur will, und ich behaupte: Es gibt mehr als genug, die das wollen! Und: Der Institutsvorstand hat keine Chance, etwas dagegen zu machen, er kann es nur verzögern. Zumindest macht ihm das das Leben nicht leichter.
Ich selbst weiß deswegen, wovon ich rede, weil ich ein zwangspragmatisierter Mittelbau-Angehöriger bin. Ich musste 1988 um die Pragmatisierung ansuchen, oder etwas später. Hätte ich das nicht getan, wäre das einem Ansuchen um Kündigung gleichgekommen. Ich war stets ein Gegner der Pragmatisierung, war aber gezwungen, darum anzusuchen. Das ist für mich persönlich katastrophal gewesen, aber auch für den Institutsvorstand, weil er gezwungen war, jemanden zu pragmatisieren oder eben zu verlieren. Er konnte nicht einmal erreichen, mich sozusagen als normalen, kündbaren Mitarbeiter behalten zu dürfen. Nunmehr soll sich das ändern, und zwar ganz massiv.
Ich bin Chemiker. Ich liebe die Chemie, ich liebe das Institut und meinen Job, bin aber auch Systemerhalter. Ich arbeite eigentlich seit fünf Jahren daran, eine neue Forschungsrichtung zu implementieren, aber man kommt praktisch nicht zum Forschen. Es gibt einige andere, die dieses Schicksal mit mir teilen. Wir haben Großgeräte für zig Millionen Schilling angeschafft, die betreut werden müssen. Das kann kein Diplomand, kein Dissertant machen, das muss jemand machen, der eingeschult ist und sich auskennt.
Ich will daher der Regierung und jenen, die Gutes für die Universität wollen – sprich: die Reform durchziehen wollen, und zwar so schnell wie möglich; ich hoffe, dass sie keinen Schritt zur Seite weichen –, mit auf den Weg geben, auf jeden Fall zu berücksichtigen, dass Universität nicht gleich Universität ist. Es gibt die Naturwissenschaften, und es gibt die Geisteswissenschaften. Die personellen Erfordernisse dieser beiden Forschungsrichtungen sind völlig unterschiedlich. Wenn ich von Großgeräten spreche, dann weiß ein Naturwissenschafter, was gemeint ist; ein Geisteswissenschafter glaubt vielleicht, dass ein PC oder bestenfalls eine Workstation damit gemeint ist.
Ich meine, dass Sie bei weiteren Verhandlungen sehr wohl berücksichtigen sollten, dass Systemerhalter in dem von mir angeführten Sinn insbesondere im Bereich der Naturwissenschaft notwendig sind und massiv gebraucht werden und dass sie im Gegensatz zu dem, was ich heute auch schon gehört habe, unbedingt laufend in Lehre und Forschung eingesetzt werden müssen. Das sind keine technischen Assistenten, die Großgeräte betreuen, sondern sie sind seit Jahren in Forschung und Lehre integriert.
In einer APA-Meldung von heute hieß es: Gewerkschaft enttäuscht und entsetzt über die gestrigen Verhandlungen. – Dazu muss ich ehrlich sagen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass diese hoch qualifizierten Mitarbeiter keine Universitätslehrer mehr sein sollen. Sie sind vollwertig in Lehre und Forschung eingesetzt, nur eben keine Habilitanden. Das muss man berücksichtigen, das ist der Ist-Zustand. Auf jeden Fall möchte ich der Regierung und denen, die damit zu tun haben, ein „Glück auf!“ wünschen und ein „Ho ruck!“ (Beifall.)
16.12
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Nächster Redner ist Herr Dr. Pöhl. – Bitte.
16.12
Rektor Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pöhl (Montanuniversität Leoben): Herr Bundesminister! Herr Vorsitzender! Das letzte Wort war: „Glück auf!“ Das passt gut zu mir, denn ich komme aus Leoben. Leoben wurde heute schon ein paar Mal erwähnt, einmal negativ. (Univ.-Prof. Dr. Zelewitz: Das war nicht negativ, nein!) 2,4 Millionen Schilling pro Studierendem wäre negativ! Ich habe nachgerechnet und muss sagen: Diese Zahl stimmt Gott sei Dank nicht. Die tatsächliche Zahl ist allerdings auch zu hoch, denn zwischen 1,6 und 1,8 Millionen Schilling pro Absolvent in den letzten vier Jahren ist auch eine beachtliche Zahl, und wir danken, dass man dafür Verständnis hat. Ich möchte aber eines betonen: Unsere Absolventen sind auch sehr gute Steuerzahler, denn sie kommen meistens in sehr gute Positionen, und dann zahlen sie vieles von dem wieder zurück, was man ihnen vorher großzügig gegeben hat.
Vieles von dem, was ich sagen wollte, wurde von meinen Vorrednern, vor allem von Rektor Skalicky bereits vorgebracht. Es ist klar, dass auch ich voll zur Autonomie stehe, und es ist klar, dass ich zu Veränderungen stehe und so viel Autonomie wie nur möglich will! Ich kann das aus meiner Situation heraus sagen, aber, und auch das passt wieder zu den Ausführungen meines Vorredners, das ist natürlich auch sehr differenziert zu sehen. Man muss so ehrlich sein, zuzugestehen, dass die Situation der Montanuniversität oder der Technischen Universitäten eine ganz andere ist als jene von geisteswissenschaftlichen Studium, um hier die entgegengesetzten Pole anzuführen. Wenn das nicht beachtet wird, dann besteht die Gefahr, dass der Ruf an das Ministerium oder an den Staat kommen muss, dass es bei aller Autonomie nicht möglich ist, die Unis gänzlich den freien Marktkräften auszuliefern. Das könnte das andere Extrem sein, so wünschenswert es natürlich für die Entwicklung und Entfaltung der Universitäten auch ist, sehr stark in der Wirtschaft voranzukommen.
Warum ist das so notwendig? Ich glaube, das werden Sie selbst sehr rasch feststellen. Der Staat oder das Ministerium hätte es auch anders, hätte es sich auch leichter machen können. Sie hätten zum Beispiel sagen können: Da habt ihr das Globalbudget! – das wünschen wir uns alle; ich würde es mir sofort wünschen –, und wir machen einen Gleitmaßstab, die ersten zwei Jahre fix, dann Fixum/variabel, und dann Leistungsverträge – das würde vieles sehr rasch in Bewegung setzen –, und dazu noch die Personalhoheit.
Das würde ausreichen, um vieles in Bewegung zu bringen. Aber das wäre für viele Bereiche insofern eine Gefahr, als es für sie im Wettbewerb Probleme gäbe und sich für die technischen und sehr wirtschaftsnahen Fachrichtungen rasch ungleich größere Möglichkeiten auftäten, sich in eine Richtung, die neue Wissensgebiete vorgibt, zu entwickeln.
Das vorgestellte Reformvorhaben wirkt natürlich noch sehr „in den Raum gestellt“. Probleme ergeben sich daraus, dass es nicht in einer Form entwickelt wurde, wie das etwa in Unternehmen der Fall ist: Ein Unternehmen fängt mit einer Standortbestimmung an, entwickelt dann eine Strategie, und von dieser Strategie leitet sich dann der nachhaltige Erfolg ab. Das ist dann das, was man als Ziel darstellt, und diese Ziele verfolgt und erreicht man mit entsprechenden Maßnahmen.
Im vorliegenden Fall sind aus dieser Gesamtheit leider Detail-Mosaiksteine herausgegriffen worden: die Studiengebühr und das Dienstrecht. Die Studiengebühr hat eines gebracht, nämlich, dass endlich über die Universitäten gesprochen wird. Darüber bin ich sehr glücklich, denn ich war sehr unglücklich darüber, wie wenig Interesse der Universität im Grunde genommen von der Wirtschaft entgegengebracht wurde und wie wenig Interesse auch die Öffentlichkeit gezeigt hat. Ich habe versucht, in dieser Hinsicht sehr viel einzubringen, aber es war sehr, sehr schwierig. Nunmehr ist es gelungen, aber leider nicht ganz in positiver Form.
Ein wesentlicher Punkt vor allem im technischen Bereich ist gegenwärtig der Wettbewerb mit den Fachhochschulen. Generaldirektor Hochleitner hat die zur Entwicklung der Forschungsquote von 1,8 auf 2,5 Prozent erforderliche Zahl von zusätzlich 18 000 Forschern bereits angesprochen, und er hat gleich erkannt, die Frage ist: Wo ist das Potential? Das Problem der Montanuniversität und auch der Technischen Universitäten ist, dass wir viel zu wenige Studierende, das heißt Maturanten haben, die diesen Weg wählen. Sie nehmen lieber den kürzeren Weg und auch den der – in der öffentlichen Meinung – besseren Universität.
Wenn wir aber von Forschungskapazität sprechen, dann müssen wir von der Universität sprechen. Es ist also gegenwärtig ganz wesentlich – und das ist die Aufgabe, die wir haben –, darzustellen, was die Universitäten und was die Fachhochschulen leisten können. Es ist höchste Zeit, dass wir den Wert der Universität, der unbestreitbar gegeben ist und nach dem ja auch gerufen wird, gebührend hervorheben, denn die Technologie-Milliarden, die man investieren will, und die Forschungsaktivitäten, die sie auslösen werden, wird man mit Fachhochschülern nicht bewältigen können! – Danke. (Beifall.)
16.17
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Als Nächster spricht Herr Professor Gäbler. – Bitte.
16.17
Referent Univ.-Prof. Dr. theol. Ulrich Gäbler (Rektor der Universität Basel): Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte zwei Bemerkungen machen. Zunächst eine Bemerkung zum Verhältnis zwischen Universität und Industrie. Ich gebe jenen Recht, die sagen, es besteht hier eine Gefahr. Tatsächlich besteht die Möglichkeit, dass Industrieinteressen in der Universität durchgesetzt werden. Es liegt allerdings an den Universitäten, ob diese Interessen durchgesetzt werden können.
Wenn Sie gestatten, dann gebe ich Ihnen zwei Beispiele aus meinem eigenen Erfahrungsbereich. Erstes Beispiel: Die Basler Pharma-Firma Roche hat uns eine Professur für Immunologie gestiftet und hat dafür 12 Millionen Franken überwiesen. Die einzigen Bedingungen, die daran geknüpft wurden, waren, dass wir eine exzellente Berufung machen, dass die Professur 20 Jahre lang besteht und dass wir jedes Jahr berichten. Es gibt keine weitere Bedingung, die an diese Professur geknüpft ist.
Ich kann Ihnen auch sagen, wie wir damit umgegangen sind: Wir haben diese 12 Millionen Franken in das Eigenkapital der Universität integriert und haben die Annahme getätigt, dass wir auf dem Kapitalmarkt jedes Jahr mindestens 5 Prozent generieren können. Die Universitätsleitung macht mit der Medizinischen Fakultät einen Leistungsvertrag, eine Leistungsvereinbarung, und stellt der Medizinischen Fakultät jedes Jahr 600 000 Franken für die Einrichtung einer Professur in Immunologie zur Verfügung. Was wir mehr einnehmen, geht ins Gesamtbudget der Universität ein, womit wir dann beispielsweise den Lehrstuhl für Ägyptologie finanzieren können. Die Firma Roche hat diesem System ausdrücklich zugestimmt, die Professur wird 20 Jahre lang „Roche-Professur“ heißen. Ob sie im 21. Jahr dann auch noch „Roche-Professur“ heißen wird, das sei dahingestellt.
Wir führen jetzt die Berufung durch, und ich habe mich an das Roche-Management gewandt und gebeten, sie möchten doch für die Berufung noch etwas hinzutun. Ich bin derzeit noch in Verhandlung mit der Firma Roche, ob sie für ihren eigenen Lehrstuhl noch zusätzlich etwas zahlt. – Das ist ein erfreuliches Beispiel; darin werden Sie mir ohne weiteres zustimmen.
Ein zweites Beispiel: An unserer Universität haben wir eine ausgesprochen schlechte Situation in der Informatik – Sie werden es nicht glauben, aber auch in der Schweiz ist das Geld für Universitäten bisweilen knapp; die Eidgenössische Technische Hochschule ist in dieser Hinsicht ein weißer Rabe –, wir haben also einen Mangel an Informatik-Kapazität, wir möchten einen neuen Hauptstudiengang einrichten, aber es fehlt uns das Geld. Wir haben daher unsere Fühler ausgestreckt. Es gibt eine Stiftung, von der ich letzte Woche einen Brief bekam, und in diesem heißt es sinngemäß:
Die Stiftung ist bereit, 4 Millionen Franken für die Einrichtung eines Studienganges Informatik zu bezahlen. – Das sind umgerechnet zirka 40 Millionen Schilling. – Allerdings erwarten wir, dass die Universität ungefähr dieselbe Summe drauflegt respektive einwirbt. Außerdem erwarten wir, dass jemand berufen wird, der sich durch Erfahrung in der Industrie auszeichnet, und dass Sie uns informieren, wie die Berufungsliste aussieht. – Das ist eine Informationspflicht.
Nun, morgen in einer Woche werde ich mich mit dem Präsidenten und der Vizepräsidentin dieser Stiftung zusammensetzen und sagen, was für die Universität akzeptabel ist und was nicht akzeptabel ist. Das heißt, wenn wir von akademischer Freiheit an der Universität sprechen, dann ist das nichts Absolutes. Sie muss im Kontakt, in der Beziehung mit der Industrie jeweils neu eingelöst und bewahrt werden. Natürlich: Wenn solche Forderungen erhoben werden oder noch weitergehende, und wenn wir ablehnen, dann kann es passieren, dass diese Stiftung zu einer Nachbar-Universität im In- oder Ausland geht und wir keinen Hauptstudiengang Informatik einrichten können. Aber wir haben dann unsere Seele wenigstens nicht dem Teufel verkauft; und wie ein solcher Pakt ausgeht, ist Ihnen ja bekannt.
Zu meiner zweiten kurzen Bemerkung. Heute war bereits mehrfach von US-amerikanischen Universitäten die Rede; im guten wie im schlechten Sinne. Auf einen wesentlichen Unterschied zwischen einer guten amerikanischen Universität – mehrere Namen wurden genannt – und einer durchschnittlichen mitteleuropäischen Universität möchte ich gerne noch aufmerksam machen. Der wesentliche Unterschied besteht in der exzellenten Betreuung der Studierenden, weniger deswegen, weil man sie bei hohen Studiengebühren als Kunden auffasst, sondern weil Studierende als Partner und Partnerinnen der Älteren, der Dozierenden ernst genommen werden, weil man meint, dass man gemeinsam mit diesen jungen Menschen, die in die Universität kommen, etwas Neues schaffen kann.
Nach meiner tiefen Überzeugung darf bei allen Reformbemühungen dieses Ziel nicht aus dem Auge verloren werden. Es geht um junge Menschen mit ihren Fragen und Hoffnungen, mit ihren Erwartungen, um Studierende, die nicht nur studieren, weil sie mehr verdienen wollen, sondern weil sie wirklich auch Antworten bekommen wollen auf Fragen nach ihrem Leben, nach ihrem Lebenssinn, nach ihrer Zukunft. Und wir an den Universitäten müssen uns fragen, wie wir mit diesen Erwartungen und Hoffnungen der jungen Menschen umgehen. Ich frage mich, wie wir an den Universitäten damit umgehen; aber diese Frage lässt sich natürlich auch an die Politik stellen. – Danke. (Beifall.)
16.22
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Nächste Rednerin ist Frau Professor Dr. Hassauer. – Bitte.
16.23
Referentin Univ.-Prof. Dr. Friederike Hassauer (Universität Wien): Meine Damen und Herren! Ich möchte versuchen, zu zwei, drei Hauptpunkten kurz etwas zu sagen. Ein Hotspot in der Diskussion hier scheint Mitbestimmung versus Autorität zu sein. Ich habe den Eindruck, das Zerrbild, das hier aufgemacht wird, ist eine knackautoritäre Universitätsführung, die dann irgendwie auch noch die Peitsche schwingt. Warum man einen Text von mir bewusst missversteht und dann das Wort „Chefsache“ dafür verwendet, verstehe ich nicht.
„Chefsache“ bedeutet für mich das, was wir heute das Glück haben zu tun, nämlich auf einer Top-Prioritätenebene Wissenschaft zu verhandeln. Das war in vielen Ländern Europas lange nicht der Fall; da war das Bildungsministerium das Ministerium, von dem aus man, wenn man Minister oder Ministerin war, wirklich schnell die Flucht ins nächste Ministerium angetreten hat, weil das ein schlecht reputiertes, weiches Ministerium war. Mit Chefsache meine ich also, dass Bildung endlich zur Top-Priorität einer Gesellschaft erklärt werden muss.
Ich bin der Meinung, dass sich die Kollegialstruktur in der internationalen Hochschulvergleichsdiskussion als ein Modell herausgestellt hat, das nicht gangbar ist. Man hat lange Erfahrungen damit, und sie sind negativ. Es kommt zu klassischen Effekten, die in großen Studien beschrieben worden sind, wie Selbstblockade und so weiter. Und ich bitte doch diejenigen, die Erfahrungen vor Ort haben, zuzugeben, und die anderen, die sie nicht haben, zu glauben, dass es Zustände an Instituten gibt, die unvorstellbar sind.
Wenn Sie als Deutscher, noch schlimmer als Deutsche, in Österreich an ein Institut kommen und mit den bekannten 20-, 30-jährigen Kindergarten-Duzfreundschaften zu tun haben, dann ist das hoffnungslos! Ich habe es aufgegeben. Qualität wird niedergestimmt, und was mich daran besonders ärgert ist: Ich habe Top-Studenten, und zwar von den Einführungsveranstaltungen bis hinauf zur Forschungsgruppe und zum Forschungsverbund, aber es ist unmöglich, diese Leute zu platzieren. Ich habe es aufgegeben! Ich bin auch völlig unkokett und sage ihnen, es kommt überhaupt nicht darauf an, was ich sage. Sie müssen hier in diesem Land irgendwie zurechtkommen, einen Weg finden und sich einen Modus aushandeln.
Was auch immer hier nicht getan wird, ich kann nur sagen, das Rad der Geschichte wird über nationale Sonderwege hinweggehen, und im globalen Wissenschaftswettbewerb wird man es dann eben sehen. Ich persönlich würde mir eine andere Entwicklung wünschen, aber das liegt nicht in meiner Hand, und Consulting sollte man prinzipiell nur betreiben, wenn man gefragt wird. Insofern bin ich sehr glücklich, dass ich gefragt worden bin und hierher kommen durfte.
Was mich aber wirklich ärgert, ist diese Aufführung von Zerrbildern. Also: Mitbestimmung sein lassen, heißt nicht, dass ich mit der Knute regieren will, sondern dass es eben in allen möglichen Gremien, die man sich nur denken kann, eine studentische Anhörung gibt, dass ich aber nicht die Entscheidungsbefugnis über Peers an Non-Peers abgebe. – Das ist der eine Punkt.
Der andere Punkt: Ich halte es für logisch unordentlich, unsauber und unehrlich, daran Folgerungen anzuhängen – Schopenhauer nennt so etwas die „unehrliche Konsequenzmacherei“ – wie, dass es dann keine Lehrevaluation durch Studenten mehr gäbe. Ich bin 1983 in Berkeley evaluiert worden, da hat man hierzulande noch nicht einmal das Wort buchstabiert. Natürlich soll Lehrevaluation durch Studenten stattfinden und auch wiederum in weitere Beurteilungen eingehen. – Ich finde es also sinnlos, solche Alternativen aufzumachen.
Noch etwas zum historischen Punkt der „universitas magistrorum et scolarium“. Das hat natürlich seinen Haken. Das ist die berühmte Scholarenkonstitution von Roncaglia des Kaisers Barbarossa von 1158. Allerdings ist dieses Modell sehr schnell durch das Pariser Modell abgelöst worden, und das war die „universitas magistrorum“.
Als Kuratorin der VolkswagenStiftung möchte ich noch ein letztes Wort zu dem mehrfach geäußerten und mir sehr bekannten Vorwurf sagen, wir würden hier nur über Technikalitäten, Strukturen und Autonomie reden, und das wäre alles ganz grässlich, und wir müssten stattdessen über Wissenschaft reden. Die VolkswagenStiftung hat mit großer Besorgnis ihren klassischen Weg der Wissenschaftsförderung um den Preis von 25 Millionen D-Mark verlassen, weil sie der Meinung ist, dass klassische Lehr- und Forschungsförderung in der gegenwärtigen Situation, in der der Staat nicht dazu in der Lage ist und in der Ressourcenstreckung nicht stattfinden kann, nicht ausreicht, und dass man Strukturprogramme machen muss. Das war eine sehr gravierende Entscheidung. Ich kann Ihnen nur sagen: Glauben Sie nicht, dass man so etwas kostenneutral machen kann! Jeder Betriebswirt wird Ihnen sagen, dass ein Systemübergang von einem in den anderen Systemzustand kostenneutral nicht zu machen ist. Deswegen meine herzliche Bitte um absolute budgetäre Priorität für die Bildung als Zukunftsinvestition. (Beifall.)
16.28
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Nächster Redner ist Herr Professor Winkler. – Bitte.
16.28
Referent Univ.-Prof. DDr. Hans Winkler (Senatsvorsitzender der Universität Innsbruck): Frau Bundesminister! Meine Damen und Herren! Es gab zwei Anfragen, die ich beantworten möchte. Zur Frage, warum in Innsbruck und Leoben die Implementierung des UOG nicht gleichzeitig erfolgte. Die faktische Information ist: Das Gesetz hat vorgesehen, dass das in Tranchen geschieht. Ich würde aber auch vorschlagen, die Reformfreudigkeit zu evaluieren, indem man sich etwa ansieht, was Leoben aus dem UOG 1993 gemacht hat, und was in Innsbruck passiert ist. Ich bin gespannt, was dabei herauskommt.
Frau Abgeordnete Dr. Brinek! Zur „politischen Amnesie“: Bevor das zu einer neuen „Krankheit“ wird, die vielleicht als „Winkler-Syndrom“ in die Geschichte eingeht, möchte ich das lieber noch einmal authentisch interpretieren: Es ist politische Amnesie, wenn zum Beispiel eine Regierungspartei vergessen hat, dass etwas, was ihr jetzt nicht passt, von ihr damals mitbeschlossen wurde. Das wäre für mich politische Amnesie. Die kann ich nicht haben, ich kann keine politische Amnesie haben, denn ich bin kein Politiker. Ich kann allerdings subjektive Amnesie haben.
Das Angenehme ist nun, dass Sie mir vorwerfen, dass ich konsistent gewesen sei. Was gibt es Schöneres? Diesen Vorwurf habe ich ja nicht gemacht. Was heißt Konsistenz? Sie haben gesagt, ich hätte zum UOG 1993 das Gleiche gesagt. Sicher, das habe ich getan, und das war auch die einzig vernünftige Sache, und das hat sich inzwischen bestätigt. Ich habe gesagt, man muss die einzelnen Punkte evaluieren, also nicht ein großes Gesetz machen, sondern das, was gut läuft, beibehalten und das andere ändern. Das war damals leider nicht durchsetzbar, und das war schade, denn wir hätten uns einigen Leerlauf bei der Implementierung erspart.
Das Gleiche sage ich heute. Das ist zumindest etwas, worüber man sachlich diskutieren kann. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten. Schauen wir, was gut läuft! Zum Beispiel laufen Berufungsverfahren gut, die Mitbestimmung läuft an sich gut, und es läuft die Exekutive gut. Wir haben zu wenig Autonomie im Bereich des Budgets, darüber sind wir uns einig! Die wesentliche Differenz, die wir haben, ist, dass Sie nunmehr sozusagen global alles neu gesetzlich beschließen wollen, und wir dann wieder die gesamte Arbeit der Umsetzung haben. Mein Vorschlag wäre: Belassen wir das, was durch die Regierung und durch das Gesetz 1993 schon vernünftig umgesetzt ist, und bearbeiten dazwischen die Lücken. An sich unterscheiden wir uns also gar nicht.
Wenn ich dann noch sage: Nehmen wir uns die Zeit – und dem hat eben auch die Rektorenkonferenz zugestimmt –, das zu evaluieren, und machen wir im Herbst vor allem die Studienreform!, dann sind das doch an sich Dinge, über die man sich einigen kann. Die Erfahrung hat gezeigt – und das möchte ich Ihnen aus der Universität berichten –, dass die zu schnelle Umsetzung all dieser Sachen manchmal Emotionen erzeugt, die die Sache gar nicht verdient. Und wenn ich von außen sozusagen diesen netten politischen Rat bringe, dann nicht, um gescheiter zu sein, sondern nur, damit Sie ein faires Feedback haben, Frau Minister. – Sie ist nicht da? (Abg. Dr. Brinek: Ich sage es ihr schon!) – Ein Feedback, und zwar ein neutrales ohne böse Absichten, ist immer ganz gut. Und genau das habe ich im Sinn!
Zu Hoffmann-La Roche kann ich mich als Pharmakologe nicht enthalten, etwas zu sagen. Ob man „die Seele dem Teufel verkauft“, das hat man als Universität zum Teil in der Hand, vor allem dann, wenn die sonstige finanzielle Ausstattung ganz gut ist. Wenn es etwas knapp wird, dann wird man natürlich viel stärker induziert, die Seele zu verkaufen – das ist ein Faktum! –, man muss es nicht, aber der Druck wird stärker, doch es lässt sich sicherlich kontrollieren.
Bei meiner Tätigkeit bei der Zulassungsbehörde in London – drei Jahre als österreichischer Vertreter –, bei der es täglich um Entscheidungen in einer Größenordnung von 5 Milliarden gegangen ist, habe ich aber natürlich schon sehen können, wie anfällig die menschliche Seele für den Verkauf an den Teufel ist. Auf der einen Seite gab es die Zulassungsbehörde, vor allem sehr hoch stehende Beamte aus 15 Ländern Europas und auch einige Professoren. Auf der anderen Seite sind dann aber schon immer wieder auch Universitätsmitglieder gekommen, die offensichtlich mit ihrer Seele etwas unvorsichtig waren. So hat mir ein englischer Kollege einmal gesagt: Na ja, das, was er sagt, das muss er sagen. Er hat nämlich für den Abend 500 000 S bekommen. – Es gibt dieses Phänomen also (Abg. Dr. Brinek und andere: Unbestritten!), das ist unbestritten, und es ist eine Gefahr, darüber sind wir uns doch einig! Daher ist es auch so wichtig, dass die Universität in ihrer Grundstruktur vom Staat so ausreichend finanziert ist, dass sie sich nicht verkaufen muss, um weiter zu existieren. – Danke.
16.32
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Als Nächster gelangt Herr Rektor Bast zu Wort. – Bitte.
16.33
Referent Dr. Gerald Bast (Rektor der Universität für angewandte Kunst): Frau Abgeordnete Brinek, Sie haben mir eine Reihe von Fragen gestellt, und ich werde versuchen, diese zu beantworten. Wir kennen einander seit vielen Jahren, und ich schätze Sie wegen Ihrer Praxis, anhand von Fakten zu argumentieren, und wegen Ihrer Fähigkeit zur politischen Analyse. Deshalb bin ich auch zum Teil ein bisschen enttäuscht über Ihre Fragen. Aber lassen Sie mich beginnen:
Woher wissen Sie – haben Sie mich gefragt –, dass die Ausgliederung mehr Geld kostet? (Abg. Dr. Brinek: Dass den Universitäten weniger Geld bleibt, habe ich gesagt!) – Ich lade Sie ein, den vor kurzem vorgelegten Bericht – ich glaube des Rechnungshofes – über die bisherigen Ausgliederungen aus dem Bundesbereich zu lesen. Daraus geht klar hervor: Jede Ausgliederung hat in den ersten Jahren mehr Kosten verursacht. Diese Mehrkosten konnten zum Teil kompensiert werden, teils durch erhöhte Bundeszuschüsse, teils aus anderen Bereichen.
Sie brauchen auch nur jene Museumsdirektoren zu befragen, die bereits ausgegliederte Museen leiten. Auch sie werden Ihnen bestätigen: Ausgliederungen kosten Geld. Zum Teil wurde das vom Staat beglichen, zum Teil haben sie andere Quellen angezapft. Herr Direktor Pechlaner, den ich ebenfalls sehr schätze, hat unter anderem die Eintrittsgebühren des Schönbrunner Tiergartens innerhalb kürzester Zeit verdoppelt – und noch mehr! Ich weiß das, weil ich sieben Kinder zu Hause habe und die Preiserhöhungen leidvoll in der eigenen Tasche bemerkt habe.
Natürlich werden wir auch in Zukunft – wie wir das jetzt schon machen – versuchen, Drittmittel einzuwerben. Wir machen das jetzt schon! Zwei Beispiele: Wir haben gerade in diesen Tagen – wenn Sie uns besuchen, dann werden Sie es erleben – drei Tonnen Spanplatten von der Turnauer-Gruppe bekommen. Mit diesen Spanplatten wird unsere Bühnenbildklasse die Diplomarbeiten machen, Diplomarbeiten, die Sie ab 29. Juni im Museum moderner Kunst im Museumsquartier in unserer Leistungsschau begutachten werden können. Sie alle sind herzlich dazu eingeladen!
Oder: Wir haben eine Kooperation – auch ein aktuelles Beispiel – mit den ÖBB. Ab Herbst werden wir den in Umbau befindlichen Bahnhof Praterstern durch diverse Interventionen künstlerisch ausgestalten. Wir machen das also ohnehin! Allerdings ist jedem, der sich damit beschäftigt, klar, dass sich insbesondere in dem Bereich, in dem ich mich aufhalte, in dem es darum geht, zeitgenössische, experimentelle Kunst zu betreiben – das ist im Wesentlichen die Aufgabe der Kunstuniversitäten –, diese Möglichkeiten beschränkt sind.
Frau Abgeordnete Brinek, Sie haben mich auch gefragt: Woher wissen Sie, dass die Universitäten dann weniger Geld zur Verfügung haben werden? – Nun: Wenn die Ausgliederung mehr Geld kostet und nicht klar ist, wie diese zusätzlichen Kosten gedeckt werden sollen, dann ist klar, dass den Universitäten für ihre Aufgaben weniger Geld zur Verfügung steht. Sie sind doch Wissenschaftssprecherin! Ich lade Sie ein, hier zu sagen oder den Finanzminister dazu zu drängen, zu erklären, woher er das Geld nehmen und ob er es überhaupt zur Verfügung stellen wird.
Sie haben mich auch zu höheren Studiengebühren befragt. – Es war nicht ich, der das gesagt hat, sondern Rektor Hansen: 25 000 S. Auch der Herr Bundeskanzler hat im vorigen Jahr gegenüber Rektoren erklärt – das war noch vor der Einführung der Studiengebühren –: Na ja, wenn die Universitäten glauben, sie hätten zu wenig Geld, dann sollen sie eben die Studiengebühren erhöhen oder Studiengebühren einführen. – Das sind Fakten!
Oder: Zum Einfluss des Universitätsrates. Woher wissen Sie, fragten Sie mich, dass es politischen Einfluss über den Universitätsrat geben wird? – Frau Abgeordnete Brinek! Sie sind Wissenschaftssprecherin! Sagen Sie uns Ihre Vorstellung über die Zusammensetzung und die Funktion des Wissenschaftsrates! Derzeit sind wir zum Teil auf Vermutungen oder auf die Reaktion von Drittquellen angewiesen!
Sie zitieren das Beispiel Basel. Basel hat einen Universitätsrat, in dem drei Minister vertreten sind. Darauf sagen Sie: Na ja, so wird es nicht sein. – Sie zitieren das so genannte Schwarzbuch, in dem Expertisen zur Universitätsreform vorgelegt wurden; das wurde vom Wissenschaftsministerium finanziert. Darin steht klar und deutlich, dass der Universitätsrat aus Mitgliedern bestehen soll, die der Minister beruft, und dass die universitären Mitglieder ebenfalls zum Teil vom Minister bestätigt werden sollen. Uns wird dann zur Antwort gegeben: Na ja, so wird es nicht ausschauen. – Wie sollen wir da diskutieren?
Zum Schluss noch zur Frage nach den früheren Konzepten. Frau Abgeordnete Brinek! Ich schäme mich für nichts, was ich in meiner Funktion als Beamter des Wissenschaftsministeriums gemacht habe, weil ich das genauso professionell gemacht habe, wie ich jetzt meine Arbeit als Rektor einer Universität mache. Ich nehme Ihnen nicht ab, dass Sie nicht den Unterschied zwischen den Positionen einer Universität und eines Ministeriums wissen. Ich nehme Ihnen nicht ab, dass Sie nicht wissen, dass es hier auch unterschiedliche politische Positionen gibt, geben muss, auch geben soll und geben darf. Ich nehme Ihnen auch nicht ab, dass Sie den Unterschied zwischen der Funktion und der Stellung eines Beamten und jener eines Rektors, der seine Universität und die Interessen seiner Universität zu vertreten hat, nicht kennen. Sie wissen das! Aber ich nehme zur Kenntnis, dass Sie dieses Wissen offenbar auf dem Altar der Polemik ...
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Herr Rektor Bast, es tut mir Leid, aber Sie haben Ihre Redezeit schon lange überschritten. Bitte um den Schlusssatz.
Referent Dr. Gerald Bast (fortsetzend): Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam Gelegenheit hätten, die Reformvorstellungen, die ich heute skizziert habe, genauer zu diskutieren. – Danke. (Beifall.)
16.40
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Nächste Rednerin ist Frau Dr. Eisenmenger-Pelucha. – Bitte.
16.40
Dr. Andrea Eisenmenger-Pelucha (Universität Wien): Herr Dr. Unfried! Jetzt ist sie da, die „enttäuschte Gewerkschaft“: „Betonierer“, „nicht informiert“, „Altlast“. Habe ich heute auch das Wort „Filz“ schon gehört?
Darf ich mich vorstellen? – Eisenmenger-Pelucha, Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin an der Medizinischen Fakultät der Universität Wien, Vorsitzende der Bundessektion Hochschullehrer in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst.
Audiatur et altera pars – auch Gewerkschafter haben ein bisschen Bildung, vor allem, wenn sie im universitären Bereich tätig sind. Aus dem Selbstverständnis meiner Funktion heraus lassen Sie mich – und ich versuche, das ganz kurz zu machen – drei Punkte herausgreifen. Zu diesem Thema gibt es tausende, und wir alle haben sie tausendfach diskutiert.
Die Personalvertretung hat seit Anfang dieser Diskussion Ende vorigen Jahres etwas stets klar gesagt: Wir haben gesagt, wir wünschen uns zuerst eine Organisationsstruktur, damit wir wissen, wohin der Weg geht. Dann wollen wir wissen, wie das Budgetäre aussieht und was an Geld zur Verfügung steht, und dann können wir darüber sprechen, wie ein Dienstrecht da hinein gehört. So, habe ich mir sagen lassen, ist es eigentlich auch in privatwirtschaftlichen und anderen Bereichen üblich.
Nun haben wir aber ein Übergangsdienstrecht, und wir haben heute schon gehört, warum: Es soll Luft schaffen; Professor Marhold hat das gesagt. Es soll – noch verachtender, wie Frau Professor Hassauer das ausgedrückt hat – „Altlasten“ abbauen. Auch ich bin eine Altlast, nebstbei bin ich nicht pragmatisiert. Wir sprechen hier aber nicht von Luft und von Altlasten, wir sprechen von Menschen und von Individuen – von Menschen und Individuen, meine Herrschaften, die tagtäglich an den österreichischen Universitäten Großartiges leisten! Und ich denke, als Personalvertreter bin ich auch dazu verpflichtet, das wieder einmal in die Gedächtnisse der Leute zu rufen.
All das geschieht nämlich unter relativ schwierigen Bedingungen – wir haben das heute alles schon gesagt –: wenig Geld, relativ wenig Flexibilität, das ist schon richtig, und ich sage auch als Personalvertreter, mit Fehlern, die gemacht werden. Keine Frage: Dort, wo Menschen arbeiten, dort werden auch Fehler gemacht, und über diese Fehler sollten wir uns einmal den Kopf zerbrechen und schauen, wie wir sie verbessern können.
Wir wollen aber nicht zu lange über dieses Dienstrecht sprechen. Ich möchte nur als zweiten Punkt erwähnen: Natürlich bin ich als Gewerkschaftsvertreter unglücklich über diese Form, denn es ist ein neuer Ton in unserer Landschaft, dass wir in der Sozialpartnerschaft nicht mehr miteinander etwas fertig machen, um es dann hinaus zu bringen, sondern wir beginnen eigentlich, und versuchen, uns dann während irgendwelcher Geschehnisse doch noch zu einigen. Ich persönlich hoffe für die Sache, dass wir das schaffen. Die Vorgangsweise finde ich jedoch nicht richtig. Dass wir für die Kolleginnen und Kollegen, die wir zu vertreten haben, verpflichtend Zukunftsperspektiven auf allen Ebenen verlangen, und dass wir eine durchgängige Karriere, wie sie überall sonst möglich ist, ebenfalls verlangen, das, meine ich, ist nichts Bösartiges.
Lassen Sie mich noch etwas zur Autonomie sagen. Da stellen sich für mich schon ein paar Fragen. Wie viel Sicherheit haben wir in dieser Autonomie für die Freiheit der Wissenschaft und Forschung? Wie viel Sicherheit für Pressefreiheit, Redefreiheit? Ich verweise auf „Le Monde diplomatique“ vom 16. März dieses Jahres:
Amerika: Ein hochrangiger Professor der University of California, Berkely, beschreibt auf fünf Seiten die Übernahme – und so viel jetzt auch zum Einfluss der Wirtschaft und des Geldes auf Universitäten – mehrerer Midwest-Universities durch die Firma Nike. Als sich Studenten dieser Universitäten bei einer öffentlichen Veranstaltung dagegen ausgesprochen haben, dass die Firma Nike in Dritte-Welt-Staaten produziert, wo Kinderarbeit zugelassen ist, wurden die Gelder relativ rasch zurückgezogen. – So etwas sehe ich schon als Problem.
Da heute gefragt wurde: Warum Angst?, möchte ich betonen: Ich will die Sicherheit, dass die Universitäten gut bleiben, dass die technologienahen Fächer an den Universitäten bleiben, weil sie draußen keine bessere Situationen vorfinden, und ich will die Sicherheit für nicht technologienahe Fächer, damit sie die Chance haben, unser universitäres Gedankengut weiterzutragen.
Zu viel Unsicherheit führt nicht zu besserer Leistung, sondern zu Angst. Druck bringt keine Leistung, sondern Angst. Abhängigkeit bringt keine Leistung, sondern Aggression. Und ich denke mir, meine Herrschaften, wir werden lernen müssen, miteinander zu sprechen. Ich bin für Leistung! Jeder, der sich meine Publikationsliste anschauen will, kann das gerne tun. – Danke schön. (Beifall.)
16.45
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Nächster Redner ist Herr Martin Faißt. – Bitte.
16.45
Martin Faißt (Vorsitzender der Österreichischen Hochschülerschaft): Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Frau Bundesministerin! Erlauben Sie mir zwei kurze Vorgedanken.
Zum einen: Die österreichischen Universitäten sind nicht schlecht, sie sind gut. Die österreichischen Lehrer und Forscher sind gut. Und ich meine auch, dass die Studierenden gut sind. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich im öffentlichen Raum spreche, diesen Gedanken immer im Vorfeld meiner Rede zu äußern, weil ich das Gefühl habe, dass man die österreichischen Universitäten etwas unterschätzt und versucht, ihr Licht unter den Scheffel zu stellen.
Zweiter Vorgedanke: Österreich hat kein Öl, wir haben keine nennenswerten Kohlevorkommen, wir haben keine zu verschmutzte Umwelt, wir haben Gott sei Dank auch keine korrupte Verwaltung oder korrupte Politik, wir sollten uns also auf das konzentrieren, was wir haben, und das ist die Bildung – eine Bildung und eine Wissenschaft, die eine gute Basis haben müssen, um dieses kleine Pflänzchen, das wir derzeit haben, zu einem richtigen Baum wachsen zu lassen.
Ich habe mir im Rahmen dieser Enquete öfter die Frage gestellt: Was ist denn hier neu? Irgendetwas ist neu. Ich habe das Gefühl, es hat sich etwas geändert im Vergleich zu früher, und ich bin in der Mittagspause beim Würstchen draufgekommen, was es ist. Es ist neu, dass das Ziel eigentlich nicht mehr in Frage gestellt wird. Noch vor drei Jahren wurde ich geprügelt, als ich an der Universität gesagt habe, eine Universitätsreform muss her. Ich wurde geprügelt wie ein junger Hund, der gerade in die Küche gepinkelt hat und dem man jetzt zeigen will, wie es in der Welt läuft.
Heute ist es anders! Das Ziel ist klar: Es muss eine Universitätsreform her, und es gehört auch im Dienstrecht etwas verändert. Was natürlich unterschiedlich ist, ist die Antwort auf die Frage, wie man dorthin kommt. Aber das Ziel ist klar: Eine Universitätsreform muss her, eine Dienstrechtsreform muss her, und das finde ich sehr, sehr positiv.
Lassen Sie mich Ihnen jetzt wahllos einige Gedanken näher bringen, und ich bitte Sie, die Reihenfolge nicht als Prioritätenreihung zu sehen.
Ich denke, Autonomie ist eine Chance. Als Vorarlberger ist man es gewöhnt, möglichst viel selber zu machen und auf den Wasserkopf Wien zu schimpfen, der für alles verantwortlich ist, was nicht läuft, angefangen von den Steuern, die zu hoch sind, über die schlechte Politik, die gemacht wird, bis hin zum Bodensee-Schiff, das „Österreich“ genannt werden soll und nicht „Vorarlberg“.
Ich finde, dass die unteren Ebenen am besten entscheiden können, was für sie relevant ist, und dass man den unteren Ebenen auch die Chance geben muss, das zu tun. Das Ministerium, und das finde ich positiv, will sich zurückziehen, will ein Rahmengesetz erarbeiten, das aber kein Korsett sein soll, und dann die unteren Ebenen arbeiten lassen. Das ist notwendig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist notwendig, den Universitäten die Chance zu geben, für sich selber zu entscheiden, was wichtig und was weniger wichtig ist. Die Universitäten können das, glauben Sie mir das!
Zweites Thema: Mitbestimmung. Sehr verehrte Damen und Herren! Das eigentliche Problem ist nicht die Parität oder die Drittelparität, oder wer jetzt wo entscheidet, sondern ich glaube, wir haben andere Probleme. Das eine Problem ist, dass es zu große Gremien gibt, in denen sehr viele Leute mitbestimmen. Man könnte manches Gremium ohne Qualitätsverlust auf 25 Prozent reduzieren und hätte die gleichen Ergebnisse, allerdings mit vier Stunden weniger Diskussion.
Was es auch geben muss, ist eine klare Verantwortungsstruktur. Derzeit ist es so: Sehr viele Leute entscheiden mit, aber keiner will die Verantwortung übernehmen. Es gibt sozusagen viele Väter, aber keiner will die Alimente bezahlen. In Zukunft muss es anders sein. Es muss eine operative Ebene geben, das ist ein monokratisches Organ, eine monokratische Struktur, die das umzusetzen hat, was die strategische Ebene sagt. Es muss ganz klar sein: Die strategische Ebene gibt vor, eine operative Ebene, eine Person oder mehrere Personen, haben das dann umzusetzen.
Ein Gedanke noch zum Thema Evaluierung. Evaluieren, auswerten, wegschmeißen – das ist derzeit die Praxis. Die Evaluierung in der Lehre hat überhaupt keinen Stellenwert an den Universitäten beziehungsweise nur dort, wo sich Einzelne den Kopf darüber zerbrochen haben. Es gibt sehr gut funktionierende Beispiele: Ich darf die SOWI in Innsbruck herausgreifen, an der es gang und gäbe ist, dass die Evaluierung gemacht wird, allerdings ohne Konsequenzen.
Ein letzter, größerer Punkt noch: die Zugangskontrolle. Ich denke, der Staat überschätzt sich, wenn er behauptet, er könne sagen, was in nächster Zukunft gebraucht wird. Wir haben zwei gute Beispiele dafür, dass es nicht funktioniert. Wer hat uns denn vor fünf Jahren davor gewarnt, dass man 1999, 2000, 2001 viele technische Berufe zu besetzen, aber einfach keine Leute dafür haben wird? Wenn wir das vorausgesehen hätten, dann hätten wir jetzt genügend Informatiker, dann hätten wir genügend Ressourcen in diesem Bereich. Und wer hat die Juristenkrise 1995/96 vorhergesehen? – Niemand.
Ich hätte zum Schluss eine Bitte an die Politik, die ein bisschen abseits der Universitätsreform liegt, aber trotz allem sehr wichtig ist. Ich bitte, die Verordnung über die Rückerstattung der Studiengebühren an die ausländischen Studierenden möglichst schnell zu erlassen. Die Studenten warten darauf. 20 000 S im Jahr sind für jemand, der aus Osteuropa kommt, kein Klacks.
Ein Appell noch: Ich meine, wir müssen das hier (der Redner deutet auf Brust und Kopf) wirken lassen! Herz und Hirn sind gefragt, wenn wir eine Universitätsreform auf die Beine stellen wollen, die gut, die zukunftsträchtig ist. Und ich darf, da es hier im Hohen Hause üblich ist, auch mit etwas schließen, was sozusagen der „Kurier“ ein bisschen vorgegeben hat: Ein guter Tag beginnt mit einer ausgezeichneten Universität. – Danke. (Beifall.)
16.51
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Nächster ist Herr Michael Hausenblas. – Bitte.
16.51
Michael Hausenblas (Zentralausschusss der Österreichischen Hochschülerschaft, FLÖ): Sehr geehrte Damen und Herren! Als ich die Einladung bekommen und die Impulsreferate durchgesehen habe, habe ich mich schon ein bisschen gewundert, dass unter den ReferentInnen kein einziger Studierender, keine einzige Studierende zu finden war. Das ist irgendwie symptomatisch, und ich frage mich schon: Dürfen oder sollen wir keine Impulse setzen? Ich hätte mir doch erwartet, dass auch unsere Seite ein bisschen mehr mit Respekt und mit Ernst genommen wird. Dass ich trotzdem hier stehen darf, ist, obwohl dies heute sehr oft kritisiert worden ist, dem Prinzip zu verdanken, das es zum Glück noch immer gibt, nämlich, dass wir nach wie vor demokratische Strukturen an den Universitäten haben. Trotzdem hat es den Anschein, dass nach wie vor sehr oft über die Studierenden und über die Universitäten geredet wird, aber sehr selten mit ihnen.
Ein Plädoyer für eine demokratische Universität! Subsidiarität sollte eigentlich kein Fremdwort sein – nur leider sind die Damen und Herren, denen ich das an den Kopf werfen wollte, nicht mehr hier, aber für diese Damen und Herren ist es anscheinend ein Fremdwort. Für mich dagegen ist die demokratische Mitbestimmung vor allem auch der Studierenden an der Universität einer der Kernpunkte. Und wer sagt, dass das gegenwärtige System nicht demokratisch ist, dass es in irgendeiner Weise unhaltbar, untragbar ist, der kennt es entweder nicht oder hat ein grundlegendes Problem damit.
Was dafür spricht, kann ich auch kurz erwähnen, nämlich das lokale Know-how. Das, was vor Ort vorhanden ist, kann und wird zurzeit auch sehr effektiv ausgenutzt und ausgeschöpft, und das soll auch in Zukunft so bleiben. – Das war eigentlich alles, was ich zu diesem Thema hier in dieser Runde loswerden wollte.
Ich habe auch noch eine Bitte – und es betrübt mich schon, dass, wenn ich in die Runde blicke, gerade die Leute, die es betrifft, nämlich die Damen und Herren Nationalratsabgeordneten derzeit ein bisschen in der Minderzahl sind, da wir uns gegenseitig oder einem Rektor, einem Vorsitzenden oder wem auch immer die Sachlage nicht zu erklären brauchen. Bitte, nehmen Sie uns Studierende ernst und uns als Universität! Ich bin – und da möchte ich mich auch der Ansicht einer Vorrednerin anschließen – nicht ein Kunde, sondern ein Teil der Universität, und das ist auch gut so, und ich möchte es auch gern bleiben. – Danke schön. (Beifall.)
16.54
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Ich darf nur ergänzen: Die Experten, die heute hier sind, sind nicht da, weil die Universität eine demokratische Struktur hat, sondern weil die Fraktionen, die im Hauptausschuss vertreten sind, sie eingeladen haben. Darauf möchte ich hinweisen.
Als Nächster spricht Herr Mag. Öhlböck. – Bitte.
16.54
Mag. Johannes Öhlböck (Zentralausschuss der Österreichischen Hochschülerschaft, RFS): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Frau Bundesminister! Sehr geehrte Magnifizenzen! Sehr geehrte Damen und Herren Professoren! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte hier und heute meinen Beitrag zur Universitätsreform als junger engagierter Student bringen, und ein solcher erwartet sich von der heute zur Diskussion und Erörterung stehenden Universitätsreform vor allem eine Steigerung der Qualität der universitären Ausbildung.
Diese Steigerung der Qualität und in der Folge natürlich auch die Sicherung dieser Qualität sollen und müssen der Gradmesser für sämtliche dieser geplanten Reformen sein. Der große Reformschritt und damit auch die große Chance für die Universitäten und für uns Studenten im Speziellen ist die Entlassung der Studenten und der Universitäten aus der staatlichen Oberhoheit. Die Diskussion um die Studiengebühren ist dabei nur Teil dieser größeren Gesamtreform und darf nicht überbewertet werden.
Die Studiengebühren sind Mittel zum Zweck, und der Zweck heißt: Mitfinanzierung von vollrechtsfähigen, vom Staat unabhängigen Universitäten auf qualitativ hohem Niveau bei gleichzeitiger Wahrung des freien Zugangs zur Universität, dies natürlich bei gegebener Bereitschaft der Studierenden zu einer ansprechenden Studienleistung.
Eine Qualitätssteigerung kann jedenfalls durch die Einführung einer Studieneingangsphase erreicht werden. Dadurch soll die Zahl jener gesenkt werden, die die erforderlichen Fähigkeiten für ein akademisches Studium nicht haben. Der Student erhält dabei im ersten Semester einen Überblick über das Studium im Sinne einer Einführung, die für einen unschlüssigen Studenten mitunter auch eine Entscheidungshilfe sein kann.
Auch die Umstrukturierung des Dienstrechtes ist meines Erachtens im Zuge einer ganzheitlichen Reform unerlässlich. Die Pragmatisierung von Universitätslehrern verhindert die Verjüngung und die Erneuerung des wissenschaftlichen Personals und verschlechtert – oder hat Verschlechterungspotential für – Lehre und Forschung.
Das vom Ministerium vorgestellte Vier-Säulen-Modell scheint mir ein möglicher Weg in die richtige Richtung zu sein. Um aber dem Zweck der Reform, nämlich der Schaffung und auch Sicherung von Qualität gerecht zu werden, ist auf jeden Fall auch an eine zweckmäßige Form der Evaluierung zu denken und auch an eine Umsetzung dieser Evaluierung. Die im Moment praktizierte Form der Evaluierung, die, wie mein Vorredner bereits erwähnt hat, nur durch Studenten erfolgt, erfüllt diese Ansprüche nicht. Eine sinnvolle Evaluierung sollte, so wie im Wirtschaftsleben auch, durch die Kunden der Universität erfolgen, und das sind neben den auszubildenden Studenten – ich fühle mich als Kunde der Universität – auch der Staat und die Wirtschaft. Damit würde eine bestmögliche Besetzung von Planstellen erreicht, und eine Bewährung im Amt wäre die Voraussetzung, um wieder berufen zu werden.
Zur Studentenvertretung sei Folgendes angemerkt: Es stellt sich prinzipiell die Frage, ob Studierende eine gemeinsame Interessenvertretung auf Basis verpflichtender Mitgliedschaft überhaupt benötigen. Hierbei ist vor allem die Existenzberechtigung der Bundesvertretung der Österreichischen Hochschülerschaft zu prüfen, denn diese übt ein ihr nicht zustehendes, allgemeinpolitisches Mandat aus und geht nicht auf die Probleme der Studierenden ein. An die Stelle der bundesweiten ÖH könnten zum Beispiel Universitätsvertretungen treten, die durch freiwillige Beiträge finanziert werden. Diese Freiwilligkeit würde bewirken, dass sich die Fakultätsvertretungen nach den Bedürfnissen der Studenten richten müssten, um eine größtmögliche Akzeptanz unter eben jenen zu erreichen. Der Student kann somit selbst entscheiden, ob er mit seiner Vertretung zufrieden ist oder nicht.
Sehr zu begrüßen ist aus meiner Sicht die mit der Reform einhergehende Abschaffung der Drittelparität bei Besetzungsvorschlägen. Es ist nun einmal eine faktische Gegebenheit, dass ein in Ausbildung stehender junger Mensch nicht in der Lage ist, seriös über wissenschaftliche Qualifikationen von zu bestellenden Hochschullehrern zu urteilen. Dadurch wird die Möglichkeit unsachlicher Kritik geradezu eröffnet und Besetzungen hängen partiell von persönlichen Befindlichkeiten ab.
Abschließend lassen Sie mich noch bemerken, dass die vom Ministerium eingeleitete, breite, sachliche Diskussion – wir haben sie heute erlebt – rund um die Universitätsreform, mit Beiträgen aus allen beteiligten Kreisen des universitären Betriebes und auch der Wirtschaft, die größte Chance ist, die sich dem Wissenschaftsstandort Österreich zum Aufbruch in ein neues Jahrtausend der Information und der Kommunikation, vor allem aber in ein neues Jahrtausend der Wissenschaft als kommender wichtigster Ressource eines Landes seit langem bietet. Und ich wünsche – wie auch schon mein Vorredner – dieser Regierung Herz und Hirn und vor allem die Kraft, die angedachten Ideen durchzusetzen. (Beifall.)
17.00
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Nächster Redner ist Herr Dr. Riemer. – Bitte.
17.00
Dr. Gerhard Riemer (Vereinigung der Österreichischen Industrie): Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrte Frau Bundesminister! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Sieben oder acht Punkte zur heutigen Diskussion und zum Stand der Universitätsreform sowie dazu, wie die Wirtschaft und die Industrie das sehen.
Zunächst mein Dank – und das ist kein Lippenbekenntnis – für die offene Diskussion, die hier geführt wird, für die Enquete, für die internationalen Beispiele, die noch vielfach ergänzbar wären und sehr wichtig sind. Ein Dank auch an die Bundesregierung, die sich traut, ein paar Probleme, heiße Eisen – die Frau Ministerin würde „Herausforderungen“ sagen –, die wir seit Jahren kennen, auch einmal anzupacken, intensiv zu diskutieren und – einer meiner Vorredner hat das gesagt – es endlich einmal zumindest zu versuchen, mit aller Kraft daran zu arbeiten. Ich meine, dass es uns gelingen sollte, dass eine überlegte, notwendige Entscheidung vor einem österreichischen Kompromiss Vorrang bekommt.
Wir haben uns etwa auch beim UOG 1993 – und all jene, die daran mitgewirkt haben, wissen, wovon ich rede – manche Probleme eingehandelt, die auf diesen gemeinsamen Weg, der zu einem Kompromiss werden musste, zurückzuführen sind. Es geht nicht, wie manche heute gesagt haben, nur um Organisation, nur um Strukturen. Es freut mich als Wirtschaftsvertreter sehr, dass Internationalität so oft genannt wurde, dass Wettbewerb so oft genannt wurde, dass von der Effektivität der Ressourcen und von der Entwicklung des Humanpotentials so oft die Rede war. Es geht also vielmehr um den internationalen Wettbewerb, es geht darum, ob unsere hohen Schulen und Universitäten auch morgen noch die Leistungen zu erbringen imstande sind, die unsere Gesellschaft und die Wirtschaft – und wir wissen, dass das ein kleiner Teil davon ist – erwarten und brauchen, und es geht darum, ob wir einerseits die wichtigen Leute, die Topwissenschaftler nach Österreich holen können, ob wir dafür attraktiv genug sind und ob man sich andererseits im Ausland darum reißt, Topleute aus der österreichischen Wissenschaft zu gewinnen, ob man um sie wirbt.
Manche Wünsche, Anregungen, Sorgen erinnern mich sehr an Diskussionen in Unternehmen. Ich weiß, dass man Universitäten nur sehr bedingt und vorsichtig mit Unternehmen vergleichen darf. Da geht es um sichere Arbeitsplätze, um die hohe Motivation, die sich jeder wünscht – wir auch –, um die gute Bezahlung, um Entfaltungsmöglichkeiten und maximale Freiräume, und das alles bis zur Pension.
Meine Damen und Herren! Die Welt hat sich verändert, und mit Analysen aus dem Jahr 1982 und auch aus dem Jahre 1991 oder aus dem Jahre 1993 werden wir heute nicht weit kommen. Ich sage durchaus auch: leider! Es hat sich vieles völlig verändert, und man kann darüber diskutieren, ob das gut oder schlecht ist. Umzugehen mit Unsicherheit, Fähigkeiten zu entfalten, Potentiale auszuschöpfen und Wissen in einer Wissensgesellschaft zu festigen: Das sind unter anderem Forderungen der Zeit. In dieser Hinsicht kann man bei aller Vorsicht sehr wohl Universitäten mit Unternehmen vergleichen, wenn es um das professionelle Management geht, wenn es darum geht, Ressourcen möglichst optimal zu verwenden und Qualität und Leistung, die international mithalten können, zu verlangen.
Eine Bemerkung in eigener Sache, in der Sache der Wirtschaft: Wir wissen sehr genau, dass wir im Bereich der Ökonomie, der Naturwissenschaft und der Technik mehr mitreden dürfen und auch wollen, wir denken aber, dass die Geisteswissenschaften genauso wichtig sind. Wir wollen dort weniger dreinreden, aber dir Grundprinzipien Qualität, Effizienz und Leistung müssen dort ebenfalls stimmen.
Wir sehen keine echte Alternative zur autonomen Universität, und dafür brauchen wir ein flexibles Dienstrecht. Die Zeit erlaubt es mir jetzt nicht – vielleicht kann ich es später noch einmal nachholen –, auf die berechtigte Frage von Herrn Abgeordneten Niederwieser zur Personalpolitik in Unternehmen einzugehen.
Ich führe stattdessen die letzten beiden Punkte, die mir wichtig sind, noch kurz aus: Wenn Sie die europäischen Benchmarks verfolgt haben, dann werden Sie wissen, dass wir uns als Innovationsstandort im europäischen Vergleich – und da nimmt uns Europa das Benchmarking ab, wir brauchen nur die richtigen Zahlen zu liefern und darauf zu achten, dass wir mithalten können – zurzeit an neunter Stelle befinden. Wenn es uns gelingen soll – und das sollte ein Ziel der Bundesregierung sein –, auf den fünften Platz zu kommen, dann muss ich sagen: Das werden wir ohne attraktive Universitäten nie schaffen.
Daher denke ich, dass diese Universitätsreform zwar ein besonderes Anliegen dieser Regierung ist und sein muss, dass aber die Ergebnisse dieser Reform, egal ob sie gelingt oder nicht gelingt, jede weitere Regierung, jeder weitere Minister, jede weitere Ministerin zu genießen oder zu tragen haben wird. Deshalb hoffe ich – und die Frage zur Personalpolitik darf ich nachher persönlich beantworten –, dass diese Reform unter maximaler Berücksichtigung der Anregungen gelingt, aber nur als Kompromiss, der auch wirklich tragbar und für die Zukunft machbar ist. (Beifall.)
17.06
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Nächste Rednerin ist Frau Michaela Köberl. – Bitte.
17.06
Michaela Köberl (Zentralausschuss der Österreichischen Hochschülerschaft, LSF): Sehr geehrte Damen und Herren! Ich bin 22 Jahre alt, Jusstudentin in Wien und seit etwa zwei Jahren liberale Studentenvertreterin in der Österreichischen Hochschülerschaft. Ich rede daher aus der Sicht der Studierenden, ich vertrete sie und bin auch selbst davon betroffen.
Lassen Sie mich aber eingangs noch eines anmerken: Es wird von Autonomie und Unabhängigkeit der Universitäten gesprochen. Ich finde es paradox, dass sich Vertreter der Universitäten dagegen sträuben, unabhängiger zu werden. Ich finde es noch paradoxer, dass man Universitäten als Ebenen und sogar noch als untere Ebene des Ministeriums und infolgedessen auch des Staates bezeichnet. Wie ist das möglich? Ich finde es noch seltsamer, dass einerseits diese Aussagen gemacht werden, obwohl man weiß, dass die Regierung beziehungsweise der Staat in den letzten Jahren immer wieder Universitätsbudgets gekürzt hat, dass er willkürlich in die Budgets der Universitäten eingegriffen hat, und dass man andererseits jetzt Angst davor hat, mit der Wirtschaft zu kooperieren. Da sehe ich keine Verhältnismäßigkeit mehr.
Zum UOG 1993 – man verzeihe mir diese Aussage, sie ist wieder aus der Sicht der Studierenden getroffen –: Es mag wohl ein großer Schritt für den Gesetzgeber gewesen sein, aber es war ein sehr kleiner Schritt für die Studierenden und für die Universitäten. Das größte Problem der Universitäten sehe ich darin – und das zeigt sich vor allem an sehr großen Universitäten, wie zum Beispiel an der Universität Wien –, dass sie Massenbetriebe sind. In einem Massenbetrieb kann eine Universität nicht mehr funktionieren, es sind keine wissenschaftliche und auch keine kritische Auseinandersetzung mehr möglich. Im Wesentlichen läuft es dann darauf hinaus, dass man mit 100 anderen Studierenden in einer Vorlesung sitzt und sich aus einem Buch vorlesen lässt. Das kann es doch wohl nicht sein! Das ist sowohl für die Lehrenden als auch für die Studierenden frustrierend.
Nächster Punkt: die Einführung der „Studiensteuer“. – Ich bezeichne die Studiengebühren bewusst nicht als Gebühren, sondern als Steuer. Die Mittel gehen an das Finanzministerium, und es ist überhaupt nicht klar, wie sie wieder an die Universitäten zurückkommen sollen. Für bedenklich halte ich es auch, dass damit die Regierung den Universitäten oktroyiert, dass jede Universität von jedem Studierenden 5000 S einzuheben hat. Das ist meiner Meinung nach Sache der Universitäten! Ob sie Studiengebühren einheben wollen, sollen, müssen oder nicht, ist nach meinem Dafürhalten allein Sache der Universitäten, darüber hat der Staat nicht zu entscheiden.
Ich stehe Studiengebühren nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber, es müssen aber bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Im Wesentlichen geht es dabei um drei Bedingungen:
Erstens: Die Chancengleichheit muss für alle bestehen bleiben, es darf keinen finanziellen Numerus clausus geben, jeder Studierende muss das Recht haben, zu studieren, und dieses Recht muss er auch wahrnehmen können.
Zweitens müssen die Studiengebühren dazu verwendet werden, um die Studienbedingungen für die Studierenden zu verbessern. Das bedeutet eine Zweckbindung der Mittel. Studiengebühren dürfen nicht zum Stopfen von Budgetlöchern verwendet werden, sondern sollen den Universitäten und den Studierenden zugute kommen.
Drittens dürfen Studiengebühren nur dann eingehoben werden, wenn man dafür auch eine Gegenleistung bekommt. 5 000 S für nichts zu zahlen, ist unfair und ungerecht!
Ich sehe, die Zeit wird jetzt schon zu kurz. – Ich will noch einen Punkt zu den ausländischen Studierenden einbringen: Ich würde so weit gehen, zu sagen, jeder Studierende hat die gleichen Chancen und die gleichen Möglichkeiten zu haben. Ich halte es für sehr ungerecht, auf Grund der Herkunft von Studierenden zu sagen: Ihr müsst das Doppelte zahlen, und ihr zahlt den einfachen Betrag! Das halte ich für ungerecht. Ich möchte daher keine Verordnung über Studiengebühren und darüber, wer 20 000 S statt 10 000 S bezahlen muss. Wenn schon 10 000 S zu bezahlen sind, dann sollten alle 10 000 S zahlen und nicht Studierende herausgepickt werden, die das Doppelte zahlen müssen.
Last but not least sei mir noch ein Satz zur Frage der Mitbestimmung gestattet. Ich bin für eine Ausweitung der Mitbestimmung der Studierenden, vor allem in der Lehre, denn da müssen die Studierenden mitreden dürfen. Es betrifft sie direkt, und man bedenke auch, dass eine Ausweitung der Mitbestimmung der Studierenden mehr Reformen bedeutet, denn die Studierenden sind die Reformfreudigsten. – Danke. (Beifall.)
17.12
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Als nächster kommt Herr Dr. Bundschuh zu Wort. – Bitte.
17.12
Dr. Erwin Bundschuh (Vorsitzender des Universitätenkuratoriums): Herr Vorsitzender! Frau Ministerin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Abgeordneter Dr. Niederwieser, Sie haben an das Auditorium gerichtet gesagt, Sie würden gerne von jemandem aus der Wirtschaft hören, wie das dort sei und was die täten, und gemeint, die wollen doch auch die guten Leute behalten. – Ich habe mein ganzes Berufsleben in der Wirtschaft verbracht, ich durfte für einen Konzern in Italien zwei Firmen sanieren und war zum Schluss zehn Jahre Vorstandsvorsitzender der österreichischen Unilever. Ich denke, ich habe das ein bisschen erlebt.
Natürlich wollen auch die Unternehmen die guten Leute behalten, darüber besteht überhaupt kein Zweifel, und die tun auch sehr viel dafür, aber ich sage Ihnen auch, was die Unternehmen in diesem Zusammenhang nicht wollen: Die werden weder von vornherein versprechen, dass einer eine durchgängige Karriere hat, die werden nicht durch formale Bestimmungen den Weg nach oben sozusagen ein bisschen automatisieren, und die werden es nicht einmal dem jeweiligen Vorgesetzten zu leicht machen, dass er aus Gefälligkeit jemanden dorthin bringt, wo er seiner Leistung nach nicht mehr hingehört. Dieses System funktioniert meiner Ansicht nach nicht schlecht. Das heißt also, in der Wirtschaft ist eine durchgängige Karriere nicht ausgeschlossen, es gibt aber auch keine Rutsche, auf der man sich von selbst bewegt, wenn man sich einmal darauf befindet. Das halte ich für einen sehr wichtigen Grundsatz für das, was man bei den Regeln, die solche Dinge regulieren, berücksichtigen muss.
Ich finde die Panikmache fürchterlich, die jetzt angesichts dieses Modells losbricht, nach dem man sich nach gewissen Zeiten neu bewerben muss. Ich finde das „milder“ – unter Anführungszeichen – als in der Wirtschaft, denn dort müssen Sie sich Jahr für Jahr bewerben. Wir haben in der Wirtschaft keinen Vierjahreszeitraum und dann einen solchen von sechs Jahren und von sieben Jahren, sondern da werden sozusagen Jahr für Jahr Bewertungen gemacht – die werden besprochen, und daraus werden dann die Konsequenzen gezogen.
Darum halte ich die Panikmache für sehr unangebracht, wenn man jetzt sagt, wenn ein solches Modell an unseren Universitäten zum Tragen käme, dann würden plötzlich Tausende arbeitslos. Ich halte das für unangebracht, weil das doch hieße, dass wir viel zu viele haben, die nicht tauglich sind. Daran glaube ich nicht. Unsere Universitäten sind besser als dieses Zerrbild, auch wenn sie als Ganzes international gesehen nicht ganz so gut sind, wie wir manches Mal glauben! Ich bin aber auch sicher, würde das passieren, was behauptet wird, nämlich dass so viele Gute plötzlich ihren Job verlieren würden, dann würden die am nächsten Tag einen anderen finden, denn für gute Leute gibt es heutzutage in der Wirtschaft genügend Platz. Den Nachweis kann man leicht erbringen.
Ich finde auch die ganze Diskussion irgendwie eigenartig, denn wir sind uns doch alle darüber einig, dass Forschung, wissenschaftlicher Nachwuchs und eine entsprechend gebildete Jugend, die die Wirtschaft des Landes betreuen kann und auch im Ausland vielleicht etwas bewirkt, unwahrscheinlich wichtig sind. Der Konkurrenzkampf ist hart – das sehen wir heute.
Ich ziehe eine Analogie zum Sport: Was würden Sie sagen, wenn man in der Fußballwelt oder beim Skifahren eine durchgängige Karriere bis zur Nationalmannschaft garantiert bekäme? Da würden wir alle sagen: Die sind verrückt, das kann doch nicht funktionieren! (Abg. Dr. Niederwieser: Man wird niemand nach vier Spielen automatisch rausstellen, auch wenn er gut ist!) Dort ist aber auch völlig klar, warum wir nach ganz anderen Grundsätzen vorgehen, denn wenn man dauernd verliert, dann hat man offensichtlich ein Problem. Nur leider spürt man das Qualitätsproblem an der Universität, wenn sie nicht nach menschlichen, aber doch leistungsorientierten Grundsätzen ihre Personalpolitik gestalten kann, allzu lange nicht. Das ist die große Gefahr!
Abschlussbemerkung: Ich habe den Eindruck, wir sind in Österreich immer ganz groß, wenn es um die hehren, heiligen Prinzipien geht, da sind wir uns alle einig, wir sind aber noch größer, wenn es darum geht, im Detail dann genau jene Bestimmungen zu schaffen, die uns daran hindern, diesen Weg menschlich, aber konsequent zu verfolgen. – Danke. (Beifall.)
17.17
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Nächste Rednerin ist Frau Silke Petsch. – Bitte.
17.17
Dipl.-Ing. Silke Petsch (Vizedekanin, Universität für angewandte Kunst): Meine Damen und Herren! Ich bin von der Bundessektion 13 der GÖD nominiert, aber an der Universität für angewandte Kunst tätig. Ich habe mit ganzem Herzen und auch immer unter den Prügeln der anderen Kunsthochschulen das KUOG mitgetragen. Ich war in vielen Reformprozessen eingebunden, stehe zu diesem KUOG und bin auch dafür, dass die Kunsthochschulen dieses KUOG behalten. Warum? – Weil es uns ein hohes Maß an Autonomie bietet. Ich bin auch dafür, dass wir an den Kunsthochschulen das gängige und durchführbare Modell des Dr. Bast heranziehen, denn das bietet uns noch mehr Autonomie. Ich bin aber gegen eine Ausgliederung.
Ich bin auch gegen die Abschaffung der Mitbestimmung, denn diese – „ach so furchtbare“! – Mitbestimmung hat an den Kunsthochschulen hohe Bereitschaft zur Mitarbeit herbeigeführt, die wir bis jetzt nicht kannten. Alle Gremien sind mit hoher Bereitschaft mitgetragen worden, wir arbeiten jetzt mit hoher Bereitschaft an Studienplänen, die meiner Ansicht nach sehr gut und auch sehr zeitgemäß sind.
Gerade jetzt, da wir das Gesetz noch nicht einmal gelebt haben, wird den Kunsthochschulen gesagt: Ihr bekommt jetzt etwas anderes! – Das halte ich für den absolut falschen Weg. Bei der „Open Space“-Veranstaltung in Linz ist diese Ablehnung seitens der Kunsthochschulen sehr deutlich zum Ausdruck gebracht worden, und es ist die Frage an die Politik gestellt worden: Warum, bitte, tun Sie uns das an?
Ich frage das noch einmal: Warum tun Sie den Kunsthochschulen, die das KUOG noch nicht einmal gelebt haben, das an, nämlich dass schon wieder ein neues Gesetz kommt? Das ist unzumutbar! Das bestehende Gesetz bietet wirklich die Autonomie, die wir immer wollten, und ich wehre mich gegen Ausdrücke wie „Sündenfall der Mitbestimmung“ und „Knebelung der Universitäten“. Ich halte das für einen Schwachsinn. Meiner Meinung nach können solche Aussagen nur von Personen getroffen werden, die mit Mitbestimmung nicht umgehen können, die keine hohen Management-Qualitäten aufweisen.
Das wollte ich einmal zu Autonomie und Mitbestimmung sagen. Genauso, wie ich das KUOG mitgetragen habe, werde ich diese Vollrechtsfähigkeit voll und ganz ablehnen und auch bei jeder Gelegenheit darauf hinweisen, dass das der absolut falsche Weg ist – zumindest für die Kunsthochschulen. Das möchte ich wirklich einmal gesagt haben.
Ich sitze seit vier Monaten bei Dienstrechtsverhandlungen dabei, und aus meiner Sicht hat sich nicht sehr viel bewegt. Ich halte es auch für unzumutbar, dass man auf die Kurie des Mittelbaus hinunterschimpft und versucht, mangelnde Führungsqualitäten durch ein neues Dienstrecht zu kaschieren, nach dem man den Leuten nicht mehr definitiv ins Gesicht sagen muss: Liebe Herrschaften, ihr seid unfähig, wir können euch nicht brauchen! Das versucht man jetzt, durch befristete Verträge zu umgehen. – Ich meine, jeder Universitätsprofessor sollte auch ein hohes Maß an Führungsqualität mitbringen und auch bereit sein, seiner Mannschaft, wenn sie ausgewechselt gehört, zu sagen, dass er sie auswechseln wird, und nicht stattdessen nach einem neuen Dienstrecht schreien. – Danke. (Beifall.)
17.21
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Nächster Redner ist Herr Dr. Mikosch. – Bitte.
17.21
Dipl.-Ing. Dr. Hans Mikosch (Präsidium der Bundeskonferenz des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals): Sehr geehrte Frau Ministerin! Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Es sind jetzt leider nur mehr sehr wenige von den Referenten hier, aber dieser Hinweis auf die Lokomotiven und dass es unnötig sei, ein solches Institut zu haben, ist schon irgendwie aufreizend. – Ich denke doch, von Siemens hätten wir die Bestätigung bekommen, dass es moderne Thyristor-Lokomotiven gibt, also Elektrolokomotiven, und Diesellokomotiven gibt es sicherlich auch, nicht nur Dampflokomotiven.
Ich hätte dann auch noch eine Frage an Herrn Rektor Gäbler von der Uni Basel gehabt, und zwar wie es dort mit den Immobilien ausschaut. – Die Immobilien sind nämlich in einem siebenjährigen Prozess der Universität Basel zur Verfügung gestellt worden, und genau das schließt das Bundesimmobiliengesetz in Österreich fürs Erste aus.
Zu vielen Aspekten wurde auf die nordamerikanische Situation hingewiesen. – Vor einigen Monaten ist ein ganzseitiger Artikel in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ erschienen. In der redaktionellen Vorbemerkung dazu heißt es dort – ich zitiere –:
Ist nicht Amerika hier wie so oft mehr ein Symbol für das, was wir gerne hätten, als ein Wissen davon, wie es dort wirklich zugeht? – So ist es offenbar!
Dieser Artikel handelt ganz konkret von „tenure track“-Methoden und „tenure track positions“ im nordamerikanischen Bildungssystem. Siehe da: Es ist sogar in einem rein marktwirtschaftlich-wettbewerblich organisierten System wie dem nordamerikanischen Bildungssystem oder überhaupt im nordamerikanischen Wirtschaftssystem so, dass es dort „tenure track positions“ gibt, das heißt Sicherstellungen für Wissenschafter an Universitäten. Es gibt Universitäten, die diese „tenure track“-Position halten und auch mit großem Engagement verteidigen, weil das ein entscheidendes Kennzeichen von und ein entscheidender Beitrag zu vernünftiger wissenschaftlicher Arbeit ist.
Es ist wirklich nicht so, dass es im nordamerikanischen System nur ausgezeichnete private Universitäten gibt. – Wer das behauptet, der kennt sich vielleicht wirklich nicht aus. – Es gibt ausgezeichnete staatliche und schlechte private Universitäten in Nordamerika. Es ist also falsch, „ausgezeichnet“ und „privat“ zusammenzuheften.
Ein Gedanke: Es wird immer wieder gesagt, wir sollten eine offene Diskussion führen. Ich stelle mich diesem Anspruch der offenen Diskussion, stelle aber dann gleichzeitig auch verwundert fest, dass von manchen immer wieder, auch jetzt hier, gesagt wird, es gäbe zu dieser Reform keine Alternative. – Wenn jemand behauptet, es gäbe keine Alternative, dann würde ich zunächst einmal sagen: Das ist wissenschaftstheoretisch eindimensional, denn es gibt immer eine Alternative, nur muss man sich eben darüber Gedanken machen, welche Alternative man will. – Ich stelle zur Diskussion und verlange als Konzept eine Weiterführung beziehungsweise einen Ausbau einer demokratisch verfassten Universität als Alternative zu dem, was jetzt vorgeschlagen wird.
Es ist keine kulturpolitische Überhöhung, wie es jetzt manchmal dargestellt wird, wenn ich als kleiner Assistent immer wieder sage, dass es signifikante Eigenschaft jeder Universität war, dass sie immer ihre Rektoren selbst gewählt hat. Das ist ein Kennzeichen einer demokratisch verfassten Universität.
Es ist in sich widersprüchlich, Bildungsinstitutionen ähnlich führen zu wollen wie Aktiengesellschaften. Ich finde es auch widersprüchlich, wenn immer wieder gesagt wird – letzte Diktion –: Bildung ist unsere kommende wichtigste Ressource oder eben die wichtigste, wesentlichste Investition in die Zukunft. Alle realistischen Abschätzungen über die Auswirkungen der gegenwärtigen Konzepte laufen jedoch darauf hinaus, dass es zu einer Reduktion um 30 bis 50 Prozent bei den Studentenzahlen kommen wird und um 20 bis 30 Prozent beim Personal. Das soll dazu dienen, zusätzliche Aufwendungen, die sich aus der Umstellung von öffentlich-rechtlichen auf privatrechtliche Dienstverhältnisse ergeben, finanzieren zu können. – Ich fordere dagegen ausreichende staatliche Finanzierung im Hinblick auf Sach- und Personalaufwand statt Ausgliederung mit beträchtlichen Zusatzkosten.
Die entscheidende Motivation zum aktuellen Reformschub ist die Kürzung – „neudeutsch“ gesagt: „Deckelung“ – des Bildungsbudgets, und das ist maximal kontraproduktiv für die Aufgaben, die anstehen. – Danke. (Beifall.)
17.26
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Als Nächster spricht Herr Rektor Winckler. – Bitte.
17.27
Univ.-Prof. Dr. Georg Winckler (Präsident der Österreichischen Rektorenkonferenz): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Frau Bundesminister! Sehr geehrte Damen und Herren! Die Rektorenkonferenz und ihre Beschlüsse wurden heute schon öfter angesprochen, und ich erlaube mir daher, die Anliegen und die Beschlüsse der Rektorenkonferenz darzustellen und zu interpretieren.
Die Rektorenkonferenz spricht sich schon seit einigen Jahren für eine Neuordnung des Universitätssystems aus. Die erste markante Äußerung waren die so genannten Universitätspolitischen Leitlinien. Die Rektorenkonferenz geht aber davon aus, dass diese Reform eine politische Aufgabe ist, wie sie Kollege Marhold dargestellt hat, dass sie von der Politik breit getragen wird, dass sie nicht Gegenstand irgendeines parteipolitischen Hickhacks wird, sondern dass sie, auch weil Verfassungsbestimmungen zur Diskussion anstehen, eine Verfassungsmehrheit hier im Parlament findet.
Ich bin – und das möchte ich sehr deutlich sagen – skeptisch gegenüber dem Vorschlag, den Rektor Bast gebracht hat, über den Ausbau der Teilrechtsfähigkeit die Kritikpunkte am bestehenden Recht zu beseitigen. Das hängt damit zusammen, dass die Rechtsfigur der Teilrechtsfähigkeit hinsichtlich ihrer Außenwirkungen sicherlich problematisch ist und dass ein Ausbau der Teilrechtsfähigkeit zu einer hybriden, sehr bürokratischen Struktur an den Universitäten führen würde. Auch meine ich – was an den Universitäten sehr wichtig ist –, dass es nicht gelingt, die entsprechende Kostentransparenz herbeizuführen. Derzeit haben die Universitäten eine reelle Gebarung, eine zweckgebundene Gebarung, eine teilrechtsfähige Gebarung und darüber hinaus auch noch eine vom Staat erwünschte private Gebarung; ich denke da etwa an die FWF-Projekte, an die Ludwig-Boltzmann-Institute oder auch an EU-Projekte.
Das heißt, ich bin skeptisch. Ich meine, dass eine derartige Finanzierung der Universitäten außerhalb des Bundeshaushaltsrechts vielleicht angehen mag für das Budget der Universität für angewandte Kunst – das macht nicht einmal 1 Prozent der Budgetmasse der Universitäten aus –, aber insgesamt würde ich schon die verfassungsrechtliche Frage stellen, ob das nicht eine Derogierung des Bundeshaushaltsrechts ist. Dennoch ist das, meine ich, sicher zu diskutieren, und wir werden uns mit diesen Fragen in der nächsten Sitzung im Juni beschäftigen.
Entscheidend für die Position der Rektorenkonferenz sind die Beschlüsse, die Mitte Mai 2000 in Irdning gefasst worden sind, und diese 14 Punkte der Universitätsreform versuchen darzulegen, wie sich die Rektorenkonferenz und die Vorsitzenden der obersten Kollegialorgane die Weiterentwicklung der Universität vorstellen.
Diese 14 Punkte haben jedoch im Wesentlichen zwei Fragen offen gelassen: Die eine war die Rechtsformfrage, und die andere war die Frage der Ziel- und Leistungsvereinbarung, und deshalb kam es im November 2000 zu weiteren Beschlüssen, die diese Punkte konkretisieren sollten. Die Rektorenkonferenz hat dabei hinsichtlich der Rechtsform den Beschluss gefasst, dass es zu öffentlich-rechtlichen Einrichtungen mit unbeschränkter Rechts- und Geschäftsfähigkeit kommt, und die Rektorenkonferenz und die Vorsitzenden der obersten Kollegialorgane haben in diesem Zusammenhang festgestellt, dass von politischer Seite anzuerkennen ist, dass dieser Schritt mit Mehrkosten verbunden ist, die unter anderem durch eine bedarfsgeprüfte Startausstattung abzudecken sind.
Ich möchte in diesem Zusammenhang aber doch auch anführen, dass es für die Rektorenkonferenz und für die Vorsitzenden sehr irritierend ist, dass es zu einem Bundesimmobiliengesetz gekommen ist, gemäß dem die Liegenschaften der Universitäten an die BIG verkauft worden sind, obwohl gleichzeitig in den so genannten Transfolien vom 15. Dezember festgestellt wird, dass es zu Eigentumsübertragungen beziehungsweise zum Fruchtgenuss an den Liegenschaften im Zuge der Ausgliederung kommen soll.
Im Sinne von John Stuart Mill möchte ich sagen: Autonomie hat nicht nur eine rechtliche, sondern auch eine materielle Dimension, und ebenfalls im Sinne von John Stuart Mill ist darauf hinzuweisen: Wir brauchen Universitäten mit „independent means“, wie er sich ausgedrückt hat. – Das ist von entscheidender Bedeutung.
Abschließend darf ich noch darauf hinweisen, dass wir uns in der Plenartagung dieser Woche auch mit den Fragen der Ausgliederung – allerdings nur am Rande – beschäftigt haben. Wir haben festgehalten, dass sich die Universitäten zu Reformen bekennen. Wir haben außerdem festgehalten, dass die weiteren Beschlüsse der Rektorenkonferenz auf der Basis der bisherigen Beschlüsse gefasst werden. Wir haben darüber hinaus festgestellt, dass es selbstverständlich Evaluierungen geben soll, Evaluierungen der Reformen, die durchgeführt worden sind, denn die Universität muss sich doch auch selbst zum Gegenstand von Analysen machen. Wir haben schließlich auch festgehalten, dass es keinen Zeitdruck geben soll. Wir sind der Meinung, dass es eine gute Reform sein soll, aber nicht notwendigerweise eine rasche Reform. – Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. (Beifall.)
17.33
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Nächster Redner ist Herr Professor Dr. Lukesch. – Bitte.
17.33
Univ.-Prof. Dr. Dieter Lukesch (Universität Innsbruck): Frau Bundesminister! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin Augenzeuge und zum Teil „Mittäter“ jener Reformen, die in den neunziger Jahren hier im Hohen Hause gemacht wurden – egal, ob das das UOG, das Studiengesetz oder das Kunstuniversitätengesetz war. Ich hätte mich auch nicht zu Wort gemeldet, wenn ich mich nicht durch die Bemerkung des Kollegen Winkler und sein Wort von der „politischen Amnesie“ provoziert gefühlt hätte. Ich habe heute nicht politische Amnesie, jedenfalls nicht bei mir und den Verantwortlichen bemerkt, sondern ich habe einen Déjà-vu-Eindruck, ein Déjà-vu-Erlebnis nach dem anderen. Wann immer man über Reformen spricht, kommen zunächst eine Fülle von Bedenken und ein „man sollte doch“ oder ein „könnte man nicht“!
Ich möchte nur drei Punkte erwähnen. – Erstens: Das UOG 1993 war immer als ein erster Schritt in einem Reformprozess gemeint. (Abg. Dr. Brinek: So war es!) Damals schon hätten unsere Universitäten – und sie haben das auch gefordert – Globalbudgets, die vollkommene Verantwortung für mehrjährige Rahmenbudgets haben können, allerdings unter einer Voraussetzung: dass irgendwo die politische Verantwortung für das Geld des Steuerzahlers auch noch fühlbar wird, sprich: eine gewisse Mitsprache des Ministers bei der Auswahl des Führungsgremiums der Universitäten. Das wollte man damals nicht. Heute fordert man wieder Globalbudgets – es ist ein vernünftiger Weg –, aber bitte bedenken Sie: Die hier im Hohen Haus und auf der Regierungsbank sitzenden Damen und Herren sind dem Steuerzahler verpflichtet, und die müssen natürlich bei der Auswahl jener Personen, denen Sie Millionen und Milliarden anvertrauen, ein Mitwirkungsrecht haben.
Der Beweis, dass das UOG 1993 nur die Einleitung für die Reformen war, waren die Diskussionen um die vollrechtsfähigen Universitäten, die wir geführt haben – und Kollege Bast ist möglicherweise zu Unrecht direkt in die persönliche Verantwortung genommen worden –, die wir gemeinsam noch unter der alten Regierung diskutiert haben. Auch damals ist schon erkannt worden, dass die UOG-1993-Reform nicht weit genug reicht und weiter gehen sollte. (Abg. Dr. Brinek: Ohne Evaluierung!)
Der jungen Kollegin vom Liberalen Forum kann ich nur sagen: Ich war auch immer verblüfft, wenn ich Stimmen von den Universitäten hörte, die sich vor neuer und hinzuzugewinnender Freiheit fürchteten. Das Argument, das ich jetzt vom Kollegen Winckler gehört habe, beruhigt mich: Die Rektorenkonferenz fürchtet sich nicht vor der Autonomie, sie will nur entsprechende Rahmenbedingungen dafür haben.
Zweites Argument, und ich nehme das ernst, Herr Kollege Winkler: Die Reform der Reform, das Reformtempo ist zu schnell. Wir haben jetzt also in mühseligen Verhandlungen eine Satzung zusammengebracht, die dem UOG 1993 entspricht – ich konnte das ja mitverfolgen –, und jetzt müssen wir auch noch die Studienreform, die wir auch diskutiert haben, in Form der neuen Studienpläne umsetzen. Ich sage dazu ganz einfach – und das betrifft insbesondere auch die offenbar optimale Organisation der Universität vom Kollegen Bast –: Wenn Sie mit Ihrer Satzung effiziente, gute Strukturen als das innere Recht der Universitäten gefunden haben, wenn Sie in den Studienplänen eine moderne Ausbildung, die auch der vorgegebenen Zeit entsprechend absolviert werden kann, festgelegt haben, dann wird die autonome, die in Vollrechtsfähigkeit stehende Universität diese Strukturen selbstverständlich übernehmen. (Abg. Dr. Brinek: So ist es!) Sie hat keinen Anlass, diese Strukturen wieder abzuschaffen. Sollte aber der eine oder andere Kompromiss aus den heute schon zitierten Notwendigkeiten, die sich auch unter UOG 1993 ergeben, eingegangen worden sein müssen, dann kann man hier nachbessern und etwas tun.
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Mein drittes Argument richtet sich an den Kollegen Grünewald. Er hat gesagt, man solle die Vergangenheit nicht idealisieren, man solle aber auch die Zukunft nicht idealisieren. Man läuft – so darf ich ergänzen – Gefahr, im Nirwana zu argumentieren. Er schlägt vor, erst die Fehler des UOG 1993 und seiner Implementierung zu analysieren, also abzuwarten und dann erst den nächsten Reformschritt zu machen. Es gibt eine andere Methode – auch Kollege Winkler wird das durchaus wissen –: Das ist das heute schon erwähnte, internationale Benchmarking. Wir haben es von den Vertretern aus der Schweiz, aus Deutschland und von anderen gehört: Die autonomen Universitäten sind die Zukunft unserer Forschungs- und Universitätslandschaft und nicht die staatsgeleitete, nachgeordnete Einrichtung einer Ministerialbürokratie. (Beifall.)
17.39
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Als Nächste gelangt Frau Weinberger-Prammer zu Wort. – Bitte.
17.39
Anita Weinberger-Prammer (Österreichische Hochschülerschaft, GRAS): Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin auch in der ÖH tätig, und ich bin fraktioniert bei der GRAS, Grünalternative StudentInnen. Es graut mir, wenn ich als Studentin als „Kundin“ bezeichnet werde! Wir sind Teil der Universität, und als solcher Teil wollen wir auch mitgestalten und mitbestimmen. Mitbestimmung ist für uns einfach ein elementarer Bestandteil, ist ein extrem wichtiger Teil. Für uns sind demokratische Universitäten eine Eroberung, mit der nicht so leichtfertig umgegangen werden darf. Sind es nicht auch die Universitäten, die zur Aufgabe haben, der Gesellschaft auch ein gewisses Vorbild zu vermitteln? Streben wir nicht auch in der Gesellschaft eine Demokratie an beziehungsweise haben wir nicht eine Demokratie in der Gesellschaft?
Wenn Herr Dr. Rainer sagt, Studierende dürften Lehrveranstaltungen evaluieren, aber in Berufungskommissionen seien sie nicht erwünscht, so frage ich mich: Dürfen Studierende beziehungsweise der Mittelbau, der da angesprochen worden ist, nur noch Symptome lindern, aber nicht die Ursachen bekämpfen? Was ist das für eine Mitbestimmung? Beratung ist nicht Mitbestimmung! In den Gremien wird nicht nur über wissenschaftliche Publikationen geredet.
Zur angeregten Standortbereinigung: Ich weiß nicht, welches Bild hier in diesem Raum von Studierenden besteht. Herr Welzig meinte, es sei kein Problem, eine Fächerkombination in zwei Universitätsstädten zu studieren. Bitte, gehen Sie nicht davon aus, dass jeder Student, jede Studentin die finanziellen Ressourcen hat, einfach so in der Welt herumzugaukeln und einfach dort zu studieren, wo sie eben gerade sind. Oder sind Berufstätige, sozial Schwächere, Frauen beziehungsweise jetzt auch schon öfters Männer mit Kind nicht mehr so erwünscht an der Universität?
Liebe Frau Ministerin! Wenn Sie kritisieren, dass wir elf Chemie-Institute haben, dann darf ich Sie fragen: Sollten wir uns nicht zuvor einmal überlegen, warum es diese gibt? Dann würden wir uns eventuell entsinnen, dass andere Institute auf diese Institute zugreifen, dass diese Institute verschiedene Dinge forschen und lehren und dass eventuell diese Institute auch deswegen da sind, weil die Wirtschaft darauf zugreift. Wenn wir schon von Kooperation reden, muss das auch bemerkt werden.
Für uns ist es ein Ziel und ein Grundwert: Bildung muss für alle zugänglich sein! Diese Universitätsreform mitsamt den Studiengebühren verhindert dies. – Danke. (Beifall.)
17.43
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Nächste Rednerin ist Frau Korecky. – Bitte.
17.43
Karina Korecky (Zentralausschuss der Österreichischen Hochschülerschaft, KSV/Linke Liste): Sehr geehrte Anwesende! Auch ich bin Studierendenvertreterin, Mandatarin in der Bundesvertretung der Österreichischen HochschülerInnenschaft. Auch ich möchte mich dem Thema Mitbestimmung widmen. So, wie hier in der Diskussion den Tag über teilweise über Mitbestimmung gesprochen wurde, hatte es für mich den Anschein, als wäre eine tatsächliche Kurien- oder Gruppenuniversität in Österreich nie verwirklicht worden. So sehr wehren sich einige Lehrende nach wie vor gegen die Vorstellung, dass die von ihnen Belehrten in ihrem scheinbar ureigensten Refugium mitreden können. Anscheinend wehren sich auch etliche dagegen, selber mitreden zu können, denn was heute als Universitätsreform vorgestellt wurde, bedeutet unter anderem eine massive Entdemokratisierung der universitären Strukturen. Das ist ja schon mehrmals erwähnt worden.
Die bisherige Form der Mitbestimmung – auch das wurde bereits erwähnt –, vor allem die Möglichkeiten der Studierenden sind natürlich nicht das Gelbe vom demokratischen Ei, aber es ist wohl immer noch demokratischer als eine Steuerung durch so genannte Experten und Expertinnen, wobei ich übrigens neugierig bin, ob Frauen im Universitätsrat sitzen werden.
Als Ersatz für die Schlachtung der „heiligen Kuh“ Mitbestimmung, wie das so martialisch ausgedrückt worden ist, bekommen wir Studierenden mal lapidar und mal ziemlich beschwörend zu hören: Ihr seid Kundinnen und bezahlt, und der Kunde ist doch König. Wozu also noch rechtlich abgesicherte, umfassende Partizipation? – Das ist doch das, was da mitschwingt!
Studierende hätten ohnehin – und das wird uns mehr oder weniger laut unterstellt – keine Qualifikation für Gremienarbeit, und überhaupt wären die Gremien zu ineffektiv, schwerfällig und anstrengend. Aber – auch das ist erwähnt worden, und ich möchte es noch einmal unterstreichen – Demokratie ist anstrengend, was in diesem Raum eigentlich nicht extra betont werden müsste. Ich tue es trotzdem, denn einem Bild der Universität als Betrieb, dem favorisierten Aufsichtsratsmodell, das vielleicht bequemer in Sinne von Zeitersparnis wäre, möchte ich entgegenhalten: Der KundInnenstatus von Studierenden wird sich darin erschöpfen, dass wir zu zahlen haben. „Wer zahlt, schafft an!“ wird für uns nicht gelten. Außerdem habe ich auch noch nie gehört, dass KundInnen im Aufsichtsrat sitzen.
Was ist dann ÖH? Die Frage von Dagmar Hemmer ist nicht beantwortet worden: Wie soll ÖH-Arbeit aussehen? Ist das dann Lobbying in Sachen KonsumentInnenschutz?
Abschließend: Ich weigere mich, die zahlende Kundschaft eines Dienstleistungsbetriebes zu spielen. Ich möchte als gleichberechtigter Teil der Universität akzeptiert sein, das heißt, Demokratisierung statt Marktprinzip, Rücknahme der Studiengebühren und Aus- statt Abbau des freien Hochschulzugangs. – Danke. (Beifall.)
17.46
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Als Nächste spricht Frau Professor Winklehner. – Bitte.
17.47
Univ.-Prof. Dr. Brigitte Winklehner (Fachhochschulrat zur Anerkennung von Fachhochschul-Studiengängen, Universität Salzburg): Meine Damen und Herren! Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Frau Bundesminister! Ich bin Vizepräsidentin des Österreichischen Fachhochschulrates, aber auch Professorin an der Universität Salzburg. Ich bemühe mich an meiner Universität seit zehn Jahren um die Internationalisierung und habe vor fünf Jahren begonnen, das im Sinne der Rektorenkonferenz und auch des Ministeriums auf europäischer Ebene zu machen.
Zunächst einmal möchte ich ebenso wie der Vorsitzende der Österreichischen Hochschülerschaft ein Bekenntnis zur Qualität dieses österreichischen Bildungssystems abgeben. Wohin überall ich auch auf der Welt hinkomme, stelle ich fest, dass dieses österreichische Bildungssystem sehr angesehen ist, und zwar auf all seinen Ebenen. Es ist derzeit noch sehr angesehen, es soll aber auch international konkurrenzfähig bleiben. Ich denke, dass wir uns gewissen internationalen Trends mit Sicherheit in Zukunft nicht werden verschließen können.
Ich möchte mich dem anschließen, was schon von vielen gesagt wurde, nämlich, dass die Notwendigkeit einer Reform in den verschiedensten Bereichen heute klar ersichtlich ist. Wir brauchen einerseits mehr Handlungsspielraum für die Universitäten – das ist auch von Rektor Skalicky betont worden –, daher muss der Weg in Richtung Vollrechtsfähigkeit gehen. Wir brauchen ein modernes Dienstrecht, das auch internationale Mobilität und Zusammenarbeit ermöglicht und erleichtert. Änderungen im Dienstrecht werden seit langem diskutiert, und die Notwendigkeit dieser Änderungen steht für uns alle außer Frage.
Wir brauchen aber auch ein modernes Studienrecht, um auch international konkurrenzfähig zu sein. Ich würde allen empfehlen, den Blick auch etwas stärker nach außen, über die Grenzen zu richten. Wir haben heute Beispiele aus der Schweiz gehört, wir haben ein Beispiel aus Deutschland gehört. Ich möchte Sie auch darauf aufmerksam machen, dass international sehr viel in Bewegung ist und wir, wenn wir nicht bald agieren, Gefahr laufen, den Anschluss zu verlieren.
Das Problem der Studiengebühren ist auch hier heute mehrmals angesprochen worden, auch von den letzten Rednern und Rednerinnen. Schauen Sie doch bitte auch in dieser Frage nach außen! Wie viele Länder gibt es noch auf der Welt, in denen die Universitäten ausschließlich vom Staat finanziert werden? Es gibt sehr viel andere Finanzierungsmodelle, nicht nur, aber selbstverständlich auch Studiengebühren, und Studiengebühren kann man sehr wohl sozial staffeln. Außerdem haben wir in Österreich, meine ich, auch ein ausgezeichnetes Stipendiensystem sowie ein System, das den Studierenden heute internationale Mobilität leicht macht und ermöglicht.
Es sind heute einerseits die Notwendigkeit all dieser Reformen, andererseits die Geschwindigkeit derselben sehr oft angesprochen worden. Es wurde sehr oft gesagt, das Reformtempo sei zu rasch. Ich denke, dass wir möglichst bald voll handlungsfähige Universitäten brauchen. Wir brauchen dazu keine endlosen Diskussionen, denn diese werden mit Sicherheit auch nicht in der Lage sein, unterschiedliche Einzelpositionen, wie wir sie auch heute hier wieder vernommen haben, letztlich auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen.
Ich habe hier meine persönliche Meinung dazu geäußert. Ich möchte nicht verhehlen, dass es in jeder Universität äußerst unterschiedliche Positionen quer durch die Kurien gibt. Ich jedenfalls erwarte nicht, dass ein sehr langer Diskussionsprozess wirklich letztlich zu einheitlichen Meinungen in Bezug auf die Notwendigkeiten und die Geschwindigkeit dieser Reform führen wird. – Danke schön. (Beifall.)
17.52
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Als Nächste zu Wort gelangt Frau Abgeordnete Dr. Papházy. – Bitte.
17.52
Abgeordnete Dr. Sylvia Papházy, MBA (Freiheitliche): Herr Vorsitzender! Frau Bundesminister! Sehr geehrte Damen und Herren! Die heutige Enquete hat mich darin bestärkt, wie wichtig Eigenverantwortung, Marktorientierung, wie wichtig Kundennähe und Wettbewerb auch im universitären Bereich sind. Erst die Autonomie der Universitäten ermöglicht einen positiven Wettbewerb zwischen allen Universitäten, ob es jetzt öffentlich-rechtliche oder private Universitäten sind. Ich hätte Herrn Professor Gäbler gerne gesagt, wie gut mir sein Erfahrungsbericht über die Autonomie der Schweizer Universitäten gefallen hat, insbesondere, was die Stiftungsprofessuren anbelangt.
Was ich mir in Zukunft gerade für die Privatuniversitäten wünsche, ist ein tatsächlich gleichberechtigtes Nebeneinander von öffentlich-rechtlichen und von privaten Universitäten, zum Beispiel was die Akkreditierung neuer Universitäten anbelangt, was die Einführung neuer Lehr- und Studiengänge anbelangt und auch was steuerrechtliche Fragen betrifft.
Das Beispiel Schweiz hat für mich sehr schön gezeigt, dass die politische Kultur des Staates, so wenig wie möglich einzugreifen, sich gerade im universitären Bereich bewährt.
Sehr geehrte Damen und Herren! Diese Enquete war meiner Ansicht nach eine Bestätigung dafür, dass die Universitätsreform auf dem richtigen Weg ist. (Beifall.)
17.53
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Als vorläufig letzte Rednerin kommt Frau Kollegin Brinek zu Wort. – Bitte.
17.53
Abgeordnete Dr. Gertrude Brinek (ÖVP): Frau Bundesministerin! Herr Vorsitzender! Herr verbliebener Senatsvorsitzender! Meine sehr geschätzten Damen und Herren Ausharrenden! Nur zwei oder drei Stichworte: Ich muss in Abwesenheit des Rektors Bast auch nichts mehr hinsichtlich einer Klärung hinzufügen. Als authentischer Zeuge der UOG 93-Verhandlungen und -Interpretationen hat Dieter Lukesch schon alles gesagt, ich werde das aber auch noch persönlich richtig stellen.
Verzeihung, wenn ich nun Sektionschef Höllinger als Beispiel zitiere! So wie er ein persönlich überzeugter Verfechter der Vollrechtsfähigkeit war und ist – niedergelegt in eigenständigen Publikationen und Referaten –, ist auch Rektor Gerald Bast als Beamter ein glaubwürdiger Vertreter, ein Verfechter des UOG in seiner Reformbedürftigkeit gewesen. Das war es, woran ich ihn erinnern wollte.
Mitzunehmen versuche ich noch eines: Ich habe auch Probleme mit der Kunden-Metapher und mit dem Kunden-Beispiel. Professor Kellermann hat das auf die Gedanken-Ebene transitive versus intransitive Bildung geholt. Der Bildungsprozess in der korporativ strukturierten Universität ist immer einer, der von allen gestaltet wird und von dem beide Teile profitieren: Lehrer und Studierende; Lehrende und Forschende. Von dem, was sich im Kopf bewegt, profitieren beide und das bringen beide Teile hervor. „Der eine produziert, und der andere kauft“ gilt nicht für den Bildungsprozess. Dienstnehmerfreundlichkeit ist allenfalls die Perspektive, die damit gemeint ist.
Ich nehme weiters „Vertrauenskapital“ als wichtigsten Begriff mit – auch von Kellermann reklamiert – und beziehe ihn auf unseren weiteren Reformprozess, auf das Vertrauen, das ich in die Kompetenz der Universitäten selbst habe, was heißt, dass sie ihre Angelegenheiten in die eigene Hand nehmen müssen. Ich tue dies in Abwandlung eines Wortes des Pädagogen Herbart, das da lautet: Jünglinge müssen gewagt werden. – Ich sage: Reformen müssen gewagt werden!
Zum Schluss füge ich noch eine, wie ich hoffe, sympathische Mitteilung und Einladung an: Angesichts des schon ein bisschen abgeschmolzenen Gremiums, das wir sind, bin ich in der Lage, Sie alle zu dem kleinen Buffet, dass meine Fraktion vorbereitet hat, einzuladen, und zwar in die Räumlichkeiten des ÖVP-Klubs im zweiten Stock. Sie alle sind herzlich zu dem, was wir teilen wollen, eingeladen. – Danke. (Beifall.)
17.56
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Martin Graf: Ich danke Frau Kollegin Brinek für diese großzügige Einladung.
Es ist niemand mehr auf der Rednerliste eingetragen. Daher schließe ich nun die Debatte.
Ich möchte mich bei allen Teilnehmern dieser Enquete ganz herzlich bedanken, insbesondere bei jenen Teilnehmern, die es geschafft haben, vom Anfang bis zum Schluss durchzuhalten. Das war eine sehr große Leistung.
Ich möchte an dieser Stelle auch nicht verabsäumen, hier zu sagen, dass es uns gelungen ist, in diesem Hohen Haus, dem man sehr oft vorwirft, dass hier in diesem Saal unsachlich argumentiert werde, einen ganzen Tag lang ein Thema auf äußerst sachlicher Ebene zu behandeln. Wir haben – wie auch schon in der Vergangenheit – sehr viele Anregungen, Expertenmeinungen mitgenommen. Es war eine wichtige Veranstaltung zur Unterstützung aller Abgeordneten. Ich danke der Frau Bundesminister, dass sie ebenfalls von Anfang bis zum Ende dieser Debatte beigewohnt hat, bei den Ministerialbeamten, die mitgeholfen haben, diese Enquete vorzubereiten, bei den Parlamentsbediensteten im Hause, die auch für unser leibliches Wohl gesorgt haben. Haben Sie alle Dank!
Diese Enquete wird nicht der Schlusspunkt der Behandlung dieses Themas sein, sondern es wird in diesem Hohen Haus noch sehr viel über die Universitäten gesprochen werden, hoffentlich auch in der medialen Öffentlichkeit. Eines ist sicher: Es gibt von Tag zu Tag mehr, denen das Wohl der Universitäten am Herzen liegt – und das kann nur gut sein. (Beifall.)
Damit erkläre ich diese Enquete für geschlossen.
Schluss der Enquete: 17.58 Uhr
|
Wiener Zeitung Digitale Publikationen GmbH 740 705 |