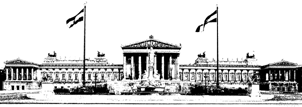
„Zur Zukunft der
Europäischen Union –
Reformen nach dem Vertrag von Nizza“
Parlamentarische Enquete
Mittwoch, 20. Juni 2001
(Stenographisches Protokoll)
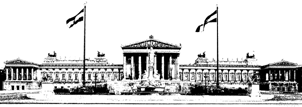
„Zur Zukunft der
Europäischen Union –
Reformen nach dem Vertrag von Nizza“
Parlamentarische Enquete
Mittwoch, 20. Juni 2001
(Stenographisches Protokoll)
Gedruckt auf 70g chlorfrei gebleichtem Papier
Parlamentarische Enquete
Mittwoch, 20. Juni 2001
(XXI. Gesetzgebungsperiode des Nationalrates)
Thema
„Zur Zukunft
der Europäischen Union –
Reformen nach dem Vertrag von Nizza“
Dauer der Enquete
Mittwoch, 20. Juni 2001: 9.04 – 13.41 Uhr
*****
Tagesordnung
I. Die Europäische Union nach dem Vertrag von Nizza
Bundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel
Vizekanzlerin Dr. Susanne Riess-Passer
II. Eine klare Aufgabenverteilung zwischen der Union und ihren Mitgliedern
Univ.-Prof. Dr. Klaus Firlei, Universität Salzburg
III. Zur Stärkung der Demokratie in der Europäischen Union
Univ.-Prof. Dr. Sonja Puntscher-Riekmann, Österreichische Akademie der Wissenschaften
IV. Die Zukunft der Europäischen Union aus der Sicht des Europäischen Parlaments
David W. Martin, Vizepräsident des Europäischen Parlaments
V. Der weitere Diskussions- und Entscheidungsprozess zur Zukunft der Europäischen Union
Bundesministerin für auswärtige Angelegenheiten Dr. Benita Ferrero-Waldner
VI. Schlussfolgerungen
*****
I. Die Europäische Union nach dem Vertrag von Nizza
Bundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel ....................................................... 3
Vizekanzlerin Dr. Susanne Riess-Passer ...................................................... 7
Abg. Dr. Caspar Einem ............................................................................. 10
Abg. Dr. Werner Fasslabend ..................................................................... 13
Abg. Dr. Gerhard Kurzmann ..................................................................... 15
MEP-Abg. Johannes Voggenhuber ........................................................... 17
Abg. Dkfm. Dr. Hannes Bauer ................................................................... 19
Abg. Dr. Michael Spindelegger ................................................................. 20
Univ.-Prof. Dr. Helmut Schreiner ............................................................... 21
ao. Univ.-Prof. Dr. Alexander Somek ........................................................ 23
Univ.-Prof. Dr. DDr. h. c. Günther Winkler ................................................. 23
II. Eine klare Aufgabenverteilung zwischen der Union und ihren Mitgliedern
Univ.-Prof. Dr. Klaus Firlei ........................................................................ 25
Abg. Dkfm. Dr. Günter Stummvoll ............................................................ 29
Mag. Wolfgang Ilgenfritz .......................................................................... 30
Bundesrat Alfred Schöls ........................................................................... 31
ao. Univ.-Prof. Dr. Hubert Isak ................................................................... 32
Abg. Dr. Caspar Einem ............................................................................. 33
Dkfm. Dr. Erich Pramböck ........................................................................ 34
Univ.-Prof. Dr. DDr. h. c. Günther Winkler ................................................. 35
MEP-Abg. Dr. Marilies Flemming ............................................................. 36
III. Zur Stärkung der Demokratie in der Europäischen Union
Univ.-Prof. Dr. Sonja Puntscher-Riekmann ................................................ 38
Abg. Inge Jäger ........................................................................................ 41
Abg. Ing. Gerhard Fallent ......................................................................... 42
Abg. Wolfgang Großruck ......................................................................... 43
Abg. Dr. Evelin Lichtenberger .................................................................. 45
Abg. Dr. Gerhart Bruckmann .................................................................... 46
ao. Univ.-Prof. Dr. Alexander Somek ........................................................ 47
Univ.-Prof. Dr. DDr. h. c. Günther Winkler ................................................. 47
Univ.-Prof. Dr. Klaus Firlei ........................................................................ 49
MEP-Abg. Johannes Voggenhuber ........................................................... 50
IV. Die Zukunft der Europäischen Union aus der Sicht des Europäischen Parlaments
David W. Martin ........................................................................................ 51
V. Der weitere Diskussions- und Entscheidungsprozess zur Zukunft der Europäischen Union
Bundesministerin Dr. Benita Ferrero-Waldner ........................................... 57
Univ.-Prof. Dr. DDr. h. c. Günther Winkler ................................................. 59
VI. Schlussfolgerungen
MEP-Abg. Johannes Voggenhuber ........................................................... 60
Abg. Dr. Gerhard Kurzmann ..................................................................... 60
Abg. Dr. Michael Spindelegger ................................................................. 61
Abg. Dr. Caspar Einem ............................................................................. 61
Beginn der Enquete: 9.04 Uhr
Vorsitzende: Präsident Dr. Heinz Fischer, Dritter Präsident Dr. Werner Fasslabend.
*****
Vorsitzender Präsident Dr. Heinz Fischer: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf die vom Hauptausschuss des Nationalrates einstimmig beschlossene Enquete zum Thema „Zur Zukunft der Europäischen Union – Reformen nach dem Vertrag von Nizza“ eröffnen und Sie alle herzlich begrüßen. Seien Sie alle herzlich willkommen!
Parlamentarische Enqueten wie diese sind nicht vertraulich, sondern medienöffentlich, und wir haben – Ihre Zustimmung annehmend und voraussetzend – zugestimmt, dass auch das Fernsehen von dieser Enquete berichten kann.
Im Einvernehmen mit den Fraktionen mache ich noch folgenden Vorschlag für die Redezeiten, damit wir im vorgesehenen Zeitraum die gesamte Tagesordnung abwickeln können: Die Referenten sind gebeten, für ihre einleitenden Ausführungen eine Obergrenze von 15 Minuten vorzusehen. Die Diskussionsbeiträge in den anschließenden Debatten sollen auf maximal 5 Minuten begrenzt sein, wobei ich gebeten wurde, vorzuschlagen, dass nach den beiden ersten Referaten je ein Sprecher jeder Fraktion für eine Art Generalstatement eine Redezeit von 10 Minuten zur Verfügung gestellt bekommt.
Einwendungen dagegen liegen, nehme ich an, nicht vor, da das ja zwischen allen vier Fraktionen so vereinbart wurde. Ich werde daher so vorgehen und bitte um Verständnis, dass wir die Einhaltung dieser Redezeiten auch tatsächlich einmahnen werden.
I. Die Europäische Union nach dem Vertrag von Nizza
Vorsitzender Präsident Dr. Heinz Fischer: Der erste Diskussionsblock ist dem Thema „Die Europäische Union nach dem Vertrag von Nizza“ gewidmet, und ich bitte den Herrn Bundeskanzler, das Wort zu ergreifen. – Bitte, Herr Bundeskanzler.
9.09
Bundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel: Herr Präsident des Nationalrates! Herr Präsident des Bundesrates! Meine Damen und Herren! Ich freue mich sehr, dass diese Diskussion zustande kommt. Wir haben ja vor einigen Tagen, am 30. Mai, von der Bundesregierung initiiert, eine Diskussionsrunde mit etwa 60 Persönlichkeiten – es waren dies Vertreter der Höchstgerichte, der Sozialpartner, Ländervertreter und Vertreter der Wissenschaft – zum gleichen Thema gehabt, und ich finde es absolut gut und wichtig, dass wir eine breite Diskussion über die Zukunft Europas starten.
In Österreich gibt es – anders als in den meisten anderen europäischen Ländern – nicht die große Rede des Regierungschefs – wir brauchen nicht unbedingt einen Berg Sinai und Gesetzestafeln –, sondern wir versuchen eher, einen gemeinsamen diskursiven Prozess in Gang zu setzen, damit man gemeinsam nachdenkt, welche Elemente einer solchen Zukunftsdiskussion Sinn machen würden.
Das Spannende war, dass bei dieser fünfstündigen Debatte vor einigen Tagen eigentlich ein sehr großer Konsens in vielen Bereichen sichtbar geworden ist – die Redebeiträge wurden transkribiert; diese Arbeit ist mittlerweile abgeschlossen, und wir können daher bereits einige Exemplare, vielleicht auch den Fraktionen, zur Verfügung stellen –, und zusammen mit der heutigen Diskussion und der nächstwöchigen Diskussion im Bundesrat gibt es, glaube ich, einen sehr interessanten Startschuss für eine gesamtösterreichische Debatte.
Darf ich zugleich auch einige Grenzen und einige Akzente sichtbar machen, denn als einem, der jetzt über dreißigmal dem Europäischen Rat als Teilnehmer und Mitdiskutant angehört hat, sind mir dabei einige Dinge aufgefallen.
Ich finde, es stehen die institutionellen Fragen viel zu stark im Vordergrund. Ein Element in der Debatte, ein Element der Probleme, die Bürger mit den Institutionen Europas haben, liegt schon auch darin, dass wir vieles gar nicht mehr richtig kommunizieren können – Klammer: manchmal auch nicht wollen –, aber der entscheidende Punkt ist, dass durch das Tempo und durch die Komplexität der Prozesse vieles auch nicht mehr wirklich verständlich ist.
Wir haben 30 Jahre lang überhaupt keine Vertragsrevision in der Europäischen Gemeinschaft gehabt. In den letzten zehn Jahren – in dem Zeitraum, den ich selbst überblicke – gab es drei wichtige Vertragsreformen: Maastricht, Amsterdam und jetzt Nizza. Und bevor Nizza überhaupt noch ratifiziert ist – ein Land hat mittlerweile ratifiziert; ich glaube, das zweite folgt in dieser Woche –, führen wir bereits die nächste Zukunftsdebatte, die in die nächsten zehn, fünfzehn Jahre vorausgreift, und stellen Fragen, die natürlich nicht konsensfähig sind, wie etwa die Frage der Reduktion der Repräsentanz der Staaten zu einer Art zweiten Kammer oder die Finalität, die Frage einer europäischen Verfassung, wozu wir Österreicher eine durchaus positive Stellung hätten, während andere wie die Briten oder die Schweden aus sehr prinzipiellen und auch verständlichen rechtspolitischen Überlegungen Skepsis haben. Und dann wundern wir uns, wenn die Bevölkerung in den entsprechenden Ländern mit Sorgen oder mit Skepsis reagiert, denn sie sagt: Wenngleich dieses und jenes nicht im Vertrag von Nizza steht, so wird aber doch genau das diskutiert, was wir eigentlich nicht wollen oder was in dem einen oder anderen Land auf Skepsis stößt.
Unser Ansatz sollte daher sein – das könnte auch ein österreichischer Beitrag sein –, uns stark auf die Inhalte zu konzentrieren. Da ist ja auch vieles sehr positiv und konstruktiv weitergegangen: die wirtschaftliche Entwicklung, der Binnenmarkt, die Schaffung der Währungsunion, die natürlich auch erst jetzt mit Leben erfüllt und physische Wirklichkeit wird, die ganze Frage der Neuorganisation, der Neustrukturierung der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
Ich vertrete seit langem die These, dass die Säulenstruktur, die Säulenarchitektur letztlich überholt ist und irgendwann einmal vor allem die Fragen der ersten und zweiten Säule zusammengezogen werden sollten. Dann würden auch viele Doppelgleisigkeiten, die sich heute aus der Vertragsstruktur ergeben, beseitigt werden, dann hätten wir wirklich einen Vertreter Europas für die gemeinsame Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Man muss auch die umfassende Dimension all dieser Fragen besprechen und zu ihr stehen – ein Thema, das ja auch im Europadialog vor einigen Wochen von mir angeregt wurde und eigentlich auf eine sehr breite Zustimmung gestoßen ist.
Dazu kommen jetzt neu – vor allem über das Instrument der offenen Koordinierungsmethode – so genannte „soft issues“, die aber die Tagesordnung Europas immer stärker beeinflussen und prägen, wie etwa Erziehung, dieses Benchmarking, wo man sich aneinander orientiert und damit eine sehr interessante internationale Diskussion auslöst: Wo stehen wir? Wo müssen wir besser werden? In welche Richtung entwickeln wir uns? Da ist unter der schwedischen Präsidentschaft etwa das Thema „education“ besonders zu nennen, dazu gehören die Fragen der sozialen Standards, die jetzt vor allem unter der belgischen Präsidentschaft richtigerweise, wie ich meine, zur Debatte gestellt werden, oder auch die Frage der Kohärenz und Konvergenz in verschiedenen Altersvorsorgemodellen und die Gesundheitsversorgung. Alle diese Themen sind wichtig und sollten inhaltlich sehr stark in den Vordergrund gerückt werden.
Ein kleines Caveat: Man sollte aber auch Acht geben, dass nicht unter diesem an sich völlig richtigen und auch positiven Element der offenen Koordinationsmethode über die „soft issues“ auf einmal ein schrittweises Sich-Ausdehnen des Gemeinschaftsrechtes entsteht. Das war in der Lissabon-Strategie auch nie so gemeint. Das bleiben natürlich nationale Zuständigkeiten, die zwar europäisch diskutiert werden sollten, es könnte aber auch sein – und manche Tendenzen gehen dorthin –, dass man versucht, in diesem Bereich immer stärker zu vergemeinschaften.
Daher glaube ich, dass man Artikel 308 – früher Artikel 235 – jetzt gar nicht grundsätzlich in Frage stellen soll, der der Union das Recht gibt, auch Themen, die nicht vergemeinschaftet sind, prinzipiell dann zu regeln, wenn es Einstimmigkeit gibt. Es ist vielleicht zu weitgehend, das überhaupt in Frage zu stellen, aber es sollte rechtliche Sicherheiten geben. Vielleicht könnte die Diskussion um eine Kammer, um einen eigenen Senat im Europäischen Gerichtshof, der etwa Subsidiaritätsfragen, der die Frage der Abgrenzung der Rechtsakte stärker thematisiert, ein Gegengewicht sein. Auch das Einräumen eines Klagerechts für Regionen, für Länder oder auch für den Ausschuss der Regionen könnte ein Element sein, das in eine solche Richtung hinzielt.
Einige andere Anmerkungen, die sich aus meiner Sicht ergeben haben, zu Punkten, die derzeit in Diskussion sind: Vieles kann man ohne Vertragsreform machen, was die Union deutlich stärken und letztlich einen sehr positiven Impuls für unsere gemeinsame Arbeit darstellen würde. Dazu gehört etwa die ganze Frage der Effizienzstärkung der Ratsformationen – wir haben heute viel zu viele unübersichtliche Ratsformationen; ich glaube 16 oder 17; wir haben seinerzeit unter österreichischer Präsidentschaft versucht, das stärker zu clustern und zusammenzuführen, doch das ist nur halb gelungen –, dazu gehört die Frage der Reformen im Ratssekretariat. Das Abstimmen der Arbeit zwischen den verschiedenen Institutionen wie Kommission, Europaparlament und Ratssekretariat scheint mir noch lange nicht optimal gelöst zu sein. Ich glaube, dass man hier die Arbeit mit viel mehr wechselseitigem Respekt aufbauen sollte.
Das Sprachenregime ist ein ganz wesentliches Thema. Weniger auf der politischen Ebene, auf der das vielleicht eine Frage der prinzipiellen Identität ist, aber vor allem auf der Arbeitsebene wäre da unendlich viel zu tun, ohne dass man in die strukturellen Vertragselemente hineingehen muss.
Ich glaube, dass auch die Frage der Verteilung, der Lozierung der europäischen Institutionen ein Thema ist, das man einmal offen diskutieren muss, denn es ist bei dem Basarhandel, der gerade jetzt um diverse Agenturen ausgebrochen ist, dringend notwendig, sich einmal mit Fairness und mit Augenmaß anzuschauen, wo Europa sichtbar sein soll. Ich glaube, das soll nicht nur in Brüssel sein, sondern es ist schon auch eine gewisse Dezentralisierung anzustreben.
Ich meine übrigens, dass die halbjährlich wechselnde Präsidentschaft ein solches dezentrales Thema ist, das Sinn macht. Da könnte man auch vieles in Richtung einer Kooperation verschiedener Präsidentschaften, eines längerfristigen Themenkatalogs, eines Themenmanagements unternehmen. Ein etwa zweijähriges Tagesordnungsregime könnte hier helfen. Dieses Symbol „Europa ist vielfältig, boomt und ist dezentral“ scheint mir sehr wesentlich zu sein.
Man sollte durchaus auch sichtbar machen, dass die heutige Fokussierung auf wenige Standorte in der Union nicht unbedingt sinnvoll ist. Ich glaube, dass es schon auch ein Thema ist, darüber nachzudenken, wie Agenturen in Zukunft vergeben werden, wo sie angesiedelt werden, welche sachlichen Kriterien hiefür ausschlaggebend sind.
Ich habe zu der Frage Kompetenzen schon einiges gesagt. Hier ist aus österreichischer Sicht natürlich vor allem die Stärkung der Regionen nicht unwesentlich. Auch die Frage, wie man zu einem solchen Kompetenzkatalog oder zu einem Cluster – was soll wo geregelt werden? – gelangt, ist ein Thema, das uns heute wahrscheinlich noch sehr beschäftigen wird.
Ein Thema, das medial massiv und immer stärker in der Vordergrund rückt, ist die so genannte Europasteuer, also die Finanzierung Europas. Ich will mich hiezu nicht verschweigen. Ich glaube, dass hier auch ein sehr starker innerösterreichischer Mainstream sichtbar ist, nämlich eine Grundskepsis, dass jede Art von Europasteuer im Wesentlichen noch zu dem dazukommt, was heute schon an Steuerlast für die Bürger da ist.
Eine prinzipielle Skepsis ist wichtig, aber andererseits sollte man nicht von vornherein sagen, über eine solche Frage diskutiert man überhaupt nicht. Aber wenn so eine Diskussion stattfinden soll, möchte ich vorher von der Kommission Vorschläge sehen, wie denn so etwas aussehen kann, denn es sollte auf keinen Fall eine Konsumentensteuer sein. Man sollte darüber nachdenken, ob es europapolitische Anknüpfungspunkte für ein solches Finanzierungsmodell gibt. Über eine Kerosinabgabe wurde einmal diskutiert. Das ist ein Thema, über das man auch aus ökologischen Gründen durchaus einmal in einem internationalen Zusammenhang reden könnte.
Auch die Frage von Finanzdienstleistungen – Tobin-Tax wurde einst vorgeschlagen – wäre eine Sache, über die man schon nachdenken kann, aber mit sehr großen Warnlichtern. Es soll nicht zu einer zusätzlichen Belastung der Konsumenten, es soll nicht zu einer Erhöhung der Steuerlast insgesamt kommen. Deswegen glaube ich, dass unsere Bedenken, die wir auch in vielen Gesprächen mit anderen europäischen Politikern vorgetragen haben, durchaus interessant und wichtig sind.
Ein Thema, das mir im Rechtsrahmen sehr wichtig zu sein scheint – denn wir brauchen ja auch Dinge, die dem Bürger Europa nahe bringen, durch die er einfach auch physisch und konkret erlebt, dass es dieses Europa gibt und dass es ihm auch Rechte einräumt; dazu gehören der Pass, die Währung, die Flagge, die Hymne –, ist ein Recht, das es derzeit nicht gibt, nämlich ein individuelles, ausreichend fundiertes Klagerecht. Die Idee stammt vom österreichischen Richter Azizi, einem Richter erster Instanz. Ich finde, das ist ein Thema, das zu diskutieren Sinn machen würde und das man durchaus auch offiziell zur Debatte stellen soll. Das Problem heute ist, dass es natürlich schon auch ein individuelles Klagerecht – neben jenem der Mitgliedstaaten, des Rates und der Kommission – gibt, aber es muss der Bürger unmittelbar und individuell betroffen sein.
Der Europäische Gerichtshof und der Gerichtshof erster Instanz verfügen über eine umfangreiche Literatur von Fallbeispielen, die an sich hochinteressant sind – ich kann das jetzt auf Grund der Zeitenge natürlich nicht ausführen, aber da dieses Thema so interessant ist, habe ich mich ein bisschen eingearbeitet –: Da geht es etwa um Fälle wie die Kanarischen Inseln, um Elektrizitätswerke, Nachbarrechte – Greenpeace hat sich dagegen ausgesprochen –, um die Fischereiproblematik hinsichtlich der Treib- und Schleppnetze oder um den Export portugiesischer Kampfstiere nach Spanien. Immer sind absolut berechtigte Sachfragen abgewiesen worden, weil es nicht den unmittelbaren und vor allem individuellen Zusammenhang gegeben hat.
Wir haben in Österreich eine, glaube ich, sehr gute Rechtssystematik. Bei uns kann eben der Bürger direkt zu seinem Verfassungsgerichtshof gehen. Ich meine, dass gerade eine solche Frage die Europäische Union lebbar und spürbar machen würde. Es wäre daher eine hochinteressante österreichische Initiative, bei den kommenden Vertragsdiskussionen in diese Richtung hineinzugehen.
Natürlich soll – und damit will ich schließen – neben den institutionellen Fragen, die ja schon oft besprochen worden sind, jetzt vor allem auch die Frage der Beteiligung, der stärkeren Einbindung der nationalen Parlamente diskutiert werden. Ich sehe das nicht als Gegensatz zum Europäischen Parlament, wie das oft verstanden wird – je mehr sozusagen das Europaparlament gestärkt wird, umso schwächer werden die nationalen Parlamente und umgekehrt –, sondern ich glaube, dass man eine klare Arbeitsteilung zwischen den drei großen Blöcken Europaparlament, Kommission und Rat haben soll und dass die Beteiligung der nationalen Parlamente, die in Österreich institutionell ja ganz gut ausgeprägt ist, natürlich Sinn macht, dass man sich aber durchaus überlegen kann, wie weit dies im institutionellen Geflecht noch verstärkbar ist.
Ich würde mir wünschen, dass die österreichischen Parlamentarier dazu einiges mit einbrächten. Ich weiß, es ist auch hier in Österreich ein kontroversielles Thema, aber ich glaube, es wäre ganz klug, würden wir diese Frage offen und ehrlich ansprechen.
Was das Interesse der Bevölkerung an sich betrifft, meine ich, dass es insgesamt auch sehr wesentlich wäre, Themen anzusprechen, die zwar auch nicht im Vertragskontext stehen, die aber deutlich dazu beitragen würden – etwa Austauschprogramme, „Europa“ als schulisches Pflichtfach und viele ähnliche Dinge –, Europa viel stärker erlebbar und spürbar zu machen.
Das sind die Fragen, die wir diskutiert haben. Ansonsten glaube ich, dass man den behutsamen Weg, den wir gegangen sind, durchaus fortsetzen sollte, denn er macht Sinn.
Ich glaube auch, dass dieser Vertrag von Nizza, zu dem ich absolut stehe – ich will das hier auch ganz klar sagen – und der rasch ratifiziert werden sollte, um weitere Schritte in Europa gehen zu können, kein perfektes Dokument ist, aber eines, auf dem man aufbauen kann. – Herzlichen Dank. (Beifall.)
9.24
Vorsitzender Präsident Dr. Heinz Fischer: Danke vielmals, Herr Bundeskanzler.
Zu Wort gelangt nun Frau Vizekanzlerin Dr. Riess-Passer. – Bitte.
9.25
Bundesministerin für öffentliche Leistung und Sport Vizekanzler Dr. Susanne Riess-Passer: Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir sind in den vergangenen Wochen wiederholt damit konfrontiert gewesen, über die Medien verschiedenste Visionen über die Zukunft Europas zu hören. Es ist prinzipiell positiv, sich über die Zukunft Europas Gedanken zu machen. Ich glaube nur, wenn das im Sinne einer Marketing-Initiative geschieht, bei der im Wochenrhythmus Visionen präsentiert werden, die sich voneinander in irgendeiner Form unterscheiden müssen, ohne die Gemeinsamkeit oder die Basis dessen, was eigentlich im Mittelpunkt stehen sollte, zum Inhalt zu haben, trägt das eher zur Verwirrung und zur Verunsicherung der Bevölkerung bei. Und das hat auch Auswirkungen gehabt, über die hier noch zu sprechen sein wird.
Die Debatte über die Zukunft der Europäischen Union kann nur unter Einbeziehung derjenigen erfolgen, die diese Union am meisten betrifft, die sie eigentlich bilden, nämlich der Menschen in Europa. In diesem Sinne halte ich auch die heutige Veranstaltung für einen wesentlichen Schritt und sehe sie auch als Beispiel dafür, dass wir in Österreich einen anderen Weg gehen als andere Staaten, indem wir einen offenen Dialog führen. Wir haben ja schon eine solche Veranstaltung gehabt; der Herr Bundeskanzler hat darauf hingewiesen.
Wir haben gesehen, dass die Schwerpunktsetzungen im Sinne eines Kerneuropas, eines Gravitationszentrums, eines Machtzentrums, eines europäischen Direktoriums, einer europäischen Avantgarde, einen negativen Effekt gehabt haben, die Menschen negativ in ihrem Bewusstsein über das Fortschreiten oder die Zielvorstellungen der Integration beeinflusst haben und natürlich auch große Skepsis, großes Misstrauen und teilweise auch Ablehnung hervorgerufen haben. Ich glaube daher, dass es, anstatt im Wochentakt große Visionen zu präsentieren, wichtiger ist, hinzuhören, was die Menschen wirklich wollen. Denn die Sorgen der Menschen in Europa haben auch damit zu tun, dass die Organisation des Einigungsprozesses, der Integration in den vergangenen Jahren für sie nur schwer zu durchschauen war und ist und sie geringen beziehungsweise überhaupt keinen Einfluss auf den Weg, die Richtung und die Art und Weise der einzelnen Integrationsschritte haben. Das hat zu einer doch deutlichen Vertrauenskrise zwischen der Union und ihren Bürgern geführt, die wir ernst nehmen sollten.
Wichtig ist daher, dass Österreich in diesem Prozess eigene Zielvorstellungen entwickelt, und zwar in einem breiten Dialog – wie auch bei der heutigen Veranstaltung –, dass wir uns bewusst sind, dass europäische Gesinnung und Loyalität zu Österreich kein Widerspruch sind, sondern dass es eine Grundvoraussetzung ist, auch die Rolle Österreichs und den Entscheidungsspielraum Österreichs in einem gemeinsamen Europa klar zu definieren.
Die Zukunft Europas ist und wird immer auch eine Zukunft der Nationalstaaten sein, die auch weiterhin eine Schlüsselfunktion haben werden. Wir lehnen daher einen zentralistischen europäischen Bundesstaat, wie er in der Vergangenheit von manchen präsentiert wurde, ab, weil wir das für einen falschen Weg halten.
Die Aufgabenverteilung zwischen den Mitgliedstaaten und der Europäischen Union ist eine zentrale Frage. Das ist etwas, was schon vielfach, immer sehr punktuell anhand von Beispielen, diskutiert wurde, und ich glaube, dass das eine Grundsatzfrage ist. Das ist es, was man unter diesem Codewort „Post-Nizza-Prozess“ versteht. Aber ich meine, dass wir uns auch bewusst machen müssen, dass man in den Maastricht-Vertrag ein Wort hineingeschrieben hat, nämlich das Wort „Subsidiarität“. Dies geschah genau aus der Zielsetzung heraus, dass man die Notwendigkeit erkannt hat, zu klären und zu definieren, wie man Regelungen, Kompetenzzuteilungen finden kann, die sicherstellen, dass Entscheidungen möglichst nahe am Bürger getroffen werden. Mehr als dieses Wort ist allerdings nicht in diesen Vertrag hineingekommen.
Wir haben heute die Situation, dass wir eigentlich gerade in diesem Punkt keine Fortentwicklung haben. Das Wort „Kommune“ oder „Gemeinde“ kommt im Vertrag von Maastricht de facto überhaupt nicht vor. Das Wort „Regionen“ kommt zwar vor, ist aber nicht mit irgendwelchen konkreten Kompetenzzuordnungen erfüllt. Ich glaube daher, dass es ganz entscheidend ist, dass wir uns dieser Frage stellen.
Helmut Schmidt hat einmal vom „Kompetenzimperialismus“ der Europäischen Union gesprochen, der sich natürlich auch in vielfacher Weise ausgewirkt hat. Das ist nicht die Schuld des Europäischen Gerichtshofes, sondern das ist die Schuld von Verträgen, die völlig unverständlich, undeutlich und unklar formuliert sind und daher einen breitesten Interpretationsspielraum geben, der im Zweifelsfall immer zugunsten der Union ausgelegt wird.
Das heißt, eine Neufassung, eine Verständlichmachung, eine Klarstellung der Verträge ist auch eine Frage der Rechtssicherheit. Man muss darin den klaren Umfang von Kompetenzen beschreiben und darf sich auch nicht davor scheuen, in der einen oder anderen Frage zu sagen: Das kann man besser im nationalen oder regionalen Bereich als auf europäischer Ebene regeln. Das heißt, die Frage, wer was macht, ist auch unter diesem Gesichtspunkt zu sehen.
Die Gemeinsame Agrarpolitik ist zum Beispiel eine jener Fragen, von denen ich der Meinung bin, dass man sie unter diesem Gesichtspunkt neu überdenken sollte. Wir brauchen keine europaweite Kommandowirtschaft, sondern eher eine Rücknahme von verschiedenen Entscheidungen unter Berücksichtigung regionaler Besonderheiten und Erfordernisse. Wir brauchen mehr Entscheidungsfreiheit auf nationaler Ebene – auch im Bereich der Agrarpolitik.
Es gibt andererseits Bereiche, wo wir darüber nachdenken müssen, ob wir nicht mehr oder auch bessere Regelungen auf europäischer Ebene brauchen. Die Wissens- und Informationsgesellschaft ist schon erwähnt worden. Aber auch bezüglich der Frage der Sicherheit von Atomkraftwerken und der Schaffung einheitlicher Standards in diesem Bereich wäre eine Regelung wünschenswert. Da ist bisher zu wenig passiert. Die Bekämpfung der organisierten Kriminalität, des Schlepperunwesens, des Terrorismus – das alles sind Fragen, die wir auf europäischer Ebene gemeinsam klären müssen, genauso wie den grenzüberschreitenden Umweltschutz.
Die Rolle der nationalen Parlamente und deren verstärkte Einbindung ist von entscheidender Bedeutung. Österreich hat, so wie Dänemark und einige wenige andere Mitgliedstaaten, hier ohnehin einen weiteren Schritt als andere gemacht, aber ich denke trotzdem, dass wir uns auf europäischer Ebene bewusst sein müssen, dass die Einbindung der nationalen Parlamente ganz entscheidend ist.
Mir hat ein Vorschlag sehr gut gefallen, den Premierminister Juncker gemacht hat, als er jetzt in Österreich war. Er vertritt die Meinung, dass es dann, wenn bei Mehrheitsentscheidungen mit Mehrheit gegen einen Mitgliedstaat entschieden wird, ein Klagerecht des nationalen Parlaments geben sollte. Ich glaube, dass das auch festmacht, dass in so einem Fall nicht die Regierung, sondern das nationale Parlament betroffen ist. Ich halte das für einen sehr vernünftigen und auch zukunftsweisenden Vorschlag.
Darüber hinaus müssen wir uns auch überlegen, wie wir die Gerichtshofstruktur auf europäischer Ebene gestalten. Es gibt eine Reihe von Völkerrechtlern, die der Meinung sind, dass man einen eigenen Subsidiaritäts- oder Kompetenzgerichtshof haben sollte und eine klare Trennung zwischen dem EuGH als Wettbewerbsgerichtshof und einem Gerichtshof, der dort, wo es Unklarheiten gibt, über die Kompetenzfragen entscheidet.
Das gilt natürlich auch für die Frage des Ausschusses der Regionen oder überhaupt für die Stellung der Regionen. Es ist eine langjährige Forderung der Regionen, ein autonomes Klagerecht durchzusetzen. Wir haben – das ist auch so eine Geschichte – diesen Ausschuss der Regionen installiert. Er ist auch ein wichtiges Gremium, in dem es sehr gute Diskussionen gibt, aber ich habe in meiner Zeit im Europaparlament selbst noch erlebt, dass es als großer Fortschritt empfunden wurde, dass der Ausschuss der Regionen eigenständig Pressekonferenzen einberufen darf, denn nicht einmal das war bis dahin noch erlaubt. Sehr viel mehr als dieses Recht gibt es bis heute nicht. Doch ich glaube, wir müssen uns bewusst machen, dass man mit Feigenblättern der Subsidiarität oder der Betonung der Regionen das Vertrauen der Menschen nicht gewinnen wird, sondern dass wir diese Dinge auch mit Leben erfüllen müssen.
Die Rolle des Europäischen Parlaments beziehungsweise die Aufgabenzuordnung für das Europäische Parlament ist eine weitere entscheidende Frage. Ich glaube, dass wir uns bewusst sein müssen, dass das Europäische Parlament gerade in Fragen der Budgetkontrolle eine wichtige Aufgabe hat. Heute haben wir aber die Situation, dass das Europäische Parlament auf 50 Prozent des europäischen Haushalts mehr oder weniger überhaupt keine Einflussmöglichkeiten hat.
Die Stellung der Kommission: Sie darf keine zentrale europäische Regierung darstellen – ich sage das der Vollständigkeit halber, ich halte es an sich für selbstverständlich –, denn das wäre auch mit dem Gedanken der Gewaltentrennung überhaupt nicht vereinbar. Ich glaube aber, dass man sich überlegen sollte, nicht nur die Zahl der Kommissare – wie man das jetzt in Nizza gemacht hat –, sondern auch die Stellung der Kommissare, die Art und Weise, wie sie von den Mitgliedstaaten dorthin entsandt werden, zu überdenken. Es wäre auch eine vertrauensbildende Maßnahme gegenüber der Bevölkerung, wenn man zum Beispiel eine Direktwahl der Kommissare in Aussicht stellen würde, denn das würde das Vertrauen der Menschen und die personelle Bindung und Identifikation der Bevölkerung mit denen, die in Europa die Entscheidung treffen, herstellen.
Wichtiger als die Institutionen sind aber selbstverständlich die Inhalte. Dazu gehört die sicherheitspolitische Dimension Europas, die ich schon angesprochen habe, die umweltpolitische Dimension, aber auch die sozialpolitische Dimension in Fragen von Mindeststandards von Arbeitnehmerrechten. Wir haben in Europa, besonders in den Grenzregionen, eine Fülle von Missständen mit Leiharbeitsverträgen und ähnlichen Regelungen. Ich glaube, dass das Fragen sind, die man nur grenzüberschreitend unter Festlegung entsprechender Standards regeln kann, um die Probleme, die sich für die Arbeitnehmer daraus ergeben, zu lösen.
Solidarität innerhalb der Europäischen Union – Solidarität ist ja ein Grundpfeiler des gemeinsamen Europas – muss natürlich auch Solidarität in finanzieller Hinsicht heißen, das heißt Beitragsgerechtigkeit zwischen den Mitgliedstaaten. Aus österreichischer Sicht ist das nicht gegeben, denn wenn wir die Pro-Kopf-Belastung in Österreich mit jener in anderen Mitgliedstaaten vergleichen, ist festzustellen, dass wir unverhältnismäßig hohe Beiträge zahlen.
Ich glaube, dass wir es einfach unter dem Gesichtspunkt sehen müssen: Wie schafft man einen gerechten finanziellen Ausgleich innerhalb der Europäischen Union? Da darf man sich auch nicht davor scheuen, die heiklen Punkte der Förderungspolitik anzusprechen. Das betrifft die Agrarpolitik und die Agrarförderungen, das betrifft die Strukturförderungen, von denen wir seit Jahren wissen, dass die eigentlichen Zielsetzungen arbeitsmarktpolitischer Natur, die damit verbunden sind, nämlich Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, in vielen Bereichen nicht erreicht werden. Es gibt in regelmäßigen Abständen Evaluierungen durch den Europäischen Rechnungshof, der immer wieder zu dem Schluss gekommen ist, dass die Effektivität und die Zielorientierung in vielen Bereichen nicht erreicht wird. Das ist eine Frage, die man offen diskutieren muss.
Das gilt in gleicher Weise natürlich auch für den Kohäsionsfonds. Es stellt sich die Frage, ob es notwendig ist, an Mitgliedstaaten, die fit genug sind, Mitglieder der Währungsunion zu sein, noch Mittel aus diesem Kohäsionsfonds umzuverteilen, oder muss man nicht auch hier ehrlich sein und sagen: Hier müssen wir zu neuen Regelungen kommen.
Das sind wichtige Fragen, besonders im Hinblick auf die Erweiterung und die Ermöglichung der Erweiterung auch durch die Schaffung sicherer finanzieller Grundlagen. Ich weiß, dass das eine sehr schwierige Diskussion in Europa ist, dass man in Berlin unter sehr schwierigen Umständen einen Kompromiss erreicht hat, von dem wir aber alle wissen, dass er langfristig natürlich bei weitem keine finanzielle Grundlage für die Erweiterung darstellen kann.
Abschließend: Ich glaube, dass wir – und das ist ja auch Gegenstand der heutigen Konferenz – auch die Frage der Demokratisierung der Europäischen Union in den Mittelpunkt unserer Überlegungen stellen sollten. Das Demokratiedefizit der EU ist schon so eine Art Schlagwort geworden. Jeder bestätigt, dass es das gibt, und jeder sagt, wir müssen etwas dagegen tun, aber die konkreten Vorstellungen, wie man das machen soll, sind nicht sehr ausgereift.
Ich glaube, dass gerade das irische Referendum gezeigt hat, dass wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen und sagen können, das war ein demokratischer Betriebsunfall, der da passiert ist, sondern dass wir uns bewusst machen müssen, dass es hier eine große Skepsis gibt. Allein die Reaktionen auf das irische Referendum, die es teilweise gegeben hat, zeigen, dass diese Skepsis der Menschen in vielen Fällen zu Recht besteht.
Ich sage nicht, dass alle Motive für das Nein in Irland richtig waren, aber ich glaube, die Skepsis der Menschen gegen eine Union, die sofort nach dieser Entscheidung gesagt hat, sie bedauert das, aber das hat damit zu tun, dass die Menschen das eben nicht verstehen und dass das viel zu komplex ist, war berechtigt, und ich glaube, dass das eine falsche Reaktion der Union war. Wir haben fehlende demokratische Strukturen, wir haben zu wenig Informationen, und ich glaube prinzipiell, dass man überhaupt jede Frage der Union so kommunizieren sollte, als gäbe es ein Referendum. Damit wäre ein Zwang auf die Regierenden, auf alle politischen Verantwortungsträger, auf Abgeordnete und andere vorhanden, die Dinge – auch wenn das sehr schwierig ist – wirklich so darzustellen, dass die Menschen auch die Zielsetzung verstehen. Wenn man es nicht erklären kann, dann muss man die Entscheidung selbst hinterfragen, denn etwas, was man den Menschen oder den Bürgern oder den Wählern nicht mehr erklären kann, weil es angeblich so kompliziert und so komplex ist, muss von der Entscheidungsgrundlage her grundsätzlich hinterfragt werden.
Die EU ist nicht eine Sache von politischen Eliten, sondern eine Sache des Volkes. Volksentscheide über europäische Themen finden seit Jahrzehnten in Europa statt, und die Tatsache, dass die Bürger, wenn sie gefragt werden, immer öfter nein sagen, ist etwas, was uns zu denken geben muss. Man muss sich die Grundsatzfrage stellen, woran das liegt. Die Lösung kann jedenfalls nicht darin liegen, dass man die Entscheidungen sozusagen an der Bevölkerung vorbei trifft, sondern Fragen wie Integrationsfortschritte, Reformen, aber auch Erweiterungsschritte müssen so gut wie möglich vorbereitet werden, so gut wie möglich kommuniziert, dargestellt und erklärt werden, dann braucht man sich auch vor keiner Entscheidung der Bevölkerung zu fürchten. – Danke für Ihre Aufmerksamkeit. (Beifall.)
9.39
Vorsitzender Präsident Dr. Heinz Fischer: Danke, Frau Vizekanzlerin.
Diskussion
Vorsitzender Präsident Dr. Heinz Fischer: Wir gehen jetzt in die Debatte ein. Am Beginn hören wir Stellungnahmen der vier Fraktionen des Nationalrates. Ich bitte, die 10-Minuten-Vereinbarung einzuhalten.
Zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Dr. Einem. – Bitte.
9.39
Abgeordneter Dr. Caspar Einem (SPÖ): Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn wir heute hier bei dieser ersten Enquete, die uns helfen soll, die Position Österreichs zu der weiteren Entwicklung der Europäischen Union vorzubereiten, sprechen, dann sollten wir dabei zumindest versuchen, auch Lehren aus dem irischen Referendum zu ziehen. Ich will das nicht in aller Ausführlichkeit tun, aber ich denke, es sind zumindest drei Anmerkungen zu machen.
Erstens: Man kann sagen, dass, wenn alles gut läuft, die Menschen es im Allgemeinen als selbstverständlich nehmen. Irland ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass dort das, was die Solidarität Europas ausmacht, was Umverteilung, was Unterstützung jener Staaten ausmacht, die in ihrem Wohlfahrtsniveau noch den anderen nachhinken, gut gelungen ist und kombiniert mit einer sehr intelligenten irischen Politik auch zu sehr guten Ergebnissen geführt hat. Das wird von den irischen Bürgern ganz offensichtlich hingenommen und akzeptiert, aber an sich für den Normalfall gehalten.
Es gibt die zweite Seite, und die sollte uns nachdenklich machen. Die zweite Seite ist, dass es eine Skepsis der Bürger und Bürgerinnen gegenüber der Union gibt, die vielfach mit den Entscheidungen, die konkret zu treffen sind, gar nicht so direkt zu tun hat, aber bei solchen Entscheidungen hervorkommen kann. Mir scheint das auch in Irland der Fall gewesen zu sein. Das Grundproblem, das ich dahinter sehe, ist, dass es der Union und insbesondere den nationalen Regierungen nicht gelungen ist – sie haben es vielleicht auch nicht mit der gebotenen Intensität versucht –, die Union als ein Instrument der Politik darzustellen, das den Bürgern des eigenen Landes dient und nützt.
Das ist nicht gelungen, das ist in vielen Fällen vielleicht auch gar nicht versucht worden, und das führt dazu, dass die Gefühle der Bürgerinnen und Bürger der Union gegenüber mitunter von außerordentlicher Skepsis geprägt sind. Ich denke, dass es für die Skepsis und die Distanz der europäischen Bürgerinnen und Bürger gegenüber der Union aber auch noch zwei weitere, sehr konkrete Gründe gibt, und die sind der Anlass dafür, warum ich diese Frage am Anfang meines Statements anspreche.
Der eine Grund ist, dass die Bürger und Bürgerinnen spüren, dass die Union in den letzten Jahren oder überhaupt einen Schwerpunkt ihrer Aktivitäten gehabt hat und hat, der die Bürger jedenfalls nicht zum Zentrum ihrer Bemühungen macht. Die Konzentration der Europäischen Union darauf, einen Binnenmarkt, also wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen optimal gewirtschaftet werden kann, unter denen eine wettbewerbsfähige Industrie entstehen kann und Ähnliches mehr, sind Dinge, die zwar im Nebeneffekt auch für die Bürger da und dort Vorteile haben mögen, aber wo jedenfalls nicht das Wohl des einzelnen europäischen Bürgers, der einzelnen europäischen Bürgerin im Mittelpunkt steht. Und das spüren sie. Sie sind Nebeneffekt-Genießer, wenn es denn solche positiven Nebeneffekte gibt. – Ich denke, das ist der eine Grund.
Der zweite Grund ist, dass sich alle nationalen Regierungen angewöhnt haben, Brüssel – wie man so schön sagt –, die Europäische Union schuldig werden zu lassen für all das, was nicht so gut gelungen ist, und die wesentlichen Dinge, die gut gelungen sind, auf die eigenen Fahnen zu schreiben, denn gewählt werden sie im Inland. Auch das ist zwar verständlich, bringt aber für die Union ein schweres Problem mit sich, das nicht ohne Folgen bleiben kann bei denen, die dann etwa bei einem Referendum abstimmen.
Lassen Sie mich daher zur Frage kommen: Was sollte und muss im Lichte dieser Einschätzung im Mittelpunkt der europäischen Reformbemühungen stehen?
Der erste Punkt ist: Nizza war, wie ich meine, ein trauriger Höhepunkt eines Schauspiels, das natürlich nicht einladend war, und zwar deshalb, weil es dort um nationale Egoismen gegangen ist und um Hahnenkämpfe, die jedenfalls nicht den Eindruck vermittelt haben, es ginge um Bürgerinteressen, sondern es ist offensichtlich um andere Fragen gegangen. Ich denke, wenn es um Bürger- und Bürgerinneninteressen geht, dann muss auch verdeutlicht werden, dass etwa Fragen der sozialen Sicherheit, Fragen der Beschäftigung, Fragen des Umweltschutzes im Mittelpunkt der Interessen stehen und dass der Rest der Bemühungen dazu dient, diesen Interessen zum Durchbruch zu verhelfen. Das ist heute nicht der Fall, und das spüren alle Europäerinnen und Europäer relativ deutlich. Sie müssen jedoch spüren können, dass die Union ihnen in diesen ihren Alltagsinteressen nützt.
Daher die Frage: Was braucht es?
Ich glaube, es braucht erstens – das ist schon deutlich geworden – einen Wechsel im Schwerpunkt der Politik. Der Binnenmarkt ist kein Ziel. Er kann ein Mittel sein, Bedingungen zu schaffen, die die Wohlfahrt der BürgerInnen heben, aber das muss deutlich werden in der Politik, und das muss auch gesagt werden.
Zweitens: Wir brauchen, wenn die BürgerInneninteressen stärker zum Durchbruch kommen sollen, auch eine stärkere Beteiligung der unmittelbaren Vertreter der Bürgerinnen und Bürger. Das sind im Allgemeinen die Abgeordneten, die direkt für diesen Zweck gewählt werden. Und das sollte auch deutlich werden.
Ich glaube, dass wir drittens – das ist ein moralischer Appell, der das Schicksal moralischer Appelle hat – auch etwas mehr Ehrlichkeit der nationalen Regierungen brauchen, was die Frage betrifft, was wo entschieden wird und wer sozusagen die Vorteile oder die Nachteile erzeugt. Die Regierungen und die Regierungsvertreter sind es, die in Brüssel die wesentlichen Entscheidungen treffen, und nicht die Kommission. Das wird natürlich im Inland im Allgemeinen nicht so klar gesagt.
Viertens: Wir brauchen natürlich auch ein klares Bekenntnis dazu, dass die Europäische Union etwas ist, was wir gemeinsam veranstalten im Interesse unserer Bürger. Das sollte man auch sagen, und dazu sollte man sich auch bekennen, und ich denke, wenn das gelänge, dann würde auch das Gefühl der Bürgerinnen und Bürger in dieser Hinsicht ein etwas anderes sein.
Kurz: Wir Sozialdemokraten treten aus all diesen Gründen und aus einigen mehr dafür ein, auch eine neue Form der Vorbereitung von Verfassungsentscheidungen auf europäischer Ebene zu finden, an denen Vertreter der Bürgerinnen und Bürger unmittelbar beteiligt sind. Deswegen treten wir für einen Konvent zur Vorbereitung ein, und zwar einen Konvent nach Art des Grundrechtskonvents und nicht nur irgendeine offene Debatte. Wir sind der Überzeugung, dass, wenn Parlamentarier entscheiden, andere Ergebnisse herauskommen, als wenn Regierungsvertreter entscheiden. – Ich komme am Schluss noch einmal kurz darauf zurück.
Ich denke, dass wir weiters aber auch dafür eintreten müssen, dass die nationalen Regierungen im europäischen Zusammenhang ihre Aufgaben erledigen, das heißt, dass sie die Lebensverhältnisse der Menschen, sozusagen deren Lebenslagen, positiv beeinflussen im Kontext europäischer Entscheidungen. Das ist der Grund, warum wir Sozialdemokraten dafür eintreten, dass jetzt in Vorbereitung auf die Erweiterung der Europäischen Union – die wir wünschen und für notwendig und richtig halten – die österreichische Regierung im Inland und gemeinsam mit den Kandidatenländern Schritte setzt, die deutlich machen, dass sie die Sorgen der Menschen in diesem Land vor der Erweiterung ernst nimmt und die Maßnahmen setzt, die man nach menschlichem Ermessen setzen muss, um das Risiko, das allenfalls in der Erweiterung steckt, gering zu halten. Deswegen verstehen wir nicht, dass sich die Regierung oder Teile der Regierung nicht auf die Lebenslagen, sondern nur auf die Stimmungslagen konzentrieren.
Lassen Sie mich abschließend noch zwei Anmerkungen zur institutionellen Struktur machen – auch im Widerspruch zur Frau Vizekanzlerin.
Ich denke, wir sollten sehen – und wenn die Regierungsvertreter das selbst so sähen, dann würden sie vielleicht auch anders agieren –: Wenn die Regierungsvertreter im Rat in Europa sich nicht primär als Staatenvertreter, sondern als demokratisch legitimierte Vertreter der Bürgerinnen und Bürger ihrer Länder verstünden, dann würden sie vielleicht auch anders handeln. Der Punkt ist nur – dafür brauchen wir keine Verfassungsänderung –, dass das etwas ist, was in den Köpfen und in den Herzen vorgeht. Wenn wir es so sähen, ohne jede Verfassungsänderung, dann wären diese Regierungsvertreter als demokratisch legitimierte Vertreter und Vertreterinnen der Bürgerinnen und Bürger ihrer Länder auch das, was ein Parlament ist, und dann brauchte man sich über die Frage einer zweiten Kammer nicht lange den Kopf zu zerbrechen. Das Entscheidungsorgan wäre ein den Bürgern verpflichtetes, demokratisch legitimiertes Entscheidungsorgan, und ob man das zweite Kammer oder Rat nennt, ist vollkommen egal.
Der zweite Punkt ist die Frage der Kommission. Die Kommission ist – wie ich unlängst einen Kommissionsvertreter sagen gehört habe – ein dienendes Organ mit dem Zweck, erstens Initiativen vorzubereiten und zu ergreifen und den Gesetzgebungsorganen vorzuschlagen und zweitens die Vollziehung der Union zu besorgen.
Ehrlich gesagt, ich habe Mühe, die Tätigkeit einer Bundesregierung anders zu definieren. Auch die Bundesregierung ergreift Initiativen, die dann Gesetzesvorschläge heißen und den zuständigen Organen zur Entscheidung vorgelegt werden, und sie ist für die Vollziehung verantwortlich. Ich sehe daher nicht wirklich den Grund, warum man so sehr gegen eine europäische Regierung antreten muss. Ich denke, wenn man die Kommission nicht Kommission, sondern Regierung nennen würde, würde manches auch etwas klarer sein, was heute im Diskurs zu Lasten der Europäischen Union untergeht. (Beifall.)
9.49
Vorsitzender Präsident Dr. Heinz Fischer: Zu Wort gelangt nun Herr Präsident Dr. Fasslabend. Redezeit: gleichfalls 10 Minuten. – Bitte.
9.50
Abgeordneter Dr. Werner Fasslabend (ÖVP): Da wir uns am Beginn einer Grundsatzdiskussion befinden, werde ich versuchen, auch sehr stark im Grundsätzlichen zu bleiben. Ich glaube, die Eingangsfrage, die wir uns alle stellen sollten, ist eindeutig die: Was ist Europa, was ist die Europäische Union, was soll sie sein? Und wenn man von dieser Frage ableitet, wie man dabei vorgehen kann, dann gibt es für mich folgende Grundsatzfragen:
Die erste Frage ist: Was wollen die Bürger von Europa? Durchaus auch: Was wollen sie nicht?
Das Zweite ist: Wie wollen wir, dass uns die anderen sehen als Europäer? Wie sollen sie uns in Asien erleben, wie in Afrika, wie in Amerika?
Die dritte Frage, die ich stellen würde, ist folgende: Was ist wünschbar einerseits, was ist realisierbar und realistisch andererseits? Und da – das möchte ich bereits eingangs sagen – teile ich in keiner Weise den Euroskeptizismus, wie er weit und breit gerade nach Ereignissen wie Nizza immer wieder auftritt.
Europa ist eine Erfolgsgeschichte, eine ungeheure Erfolgsgeschichte, die aber jeweils nur in ganz kleinen Etappen, in ganz kleinen Schritten, in sehr mühevoller Weise und unter nicht sehr attraktiven Umständen zustande gekommen ist. Langfristig ist Europa aber trotzdem eine Erfolgsgeschichte, und wie sehr es das ist, sehen wir vielleicht überhaupt erst dann, wenn wir Vergleiche ziehen. Wie realistisch wäre eine ähnliche Entwicklung, wie sie Europa in den letzten Jahrzehnten genommen hat, etwa im asiatischen Raum? Können wir uns vorstellen, dass China und Indien, Thailand und Burma – das ehemalige Indochina – auf eine ähnliche Art und Weise zusammenarbeiten? Können wir uns vorstellen, dass selbst in Südamerika, wo eigentlich die Verhältnisse von der sprachlichen Voraussetzung, aber auch von der gesamten Entwicklung her viel, viel homogener sind als in Europa, eine ähnliche Form der Zusammenarbeit stattfindet zwischen Argentinien und Brasilien und Guatemala? Da erst sehen wir, wie weit Europa bereits wirklich ist.
Versuchen wir ein bisschen, ins Konkrete hineinzugehen: Was wünschen sich die Bürger? – Ich bin da ganz beim Herrn Bundeskanzler und seinen Prioritäten. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir davon ausgehen, was die Bürger an allererster Stelle wollen. Sie wollen für sich wahrscheinlich einen bescheidenen Wohlstand, sie wollen Sicherheit, sie wollen aber auch mehr Lebenschancen für sich selbst. Mir scheint es ganz, ganz wichtig zu sein, dass wir auch diesen positiven Akzent sehen.
Wenn wir versuchen wollen, daraus Konsequenzen für die zukünftigen Inhalte abzuleiten – durchaus auch aus der Geschichte Europas –, dann muss man sich bewusst machen, dass Europa eben aus dem Versuch heraus entstanden ist, Kriege in Zukunft zu vermeiden, dann muss es unser aller vordringlichstes Ziel sein, Kriege auf dem Kontinent, bewaffnete Auseinandersetzungen überhaupt zu verhindern. Das heißt eindeutig auch, dass wir versuchen müssen, in eine gemeinsame Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik hineinzugehen, wo es ganz selbstverständlich sein muss, dass der eine für den anderen einsteht und nicht gerade dann, wenn es für den anderen bedrohlich wird, wegschaut und sagt: Das geht mich nichts an. – Es geht nicht an, dass man alles teilt, aber dann, wenn es um vitale und substantielle Interessen geht, das Prinzip der Gemeinsamkeit und der Solidarität vernachlässigt.
Ich würde aber die Frage der Sicherheit nicht nur auf die äußere Sicherheit beziehen, sondern die Bürger wünschen sich sicherlich eine noch viel effizientere Bekämpfung etwa der internationalen Kriminalität, des internationalen Terrors, der internationalen Drogenszene, aber durchaus auch mehr Sicherheit auf dem Gebiet der Umwelt, weil das, was auf diesem Gebiet geschieht, von vielen Menschen als bedrohlich empfunden wird und weil hier auch langfristig und nur grenzüberschreitend entsprechende Maßnahmen gesetzt werden können. Das heißt Sicherheit in der Außen- und Sicherheitspolitik, das heißt Sicherheit in der Umweltpolitik, aber auch innere Sicherheit, wobei der Kampf im Problembereich der Kriminalität zumindest in der internationalen Dimension deutlich effizienter geführt werden muss.
Damit ist es nicht aus. Gerade weil die Bürger Europa als eine Wohlstandsunion erlebt haben, müssen wir versuchen, da fortzusetzen. Was in den nächsten Jahren durch die Integration der ostmitteleuropäischen Staaten vielleicht noch viel stärker auf den Plan treten wird, ist die Problematik der unterschiedlichen Ausgangsstandards, die künftig viel größer sein wird, als sie es bisher war. Zweifelsohne muss das für uns auch Ansatzpunkt sein, hinsichtlich der sozialen Mindeststandards zu überlegen, was man tun kann, um nicht in einen zusätzlichen Wettbewerb zwischen den einzelnen Nationen und Standorten einzutreten, der auf dem Sektor des Arbeitsmarktes oder auf der Ebene geringerer Arbeitsstandards ausgetragen wird und nicht nur auf dem Finanzsektor – eine Frage, die für uns in den nächsten drei Jahren bereits eine unmittelbare Auswirkung haben kann.
Ich sehe Europa aber auch als das, was wir als den Zukunftsraum ansehen, auch für den Einzelnen. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass sich die Menschen als europäische Bürger fühlen sollen, dann müssen sie auch das Gefühl haben, freier, beweglicher sein zu können und mehr Chancen zu haben. Das gilt insbesondere für den Bildungsbereich. Der Soft-Bereich wird stärker an Bedeutung gewinnen. Dabei geht es aber wahrscheinlich nicht so sehr um Reglementierungen, sondern um das Anbieten von Möglichkeiten. Sofort immer nach einem Gesetz zu rufen, ist nach meiner Ansicht der falsche Weg. Er führt in eine Reglementierung hinein, die Chancen eher einschränkt als sie zu eröffnen.
Natürlich müssen wir, wenn wir das Ganze realistisch sehen wollen, auch versuchen, Antworten darauf zu geben.
In der Frage der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik bedarf es eindeutig europäischer gesetzlicher Regelungen, weil wir hier ja erst ganz am Anfang sind. Da ist es notwendig, diesen gesamten Bereich sozusagen voll in die europäische Aufgabenstellung zu integrieren. Bis jetzt arbeiten wir mit Übergangslösungen, die absolut nicht befriedigend sind. Denken wir nur etwa daran, dass es gerade in der parlamentarischen Behandlung zurzeit gar nichts gibt, was eben auch dazu geführt hat, dass auf der einen Seite immer noch die WEU-Versammlung tagt oder sich selbst einberuft, weil auf der anderen Seite im Europäischen Parlament noch keine Kompetenz vorhanden ist. Da muss dringend eine Klärung erfolgen.
Kompetenzabgrenzung ist sicherlich notwendig. Daher glauben wir durchaus auch, dass es richtig ist, einen Verfassungsvertrag aufzustellen. Es wäre aber nach meiner Ansicht vollkommen falsch, wenn man erwarten würde, dass es hier zu einer dauerhaften und ganz klaren Kompetenzabgrenzung kommen kann. Gerade bei Dingen, die in Entwicklung begriffen sind – und das trifft auf Europa zu –, ist eine eindeutige und klare Abgrenzung nicht machbar, sondern da muss man einfach versuchen, in Schritten vorzugehen und zu sagen: Für die nächsten Jahre ist das sozusagen das Muster, wo man abgrenzen soll. Diese Abgrenzung wird notwendig sein, um eben auch die Verantwortlichkeiten zuordnen zu können. Da bin ich einer ähnlichen Ansicht, wie sie auch Caspar Einem hier geäußert hat, was die Stellung der Kommission betrifft.
Selbstverständlich sollten wir die Position der Kommission stärken. Ich halte das für wichtig. Denn wenn die Bürger Europa nur so erleben, dass sie jedes halbe Jahr eine Veranstaltung sehen, bei der die Ministerpräsidenten oder Außenminister oder Fachminister der einzelnen nationalen Regierungen auftreten und jeder stolz ist, dass er für sich möglichst viel nach Hause geholt hat, aber Europa nie sozusagen in der gemeinsamen europäischen Dimension sichtbar wird, dann wird das Europagefühl wahrscheinlich nicht sehr viel stärker werden.
Daher ist es notwendig, nicht nur die Kompetenz zu stärken und auszubauen, sondern es wird auf der einen Seite notwendig sein – durchaus im Rahmen des Möglichen, das muss man ganz realistisch sehen –, die Kommission zu stärken, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Versammlung der nationalen Regierungschefs und Außenminister in ihrer bisherigen Form weiterzuentwickeln und das Ganze zu homogenisieren. Es wird weder das eine noch das andere sein. Es wäre völlig unrealistisch, das für die nächsten fünf oder zehn Jahre zu erwarten.
Europa ist darüber hinaus aber noch etwas mehr, es ist auch eine Wertegemeinschaft, eine Wertegemeinschaft angefangen von der Einstellung zur Todesstrafe bis hin etwa zur Frage des sozialen Standards. Ich glaube, dass es notwendig ist, diesen Charakter der Wertegemeinschaft stärker hervorzuheben. Europa ist eine Wertegemeinschaft aber auch in der Form, dass wir eine offene Gesellschaft sind, dass wir uns in Zukunft auch als eine offene Gemeinschaft für alle Europäer sehen. Selbstverständlich kann das nicht ein Klub für eine beschränkte Anzahl sein. Die Voraussetzung ist, dass alle auch die notwendige Ausgangssituation mitbringen – das ist ganz klar – und auch die notwendige Einstellung. Aber dass wir, wenn das der Fall ist, dann auch offen sein müssen und niemandem den Zugang verwehren können, das ist, glaube ich, ganz klar. Alles andere wäre nicht europäisch, sondern wäre ein partikularistisch-egoistisches Verhalten, das niemand verstehen könnte und das auch wir nicht verstanden hätten, wenn es in der Vergangenheit so gewesen wäre.
Insofern sollten wir uns – wenn ich das zusammenfassen darf – nicht nur darauf beschränken, welche Veränderungen der Institutionen wir wollen, sondern wir sollten sehr wohl auch versuchen, das Chancenpotential viel stärker herauszuarbeiten, als das in der Vergangenheit der Fall war. (Beifall.)
10.00
Vorsitzender Präsident Dr. Heinz Fischer: Nächster Redner ist Herr Abgeordneter Dr. Kurzmann. – Bitte.
10.01
Abgeordneter Dr. Gerhard Kurzmann (Freiheitliche): Sehr geehrte Damen und Herren! Der Vertrag von Nizza hat in den vergangenen Monaten viele kritische Stellungnahmen vor allem in der Politik, aber auch in den Medien ausgelöst. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die Aussagen prominenter Vertreter der großen Fraktionen im Europäischen Parlament, aber auch an die Leitartikel einflussreicher Kommentatoren unmittelbar nach dem Gipfel von Nizza.
Trotzdem oder gerade deshalb muss man hervorheben, dass es der österreichischen Bundesregierung in Nizza sehr gut gelungen ist, die Interessen unseres Landes zu wahren und dabei auch die grundlegenden Reformen entscheidend mitzugestalten.
Dass das Ergebnis der Konferenz von Nizza ein politischer Kompromiss ist, wird von niemandem bestritten. Die unterschiedlichen Standpunkte der einzelnen Staaten und der einzelnen Regierungen haben von Anfang an eigentlich nichts anderes erwarten lassen. Das ist Realpolitik, ob man das jetzt bedauert oder nicht.
Die Kernforderungen freiheitlicher Europapolitik waren seit jeher die Forderungen nach mehr Transparenz innerhalb der EU, nach noch größerer Bürgernähe und auch nach stärkerer Demokratisierung der Entscheidungsprozesse innerhalb der Europäischen Union. Diese Politik, die eine klare Kompetenzabgrenzung geradezu bedingt, ist manchmal als antieuropäischer Egoismus durchaus fehlinterpretiert worden. Ebenso ist unsere Forderung nach einer verstärkten Beteiligung der nationalen Parlamente am europäischen Einigungsprozess manchmal überheblich als populistisch zurückgewiesen und abgelehnt worden.
Wir Freiheitlichen fühlen uns aber durch den Vertrag von Nizza in unseren Bestrebungen durchaus bestätigt. Denn die Erklärung Nummer 23 des Vertragswerkes zur Zukunft der Union enthält nun auch viele Themen, deren Behandlung wir auf europäischer Ebene seit Jahren immer wieder gefordert haben. Das sind unter anderem eine dem Subsidiaritätsprinzip entsprechende Kompetenzabgrenzung zwischen der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten, die Vereinfachung der Verträge, um sie nicht nur für den Bürger, sondern auch für viele Staatsmänner, Politiker klarer und verständlicher zu machen. Es ist die Rolle der nationalen Parlamente im künftigen Europa – sie wurde ebenfalls schon angesprochen –, die eine entscheidende Bedeutung für uns hat, ebenso der Status der Charta der Grundrechte.
Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben mit dieser Erklärung anerkannt, dass die demokratische Legitimation und die Transparenz der Union in Zukunft verbessert werden müssen, um diese auch den Bürgern näher zu bringen. Ich meine, dass gerade diese Erkenntnis der eigentliche Fortschritt von Nizza und des dort in Gang gekommenen Reformprozesses ist.
Wo sollen also die Schwerpunkte einer künftigen Reform der EU liegen?
Unbestritten – das ist heute schon mehrfach erwähnt worden – ist das demokratiepolitische Defizit der Europäischen Union. Ein wesentlicher Faktor dieser demokratiepolitischen Schwäche ist die Intransparenz der Beratungen im Europäischen Rat. Es kann nicht hingenommen werden, dass der Europäische Rat, der für fast 375 Millionen Bürger Recht setzt, in völliger Intransparenz die Dossiers diskutiert. Das erinnert eher an die Geheimdiplomatie der Kabinette der europäischen Großreiche im 17. oder 18. Jahrhundert, aber nicht an einen modernen Staatenverbund am Beginn eines neuen Jahrtausends.
Die weitreichenden Befugnisse des Rates machen aber eine Öffnung der Tätigkeit des Rates als Rechtsetzungsorgan dringend notwendig. Die Frage ist nun, wie diese Öffnung sinnvoll vorgenommen oder in die Wege geleitet werden kann.
In diesem Zusammenhang möchte ich auf jenes Zukunftsthema der Union zu sprechen kommen, dem wir Freiheitlichen eine entscheidende Bedeutung beimessen, nämlich auf die Rolle der nationalen Parlamente, wie das die Frau Vizekanzlerin bereits angesprochen hat.
Die Forderung nach der Einrichtung einer zweiten Kammer des Europäischen Parlaments zur Aufwertung der nationalen Volksvertretungen ist zurzeit sehr häufig und von überall zu hören. Würde eine solche zweite Kammer des Europäischen Parlaments, mit den Abgeordneten der nationalen Parlamente beschickt, aber den Anforderungen wirklich gerecht werden? Die Einbeziehung der nationalen Parlamente darf nicht nur den Zweck haben, die Arbeit des Rates zu kontrollieren, sie muss auch in der Lage sein, die europapolitischen Themen in die Mitgliedstaaten selbst zu tragen. Noch sinnvoller wäre es, die Bürger in den Mitgliederstaaten an der europapolitischen Debatte richtiggehend teilhaben zu lassen.
Die Schaffung einer zweiten Kammer des Europäischen Parlaments mit Sitz in Brüssel oder in Straßburg oder – noch schlechter – mit Sitz in beiden Städten wird dieser Aufgabe aber ganz sicher nicht gerecht. Die Union näher zum Bürger zu bringen, wird durch die Einrichtung einer zweiten Kammer allein wohl nicht gelingen. Eine Neubestimmung der Rolle der nationalen Parlamente wäre jedoch in der Lage, die Forderung nach mehr Bürgernähe mit der Forderung nach der Aufwertung der nationalen Parlamente sinnvoll zu verknüpfen. Die Beteiligung beispielsweise der Vorsitzenden der mit EU-Angelegenheiten befassten Ausschüsse der nationalen Parlamente an den Beratungen im Rat könnte einen wesentlichen Beitrag zu mehr Transparenz der Arbeit des Rates in Europa leisten. Gleichzeitig würden auch die so genannten fernen Brüsseler Themen zu nationalen Themen werden, die dann regelmäßig in den EU-Ausschüssen der heimischen Parlamente beraten würden. Die mediale Aufmerksamkeit hinsichtlich europapolitischer Themen wäre verstärkt gegeben und damit verbunden auch eine breite Debatte dieser Themen in der Bevölkerung.
Um Missverständnisse zu vermeiden: Ich schließe mich nicht der Forderung nach einer zweiten Kammer des Europäischen Parlaments an, sondern stelle das Modell der Einbindung der Vertreter der nationalen Parlamente direkt in die Arbeit des Rates zur Diskussion.
In ihren Stellungnahmen haben sowohl der Herr Bundeskanzler als auch die Frau Vizekanzlerin mehrfach auf den Erfolg und die Fortschritte der Europäischen Union in den vergangenen Jahren hingewiesen. Das ist deshalb von Bedeutung, weil sich die europäischen Staaten in einer globalisierten Welt nicht einzeln, sondern nur gemeinsam wirtschaftlich, politisch, aber irgendwann auch militärisch behaupten werden müssen.
Das ändert nichts daran, dass noch viele schwierige Probleme zu lösen sein werden, etwa – das wurde ebenfalls schon angesprochen – die Frage der Sprachen, vor allem in den Institutionen der EU nach deren Erweiterung, oder die Frage des Sitzes des Europäischen Parlaments. Auf Dauer wird es nicht möglich sein, beide Standorte, Brüssel und Straßburg, aufrechtzuerhalten.
Ein heikles Thema, das fast ein Tabu darstellt, das aber heute von der Frau Vizekanzlerin schon angesprochen worden ist, ist die künftige Finanzierung der Europäischen Union. Eine EU-Steuer ist aber gerade für ein Land wie Österreich, das Nettozahler ist, durchaus unzumutbar, denn ich glaube, wir leisten schon sehr viel für die Europäische Union.
Abschließend noch einige Anmerkungen zur nächsten Regierungskonferenz: Das Europäische Parlament fordert in seiner heutigen Sitzung, die Regierungskonferenz vom Jahr 2004 in das Jahr 2003 vorzuverlegen. Als Begründung dafür werden die Wahlen zum Europäischen Parlament angegeben. Eine solche Vorverlegung, meine Damen und Herren, wäre aber sicher das falsche Signal zur falschen Zeit, denn man würde in einem solchen Fall nicht nur von einer einmal getroffenen – und zwar gemeinsam getroffenen – Vereinbarung abrücken, sondern man würde sich auch dem Vorwurf aussetzen, die Flucht vor dem Bürger anzutreten. Die Wahlen zum Europäischen Parlament im Jahre 2004 sollten unserer Auffassung nach im Gegenteil geradezu zu einem Wettbewerb der europapolitischen Konzepte der wahlwerbenden Gruppen führen. Insofern hätte der Wahlausgang dann auch Einfluss auf die Regierungskonferenz, die sich an diesem Wahlergebnis orientieren könnte.
Meine Damen und Herren! Die Europäische Union befindet sich in einer sehr wichtigen, vielleicht entscheidenden Phase ihrer Entwicklung. Lassen Sie uns die Diskussion über die Zukunft der Union mit der gebotenen Sorgfalt führen! Polemik hat hier genauso wenig Platz wie Diskussions- oder Denkverbote, denn die Zukunft der Europäischen Union ist schließlich unsere gemeinsame Zukunft. (Beifall.)
10.11
Vorsitzender Präsident Dr. Heinz Fischer: Das vierte Fraktionsstatement gibt jetzt Herr Abgeordneter Voggenhuber für die grüne Fraktion ab. – Bitte.
10.11
Abgeordneter zum Europäischen Parlament Johannes Voggenhuber (Grüne): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wenn heute von Europa die Rede ist, dann ist von Ideen die Rede, von Idealen, von Träumen, von kulturellen Horizonten und Traditionen. Das alles ist Europa sicherlich auch, aber es ist auch ein Machtkampf, eine Auseinandersetzung um den politischen Primat über die Entwicklung dieses Kontinents, es ist auch eine Frage: Wer bestimmt, was Europa in der Zukunft sein wird? Und in dieser Auseinandersetzung geht es im Wesentlichen um eine Frage: Bleibt Europa eine politische Union, beherrscht und gestaltet von Eliten und Technokratie, oder gelingt es, aus der europäischen Integration eine Res publica zu machen, und wird im künftigen Europa alles Recht und alle Gewalt vom Volk ausgehen? – Das ist die Auseinandersetzung, die wir erleben. Wir sind Zeugen und Beteiligte dieses Machtkampfes.
Europa ist auch ein Kostümfest. Hinter den Ideen und den Masken der Ideale verbergen sich eben jene ideologischen und machtpolitischen Ansprüche, und es ist wichtig für die Stellung eines Landes und eines Parlaments, so manche Maske zu lüften.
Ich komme zurück zu Nizza. – Wir haben es nach der irischen Abstimmung mit einem Nein zu Nizza zu tun. Meine Damen und Herren, wir haben es nur mit einem Nein zu tun, weil es nur ein Referendum gibt. Gäbe es 15, hätten wir es wahrscheinlich mit zehn bis zwölf Nein zu tun.
Nun, nach einem solchen Trauma für die politisch Verantwortlichen, wie es eine Volksabstimmung im Allgemeinen darstellt, kam die These auf, die Iren hätten nicht ganz verstanden, worum es geht, und die irische Regierung hätte es verabsäumt, die Bevölkerung entsprechend aufzuklären. Meine Damen und Herren, ich kann aus Kenntnis von Nizza nur vor dieser These warnen. Jede weitere Aufklärung der irischen Bevölkerung über den Vertrag von Nizza hätte mit Sicherheit die Anzahl der Nein-Stimmen dramatisch erhöht.
Das Europäische Parlament, dem man nun nicht einen Mangel an Aufgeklärtheit vorwerfen kann, hat mit überwältigender Mehrheit, quer durch alle Fraktionen, quer durch alle Länder, diesen Vertrag sehr klar und sehr deutlich als kläglich und gescheitert betrachtet und sehr klare Forderungen für die Zukunft aufgestellt.
Die Iren haben vielleicht gewusst, dass die Staats- und Regierungschefs die Stirn hatten, die Grundrechtscharta nicht mit Rechtsverbindlichkeit zu versehen und den Bürgern keinen direkten Zugang zum Gerichtshof zu ermöglichen. Apropos viel beschworene Bürgernähe: Die nationalen Regierungen haben sich ja zu Monopolisten der Bürgernähe und des Volkes aufgeschwungen. Ich dachte immer, sie sind die Vertreter der Staaten, und wir, die Abgeordneten und Parlamente, sind die Vertreter der Völker. Aber das kommt in Europa ein wenig durcheinander.
Die Mitentscheidung des Parlaments bei der qualifizierten Mehrheit ist eine zentrale Demokratiefrage. Man hat sich in Nizza nicht dazu aufgeschwungen. Dadurch bekommen wir in Europa zum ersten Mal nach 200 Jahren Demokratie reine Regierungsgesetzgebung, reine von Parlamenten nicht mehr kontrollierte Regierungsgesetzgebung, nicht mehr kontrolliert auf europäischer Ebene, nicht mehr kontrolliert auf nationaler Ebene.
Meine Damen und Herren! Die Öffentlichkeit der Gesetzgebung ist ein Grundprinzip europäischer Tradition. Kant hat einmal gesagt: Alles, was der Staat nicht öffentlich machen kann, ist ein Verbrechen. – Demnach wären viele Beschlüsse des Rates ein Verbrechen, denn nicht einmal die Parlamente wissen, wie unsere Minister im Rat abstimmen. Wie kann man sie zur Rechenschaft ziehen? Wie soll das Demokratie genannt werden?
Die Kommission als supranationale Institution ist gescheitert. Sie wurde natürlich nach wie vor zur nationalstaatlichen Vertretung gemacht.
Meine Damen und Herren! Das, worum es in Europa geht, ist ein tiefer Demokratiekonflikt, und es geht um die Frage, die siamesischen Zwillinge Nationalstaat und Demokratie zu trennen. Es ist richtig, dass der Nationalstaat die einzige historische Verwirklichung von Demokratie ermöglicht hat, aber genau das ist die Aufgabe: einen neuen Entwurf von Demokratie auf supranationaler Ebene, eine republikanische Grundordnung für Europa zu entwickeln.
Was wir derzeit haben – da muss man sich über die Geschichte der EU sehr klar sein –, ist eine Machtanmaßung der nationalen Regierungen, die Grundprinzipien der Demokratie missachtet. Der Rat als Institution nationaler Exekutiven, nationaler Staatsvertreter maßt sich heute an, in Europa Regierung zu sein, oberste Verwaltung, Gesetzgeber, und er setzt nun dazu an, auch noch Verfassungsgeber Europas zu werden.
Meine Damen und Herren! Es ist die Stunde der Parlamente! Es ist eine originäre Aufgabe der Parlamente, Verfassungsgeber zu sein. Mit Regierungen über Demokratie zu verhandeln, ist, wie mit Gänsen über Weihnachten zu reden. Ich meine, Regierungen werden nicht Demokratie schaffen. Sie haben es nie getan, es ist nicht ihr Job, nicht ihre Natur, und sie werden es auch in Europa nicht tun, wenn die Parlamente diese europäische Sache nicht in die Hand nehmen, um dieses – das meine ich sehr historisch und keineswegs polemisch – Europa der Reichsfürsten zu einem republikanischen Europa zu machen.
Das Europäische Parlament hat dazu einen klaren Weg aufgezeigt: einen parlamentarischen Konvent – nicht, Herr Bundeskanzler, wie die Mitglieder des Rates, um ihre Stellung bei der nächsten Regierungskonferenz zu erhalten, uns nun vorschlagen, einen offenen Konvent, in dem NGOs, Wissenschafter und Parlamentarier zusammen frisch-fröhlich diskutieren, um, wie die schwedische Ratspräsidentschaft es ausgedrückt hat, einen „stimulierenden Dialog“ zu entfalten. – Stimulierend sollen wir sein für die Regierungen auf der nächsten Regierungskonferenz!
Ich glaube, man muss in diesem Europa klarstellen: Nicht wir beraten die Regierungen, nicht wir stimulieren die Regierungen, sondern die Regierungen beraten uns, die Parlamente dieses Europas, und die Parlamente sind die einzig Legitimierten, um die Völker zu vertreten. Ich denke, es wird sehr entscheidend werden, ob es einen solchen Erinnerungsprozess der Parlamente an ihre urtümlichste Aufgabe, Verfassungsgeber zu sein und dieses Europa nicht den nationalen Verwaltungen zu überlassen, gibt. Denn das andere Europa, eines, das nicht Republik, das nicht republikanische Ordnung, das nicht supranationale Demokratie wird, führt uns ins 19. Jahrhundert zurück.
Wenn Sie Maastricht, Amsterdam und Nizza betrachten, dann haben Sie den Rückweg ins 19. Jahrhundert, in ein Europa der Hegemonien, der nationalstaatlichen Balancen, der Vorherrschaften, der Kern- und Achsenbildungen. Das ist es, was wir erleben! Es ist, glaube ich, notwendig, dieses große europäische Zivilisationsmodell, das ein Modell der Zähmung der Macht war, auf dieses Europa anzuwenden, einen Entwurf eines demokratischen Europas zu entwickeln, in dem die nationalen Regierungen nicht die Reichsfürsten sind, sondern gezähmt werden und im besten Falle in einer zweiten Kammer beteiligt sind, aber nicht länger die Gewaltentrennung verletzen.
Wenn wir diese Basis Europas, die Demokratie, angreifen, dann haben wir keine Gemeinsamkeit mehr. Es ist nicht zulässig, dass ein Minister als Exekutive hier ins Flugzeug steigt und als Gesetzgeber in Brüssel aus dem Flugzeug steigt. Es ist nicht zulässig, dass ein Minister hinter verschlossenen Türen Gesetze macht. Es ist nicht zulässig, dass in der Regierungszusammenarbeit staatliche Gewalt ausgeübt wird, ohne dass die Grund- und Bürgerrechte geschützt sind, ohne dass die Parlamente die Regierung kontrollieren können, ohne dass die Gerichte Recht sprechen können.
Ich denke, die Aufgabe ist, diesem Europa der Reichsfürsten, diesem Europa der Machtanmaßung nationaler Regierungen ein Ende zu machen und einen Prozess tiefer Demokratisierung in Europa einzuleiten, damit eines nicht passiert, denn eines könnte die europäische Integration zum Scheitern bringen, nur eines: wenn die europäische Einheit und die Demokratie in Konflikt und in Widerspruch geraten. Das zu verhindern ist die Aufgabe dieses Verfassungsprozesses, den das Europäische Parlament vorschlägt, und wir hoffen, dass auch dieses Parlament, auch unser Parlament, dazu beiträgt, dass diese Europäisierung gelingen kann. (Beifall.)
10.21
Vorsitzender Präsident Dr. Heinz Fischer: Danke. – Wir haben damit die vier Fraktionsstatements gehört.
Die Redezeiten betragen ab jetzt einheitlich 5 Minuten, und ich bitte, auch diese diszipliniert einzuhalten.
Herr Abgeordneter Dr. Bauer erhält als Nächster das Wort. – Bitte.
10.22
Abgeordneter Dkfm. Dr. Hannes Bauer (SPÖ): Herr Präsident! Herr Bundeskanzler! Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Zunächst einmal haben die Debattenbeiträge gezeigt, in welchem Spannungsfeld sich Europa befindet und welche Orientierung wir diesem Europa noch zu geben haben, einem Europa, das seine Identität noch lange nicht gefunden hat und in dem so vieles noch prozesshaft abläuft. Daraus resultieren natürlich Akzeptanzprobleme, und diese sind zu überwinden. Da müssen Maßnahmen gesetzt werden, die nicht auf der Regierungsebene stattfinden, sondern auf die Bürgerebene transportiert und hinuntergebrochen werden.
Ich meine, dass wir in diesem Europa die Fragen der Wirtschaft durchaus einigermaßen gelöst haben. Es ist ja eher eine Wirtschaftsunion im Entstehen als eine Union der Bürgerinnen und Bürger. Und genau das ist der Konflikt. Ich meine, dass wir uns auch damit zu beschäftigen haben, auf welche Weise die Frage der sozialen Dimension in diesem Europa gleichwertig behandelt werden kann und Institutionen geschaffen werden, die anerkannterweise auf europäischer Ebene auch agieren können wie eben die staatlichen oder die wirtschaftsnahen Bereiche. Das ist das Entscheidende.
Wenn man also von Akzeptanzproblemen spricht, so ist einer der Gründe sicher der, dass die soziale Dimension immer als nationales Anliegen abgetan wurde, aber in Wirklichkeit genau diese erst die Union der Bürgerinnen und Bürger schaffen könnte.
So wichtig es ist, die Rechte der Bürgerinnen und Bürger zu verankern, so wichtig ist es meiner Meinung nach auch, eine Verankerung des Beschäftigungszieles anzustreben, damit neben dem Ziel einer möglichst geringen Inflation oder der Verpflichtung der Europäischen Zentralbank, eine Geldpolitik zu betreiben, die das Wirtschaftswachstum bewegt, auch die Beschäftigung als gleichwertiges Ziel anerkannt wird. Wenn das der Fall ist, dann, glaube ich, entsteht mehr soziale Sicherheit, aber auch eine größere Akzeptanz.
Ich möchte noch eine Bemerkung zum Nizza-Prozess machen, der ja läuft. Wie unterschiedlich er beurteilt wird, wissen wir. Aber es gab Göteborg und die Schlussakte, und ich meine, dass dort auch wichtige Entscheidungen und Aussagen in Bezug auf die Erweiterung getroffen wurden. Wenn schon die österreichische Bundesregierung nicht mit einer klaren Positionierung nach Nizza gereist ist, so meine ich, dass es jetzt notwendig ist, diese Frage der Positionierung zur EU-Erweiterung zu verdeutlichen.
Wenn man sich überlegt, dass in den Schlussakten von Göteborg zwar die Beitrittsstaaten nicht genannt wurden, aber auf der einen Seite gesagt wurde, dass dieser Prozess unumkehrbar ist, und auf der anderen Seite angesprochen wurde, dass diese Staaten bereits als Mitglieder an den europäischen Wahlen teilnehmen sollen, bedeutet das, dass dieser Prozess der Anpassung ein sehr kurzer ist. Ich glaube auch, dass es notwendig ist, diese institutionellen Herausforderungen auf der anderen Seite der Grenze so zu gestalten, dass die Bürger das Vertrauen haben, dass die Institutionen hüben wie drüben so funktionieren, dass ihre Anliegen auch in diesem Prozess der Erweiterung entsprechend gewahrt werden.
Und das ist das Wichtige, denn Stimmungsbilder entstehen ja an Schnittstellen, und wenn diese Stimmungsbilder an den Schnittstellen negativ sind, so prägen sie unter Umständen das Gesamtbild. Das bedeutet, dass wir uns mit der Frage der Erweiterung gerade im grenznahen Bereich zu beschäftigen haben, denn ich sehe darin auch ein Akzeptanzproblem, wenn diesbezüglich keine Sicherheit hergestellt wird.
Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Die Frage der sozialen Erweiterung, Europa als Sozialraum zu gestalten, das muss unser oberstes Anliegen sein. Die institutionellen Fragen sind wichtig für das Funktionieren, aber von sekundärer Bedeutung für die Beurteilung der Europäischen Union durch die Bürgerinnen und Bürger. – Ich danke. (Beifall.)
10.27
Vorsitzender Präsident Dr. Heinz Fischer: Herr Abgeordneter Dr. Spindelegger, bitte.
10.27
Abgeordneter Dr. Michael Spindelegger (ÖVP): Herr Präsident! Herr Bundeskanzler! Meine Damen und Herren! Ich hatte die Möglichkeit, eineinhalb Jahre im Europäischen Parlament als Abgeordneter tätig zu sein und jetzt einige Jahre mehr als Abgeordneter zum Nationalrat, und möchte daher aus dieser persönlichen Erfahrung, aus dieser persönlichen Sicht ein paar Anmerkungen zu dieser Frage der Zukunft Europas machen.
Für mich – wie, glaube ich, für uns alle – ist als Erstes klar, dass dieser Acquis Communautaire, den wir heute in Europa haben, sehr weit gefasst ist, vielleicht manchmal zu weit gefasst. Er hat sich entwickelt. Wir haben eine weite Formulierung von Kompetenzbestimmungen. Wir haben Generalklauseln, bei denen sich nicht klar abzeichnet, wo jetzt wirklich die Trennlinie zwischen Europa und den nationalen Staaten ist. Aus meiner Sicht muss man bei der Zukunft Europas sehr wohl überlegen, wo diese Trennlinie zu gestalten ist und welche Kompetenzen, enger gefasst, zukünftig wirklich der Europäischen Union und welche den nationalen Mitgliedstaaten zugeordnet werden. Ohne diese klarere Trennlinie geht beides wahrscheinlich in eine falsche Richtung, und der Konflikt steigt.
Ich darf das an einem Beispiel aufzeigen, das derzeit in Österreich auch unter Bürgern stark diskutiert wird – vielleicht werden Sie selbst auch damit konfrontiert –, das ist die ganze Vorgangsweise rund um die „Natura 2000“, um die berechtigte Forderung der Europäischen Union, klar abzugrenzen, welche Gebiete schützenswert sind. Aber auf der anderen Seite jetzt so weit zu gehen, den Ländern und Regionen die Kompetenz für diese Raumordnungsfragen wegzunehmen, erzeugt aus meiner Sicht ein Spannungsverhältnis, das klar erkennen lässt, dass es so nicht gehen kann.
Zweite Bemerkung aus meiner Sicht, und zwar zum Verfassungsvertrag: Ich glaube, wir sollten der Idee, einen Verfassungsvertrag für Europa vorzusehen, sehr aufgeschlossen gegenüberstehen und versuchen, das, was wir in Österreich in Richtung verfassungsgesetzlich gewährleisteter Rechte der Bürger haben und worauf wir stolz sind, vielleicht auch einmal auf europäischer Ebene zu entwickeln und zu gestalten.
Diese verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte haben ja ein Vorläufermodell gehabt, an dem auch österreichische Parlamentarier mitgewirkt haben, nämlich die Charta der Bürgerrechte. Diese Charta kann eine Grundlage bilden, und aus dieser relativ reichhaltigen Liste von Bürgerrechten könnte man einige herausnehmen und sie wirklich mit einem speziellen Grundrechtsschutz ausgestalten.
Ich würde mir sehr wünschen, dass es uns gelänge, in einem Verfassungsvertrag solche verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte auch zu verankern.
Dritter Punkt: Einbindung der nationalen Parlamente. – Ich glaube, wir haben in Österreich ein System, mit dem wir beim Rat als nationale Parlamentarier Einfluss nehmen können, und das sollten wir nicht gering schätzen. Ganz im Gegenteil: Gerade bei der Frage von Nizza ist es in einer sehr guten Art und Weise gelungen, dass der Nationalrat über den Hauptausschuss, über ein „Feuerwehrkomitee“, gemeinsam mit der Bundesregierung diesen Prozess in enger Abstimmung begleitet hat und sogar noch in die laufenden Verhandlungen über Informationen der Mitglieder der Bundesregierung mit eingebunden war. – Das ist ein Modell, das für viele andere Staaten durchaus Erfolg versprechend und gut wäre.
Aber wir müssen darüber hinausgehen. Das österreichische Modell ist noch zu wenig ausgestaltet, und wir als nationale Parlamentarier haben auch institutionell zu wenig Möglichkeiten. Ich habe seit vielen Jahren die Möglichkeit, in der COSAC tätig zu sein. Es ist dies eine interessante Diskussion mit den jeweiligen Ministerpräsidenten und Außenministern, die den Vorsitz führen, es handelt sich hiebei aber sicherlich nicht um das geeignete Gremium für die Einbindung nationaler Parlamente in die europäische Rechtssetzung. Ich meine, dass eine Vernetzung gerade über die Kommissare eine wünschenswerte Möglichkeit wäre. Vielleicht kann man einmal eine Art Interpellationsrecht für nationale Parlamente gegenüber der Kommission entwickeln. Das wäre ein Ansatzpunkt, wie man in verstärktem Maß auch die Fragen, die nationalen Parlamentariern von der Bevölkerung gestellt werden, tatsächlich beantworten kann. – Danke. (Beifall.)
10.31
Vorsitzender Präsident Dr. Heinz Fischer: Zu Wort gelangt nun Herr Professor Schreiner. – Bitte.
10.32
Landtagspräsident Univ.-Prof. Dr. Helmut Schreiner (Präsident des Salzburger Landtages): Herr Präsident! Herr Bundeskanzler! Meine Damen und Herren! Ich bringe drei kurze Bemerkungen.
Erstens: Der Post-Nizza-Prozess – oder wie immer man diesen Vorgang nennen will – kann nur gelingen, wenn im Mittelpunkt eine Stärkung des Projekts betreffend die Demokratie in Europa steht.
Und damit beginnt es: Diese Stärkung der Demokratie in Europa macht nur Sinn, wenn die Parlamente stärker eingebunden sind und eine zentralere Rolle bekommen. Dazu ist zu bemerken: Alle Vorredner oder die meisten der Vorredner sprechen von so genannten nationalen Parlamenten in einem ganz bestimmten Sinn und meinen nur Nationalrat und Bundesrat. Das widerspricht aber den europarechtlichen Vorgaben und entspricht auch nicht der Bundesverfassung. Weder sieht das Europarecht vor, dass der Nationalrat dann, wenn er als Parlament auftritt, die Befugnis hat, für die Landesparlamente zu sprechen – und Österreich ist eben ein Bundesstaat –, noch gibt es entsprechende Regelungen von der Bundesverfassung her.
Ich meine daher, dass es angemessen wäre – und das Europarecht gibt keinen Hinweis darauf, dass nur die Parlamente auf nationaler Ebene gemeint sind –, wenn etwa im COSAC-Prozess auch die Landtage vertreten wären.
Außerdem müsste man diesen Punkt meiner Meinung nach auch anders überlegen. Ich halte das Projekt eines Verfassungskonvents für wichtig und gut. Dieses Projekt wird natürlich parlamentarisch beherrscht sein müssen, und ich meine, dass es auch in diesem Verfassungskonvent eine Rolle für die nach unserer österreichischen Bundesverfassung grundgelegten Landesparlamente geben muss. – Das ist der erste Punkt, den ich anmelden möchte.
Zweitens – zur Neuordnung der Kompetenzen: Ich würde mich sehr freuen, wenn es gelänge, eine solche Formulierung zu finden, ich bin diesbezüglich aber pessimistisch. Ich glaube, man sollte eher beim Punkt der Subsidiarität anfangen, der heute im Vertrag so formuliert ist, dass sich jeder alles darunter vorstellen kann. Das hat nur dazu geführt, dass man jetzt mehr Richtlinien erlässt als Verordnungen und damit den Eindruck erweckt, dass die Subsidiarität verwirklicht ist. – Das kann es aber nicht sein!
Ich meine, man sollte sich der Mühe unterziehen, die Subsidiarität neu und stärker zu formulieren, und zwar dadurch, dass man die technische Seite der Erforderlichkeitsprüfung genau regelt. Außerdem sollte es im Zusammenhang mit dieser Subsidiaritätsprüfung auch ein Klagerecht geben, und zwar sollte das privilegierte Klagerecht der Mitgliedstaaten auch jenen Regionen eingeräumt werden, die Gesetzgebungsbefugnis haben. Das, meine Damen und Herren, würde mit Sicherheit einen Rechtfertigungsprozess in der EU auslösen, sodass die Subsidiarität mit Leben erfüllt werden würde.
Dritter und letzter Punkt: Der Post-Nizza-Prozess kann nicht nur Österreich und Europa betreffen, sondern man muss auch innerösterreichisch dafür sorgen, dass einige Schieflagen berücksichtigt und bereinigt werden. Diesbezüglich gibt es sehr viel zu tun. Ich möchte nur ein Beispiel erwähnen: Die Grenzen fallen, und ein Land wie Salzburg liegt etwa in Nachbarschaft zu Deutschland, zu Bayern. Dort gibt es keine Sprachengrenze und keine Kulturgrenze, und bald wird es eine einheitliche Währung geben. Hier wächst eine neue Großregion heran, und in dieser neuen Großregion werden jene Teile die besten Chancen für sich selbst haben, die auch am meisten für sich selbst bestimmen können.
Meine Damen und Herren des Nationalrates! Ich fordere Sie daher auf, dafür zu sorgen, dass wir mehr Freiheit bekommen, um uns selbst bestimmen und unsere Chancen in dieser neuen Großregion mehr in die eigene Hand nehmen zu können! Derzeit leben wir nämlich – ich erlaube mir, das jetzt so drastisch zu sagen – unter der Vormundschaftsordnung der Bundesverfassung hinsichtlich der Kompetenzen. – Das war der dritte Punkt.
Ich bitte Sie, auch beim Post-Nizza-Prozess daran zu denken. Sie müssen uns die Möglichkeit geben, uns in den neu wachsenden Großregionen selbst zu bestimmen und unsere Chancen selbst in die Hand zu nehmen! – Danke. (Beifall.)
10.36
Vorsitzender Präsident Dr. Heinz Fischer: Zu Wort gelangt nun Herr Universitätsprofessor Dr. Somek. – Bitte.
10.36
ao. Univ.-Prof. Dr. Alexander Somek (Universität Wien, Institut für Rechtsphilosophie und Rechtstheorie): Meine Damen und Herren! Ich werde mich wirklich ganz kurz fassen.
Ich habe vor, ein bisschen aus der Rolle zu fallen. Ich bin als Experte geladen, aber es reizt mich sehr, als Bürger zu sprechen. – Brav und anständig aufzutreten und auch etwas zur Europäischen Union zu sagen ist eine Rolle, die üblicherweise von Mittelschülern wahrgenommen wird. Mich reizt dabei so sehr, als Bürger zu sprechen, weil in diesem Zusammenhang Bürger und Inhalte der Politik beschworen werden.
Mir fällt an diesem Diskussionsprozess auf, dass er richtig begonnen wird, letztlich aber in die falsche Richtung läuft. Die Diskussion wird richtig begonnen. Der Herr Bundeskanzler hat ganz richtig gesagt, dass wir zu viel über Institutionen, Details der Institutionen und Reformen sprechen und die Inhalte auf der Strecke bleiben. Dann werden die Inhalte als etwas beschworen, was für den europäischen Integrationsprozess wichtig ist, und dann endet man wieder mit Fragen wie: Wo sollen regulatory agencies stationiert werden? Wie sollen die Stimmenverhältnisse gewichtet werden? Man gelangt wieder zu institutionellen Fragen, insbesondere zur Frage betreffend das Verhältnis von nationalem Parlament und Europaparlament. – Dort enden dann die inhaltlichen Diskurse.
Als Bürger, als der ich jetzt zu sprechen versuche, würde ich mir wirklich wünschen, dass wir über die Inhalte der europäischen Politik reden und nicht über deren Werte und Ziele. Die Werte und die Ziele stehen fest, und sie sind in den Verträgen auch gut festgelegt. Hingegen fehlt die Diskussion über den Weg, der zur Realisation dieser Werte und Ziele führt, also zur europäischen Politik. Diese Diskussion fehlt, weil es europäische Bürger nicht patriotisch begeistert, wenn von Mindeststandards die Rede ist. Ich weiß, dass politisch anderes nicht machbar ist, aber die Begeisterung der Bürger bleibt aus.
Wer will Mindeststandards? – Diejenigen, die Mindeststandards nicht brauchen, rufen nach Mindeststandards. Diejenigen, die Mindeststandards brauchen, wollen mehr als Mindeststandards. Sie wollen maximale Standards haben. Und hier ist die Lücke, nämlich die institutionelle Lücke, auf die man plötzlich stößt, wenn man über Inhalte nachdenkt! Wo sind die politischen Parteien in Europa, die Programme formulieren? Wo sind die politischen Parteien, die sich organisieren und sagen: Jetzt wollen wir – natürlich über die Parlamente beziehungsweise über das Europäische Parlament – Einfluss auf den politischen Prozess gewinnen? Daran fehlt es! Daran fehlt es gravierend! Wenn man aber diesen Prozess der Formulierung politischer Programme ins Auge fasst, dann wird man auch auf die Institutionenreform einen anderen Blick gewinnen. Dann wird die Rolle der Kommission anders aussehen, als sie heute aussieht. Diese kurze Bemerkung zu machen habe ich mir als Bürger gestattet. – Danke. (Beifall.)
10.39
Vorsitzender Präsident Dr. Heinz Fischer: Ich habe schon gefürchtet, dass Sie als Experte und Bürger zweimal 5 Minuten in Anspruch nehmen werden. Das war aber nicht der Fall!
Mir liegen zu diesem ersten Teil keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wenn wir daran denken, dass insgesamt fünf Kapitel auf der Tagesordnung stehen, dann ist es angemessen, jetzt abzuschließen und zum Thema II voranzuschreiten.
Herr Professor Winkler hat sich noch zu Wort gemeldet. – Bitte.
10.40
Univ.-Prof. Dr. DDr. h. c. Günther Winkler (Universität Wien, Institut für Staats- und Verwaltungsrecht): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich möchte nur ein kurzes Statement abgeben, und zwar zuerst ein Bekenntnis zu Europa.
Ich bin ein alter Europäer. Ich war im Jahre 1959 in Brügge an der Errichtung der Europäischen Universität beteiligt und freue mich heute noch darüber. Ich habe als Rektor der Wiener Universität mit großer Zustimmung und Freude die Herderpreis-Vergaben an die Kulturvertreter der Oststaaten getätigt und gefördert.
Ich bin aber nicht europa-euphorisch, sondern ich bin europakritisch und -skeptisch – aber konstruktiv.
Eine weitere Vorbemerkung: Ich beglückwünsche den Nationalrat zu dieser Tagung! Ich halte sie für wegweisend und wichtig, und ich hoffe, dass noch viele folgen werden! Ich hoffe, dass der Hauptausschuss sich monatlich trifft, um Europafragen zu diskutieren, und ich hoffe, dass das Plenum mindestens zweimal im Jahr ganztägig oder mehrtägig Europafragen diskutiert.
Ich erinnere mich mit Unruhe und Besorgnis an ein Gespräch mit einem deutschen Mitglied des Bundestages beim Juristenball vor mehr als zehn Jahren: Er hat geradezu ironisch und abwertend darüber berichtet, wie er als Schlüsselfigur und Bindeglied zwischen Parlament und europäischen Organen die Abgeordneten mit seinen Stellungnahmen abspeist, die nicht einmal fundiert seien. Vielmehr habe er einfach das, was in Europa geschehen sei und was die europäischen Organe gemacht haben, als okay befunden. Und der Bundestag hat zugestimmt.
Diese Rolle hatte der Nationalrat nicht, aber ich glaube, der Nationalrat sollte sich seiner Bedeutung bewusst werden: Nach unserer Verfassung trägt er die Hauptverantwortung im Staat. Die Regierung ist dem Nationalrat verantwortlich. Der Nationalrat kann Interpellationen und Resolutionen gegenüber der Regierung wahrnehmen und kann als Gesetzgeber in Fragen der europäischen Gesetzgebung der Regierung als Vertreterin im Rat natürlich auch Gesetzgebungsaufträge erteilen. Die Regierung steht in Fragen europäischer Gesetzgebung in einem gebundenen Mandat gegenüber dem Parlament.
Heinrich Neisser hat kürzlich ein Buch herausgebracht: „Die Europäische Union“. Es ist dies ein sehr niveauvolles Buch. – Es ist in der Wissenschaft sehr viel geschrieben und sehr viel Unsinn gesagt worden. Ich bin besorgt und wollte mich eigentlich heute gar nicht hier einfinden, weil ich über die Wirrnis desperat bin, welche die Wissenschaft in das Europarecht hineinträgt: Da wird künstlich zwischen Völkerrecht und Staatsrecht unterschieden. Und niemand bedenkt, dass das Recht ein einheitliches und ein ganzes ist, dass es nur Nuancierungen, Differenzierungen und Verzahnungen gibt und dass man sorgfältig unterscheiden muss nach der Herkunft des Rechtes, nach der Verbindlichkeit des Rechtes und nach den Weisungen, die in dem Recht enthalten sind, gerichtet auf die Organe und auf die Bürger, die in der Gemeinschaft Europas zusammengefasst sind.
Ich halte nichts von der Frage: Ist die EU eine juristische Person oder nicht? – Ich glaube, sie ist eine, wenn auch zweifellos nur beschränkt. Aber das ist kein wichtiges Thema. Der Verfassungsgerichtshof hat einmal gesagt: Wenn jemand nur ein einziges Recht hat, dann hat er Rechtsfähigkeit und Handlungsfähigkeit und ist insofern als juristische Person zu betrachten. Und das gilt selbstverständlich auch für die Europäische Union.
Ist die Europäische Union ein Staat? – Meine Damen und Herren! Das ist eine völlig unnütze Frage! Was ist denn wirklich ein Staat? Es gibt nicht den Einheits-Idealstaat, an dem man Europa messen und sagen könnte: Es ist dies ein Staat, oder es ist kein Staat. Die Staatlichkeitskomponenten in Europa, und zwar selbstverständlich auf der Grundlage des Völkerrechtes, sind schon enorm fortgeschritten und nicht mehr wegzudenken. Aber anstatt Alternativen aufzustellen im Sinne von: hier Völkerrecht und hier Staatsrecht, müsste man integrativ denken. Man müsste das allgemeine und partikuläre Völkerrecht als Grundlage für das Vertragsrecht betrachten, nämlich das universelle Völkerrecht und das partikuläre Völkerrecht in Europa als Grundlage des Ganzen. Das soll die Grundlage für die Schaffung von Institutionen und Organen sein, die wie staatliche Organe rechtsverbindlich handeln. Man sollte sich viel mehr um die Qualität der Rechtsakte der Union kümmern und nicht von „Soft Law“ und „Hard Law“ sprechen. Das ist Unsinn und eine Verantwortungslosigkeit! Der Bürger wird mit dem „Soft Law“-Argument nicht zufrieden sein, da ein solcher Bereich ihm als zu wenig griffig erscheint und sich für ihn die Frage erhebt, wo der Rechtsschutz und die Verantwortung bleiben. Das kann einen mit Besorgnis erfüllen!
Ist Europa ein Bundesstaat oder eine Föderation? – Auch das ist eine müßige Frage. (Vorsitzender Präsident Dr. Fischer gibt das Glockenzeichen.) Herr Präsident! Ich komme gleich zum Schluss! Nur noch eine halbe Minute! Man soll mich nicht um das Wort bitten! Ich bin ein Professor, und es fällt mir sehr schwer, rechtzeitig zu stoppen! (Beifall.) Aber ich werde diszipliniert sein! Ich werde ja später noch einmal die Gelegenheit haben, etwas zu sagen.
Ich möchte noch einmal erwähnen: Heinrich Neisser hat ein Buch herausgebracht, und in diesem zeichnet er Europa wie einen klassischen griechischen Tempel. Das Dach ist die Europäische Union, außerdem gibt es drei Säulen und ein Fundament. Und überall sieht man Namen, nur im Fundament nicht, meine Damen und Herren! Das Fundament sind die staatlichen Verfassungen und die Parlamente. – Ich danke, Herr Präsident. (Beifall.)
10.46
Vorsitzender Präsident Dr. Heinz Fischer: Ich danke Herrn Professor Winkler, der in den letzten 35 Jahren von seinem Temperament nichts eingebüßt hat.
Ich glaube, nun können wir den ersten Abschnitt abschließen.
II. Eine klare Aufgabenverteilung zwischen der Union und ihren Mitgliedern
Vorsitzender Präsident Dr. Heinz Fischer: Wir kommen zum zweiten Thema, der Frage der Aufgabenverteilung zwischen der Union und ihren Mitgliedern.
Die Einleitung macht Herr Universitätsprofessor Dr. Firlei, dem ich hiemit das Wort erteile. Die Redezeit beträgt 15 Minuten. – Bitte.
10.47
Univ.-Prof. Dr. Klaus Firlei (Universität Salzburg, Institut für Arbeits- und Sozialrecht): Herr Präsident! Herr Bundeskanzler! Der Ausdruck „Kompetenz“ hat ein Doppelgesicht. Zum einen bezeichnet man damit Regelungsbefugnisse, Machtausübung, Gestaltung, also Zuständigkeiten. Zum anderen bedeutet Kompetenz die Fähigkeit zur Gestaltung, zu einer zielgerechten, unter Umständen bürgernahen, problemlösenden Gestaltung. – Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man die europäische Kompetenzfrage vor allem unter diesem zweiten Aspekt der Gestaltungsfähigkeit sieht.
Das Thema meines Referats „Aufgabenverteilung zwischen der Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten, klare Abgrenzungen“ fordert geradezu den Zynismus heraus. – Es wurde schon gesagt: Die Aufgabenverteilung ist weder klar abgegrenzt, noch hat die Gemeinschaft wirklich Kompetenzen im Sinn politischer Gestaltungsfähigkeit, noch gibt es eine Verteilung, denn Verteilung heißt: das da und das dort – etwa so wie in Artikel 10 bis 15 B-VG, oder wie auch immer –, allenfalls mit Koordinierungsmöglichkeiten. So etwas haben wir aber nicht.
Wenn Helmut Schmidt von einem Kompetenzimperialismus spricht, so mag das aus formaler Sicht durchaus richtig sein, denn wenn ich mir Artikel 100 – ich zitiere die alten Nummerierungen – oder Artikel 235 ansehe, dann heißt das ja eigentlich: Die Kompetenz-Kompetenz, die der Gemeinschaft abgesprochen wird, liegt bei ihr. – Das ist ein erstaunliches Ergebnis!
Kompetenz hat aber auch weitere Dimensionen. Es hat keinen Sinn, von „leeren Kompetenzen“ zu reden. Kompetenzen zu analysieren und die Frage zu stellen, wie sie sich weiterentwickeln sollen, bedeutet, zu definieren, wie die Verfahren und die Realitäten aussehen, um Kompetenzen zum Leben zu verhelfen.
In unserer heutigen Welt gibt es ein gutes Beispiel dafür, dass Akteure überhaupt keine rechtliche Kompetenz haben und trotzdem die Welt gestalten: die Wirtschaft. In der Gemeinschaft haben wir die Situation, dass die Organe hochgradig mit Kompetenzen ausgestattet sind, im Grunde mit allen Kompetenzen – ich komme aus dem Arbeits- und Sozialrecht –, die man sich wünschen kann. Denken Sie daran, dass das gesamte kollektive Arbeitsrecht jetzt durch die Gemeinschaft geregelt werden kann. Denken Sie daran, dass das gesamte Recht der sozialen Sicherheit, jedenfalls für Arbeitnehmer, durch die Gemeinschaft geregelt werden kann. Da bleibt also kein Wunsch offen.
Aber auf der Verfahrensebene ist die Kompetenzausstattung konterkariert. Sie kann sich nicht entfalten. Verehrte Regierungsmitglieder! Stellen Sie sich vor, Sie müssten in Österreich jeweils mit 70-Prozent-Mehrheiten unsere Gesellschaft gestalten! Das ist das Problem. Und stellen Sie sich vor, Sie müssten sie noch dazu vor einem Hintergrund völlig divergierender Interessen, völlig divergierender kultureller Sichtweisen, völlig divergierender Philosophien über die Wirtschaft – die einen setzen auf Deregulierung, die anderen auf Regulierung – gestalten. Das ist ein hoffnungsloses Unterfangen! Welche Schlussfolgerungen ziehen wir daraus?
Erlauben Sie mir, bevor ich zu diesen Schlussfolgerungen komme – meine Zeit ist sehr knapp –, doch noch eine etwas unkonventionelle These: Es klang ja schon durch, dass wir keinen europäischen Superstaat wollen. Wir wollen keinen europäischen Zentralstaat, wir wollen kein neues Moskau. – Meine Damen und Herren! Das haben wir aber zum Teil, und zwar auf eine ganz überraschende Weise: Es gibt nämlich in Europa eine neue Wirtschaftsverfassung, die unsere alte österreichische völlig präformiert hat und welche die wirtschaftliche und gesellschaftliche Landschaft in Europa völlig verändert hat: Diese paar Artikel Im EG-Vertrag, die „Grundfreiheiten“, wie sie sich nennen, oder die „vier großen Plagen“, wie manche sagen, der Deregulierungsdruck, die Entfesselung eines schrankenlosen Marktes – gegen den ich nichts habe, es ist dies ein gutes Instrument, um uns wirtschaftlich weiter zu bringen –, die Subventionsverbote, der Monopolabbau, der Druck auf die Staatsfinanzen, all das summiert sich zu einem einzigartigen Ergebnis, nämlich zu einem gigantischen Souveränitätsverlust der Mitgliedstaaten, und zwar nicht auf dem Papier, aber realiter. Das wirkt sich realiter auf die Instrumente unten aus. Schauen Sie sich etwa die Situation in den Bundesländern an, welche Probleme diese jetzt mit der Organisierung der sozialen Dienste, mit der Krankenanstaltenfinanzierung und so weiter haben! Ich brauche hier jetzt keine Liste von Problemen vorzutragen. All das summiert sich jedenfalls zum größten Souveränitätsverlust der Mitgliedstaaten, den es je gegeben hat! Da brauchen wir über Regulierungen und über den Acquis gar nicht zu reden. Auf dieser Ebene spielt es sich ab!
Es ist genau das eingetreten, wovor alle gewarnt haben: Man kann nicht eine EU auf Basis des Binnenmarktes konstruieren und dann auf der anderen Seite im Sinne der europäischen Idee der Christdemokraten und der Sozialdemokraten erwarten, dass Markt und Wirtschaft einerseits und Politik andererseits in einem Gleichgewicht sein müssen. Dass Märkte, die sich schrankenlos entfalten, ein Gegengewicht brauchen, das bezeichne ich jetzt nicht als Ideologie – Sie können es aber auch so nennen –, sondern das ist schlicht und einfach christliche Soziallehre beziehungsweise soziale Marktwirtschaft. Die Idee von den „countervailing powers“ ist nichts Revolutionäres, das hatten wir immer, das ist das Erfolgsrezept aller europäischen Staaten.
Nun entfaltet dieser Binnenmarkt eine Dynamik ohnegleichen einfach in Form einer Kontextsteuerung. Das ist eine teuflische Geschichte, und zwar nicht, weil niemand handelt, sondern weil niemand handeln kann, und da passiert es dann. Ich darf das an einem einzigen Beispiel ausführen, wie es sich heute in Europa tagtäglich abspielt: Da werden etwa in Murcia riesige Erdbeerplantagen errichtet, auf welchen unter Plastikhüllen marokkanische Arbeiter unter unglaublichen Verhältnissen die Erdbeeren pflücken, und sie werden dann auf LKW, wenn auch nicht gefördert, aber doch ohne Kostenwahrheit, nach Mitteleuropa transportiert. Die Standards, unter denen dort produziert wird, liegen auf jeden Fall weit unter jenen der meisten europäischen Staaten.
Der wirtschaftliche Erfolg ist gegeben, weil heute Dumping, Sozialdumping und Umweltdumping, überall vor sich geht. Das sieht man auch im Arbeitsrecht. Wir bräuchten längst Regelungen gegen die atypische Arbeit und zur Sicherung der Arbeitnehmer. Die betreffenden Richtlinien liegen seit Ende der achtziger Jahre bei den Organen, und es ist Einstimmigkeit erforderlich. Da brauche ich Ihnen nichts zu sagen! Denken Sie an das Schicksal der Arbeitszeitrichtlinie: Diese lächerliche 48‑Stunden‑Richtlinie konnte nur zustande kommen, weil sie auf der Basis qualifizierter Mehrheit verabschiedet wurde. England hat dagegen geklagt, und zwar in einem Punkt erfolgreich: Die Wochenendruhe ist hinausgeflogen, weil der EuGH gesagt hat, dass das nichts mit Arbeitsschutz zu tun hat und daher dafür Einstimmigkeit erforderlich ist. Die Engländer mit ihrer Philosophie des 24-Stunden-Arbeitens haben sich durchgesetzt, und es gibt daher keine europäische Wochenendruhe.
Ich könnte Hunderte von Beispielen nennen. Das ist die Realität!
Ich muss da abrupt abbrechen und komme zu den Schlussfolgerungen. – Es gibt eine Schlussfolgerung, die dem klassischen Verfassungsdenken entspricht, indem man einfach sagt: Warum soll das, was bisher in den europäischen Staaten immer gegolten hat, nicht auch für die Gemeinschaft gelten? Handlungsfähigkeit bedeutet Mehrheitsentscheidungen, Handlungsfähigkeit bedeutet europäische Politik und nicht nationalstaatliche Politik, Handlungsfähigkeit bedeutet Demokratisierung, Handlungsfähigkeit bedeutet ein starkes Parlament. Wenn man das so sieht – Sie sehen, dass ich in Kategorien von „wenn“ und „dann“ rede –, dann kann man sagen: Das ist eine brillante Idee. Es werden europäische Diskurse geführt. Die Europäer diskutieren nicht mehr als Engländer, als Österreicher oder als Spanier, sondern sie diskutieren als Arbeitnehmer, als Konsumenten, als Sozialdemokraten, als Konservative, als Ultraliberale oder als was auch immer. Und dann wird so entschieden, wie es in zivilisierten europäischen Demokratien seit jeher üblich war.
Meine Damen und Herren! Diesbezüglich bin ich allerdings einer Meinung mit einigen, die hier eine gewisse Skepsis angemeldet haben. Ich brauche mir jetzt nämlich nur England oder andere Staaten anzuschauen, um zu sehen, wie immer wieder nationale Egoismen eine Rolle spielen. Verfassungsfragen und Kompetenzfragen aber sind das Sensibelste überhaupt! Und ich darf Herrn Präsidenten Schreiner als Zeugen dafür aufrufen: Im Bereich der Föderalismusreform oder Bundesstaatsreform läuft nichts, nicht einmal in Österreich, innerhalb eines homogenen Staatsgebiets, bei dem wir auf dem Reißbrett wüssten, wohin was gehört, und zwar auf Grund einer wissenschaftlichen Kompetenztheorie, die – ich glaube, es war Ende der achtziger Jahre – bereits in einem dicken Band des Bundeskanzleramtes festgelegt wurde.
Ja, wie soll da eine Kompetenzverteilung zustande kommen – klarerweise auf Einstimmigkeitsbasis? – Oder denken Sie an den Big Bang, dass es nicht nur einen Verfassungskonvent geben, sondern das europäische Volk gefragt werden sollte: Wollt ihr ein anderes Europa?
Ich habe dafür natürlich keine wirklichen Lösungen, das ist klar, aber zumindest ein paar Ideen. Kelsen würde es überhaupt ablehnen, über dieses Thema zu reden.
Ich denke mir – und damit bin ich fast am Ende –: Wir müssen zwei weitere Dinge ins Auge fassen, und aus dieser Perspektive sieht die europäische Verfassungsdebatte etwas anders aus, als wenn man sozusagen am Reißbrett eine neue Verfassung konzipiert. – Ich kann das jetzt nur mehr kurz umreißen:
Punkt eins: Wir haben Europa doch eigentlich geschaffen, damit wir in Europa die großen Probleme lösen können, für deren Lösung die kleinen Mitgliedstaaten zu klein sind. Was ist das? – Grundsicherungen, Armutsbekämpfung, Schutz der prekären Arbeit, Schutz der europäischen Kultur vor dem allumfassenden amerikanischen Kulturimperialismus, Schutz unserer Umwelt, eine andere, gerechtere Weltwirtschaftsordnung. – Das sind die Fragen, für die wir Europa geschaffen haben! Wir haben es nicht für die Formulierung einer Nachweisrichtlinie geschaffen, die den alten Dienstzettel des Angestelltengesetzes noch einmal regelt. – Für die Auseinandersetzung mit den genannten Fragen brauchen wir aber eine europäische Politikebene, die anders konzipiert ist, die auf einem lebendigen Fundament aufbaut, das nicht mehr Abstimmungsdemokratie sein kann, sondern das sich einfach und schlicht – ich kann jetzt nur mehr in Schlagworten reden – als „Zivilgesellschaft“ bezeichnet. Das heißt, wir müssen investieren und Geld und Ideen in die Entstehung einer lebendigen europäischen Zivilgesellschaft hineinpumpen, denn nur aus dieser wird eine neue Verfassungsordnung entstehen.
Wir müssen noch ein Weiteres bedenken, nämlich dass es den alten Staat bald nicht mehr geben wird. Der Staat verändert sich in rasantem Tempo in das, was einige Verfassungspolitiker, Verfassungsrechtler und Politologen „Supervisionsstaat“ nennen. Das heißt, der alte anordnende Staat verschwindet zunehmend, und zwar wegen der Komplexität der Probleme, weil es eben nicht mehr möglich ist, etwa Armutspolitik sozusagen in Form von Gesetzen zu machen. Vielmehr ist das ein Projekt, zu welchem man die Regionen, die Gewerkschaften, die Wissenschaft, die Mitgliedstaaten und schließlich eben die Europäische Union braucht.
Das heißt, der moderne Staat organisiert, leitet an, motiviert und schafft Bewusstsein. Das heißt, er arbeitet im Grunde – ich bitte, das zu überlegen! – wie ein erfolgreiches Unternehmen. Er managt intelligent Projekte. Wir sehen das auch in Österreich, dass wir dort, wo wir mit Gesetzen arbeiten, eigentlich nichts mehr weiterbringen. Vielmehr müssen wir Verbände einbinden und Bewusstsein schaffen, wenn wir etwas weiterbringen wollen, wir brauchen dazu etwa auch die Wissenschaft.
Das Ganze ist ein so komplexer Prozess, dass die einfachen alten Modelle à la „hier Gesetz – hier Vollziehung“ und „friss Bürger oder stirb!“ nicht mehr funktionieren. Der neue Staat wird ein Staat sein, der mit der Wirtschaft verhandeln muss, der Arbeit organisieren müssen wird, der die Zivilgesellschaft einbindet und vieles andere mehr. Ich kann jetzt nicht alles ausführen.
Das bedeutet, dass wir uns die Frage stellen müssen, ob die Vision des alten Verfassungsstaates des 19. Jahrhunderts mit Kompetenzverteilung, Gewaltentrennung, Mehrheitsentscheidungen und so weiter überhaupt noch ein angemessenes Modell für den Staat des 21. Jahrhunderts ist. – Ich zweifle daran.
Ich glaube, dass die Union in systemische Intelligenz investieren muss, dass die Organe oben die Fähigkeit haben müssen, die großen Projekte Europas – von Kultur über Arbeit zu Sozialem – zu organisieren, die vertikalen Vernetzungen zwischen den verschiedenen Ebenen von oben bis unten zu schaffen, die Wissenschaft einzubinden, Forschungsprojekte zu gestalten, europäische Märkte mit öffentlicher Nachfrage zu gestalten und auch weltweit auszuweiten. – Das wäre die Aufgabe! Das heißt, dass die Frage einer echten Kompetenzabgrenzung in unserem Jahrhundert vielleicht bereits falsch gestellt ist. Vermutlich geht es darum, koordinierende, motivierende, anleitende, die richtigen Partner zusammenbringende, auf Synergieeffekte setzende Konzepte zu verwirklichen, und nicht darum, in den alten Verfassungskategorien zu denken. Das ist sehr anspruchsvoll, aber wahrscheinlich wirkungsvoller.
Kompetenz – ich bin beim Anfang meiner Definition und bin auch schon fertig – bedeutet Gestaltungsmacht, und Gestaltungsmacht gewinnt man heute, in einer Zeit der Internationalisierung und sehr hoher Komplexität, nicht ausschließlich über Gesetzgebung, sondern vor allem über das Organisieren der großen politischen Aufgaben in Europa. Das bedeutet aber auch, dass die Kompetenzfrage so zu stellen ist, dass die Massierung der Mittel, auch der Finanzmittel, und die Möglichkeit, solche Projekte zu organisieren, bei den europäischen Institutionen verankert sein muss. Wo dann die jeweiligen Prioritäten liegen, ist eine Frage der Beobachtung der letzten 15 Jahre der Rechtsentwicklung. (Präsident Dr. Fasslabend übernimmt den Vorsitz.)
Die Motoren der europäischen Integration und der Problemlösung – etwa wo die Richtlinienvorschläge herkommen, die wir brauchen – waren die Kommission, das muss ich ganz offen sagen, und der Europäische Gerichtshof. Die Bremsen liegen anderswo.
Wir haben heute einen Subsidiaritäts-Overkill in Europa, der dringend überwunden werden muss, denn ansonsten wird Europa zu langsam. Denken Sie an einen Satelliten: Wenn er zu schnell ist, weicht er ins Weltall ab, und wenn er zu langsam ist, stürzt er ab. Europa ist derzeit zu langsam. – Danke. (Beifall.)
11.03
Vorsitzender Präsident Dr. Werner Fasslabend: Ich danke für das Einleitungsstatement, Herr Professor.
Diskussion
Vorsitzender Präsident Dr. Werner Fasslabend: Wir gehen damit in die Diskussion ein.
Als Erster hat sich Herr Abgeordneter Dr. Stummvoll zu Wort gemeldet. – Bitte.
11.04
Abgeordneter Dkfm. Dr. Günter Stummvoll (ÖVP): Herr Vorsitzender! Herr Bundeskanzler! Frau Vizekanzlerin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir diskutieren den Abschnitt „Aufgabenteilung zwischen Union und Mitgliedstaaten“. Ich möchte keinen juristisch fundierten Diskussionsbeitrag liefern, sondern aus einer bewusst ganz einfachen politischen Sicht zu diesem Thema etwas sagen.
Wenn wir heute über die Zukunft, über die künftige Entwicklung Europas diskutieren, dann muss uns bewusst sein – ich spreche diese Banalität aus –, dass diese Entwicklung letztlich davon bestimmt wird, inwieweit die politische Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger dafür vorhanden ist.
Ich glaube, dass wir Europa dieser großen Idee folgend nicht dazu gegründet haben, dass uns im Rahmen der Aufgabenteilung zwischen der EU und den einzelnen Mitgliedstaaten von der EU vorgeschrieben wird, wie der Krümmungsradius von Gurken aussehen soll, und dass uns bis in die kleinste Gemeinde vorgeschrieben wird, wie „Natura 2000“ sich auf Standorte von Betrieben in einzelnen Gemeinden auszuwirken hat. Wir hatten die europäische Idee nicht, damit den Kleinstbetrieben vorgeschrieben wird, dass sie im Rahmen gesamteuropäischer Konjunkturumfragen jeden Monat seitenweise Formulare ausfüllen müssen. Diese Aufgabenteilung war nicht die europäische Idee! So tritt sie den Bürgern aber vielfach entgegen.
Ich glaube, wir sind politisch gefordert, dafür zu sorgen, dass wir wieder dorthin kommen, wo eigentlich die große Hoffnung und Zukunftsvision Europas liegt. Wir können uns sofort der politischen Akzeptanz unserer Bürgerinnen und Bürger sicher sein, wenn wir uns sehr auf die Fragen der Sicherheit und Friedenspolitik konzentrieren. Dem stimmt der Bürger zu. Deshalb will er diese Europäische Union. Wir stoßen auch sofort auf Akzeptanz, wenn wir sagen, dass Arbeitsplätze und Einkommenschancen für die Existenz der Bürger enorm wichtig sind oder dass die Europäische Union dazu da ist, im brutalen globalen Wettbewerb zwischen Amerika, Asien und Europa Arbeitsplätze und Einkommenschancen in Europa zu sichern. Außerdem bekommen wir wahrscheinlich sofort politische Akzeptanz, wenn wir sagen, dass die Europäische Union sich stark auf die Frage konzentriert, wie wir gemeinsame Strategien zur Erhaltung einer lebenswerten Umwelt für unsere Kinder und Enkel entwickeln können.
Ich glaube, das sollte die politische Sicht einer Aufgabenteilung zwischen der Europäischen Union und den einzelnen Mitgliedstaaten sein! Mir geht es gar nicht so sehr um die Frage, wie man einzelne Dinge im Detail juristisch abgrenzt, sondern ich glaube, dass diese politische Akzeptanz die Voraussetzung dafür ist, dass sich Europa weiterentwickeln kann.
Meine Damen und Herren! Ich glaube, der Bürger hat ein feines Gespür, und wenn wir uns zu demokratischen Wahlergebnissen bekennen, dann können wir ehrlicherweise nicht damit argumentieren, dass sich der Bürger geirrt hat. Wir können nicht sagen, dass sich 300 000 Iren geirrt haben. Das ist nicht legitim! Wenn es uns, die wir von der europäischen Idee und von den Vorteilen dieser Europäischen Union überzeugt sind, nicht gelingt, das dem Bürger zu kommunizieren und entsprechend zu argumentieren, dann liegt der Fehler bei uns und nicht beim Bürger! – In diesem Sinne kann in einer Demokratie der Bürger überhaupt nicht irren, sondern es ist letztlich unser Versagen, indem wir die Idee und die Vorteile offensichtlich nicht entsprechend kommuniziert haben.
Frau Vizekanzlerin! Mir hat Ihre heutige Formulierung insofern recht gut gefallen, als Sie im Konjunktiv gesagt haben, dass wir so kommunizieren sollten, als gäbe es letztlich eine Volksabstimmung. Es wird sie nicht geben, weil dies der europäischen Idee widerspricht und weil es neue Gräben aufreißen würde. Würden wir jetzt etwa sagen, dass die Tschechen nicht in die Europäische Union dürfen, dann widerspricht das der ursprünglichen Friedensidee der Völker Europas. Wir können aber so tun, als ob es eine Volksabstimmung gäbe, denn das bedeutet, dass wir im Bereich Kommunikation und Argumentation enorm gefordert sind. Das ist genauso, wie ich es in einem anderen Bereich einmal gesagt habe: Ich bekenne mich zur Pflichtmitgliedschaft bei den Kammern. Trotzdem sind diese so zu führen, als gäbe es die Pflichtmitgliedschaft nicht und als könnte jedes Mitglied morgen austreten. – Das ist ein ähnlicher Sachverhalt. Ich bekenne mich dazu, aber wir tun so als ob, weil das eine größere Herausforderung ist.
Ich glaube, wir Politiker müssen sagen, dass sich die Herausforderung uns stellt. Wenn wir überzeugt sind von den europäischen Zukunftsvisionen, dann liegt es nur an uns, den Bürgerinnen und Bürgern diese Vorteile entsprechend zu kommunizieren. – Das wäre aus meiner Sicht der politische Aspekt einer Aufgabenteilung zwischen der EU und den einzelnen Mitgliedstaaten. (Beifall.)
11.09
Vorsitzender Präsident Dr. Werner Fasslabend: Nächster Redner ist Herr Mag. Ilgenfritz, Vertreter der Kärntner Landesregierung. – Bitte.
11.09
Mag. Wolfgang Ilgenfritz (Kärntner Landesregierung): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Kanzler! Sehr geehrte Frau Vizekanzlerin! Sehr geehrte Damen und Herren! Kompetenz ist wichtig, darüber sind sich hier in diesem Raum alle einig. Allerdings sollte sie auch klar geregelt sein, denn unklare Kompetenzen führen im Regelfall zu Streitigkeiten, und die Folge davon ist Vertrauensschwund.
Auch in der kleinsten Zelle, nämlich in der Familie, ist es daher wichtig, dass wir nach Möglichkeit für eine klare Kompetenzverteilung sorgen, damit dieses Institut auch dementsprechend gut funktioniert, was wiederum wichtig ist für das Funktionieren unseres Gesamtstaates.
Dass Kompetenzprobleme aber nicht nur unsere kleinste Zelle und damit wiederum unseren Staat gefährden können, das haben wir, wie ich meine, am Fall Nizza beziehungsweise an der Reaktion des irischen Volkes hautnah miterlebt. Wir sollten diese Warnungen ernst nehmen und entsprechende Diskussionen darüber möglichst rasch führen, damit wir diesen Problembereich – ich glaube, in diesem Zusammenhang kann man offen von einem Problembereich der Union sprechen – in den Griff bekommen.
Ich meine aber auch, dass gerade die Verhängung der Sanktionen gegen Österreich ein Beispiel dafür war, dass Kompetenzen klar überschritten beziehungsweise völlig missverstanden, aber auch falsch eingesetzt wurden. Dadurch bekommen die Menschen in unserem gemeinsamen Europa das Gefühl, dass wir sie überfahren und dass wir sie entmündigen. Und wir selbst, die in diesem Europa Mitverantwortung tragen, sind letzten Endes dann auch diesbezüglich zur Rechenschaft zu ziehen.
Es gibt viele Vorschläge, wie wir die Kompetenzverteilung diskutieren beziehungsweise regeln könnten. Der Vorschlag, dass das Subsidiaritätsprinzip mehr präzisiert beziehungsweise erweitert wird, ist sicherlich gut, genügt meiner Meinung nach aber nicht. Das könnte vielleicht ein erster Schritt in die richtige Richtung sein. Das Ziel sollte es jedoch sein, eine positive wie negative Kompetenzabgrenzung innerhalb der Union zu regeln, und sei es auf dem Wege eines Teils unserer gemeinsamen Verfassung, wobei aber klar geregelt sein muss, wofür die Union steht, welche Rechte die Union hat, aber auch umgekehrt geregelt ist, welche Rechte die Union nicht hat.
Auch die Einführung des Klagerechtes ist ein sinnvoller Weg, um in Zukunft Kompetenzprobleme beziehungsweise Unklarheiten, die auch bei einer noch besseren Regelung möglich sind, zu minimieren, beziehungsweise es würde damit ein Institut zur Stärkung der Demokratie in Europa geschaffen werden.
Ich glaube, dass es, wenn wir die europäischen Bürger in Zukunft besser informieren wollen, notwendig sein wird, dass wir dafür Sorge tragen, dass wir eine klarere Kompetenzabgrenzung beziehungsweise Kompetenzverteilung in Europa bekommen. Es muss unser Ziel sein, ein Europa zu schaffen, in dem sich die Bürger Europas wohl fühlen, damit sie uns keine Absage erteilen. – Danke. (Beifall.)
11.13
Vorsitzender Präsident Dr. Werner Fasslabend: Nächster Redner ist Herr Bundesrat Schöls. – Bitte.
11.13
Bundesrat Alfred Schöls (ÖVP, Niederösterreich): Herr Präsident! Herr Bundeskanzler! Frau Vizekanzlerin! Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Der ehemalige Präsident des Europäischen Parlaments Hänsch hat einmal gesagt:
„Wenn die liebe Sonne lacht, haben wir es selbst gemacht; gibt es Regen, Sturm und Schnee: schuld daran ist die EG.“
Ich habe mich nicht versprochen, sondern ich wollte damit zum Ausdruck bringen, wie lange wir uns in Europa schon mit der Frage beschäftigen, wer für das Gute zuständig ist und wer für das weniger Gute verantwortlich ist.
Ich bin aber schon lange genug in der Politik, um auch ehrlich sagen zu können, dass das nicht nur in Europa so ist, sondern dass sich das auf allen Ebenen so abspielt: Der Bürgermeister ist bei Feuerwehrfesten nicht nur für das schöne Wetter verantwortlich, sondern er lässt sich auch für die Spende für das Auto feiern, und wenn das Auto nicht so groß ausfällt, wie es sich der Feuerwehrkommandant wünscht, dann ist natürlich das Land zuständig. Auch die Landeshauptleute und auch die Präsidenten der Landtage – da ist keiner auszunehmen – halten es natürlich so, dass für das Schöne das Land zuständig ist, für das weniger Schöne hingegen „die in Wien“ zuständig sind. – Es kommt dann auf den Grad der Entfernung an, wie man es sagt.
Daher haben wir Politiker ganz einfach damit zu leben, dass diese Diskussion läuft. Ich glaube aber, dass es auch in unserer politischen Verantwortung liegt, darauf hinzuweisen, dass es in Wirklichkeit keine Alternative zu dieser Wertegemeinschaft und zu diesem Friedensprojekt Europa gibt. Und wir Politiker haben, wie ich glaube, die Verpflichtung, den Bürgern Europas die Angst zu nehmen.
Herr Abgeordneter Voggenhuber! Ich habe mich wirklich gewundert, als ich Sie hier von nationalen Regierungen reden gehört habe! Ich weiß nicht, wo Sie diese erlebt haben! Ich bin für den Gewerkschaftsbereich meiner Christlichen Fraktion auch ein bisschen in Europa unterwegs, aber die Gespenster, die Sie hier an die Wand gemalt haben, sind mir noch nicht untergekommen!
Wir Politiker müssen unserer Gestaltungsverpflichtung nachkommen. Ich sehe in jenen Punkten, mit welchen sich beispielsweise die Präsidentenkonferenz der Landtagspräsidenten und auch die Konferenz der Landtagspräsidenten Deutschlands, Südtirols und Österreichs befasst haben, sehr wohl einen Ansatz, der zumindest für mich als Christdemokraten klarmacht, dass das Subsidiaritätsprinzip die Leitlinie für jede Kompetenzabgrenzung und für jede Kompetenzbereinigung zu sein hat. Das müssen wir den Menschen verständlich machen.
Herr Professor! Ich bin mit Ihnen eines Sinnes, dass wir diesbezüglich Lobbying im schönsten Sinne des Wortes betreiben müssen: Wir müssen den Arbeitnehmern die Ängste vor Europa genauso nehmen wie allen anderen Gruppierungen. Und wenn uns das gelingt – und das sehe ich als eine Verpflichtung der Politik –, dann bin ich zuversichtlich, dass wir ein Europa der Bürger schaffen können.
Um zum Schluss noch einmal eine Seelenverwandtschaft herzustellen: Es handelt sich nicht um eine Frage der Gesetze allein. Gesetze können einiges regeln, aber die politische Vorgabe ist entscheidend. Die Politik muss das Beispiel vorleben, dass wir die Diskussion um Europa nicht wegen des politischen Kleingelds führen, sondern dass wir das visionäre Ziel weiterverfolgen. (Beifall.)
11.17
Vorsitzender Präsident Dr. Werner Fasslabend: Nächster Redner ist Herr Professor Dr. Isak. – Bitte.
11.17
ao. Univ.-Prof. Dr. Hubert Isak (Universität Graz, Institut für Europarecht): Herr Präsident! Herr Bundeskanzler! Frau Außenministerin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich werde versuchen, mich ganz kurz zu fassen, und werde, so wie es meiner Kompetenz im Firlei’schen Sinn entspricht, nicht von den Visionen reden, sondern den schlichten juristischen Zugang zur Thematik suchen.
Was ich – wie es heute geheißen hat – kommunizieren möchte, ist, dass wir uns bei der Frage der Kompetenzabgrenzung vier Dinge überlegen müssen.
Erstens: Gibt es ein tatsächliches Bedürfnis nach einer Neuregelung oder Klarstellung der Kompetenzabgrenzung?
Zweitens: Ist ein Kompetenzkatalog, wie er diskutiert wird, geeignet, diesem Bedürfnis zu entsprechen?
Drittens: Ist in weiterer Folge ein solcher Katalog notwendig?
Viertens: Was wären, wenn wir einen solchen Kompetenzkatalog zustande brächten, dessen Vor‑ und Nachteile?
Zum Bedürfnis nach einer Verbesserung der Situation: Dieses Bedürfnis wird, glaube ich, von niemandem bestritten. Es gibt ganz einfach Schwierigkeiten bei der Anwendung der derzeit den Organen der Gemeinschaften oder der Union eingeräumten Kompetenzen. Das hängt damit zusammen, dass manche Befugnisnormen sehr weit definiert sind und dass sie schwer sowohl voneinander innerhalb der Gemeinschaft als auch gegenüber den Mitgliedstaaten abzugrenzen sind. Und natürlich kann auch das viel beschworene Subsidiaritätsprinzip diese Probleme nicht lösen. Warum? – Weil in Wirklichkeit das Subsidiaritätsprinzip nicht eine Regel ist, die dazu dienen soll, Kompetenzen abzugrenzen, sondern die dazu dienen soll, darüber zu entscheiden, ob eine tatsächlich vorhandene Kompetenz im konkreten Fall auch wirklich angewendet werden kann und muss.
Es gibt also aus föderalistischen Gründen und ganz sicher aus demokratiepolitischen Gründen ein Bedürfnis in dieser Richtung. Diesbezüglich bin ich absolut der Meinung von Herrn Abgeordnetem Voggenhuber. Außerdem gibt es dieses Bedürfnis auch aus Gründen der Bürgernähe und vielleicht auch aus Gründen, die mit dem Verhältnis zwischen Bund und Ländern in unserer Republik zusammenhängen.
Da das unbestritten sein dürfte, ist die nächste Frage: Ist ein Kompetenzkatalog geeignet, diese Bedürfnisse zu befriedigen? – Ich denke, er ist nur in beschränktem Maße geeignet, diese Anwendungsprobleme zu lösen. Warum? – Ich kann das nur an einigen wenigen Beispielen verdeutlichen: Ein Kompetenzkatalog wird letzten Endes unter den besonderen Bedingungen der europäischen Integration nicht in der Lage sein, zu verhindern, dass es Befugnisnormen geben muss, die relativ weit definiert sind. Und damit sind wir sozusagen auf Feld eins zurückverwiesen.
Zweitens wird es im Zusammenhang mit diesem Kompetenzkatalog auch bei großem Bemühen nur beschränkt gelingen, die Abgrenzung einzelner Befugnisse in verschiedenen Politikbereichen so zu gestalten, dass es keinen Zweifel mehr daran gibt.
Trotzdem ist – und das ist zu akzeptieren – gemäß der politischen Auffassung und auch nach Auffassung des Bürgers ein Katalog in gewissem Sinn notwendig. Warum ist ein Kompetenzkatalog notwendig? – Weil andere Alternativmodelle dieses Bedürfnis auch nicht befriedigen können.
Zum Subsidiaritätsprinzip habe ich mich schon geäußert. Negative Kompetenzabgrenzungen, wie sie heute auch hier vorgeschlagen wurden, führen, glaube ich, auch nicht zum Ziel. Eine Streichung der viel zitierten Generalklausel des Artikels 308 würde meines Erachtens das Problem nicht lösen und überdies in völligem Widerspruch zum Wesen der europäischen Integration stehen, die eben als dynamischer Prozess angelegt ist.
Wenn wir nun die Vor- und Nachteile eines solchen Kompetenzkataloges – und damit komme ich schon zum letzten Punkt – gegeneinander abwägen, dann ergeben sich meines Erachtens folgende Aspekte. – Zunächst zu den Nachteilen: Ich denke, dass es berechtigten Zweifel daran geben kann, ob es realistisch ist und wirklich gelingt, die klaren Formulierungen zustande zu bringen, die dafür vonnöten wären, wenn wir im Auge behalten wollen und wenn es dabei bleiben soll, dass es ein Prozess funktioneller Integration ist, in dem die Finalität noch nicht ausdiskutiert ist. Wenn wir allerdings der Meinung sind, dass diese Idee der funktionellen Integration nunmehr aufgegeben werden sollte, weil wir einen bestimmten Entwicklungsstand erreicht haben, dann stellt sich die Sache vielleicht anders dar.
Als zweiten Hauptnachteil würde ich die Tatsache sehen, dass die Gefahr besteht, dass es auch nach einem solchen Versuch der Kompetenzabgrenzung weiterhin weite, unbestimmte Formulierungen geben wird, weil nur die weiten, unbestimmten Formulierungen konsensfähig sein werden.
Die Vorteile eines Kompetenzkataloges sind, glaube ich, unbestritten. Es geht um mehr Transparenz. Es wird erwartet, dass auf diese Weise mehr Stabilität, auch angesichts der sehr kritischen Balance zwischen Europa und den Mitgliedstaaten, und vielleicht mehr Rechtssicherheit in das europäische Gefüge gebracht werden. Allerdings ist das nicht ganz klar herauszulesen.
Letzter Punkt – ich komme zum Ende –: Wie soll der Kompetenzkatalog, wenn es ihn geben wird, aussehen? Soll nach Materien differenziert werden? Soll enumerativ gearbeitet werden? Soll mit negativen Abgrenzungen gearbeitet werden? Oder soll, wie es zum Beispiel Ministerpräsident Klement vorgeschlagen hat, auf einer oberen Ebene nach Bereichen differenziert werden, und sollen dann im Detail Kompetenzen nach unten differenziert werden? Das sind Verfahrensfragen, die man sich überlegen soll, bevor man an dieses Projekt eines Kompetenzkataloges herangeht. – Danke. (Beifall.)
11.23
Vorsitzender Präsident Dr. Werner Fasslabend: Nächster Redner ist Herr Abgeordneter Dr. Einem. – Bitte.
11.24
Abgeordneter Dr. Caspar Einem (SPÖ): Ich komme noch einmal in aller Kürze auf die Kompetenzfrage zu sprechen.
Die Überlegungen von Professor Firlei aufgreifend meine ich, dass es einerseits noch Bereiche gibt, wo es um Gesetzgebung geht und wo diese Frage nicht ganz unbedeutend ist. Betreffend diese Bereiche sollte klar sein, dass Gesetzgebung von Parlamenten ausgeübt wird. Das gilt auch für die europäische Ebene. Dort müssen wir wirklich einen Schritt in eine Richtung tun. Es ist dies nicht der einzige, aber er ist entscheidend.
Zweiter Punkt: Ich habe heute mehrere Forderungen nach dem Klagsrecht der Regionen und Ähnliches mehr gehört. – Dazu meine ich: Was wir in der Europäischen Union nicht brauchen und was im Übrigen – mit Verlaub gesagt – am Interesse der Bürgerinnen und Bürger völlig vorbeigeht, ist die Frage, welche Einheiten jetzt noch zusätzliche Rechte zum Bremsen bekommen sollen. Um dieses Problem geht es überhaupt nicht. Vielmehr geht es darum, im Sinne der Bürgerinnen und Bürger Gestaltungsrechte positiv zu gewinnen.
Ich darf ein Beispiel aus dem kommunalen Bereich nennen: Es geht durchaus darum, Ansatzpunkte dafür zu schaffen, dass die Frage, wie das Verkehrswesen in einer Kommune geregelt wird, nicht ausschließlich nach Binnenmarktgesichtspunkten und letztlich nach den Interessen von Autobusunternehmen in Europa entschieden wird, sondern nach der Frage der Bewältigung des Transportinteresses unter umweltorientierten Bedingungen in einer Kommune. Wenn es dort klare, positive Kompetenzen für kommunale Selbstentscheidung gibt – Ansätze dazu haben wir auch im Rahmen der Grundrechtscharta diskutiert –, dann würde das meines Erachtens eine Chance bieten, auch ein Gegengewicht im Interesse der Bürger zu schaffen. Womit ich bereits mitten in der gesamten Komplexität der Frage bin und schon wieder aufhöre.
11.25
Vorsitzender Präsident Dr. Werner Fasslabend: Nächster Redner ist Herr Dr. Pramböck. – Bitte.
11.25
Dkfm. Dr. Erich Pramböck (Generalsekretär des Österreichischen Städtebundes): Sehr geehrte Frau Bundesministerin! Geschätzte Abgeordnete! Herr Präsident! Als Vertreter des Städtebundes erwarten Sie von mir natürlich eine Stellungnahme aus der Sicht der Städte und Gemeinden.
Ich möchte vorausschicken: Als Städtebund haben wir immer ein klares Bekenntnis zu Europa abgegeben. Ich möchte an dieser Stelle ganz besonders die vorbildhafte Rolle Österreichs in den letzten zehn bis zwölf Jahren betonen, sowohl im Laufe der Vorbereitung auf den EU-Beitritt als auch in der Umsetzung etwa mit der Einbindung vieler Interessengruppen, darunter auch der Städte und Gemeinden als Vertreter der Bürger, die auf der lokalen Ebene gewählt werden.
Ich halte das – ich habe diesbezüglich ebenfalls zehn‑ bis zwölfjährige Erfahrung – für ein ganz hervorragendes österreichisches Ergebnis im Hinblick auf die Einbindung der Ebene, die dem Bürger am nächsten ist. Ich glaube, dass diese Politik beim Referendum 1994 auch eine wesentliche Rolle gespielt hat, und zwar nicht nur bezogen auf die Städte, sondern insgesamt auf Grund der Offenheit der Diskussion und auf Grund der Einbindung und Information der Bürger.
Einige neuere Entwicklungen in der Europäischen Union geben aber durchaus Grund zur Sorge, weil sie in einem gewissen Spannungsverhältnis zum Leben der Menschen in den Städten und Gemeinden stehen. Die Bürger erleben Europa auch in der unmittelbaren Lebensumwelt der Städte und Gemeinden, und zwar in erster Linie durch die Leistungen, welche die Kommunen selbst organisieren und selbst erbringen, beziehungsweise wenn sie selbst entscheiden – das Stichwort ist von Abgeordnetem Einem bereits gefallen –, wie diese Leistungen erbracht werden.
Es handelt sich hiebei vor allem um Leistungen der Daseinsvorsorge, die eine bestimmte Kontinuität, eine bestimmte Qualität und eine bestimmte Flexibilität erfordern, die unter demokratischer Kontrolle von den Städten und Gemeinden erbracht und organisiert werden beziehungsweise im Hinblick auf welche entschieden wird, in welchem Umfang und in welcher Qualität sie tatsächlich erbracht werden. Sie sind ein wesentlicher Teil der Lebensqualität, und sie sind, wie uns auch die Europäische Union versichert, ein Teil des europäischen Gesellschaftsmodells.
Die Gemeinden und Städte sind ganz von sich aus aktiv bei der Erbringung von Leistungen, ohne auf EU-Regelungen zu warten, weil wir in unmittelbarem Bezug und auf Grund des unmittelbaren Auftrags der Bürger tätig werden. Die EU – das muss klar gesagt werden – postuliert keinen Eingriff in die innerstaatliche Struktur. Sie postuliert keinen Eingriff in die Eigentumsstruktur. Die tatsächliche Praxis steht dazu jedoch in einem Spannungsverhältnis, um nicht zu sagen in einem Widerspruch, und sie schafft erhebliche Verunsicherung, weil unter Berufung auf den heute schon mehrfach erwähnten Wettbewerb und den Binnenmarkt ein Eingriff in die Entscheidungsgewalt seitens der Union darüber erfolgt, wie die Leistungen dargestellt und für die Bürger erbracht werden. Das schafft Rechtsunsicherheit und geht in Einzelfällen etwa bis zu der Frage, ob eine deutsche Stadt ein Schwimmbad selbst betreiben kann oder ob sie es ausschreiben und allenfalls einem Privaten übergeben muss.
Das sind Einzelfälle, die unter Umständen weit weg sind. Neu sind aber die Absicht und die Diskussion betreffend die Frage der Verordnungen und Regelungen der Union zur Daseinsvorsorge, die sich bis auf den bereits genannten Nah- und Regionalverkehr und vom Abwasser über den Abfall bis zum Wasser erstrecken – Letzteres wurde aus Gründen der politischen Sensibilität zurückgestellt –, und zwar mit dem Ziel eines Zwangs zur Ausschreibung. Das bedeutet natürlich, dass die Gemeinde, die die Bürger repräsentiert, in ihrer umfassenden Selbstverwaltung und der Möglichkeit, sich selbst zu organisieren und selbst zu entscheiden, massiv ausgehöhlt wird und Selbstgestaltung und Flexibilität weit zurückgedrängt werden.
Das heißt, dass diese entscheidenden Leistungsbereiche im Bereich der Daseinsvorsorge, die für das Leben und die Lebensqualität der Bürger wichtig sind – oder auch für die wirtschaftliche Entwicklung einer Stadt, weil sie hier als Instrumente eingesetzt werden –, auf einige wenige soziale, kulturelle und karitative Aspekte reduziert werden. Um es pointiert zu sagen: Die Verteilung der Armensuppe werden wir in Zukunft wahrscheinlich nicht ausschreiben müssen, bei den restlichen Leistungen könnte es aber durchaus der Fall sein.
Das heißt, die Gemeinde, die bisher nach österreichischem oder mitteleuropäischem Vorbild ein Instrument, nämlich ein Selbstverwaltungs- und Selbstgestaltungskörper mit eigener Entscheidungsfähigkeit war, würde unter Umständen ausschließlich zur Ausschreibung und zur Koordinierung von Leistungen gezwungen werden. Das heißt, es würde sich die Frage stellen, wie Qualität dann definiert wird und welchen Apparat man überhaupt zur Verfügung hat. Und ob man am Ende nur mehr Mindeststandards statt bestmöglicher Standards, wie wir sie in unserem europäischen Gesellschaftsmodell und vor allem in Österreich anstreben, hätte, das sei dahingestellt. (Präsident Dr. Fasslabend gibt das Glockenzeichen.)
Ich rede nicht der wirtschaftlichen Ineffizienz das Wort, das sei mir fern, aber ich möchte eine Diskussion über die Schnittstelle zwischen Selbstgestaltung und Selbstentscheidung auf örtlicher Ebene einerseits und der Regelung, welche Leistungen europaweit ausgeschrieben werden müssen, andererseits anregen.
Die Nennung des Beispiels Nahverkehr wurde mir bereits abgenommen. – Ich halte das für eines der hervorragendsten Beispiele: Ein so komplexes System wie Nahverkehrssysteme und Verkehrsverbünde, die wir Jahrzehnte hindurch aufgebaut haben, einem Ausschreibungsprozess zu unterziehen, ist, wie auch ich glaube, ein sehr gefährliches Vorhaben, das zu Lasten der Städte und Gemeinden gehen könnte!
Ich möchte abschließend sagen: Der Ausschuss der Regionen spielt eine wichtige Rolle. Er ist aber vorläufig erst nach der Grundkonzeption der Regelungen eingebunden. Das offene Koordinierungsverfahren stellt nicht nur für Parlamentarier, sondern auch für Städte und Gemeinden eine gewisse Gefahrenquelle dar, weil Entscheidungen an uns vorbeilaufen. Daher bitte ich, dieser Definition im Hinblick auf die Daseinsvorsorge doch näher zu treten! Das wird sicherlich schwierig sein, die Städte und Gemeinden sind aber selbstverständlich bereit, an diesem Prozess mitzuwirken. Ich bitte, uns auch auf Ebene der Bundesregierung vollinhaltlich in den Dialog mit einzubinden und abschließend zu berücksichtigen ...
11.32
Vorsitzender Präsident Dr. Werner Fasslabend: Danke, Herr Doktor. Sie haben jetzt abschließend ausreichend viel gesagt.
Nächster Redner ist Herr Professor Winkler. – Bitte.
11.33
Univ.-Prof. Dr. DDr. h. c. Günther Winkler¦ (Universität Wien, Institut für Staats- und Verwaltungsrecht): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Punkt II der Tagesordnung lautet: „Eine klare Aufgabenverteilung zwischen der Union und ihren Mitgliedern“, und zu einer klaren Aufgabenverteilung kann man nur ja sagen. Aber man sollte bedenken: Einerseits ist Europa eine Notwendigkeit, andererseits ist Europa ohne die Staaten nicht existenzfähig. Noch ist der Prozess nicht so weit gediehen, dass die Staaten in Auflösung sind und Europa so verdichtet ist, dass es als Einheit selbständig sein könnte.
Im Zusammenhang mit den Kompetenzen müsste man veranschlagen, dass in Artikel 6 EU‑Vertrag auch ein Prinzip festgelegt ist, das „die Identität der Staaten“ heißt. Nicht nur die Subsidiarität ist in der Einleitung und auch an anderen Stellen des EG-Vertrages geregelt, sondern auch die Identität der Staaten, und dazu gehört auch etwas, was in einem ganz anderen Vertragswerk enthalten ist, nämlich in den Beschlüssen der OSZE/KSZE, und zwar das „Selbstbestimmungsrecht der Völker“.
Unter diesem Aspekt muss man sich einmal überlegen, was man mit dem Kompetenzkatalog in Europa anfangen soll. Dabei bewegt mich die Kenntnis des Artikels 5 des Reichsgemeindegesetzes aus dem Jahre 1862 oder 1863, in welchem der eigene Wirkungskreis der Gemeinden im Sinne der Subsidiarität definiert ist. Alles, was die Interessen der Gemeinden zunächst berührt und mit ihren eigenen Kräften besorgt werden kann, ist „ihr eigener Wirkungskreis“.
Das kann man natürlich auch auf Europa mit einer hierarchischen Struktur von Gemeinschaften übertragen. Dabei geht es nicht nur um die EU, sondern auf verschiedenen Ebenen darunter sind die Staaten, in Verbindung mit den Staaten die Regionen, innerhalb der Staaten die Länder und Provinzen und innerhalb der Provinzen die Gemeinden. Dabei handelt es sich jeweils um echte Gemeinschaften, die Aufgaben zu besorgen haben und Kompetenzen im Sinne von Handlungsmacht, aber auch von Handlungsauftrag, Verpflichtung und Verantwortung haben.
Bei der Ordnung der Kompetenzen, die unerlässlich ist, müsste man unterscheiden zwischen den Kompetenzen betreffend Politiken einerseits, nämlich hinsichtlich der Zielsetzungen, der allgemeinen richtungsweisenden Ideen und Leitlinien, und Kompetenzen betreffend Rechtsakte andererseits.
Für Rechtsakte muss es klare und feste Kompetenzen geben, oder es funktioniert gar nichts! Daher ist die Generalklausel problematisch. Diese muss man sich wirklich überlegen! Und wenn im Zusammenhang mit Reformideen von einer Kompetenzverteilungsdynamik oder von flexiblen Kompetenzverteilungen die Rede ist, dann kann ich nur davor warnen. Was nämlich heute verteilt ist, meine Damen und Herren, ist morgen Gegenstand neuer Politiken und kann wieder neu verteilt werden. Es ist ja das Wesen einer Gemeinschaft, dass man durch das Recht die Erfordernisse der Zeit erfüllt, und wenn es neue Erfordernisse gibt, dann wird man eben neue Entscheidungen treffen, und wenn die Kompetenzen dann nicht mehr passend sind, dann wird man sie verändern.
Eigentlich handelt es sich bei diesem Ineinanderfließen beziehungsweise Hin‑ und Herfließen von Kompetenzen aber nur um ein Hinfließen, und daran sind die Staaten selbst schuld, denn sie haben freiwillig und de facto Kompetenzen auf die EU übertragen, ohne dass das im EU-Vertrag bindend vorgezeichnet gewesen wäre. Ich meine, dass eine Rückverlagerung von Kompetenzen auf die Staaten und auf die unter der EU angesiedelten Gemeinschaften und Regionen wünschenswert wäre. – Ich danke Ihnen. (Beifall.)
11.37
Vorsitzender Präsident Dr. Werner Fasslabend: Danke.
Nächste Rednerin ist Frau Europaabgeordnete Dr. Flemming. – Bitte.
11.37
Abgeordnete zum Europäischen Parlament Dr. Marilies Flemming (ÖVP): Herr Präsident! Frau Bundesministerin! Lieber Herr Einem! Wenn man die Botschaft „klägliches Schauspiel von Nizza“ ständig transportiert und die Medien dies mittransportieren, dann sollte man sich über Irland nicht wundern!
Man muss, wenn man über Irland redet, auch ehrlich dazusagen, dass man den Iren im Vorfeld immer wieder erklärt hat: Bis jetzt wart ihr die Armen – Kohäsionsfonds, Strukturfonds –, bei der Erweiterung wird es andere Arme geben, dann werdet ihr ein bisschen weniger bekommen. Das ist nur ein Grund von vielen, wie auch die Abtreibungsdebatte. Aber wir sollten doch ein bisschen ehrlich sein!
Zu Demokratiedefizit: Dass es mehr Rechte für das Europäische Parlament geben soll, ist wunderbar! – Meine Damen und Herren! Im Umweltbereich bin ich Gesetzgeber, natürlich zusammen mit dem Rat. Im Umweltbereich darf das österreichische Parlament nur noch nachvollziehen, wozu ich in Straßburg oder Brüssel schon die Hand gehoben habe. Ich bitte Sie, sich auch dies vor Augen zu halten!
Trotzdem bin ich unendlich dankbar, dass der Herr Bundeskanzler – der jetzt nicht mehr da ist – es geschafft hat, und zwar, wie ich glaube, schon in Amsterdam, verehrte Frau Bundesministerin, zu bewirken, dass der Gebrauch unseres Wassers nationale Sache bleibt beziehungsweise es hiefür der Einstimmigkeit bedarf. Das trägt natürlich zum Demokratiedefizit der EU bei. Ich frage Sie aber, meine Damen und Herren: Was hätten Sie alle denn gesagt, wenn der Herr Bundeskanzler nach Hause gekommen wäre und gesagt hätte: Es ist ein Erfolg der Demokratie, ab jetzt bestimmt Europa, das Europäische Parlament oder irgendein mehrstimmiger Rat darüber, wie wir mit unserem Wasser umzugehen haben? – „Demokratiedefizit“ ist ein schönes Wort. Ich glaube aber, dass, wenn zwei das sagen, sie manchmal jeweils etwas anderes damit meinen.
Zur Zukunft der Europäischen Union: Wir landen automatisch immer bei der Institutionenreform. Hochverehrter Herr Professor Winkler, ich habe mich immer gefürchtet, wenn Sie mich geprüft haben! Diese Angst bleibt bei mir tief drinnen! Natürlich bin ich aber dankbar, dass Sie über Institutionen reden. Ich möchte jetzt aber bei dem jungen Mann anknüpfen, der gesagt hat, dass Europa noch etwas ganz anderes hat. Europa ist noch viel mehr: Wir haben eine grauenvolle gemeinsame Geschichte, Hitler und Stalin stehen für Europa, wir haben aber auch eine wunderbare Geschichte, denn auch Sokrates, Mozart, Voltaire oder Picasso stehen für Europa.
Aufklärung, Französische Revolution, Formulierung der Menschenrechte, Abschaffung der Todesstrafe und Verbot, dass bei uns Kinder in Handschellen abgeführt werden: Das ist Europa.
In den sechziger Jahren gab es 3 Milliarden Menschen auf der Welt, heute gibt es 6 Milliarden – und wir sind wahnsinnig wenig, wir sind lächerliche 380 Millionen! Und selbst wenn dann noch 100 Millionen dazukommen, sind wir sehr wenige. Und, meine Damen und Herren, wir sind die Reichen auf dieser Welt!
Schon im 19. Jahrhundert ging es um den Ausgleich zwischen Arm und Reich in unseren europäischen Staaten, und jetzt, im 21. Jahrhundert, wird es den Ausgleich zwischen Arm und Reich auf diesem Kontinent geben. – Mr. Martin! Shall I wait, until you can hear me, or shall I tell you afterwards, what I said? We have a lot of possibilities in Strasbourg and Brussels! – Jeder, der nur fragt, was es uns wirtschaftlich bringt, stellt eine unmoralische Frage! Mrs. Thatchers schönes Wort von „I want my money back!“ war wirklich eine zutiefst uneuropäische Frage, und da war die Dame nicht einmal angestreift vom heißen Hauch der Geschichte!
Sehen Sie: Europa muss einfach größer gedacht werden als nur in Strukturen und in wirtschaftlichen Vorteilen. Europa muss so geliebt werden, wie es einem Kontinent zusteht, der formuliert hat, dass er als zentrale Wertvorstellung den Menschen hat, ob er arm oder reich, schwarz oder weiß, unendlich intelligent oder geistig behindert, alt oder jung ist! – Danke schön. (Beifall.)
11.41
Vorsitzender Präsident Dr. Werner Fasslabend: Der temperamentvolle Redebeitrag im bestens bekannten Stil von Marilies Flemming veranlasst mich zur Feststellung des Rückschlusses aus einem derartigen Verhalten: Wenn man der Europäischen Union nur den administrativ-bürokratischen Teil überlässt, dann wird sie auch von den Bürgern als bürokratisch erlebt werden.
III. Zur Stärkung der Demokratie in der Europäischen Union
Vorsitzender Präsident Dr. Werner Fasslabend: Wir kommen damit zum dritten Themenbereich unserer Enquete.
Das einleitende Statement dazu gibt uns Frau Professor Puntscher-Riekmann, die Jahre ihres Lebens in diesem Hause gearbeitet hat – eine Zeit, an die wir uns gerne erinnern.
11.43
Univ.-Prof. Dr. Sonja Puntscher-Riekmann (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Forschungsstelle für institutionellen Wandel und europäische Integration): Herr Präsident! Frau Bundesminister! Sehr geehrte Abgeordnete dieses Hauses! Meine Damen und Herren! Ich spreche hier in einem Parlament, das sich in Wirklichkeit formal die besten Mitspracherechte in Europa gesichert hat. Trotzdem ist es Tatsache, dass jenes Parlament – nämlich das dänische –, das diese Rechte nicht formalisiert hat, wesentlich erfolgreicher darin ist, sie auszunützen und seine Stellungnahmen auf europäischer Ebene geltend zu machen. Auf die Frage, warum das so ist, werde ich noch einmal zurückkommen.
Sie haben mich eingeladen, über die europäische Demokratiefrage zu reden. – Ich muss mein Statement mit einer gewissen Verblüffung anlässlich einiger Redebeiträge, bis hin zu jenem des Herrn Bundeskanzlers, eröffnen, in welchen Institutionen gegen Inhalte ausgespielt wurden. Als Demokratietheoretikerin weiß ich nicht, warum man das tut. Zwischen Institutionen und den Inhalten von Politik besteht eine enge Dialektik. In unterschiedlichen Institutionengefügen entstehen unterschiedliche Politiken. – Daher plädiere ich für das Zusammendenken der beiden Bereiche.
Meine zweite Vorbemerkung: Demokratie ist nicht ein Instrument, um das Schöne, Gute und Wahre hervorzubringen, sondern eine präzise Form der Organisation von Herrschaft. Wenn wir heute über die Demokratisierung der Europäischen Union sprechen, dann deshalb, weil auf europäischer Ebene öffentliche Herrschaft ausgeübt wird, die nicht klassischen demokratietheoretischen und ‑praktischen Errungenschaften genügt.
Nun weiß ich, dass diese Errungenschaften ein Produkt der Nationalstaaten sind und dass die automatische Übertragung dieses nationalstaatlichen Institutionengefüges Demokratie auf die supranationale Ebene Probleme schafft, und zwar auch hinsichtlich der Akzeptanz in den Köpfen der Demokratietheoretiker. Sie kennen das Standardargument wahrscheinlich alle so gut wie ich: Es kann dort keine Demokratie geben, wo es keinen ausgebildeten Staat und kein Staatsvolk gibt.
Dem möchte ich entgegenhalten: Die Frage der Demokratie stellt sich dort, wo Macht und Herrschaft ausgeübt werden, und nicht, wo ein Staat und ein Staatsvolk existieren. Abgesehen davon könnte ich lange ausführen – nur ist das heute nicht mein engeres Thema –, warum wir uns auf europäischer Ebene in einem Staatswerdungsprozess befinden. Welchen Grad der Staatswerdung wir erreicht haben, darüber ließe sich streiten, aber dass das ein Schritt in diese Richtung ist, ist ganz unbestritten, das ist mittlerweile auch in der Politik‑ und Rechtswissenschaft ein akzeptierter Zugang zur Analyse der Union. Ich denke, dass wir spätestens mit der Wirtschafts- und Währungsunion den Rubikon in diese Richtung überschritten haben.
Eine weitere Tendenz der Debatte, wie sie bis jetzt gelaufen ist, die mich seltsam anmutet, ist, dass man so tut, als wäre die Europäische Union nicht das Produkt von Vertragsabschlüssen und daraus resultierender Politik durch die nationalen Regierungen, sondern wie ein Deus ex machina auf uns herabgeschwebt.
Auch bin ich immer ein wenig verblüfft, wenn Regierungsmitglieder von einer Kompetenzanmaßung der Europäischen Union sprechen – einer Kompetenzanmaßung, die bis zu dem ad nauseam zitierten Beispiel der Gurkenkrümmung reicht –, obwohl es doch Regierungen sind, die sowohl die Verträge abschließen als auch das letzte Wort im Rat der Union haben.
All das, was wir in den Parlamenten der Nationalstaaten an Recht implementieren, ist das Ergebnis dieses Prozesses, in dem die Dominanz der Exekutive nicht das Gespenst ist, das hier gesehen wird, sondern mittlerweile wirklich die kleine Münze der politikwissenschaftlichen Analyse, wie Europa zu beschreiben ist. – Darüber gibt es Konsens.
Zugleich gibt es einen Konsens darüber – ich langweile Sie nicht mit der Literatur, die dazu geschrieben wurde, sondern nenne nur John Pinder, der im letzten Heft der Zeitschrift „Integration“ darüber geschrieben hat –, dass ein wesentliches Problem darin liegt, dass in diesem System die Gewaltenteilung suspendiert ist und dass wir zum ersten Mal in der Geschichte der europäischen Demokratien formal – nicht informell – mit Regierungsgesetzgebung konfrontiert sind. Das widerspricht meines Erachtens zumindest allem, was wir seit dem 18. Jahrhundert zur Frage der Demokratie artikuliert haben, worüber es theoretischen, aber auch praktischen Konsens gab. Diese Aufhebung der Gewaltenteilung ist das eigentliche Problem des Demokratiedefizits, und das ist, Frau Abgeordnete Flemming, nicht ein „schönes Wort“, sondern bezeichnet tatsächlich ein Problem.
Ich glaube, dass ich nicht übertreibe, wenn ich behaupte, dass wir in Europa mit einer Krise des Parlamentarismus konfrontiert sind, und zwar ist das ein Resultat dessen, was ich wie eine Renaissance des alten Investiturstreits empfinde, nämlich in dem Sinn – ich weiß schon, dass alle Vergleiche dieser Art immer auch ein bisschen schief sind –, dass zwei Organe, nämlich die Parlamente und die Regierungen, beanspruchen, Repräsentanten des Souveräns, der Völker, zu sein. Ich denke, diese Frage bahnte sich schon seit längerem im nationalen Kontext insofern an, als wir auch im nationalen Kontext eine Verschiebung der Macht von den Parlamenten zur Exekutive erleben. Formal gibt es da aber noch eine klare Trennung. Im supranationalen Raum hat sich diese Problematik allerdings dramatisch verstärkt. Das mag noch tragbar sein, wenn wir von klassischer Außenpolitik reden. Es ist jedoch nicht tragbar, wenn wir von europäischer Politik reden, die in hohem Maße Innen‑ und nicht Außenpolitik ist.
Es bestand und besteht hoffentlich noch immer der Konsens der Demokratietheorie und auch der -praxis, dass die Repräsentanten der Völker die Parlamente sind, aus deren Wahlen Regierungen hervorgehen. Das heißt, Regierungen legitimieren sich qua Parlamentswahlen, und sie sind – wie das Wort sagt – Exekutoren eines Willens, aber nicht Gesetzgeber. Das heißt nicht, dass damit das Initiativrecht der Regierungen oder die Vorbereitung von Gesetzgebung durch die Bürokratie beschnitten werden soll.
Dieses Problem ist auf europäischer Ebene verschärft worden. Verschärft worden ist aber ein Zweites: Es ist zu einer Abnahme der Vorstellung darüber, was Republik, was res publica, was die öffentliche Sache ist, gekommen, und zwar im nationalen Kontext, ohne dass dieser Verlust auf europäischer Ebene kompensiert worden wäre. – Die europäische res publica erschöpft sich im Feilschen um nationale Interessen, und sie ist manchmal die mehr oder weniger glückliche Summe nationaler Interessen, wobei ich auch oft nicht sicher bin, dass wir genau wissen, wovon wir reden, wenn wir von nationalen Interessen reden. Wer aggregiert diese Interessen nach innen? Wer definiert sie, und wie werden sie auf europäische Ebene transportiert? Ohne das Entstehen eines europäischen Interesses wird es auch keine glückende Europäische Union geben.
Ein europäisches Interesse – da bin ich ganz bei meinem Vorredner Herrn Kollegen Firlei – hat natürlich etwas mit der Vorstellung eines europäischen Gesellschaftsmodells und nicht nur mit einem Institutionengefüge zu tun. Das steht natürlich im Zusammenhang mit der Vorstellung davon, was europäische Solidarität bedeutet, und europäische Solidarität bedeutet nun einmal, wenn wir diesen Begriff nicht, wie es neumodisch geworden ist, auf die Außen- und Sicherheitspolitik reduzieren wollen, auch die Umverteilung von Reichtum.
Die Frau Vizekanzlerin ist nicht mehr da. – Jedenfalls ist es aber nun einmal so, dass wir Nettozahler sind, weil wir zu den Reichen gehören. Umverteilung kann nur von den Reichen zu den Armen erfolgen, wenn wir nicht den Begriff selbst ad absurdum führen wollen. Daher empfinde ich jede österreichische Debatte betreffend „we want our money back“ im Namen eines europäischen Gesellschaftsmodells als hoch problematisch. – Festzuhalten ist an dieser Stelle auch, dass das Gesellschaftsmodell Inhalt der europäischen Politik sein soll. Das sagt noch nichts darüber aus, wie das Institutionengefüge aussehen soll, in dem es zu einer solchen Formulierung kommen kann.
Meine Damen und Herren! Der Post-Nizza-Prozess bietet die einmalige Chance, die wiederholte Vertagung der zu behandelnden institutionellen Probleme seit Maastricht einer Lösung zuzuführen. Dass es immer wieder, von Maastricht über Amsterdam bis Nizza, zu dieser Vertagung kommen konnte und jetzt auch noch der, wie ich meine, unglückliche Begriff „Post-Nizza-Prozess“ gewählt wurde – aber das sei nun einmal dahingestellt –, ist ein Zeichen der Schwäche politischer Entscheidungsträger, dieses Wort kann ich Ihnen nicht ersparen. Dass man den Willen hat, den Status quo zu erhalten, ist verständlich, alle Politik ist immer konservativ und will den Status quo erhalten, es ist dies aber grob fahrlässig.
Ich denke, es ist unmöglich, die neue demokratisch‑republikanische Ordnung zur Zähmung der öffentlichen Herrschaft in Europa auf dem Reißbrett zu entwerfen. Es gibt eine ganze Reihe von Rechtswissenschaftlern und Politikwissenschaftlern, die sich hinstellen und Vorschläge machen, aber in welchem Entscheidungsprozess dies zu einem Ergebnis führen kann, das am Ende von den Völkern Europas auch akzeptiert wird, das vermögen wir heute nicht zu entscheiden.
Wir können aber sehr wohl entscheiden, den abnehmenden Konsens der Völker gegenüber der europäischen Politik – und die irische Abstimmung zu Nizza ist nur ein vorläufiger Endpunkt in diesem abnehmenden Konsens – zu konterkarieren beziehungsweise diesem etwas entgegenzusetzen, indem wir aufhören, europäische Politik als arcana imperii zu betreiben.
Letzteres setzt Verfahren voraus, und zwar Verfahren der Beteiligung und der Repräsentation, in welchen die neue europäische Verfassungsordnung diskutiert und entschieden werden kann. Auch ich habe allerdings die Sorge, dass gerade die Regierungsmitglieder aller europäischen Staaten nun eine besondere Liebe zum öffentlichen Diskurs entwickelt haben, zur Debatte, an der sich alle, auch die berühmte Zivilgesellschaft, beteiligen dürfen, ohne dass es am Ende Verbindlichkeiten und eine Veränderung des Entscheidungsprozesses geben wird. – Das halte ich ebenfalls für grob fahrlässig.
Wir sollten daher heute weniger über die ideale Verfassung Europas diskutieren, sondern über ein Verfahren, in dem eine solche erreicht werden kann. Ich glaube, ich renne offene Scheunentore ein – wahrscheinlich sogar bei den Mitgliedern der Regierung –, wenn ich sage, dass Regierungskonferenzen dieser Aufgabe nur in Maßen gewachsen sind, um es sehr vorsichtig auszudrücken.
Was sich dagegen in der Vergangenheit als produktiv herausgestellt hat, ist das Modell des Konvents – das hat die Ausarbeitung der Grundrechte-Charta bewiesen –, und zwar weil es damit zu einer Ausweitung der Akteure auf europäische und nationale Parlamentarier, durchaus in Zusammenarbeit mit nationalen Regierungsvertretern und Vertretern der Kommission, gekommen ist. Dass dies fruchtbringender und sinnvoller war, hat nichts damit zu tun, dass Parlamentarier und Parlamentarierinnen klügere oder bessere Menschen wären, sondern damit, dass ihre Teilnahme an einem solchen Konvent den Blick verändert. Und nur darum geht es im Augenblick: Einerseits wird so die Perspektive verändert, und andererseits – auch das ist heute schon mehrfach eingemahnt worden – wäre ein weiterer Vorteil dieser Vorgangsweise die Europäisierung nationaler Parlamentarier und möglicherweise auch der Parteien.
Wenn wir die neu zu definierende Rolle der nationalen Parlamente einmahnen, die dem europäischen Prozess plötzlich Frischblut zuführen sollen, dann muss es entsprechende Voraussetzungen geben und kann nicht einfach so geschehen. – Ich komme auf meine anfängliche Bemerkung zurück: Dieses Parlament hat sich die größten Rechte der Beteiligung an europäischer Politik gesichert, ohne sie ausfüllen zu können. Das ist ein kläglich gescheitertes Modell, denn die Voraussetzung muss sein, dass der Wille, die Fähigkeit und die Ressourcen vorhanden sind, sich mit europäischer Politik befassen zu können.
Die Europäisierung nationaler Parlamentarier und Parlamentarierinnen ist dringend notwendig, um europäische Politik zum Allgemeingut nationaler Politiker werden zu lassen, aber auch, um die Vermittlung dieser Politik an die nationalen Öffentlichkeiten zu verstärken. Erst dann, wenn ein solcher Konvent etabliert ist, stellt sich die Frage der Gewalten- und Kompetenzverteilung.
Ohne jetzt zu kritisch gegenüber der Organisation dieses Hearings zu sein, möchte ich sagen: Vielleicht hätte man die Thematik umdrehen und zuerst über Demokratie und das Demokratieverständnis reden sollen, bevor wir über Kompetenz- und Gewaltenverteilung reden. Ich sage das nicht aus Eitelkeit, weil ich nach Herrn Firlei zu sprechen komme, sondern ich denke, dass es hier eine logische Hierarchie der Thematik gibt.
Wenn er etabliert ist, kann ein solcher Konvent die Fragen der Gewaltenteilung und der Kompetenzverteilung in horizontaler und vertikaler Hinsicht, die Verantwortlichkeit einer europäischen Exekutive gegenüber dem Europäischen Parlament, den nationalen und den subnationalen Parlamenten, das Verhältnis zwischen EP und den nationalen Parlamenten, die Initiativ- und Kontrollrechte des EP und der nationalen Parlamente sowie die Ausweitung der Mehrheitsentscheidungen klären.
Ich komme zum Schluss. – Ich glaube, dass die Zentralisierung der Geldpolitik, die wir auf europäischer Ebene etabliert haben, nicht einhergehen kann mit einer Dezentralisierung der Wirtschafts-, Sozial-, Bildungs-, Gesundheitspolitik und vielem anderen mehr. Daher wird eine bestimmte Zentralisierung Europas unausweichlich sein. Diese kann aber nur dann glücken, wenn sie tatsächlich demokratisch veranstaltet wird. Das heißt, dass auch die Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen, die eine größere Effizienz der Entscheidungen erlauben soll, Grundprinzipien der Demokratie wahren muss, damit die unterlegene Minderheit bereit ist, das Opfer zu bringen, unterlegen zu sein und die Entscheidungen der Mehrheit zu akzeptieren. Auch dies ist eine kleine Münze der Demokratie.
Was immer das Ergebnis eines solchen Konventes ist, ich rate dazu, eine neue Verfassungsgrundlage der Europäischen Union plebiszitär in allen Mitgliedstaaten abstimmen zu lassen. Nur das kann die Loyalität der Bürger und Bürgerinnen zu dieser neuen Konstruktion erhöhen. Ich weiß, das ist ein riskantes Spiel. Aber ich frage mich, wie lange wir uns das Risiko von Einzelablehnungen, wie es jetzt im Fall des Nizza-Vertrages wieder geschehen ist, leisten können, ohne das gesamte Integrationsprojekt zu gefährden. – Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. (Beifall.)
12.01
Vorsitzender Präsident Dr. Werner Fasslabend: Herzlichen Dank, sehr geehrte Frau Professor.
Diskussion
Vorsitzender Präsident Dr. Werner Fasslabend: Wir gehen jetzt in die Debatte ein.
Die erste Wortmeldung stammt von Frau Abgeordneter Jäger. – Bitte.
12.02
Abgeordnete Inge Jäger (SPÖ): Herr Präsident! Frau Ministerin! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich denke, Sie stimmen mit mir überein, wenn ich sage, dass heute die größte Gefahr für die Integration Europas davon ausgeht, dass die Bürger und Bürgerinnen Europas mit dieser Integration nicht mitgehen und nicht Schritt halten. Ich denke, die Abstimmung in Irland war wieder ein solcher Kontrapunkt, wie es ihn schon öfter gegeben hat.
Ich denke, die Voraussetzung dafür, dass die Bürger und Bürgerinnen mitgehen, ist, dass tatsächlich die Lebensqualität aller Menschen in Europa verbessert wird und dass alle Menschen in Europa eine Zukunft in dieser gemeinsamen Europäischen Union sehen. Ich denke, die Ängste, die bei vielen Bürgern und Bürgerinnen vorhanden sind, zeigen sich eben in solchen Bereichen wie etwa im Zusammenhang mit der BSE-Krise, bei Umweltproblemen oder, gerade in Österreich, bei Verkehrskollapsen. Da entsteht wirklich eine große Verunsicherung.
Da Sie, Frau Dr. Puntscher-Riekmann, von einer „Form der Organisation von Herrschaft“ beziehungsweise von der „Ausübung von Macht und Herrschaft“ gesprochen haben, möchte ich feststellen, dass Macht und Herrschaft auch für Interessen ausgeübt werden. Und da frage ich mich, ob auf europäischer Ebene auch die Interessen der „Kleinen“, der Arbeitnehmer, der Konsumenten entsprechend vertreten werden, wenn ich an Brüssel denke, wo sich sehr oft vorrangig Interessen von Lobbyisten in Bezug auf industrielle Landwirtschaft ebenso wie in Bezug auf Wirtschaftsinteressen durchsetzen, sowohl im Rat als auch in der Kommission.
Deshalb ist es, glaube ich, wirklich notwendig, dass das Europäische Parlament verstärkt Kompetenzen bekommt und auf diese Weise gestärkt wird. Wir Sozialdemokraten treten aber auch dafür ein, dass tatsächlich ein Konvent eingerichtet wird, in dem sowohl nationale Parlamente als auch das Europäische Parlament gemeinsam mit Regierungen über wesentliche und entscheidende Zukunftsfragen diskutieren, und dass es da auch eine Rückkoppelung zur Zivilgesellschaft gibt.
Es ist mir bekannt, dass das zum Beispiel in Göteborg nicht die wichtige Fragestellung war. Ich möchte Sie aber ersuchen, Frau Ministerin, die Einrichtung eines solchen Konvents für die Zukunft zu befürworten, sodass auch Österreich eine sehr aktive Rolle bei der Einrichtung dieses Konvents spielt.
Was wir vor allem im österreichischen Diskussionsprozess ebenfalls ganz dringend brauchen, ist, dass wirklich dieser Europa-Gedanke, der Solidaritäts-Gedanke in den Vordergrund rückt und nicht immer wieder diese kritische Sichtweise. Man will jetzt – oder die FPÖ will das – wieder das österreichische Volk darüber befragen, ob man die Erweiterung überhaupt möchte. Ich denke, es geht heute darum, der österreichischen Bevölkerung eine Zukunftsperspektive zu geben, damit Demokratisierung tatsächlich eine reale Chance auf Verwirklichung hat. Ich ersuche Sie, dafür einzutreten. – Danke. (Beifall.)
12.06
Vorsitzender Präsident Dr. Werner Fasslabend: Nächster Redner ist Herr Abgeordneter Ing. Fallent. – Bitte.
12.06
Abgeordneter Ing. Gerhard Fallent (Freiheitliche): Sehr geehrter Herr Präsident! Frau Bundesminister! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Frau Professor Puntscher-Riekmann, wenn Sie davon sprechen, dass Demokratie die präzise Organisation von Herrschaft ist, dann ist das in der Theorie mit Sicherheit richtig. Aber genau um diese präzise Organisation geht es. Denn diese präzise Organisation wird, glaube ich, nicht in den Köpfen aller so verstanden, wie sie eben verstanden werden sollte. Es gibt hier die verschiedensten Ansichten, und ich glaube, dass es da und dort doch darum geht, Macht und Einfluss geltend zu machen und durchaus immer wieder andere Ansichten zu haben.
Ich stimme aber mit Ihnen überein, wenn Sie sagen: Der Weg ist das Ziel. Ich glaube, gemeinsam sind wir dazu aufgerufen, die Situation zu verbessern und mehr Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in dieses Haus Europa zu bringen.
Ich möchte mich mit einem Thema beschäftigen und Ihnen anhand dieses Themas klarmachen – oder zumindest versuchen, Ihnen klarzumachen –, worin hier die Defizite bestehen und dass wir meiner Ansicht nach noch viel tun müssen, um die Situation zu verbessern. Wir haben im letzten Hauptausschuss ein Papier der Europäischen Union besprochen, das sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Nachhaltigkeit ist, glaube ich, eines der wichtigsten Prinzipien und Ziele, die wir gemeinsam verfolgen müssen. Ich denke, dass es sich dabei um eine lebensnotwendige Orientierung für uns alle handelt.
Aber wir sehen, dass die Realität etwas anders aussieht. Wir erkennen, dass es einen massiven Strukturwandel in Österreich gibt, dass es ein Ausdünnen des ländlichen Raumes gibt, dass es im landwirtschaftlichen Bereich massive Veränderungen gibt und dass wir damit zu kämpfen haben, dass wir im ländlichen Raum in den Kommunen Nahversorgung nicht mehr in dem Maße zur Verfügung stellen können, wie es eben notwendig wäre.
Wenn wir nun der Bevölkerung die Frage stellen würden: Sind Sie dafür, dass Nahversorgung nicht mehr verfügbar ist, dass Güter des täglichen Bedarfes weit weg rücken, dass Arbeitsplatz und Arbeitskraft in der Region so nicht mehr verfügbar sind und dass somit Wertschöpfung und Kaufkraft verloren gehen?, dann würde, meine ich, jeder, der dort lebt, sagen: Nein, das will ich nicht!, und würde sich dagegen aussprechen.
Ich glaube, hier gilt es anzusetzen. Wir müssen unsere Entwicklungen mit mehr Bürgerbeteiligung betreiben. Wir müssen versuchen, die Interessen und Bedürfnisse der Bevölkerung besser einzubinden. Ich glaube, dass sich die Europäische Union bewusst sein muss, dass es im Bereich der Rechtsstaatlichkeit im Besonderen, aber auch im Bereich der Demokratie noch viel zu tun gibt. Ich stelle die Frage an die Experten und an diejenigen, die es besser als ich wissen: Wie steht es mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Österreich? Wie steht es damit bei den Beitrittskandidaten? Welche Standards fordern wir von den Beitrittskandidaten in diesen sehr zentralen und wesentlichen Fragen?
Ich glaube, dass es wichtig wird, viel mehr miteinander zu kommunizieren und zu reden. Es ist notwendig, dass auf europäischer Ebene die Kommission enger mit dem Parlament zusammenarbeitet, und ich glaube, es ist notwendig, dass die nationalen Parlamente mehr Möglichkeiten haben, ihre Ideen und ihre Wünsche einzubringen. Ich sehe dieses Haus Europa als ein Haus an, das ein Fundament hat, das von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Werteorientierung geprägt ist, das Räume und Zimmer besitzt, die eingerichtet und ausgestattet sind mit lokaler Identität, mit nationaler Identität, mit Nachhaltigkeit, mit Kompetenz auf nationaler Ebene. Ich sehe auch ein Dach, das uns Schutz gibt – Schutz, um in diesem Europa wirtschaftlich erfolgreich und sozial gerecht zu sein und letztendlich unser Ziel zu erreichen, Lebensqualität für jetzt lebende und kommende Generationen in diesem Europa zu erhalten und zu gestalten.
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass alle in diesem Haus wohnen können und dass alle in diesem Haus vernünftige Rahmenbedingungen haben, um hier eine gute Entwicklung zu nehmen. Dafür müssen wir uns einsetzen, das ist die Aufgabe, die wir haben. Aber es ist nicht die Aufgabe, so weit zu reglementieren, dass wir nicht einmal auf kommunaler Ebene in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, die der jeweiligen Region angepasst sind und dort auch ihre Berechtigung haben.
In diesem Sinne freue ich mich auf eine weitere Diskussion. Ich glaube, wir müssen noch sehr viel miteinander reden. – Danke sehr. (Beifall.)
12.11
Vorsitzender Präsident Dr. Werner Fasslabend: Nächster Redner ist Herr Abgeordneter Großruck. – Bitte.
12.11
Abgeordneter Wolfgang Großruck (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Frau Bundesministerin! Sehr geehrte Damen und Herren! Wie ein roter Faden zieht es sich für mich durch die heutige Diskussion: Demokratisierung, mehr Demokratie, Solidarisierung, Subsidiarität. Ich versuche – auch als Kommunalpolitiker –, in die Rolle des einfachen Bürgers zu schlüpfen und von dieser Seite her die Thematik zu beleuchten. Denn ihn brauchen wir, glaube ich, bei allen Diskussionen. Wir fordern die Beteiligung des Volkes – und das Volk ist eine anonyme Gruppe; wir sollten aber die Betroffenheit des Einzelnen sehen und uns in ihn hineindenken, um dann vielleicht auch einige Probleme besser lösen zu können und sie nicht nur von der staatsrechtlichen Seite, der verfassungsrechtlichen Seite her und so weiter zu betrachten.
Wenn ich in diese Rolle schlüpfe, dann zeigt sich, dass die EU heute für viele ein Sündenbock ist. Man haut den Sack und meint den Esel. Die EU muss heute für vieles herhalten, wofür sie eigentlich nichts kann – das ist so, das ist psychologisch bedingt. Die Wüste ist größer geworden: Als wir noch nicht bei der Europäischen Union waren, war es Wien; jetzt sind zu Wien die Wüsten Brüssel, Luxemburg und Straßburg hinzugekommen. Oder: Der biblische Sündenbock muss herhalten, die eigenen Sünden werden deponiert, und er wird dann hinaus in die Wüste gejagt.
Das ist Realität, und da wird ein großer Fehler gemacht, auch von den Verantwortlichen, die für Probleme, die hausgemacht sind und im eigenen Haus passieren, die EU verantwortlich machen. Da darf es einen dann nicht wundern, wenn wir auf der anderen Seite ein positives Klima, eine positive Stimmung für die Europäische Union wollen. Ich bezeichne das als die virtuelle Seite der EU.
Es gibt aber auch eine konkrete Seite der Auswirkungen, die den Einzelnen betreffen. Es ist schon die Gurkenkrümmung erwähnt worden, die symptomatisch ist und stellvertretend für alle anderen Verordnungen stehen soll, für die der Bürger eigentlich kein Verständnis aufbringt. Er ist unmittelbar konfrontiert mit verschiedenen Vorschriften und verschiedenen Bürokratismen, die besser subsidiär zu Hause erledigt werden sollten und bei denen der Bürger zu Recht sagt: Das brauche ich mir doch nicht von der Beamtenschaft oder von wem auch immer in Brüssel vorschreiben zu lassen, das weiß ich besser! – Das heißt, das Subsidiaritätsprinzip ist meiner Ansicht nach das Wichtigste in der ganzen Diskussion.
Ich denke auch an die Transitlösung, die nicht geschafft worden ist. Wenn ich, so wie heute, um 6 Uhr in der Früh von Oberösterreich auf der Autobahn hierher fahre und dabei einem Autorennen von LKWs ausgeliefert bin und Glück habe, nicht zermalmt zu werden – das erleben die Bürger jeden Tag! –, dann sehe ich, dass da etwas nicht stimmt. Da bedarf es einer Lösung, nicht einer österreichischen, sondern einer gesamteuropäischen Lösung.
Ich denke hier aber auch an Landstriche und Gemeinden, die von der so genannten „Natura 2000“ betroffen sind. Da wird verordnet, dass eine Gemeinde oder die Hälfte einer Gemeinde jetzt „Natura 2000“-Gebiet ist, und die Bürger werden mehr oder minder über Nacht enteignet, weil sie kein Verfügungsrecht mehr über ihren Grund und Boden haben. Das hat dann natürlich Auswirkungen negativer Art auf die Stimmungslage der Bürger.
Ich erinnere auch an die Getränkesteuer-Diskussion. Sie war sicherlich teilweise hausgemacht, es hat aber der Europäische Gerichtshof entschieden. Auch davon sind die Gemeinden gebeutelt worden, sie leiden heute noch darunter.
Die eine Seite ist also die Sündenbockseite, die andere Seite die „Big Brother“-Seite der EU. Dazu muss ich sagen, es sollte nicht alles dort geregelt werden. Der Bürger hat den Eindruck: Wir sind von Bürokratie beherrscht. – Deshalb ergibt sich die Forderung: Stärkung des Subsidiaritätsprinzips und der Aufgabenteilung, nicht Institutionalisierung bis in die Wohnzimmer hinein, nicht Bürokratisierung!
Ich darf auch ein kritisches Wort zur Bürokratisierung sagen. Derzeit bin ich selbst Obmann eines LEADER-Programms, eines EU-Programms. Meine Damen und Herren, das Erste bei der Beantragung dieses Programms war, dass wir einen hauptamtlichen Geschäftsführer haben installieren müssen, dessen Bezahlung 20 Prozent der Förderungsmittel innerhalb der nächsten vier Jahre verschlingen wird. Ich weiß nicht, ob das unbedingt der richtige Zugang ist. Das sind aber die Vorschriften, die uns auferlegt worden sind. Auch das ist meiner Ansicht nach ein Beitrag, der uns nicht unbedingt freundlich stimmt.
Meine Damen und Herren! Wir haben aber auch andere Beispiele. Beim Verkauf kommt es nicht auf das Produkt, sondern auf den Kundennutzen an. Wir sollten also bei der EU nicht die Institution, nicht die Bürokratie und nicht die Funktionen verkaufen, sondern den Nutzen, den die Bürger daraus haben. Wir haben in Österreich ein gutes Beispiel dafür gehabt, als die Österreicher mit Zweidrittelmehrheit für den EU-Beitritt gestimmt haben. Ich erinnere mich an die Kampagne, die natürlich ins Positive hin übertrieben worden ist. Man hat nur die Vorteile „kampagnisiert“, nicht aber auch die „Nachteile“ – unter Anführungszeichen – oder Probleme vorgebracht.
Eine offene und ehrliche Diskussion verträgt der Bürger, und wir sind sie ihm schuldig. Wir sollen ihm den Nutzen der EU und unserer Mitgliedschaft verkaufen, nämlich der Sicherheit, des Wohlstandes, der Arbeitsplatzsicherung, der Gesundheitssicherung und so weiter. Dann werden wir, glaube ich, auch das Votum des Bürgers haben, dann brauchen wir uns vor Abstimmungen nicht zu fürchten, sondern können in Abstimmungen gehen und uns sicher sein, dass wir auch die Stimme jenes einfachen und „kleinen“ Mannes bekommen werden, der dann in der Wahlzelle entscheiden muss: Habe ich Vorteile aus der Mitgliedschaft in der EU, oder bin ich dabei ein Verlierer?
Da liegt meiner Ansicht nach sehr viel an uns und an der Aufbereitung dieses Themas. (Beifall.)
12.17
Vorsitzender Präsident Dr. Werner Fasslabend: Nächste Rednerin ist Frau Abgeordnete Dr. Lichtenberger. – Bitte.
12.18
Abgeordnete Dr. Evelin Lichtenberger (Grüne): Sehr geehrte Damen und Herren! Ich verfolge die Debatte mit sehr viel Interesse – sofern es sich um eine solche handelt, weil das, was heute hier stattfindet, eher als Artikulation im Sinn von reinen Stellungnahmen von Interessenvertretungen, ohne sehr viel Bezugnahme auf die Vorrednerinnen und Vorredner, zu beschreiben wäre.
Lassen Sie mich deshalb einige Dinge aufgreifen, die in der Debatte gesagt worden sind. Da höre ich – was mittlerweile auch innerösterreichisch schon lange diskutiert worden ist – eine zunehmende Zahl von Angriffen auf die Umweltschutzpolitik der Europäischen Union, indem man sagt: „Natura 2000“, das darf es nicht geben; die europäische Ebene darf nicht unsere Handlungsmöglichkeiten auf regionaler, lokaler oder nationalstaatlicher Ebene einschränken.
Meine Damen und Herren! Die Frage „Natura 2000“ hat als Hintergrund eine gesamteuropäische Verantwortung für unsere Naturräume, die es hier zu betonen gilt! Diese ist genau das, was in den Reden immer wieder als Sicherung der Lebensgrundlagen für die nächsten Generationen bezeichnet wird. Meine Damen und Herren, wenn Sie dieses Recht der Europäischen Union, die Sicherung der Lebensgrundlagen für die künftigen Generationen, subsidiär behandeln wollen, dann schauen Sie sich bitte die Praxis des Naturschutzes in Europa, in den Regionen und in den Nationalstaaten, an, und Sie werden sehen, dass dort sehr wohl so etwas wie die Betonung der Notwendigkeit des Schutzes auf europäischer Ebene nicht nur aus inhaltlichen, sondern auch aus politischen Gründen gegeben ist.
Eine weitere Anmerkung meines Vorredners hat mich herausgefordert; er hat gesagt, er habe sich in einem Elefantenrennen von LKWs auf der Autobahn befunden. – Wir wollen doch klarstellen, dass die Geschwindigkeitskontrollen auf Autobahnen auch bei LKWs keine europäische Aufgabe sind, sondern dass dieses Problem wohl etwas damit zu tun hat, wie Geschwindigkeitskontrollen auf nationaler Ebene gehandhabt werden und stattfinden. Das sollte man, glaube ich, trennen.
Wenn diese Grundvoraussetzungen nicht einmal in den Debattenbeiträgen, die im Rahmen eines informierten Gremiums erfolgen, gegeben sind, so ist das aus meiner Sicht, aus der Sicht einer Abgeordneten dieses Parlamentes, ein mehr als dringlicher Hinweis auf die Notwendigkeit einer vertieften Information über das, was wirklich nationale Kompetenzen und was europäische Kompetenzen sind. Dass im Rahmen des Transitvertrages eine Zunahme der Zahl von LKW zu verzeichnen ist, trifft zu, aber die Frage der Geschwindigkeiten können wir, bitte, nicht Brüssel in die Schuhe schieben, Herr Kollege! (Abg. Großruck: Sie interpretieren mich bewusst falsch!)
Damit komme ich auf einen ganz zentralen Punkt zu sprechen – und hier möchte ich vor allem das Referat von Frau Professor Puntscher-Riekmann aufgreifen –: Es ist ganz wesentlich, zu erkennen, dass es eine Verfasstheit Europas ja schon gibt, dass hier Gremien für Bürgerinnen und Bürger handeln – im Interesse von Regionen oder manchmal auch nicht. Das ist schlicht und ergreifend zur Kenntnis zu nehmen! Jetzt geht es darum – und das ist die Pflicht von ParlamentarierInnen –, in erster Linie, und zwar sofort, für die Demokratisierung dieser Prozesse auf europäischer Ebene zu sorgen.
Man kann eine solche Debatte nicht so führen, als würde derzeit noch gar nichts passieren. Dass man auf dem Reißbrett etwas entwirft, was dann vom Reißbrett herunter umgesetzt werden könnte, geht an der Realität ganz schrecklich vorbei. Das lässt sich nicht damit lösen, dass man nationalstaatliche Probleme sozusagen auf der europäischen Ebene spiegelt. Jetzt oder nie ist die Frage der Demokratisierung des Procedere auf europäischer Ebene da, und das muss sich auch in der Demokratisierung von Entscheidungsfindungsprozessen in nationalen Parlamenten abbilden.
Hier haben wir – und das ist anzumerken – sehr gute Voraussetzungen im österreichischen Parlament, nur lässt die Praxis nach wie vor zu wünschen übrig. Das ist aber nicht ein Problem von Brüssel, sondern unser eigenes. Das ist ein Problem des Umganges von Fraktionen mit demokratischen Spielregeln. – Danke. (Beifall.)
12.23
Vorsitzender Präsident Dr. Werner Fasslabend: Nächster Redner ist Herr Abgeordneter Dr. Bruckmann. – Bitte.
12.23
Abgeordneter Dr. Gerhart Bruckmann (ÖVP): Herr Präsident! Frau Bundesminister! Meine Damen und Herren! Ich wollte mich eigentlich bei Punkt 5 zu Wort melden, aber Kollegin Puntscher-Riekmann hat mich in einem Punkt provoziert. Sosehr ich im Prinzip mit dem überwiegenden Teil ihrer Ausführungen übereinstimme, möchte ich doch nicht im Raum stehen lassen, dass das österreichische Parlament zwar auf dem Papier, institutionalisiert, die meisten Mitspracherechte für sich in Anspruch nimmt, dass diese aber „kläglich gescheitert“ seien.
Ich darf hier an die Frühzeit der Schaffung eines Unterausschusses erinnern. Ich weiß jetzt nicht, ob es Voggenhuber oder Pilz war, der sich damals als Einziger gut vorbereitet hatte und, da alle anderen Parteienvertreter nicht gut vorbereitet waren, dem österreichischen Fachminister damit de facto über Beschluss dieses Gremiums eine Weisung mitgab, mit der er überhaupt keine Freude hatte – und die anderen Parteien auch nicht, als sie dann draufkamen.
Dieses Ereignis war es, das dazu geführt hat, dass seither in allen Parteien sehr wohl über die EU-Politik nachgedacht wird. Es gibt in jeder Partei parteiinterne Fachausschüsse, die sich mit diesen Fragen befassen. Es gibt den Hauptausschuss, der sich, wie Sie gesagt haben, Rechte gegeben hat, die andere Länder nicht haben. Es gibt auch den Ständigen EU-Unterausschuss. Wenn ich überdies daran denke, wie viele Stunden wir jeweils in Anwesenheit der zuständigen Frau Bundesministerin hier zugebracht haben, glaube ich doch nicht, dass man sagen kann, hier sei diese Zusammenarbeit „kläglich gescheitert“.
Ich gebe Ihnen aber schon darin Recht, dass zum Beispiel im dänischen Parlament diese Zusammenarbeit auf individueller Basis eine wesentlich intensivere ist. Das wäre vielleicht eine Hausaufgabe, die wir – an alle Parteien gerichtet – wahrnehmen könnten.
Warum ich mich aber eigentlich zu Wort gemeldet hatte, war die einleitende Bemerkung von Bundeskanzler Schüssel über den Artikel 308, der an sich eine Art „Münchhausen-Artikel“ ist: sich selbst am Schopf aus dem Sumpf zu ziehen, wenn man sich verheddert hat. Er hat die Warnung ausgesprochen, dass die Handhabung des Artikels 308 sehr wohl überlegt werden müsse. Ich möchte das etwas stärker verallgemeinern.
Wenn von einem Verfassungsvertrag für die EU gesprochen wird, den wir anstreben sollten, dann hätte ich große Angst, wenn man das als ein großes kodifiziertes Kompendium, als eine Art Katechismus ausarbeiten wollte. Denn die Europäische Union ist kein fertiges Sein, sondern – darüber stimmen wir alle überein – ein sich ständig weiterentwickelnder Prozess. Daher wäre es mir wesentlich lieber, als an einem riesigen Verfassungswerk zu arbeiten, das uns dann alle bindet, die Entwicklung fortzusetzen, die von Rom über Maastricht, Amsterdam bis Nizza – und es gibt noch einige Ortsnamen, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten hinzukommen könnten – stattgefunden hat, nämlich den jeweiligen Gegebenheiten entsprechend das Subsidiaritätsprinzip neu zu interpretieren und anzuwenden.
Gerade ein Land wie Österreich, das zu den wenigen europäischen Ländern gehört, in denen es eine föderale Struktur gibt, hat da eine besondere Aufgabe: die Erfahrung, die es hier hat – ich werfe nur einen Begriff in den Raum: Artikel-15a-Vertrag –, auf die europäische Ebene zu übertragen und dort einzubringen. Denn wir wissen ja heute noch nicht, welche Probleme morgen und übermorgen auftauchen werden. Diese Probleme können dann nur in der Form gelöst werden, dass eben manches von unten nach oben, aber anderes gleichzeitig wohl von oben nach unten verlagert werden muss.
Eine Nachbemerkung noch bitte ich Sie in die Welt hinauszutragen: Die Gurkenkrümmung ist eine österreichische Bestimmung. Nicht an allem ist die EU schuld. (Beifall.)
12.27
Vorsitzender Präsident Dr. Werner Fasslabend: Nächster Redner ist Herr Universitätsprofessor Dr. Somek, nicht als Bürger, sondern jetzt als Fachmann. – Bitte.
12.27
ao. Univ.-Prof. Dr. Alexander Somek (Universität Wien, Institut für Rechtsphilosophie und Rechtstheorie): Ja, diesmal ist es ein Versuch, ein Fachmann zu sein, und wirklich auch ein Versuch, mich kurz zu fassen. – Nur zwei Bemerkungen zum Referat von Frau Puntscher-Riekmann.
Das Demokratie-Defizit ist ein fälschlich so bezeichnetes Defizit. Präziser müsste man es als Parlamentarismus-Defizit in der Europäischen Union bezeichnen – seiner Entstehung nach: Es entsteht im Verhältnis zu nationalen Parlamenten, und in Schuldübernahme besteht es weiter auch im Verhältnis zum Europäischen Parlament.
Ich sage dies deswegen, weil Parlamente sich anstrengen müssen, für Bürger attraktiv zu bleiben. Deswegen bestehe ich immer wieder darauf, dass Parteien politische Programme haben sollten – auch wenn es angesichts der internen Diversität von politischen Parteien schwer fällt –, weil ja jemand auf die Idee kommen könnte, zu sagen: Der Parlamentarismus ist ein Demokratiemodell, aber er ist ein Auslaufmodell.
Immerhin haben wir auf der Ebene des europäischen politischen Prozesses die Beteiligung von Interessenvertretungen, Non-Governmental Organisations und so weiter. Warum ist das nicht unser neues, typisch europäisches, deliberatives Demokratiemodell?
Die Gefahr, dass das artikuliert wird, besteht. Der Parlamentarismus ist meines Erachtens kein Auslaufmodell, ganz im Gegenteil. Es wird nur wichtig sein, dass die Parlamentarier es verstehen, den Parlamentarismus dadurch, dass sie Programme haben, an das Volk zu „verkaufen“ und dem Volk attraktiv zu machen. – Das war die erste Bemerkung.
Zweite Bemerkung: Der Begriff „Verfassungskonvent“ ist durch die europäische politische Praxis leider ein wenig verwässert worden. Bis zu dem Konvent, der die europäische Grundrechte-Charta beschlossen hat – die leider nur eine Absichtserklärung geworden ist, wenn ich es überspitzt ausdrücken darf –, war relativ klar, dass ein Verfassungskonvent etwas Revolutionäres ist. Ein Verfassungskonvent ist dazu da, um stellvertretend für das Volk, das ja selbst nicht handlungsfähig ist, die „pouvoir constituant“ des Volkes auszuüben.
In Europa haben wir jetzt eine alternative Variante dafür entwickelt, nämlich einen Konvent, der nicht die „pouvoir constituant“ ausübt, sondern ein Dokument entwickelt, das zur weiteren Behandlung im Rahmen des normalen Vertragsrevisionsverfahrens vorgelegt wird.
Wenn man dieses Modell für weitere Vertragsrevisionen – die dann ganz normal auf Grundlage des EU-Vertrages stattfinden – als neues Verfahren der Vertragsrevision, als Alternative zur Regierungskonferenz heranziehen will, finde ich es sogar für sehr gut, dass dort Abgeordnete der nationalen Parlamente und des Europaparlaments sitzen. Wenn wir aber meinen, dass wir jetzt schon ein echtes „Convention Parliament“ – wie wir es erstmals 1660 in der englischen Verfassungsgeschichte kennen gelernt haben, also ein Parlament, das revolutionär eine neue Verfassung setzt – wählen können, so wäre dies meiner Ansicht nach verfrüht. – Danke. (Beifall.)
12.30
Vorsitzender Präsident Dr. Werner Fasslabend: Nächster Redner ist Herr Professor Dr. Winkler. – Bitte.
12.31
Univ.-Prof. Dr. DDr. h. c. Günther Winkler (Universität Wien, Institut für Staats- und Verwaltungsrecht): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Frau Puntscher-Riekmann hat einleitend etwas sehr Wichtiges gesagt: Es besteht kein Gegensatz zwischen Institutionen und Inhalten. – Ich würde hinzufügen: Das ist auch keine Alternative, sondern – Sie haben gemeint, es sei eine Dialektik – es ist in Wirklichkeit ein notwendiger konstruktiver Zusammenhang. Struktur und Funktion gehören im ganzen Leben zusammen.
Herr Abgeordneter Fallent hat das Bild eines Hauses gebraucht; ich erinnere mich aus diesem Anlass an ein Wort meines Lehrers Franz Gschnitzer. Franz Gschnitzer hat gesagt: Das ABGB gleicht einem Haus, einem alten Haus; es ist sehr geräumig, und es lässt viel Raum für freie vertragliche Entfaltung – zum Unterschied vom BGB, das ein modernes Haus ist, ein neues Haus mit kleinen Räumen, mit wenig Freiräumen und Freiheiten.
Wenn wir das Bild auf die EU übertragen, dann sehen wir verbildlicht, was es heißt, Institutionen und Inhalte künstlich in Gegensatz zueinander zu bringen. Der EU-Vertrag in Verbindung mit den anderen Verträgen ist wie ein Haus, in dem sich die Europäischen Gemeinschaften in einer Hierarchie – nicht nur die EU, die Gesamtheit der Staaten, sondern auch die Regionen, also die Staaten, die Länder, die Provinzen und die Gemeinden – verlebendigen sollen.
Gschnitzer hat gemeint, das ABGB ist ein altes Haus, darin zieht es auch dann und wann. Das könnte auch beim EU-Vertrag der Fall sein. Aber wie wohnlich der EU-Vertrag wirklich ist, das wage ich zu bezweifeln. Er ist von Anfang an, seit Maastricht schon, problematisch und über die Maßen reformbedürftig. Eigentlich ist das wichtigste der Anliegen, die wir verfolgen müssten, die Klärung, Bereinigung, Entrümpelung und Durchforstung dieses wirklich verunglückten völkerrechtlichen Vertrages, nämlich legistisch verunglückten Vertrages, nicht jedoch von der Zielsetzung her, die ich voll unterschreibe.
Ein Wort noch zur Frage der Gewaltenteilung, nur eine Nebenbemerkung: Montesquieu hat sie nicht erfunden – schon Aristoteles hat sie gekannt –, aber Montesquieu hat ihr politischen Sinn gegeben. Er hat beiläufig über die Verfassung Englands geschrieben – um in einem autokratischen Frankreich nicht anzuecken, über die Verfassung Englands. Im 6. Kapitel des 11. Buches seines Werkes „De l’esprit des lois“ hat er die Gewaltenteilung nicht einfach formal unterschieden – hier die Gesetzgebung, da die Verwaltung oder Vollziehung und dort die Gerichtsbarkeit, wie es Aristoteles eigentlich gemacht hat –, sondern er hat sie nach der politischen Gegebenheit der damaligen Zeit formuliert. Er hat der Exekutive und natürlich der Vollziehung bestimmte Aufgaben zugewiesen, in einem bestimmten Sinn auch der Legislative und der Judikative. Damit sind bestimmte Inhalte verbunden.
Zur Exekutive zählte er die Vertretung nach außen und den Abschluss von Staatsverträgen. Nach diesem Vorbild steht in unserer Bundesverfassung, dass der Nationalrat an der Vollziehung beim Abschluss von Staatsverträgen mitwirkt. Meine Damen und Herren, das ist anachronistisch und rührt natürlich von dieser ursprünglichen Vorstellung der Gewaltenteilung her. In Wirklichkeit ist die Mitwirkung des Nationalrates am Abschluss von Verträgen essentielle Gesetzgebung und nichts anderes.
Wenn man das so sieht, dann sieht man natürlich auch die Dualität des nationalen Parlaments zum Europaparlament und zu den europäischen Organen in einer ganz anderen Weise. Es gibt keinen Prototyp und kein Idealbild der Gewaltenteilung, nicht einmal die gewaltenteilende Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika, obwohl sie ein Musterbeispiel für alle Verfassungen der Welt geworden ist, vom 18. Jahrhundert an bis in das späte 19. Jahrhundert.
Man soll sich nicht der Gefahr aussetzen, allgemeine Begriffe herzunehmen und daraus in einer Wesensschau Schlussfolgerungen zu ziehen, die quasi Verbindlichkeit haben. Es gibt kein verbindliches Konzept der Gewaltentrennung, sondern es gibt die vernünftige Ordnung eines Gemeinschaftswesens nach den Anforderungen und Herausforderungen der Zeit, nach politisch vernünftiger Entscheidung, um der Gemeinschaft die Existenz zu sichern und ihre Entwicklung in die Zukunft zu gewährleisten. – Ich danke Ihnen. (Beifall.)
12.36
Vorsitzender Präsident Dr. Werner Fasslabend: Nächster Redner ist Herr Universitätsprofessor Dr. Firlei. – Bitte.
12.36
Univ.-Prof. Dr. Klaus Firlei (Universität Salzburg, Institut für Arbeits- und Sozialrecht): Frau Kollegin, Sie haben völlig zu Recht gesagt, dass sich die Schlussfolgerungen im Bereich der Kompetenzverteilung eigentlich erst aus der Frage der Lösung des europäischen Demokratiemodells und anderer vorgelagerter Fragen ergeben. Das sehe ich ganz genauso.
Die Kompetenzfrage im Sinne einer notwendigen Abgrenzung stellt sich aus meiner Sicht erst dann in voller Schärfe, wenn auf europäischer Ebene tatsächlich normale staatliche Verhältnisse eingekehrt sind, nämlich dass europäische Gesetze im Parlament mit 50-prozentiger Mehrheit beschlossen werden. Heute sehe ich alle Forderungen nach einer Klärung von Kompetenzen und nach einer Stärkung des Subsidiaritätsprinzips als eine weitere Entmachtung der Politikfähigkeit der Gemeinschaft. Wir brauchen – das wurde schon gesagt – diese Generalkompetenzen. Wir brauchen sie, was hätten wir denn sonst?
Ich nenne Ihnen jetzt ein Beispiel. Eine Richtlinie wie die Betriebsübergangsrichtlinie oder die Massenentlassungsrichtlinie konnte nur auf der Basis des Artikels 235 alt entschieden werden. Wir brauchten das aber in einer Zeit dringender Reaktionen des europäischen Gesetzgebers auf die rasanten Strukturveränderungen in den Unternehmen.
Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen: Das Wort „Subsidiarität“ ist heute so oft gefallen, dass ich in aller Offenheit bekunden möchte, dass ich es nicht mehr hören kann. (Heiterkeit.)
Wenn ich mir ansehe, dass wir fast zwölf Jahre gewartet haben, um eine geradezu lächerliche Richtlinie wie die Betriebsratsrichtlinie der Gemeinschaft zu schaffen – wobei jeder österreichische Arbeitsrechtler darüber lacht, dass hier etwas anderes als Informations- und Beratungsrechte nicht verankert sind, und das nur in transnational agierenden Unternehmen, und dann noch drei Optionsrechte, die es den Staaten ermöglichen, Standortvorteile zu wahren –, dann frage ich mich, wo da die gestaltende Macht europäischer Politik ist. Wir brauchen sie aber, weil die Konkurrenzprozesse bereits laufen!
Das hat die Diskussion meiner Ansicht nach recht gut bestätigt, dass man zwischen zwei Dingen unterscheiden muss. Europäische Politikfähigkeit: Ich sage zum Beispiel – es gibt dazu auch eine Arbeitsgruppe, die aber nur Papier produzieren wird –, wir brauchen dringend eine Neudefinition des Arbeitnehmerbegriffs angesichts des Unterlaufens der arbeitsrechtlichen Schutzbestimmungen in vielen europäischen Staaten, die ganz aktiv auf diese Karte setzen und ganz aktiv Dumping-Wettbewerb gegen Staaten wie Österreich betreiben, die relativ hohe Standards haben. Daher brauchen wir das dringend, aber wir bekommen auf 70-Prozent-Mehrheiten im Rat keine Zustimmung dazu. Das heißt, der Prozess der Deregulierung ist in Gang gesetzt. Das ist der Konstruktionsfehler.
Jetzt sage ich etwas, was mir in der Debatte wirklich bestätigt worden ist. Wenn gesagt wird, jetzt geht es noch um den öffentlichen Verkehr in den kommunalen Unternehmen – das wird in Salzburg genauso diskutiert –, dann sehen Sie daran, dass das Wirtschaftsmodell der Gemeinschaft in geradezu imperialistischer Weise funktioniert. Das war ein unglaublicher Putsch, ich würde sagen: von oben, weil kein Mensch über die Wirtschaftsverfassung in Österreich abgestimmt hat. Da wurde auch nie gesagt, worum es dabei wirklich geht. Nun sehen wir die Auswirkungen, dass wir plötzlich nicht mehr wissen, ob in der Region Salzburg der öffentliche Verkehr noch im Sinne der demokratischen Artikulierung von Landes- und Gemeindeinteressen gemacht werden kann.
Deswegen habe ich gesagt: Nicht die Kompetenzen der Gemeinschaft im Arbeitsrecht, Sozialrecht oder Umweltrecht, sondern diese Wirtschaftsordnung untergräbt die Demokratie unten – und oben haben wir keine. Das heißt, wir sind in einer Falle. Wir sind in einer echten Integrationsfalle, die genau das produziert, was in den Abstimmungen zum Ausdruck kommt, nämlich Unzufriedenheit mit der Lösung der konkreten Probleme der Bürger im Verkehrsbereich, im Sozialbereich, im Bereich Armut, im Bereich Arbeitslosigkeit.
Wir brauchen dringend ein Projekt des Empowerment der Arbeitnehmer in Europa, damit sie fähig sind, in der Wissens- und Informationsgesellschaft zu bestehen. Für alle diese Dinge fehlt es an Machbarkeit und an Beweglichkeit. Das wird nicht anders gehen als durch eine Stärkung der oberen Ebene.
Ich bitte Sie, vergessen wir nicht, wie wir an nationale Kompetenzordnungen herangehen! Es würde doch in Österreich niemandem einfallen, zu sagen: Das Arbeits- und Sozialrecht machen Tirol, Salzburg und Kärnten, oder auch das Umweltrecht. Diese Maßstäbe gelten auch dann für Europa, wenn Europa zu einem einheitlichen Wirtschaftsraum geworden ist. Europa ist durch den Binnenmarkt ein einheitlicher Wirtschaftsraum, und daher gehören gewisse Kompetenzen, wenn sie sich real entfalten und nicht nur auf dem Papier stehen sollen, auf die zentrale Ebene. Das gehört doch zum Abc von Kompetenztheorie!
Es war früher nicht erforderlich, so zu denken, weil wir diesen Integrationsschub im wirtschaftlichen Bereich nicht hatten. Jetzt haben wir ihn, und jetzt muss reagiert werden. Diejenigen, die hier zu langsam sind und nicht diese Schlussfolgerungen aus der veränderten wirtschaftlichen Situation ziehen, sind diejenigen, die das Projekt Europa gefährden – nicht diejenigen, die mehr Tempo fordern!
Zur Demokratie der letzte Satz: Was da an Intransparenz passiert, betrifft vor allem die wirtschaftlichen Grundentscheidungen. Ich weiß nicht, wie viele wissen – die meisten von Ihnen werden es wissen –, dass die Gemeinschaft vorhat, auf WTO-Ebene den Dienstleistungsverkehr zu liberalisieren. Wissen Sie, was das heißt? Wer wurde in Europa gefragt, als es darum ging, das europäische Projekt dem weltweiten Wettbewerb auszusetzen?
Das ist eine ganz zentrale Frage, viel wichtiger als all das, was wir hier diskutieren. Hinter verschlossenen Türen wird dieser Weg gegangen, der letztlich die Vorstellungen der europäischen Bürger von einem europäischen Sozialstaat und einer sozialen Marktwirtschaft – ich sage das ganz bewusst –, also gemeinsames Gedankengut von Sozialdemokraten und Christdemokraten, zerstört! (Beifall.)
12.43
Vorsitzender Präsident Dr. Werner Fasslabend: Nächster Redner ist Herr Abgeordneter Voggenhuber. – Bitte.
12.43
Abgeordneter zum Europäischen Parlament Johannes Voggenhuber (Grüne): Meine Damen und Herren! Ich möchte nur kurz zwei Begriffe aufgreifen und versuchen, Herrn Kollegen Firlei den Begriff „Subsidiarität“ schmackhaft zu machen. (Heiterkeit.)
Ich bin ja, mehr denn je, ein glühender Verfechter der Subsidiarität, ich bitte jedoch, einen Moment lang einen Blick auf das Prinzip zu werfen. Wir haben uns vorgenommen, dass wir genau prüfen, welche politische Aufgabe auf welcher Ebene am besten zu lösen ist, und dass wir sie jeweils auf der untersten Ebene lösen, die das noch optimal kann. Wenn wir uns auf dieses Prinzip einigen, dann bin ich ein hoher Verfechter der Subsidiarität.
Wir würden nämlich schlagartig draufkommen, dass wir eine Fülle von Aufgaben auf unteren Ebenen, auf regionalen und nationalstaatlichen Ebenen, belassen, die dort schon längst nicht mehr gelöst werden können. Eine genaue Prüfung des Subsidiaritätsprinzips würde ergeben, dass wir unser Verständnis von Sozialpolitik auf nationaler Ebene nicht mehr erhalten können oder dass wir dem Steuerdumping in Europa auf nationaler Ebene nicht mehr begegnen können. Nun könnte die Liste sehr lang werden.
Herr Firlei! Wir würden bei einer ganz strengen, gewissenhaften, ernsthaften Prüfung des Subsidiaritätsprinzips zu einem ganz enormen Zentralisierungs- und Europäisierungsschub kommen. Wir würden auch sehen, dass das heute ein Kampfbegriff geworden ist, der nichts mehr mit der Subsidiarität zu tun hat, sondern im Wesentlichen den Nationalismus meint. Darum geht es nämlich: Um den offenen Nationalismus geht es und nicht um die Subsidiarität!
Ich beobachte ja mit Erstaunen, wie die nationalen Regierungen vorgehen. Seit Jahren gibt es zum Beispiel den Begriff der politischen Einheit Europas nicht mehr. Wenn Sie die Nizza-Protokolle oder die Amsterdam-Protokolle durchlesen, werden Sie diesen Begriff nicht mehr finden. Die nationalen Regierungen stellen sich als Anwälte der nationalen Identität und nicht mehr des europäischen Einigungsprozesses dar.
Das Zweite betrifft den Begriff des Prozesses. Selbstverständlich ist die europäische Integration ein Prozess, aber das kann uns doch nicht davon abhalten, ihre Stadien und ihre Formwerdung zu beobachten und zum Beispiel festzustellen, wo in diesem Prozess von der internationalen Organisation, die eine klassische Domäne der Regierungen ist, zu einer hohen Staatlichkeit, in der es natürlich illegitim ist, dass Regierungen Gesetzgeber sind, jeweils der Rubikon zu sehen ist, der überschritten wird, und eine neue Form der Verfassung zu verlangen. Es ist illegitim, dass wir heute in Europa ein Recht haben, an dessen Werdung wir nicht mehr beteiligt sind.
Der Hauptsatz – damit bin ich schon am Ende – und eines der Dinge, die mir immer wieder begegnen, ist: Wie soll es eine europäische Demokratie geben, wenn es keinen Demos gibt? – Puntscher-Riekmann hat das auch kurz angezogen, es ist aber zu begreifen, dass der Anspruch auf Demokratie dort entsteht, wo ich einem Recht unterworfen werde und das Recht habe, dieses Recht selbst zu setzen. Wir brauchen kein Volk, kein ethnisches, gemeinsames Volk in Europa, wir brauchen kein Staatsvolk, sondern wir sollten uns vielleicht an Cicero erinnern, der einmal sagte: Durch die Unterwerfung unter das selbst gewählte Recht wird eine Masse zum Volk.
Durch die Annahme des europäischen Rechtes, das wir uns selbst geben – aber nicht durch Regierungen, sondern durch Parlamente! –, wird es auch ein europäisches Volk geben. (Beifall.)
12.47
IV. Die Zukunft der Europäischen Union aus der Sicht des Europäischen Parlaments
Vorsitzender Präsident Dr. Werner Fasslabend: Wir kommen nun zum vierten Themenabschnitt dieser Enquete.
Ich freue mich, dass jetzt das Einleitungsstatement der Vizepräsident des Europäischen Parlaments David W. Martin halten wird. (Beifall.) – Bitte.
12.47
Vizepräsident des Europäischen Parlaments David W. Martin (in Übersetzung): Meine Damen und Herren! Zuerst möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich nicht deutsch spreche, und Ihnen vielmals für Ihre Einladung danken. Ich bin davon überzeugt, dass die nationalen Parlamente eine bedeutsame Rolle in der Debatte über die Zukunft Europas spielen, daher begrüße ich auch diese Veranstaltung des österreichischen Parlaments.
Was den Vertrag von Nizza betrifft, kann meiner Ansicht nach aus der Sicht des Europäischen Parlaments zusammenfassend Folgendes festgestellt werden: Das Beste, was wir über diesen Vertrag sagen können, ist, dass er die Erweiterung zu einer Realität gemacht hat; das stellt für sich bereits einen Fortschritt dar. Zweitens ist zu vermerken, dass dieser Vertrag die Voraussetzungen für seine Zerstörung bereits selbst in sich birgt, sodass der gesamte Nach-Nizza-Prozess damit zu enden droht, dass das zerstört wird, was in Nizza aufgebaut worden ist.
Mein Appell besteht darin, dass wir, wenn wir mit diesem Prozess fortfahren, dies auf einem Niveau tun, auf dem unter Einbeziehung der Menschen in der Europäischen Union und nicht über deren Köpfe hinweg vorgegangen wird.
Madeleine Albright sagte einst das berühmte Wort, dass man, um die Europäische Union zu verstehen, entweder ein Franzose oder ein Genie sein muss. Aber ich glaube, nicht einmal ein französisches Genie versteht Europa nach Nizza.
Ich glaube, unter all den Botschaften, die von der irischen Volksabstimmung gekommen sind, ist wohl diejenige die stärkste, dass die Leute das, was sie nicht verstehen, nicht lieben können und auch nicht unterstützen werden. Die Iren haben einfach nicht verstanden, worum es beim Vertrag von Nizza geht, und sie wussten auch nicht, was auf sie zukommen würde. Das meiste wurde erst eine Woche, bevor die Abstimmung erfolgte, dargestellt. Das heißt, die meisten wussten überhaupt nicht, worum es geht. Sie wussten überhaupt nicht um die Zielsetzung des Vertrags von Nizza. Man kannte vielleicht wohl das Ziel, aber nicht den Inhalt. Die meisten Leute sagten, sie hatten das Gefühl – sie wussten es nicht, sondern sie hatten das Gefühl –, dass dieser Vertrag einfach nicht in ihrem Interesse sei.
Wie sind sie zu dieser Haltung gekommen? – Man muss sich überlegen, dass dies auf eine klug angelegte Nein-Kampagne zurückzuführen ist. Diese verbreitete einen sehr einfachen Slogan, nämlich: Wenn Sie mit Ja stimmen, dann verlieren Sie Macht, dann verlieren Sie Geld, dann verlieren Sie Freiheit.
Wie stand es um die Ja-Kampagne? – In deren Rahmen musste erklärt werden, was es bedeutet, wenn dreifache Mehrheiten für Abstimmungen im Rat erforderlich sind, und so weiter.
Ich habe im „Journal of Common Market Studies“ soeben einen Artikel von Wolfgang Wessels gelesen, in dem gesagt wird: Es gibt nicht weniger als 16 unterschiedliche Methoden, um Entscheidungen im Ministerrat zu treffen, und elf verschiedene Wege, Entscheidungen im Europäischen Parlament herbeizuführen. Kombinationen von 38 unterschiedlichen legislativen Prozessen bestehen zwischen dem Parlament und dem Rat, all die anderen Institutionen noch gar nicht berücksichtigt. Wie soll das ein Durchschnittsbürger oder auch nur ein Durchschnittsjurist überhaupt verstehen? – Niemand kann all das verstehen.
Ich glaube auch – um ehrlich zu sein –, dass Nizza bereits zum Scheitern verurteilt war, bevor die Menschen noch lesen konnten, was in dem Vertrag stand, und zwar einfach schon damit, dass die Leute um 3 Uhr früh aus der Sitzung kamen und sagten: Wir haben jetzt endlich einen Vertrag. Aber sie haben auch gesagt, sie wüssten noch nicht, wie der Vertrag aussehen würde, doch würden sie es uns bald sagen. – Das war sicherlich kein gutes Image für den ganzen Nizza-Prozess.
Die stärkste Botschaft nach Nizza ist natürlich die, dass wir niemals mehr so vorgehen dürfen. Wir brauchen eine bessere Vorgangsweise, wir müssen einen Vertrag auf andere Art und Weise erreichen.
Wir haben eben gesagt, wir brauchen unbedingt eine andere Vorgangsweise, und wir haben gesagt: In Zukunft brauchen wir drei Stufen. – Wir sind schon mittendrin in diesem Vorgang und befinden uns jetzt in der ersten Phase: Wir glauben, dass es notwendig ist, eine öffentliche Debatte zu führen, das heißt, eine Debatte, die sich wirklich darum kümmert, dass die Bürger daran teilnehmen, dass sie einen Beitrag leisten, dass sie sagen, was sie von Europa erwarten, welche Sorgen sie haben und wie diese Sorgen zerstreut werden können.
Niemand sagt, dass das einfach sein wird; das wird sicherlich nicht der Fall sein. Das ist in meinem Wahlkreis zumindest nicht die Art von Thema, die normalerweise am Biertisch, in den Klubs und so weiter besprochen wird. Aber durch Gewerkschaften, durch freiwillige Organisationen, durch Pensionistengruppen und Jugendorganisationen sollten wir wenigstens versuchen, die Leute dazu zu bringen, diese Themen aufzugreifen und sich zu überlegen, in welche Richtung die EU gehen soll. – Das ist die Phase eins.
Phase zwei: Das Parlament hat schon sehr klar und deutlich gesagt, dass wir glauben, dass der Konvent, von dem heute schon gesprochen wurde, auch auf der Charta der Grundrechte basieren müsste und dass das die Basis für die Zukunft sein sollte. Man müsste einfach auch beweisen, dass die Debatte auf dieser Basis abgehalten wird, das heißt, mit Parlamentariern, mit Regionalparlamenten, mit Bürgern, mit allen möglichen Vertretern und allen möglichen Kreisen der Öffentlichkeit, bevor hier Entscheidungen getroffen werden.
Wir möchten auch betonen, dass dieser Konvent auf dem Modell der Charta, die wir entwickelt haben, basieren muss. Wir glauben zwar nicht, dass es da ein identisches Dokument geben muss, aber wir wollen unsere Lektionen aus diesen Erfahrungen lernen.
Was jedoch besonders wichtig ist, ist die Vertretung der nationalen Parlamente. Diese muss wahrscheinlich stärker als in der Vergangenheit und stärker als bei der Verfassung der Charta sein. Denn dazu braucht man eine pluralistische Vertretung der nationalen Parlamente. Es müssten auch mehrere politische Parteien bei diesem politischen Prozess vertreten sein.
Wir glauben nicht, dass der Konvent ein Dokument herausbringen wird, das so aussehen wird wie das Dokument, das die Charta schließlich geworden ist. Das können wir nicht erwarten. Wir brauchen aber immerhin ein Dokument, das abgeändert werden kann. Wir glauben, dass ein Konvent grundsätzliche Veränderungen im System vorbereiten und Abänderungen vorschlagen kann. Das muss dann vielleicht noch diskutiert werden, wie es zum Beispiel vor Nizza der Fall war. Es würde dann ein kohärentes Dokument vorliegen, und man hätte verschiedene Optionen, unter denen gewählt werden könnte. All das würde vor der Regierungskonferenz vorbereitet werden müssen. Erst die Regierungskonferenz müsste die Entscheidung treffen.
Wir haben auch vom Zeitpunkt gesprochen. Wir glauben, es wäre besser, wenn die Regierungskonferenz vor dem Jahr 2004 fertig gestellt wird und die Vorbereitungen abgeschlossen werden. Wir glauben nicht, dass die Regierungskonferenz im Jahr 2002 abgehalten werden sollte – das wäre unrealistisch –, aber wir denken, es sollte schon vor dem Frühjahr 2004 eine Entscheidung getroffen sein. Das heißt, wir brauchen unbedingt eine Debatte für die Wahl zum Europäischen Parlament. Das wäre natürlich auch ein wesentlicher Beitrag zur Transparenz.
Die Transparenz ist sicherlich ein wesentliches Thema. Ich möchte hier sagen, dass wir sie unbedingt brauchen. Auch heute Vormittag haben wir hier immer wieder davon gehört. Seit dem Maastrichter Vertrag hat die EU zwei so genannte Säulen zusätzlich zur ursprünglichen ersten Säule gehabt. Diese zwei neuen Säulen wurden sehr unterschiedlich gehandhabt, sie verwendeten unterschiedliche Methoden und erforderten unterschiedliche Kooperationsmodelle mit den nationalen Parlamenten und mit den Einzelstaaten. Das ist also dieser Intergouvernementalismus.
Es wurde heute schon von einem griechischen Tempel gesprochen. Ich stelle fest, auch hier sind wir mehr oder weniger in einem Tempel. Wir haben Strukturen, die an einen griechischen Tempel erinnern, und man weiß nicht, was hinter diesen Wänden vor sich geht. Wenn wir diese Säulenstruktur heraufbeschwören, dann denken wir natürlich immer an den Tempel, aber es ist sehr wichtig, zu erkennen, dass diese Gebäude sehr viele Säulen haben.
Diese Säulen sind sehr wichtig, aber wir haben auch andere Strukturen, die ebenso wichtig sind. Wir haben die Wirtschafts- und Währungsunion – auch das ist zum Beispiel eine Struktur, die wir haben. Wir haben den Wirtschafts- und Sozialausschuss, und wir haben auch die Europäische Investitionsbank, die in Luxemburg zusammentritt.
Ich werde da nicht weiter ins Detail gehen. Wir haben sehr viele Strukturen, aber wir haben keine klare Tempelstruktur. Wir haben sehr unterschiedliche, lose Strukturen, wir haben da ein Patchwork. Wir haben eine Art Burg, die im Laufe der Zeit gebaut wurde: Wir haben eine mittelalterliche Mauer, einen barocken Turm, ein gotisches Türmchen oder Fensterchen oder was immer. Das heißt, in einer – historisch gesehen – kurzen Zeit, nach 50 Jahren, haben wir da eine sehr komische Struktur bekommen, ein Gebäude, das sehr eigenartig ist.
Nun kommen wir auf die Frage zu sprechen, wie man an einer Debatte auf europäischer Ebene teilnehmen kann. Das heißt, man muss Vorschläge dafür unterbreiten, wie man mit dieser Architektur zu Rande kommen will. Dann kommt es dazu, dass die Führer Europas nicht nur von einer allgemeinen Sache sprechen, sondern nach Slogans suchen, mit denen sie uns sagen, was sie mit dieser Architektur anfangen wollen.
So kommt Joschka Fischer dazu, zu sagen: Was wir brauchen, ist eine europäische Föderation. So kommt Jacques Chirac dazu, zu sagen: Was wir brauchen, sind nicht die Vereinigten Staaten von Europa, sondern ein vereintes Europa, das auf Staaten beruht. Worin besteht da der Unterschied? – Ich musste das zweimal lesen, um sicherzugehen, dass ich richtig gelesen hatte.
Tony Blairs Motto besteht darin: eine Supermacht, aber nicht ein Superstaat. Es gibt viele Slogans dieser Art, die von Politikern immer wieder geäußert werden, aber diese Slogans bedeuten eigentlich sehr wenig. Deshalb glaube ich, dass wir an der Basis viel mehr Arbeit leisten müssen. Die Parlamentarier müssen diese Slogans eher ignorieren und vieles tun, um die Botschaft für die Bürger genau aufzubereiten. (Präsident Dr. Fischer übernimmt wieder den Vorsitz.)
Ich habe bereits gesagt, was meiner Ansicht nach das erste Ziel ist: Unser erstes Ziel muss die Vereinfachung sein. Ohne eine Vereinfachung wird es kein Verständnis für die Europäische Union geben. Ich wiederhole: Ohne Verständnis gibt es keine Liebe, keine Loyalität, keine Treue, keine Unterstützung der Institutionen der EU! Egal, wie oft man in den Ministerrat geht oder was immer man tut – man bekommt keine Transparenz, wenn man nicht eine Vereinfachung vornimmt.
Das bedeutet, wir brauchen eine einfache Struktur und eine einfache Architektur. Wir müssen die Verträge vereinfachen, das heißt, wir müssen auch die Institutionen vereinfachen. Das Universitätsinstitut in Florenz hat hierfür schon Vorarbeit geleistet. Wir müssen auch die Entscheidungsprozesse vereinfachen, und wir müssen sicherstellen, dass die Entscheidungen in transparenter Form erfolgen.
Das heißt mit anderen Worten, wir müssen einfach die Idee einer europäischen Verfassung fördern und unterstützen. Der Bundeskanzler hat heute Vormittag gesagt, dass wir sicherlich keine Finalisierungspolitik wollen. Aber wir brauchen ein transparentes Dokument, das die Menschen verstehen können und das sie als europäische Verfassung unterstützen und akzeptieren können.
Das führt uns schon zum nächsten Thema: Was sollte ein derartiges Dokument beinhalten, abgesehen von seiner Struktur? – Ich möchte nur einige der Fragen aufwerfen, die auch in Nizza angesprochen wurden.
Erstens ist dies die Frage der Kompetenzaufteilung, die heute bereits besprochen worden ist. Diese wird sehr oft als das Gegenmittel gegen die Überzentralisierung gesehen, aber ich bin da sehr skeptisch. Erstens ist es schwierig, einen derartigen Katalog zu erstellen. Das ist sehr schwierig, weil es, vielleicht mit einer oder zwei Ausnahmen, nur sehr wenige EU-Kompetenzen gibt. Es gibt fast immer Überlappungen mit nationalen oder regionalen Verwaltungskompetenzen.
Betrachten Sie das am Beispiel der Landwirtschaft. Würden Sie heute einen entsprechenden Katalog erstellen, dann müsste die Kompetenz für die Landwirtschaft wahrscheinlich mehr auf der EU-Seite als auf der nationalstaatlichen Seite liegen. Es ist heute auch die Ansicht vertreten worden, dass die Landwirtschaft renationalisiert werden sollte. Hätten wir einen Katalog der Kompetenzen, dann würde das fast unmöglich werden. Vielleicht wird es – ich argumentiere nicht dafür, um das klarzustellen, aber es könnte so sein – in Zukunft ein Argument dafür geben, die Kompetenz für die Landwirtschaft wieder auf die nationale Ebene zu verlagern. Die Flexibilität dafür würde jedoch mit einem rigiden Katalog der Kompetenzen verschwinden.
Wo wäre die Bildung anzusiedeln? – Das ist eindeutig eine regionale und nationale Kompetenz. Aber es gibt Aspekte des Bildungswesens, die für die EU einfach wichtig sind, wie zum Beispiel die gegenseitige Anerkennung der Qualifikationen und Abschlüsse, der Austausch von Studenten auf universitärer Ebene und so weiter.
Die Erstellung eines solchen Katalogs würde daher zu immensen Schwierigkeiten führen. Ich spreche da aus Erfahrung. Niemand Geringerer als Giscard d'Estaing hat einmal versucht, einen genauen Katalog dafür zu erstellen, und wir haben diese Frage zirka 15 Monate lang im Europäischen Parlament besprochen. Deshalb möchte ich Sie warnen und Ihnen sagen, dass es dafür keine einfache Lösung gibt.
Das heißt nicht, ich würde behaupten, dass es sich dabei nicht um eine wichtige Frage handelt. Ich denke, wir müssen anerkennen, dass die EU manchmal auch Details zu regeln hat, die sie vielleicht nicht regeln sollte. Ich erinnere mich an einen Vortrag, den wir hörten, als wir vor einiger Zeit in Florenz waren. Da hat ein italienischer Professor gegen die Überregulierung gesprochen und gewettert, er hat auch gesagt, dass auf Grund der von der EU vorgeschriebenen extrem hohen Hygienestandards der Käse und die Weine in Italien einfach nicht mehr so gut wie früher sind.
Dieser Professor ist jetzt Präsident der Europäischen Kommission. Ich denke, wenn er wirklich an das glaubt, was er damals sagte, dann sollte er sofort agieren. Er sollte seine Kritik vollkommen ummünzen und sofort, statt einen Katalog der Kompetenzen zu erstellen, einfach das übernehmen, was Jacques Santer vorgeschlagen hat, nämlich dass Europa weniger, das aber etwas besser tun sollte. Das ist der Weg in die Zukunft.
Das heißt, wir brauchen eine kulturelle Veränderung, eine Änderung der Haltung, und zwar ganz besonders in Brüssel; nicht nur in der Kommission, sondern auch im Europäischen Parlament und im Rat. Denn sehr oft ist es so, dass sich die Mitglieder des Rates einfach etwas aushandeln. Wir müssen daher die Kultur verändern. Wir müssen sagen: Dort, wo europäische Aktionen gefragt sind, müssen wir schnell und effektiv handeln, aber in gewissen Bereichen brauchen wir keine europäischen Aktionen, und dort sollten wir nicht einmal eine Debatte darüber führen. Wir sollten es niedrigeren Regierungsebenen überlassen, dort tätig zu werden. „Niedrigere Ebene“ meine ich in geographischem Sinn, das hat überhaupt nichts mit Wichtigkeit zu tun.
Nun möchte ich mich noch rasch mit den anderen Nach-Nizza-Prozessen befassen. Ich möchte dabei nicht diplomatisch sein, sondern auf Grund der Zeitknappheit ganz offen mit Ihnen sprechen.
Ich bin für eine größere Beteiligung der nationalen Parlamente, und ich glaube, dass es da auch auf der europäischen Ebene mehr an Mitspracherecht geben sollte. Die Parlamente haben die Verbindung mit den Menschen, sie haben Zugang zur Presse, sie haben Zugang zu den Menschen – das ist etwas, was das Europäische Parlament nicht so sehr hat. Das heißt, sie müssen an der europäischen Debatte mitwirken.
Ich bin gegen eine zweite Kammer und möchte Ihnen auch die Begründung dafür geben. Erstens ist eine zweite Kammer, wenn sie Macht haben soll, keine echte zweite Kammer, sondern eine Unterkammer. Wir hätten dann außer dem Ministerrat noch ein zusätzliches Gremium, das an der Legislative mitwirken würde. Das heißt, die Entscheidungsfindung wäre noch komplexer, und wir hätten noch ein Gremium, das zwischen den Menschen und den Institutionen stünde.
In vielen Argumenten wird darauf vergessen, dass wir damit keine Verbindung zur nationalen Ebene herstellen, sondern eine zusätzliche EU-Ebene einführen würden. Das heißt, wir hätten hiermit keinerlei nationalen Einfluss auf europäischer Ebene, sondern einfach nur eine weitere europäische Institution. Das würde seitens der Öffentlichkeit sicherlich Frustrationen auslösen. Diese Körperschaft hätte auch keinerlei Macht. Aber wenn sie keine Macht hätte, dann hätte das Ganze sowieso keinen Sinn. Vor allem in meinem Land – und das kann ich wirklich aus Erfahrung sagen – ist es so: Man würde das sicherlich nicht ernsthaft in Erwägung ziehen; ich möchte da ganz ehrlich sein.
Wenn Sie sich an das Jahr 1979 erinnern, als das Europäische Parlament eine Kammer aus indirekt bestellten Mandataren war, so bestand eines der Argumente dagegen, ihr wirkliche Macht zu verleihen, damals darin, dass die Mehrheiten ständig wechselten. Wenn es Wahlen in Deutschland gab, dann waren die Vertreter aus dem Bundestag nicht anwesend. Gab es Wahlen in Großbritannien, dann waren die Mitglieder aus dem Unterhaus nicht anwesend. Es gab daher keine konsistenten Mehrheitsverhältnisse. Aber es ging dabei nicht nur um Wahlen, auch wenn in den nationalen Parlamenten wichtige Debatten stattfanden, blieben die jeweiligen Abgeordneten eher zu Hause. Im Hinblick auf eine konsistente Entscheidungsfindung war dies daher keine verlässliche Kammer.
Nachdem dies klargeworden war, ist der Vorschlag unterbreitet worden, der zweiten Kammer keine legislativen Befugnisse zu geben; stattdessen soll sie eine Art Subsidiaritätskammer sein. Was ist zu diesem Argument zu sagen? Wann würde eine solche Kammer tätig werden? – Würde sie am Beginn des Gesetzgebungsprozesses eingreifen, dann würde sich dieser dadurch enorm verzögern. Es müsste auf die Details eingegangen werden; allein der Titel oder die Präambel eines Gesetzes könnten noch nicht Aufschluss darüber geben, ob das Gesetz, das verabschiedet werden soll, wirklich gegen das Subsidiaritätsprinzip verstieße oder nicht. Das heißt, am Anfang wäre ein Einschreiten sehr schwierig.
Im Fall eines Einschreitens am Ende des Gesetzgebungsprozesses könnte dies Folgendes bedeuten. Eine zweite Kammer würde sich möglicherweise proportional aus Mitgliedern der verschiedenen nationalen Parlamente zusammensetzen. Würde dann der Rat ein Gesetz annehmen und die zweite Kammer es ablehnen, dann hieße das logischerweise, dass die nationale Delegation, die ja Teil einer Regierung ist – dies ist ein wichtiger Punkt –, eigentlich gegen die eigene Regierung gestimmt haben könnte. Dies könnte dann wieder zu landesweiten Diskussionen führen.
Ich denke, dass dieser Mechanismus nicht sehr sinnvoll ist und dass wir andere Möglichkeiten finden müssen, die nationalen Parlamente besser in die Arbeit auf europäischer Ebene einzubinden. Von den bestehenden Möglichkeiten möchte ich hier drei vorschlagen.
Die bereits bestehende COSAC könnte verbessert werden. Wir sollten nach Wegen suchen, damit sie besser arbeiten könnte.
In den letzten drei, vier Jahren haben wir enorme Anstrengungen unternommen, um einen besseren Informationsfluss zu den nationalen Parlamenten herzustellen. Wir müssen dies weiterentwickeln, wir können da mehr Verantwortlichkeit einführen. Aber das ist natürlich nicht nur auf europäischer Ebene so.
Eine Möglichkeit wäre auch, zweimal im Jahr eine Art Bericht über die Lage der Union zu erstatten. Man könnte da zum Beispiel sechsmonatige Programme einführen. Das könnte nicht nur das Europäische Parlament, sondern ein wesentlich größeres Gremium sein. Man könnte nationale Abgeordnete einbeziehen und so weiter. Man weiß natürlich, dass alle diese Informationen in gedruckter Form vorhanden sind. Dennoch ist es anders, wenn man die Informationen dann auch tatsächlich hört. Dann hat man einen anderen Eindruck davon, und dann hat man auch eher die Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen.
Nun habe ich also diese Debatte kritisiert und selbst dieselben Termini verwendet. Ich möchte aber kurz noch sagen, dass wir diese Debatte, diese Diskussion brauchen. Wir sprechen ja jetzt über den Nach-Nizza-Prozess und müssen hier weiterschreiten. Ich bin der Ansicht, dass wir – wie wir schon gehört haben – europaweite Parteien und eine Diskussion über ganz Europa brauchen. Auf diese Weise müssen wir auch sicherstellen, dass bei den Europawahlen im Jahre 2004 Möglichkeiten bestehen, zwischen verschiedenen Parteien auszuwählen. Ich denke, wenn Parteien auf europaweiter Basis ihre Meinungen und Programme darstellen und vertreten müssen, wäre das etwas sehr Gutes.
Es ist nicht sinnvoll, 15 nationale Diskussionen über die Veränderungen und die Zukunft der Union zu führen. Es ist viel besser, eine Diskussion über ganz Europa abzuhalten. Daher wäre es sehr gut, einen demokratischen Prozess zu pflegen, in dem wir europaweite politische Parteien haben. – Danke. (Beifall.)
13.10
Vorsitzender Präsident Dr. Heinz Fischer: Vielen Dank, Herr Martin, für diesen ausgezeichneten Vortrag einschließlich sehr interessanter Vorschläge und Ideen.
Dieses Thema steht auch zur Diskussion. Gibt es dazu Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall.
Ich glaube, das hat nichts mit der Wichtigkeit des Themas zu tun, sondern nur mit der Frage, dass wir in der Zeit jetzt doch schon vorgeschritten sind. – Ich danke nochmals.
V. Der weitere Diskussions- und Entscheidungsprozess zur Zukunft der Europäischen Union
Vorsitzender Präsident Dr. Heinz Fischer: Nun darf ich Sie, Frau Bundesministerin, bitten, Ihren Vortrag zu halten.
13.11
Bundesministerin für auswärtige Angelegenheiten Dr. Benita Ferrero-Waldner: Herr Präsident! Herr Vizepräsident! Lassen Sie mich, bevor ich auf mein eigenes Thema hinsichtlich des Verfahrens eingehe, etwas zur Debatte sagen.
Zum Ersten: Frau Professor Puntscher-Riekmann hat natürlich auch mich angeregt, als sie sagte, dass Europa nicht auf dem Reißbrett gemacht werden soll. Ich muss sagen, das ist auch meine Meinung. Deshalb müssen wir, glaube ich, dort aufbauen, wo wir jetzt stehen. Das heißt, wir müssen auf einer Kommission aufbauen, die wir verstärken können. Wir müssen auf den Räten aufbauen, die meiner Ansicht nach nicht abzuschaffen sind. Ich glaube auch nicht, dass Regierungen illegitim sind, sondern sie sind sehr wohl von ihren nationalen Bevölkerungen gewählt und als solche selbstverständlich handlungsberechtigt und handlungsverpflichtet.
Ich glaube, wir müssen hineingehen in die Debatte über die Frage, wie Parlamente stärker eingebunden werden können. Ich halte es auch für sehr interessant – (in Richtung von Univ.-Prof. Dr. Somek) ich glaube, Sie sagten das –, dass es eigentlich eine Krise des Parlamentarismus und nicht so sehr die Frage der Demokratie ist. Da wäre es meiner Ansicht nach wichtig, die Parlamente stärker einzubeziehen, vielleicht auch das nationale Parlament insofern, als man – das wäre ein Gegenvorschlag zu dem, was Sie sagten, Herr Vizepräsident – Kommissionen bildet, in die man nationale Parlamentarier stärker einbindet. Das wäre ein Modell, wie wir es zum Beispiel in der amerikanischen Verfassung finden. Ich halte das für wesentlich vernünftiger als zum Beispiel eine zweite Kammer des Parlaments, weil ich es wie Sie sehe: dass wir dann – weil es noch schwieriger und umfangreicher würde – noch langsamer zu Entscheidungen kämen.
Ich stimme mit Professor Firlei darin überein, dass die Entscheidungen, die auch in Zukunft auf europäischer Ebene zu fällen sein werden, manchmal schnell gefällt werden müssen und dass wir manchmal mehr Tempo, manchmal aber auch weniger Tempo brauchen. – Das nur ganz kurz zu dieser Debatte. Lassen Sie mich nun auf das eingehen, was Sie eigentlich von mir hören wollen, nämlich auf die Frage: Wie geht es mit dem Verfahren weiter?
Gerade Göteborg hat gezeigt, dass zum einen die Debatte noch nicht weit fortgeschritten ist und erst unter der belgischen Präsidentschaft voll anlaufen wird. Andererseits hat natürlich das irische Referendum sehr stark hereingespielt. Eine Diskussion mit breiter Beteiligung ist etwas, was wir uns inzwischen alle, glaube ich, wünschen und was auch in die neue Formulierung hineingenommen wurde, die jetzt von einem „öffentlichen Forum“ spricht, in das die interessierte Öffentlichkeit – Parlamente, Regionen, Wissenschaft, Medien – eingebunden werden soll.
Sie wissen, dass wir diese Debatte bereits am 30. Mai eröffnet haben. Ich freue mich auch über die heutige Debatte im Parlament. Ich halte sie für sehr interessant, es sind hier sehr gute Ideen geäußert worden. Lassen Sie mich gleich sagen, was ich selbst von diesen nächsten Reformschritten und von dem Verfahren halte.
Erstens würde ich dafür plädieren, dass man den Teilnehmerkreis dieses öffentlichen Forums oder Konventes, wenn Sie so wollen, flexibel und – das ist jetzt etwas Neues – je nach Themenkreis unterschiedlich gestaltet. Das heißt, die politischen Themen – wie zum Beispiel die Frage der Kompetenzabgrenzung, aber auch die Frage der Rolle der nationalen Parlamente – sollten auf breiter Basis diskutiert werden, etwa so, wie es im Konvent zur Grundrechtscharta geschah.
Aber bei anderen Themen, die ebenfalls angesprochen wurden und die sehr wesentlich sind – wie zum Beispiel die Frage der Vereinfachung der Verträge; darin, dass das eine sehr wesentliche Frage ist, gebe ich allen Diskussionsrednern und vor allem Ihnen, Herr Professor Winkler, Recht –, sollten wir auf das Expertengut zurückgreifen und auf das, was in Florenz bereits an Vorarbeit geleistet wurde. Das gilt auch für die Frage der Grundrechtscharta, die bereits erarbeitet wurde; da geht es ja nur um die Frage: Kann sie politisch verbindlich sein? Kann sie sozusagen in die Verfassung hineinkommen oder nicht? – Das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Man wird sich auch überlegen müssen, wie man von der Diskussion – und das ist der zweite wichtige Punkt, das haben auch Sie, Herr Vizepräsident, schon angesprochen, und ich danke Ihnen dafür – dann weiterleitet. Denn es kann nicht so wie bei der Grundrechtscharta-Diskussion sein, dass man einen verbindlichen Text hat, zu dem man eigentlich telquel ja sagen muss. Das wird es sicherlich nicht geben, sondern es muss dann wieder in eine Regierungskonferenz hineinfließen. Denn die Regierungen sind diejenigen, die die Endentscheidung gemeinsam zu treffen haben werden.
Die Frage ist, wie es zu diesem Rückkoppelungsmechanismus kommt. Hierfür könnte man sich alles mögliche vorstellen, vielleicht ein Steering-Committee. Oder man kann sich vorstellen, dass es eine Reihe von Optionen gibt, unter denen ausgewählt wird. Aber ich glaube, dieses größere Gremium ist als Ideengeber sicherlich etwas sehr Positives. – Das ist also der erste große Bereich, den ich ansprechen wollte.
Das Zweite ist die Einbindung der Beitrittskandidaten. Gerade aus österreichischer Sicht scheint es mir ganz wesentlich zu sein, dass wir die Beitrittskandidaten in diese Diskussion bereits einbinden. Wir haben uns schon in Nizza darauf geeinigt, dass diejenigen Kandidaten, deren Beitritte bereits unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert sind, gleichberechtigt an der Regierungskonferenz 2004 teilnehmen sollen. Ich glaube, das ist nur recht und billig. Denn es wäre wohl unzulässig, die Zeit zwischen der Unterzeichnung eines Beitrittsvertrages und seinem In-Kraft-Treten zu nützen, um den Acquis maßgeblich zu verändern, ohne dass die neuen Mitglieder mitentscheiden können. Daher ist das wesentlich, wobei aber noch unklar ist, in welcher Form die Beitrittskandidaten eingebunden werden sollen.
Aller Voraussicht nach werden diese Staaten schon in einigen wenigen Jahren Mitglieder sein. Daher sollen wir sie nicht vor vollendete Tatsachen stellen. Wir sollen sie im Gegenteil zu Miteigentümern dieses Prozesses machen und sie nicht nur sozusagen als „Untermieter“ sehen. Manche der Beitrittskandidaten sind vielleicht fast zu pragmatisch – vor allem diejenigen, die weiter weg stehen –, weil sie im Augenblick glauben, sie werden, wenn sie in die Europäische Union hineingehen – das ist auch eines der Paradoxa, die es jetzt gibt, weil sie noch nicht dabei sind –, die Union als die heile, bessere Welt vorfinden. Je näher sie dem Prozess kommen, desto eher sind sie daran interessiert, an diesen Detailfragen mitzuarbeiten.
Wir haben beim informellen Außenministerrat in Nyköping diese Debatte kurz angerissen. Aber ich muss sagen, sie war viel zu kurz – fünf Minuten für die Beitrittskandidaten, zwei Minuten für uns, das war sicherlich nicht genügend. Ich habe es dann auch bei der Regionalkonferenz gemacht, zu der ich die unmittelbaren Nachbarn und Polen eingeladen hatte. Daran sieht man schon, dass dem von allen eine große Bedeutung zugemessen wird.
Lassen Sie mich abschließend – da alle anderen Fragen in der Debatte schon klar angesprochen worden sind – nur noch einiges zum Grundsätzlichen sagen.
Erstens: Was können wir tun, um Europa wirklich weiter positiv zu vermitteln? – Ich glaube, wir müssen erst einmal selbst von diesem Europa begeistert sein. Nur dann, wenn wir selbst Enthusiasten sind, können wir das auch vermitteln. Für viele außerhalb Europas und auch für diejenigen, die noch nicht in Europa sind – wenn ich jetzt die EU damit meine –, ist das so etwas wie ein geheiligtes Land. Die EU hat inzwischen für die Afrikaner, die Asiaten, die Amerikaner, die Lateinamerikaner Modellcharakter – nur offensichtlich nicht mehr für die eigene Bevölkerung. Das ist etwas, was wir zu ändern versuchen müssen.
Ich glaube nach der Diskussion auch, dass das, was wir immer für wichtig gehalten haben, schon als wir beigetreten sind, nämlich dass die Union für Frieden, Wohlstand und Sicherheit steht, allein für unsere Jugend und für viele andere nicht mehr genügt. Wir müssen ihnen für die Zukunft etwas Neues geben.
Da muss man meiner Ansicht nach – das wurde auch schon gesagt – wirklich in eine größere Frage der Verständigung und des Verständnisses zur Europäischen Union hineingehen. Daher müssen wir die Frage Europas, und zwar die politische Frage Europas, aber auch die rechtliche Frage – Europarecht –, total auf die Tagesordnung setzen. Es muss eine Selbstverständlichkeit sein, mit Europa umzugehen, so wie es eine Selbstverständlichkeit für jeden Bürger sein sollte, mit seinem eigenen Land und seiner eigenen Verfassung umzugehen. – Danke, Herr Präsident. (Beifall.)
13.21
Vorsitzender Präsident Dr. Heinz Fischer: Danke, Frau Bundesministerin. – Ich schlage vor, dass ich zunächst die Frage stelle, ob jemand spezifisch zu den Ausführungen der Frau Bundesministerin das Wort wünscht. Als Zweites werde ich dann die vier Fraktionssprecher fragen, ob sie noch Schlussbemerkungen im Ausmaß von zwei oder drei Minuten machen wollen. Dann werden wir, wie es im Programm vorgesehen ist, zum Abschluss kommen.
Professor Winkler, haben Sie sich gemeldet? (Univ.-Prof. Dr. Winkler: ... vielleicht am Schluss?) Die vier haben das letzte Wort, Herr Professor. Daher erteile ich Ihnen jetzt das Wort. – Bitte.
13.22
Univ.-Prof. Dr. DDr. h. c. Günther Winkler (Universität Wien, Institut für Staats- und Verwaltungsrecht): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich werde mich kurz fassen. – Ich komme noch einmal zurück auf meine Eingangsbemerkungen über das Verhältnis von Völkerrecht und Staatsrecht und über das Verhältnis von Staatsrechtlern und Völkerrechtlern. Ich möchte noch einmal meine Warnung wiederholen: Fallen Sie nicht herein auf diese plakative Orientierung der Wissenschaften, die bestimmte theoretische Denkfiguren zu Kriterien für rechtliche Urteile machen wollen!
Es geht nicht um den qualitativen Unterschied und auch nicht um die Trennung von Verfassungsrecht und Völkerrecht, sondern um die Integration von beidem. Das ist eine Realität. Haben Sie keine Scheu, von einer Verfassung Europas zu reden und auch zu träumen! Wir brauchen eine einheitliche Verfassung Europas.
Es ist ganz egal, ob dieses Gemeinschaftsgefüge ein Staat, ein Bundesstaat – oder ein Bundesstaat im Werden –, eine Föderation oder etwas anderes ist. Der Staat Europa der Zukunft ist im Sinne Georg Jellineks eine Verbandseinheit sesshafter Menschen mit ihren Innenstrukturen von mehreren Verbandseinheiten sesshafter Menschen mit staatlichen Komponenten, die es zu respektieren gilt.
Noch eine kurze Bemerkung: Ich unterschreibe die These, dass es keine zweite Kammer geben soll – auf der einen Seite, weil wir schon eine haben. In Wirklichkeit ist der Rat die zweite Kammer! Es geht nicht darum, eine neue zweite Kammer zu schaffen und vielleicht den Rat abzuschaffen, sondern es geht darum, den Rat in der Verbindung zu den europäischen Organen, zum Parlament und zur Kommission, aber auch zu den nationalen Parlamenten zu positionieren und den Rat gewissermaßen als eine Transferstelle für die Teilnahme nationaler Parlamente an der Gesetzgebung Europas zu betrachten. – Ich danke. (Beifall.)
13.24
Vorsitzender Präsident Dr. Heinz Fischer: Danke, Herr Professor Winkler. – Wir kommen damit zu einer Art Schlussrunde.
VI. Schlussfolgerungen
Vorsitzender Präsident Dr. Heinz Fischer: Ich befreie Herrn Abgeordneten Voggenhuber von den „glühenden Kohlen“, auf denen er im Hinblick auf den Flugzeug-Abflugtermin sitzt, indem ich jetzt die umgekehrte Reihenfolge wähle. – Bitte, Herr Abgeordneter Voggenhuber.
13.24
Abgeordneter zum Europäischen Parlament Johannes Voggenhuber (Grüne): Danke, Herr Präsident! Ich bedanke mich auch bei den Kollegen für die stillschweigende Duldung dieser Umkehrung der Reihenfolge.
Frau Minister, nur damit kein Missverständnis entsteht: Ich habe nie behauptet und werde nie behaupten, dass die Regierungen der Staaten der EU illegitim sind. Sie sind selbstverständlich demokratisch legitimiert, wenn auch nicht – wie Sie behauptet haben – demokratisch gewählt. Ihre Legitimation besteht in ihrer Bindung an die Parlamente.
Ich denke, es ist wichtig – und das ist in verschiedenen Stellungnahmen hier sehr deutlich geworden –, zwei Disbalancen festzustellen, mit denen wir in Europa beschäftigt sind. Die eine ist der Übergang von einer internationalen Organisation zu einer supranationalen Staatlichkeit, in dem wir politische Macht, nationalstaatliche Souveränitätsrechte auf die europäische Ebene transferiert haben, ohne ein angemessenes System von „checks and balances“ auf der europäischen Ebene mit zu begründen. Das ist nicht nur eine Parlamentarismuskrise – das ist sie im Kern, damit ist sie aber auch eine Demokratiekrise; das kann wohl kein Gegensatz sein –, sondern das geht auch zum Beispiel in die sich öffnende Kluft der Grundrechte, des erodierenden Grundrechtsschutzes. Oder es geht in die Frage der Öffentlichkeit der Gesetzgebung.
Frau Bundesminister! Was ruft man eigentlich an, wenn man die europäische Tradition anruft, wenn die Öffentlichkeit der Gesetzgebung – heiligster Grundsatz der Demokratie und Grundlage dafür, dass Bürger Politik zur Verantwortung ziehen können – im Rat einfach negiert wird oder wenn der Europäische Gerichtshof in den sensibelsten Bereichen – Polizei, Justiz, Dritte Säule – von der Kontrolle staatlicher Gewalt ausgeschlossen wird? – Das sind Zustände, die demokratisch schlicht unerträglich sind! Diejenigen, die das tun, haben die mangelnde Akzeptanz zu verantworten.
Ein letzter Satz zu einer zweiten Ungleichgewichtigkeit, einer zweiten schweren Disbalance, mit der wir befasst sind: Sie besteht darin, dass die europäische Integration als Prozess vom Motiv oder den Notwendigkeiten oder Zwangsläufigkeiten wirtschaftlicher Zentralisierung wesentlich stärker als von den politischen Motiven angetrieben wurde. Wir haben daher einen hoch konzentrierten Wirtschaftsraum in höchster Zentralisierung vor uns, während die flankierenden Politiken – und hier vor allem die Entwicklung einer sozialen Dimension – zur Zähmung dieses Marktes hintangehalten und zum Teil offen gebremst wurden. Zum Teil wird – ich nenne jetzt nur das polemische Stichwort „Neoliberalismus“ – darauf gesetzt, dass die nationalen Souveränitätsrechte, die unter dem Vorwand der Europäisierung nach Europa abgegeben werden, dort nicht realisiert werden, sondern dass mit der Wahnidee des „schlanken Staates“ Politik und das Politische grundsätzlich angegriffen werden.
Diese zwei Punkte – die Zähmung der Macht und die Zähmung der wirtschaftlichen Interessen – bilden eigentlich die Aufgabe einer republikanischen Ordnung für Europa, die wir brauchen. Dazu sage ich, wir werden sie nur durch die Bürger in Allianz mit den Parlamenten bekommen. (Beifall.)
13.28
Vorsitzender Präsident Dr. Heinz Fischer: Zu Wort gelangt nun Herr Abgeordneter Kurzmann. – Bitte.
13.28
Abgeordneter Dr. Gerhard Kurzmann (Freiheitliche): Herr Präsident! Frau Bundesminister! Sehr geehrte Damen und Herren! Es wäre schwierig, wollte man am Ende einer solchen Enquete eine Zusammenfassung aller Referate, die gehalten worden sind, und aller Stellungnahmen versuchen.
Wir haben seit 9 Uhr ein sehr breites Spektrum von interessanten und diskussionswürdigen Ideen kennen gelernt. Alle Referenten und alle, die sich an der Diskussion beteiligt haben, haben mit Sicherheit zur individuellen Meinungsbildung beigetragen, ohne dass sich daraus zwangsläufig eine einheitliche Meinung aller hier im Saale Anwesenden ergeben hätte. Aber das wäre auch keineswegs der Zweck einer solchen Enquete.
Wir wissen, dass das nur eine Auftaktveranstaltung war und dass weitere Veranstaltungen folgen werden. Ich glaube auch, dass ein intensivierter Dialog mit den Bürgern über den Themenbereich Europa – Erweiterung – Nach-Nizza-Prozess notwendig sein wird.
Im Namen der freiheitlichen Nationalratsfraktion möchte ich mich bei allen bedanken, die zu diesem lebendigen Gedankenaustausch beigetragen haben, bei den Vertretern der Politik ebenso wie bei den Wissenschaftern. Sie, meine Damen und Herren aus der Wissenschaft, sind die geistigen Impulsgeber, ohne die ein gesellschaftlicher Fortschritt auch für die Politik nicht möglich wäre. – Danke vielmals. (Beifall.)
13.29
Vorsitzender Präsident Dr. Heinz Fischer: Herr Abgeordneter Dr. Spindelegger, bitte.
13.30
Abgeordneter Dr. Michael Spindelegger (ÖVP): Sehr geschätzte Damen und Herren! Ich glaube, das Ziel unserer Enquete ist erreicht. Wir wollten hier im Haus einen Anfang für eine Diskussion über die Zukunft Europas, über dieses neuerliche Procedere nach Nizza setzen. Es ist nicht verwunderlich, dass es keine einheitliche Meinung dazu gibt, sondern eine sehr unterschiedliche, würde ich sogar sagen, unterschiedlich nach Fraktionen, aber auch nach Institutionen, aber es zeigt sich nach diesem Vormittag doch, dass es von der Themenstellung her – Kompetenzabgrenzung, Stärkung der nationalen Parlamente, Verfassungsgesetzgebung auch in Europa, mehr Demokratie – eine gewisse Richtung gibt, in die sich alle bewegen. Das stimmt mich positiv.
Ich würde meinen, der nächste Schritt müsste sein, dass auch innerhalb der Parteien, dass innerhalb der Institutionen Österreichs, innerhalb der Sozialpartner die Fragen vertieft werden, bevor wir uns wieder in einer parlamentarischen Enquete diesem Thema widmen.
Es war jedenfalls wert, die Diskussion heute zu führen und zu versuchen, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Ich denke, nach vielen weiteren Schritten könnte am Ende des Prozesses ein solcher kleinster gemeinsamer Nenner auch gefunden werden. (Beifall.)
13.31
Vorsitzender Präsident Dr. Heinz Fischer: Herr Abgeordneter Dr. Einem, bitte.
13.31
Abgeordneter Dr. Caspar Einem (SPÖ): Meine sehr geehrten Damen und Herren! Auch ich möchte zunächst sagen: Ich bin sehr froh darüber, dass wir diese Enquete heute gehabt haben. Ich denke, die Diskussion war nützlich. Sie hat uns – mich jedenfalls und unsere Fraktion – auch in manchen der Beiträge bereichert.
Sie erlauben, dass ich ein paar Worte der inhaltlichen Zusammenfassung aus meiner Sicht dazu sage:
Erstens: Ich glaube, es ist an mehreren Stellungnahmen ziemlich deutlich geworden, dass es absolut notwendig ist, Luft herauszunehmen aus dem Unmut der Bevölkerung. Und ein Weg dorthin besteht darin, die Regeln, die die Menschen zu befolgen haben, letztlich auch durch sie selbst beschließen zu lassen. Das ist ein wesentlicher Punkt, und der weist in Richtung stärkere Parlamentarisierung der Europäischen Union.
Der zweite Punkt ist, die Union als Instrument der Interessen der Bürgerinnen und Bürger spürbar zu machen. Firlei hat sehr deutlich darauf hingewiesen, dass etwa die Europäische Union das Instrument sein könnte, aber beileibe und bei weitem nicht ist, das europäische Sozialmodell gegen die Grenzenlosigkeit von Kapitalinteressen zu verteidigen und aufrechtzuerhalten. Davon sind wir entfernt, das muss spürbar werden, dann werden auch die Bürger und die Bürgerinnen in ihrer Mehrheit sich dazu bekennen.
Drittens: Wir brauchen eine öffentliche Diskussion über diese Inhalte, nämlich über die materiellen Interessen. Ich meine damit nicht nur geldliche Interessen, sondern ich meine inhaltliche Interessen, Alltagsinteressen, Lebensinteressen dieser Bürgerinnen und Bürger, deretwegen wir die Union verändern wollen. Im Anschluss daran geht es um die Instrumente, wie man das macht. Aber zunächst geht es um den Inhalt. Und diese Debatte müssen wir führen.
Vierter Punkt: Verfahren Post-Nizza. Ich möchte noch einmal versuchen, es so deutlich und so klar wie möglich zu sagen: Für uns braucht es zur Vorbereitung der Entscheidungen bei einer Regierungskonferenz und letztlich bei einem Gipfeltreffen der Union längstens im Jahre 2004 einen Konvent, zusammengesetzt aus Parlamentariern der nationalen Parlamente, des Europaparlaments und aus Regierungsvertretern und der Kommission. Dies ist für mich ein Konvent.
Er muss offen sein, und zwar inhaltlich offen sein, erstens für die Kandidatenländer, solange sie solche sind – sie müssen Platz, aber nicht notwendigerweise Stimme haben; sie müssen Stimme haben ab dem Moment, ab dem klar ist, dass sie beitreten –, er muss auch offen sein für die Zivilgesellschaft – besser als das der Grundrechtskonvent gewesen ist, aber mit der Intention, wirklich zu hören, welche Vorschläge von dort kommen –, und er muss einen Vorschlag erarbeiten, möglichst einen einheitlichen Vorschlag, an den formell nach heutiger Vertragslage die Regierungskonferenz nicht gebunden ist. Das war beim Grundrechtskonvent nicht anders, Frau Außenministerin. Tatsächlich war sie gebunden, formell war die Regierungskonferenz nicht gebunden.
Der Grund, warum Regierungsvertreter darin vertreten sein sollen, besteht darin, dass sie nicht überrascht sein sollen über das, was herauskommt. Sie sollen über ihre Vertreter auch dafür sorgen können, dass ihre Positionen darin vertreten werden.
Aber – fünfter Punkt meiner Anmerkungen – inhaltlich gibt es schon eines vorweg zu nehmen: Ich trete eindeutig dafür ein, dass ein materieller Inhalt des Vorschlages eines solchen Konventes darauf hinauslaufen muss, dass künftig Verfassungsänderungen der Union durch einen Konvent und nicht mehr durch Regierungskonferenzen gemacht werden, weil ich das Verfahren für am Ende seiner Laufzeit angekommen halte. Nur lässt es sich bis zur nächsten Regierungskonferenz nicht ändern, daher sollte es in der nächsten Regierungskonferenz geändert werden.
Lassen Sie mich eine letzte Anmerkung machen, die sich auf die nationale Ebene bezieht, weil ich glaube, dass heute richtigerweise darauf hingewiesen worden ist, dass wir auch da etwas ändern müssen.
Ich glaube, uns nationalen Parlamentariern tut es unglaublich gut, wenn wir öfter und intensiver mit Europaparlamentariern, und zwar nicht nur unseren eigenen, sondern auch – wie heute mit David Martin – mit Europaparlamentariern aus anderen Ländern reden, weil dadurch Europa auch für uns viel spürbarer und lebendiger wird. Es geht nicht um das Parteienhickhack zwischen uns, das leicht auszuarten droht, sondern es geht darum, auch zu sehen, wie die europäische Debatte auf europäischer Ebene mit anderen Vertretern, also Vertretern anderer Länder, anderer Bürgerinnen und Bürger in ihren Ländern funktioniert. – Das ist der eine Punkt.
Vielleicht eine persönliche Anmerkung dazu: Hätte ich nicht die Chance gehabt, als Minister sehr intensiv in den verschiedenen Ministerräten und nachher auch noch im Grundrechtskonvent Europa institutionell und von den unterschiedlichen Interessen und Kulturen her kennen zu lernen, mein Engagement wäre zweifellos geringer. Das Problem, das wir im nationalen Parlament haben, ist, dass wir zu wenige haben, die diese Erfahrung gemacht haben und sich daher insoweit für Europa interessieren würden.
Letzter Punkt in diesem Kontext: Es ist schon einmal angesprochen worden, und auch ich glaube, wir sollten uns überlegen, ob wir die Debatten, die wir heute im Hauptausschuss führen, nicht in der einen oder anderen Form ins Plenum verlegen sollten, weil es wichtig ist, dass Europaangelegenheiten dort abgehandelt werden, wo auch sonst die Gesetze letztlich beschlossen werden. Wir sollten nicht den Eindruck erwecken, dass es zwar ein hübsches Stellvertretergremium gibt, in dem über europäische Angelegenheiten gesprochen wird, aber in Wirklichkeit ist es egal, sondern es muss dort geschehen, wo auch sonst die wesentlichen Entscheidungen fallen. Das kann durchaus auf die gleiche Weise wie im Hauptausschuss vor sich gehen, also mit der Möglichkeit, von Regierungsmitgliedern eine Erklärung zu hören und andererseits Fragen zu stellen, aber eben im Plenum des Nationalrates. Das würde das Engagement aller Parlamentarier für europäische Fragen vermutlich heben. (Beifall.)
13.37
Vorsitzender Präsident Dr. Heinz Fischer: Danke vielmals. – Meine Damen und Herren! Wir sind damit zeitgerecht am Ende dieser vom Hauptausschuss beschlossenen parlamentarischen Enquete angelangt.
Natürlich freuen sich alle, die diese Enquete beschlossen haben, dass von mehreren Teilnehmern – zuletzt auch von der Frau Bundesministerin – zum Ausdruck gebracht wurde, dass diese Veranstaltung als nützlich empfunden wird. In der Tat sind ja sehr grundlegende Fragen einerseits und dann in einem breiten Bogen auch sehr konkrete Fragen angeschnitten und auch konkrete Vorschläge gemacht worden. Ich denke zum Beispiel an das, was der Bundeskanzler zur Frage eines individuellen Klagerechts gesagt hat oder was über flexible Formate bei einem Konvent gesagt wurde oder was zuletzt Caspar Einem angeregt hat, solche Themen verstärkt auch im Plenum des Nationalrates zu debattieren. Ich glaube, dass es darüber sogar Konsens gibt, denn ich habe denselben Gedanken bei der Veranstaltung der Bundesregierung vor einigen Wochen in der Hofburg geäußert, und es ist dazu sowohl vom Bundeskanzler als auch vom Fraktionsvorsitzenden der ÖVP positiv Stellung genommen worden.
Natürlich ist es nicht verwunderlich, dass auch die Stellung und die Mitwirkung der nationalen Parlamente bei dieser Veranstaltung eine wichtige Rolle gespielt haben, wobei wir auch die Standpunkte der Länder und der Gemeinden dazu gehört haben und die Länder natürlich auch auf ihre Aspekte, auf ihre Gesichtspunkte und auf ihre Rolle hingewiesen haben.
Ich möchte Ihnen mitteilen, dass wir von den heutigen Ausführungen – sowohl von den Referaten, die gehalten wurden, als auch von den insgesamt 21 Diskussionsbeiträgen, die geleistet worden sind – ein Stenographisches Protokoll anfertigen werden, sodass nichts verlorengeht von dem, was gesagt wurde. Wir sind außerdem im Begriffe, von Seiten des Nationalrats bis zum Ende des Sommers eine Broschüre zum Thema Post-Nizza oder Zukunft Europas anzufertigen, in der wir verschiedene interessante Aspekte dieses Prozesses und Diskussionsbeiträge berücksichtigen werden. Da wird das, was heute gesagt wurde, auch eine gewisse Rolle spielen; nicht in Form von wörtlicher Wiedergabe, aber durch das Aufgreifen des einen oder anderen Gedankens. Außerdem ist es ja nicht die letzte Veranstaltung dieser Art, sondern wir arbeiten daran, im Herbst eine Fortsetzung – natürlich mit variabler Themenstellung – zu organisieren.
Es bleibt mir nur mehr, allen zu danken, die heute mitgewirkt und mitgeholfen haben:
In erster Linie danke ich den Referenten für ihre gut vorbereiteten Ausführungen.
Ich freue mich, dass die Frau Bundesministerin mit anderen gemeinsam vom Anfang bis zum Ende teilgenommen hat.
Ich danke auch ganz besonders Ihnen, David Martin. Sie haben eine weite Anreise auf sich genommen und ebenfalls vom Anfang bis zum Ende mitgewirkt.
Ich bedanke mich bei den Medien. Wir sind nicht böse darüber, wenn auch berichtet wird.
Ich bedanke mich auch bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Parlamentsdirektion.
Herzlichen Dank! Die Enquete ist geschlossen. (Beifall.)
Schluss der Enquete: 13.41 Uhr
|
Wiener Zeitung Digitale Publikationen GmbH 741 152 |