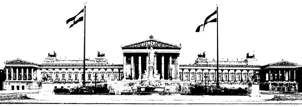
„Die Umsetzung
der
EU-Biopatentrichtlinie 98/44/EC –
Chancen und Risken“
Parlamentarische Enquete
Mittwoch, 8. Oktober 2003
(Stenographisches Protokoll)
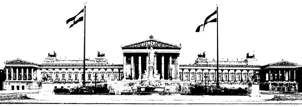
„Die Umsetzung
der
EU-Biopatentrichtlinie 98/44/EC –
Chancen und Risken“
Parlamentarische Enquete
Mittwoch, 8. Oktober 2003
(Stenographisches Protokoll)
Parlamentarische Enquete
Mittwoch, 8. Oktober 2003
(XXII. Gesetzgebungsperiode des Nationalrates)
Thema
„Die Umsetzung der EU-Biopatentrichtlinie 98/44/EC – Chancen und Risken“
Dauer der Enquete
Mittwoch, 8. Oktober 2003: 11.05 – 16.41 Uhr
*****
Tagesordnung
Eröffnung:
Abg. Dr. Reinhold Mitterlehner
Einleitungsreferate:
Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz Vizekanzler Mag. Herbert Haupt
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit Dr. Martin Bartenstein
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie Hubert Gorbach
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Dipl.-Ing. Josef Pröll
Einleitende Statements der Parlamentsfraktionen:
Abg. Dr. Reinhold Mitterlehner
Abg. Mag. Ulrike Sima
Abg. Dipl.-Ing. Maximilian Hofmann
Abg. Dr. Eva Glawischnig
Impulsreferate:
Univ.-Prof. DDr. Johannes Huber
Dr. Otmar Kloiber
Dr. Wolfgang Schallenberger
Dr. Christine Godt
Diskussion
*****
Eröffnung
Abg. Dr. Reinhold Mitterlehner .................................................................................... 4
Einleitungsreferate
Vizekanzler Mag. Herbert Haupt ................................................................................... 4
Bundesminister Dr. Martin Bartenstein ...................................................................... 6
Bundesminister Hubert Gorbach ................................................................................. 9
Bundesminister Dipl.-Ing. Josef Pröll ........................................................................ 11
Einleitende Statements der Parlamentsfraktionen
Abg. Dr. Reinhold Mitterlehner .................................................................................. 14
Abg. Mag. Ulrike Sima ................................................................................................. 15
Abg. Dipl.-Ing. Maximilian Hofmann .......................................................................... 17
Abg. Dr. Eva Glawischnig ........................................................................................... 18
Impulsreferate
Univ.-Prof. DDr. Johannes Huber .............................................................................. 20
Dr. Otmar Kloiber ......................................................................................................... 23
Dr. Wolfgang Schallenberger ..................................................................................... 27
Dr. Christine Godt ........................................................................................................ 30
Diskussion
Prof. Dr. Nikolaus Zacherl .................................................................................... 34, 79
Dr. Christoph Then ............................................................................................... 35, 74
Univ.-Prof. Dr. Günter Virt .......................................................................................... 37
Dr. Ingrid Schneider ............................................................................................. 39, 67
Univ.-Prof. Dr. Kurt Zatloukal ..................................................................................... 41
Dr. Josef Hoppichler ............................................................................................. 42, 82
Dr. Daniel Alge ....................................................................................................... 44, 77
MEP Ursula Schweiger-Stenzel .................................................................................. 45
Abg. Dr. Kurt Grünewald ............................................................................................ 46
Abg. Dipl.-Ing. Elke Achleitner .................................................................................... 48
Bundesrätin Elisabeth Kerschbaum .......................................................................... 48
Univ.-Doz. Dr. Peter Weish .......................................................................................... 49
Dr. Peter Mateyka ......................................................................................................... 50
O. Univ.-Prof. Dr. Josef Glössl ................................................................................... 51
Mag. Petra Lehner ........................................................................................................ 52
Abg. Dr. Gertrude Brinek ............................................................................................ 54
Abg. Mag. Karin Hakl ................................................................................................... 55
Abg. Dipl.-Ing. Wolfgang Pirklhuber .......................................................................... 56
Dr. Gerda Redl .............................................................................................................. 57
Dr. Johann Hager ......................................................................................................... 59
Univ.-Prof. Dr. Christine Mannhalter ......................................................................... 60
Univ.-Doz. Dr. Alexander Haslberger ......................................................................... 61
Dr. Helge Torgersen ..................................................................................................... 62
Abg. Ing. Hermann Schultes ....................................................................................... 63
Dr. Kurt Konopitzky ..................................................................................................... 64
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Karl Kuchler ....................................................................... 66
Hans Schaller ................................................................................................................ 67
Dr. Christine Godt ........................................................................................................ 69
Dr. Ernst Leitner ........................................................................................................... 70
Univ.-Prof. Dr. Holger Baumgartner .......................................................................... 73
Univ.-Prof. Dr. Alexander von Gabain ....................................................................... 76
Dr. Otmar Kloiber ......................................................................................................... 80
Beginn der Enquete: 11.05 Uhr
Vorsitzende: Abgeordneter Dr. Reinhold Mitterlehner, Abgeordnete Mag. Ulrike Sima, Abgeordneter Dipl.-Ing. Maximilian Hofmann, Abgeordnete Dr. Eva Glawischnig.
*****
Eröffnung
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Reinhold Mitterlehner: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf Sie sehr herzlich zur Parlamentarischen Enquete „Die Umsetzung der EU-Biopatentrichtlinie 98/44/EC – Chancen und Risken“ begrüßen und die Sitzung eröffnen.
(Es erfolgen technische Mitteilungen durch den Vorsitzenden.)
Einleitungsreferate
11.08
Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz Vizekanzler Mag. Herbert Haupt: Sehr geehrte Damen und Herren! Hohes Präsidium! Hohes Haus! Mit der nunmehr intendierten Umsetzung der EU-Richtlinie 98/44 über die Patentierbarkeit von biotechnologischen Erfindungen soll zum einen einer Verpflichtung Österreichs der EU gegenüber nachgekommen und zum anderen zugleich eine innerstaatliche Rechtslücke geschlossen werden.
Sehr geehrte Damen und Herren! Ich erachte beide Punkte grundsätzlich für wesentlich und wichtig, möchte aber dennoch bemerken, dass jeder Patentierung – sowohl nach innerösterreichischem Recht als auch nach den Bestimmungen der Europäischen Union – gerade im Rechtsbereich und im Bereich der Biotechnologie eine intensive Forschungsarbeit gegenübergestellt werden muss.
Und hier sehe ich einen wichtigen Ansatzpunkt für eine mögliche Kritik an der aktuellen Vorgangsweise: Bei der Erteilung eines Patents wird grundsätzlich nur beurteilt, ob die Erfindung neu, gewerblich verwertbar und eine erfinderische Leistung eo ipso darstellt. Nicht jedoch erfolgt bei Erteilung eines Patents eine ethische Bewertung des zeitlich davor liegenden Forschungsvorganges und dessen ethische Berücksichtigung!
Artikel 6 der Richtlinie nimmt Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde, von der Patentierbarkeit aus. So werden insbesondere gemäß Absatz 2 Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen, Verfahren zur Veränderung der gentechnischen Identität der Keimbahn des menschlichen Lebewesens sowie die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.
Diese Einschränkungen gehen aber meines Erachtens nicht weit genug. Vor allem nimmt die Richtlinie keinen Bezug auf die Frage, wie es zu den Forschungsergebnissen gekommen ist.
Genau hier ist zu hinterfragen, auf welchen – ethisch vertretbaren – Wegen und auf Grund welcher Vorgangsweisen die zum Patent angemeldeten biotechnologischen Erfindungen überhaupt zustande gekommen sind.
Ich denke da insbesondere an die Forschungseingriffe an nicht einwilligungsfähigen Personen, die nicht ihrem eigenen Nutzen dienen, wie sie etwa in der von Österreich noch nicht ratifizierten Europäischen Biomedizin-Konvention vorgesehen sind. Bei diesem Personenkreis, sehr geehrte Damen und Herren, handelt es sich nämlich nicht um eine quantité négligeable, also nicht um eine kleine Minderheit, sondern um eine durchaus sehr große Anzahl von Personen: um Patienten im Wachkoma, an Alzheimer erkrankten Personen, um Menschen mit hochgradiger Altersdemenz und sonstigen Demenzerscheinungen, um Menschen mit einer geistigen Behinderung, um psychisch erkrankte Menschen und letztendlich auch um minderjährige Kinder; Bevölkerungsschichten, die im Schutzbereich meines Bundesministeriums für Soziales und Generationen liegen. Es handelt sich um Personen, die ein besonderes Schutzbedürfnis haben.
Auch die Richtlinie selbst nimmt zumindest indirekt auf diese Problematik Bezug, nämlich in der Erwägung 26, in der es heißt:
„Hatte eine Erfindung biologisches Material menschlichen Ursprungs zum Gegenstand oder wird dabei derartiges Material verwendet, so muss bei einer Patentanmeldung die Person, bei der Entnahmen vorgenommen werden, die Gelegenheit erhalten haben, gemäß den innerstaatlichen Rechtsvorschriften nach Inkenntnissetzung und freiwillig der Entnahme zuzustimmen.“
Genau hier, sehr geehrte Damen und Herren, setzt die Problematik für einwilligungsunfähige Personen an, die eben nicht in der Lage sind, freiwillig ihre Zustimmung zu erteilen beziehungsweise bei ihrer freiwilligen Zustimmung nicht in der Lage sind, die weiteren Folgen für sich abzuschätzen und daher die Zustimmung im vollen Bewusstsein der Abschätzung der Folgen zu geben.
Ich denke daher, dass es sinnvoll wäre – und das ist meine Forderung als Minister für Generationen –, zuerst bestehende potentielle Gefährdungen einwilligungsunfähiger Personen innerstaatlich abzusichern, etwa durch entsprechende Festschreibungen auf Ebene der Bundesverfassung – und dann erst weitere legistische Schritte, etwa durch eine Novellierung des Patentrechtes, zu setzen.
Es ist mir selbstverständlich bewusst, dass wir uns gerade in einer Phase der innerstaatlichen Neuordnung des Verfassungsbestandes der Republik Österreich befinden, ich halte es aber trotzdem für notwendig und sinnvoll, diesen von mir skizzierten Schritt zuerst zu setzen, um nach Festsetzung im Verfassungsrang die weiteren Schritte, nämlich die Bioethik-Richtlinie zu ratifizieren und die Biopatent-Richtlinie im Parlament einer Beschlussfassung zuzuführen, nicht mehr zu behindern, weil damit die wichtigsten Punkte für einwilligungsunfähige Personen innerstaatlich im Verfassungsrang abgesichert werden. – Ich halte die isolierte Umsetzung beider Rechtsbereiche ohne einen solchen Schritt, sehr geehrte Damen und Herren, für rechtlich nicht vertretbar.
Wenn wir in Betracht ziehen, dass mehr als die Hälfte der derzeitigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Biotechnologie-Richtlinie noch nicht innerstaatlich umgesetzt haben: Das hat wohl auch seine guten Gründe, von denen durchaus vermutet werden kann, dass sie zumindest teilweise im Bereich massiver ethischer Bedenken angesiedelt sind, wie ich auf Grund von Gesprächen mit meinen Fachministerkollegen aus anderen europäischen Staaten weiß.
Besondere Nachteile für den Wirtschafts- und Forschungsstandort Österreich sind derzeit zwar nicht unmittelbar abzusehen, aber wenn wir das internationale Ranking Österreichs als Standort für biotechnologische Forschungen im Bereich der Medizin betrachten, so ist auch unübersehbar, dass wir Jahr für Jahr Platz um Platz verlieren.
Und wenn wir wissen, dass Bioethik auf der einen Seite und Gentechnologie auf der anderen Seite gerade im Bereich der Medizin von sehr vielen Österreicherinnen und Österreichern, die heute schon in den Vorteil von Forschungsergebnissen aus diesem Bereich kommen, zu Recht befürwortet werden, so haben wir hier einen besonderen Handlungsbedarf im Spannungsfeld zwischen Ethik, Wirtschaft, Wissenschaft und Patentierbarkeit.
Die beiden eingesetzten Ethik-Kommissionen – jene Ethik-Kommission der Bundesregierung, die die Rechte der Menschen mit Behinderungen im weitesten Sinne apostrophiert hat, und die Ethik-Kommission beim Bundeskanzleramt – haben sich mit diesem Spannungsfeld befasst. Sie sind in der Güterabwägung zu eindeutigen Schlüssen gekommen. Ich darf daher die Damen und Herren des österreichischen Parlaments bitten, sich die Ergebnisse der Ethik-Kommissionen genau anzusehen und den von mir skizzierten Schritt zu setzen, nämlich zunächst die Rechte der Menschen mit Behinderungen, der Menschen, die einwilligungsunfähig im weitesten Sinne sind, in der Verfassung festzulegen und dann die beiden nächsten rechtlichen Schritte zu machen. Ich glaube, wir brauchen alles, aber zunächst brauchen wir die verfassungsmäßige Absicherung der Menschen in Österreich, sodass mit ihnen ordnungsgemäß und nur mit ihrem Einverständnis oder mit dem Einverständnis ihrer Vertretungen – egal, ob es Sachwalterschaft, Eltern oder andere sind – die entsprechenden Forschungsergebnisse erzielt und umgesetzt werden können. Eine andere Sicht kann ich als Bundesminister für Soziales und Generationen nicht haben!
11.16
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Reinhold Mitterlehner: Ich darf nun Herrn Bundesminister Dr. Martin Bartenstein um seine Stellungnahme bitten.
11.17
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit Dr. Martin Bartenstein: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Herr Vizekanzler! Meine geschätzten Kollegen der Bundesregierung! Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor allem meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete, die Sie an dieser Parlamentarischen Enquete teilnehmen, wofür ich herzlich danke. Der Herr Vizekanzler hat vom Spannungsfeld und vom Handlungsbedarf gesprochen – beides kann ich unterstreichen. Die entsprechende Biopatentrichtlinie der Europäischen Union wurde im Sommer 1998 verabschiedet und hätte bis zum Sommer 2000 umgesetzt sein sollen. Der Status quo ist, dass sie sieben Mitgliedstaaten der Europäischen Union umgesetzt haben, acht – darunter Österreich – noch nicht. Und der weitere Status quo ist, dass die Europäische Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen jene Mitgliedstaaten eingeleitet hat, die sie noch nicht umgesetzt haben. Daraus, aber nicht nur daraus, resultiert Handlungsbedarf, und die Zeit ist ein Faktor, der nicht gering zu schätzen ist.
Ganz wesentlich ist, dass sich nicht nur die Bioethik-Kommission – ich komme darauf noch zu sprechen –, sondern auch der Rat für Forschung und Technologieentwicklung für die Umsetzung, und zwar für die rasche und vollständige Umsetzung der Biopatentrichtlinie, ausgesprochen hat.
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Gestatten Sie mir zwei oder drei Sätze zur Bedeutung Österreichs als Wirtschaftsstandort im Zusammenhang mit der Umsetzung der Biopatentrichtlinie.
Österreich ist ein Standort, der zu Recht für sich in Anspruch nimmt, in Sachen Biotechnologie, in Sachen Life-Sciences in den letzten Jahren mehr als nur aufgeholt zu haben. Unternehmerische Erfolgsgeschichten wie jene der Biochemie Kundl, Sandoz, Novartis, Life-Science- und Biotech-Standort weltweit für den Novartis-Konzern, aber auch Immuno, später Baxter hier in Wien und in Niederösterreich sind ebenso beeindruckend wie Forschungsinstitutionen – einige Vertreter sind hier im Saal –, aber auch Start-ups mittelständischer Unternehmungen, die sich im Bereich Biotech etabliert haben und deren Standortbedeutung in Zukunft auch davon abhängen wird, ob und inwieweit Österreich diese Richtlinie umsetzen kann.
Es mag hier ein Allgemeinplatz sein, aber ich sage es trotzdem: Die Biotechnologie gilt zu Recht als eine der Schlüsseltechnologien, vielleicht sogar als die Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts: Tausende Arbeitsplätze, Milliarden Euro an Umsatz – aber das ist nur das eine. Letztlich hängt jedoch vieles, was den medizinischen und auch pharmazeutisch-pharmakologischen Fortschritt ausmachen wird, davon ab, wie es in diesem Bereich weitergeht. – Also vieles von dem, wovon kranke und auch behinderte Menschen hoffen, dass es für sie bald eine Therapie geben möge, hängt davon ab, inwieweit in diesem wichtigen Bereich geforscht werden kann, letztlich auch patentiert und dann produziert und angewandt werden kann.
Die Biopatentrichtlinie wird für den Standort Österreich Verbesserungen bringen, was die Patentsituation insgesamt anlangt, weil sie Klarheit schafft. Es werden im Gegensatz zu dem, was in den letzten Tagen da und dort auch zu lesen war, klare Grenzen zwischen patentierbaren Erfindungen und nicht patentierbaren Entdeckungen gezogen. Als nicht patentierbar werden dabei der menschliche Körper oder die bloße Entdeckung seiner Bestandteile einschließlich der Gensequenzen oder auch Teilen davon eingestuft. Der Erhalt der menschlichen Würde und die Unverfügbarkeit des menschlichen Körpers sind gewährleistet. Dies wurde auch vom Europäischen Gerichtshof eindeutig so festgestellt.
Zum Zweiten, meine sehr verehrten Damen und Herren, stellt die Umsetzung der Biopatentrichtlinie keinen Verstoß gegen das Übereinkommen zur biologischen Vielfalt dar. Auch das hat der Europäische Gerichtshof bereits klargestellt.
Zum Dritten werden erstmals – und das ist noch nicht Status quo, sondern das wird erst durch die Biopatentrichtlinie und deren Umsetzung gewährleistet – klare Verbote der Patentierbarkeit in mancherlei Beziehung festgelegt, die für uns ein Anliegen sein müssen: Das Klonen von Menschen wird nicht patentierbar sein. Die Veränderung der genetischen Identität des Menschen wird nicht patentierbar sein. Wie aktuelle Ereignisse deutlich machen, ist daher auch aus ethischen Gründen die Umsetzung der Biopatentrichtlinien in Österreich dringend geboten.
Ich komme zur Bioethik-Kommission, die ihre Entscheidung nicht lediglich darauf begründet hat, dass EU-Recht umzusetzen sei, dass das standortrelevant sei, sondern die Bioethik-Kommission sagt laut Protokoll in ihrer Sitzung vom 6. März 2002, dass die innerstaatliche Umsetzung der Biopatentrichtlinie auch aus ethischer Sicht notwendig ist – und das scheint mir von großer Bedeutung zu sein.
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Zum Vierten wird durch die Umsetzung der Biopatentrichtlinie auch eine Situation verhindert, die wir nicht wollen, nämlich dass geheim geforscht wird, dass geheim dokumentiert wird – und dass letztlich öffentlich über Entwicklungen und Forschungen nicht diskutiert wird.
Wir wissen, dass die Entwicklung und Forschung in diesem Bereich in hohem Maße von einer ethischen und auch moralischen Diskussion begleitet werden soll, und dass Ethiker, dass Vertreter der Kirchen, dass auch die Politik Antworten geben muss, die sie in vielfacher Weise noch nicht hat. Wenn das Erkenntnismaterial durch Patentierung öffentlich zugänglich gemacht wird, wenn also Forschungsergebnisse durch Patentierung offen gelegt werden müssen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann haben Sie, dann haben wir die Möglichkeit, darüber zu diskutieren. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird erstens sicherlich nur in einem Teilbereich geforscht werden, denn Forschung braucht Patente – dazu komme ich noch –, und zweitens werden viele Forschungsergebnisse in Wirklichkeit nicht öffentlich zugänglich sein, sondern sie werden geheim gehalten werden.
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Machen wir uns nichts vor: Biotechnologische Erfindungen sind nach geltendem Recht bereits heute patentierbar. Die Zahl der Patente steigt weltweit um etwa 14 Prozent. Das heißt, dass diese Branche etwa dreimal so innovativ ist wie alle übrigen patentierbaren Bereiche.
Glauben wir auch nicht, dass letztlich ein Patent mehr kann, als es tatsächlich kann! Was kann ein Patent? – Ein Patent sichert seinem Inhaber, dem Patentinhaber, lediglich das Recht zu, Dritte daran zu hindern, seine Erfindung ohne seine Zustimmung zu gewerblichen, also kommerziellen Zwecken zu nutzen. Ein Patent verhindert nicht die Forschung durch einen Dritten, keinesfalls! Ein Patent nimmt auch niemandem etwas weg, sondern ein Patent verhindert nur, dass ein Dritter diese Erfindung zu seinen eigenen kommerziellen Zwecken nutzt – und das auch nur innerhalb einer bestimmten Patentlaufzeit. Übersehen wir nicht, dass wir innerhalb der Europäischen Union eine Patentlaufzeit von etwa 20 Jahren haben! Es braucht zwischen fünf und zehn Jahren Vorlauf, bis entsprechende Erfindungen überhaupt zum Markt und damit zum Menschen und seinem Benefit kommen, und dann verbleibt eine Restnutzungsdauer von noch einmal 20 Jahren.
Ich lese in diesen Tagen ja auch von Entwicklungen im Bereich Penicillin oder bestimmter Hefen, deren Patente nicht vor Jahren, sondern schon vor Jahrzehnten abgelaufen sind und niemanden mehr an irgend etwas hindern.
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ein Patentanmelder hat auch klar zu deklarieren, welchen gewerblichen Zweck und welchen gewerblichen Nutzen er aus seiner Erfindung ziehen muss; allein die Erfindung ist’s ja nicht.
Etwas, was auch offen gesagt werden soll an dieser Stelle, ist, dass die Zulässigkeit der Forschung an und für sich, also: Was darf der Forscher, was darf die Forscherin, was darf er/sie nicht?, durch alles Mögliche zu regeln ist: durch unsere Diskussion, durch ein Gentechnikgesetz, durch ein Fortpflanzungsgesetz – aber nicht durch die Biopatentrichtlinie und deren Umsetzung. Diese regelt nur, was patentiert werden kann und was nicht.
Erwähnt werden soll auch, dass die entsprechende Richtlinie der Europäischen Union – Vizekanzler Haupt hat das bereits angesprochen – in mancher Hinsicht die Bedingungen für die Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen gegenüber geltendem Recht noch verschärft, es also zu einer Verschärfung kommt, die im Sinne mancher Kritiker sein sollte.
Ich habe etwas gesagt, worauf ich zuletzt noch Bezug nehmen möchte, nämlich: Forschung braucht Patent. Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ob eine Neuentwicklung im Bereich einer New Chemical Entity , einer Gensequenz oder Ähnlichem, die dann letztlich zu einem Diagnostikum, zu einem Therapeutikum an Menschen führt, also zu einem neuen Arzneimittel, das entweder diagnostiziert oder heilt, jetzt 500, 700 oder sogar 1 000 Millionen € an Entwicklungskosten braucht, das mag eine Bandbreite sein, die zu diskutieren ist, aber jedenfalls sind hiefür dreistellige Millionen-Euro- oder Millionen-Dollar-Beträge aufzuwenden.
Wenn man will, dass in diesem Bereich geforscht wird, dann wird man es den Forschern und den Firmen, die diese Forschung entweder direkt finanzieren oder indirekt, weil Patente, Lizenzen von Universitäten oder anderswo zugekauft werden, ermöglichen müssen, diese Forschung kommerziell zu verwerten. Andernfalls nimmt man in Kauf, dass diese Forschung nicht stattfindet und Fortschritte der Medizin und der Pharmakologie, der Pharmazie in vielfacher Weise für die Menschen nicht mehr stattfinden werden.
Forschung braucht also Patentierbarkeit. Wir sind aufgerufen, die Rahmenbedingungen festzulegen, und da hat Herr Vizekanzler Haupt natürlich einen wichtigen Aspekt mit eingebracht.
Forschung braucht Patentierbarkeit. Patentierbarkeit brauchen aber – gestatten Sie mir, diesen letzten Aspekt noch zu erwähnen – insbesondere Start-ups, brauchen insbesondere mittelständische Unternehmungen, die forschen können, die aber in einem sehr frühen Stadium ihrer Entwicklungen, ihrer Erfindungen angehalten sind, mit Größeren über Lizenzierungen zu verhandeln, um einen weltweiten Vertrieb und breite klinische Forschung und dergleichen mehr durchführen zu können. Das kann sich im Regelfall ein mittelständisches österreichisches Unternehmen, ein Start-up, das beispielsweise in Wien gegründet ist, nicht leisten. Es braucht also diese Patentierbarkeit, um – nicht gegenüber die Allgemeinheit, sondern gegenüber den großen internationalen, multinationalen Unternehmen – geschützt zu sein. Das ist also ein spezifischer Mittelstandsaspekt, den ich für den Biotech-Standort Österreich, für den Standort Wien nicht gering schätzen möchte.
Herr Vorsitzender! Damit komme ich zum Schluss. Ich verhehle nicht, dass ich es für den Standort Österreich auf der einen Seite, aber insgesamt auch zur Gewährleistung eines vernünftigen Fortschrittes im Bereich der Medizin und der Pharmakologie für dringend geboten erachte, diese Biopatentrichtlinie umzusetzen, und hoffe, dass die Meinungsbildung heute im Rahmen dieser wichtigen Parlamentarischen Enquete einen Schritt in die richtige Richtung bringt.
11.28
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Reinhold Mitterlehner: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Bundesminister Gorbach. – Bitte.
11.28
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie Hubert Gorbach: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Herr Vizekanzler! Geschätzte Regierungskollegen! Meine Damen und Herren Abgeordnete zum österreichischen Nationalrat! Delegierte! Abgeordnete des Europaparlaments! Meine Damen und Herren! Ich weiß, dass in den vergangenen Jahren zum Thema Biopatentrichtlinie die Debatte nicht nur sehr heftig, sondern auch sehr emotional geführt wurde. Daher möchte ich an den Beginn meiner Rede einen Aufruf stellen: Lassen Sie uns über dieses wichtige Thema sachlich diskutieren, denn wir haben, glaube ich, alle ein gemeinsames Ziel: einen verbesserten Umgang mit biotechnologischen Erfindungen – im Interesse des Wohlergehens der gesamten Natur und aller Menschen.
Meine Damen und Herren! Das Patentrecht ist ein wertneutrales Instrument der Innovationsförderung. Wie jedes Gesetz muss auch ein Patentgesetz im Laufe der Jahre an geänderte Umstände angepasst werden. Mir ist das sehr wichtig, denn unter diesem Aspekt sehe ich auch die nächste Zeit, wo wir dieses Patentrecht diskutieren, begutachten und hoffentlich auch beschließen werden. Es muss angepasst werden, um den aktuellen Bedürfnissen gerecht werden zu können, und vor allem auch deshalb, damit der Patentschutz für Industrie und Wirtschaft – der Herr Wirtschaftsminister ist darauf schon eingegangen – auch ein sinnvolles Werkzeug darstellt.
Die großen Fortschritte im Bereich der Biotechnologie sind unbestritten. Ebenso klar ist aber auch, dass ein Patentgesetz, das im Prinzip aus dem Maschinenpatent des 19. und 20. Jahrhunderts hervorgegangen ist, in unveränderter Form keine taugliche Grundlage für die technische Bewertung einer gänzlich neuen Technologie sein kann.
Der rechtliche Schutz biotechnologischer Erfindungen erfordert nicht die Einführung eines besonderen Rechts, das an die Stelle des nationalen Patentrechts tritt. Das nationale Patentrecht ist auch weiterhin die wesentliche Grundlage für den Rechtsschutz biotechnologischer Erfindungen. Es muss jedoch in bestimmten Punkten, wie schon gesagt, angepasst oder eben ergänzt werden, um der Entwicklung der Technologie, die biologisches Material benutzt, aber gleichwohl die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit erfüllt, auch angemessen Rechnung zu tragen.
Der Hauptzweck der Richtlinie besteht ja darin, harmonisierte, eindeutige und verbesserte Normen für den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen zu schaffen. Die Richtlinie soll eine systematische Anpassung der in den Mitgliedstaaten bestehenden Regelungen auf dem Gebiet des Patentrechtes für den Bereich der Biotechnologie erreichen und verfolgt den Zweck, in diesem Bereich die Anwendung des Patentrechts – so wie auch in allen anderen Gebieten der Technik – zu ermöglichen.
Die Richtlinie, meine Damen und Herren, bringt einerseits Klarstellungen – das wurde auch von meinen Vorrednern schon gesagt –, Klarstellungen der gegenwärtig gegebenen Möglichkeiten des Patentschutzes auf dem Gebiet der Biotechnologie, andererseits aber auch Einschränkungen der gegenwärtigen Gesetzeslage. Sie enthält darüber hinaus Antworten auf die zahlreichen ethischen Probleme, die im Zusammenhang mit der Patentierung biotechnologischer Erfindungen natürlich entstehen könnten.
Wesentlich ist es in diesem Zusammenhang, sich den Umstand bewusst zu machen, dass ein Patent seinen Inhaber nicht berechtigt, die Erfindung anzuwenden, sondern ihm lediglich das Recht verleiht, Dritten deren Verwertung zu kommerziellen Zwecken zu untersagen.
Die Biopatentrichtlinie ist das Ergebnis jahrelanger Diskussionen, aber sie stellt, wie ich meine, dennoch nur ein Zwischenergebnis dar, denn sie muss parallel zum technischen Fortschritt immer wieder weiterentwickelt werden. Erstmals – auch das wurde gesagt – in der Geschichte des Patentrechtes legt die Richtlinie auch fest, dass der menschliche Körper in allen Phasen seiner Entwicklung und Entstehung nicht patentierbar ist. Die bloße Entdeckung zur Unterscheidung von Erfindung eines seiner Bestandteile oder seiner Produkte, einschließlich der Sequenzen oder Teilsequenzen eines menschlichen Gens, ist ebenfalls nicht patentierbar. Die Richtlinie stellt damit unmissverständlich klar, dass bloße Entdeckungen eben nicht patentierbar sind, ebenso wie jede Form des Klonens menschlicher Wesen, egal zu welchem Zweck. – Eine Regelung, die derzeit in den nationalen Patentgesetzen der Mitgliedsstaaten fehlt. Dessen sollte man sich bewusst sein.
Neben diesen eindeutigen Patentierungsausschlüssen sind aus österreichischer Sicht vor allem folgende Regelungen der Richtlinie wesentlich: einmal der Ausschluss von Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn, weiters die begleitende Kontrolle aller ethischen Aspekte im Zusammenhang mit der Biotechnologie durch eine Sachverständigengruppe der Europäischen Kommission, weiters die ausgeweiteten Berichts- und damit Kontroll- und Korrekturmechanismen, die einen jährlichen Bericht über die Entwicklung des Patentrechts im Bereich der Bio- und Gentechnologie gewährleisten, einen Zweijahresbericht bezüglich der Auswirkungen auf die gentechnologische Grundlagenforschung und schließlich auch einen Fünfjahresbericht betreffend allfälliger Probleme im Hinblick auf internationale Abkommen zum Schutz der Menschenrechte vorsieht.
Meine Damen und Herren! Das letztgenannte umfassende Monitoring-System ermöglicht es, auf etwaige Fehlentwicklungen, wie ich meine, rechtzeitig, rasch zu reagieren. Nur durch die Umsetzung dieser Richtlinie in nationales Recht kann dieses System auch auf Österreich ausgedehnt werden.
Die Richtlinie schafft im Vergleich zum derzeitigen Stand der nationalen europäischen Patentrechte in wesentlichen Bereichen erstmals Rechtssicherheit – das ist mir ganz besonders wichtig – für in der Praxis längst existente Probleme. Gleichzeitig wird aber auch eine EU-weite Harmonisierung der Spruch- und Erteilungspraxis der Patentämter in diesen heiklen Bereichen der Biotechnologie angestrebt.
Geschätzte Damen und Herren! Es ist nicht Aufgabe des Patentrechts, die nationalen europäischen oder internationalen Rechtsvorschriften zur Festlegung von Beschränkungen und Verboten zur Kontrolle der Forschung und der Anwendung oder der Vermarktung ihrer Ergebnisse zu ersetzen oder überflüssig zu machen, insbesondere Regelungen, welche die Erfordernisse der Volksgesundheit, der Sicherheit, des Umweltschutzes, des Tierschutzes, der Erhaltung der genetischen Vielfalt und die Beachtung bestimmter ethischer Normen betreffen. Grundsätzlich können diese Dinge nicht Kern des Patentwesens sein. Das ist Aufgabe spezifischer Materiengesetze, wie etwa des Fortpflanzungsmedizingesetzes oder das Gentechnikgesetzes.
Es besteht aber auch kein Zweifel darüber, dass das Patentrecht unter Wahrung jener Grundprinzipien ausgeübt werden muss, welche die Würde und die Unversehrtheit des Menschen gewährleisten. Deshalb ist es besonders wichtig, den Grundsatz zu bekräftigen, wonach – ich habe es schon gesagt – der menschliche Körper in allen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung, einschließlich der Keimzellen, sowie die bloße Entdeckung eines seiner Bestandteile oder seiner Produkte, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines menschlichen Gens, nicht patentierbar sind. Diese Prinzipien stehen im Einklang mit den im Patentrecht vorgesehenen Patentierbarkeitskriterien, wonach eine bloße Entdeckung, wie schon gehört, nicht Gegenstand eines Patents sein kann.
Daher schafft die vorliegende Richtlinie weder neue Möglichkeiten einer Patentierung, noch steht sie im Widerspruch zu längst anerkannten Grundsätzen des Patentrechts. Tatsächlich wird durch eine Vielfalt von Regelungen und durch klare Normierung von Ausschlusstatbeständen Rechtssicherheit geschaffen.
Eine kritische Beschäftigung mit den Entwicklungen der modernen Technologie bringt vor allem auch die Verpflichtung mit sich, den rechtlichen Rahmen so rasch und so umfassend wie möglich an neue Herausforderungen anzupassen, wie das ja übrigens in anderen Bereichen gang und gäbe ist. Nur wer gestaltet, kann auf diese Weise den in Österreich auf dem Gebiet der Biotechnologie tätigen Unternehmen optimale Rahmenbedingungen gewährleisten. Wer jetzt diesbezüglich eine Blockadepolitik betreibt, verhindert meines Erachtens eine Verbesserung der derzeitigen Rechtsunsicherheit.
Meine Damen und Herren! Der Wunsch, dass auf europäischer Ebene rasch eine vielleicht noch restriktivere Regelung gefunden wird, ist zwar ein guter und frommer, aber kein realistischer.
Abschließend: Ich glaube, dass wir Sicherheit schaffen, ich glaube, dass es nach all den Diskussionen Zeit ist, diese Richtlinie zu verabschieden, und bitte Sie um Unterstützung bei der gemeinsamen Umsetzung der Patentrichtlinie, wie sie vorliegt.
11.39
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Reinhold Mitterlehner: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Bundesminister Pröll. – Bitte.
11.39
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Dipl.-Ing. Josef Pröll: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Herr Vizekanzler! Kollegen aus der Regierung! Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete! Experten, die Sie heute hier hergekommen sind, um ein sehr wichtiges Thema gemeinsam zu besprechen und zu erörtern!
Ich möchte, bevor ich auf die landwirtschafts- und umweltspezifischen Themen in diesem Bereich eingehe, doch auch anmerken, dass uns klar sein muss, dass wir vor der Entscheidung stehen, die Biopatentrichtlinie umzusetzen oder nicht, und ich schließe mich da natürlich den Ausführungen meiner Vorredner an: Es ist wichtig, diesen Schritt jetzt gemeinsam anzugehen und umzusetzen, denn wir müssen auch sehen, dass wir europaweit – wie auch immer unsere Entscheidung aussehen würde – mit neuen Bedingungen konfrontiert sind, weil in anderen Staaten auch die entsprechende Umsetzung erfolgt und uns auch diese Entwicklung, – egal, ob wir wollen oder nicht – vor gewisse Tatsachen stellt.
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir müssen uns auch im Klaren darüber sein – der Herr Wirtschaftsminister hat das auch angeführt –, dass natürlich auch die Umsetzung der Biopatentrichtlinie hinsichtlich des Wirtschaftsstandortes Österreich von großer Bedeutung ist und wir auch dieses zentrale Ziel nicht aus den Augen verlieren dürfen.
Aus Sicht der Landwirtschaft spielt der Schutz des geistigen Eigentums in der Züchtung von Pflanzensorten in Form der Sortenschutzrechte schon jetzt eine sehr zentrale und große Bedeutung. Die Rechte der heimischen Züchter werden derzeit gemäß dem österreichischen Sortenschutzgesetz geschützt. Die EU-Biopatentrichtlinie soll jetzt in das Patentgesetz eingearbeitet werden, womit unter bestimmten Umständen auch Gene in Pflanzen und Tieren geschützt werden könnten. Das ist aus meiner Sicht auch ein Punkt, den wir uns dann bei der Umsetzung auf Grund der Problematik noch genau anzusehen haben. Es ist sicherzustellen, dass wir ein Zusammenwirken mit dem bestehenden Sortenschutzgesetz jedenfalls so gestalten, dass es für das bestehende System zu keinen Nachteilen kommt.
Im Prinzip sichern Sortenschutzrechte dem Sortenschutzinhaber, also dem Züchter, sein Einkommen aus den Lizenzen, die er für den Verkauf seiner gezüchteten und angebotenen Sorten erhält.
Die Entwicklung neuer Pflanzensorten hat dem Landwirt aber auch durchaus Vorteile gebracht. Oftmals wird heute der technische Fortschritt in der Züchtung sehr kritisch beleuchtet. Er hat Vorteile auch für den heimischen Landwirt gebracht, durch ertragreichere, resistente Sortenzüchtungen – und ist damit auch direkt einkommenswirksam; das darf man nicht vergessen. So gesehen haben wir diese Aufgabe auch bei der Umsetzung der Biopatentrichtlinie entsprechend zu berücksichtigen.
Nach der Biopatentrichtlinie sind Pflanzensorten und Tierrassen ja nicht patentierbar, und das ist auch richtig so. Das wurde in Vorreden bereits mehrmals ausgeführt. Pflanzensorten können nach dem Sortenschutzgesetz geschützt werden, und Tierrassen stellen an sich, so wie sie sind, keine Erfindung dar. Das gilt natürlich auch für Pflanzenarten, welche ebenso nach der Biopatentrichtlinie nicht geschützt werden können.
Problematisch ist meiner Auffassung nach, dass Pflanzen und Tiere als solche nicht dezidiert in der Biopatentrichtlinie vom Patentschutz ausgenommen werden. Wenn eine bestimmte Pflanze oder ein bestimmtes Tier mit einem bestimmten Gen patentiert werden würde, könnte dies – und das unterstreichen auch durchaus die Aussagen mehrerer Experten – nur mehr mit der Zustimmung des Patentinhabers zur Züchtung in der Pflanzen- und Tierproduktion geschehen. Diesen Punkt sehe ich durchaus als kritisch und hinterfragenswürdig.
Im internationalen Sortenschutzrecht ist das so genannte Züchterprivileg verankert, welches die Verwendung einer geschützten Sorte als Ausgangsprodukt für die Züchtung einer neuen Sorte vom Sortenschutz explizit ausnimmt. Das heißt, dass für die Züchtung einer neuen Sorte als Ausgangsmaterial jede geschützte Sorte ohne Zustimmung des Sortenschutzinhabers verwendet werden kann. Damit wurde und wird ohne Zweifel die Grundlage gelegt für den züchterischen Fortschritt und für die Tatsache, wie ich bereits angeführt habe, dass das durchaus einen Gewinn für die europäische und die heimische Landwirtschaft darstellt.
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Eine Sorge begleitet mich in dieser Debatte nach wie vor, nämlich inwieweit die Frage der gentechnischen Anwendung in der Landwirtschaft und die Frage Biopatentrichtlinie in der Diskussion vermischt werden. Wir müssen dieses Thema klar und deutlich auch für die Zukunft trennen. Es gibt Kontakt- und Anknüpfungspunkte, aber im Prinzip sind es zwei voneinander abgegrenzte Themen, die auch so zu behandeln sind.
Meine sehr geehrten Damen und Herren! In die Gentechnik-Debatte möchte ich einen Punkt doch noch einbringen, auch an diesem Ort: Sie wissen, dass wir die Frage der Koexistenz, des Nebeneinanders von diversen Kulturen, biologischer Produktion, konventioneller und zukünftig gentechnischer Produktion, gemeinsam zu klären haben.
Es kommt dann ein Punkt auf uns zu, nämlich jener der Haftungsregelung: Wer haftet bei Verunreinigung für die entstandenen Schäden? In diesem Zusammenhang muss mit der Biopatentrichtlinie aus meiner Sicht unbedingt Vorsorge dafür getroffen werden, dass Patentinhaber im Falle von Kontaminationen durch GVOs keine auf diesen Patenten basierenden Ansprüche gegen betroffene Landwirte erheben können. Ich halte das für einen wichtigen Punkt, weil das Ausmaß dieses Themas – Kontamination, Koexistenz und daraus abgeleitet natürlich die Frage der Haftung – doch ein sehr großes ist.
Ein weiterer Punkt ist, dass gemäß der EU-Verordnung über den gemeinschaftlichen Sortenschutz für den Züchter die Möglichkeit besteht, vom Landwirt für den Nachbau seiner Sorte eine angemessene Entschädigung zu verlangen, aber damit auch der Landwirt natürlich ermächtigt wird, Saatgut von geschützten Sorten selbst nachbauen zu können. Man nennt das jetzt das „Landwirteprivileg“. Auch die Biopatentrichtlinie greift diese Bestimmung explizit auf und bezieht sich auf Sorten mit geschützten Transgenen. Da ist aus meiner Sicht sicherzustellen, dass Nachbaugebühren und ähnliche Zahlungen nur an den Sortenschutzinhaber, aber – zukünftig – nicht an den Patentinhaber zu leisten sind.
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Sie sehen, es gibt viele wichtige Anknüpfungspunkte in der Umsetzung der Biopatentrichtlinie, das ist keine Frage. Klar ist aber auch, dass wir uns grundsätzlich der Forschung und neuen Entwicklungen aus umwelt- und landwirtschaftspolitischer Sicht nicht entgegenstellen wollen. Im Gegenteil: Die Umsetzung der Biopatentrichtlinie ist aus meiner Sicht ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Sie hilft und leistet einen wesentlichen Beitrag dazu, dass wir auch den Wirtschaftsstandort Österreich entsprechend absichern. Ein paar Fragen, die noch offen sind, sind sicher konsensual und erfolgreich zu klären. Unter diesem Gesichtspunkt danke ich auch, dass sich sehr viele heute hier eingefunden haben, die gemeinsam diesen Weg diskutieren wollen.
11.46
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Reinhold Mitterlehner: Wir kommen nun zu den fraktionellen Stellungnahmen, die jeweils mit 5 Minuten angesetzt sind, und ich darf jetzt meinen Platz und meine Rolle kurzfristig verlassen und für die Österreichische Volkspartei eine kurze Stellungnahme abgeben.
Einleitende Statements der Parlamentsfraktionen
11.47
Abgeordneter Dr. Reinhold Mitterlehner| (ÖVP): Sehr geehrte Herren Minister! Sehr geehrte Experten! Liebe Abgeordnetenkolleginnen und -kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben hier ein Thema, das uns schon mehrere Jahre begleitet, und ich glaube, wir sollten auch die formale Seite der Angelegenheit neben der materiellen Seite sehen.
Seit dem Jahre 1998 haben wir diese Richtlinie und wären verpflichtet gewesen, diese bis zum Juli 2000 umzusetzen. Wir haben das trotz einiger Versuche bis jetzt nicht geschafft und haben dadurch auch ein Vertragsverletzungsverfahren durch die Europäische Union jetzt am Laufen. Das wirft die Frage auf – der Herr Vizekanzler hat es angesprochen –: Warum haben sieben Länder die Richtlinie umgesetzt, und warum haben sie acht Länder noch nicht umgesetzt? Damit sind wir sozusagen beim inhaltlichen Teil. Die Antwort darauf war: Es gibt gute Gründe. Meines Erachtens gibt es Gründe, aber ob es gute Gründe waren, ist aus meiner Sicht schon die Frage, denn ich sehe das Problem darin, dass hier eine Diskussion mit vielen anderen Diskussionen vermischt wird.
Was wir hier zu machen haben oder zu machen hätten, ist die Umsetzung einer Richtlinie, die sich auf das Patentrecht bezieht. Sie bezieht sich nicht auf den Forschungsbereich, auf den medizinischen Bereich, auf den gentechnischen Bereich und alle Anwendungsgebiete, sondern es geht hiebei schlicht und einfach um die Umsetzung einer Richtlinie in nationales Recht, was den Patentbereich anlangt. Das heißt, wir haben hier die Definitionen sachgerecht zu treffen – und nicht andere Themenbereiche, die möglicherweise innerstaatlich geregelt werden können und vielleicht in diese Diskussion jetzt eingebracht werden, diesem Thema aufzupropfen.
Was ist das Problem, was ist zu berücksichtigen? Meiner Meinung nach ist bei einem Patent die Erfindung entscheidend. Man sollte davon die Entdeckung unterscheiden. Es würde vieles in der Diskussion versachlichen, wenn diese Unterscheidung gemacht würde.
Zweiter Punkt: Es muss sich um etwas Neues handeln, und es muss gewerblich verwertbar sein. Wenn es um gewerbliche Verwertbarkeit geht, dann ist damit auch klar definiert, dass man lediglich eine zeitlich befristete Exklusivität hat – mehr aber nicht. Damit verbunden ist aber die Klarheit, die Nachprüfbarkeit – und auch eine bestimmte Offenheit. Da in der Richtlinie ganz klar und definitiv die Verwertung, was den menschlichen Körper anlangt, auch was die Entstehung, die Entwicklung anlangt, was das Verfahren zum Klonen anlangt, aber auch was die kommerzielle Verwertung von Embryonen anlangt, ausgeschlossen ist, würde sich die Umsetzung auf den bisherigen Status auch im Forschungsbereich sogar als Verbesserung darstellen.
Daher, Herr Vizekanzler, kann ich nicht verstehen, dass man die eine Problematik mit der anderen Problematik vermengt. Im Klartext: Aus meiner Sicht wäre notwendig, dass man, gerade um die Rechtsqualität zu heben, die Biopatentrichtlinie in nationales Recht umsetzt und auf der anderen Seite die Qualität der Regelungen verbessert. Nicht die Blockade bringt uns weiter, sondern die qualitative Fortsetzung.
Daher ist aus meiner Sicht der entscheidende Punkt, dass die ethischen Gesichtspunkte, was Österreich anlangt, in einer eigenen Kommission geprüft worden sind. Ich bin da nicht der Fachmann; darüber werden dann Experten reden. Eigentlich ist das genau der Ansatzpunkt, nachdem auch diese Punkte geprüft worden sind, dass man dazu übergehen müsste, zu sagen: Welchen Hinderungsgrund gibt es, diese Richtlinie in nationales Recht umzusetzen?
Manches Mal wird gesagt, durch die Patentierbarkeit würden die Kleinbetriebe ausgeschlossen, das wäre nur eine Sache für die Großbetriebe. – Genau das Gegenteil ist der Fall: Sie schaffen einen transparenten Markt, machen die Klein- und Mittelbetriebe dann so stark, dass sie mit diesen Patenten in Lizenzverfahren, in Kooperationen eintreten können, dass Investitionen getätigt werden können.
Wenn die eine Seite, die ethische Seite, abgeklärt ist und die andere Seite für den Standort Österreich ein entscheidender wirtschaftlicher Vorteil wäre – wir würden eine große Marktchance in einem großen Sektor vertun und vergeben –, sehe ich aus unserer Sicht in der Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht – nicht bedingungslos, es gibt durchaus Einschränkungen, nicht ohne Wenn und Aber, unter Berücksichtigung der schon teilweise angesprochenen Punkte – eine Chance für den Standort Österreich und für alle Betroffenen.
11.52
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Reinhold Mitterlehner: Ich darf ich nun Frau Abgeordnete Sima um ihr Statement bitten.
11.53
Abgeordnete Mag. Ulrike Sima (SPÖ): Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Biopatentrichtlinie ist 1998 nach einem sehr langen Streit beschlossen worden, und das Bemerkenswerte daran war, dass das 1995 eine der wenigen Richtlinien auf EU-Ebene war, die in dritter Lesung vom Europäischen Parlament abgelehnt worden ist – und das, wie ich glaube, aus gutem Grund, weil es sehr massive Streitpunkte in dieser Richtlinie gibt.
Die Richtlinie ermöglicht – im Gegensatz zu dem, was viele Vorredner behauptet haben; leider, muss ich sagen – Patente auf Gene, Patente auf menschliche Organe, auf Zellen, auf Pflanzen und auf Tiere, kurz gesagt: auf unsere Lebensgrundlagen. Deswegen ist es auch so ein sensibler Bereich, über den so lange gestritten worden ist.
Im Gegensatz zu dem, was Minister Bartenstein oder Kollege Mitterlehner gesagt hat, steht auch: Die Grenze zwischen Erfindungen und Entdeckungen wird mit dieser Richtlinie massiv verwischt, denn es ist möglich, Gene, Pflanzen, Tiere zu patentieren, die in keiner Form, nicht einmal gentechnisch, verändert worden sind. Es gibt ein aktuelles Beispiel des Europäischen Patentamtes: ein Patent, das im Mai 2003 erteilt wurde. Da wurde ein Weizen von der Firma Monsanto patentiert, ein Weizen der nicht gentechnisch verändert worden ist, sondern eine jahrhundertealte Züchtung von indischen Bauern ist. Monsanto hat jetzt das Recht auf das Saatgut, auf die Weizenpflanze selbst, auf die nachfolgenden Generationen, auf das Mehl, auf die Produkte und so weiter. Das ist ein aktuelles Beispiel aus der Rechtsprechung des Europäischen Patentamtes und zeigt sehr deutlich, wie die Grenzen zwischen einer Erfindung wie etwa einem Zweitaktmotor und einer Entdeckung, wie es ein Weizensaatgut eigentlich nur sein kann, verwischt werden.
Das ist auch genau das, was uns an dieser Richtlinie stört, dass es eben keine klare Trennung zwischen diesen beiden Bereichen gibt.
Es geht also nicht nur um Biotechnologie oder um Gentechnik, sondern um viel mehr. Und ich bin ganz bei Minister Pröll, wenn er sagt, dass man die Debatte über Gentechnik und die Debatte über diese Richtlinie wirklich unterscheiden muss. Es geht nicht um pro oder kontra Gentechnologie, sondern es geht um unsere Lebensgrundlagen und darum, wer die Verfügbarkeit darüber hat: ob das einzelne Konzerne sein sollen, die ein exklusives Nutzungsrecht für meistens 20 Jahre bekommen – oder ob unsere Lebensgrundlagen wirklich allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollen. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige und grundsätzliche Entscheidung und eine Verantwortung, die wir als Parlamentarier haben und vor der wir uns nicht drücken können.
Um konkret zur Richtlinie zu kommen, möchte ich jetzt das, was ich vorher gesagt habe, mit ein paar Zitaten belegen, weil die Richtlinie voller Widersprüche und Schlupflöcher ist. Das ist auch durch die Entstehungsgeschichte leicht erklärbar, weil es sehr viele Änderungsanträge gegeben hat, mindestens 20 verschiedene Versionen – und das, was herausgekommen ist, ist alles andere als einheitlich, sondern leider voller Widersprüche.
Ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, ist der menschliche Körper. Minister Gorbach hat gesagt, der menschliche Körper wäre nicht patentierbar. – Ich lese Ihnen jetzt ein Zitat aus der Richtlinie vor, das Sie sicher kennen, es ist der Artikel 5 (2), in dem heißt es:
„Ein isolierter Bestandteil des menschlichen Körpers (...), einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, kann eine patentierbare Erfindung sein, selbst wenn der Aufbau dieses Bestandteils mit dem Aufbau eines natürlichen Bestandteils identisch ist.“ – Das heißt, es wird explizit erlaubt.
Im Absatz darunter heißt es, der menschliche Körper könne keine patentierbare Erfindung darstellen.
Also wenn das kein Widerspruch ist, dann weiß ich nicht! Und deswegen halte ich es für sehr problematisch, die Richtlinie 1 : 1 zu übernehmen, weil sehr viele widersprüchliche Bestimmungen enthalten sind.
Punkt zwei, der mir immer besonders aufgefallen ist, ist der ganze Themenbereich „biologisches Material“. Die Richtlinie definiert eigentlich alles als biologisches Material und zwar heißt es da:
„Biologisches Material, das mit Hilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung isoliert (...) wird, kann auch dann Gegenstand einer Erfindung sein, wenn es in der Natur schon vorhanden war.“
Allein mit diesem Passus wäre es möglich, von Embryonen abwärts Organe, Blutzellen, Gene, alles zu patentieren. Diese Definition ist so breit und so umfassend gefasst, dass man darunter alles verstehen kann. Das ist ein nächstes Problem, das wir mit dieser Richtlinie haben: Schlupflöcher, Widersprüche, sehr weit gefasste Definitionen. Von der Rechtssicherheit oder von der Ausschließbarkeit von ethisch problematischen Patenten, die Sie erwähnt haben, kann ich im Richtlinientext nichts finden, und ich möchte Sie wirklich auffordern, mir die entsprechenden einschränkenden Passagen zu zeigen. Ich kenne die Richtlinie, glaube ich, mittlerweile recht gut, sie ist ja nicht besonders lang und relativ einfach zu lesen. Auf Widersprüche trifft man immer wieder.
Noch ein Punkt, auf den ich eingehen möchte – es gäbe natürlich noch viele andere, aber dieser ist mir ein besonderes Anliegen –: der Bereich Pflanzen und Tiere. Minister Pröll hat es vorher angesprochen: Es ist zwar nicht möglich, einzelne Sorten oder Tierrassen zu patentieren, aber es ist sehr wohl möglich, darüber hinaus gehende, breiter gefasste Patente zu haben. Das heißt, zum Beispiel die Maissorte Campa könnten Sie nicht patentieren, Sie könnten aber sehr wohl ein Patent bekommen auf alle zweikeimblättrigen Pflanzen, die ein bestimmtes Gen enthalten, oder vielleicht überhaupt auf Pflanzen. Dieses vorher zitierte Patent von Monsanto auf Weizen läuft unter dem Titel Pflanzen. Also ein sehr, sehr weit gefasstes Patent. Und das alles ist mit dieser Richtlinie möglich.
Auch wenn hier behauptet wird, dass das nicht die Intention des Gesetzgebers ist, kann ich nur noch einmal darauf verweisen, dass das mit der Richtlinie, wenn wir sie 1 : 1 umsetzen, sehr wohl möglich ist.
Meine Damen und Herren! Aus unserer Sicht geht diese Richtlinie in die falsche Richtung, und wir möchten, dass sich die österreichische Bundesregierung dafür einsetzt, auf EU-Ebene neue Verhandlungen zu erreichen, weil das wirklich ein sehr umstrittener Text ist: mit massiven Auswirkungen auf die Forschung, auf die Medizin und auf die Landwirtschaft.
11.58
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Reinhold Mitterlehner: Als Nächster zu Wort gelangt Kollege Hofmann für die Freiheitliche Partei.
11.58
Abgeordneter Dipl.-Ing. Maximilian Hofmann (Freiheitliche): Herr Vorsitzender! Geschätzte Herren Minister! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich teile die Meinung meiner Vorrednerin nicht und stelle gleich zu Beginn meiner Ausführungen fest, dass ich positiv zu einer Umsetzung der EU-Richtlinie stehe.
Diese EU-Richtlinie gibt es seit dem Jahre 1998, seitdem ist sie in dieser Form vorliegend und bekannt. Im Juli 2000 hätte die Ratifizierung erfolgen sollen. Nur sieben Länder haben bislang ratifiziert, wobei dem Vernehmen nach die beiden großen Länder Deutschland und Frankreich dabei sind, zu ratifizieren.
Ich halte die angedachte Vorgangsweise, gleichsam eine Zurückverweisung vorzunehmen, neu zu verhandeln, eine EU-Richtlinie auf europäischer Ebene neu zu gestalten, für keinen zielführenden Weg, auch in Anbetracht der Tatsache, dass Deutschland und Frankreich nun doch diese Ratifizierung vornehmen.
Bei der heutigen Enquete sollen nicht unbedingt die Statements, die Positionen von uns Parlamentariern die wesentlichen Inhalte sein. Es sollen vielmehr die Stellungnahmen der geladenen Experten und, wie ich meine, auch die Beiträge der sicherlich stattfindenden Diskussion im Mittelpunkt stehen.
Den Experten darf ich von dieser Stelle aus für ihre Bereitschaft, an dieser Veranstaltung teilzunehmen, ihren Beitrag dazu zu leisten, namens meiner Fraktion sehr herzlich danken. Ich darf auch einen Wunsch anschließen, und zwar dass diese Enquete einen Beitrag dazu leisten möge, dass eine Versachlichung, eine Entmystifizierung der Biotechnologie stattfindet. Aus patentrechtlicher Sicht wird sich, wie ich meine, auch durch diese EU-Richtlinie und deren mögliche oder, aus meiner Sicht, gewünschte Umsetzung nichts ändern. Es wird nichts dazukommen. Wesentlich erscheint mir aber, darauf hinzuweisen, dass entgegen den Ausführungen meiner Vorrednerin Einschränkungen, Ausschlussfeststellungen sehr wohl legistisch gefasst werden können.
In der Praxis erfolgt gleichsam in patentrechtlicher Hinsicht eine Umsetzung der auf nationalstaatlicher Ebene noch nicht umgesetzten EU-Richtlinie. Der wesentliche Unterschied ist allerdings, dass es hiebei keine Rechtssicherheit gibt. Wie ich meine, sind speziell kleine Unternehmen, die im Bereich der Pharmakologie und der Medizin forschen, auf dem Gebiet der Biotechnologie forschen, in besonderem Maße betroffen, denn diese Forschung ist kostenintensiv, und sie ist, wie ich meine, risikoreich. Da sollte man Rechtssicherheit schaffen.
Eine innerstaatliche Umsetzung, eine nationalstaatliche Umsetzung ist sicherlich eine legistische Herausforderung: Es geht darum, Rahmenbedingungen festzulegen, festzuschreiben, es geht darum, ethischen Ansprüchen gerecht zu werden, es geht, wie ich meine, auch darum, Wildwuchs zu vermeiden – Dinge, die jetzt, bei einer Nichtumsetzung, stattfinden. Es geht auch um eine klare Abgrenzung zwischen Erfindung und Entdeckung, die schwierig ist, sprich eine Abgrenzung zwischen Patentierbarem und nicht Patentierbarem, es geht um eine Verhinderung des Blockierens der Weiterentwicklung, es geht um eine Verhinderung von so genannten strategischen Patenten, es geht um eine Verhinderung der Errichtung von Monopolen durch gewerbliche Scheinnutzung, wie ich meine. All diese Dinge sind vom Gesetzgeber bei der Umsetzung zu beachten.
Der Ruf nach einer Ratifizierung, nach einer neuerlichen Behandlung auf europäischer Ebene scheint mir nicht zielführend zu sein. Alle ernsthaft geäußerten Bedenken, alle Sorgen – auch jene, die heute möglicherweise noch zusätzlich in den Raum gestellt werden – sollen und müssen ernst genommen werden.
Wir haben die Möglichkeit, durch eine entsprechende Gesetzgebung diesen formalen Rahmen zu schaffen. Ich denke, dass es im medizinischen Bereich und im pharmakologischen Bereich im Sinne einer zukunftsorientierten Forschung und auch einer kommerziellen Nutzung durchaus angebracht erscheint, hier Rechtssicherheit zu schaffen.
12.04
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Reinhold Mitterlehner: Nun darf ich Frau Dr. Glawischnig für die Fraktion der Grünen zum Rednerpult bitten.
12.04
Abgeordnete Dr. Eva Glawischnig (Grüne): Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte diese Enquete gerne auch zum Anlass nehmen, um auf die Hintergründe für die Abhaltung dieser Enquete hinzuweisen. Das ist schon ein Beleg dafür, welch großes Unbehagen hinter dieser ganzen Diskussion der Frage Nichtumsetzung/Umsetzung steckt.
Das ist nicht nur eine rein juristische Frage von compliance/non-compliance, sondern dahinter steckt eine gesellschaftspolitische Diskussion. Nicht von ungefähr hat das Europäische Parlament zehn Jahre gebraucht, um eine Richtlinie zu verabschieden, und auch die Widersprüchlichkeiten dieser ganzen gesellschaftlichen Diskussion sind eben in diese Richtlinie hineinverpackt. Das kann man nicht so einfach vom Tisch wischen, indem man sagt, es geht hier nur um eine Novelle des Patentrechtes. Selbstverständlich hat diese Novelle massive Auswirkungen nicht nur auf das Patentrecht, sondern auch auf die Wissenschaft, auf die Forschung, auf das Gesundheitssystem, auf die Kosten des Gesundheitssystems, selbst auf die ökologische Vielfalt und natürlich auch auf die gesamtgesellschaftliche Fragestellung: Was und in welchem Umfang wollen wir Patente zulassen?
Wenn man den Kern dieser Auseinandersetzung beziffern möchte, dann muss ich sagen, es ist nicht die Klarheit, sondern es ist tatsächlich die Unklarheit und die Unsicherheit. Den Punkt, den eine Vorrednerin schon angesprochen hat, muss man einfach diskutieren, nämlich die Frage der Grenze. Diese Grenze ist absurd und legal auf, sagen wir, willkürliche Weise gezogen.
Ich möchte, damit wir zum Kern der Diskussion vorstoßen, noch einmal betonen, was diese Grenze genau ist: Die Trennung, die im Moment zwischen patentierbaren und nicht patentierbaren Genen gezogen wird, beruht ausschließlich auf der Frage, ob sie durch ein technisches Verfahren isoliert worden sind. Ich möchte das noch einmal vorlesen, es heißt in Artikel 5, Abs. 2:
„Ein isolierter Bestandteil des menschlichen Körpers oder ein auf andere Weise durch ein technisches Verfahren gewonnener Bestandteil, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, kann eine patentierbare Erfindung sein, ...“
Also die Grenze, die hier gezogen wird – und das hat die Schweizer Bioethik-Kommission auch sehr gut bezeichnet –, die Trennung zwischen Genen als nicht patentierbaren Größen und isolierten Genen als patentierbaren Größen, ist ausschließlich legale oder legalistische – wie immer man das auch nennen möchte –Willkür. Es geht rein um dieses Verfahren.
Das ist die große Zukunftsfrage: Sollen wir uns darauf beschränken, diese Grenze ausschließlich dort zu ziehen, wo eben isoliert wird – und ob das jetzt mit der Natur noch im Einklang ist oder nicht, ist völlig egal? – Die Frage der Grenze, die wir im Patentrecht jetzt über Jahrzehnte gezogen haben, nämlich zwischen Erfindung und Entdeckung, wird hier nicht gelöst. Es erfolgt nur eine legale Definition, die der ganzen Frage, die dahinter steckt, in keiner Weise gerecht wird. Das ist die spannende Frage, der wir uns heute widmen sollten.
Der zweite Punkt, der mir sehr wichtig ist, ist nicht die Frage: Patente – ja oder nein?, sondern: Patente – in welchem Umfang und auf was? Wir müssen uns vor Augen führen, dass die Richtlinie 1998 verabschiedet wurde und dass in der Zwischenzeit sehr viel an Erkenntnissen dazugewonnen wurde, dass sich der Erkenntnisstand wesentlich weiterentwickelt hat. Heute stehen wir nicht mehr bei dem Punkt, dass man sagt, es gibt 100 000 Gene, sondern nach heutiger Ansicht gibt es 30 000, die multifunktional und nicht monofunktional sind. Was bedeutet es dann, wenn man so etwas wie strategische Patentierung zulässt, wenn man eine einzige Funktion als Dominator zulässt und ein ganzes weißes Feld, eine Landkarte absteckt mit einem Fähnchen, die dann patentiert wird? Was bedeuten diese strategischen Patente auch für die Freiheit der Forschung und Wissenschaft?
Wenn man die Diskussion der letzten fünf Jahre betrachtet, dann meine ich, dass es jetzt nicht weniger Gründe gibt, die Richtlinie zu überarbeiten und auf einen neuen Stand zu bringen, sondern noch sehr viel mehr Gründe, eben wegen dieses neuen Erkenntnisstandes. Also in der präzisen Diskussion heißt das der absolute Stoffschutz, den ich aus meiner Sicht für absolut überholt halte. Ich halte es auch für die europäische Wissenschaft und Forschung für unerträglich, wenn in dieser Breite strategische Patentierung zugelassen wird.
Wir kennen das berühmte Beispiel Myriad: Das Brustkrebsgen kann durchaus auch andere Anwendungsfunktionen haben! – Diese singuläre Betrachtung ist einfach überholt. Diesem Aspekt müssen wir uns heute auch widmen.
Ich würde daher bitten, dass man sich nicht nur ausschließlich auf die Frage konzentriert: umsetzen oder nicht umsetzen?, sondern schauen wir uns wirklich an, was sich da noch maßgeblich verändert hat und welche Anforderungen es gibt, um das tatsächlich auch in einer für die Freiheit der Wissenschaft und Forschung erträglichen Form umzusetzen.
Parallel zur Entwicklung der Forschung – das war heute schon das Schlagwort, und ich denke, das soll einer der Kernpunkte auch der Diskussion mit den Experten und Expertinnen sein.
Ein dritter Punkt, der mir noch sehr wichtig ist, ist Persönlichkeitsschutz. Herr Minister Haupt, Sie haben das auf Personen beschränkt, die nicht einwilligungsfähig sind, aber der Persönlichkeitsschutz, wie er hier in der Richtlinie formuliert ist, ist ausschließlich ein Erwägungsgrund. Ich kenne die Debatte, man sagt, man kann dies auch in anderen Gesetzen regeln, aber Persönlichkeitsschutz ist etwas, was auch in dieser Gesetzesmaterie explizit festgeschrieben werden muss. Diese Formulierung geht hier viel zu weit, und wir kennen alle die Konsequenzen von solchen vagen Formulierungen, die ausschließlich als Erwägungsgrund in einer Richtlinie enthalten sind.
Die Frage biologische Vielfalt kann ich jetzt nicht mehr ansprechen, aber ich möchte noch einen abschließenden Appell aussprechen: Es geht tatsächlich um diese Grenze! Stellen wir uns daher die Frage: Ist es wirklich noch zeitgemäß, was in dieser Richtlinie jetzt formuliert ist, und ist es auch wirklich zeitgemäß vor allem für die Forschung und die Freiheit der Wissenschaft?
12.10
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Reinhold Mitterlehner: Meine Damen und Herren, wir kommen damit zu den vier Impulsreferaten der Experten. Es sind dafür je 15 Minuten vorgesehen.
Ich darf Herrn Professor Huber um seine Ausführungen bitten.
Impulsreferate
12.10
Referent Univ.-Prof. DDr. Johannes Huber| (Leiter der Abteilung für Endokrinologie und Sterilitätsbehandlung der Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Universität Wien): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Frau Abgeordnete Glawischnig hat zu Recht gesagt, dass die Situation extrem komplex und facettenreich ist und noch facettenreicher wird. Ich wage allerdings zu bezweifeln, ob man die Probleme, die in zunehmendem Maße auf uns zukommen, umgehen kann, wenn man die Biopatentrichtlinie nicht unterschreibt und nicht übernimmt.
Das Hauptproblem, meine Damen und Herren – und das haben die beiden Vorrednerinnen eigentlich sehr schön präsentiert –, liegt darin, dass die Medizin beginnt, zu gut zu werden. Sie schafft komplexe Zusammenhänge. Sie schafft Situationen, mit deren letzten Endes vorzunehmender Reglementierung Sie als Vertreter der Legislative in Zukunft große Schwierigkeiten haben werden.
Ich prophezeie Ihnen als Naturwissenschaftler, dass Sie von Seiten der Legislative den Entwicklungen der Medizin und der Molekularbiologie in Zukunft permanent hinterherlaufen werden. Dass Regelungen getroffen werden können, die gerecht und gut sind, das wage ich überhaupt grundsätzlich in Zweifel zu ziehen, sodass man sich letzten Endes die Frage stellen muss, wie man diese Unklarheit, die tatsächlich vorhanden ist und die immer größer wird, eingrenzen und limitieren kann.
Die Situation wird nicht besser, wenn wir zwei Jahre warten. Die Situation wird schlechter, denn die Komplexität wird größer. In zwei Jahren, wenn Sie glauben, Antworten gefunden zu haben, werden Sie vor neuen Fragen stehen, die dann noch schwieriger zu beantworten sind, sodass ich persönlich glaube, dass eine Übernahme einer Basiskonvention sinnvoll ist, vor allem deswegen, weil zwei Dinge drinnen sind, von denen ich glaube, dass sie essentiell sind.
Erstens einmal besteht die Möglichkeit des Monitorings, das hat Herr Minister Gorbach schon andiskutiert. Man kann also Probleme, die auftauchen, permanent artikulieren und auch permanent lösen. Zweitens ist die Überwachung der Patenterteilung meiner Meinung nach viel wichtiger als irgendwelche Richtlinien, denn in der Patenterteilung liegt dann das Problem. Man müsste sich, wie ich meine, in zunehmendem Maße den Kopf darüber zerbrechen, wie man die Patenterteilung im konkreten Fall sicherer und gerechter machen kann.
Die Komplexität der Sache ist natürlich so groß, dass es auch für einen Experten schwierig ist, alle Aspekte anzudiskutieren und abzudecken, wobei natürlich jeder Gesprächspartner selbst der Versuchung unterliegt – und der muss man begegnen –, sich in der Diskussion nur jene Seiten herauszuholen, die ihm gefallen. Und diese Seiten beleuchtet man dann, und über die redet man.
Das ist ähnlich wie beim halb gefüllten Glas Wasser: Wenn man es von oben betrachtet, ist es halb leer; wenn man es von unten betrachtet, ist es halb voll. Und wir müssen eben versuchen, hier die ganze Wahrheit rüberzubringen, so schwierig das auch ist.
Die ganze Wahrheit bedeutet, dass das Patent zwar die ökonomische Ausnützung einer Erfindung schützt, allerdings nicht die wissenschaftliche Bearbeitung. Das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt zu sein, denn zu den ganz wenigen Dingen, die der Geburtshelfer fürchtet, gehört zum Beispiel die tiefe Beckenvenenthrombose, an der Frauen unmittelbar nach der Entbindung sterben können. Da gibt es Patente, die es uns gestatten, das zu erkennen und auch ein Set an Therapie und Prävention anzuwenden. Diese Patente haben uns nicht daran gehindert, dass wir jahrelang darüber geforscht und uns den Kopf zerbrochen haben und neue wissenschaftliche Erkenntnisse kreiert haben.
Auch das schon erwähnte BRCA 1, BRCA 2, also die Mammakarzinom-Gene, sind patentiert. Wahrscheinlich sind sie sogar zu Unrecht patentiert. Allerdings hindern sie uns nicht daran, auf diesem Gebiet intensiv weiter zu forschen. Ich habe Ihnen den Jahresbericht der Frauenklinik mitgebracht. Darin können Sie sehen, was auf diesem Gebiet von uns geforscht und publiziert wird. Ich darf Ihnen verraten, wir haben bis dato keinen einzigen Einwand von irgendjemandem bekommen, der uns hindern würde, da weiter zu forschen.
Also die Trennung zwischen Forschung auf der einen Seite und ökonomischer Verwertung auf der anderen Seite muss man natürlich schon artikulieren, und die ist da, wenngleich unsere amerikanischen Freunde – und das muss ich auch bekennen –permanent die possessive Versuchung artikulieren, auch da einen gewissen Einspruch zu machen und die Wissenschaft zu limitieren.
Allerdings trifft das nicht die europäische Situation. Von da her wäre es gerade wichtig, dass wir in Europa eine geeinte Front haben, um dieser possessiven Denkweise unserer amerikanischen Freunde besser widerstehen zu können.
Das halbe Glas, das voll oder leer sein kann, bezieht sich natürlich auch auf die Unterscheidung zwischen Anmeldung und Erteilung eines Patentes. Man kann die Horrorszene, die durch die Anmeldung möglicherweise an die Wand projiziert wird, nicht vergleichen mit der tatsächlichen Erteilung eines Patentes. Natürlich kann man, wenn man die Listen der Anmeldungen nimmt, die Leute das Fürchten lehren. Das ist schon richtig. Allerdings sind die angemeldeten Patente ganz etwas anderes als die erteilten Patente. Da besteht ein großer Unterschied. Ich meine daher, dass es deswegen wichtig ist, dass man im Patentamt selbst angreift, denn dort kann man tatsächlich aktiv regeln und Missbrauch verhindern.
Ein weiterer Aspekt, der das halb volle und das halb leere Glas illustriert, ist die Trennung und die Differenzierung zwischen dem Weg zu einer Substanz, der patentiert wird, und dem Ziel. Natürlich, ich gebe Ihnen Recht, da ist die Trennung nicht mehr so leicht, denn zum Weg gehört natürlich auch das Ziel. Wenn ich eine Substanz patentieren möchte, dann patentiere ich den Weg, aber der Weg führt natürlich zu einem Ziel. Da muss man differenzieren, und darüber muss man sich möglicherweise auch noch im Rahmen des Monitorings den Kopf zerbrechen. Allerdings ist sicher, dass man das vom Patentrecht auseinander halten kann. Man kann das Ziel vom Weg sehr wohl sauber trennen. Allerdings ist diese Trennung dann letzten Endes auch nur im Patentamt zu exekutieren und nicht per Richtlinie zu verordnen.
Denken Sie an das Insulin, das Sanger und Tuppy vor vier Jahrzehnten gefunden haben. Sanger hat den Nobelpreis bekommen, Tuppy nicht. Das ist damals auch patentiert worden. Seitdem gab es viele Patente zu diesem Protein, allerdings eines hat das andere nicht behindert.
So glaube ich also tatsächlich, dass die Diskussion hier die volle Wahrheit von allen Aspekten her beleuchten soll. Wir alle sollten der Versuchung widerstehen, nur die Seite zu artikulieren, die einem gerade irgendwie zu Gesicht steht, wobei ich noch einmal darauf hinweisen möchte, meine Damen und Herren, dass die wirkliche Problematik von der Medizin kommt. Und ich darf das deswegen noch einmal unterstreichen, weil ich tatsächlich glaube, dass die Komplexität, vor der die Legislative in Zukunft stehen wird, äußerst groß ist: durch eine Medizin, die zum Beispiel vor einigen Jahren eine Koalition mit der Datenverarbeitung eingegangen ist, die jetzt vor einer neuen Koalition steht, nämlich mit der Quantenmechanik, klinische Fächer mit der Quantenmechanik, nicht zu reden von den Interferenzerfolgen in der Schwangerschaft, die bereits die Überspringung der Artengrenzen, die die Evolution gemacht hat, ermöglicht.
Also da kommt tatsächlich ein Horrorszenario von einer Wissenschaft, die zu gut geworden ist, auf uns zu. Da müssen wir beginnen, uns den Kopf darüber zu zerbrechen und dem wirklich Widerstände und Regeln entgegenzusetzen, und sei es nur auf Basis eines gemeinsamen kleinen Vielfachen.
Ich darf vielleicht die zwei Punkte noch einmal unterstreichen, von denen ich glaube, dass sie ein Lösungsansatz wären, nämlich – ich wiederhole hier das von Minister Gorbach Vorgebrachte – erstens eine Ausnützung, und zwar eine extreme Ausnützung der Monitoring-Möglichkeit und zweitens eine höhere Observierung der Patentämter, denn dort fallen meines Erachtens letzten Endes die Entscheidungen, die uns mitunter auch wehtun können. Das muss besser überwacht und auch gemonitort werden, und das ist auch möglich.
Ein Wort noch zur Ethik. „Ethik“, meine Damen und Herren, ist ein Wort, das momentan Hochkonjunktur hat. Es gibt die Ethik für den Politiker, die Ethik für den Mediziner, die Ethik für den Journalisten und letzten Endes natürlich auch die Ethik für das Patent.
Wenn wir vom Ethischen reden, dann verstehen Sie bitte, dass ich mir schon erwarte, dass derjenige, der das Wort „Ethik“ in den Mund nimmt, genau definiert und aufzeigt, welche ethischen Grundlagen er vertritt und dann letztendlich als Argumentationshilfen im Detail und im Konkreten heranzieht.
Ein ganz wichtiger ethischer Aspekt für uns in der Ethik-Kommission war die Individualethik. Die Individualethik ist letzten Endes dafür verantwortlich – und das ist ein Erbe Mitteleuropas –, dass wir eben Leben nicht patentieren wollen, dass wir das Individuum nicht patentieren wollen, dass wir den Körper nicht patentieren wollen, dass wir einzelne Organe und letztendlich auch einzelne Gene nicht patentieren wollen.
In einer Dialektik steht diese Individualethik dem Utilitarismus, der in den angelsächsischen Ländern Hochkonjunktur hat und dort seit Jahrzehnten auch kultiviert wird, gegenüber. Der Utilitarismus sieht eher das Gemeinwohl des Kollektivs und richtet ethische Normen nicht danach aus, welchen Vorteil jetzt das Individuum hat, sondern danach, welchen utilitaristischen Vorteil die Kommunität hat. Daher ist es mitunter auch schwierig, Widersprüche zu vermeiden – die Widersprüche sind wahrscheinlich nicht zu Unrecht aufgezeigt worden, aber sie sind inhärent in der Sache und inhärent auch in der Komplexität des Themas.
Ein weiterer ethischer Aspekt besteht darin, dass man eine Güterabwägung machen muss; es ist heute schon erwähnt worden. Die Güterabwägung ist meines Erachtens in ethischen Diskussionen von ganz großer Bedeutung. Dieser Aspekt kombiniert sich natürlich mit dem vorsokratischen Postulat des nihil nocere, nämlich: bei allen Dingen, die man macht und plant, das Nicht-schaden-Prinzip anzuwenden. Das ist im Konkreten natürlich nur dann exekutierbar, wenn man die Güterabwägung überlegt, denn was für den einen von Nutzen ist, kann für den anderen von Schaden sein, und daher ist die Güterabwägung von ganz großer Bedeutung.
Für die Ethik-Kommission von großer Wichtigkeit – und das möchte ich auch noch kurz erwähnen – war, dass in einer so sensiblen Diskussion – und es ist zweifellos richtig, es ist mehr als nur die Diskussion über eine Richtlinie, es ist wesentlich mehr – auch die ethische Gesprächskultur Hochkonjunktur haben sollte. Das heißt, man kann sich nicht zum Advokaten von Plastomeren machen, aber denjenigen, der nicht derselben Meinung ist, von oben bis unten bekübeln. Man muss zur Kenntnis nehmen, meine Damen und Herren, dass es auch Menschen gibt, die andere Auffassungen haben, und man muss diesen Menschen im ethischen Bereich mit besonders hohem tolerantem Respekt begegnen. Man darf diejenigen, die nicht derselben Meinung sind, nicht als Schwarzfärber oder Weißmacher apostrophieren. Das ist ungerecht, und das zu berücksichtigen gehört meiner Meinung nach auch zur Ethik.
Es geht nicht um Dogmen. Es geht – zumindest was mich als Mediziner betrifft – vor allem um die Tatsache, dass auch die Menschen der Republik Österreich Zugang zu den Anwendungen der biomedizinischen Forschung haben. Sie sollen nicht schlechter bedient sein als die Bewohner anderer Länder – natürlich unter Einhaltung jenes Humanismus, dem sich Mitteleuropa verpflichtet fühlt und den wir auch zu exekutieren und immer zu bedenken haben.
Unter Abwägung aller Güter und aller Argumente scheint mir die Umsetzung dieser Biopatentrichtlinie ein Schritt in diese Richtung zu sein, und zwar ein erster Schritt, dem noch weitere folgen sollen und müssen. Wir müssen diesen Schritt einmal wagen, und wir müssen jene Systeme zur Anwendung bringen, die letzten Endes auch Korrekturen ermöglichen. Korrekturen beziehungsweise Ergänzungen sind unter Umständen sinnvoll und, auch wenn man die Biopatentrichtlinie übernimmt, auch möglich, meine Damen und Herren.
Unter Umständen kann man hier in dieser Diskussion auch ein Wort modulieren, das offensichtlich – soweit mir das gesagt wurde – in der Medizin und auch in der Politik Gesetz ist, nämlich: dass nicht denjenigen, der zu spät kommt, das Leben bestraft, sondern denjenigen, der verhindert, dass viele Menschen einen Vorteil aus einer Sache haben.
12.25
Vorsitzender Abgeordneter Dr. Reinhold Mitterlehner: Als nächster Experte gelangt Herr Dr. Otmar Kloiber zu Wort. – Bitte.
12.26
Referent Dr. Otmar Kloiber (Bundesärztekammer, Köln): Herr Vorsitzender! Herr Vizekanzler! Sehr verehrte Herren Minister! Sehr geehrte Abgeordnete! Meine Damen und Herren! Ich möchte mich dafür bedanken, dass ich hier Gelegenheit habe, von Seiten der Deutschen Bundesärztekammer zu Ihnen zu sprechen. Ich denke, ich tue niemandem Unrecht, wenn ich sage, dass ich gleichzeitig auch jene Position reflektiere, die wir im europäischen Ärztegremium, im Ständigen Ausschuss der Europäischen Ärzte, aber auch im Welt-Ärztebund, der sich bereits in den Jahren 1991 und 1992 mit diesem Thema, auch in Reflexion der europäischen Richtlinie, beschäftigt hat, gemeinsam erarbeitet haben.
Wir haben eben gehört, dass insbesondere das Patentrecht ein Werkzeug ist, das zunächst einmal unabhängig von ethischen Erwägungen zu betrachten ist. Die Frage ist natürlich: Wenn wir ein solches Werkzeug, einen solchen Hebel haben – wo setzen wir ihn an? Ich denke, wir sollten einen Blick darauf werfen, wo dieser Hebel angesetzt wird, um dann festzustellen, ob er tatsächlich so wertneutral zu betrachten ist und ob nicht doch wesentliche Werte, die wir momentan, zumindest für das Gesundheitswesen, miteinander teilen oder noch teilen, in Gefahr geraten.
Natürlich – und das sieht wahrscheinlich jedermann so – kann man Gene nicht erfinden, natürlich kann man Organe, Gewebe, Zellen – auch die fallen unter diese Richtlinie, ganz natürlich – nicht erfinden, dennoch sollen hier Erfindungen definiert werden. Der Gesetzgeber, zunächst der europäische, macht da einen Kniff. Er sagt: Eine Entdeckung – also die eines Gens – zusammen mit der Beschreibung einer Anwendung ist eine Erfindung. Kinder würden so etwas eine Lüge nennen, wir Mediziner nennen das eine Pseudologie, für Juristen mag das akzeptabel sein, ich denke, man muss das noch einmal reflektieren, ob das so in Ordnung ist.
Daraus, meine Damen und Herren, entfaltet sich ein absoluter Stoffschutz, wie zum Beispiel für das eben zitierte Brustkrebsgen. Mein Vorredner hat schon anklingen lassen, es ist nicht ganz klar, ob dieses Patent wirklich zu Recht erteilt worden ist, weil auch viele andere daran gearbeitet haben; aber dieses Brustkrebsgen ist patentiert und hat durch das Patent eben einen absoluten Stoffschutz. Wenn sich jetzt herausstellt – und das wird durchaus diskutiert –, dass dieses Gen auch mit ganz anderen Erkrankungen assoziiert ist – Prostatakrebs ist zum Beispiel eine solche Erkrankung –, dann wird zum Beispiel in Zukunft jemand für ein Diagnostikum, das dieses Gen beinhaltet, das aber auf den Prostatakrebs abzielt, auch Lizenzgebühr an den Erstinhaber dieses Patents zahlen müssen, obwohl dieser beim allerbesten Willen nichts in dieser Richtung entdeckt und erst recht nichts erfunden hat.
Meine Damen und Herren Abgeordneten! Wenn Sie das ins Gesetz aufnehmen, übertragen Sie eine Wirtschaftssystematik, ein gewerbliches Wettbewerbsregulativ in das Gesundheitssystem. Im Gesundheitssystem sind bisher diagnostische, therapeutische, präventive Verfahren von der Patentierung ausgeschlossen gewesen, und das, wie ich meine, aus gutem Grund. Sie provozieren damit natürlich einen Paradigmenwechsel in der Medizin, denn mit der Übertragung dieser wettbewerblichen Systematik, dieser kommerziellen Systematik – Patente sind immer mit gewerblichen Anwendungen verknüpft – machen Sie die Medizin zum commodity business, zur Handelsware, und damit die Gesundheit auch.
Wir haben eben gute Argumente dafür gehört, die wir alle aus der klassischen Patent-Diskussion kennen: Patente schützen Investitionen, Patente machen Dinge überhaupt erst verfügbar, Patente stellen Öffentlichkeit her. In all diesen Argumenten liegt – halbes Glas voll, halbes Glas leer – natürlich immer ein Stück Wahrheit, und dennoch sind sie gerade in Bezug auf genetisches Material und auf den Kontext der Medizin falsch.
Geistiges Eigentum genießt in unserer Zeit, in der Produkte der Arbeit oft Gedankenprodukte sind, natürlich ein hohes öffentliches Schutzinteresse. Aber dabei ist es völlig irrelevant, ob diese Erfindungen, wenn sie dann geschützt werden sollen, durch hohe Investitionen zustande gekommen sind oder auf der Rückseite eines Briefumschlages – es muss Schutzwürdigkeit bestehen; Schutzwürdigkeit insofern, als es tatsächlich Erfindungen sind.
Das gilt, glaube ich, für Erfindungen, aber nicht für die Entdeckung von DNA und erst recht nicht für die Sequenzierung von DNA durch Roboter, was heutzutage der Fall ist. Die Erfindung hier, die so tituliert ist, ist nichts anderes als die Frage eines Kapitaleinsatzes, eine erfinderische Leistung findet dort und an dieser Stelle gar nicht statt.
Für zumindest zwei ganz große Bereiche kann man sagen, auch ohne Patente haben sich diese Bereiche sehr gut entwickelt. Der eine Bereich ist die Medizin selbst; ich sagte schon, medizinische Verfahren waren bisher von der Patentierung ausgeschlossen. Die Medizin hat sich in den letzten 200 Jahren mit rasanter Geschwindigkeit entwickelt, und sie hat dies ohne Patente getan. Die Patente von Arzneimitteln, die in der Industrie produziert werden, sind eine andere Sache – medizinische Verfahren selbst sind bisher nicht patentierbar! (Abg. Mag. Sima übernimmt den Vorsitz.)
Der zweite große Bereich ist die Kommunikationsindustrie. Das Internet hat sich ohne Patente entwickelt. Es hat sich sehr rasant entwickelt, und jetzt, wo Patente eingeführt werden sollen, wird auch schon die Behinderung in der Entwicklung dadurch erkennbar. Man muss das mit offenen Augen sehen. – Das Argument, dass nur Patente diese Investitionen schützen können und fördern können, trifft so nicht zu!
Ein weiteres Argument – und nun kommen wir zu einem sehr emotionalen Argument – ist, dass Patente Dinge verfügbar machen. Die Menschen denken, sie bekommen ihre Medizin nur dann, wenn es die Patente gibt.
Ebenso können Patente natürlich auch eingesetzt werden, um Dinge zu verhindern. Natürlich können Patente auch genutzt werden, um ein Produkt vom Markt zu halten, zum Beispiel dann, wenn man ein eigenes hat, das man noch weiter vermarkten möchte, weil man sich ein höheres Einkommen erhofft. Gerade angesichts der Diskussion über die Zugänglichkeit von Medikamenten in der Dritten Welt, die wir gehabt haben – denken Sie an die Medikamente für HIV-kranke Patienten –, birgt dieses Argument einen gewissen Zynismus in sich.
Stichwort Öffentlichkeit. – Ja, es ist richtig, eine Patentschrift ist eine Veröffentlichung, das ist gar keine Frage. Aber dennoch hat es massiv negative Auswirkungen auf die Medizin. In der Medizin sind die Erfolge sehr kleinschrittig, da gibt es sehr viele Teilergebnisse, Zwischenergebnisse, und es ist bislang gute Tradition, dass wir diese auf Kongressen austauschen. Dann können andere Gruppen damit arbeiten, Erkenntnisse daraus ziehen und mit diesen Informationen fortfahren.
Nun aber sollen wissenschaftliche Schritte patentfähig werden. Das bedeutet für den Wissenschaftler und die Wissenschaftlerin, dass sie patentrelevante Informationen nicht vor der Patentanmeldung veröffentlichen dürfen. Natürlich wissen sie nicht, was irgendwann einmal für sie patentrelevant sein wird.
Das bedeutet – und das sehen wir jetzt auch schon –, dass Wissenschaftler, die früher ihre Zwischenergebnisse auf Kongressen kommuniziert haben, diese natürlich in die Schublade legen. Sie nehmen sie nicht mehr mit, sie werden nicht mehr kommuniziert. Selbst in den Instituten werden die Labore gegeneinander abgeschottet, damit nicht mehr kommuniziert wird, wenn man erhofft, ein Patent gewinnen zu können.
Das bedeutet, dass die Art der Publikation, die wir in der Medizin gehabt haben, durch die Patentierung massiv beeinflusst und beschränkt wird. Die Patentschrift selbst erfüllt in keiner Weise die Anforderung an eine wissenschaftliche medizinische Publikation, die einem so genannten Peer-Review-Verfahren, also einer Kontrolle durch andere, unterzogen werden muss. Wir haben dadurch keinen Ersatz, sondern eine wesentliche Verzögerung der Kommunikation.
Das alles ist, könnte man natürlich sagen, vielleicht nur eine Verzögerung in der Zeit, aber es hat auch noch einen anderen Effekt. Es hat nämlich den Effekt, dass Forscher über abgelaufene Experimente erst zu spät informiert werden. Das bedeutet – Experimente werden in der Medizin nun einmal in großen Teilen an Tieren, in Tierversuchen, aber auch an Menschen durchgeführt –, dass diese Experimente, diese Versuche nicht mehr kommuniziert werden. Das wiederum heißt, dass allein aus diesen kommerziellen Überlegungen heraus, weitere Versuche gemacht werden müssen, denn die anderen wissen nicht von den Versuchen, die schon abgelaufen sind. Das heißt, dass weitere Menschenversuche gemacht werden müssen, und ich denke, ohne dass ich in die Tiefe der ethischen Theorien gehe, das ist ein ethisches Problem.
Nur der freie Informationsaustausch – und der wird, wie gesagt, durch die Patente behindert – kann dafür sorgen, dass diese Informationen schnell an die Menschen gelangen.
Die Schutzwürdigkeit des Lebens und die Belastung von Menschen, aber auch der Einsatz und das Leiden von Tieren sind gegen die Argumente eines kommerziellen Schutzes des geistigen Eigentums nicht aufzurechnen. Insofern glauben wir, dass diese Systematik aus dem Wirtschaftsleben in der Medizin nichts verloren hat und dort auch nicht angewandt werden soll. Sie machen aus der Medizin ein „commodity business“, eine Handelsware, sie wird sich natürlich auch den Gesetzen des Marktes unterwerfen, und es wird dann auch zu den entsprechenden Verteilungsschwierigkeiten kommen.
Eine kleine Randnotiz: Dadurch wird gerade das Gegenteil von dem gemacht, was für die Medizin eigentlich verlangt wird, nämlich eine stärkere Wettbewerbsorientierung. Patente sind natürlich ein Konkurrenzschutzinstrument, kein Wettbewerbsförderungsinstrument. Patente sind ein Konkurrenzschutzinstrument, das der Wirtschaft gewährt wird.
Natürlich gibt es – und ich habe gehört, das gibt es auch in Österreich – auch die Möglichkeit eines Zwangspatentes. Es gibt ein Forschungsprivileg, dass geforscht werden kann, auch wenn Lizenzen erteilt worden sind. Aber denken Sie doch bitte daran, wie das in Zukunft in der Forschungsförderung sein wird! Da wird ein Geldgeber fragen: Was möchtest du als Ziel erreichen? Dann kann man sagen: Am Ende soll dort ein Diagnostikum oder ein Therapeutikum stehen!
Diese Fragen müssen beantwortet werden, und es könnte sich herausstellen, dass es darauf bereits ein Patent gibt. Dann wird der Geldgeber sich natürlich überlegen, ob er noch Geld bereitstellt, um zum Beispiel ein Zwangspatent zu erstreiten, das dann zur Folge hätte, die Vermarktung möglich zu machen. Aber selbst die Zwangspatente, wenn sie dann erteilt werden – und ich halte es für durchaus möglich, dass sie erteilt werden, obwohl es gegenwärtig eine rare Praxis sind –, würden nicht davon entbinden, dass man die Lizenzgebühren zahlen muss.
Das heißt also, die ökonomischen Effekte der Patentierung sind trotz Forschungsvorbehalt und trotz Zwangspatente hundertprozentig da und sie werden ihre negative Wirkung natürlich auch entfalten.
So ist es also, dass wir ganz klar feststellen müssen, dass durch die Patentierung ein Einbruch von wirtschaftlichen Verfahrensweisen und Regulativen in die Medizin geschieht, was massiv zu einem Paradigmenwechsel der Medizin führen wird. Das wird zu ethischen Problemen führen, weil Versuche zum Beispiel wiederholt werden müssen, die eigentlich nicht wiederholt werden sollten oder nicht zu wiederholen sind.
Die Patentierung ist ein ethisches Problem, weil es durch die ökonomischen Auswirkungen zu massiven Verteilungsproblemen kommen wird. Wir haben diese in Ansätzen jetzt schon, wir brauchen uns da nicht in die Tasche zu lügen. Wir haben jetzt schon Schwierigkeiten, Patienten zu behandeln, die zum Beispiel an Hepatitis erkrankt sind. Wir haben zum Beispiel jetzt schon Schwierigkeiten, die extrem hohen Preise für die Hepatitis-Testung von Blutprodukten zu bezahlen. – Das liegt nicht in der Zukunft, das betrifft nicht nur die Dritte Welt, das wird uns hier in Mitteleuropa und in Westeuropa genauso betreffen.
Das heißt, die Rationierungsprobleme in der Medizin werden sich noch einmal verschärfen. Wir werden durch diese Richtlinie dort eine Zunahme der Gangart erleben. Wir können es jetzt schon sehen. Wir werden einen Einbruch in das eigentlich bisher von Patenten freie System der Medizin erleben. Wir werden damit Patente auf medizinische Verfahren praktisch bekommen. Denken Sie an die Patentierung von Stammzelltherapien! Das sind medizinische Verfahren, und diese werden in Zukunft patentfähig sein. Damit wird uns ein Eigentumsrecht an dem, was unser gemeinsames Erbe ist, nämlich das Genom der belebten Umwelt, faktisch genommen. Ich glaube, wir erhalten im Gegenzug keinen vernünftigen Gegenwert zurück.
12.41
Vorsitzende Abgeordnete Mag. Ulrike Sima|: Ich darf als Nächstem Herrn Dr. Schallenberger das Wort erteilen. – Bitte.
12.41
Referent Dr. Wolfgang Schallenberger (Wirtschaftskammer Österreich): Frau Vorsitzende! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin im Programm als Vertreter der Wirtschaftskammer angeführt. In der Tat bin ich dort Mitglied der Arbeitsgemeinschaft für Biotech-Industrie und habe mein gesamtes Berufsleben in kleinen Forschungsfirmen verbracht. Daraus werden Sie unschwer erraten, dass ich ein Befürworter der Umsetzung der Biopatentrichtlinie bin.
Ich werde mich hinsichtlich der Argumentation auf den Punkt Patentschutz in der Biotechnologie und die Auswirkungen auf die medizinische und pharmazeutische Forschung beschränken, und zwar aus Sicht dieser kleinen forschungsorientierten Biotech-Unternehmen.
Ich möchte nicht verabsäumen, mich beim Klub der Freiheitlichen Partei zu bedanken, der mir die Möglichkeit eingeräumt hat, im Rahmen dieses Referates Positionen zu vertreten, die möglicherweise innerhalb dieser Partei nicht ganz unumstritten sind.
Während meines Studiums an der Technischen Universität Graz in den Siebzigern führten wir erste Gentransfer-Experimente im Studentenlabor durch. Wir entnahmen einem Milchsäurebakterium einen Genabschnitt, transferierten ihn in ein Darmbakterium, und dieses konnte daraufhin Laktose verwerten.
Das war aus heutiger Sicht ein unendlich simples, einfaches Experiment. Unser damaliges Wissen würde heute wahrscheinlich nicht für die Biologie-Matura ausreichen. Die Methoden waren damals so, als würde man heute im Internet-Zeitalter mit Rauchzeichen Nachrichten übermitteln wollen.
Aber es war dies alles damals natürlich sehr spannend. Wir waren damit damals an der vordersten Front der wissenschaftlichen Entwicklung – und das als Studenten! –, und wir konnten uns durchaus vorstellen, dass diese sehr junge Erfindung des Zerschneidens und wieder Zusammenfügens von Genabschnitten eine große Bedeutung in der Zukunft haben könnte. Wir hatten aber keine Vorstellung davon, wie schnell diese Fortschritte in die Tat umgesetzt werden. Bereits einige Jahre später hat die Firma Genentech, die damals noch ein winziges Unternehmen in Kalifornien war, das Humaninsulin zum Patent angemeldet und auf den Markt gebracht. Wir haben heute schon einmal gehört, welche großen Fortschritte in der Behandlung von Diabetikern dieses Medikament gebracht hat.
Mittlerweile haben wir an die 200 zugelassene Biotech-Patente in der Medizin. Fast jedes dieser Medikamente hat im entsprechenden Indikationsbereich zu großen Behandlungsfortschritten geführt. Ich möchte all die Beispiele jetzt gar nicht anführen; sie sind heute bereits angeschnitten worden und werden wahrscheinlich in weiterer Folge noch einmal beleuchtet werden.
Sehr früh, eben bereits Mitte der siebziger Jahre, dachten aber die Wissenschaftler und Forscher bereits an die Kehrseite der Medaille, nämlich an die möglichen Risken für Natur und Mensch, die diese neue Technologie mit sich bringen könnte. Schon 1975 kam es daher zu einem Treffen der damals führenden Wissenschaftler, um sich über die Risken der Gentechnik zu beraten und einen Katalog verbotener Experimente festzulegen, an den sich all diese Wissenschaftler dann in der Zukunft auch gehalten haben. Das war ein bis dahin in der gesamten Wissenschafts- und Technikgeschichte einmaliger Akt der Selbstbeschränkung – einer Selbstbeschränkung ohne öffentlichen Druck, denn die Öffentlichkeit wusste damals noch nichts über die Natur dieser Experimente.
Mir ist es wichtig, diese beiden Aspekte hier in den Vordergrund zu stellen: einerseits den großen Fortschritt, den die Biotechnologie für die Menschheit – das sage ich bewusst! –, für die Medizin, aber auch für andere Bereiche, bis hin zum Umweltschutz, gebracht hat und noch bringen kann, und andererseits das Bewusstsein für ethische Verantwortung, das den akademischen und industriellen Wissenschaftlern von Anbeginn dieser Methoden der Biotechnologie eigen war.
Ich sagte „Biotech-Unternehmen“: Darunter verstehe ich nicht große industrielle Unternehmen, sondern kleine Start-up-Unternehmen – das ist eine Besonderheit der Biotechnologie –, die ihre industrielle Entwicklung von Anbeginn an geprägt haben, und zwar zuerst in den USA und mit entsprechender Verspätung auch in Europa. Sie sind zumeist an der Schnittstelle zwischen wissenschaftlicher Forschung und technischer Entwicklung angesiedelt, ihr Geschäftskonzept ist daher auch wissenschaftsfokussiert, ihre Gründer sind zumeist Wissenschaftler, die dann später Managern Platz machen. Es gibt aber auch Beispiele, wo exzellente Wissenschaftler im Laufe der Zeit zu hervorragenden Managern werden. Als Finanziers solcher Firmen kommen eigentlich nur sehr risikobewusste Investoren in Frage, die man auch Venture-Kapitalisten nennt.
Nur vergleichsweise wenige Biotech-Firmen von den mehreren Tausend, die es gibt, haben bisher die Entwicklung hin zum profitablen Pharmaproduzenten geschafft. Die meisten profilieren sich als Kooperationspartner für die Pharmaindustrie. Die Biotechs – so nennt man sie auch – entwickeln wissenschaftliche Konzepte bis hin zur klinischen Phase, die Industrie übernimmt dann die Zulassung, die Produktion und den Vertrieb – eine Arbeitsteilung, die sich in der biopharmazeutischen Wertschöpfungs- und Innovationskette sehr bewährt hat. Die Kleinen bringen Innovation, Kreativität, Geschwindigkeit ein, die Großen bringen die „tiefen Taschen“ ein – das heißt das notwendige Geld –, die Umsetzung, die Produktion und den Vertrieb. Mehr als die Hälfte der heute zugelassenen Biotech-Produkte stammt von solchen kleinen Firmen, entweder ursprünglich oder zur Gänze.
Was ist wichtig für solch kleine Biotech-Unternehmen? – Sie sind naturgemäß eine höchst riskante Angelegenheit, und zwar für alle Beteiligten: für die Gründer, für die Gesellschafter, für die Mitarbeiter, aber natürlich auch für die Investoren. Die Entwicklungszeiten sind lang, und zwar dauern sie zwischen fünf und zehn Jahre, meistens auch länger. Das sind nur die Entwicklungszeiten, noch nicht die Amortisationszeiten! In der Anfangsphase solch einer Firma gibt es oft noch keine Produktvorstellung. Man weiß noch gar nicht einmal, wie der Markt in Jahren aussehen wird, geschweige denn hat man eine Vorstellung davon, wie sich die Kunden verhalten werden oder wie sich das Produkt letztendlich auf solchen Märkten wird bewähren können.
Entsprechend schwierig ist es daher, ein solides Geschäftskonzept zu entwickeln. Dabei sind drei Punkte wichtig:
Einerseits das Geschäftsmodell an sich: Wie will die Firma irgendwann einmal Geld verdienen? Andererseits auch eine so genannte proprietäre Technologie, also das geistige Eigentum – ein wichtiges Wirtschaftsgut! Da sind eben unter anderem Patente oder geheimes Know-how sehr wichtig. Dann ist noch wichtig Geld – Geld und nochmals Geld. Doch da sind wir aber noch weit davon entfernt, welches zu verdienen.
Wenn Investoren ein ihnen angebotenes Geschäftsmodell beurteilen, dann haben sie es meist nur mit Annahmen und Möglichkeiten zu tun, es gibt keine Sicherheiten und schon gar keine Gewissheiten. Je innovativer ein Konzept ist, desto weniger Anhalt bieten bereits vorhandene Erfahrungswerte. So ist das eben mit Risiko. Materielle Vermögenswerte haben solche Firmen meistens auch nicht – Labor- und Büroausstattung ist geleast oder soll erst mit dem Geld der Investoren angeschafft werden.
In dieser Situation ist geistiges Eigentum oft das Einzige, woran sich der Investor halten kann, der einzige wirklich reale Vermögenswert – neben, natürlich, einem notwendigen motivierten Gründerteam und Managementteam.
Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, geistiges Eigentum zu schützen, etwa Geheimhaltung, aber das stärkste Recht ist eben das Patentrecht, und wenn man Entwicklungszeiten über längere Jahre hat, dann gibt es eigentlich keinen anderen vernünftigen Investitionsschutz außer einem starken Patentrecht, außer einem starken Rechtsschutz.
Man kann oft hören und lesen, dass Österreich im internationalen Vergleich hinsichtlich Life Science sehr gut liegt. Das stimmt insbesondere für den Großraum Wien, aber auch Standorte wie Graz, Salzburg, Innsbruck können sich da sehen lassen, und das stimmt auch für die biopharmazeutische Industrie, aber es stimmt nicht für den eben erwähnten Biotech-Sektor in Österreich. Es gibt diesbezüglich viele Statistiken, ich nenne Ihnen eine andere: Nimmt man die Arbeitsplätze in Biotech-Unternehmen pro eine Million Einwohner, dann liegen die USA bei 600, der Durchschnitt der Europäischen Union bei 300 und Österreich, hochgerechnet, bei 60. Wir in Österreich haben also ein Loch gegenüber den USA von Faktor 10, und bei der Europäischen Union muss man anmerken – da sind auch Spanien, Griechenland und Portugal enthalten –: Wenn wir uns mit den westlichen und nördlichen Industrieländern vergleichen, würde der Faktor noch stärker auseinander gehen.
Wir sprechen hier also von 2 000 bis 2 500 hoch qualifizierten Arbeitsplätzen in der Forschungs- und Entwicklungsindustrie, und wir sprechen auch von einem Beitrag zum Forschungsprodukt von 0,15 bis 0,20 Prozent. Wäre dieser Biotech-Sektor in Österreich stärker entwickelt, als er es – von einigen sehr präsentablen Ausnahmen abgesehen – ist, dann würden wir heuer das angepeilte Ziel im Forschungsprodukt nicht knapp verfehlen, sondern ziemlich komfortabel übertreffen.
Dieses Faktum erklärt sicherlich einige Strukturschwächen unserer Forschungslandschaft. Wir haben einen negativen Brain-Saldo, das heißt, die Abwanderung von talentierten Forschern und Technikern ist größer als die Zahl der Forscher, die zu uns nach Österreich kommen. Wir haben auch etwas, was fast alle anderen entwickelten Industrieländer nicht haben: Wir haben eine versteckte Arbeitslosigkeit in diesem Sektor, obwohl unsere Studentenzahlen in den naturwissenschaftlichen Fächern niedriger sind als jene in Vergleichsstaaten – versteckte Arbeitslosigkeit: Personen, die einen Studienabschluss machen, aber noch nie einen Job gehabt haben, scheinen in der Arbeitslosenstatistik nicht auf –, und wir haben an Österreichs Universitäten eine hohe Anzahl junger Forscherinnen und Forscher, die froh sein müssen, mit schlecht dotierten Werkverträgen mitarbeiten zu dürfen. Daher ist es kein Wunder, dass die talentiertesten von ihnen abwandern.
Ich würde mich natürlich sehr freuen – und viele meiner Kollegen aus der Biotech-Industrie auch –, wenn wir anlässlich der Diskussion über ein Konjunkturpaket auch zu diesem Thema einmal Vorschläge machen könnten. Wir hätten welche, aber das ist eine andere Geschichte.
Österreich, seine Wirtschaft, seine Gesellschaft brauchen eine leistungsfähige, dynamische Biotech-Industrie. Ein adäquater Schutz des geistigen Eigentums ist neben anderen eine unabdingbare Voraussetzung für das Entstehen einer modernen wissensbasierten Industrie. Die Umsetzung der Biopatentrichtlinie wäre daher ein wichtiges Signal sowohl nach innen als auch nach außen.
12.55
12.56
Referentin Dr. Christine Godt (Universität Bremen, Zentrum für Europäische Rechtspolitik): Sehr geehrte Damen und Herren! Herzlichen Dank für die Einladung! Ich will mich mit Fragen des Stoffschutzes beschäftigen und dabei auf drei Punkte konzentrieren: Zunächst will ich auf den Gestaltungsauftrag an Sie als nationales Parlament eingehen, dann werde ich den Richtlinieninhalt zum tatbestandsseitigen Stoffschutz erläutern – Stichwort Patente auf Leben in Artikel 5 Absatz 2 –, und schließlich werde ich auf den umfangsseitigen Stoffschutz – Stichwort Funktionsbeschränkung in Artikel 5 Absatz 3 der Richtlinie – eingehen.
Zunächst zum nationalen Gestaltungsspielraum: Bekanntermaßen handelt es sich bei dem vorliegenden europäischen Rechtsakt um eine Richtlinie. Das bedeutet, in Abgrenzung zu einer Verordnung hat der europäische Gesetzgeber nur das Ziel vorgeschrieben und die Wahl von Form und Mittel zur Erreichung dieses Ziels dem nationalen Gesetzgeber überlassen. In der Regel bedeutet das Gestaltungsspielraum, und das gilt insbesondere in Bezug auf die politischen Kompromisse in diesem europäischen Rechtsakt. Diese sind im europäischen Recht die harten Nüsse bei der Umsetzung: Sie passen nicht in das gewachsene nationale Rechtsgefüge, und, wie hier bei der Biopatentrichtlinie, nicht in die Regeln des tradierten Patentrechts hinein.
Damit bin ich schon beim ersten Punkt. – Umsetzen heißt: den europäischen Kompromiss in das eigene Recht übersetzen. Das heißt gestalten – und nicht abschreiben. Umgesetzt werden muss natürlich nur das, was in der Richtlinie steht, und deshalb muss man genau hinschauen, was eigentlich drinsteht und was nicht. Was nicht geregelt wird, verbleibt im Raum der nationalen Souveränität.
Ziel der Richtlinie war also die Rechtsharmonisierung im Bereich des biotechnologischen Patentrechts, aber sie regelte es auch nicht umfassend, sondern nur bestimmte Fragen.
Wenn etwas in der Umsetzung geregelt wird, was nicht in der Richtlinie steht, dann bedeutet das entweder nationale Übererfüllung oder Instrumentalisierung des Umsetzungsprozesses zu anderen Zwecken, und das sollte offen gelegt werden.
Schauen wir einmal genau hin, was konkret in der Richtlinie betreffend den Stoffschutz geregelt wird. Da müssen wir sorgfältig zwischen der Tatbestandsseite und der Umfangseite trennen.
Zunächst zum tatbestandsseitigen Stoffschutz: Tatbestandsseitiger Stoffschutz oder auch Sachschutz sagen die Patentrechtler zu dem, was in der politischen Debatte mit dem Begriff „Patente auf Leben“ belegt ist. Sachschutz besteht seit Anfang des vorigen Jahrhunderts für Bakterien und Viren. Ende der achtziger Jahre wurde der Schutz für jedes biologische Material verallgemeinert. Diesen Sachschutz sieht die patentrechtliche Profession in Artikel 5 Abs. 2 der Richtlinie festgeschrieben.
Aber ist das so? War das das, was das Europäische Parlament 1998 gewollt hat?
Widerspruch wurde sogleich nach Verabschiedung der Richtlinie laut, als die Profession von einer Festschreibung der überkommenen Rechtsprechung sprach. Im November des vergangenen Jahres hat das Europäische Parlament noch einmal einen Versuch gestartet, auf die Auslegung der Richtlinie Einfluss zu nehmen. Es forderte die Kommission auf, klarzustellen, dass isolierte Sequenzen als solche vom Patentschutz ausgeschlossen sind. Dies genau widerspricht dem Wortlaut der Richtlinie in Artikel 5 Abs. 2.
Was ist hier los? Dazu ein Schaubild: Folie 2. (Die Rednerin erläutert ihre Ausführungen anhand eines Schaubildes, das für alle Enquete-Teilnehmer sichtbar auf eine an der Stirnwand des Saales aufgestellte Leinwand projiziert wird.)
Auf der linken Seite sehen Sie die Auslegung des Artikels 5 so, wie sie die patentrechtliche Profession nach überkommenen Grundsätzen sieht. Danach steht in Absatz 1 der Ausschluss der bloßen Entdeckung. In Absatz 2 sieht die Profession den Naturschutz, die Naturstoffrechtsprechung kodifiziert und in Absatz 3 den absoluten Stoffschutz. Diese Auslegung beruht auf 40 Jahren Rechtsprechung, entwickelt anhand von Chemiepatenten, bei denen ethische Fragen keine und Abwägungsprozesse nur eine untergeordnete Rolle spielen.
Das Europäische Parlament hatte aber eine ganz andere Aufgabe, nämlich die ethischen Probleme bei der Biopatentierung zu lösen, das Recht an den Gegenstand anzupassen und Abwägungsprozesse vorzustrukturieren. Im Ergebnis macht die merkwürdige Entschließung des Europäischen Parlaments aus dem vergangenen November dann Sinn, wenn man Artikel 5 so auslegt, wie es hier auf der rechten Seite verschriftlicht ist.
Danach schließt Artikel 5 Abs. 1 Patente auf Sequenzen des menschlichen Körpers nicht nur deshalb aus, weil sie Entdeckungen wären, sondern auch deshalb, weil sie gegen den Ordre public, das heißt, gegen die öffentliche Ordnung und die Sitten, verstoßen würden. Das ist etwas anderes. In genau dieser Rechtsqualität ist es jetzt im französischen Gesetzentwurf festgeschrieben, dem im Januar dieses Jahres der französische Senat zugestimmt hat.
Dann bekommt auch Absatz 2 eine ganz andere Qualität. Die Isolierung biologischen Materials ist nicht bereits die Erfindung. Die Isolierung macht das biologische Material erst zu „patentable subject matter“. Mit anderen Worten: Absatz 2 regelt die Patentwürdigkeit, aber nicht bereits die Patentfähigkeit. Das besagt auch Erwägungsgrund 23 der Richtlinie: Ein einfacher isolierter DNA-Abschnitt ohne Angabe einer Funktion ist nicht eine technische Lehre.
Damit entspricht das Parlament dem naturwissenschaftlichen Verständnis, dass die Aminosäurenabfolge als solche keine signifikante Bereitstellung eines nützlichen Stoffes wäre, so wie etwa die Isolierung oder die Reinigung einer chemischen Substanz. Das Interessante hier ist das Gen, das heißt, erst die in der Aminosäurenabfolge kodierte Information.
Die Patentfähigkeit ist in dieser Lesart erst in Absatz 3 geregelt. Die eigentliche technische Lehre stellt erst die konkrete Beschreibung dar. Dazu sagt Erwägungsgrund 24 der Richtlinie: Die gewerbliche Anwendbarkeit setzt die Angabe eines Proteins und seine Funktion voraus.
Das bedeutet eine Tatbestandsverschiebung: Die Isolierung allein macht noch nicht die Erfindung aus, sondern erst die konkrete Beschreibung, was man mit der Sequenz machen kann, also die gewerbliche Anwendbarkeit.
Damit stehen wir vor folgendem Problem: Die linke Auslegung mag zwar technisch richtig sein, aber sie widerspricht dem Geist der Richtlinie. Das aber, was das Parlament eigentlich regeln wollte, widerspricht dem Wortlaut von Artikel 5 Abs. 2. Dessen Formulierung kann man beim besten Willen nicht als Beschränkung auf Verfahrensschutz auslegen.
Hier liegt ein krasses Beispiel dafür vor, dass sich der politische Wille des Parlaments wie er in den Erwägungsgründen erklärt wurde – und die juristischen Formulierungen des verfügenden Teils widersprechen. Das Europäische Parlament hat wohl darauf vertraut, dass die juristischen Sachbearbeiter und Experten die Kompromissformeln, die gefunden worden sind, irgendwie in den Text integrieren. Die Patentjuristen waren und sind – gewollt oder ungewollt – beim Schreiben des Richtlinientextes und erst recht bei der Auslegung der Richtlinie der überkommenen Dogmatik verhaftet. Also lässt man die Dinge jetzt so laufen, wie sie sind, und überlässt man die Auslegung denjenigen, die das Patentsystem administrieren, dann kommt dabei eine Auslegung heraus, die nicht dem Geist der Richtlinie entspricht.
Was also tun? – Die Situation in Bezug auf den tatbestandsseitigen Stoffschutz ist meiner Ansicht nach so verfahren, dass sie nur durch Neuverhandlung gelöst werden kann. Darauf müssen nun die nationalen Parlamente drängen. Das wäre auch ganz im Sinne des Europäischen Parlaments, das sich ja, wie eingangs gesagt, bereits in diesem Sinne an die Kommission gewandt hat, da es selbst kein eigenes Initiativrecht hat. Im Rahmen des nationalen Umsetzungsprozesses gibt es jedenfalls in Sachen Sachschutz, tatbestandsseitiger Stoffschutz keinen Spielraum. Absatz 2 ist bindend und fordert Patentschutz auf isoliertes Material. Auch eine wohlwollende Auslegung vermag in Absatz 2 keine Beschränkung hineinzulesen. Hier hilft allein, neu zu verhandeln.
Umgekehrt: Spielraum besteht beim umfangseitigen Stoffschutz. – Dazu meine dritte Folie. (Es erfolgt wiederum eine Projektion eines Schaubildes.)
Hier spielt auch in der deutschen Umsetzungsdebatte die Musik. Stichwort: funktionsbeschränkter Stoffschutz. Was heißt das? – Der Begriff bezeichnet ein Mittelding zwischen dem absoluten Stoffschutz und der Zweckbeschränkung.
Absoluter Stoffschutz heißt, dass alle Anwendungen – auch die zum Zeitpunkt der Anmeldung noch nicht erkannten – vom Schutzumfang des Patents erfasst sind. Kleines fiktives Beispiel: Aspirin. Das Patent beansprucht Salizylsäure, und als gewerbliche Anwendbarkeit wird beispielhaft Kopfschmerz genannt. Absoluter Stoffschutz heißt in diesem Beispiel: Der Patentinhaber hat die Rechtsmacht, den Verkauf von Salizylsäure auch zu Zwecken der Vorbeugung von Herzinfarkt und Erkältungskrankheiten zu verbieten. Auch diese Anwendungen sind vom Schutzumfang des Patents erfasst. Bei der Patentanmeldung braucht diese eine beispielhafte Anwendung – wenn überhaupt – erst zum Zeitpunkt der Erteilung dargelegt werden.
Die Richtlinie indes sagt nichts über den absoluten Stoffschutz aus. Nur die Patentrechtler halten ihn für einen tradierten Grundsatz und interpretieren ihn in Artikel 5 Abs. 3 hinein. Dort soll er festgeschrieben sein – allenfalls mit der Beschränkung, dass die Angaben bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung gemacht werden müssen –, aber ohne zwingenden Einfluss auf den Patentumfang.
Gewissermaßen der Gegenbegriff zum absoluten Stoffschutz ist die Zweckbeschränkung. Dies ist eine Rechtsfigur, die in den sechziger Jahren diskutiert wurde, damals aber für Chemiepatente von der Rechtsprechung abgelehnt wurde. Danach beschränkt sich der Schutzumfang eines Sachpatents auf die konkret offenbarte Verwendung, egal ob im Anspruch oder in der Beschreibung genannt. In meinem Beispiel: Vom Schutzumfang umfasst wäre nur die Salizylsäure zur Behandlung von Kopfschmerzen. Der Verkauf zu Zwecken der Infarktprävention läge außerhalb des Umfanges.
Diese Rechtsfigur wurde nun im französischen Gesetzentwurf für die Patentierung von menschlichen Gensequenzen aufgegriffen. Das Gesetz beschränkt den Umfang von Ansprüchen auf menschliche Gensequenzen auf die offenbarte Anwendung.
Von der Zweckbeschränkung ist wiederum die Funktionsbeschränkung zu unterscheiden, die in Deutschland derzeit die Gemüter bewegt. Sie sucht einen Weg dazwischen, und zwar in Anpassung an die Besonderheiten der DNA. Von chemischen Verbindungen unterscheidet sich die DNA nicht nur durch den Informationsgehalt, sondern vor allem durch die Multifunktionalität für die Synthese verschiedener Proteine und ihren Einfluss auf verschiedene Krankheiten.
Die Funktionsbeschränkung sucht das Patent im Umfang auf jene Anwendungen zu beschränken, die innerhalb der offenbarten DNA-Kodifizierungsfunktion liegen.
Die Auslegung von Absatz 3 als Festschreibung des absoluten Stoffschutzes widerspricht der Ratio der Richtlinie, wie sie in Erwägungsgrund 23 und 24 dargelegt ist. Diesen weit reichenden Schutz hat das Parlament zum Schutz der Forschung nicht gewollt. Nein, die gewerbliche Anwendung soll konkret beschrieben werden. Die Proteine und deren Funktion sollen angegeben werden, und zwar mit rechtlicher Konsequenz. So steht es übrigens auch im verfügenden Teil im Artikel 9 der Richtlinie. Das heißt: Die Angaben sollen den Umfang des Patents auf das beschränken, was der Anmelder tatsächlich „erfunden/gefunden“ hat. Ob dies in Form der Zweckbeschränkung oder in Form der Funktionsbindung erfolgt, diese Wahl der Mittel überlässt der europäische Gesetzgeber den nationalen Parlamenten.
Damit komme ich zum Schluss und möchte den Bogen zum Anfang spannen: Bekanntermaßen ist die europäische Rechtsetzung aus demokratischen Gesichtspunkten prekär. Die Legitimationskette ist zu lang, und die Rechtsetzung ist zu sehr von den Exekutiven vorgeprägt. Ich will dieses Problem auf die Biopatentrichtlinie zuspitzen:
Je mehr den nationalen Parlamenten nur noch Rechtsakte zur bloßen Umsetzung vorgelegt werden, umso größer wird ihre Kontrollaufgabe der Exekutive gegenüber. Die nationalen Parlamente haben darauf zu achten, dass der politische Kompromiss, der auf europäischer Ebene gefunden worden ist, nicht bei der Umsetzung durch Recht verloren geht. Es sind diese Kompromisse, die das Ringen um eine ausgewogene Abwägung von Allgemeininteressen widerspiegeln. Dies gilt insbesondere für den zähen Kompromiss um die Biopatentrichtlinie, den das Europäische Parlament der Kommission und dem Europäischen Rat abgetrotzt hat.
Insoweit tragen die nationalen Gesetzgeber bei der Umsetzung der EG-Richtlinien eine neue Verantwortung. Es ist ihre Aufgabe, bei der Umsetzung der Richtlinie in das nationale Recht diese Kompromisse als Antwort auf die ethischen und sozialen Belange in das nationale Recht hinüberzuretten. Gestalten heißt hier, die Erwägungsgründe und den verfügenden Teil der Richtlinie zusammenzudenken. Umsetzen heißt hier nicht, allein den verfügenden Teil abzuschreiben.
13.13
Diskussion
Vorsitzende Abgeordnete Mag. Ulrike Sima|: Wir gehen nun in die Diskussion ein, der noch die Expertenstatements vorangehen. Die Höchstredezeit beträgt 5 Minuten.
Erster Redner ist Herr Professor Zacherl. – Bitte.
13.13
Professor Dr. Nikolaus Zacherl (Forschungsinstitut für molekulare Pathologie GmbH, Wien): Ich habe eine Reihe von Argumentationen und Beschreibungen rund um diese Richtlinie gehört, warum oder warum sie nicht umgesetzt werden sollte. Ich muss mich sehr beherrschen, bei einer Redzeit von 5 Minuten zu bleiben. Ich werde daher nur einige Punkte ansprechen.
Erstens: Es wurde hier gesagt, Österreich sei verpflichtet, die Richtlinie auf Grund der Richtlinie selbst umzusetzen. Das greift zu kurz! Wir sind nicht nur auf Grund der Richtlinie verpflichtet, diese umzusetzen, sondern wir sind auch auf Grund des TRIPS-Abkommens, des WTO-Abkommens über geistiges Eigentum, verpflichtet, entsprechende Vorschriften zu garantieren.
Was meine ich damit? – Wenn wir vom Stoffschutz abgehen wollten, dann müssten wir das TRIPS-Abkommen ändern. Wenn wir eine spezielle Regelung für die Biotechnologie machen wollten, dann müssten wir das TRIPS-Abkommen ändern. Dazu darf ich sagen: Es ist in der Juristerei alles abänderbar, aber man muss wissen, in welchem rechtlichen Umfeld man sich bewegt.
Zweitens: Unternehmen sind auf die Berechenbarkeit der Rechtsordnung angewiesen. Das heißt: Es geht nicht, dass man von einem Tag auf den anderen grundsätzliche Regelungen ändert.
Was tut ein Patent? – Ein Patent ist nur ein Ausschließungsrecht, es hat nichts mit der Anwendung der Erfindung zu tun, außer vielleicht im Zusammenhang mit ethischen Fragen. Herr Vizekanzler! Daher finde ich die Idee, einen besonderen Schutz der einwilligungsunfähigen Personen auch im Zusammenhang mit der Patentierung in Erwägung zu ziehen, interessant und gut. Ich frage mich nur, warum es die Verfassung sein muss. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man das im Zuge der Novelle des Patentgesetzes macht und das damit auch einfacher wird.
„Die Richtlinie schafft kein neues Patentrecht“, das heißt – und das bitte ich Sie zu akzeptieren –: Wenn die Richtlinie kein neues Patentrecht schafft, dann sind Debatten über Stoffschutz oder nicht Stoffschutz fehl am Platz. Ich bitte, die Richtlinie nicht so zu interpretieren, dass manche Dinge offen sind, die zum Patentrecht gehören. Selbstverständlich, sie sind bewusst offen, weil es in die nationalen Patentrechte eingebaut werden soll.
Ich greife als Beispiel die Frage „Entdeckung und Erfindung“, die hier diskutiert worden ist, heraus: Sie können in der Richtlinie nachlesen, dass die Richtlinie die Begriffe „Entdeckung“ und „Erfindung“ nicht ändern will. Das heißt: Sie verweist in diesem Zusammenhang auf das bestehende konventionelle Patentrecht. Es wird hier ein Widerspruch zwischen Artikel 5 und Artikel 3 konstruiert.
Sie können über den Artikel 5: Bestandteile des menschlichen Körpers, Patentwürdigkeit oder Patentfähigkeit, Aussagen nur dann treffen, wenn Sie Artikel 5, im Speziellen Absatz 2, immer im Zusammenhang mit Artikel 3 lesen.
Was besagt Artikel 3? – Artikel 3 tut nichts anderes, als die konventionelle Patentlehre zur Patentierung von Naturstoffen festzuschreiben. Dort heißt es: Ein in der Natur vorkommender Stoff kann Gegenstand einer Erfindung sein, wenn (...). – Genau das Gleiche besagt auch Artikel 5 Abs. 2: Ein durch ein technisches Verfahren isolierter Bestandteil kann Gegenstand einer Erfindung sein.
Sie ersehen daraus, dass es einfach nicht richtig ist, dass die Richtlinie die Begriffe „Entdeckung“ und „Erfindung“ verschiebt, sondern im Gegenteil: Sie interpretiert nur die Naturstoffpatentrechtslehre auch auf diese Frage der Bestandteile des menschlichen Körpers hin.
Bei der Umsetzung von Richtlinien könne man gestalten, hörte ich hier. – Bitte Vorsicht! Was ist denn die Absicht dieser Richtlinie? – Diese Richtlinie ist erstens eine so genannte Common-market-Richtlinie. Das heißt: Nach dem EU-Vertrag dürfen derartige Richtlinien nicht – nicht im Wortlaut, aber in ihrem Sinn – verändert werden, denn die Idee ist, dass in allen Mitgliedstaaten gleiche Voraussetzungen für die Patentierung gelten sollen. Wir bewegen uns hier im Wettbewerbsrecht.
Eine der Hauptabsichten dieser Richtlinie ist, den so genannten Fleckerlteppich, den wir heute noch innerhalb der EU haben, nämlich unterschiedliche – speziell – Rechtsprechungen in den einzelnen EU-Staaten auf Grund unterschiedlicher Interpretationen von Patentrechten, zu vermeiden. Jetzt gibt es aber plötzlich eine österreichische Version dieser Richtlinie. Ich fordere Sie auf: Bitte haben Sie den Mut und die Konsequenz und sagen Sie: Wir setzen nicht um. – Daraus eine österreichische Version zu basteln, widerspricht völlig der Intention. Dann wäre es besser, diese gar nicht umzusetzen.
Ich habe nur wenig Zeit, um etwas zur Ethik zu sagen. Es wird immer wieder die Ethik angesprochen. Im Zusammenhang damit höre ich hier nur: verzögern, abwarten. – Ich möchte Sie gerne auf einen Gedanken hinweisen. Ethik besteht nicht nur im Verhindern, Ethik gebietet auch Handlungen speziell in der Medizin. Und ich bitte Sie, einmal darüber nachzudenken, ob es nicht ein ethisches Gebot ist, diese Richtlinie im Sinne der Medizin umzusetzen.
13.21
Vorsitzende Abgeordnete Mag. Ulrike Sima|: Als Nächstem darf ich Herrn Dr. Then das Wort erteilen. – Bitte.
13.21
Dr. Christoph Then (Greenpeace, Hamburg): Sehr geehrte Herren Minister! Sehr geehrte Abgeordnete! Sehr geehrte Damen und Herren! Vielen Dank für die Einladung, für die Möglichkeit, hier unseren Standpunkt vorzutragen. Greenpeace hat als internationale Organisation zum Teil einen etwas anderen Blick auf diese Richtlinie, als er in den bisherigen Stellungnahmen hier zum Ausdruck gekommen ist.
Es gibt international eine lebhafte Diskussion über diese Richtlinie. Patientenorganisationen, Humangenetiker, Ärzte, Krankenkassen, also all jene, die angeblich für die Umsetzung dieser Richtlinie sein müssten, weil sie im Grunde theoretisch von ihr profitieren sollen, sind im europäischen Kontext gegen die Umsetzung der Richtlinie, sind gegen die Patentierung menschlicher Gene. Landwirte, zum Beispiel der große Deutsche Bauernverband, alle Ethikkommissionen, die sich mit der Richtlinie befasst haben – mit Ausnahme der österreichischen Ethikkommission –, der Europarat und sogar das Europäische Parlament haben deutliche Kritik an dieser Richtlinie geübt und haben sich alle dahin gehend geäußert, dass sie im Grunde neu verhandelt werden muss.
Insofern bitte ich Sie, diesen internationalen Kontext zu berücksichtigen, wenn auch in Österreich über dieses Thema insbesondere vor dem Hintergrund debattiert wird, dass auch die österreichischen Ärzte und die Vertreter der Kirche gegen die Umsetzung sind. Nicht zu vergessen ist in diesem Zusammenhang das Volksbegehren, das in Österreich unter dem Titel „Kein Patent auf Leben“ gelaufen ist und sehr erfolgreich war. Im Grunde gab es auch in Österreich stark ablehnende Stimmen.
Die Gründe, warum man von dieser Richtlinie abgehen soll, kann man nach drei Gesichtspunkten katalogisieren. Das eine sind die ethisch-moralischen Gesichtspunkte. Das andere sind die wissenschaftlichen Gründe. Und das Dritte sind die wirtschaftlichen und sozioökonomischen Gründe.
Für Greenpeace sind die ethischen Gründe mit Händen zu greifen. Lebewesen, Säugetiere sind keine Erfindung wie Glühbirnen. Man sollte sie auch im Patentrecht nicht gleichsetzen, man sollte sie vom Patentschutz ausnehmen. Man sollte es ermöglichen, technische Verfahren zu patentieren, nicht aber die Lebewesen selbst.
Der zweite Aspekt sind die wissenschaftlichen Gründe. Spätestens seit der Entschlüsselung des menschlichen Erbguts ist klar, dass Gene sehr viele verschiedene Funktionen haben. Ein Gen codiert nicht ein Protein, stellt nicht einen bestimmten Eiweißstoff her, sondern in der Regel mehrere. Die Mehrheit der menschlichen Gene ist für mehrere unterschiedliche biologische Funktionen zuständig. Es ist unsinnig, ein Patent demjenigen zu erteilen, der das Gen isoliert und eine kommerzielle Anwendung angibt. Diesem ein Monopol für die wirtschaftliche Verwertung aller biologischer Funktionen dieser Gene, soweit sie wirtschaftlich verwertet werden können, zu geben, ist absolut unsinnig. Spätestens seit der Entschlüsselung des menschlichen Erbguts muss uns das klar sein.
Das Dritte sind die wirtschaftlichen Erwägungen. Der Zugang zu genetischen Ressourcen sollte unserer Ansicht nach nicht durch Monopolrechte, durch exklusive Zugangsrechte blockiert werden. Gerade im Bereich der Landwirtschaft in Fragen des Saatguts und in der Medizin sollte das, was genetische Ressourcen sind, was genetische Informationen sind, in der community bleiben, also common good bleiben. Für jeden, der Zugang zu diesen genetischen Ressourcen braucht, sollte dieser Zugang auch festgeschrieben werden.
Es wurden inzwischen Fälle beschrieben, wobei in einem einzigen Reiskorn 70 verschiedene Patente versteckt sind. Für mittelständische Züchter, für Landwirte ist es unmöglich, unter diesen wirtschaftlichen Gegebenheiten traditionelle Landwirtschaft oder traditionelle Züchtung zu betreiben.
Bei der Firma Myriad, die ein Patent auf ein Gen hat, das schon verschiedentlich angesprochen worden ist, ist es so, dass sie die Vorstellung hat, dass in Europa jegliche Testungen auf Brustkrebserkrankungen im Zusammenhang mit diesem Gen unterbleiben müssen. Die Labors sollen ihrer Meinung nach ihre Tests einstellen, die Blutproben sollen in die USA geschickt werden. Labors, die zum Teil bessere diagnostische Verfahren haben, sollen diese Verfahren nicht mehr anwenden. Es soll nur noch das Verfahren der Firma Myriad angewendet werden. Wem soll das nützen außer der Firma Myriad? – Bestimmt nicht den Patienten, bestimmt nicht den Ärzten!
Vor diesem Hintergrund denken wir, dass die Umsetzung der Richtlinie nicht im Vordergrund stehen sollte, sondern dass die Richtlinie genau geprüft werden sollte. Es gibt viele Verbote im Text der Richtlinie, die gut klingen, die aber letztlich rechtlich nicht wirksam sind. Der Schwerpunkt müsste hier im Bereich der Neuverhandlung liegen.
Die deutsche Bundesregierung hat schon im Jahr 2000 grundsätzlich gesagt, sie möchte gerne neu verhandeln. Die französische Regierung hat ähnliche Initiativen unternommen. Es gibt kritische Haltungen zum Beispiel in England, obwohl die Richtlinie dort bereits umgesetzt worden ist. In England interessiert man sich für eine Neuverhandlung.
Die Europäische Kommission hat in der Tat ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, das aber gegen die Mehrheit der EU-Länder geführt werden muss und dessen Ende in den nächsten zwei Jahren vermutlich nicht absehbar ist. Das heißt, es besteht keine Dringlichkeit von Seiten dieses Vertragsverletzungsverfahren. – Im Gegenteil: Die Patentierung von Software, die in der Europäischen Union auch heftig umstritten ist, hat eher dazu geführt, dass das Patentrecht neu überdacht wird. Das, was die Kommission im Bereich der Software-Patentierung vorgeschlagen hat, war ähnlich unangemessen wie das, was im Bereich der Genpatentierung umgesetzt worden ist. Das Europäische Parlament hat auf verschiedenen Ebenen die Fragen der Patentierung neu zu beraten.
Deshalb sagen wir ganz klar, wir müssen uns in Richtung Neuverhandlung bewegen. Das Ziel muss sein, dass Gene eben nicht patentierbar sind, biotechnologische Erfindungen oder Bioarzneimittel aber patentiert werden können. Das Ziel muss auch sein, dass Lebewesen nicht patentiert werden können, dass aber technische Verfahren in bestimmtem Umfang patentiert werden können, dass also tatsächlich eine Balance hergestellt wird zwischen dem technischen Input und dem, was an Monopolrechten verliehen wird.
Vor diesem Hintergrund kann ich nur an das österreichische Parlament appellieren, sich diese Richtlinie genau anzusehen und alle möglichen Initiativen zusammen mit anderen europäischen Parlamenten, mit anderen europäischen Regierungen zu ergreifen, um Schritte in Richtung Neuverhandlung einzuleiten.
13.27
Vorsitzende Abgeordnete Mag. Ulrike Sima|: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Universitätsprofessor Dr. Virt. – Bitte.
13.27
†Univ.-Prof. Dr. Günter Virt (Bioethik-Kommission beim Bundeskanzleramt; Vorstand des Instituts für Moraltheologie der Universität Wien): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrter Herr Vizekanzler! Herr Minister! Sehr geehrte Nationalratsabgeordnete! Meine Damen und Herren! Ich bin von mehreren Seiten eingeladen worden, hier als Ethiker zu sprechen und bedanke mich sehr dafür.
Ich möchte ganz kurz sieben Punkte anführen, obwohl man zu jedem einzelnen Punkt sehr lange reden könnte.
Punkt eins: Aus meiner ethischen Perspektive fährt der Zug mit der Erteilung auf Patente auf lebendige Stoffe weltweit seit langer Zeit in die verkehrte Richtung. Ich habe bereits 1992 hier anlässlich der Enquete zur Vorbereitung des österreichischen Gentechnikgesetzes gesagt – man kann das nachlesen –, dass es wohl besser gewesen wäre, bewährte bereits bestehende Instrumente zum Schutz geistiger Leistungen und innovativer Leistungen auf dem Gebiet lebendiger Stoffe weiterzuentwickeln anstatt eins zu eins ein dem Gegenstand nicht angemessenes Recht zu übernehmen. Aber der Zug fährt international schon.
Punkt zwei: In diesem Kontext ist unter dem enormen Konkurrenzdruck mit den Vereinigten Staaten in der EU nach langem Ringen, Widersprüchen und Änderungen – wir haben darüber gehört – nach zehn Jahren Verhandlungen die Biopatentrichtlinie im Jahre 1998 verabschiedet worden. Dass diese Biopatentrichtlinie nicht das letzte Wort in dieser schwierigen Materie ist und sein kann, zeigt Artikel 16 mit dem Monitoring, der die Auswirkung auf die Menschenrechte, Veröffentlichungen und überhaupt den Bereich der Bio- und Gentechnologie vorsieht. Die langfristig zu befürchtenden negativen Auswirkungen auf die Entwicklungsländer und andere arme Länder, die schon mit Händen zu greifen sind, sind in dieses Monitoring nicht aufgenommen. Daher ist auch dieses Monitoring in der Biopatentrichtlinie unvollständig.
Punkt drei: Angesichts der Notwendigkeit der Umsetzung habe ich als Mitglied der Bioethik-Kommission beim Bundeskanzleramt den Rat mitgetragen – denn mehr als Rat können wir nicht geben –, die Biopatentrichtlinie dennoch umzusetzen, weil sie kein neues Recht schafft. Sie will Rechtssicherheit, Klarstellungen geben und vor allem ethische Grenzen einziehen, die es bislang so in dieser Deutlichkeit nicht gab.
Ich habe gleichzeitig – allerdings als Mitglied der Europäischen Ethikberatergruppe für den Präsidenten und die EU-Kommission in Brüssel – am Dokument Opinion 16 über die Patentierbarkeit von Stammzellen gearbeitet und habe eine dissenting opinion, die ich Ihnen gleich verkürzt vorlesen werde, niedergelegt. Sie finden diese dissenting opinion im Bundeskanzleramt, aber auch als Protokollanmerkung von mir. Sie bezieht sich darauf, dass embryonale Stammzell-Linien von der Patentierbarkeit ausgenommen sein sollen, weil sie notwendig auf der Zerstörung menschlicher Embryonen beruhen. Patente können aber nur erteilt werden, wenn es eine gewerbliche Anwendung gibt. Die Verwendung von menschlichen Embryonen zu kommerziellen Zwecken ist aber in Artikel 6c ausdrücklich von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Zudem würde die Patentierung von embryonalen Stammzell-Linien den Anreiz bedeuten, die Forschung in Richtung verbrauchender Embryonenforschung eindeutig zu machen.
Punkt vier: Der Wunsch der Wissenschaft und Industrie nach Rechtssicherheit und nach einem starken Patentschutz ist auch unter ethischem Aspekt legitim.
Punkt fünf: Probleme entstehen aber, wenn mit dem legitimen Wunsch nach Rechtssicherheit zu breite Patente angestrebt werden; das ist jetzt kein rechtlicher, sondern ein ethischer Punkt. Die Gefahr ist gerade bei lebendigen Stoffen groß, dass auch das, was nicht Gegenstand der Erfindung ist, mitpatentiert wird, dass also zu viel Stoff sozusagen mitgenommen wird. Und das ist die ethische Spannung: auf der einen Seite Rechtssicherheit, auf der anderen Seite der Umstand, dass lebendiger Stoff, der nicht erfunden ist, mitgenommen wird, vor allem Fortpflanzungsfähigkeit. – Ich könnte noch viel dazu sagen.
Punkt sechs: Es ist ethisch nicht zu rechtfertigen, wenn durch überhöhte Patentgebühren nachteilige Folgen für die Gesundheit entstehen, wenn sie also das öffentliche Interesse behindern. Es wurde schon angedeutet – ich entnehme das der deutschen Presse –, dass durch ein neues Patent die Testung von Blutkonserven auf Hepatitis C um das 3 000-Fache gesteigert wurde und dass man nicht weiß, wie diese Mehrkosten zur Testung von Blutspenden aufgebracht werden können.
Die Europäische Ethikberatergruppe hat in dem Dokument Opinion 16, an dem ich mitgearbeitet habe, daher die Erteilung von Zwangslizenzen vorgeschlagen.
Punkt sieben – ich resümiere –: Die Umsetzung der Biopatentrichtlinie kann ich mir nur unter folgenden drei Bedingungen vorstellen:
Erste Bedingung: dass Patente auf lebendige Stoffe nicht zu breit gegeben werden, sondern präzise auf eine konkrete gewerbliche Anwendung, also nicht auf ganze Gene und Gensequenzen, was andere Forscher abschrecken könnte.
Zweite Bedingung: dass Zwangslizenzen ausdrücklich vorgesehen werden, wenn das Gesundheitswesen durch überhöhte Patentgebühren beeinträchtigt wird.
Dritte Einschränkungsbedingung: wenn alle Erfindungen, die menschliche Embryonen zum Gegenstand oder zur Voraussetzung haben, von der Patentierbarkeit ausgeschlossen werden.
Das war tatsächlich eine offene Frage der Interpretation. Die Mehrheit in der Europäischen Ethikberatergruppe hat anderes interpretiert als ich. Das Europäische Patentamt hat sich aber inhaltlich meiner dissenting opinion am 21. Juli ausdrücklich angeschlossen in seiner Entscheidung zur Einschränkung des so genannten Edinburgh-Patents und hat damit auch die Linie für die Zukunft angegeben, dass alle Erfindungen, die Embryonen zum Gegenstand oder zur Voraussetzung haben, in Zukunft nicht patentiert werden sollen.
Ich möchte dieses Dokument gerne dem Protokoll beilegen, wenn ich darf, weil es vom Patentamt sehr schwer erhältlich ist.
13.34
Vorsitzende Abgeordnete Mag. Ulrike Sima|: Als Nächste zu Wort gelangt Frau Dr. Ingrid Schneider. – Bitte.
13.35
Dr. Ingrid Schneider (Forschungsgruppe Medizin/Neurowissenschaften, Universität Hamburg): Sehr geehrter Herr Vizekanzler! Sehr geehrte Minister, Nationalrats- und Bundesratsmitglieder! Ich freue mich sehr, als Politologin in der Technikfolgenabschätzung und als ehemaliges Mitglied der deutschen Bundestags-Enquete-Kommission „Recht und Ethik der modernen Medizin“ heute zu dieser Enquete eingeladen worden zu sein. Wie der bisherige Verlauf gezeigt hat, bleiben die Kontroversen, die diese Richtlinie seit 20 Jahren begleiten, weiterhin virulent.
Es hat sich auch gezeigt, dass die geforderte Klarheit der Richtlinie nicht erreicht wurde. Ich meine aber auch, dass sich seit Verabschiedung der Richtlinie im Jahre 1998 in den letzten fünf Jahren in der Genforschung eine Reihe von Veränderungen abgezeichnet hat und dass es deshalb meines Erachtens anachronistisch wäre, nun die Richtlinie wortlautgetreu umzusetzen, ohne als nationaler Gesetzgeber politischen Kontroll- und Gestaltungswillen im Hinblick auf die veränderten Faktoren und Rahmenbedingungen der Genforschung aufzuzeigen.
Es ist richtig: Forschung braucht Patente, aber es ist eine Frage, wie der Patentschutz für biotechnologische Erfindungen ausgestaltet werden soll. Mittlerweile herrscht in der Wissenschaft, aber auch bei Patentrechtlern und in der Politik, bei Beratungsgremien – diese reichen vom britischen Nuffield Council bis zur australischen Law Reform Commission – eigentlich sehr breite Überreinstimmung darüber, dass die bisher gewährten Genpatente zu breit sind und einer spekulativen Vorratspatentierung Tür und Tor öffnen.
Das heißt, im Umfang ist keine angemessene Balance zwischen dem auf 20 Jahre befristeten Monopol und dem, was die Gesellschaft dafür vom Erfinder an erfinderischer Leistung erhält, hergestellt. Absoluter Stoffschutz auf Genpatente stellt eine Überbelohnung des Erfinders dar, und leider muss man sagen, dass der Bericht der österreichischen Ethikkommission in dieser Hinsicht der Höhe des internationalen Diskussionsstandes nicht gerecht wird.
Lassen Sie mich einige Indikatoren für diese Einschätzung nennen: Seit 1991 ist bekannt, dass der Mensch nur ungefähr 30 000 Gene hat, das heißt nur wenige mehr als ein Fadenwurm, der immerhin schon 20 000 Gene aufweisen kann. Damit wird die schon bekannte Multifunktionalität von Genen noch einmal deutlich unterstrichen.
Eine Gensequenz hat, je nachdem, wie sie im Organismus abgelesen wird, wie sie in das Gefüge von Proteinen, von Zell- und Umweltfaktoren eingebaut ist, ganz unterschiedliche Funktionen, und dem muss im Zuschnitt des Schutzbereiches Rechnung getragen werden.
Außerdem geht man bei Genen davon aus, dass sie eben weniger durch ihre Materialität bestimmt sind, sondern dass sie vor allem Informationsträger sind. Damit unterscheiden sie sich auch von chemischen Stoffen. Diese übliche Parallele, die man zum absoluten Stoffschutz in der Chemie betreibt, ist von daher nicht angemessen, sondern man braucht für Genpatente eine eigene Systematik.
Eine Reihe von Studien weist auch auf Forschungsblockaden durch zu breite Genpatente hin. Das reicht von Publikationsverzögerung über Geheimhaltungspolitik bis hin zur potentiellen Verzerrung von Forschungsergebnissen; das heißt, Abhängigkeitspyramiden bei Patentrechten können die Produktentwicklung beeinträchtigen.
Heute bereits mehrfach genannt wurden einige prägnante Fälle, zum Beispiel das Brustkrebsgen BRCA 1. Gegen diese Patenterteilung gibt es ja einen Einspruch von drei französischen Forschungsinstituten sowie der belgischen und der dänischen Gesellschaft für Humangenetik. Diese Einsprüche zeigen, dass zu breite Genpatente der europäischen Wissenschaft und Industrie schaden, denn die französischen Institute können zwar eigene Gentests anbieten, können dies aber aus patentrechtlichen Gründen nicht leisten, obwohl die eigenen Gentests sowohl wissenschaftlich besser als auch ökonomisch kostengünstiger sind.
Damit verkehrt sich also das, was mit dem Patentrecht eigentlich erzielt werden soll, ins Gegenteil, und das zum Teil groteske Missverhältnis zwischen dem in der Patentschrift Offenbarten und der Reichweite erfordert deshalb korrektive Maßnahmen.
Eine solche Option liegt in der Funktionsbindung des Stoffschutzes. Diese würde mit der bisherigen absoluten Stoffschutzdogmatik des Patentrechts nicht völlig brechen, das heißt, sie wäre patentrechtsimmanent, würde aber zu einer Einschränkung von spekulativen und allzu breiten Stoffschutzpatenten auf DNA führen.
Welche Modelle gibt es für einen solchen funktionsgebundenen Stoffschutz? – Sie sehen auf diesem Schaubild: Bisher erhält ein Erfinder, der eine DNA-Sequenz nennt, aufführt und eine Funktion, also hier Protein A, in der Patentschrift benennt, alle in diesem Beispiel neuen Anwendungen zugeschrieben, obwohl er über Protein B und Protein C nichts weiß. Eine Funktionsbeschränkung läge nun darin, dass ein Erfinder nur die Verwendungen 1 bis 3 von A zugesprochen bekommt – potentiell sind das unendlich viele –, die mit der offenbarten Funktion, nämlich DNA-Sequenz kodiert für Protein A, in Verbindung stehen. Ein Wissenschaftler, der nun Protein B als Kodierung für dieselbe DNA-Sequenz aufweist, würde dann gemäß der Funktionsbindung ein unabhängiges Patent erhalten und könnte so die anderen Anwendungen beanspruchen. Das heißt, mit dieser Funktionsbindung würde eine gerechtere Verteilung stattfinden und wäre auch eine unabhängige Forschung in Bezug auf diese DNA-Sequenzen möglich.
Dasselbe kann man auch noch auf Krankheiten beziehen, denn die Funktion im Sinne einer Proteinkodierung ist ja bei DNA-Sequenzen teilweise gar nicht bekannt, man kennt aber eine Korrelation zu einer bestimmten Krankheit. Am Beispiel Brustkrebs würde das bedeuten, dass die Funktion der DNA-Sequenz „Krankheit Brustkrebs“ in die Patentansprüche aufgenommen würde, und damit könnten alle auf diese Krankheit bezogenen Anwendungen – Diagnose-Test, Gentherapie oder „drug-target“ – beansprucht werden. Bei BRCA 1 weiß man aber inzwischen, dass es auch für Prostatakrebs eine wichtige Rolle spielt, BRCA 2 spielt auch für Bauchspeicheldrüsentumore eine Rolle. Und diese Erkenntnisse verdienen einen eigenen, nicht abhängigen Patentschutz, denn es würde eine Überbelohnung darstellen, würde man dem ersten Patentinhaber alle Krankheiten und alle Erfindungen, die mit dieser DNA-Sequenz korreliert sind, überantworten.
Die Europäische Kommission hat signalisiert, dass sie den Mitgliedstaaten Flexibilität bei der Umsetzung zugesteht und insbesondere den Schutzumfang bei DNA-Sequenzen national unterschiedlich auslegen lässt, dass also in Bezug auf den Stoffschutz eine unterschiedliche Implementierung vorgenommen werden kann.
Die Probleme des absoluten Stoffschutzes sind bekannt und müssen meiner Meinung nach angegangen werden. Es reicht nicht, in dieser Hinsicht auf eine Neuverhandlung der Richtlinien in drei bis fünf Jahren zu warten und die Patentämter weiterhin derart breite Genpatente erteilen zu lassen. Gerade Sie als Parlament sind aufgefordert, zu handeln und eine Funktionsbindung des Stoffschutzes in die nationale Umsetzung der Patentrichtlinie einzuschreiben. Das wäre jedenfalls als substantieller Fortschritt zu bewerten.
13.43
Vorsitzende Abgeordnete Mag. Ulrike Sima|: Als Nächster gelangt Herr Universitätsprofessor Dr. Zatloukal zu Wort. – Bitte.
13.44
Univ.-Prof. Dr. Kurt Zatloukal (Universität Graz; Institut für Pathologie): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Ich möchte Ihnen als an der Universität tätiger Arzt einige Aspekte der Bedeutung von Biopatenten im Bereich der Universitäten, insbesondere der Medizin näher bringen.
Wir in der biomedizinischen Forschung haben das Ziel, neues Wissen über Erkrankungsprozesse zu erarbeiten. Wichtig ist es aber, dass dieses Wissen letzten Endes zu neuen Diagnostika oder neuen Therapeutika führt. Nur: Diesen Schritt kann die Universität nicht tun. Dazu fehlen die Möglichkeiten und die Mittel, es braucht die Interaktion mit der Industrie. Man muss also einen industriellen Partner finden, der bereit ist, dieses Wissen, diese Erfindung weiterzuentwickeln, bis ein Diagnostikum oder ein Medikament zur Verfügung steht.
Und diese Entwicklung ist in manchen Bereichen ein sehr langwieriger Prozess, zum Beispiel in der Onkologie, wo ich tätig bin, geht man davon aus, dass im Durchschnitt mit einer 14-jährigen Entwicklungszeit zu rechnen ist und Entwicklungskosten im Bereich von mehreren 100 Millionen € erforderlich sind. Wenn es also für eine solche Erfindung keinen Patentschutz gibt, ist für den industriellen Partner das Risiko, diese Investition zu tätigen, einfach zu hoch. Deshalb ist es eine sehr wichtige Voraussetzung, dass Erfindungen im universitären Umfeld durch Patente geschützt werden, denn dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass aus dieser Erfindung letzten Endes auch einmal ein Medikament wird, das dann bei den Patienten zur Anwendung kommt.
Somit haben Patente im Umfeld der Universitäten eine doppelte Bedeutung: Einerseits sind sie sozusagen ein wichtiger Faktor dafür, dass das Wissen der Universitäten industriell umgesetzt wird und zur Anwendung am Menschen kommt. Umgekehrt – das wird gerade jetzt, für die neue Rolle der Universitäten sehr wichtig sein – sind sie eine Möglichkeit, wie die Universitäten mit der Industrie kooperieren und durch den Verkauf von Lizenzen an die Industrie ihre eigene Forschung teilweise finanzieren können.
Diesbezüglich gibt es sehr gute Beispiele, wie das erfolgreiche Universitäten in den USA machen. Es ist sicherlich noch sehr viel Arbeit erforderlich, um dieses Know-how auch in Österreich zu etablieren. Und in dieser fehlenden Erfahrung im Umgang mit Patenten sehe ich auch die Erklärung vieler Probleme, die hier zur Sprache gekommen sind. Diese betreffen meiner Ansicht nach weniger Grundsatzprobleme des Patentwesens, sondern eher die Frage: Wie geht man sinnvoll damit um?
Nun: In der Biomedizin geht es nun einmal um Diagnostika und Medikamente. Diagnostika sind Nachweisverfahren von Proteinen, Kohlehydraten, Fetten, aber natürlich auch Nukleinsäuren im Blut oder Gewebe. Die Medikamente interagieren natürlicherweise mit biologischen Strukturen: mit Proteinen, mit Kohlehydraten, mit Fetten. Folglich ist es in diesem Bereich unumgänglich, diese Zellkomponenten auch in ein Patent einzubeziehen. Und aus meiner Sicht wäre es wirklich unlogisch, gerade die Nukleinsäuren, den Bestandteil der DNA, vom Patentschutz auszuklammern beziehungsweise grundsätzlich anders zu behandeln. Wir wissen alle, dass gerade im Umfeld der Forschung an der DNA in nächster Zeit ganz wesentliche Fortschritte für die Medizin zu erwarten sind.
Noch ein Gedanke zu Alternativen: Man muss überlegen: Gibt es bessere Möglichkeiten als den Patentschutz? – Aus meiner Sicht wäre das Szenario, mit dem wir konfrontiert würden, gäbe es keine Patente in diesem Bereich, eigentlich nur die Geheimhaltung. Und diesbezüglich habe ich eine grundsätzlich andere Position als einer meiner Vorreferenten. Für mich sind Patente ein Grundvoraussetzung für die Publikation und dafür, dass Wissen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.
Es gibt dafür auch in Österreich Beispiele: Eines der erfolgreichsten Forschungsinstitute, das hier in Wien lokalisiert ist, hat nicht nur den höchsten Output an Publikationen, sondern auch den höchsten Output an Patenten. Also: Publikation und Patente sind kein Widerspruch, wenn man mit diesem Instrument richtig umgehen kann.
Weitere Konsequenzen wären, dass aufgrund der fehlenden Kommunikation die Interaktion zwischen Universität und Industrie wesentlich schwieriger, die Kommunikation unter den Forschungsgruppen eingeschränkt sein würde. Die Folge davon wiederum wäre, dass die Forschung unkoordiniert wäre, das Rad mehrfach neu erfunden und, als weitere Folge, dass Forschung wesentlich teurer werden würde – für mich kein wirklich sinnvolles Szenario.
All das sind generelle Probleme des Patentwesens, haben eigentlich nichts mit der Biopatentrichtlinie zu tun. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Biopatentrichtlinie kein neues Patentwesen schafft: Es wird nichts patentierbar, was nicht auch nach dem derzeit gültigen österreichischen Patentrecht patentierbar ist, es schafft nur eine gewisse europäische Harmonisierung; aber gerade diese Harmonisierung würde es den Universitäten deutlich erleichtern, sich mit dem internationalen Patentrecht besser zurechtzufinden.
13.48
Vorsitzende Abgeordnete Mag. Ulrike Sima|: Als Nächster gelangt Herr Dr. Josef Hoppichler zu Wort. – Bitte.
13.49
Dr. Josef Hoppichler (Bundesanstalt für Bergbauernfragen, Wien): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Politikerinnen und Politiker! Liebe Damen und Herren! Ich möchte zu Beginn kurz auf etwas eingehen, das mir bei meinen Vorrednern, aber auch bei Politikerinnen und Politikern besonders aufgefallen ist: Anscheinend wird da etwas in Bezug auf die Frage, wen die Biopatentrichtlinie schützt, verwechselt. Ich hoffe, Ihnen ist allen bewusst, dass die Biopatentrichtlinie die Patentinhaber schützt – und nicht die Firmen! Das ist ein haushoher Unterschied.
Ich war im österreichischen und auch im Europäischen Patentamt und habe mir die Patente genau angeschaut. Das, was mich interessiert hat und was ich mir gemerkt habe, waren die Firmen, die sie angemeldet haben. Es tut mir Leid, aber die Forscher, die dahinter gestanden sind, habe ich sämtliche vergessen. In diesem Zusammenhang sieht man nun, wen diese Biopatentrichtlinie vorwiegend schützt.
Ich habe versucht, das Problematische dieser EU-Biopatentrichtlinie in einem Satz zusammenzufassen: Diese Richtlinie schränkt die Patentausschließungsgründe derart ein, dass sich im Endeffekt ein weitgehend neues – also nicht absolut neues, aber doch weitgehend neues, Kollege Zacherl – Patentrecht ergibt, bei dem die traditionellen Verbote in vielen Bereichen aufgehoben werden und der bisher auf ethischen Grundsätzen bestehende Rahmen weitgehend ausgehöhlt wird.
Ich erinnere in diesem Zusammenhang nur daran, dass ein Jahr nach dem Beschluss der EU-Biopatentrichtlinie die Parlamentarische Versammlung des Europarates eine eindeutige Empfehlung abgegeben hat, was sie geändert haben möchte beziehungsweise was sie nicht patentiert haben möchte. Ich empfehle jedem, all das genau nachzulesen.
Ich zitiere deshalb den Europarat – man könnte ja noch viele andere zitieren –, weil das aufzeigt, dass man sich im erweiterten europäischen Rahmen und im europäischen Kontext sehr wohl dessen bewusst ist, dass die vorliegende Richtlinie in wesentlichen Aspekten ethische Grundsätze verletzt und dass dies zu einer Revision dieser Richtlinie Anlass geben sollte. Ich wollte jetzt nicht auf die parlamentarischen Beratungen zu Chancen und Risken des österreichischen Gentechnikgesetzes, die vor zehn Jahren stattgefunden haben, eingehen, aber damals haben sich die politischen Parteien in Österreich sehr konsensual auf ethische Grundsätze verständigt.
Nun können Sie zwar sagen: Wir sind halt gescheiter geworden!, und so weiter. Ich möchte jedoch betonen, dass für mich – nicht nur als Mensch! – ethische Grundsätze nicht eine flüchtige Tochter der Zeit sind oder Dinge, die man nur mehr in Ethikkommissionen diskutieren soll – auch das habe ich hier gehört. Nicht dass ich Ihre Beiträge, Professor Huber, gering schätze, ich halte sie für wichtig, aber für bei weitem nicht ausreichend, denn die ethische Diskussion müssen wir hier führen, in der Öffentlichkeit! Und Ethik ist dann letztlich auch die konkrete Entscheidung.
In diesem Zusammenhang möchte ich noch etwas einbringen: Es tut mir Leid, aber ich kann diese Richtlinie in ethischen Fragen, in Wertfragen nicht mehr an meine Kinder kommunizieren – ich kann es nicht! –, und ich kann sie auch nicht mehr an meinen Vater kommunizieren, der aus der Landwirtschaft kommt. Er wird mich nicht mehr verstehen, und, leider, es verstehen mich auch meine Kinder nicht mehr. Es gibt diesbezüglich einen wissenschaftlichen Ausdruck, den Christine von Weizsäcker geprägt hat: die Überschreitung der kritischen Innovationsgeschwindigkeit.
Genau das ist mir hier aufgefallen. Professor Huber hat an die Politikerinnen und Politiker gerichtet gesagt: Alle zwei Jahre werden Sie etwas ändern müssen! – Er wird nicht Unrecht haben, aber die politische Sphäre, die soziale Sphäre, die menschliche Sphäre einerseits und die technologische Sphäre andererseits sind auseinander gefallen. Und in diesem Sinne, also auch als Experte, möchte ich Sie als Politiker ersuchen, doch nicht immer nur auf die technische Sphäre zu achten! Dort liegt zwar das Geld, aber es geht auch um eine soziale, um eine politische und um eine menschliche Sphäre. Ich appelliere an Sie, sozusagen die humanistische Dimension des menschlichen Maßes nicht zu verlieren.
Ich bin Agrarier, ich wollte noch etwas zur Patentierung von Pflanzen und Tieren, zur Monopolisierung der gesamten Agrarwirtschaft und letztlich zur Gefährdung der Ernährungssicherheit durch Monopole sagen. (Der Redner hält ein Buch in die Höhe.) Das habe ich nicht selber entdeckt, die österreichische Bischofskonferenz, der ich dafür sehr dankbar bin, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es internationale Literatur zu Biopatenten und der Gefährdung der Ernährungssicherheit gibt und dass sich auch christliche NGOs weltweit mit dieser ganzen Problematik auseinander setzen.
Ich will nun überhaupt keine Empfehlungen abgeben wie Ethiker und Kommissionen hier im Saal, aber ich persönlich halte diese Richtlinie für sachlich nicht gerechtfertigt, sachlich viel zu weit gehend, ethisch bedenklich und politisch und sozial extrem diskussionswürdig.
13.55
Vorsitzende Abgeordnete Mag. Ulrike Sima|: Als Letzter aus der Expertenrunde gelangt Herr Dr. Daniel Alge zu Wort. – Bitte.
13.55
Dr. Daniel Alge (Sonn & Partner, Wien): Der primäre Zweck der Richtlinie war – und ist es auch noch immer –, Rechtssicherheit zu schaffen, und zwar im gesamten EU-Raum. Die Richtlinie ist in der vorliegenden Form aus patentrechtlicher Sicht – und als Patentanwalt bin ich natürlich nur fähig, patentrechtlich etwas auszusagen – sicherlich kein großer Wurf, aber er schreibt die Rechtsprechung des Europäischen Patentamtes der letzten 25 Jahre fest, und zwar zwingend für alle EU-Staaten. Das hat zur Folge, dass man genau darüber Bescheid weiß, dass, wenn ein europäisches Patent im Zuge auch von Einspruchs- und Beschwerdeverfahren einmal unter diesen Gesichtspunkten erteilt worden ist, es dann nicht auf einmal in irgendeinem Staat der Europäischen Union aus nicht patentrechtlichen Gründen oder Gründen, die nicht im Patentgesetz oder auch in der Richtlinie enthalten sind, widerrufen wird. Das schafft natürlich Rechtssicherheit.
Das Patentrecht gibt natürlich nur ein negatives Ausschlussrecht, kein positives Nutzungsrecht, und die Biopatentrichtlinie ändert auch nicht das Patentgesetz. Medizinische Verfahren, therapeutische Verfahren werden durch diese Richtlinie nicht patentgeschützt. Sie waren vorher nicht patentierbar und sind auch nachher nicht patentierbar. Es werden jetzt auch keine jahrhundertealten indischen Traditionen patentrechtlich schützbar. Wenn es diese jahrhundertealte Tradition in Indien gegeben hat und nun ein Patent darauf erteilt worden ist, dann ist das Patent potentiell nichtig, weil es nicht mehr neu war. Es erfüllt das Patentierbarkeitskriterium der Neuheit nicht und wird daher widerrufen.
Gleiches gilt für das heute zigmal präsentierte Brustkrebsgen-Patent der Firma Myriad. Es stimmt, dieses Patent wurde erteilt. Es stimmt auch, dass dieses Patent in der erteilten Fassung nicht überleben wird. Es gibt die Einsprüche dieser französischen Firmen, die sehr gut sind und dieses Patent zu Fall bringen, und zwar nicht aufgrund ethischer Abstrakta oder menschlicher beziehungsweise grundrechtlicher Erwägungen, sondern aufgrund patentrechtlicher Erwägungen, die seit 150, 200 Jahren etabliert sind und einen solchen Selbstschutz, eine solche Selbstregulierung haben, dass sie sich eben in diesen 150 bis 200 Jahren bewährt haben. Das BRCA 1-Patent wird entweder ganz widerrufen oder nur in einem bestimmten Ausmaß übrig bleiben.
Gleiches gilt für das HCV-Patent der Firma Chiron. Auch dieses ist zunächst breit erteilt worden, dann aber auf ein minimales, auf den diagnostischen Aspekt bezogenes Patent eingeschränkt worden, eben durch Anwendung normaler patentrechtlicher Grundsätze.
Ausreichende Offenbarung. Wenn Sie breite Ansprüche auf diese Vielzahl von Anwendungen und auf die Vielzahl von Modifikationen Ihrer Erfindung haben wollen, müssen Sie dafür in Ihrem Patent dem Fachmann die Offenbarung geben, das heißt, Sie müssen als Patentinhaber diese Erfahrung und dieses Wissen selbst haben, damit Sie diese Offenbarung auch in die Patentschrift hineinnehmen können, um so diesen Schutz zu erhalten. Wenn Sie dies nicht tun, laufen Sie Gefahr, dass Ihr Patent aufgrund ganz normaler patentrechtlicher Erwägungen entweder stark reduziert oder aber ganz widerrufen wird.
Zum Stoffschutz. Den anwendungsorientierten Stoffschutz können Sie bereits jetzt haben, wenn Sie nur einen Verwendungsanspruch auf irgendeine bestimmte Substanz haben. Wenn aber jemand eine Substanz erstmals zur Verfügung stellt und dafür einen hohen Forschungsaufwand getrieben hat, dann ist es in der mittlerweile 40-jährigen Tradition des Stoffschutzes Konvention, dass derjenige, der als Erster einen Stoff aufgefunden, eine chemische Substanz wie beispielsweise Insulin isoliert hat, ein Recht auf diese Substanz selbst erhält. Sollte jemand eine neue Anwendung dafür finden, so ist es ja nicht so, dass dieser kein Patent dafür erhält, sondern er bekommt das Patent auf die Anwendung und kann seinerseits, falls der erste Patentinhaber versucht, diese weitere Diagnose oder weitere Verwendung auch zu vermarkten, von diesem Lizenzgebühren verlangen.
Das österreichische Patentamt entscheidet ebenso wie das Europäische Patentamt ohnehin seit mehr als zehn, 15 Jahren richtlinienkonform. Wir haben in Österreich nicht die Probleme mit Rechtsunsicherheit, was Investoren anbelangt. Würde aber diese Richtlinie nicht umgesetzt, hätte dies wahrscheinlich negative Folgen für den Biotechnologie-Standort Österreich. Es sind nämlich private Firmen oder Investoren, die hier Geld investieren, und diese wollen natürlich auch einen Gewinn haben, das ist ganz klar! Sie würden sich fragen, ob diese Ablehnung nicht auch eine Umkehr der Patentierungspraxis zur Folge haben und ihr Investment gefährden könnte.
Ich bin für eine ganze Reihe von größeren und auch kleineren Biotechnologiefirmen tätig und kann aus meiner Erfahrung versichern, dass für die Investoren die Position einer Firma im Hinblick auf ihre Patente einer der wichtigsten Punkte bei der Entscheidung über ihr Investment darstellt, und nur dieses Investment schafft Arbeitsplätze und ermöglicht den Weg der Erfindung von der Idee zum Markt. Die Idee ist noch nicht die Innovation; davon kann man erst dann sprechen, wenn diese Erfindung für den Markt entwickelt worden ist.
Solch ein Investment sollte dann nicht daran scheitern, dass Österreich seiner Verpflichtung zur Umsetzung der Biotechnologierichtlinie nicht nachgekommen ist.
14.00
Vorsitzende Abgeordnete Mag. Ulrike Sima|: Frau Stenzel ist sozusagen die Erste in der Politiker-Runde.
14.01
†Ursula Schweiger-Stenzel (ÖVP, Mitglied des Europäischen Parlaments): Frau Vorsitzende! Verehrte Damen und Herren! Die Biopatentrichtlinie hat zu einer der umstrittensten Materien im Europäischen Parlament gezählt – das wurde hier schon gesagt. Pro und Kontra gingen wirklich quer durch die Fraktionen. Daher kam es zu dem außergewöhnlichen Fall, dass das Ergebnis eines Vermittlungsausschusses in dritter Lesung abgelehnt wurde. Daraufhin hat die Kommission aber ihren ursprünglichen Vorschlag korrigiert. Dieser korrigierte Vorschlag ist in die neue Richtlinie gemündet, und diese neue Richtlinie hat natürlich schon viele Bedenken berücksichtigt: die Unversehrtheit, den Schutz vor Eingriffen in die Keimbahn; all diese Dinge sind hier berücksichtigt.
Man muss davon ausgehen, dass wir nun ein Verfahren zu gewärtigen haben, das auch Österreich schaden kann. Ich bin daher ein Befürworter dessen, dass man diese Richtlinie nun umsetzt – obwohl ich an diesen sehr emotionalen Debatten auch zum Teil teilgenommen habe –, nicht nur, weil wir säumig sind, sondern weil vielen Bedenken bereits Rechnung getragen wurde und weil auch Spielraum für politische Gestaltungsfähigkeit seitens des österreichischen Gesetzgebers besteht.
Ich bin auch noch aus einem anderen Grund dafür, diese Richtlinie umzusetzen: Ich habe in meinem persönlichen Bekanntenkreis einen jungen Wissenschaftler, der sich in einer biotechnologischen Grenzdisziplin hochgearbeitet hat, der sich mit mühsamen Stipendien zum Teil in der Schweiz und dann in Amerika seine Lorbeeren verdient hat, der durchgekommen ist und der nun kaum eine Möglichkeit hat, hier Arbeit zu finden, aber an der Universität in Zürich eine entsprechende Forschungsmöglichkeit gefunden hat. (Abg. Dipl.-Ing. Hofmann übernimmt den Vorsitz.)
Das heißt, wir brauchen in Österreich, um den Forschungsstandort zu gewährleisten, dringend diesen Patentschutz und die Umsetzung der Biopatentrichtlinie.
Ich halte es für absolut negativ für die Entwicklung nicht nur für den Wirtschaftsstandort, sondern vor allem auch für den Forschungsstandort eines Landes, wenn junge Wissenschaftler faktisch ins wissenschaftliche Exil getrieben werden, weil sie hier keine Möglichkeit finden, weil sich Forschung einfach nicht mehr rentiert, weil hier viele Möglichkeiten abgeschnitten werden.
Der Gesetzgeber sollte auch diese Beweggründe in Rechnung stellen, mit einkalkulieren – natürlich auch die ethischen. Aber es geht auch darum, dass Nichthandeln auch nicht-ethisch sein kann. Viele Kranke, die leiden, bedürfen einer sehr teuren Forschung, und diese teure Forschung kann nur durch einen entsprechenden Patentschutz gewährleistet werden. Auch in diesem Sinne bin ich eine Befürworterin, bin ich dafür, dass man hier nicht nur verzögert. Man soll alles bedenken, aber ein Gewissen haben nicht nur die einen oder die anderen, sondern Gewissensentscheidungen haben wir alle zu treffen.
Wir von der ÖVP-Delegation haben uns im Europäischen Parlament diese Gewissensentscheidung nicht leicht gemacht. Ich meine, es gilt jetzt, in Österreich den politischen Rahmen zu setzen, einen Rahmen, der den ethischen Grundsätzen entspricht, wie die Bioethik-Kommission in Österreich bescheinigt, und der auch den wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Notwendigkeiten Rechnung trägt.
14.05
14.05
Abgeordneter Dr. Kurt Grünewald (Grüne): Sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben gehört, dass Ethik kompliziert ist: die Bischofskonferenz hat eine Meinung, die Bioethik-Kommission beim Bundeskanzleramt hat eine andere Meinung. Wir müssen deswegen aber nicht in Panik und Entsetzen verfallen, auch die Molekularbiologie ist kompliziert.
Eine Münze hat auch zwei Seiten – Sie wissen, es gibt noch keine Münze, die auf der einen Seite schwarz und auf der anderen weiß ist –, und so möchte ich auch mein Statement aufbauen: Ich glaube, dass diese Biopatentrichtlinie der EU unbefriedigend ist. Ich stehe aber nicht an zu sagen, dass der Ist-Zustand zumindest ebenso unbefriedigend ist.
Was tun? – Hinnehmen oder etwas verändern. Das Wort „verändern“ ist heute schon gefallen, und ich möchte hier einige Kritikpunkte anmelden, die aber auch für den Ist-Zustand gelten.
Vorweg etwas, das ich loswerden muss, weil ich mich manchmal darüber ärgere: Ich würde wirklich herzlich ersuchen, den menschlichen Körper nicht mit Abschnitten einer Gensequenz zu verwechseln. Für mich ist ein Körper schon mehr als die Aneinanderfolge von zehn Molekülen, und da sollten wir ein bisschen präziser und ethischer bleiben.
Was mich irritiert: dass im Vorspann der Erläuterungen zur Biopatentrichtlinie schon ein sehr fokussierter Blickwinkel auf Innovation, Binnenmarkt, Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum, Handel gegeben wird, ohne andere Bereiche intensiver zu beleuchten. Trotzdem, muss man sagen, ist in diesem Vorspann der so genannten Erwägungen oder Erläuterungen einiges enthalten, das den Ist-Zustand verbessern würde: kritisch ablehnende Stellungnahmen, Klonen, Keimbahneingriffe, Embryonenschutz, der bei uns jetzt gar nicht so gut ist, wie viele glauben, sondern man ist erst durch die Diskussion mit der Nase darauf gestoßen worden, welche Unklarheiten und Bedürfnisse es noch gibt.
Trotzdem sind diese Erläuterungen immer noch präziser und klarer – ich würde auch sagen: umfassender, ethischer – als die Artikel selbst, die mir in vielen Dingen schon etwas vage erscheinen, und zwar so vage, dass Interpretationsspielraum besteht. Den Interpretationsspielraum – wenn ich da nur höre: Industrie, Handel, Wettbewerb, Binnenmarkt – werden jene nutzen, die die größte Lobby haben und die größte Macht. Ob das dann immer die richtigen Interpretationen sind, weiß ich nicht, aber ich stelle es zumindest in Frage.
Was noch irritierend ist: dass der Gen-Begriff sehr eng gefasst wurde – unsere beiden Expertinnen haben das auch erwähnt. Mir kommt das so vor, als würde jemand sagen: Ich möchte ein Patent auf das ABC, und auch wenn ich nur ein Buch geschrieben habe mit dem ABC, möchte ich das Patent auf die ganze Bibliothek. – Das kann es nicht sein, denn da fehlt der Grips und, wenn Sie wollen, auch das TRIPS. Ich kann etwas erfinden, aber völlig im Unklaren sein über andere Einsatzgebiete. Und ein Gen unterliegt ja Hunderten von Steuerungsmöglichkeiten.
Nur ein Beispiel: Es gibt Zehntausende von Stoffen, auf die wir allergisch reagieren. Dagegen kämpfen die körpereigenen Immunabwehrstoffe, die Antikörper. Diese sind auf zwei, drei Genen lokalisiert, erzeugen aber Zehntausende von Antikörpern. Und darauf hat niemand ein Patent und soll es meiner Meinung nach auch nicht haben.
Das heißt, wir sollten schon mit den Gen-Begriffen verknüpfen, dass deren Anwendung auch auf eine bestimmte, und zwar wirklich nachvollziehbar bewiesene Funktion festgeschrieben wird. Und da habe ich so meine Bedenken.
Eine weitere Frage ist: Welches Patentamt hat den Grips oder das TRIPS, das zu beurteilen? – Ich glaube, dass man vielfach durch Modellrechnungen, Wahrscheinlichkeitsrechnungen im Vergleich mit anderen biologischen Systemen wahrscheinliche Einsatzgebiete und Funktionen extrapolieren kann. Aber dann darauf ein Patent zu bekommen und solch ein Terrain zu okkupieren, das für andere nur noch schwer zu erkaufen oder zu besetzen ist, halte ich auch für problematisch.
Was die KMUs und die österreichische Wirtschaft anlangt, haben Sie schon Recht, aber auch diese Medaille hat zwei Seiten: Ich glaube, dass in diesem Kampf um Patente nicht immer die hellsten Köpfe den Sieg davontragen, sondern jene, die am schnellsten sind, die über das Kapital verfügen, die besten Roboter einzusetzen – natürlich muss man da auch denken, ich möchte da niemanden beleidigen, das ist unverzichtbar. Aber da hat Österreich Nachholbedarf.
Wenn jetzt geklagt wird, dass wir nachhinken, dann hätte ich auch ganz gern gehört: Wir brauchen mehr Ressourcen für Forschung und Wissenschaft, sonst wird es Patente, wie auch immer sie geregelt werden, nicht geben.
Ganz kurz zur Bioethik-Konvention: Sie hat ihre Pro-Seite sauber dargestellt, umfassend, aber vorwiegend eine Seite beleuchtet – und das etwas salopp. Ich komme nicht umhin: Wenn da als Beispiel drinsteht, Erythropoietin – das ist eine Substanz, die das Wachstum von roten Blutkörperchen anregt – dient zur Behandlung der Niereninsuffizienz, muss ich sagen: Medizinisch ist das Unsinn!
Daher wäre ich skeptisch bei solchen Eiligkeiten, und wenn man da nicht genauer ist, werden wir nicht weit kommen. Sonst schließe ich mich weitestgehend der Meinung unserer Expertinnen an, die ich ganz gern bitten würde, zu meinen Fragen beziehungsweise Thesen kurz Stellung zu nehmen.
14.12
14.12
Abgeordnete Dipl.-Ing. Elke Achleitner| (Freiheitliche): Herr Vizekanzler! Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Die EU-Kommission hat klar zum Ausdruck gebracht, auf Anfragen und sogar auf eine Klage von den Niederlanden und eine Anfrage von Luxemburg, dass Neuverhandlungen der Richtlinien nicht mehr in Frage kommen. Daher bin ich der Meinung, dass es gerade auf Grund des Wildwuchses, der zurzeit herrschen kann – es können ja jetzt biotechnische Patente jederzeit angemeldet werden –, um diesem möglichst schnell entgegenzuwirken, keine Verzögerung der Umsetzung der Biopatentrichtlinie mehr geben darf.
Es ist sicher auch im Hinblick auf die Forschung wichtig – Österreich hat sich für das Jahr 2006 eine Forschungs- und Entwicklungsquote von 2,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes zum Ziel gesetzt –, dass hier insbesondere auch für die kleinen Firmen so schnell als möglich Rechtssicherheit geschaffen wird, um die wirtschaftsnahe Forschung von 58 Prozent auf die internationale Norm von 66 Prozent steigern zu können.
Wie wir heute schon öfters von den Experten gehört haben, stellt die neue Biopatentrichtlinie kein neues Patentrecht dar. Es gibt sogar die Möglichkeit, die Verbotslisten zur Rechtssicherheit zu erweitern.
Es ist sicher notwendig, dass die Maßnahmen des Mentoring und, wie Vizekanzler Haupt schon angesprochen hat, der Schutz von bestimmten Personenkreisen ganz besonders ins Auge gefasst werden. Ich bin sicher eine Befürworterin dessen, dass diese Maßnahmen berücksichtigt werden.
14.14
Vorsitzender Abgeordneter Dipl.-Ing. Maximilian Hofmann: Nächste Rednerin: Frau Bundesrätin Kerschbaum. – Bitte.
14.14
Bundesrätin Elisabeth Kerschbaum (Grüne, Niederösterreich): Sehr geehrte Damen und Herren! Ich kann mich den Ausführungen meiner Vorrednerin teilweise anschließen und auch jenen des Herrn Vizekanzlers Haupt, wenn er meint, dass betreffend den Persönlichkeitsschutz sicher noch Vorkehrungen getroffen werden müssen, bevor man diese Richtlinie in Österreich umsetzt.
Allgemein möchte ich noch sagen: Diese Richtlinie wurde im Europäischen Parlament im Jahr 1998 behandelt. Ich habe heute ein paar Mal gehört, wie schnell alles vor sich geht, wie rasch die Entwicklung ist, wie schnell wir neues Wissen erlangen. Es erscheint mir daher ziemlich unsinnig, jetzt diese doch etwas veraltete Richtlinie – sie ist schon fünf Jahre alt – genau in dieser Form umzusetzen beziehungsweise zu sagen, dass wir keine neuen Verhandlungen auf EU-Ebene mehr brauchen. Ich denke, da muss auf jeden Fall – und das ist nur logisch – neu verhandelt werden.
Ob wir das jetzt national umsetzen können oder nicht, ist für mich schon auch abhängig von den nationalen Spielräumen, die wir weiter in dieser Richtlinie haben. Dazu habe ich ein paar Fragen an die ExpertInnen, insbesondere an Frau Dr. Godt und Frau Dr. Schneider: Wie groß sind da die nationalen Spielräume, wie weit lässt die Richtlinie in diesem Bereich noch etwas offen? Wie weit sind absolute Stoffschutzpatente richtlinienkonform auszuschließen? Wäre ein funktionsgebundener Stoffschutz überhaupt richtlinienkonform, ist das möglich? Wie würde die EU-Kommission auf solch einen nationalen Spielraum reagieren? Was passiert, wenn der Stoffschutz national enger gesetzt wird als in der Richtlinie? Welche Rolle können die nationalen Parlamente in diesem Fragenbereich noch spielen?
Ich denke, die Umsetzung der Richtlinie in Österreich ist wirklich abhängig davon, inwieweit für diese nationalen Spielräume Platz ist und inwieweit hier noch ein Kompromiss möglich ist, um all jene Einwendungen, die wir heute gehört haben, unterzubringen.
14.16
14.17
Universitätsdozent Dr. Peter Weish| (Initiatoren des Gentechnik-Volksbegehrens): Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich vertrete das Gentechnik-Volksbegehren, das mehr als 1,2 Millionen Menschen dieses Landes unterstützt haben. Und die dritte Forderung dieses Volksbegehrens lautete: kein Patent auf Leben.
In der Vorbereitungsphase dieses Volksbegehrens hörten wir von VertreterInnen verschiedener Parteien, zum Beispiel der ÖVP: Wir sind bei der dritten Forderung ganz bei euch, die ist ja geradezu selbstverständlich! Wir als christliche Partei fühlen uns da verpflichtet, genau diese Position einzunehmen!
Bei der Behandlung der Forderungen im parlamentarischen Ausschuss wurde dann klar, dass in den USA die klare Trennung zwischen Entdeckungen und Erfindungen schon überschritten ist, Grenzen verwischt wurden. Und dieser normativen Macht des Faktischen hat sich dann die ÖVP gebeugt – damals nicht die FPÖ.
Wir meinen, dass man doch wieder zu dieser klaren Grenzziehung zwischen Entdeckung und Erfindung zurückkommen muss. Ich kann Gensequenzen nicht erfinden, ich kann sie nur entdecken. Und all das, was in den bisherigen Diskussionen hier an Problemen, an schwer lösbaren, unlösbaren Problemen aufgetaucht ist, geht auf diese Grenzüberschreitung zurück, darauf, dass wir diese klare Grenzlinie verlassen haben.
Daher mein Plädoyer: Gehen wir zurück! Diese Grenzüberschreitung ist Gott sei Dank ganz leicht revidierbar. Wenn alle Fehler, die die Menschheit gemacht hat, so leicht zu revidieren wären wie dieser, dann hätten wir keine gravierenden Umwelt- und Sozialprobleme.
Mit anderen Worten: Wir sollten klar feststellen, dass wir zwischen Entdeckung und Erfindung unterscheiden müssen.
Zur Stellungnahme der Bioethik-Kommission, sie sei dafür, dass man diese Richtlinie umsetzt, weil damit eine klare Grenzziehung getroffen würde: Das kann ich nicht nachvollziehen.
Die klare Grenzziehung heißt offenbar, dass man sagt, Teile des menschlichen Körpers und Gene und Gensequenzen sind nicht patentierbar. Was heißt das? Bei nicht-menschlichen Lebewesen schon?
Und jetzt taucht eine Frage auf, die bisher noch nicht gestellt worden ist, nämlich: Wie schaut es denn aus mit der Verwandtschaft des Menschen zu seinen nächsten Verwandten? Wir wissen heute – das ist auch eine relativ neue Erkenntnis –, dass wir mit unseren nächsten Verwandten, den Schimpansen, mehr als 98 Prozent der genetischen Information teilen. Der Schimpanse ist nach unserer Einteilung ein Tier, also wären 98 Prozent des genetischen Materials des Menschen patentierbar in irgendeinem Zusammenhang mit Stoffpatenten, wenn man sie quasi dem Schimpansen zuschreibt.
Also von einer klaren Grenzsetzung ist überhaupt keine Rede! Daher meine ich, wir müssen diese Fehlentwicklung – Professor Virt hat schon gesagt, der Zug läuft seit langer Zeit in die falsche Richtung – eigentlich korrigieren. Das ist mein klarer Schluss daraus.
Zu dem Vorwurf, dass es fortschrittshemmend sei, wenn man dafür eintritt – was ich auch tue –, dass die Biopatentrichtlinie neu verhandelt wird, dass wir sie so nicht umsetzen, sondern neu verhandeln, muss ich sagen: Ich halte das für eine völlig daneben gehende Argumentation, denn ich halte eine solche Vorgangsweise für fortschrittsichernd, nämlich im Sinne eines Fortschritts, der nicht mehr Schaden als Nutzen produziert. Wir müssen also einen Fortschritt finden, der negative Probleme von vornherein zu vermeiden sucht.
14.22
14.22
Dr. Peter Mateyka (Baxter AG; Industriellenvereinigung): Herr Vorsitzender! Sehr geehrter Herr Vizekanzler! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Erlauben Sie mir, dass ich als Vorstand der Baxter AG ein bisschen aus der Praxis über Biotechnologie spreche. Ich darf Sie daran erinnern, dass wir in Österreich in der Biotechnologie eine große Historie haben, denn die Erfolge der Firma Immuno – eine Gründung aus dem Jahr 1953 – sind allgemein bekannt. Sandoz ist 1948 gegründet worden. Das heißt, wir haben eine große Historie und haben für die Biotechnologie in Österreich auch einen großartigen Standort geschaffen. Landeshauptleute haben das attestiert, indem sie Biotech-Cluster geschaffen haben. Es ist also an der Zeit, dass wir das auch gesetzlich umsetzen, was wir tatsächlich haben wollen, sonst hätte man ja in diese Biotech-Cluster in Wien, Krems und Tirol nicht investiert.
Ich habe hier eine Definition aufgeschrieben, möchte sie aber nicht erläutern, weil das ja ohnedies bereits diskutiert wurde. Wir reden hier über die Biopatentrichtlinie, vermischt mit dem Gentechnikgesetz. Herr Vizekanzler! Ich hatte ja Gelegenheit, mit Ihnen in Alpbach darüber zu sprechen. Viele der Dinge, die Sie angesprochen haben, sind im Arzneimittelgesetz, in der klinischen Prüfung bereits geregelt. Wir haben einen besonderen Schutz für diese Probanden, für diese Patienten, die hier behandelt werden.
Als Mediziner möchte ich Ihnen sagen, dass es eine große Chance ist. Was hier nicht außer Acht gelassen werden darf, ist die Tatsache, dass die Biotechnologie die größte Chance für die Patienten und die Industrie darstellt. Wir haben in Alpbach darüber gesprochen, wie unsere Sozialsysteme zu festigen und zu verbessern sind. Biotechnologie ist eine innovative Form der Industrie, eine grüne Industrie, wenn Sie so wollen, und hat wirklich Zukunftschancen. Wir brauchen Vollbeschäftigung, wir brauchen Investitionen. 1,8 Prozent sind nicht genug, wir brauchen höhere Investitionen. Und wenn wir Wachstum haben, dann haben wir auch kein Problem mit Pensionen oder dem Gesundheitssystem.
Der Patient muss im Vordergrund bleiben! Wir können heute nicht heilen. Mit biotechnologischen Verfahren werden wir heilen können, und dann wird die Medizin billig. Solange wir chronisch kranke Patienten haben, ist die Medizin teuer. Wenn wir durch biotechnologische Verfahren heilen können, dann wird die Medizin billiger.
Wir haben erst kürzlich ein Präparat für die Hämophilie auf den Markt gebracht, und wir haben die Sicherheit, dass es keine Infektionen mehr geben wird. Es ist das erste Präparat, das rekombinant hergestellt wurde und das dem Patienten zugute kommen wird.
Lassen Sie mich dazu sagen, dass die Infrastruktur, die zur Verfügung gestellt wurde, auch genützt werden muss. Daher brauchen wir eine Patentsicherheit. Baxter hat kein Problem – die kleinen Firmen haben ein Problem, die können den Standort nicht wechseln. Wir können jederzeit sagen: Österreich ist nicht gut genug, wir gehen nach Singapur oder sonst wohin. Die kleinen Firmen brauchen diese Investitionen und das Venture-Capital, das hier hereinfließen soll. Das ist ganz wichtig für die Zukunft der österreichischen Unternehmen und des österreichischen Standortes.
Lassen Sie mich dazu ein paar Zahlen nennen. – Wir haben derzeit 6 500 Beschäftigte. Weltweit gibt es 300 000 Beschäftigte in der Biotechnologie. Es werden 2010 ungefähr 1,2 Millionen Beschäftigte in diesem Bereich erwartet; Österreich könnte 10 000 haben. Es liegt jetzt an Ihnen zu sagen: Sichern wir diesen Standort ab – oder sichern wir ihn nicht ab. Wir brauchen hier eine Rechtssicherheit. Wir haben im Gentechnikgesetz, ganz egal, ob Sie sagen, es ist gut oder schlecht, eine gewisse Rechtssicherheit geschaffen, und wir brauchen auch in diesem Bereich eine gewisse Rechtssicherheit, die Investoren ermutigt, in Österreich zu investieren.
Wenn wir Biotech-Cluster haben, ist das nicht genug. Wir brauchen auch die Rechtssicherheit, dass die Forschungen, die daraus resultieren, für die Firmen verwertbar sind. Dann werden wir auch die nötigen Investitionen bekommen.
14.27
Vorsitzender Abgeordneter Dipl.-Ing. Maximilian Hofmann: Nächster Redner: Herr Professor Glössl, bitte.
14.27
O. Univ.-Prof. Dr. Josef Glössl (Österreichische Gesellschaft für Genetik und Gentechnik): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrter Herr Minister! Sehr geehrter Herr Vizekanzler! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich darf hier für die Österreichische Gesellschaft für Genetik und Gentechnik die Position klarlegen.
Diese Gesellschaft vertritt die in Österreich arbeitenden Wissenschaftler auf dem Gebiet der Genetik und Gentechnik, der Molekularbiologie und verwandter Gebiete der Biowissenschaften. Wir sind der Überzeugung, dass die Grenze zwischen Entdeckung und Erfindung durch diese Biopatentrichtlinie nicht verschoben wird. Das bloße Auffinden von biologischem Material ohne Angabe einer gewerblichen Anwendbarkeit stellt weiterhin eine nicht patentierbare Entdeckung dar. Wir bekommen durch diese Biopatentrichtlinie also kein neues Patentrecht.
Ich möchte meine Ausführungen in insgesamt sechs Punkte gliedern:
Der zweite Punkt nach dieser ersten Klarstellung ist die Frage: Patente auf Gensequenzen – welche Konsequenzen hat das? Als eine zusätzliche, über das allgemeine Patentrecht hinausgehende Hürde für die Patentierung einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens verlangt die Biopatentrichtlinie jedoch, dass bereits im ersten Text der Patentanmeldung die gewerbliche Anwendbarkeit konkret beschrieben wird. Das heißt also, es muss eine enge und präzise Funktionszuordnung bereits zum Zeitpunkt der Patentanmeldung erfolgen. Dies ermöglicht es, dass weitere Funktionen des patentierten Gegenstandes auch später noch patentfähig sind, sofern eben kein absoluter Stoffschutz vorliegt. In diesem Zusammenhang ist auch festzuhalten, dass die Forschung am patentierten Gegenstand durch das Forscherprivileg ja ermöglicht wird.
Punkt drei: Kommentar zu Pflanzen und Tieren, zur Patentierung von Pflanzensorten und Tierrassen. – Es wurde hier schon Wesentliches festgestellt. Ich möchte nur ergänzen, dass die Biopatentrichtlinie im Gegenzug für Tierzüchter und Landwirte das so genannte Züchterprivileg und das Landwirteprivileg im Patentrecht-Neu vorsieht. Bisher war das nicht der Fall. Demgemäß darf ein Züchter das geschützte Vieh zu landwirtschaftlichen Zwecken verwenden oder das Vieh für die Fortführung seiner landwirtschaftlichen Tätigkeit anderen überlassen – ausgenommen eben mit dem Ziel einer gewerblichen Verwertung, einer Viehzucht.
Ein Landwirt darf sein pflanzliches Vermehrungsgut zum landwirtschaftlichen Anbau und das von ihm erzeugte Erntegut für die generative und auch vegetative Vermehrung durch ihn selbst im eigenen Betrieb selbstverständlich verwenden.
Als eine weitere Erleichterung sieht die Biopatentrichtlinie Zwangslizenzen vor, wenn ein Pflanzenzüchter den Sortenschutz vielleicht nicht erhalten oder verwerten kann, ohne ein früher erteiltes Patent zu verletzen, oder wenn der Inhaber eines Patents die geschützte biotechnologische Erfindung nicht verwerten kann, ohne ein früher erteiltes Sortenschutzrecht zu verletzen. Damit sollen eben gegenseitige Behinderungen ausgeschaltet werden.
Auch ein Kommentar zu Herrn Dr. Hoppichler: Ich glaube, dass die Welternährung und die Ernährungssicherheit wohl keine Frage des Patentrechtes ist, sondern ein vielschichtiges politisches und soziales Problem, wo durch die Umsetzung oder Nichtumsetzung der Biopatentrichtlinie kein signifikanter Einfluss zu erwarten ist.
Punkt 4: die Frage, ob die Forschung durch Patente auf biotechnologische Erfindungen behindert wird. – Ich möchte hier diesen Punkt besonders aus Sicht der Universitäten beleuchten, weil ich selbst im Bereich der Biotechnologie an einer Universität arbeite.
Es wurde schon festgestellt, dass durch die Veröffentlichung der Patentschrift der Inhalt der Erfindung öffentlich zugänglich wird und vollständig zugänglich wird, und es wird oft gesagt, dass die Patentierung die Publikation in wissenschaftlichen Journalen verhindert. – Das kann wohl sein, wenn man das nicht optimal organisiert, aber bei guter Organisation einerseits der wissenschaftlichen Publikation, andererseits der Patenteinreichung ist nur eine marginale Verzögerung, wenn überhaupt, zu erwarten. Da gibt es gute Beispiele, das könnte ich Ihnen durchaus belegen, auch aus eigener Erfahrung.
Bei der Verhinderung der Patentierungsmöglichkeiten wäre ja die logische Konsequenz eine Geheimhaltung von kommerziell wichtigen Erfindungen.
Ich möchte nun zu den wichtigsten Punkten für die universitäre Forschung kommen: Möglichkeit der Generierung von Lizenzeinnahmen, Möglichkeit der Ausgründung von Start-up-Firmen – da gibt es ein sehr großes Potenzial auch in Österreich.
Ich glaube, dass insgesamt durch die Umsetzung der Biopatentrichtlinie der Forschungsstandort Österreich wesentlich gestärkt werden kann, weil das sowohl für die Grundlagenforschung als auch für die anwendungsorientierte Forschung und vor allem für ein gutes Zusammenspiel zwischen Grundlagenforschung und anwendungsorientierter Forschung wichtig ist.
Aber dennoch: Die beste Methode, um den Forschungsstandort Österreich abzusichern, ist sicherlich eine ausreichende Finanzierung der Forschung an sich auf einem international kompetitiven Level. Die Umsetzung der Biopatentrichtlinie stellt aber sicherlich einen wichtigen Faktor dar, um den Forschungsstandort Österreich gut abzusichern.
14.33
14.34
Mag. Petra Lehner (Österreichische Bundesarbeitskammer): Sehr geehrter Herr Minister! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin hier als Vertreterin der Bundesarbeitskammer, und ich bin dort verwurzelt im Konsumentenschutz.
Wir haben heute schon sehr viel gehört – widersprüchlich, gleich lautend – über die verschiedenen Interpretationen der Biopatentrichtlinie. Die „Klarseher“, die alles klar sehen, wollen uns weismachen, dass die Richtlinie klar wäre und nicht widersprüchlich. Ich frage mich: Warum diskutieren wir dann schon seit mittlerweile vier Stunden darüber, und warum existieren zahlreiche Reports, zahlreiche Berichte, die auch nicht deckungsgleich sind?
Wir haben von den Rechtsexperten gehört, dass manche Dinge 1 : 1 zu übernehmen sind und dass es in anderen Bereichen nationalen Spielraum gibt – bei der funktionsbezogenen Patentanmeldung zum Beispiel wäre dieser Spielraum gegeben –, und ich frage mich in diesem Zusammenhang: Könnte es dann dadurch nicht zu einem Anmeldungstourismus hin zu Patentämtern in anderen Ländern kommen, die einen umfassenderen Schutz geben würden? – Ich hätte diese Frage gerne von den ExpertInnen beantwortet. Ich frage mich in diesem Zusammenhang auch, inwieweit das dann überhaupt EU-rechtskonform wäre und ob das nicht der Intention der Richtlinie widerspräche, die ja Rechtssicherheit schaffen will, die man aber dann letztendlich nicht hat.
Die Erarbeitung der Richtlinie hat zehn Jahre gedauert, und sie ist jetzt in der Mehrheit der Mitgliedstaaten fünf Jahre nicht umgesetzt. Man hat heute gehört, es wäre ein frommer Wunsch von Minister Gorbach, die Richtlinie aufzuschnüren, und es gibt auch das Bekenntnis der Europäischen Kommission, die Richtlinie nicht aufzumachen. Es gibt in sehr vielen anderen Bereichen regelmäßige Amendings, also Verbesserungen, oder Updatings von Richtlinien, die in sehr viel kürzeren Abständen erfolgen. 1998 war nicht vorgestern, und eine Verbesserung der Richtlinie in manchen Bereichen, nämlich dort, wo die Definitionen unklar sind, und dort, wo es Widersprüche gibt, speziell im Artikel 5, der genauer zu definieren wäre, wäre sinnvoll.
In Bezug auf diese Bereiche bekennen wir uns klar dazu, dass es im Forschungsbereich natürlich einen Patentschutz geben muss. Einen Verfahrensschutz muss es auf jeden Fall geben, vielleicht auch einen leicht erweiterten Stoffschutz, aber keinen absoluten Stoffschutz, denn das führt, wie man es im Bereich der Hepatitis-Prüfung von Blutkonserven ja schon gesehen hat, dazu, dass es 3 000-fache Verteuerungen gibt. Dass es 3 000-fach ist, das hat mich selbst überrascht – das habe ich heute das erste Mal gehört –, und aus KonsumentenvertreterInnensicht habe ich natürlich Bauchweh, wenn 3 000-fache Verteuerungen von Medikamenten, Diagnostikverfahren oder vielleicht auch Lebensmitteln auf uns zukommen könnten. Deshalb wäre speziell der umfassende Stoffschutz in diesem Zusammenhang stark zu überdenken. Da hat man ja national keinen Spielraum, wurde heute zumindest zweimal betont, und da wäre eine Neuverhandlung unumgänglich.
Nun noch ein kurzes Statement zur Forschungsbeeinträchtigung: Es hieß hier, die Umsetzung der Biopatentrichtlinie sollte lieber gestern als morgen erfolgen, sie wäre für die Forschung so fördernd und führte dazu, dass wir im Ranking nicht ständig zurückrutschen. Wir rutschen zurück, das ist ein Faktum, aber das liegt nicht daran, dass wir die Biopatentrichtlinie nicht umsetzen, sondern an viel einflussreicheren Faktoren wie der Finanzierung der Forschungseinrichtungen, der Finanzierung der Universitäten, an der Infrastruktur, an der Zurverfügungstellung von Personal, das ausreichend qualifiziert ist. Viel weniger ausschlaggebend sind die Biopatente oder die Umsetzung der Biopatentrichtlinie, und zwar vor allem im Hinblick darauf, dass ja nach dem Buchstaben der Biopatentrichtlinie die Anmeldung beim EPA ohnehin möglich ist.
Ich hoffe, dass auch die Fragen von Frau Abgeordneter Kerschbaum von den ExpertInnen noch beantwortet werden, denn das interessiert mich auch.
14.38
Vorsitzender Abgeordneter Dipl.-Ing. Maximilian Hofmann: Als Nächste darf ich Frau Abgeordnete Dr. Brinek bitten, das Wort zu ergreifen.
14.39
Abgeordnete Dr. Gertrude Brinek (ÖVP): Herr Vorsitzender! Herr Vizekanzler! Hohe Versammlung! Werte Kolleginnen und Kollegen! Vieles ist schon als Focus sichtbar geworden; ich möchte mit einer Art Selbstvergewisserung anknüpfen: Wissenschaft ist eine Art Erklärung der Komplexität und Differenziertheit von Welt, also sie will die Welt begreifbar machen, sie aber auch verbessern. Es gibt ein Telos von Wissenschaft. Verändert sich die Komplexität, so steigert sich wissenschaftliches Wissen oder wird gesteigert, und dann steigt auch die Geschwindigkeit im Wissenszuwachs. Da komme ich zu dem Schluss: Wenn das stimmt, was Frau Dr. Godt als letztgültiges rechtsinterpretatorisches Wissen bezeichnet hat, wenn das Gültigkeit erhebt zum Anspruch der Umsetzung in Österreich, dann muss ich sagen: Dann ist es schon wieder überholtes Wissen.
Was will ich damit sagen? – Wir müssen uns mit der Veränderungsgeschwindigkeit, wir müssen uns als legistische Akteure mit der Notwendigkeit, dass wir immer hintennach hinken, dass wir eigentlich immer erst im Nachhinein Regelungen fassen können, abfinden.
Das heißt, die alte Vorstellung: Diskutiert diese Richtlinie einmal ganz lang, arbeitet diese Richtlinie so lange um, bis sie allen Einsprüchen standhält, und dann verabschiedet sie!, die ist illusorisch. Wir müssen uns von dieser verabschieden. Das ist ein wesentlicher Sukkus aus der heutigen Diskussion.
Ein wesentliches Augenmerk muss sicherlich auf das Monitoring und die europäische Weiterentwicklung gerichtet werden; ich blicke in Richtung meiner Kollegin Ursula Stenzel. Die Patentämter beziehungsweise die Patentdefinition wird sicher im Fokus der Zukunft stehen – und ein wenig mehr Rationalität, wenn ich Herrn Dr. Kloiber gehört habe, der Erfindung als Lüge definiert hat. Ich sage, Erfindung ist eine angewandte Hypothese. Also verkehren wir doch mit ein bisschen mehr Rationalität!
Patentschriften sind Veröffentlichungen. Diskutieren wir diese Veröffentlichungen und mystifizieren wir nicht, was hier diskutiert wird und angelegt ist!
An die Adresse des Herrn Dr. Hoppichler sei Folgendes gerichtet: Meinem jüngst verstorbenen Vater, einem Bauern aus dem Weinviertel, hätte ich auch die Richtlinien nicht erklären können, aber ich kann auch ein Rechtsurteil einem einfachen Bauern nicht eins zu eins erklären.
Viele Expertinnen und Experten haben gezeigt, wo die Chance liegen könnte. Österreichs Universitäten und Österreichs Wissenschaft und Forschung brauchen Patente, damit Technologietransfer funktionieren kann. Ohne Patente, ohne Patentabsicherung wird aus Erkenntnis kein Produkt. Das betrifft auch die Grundlagenforschung, und das betrifft auch die im ersten Moment nicht auf Anwendung orientierte Forschung.
Ich denke auch, so wie Protein eine chemische Substanz ist – jetzt auch schon im Hinblick auf ihre Qualität isoliert, was die Patentierung angeht –, so ist auch das Gen eine Substanz. In der Stoffbezeichnungsdiskussion ist sicher auch mit einem Fortschritt in den nächsten Jahren zu rechnen, was uns nicht hindern sollte, an die Umsetzung dieser Richtlinie als ersten Schritt zu gehen und an die Weiterentwicklung in den nationalen Parlamenten in Zusammenarbeit mit den europäischen Kooperationspartnern zu denken.
14.42
14.42
Abgeordnete Mag. Karin Hakl (ÖVP): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Herr Bundesminister! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich glaube, einen Grundkonsens bereits ausgemacht zu haben, zumindest zwischen den Abgeordneten aller Fraktionen, darüber, dass im Wesentlichen die Biopatentrichtlinie gegenüber dem Iststand, den wir heute haben, ein Fortschritt ist, auch wenn sie in Punkten durchaus diskussionswürdig ist. Das heißt, gegenüber dem rechtlichen Stand, den wir hatten, ist es ein Fortschritt in jedweder Hinsicht, wenn erstmals ethische Überlegungen, wenn erstmals der Schutz des Menschen und seiner Teile berücksichtigt wird.
Die große Hauptdebatte dreht sich wohl um folgende Fragen: Ist der Stoffschutz insbesondere bei einem Gen oder einer Gensequenz notwendig? Gibt es da einen nationalen Spielraum bei der Umsetzung? Gäbe es ihn, sollte man ihn nützen?
Das Interesse von uns als Politikern muss zum einen sein, die wissenschaftliche Forschung, die von einem Patent nicht betroffen und immer möglich ist, voranzutreiben, zum anderen aber auch, dass möglichst viele Menschen in den Nutzen der entwickelten und dann industriell gefertigten Medikamente kommen. Dafür ist eine industrielle Fertigung in Massen für diese Medikamente erforderlich. Das geschieht in unseren Unternehmen, und wir wollen, dass es auch in Österreich geschieht und für möglichst viele Menschen zur Verfügung steht.
Ist dafür ein Stoffschutz bei einem Gen oder einer Gensequenz erforderlich oder nicht? Ich glaube, das ist der Kern des Problems. Richtig ist, dass in Form einer Lex-specialis-Regelung im § 5 vorgesehen ist, dass Gene im Unterschied zu anderen Stoffen nur dann als solche patentierbar sein können, wenn als zusätzliches Erfordernis auch die Verwend- und Verwertbarkeit dargestellt wird. Tatsächlich ist es dann aber möglich, das gesamte Gen oder die Gensequenz als solche zu patentieren. Diese Bestimmung ist nicht durch Zufall in die Richtlinie gekommen, sondern sie ist für einige Dinge zwingend erforderlich.
Ich möchte ein Beispiel nennen: die Produktion von Insulin auf genetischem Wege. Insulin ist ein Stoff, der bereits lange bekannt ist, den man aus Allergien hervorrufenden Produkten von Schweinen hergestellt hat, der aber jetzt für den Menschen viel verträglicher genetisch aus Genen hergestellt wird. Dieses Insulin wäre nicht mehr patentierbar gewesen, hätte man nicht das Gen, das dieses menschliche Insulin produziert, an sich patentieren können. Wäre nicht dieser Stoffschutz möglich gewesen, dann wäre es nie zur massenweisen Produktion von diesem Insulin gekommen, denn das wäre dann wirtschaftlich völlig sinnlos gewesen. Deswegen bin ich in meiner persönlichen Abwägung von Pros und Kontras dazu gelangt, auch dem Stoffschutz, der da und dort Probleme macht, auch in der nunmehr folgenden parlamentarischen Debatte das Wort zu reden.
Ein weiterer Grund, warum ich auch den Stoffschutz für sinnvoll erachte, ist der folgende: Wenn ich etwas zum Patent mit einer möglichen Therapiemöglichkeit anmelde, also ein Gen finde, das beispielsweise gegen Schizophrenie hilft, und jemand anderer entdeckt, dass es auch noch andere Behandlungsmöglichkeiten mit diesem Gen gibt, andere Möglichkeiten, dieses Gen einzusetzen, dann baut er auf einer veröffentlichten zehnjährigen Vorarbeit von anderen auf. Es ist nämlich nicht so, dass es so einfach geht, von einem Tag auf den nächsten ein Gen zu isolieren. Das ist extrem schwierig, das dauert Jahre, und jemand, der sich diese Arbeit erspart, sollte meines Erachtens auch ohne weiteres eine Lizenzgebühr, wie das auch bei Medikamenten mit neuen Anwendungsmöglichkeiten der Fall ist, an den Besitzer des Erstpatentes zahlen müssen. Ich glaube, dass das durchaus legitim ist.
Ich habe in der Diskussion draußen vor der Tür festgestellt, dass es immer noch nicht allgemein verstanden worden ist: Es geht nicht darum, irgendjemanden von der Forschung auszuschließen. Die Experten wissen das: Forschung ist jederzeit auch und gerade an patentierten Erfindungen, auch an patentierten Genen möglich. Um zu verhindern, dass jemand ein Patent erlangt, kann ich nur einem Konkurrenten sagen, er möge es schnellstmöglich veröffentlichen, denn dann ist etwas nicht mehr neu und kann überhaupt nicht mehr patentiert werden.
Wichtig ist aber, ganz grundsätzlich zu wissen, dass es so ist wie bei einem Lyriker, der ein Gedicht schreibt, der vielleicht nur das Geld hat, drei Bücher zu verlegen: Auch da kann wegen des Urheberrechtsschutzes niemand anderer kommen und das Buch Millionen Mal auflegen, seinen Namen drunterschreiben und es dann verkaufen und verwerten. Das ist das, worum es beim Patent im Kern geht, und ich hoffe, dass wir im Sinne der kleinen Start-ups und unserer Industrie, vor allem aber der Patienten, die darauf warten, dass die Medikamente ausreichend zur Verfügung stehen, diesen Grundsatz auch beim Patentschutz verwirklichen.
14.48
Vorsitzender Abgeordneter Dipl.-Ing. Maximilian Hofmann: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Dipl.-Ing. Pirklhuber. – Bitte.
14.48
Abgeordneter Dipl.-Ing. Wolfgang Pirklhuber (Grüne): Herr Vizekanzler! Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren!! Die Kollegin Brinek hat heute den Begriff der Rationalität bemüht. Ich halte das für bemerkenswert insofern, als sie die einzige Aufgabe der Wissenschaft damit kennzeichnet, dass sie zur Veränderung und zur Verbesserung der Welt beitragen soll. Dazu möchte ich schon zur Ehrenrettung der Wissenschaft anmerken, dass es auch darum geht, kritische Argumente auf die Waagschale zu legen, in den Diskurs einzuschleusen und vor allem Wert auf eine breite interdisziplinäre Sichtweise gerade dieses Phänomens zu legen und diese Fragestellung hier entsprechend zu behandeln.
Aus bäuerlicher Sicht – ich bin ein Grüner und Bauer in Oberösterreich – muss ich sagen, bäuerliche Rationalität zeichnet sich auch durch eine gewisse Komplexität aus, die eben schon versteht, dass es auch darum geht, einen Humanismus in reale Politik umzusetzen, soziale Fragen, ethische Fragen mit zu diskutieren und sie nicht von vornherein als emotionsgeladen, als nicht wissenschaftlich auszugrenzen. Also das vorneweg, denn das erscheint mir ganz wichtig.
Warum? – Weil sich gerade in dieser Fragestellung eines zeigt – und das ist ein unbestrittenes Faktum und auch anzuerkennen –: Die Industrie hat ein Interesse, die Wissenschaft, Teile der Wissenschaft, der Forschung haben ein Interesse an dieser Patentierbarkeit, am Schutz der Investitionen. Das kann man anerkennen. Man muss aber genauso gut sehen und anerkennen, dass es andere Interessen gibt, und die sollte man auch besprechen, diskutieren und auch entsprechend ernsthaft würdigen.
Ich denke, der Schutz des Lebens ist eine sehr umfassende Fragestellung, eine sehr umfassende wichtige Intention, die gerade beim Gentechnik-Volksbegehren sehr deutlich und sichtbar zum Ausdruck kam. Meine Damen und Herren, erinnern wir uns: Es waren über 1,2 Millionen Österreicherinnen und Österreicher, die sich ganz klar gegen ein Patent auf Leben ausgesprochen haben. Hier haben wir eine hohe Verantwortung in der Politik der österreichischen Bevölkerung gegenüber. Hier sind Interessen abzuwägen. Unter diesem Gesichtspunkt ist für mich als Abgeordneten heute schon sehr deutlich sichtbar geworden, nicht zuletzt durch die Aussagen der Expertinnen und Experten – und das nehme ich auch heute mit –, ob es Prof. Huber ist, Dr. Zacherl oder Prof. Virt, um nur einige zu nennen, dass es Mängel in der bestehenden Patentrichtlinie gibt und dass diese Mängel sozusagen per se dazu führen müssen, dass es zu einer Weiterentwicklung kommt.
Aus der politischen Verantwortung heraus kann das doch nur heißen, dass wir, wenn wir den Wählerwillen, wenn wir die österreichische Bevölkerung ernst nehmen, hier wieder, genauso wie 1997, 1998, die Initiative ergreifen, dass das österreichische Parlament hier initiativ wird und genau das macht, was aus mehreren Gründen hier zweckmäßig erscheint, nämlich eine Neuverhandlung der Patentrichtlinie auf europäischer Ebene anzustrengen. Das würde sehr wohl dem Willen der österreichischen Bevölkerung entsprechen und würde auch sehr schön an einigen Eckpunkten exemplifizierbar sein.
Meine Damen und Herren, ein konkretes Beispiel: Erinnern wir uns zurück an die Entdeckung des Periodensystems, der Basis der Chemie schlechthin! Wer hätte damals überlegt, dass die Isolierung von einem neuen Element patentierfähig wäre, geschweige denn, dieses Element eventuell zu patentieren? Stellen wir uns das einmal im Vergleich gegenüber: hier die Grundbestandteile des Lebens, dort die Grundbestandteile der Chemie an sich! Doch das Leben selbst sollte jetzt in seinen Bestandteilen plötzlich patentierbar sein.
Hier ist also ein völliger Paradigmenwechsel in der Patentierphilosophie Europas zu sehen, was auch eine große Gefahr für den europäischen Humanismus darstellt, weil hier die Grundelemente unserer Herangehensweise völlig auf den Kopf gestellt werden, nämlich dass wir organische Prinzipien, dass wir das Lebendige auch als Lebendiges wahrnehmen. Eine der wesentlichen Möglichkeiten des Lebendigen ist eben die Fähigkeit zur Selbstreproduktion, die Fähigkeit, sich selbst zu vermehren, und diese Reproduktionsfähigkeit liegt natürlich auch schon in den Teilen dieses Systems, in den Gensequenzen, in den Genen.
Ich bin aber schon bereit, in Richtung der Frage der Nutzen- und Anwendungsorientierung weiterzudenken und darüber zu diskutieren. Da wird es sicher notwendig sein, diesen funktionsbedingten Patentschutz auch durchzudenken. Aber, bitte, eines kann es nicht sein: zu glauben, hier in Österreich könnten wir das irgendwie national, eigenständig regeln. Plötzlich, Herr Vizekanzler, könnten wir bei diesem heiklen Thema einen Spielraum nutzen, den wir in anderen Fragen, zum Beispiel bei der Gentechnik, auf der europäischen Ebene derzeit nicht haben. Außerdem fordern wir ein, geradezu einmütig, alle Parteien, dass es zu einer einheitlichen Regelung auf europäischer Ebene kommt, zum Beispiel zum Schutz gentechnikfreier Zonen. Genauso müssen wir fordern, dass auch hier, wenn es neue Sachverhalte gibt, neue Untersuchungen, neue Ergebnisse, neue Forschungen gibt, diese auch berücksichtigt werden.
Meine Damen und Herren! Wie gesagt, Pflanzen und Tiere sind von der Patentierbarkeit nicht ausgeschlossen, und als Bauer muss ich schon sagen: Das geht nicht rein, das werden unsere Bäuerinnen und Bauern nicht verstehen und auch die österreichischen KonsumentInnen nicht! Daher ersuche ich Sie, heute diesen Tag wirklich zu nutzen, um eine gemeinsame Initiative zu einer europäischen Neuverhandlung zu starten.
14.54
Vorsitzender Abgeordneter Dipl.-Ing. Maximilian Hofmann: Als Nächste darf ich Frau Dr. Redl ersuchen, das Wort zu ergreifen.
14.55
Dr. Gerda Redl (Wirtschaftskammer Österreich): Herr Vorsitzender! Herr Minister! Sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben heute schon sehr viele Aspekte der Biopatentrichtlinie beleuchtet, und ich glaube, der Grundkonsens liegt darin, dass die Innovation in unserem Land gefördert werden soll. Das klingt sehr gut, wenn man die Forschungsquote erhöhen und Innovation fördern will, aber was bedeutet das für mich als Betroffenen konkret?
Ich bin Biochemikerin und europäische Patentanwältin, arbeite bei der Igeneon, einer kleinen Hightech-Start-up-Firma, die es seit 1999 gibt, die also relativ jung ist, aber wir haben immerhin mit 45 Millionen Kapital, und zwar zum Großteil Risikokapital, schon drei Produkte in klinischen Prüfungen, und wir arbeiten an Krebsimmuntherapien, an Krebsimpfstoffen, und damit sind wir als erstes Unternehmen im europäischen Raum an den Kliniken vertreten.
Wir haben auch klinische Prüfungen in den USA, die sind zwar sehr kostenintensiv, aber die Investoren glauben an uns. Das geht ganz ohne Biopatentrichtlinie, könnte man sagen, aber wir haben mit Patenten begonnen. Wir haben mit einem Patent begonnen und dadurch das Vertrauen der Investoren gewonnen. Wir haben jetzt schon 20 Patente, natürlich auf biotechnologische Produkte, die wir zur Versicherung für die Investoren unbedingt brauchen, damit sie uns ihr Geld anvertrauen, und schließlich wollen sie dann auch am Profit teilhaben.
Wenn Sie ein Haus bauen, dann wollen Sie vielleicht auch von der Bank Geld lukrieren, und die Bank wird Ihnen sagen: Geben Sie mir, bitte, eine Lebensversicherung, und dann vertraue ich darauf, dass Sie mit Ihren eigenen Kräften ein Haus bauen können!
Wir wollen Produkte entwickeln, wir wollen nicht nur Grundlagenforschung betreiben. Das ist unser Haus. Wir sind zwar erst beim Keller, aber mit dem Vertrauen und mit der Versicherungspolizze, nämlich unseren Patenten, können wir weiter arbeiten.
Ohne Biopatentrichtlinie gibt es zwar schöne Patente, und wir haben jetzt auch schon ein schönes Portfolio, aber national sind sie dann das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben sind, und damit werden wir konfrontiert mit einer möglichen Inflation unserer Werte, die wir geschaffen haben. Die Versicherungspolizze ist ja auch nur dann etwas wert, wenn man sich auf den Versicherer verlassen kann, wenn Not am Mann ist. Das heißt, in diesem Fall ist der österreichische Staat unser Versicherer, und das österreichische Rechtssystem muss diese Sicherheit geben, sonst haben wir wirklich einen Verfall unserer Werte, die wir geschaffen haben.
Die Patente kosten zwar viel, sie sind es aber wert, denn ohne Patentschutz wären wir hier in Wien wahrscheinlich nicht mit 65 Leuten vertreten, sondern wären vielleicht eine an irgendeine Universität gekoppelte kleine Firma mit 5 Leuten. Wir hätten öffentliche Förderungen, wir hätten gute Forschungsergebnisse, weil wir wirklich gute Wissenschafter engagieren, wir hätten sehr schöne Publikationen in Fachzeitschriften, und die ganze Welt könnte davon profitieren, aber wir hätten keine internationalen Partner, die sich dann unsere Kommerzialisierungsrechte sichern wollen. Wir könnten keine Einnahmen daraus lukrieren, und wir könnten keinesfalls die Produkte selber entwickeln. Die großen Pharmafirmen würden uns dann nicht brauchen. Das heißt, die großen Pharmafirmen würden sich die Forschungsergebnisse gratis aus der Zeitung holen und könnten dann die Produkte selber entwickeln und den Profit daraus lukrieren, und es käme zu uns nach Österreich nichts mehr zurück. Wir hätten zwar die Werte geschaffen, diese aber verschenkt.
Ich möchte noch ein Wort zur universitären Forschung sagen: An sich ist ja die Forschung frei, ist vom Patent nicht blockiert und nicht beeinträchtigt. Wenn der Herr Kloiber oder sonst jemand aus Deutschland ein Problem mit der geänderten Publikationspraxis an den Universitäten hat, dann liegt das hauptsächlich daran, dass es nicht gescheit gehandhabt wird, denn es funktioniert woanders auch, dass man patentieren und publizieren kann, das man das nebeneinander tun kann. Da muss man halt mit einem intelligent potential darangehen.
Weil auch immer wieder Fragen an Experten gestellt werden: Ich könnte mir auch eine gute Frage an den österreichischen Patentanwalt Dr. Alge vorstellen, nämlich warum sich dieser zweckgebundene Stoffschutz in Europa nicht durchgesetzt hat. Ich denke, das liegt hauptsächlich daran, dass es diesen zweckgebundenen Stoffschutz prinzipiell nicht geben kann. Das ist dann nur auf irgendeine Verwendung eingeschränkt.
Jeder andere, der den gleichen Stoff, an dem jahrelang hart gearbeitet und in den viel investiert wurde, für eine andere Verwendung einsetzt, kann dann unabhängig davon weitermachen, ohne dem Urheber dieser ersten Erfindung etwas zurückzugeben. – Vielleicht kann Herr Dr. Alge noch etwas zum zweckgebundenen Stoffschutz sagen.
15.00
Vorsitzender Abgeordneter Dipl.-Ing. Maximilian Hofmann: Zu Wort gemeldet ist nun Herr Dr. Hager. – Bitte.
15.01
Dr. Johann Hager (Ethikkommission für die österreichische Bundesregierung): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Herren Bundesminister! Meine Damen und Herren! Die Richtlinie gefällt mir persönlich nicht. Ich halte sie in verschiedensten Punkten für mangelhaft. Wir müssen uns aber die Frage stellen: Was passiert, wenn wir sie nicht umsetzen, oder welchen Zustand führen wir herbei oder haben wir eigentlich bereits herbeigeführt?
Nichtumsetzen der Richtlinie bedeutet nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes, dass im Anwendungsfall er, der Gerichtshof, die Richtlinie anwendet. Weiters bedeutet Nichtumsetzen der Richtlinie, dass in keinem Punkt das Europäische Patentamt in München gehindert wäre, den Inhalt der Richtlinie selbst anzuwenden. Das Patentamt in München wendet die Richtlinie nicht unmittelbar an, hat aber wesentliche Teile dieser Richtlinie in sein Regulativ übernommen. Das Patentamt kann nämlich das Europäische Patentübereinkommen ergänzen.
Ich war im Juli vergangenen Jahres bei der Einspruchsverhandlung in München dabei, wo es um das Edinburgh-Patent gegangen ist, und habe dort verschiedenste Erfahrungen gemacht. Eine der Erfahrungen war, dass der Vorsitzende der Einspruchskammer ausdrücklich erklärt hat, nicht an die Richtlinie gebunden zu sein. Zu dem Punkt, wo es um die Frage des Ausschlusses der Patentierbarkeit wegen Verletzung der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten geht, hat jedoch das Patentamt die Richtlinie in sein Regulativ übernommen.
Wir handeln uns bei Nichtübernahme auch weitere Probleme ein. Ich meine nämlich, wir verschlechtern unsere Position bei einer allfälligen Bestrebung, die Richtlinie zu ändern. Es sollte meiner Meinung nach das Bestreben Österreichs sein, nicht neu zu verhandeln, sondern eine Änderung der Richtlinie herbeizuführen. Neuverhandeln heißt nämlich, mehr oder weniger die ganze Richtlinie zu verwerfen; ändern hingegen würde bedeuten, sie an den neuen Erfahrungsstand anzupassen, die in den Ländern, wo sie bereits angewendet wird, gewonnenen Erfahrungen einfließen zu lassen und auch die Rechtsprechung des Europäischen Patentamts insbesondere zum Edinburgh-Patent.
Ich muss auch darauf hinweisen, dass Fragen der Einwilligung, so wichtig und so unabdingbar sie sind, im Patentrecht nicht Platz finden können, sondern Fragen sind, die in den Bereich der Biomedizin-Konvention gehören und bei einer allfälligen Umsetzung dieser Konvention zu behandeln wären, wobei meine Meinung ist, dass jedenfalls – unabhängig von der Umsetzung der Richtlinie – der österreichische Verfassungsgesetzgeber berufen und gefordert wäre, hier für einen verbesserten Grundrechtsschutz zu sorgen.
Weiters bedeutet Patentschutz nicht, dass man etwas Verwerfliches, Unmoralisches nicht tun dürfte. Das bedeutet nur, dass das moralisch Verwerfliche nicht schützbar ist. Das heißt, auch im Falle der Umsetzung der Richtlinie wird man sich über Begleitmaßnahmen den Kopf zerbrechen müssen und allfällige unerwünschte Maßnahmen und Tätigkeiten verbieten müssen. Aber das soll uns nicht daran hindern, die Richtlinie umzusetzen. Man darf die beiden Dinge nicht vermischen.
Die Richtlinie hat natürlich viele Unzulänglichkeiten. Etwas, was mich zum Beispiel immer besonders gestört hat, ist die Regelung der Zwangslizenz: Weswegen gibt es Zwangslizenzen im Bereich der Pflanzen, aber nicht im Bereich des Humanen? Hier ist vor allem Folgendes ein Problem: Wenn im Bereich der Pflanzen ausdrücklich geregelt wird, dass es eine Zwangslizenzmöglichkeit gibt, die Richtlinie aber diesbezüglich im Bereich des Humanen nichts sagt, dann ist wohl der Umkehrschluss nicht ganz verfehlt: Die Richtlinie sieht es nicht vor, das heißt, der nationale Gesetzgeber kann es gar nicht vorsehen. – Das zum Beispiel ist ein Umstand, auf den ich ausdrücklich hinweisen wollte und der in einer allfälligen Änderung der Richtlinie, die ich sehr wünsche, mit berücksichtigt und auch entsprechend geregelt werden sollte.
15.06
Vorsitzender Abgeordneter Dipl.-Ing. Maximilian Hofmann: Ich darf nun Frau Professor Mannhalter um ihre Ausführungen ersuchen.
15.06
Univ.-Prof. Dr. Christine Mannhalter (Bioethik-Kommission beim Bundeskanzleramt): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrter Herr Vizekanzler! Sehr geehrter Herr Minister! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte mich in meinem Redebeitrag ganz kurz fassen. Ich bin hier in zwei Funktionen, wenn Sie so wollen, einerseits als Vertreterin der Bioethik-Kommission und andererseits als Professorin an der Universität Wien.
In beiden Funktionen bin ich unmittelbar von der Biopatentrichtlinie betroffen. Im Rahmen der Bioethik-Kommission wurden wir aufgefordert, uns mit der vorliegenden Fassung der Richtlinien auseinander zu setzen, und ich kann Ihnen versichern, wir haben uns die Arbeit nicht leicht gemacht. Wir haben sehr sorgfältig und ausführlich diskutiert und sind mehrheitlich zu der Auffassung gekommen: Es gibt nichts Besseres. Die derzeitige Situation, die derzeitige Lage ist unklarer. Es ist ja nicht so, dass wir im Augenblick nicht Gene, DNA-Sequenzen patentieren können, sondern wir können dies tun. Basierend auf der Richtlinie müssen Anwendungen spezifiziert werden. Das heißt, das ist eigentlich eine Einschränkung der derzeitigen Praxis, eine bessere Definition.
Hier möchte ich gerne etwas aufgreifen, was Herr Professor Grünewald gesagt hat und was mir sehr wichtig zu sein scheint. Diese Begriffsvermengung: „Leben“, „Patent auf Leben“, und gleichzeitig von einem kleinen Abschnitt einer DNA-Sequenz zu sprechen, das erscheint mir doch sehr weit hergeholt, denn ein kleines Stück einer DNA-Sequenz ist natürlich nicht das Leben. Ein kleines Stück einer DNA-Sequenz kann völlig unbedeutend sein, oder es kann eine Information, wie wir heute schon gehört haben, entweder für einen Eiweißstoff beinhalten oder auch für eine Funktion, für eine Erkrankung.
Ein Punkt, der uns von Frau Expertin Dr. Godt vorgestellt wurde und der mir eine gute Option für die nationalen Parlamente zu sein scheint, ist diese Zweckbindung oder Funktionsbindung. Ich glaube, ein Punkt, der von, wenn ich mich richtig erinnere, Frau Stenzel angesprochen wurde, war ja, dass wir natürlich keine Illusionen haben dürfen, dass es Richtlinien geben wird, die für ganz Europa mit den multikulturellen und, wie auch Herr Professor Virt gesagt hat, multiethischen Betrachtungsweisen gelten können. Natürlich wird es nur Consensus papers geben. Es werden keine detailliert ausgearbeiteten und für jedes einzelne Land optimal passenden Richtlinien zur Abstimmung gebracht werden können. Daher scheint mir diese Erwähnung und Aufforderung der nationalen Parlamente, den Gestaltungsspielraum, den sie haben, voll auszunützen, wirklich sehr wichtig zu sein.
Ich möchte nicht verhehlen, dass es mir ganz wichtig zu sein scheint, dass Österreich nun nicht mehr länger zögert, sondern die Biopatentrichtlinie ratifiziert, denn, wie gesagt, es gibt derzeit nichts Besseres.
Ich möchte noch kurz eine Frage ansprechen. Es wurde heute gefragt: Wen schützen Patente? – Patente schützen die Erfinder. Wir sind im Augenblick gerade dabei, die Universitäten umzustrukturieren. Die Universitäten haben ein neues Recht, und die Universitäten sind in dieser neuen Rechtsform nun Unternehmer. Die Universitäten sind sozusagen jetzt auch verpflichtet, mit ihrem Budget geschäftsmäßig gut umzugehen und dieses unternehmerisch einzusetzen.
An den Universitäten sind die Wissenschafter, die zu einem sehr wesentlichen Teil die Erfindungen machen. Diese Erfinder, diese Wissenschafter sind nicht nur Benützer von Erkenntnissen, die irgendjemand außerhalb macht, sondern sind die Lieferanten, und diese wollen, müssen und sollen ihre Erfindungen und ihre geistigen Aktivitäten auch geschützt haben.
Daher glaube ich, dass es sehr wichtig ist, dass wir auch diesen Aspekt in Betracht ziehen, dass die Wissenschafter an den Universitäten nicht nur die Ergebnisse der anderen benützen, sondern eigene Ergebnisse liefern, die natürlich geschützt werden sollen und müssen.
15.12
Vorsitzender Abgeordneter Dipl.-Ing. Maximilian Hofmann: Ich darf nun Herrn Dozenten Haslberger um seine Ausführungen bitten.
15.12
Univ.-Doz. Dr. Alexander Haslberger (Forum Wissenschaft und Umwelt): Sehr geehrter Herr Vizekanzler, Minister, Abgeordnete! Sehr geehrte Experten! Ich darf heute das Forum Wissenschaft und Umwelt vertreten. Auch uns ist der Stellenwert von Patenten sehr klar: der Stellenwert für den Wirtschaftsstandort, der Stellenwert für die Forschung, für die Belohnung kreativer Fähigkeiten.
Wir brauchen aber auch Patentregelungen, die dem adäquat sind, was sie regeln, und das Feld von Genanalysen bis zu Analyseverfahren, bis zu Gensequenzen, bis zu Stammzelllinien ist ein sehr weites. Ich denke, dass wir hier heute nicht am Ende einer internationalen Diskussion und Entwicklung stehen, wo wir dann auch eine österreichische Umsetzung machen mit einigen kleinen Adaptationen in der Zukunft, sondern dass wir am Beginn einer internationalen Diskussion diesbezüglich stehen.
Drei Beispiele: Eine neue Studie der Universität Genf sagt mehr als klar, dass der Konflikt Convention on Biological Diversity und TRIPS nicht ausgeräumt ist. Ganz im Gegenteil, es wird eine Neuverhandlung gewünscht, gefordert. Wenn wir uns die Globalisierungsdebatten, die alle paar Monate über uns hinwegschwemmen, anhorchen, dann sehen wir, dass uns diese Probleme noch sehr lange erhalten bleiben werden.
Zweiter Punkt: Der Konflikt Sortenschutz gegen Patentierung ist in der Landwirtschaft nicht vollständig gelöst, sondern wir müssen feststellen, dass neue FAO-Statistiken eines klarstellen, dass nämlich die Anzahl der Rassen, der Sorten, besonders der Landrassen, dramatisch zurückgeht, wodurch die Grundlage für neue Entwicklungen, neue Züchtungen dramatisch schwindet, und dass das als eines der wichtigsten Probleme international für food security, für die Entwicklung der Lebensmittel gesehen wird.
Dritter Punkt: Die EU-Richtlinie, der Stoffschutz wird diskutiert, auch international. Im Rahmen eines neuen Reports der WHO, Weltgesundheitsorganisation, „Genomics and World Health“, wird besonders der Stoffschutz kritisiert. Es wird die Legitimität dieser Regelungen angezweifelt, und es wird befürchtet, dass massive Ungleichheiten kommen, Ungleichheiten zwischen Gesund und Krank, zwischen Arm und Reich, und es wird auch, wie zuvor schon gesagt, massiv angenommen, dass der Public-health-Gedanke, dass die Möglichkeit eines Public-health-Systems international problematisch werden wird. Das Buch fordert mehr als eindeutig ein neu Überdenken, eine internationale Harmonisierung und Neuverhandlungen. Eine Eins-zu-eins-Umsetzung der europäischen Richtlinie würde diesen Gedanken dieser internationalen Organisationen in Richtung einer Neuorientierung erschweren.
Sehr geehrte Abgeordnete! Sie werden in Ihren Verhandlungen schwierige Themen erläutern. Wir haben es heute gesehen. Ich darf Sie aber bitten, im Falle einer Umsetzung – und ich gehe davon aus, dass Österreich umsetzen wird – das nicht eins zu eins zu tun. Es haben sich wichtige Experten hier dafür ausgesprochen, Abänderungen vorzunehmen – ich denke da etwa an Professor Virt und auch an einzelne Punkte wie etwa die bessere Durchsetzung von Zwangslizenzen.
Ganz besonders das Stoffpatent darf in dieser Form nicht umgesetzt werden. Die Verwendungsregelungen sind in der europäischen Richtlinie so weich definiert, dass sie Missbrauch Tür und Tor öffnen. Das heißt, wir müssen klarmachen, dass diese Regelungen – die erwünscht sind – viel stärker in Richtung Anwendung gezogen werden. Ich darf Herrn Dr. Kloiber bitten, uns hier diesbezüglich vielleicht noch einige Anregungen zu geben.
Ich darf Sie zuletzt auch bitten, als Abgeordnete dafür zu sorgen, dass in internationalen Verhandlungen zu intellectual-property-related Themen oder auch trade-related Themen die Dinge, die wir heute besprochen haben, zu Gehör gebracht werden, das heißt, dafür Sorge zu tragen, dass es nicht nur wirtschaftsrelevante Punkte sind – und wirtschaftsrelevante Punkte sind wichtige Punkte! –, die die österreichischen Vertreter dort in die Diskussion einbringen, sondern dass auch ökosoziale, gesundheits- und umweltrelevante Punkte in diese internationalen Verhandlungen einfließen.
15.17
Vorsitzender Abgeordneter Dipl.-Ing. Maximilian Hofmann: Die nächste Wortmeldung kommt von Herrn Dr. Torgersen. – Bitte.
15.17
Dr. Helge Torgersen (Österreichische Akademie der Wissenschaften): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Herr Vizekanzler! Meine Damen und Herren! Es ist heute schon sehr viel gesagt worden, deswegen kann ich mich kurz fassen und möchte auf einen einzigen Punkt hinweisen.
Das Problem scheint mir doch zu sein, dass es zu einer Balance zwischen der erfinderischen Leistung und der Breite des gewährten Patentes kommen muss. Darum geht es doch eigentlich. Eine mögliche Missbalance ist auch dasjenige, was in der Öffentlichkeit immer wieder zu Unruhe führt und was es auch so schwierig macht, die Sache in der Öffentlichkeit zu diskutieren.
Nun ist klar, dass die Patentrichtlinie in der derzeitigen Form das Resultat einer sehr langen Entwicklung ist, die zum Teil auf die achtziger Jahre zurückgeht. Damals war tatsächlich der Stand der Wissenschaft und Forschung noch ein anderer als heute, insbesondere in Bezug auf die Konzeption, zum Beispiel was ein Gen ist, wie es im Organismuszusammenhang wirkt, wie also diese Dinge zusammenhängen.
Das hat sich heute wesentlich gewandelt, und die Änderung der Geschwindigkeit dieses Wandels ist eine rasante. Das heißt, die Richtlinie greift zum Teil noch auf Konzepte zurück, die heute eigentlich obsolet sind. Das äußert sich zum Beispiel beim Problem des Stoffschutzes.
Wie geht man mit solch einer Situation um? – Ich halte nichts davon, das Ganze wieder zurück an den Start zu befördern und neu zu verhandeln. Angesichts der Rasanz der Entwicklung würden wir in zehn Jahren wahrscheinlich wieder hier sitzen und uns überlegen, ob wir eine neue Richtlinie umsetzen wollen oder nicht.
Ich würde daher dafür plädieren, die Richtlinie so, wie sie ist, umzusetzen und gleichzeitig diese Monitoring-Funktion wahrzunehmen, allerdings nicht in einer Insellösung nur für Österreich alleine und mit österreichischen „Sonderwürsteln“, sondern das sollte im europäischen Konzert geschehen. Eine Möglichkeit wäre, um die Patentämter auch mit entsprechender Expertise zu versorgen, das in Form von Advisory Boards zu machen, die den Patentämtern eben bei der Patentvergabe ein bisschen auf die Finger schauen und darauf achten, ob diese Balance zwischen erfinderischer Leistung und der Breite des Patentes noch dem Stand von Wissenschaft und Technik entspricht.
15.19
Vorsitzender Abgeordneter Dipl.-Ing. Maximilian Hofmann: Nun gelangt Herr Abgeordneter Hermann Schultes zu Wort. – Bitte.
15.20
Abgeordneter Ing. Hermann Schultes (ÖVP): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Herr Vizekanzler! Herr Bundesminister! Geschätzte Damen und Herren! Kurze Anmerkung: Ich bin ganz sicher, dass Österreich die Umsetzung dieser Biopatentrichtlinie braucht, und zwar rasch braucht. Wir wollen, dass in dieser modernen Schlüsseltechnologie in Österreich ernsthaft geforscht wird, dass umsetzungsorientiert geforscht wird und dass die Ergebnisse rasch zur Lösung der Probleme unserer Menschen zur Verfügung stehen.
Es entstehen Produkte, es entstehen Produktionseinrichtungen, es entstehen Arbeitsplätze. – Ich weiß, wovon ich spreche. Ich komme aus einem Wahlkreis, in dem die Firma Baxter sehr viele Arbeitsplätze anbietet, und sehr viele aus meinem Wahlkreis fahren nach Wien und arbeiten in ähnlichen Betrieben. Ich sehe, dass das Zukunftsbetriebe sind. Ich rede ja mit den Menschen, höre zu, was sie mir erzählen, und weiß, was sie an Hoffnung in diese Arbeitsplätze setzen, und es wäre, denke ich, sehr wichtig, da nicht zu zögern, sondern jene Richtlinien zu schaffen, die derartige Betriebe brauchen, um ordentlich und ehrlich arbeiten zu können.
In Österreich entwickeln sich viele junge Forschungseinrichtungen, die mit viel und fremdem Geld tätig sind, und bieten ein Potential. Sie leisten Großes in der Methodenentwicklung, sie leisten Großes auch in der Wertschöpfung, und wir sollten ihnen dabei helfen. Wir alle wollen ihre Ergebnisse, und daher sollten sie auch die notwendigen Rahmenbedingungen vorfinden, um gut arbeiten zu können.
Ich bin auch Landwirt, und ich verfolge die Diskussion um die Biopatentrichtlinie natürlich mit zweifachem Interesse. Ich möchte nicht, dass diese Diskussion, die ja in Wirklichkeit losgetreten wurde durch die Diskussion um die GVOs in der Landwirtschaft, zu einer massiven Veränderung unserer Sortenrechte, unserer derzeitigen landwirtschaftlichen Gesetzgebung führt. Das brauchen wir nicht. – Ich wundere mich gerade, dass sich Kollege Pirklhuber Sorgen macht, denn er als Biobauer braucht ja die GVOs ohnedies nicht und wird daher nie Patente zahlen müssen. Aber wir alle wissen nicht, was auf uns zukommt, und daher wollen wir sicherstellen, dass wir nicht ein böses Erwachen erleben und die dritten Zahler sind in einem Prozess, der uns nicht gefällt.
Wir haben aus der gesetzlichen Regelung für die Sorten sehr viel Erfahrung mit dieser Art von Rechtsmaterie. Daraus ist viel zu lernen, und ich denke, dass es gut wäre, diese Erfahrungen im parlamentarischen Prozess einzuarbeiten und nicht umgekehrt ein Gesetz über die Sortengesetze drüberzustülpen und doppelt zu regeln, was schon gut geregelt ist.
Wir haben das Landwirteprivileg – ein wunderschönes Wort, leider kann ich damit nicht sehr viel anfangen, aber es ist zumindest klargestellt, dass Nachbau patent- und lizenzfrei sein soll. Das muss auch heißen, dass in jedem Fall beim Züchter die Kette der Rechtsfolgen endet und der Landwirt selbst beim alten Sortenrecht bleiben muss.
Ich will ganz besonders an meine Kollegen im Parlament appellieren, dass wir in dieser Frage rasch, zügig und erfolgsorientiert verhandeln. Es gibt sicherlich noch Argumente, aber erstes Ziel muss es sein, dass wir rasch umsetzen. Österreich ist ein kleiner Standort, es soll ein guter Standort sein, weil wir gute Regeln anbieten und Rechtssicherheit und Klarheit für jene Leute, die in diesem Bereich arbeiten, und auch für die Investoren.
Für uns als Politiker und Parlamentarier – ich appelliere an alle – gilt es, die Verantwortung zu übernehmen, in dieser Frage zu einer Entscheidung zu kommen, und nicht zu versuchen, die Dinge abzuschieben auf irgendeine zweite Diskussion in Brüssel oder irgendwo sonst auf dieser Welt. Wenn wir krank sind, sind wir alle sehr froh, wenn wir die Produkte nutzen können, und fragen nicht, wer die Verantwortung dafür übernommen hat.
15.24
15.24
Dr. Kurt Konopitzky (Österreichische Gesellschaft für Biotechnologie): Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Biopatentrichtlinie schafft Rechtssicherheit darüber, was im europäischen Raum patentierbar, was nicht patentierbar ist. Sie gibt klare Auskunft darüber, dass Leben nicht patentierbar ist, wenn man der Auffassung folgt, dass ein paar Moleküle kein Leben sind.
Warum ist diese Rechtssicherheit in diesem globalen Umfeld so wichtig? Wir können gerade beobachten, dass die Universitäten privatisiert werden. Die Universitäten werden aufgefordert, sich durch entsprechende Technologieverwertung ihr Kapital selbst zu organisieren. Das geht aber nur unter den entsprechenden Rahmenbedingungen.
Normalerweise ist es so, dass ein Wissenschafter an einer Universität, der eine Erfindung macht, diese erst einmal schützen muss. Er hat sonst nichts, er hat nur diese Erfindung. Er hat kein Kapital, er hat keine Firma hinter sich, nichts, er muss seine Erfindung zuerst einmal patentieren lassen. Als nächsten Schritt muss er sie veröffentlichen, publizieren, möglichst in einem guten internationalen Paper. Dann kann er nationale, internationale Netzwerke nutzen und auf sich aufmerksam machen. Neben diesen internationalen Kooperationen kann er im Land mit den entsprechenden staatlichen Institutionen über Fund-Raising, über Firmengründungen, über nationale und internationale Kooperationen diskutieren. Diese kommen dann wieder der Universitätsfinanzierung zugute, sie kommen der Errichtung von Start-up-Companies in unseren Cluster-Centers zugute und können teilweise den Brain Drain, der in großem Ausmaß stattfindet – 50 Prozent unserer guten Wissenschafter wandern jetzt schon ins Ausland ab –, stoppen.
Was ist die Alternative? – Die Wissenschafter wandern ab, sie nehmen ihr Know-how mit, sie gründen ihre Start-up-Companies im Ausland, sie machen im Ausland hervorragende Karrieren und Österreich profitiert in keinster Weise – außer dass es die Ausbildung dieser Wissenschafter bezahlt hat. Big Pharma verlagert. Ich darf Sie daran erinnern, dass es in Deutschland vor wenigen Jahren noch sieben große forschende, produzierende Pharmafirmen gab. Mittlerweile sind es vier, und in Kürze sind es nur noch drei.
Die Bioethik-Kommission hat Ja zu dieser Biopatentrichtlinie gesagt, wohl wissend, dass es ein Spannungsfeld gibt, in dem sich Ethik und Wirtschaft befinden; nicht nur bei dieser Biopatentrichtlinie, Ethik und Wirtschaft werden sich immer in einem Spannungsfeld befinden. Dieses ist einfach unauflösbar, aber es wurde ein sehr gutes Tool, ein Monitoring geschaffen, um zu beobachten, wie die Umsetzung der Richtlinie stattfinden, wie die Rechtsprechung erfolgen wird. (Abg. Dr. Glawischnig übernimmt den Vorsitz.)
Folgenden Punkt möchte ich noch gerne aufnehmen: Wissenschafter an Universitäten, in kleinen Firmen und in der Industrie agieren ethisch und verantwortungsvoll. In der Diskussion kommt aber immer sanft der Unterton, man müsse sie regulatorisch genau eingrenzen, sonst geschehe irgendetwas. 1975 haben sich in Asilomar die besten Wissenschafter der Welt getroffen und eine Selbstbeschränkung durchgeführt. Erst 15 bis 20 Jahre später wurden die ersten regulatorischen Werke, die Gentechnik-Gesetze, in Europa durchgeführt. – 15 bis 20 Jahre lang ist nichts geschehen, was den Menschen irgendwo geschadet hat! Genau genommen haben die nationalen Richtlinien auf den alten Asilomar-Richtlinien aufgebaut und diese umgesetzt.
Ich möchte noch kurz erinnern: Vor 15 Jahren hatten wir eine große Diskussion in Österreich über die Anwendung der Gen- und Biotechnologie in der Medizin und in der Pharmazie. Harter Wind blies uns entgegen. – Wir haben mittlerweile 150 Arzneimittel auf der Welt entwickelt, Hunderte von assays, wir haben Millionen von Menschenleben damit retten können. Insulin ist heute schon angesprochen worden, AIDS-Tests gäbe es keine, eine Chemotherapie ohne Erythropoietin ist ein hartes Brot, wenn überhaupt möglich.
Meine Damen und Herren! Österreich hat vor fünf Jahren mit breitem parlamentarischen Konsens diese Richtlinie in Brüssel mitbeschlossen, Österreich hat die Ethik-Kommission befragt – Österreich hat nun von Brüssel die erste Klage erhalten; die erste kostet noch nichts, die nächste wird teuer. Österreich braucht langfristig kalkulierbare politische, wirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen, denn es ist einfach so: Wenn wir nicht mitmachen, dann wird die Entwicklung ohne uns stattfinden, und wenn wir nicht dabei sind, können wir diese Entwicklung auch nicht beeinflussen und nicht mitreden.
Es ist eine Form von Naivität zu glauben, dass wir in diesem globalen Umfeld irgendetwas aufhalten können. Wir können es nur mitbestimmen, und das können wir aber nur, wenn wir dabei sind und mitmachen.
Meine Damen und Herren! Ich hoffe, dass Sie diese Biopatentrichtlinie umsetzen – zum Wohle unseres Landes. Damit wir das, was die Biotech-Society vorhat, nämlich 3 000 Arbeitsplätze in den nächsten zwei bis vier Jahren zusätzlich zu gründen, umsetzen können, brauchen wir die entsprechenden Rahmenbedingungen. Das sind dann auch hoch qualifizierte Arbeitsplätze, die nicht vom Osten bedroht sind.
15.29
Vorsitzende Abgeordnete Dr. Eva Glawischnig: Nächster Redner ist Herr Universitätsprofessor Dipl.-Ing. Dr. Kuchler. – Bitte.
15.30
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Karl Kuchler (Dialog Gentechnik): Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich vertrete hier „Dialog Gentechnik“. Das ist ein gemeinnützig geführter Verein, der ausschließlich wissenschaftliche Gesellschaften als Mitglieder hat. Alle unsere Aktivitäten sind rein öffentlich finanziert. Wir haben verschiedene Mitgliedsgesellschaften, daher ist es schwierig, hier eine einheitliche Meinung widerzuspiegeln. Unser Interesse liegt in einer breiten öffentlichen Diskussion und einem breiten Diskurs.
Ich möchte die Punkte von „Dialog Gentechnik“ in sechs Punkten darlegen.
Erstens: „Dialog Gentechnik“ stellt fest, dass das Verständnis für Patente und ein Grundwissen über Patente in der Bevölkerung de facto nicht ausgeprägt sind. „Dialog Gentechnik“ bedauert außerordentlich die fehlende Rationalität in der Diskussion. Es werden hier Informationen bewusst oder unbewusst falsch oder aus dem Kontext heraus interpretiert und an die Öffentlichkeit gebracht. Wir haben heute einige Beispiele davon gesehen.
Zweitens: „Dialog Gentechnik“ stellt fest, dass der Diskurs in den Medien durch die Diskurspartner zum Teil sehr emotional, polemisch und, wie gesagt, inhaltlich falsch geführt wird. Dadurch wird die Unsicherheit in der Bevölkerung maßlos übersteigert und Stichworte wie: Patente auf Leben ist gleich Genpatent, oder Patente auf Schweine-Mensch-Chimären oder Patent auf Stammzellen in der Form sind durch die Biopatentrichtlinie inhaltlich nicht gerechtfertigt. Wir brauchen jetzt keinen Aktionismus, wir brauchen einen konstruktiven Diskurs.
Drittens: „Dialog Gentechnik“ anerkennt und erkennt die Notwendigkeit der Patentierung im Bereich Biotechnologie, aber es gibt auch bei einigen bestehenden Patenten Probleme. Ich möchte noch einmal auf das Patent von Myriad Genetics hinweisen und möchte auch hervorheben – und das ist vielleicht von Interesse –, dass eine österreichische Gesellschaft, ein Mitglied von „Dialog Gentechnik“, dieses Patent beeinsprucht hat. Derzeit sieht es rechtlich so aus, dass von diesem Patent nicht sehr viel übrig bleiben wird.
Viertens: „Dialog Gentechnik“ befürchtet bei langfristigen Verzögerungen einen großen Schaden für die österreichische, für die nationale, aber auch für die europäische Forschungslandschaft. Ich muss leider wieder das Stichwort „brain drain“ strapazieren. Die Forscher werden aus Österreich abwandern, und wir werden nicht mehr kompetitiv bleiben können. Es ist daher nur eine harmonisierte Lösung für Europa denkbar. Eine Insellösung für Österreich ist nicht durchsetzbar, macht keinen Sinn und daher sind alle aufgerufen, hier gemeinsam, konstruktiv an einer harmonisierten Lösung zu arbeiten.
Fünftens: „Dialog Gentechnik“ hofft auf eine effiziente, möglichst korrekte und konsensuale Umsetzung der Ratifizierung der Biopatentrichtlinie. Dabei sollte die Wahrung der Informationspflicht an die Öffentlichkeit beibehalten werden.
Sechstens und schlussendlich: „Dialog Gentechnik“ schlägt eine Informationskampagne vor, um die Öffentlichkeit entsprechend zu informieren und über den Sinn und die Bedeutung von Patenten aufzuklären.
Wir wollen keine Schlagworte, wir wollen keinen Populismus, wir wollen faktisch richtige Informationen über Sinn und Zweck von Patentierungen herausbringen. Das wird schlussendlich auch die politische Entscheidung erleichtern. Und das gilt, nebenbei bemerkt, auch uneingeschränkt für die mediale Berichterstattung.
15.33
15.33
Hans Schaller (Novartis): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Herren Minister! Sehr geehrte Damen und Herren! Es ist schon so vieles gesagt worden, dass mir nur noch sehr wenig zu sagen übrig bleibt. Als Vertreter der Pharmaindustrie, im Namen von Novartis, als European Patent Attorney und auch im Namen der Rinter-AG-Patent-Ingenieure freue ich mich über die Ausführungen unserer Herren Minister, die im Prinzip die Biopatentrichtlinie implementieren wollen, was natürlich ganz in unserem Sinne ist.
Ich habe nur eine Anmerkung zum Stoffschutz von biotechnologischem Material, sprich Genen. Der Unterschied zwischen chemischen Verbindungen und biologischem Material ist nicht so gravierend, wie hier teilweise dargestellt worden ist. Der Stoffschutz für chemische Verbindungen ist seit seiner Einführung eigentlich nie in Frage gestellt gewesen, und es ist so, dass eine chemische Verbindung auch ähnlich wie ein Gen wirkt. Ein Gen hat verschiedene Funktionen, das ist klar. Auch eine chemische Verbindung wirkt an verschiedenen Orten im Körper.
Es ist bereits erwähnt worden, dass das Aspirin, das als Schmerzmittel entwickelt wurde, später als Herzmittel erkannt wurde. Grund dafür ist, dass der Stoff nicht nur an einer Stelle im Körper wirkt, sondern eben an verschiedenen Stellen. Genauso ist das aber auch bei einem Gen oder bei biologischem Material. Ich sehe daher keinen so gravierenden Unterschied und kann diese Infragestellung des Stoffschutzes für DNA und so weiter eigentlich nicht als Thema sehen. Ich befürworte, dass das so bleibt sowie die Implementierung der Richtlinie natürlich in erster Linie.
15.35
15.36
Dr. Ingrid Schneider (Universität Hamburg, Forschungsgruppe Medizin/Neurowissenschaften): Sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte mich in meiner Antwort vor allem auf die Fragen von Herrn Dr. Grünewald und Frau Kerschbaum beziehen, auf die Frage nach den nationalen Spielräumen bei der Implementierung, und ich möchte auf jeden Fall darauf hinweisen, dass relativ weite nationale Spielräume vorhanden sind.
Ich zitiere jetzt aus dem Monitoring-Bericht der Europäischen Kommission. Die Kommission hat den Schluss gezogen – Zitat –, ... dass der Schutzumfang der Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen gewährt werden kann, weiterhin ein aktuelles Thema bleibt, das zu unterschiedlichen Auslegungen Anlass geben kann.
Das heißt, implizit wird damit den nationalen Mitgliedstaaten eine Funktionsbindung des Stoffschutzes zugestanden. Es gibt tatsächlich – wie auch die Diskussionen in anderen Ländern, in Frankreich, in Deutschland, in Belgien, in den Niederlanden und in weiteren Mitgliedstaaten zeigen – überall eine Debatte darüber, dass die Genpatente zu breit sind. Da befindet sich Österreich überhaupt nicht in einer Inselsituation, sondern das ist eine Einschätzung, die wirklich international auch von Fachleuten geteilt wird.
Die Frage ist jetzt: Wie setzt man das um? – Es gibt andere Möglichkeiten, das muss nicht das Parlament machen. Man kann das beispielsweise alles der Industrie selbst überlassen, sie soll das selbst regulieren. Die Big Players sind da im Vorteil, sie können über Kreuzlizensierungs-Abkommen zu breite Stoffpatente einschränken und können sich gegenseitig Lizenzen gewähren. Die Start-ups und die mittelständischen Unternehmen sind in dem Fall im Nachteil, weil sie eben nicht diese breiten Genpatente in dem Umfang haben. Sie setzen zwar Patente als Bargaining Chips ein, um sich einzukaufen, um Medikamente zu entwickeln, aber das benachteiligt im Grunde die kleineren Unternehmen, wenn man es der Selbstregulierung der Industrie überlässt.
Selbstregulierung könnte man auch seitens der Wissenschaft machen. Man könnte versuchen, über großzügige, nicht exklusive Lizensierungspraxen diese Zielkonflikte zwischen Wissenschaft und Ökonomie zu bewältigen. Aber auch da ist die Frage, ob sie das tatsächlich leisten können.
Eine andere Option sind die Patentämter, sei es auf nationaler Ebene oder auf europäischer Ebene. Natürlich wird es Widerspruchsverfahren beim Europäischen Patentamt geben, und es werden dann einzelne Patente von den claims her zurechtgestutzt, aber das wird sich auf wenige spektakuläre Fälle beschränken. Das reicht nicht aus für die Gesamtheit der zu breiten Genpatentierung. Man kann auch nicht davon ausgehen, dass das Europäische Patentamt selbst durch eine Verschärfung der Patentierungsprüfkriterien dem Problem gerecht wird.
Es kann auch sein, dass es auf nationaler Ebene eine richterrechtliche Entscheidung auf der Ebene des Bundespatentgerichtes geben wird, dass das also in einem Fall bis auf die Ebene des Bundespatentgerichtshofs durchexerziert werden wird und dass dann eine Entscheidung vielleicht für Österreich oder andere Länder getroffen wird, die dann insgesamt auch rückwirkend die Reichweite aller Genpatente zurechtschneiden wird. Das ist möglich, aber es ist bisher Spekulation, ob es dazu kommen wird. Es kann auch in den nationalen Mitgliedstaaten zu unterschiedlichen rechtlichen Setzungen kommen, und dann hätten wir die Zersplitterung, die eigentlich mit der EU-Biopatentrichtlinie verhindert werden sollte, national auf der Ebene des Richterrechts erreicht.
Ich denke, dass es die vornehme Aufgabe gerade der Politik und des Parlaments sein sollte, diese Gestaltungsmacht zu nutzen – und nicht darauf zu warten, dass der Ball auf der anderen Seite angestoßen wird, sondern das wirklich in die Hand zu nehmen. Und sofern Sie sich jetzt entschließen sollten, diese Biopatentrichtlinie zu implementieren und nicht auf eine völlige Neuverhandlung zu setzen, dann bestünde diese Aufgabe eben darin, dass Sie diese Gestaltungsspielräume wirklich nutzen und dass Sie eine Balance herstellen zwischen den patentrechtlich zugestandenen Monopolen einerseits und andererseits aber auch dem, was der Erfinder an Leistung vorzeigen muss. Meines Erachtens wäre eine Funktionsbindung in dieser Frage eine ganz wichtige Sache.
Ich möchte noch auf das Beispiel Humaninsulin eingehen, das hier mehrfach genannt wurde. Da muss man einfach von der Sache her widersprechen: Humaninsulin ist nie mit absolutem Stoffschutz geschützt gewesen (Abg. Mag. Hakl: Das Gen!) – auch das Gen nicht –, sondern es ist in diesem Fall das Verfahren geschützt worden, weil Insulin als Stoff bereits lange bekannt war und damit die Neuheit überhaupt nicht gegeben war. Deswegen wurde nur ein Verfahren patentiert.
Das zeigt, dass absoluter Stoffschutz gar nicht nötig ist, um trotzdem der Industrie Möglichkeiten zu geben, auch in eingeschränkteren Umfängen die Patente ... (Neuerlicher Zwischenruf der Abg. Mag. Hakl.) – Nein, das Gen hat keinen Stoffschutz! Entschuldigung, ich habe mich wirklich länger damit befasst. Bei Humaninsulin war das Insulin schon vorher bekannt, und man konnte es daher nicht als Stoff patentieren.
Eine weitere wichtige Sache ist die Verankerung des Persönlichkeitsschutzes. In der Richtlinie ist das in Erwägungsgrund 26 behandelt. Ich würde Sie auffordern: Nehmen Sie sich ein Beispiel an einem belgischen Gesetzentwurf und schreiben Sie den Erwägungsgrund 26 als Artikel in Ihr nationales Patentgesetz hinein, denn die Persönlichkeitsrechte der Menschen, die ihre Körpersubstanzen abgeben, müssen wirklich auch im Hinblick darauf geschützt werden, dass sie entscheiden sollen, ob sie einer kommerziellen Verwertung zustimmen oder das nicht tun. Und das ist nicht alleine Sache des Medizinrechtes, sondern muss auch patentrechtlich verankert werden.
Ich muss wirklich sagen: Nutzen Sie Ihre Gestaltungsaufgabe als Parlament – das ist Ihre Funktion! Sie sollten das nicht anderen Ebenen überlassen, sondern da initiativ werden.
Wir haben in anderen Bereichen eine Diskussion über „sunset clauses“ bei Gesetzen; da soll nach fünf Jahren automatisch eine Revision stattfinden. Die EU-Biopatentrichtlinie ist schon viel älter, und man muss wirklich schauen, dass man diesen Prozess jetzt über eine Funktionsbindung und andere Mittel anstößt, damit auch auf europäischer Ebene die Kommission gedrängt wird, dort weiter strukturierend vorzugehen und diese Missverhältnisse wirklich auszuräumen.
15.43
15.43
Dr. Christine Godt (Universität Bremen, Zentrum für Europäische Rechtspolitik): Ich denke, es zeichnet sich schon ab, in welche Richtung die Diskussion gehen wird, und ich würde diese Richtung auch aus tiefstem Herzen unterstützen. Meiner Beobachtung nach ist auch im Laufe des Tages klar geworden: Die Diskussion verschiebt sich – jedenfalls was den nationalen Umsetzungsprozess betrifft – weg von der Frage des Ob des Patentschutzes hin zur Frage des Umfangs.
Ich halte diese Verschiebung der Diskussion für richtig, und zwar aus zwei Gründen: Die Diskussion im Europäischen Parlament war ja in ganz hohem Maße von der Sorge getragen, inwieweit die Würde des Menschen im Biopatent verloren geht. Diese Frage lässt sich im Bereich des Umfangs viel besser zuschneiden – Frau Schneider hat Ihnen eben einen Vorschlag dazu unterbreitet. Auch als Gegenrechte, also Persönlichkeitsschutzrechte als Gegenrechte zum Patent, lässt sich das wahrscheinlich viel besser und präziser ausformulieren.
Die Verschiebung vom Ob zum Wie halte ich allerdings auch unter einem zweiten, wirtschaftspolitischen Aspekt für sinnvoll, und da möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die Qualität von Fortschritt und Forschung insgesamt lenken.
Forschung vollzieht sich in kumulativen, kleinen Schritten. Heute wurde mehrmals das Argument dahin gehend formuliert, dass Patentschutz als solcher wichtig für die Forschung sei. Ich würde es präziser formulieren und sagen: Für die Forschung ist es wichtig, den Patentschutz schmaler zu schneiden. Patentschutz muss verfügbar sein, damit gerade dieser Leistungsindikator auch verfügbar ist; aber Investitionskapital fließt auch nur dann, wenn das ganze Forschungsfeld noch nicht als solches „vermint“ ist. Und dafür ist es wichtig, den Patentschutz auch angemessen zuzuschneiden. Das ist eine Frage des Wie und nicht mehr des Ob.
Es werden viel zu viele Hoffnungen auf das Forschungsprivileg gesetzt. Es sei nochmals in Richtung der Universitäten gesagt: Es wird immer der Eindruck vermittelt, dass die Universitäten nicht ein patentrechtsfreier Raum, aber jedenfalls ein Raum sein werden und bleiben werden, der von den Patentansprüchen Dritter uneingenommen bleiben wird. – Das wird in Zukunft ganz bestimmt nicht der Fall sein! All jene, die Patente beziehungsweise die die Patentregeln für sich in Anspruch nehmen – und das ist von den öffentlichen Forschungsförderungen, von den Forschungseinrichtungen als solchen und von den einzelnen Wissenschaftern in der Forschung als solche gewollt –, können nicht erwarten, dass sie selbst von den Ansprüchen Dritter ausgenommen werden. Ich halte das – Forschungsprivileg als solches – für einen Trugschluss.
Das Forschungsprivileg, so wie es in den nordeuropäischen nationalen Patentgesetzen festgeschrieben ist, ist ein ausschließliches Versuchsprivileg und kein Forschungsprivileg, und es ist damit deutlich enger geschnitten. Natürlich wird es so sein, dass, wenn durch die Forschung an den Universitäten industrielle Interessen beschnitten werden, auch dort die Diskussion losbrechen wird. Ich halte das für eine Rationalität, die jetzt in der Umstrukturierung der Universitäten drinnen liegt.
Im Folgenden nochmals zu Frau Kerschbaum, die fragte, ob die Funktionsbindung überhaupt richtlinienkonform ist. – Meine Antwort – und das möchte ich jetzt noch einmal klarstellen – ist: Allein die Funktionsbindung ist richtlinienkonform.
Wenn man die Erwägungsgründe 23 und 24 und Artikel 9 zusammen liest, dann kann gar nichts anderes dabei herauskommen. Dass wir heute immer noch vom absoluten Stoffschutz reden, das haben wir der patentrechtlichen Dogmatik zu verdanken, den Denkmustern, die in all unseren Köpfen stecken. Das Europäische Parlament hat etwas anderes gewollt.
Nächster Punkt: Einen ganz interessanten Aspekt gab es zur Frage, ob wir einen Anmeldungstourismus erwarten müssen, ähnlich wie wir das aus dem Vertragsrecht zum Forum Shopping kennen.
Meine Antwort darauf ist nein, und zwar aus zwei Gründen: Wir reden hier vom Umfang des Patents und nicht von den Ansprüchen. Insofern wird sowieso dasselbe angemeldet, insofern sind die Ansprüche wahrscheinlich gleich formuliert.
Der Tourismus macht aber deshalb keinen Sinn, weil das ja nur dann der Fall wäre, wenn die Wirkung im Ausland auf Österreich zurückwirken könnte, so wie das beim Vertragsrecht der Fall ist: Wenn wir einen Titel in England oder in Frankreich erwirken, dann können wir ihn in Österreich vollstrecken. Im Patentrecht geht das ja nun gerade nicht, weil es fest im Territorialprinzip verhaftet ist, sodass es überhaupt keinen Sinn macht. Also wir können ein in England erwirktes Patent in Österreich nicht zur Wirkung bringen. – Das ist meine Antwort.
15.49
15.49
Dr. Ernst Leitner (Wirtschaftskammer Österreich): Herr Vizekanzler! Herr Minister! Sehr geehrte Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Nach all den teilweise sehr grundlegenden Diskussionen, spezifisch über die Frage: Stoffschutz oder nicht?, möchte ich Ihnen jetzt einmal etwas aus der praktischen Sicht erzählen.
Ich bin Vorsitzender der Austrian Biotech Industry, und zugleich leite ich schon über sehr lange Zeit – Sie sehen es an meinem schütteren Haar – eine größere Forschungseinheit in Österreich, in Kundl, und als solche sind wir über Jahrzehnte mit dem praktischen Umgang mit Patenten beschäftigt.
Unsere Tätigkeit dort ist: Wir machen Biotech. Das heißt, wir machen auch Biotech-Patente. Wir machen aber auch Generika, das heißt, wir challengen Patente. Ich sehe daher diese Situation von beiden Seiten, und ich möchte dazu auch noch Stellung nehmen.
Aber vorher: Wie ist die Sache in Österreich? – Biotech in Österreich ist heute noch gar nicht so sehr angesprochen worden. Sie wissen, es gibt drei große produzierende Firmen in Österreich, es gibt aber dankenswerterweise mittlerweile auch eine Reihe von Start-up-Companies, Ausgliederungen – teilweise oder ganz – von Universitäten, die in Österreich Biotech machen.
Damit Sie nur eine ungefähre Dimension von dem haben, was Biotech in Österreich ist: Die Umsätze betragen momentan etwa 1,4 Milliarden €. Wir sind mit dieser Größenordnung ein größerer Wirtschaftszweig, und das Wachstum ist dramatisch. Wir erwarten uns um das Jahr 2010 deutlich mehr als 2 Milliarden € Umsatz der Biotech in Österreich – wobei der Großteil dieser Umsätze patentabhängig ist, das möchte ich hiemit betonen.
Wir haben momentan etwa 6 500 Leute in Österreich, die in Biotech arbeiten, und davon etwa 2 500 in Forschung und Entwicklung. Das heißt, wenn man das mit unserer Einwohnerzahl vergleicht, dass wir in Österreich nicht schlecht liegen und wir haben sehr, sehr gute Ergebnisse in allen Lagern: Wir haben tüchtige Firmen, es wird aber auch sehr, sehr gute Grundlagenforschung auf den Universitäten betrieben. Und dies gilt es zu schützen.
Ich komme jetzt ein wenig auf den Patentschutz zu sprechen. Ich habe schon vorher gesagt, dass ich hier spreche, weil ich quasi zwei Hüte habe: Auf der einen Seite mache ich Biotech-Patente, auf der anderen Seite challenge ich Patente.
Was ist der Ausgangspunkt? – Der Ausgangspunkt sind die TRIPS-Regulationen, also die weltweiten Patentrechte. Diese Patentrechte sind fixiert, und um diese werden wir nicht herumkommen. Ihr Anspruch, was die Ethik betrifft, ist allerdings ein marginaler.
Was ist jetzt bei der EU neu? – Es gibt Präzisierungen in verschiedene Richtungen; zwar nicht alles – das stimmt –, aber es gibt wesentliche Präzisierungen, und es gibt erstmals Ethik. Es gibt Ethik in einem Patentrecht – sofern es umgesetzt wird –, und zwar eine Ethik, die, so glaube ich, bislang von keinem bezweifelt worden ist. Es ist ein erster Schritt in diese Richtung.
Was ist mit den Patenten an sich? – Ich habe gesagt, die Industrie in Österreich überhaupt – sowohl die Großen als auch die Kleinen – hängt von den Patenten ab. Aber es ist nicht nur die Industrie, die davon abhängt, es werden zusehends auch die Universitäten sein.
Vor zwanzig Jahren hat in Österreich daran noch keiner gedacht, aber ich sage Ihnen: Wenn Sie vor zwanzig Jahren mit einer amerikanischen Universität eine Kooperation eingegangen sind, dann war der Erste, mit dem Sie zu tun hatten, der lawyer. Dieser hat nämlich nachgeschaut, ob da Patentrechte kommen.
Das ist sukzessive gekommen, und ich möchte ganz stark an die Universitäten appellieren: Wenn sie jetzt selbständig sind und über ihr Budget selbst wachen müssen, dann ist das eine ganz grundlegende Sache! – Ich rede jetzt gegen meinen Job, aber wir machen üblicherweise Verträge mit den Universitäten dahin gehend, dass das Patentrecht bei den Leuten, die die Erfindungen gemacht haben, bleibt. – Das ist diese Richtung.
Eine andere Geschichte: Wir haben immer gemeint, und auch aus der Diskussion am heutigen Nachmittag ist das hervorgegangen, dass Patente unüberwindliche Mauern wären. – Dem ist nicht so: Patente schützen ganz bestimmte Dinge – und wenn sie sehr breit sind, dann sind sie zwar breit, aber sie schützen wenig, weil sie sehr angreifbar sind.
Man kann alle Patente challengen, in allen Richtungen. Und glauben Sie mir: Es gibt Konkurrenz, wir sind nicht allein auf der Welt! Das heißt, die Konkurrenten schauen sich die Patente sehr, sehr genau an und schauen, wie weit sie diese umgehen können. Und es gibt Generika-Firmen, die nach Ablauf von Basispatenten noch einmal genau nachschauen, ob an diesen Patenten noch irgendetwas ist oder, wenn es Verlängerungen gibt, ob diese Patente angreifbar beziehungsweise zu umgehen sind.
Ich kann Ihnen sagen, da gibt es jede Menge Möglichkeiten! Wenn ich zurückkomme auf die Frage der Stoffpatente, dann war das heute auch so ein Thema: Um Gottes willen, Stoffpatente! – Was soll’s? Stoffpatente gelten maximal zwanzig Jahre für einen fix definierten Stoff. Dabei hat die Firma sicher schon drei bis fünf Jahre, wenn es sich um normale Stoffe wie Diagnostika handelt, und zehn bis zwölf Jahre, wenn es ein pharmazeutisches Präparat ist, gearbeitet, bevor der Stoff überhaupt auf den Markt gekommen ist. Das heißt, es bleiben noch irgendwo zwischen zehn und fünfzehn Jahren Zeit, in denen man das nutzen kann.
Außerdem ist ein Stoffpatent, wie schon aus dieser Bezeichnung hervorgeht, eben auf einen bestimmten Stoff fixiert. Und ich sehe, es besteht auch hier eine Möglichkeit – und wir sehen das als challenge –: Ein Stoff gibt den Hinweis, dass eine bestimmte Struktur eine Wirkung hat. Da kann ich doch meine Forscher darauf ansetzen und sagen: Findet mir eine ähnliche Struktur, die nicht gleich ist, aber die gleiche Wirkung hat! – und sofort kann ich das patentieren und bin auch im Geschäft. – Also so unüberwindlich ist es nicht.
Bei den Proteinen sowieso: Proteine sind relativ große Produkte. Auch da gibt es Möglichkeiten, durch einen abgewandelten Stoff sozusagen ein neues Patent oder ein abhängiges Patent zu bekommen, wobei man dann aber mit dem Originator wieder verhandeln kann.
Das heißt also, es sind nicht Dogmen, die da stehen und die 20 Jahre lang unantastbar sind. Wir brauchen nur aus der „normalen“ Pharmaindustrie zu lernen. Wenn Sie sich das Feld der Statine anschauen, dann finden Sie da eine breite Palette von Verbindungen. Ebenso bei den Antibiotika: In allen Variationen gibt es diese Dinge! – Das sind schlicht und einfach Umgehungen des Stoffpatentes. Man hat eine neue, ähnliche Struktur gemacht, hat sie patentiert, und das gilt. – Also ich sehe es nicht so dramatisch, auch von der Zeit her nicht.
Die zweite Richtung der Patente sind die Verfahrenspatente. Ich kann Ihnen sagen, die Originatoren sind immer cleverer geworden und bauen, spezifisch bei biologischen Verbindungen, enormen Patentschutz auf.
Ein Beispiel: Ich habe einen Mitarbeiter vor zwei, drei Jahren gebeten, nachzuschauen, wie viele Verfahrenspatente es für einen bestimmten Stoff gibt. Er hat im Computer nachgeschaut und gesagt: Etwa 1 500. – Dann habe ich gesagt: Und jetzt schau bitte nach, wie fundiert diese Patente sind und ob es Möglichkeiten gibt, das zu umgehen. – Nach zwei Monaten ist er gekommen und hat gesagt: Es gibt da eine Möglichkeit, durch die man vielleicht mit einem wirtschaftlich vertretbaren Verfahren zum gleichen Stoff kommen kann, der patentmäßig frei ist. – Also Patente sind challenges: Die kann man angreifen, die kann man umgehen. Es ist nicht so schlimm.
Zweitens möchte ich, was das „Patent auf Leben“, dieses Schlagwort, das da gebraucht wird, betrifft – abgesehen davon, dass Leben in vieler Leute Besitz ist, die damit umgehen und damit tun, was sie wollen –, nur Folgendes sagen:
Wir brauchen transgene Organismen für die Forschung – das ist überhaupt keine Frage. Und noch etwas: Wir brauchen für unsere Produktion transgene Mikroorganismen, Zelllinien und vielleicht später auch einmal etwas anderes.
Wenn Sie das in Österreich untersagen, dann kann man sagen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, wann diese Produktionen in Österreich nicht mehr stattfinden werden. Wenn keine Rechtssicherheit mehr gegeben ist, dann werden sie dahin sein, das sage ich Ihnen eindringlich. Und ich habe Ihnen gesagt, in knapp zehn Jahren reden wir von einem Umsatz in der Höhe von mindestens 2 Milliarden € in Österreich, der weitgehend ins Ausland geht.
Abschließend: Ich bin dafür, dass man das umsetzt – unbedingt. Es ist wichtig für die Leute hier, es ist absolut wichtig für die Forschung. Wir sollten es schnell machen, denn auch Deutschland hat entschieden, das jetzt umzusetzen – und sie haben genau jene Argumente, die wir heute gehört haben, auch gehört. Sie haben sich entschlossen, es trotzdem zu tun.
Ein Monitoring kann ich mir vorstellen. Und wenn man für irgendwelche spezifische Gruppen Begleitmaßnahmen braucht, wie der Herr Vizekanzler heute gemeint hat, dann würde ich sagen, man soll darüber nachdenken und es parallel dazu tun.
15.59
Vorsitzende Abgeordnete Dr. Eva Glawischnig: Ich bitte nun Herrn Dr. Baumgartner zum Rednerpult. – Bitte.
15.59
Univ.-Prof. Dr. Holger Baumgartner (Bioethik-Kommission beim Bundeskanzleramt): Meine Damen und Herren! Danke für die Möglichkeit, mich hier zu äußern. Die bisherige Diskussion beeindruckt mich vor allem durch ihren regionalen Bezug: auf die EU und auf Österreich. Aber sowohl die EU als auch Österreich agieren in einem globalen Umfeld, und dieses globale Umfeld wird ganz besonders durch die USA bestimmt.
Das US-Patentrecht unterscheidet sich in einigen wichtigen Punkten vom Patentrecht anderer Länder. In den USA werden geringere Anforderungen an den gewerblichen Nutzen gestellt.
In den USA gibt es provisorische Patente und einjährige „grace periods“, das heißt, Übergangsfristen, sodass die vage definierte „utility“ oder der vage definierte gewerbliche Nutzen für die Patenterteilung ausreicht. Man hat dann ein Jahr Zeit, um den Nutzen besser zu belegen. Das bedeutet einen eindeutigen Vorteil für Patentanmeldungen in den USA. Und schließlich wird in den USA auch über das Verfahren „first to invent“ gegenüber dem EU-Verfahren „first to file“ ein gewisser Vorteil verschafft.
Eine Publikation behindert in der EU also die Patentierung, hingegen behindert sie eine Patentierung in den USA nicht. Das heißt, dass das US-System einfacher ist. Aber es ist sicher auch primitiver, rechtsanfälliger, öffnet jedoch schnell den Weg zum US-Markt.
Die EU hätte den Vorteil, dass bei uns größere Rechtssicherheit herrscht. Aber das US-Verfahren ist, trotzdem es mit Rechtsunsicherheit behaftet ist, einfacher. Ich habe daher den Eindruck, dass die EU sich da verzettelt. Wir in Europa verzetteln uns. Es wäre viel besser, jetzt umzusetzen, dabei aber auf nationale Anliegen Rücksicht zu nehmen. Das, was etwa den Schutz von Personen, die nicht zustimmen können, betrifft, sollte man dann in einem Forschungsgesetz regeln. Die Schweiz ist dabei, ein Forschungsgesetz zu machen, Frankreich hat ein Forschungsgesetz, und auch Dänemark hat ein Forschungsgesetz.
Also noch einmal: National umsetzen, dabei unsere Anliegen berücksichtigen, mit dem Monitoring und Nachjustieren auf EU-Ebene danach trachten, dass dieser Prozess den Weg nimmt, den man offenbar auch aus den Erwägungsgründen kennt, und entsprechende Begleitmaßnahmen setzen, die zum Beispiel definieren, was nicht gemacht werden darf. Dafür wäre die „morality clause“ nach TRIPS-Übereinkommen, Artikel 27 oder der „ordre public“, öffentliche Ordnung, das Instrument. Dann würde die EU jene Kräfte freisetzen können, die wir hier verschwenden beziehungsweise verwenden, um international mitzugestalten.
Es geht um das TRIPS-Übereinkommen, es gilt, Druck auf die USA auszuüben. Das gelingt! Die USA hat auf internationalen Druck hin und auf Druck amerikanischer Wissenschaftler ihre Patentierungspraxis auf genomischer Ebene im Rahmen des Human-Genome-Projektes verändert. Die erhöhen jetzt die Anforderungen –„odd utility“.
Das wären Zielsetzungen, wo wir mitspielen müssen. Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, dass das Genom des SARS-Virus entschlüsselt ist. Was ist passiert? – Das CDC, das amerikanische Center for Disease Control – das ist eine öffentliche Einrichtung – hat eine präventive Patentierung betrieben, ebenso wie die British Columbia Cancer Association. Der „commercial arm“ der University of Hongkong hat auch patentiert. Jetzt müssen öffentliche Einrichtungen Patente aussprechen, um das patentierte Genom dieses Virus im öffentlichen Bereich zu halten. Da stimmt sicher international etwas nicht, allerdings wird sich nichts ändern, wenn Österreich nicht umsetzt. Wir müssen umsetzen, und die EU sollte ihre Ansichten mit aller Kraft in die internationale Diskussion einbringen.
Ich glaube, es sollte sich etwas bewegen, Österreich sollte mitmachen. Die Welt um uns bewegt sich, ob wir still bleiben oder nicht! Das ist meine Empfehlung.
16.03
Vorsitzende Abgeordnete Dr. Eva Glawischnig: Zu Wort gemeldet ist nun Herr Dr. Christoph Then. – Bitte.
16.04
Dr. Christoph Then (Greenpeace, Hamburg): Österreich sollte nicht nur mitmachen, Österreich sollte tatsächlich die treibende Kraft sein, auch im Bereich der Diskussion um die Biopatentierung. Insofern schließe ich meinem Vorredner an, wenn auch vielleicht mit einem anderen Akzent.
Eine kleine Vorbemerkung: Es ist mehrmals das Stichwort TRIPS-Übereinkommen gefallen. Das TRIPS-Übereinkommen zwingt uns nicht dazu, diese EU-Patentrichtlinie umzusetzen, sondern es sieht ausdrücklich vor, dass Pflanzen und Tiere vom Patentschutz ausgenommen werden können. Auch Entdeckungen können ausgenommen werden. Das heißt, es ist uns freigestellt, Gene als Entdeckungen oder Erfindungen zu definieren. Das TRIPS-Übereinkommen zwingt uns nicht zur Umsetzung dieser Patentrichtlinie. Die EU-Biopatentrichtlinie geht weit über das hinaus, was das TRIPS-Übereinkommen vorschreibt.
Ich möchte noch auf zwei Details der Richtlinie eingehen, um zu verdeutlichen, worum es hierbei eigentlich geht. Es ist immer wieder gesagt worden, die Richtlinie gebe uns klare Grenzlinien im Bereich der Ethik. Als Beispiel wurde der Fall aus Edinburgh genannt, wo das Europäische Patentamt unter Bezugnahme auf diese Richtlinie ein Patent auf einen menschlichen Embryo widerrufen hat. Das hat das Europäische Patentamt tatsächlich getan, und das finden wir gut. Es hat aber auch ausdrücklich festgestellt, dass der Widerruf des Patentes durch den Text der Richtlinie nicht gedeckt ist. Es ist im Grunde genommen eine Entscheidung der Einspruchskammer am Europäischen Patentamt, der untersten Kammer. Diese Entscheidung kann im Europäischen Patentamt unter Berufung auf die Richtlinie jederzeit gekippt werden. Das ist kein bereits etabliertes Recht, kein Spruchrecht am Europäischen Patentamt, sondern das ist ein Zwischenstand in einer Entwicklung, deren Ende nicht absehbar ist und zumindest durch die Richtlinie nicht definiert wird. Die Richtlinie besagt nämlich: Verfahren zur Klonierung menschlicher Lebewesen dürfen nicht patentiert werden. In der Richtlinie ist aber das Wort „menschliche Lebewesen“ nicht definiert.
Damit ist die ganze Frage: Ist ein menschlicher Embryo schon vor dem 14. Befruchtungstag überhaupt ein menschliches Lebewesen? völlig offen. Damit ist auch völlig offen, wo der Patentschutz tatsächlich greifen kann und wo nicht. Außerdem werden Patente auf Embryonen zu therapeutischen Zwecken in der Richtlinie sogar hervorgehoben, es wird ausdrücklich festgestellt, dass das möglich sein soll.
Zudem muss man wissen, dass das Europäische Patentamt in der schriftlichen Entscheidung dieses „Edinburgh“-Patentes, die im Juli 2003 veröffentlicht worden ist, ausdrücklich festgestellt hat, dass menschliches Gewebe – im Gegensatz zu dem widerrufenen Fall – sehr wohl patentierbar ist. Ausdrücklich werden erwähnt: menschliches Gewebe wie Organe, Gewebe aus menschlichen Föten, Blutzellen aus der Nabelschnur, Stammzellen von Adulten – all das wird vom Europäischen Patentamt nach dem Wortlaut der Richtlinie ausdrücklich als patentierbar angesehen. Das heißt, menschliche Organe, die inzwischen mehrfach patentiert worden sind – auch am Europäischen Patentamt –, sind Teile des menschlichen Körpers, die isoliert werden können, die im Sinne dieser Patentrichtlinie kommerziell verwertet werden können.
Ich möchte ein zweites Problemfeld kurz anreißen: Die Patentierung von Pflanzensorten ist auch schon angesprochen worden. Es gibt ein erteiltes europäisches Patent der Firma Monsanto, die inzwischen mehrere erteilte europäische Patente hält, das auf herbizidresistentes Saatgut, auf gentechnisch veränderte Pflanzen lautet. In diesem Patent wird nicht nur das Saatgut geschützt, sondern ausdrücklich auch der Anbau der Pflanzen. Das heißt, im Patent wird gesagt: Wir können dem Landwirt vorschreiben, welche Spritzmittel er anwenden soll!
Diese Patente reichen somit weit in den Bereich der landwirtschaftlichen Praxis hinein, weit über das hinaus, was derzeit noch im Sortenschutz üblich ist. Der Sorteninhaber verkauft seine Sorte an den Landwirt, und der Landwirt kann sie anbauen, wie er will. In diesem erteilten europäischen Patent, das auch im Einspruchsverfahren bestätigt worden ist – es ist also vom Europäischen Patentamt nicht widerrufen worden! –, steht ausdrücklich, dass das Saatgut, im Grunde genommen die Sorten, im Besitzrecht des Chemiekonzerns Monsanto stehen. Die Firma Monsanto kontrolliert auf Grundlage dieses Patentes in den USA natürlich den Vertrieb der Sorten und wird das auch hier in Europa tun, wenn derartige Patente tatsächlich wirtschaftlich relevant werden. Die Firma Monsanto wird mit Hilfe dieses Patentes die Sorten und den landwirtschaftlichen Anbau kontrollieren.
Das ist tatsächlich ein Systemwechsel in der Landwirtschaft. In Zukunft soll zwar der Patentschutz dort enden, wo der Sorteninhaber ist – das heißt, der Bauer soll nur einmal zahlen, nur an den Sorteninhaber –, wir werden aber amerikanische Verhältnisse bekommen. Dann ist nämlich der Sorteninhaber gleichzeitig der Patentinhaber, und all die mittelständischen Firmen, die es in Deutschland und in Österreich noch gibt, werden verschwinden, die werden sich in diesem Umfeld nicht behaupten können. Das heißt, die Firma Monsanto wird in naher Zukunft in verstärktem Maße der Anbieter von Sorten sein, die mittelständischen Pflanzenfirmen werden verschwinden, und der Bauer wird beim landwirtschaftlichen Anbau direkt der Firma Monsanto gegenüberstehen.
Das können wir, denke ich, nicht zulassen! Wir können leider das Europäische Patentamt auch nicht so korrigieren, dass wir das immer beobachten, Monitoring betreiben. Das macht Greenpeace seit ungefähr zehn Jahren, aber das funktioniert leider nicht. Es ist tatsächlich so, dass die gesetzlichen Grundlagen derartig schwammig und haltlos sind, dass man tatsächlich eine andere Gesetzgebung braucht.
Daher, denke ich, ist klar, dass eine Insel- oder Teillösung in Österreich hilfreich sein könnte, würde man versuchen, hier das Patentrecht auf die Bedenken eingehend, die hier geäußert worden sind, abzuändern, zu adaptieren. Was wir aber letztendlich brauchen würden, wäre eine europäische Gesetzgebung. Hierbei sollte Österreich tatsächlich ein Player sein, sollte nicht nur mitmachen, sondern sollte aktiv andere Regierungen zu einer gemeinsamen Initiative auf europäischer Ebene zusammenbringen, um dieses Patentrecht zu korrigieren.
16.09
Vorsitzende Abgeordnete Dr. Eva Glawischnig: Nächster Redner: Herr Professor Alexander von Gabain. – Bitte.
16.09
Univ.-Prof. Dr. Alexander von Gabain (Vereinigung Österreichischer Industrieller): Hohes Haus! Meine Damen und Herren! Ich bin der Vorstandssprecher der Intercell AG, einer Biotech-Firma, die es vor fünf Jahren noch nicht gegeben hat, die jetzt mit 100 Mitarbeitern neue vorbeugende, aber auch therapeutische Impfstoffe entwickelt und dazu von erstklassigen Kapitalgebern vor allem aus dem Ausland fast 100 Millionen Dollar nach Österreich geholt hat.
Ich bin beeindruckt, wie sachlich und gut diese Debatte geführt wird, dass alle verschiedenen Gesichtspunkte zur Sprache kommen. Dies ist sicherlich das richtige Forum, dieses Thema noch einmal zu diskutieren.
Eine Firma wie die unsere wird aus der Universität heraus gegründet, mit Patenten – ohne diese geht es nicht. Der nächste Schritt war, dass wir noch eine Menge Patente dazu bekommen haben. Wenn wir zum Beispiel neue Komponenten-Impfstoffe entwickeln – wir sind bei Hepatitis C inzwischen in der Phase II, und wir rücken mit einem vorbeugenden Impfstoff gegen das japanische Enzephalitis-Virus in die Phase III vor –, wenn wir also neue Impfstoffe entwickeln, brauchen wir auf die Gen-Abschnitte, die sozusagen für diese Eiweiß-Bruchstücke codieren, mit denen wir das Immunsystem trainieren, natürlich Patente.
Es ist gar keine Frage, dass wir Rechtssicherheit brauchen, denn es wird kein Investment von 100 Millionen Dollar in eine österreichische Firma geben, wenn ich zum Beispiel Investmentbankern von Goldman Sachs erklären muss, dass wir uns auf eine Insel zurückziehen. Es gibt kein Insular-Dasein, wir müssen vorwärts schauen! Selbstverständlich müssen wir die Ausführung der Patentgesetzgebung laufend beobachten.
Ich möchte noch einen Gesichtspunkt ansprechen, der heute überhaupt nicht zur Sprache gekommen ist. Mein Vorredner hat gesagt, dass die kleinen und mittleren Firmen keine Chance hätten. Ich sehe es genau umgekehrt: Es sind oft gerade die kleinen und mittleren Firmen und deren Projekte, für die sich sehr gut informierte Kapitalgeber – oft sitzen in den Beiräten dieser Kapitalgeberfirmen Nobelpreisträger – entscheiden, da dort wirklich neue, interessante Arzneimittel entwickelt werden können. Ein Beispiel sind die so genannten Orphan-Krankheiten, die wahrscheinlich – und die Kollegen von Big Pharma vergeben mir, dass ich das sage – nicht unbedingt auf der Agenda der großen Pharmafirmen liegen, also Krankheiten, von welchen in unserer Gesellschaft vielleicht nur jeder Hunderttausendste oder jeder Zehntausendste betroffen ist. Die einzige Hoffnung, gegen diese Krankheiten neue Wirkstoffe zu entwickeln, wird die Gentechnologie sein, natürlich auch nur wieder mit der Rahmenbedingung eines sicheren Patentschutzes.
Ich möchte Ihnen einen Fall schildern, der neulich in der Zeitung „The Wall Street Journal Europe“ stand und sehr interessant ist: Ein Amerikaner, dessen Tochter mit der extrem seltenen Muskelerkrankung Pompe geboren worden ist, hat eine eigene Firma gegründet, und er hat auch die Patente dazu aufgekauft und das Produkt so weit entwickelt, dass es immerhin in der Phase 1 schon gute Ergebnisse gezeitigt hat. Er hat das verzweifelt gegen die Zeit getan, denn seine eigene kleine Tochter hatte mit dieser Krankheit eine Überlebenschance von vielleicht fünf bis sechs Jahren. Er hat dann, nachdem er diesen „proof of principle“ gemacht hat, also nachdem er zeigen konnte, dass das Arzneimittel, das auf einem Genpatent beruht, funktionieren wird, die Firma Genzyme davon überzeugen können, dieses Arzneimittel weiterentwickeln zu können, und tatsächlich hat diese Tochter als Sechsjährige vor wenigen Wochen die ersten Infusionen bekommen. Sie hatte nur noch eine sehr geringe Lebenserwartung. Im „The Wall Street Journal Europe“ konnte man lesen, dass sich ihre Bedingungen entscheidend verbessert haben.
Es ist hier eine Kaskade von Menschlichkeit, aber auch von Wertschöpfung, die ohne eine gescheite, vernünftige und auch rechtssichere Gen-Gesetzgebung nicht möglich wäre, und ich hoffe, dass Sie, sehr geehrte Abgeordnete, wirklich lange überlegen, ob Sie Österreich da in das Aus stellen wollen. Wir wollen die Dinge vorwärts entwickeln! Natürlich kann man mit heutigem Erkenntnisstand viele Dinge noch einmal umdiskutieren – das steht uns ja auch nicht bevor, wir können ja auch in weiteren europäischen Gesetzen die Dinge verfeinern. – Ich bedanke mich.
16.13
Vorsitzende Abgeordnete Dr. Eva Glawischnig: Nächster Redner: Herr Dr. Alge. – Bitte.
16.13
Dr. Daniel Alge (Sonn & Partner, Wien): Ich möchte gerne die Frage, inwieweit eine Aufschnürung der Richtlinie ein Verbot eines absoluten Stoffschutzes ermöglichen würde, beantworten. Ich habe vorhin gesagt, eine freiwillige Einschränkung auf einen bestimmten Anspruch, auf nur eine bestimmte Verwendung eines bestimmten Gens oder eines bestimmten Stoffen ist jederzeit möglich, aber die Schaffung oder die Einführung eines Stoffschutz-Verbotes in das Patentsystem ist durch Aufschnüren einer Richtlinie nicht möglich. Das ausdrückliche Gebot zur Patentierung auch von chemischen Stoffen – es herrscht patentrechtlich und auch naturwissenschaftlich kein Zweifel darüber, dass es sich auch bei den isolierten Nukleinsäuren um chemische Stoffe handelt – ist durch das TRIPS-Übereinkommen geregelt und auch normiert, und zwar durch jenes TRIPS-Übereinkommen, das im Rahmen der Welthandelsorganisation unter anderem mit den USA beschlossen worden ist. Wenn man tatsächlich ein Verbot des absoluten Stoffschutzes in das Patentgesetz hineinschreiben wollte, dann müsste man dies im Rahmen der WTO tun und zunächst einmal die USA davon überzeugen, dass dies von Vorteil wäre.
In der Tat ist der Produktschutz deshalb eingeführt worden, weil damit den Innovatoren eine Rechtssicherheit geboten wird, weil damit Fortschritt gemacht worden ist. Es hat sich auch gezeigt, dass die Entwicklung, seit dieser Stoffschutz in die patentrechtliche Tat umgesetzt worden ist, schlagartig vorangegangen ist.
Das Zweite: Wenn man es einmal geschafft hat, auf TRIPS-Ebene eine Änderung herbeizuführen, dann müsste man das Europäische Patentübereinkommen aufschnüren und dort ein Stoffschutz-Verbot hineinreklamieren, und dazu ist die Einstimmigkeit aller Mitgliedstaaten des EPÜ – mittlerweile alle 15 EU-Mitglieder plus die zehn Kandidatenländer, die nächstes Jahr dazukommen, plus Schweiz, plus Liechtenstein, plus Türkei – erforderlich. Wenn man all diese Staaten überzeugen kann, dass die Einführung eines absoluten Stoffschutzverbotes eine gute Sache für die Forschung, für die Innovation und für die Industrie ist, dann kann man dies tun, aber nicht durch Aufschnürung der Biopatentrichtlinie.
Nun zur Feststellung, dass in der Biotechnologie-Patentrichtlinie nichts betreffend Zwangslizenzen geregelt ist: Das ist bereits in den nationalen Gesetzen geregelt. Es steht in jedem nationalen Gesetz im gesamten EU-Raum eine Regelung, dass bei drohendem Missbrauch oder bei volkswirtschaftlicher Notwendigkeit, wenn sich ein Patentinhaber weigert, eine Erfindung in die Tat umzusetzen, demjenigen, der die Erfindung in die Tat umsetzen will, beispielsweise ein Medikament auf den Markt bringen kann und bringen will, tatsächlich eine Zwangslizenz erteilt wird – entgegen dem Willen des Patentinhabers.
Es gibt wenige Entscheidungen über Zwangslizenzen. Das ist nicht deshalb so, weil das ein totes Recht ist, sondern das hat den Grund, weil eine Zwangslizenz ungefähr das Schlimmste ist, was einem Patentinhaber drohen kann. Glauben Sie mir, aus meiner persönlichen Praxis weiß ich, dass schon die Androhung einer Zwangslizenz gerade bei gesundheitsrelevanten Aspekten den Patentinhaber in große Nöte versetzt und er dann bereit ist – natürlich für eine angemessene Lizenzgebühr, denn er ist ja schließlich und endlich der Innovator, er hat ein Recht auf die ihm gebührende Vergütung –, einer Verwertung der Erfindung zuzustimmen. Es entsteht also kein Schaden dadurch.
All die Horrorszenarien, die hier an die Wand gemalt worden sind, sind bisher in der Praxis nicht eingetreten. Also selbst wenn die Firma Monsanto auf eine ganz neue Maissorte oder sogar auf Saatgut ein Patent erhält, zwingt das noch niemanden, diese Sorte auch zu kaufen. Man kann ja auch die bisherigen Sorten verwenden. Wenn diese Sorte allerdings um so viel besser ist, wenn man damit viel mehr an Ertrag erwirtschaften kann und auch selbst mehr Geld verdienen kann, dann haben wir eine Win-Win-Situation, die den Fortschritt immer ermöglicht hat, dass eben das Bessere nachfolgt, und dann kann eben der Patentinhaber für diese 20 Jahre mit seiner Erfindung auch mehr Geld verdienen.
Nicht viele Patentinhaber verdienen sehr viel Geld mit ihren Erfindungen. Die so genannte Harvard-Maus war kommerziell nicht sehr erfolgreich. Das hat an sich auf die Patentierungsvoraussetzung keinerlei Einfluss, das probiert man eben. Es gibt viele Entwicklungen in der Wirtschaft, die dann schlussendlich scheitern. Es müssen viele Patente zu späterer Zeit verworfen werden, sie werden einfach nicht mehr aufrechterhalten, weil sie eben nicht zum kommerziellen Erfolg führen.
Aber dann, wenn eine solche Entwicklung zu einem kommerziellen Erfolg führt, ist die adäquate Patentierung eine gute Sache. Das sind nämlich Patentansprüche, und die Patentansprüche sind die Gegenstände, die den Umfang des Patents definieren, und nichts anderes. Also es sind die Patentansprüche, die wesentlich sind, und die Patentansprüche müssen gut sein, damit man auch gegen Nachahmer und gegen Gauner, die eine Erfindung klauen, effektiv vorgehen kann.
Zum Umfang der Ansprüche kann ich sagen: Wir alle sind der Aufsichtsrat oder die Expertenkommission bei den Entscheidungen des Patentamtes! Jedermann kann nämlich, wenn ein Patent einmal erteilt ist, einen Einspruch erheben, wenn der Umfang der Ansprüche – gleich dem Umfang des Patents – zu breit ist. Da gibt es patentrechtliche Erwägungen, patentrechtliche Richtlinien, die besagen: Wenn der Umfang zu breit ist, wenn ich also mit dem Patent, das ich anmelde, einen Patentanspruch verfolgen und erteilt bekommen will, der über das hinausgeht, was ich der Allgemeinheit zur Verfügung stelle – ich muss ja in der Patentanmeldung eine Offenbarung, wie es so schön heißt, zeigen, ich muss zeigen, dass meine gesamte Erfindung im Anspruch auch geoffenbart ist –, dann ist das Patent nichtig, und zwar das gesamte Patent. (Dr. Godt: Aus rechtlicher Sicht ist das falsch!) – Das zeigt meine tägliche Praxis, die sehr erfolgreich ist und die durchaus auch Missbräuche gegen zu breite Patente – bestes Beispiel: Myriad – effektiv bekämpft.
Wenn wir noch 20 Jahre hier darüber diskutieren, ob das ethisch richtig ist, dann werden wir dieses Patent nicht umbringen, aber ein Einspruch, rechtzeitig eingereicht beim Europäischen Patentamt, hat für die französischen Klienten ihre missliche wirtschaftliche Lage gebessert. Das, was der Herr von der Biochemie Kundl gesagt hat, kann ich nur unterstützen: Mit patentrechtlichen Methoden und der etablierten Praxis auf patentrechtlichem Gebiet lässt sich das bekämpfen.
16.20
Vorsitzende Abgeordnete Dr. Eva Glawischnig: Nächster Redner ist Herr Professor Dr. Zacherl. – Bitte.
16.20
Professor Dr. Nikolaus Zacherl (Forschungsinstitut für molekulare Pathologie GmbH, Wien): Frau Vorsitzende! Herr Minister! Ich möchte auf Folgendes zurückkommen: Es wurde hier, wie immer, wiederum gesagt, es hätte zehn Jahre gedauert, bis diese Richtlinie beschlossen wurde. Daraus ist sogar von Herrn Torgersen sozusagen das Argument geschmiedet worden, daher müsste sie eigentlich überholt sein. – Dazu zwei Punkte:
Erstens: Die Richtlinie wurde 1998 beschlossen und ist daher nicht zehn Jahre alt, also der Alterungsprozess ist zumindest kürzer. Außerdem – und es wundert mich, das in einem Parlament zu hören –: Wir haben es hier mit einer Materie zu tun, die zehn Jahre lang ausführlich diskutiert und dann entschieden worden ist. Ich verstehe nicht, warum ein Parlament diese Entscheidung nicht akzeptieren will, sondern sagt, weil es zehn Jahre gedauert hat, müsse man das noch einmal diskutieren.
Zweiter Punkt: Bezüglich Monitoring-System habe ich ein weiteres grundsätzliches Problem. Wir leben alle in einem Rechtsstaat. Wir sind stolz darauf, in einem Rechtsstaat zu leben. Auch das Patentwesen spielt sich in einem Rechtsstaat ab. Wir haben heute schon im Laufe der Enquete zwei Fälle, positiv-negativ, erörtert: Myriad-Patent und Edinburgh-Patent. – Beide sind eingeschränkt worden! Das Rechtsschutzsystem, auch auf dem Patentgebiet, funktioniert anscheinend.
Ich möchte das, was Herr Professor Dr. Leitner erzählt hat, sogar noch verstärken. Er hat gesagt, als Generika-Firma sei er ein Patent-Challenger. Ich sage: Jeder Forscher ist ein Patent-Challenger. Jeder Forscher denkt sehr wesentlich nur daran, wo er ein Patent erwischen kann, sei es, dass er es aushebt, sei es, dass er es umgeht. Auch für das Patentwesen gilt also ein Rechtsschutzsystem, dem wir vertrauen können; die Gerichte entscheiden schlussendlich darüber.
Bezüglich der gesamten Debatte zum Stoffschutz muss ich sagen, Herr Then hat Recht: TRIPS zwingt uns nicht, die EU-Richtlinie umzusetzen. TRIPS, liebe Frau Godt, Frau Schneider, hat aber sehr wohl eine Vorschrift, den Stoffschutz zu belassen. Mein Vorredner hat es gesagt: TRIPS schreibt alle Arten des Patentschutzes für alle Technologien vor, das heißt, dass man den Stoffschutz für die Biotechnologie nicht ausnehmen darf. – Das wäre ein völliger Widerspruch gegen TRIPS. (Dr. Godt: Das habe ich doch nicht gesagt! ...! Sagen Sie etwas zum Umfang ...!) – Ich komme gleich zu Ihrem Argument mit der Interpretation des Artikel 5.
Ich möchte, dass wir festhalten: Stoffschutz für Biotechnologie ausschließen, das geht nicht!
Wenn wir über einen funktionsbezogenen Stoffschutz sprechen – entschuldigen Sie bitte vielmals meine Ausdrucksweise –, dann ist das Etikettenschwindel. Das ist ein Anwendungspatent. Dann sagen Sie bitte auch, wir wollen, dass es in der Biotechnologie nur noch Anwendungspatente gibt. Darüber kann man reden. Aber ein Anwendungspatent ist ein schwächerer Schutz als ein Stoffschutzpatent. Ich glaube, darin sind wir uns alle einig. Ich denke schon, denn sonst würden Sie es ja nicht bekämpfen.
Jetzt ist die Frage: Warum gerade auf dem Gebiet der Biotechnologie ein schwächerer Patentschutz? Warum eigentlich? – Ich komme wirklich auf Artikel 5 zurück. Ich höre immer: Kein Stoffschutz bei Genen! Warum eigentlich nicht? – Das einzige Argument, das ich gehört habe, stammt von Herrn Kloiber: Gene und Tiere – ich glaube, Herr Then hat es auch angesprochen – sind Gemeingut der Menschheit. Das ist das Argument gegen den Stoffschutz.
Eine sehr einfache Antwort darauf ist: Ein Patent hat mit Gut, mit Besitz, mit Eigentumsverhältnissen überhaupt nichts zu tun. (Dr. Godt: Sagen Sie etwas zur Multifunktionalität ...!)
Im Übrigen: Erzählen Sie doch bitte einmal einem Landwirt, dass die Kuh, die er auf das Feld treibt, nicht ihm gehört, denn sie sei ja Allgemeingut der Menschheit. Ich glaube, das entspricht nicht unserem – ich würde jetzt fast sagen – Rechtsempfinden.
Ich darf zu Ihrer Frage betreffend Artikel 5 kommen. Was besagt Artikel 5 Absatz 3 in Verbindung mit dem Erwägungsgrund 23, den Sie immer wieder zitieren? – Er besagt nichts anderes, als eine Verfahrensvorschrift zu implementieren. Die Biopatentrichtlinie – ich glaube, darin sind wir uns einig – ist kein umfassendes, in sich geschlossenes Patentrecht, sondern regelt bestimmte Ausschnitte aus dem Gebiet des Patentrechts. Und was tut sie jetzt in Bezug auf Gene, und zwar nur auf Gene? – Sie bringt eine Verfahrensregelung, um die strategische Patentierung zu vermeiden, nämlich auf Verdacht zu patentieren, liegen zu lassen und alles zu blockieren. Aus diesem Grund kommt nun diese Vorschrift hinein; man muss im Unterschied zu allen anderen Gebieten der Technologie bei der Patentierung von Genen sofort in der ersten Patentschrift die gewerbliche Anwendung angeben.
Das bedeutet aber keine Aussage – keine! –, weder positiv noch negativ, zur Frage des Stoffschutzes, denn diese ist in der Biopatentrichtlinie überhaupt nicht geregelt.
16.27
16.27
†Dr. Otmar Kloiber (Bundesärztekammer, Köln): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Falsch zitiert zu werden ist wahrscheinlich auch ein Privileg, dem man sich stellen muss. Ich danke zumindest für die Aufmerksamkeit, die das bekommen hat. Einige der Mythen gilt es noch abzubauen.
Was können Patente und Patentämter leisten? – Ich schließe mich diesbezüglich den Ausführungen von Frau Godt und Frau Schneider an – vielleicht mit wesentlich einfacher gestrickten Worten, die ich als Arzt dazu wählen kann. Aber wenn Sie einmal in die Patente hineinschauen – Gott sei Dank sind sie ja öffentlich, Sie können sich das ansehen –, dann werden Sie feststellen, dass die Ansprüche, die dort niedergelegt worden sind, eigentlich dem entsprechen, was man auch Biologiebüchern entnehmen kann. Da gibt es Patente, bezüglich derer zu lesen ist, dass die Ansprüche auf ein bestimmtes Gen für die Antisense-DNA, für Antikörper gegen die DNA, für die Messenger-RNA oder für die Transkriptions-RNA angemeldet werden können. Das ist alles vorhanden. Das können Sie nachlesen, das ist ja veröffentlicht.
Es ist aber eine völlige Illusion zu sagen, jeder könne hingehen und könne diese Patente bestreiten. Das kann ein normaler Bürger nicht, das können auch wir nicht, das kann auch ein einfacher Arzt nicht. Das steht ihm gar nicht offen. Er hat gar nicht die Ressourcen dazu, das zu tun. Zu hoffen, dass das die Industrie untereinander tut, ist natürlich nett, aber ich glaube, das wäre dann doch ein bisschen zu viel verlangt dem Wettbewerb gegenüber.
Das Monitoring wurde hier als eine Lösung angeboten. Meine Damen und Herren! Das Monitoring – bitte lesen Sie doch einmal diese Richtlinie! – können Sie überhaupt nicht beeinflussen! Das bestimmt nämlich die EU-Kommission. Da hat sich – mit Verlaub! – der Bock selbst zum Gärtner gemacht. Wenn Ihnen das genug ist, dann bitte, aber ich denke, das ist keine Lösung.
Es ist natürlich schön zu hören, dass es für ein Kind eines reichen Amerikaners vielleicht eine Lösung gegeben hat. (Ruf: Er war nicht reich!) – Er hat zumindest die Forschung bezahlen und auch die Patente anmelden können.
Meine Damen und Herren! Hier ist über das Insulin gesprochen worden, auch in einer etwas verzerrten Weise. Das Insulin, das übrigens zuerst entdeckt worden ist, ist nicht patentiert worden. Trotzdem wurde es der Medizin zur Verfügung gestellt. Ich mache mir auch um jene Leute Sorgen, die wegen der Patente Medikamente nicht bekommen. Das sind nicht nur Menschen in der Dritten Welt, für die wir übrigens auch Verantwortung tragen, es gibt auch hier in diesem Land – davon bin ich fest überzeugt – Menschen, die Medikamente nicht bekommen, weil sie zu teuer sind. Insulin wäre übrigens ein Thema, über das man in dieser Hinsicht auch sprechen könnte.
Betreffend Forschungsprivileg und zweckgebundenes Patent: Ich denke, auch da müssen wir noch einmal genauer nachdenken. Es sind heute sehr viele gute Vorschläge gemacht worden. Ich meine auch, dass das eine Richtung ist, die man dabei verfolgen kann. Es gibt differenzierte Umgangsformen, es hat übrigens auch vor 1968, als das absolute Stoffpatent eingeführt worden ist – das ist ja nichts Gottgegebenes, sondern das ist irgendwann einmal in die Gesetzgebung eingeführt worden –, andere Patentformen gegeben. Es hat dann natürlich einen besseren Wettbewerb gegeben. Aber vielleicht wollen Sie den Wettbewerb ausschließen und monopolisieren, denn das erreichen Sie mit den absoluten Stoffpatenten. Frankreich könnte ein Beispiel sein, auch in Europa gibt es andere Möglichkeiten.
Betreffend Forschungsprivileg und Zwangspatent: Zwangspatente sind eine Ausnahmeregelung, Zwangspatente führen nicht dazu, dass der ökonomische Druck genommen wird. Zwangspatente sind immer noch mit Lizenzgebühren verbunden, die gezahlt werden müssen.
Auch das Forschungsprivileg – Frau Dr. Godt hat es ganz richtig gesagt – könnte sich als Illusion herausstellen. In den USA gibt es diesen Rechtsstreit bereits. Dort sagen Firmen: Liebe Freunde an den Universitäten, ihr wollt das Forschungsprivileg ausnutzen, das geht aber nicht. Diese fragen: Warum nicht? Wir sind eine Universität, eine Forschungseinrichtung, wir würden das gerne machen. Darauf erwidern die Firmen: Aber ihr habt in der Vergangenheit Patente angemeldet, Patente sind nur zur gewerblichen Nutzung da. Ihr wollt in der Zukunft Patente anmelden, diese gibt es überhaupt nur zur gewerblichen Nutzung. Das bedeutet, ihr seid auch gewerbliche Teilnehmer. Wenn ihr dann gewerbliche Teilnehmer seid – und das sind die Unternehmen Universitäten somit –, dann müsst ihr auch bezahlen.
Schauen Sie dazu bitte noch einmal in den EU-Vertrag, Sie werden dort einige interessante Erhellungen finden! Ich befürchte, das ist ein Denkschema, das auch durchaus auf die Europäische Union übertragbar ist.
Betreffend Qualität der Richtlinie: Es tut mir Leid, wenn ich eben zu kompliziert gesprochen habe und Frau Brinek das falsch verstanden hat. Wie schon gesagt: Ich habe nichts gegen Erfindungen, ich habe auch nichts gegen Erfinder, ich denke, es muss einen Schutz des geistigen Eigentums geben. Das sind intellectual property rights, wir sprechen dabei über Eigentumsrechte. Dagegen ist nichts einzuwenden, aber das muss fair und gerecht. Es darf keine Überbelohnung darstellen.
Ich habe auf dieses Konstrukt abgestellt, das gebildet wird, nämlich eine Entdeckung zu nehmen, ihr eine Funktion zuzuordnen und dann zu sagen, das ist eine Erfindung. Das habe ich auch nicht als Lüge bezeichnet, sondern als Pseudologie, und ich lege Wert darauf, es auch so festzuhalten.
Eine Dame hat gesagt, es gebe nichts Besseres als diese Richtlinie. Ich habe versucht, Ihnen auszuführen, dass diese Richtlinie einen Paradigmenwechsel herbeiführen wird. Schauen Sie sich bitte noch einmal – darum bitte ich Sie innständig – Artikel 5 Absatz 1 an, in dem es heißt: „Der menschliche Körper ... sowie die bloße Entdeckung eines seiner Bestandteile, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, können keine patentierbaren Erfindungen darstellen.“
Das hört sich gut an, aber was soll „können keine patentierbaren Erfindungen darstellen“ eigentlich heißen? Soll das heißen, sie sind eine Erfindung, aber sie können nicht patentiert werden? Oder soll das heißen, sie sind keine Erfindung?
Meine Damen und Herren, in Deutschland würde man das als „verquasten Quatsch“ bezeichnen. Sie nennen das in Österreich wahrscheinlich einen „Schmarren“. Aber wollen Sie diesen Unsinn wirklich in ein Gesetz schreiben?
16.34
Vorsitzende Abgeordnete Dr. Eva Glawischnig: Zu Wort gelangt nun als letzter Redner Herr Dr. Hoppichler. – Bitte.
16.34
Dr. Josef Hoppichler (Bundesanstalt für Bergbauernfragen, Wien): Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte kurz auf Dr. Zacherl replizieren. Er hat gesagt, es ändere sich doch nichts am Eigentum, den Bauern gehöre ja weiterhin die Kuh et cetera. Da muss ich Ihnen absolut widersprechen. Das ist auch in der juridischen Literatur so aufgeführt und nicht nur auf Grund des Patentgesetzes. Schon UPOV 291 und die EU-Sortenschutzrichtlinie haben einen Eigentumsvorbehalt ermöglicht. Durch dieses Patentgesetz und durch die Anwendung auf landwirtschaftliche Pflanzen, Tiere und ihre Nachkommen wird ein Eigentumsvorbehalt definiert. Wir kennen das traditionell in der Landwirtschaft, dass das Eigentum von Grund und Boden getrennt ist, zum Beispiel von der Nutzung der Jagd und Fischerei oder der Nutzung von Wasserrecht.
Das, was hier passiert, ist historisch ungefähr so, wie es vor 150 Jahren bei der Bauernbefreiung war, als es um die Neudefinition von Eigentumsrechten an Grund und Boden gegangen ist. Damals hat man auch sehr differenziert. Momentan findet ebenfalls eine Neudefinition von Eigentumsrechten an Pflanzen und Tieren statt.
Beim Landwirteprivileg hat man sich eigentlich an das Sortenschutzgesetz angelehnt. Was das Interessante und Neue an der EU-Patentrichtlinie und an der neuen Patentrechtsausrichtung ist, ist, dass das Züchterprivileg im Prinzip ausgehebelt und durch ein System von Zwangslizenzen ersetzt wird. Da steht drinnen, diese müssen sich gegenseitig Lizenzen geben. Jetzt kann man sich aber, weil man die spezielle Pflanzenzucht und die Patentinhaber kennt – Monsanto, Pioneer, Syngenta und so weiter –, ausrechnen, wer dort gleichgewichtiger Partner ist – nicht nur in dem Sinn gleichgewichtiger Partner, sondern dass das Patentrecht auch mehr ermöglicht.
Es ist heute schon von strategischen Patenten gesprochen worden, strategische Patente auch in der Hinsicht, dass man diese über Verfahrenspatente noch einmal absichert et cetera, bis dorthin, dass man Patentpyramiden baut. Ich glaube, das bekannteste Beispiel dafür ist der Vitamin A-Reis – der so genannte golden rice –, der, wie ich gelesen habe, mit 40 oder sogar 70 Patenten abgesichert sein soll. Mit diesem deckt man ein ganzes Feld ab.
Und diese Leute sollen dann gleichgewichtige Partner beim Züchterprivileg sein! Das ist das Gefährliche, das Neue, das zusätzlich dazukommt. Diese zusätzliche Qualität gibt einfach Anlass zur Sorge, dass die großen Biotechnologiekonzerne die Saatgutunternehmen aufkaufen. Sie haben sie schon zum Großteil aufgekauft, weil allein das Potential der Patentierung hat den Agrochemie- und Biotechnologiekonzernen genügt, um strategisch in den Aufkauf der Saatgutunternehmen einzusteigen.
Ich könnte jetzt noch einmal auf Professor Glössl replizieren, wie die ganze Industrialisierung, Kommerzialisierung, die Auflösung der Subsistenz, die Landwirtschaft global stattfindet. Manche Experten sagen, dass zwei Drittel der pflanzengenetischen Ressourcen für immer verloren sind. Die Bauern und Bäuerinnen haben in Subsistenzlandwirtschaft durch Eigenentwicklung und Eigenselektion ohne wissenschaftliche Forschung, ohne Patente eine zehntausendjährige Kulturgeschichte des freien Zugangs zum Saatgut gehabt. Diese ist sozusagen in Auflösung begriffen und es droht die Überführung in den Bereich der Kontrolle von großen Saatgutunternehmen. Die zunehmende Monopolisierung mit Hilfe von Patenten wird folgen.
Das ist das Gefährliche an diesen Dingen. Das war meiner Ansicht nach auch bisher bei der traditionellen Patentgesetzgebung in Österreich so, das kann man ja im Gesetz nachlesen. Es gibt zwei Ausschließungsgründe.
Erstens: Therapeutische und diagnostische Verfahren sollen dem Patienten nicht vorenthalten werden. Wenn sie notwendig sind, sollen sie nicht durch ein Patent entzogen werden können.
Das Zweite ist, dass bestehende Monopole auf Saatgut und Zuchtvieh nicht ausgenützt werden sollen, um den Menschen die Ernährungssicherheit, die Grundlage, wozu das Saatgut absolut gehört, zu entziehen. – Das wollte ich primär anführen.
Ich bin von Frau Abgeordneter Brinek angesprochen worden und möchte dazu kurz sagen: Die Politik wird Probleme kriegen, wenn sie es nicht schafft, die Entscheidungen hier in diesem Haus, die Entscheidungen, ob wir Pflanzen und Tiere und ihre Nachkommen patentieren und so weiter, alles, was hier gesagt worden ist, den Menschen „draußen“ in irgendeiner Form rational und demokratisch zu kommunizieren. Die Politik läuft nämlich sonst Gefahr, schizophren zu werden. Man kann nicht das „Hochgeistige“ an Ethikkommissionen abschieben und auf der Straße eine Primitivpolitik betreiben. Das geht nicht! Das ist aber eine ganz große Gefahr.
Es hat irgendjemand gesagt: Wir möchten mit der Jugend eine Wertediskussion führen. Wie will man mit der Jugend eine Wertediskussion führen, wenn man die Werte an Ethikkommissionen und Spezialisten abgetreten hat?
16.40
Vorsitzende Abgeordnete Dr. Eva Glawischnig: Herzlichen Dank.
Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Ich schließe daher die Debatte.
Es liegt auch kein Antrag vor, daher gibt es keine Abstimmung.
Wir sind somit am Ende dieser Enquete angelangt. Ich möchte allen Expertinnen und Experten, vor allem jenen, die aus dem Ausland angereist sind, herzlich danken. Das Ziel einer Enquete ist die umfassende Information der Abgeordneten. Ich denke, das ist in vielerlei Hinsicht gelungen. In diesem Sinne hoffe ich, dass daraus ein fruchtbarer Prozess wird, in den man all diese Aspekte einfließen lassen kann.
Die Sitzung ist geschlossen.
Schluss der Enquete: 16.41 Uhr
|
Impressum: Parlamentsdirektion 1017 Wien |