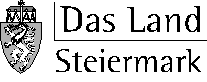Zu
den Kosten:
Zu den Kosten auf Grund der Änderungen
des GWR-Gesetzes siehe die Ausführungen zu Artikel 2 Z. 9.
Zu
den einzelnen Bestimmungen:
Zu
Artikel 2 (Änderung des Bundesgesetzes über das Gebäude- und
Wohnungsregister)
Vorbemerkung:
Unklar ist, warum im vorliegenden Entwurf
– entgegen den Erläuterungen zu § 3 Z 10 – kein
eindeutiger Bezug auf das Energieausweis-Vorlagegesetz genommen wird: Die
Erfassung des aus Sicht der Bundesländer sowohl qualitativ als auch
quantitativ – hier insbes. im Hinblick auf den Anteil an Energieeinsatz
als auch CO2-Emissionen - wesentlich bedeutsameren Sektors des
Gebäudebestands, für den die Verpflichtung zur Erstellung von
Energieausweisen in weitaus überwiegendem Ausmaß nur aus den
Bestimmungen des Energieausweis-Vorlagegesetzes resultiert, ist aus ha. Sicht
nicht eindeutig genug geregelt.
Zu Z. 2 (§ 2):
Die Definitionen in § 2 Z. 1, 2 und 4
stimmen nicht mit jenen der Richtlinie „Begriffsbestimmungen“ des
Österreichischen Instituts für Bautechnik („OIB“)
überein, welche die Grundlage für die einschlägigen Bestimmungen
im Baurecht der Bundesländer darstellen; ein sachlicher Grund dafür
ist nicht nachvollziehbar. Es wird daher vorgeschlagen, die Formulierungen der
zitierten OIB-Richtlinie zu übernehmen.
Zu Z. 7 wird vorgeschlagen, allgemeiner auf
die „baurechtlichen Vorschriften der Bundesländer“ abzustellen
und nicht auf die „Bauordnungen der Bundesländer“, da es nicht
überall „Bauordnungen“ gibt (in der Steiermark z.B.
Baugesetz).
Es wird darauf hingewiesen, dass jene
Definitionen, die nicht bereits in der OIB-Richtlinie 6 enthalten sind, in den
einzelnen Bundesländern unterschiedlich definiert werden können. So
wird der Begriff „Nebengebäude“ – hier § 2 Z. 3 - im
Steiermärkischen Baugesetz 1995 i.d.g.F. im § 4 Z. 43 wie folgt
definiert: „Nebengebäude: eingeschoßige, ebenerdige,
unbewohnbare Bauten von untergeordneter Bedeutung mit einer
Geschoßhöhe bis 3,0 m und bis zu einer bebauten Fläche von 40
m²“. Auch hier wäre eine Vereinheitlichung –
allerdings nicht im Wege des GWR-Gesetzes - erforderlich.
Zu Z 8 (§4 Abs. 5) und Z 10 (§6
Abs. 2):
Da einige Bundesländer bereits eigene
Energieausweis-Datenbanken führen, in die zum Teil gemäß
deren baurechtlichen Bestimmungen die Energieausweise verspeichert werden
müssen, ist – um doppelte Arbeit für die
Energieausweisersteller zu vermeiden – ein Passus vorzusehen, dass die
Verpflichtung zur Energieausweis-Datenübermittlung auch dann erfüllt
ist, wenn die Daten gemäß Anhang H des Gesetzesentwurfs aus einer
Datenbank eines Bundeslandes oder durch eine von einem Bundesland mit der
Führung einer solchen Datenbank betrauten Organisation automatisiert an
das GWR weitergeleitet werden. Zu § 6 Abs. 2 wird weiters angeregt, dass
die in § 4 Abs. 1 Z. 4 von den Gemeinden einzupflegenden Daten um jene
reduziert werden, welche ohnehin über die Daten des Energieausweises von
deren Erstellern zu übermitteln sind: Im Speziellen handelt es sich dabei
um die Merkmale gemäß Abschnitt D Z. 9 der Anlage sowie Abschnitt E
Z. 4 und Abschnitt G Z. 3 der Anlage.
Zu Z 9 (§5 Abs. 3) in Verbindung mit Z
11 (§7 Abs. 3):
Es geht aus der gewählten Formulierung
des § 7 Abs. 3 nicht hervor, ob die dort genannten
„Implementierungskosten“ im „Aufwand für Adaptierung und
Wartung“ gemäß § 5 Abs. 3 enthalten sind oder ob hier
noch zusätzliche Kosten für die Bundesländer entstehen. Sollte
dies zutreffen, wird dieses Ansinnen vom Land Steiermark abgelehnt, da die
gratis gelieferten Daten ohnehin einen erheblichen Wert darstellen.
Die Funktionen der Online-Applikation und vor
allem deren Einbindungsmöglichkeiten wurden in der Konzeptionsphase
angesprochen, jedoch nie in einer finalen Version vorgelegt. Es bestehen
Bedenken, dass die Applikation durch die Art der Implementierung weiteren
unangemessenen Aufwand und Kosten verursachen wird.
Des Weiteren werden in § 5 Abs. 3 letzter
Absatz die jährlichen Jahrespauschalbeträge gemäß Abs. 3 Z.
1 lit. b und Z. 2 lit. b einer jährlichen automatischen Valorisierung von
3 % unterworfen. Hier wäre zu überlegen, die automatische
Valorisierung nicht an den allgemeinen Verbraucherpreisindex zu koppeln.
Zu Z 11 (§ 7):
Zu § 7 Abs. 1 und 2:
Die Neukonzeptionierung und Neuformulierung
des § 7 birgt erhebliche Ungereimtheiten:
Nach § 7 Abs. 2 – und den
Erläuterungen sowohl zu § 1 und § 7 - fungiert die Bundesanstalt
Statistik als gesetzlich vorgesehener Dienstleister für die Gemeinde.
Zweifelhaft scheint dabei aber, ob die
Statistik Austria überhaupt als Dienstleister für die Gemeinden in
jenem Bereich tätig werden kann, in dem den Gemeinden keine
Zuständigkeit zukommt, nämlich dann, wenn Energieausweise nach dem
EAVG erstellt werden. Kompetenzrechtlich handelt es sich nämlich um
Angelegenheiten des Zivilrechts und nicht um solche des Baurechts. Aus diesem
Grunde schiene es zweckmäßiger, nicht die Zustimmung der Gemeinden
für die Datenübermittlung als Rechtfertigungsgrund zu sehen (denn bei
Zustimmungserklärungen bräuchte überhaupt keine gesetzliche
Regelung enthalten sein, wie sie in den Z. 1. -7 vorgesehen ist), sondern
unmittelbar auf Grund des Gesetzes den Zugriff für genau definierte Zwecke
zu gestatten.
Auch die Praxis der Einholung der Zustimmungserklärungen
scheint klärungsbedürftig: Dem Einleitungssatz zu Abs. 2 nach
hat die Bundesanstalt einen Online-Zugriff für bestimmte Stellen
gemäß Z. 1 bis 7 einzuräumen, wenn die Gemeinden hiezu
zustimmen. Den Erläuterungen ist zu entnehmen, dass diese Zustimmung
über den Österreichischen Gemeindebund und Österreichischen
Städtebund einzuholen ist. Diese Bestimmung weist insofern Unklarheiten
auf, als nicht klar ist, wie die Zustimmung erfolgen kann. Diese Zustimmungserklärungen
sind als zivilrechtliche Handlungen zu qualifizieren. Nach Ansicht der
Steiermärkischen Landesregierung scheint es ausgeschlossen, dass der
Gemeindebund als auch der Städtebund zivilrechtliche Erklärungen
für alle Gemeinden abgeben können. Dies würde aber umgekehrt
bedeuten, dass die Gemeinde jeweils eigenen Zustimmungen abgeben müssen
– wenn auch im Wege der Gemeindeinteressensvertretungen. Jedenfalls
wäre in diesem Fall davon auszugehen, dass der Online-Zugriff auf die in
Z. 1 bis 7 genannten Stellen erst dann zulässig wäre, wenn alle
entsprechenden Zustimmungserklärungen vorliegen, was bei mehr als 2000
Gemeinden durchaus problematisch scheint.
Problematisch scheint auch der Zeitpunkt der
Zustimmung, insbesondere aus finanzieller Sicht: Die Landesfinanzreferentenkonferenz fasste in ihrer
Tagung am 25. September 2007 den Beschluss, die Hälfte der Kosten zu
übernehmen, wenn … „b) eine einvernehmliche Klärung betreffend
Dateneingabe, Zugriffsberechtigungen und rechtliche Umsetzung erfolgt“.
Nun sind in § 5 Abs. 3 die Kosten für die Länder festgeschrieben,
ohne dass der Zugriff tatsächlich möglich sein muss. Dies bedeutet, dass diese Zustimmungen im Grunde genommen vor Gesetzesbeschluss
vorliegen müssten, da es sich wohl von selbst versteht, dass der im Vorblatt
erwähnten „vereinbarten Kostenteilung zwischen Bund und
Ländern“ nur bei voller Zugriffsmöglichkeit auf alle energie-
und klimaschutzrelevanten Gebäudedaten zugestimmt werden kann.
Ebenso ist – wie in den vorangegangenen
Gesprächsrunden vereinbart - nicht nur „den Landesbehörden“,
sondern den Bundesländern insgesamt Zugriff zu gewähren, also nicht
für Zwecke eingeschränkt auf die Hoheitsverwaltung, sondern insbesondere
auch für Zwecke der Privatwirtschaftsverwaltung. Z. 1 sollte daher
lauten:
„1. den Bundesländern, insbesondere den
Landesbehörden, auf die die Gemeinden des Landes betreffenden Daten
gemäß Abschnitt A bis H der Anlage, soweit diese zur Verfolgung
energiepolitischer Ziele erforderlich oder zur Wahrnehmung der gesetzlich
übertragenen Aufgaben notwendig sind.“
Zu § 7 Abs. 2 Z. 7:
Z. 7 sieht vor, dass die zur Ausstellung eines
Energieausweises Berechtigten den Online-Zugriff nur dann erhalten, wenn ein
derartiger Zugriff landesgesetzlich vorgesehen ist. Diese Bestimmung wird in
dieser Form abgelehnt, weil sie nicht erforderlich ist. Die Berechtigung zur
Ausstellung von Energieausweisen ist Berufsrecht und unterliegt daher im
Wesentlichen bundesrechtlichen Bestimmungen.
Bei den Daten im GWR handelt es sich –
den Erläuterungen zufolge - um Verwaltungsdaten der Gemeinden. Die
Gemeinden können über diese Daten verfügen. Mittels einer
zivilrechtlichen Zustimmung können sie auch den zur Ausstellung eines
Energieausweises Berechtigten gestatten, auf ihre Daten zuzugreifen. Wenn also
eine Zustimmungserklärung ausreicht, den in Z. 1 bis 6 genannten Stellen
den Zugriff zu gestatten, so reicht eine derartige Zustimmungserklärung
auch für die Energieausweisaussteller aus. Eine weitere gesetzliche
Bestimmung, die diesen Zugriff legitimiert, ist unnotwendig. Der letzte
Halbsatz hätte daher zu entfallen.
Im Übrigen wird auf die Ausführungen
zu § 7 Abs. 1 und 2 verweisen, wonach ohnehin ein ausschließlich
gesetzlich formuliertes Zugriffsrecht bevorzugt wird.
Des Weiteren möge folgender Abs. 4 aufgenommen
werden:
„(4) Weiters hat die Bundesanstalt auf
Verlangen den Ländern für statistische Zwecke den nach
landesgesetzlichen Vorschriften dazu berufenen Organen anonymisierte
Auszüge aus dem Register mit den Daten der Objekte des jeweiligen
Bundeslandes zu übermitteln.“
Zu. Z. 13 (§ 11 Abs. 6):
Da die Steiermärkische Landesregierung
die Regelung, den Online-Zugriff gemäß § 7 Abs. 2 Z. 7
landesgesetzlich zu regeln, ablehnt, wird konsequenterweise auch die
Übergangsbestimmung in § 11 Abs. 6 (also dessen 2. Satz) abgelehnt.
Der Online-Zugriff ist den Ländern unmittelbar nach Inkrafttreten des
Gesetzes zu gewähren.
Zur Anlage allgemein:
Es wird darauf hingewiesen, dass sich die
OIB-Richtlinie 6 derzeit in Überarbeitung befindet; dies könnte dazu
führen, dass Art und Anzahl der zukünftig im Energieausweis
ausgewiesenen Kennwerte sich von den im Gesetzesentwurf zur Übermittlung
angeführten Daten unterscheiden. Es wird daher zur Überlegung
gestellt, im Gesetzesentwurf eine Verordnungsermächtigung vorzusehen und die
Inhalte zumindest der Anlagen G und H des vorliegenden Gesetzesentwurfs nach
Abschluss der Überarbeitung der OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung
und Wärmeschutz“ (Stand: April 2007) in einer Verordnung
festzulegen.
Zu einzelnen Bestimmungen der Anlage
Zu Z. 14 (Anlage Abschnitt C):
In Z. 2 ist „die Tür- oder
Topnummer entsprechend den landesgesetzlichen Vorschriften“ vorgesehen.
Zunächst ist festzuhalten, dass die Verwendung von eindeutigen Tür-
und Topnummern als wesentliches Hilfsmittel der Statistik insbesondere im
Bereich der Registerzählung durchaus anerkannt wird. Gleichzeitig ist aber
darauf hinzuweisen, dass durch diese Bestimmung die Länder keinesfalls
gezwungen werden können, diese Tür- und Topnummern landesgesetzlich
vorzusehen; es würde sich nämlich um einen unzulässigen
Eingriff in Landeskompetenzen handeln. Vielmehr ist diese Bestimmung so zu
verstehen, dass dann, wenn landesgesetzlich entsprechende Tür- oder
Topnummern vorgesehen sind, diese zu verwenden sind.
Zu Z 15 (Abschnitt D):
In Z 9 des Abschnitt D findet sich der Begriff
„Energiekennzahl“; dieser ist jedenfalls zu präzisieren:
nach ha. Auffassung ist hier entweder der „spezifische
Heizwärmebedarf, bezogen auf Standortklima“, oder der
„spezifische Heizwärmebedarf, bezogen auf Referenzklima“,
einzupflegen bzw. aus den Daten des Energieausweises gemäß Abschnitt
H Z. 11 in Verbindung mit Z. 8 des Abschnitt H der Anlage zu übertragen.
Zu Abschnitt D Z 9, Abschnitt E Z 4,
Abschnitt G Z 3 und Abschnitt H Z 23 der Anlage:
In diesen Ziffern ist die „Art des
Brennstoffes“ anzugeben. Dieser Begriff wäre durch
„Energieträger“ zu ersetzen, denn Fernwärme und Strom
werden im Allgemeinen nicht unter „Brennstoffe“ subsummiert.
Zu Z. 16 und 17 (Abschnitt D Z. 13 und E
Z. 4.):
In Abschnitt D Z 13 ist die
Geschoßhöhe angeführt, wobei in den Erläuterungen explizit
darauf hingewiesen wird, dass zwecks erhöhter Aussagekraft die
Flächenangaben auf Nettoflächen umgestellt wurden: Die
Geschoßhöhe nach ÖNORM B 1800 ist jedoch eine Brutto-Angabe (=
Bruttorauminhalt dividiert durch Bruttogrundfläche); der im folgenden
Abschnitt E angeführte Begriff „Raumhöhe“ kommt in der
vorzitierten Norm nicht vor, gemeint ist vermutlich die lichte Höhe
(gleichbedeutend mit der Netto-Raumhöhe nach ÖNORM B 8110-6).
Zu Z. 20 (Abschnitt H der Anlage):
Zu Z 8 und Z 9:
In Z 9 findet sich hinter der Wortfolge „Angaben
zur Geometrie des Gebäudes“ ua. der „mittlere U-Wert“
– es handelt sich dabei aber um Begriffe der Bauphysik und nicht solcher
der Gebäudegeometrie. Zur Gebäudegeometrie zählen aber die
unter der Z. 8 angeführten Werte, wobei dort vor den Begriff
Brutto-Grundfläche der Terminus „konditionierte“ zu stellen wäre.
Zu Z 11:
Es wird darauf hingewiesen, dass im
Energieausweis der Heizwärmebedarf zweimal berechnet wird, und zwar zum
Einen bezogen auf das Referenzklima – auf diesen Wert beziehen sich die
baurechtlichen Anforderungen der Bundesländer – und zum Anderen auf
die klimatischen Verhältnisse am Standort.
Zu Z 11, Z 13 und Z 20:
In diesen Ziffern ist jeweils eine
Energiebedarfskennzahl „und der Vergleich zu Referenzwerten“
genannt; die in Anführungszeichen stehende Passage ist ersatzlos zu
streichen, zum Einen, weil dieser Referenzwert im Gesetzestext nicht definiert
ist, zum Anderen, weil die im Energieausweis teilweise enthaltene gesetzliche
Mindestanforderung keine fixe Größe ist, sondern im Lauf der Jahre
wohl aller Voraussicht nach angepasst werden wird; eine Angabe in dieser
Datenbank wäre irreführend. Überdies sind diese Kennwerte im
Gegensatz zu den Referenzwerten keine spezifischen, d. h. nicht auf die
Bruttogrundfläche bezogen. Die Anforderungen bei Wohngebäuden
beziehen sich im Übrigen auf den Heiztechnikenergiebedarf, diese Angabe
fehlt in der Auflistung. Für Nichtwohngebäude existieren zurzeit noch
keine Anforderungen an den Endenergiebedarf.
Zu Z 22:
Hier ist die Kohlenmonoxid-Emission
angeführt, es wird wohl CO2 gemeint sein.
Zu
Artikel 3 (Änderung des Bundesstatistikgesetzes)
Zu Z 15 ( § 24):
Die im Einleitungssatz von § 24 enthaltene
Einschränkung auf Z. 1 des § 23 Abs.1 wird abgelehnt.