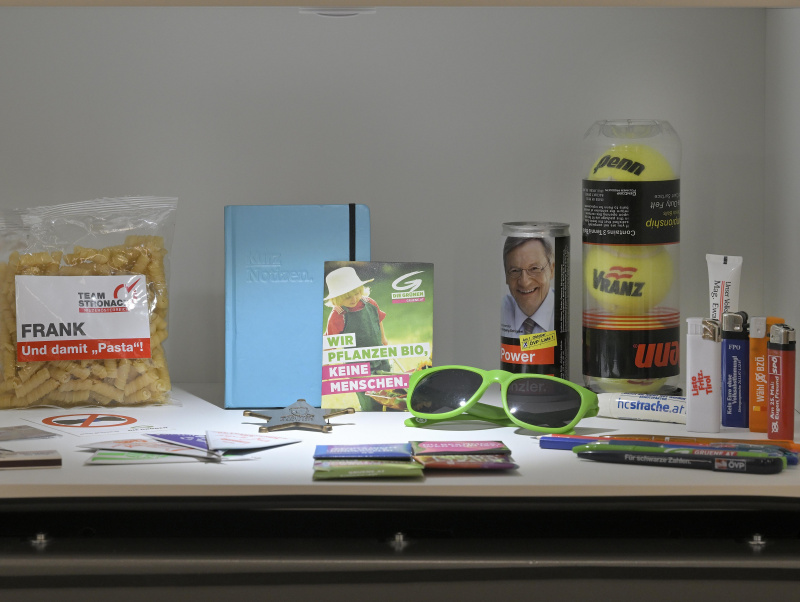Ebenfalls unverändert bleiben die jeweiligen Spendenhöchstbeträge. So dürfen Parteien weiterhin jährlich höchstens EUR 7.500,–* pro Spender:in und insgesamt EUR 750.000,–* pro Kalenderjahr annehmen (§ 6 Abs. 1a und 5 PartG). Die Novelle stellt nun den Adressat:innenkreis dieser Spendenobergrenzen klar: Auch wenn dies der bereits gängigen Praxis entspricht, wird das gesamte Umfeld der Partei ausdrücklich als wirtschaftliche Einheit aufgefasst (§ 6 Abs. 1 PartG). Die genannten Höchstgrenzen gelten somit für jene Summe von Spenden, die an die Partei selbst, ihre nahestehenden Organisationen und die ihr zuzurechnenden Personenkomitees sowie ihre Abgeordneten und Wahlwerber:innen insgesamt gespendet wurde. Das heißt: All diese Spenden werden zusammengerechnet und dürfen pro Partei (inklusive Umfeld) in einem Kalenderjahr nicht EUR 750.000,–* überschreiten.
Außerdem erfährt die Definition von Spenden an Abgeordnete bzw. Wahlwerber:innen in § 2 Z 5 lit. e PartG eine Ergänzung: So gelten Leistungen (ohne entsprechende Gegenleistung) an diesen Personenkreis nur mehr dann als Spende nach dem PartG, wenn sie "zur Unterstützung in ihrer Tätigkeit für ihre politische oder wahlwerbende Partei" gewährt werden. Den Gesetzesmaterialien zufolge stellt dieser Zusatz "keine Aufweichung des Spendenbegriffs" dar. Es soll damit lediglich dem Problem Rechnung getragen werden, dass nach der bisherigen Rechtslage beispielsweise auch Hochzeits- oder Weihnachtsgeschenke in der Familie vom (formalen) Spendenbegriff des PartG mitumfasst waren.
Die Novelle bringt zudem einige Änderungen hinsichtlich verbotener Spenden mit sich (§ 6 Abs. 6 PartG): Zum Ersten nimmt das PartG nun etwa "zulässige Öffentlichkeitsarbeit" von parlamentarischen Klubs im Sinne des Klubfinanzierungsgesetzes 1985 – KlubFG (und Landtagsklubs) für die jeweilige Partei – entsprechend der Entscheidungspraxis des UPTS (vgl. etwa einen Bescheid vom 28.04.2022) – vom Spendenverbot ausdrücklich aus. Zulässig ist die Öffentlichkeitsarbeit dann, wenn die "Verbreitung von Informationen über die Tätigkeit des Klubs oder seiner Mitglieder" im Vordergrund steht, nicht jedoch der Werbeeffekt (für die hinter dem Klub stehende Partei). Zum Zweiten gelten für das Spendenannahmeverbot von Unternehmungen, an denen die öffentliche Hand beteiligt ist, nun geringere Schwellenwerte der zugrunde liegenden Staatsbeteiligung (Z 5). Zum Dritten ist die Annahme von Spenden seitens ausländischer (natürlicher oder juristischer) Personen nun erst ab einem Betrag von mehr als EUR 500,–* verboten (zuvor ohne Betragsgrenze; Z 6), die Annahme anonymer bzw. weitergeleiteter Spenden dafür bereits ab mehr als EUR 150,–* (zuvor erst ab mehr als EUR 500,–*; Z 8 und 9).
Schließlich gilt neuerdings ein Spendenannahmeverbot, welches die strengen Vorgaben für politische Parteien flankiert. Es gilt für parlamentarische Klubs (§ 5a KlubFG) und für nach dem Publizistikförderungsgesetz 1984 (PubFG) geförderte Rechtsträger (d. h. Stiftungen oder Vereine; § 5a PubFG). Für beide Verbotsbestimmungen sind gewisse Ausnahmen vorgesehen (z. B. für Zuwendungen der jeweiligen politischen Partei an den dieser zurechenbaren Klub bzw. Rechtsträger, um weiterhin die Zusammenarbeit zwischen politischer Partei und Klub bzw. Rechtsträger zu ermöglichen; siehe dazu die Gesetzesmaterialien).
Sollten dennoch unzulässige Spenden angenommen worden sein, so sind sie – je nach Grund der Unzulässigkeit – von der Partei entweder dem:der Spender:in rückzuerstatten oder an den RH weiterzuleiten, der sie wiederum an Einrichtungen weiterzuleiten hat, die mildtätigen oder wissenschaftlichen Zwecken dienen (§ 6 Abs. 7 und 8 PartG).