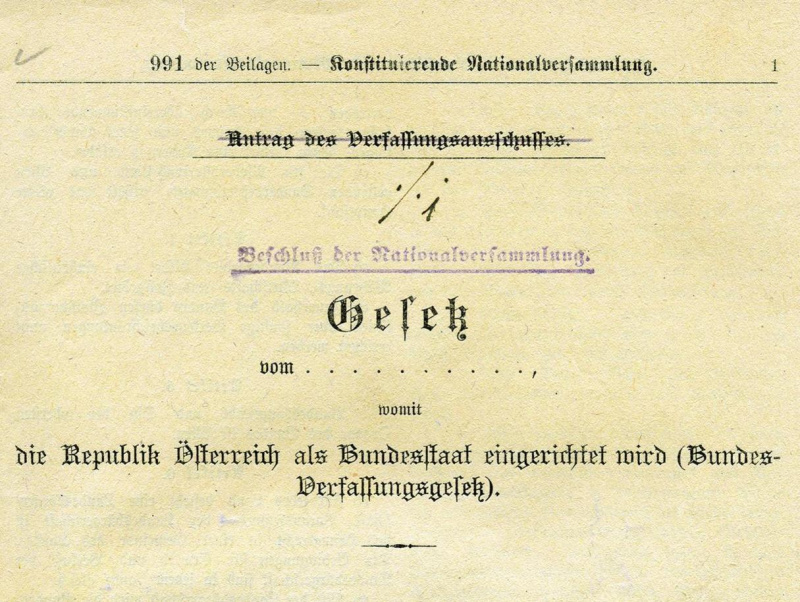Rechnerisch funktioniert die Mandatszuteilung auf den drei Ebenen wie folgt:
1. Ermittlungsverfahren (auf Ebene der Regionalwahlkreise)
Es wird zunächst für jedes Bundesland die Wahlzahl ermittelt, indem die Gesamtsumme der im Landeswahlkreis abgegebenen gültigen Stimmen durch die in diesem Landeswahlkreis zu vergebenden Mandate geteilt wird. Die so (nach dem sogenannten Hare’schen System) ermittelte Wahlzahl wird sowohl im 1. als auch im 2. Ermittlungsverfahren verwendet.
Im 1. Ermittlungsverfahren erhält nun jede Partei zunächst im Regionalwahlkreis so viele Mandate, wievielmal die Wahlzahl in der Anzahl ihrer erzielten Stimmen enthalten ist.
Ein im Regionalwahlkreis erzieltes Mandat wird auch als Grundmandat bezeichnet. Erlangt eine Partei ein solches, dann kann sie damit in den Nationalrat selbst dann einziehen, wenn ihre Stärke bundesweit unter der erforderlichen Hürde von 4 % bleiben sollte. Dies war aber bisher noch nie der Fall und ist auch äußerst unwahrscheinlich. Realistischerweise haben nur größere Parteien eine Chance auf Erlangung von Mandaten in Regionalwahlkreisen.
2. Ermittlungsverfahren (auf Ebene der Landeswahlkreise)
Am 2. Ermittlungsverfahren dürfen nur Parteien teilnehmen, die entweder im ersten Ermittlungsverfahren zumindest ein Mandat in einem Regionalwahlkreis (Grundmandat) erlangt oder im gesamten Bundesgebiet mindestens 4 % der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht haben. Alle anderen Parteien dürfen an diesem Ermittlungsverfahren (ebenso wie am dritten) nicht mehr teilnehmen und haben keine Chance auf ein Mandat.
Jede Partei erhält nun so viele Mandate, wie die Wahlzahl in ihrer Stimmensumme im Landeswahlkreis enthalten ist. Die im 1. Ermittlungsverfahren bereits erzielten Mandate werden davon abgezogen, die restlichen werden an Kandidat:innen auf der Landesparteiliste vergeben.
3. Ermittlungsverfahren ("bundesweiter Proportionalausgleich")
Auch hier nehmen Parteien teil, die zumindest ein Mandat in einem Regionalwahlkreis oder mindestens 4 % der gültigen Stimmen bundesweit erreicht haben. Weitere Voraussetzung ist, dass die Partei rechtzeitig einen Bundeswahlvorschlag (also eine Liste der auf Bundesebene kandidierenden Bewerber:innen) eingereicht hat.
In diesem Verfahren werden alle 183 Mandate mittels der Wahlzahl verteilt, die nunmehr aber nach dem D'Hondtschen Verfahren berechnet wird. Dafür werden die jeweils von den Parteien erreichten Stimmen nebeneinander geschrieben. Diese Zahlen werden dann durch zwei geteilt und darunter geschrieben, anschließend durch drei, vier, fünf usw. Danach werden die Zahlen ihrer Größe nach gekennzeichnet. Die 183-größte Zahl ist die Wahlzahl für dieses Ermittlungsverfahren. Jede Partei erhält dann so viele Mandate, wie oft die Wahlzahl in ihrer Parteisumme enthalten ist. Die im 1. und 2. Ermittlungsverfahren verteilten Mandate müssen nun wieder abgezogen werden, die restlichen Mandate werden an Kandidat:innen auf dem Bundeswahlvorschlag vergeben.
Besonders kleine Parteien erhalten einen großen Teil ihrer Mandate im 3. Ermittlungsverfahren. (Im 2. Ermittlungsverfahren gehen sich Mandate für sie meist nur in großen Bundesländern aus.)
Bei der Nationalratswahl 2017 wurden insgesamt 32 Mandate auf Bundesebene, 52 auf Landesebene und 99 Mandate in den Regionalwahlkreisen vergeben.