
Plenarsitzung
des Bundesrates
961. Sitzung des Bundesrates der Republik Österreich
Mittwoch, 20. Dezember 2023
Bundesratssaal

Plenarsitzung
des Bundesrates
961. Sitzung des Bundesrates der Republik Österreich
Mittwoch, 20. Dezember 2023
Bundesratssaal
Stenographisches Protokoll
961. Sitzung des Bundesrates der Republik Österreich
Mittwoch, 20. Dezember 2023
Dauer der Sitzung
Mittwoch, 20. Dezember 2023: 13.00 – 20.37 Uhr
*****
Tagesordnung
1. Punkt: Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die Förderung von Bildungsmaßnahmen im Bereich Basisbildung sowie von Bildungsmaßnahmen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses für die Jahre 2024 bis 2028
2. Punkt: Bundesgesetz, mit dem ein Finanzausgleichsgesetz 2024 erlassen wird sowie das Finanzausgleichsgesetz 2017, das Umweltförderungsgesetz, das Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz, das Transparenzdatenbankgesetz 2012 und das Bildungsinvestitionsgesetz geändert werden
3. Punkt: Bundesgesetz, mit das Transparenzdatenbankgesetz 2012 geändert wird
4. Punkt: Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG über die Etablierung einer gebietskörperschaftenübergreifenden Transparenzdatenbank
5. Punkt: Bundesgesetz,
mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988,
das Umgründungssteuergesetz, die Bundesabgabenordnung, das Allgemeine
Sozialversicherungsgesetz, das Kommunalsteuergesetz 1993 und das
Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert werden
(Start-Up-Förderungsgesetz)
6. Punkt: Bundesgesetz,
mit dem das Bundesgesetz zur Gewährleistung einer globalen
Mindestbesteuerung für Unternehmensgruppen erlassen wird
und die Bundesabgabenordnung sowie das Unternehmensgesetzbuch geändert
werden (Mindestbesteuerungsreformgesetz – MinBestRefG)
7. Punkt: Bundesgesetz,
mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988,
die Bundesabgabenordnung, das Gebührengesetz 1957, das
Privathochschulgesetz, das Fachhochschulgesetz
und das IST-Austria-Gesetz geändert werden (Gemeinnützigkeitsreformgesetz 2023 –
GemRefG 2023)
8. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Umsatzsteuergesetz 1994, das Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992, das Elektrizitätsabgabegesetz, das Erdgasabgabegesetz, das Kohleabgabegesetz und die Bundesabgabenordnung geändert werden
9. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Einrichtung einer Bundeswettbewerbsbehörde (Wettbewerbsgesetz – WettbG) geändert wird
10. Punkt: Bundesgesetz über die höhere berufliche Bildung (HBB-Gesetz)
11. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Emissionsschutzgesetz für Kesselanlagen geändert wird
12. Punkt: Bundesgesetz,
mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, das Arbeitsmarktservicegesetz und das Ausbildungspflichtgesetz
geändert
werden
13. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Ausländerbeschäftigungsgesetz und das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz geändert werden
14. Punkt: Bundesgesetz, mit dem zur Linderung der Inflationsfolgen bei den Wohnkosten das Mietrechtsgesetz, das Richtwertgesetz und das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz geändert werden (3. Mietrechtliches Inflationslinderungsgesetz – 3. MILG)
15. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Verbotsgesetz 1947, das Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 2008, das Abzeichengesetz 1960, das Uniform-Verbotsgesetz und das Symbole-Gesetz geändert werden (Verbotsgesetz-Novelle 2023)
16. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das GmbH-Gesetz, das Aktiengesetz, das Genossenschaftsgesetz, das SE-Gesetz, das SCE-Gesetz und das Firmenbuchgesetz geändert werden (Gesellschaftsrechtliches Digitalisierungsgesetz 2023 – GesDigG 2023)
17. Punkt: Bundesgesetz, mit dem ein Flexible-Kapitalgesellschafts-Gesetz erlassen wird sowie das GmbH-Gesetz, das Firmenbuchgesetz, das Rechtspflegergesetz, das Notariatstarifgesetz, das Rechtsanwaltstarifgesetz, das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz und das Gerichtsgebührengesetz geändert werden (Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2023 – GesRÄG 2023)
18. Punkt: Bundesgesetz,
mit dem das Allgemeine bürgerliche
Gesetzbuch geändert wird
(Abstammungsrechts-Anpassungsgesetz 2023 – AbAG 2023)
19. Punkt: Bundesgesetz,
mit dem das Personenstandsgesetz 2013
geändert wird
20. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Koordinator-für-digitale-Dienste-Gesetz erlassen und das KommAustria-Gesetz, das E-Commerce-Gesetz, das All-
gemeine bürgerliche Gesetzbuch, das Urheberrechtsgesetz, das Gerichtsgebührengesetz, das Mediengesetz, die Strafprozeßordnung 1975, das Staatsanwaltschaftsgesetz, das Bundesgesetz über die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, das Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz und das Telekommunikationsgesetz 2021 geändert werden (DSA-Begleitgesetz – DSA-BegG)
*****
Inhalt
Bundesrat
Schreiben des Bundesministers für Finanzen
gemäß Art. 50 Abs. 5 B-VG betreffend Erteilung der Vollmacht
zur Aufnahme von Verhandlungen über den Neuabschluss eines
Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik Kolumbien zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen
und vom Vermögen und zur Verhinderung der Steuerverkürzung und
‑umgehung ............................................................................................. 20
Absehen von der 24-stündigen Frist für das Aufliegen der gegenständlichen schriftlichen Ausschussberichte gemäß § 44 Abs. 3 GO-BR ............................ 24
Ersuchen des Bundesrates Marco Schreuder um Erteilung eines Ordnungsrufes ......................................................................................................................... 179
Verlesung der vorgesehenen Fassung eines Teiles des Amtlichen Protokolls dieser Sitzung durch Vizepräsidentin Doris Hahn, MEd MA ............................... 243
Genehmigung des verlesenen Teiles des Amtlichen Protokolls ........................ 246
Personalien
Verhinderung .......................................................................................................... 17
Ordnungsrufe .................................................................................... 57, 65, 193
Bundesregierung
Vertretungsschreiben ............................................................................................ 24
Nationalrat
Beschlüsse und Gesetzesbeschlüsse ................................................................... 24
Ausschüsse
Zuweisungen ............................................................................................ 17, 247
Verhandlungen
1. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend eine Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die Förderung von Bildungsmaßnahmen im Bereich Basisbildung sowie von Bildungsmaßnahmen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses für die Jahre 2024 bis 2028 (2311 d.B. und 2330 d.B. sowie 11382/BR d.B.) ................................................................................................ 25
Berichterstatter: Christoph Stillebacher ............................................................... 25
Redner:innen:
Klemens Kofler ......................................................................................................... 26
Margit Göll ............................................................................................................... 27
Doris Hahn, MEd MA ............................................................................................... 30
Simone Jagl .............................................................................................................. 35
Bundesminister Dr. Martin Polaschek .................................................................... 38
Christoph Steiner ..................................................................................................... 40
Annahme des Antrages des Berichterstatters, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................... 44
Gemeinsame Beratung über
2. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14.
Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein
Finanzausgleichsgesetz 2024 erlassen
wird sowie das Finanzausgleichsgesetz 2017, das
Umweltförderungsgesetz, das Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz, das
Transparenzdatenbankgesetz 2012 und
das Bildungsinvestitionsgesetz geändert werden (2305 d.B. und
2375 d.B. sowie 11360/BR d.B. und 11405/BR d.B.) ....................................................................................................... 44
Berichterstatterin: Bernadette Geieregger, BA .................................................... 45
3. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit das Transparenzdatenbankgesetz 2012 geändert wird (2306 d.B. und 2376 d.B. sowie 11406/BR d.B.) .............................. 44
Berichterstatterin: Bernadette Geieregger, BA .................................................... 45
4. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14.
Dezember 2023 betreffend eine Vereinbarung gemäß Artikel 15a
B-VG über die Etablierung
einer gebietskörperschaftenübergreifenden
Transparenzdatenbank (2314 d.B. und 2377 d.B. sowie
11407/BR d.B.) ............................................... 44
Berichterstatterin: Bernadette Geieregger, BA .................................................... 45
Redner:innen:
Markus Steinmaurer ................................................................................................ 46
Mag. Christian Buchmann ...................................................................................... 47
MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky ....................................................................... 51
Mag. Sascha Obrecht .............................................................................................. 52
Marco Schreuder ..................................................................................................... 55
Markus Stotter, BA .................................................................................................. 59
Dominik Reisinger .................................................................................................... 61
Bundesminister Dr. Magnus Brunner, LL.M. .......................................................... 65
Annahme des Antrages der Berichterstatterin zu Punkt 2, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................ 71
Annahme des
Antrages der Berichterstatterin zu Punkt 3, 1. gegen den vorliegenden
Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben
und 2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß
Art. 44 Abs. 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu
erteilen ..................................... 71
Annahme des Antrages der Berichterstatterin zu Punkt 4, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................ 71
Gemeinsame Beratung über
5. Punkt: Beschluss
des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das
Körperschaftsteuergesetz 1988, das
Umgründungssteuergesetz, die Bundesabgabenordnung, das Allgemeine
Sozialversicherungsgesetz, das Kommunalsteuergesetz 1993 und das
Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert werden (Start-Up-Förderungsgesetz) (2321 d.B. und
2378 d.B.
sowie 11363/BR d.B. und 11408/BR d.B.) ......................................................... 72
Berichterstatterin: Sandra Lassnig ........................................................................ 73
6. Punkt: Beschluss
des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem
das Bundesgesetz zur Gewährleistung
einer globalen Mindestbesteuerung für Unternehmensgruppen erlassen wird und die Bundesabgabenordnung sowie das
Unternehmensgesetzbuch geändert werden
(Mindestbesteuerungsreformgesetz – MinBestRefG) (2322 d.B. und
2379 d.B. sowie 11409/BR d.B.) ..................... 72
Berichterstatterin: Sandra Lassnig ........................................................................ 73
Redner:innen:
Günter Kovacs ......................................................................................................... 74
Mag. Harald Himmer ............................................................................................... 76
Günter Pröller ........................................................................................................... 79
Dipl.-Ing. Dr. Maria Huber ...................................................................................... 81
Annahme des Antrages der Berichterstatterin zu Punkt 5, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................ 84
Annahme des Antrages der Berichterstatterin zu Punkt 6, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................ 84
7. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14.
Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das
Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988,
die Bundesabgabenordnung, das Gebührengesetz 1957,
das Privathochschulgesetz, das Fachhochschulgesetz
und das IST-Austria-Gesetz geändert werden
(Gemeinnützigkeitsreformgesetz 2023 –
GemRefG 2023) (2319 d.B. und 2380 d.B. sowie 11361/BR d.B.
und 11410/BR d.B.) .................................................................... 84
Berichterstatter: Mag. Franz Ebner ....................................................................... 85
Redner:innen:
Doris Hahn, MEd MA ............................................................................................... 85
Silvester Gfrerer ....................................................................................................... 88
Dipl.-Ing. Dr. Maria Huber ...................................................................................... 90
Andrea Michaela Schartel ....................................................................................... 92
Annahme des Antrages des Berichterstatters, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................... 93
Gemeinsame Beratung über
8. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14.
Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das
Umsatzsteuergesetz 1994, das Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992, das
Elektrizitätsabgabegesetz, das Erdgasabgabegesetz, das
Kohleabgabegesetz und die Bundesabgabenordnung geändert werden (3777/A und
2381 d.B. sowie 11362/BR d.B.
und 11411/BR d.B.) ............................................................................................... 93
Berichterstatter: Ernest Schwindsackl .................................................................. 94
9. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14.
Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über
die Einrichtung
einer Bundeswettbewerbsbehörde (Wettbewerbsgesetz – WettbG)
geändert wird (2382 d.B. sowie 11412/BR d.B.) ........................................................ 93
Berichterstatter: Ernest Schwindsackl .................................................................. 94
Redner:innen:
MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky ....................................................................... 94
Christoph Stillebacher ............................................................................................. 96
Dr. Manfred Mertel .................................................................................................. 98
Michael Bernard ..................................................................................... 101, 108
Dipl.-Ing. Dr. Adi Gross ............................................................................................ 104
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 8, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................ 109
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 9, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................ 109
Gemeinsame Beratung über
10. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14.
Dezember 2023 betreffend ein
Bundesgesetz über die höhere berufliche Bildung
(HBB-Gesetz) (2312 d.B. und 2348 d.B. sowie
11376/BR d.B.) ...................... 109
Berichterstatterin: Elisabeth Wolff, BA ................................................................ 110
11. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Emissionsschutzgesetz für Kesselanlagen geändert wird (2246 d.B. und 2347 d.B. sowie 11377/BR d.B.) .............. 109
Berichterstatterin: Elisabeth Wolff, BA ................................................................ 110
Redner:innen:
Mag. Christine Schwarz-Fuchs ............................................................................... 110
Mag. Sandra Gerdenitsch ........................................................................................ 113
Andrea Michaela Schartel ....................................................................................... 116
Dipl.-Ing. Dr. Maria Huber ...................................................................................... 117
Annahme des Antrages der Berichterstatterin zu Punkt 10, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ............ 119
Annahme des Antrages der Berichterstatterin zu Punkt 11, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ............ 119
Gemeinsame Beratung über
12. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, das Arbeitsmarktservicegesetz und das Ausbildungspflichtgesetz geändert werden (2307 d.B. und 2394 d.B. sowie 11369/BR d.B.) ....................................................................................................... 119
Berichterstatter: Günther Ruprecht ...................................................................... 120
13. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14.
Dezember 2023 betreffend ein
Bundesgesetz, mit dem das Ausländerbeschäftigungsgesetz
und das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz geändert werden
(3774/A und 2395 d.B. sowie 11370/BR d.B.) .................................................................. 119
Berichterstatter: Günther Ruprecht ...................................................................... 120
Redner:innen:
Günter Pröller ........................................................................................................... 121
Dr. Andrea Eder-Gitschthaler ................................................................................. 124
Daniel Schmid .......................................................................................................... 125
Claudia Hauschildt-Buschberger ............................................................................ 131
Christoph Steiner ..................................................................................................... 134
Entschließungsantrag der Bundesrät:innen
Günter Pröller, Kolleginnen und Kollegen betreffend
„Schluss mit der unqualifizierten Zuwanderung
in unser Arbeitsmarktbudget“ – Ablehnung ...................................... 123,
137
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 12, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ............ 136
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 13, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ............ 136
14. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 15.
Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem zur Linderung der
Inflationsfolgen bei den Wohnkosten das Mietrechtsgesetz, das Richtwertgesetz
und das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz geändert werden (3. Mietrechtliches
Inflationslinderungsgesetz – 3. MILG) (3558/A und
2398 d.B. sowie 11394/BR d.B.) .......................................................................... 137
Berichterstatterin: Viktoria Hutter ....................................................................... 138
Redner:innen:
Korinna Schumann .................................................................................................. 138
MMag. Elisabeth Kittl, BA ....................................................................................... 142
MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky ....................................................................... 146
Sandra Lassnig ......................................................................................................... 149
Mag. Sascha Obrecht .............................................................................................. 151
Christoph Steiner .................................................................................... 156, 166
Matthias Zauner ...................................................................................................... 159
Günter Kovacs ......................................................................................................... 163
Mag. Harald Himmer .............................................................................. 164, 167
Entschließungsantrag der Bundesrät:innen Korinna Schumann, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Mietpreisstopp im freien Wohnungsmarkt“ – Ablehnung .............................................................................. 141, 168
Entschließungsantrag der Bundesrät:innen Mag. Sascha Obrecht, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Wohnen in der Krise – umfassendes Maßnahmenpaket für leistbares Wohnen“ – Ablehnung ................ 151, 169
Annahme des Antrages der Berichterstatterin, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................... 168
15. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 15.
Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das
Verbotsgesetz 1947, das Einführungsgesetz zu den
Verwaltungsverfahrensgesetzen 2008, das Abzeichengesetz 1960, das
Uniform-Verbotsgesetz und das
Symbole-Gesetz geändert werden
(Verbotsgesetz-Novelle 2023)
(2285 d.B. und 2340 d.B. sowie 11364/BR d.B. und
11395/BR d.B.) ............ 169
Berichterstatterin: Klara Neurauter ...................................................................... 169
Redner:innen:
Andreas Arthur Spanring ........................................................................................ 170
Marco Schreuder ..................................................................................................... 179
Barbara Prügl ........................................................................................................... 183
Stefan Schennach .................................................................................................... 186
Bundesministerin Dr. Alma Zadić, LL.M. ................................................................ 189
Markus Leinfellner ................................................................................................... 193
Annahme des Antrages der Berichterstatterin, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................... 198
16. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das GmbH-Gesetz, das Aktiengesetz, das Genossenschaftsgesetz, das SE-Gesetz, das SCE-Gesetz und das Firmenbuchgesetz geändert werden (Gesellschaftsrechtliches Digitalisierungsgesetz 2023 – GesDigG 2023) (2228 d.B. und 2341 d.B. sowie 11396/BR d.B.) ............................................................................................ 198
Berichterstatterin: Barbara Prügl .......................................................................... 198
Redner:innen:
Dr. Manfred Mertel .................................................................................................. 199
MMag. Elisabeth Kittl, BA ....................................................................................... 202
Marlies Doppler ....................................................................................................... 204
Mag. Christine Schwarz-Fuchs ............................................................................... 205
Annahme des Antrages der Berichterstatterin, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................... 207
17. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2023
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein
Flexible-Kapitalgesellschafts-Gesetz erlassen wird sowie das GmbH-Gesetz,
das Firmenbuchgesetz,
das Rechtspflegergesetz, das Notariatstarifgesetz, das Rechtsanwaltstarifgesetz,
das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz und das
Gerichtsgebührengesetz geändert werden
(Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2023 –
GesRÄG 2023) (2320 d.B. und 2342 d.B. sowie
11397/BR d.B.) ....................................................................................................... 207
Berichterstatterin: Sandra Lassnig ........................................................................ 207
Redner:innen:
Mag. Elisabeth Grossmann ..................................................................................... 208
MMag. Elisabeth Kittl, BA ....................................................................................... 209
Andreas Arthur Spanring ........................................................................................ 212
Matthias Zauner ...................................................................................................... 217
Bundesministerin Dr. Alma Zadić, LL.M. ................................................................ 218
Annahme des Antrages der Berichterstatterin, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................... 221
Gemeinsame Beratung über
18. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch geändert wird (Abstammungsrechts-Anpassungsgesetz 2023 – AbAG 2023) (3754/A und 2345 d.B. sowie 11365/BR d.B. und 11398/BR d.B.) ....................................................................................................... 221
Berichterstatter: Christoph Stillebacher ............................................................... 221
19. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 15.
Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das
Personenstandsgesetz 2013
geändert wird (2354 d.B. sowie 11399/BR d.B.) ............................................... 221
Berichterstatter: Christoph Stillebacher ............................................................... 221
Redner:innen:
Markus Leinfellner ................................................................................................... 222
MMag. Elisabeth Kittl, BA ....................................................................................... 222
Viktoria Hutter ......................................................................................................... 225
Mag. Elisabeth Grossmann ..................................................................................... 227
Bundesministerin Dr. Alma Zadić, LL.M. ................................................................ 227
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 18, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ............ 228
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 19, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ............ 228
20. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 15.
Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Koordinator-für-digitale-Dienste-Gesetz
erlassen und das KommAustria-Gesetz, das E-Commerce-Gesetz, das Allgemeine
bürgerliche Gesetzbuch, das Urheberrechtsgesetz, das
Gerichtsgebührengesetz, das Mediengesetz, die Strafprozeßordnung 1975,
das Staatsanwaltschaftsgesetz, das Bundesgesetz über die justizielle
Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen
Union, das Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz
und das Telekommunikationsgesetz 2021 geändert werden (DSA-Begleitgesetz –
DSA-BegG) (2309 d.B. und 2344 d.B. sowie 11366/BR d.B.
und 11400/BR d.B.) ............................................................................................... 229
Berichterstatterin: Viktoria Hutter ....................................................................... 230
Redner:innen:
Andreas Arthur Spanring ........................................................................................ 230
MMag. Elisabeth Kittl, BA ....................................................................................... 233
Klara Neurauter ....................................................................................................... 236
Stefan Schennach .................................................................................................... 238
Bundesministerin Dr. Alma Zadić, LL.M. ................................................................ 241
Entschließungsantrag der Bundesrät:innen
Stefan Schennach, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Den
Digital Services Act in der Praxis zum
Leben erwecken“ – Ablehnung ........................................................... 240,
242
Annahme des Antrages der Berichterstatterin, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................... 242
Eingebracht wurden
Anträge der Bundesrät:innen
Korinna Schumann, Kolleginnen und Kollegen betreffend Personalaufstockung beim Arbeitsmarktservice und der Arbeitsinspektion (406/A(E)-BR/2023)
Marlies Doppler,
Kolleginnen und Kollegen betreffend Erhaltung des Internationalen
Gebrauchshundesports in all seinen Facetten in Österreich
(407/A(E)-BR/2023)
Anfragen der Bundesrät:innen
Korinna Schumann, Kolleginnen und Kollegen an
die Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien
betreffend Wo sind die Fördermittel zur Gewaltprävention für
Frauen und Mädchen mit Behinderung?
(4139/J-BR/2023)
Korinna Schumann, Kolleginnen und Kollegen an
den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz betreffend Wo
sind die Fördermittel zur Gewaltprävention für Menschen mit
Behinderung? (4140/J-BR/2023)
Mag. Elisabeth Grossmann, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln in Österreich (4141/J-BR/2023
Anfragebeantwortungen
der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der
Bundesrät:innen Andrea Michaela Schartel, Kolleginnen
und Kollegen betreffend Ermittlungsverfahren gegen Grazer KFG-Gemeinderat
Michael Winter (3822/AB-BR/2023
zu 4127/J-BR/2023)
der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Bundesrät:innen Markus Leinfellner, Kolleginnen und Kollegen betreffend Eisenbahnkreuzungen in der Steiermark (3823/AB-BR/2023 zu 4126/J-BR/2023)
Beginn der Sitzung: 13 Uhr
Vorsitzende: Präsidentin Mag.a Claudia Arpa, Vizepräsidentin Margit Göll, Vizepräsidentin Doris Hahn, MEd MA.
Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Ich eröffne die 961. Sitzung des Bundesrates.
Die nicht verlesenen Teile des
Amtlichen Protokolls der 960. Sitzung
des Bundesrates vom 7. Dezember 2023 sind aufgelegen und wurden nicht
beanstandet.
Als verhindert gemeldet ist das Mitglied des Bundesrates Mag.a Isabella Theuermann.
Begrüßen möchte ich an dieser Stelle Herrn Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung Dr. Martin Polaschek. – Herzlich willkommen! (Beifall bei ÖVP, SPÖ und Grünen sowie des Bundesrates Arlamovsky.)
Einlauf und Zuweisungen
Präsidentin
Mag.a Claudia Arpa: Hinsichtlich
der eingelangten und verteilten Anfragebeantwortungen und eines Schreibens des
Bundesministers für Finanzen gemäß Art. 50 Abs. 5
Bundes-Verfassungsgesetz verweise ich gemäß § 41
Abs. 1 der Geschäftsordnung des Bundesrates auf die im Sitzungssaal
verteilten Mitteilungen der 961. und der 962. Sitzung des Bundesrates, die
dem Stenographischen Protokoll dieser Sitzung angeschlossen werden.
Ebenso verweise ich hinsichtlich der
eingelangten Verhandlungsgegenstände und
deren Zuweisungen im Sinne des § 19 Abs. 1 der
Geschäftsordnung
auf die gemäß § 41 Abs. 1 der
Geschäftsordnung im Sitzungssaal verteilten Mitteilungen der 961. und der
962. Sitzung des Bundesrates, die
dem Stenographischen Protokoll dieser Sitzung angeschlossen werden.
Die schriftliche Mitteilung hat folgenden Wortlaut:
A. Eingelangt sind:
1. Anfragebeantwortungen
(Anlage 1) (siehe auch S. 16)
2. Unterrichtung gemäß Art. 50 Abs. 5 B-VG
Schreiben des Bundesministers für Finanzen betreffend Vollmacht zur Aufnahme von Verhandlungen über den Neuabschluss eines Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik Kolumbien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen und zur Verhinderung der Steuerverkürzung und -umgehung (Anlage 2)
B. Zuweisungen
Gesetzesbeschlüsse (Beschlüsse) des Nationalrates
(siehe Tagesordnung)
*****
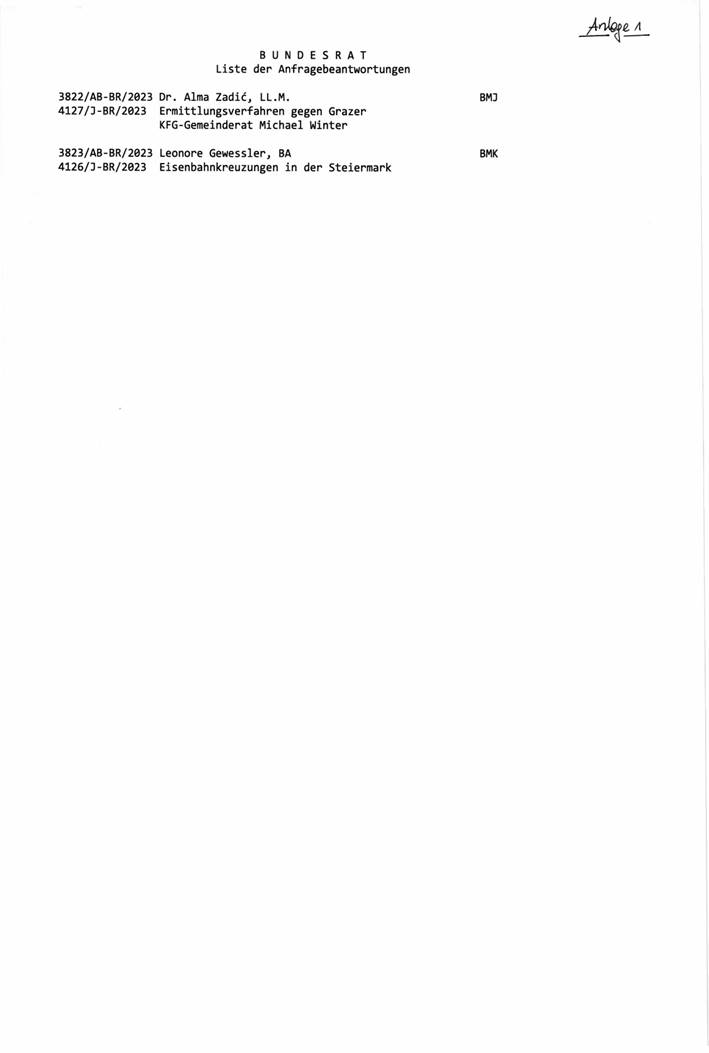
*****
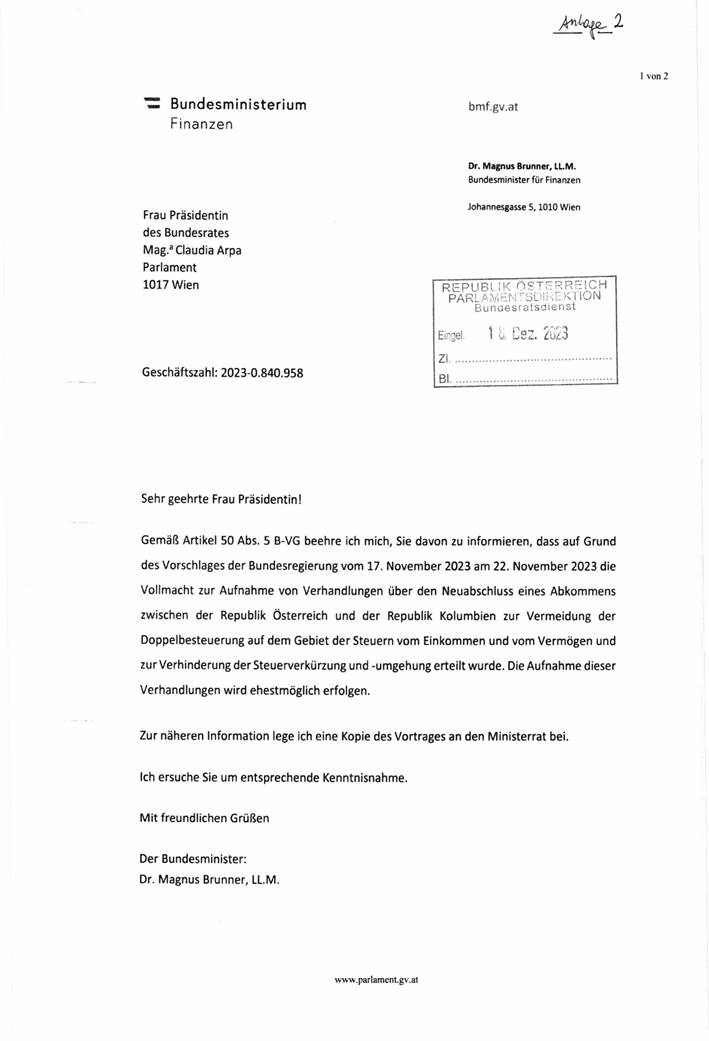
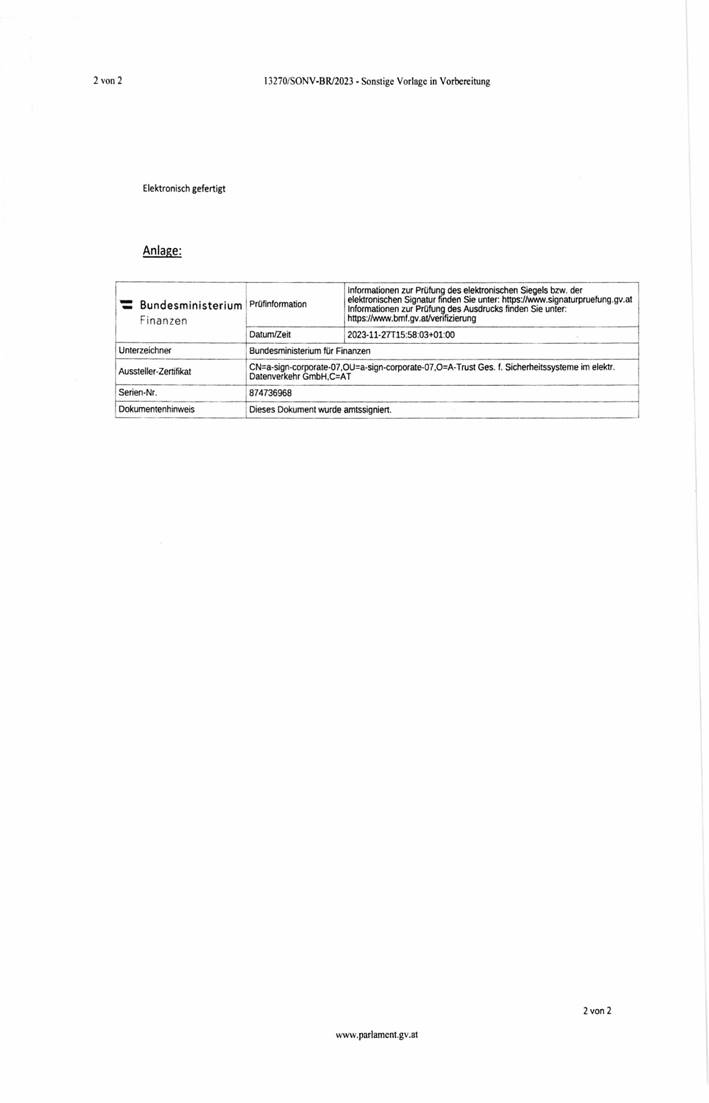
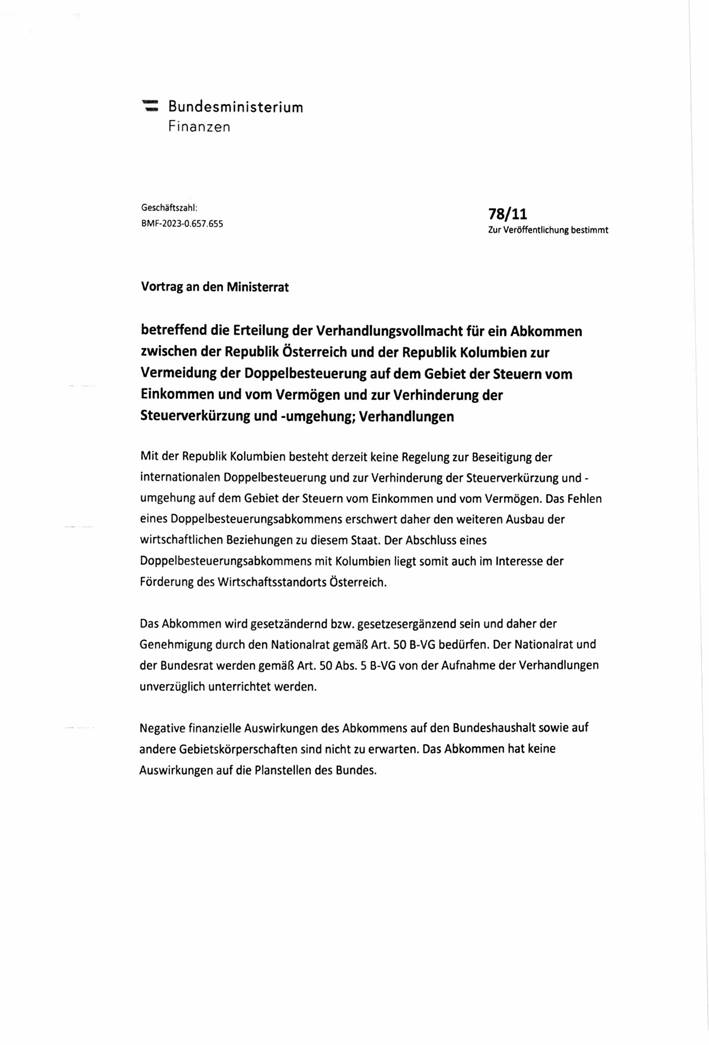
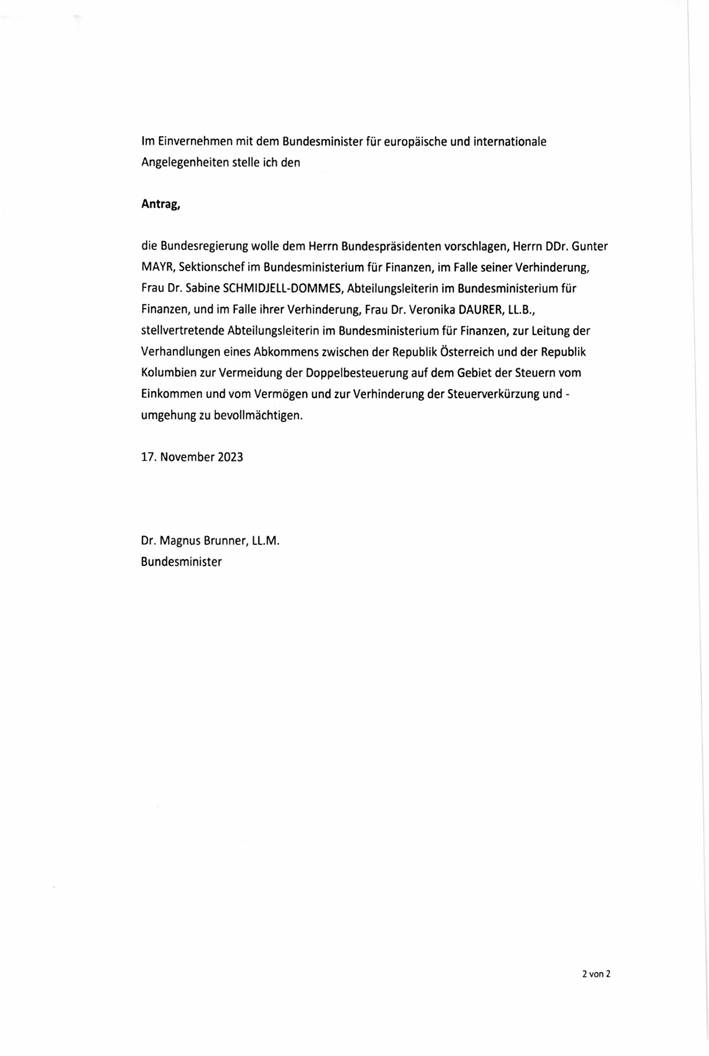
*****
Vertretung von Mitgliedern der Bundesregierung
Präsidentin
Mag.a Claudia Arpa: Eingelangt
ist ein Schreiben des Ministerratsdienstes des Bundeskanzleramtes
betreffend den Aufenthalt des Herrn Bundesministers für Arbeit und
Wirtschaft Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher vom 17. bis 21. Dezember 2023 im Oman bei
gleichzeitiger Beauftragung von
Herrn Bundesminister für Inneres Mag. Gerhard Karner
gemäß Art. 73 Abs. 1 Bundes-Verfassungsgesetz mit seiner
Vertretung.
*****
Eingelangt sind und den zuständigen
Ausschüssen zugewiesen wurden jene Beschlüsse des Nationalrates,
die Gegenstand der heutigen Tagesordnung
sind. Die Ausschüsse haben ihre Vorberatungen abgeschlossen und
schriftliche Ausschussberichte erstattet.
Absehen von der 24-stündigen Aufliegefrist
Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Es ist mir der Vorschlag zugekommen, von der 24-stündigen Aufliegefrist der gegenständlichen Ausschussberichte zu den vorliegenden Verhandlungsgegenständen Abstand zu nehmen.
Hierzu ist eine Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen erforderlich.
Ich bitte also jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die mit dem Vorschlag der Abstandnahme von der 24-stündigen Aufliegefrist der gegenständlichen Ausschussberichte einverstanden sind, um ein Handzeichnen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit.
Der Vorschlag ist mit der nach § 44 Abs. 3 der Geschäftsordnung des Bundesrates erforderlichen Zweidrittelmehrheit angenommen.
*****
Ich habe die zuvor genannten Verhandlungsgegenstände auf die Tagesordnung der heutigen Sitzung gestellt.
Wird zur Tagesordnung das Wort gewünscht? – Das ist nicht der Fall.
Behandlung der Tagesordnung
Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Aufgrund eines mir zugekommenen Vorschlages beabsichtige ich, die Tagesordnungspunkte 2 bis 4, 5 und 6, 8 und 9, 10 und 11, 12 und 13 sowie 18 und 19 jeweils unter einem zu verhandeln.
Erhebt sich dagegen ein Einwand? – Auch das ist nicht der Fall.
Somit gehen wir in die Tagesordnung ein.
Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend eine
Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den
Ländern über die Förderung von Bildungsmaßnahmen im
Bereich Basisbildung sowie
von Bildungsmaßnahmen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses für
die Jahre 2024 bis 2028 (2311 d.B. und 2330 d.B. sowie
11382/BR d.B.)
Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Wir gelangen zum 1. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatter ist Herr
Bundesrat Christoph Stillebacher. – Ich bitte um
den Bericht. Bitte sehr, Herr Bundesrat.
Berichterstatter Christoph Stillebacher: Frau Präsidentin! Herr Minister! Hohes Haus! Ich bringe den Bericht über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend eine Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die Förderung von Bildungsmaßnahmen im Bereich Basisbildung sowie von Bildungsmaßnahmen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses für die Jahre 2024 bis 2028.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher zur Antragstellung:
Der Unterrichtsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage
mehrstimmig
den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates
keinen Einspruch zu erheben.
Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Herzlichen Dank.
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Klemens
Kofler. – Bitte sehr,
Herr Bundesrat.
Bundesrat Klemens Kofler (FPÖ,
Niederösterreich): Sehr geehrte
Frau Präsident! Sehr geehrter Herr Minister! Sehr geehrte Kollegen aus dem
Bundesrat!
Liebe Freunde hier und zu Hause! Grüß Gott! Es ist mir eine
außerordentliche Ehre, obwohl es nur Zufall ist, dass ich heute der erste
Redner sein darf.
Also legen wir einmal los! Warum gibt es überhaupt so einen drastischen
Nachholbedarf bei den Pflichtschulabschlüssen? – Das liegt
ganz sicher nicht
an den Lehrern, das liegt auch nicht an den Schülern und auch nicht an
deren Eltern.
Warum dann der
Pisa-Schock? – Die Pisa-Studie hat uns ja wieder drastisch vor Augen
geführt, dass die Leistungen massiv gesunken sind. Jetzt kann man
natürlich drüber reden, vielleicht könnte man eine NGO oder eine
Stiftung gründen, lang und breit diskutieren, vielleicht
könnten wir auch noch die selbsternannten Experten befragen –
das ist auch immer recht amüsant –,
aber es wird nichts nutzen, denn der einzige Grund ist die Zuwanderung (Ah-Rufe
bei der SPÖ), die eben nicht koordiniert ist. Nur daran liegt es. (Beifall bei der FPÖ. – Bundesrat Schennach:
Sehr überraschend!)
Wie soll denn das funktionieren? – Ein Lehrer kommt in das Klassenzimmer rein und niemand kann Deutsch außer er selber. Da ist der Unterricht ja nicht
möglich. So viel ist eigentlich logisch, aber darüber darf man ja
nicht reden. (Bundesrätin Schumann: Das ist in der
International School in Wien ...!) Darüber
darf man nicht reden. Wenn man sagt, da kann man halt nichts machen!, dann sage
ich, ein Parlamentarier, der sagt: Da kann man halt nichts machen!,
kann aufstehen und nach Hause gehen. (Beifall und Bravoruf bei der FPÖ. –
Bundesrat Schreuder: Ja, man merkt, Sie dürfen nicht
darüber reden, Sie tun
es aber jetzt! Sie dürfen auch im Parlament dann nicht darüber reden!) –
Ja, ich rede.
Dann kommt auch
die Coronakrise dazu (Bundesrat Schreuder: Corona!
Corona ist auch noch schuld!), die die Lage natürlich verschärft
hat, weil die Maßnahmen ja grundfalsch waren, obwohl es
Lösungen gegeben hätte. Ich darf
da an Bundesrat Spanring erinnern, der damals schon gesagt hat, man soll Luftfilter
einbauen, damit man die Viren zurückdrängt und eben auch in den
Schulen unterrichten kann und nicht nur die Kinder dort unterbringt. Ohne Unterricht
hat ja Schule keinen Sinn.
So aber wird das zur Dauerlösung werden.
Wir werden immer wieder Geld investieren, 6 000 Euro kostet das
pro Hauptschulabschluss – das wäre ja
noch sinnvoll investiert, das ist das einzig Gute an der ganzen Sache, da
könnte ich ja noch mitgehen, aber nicht als Dauerlösung. Die Schule
muss wieder funktionieren und die kann auch funktionieren. Wir haben die
Lehrer, wir haben gescheite Schüler und ordentliche Eltern. –
Vielen Dank. (Beifall bei der FPÖ.)
13.07
Präsidentin
Mag.a Claudia Arpa: Als Nächste zu Wort
gemeldet
ist Frau Bundesrätin und meine Vizepräsidentin Margit
Göll. – Bitte sehr.
Bundesrätin
Margit Göll (ÖVP, Niederösterreich): Sehr geehrte Frau Präsidentin!
Geschätzter Herr Minister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Werte
Zuhörer! Ja, für mich ist die Freude auch groß, als zweite
Rednerin hier am Pult stehen zu dürfen und besonders zu diesem
Thema sprechen zu dürfen,
aber ich möchte mit einem Zitat beginnen. Es lautet: Es gibt nur eines,
was auf Dauer teurer ist als Bildung, nämlich keine Bildung.
Bildung – das wissen
wir – beginnt ja nicht erst in der Schule und endet mit dem
Schulaustritt. Wir alle wissen, lebenslanges Lernen umfasst genau das, was
es eben aussagt: lebenslanges Lernen. Als erster Bildungsort gilt
natürlich das Elternhaus, die Familie (Bundesrätin Doppler:
Ah, da schau her! Richtig!), in die
wir hineingeboren werden. (Beifall und Bravoruf bei der
FPÖ.) Der Kindergarten ist
die erste Bildungsinstitution und erste Bildungseinrichtung, und dem Kindergarten
kommt da auch eine sehr große Bedeutung zu.
Wenn Menschen
nach neun Jahren Pflichtschule keinen Pflichtschulabschluss erlangen, aus
welchen Gründen auch immer (Ruf bei der FPÖ: Die ÖVP
findet wieder zurück!), müssen wir die Voraussetzungen schaffen,
diesen jungen Menschen diese Möglichkeit offenzuhalten, diesen Abschluss
zu erlangen
und Bildungslücken auch zu schließen.
Es gibt viele Menschen, die erkennen, dass sie etwas nachholen wollen, was bisher in ihrem Leben nicht vorhanden war, und das müssen wir natürlich unterstützen. Daher ist diese Maßnahme auch so wichtig.
Ich habe es
eingangs schon erwähnt: Mich freut es, dass diese Maßnahme für
die Basisbildung, aber auch für den Pflichtschulabschluss, diese
15a-Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern hier
festgeschrieben wird
und wir wahrscheinlich sehr vielen Menschen helfen, wieder einen Job, wieder
einen Arbeitsplatz zu finden.
Es ist nämlich
so – ja, das ist eine Tatsache –, dass es immer noch
viele
junge Menschen gibt, die über keinen Pflichtschulabschluss verfügen,
und es wird natürlich das Bild auch dramatisch, wenn man sich die Gruppe
der Jugendlichen zwischen 16 und 24 ansieht, die weder eine Ausbildung noch
eine Beschäftigung haben.
Da reden wir schon von 75 000 Jugendlichen. Wir müssen daher auch sicherstellen und Maßnahmen setzen, dass alle Schülerinnen und Schüler, die das Schulsystem verlassen, gewisse Mindeststandards, die für die 8. Schul-
stufe gelten,
beherrschen. Da rede ich in der Pflichtschule von Grundkompetenzen. Wir
kennen diese Grundkompetenzen alle – das sind natürlich Lesen,
Rechnen und Schreiben –, und diese gilt es auch ausreichend zu
vermitteln. Sie sind die Grundlage für ein erfülltes Leben und
natürlich auch für Erfolg
im Beruf.
Geschätzte Kolleginnen und
Kollegen! Ihnen wird es sicherlich auch schon bei einem Besuch in einer
Firma so gegangen sein, dass der Firmenchef erzählt,
dass er händeringend junge Menschen anwerben möchte (Bundesrätin
Schumann: Ältere bitte auch! Ältere nehmts auch!), damit
sie eine Lehre machen, und dann feststellen muss, einfache Aufgaben können
nicht gelöst werden. (Bundesrat Steiner: Handeln!)
Das muss uns schon zu denken
geben und daher müssen wir natürlich alle Maßnahmen setzen
und sicherstellen, dass am Ende der 8. Schulstufe gewisse Mindeststandards
beherrscht werden. Es ist von enormer Bedeutung, dass wir den Jugendlichen in
der Pflichtschule Lesen, Rechnen und Schreiben
vermitteln.
Nur wenn Schüler
sinnerfassend lesen können, sind sie in der Schule und auch im weiteren
Leben und auch in der Arbeitswelt erfolgreich. Lernen beginnt
ja lange vor dem Schuleintritt – das habe ich schon
erwähnt –, weshalb
man auch die vorherige Entwicklung der Kinder kennen und beachten muss, und da
kommt dem Elementarbereich eine enorm wichtige Bedeutung zu.
Es sind aber – ich
spreche das jetzt auch ganz deutlich an – auch die Eltern in die
Pflicht zu nehmen. Die Kinder sind viele Jahre zu Hause, und es ist wichtig,
dass die Eltern mit den Kindern von deren Geburt an in Kontakt und in Kommunikation
treten. Das ist sehr, sehr wichtig. Es ist auch wichtig, dass Eltern
ihren Kindern vorlesen – lesen, lesen, lesen ist ganz, ganz wichtig.
Wir müssen alles daransetzen, jeden Jugendlichen zu begleiten und zu unterstützen. Ich freue mich wirklich besonders, dass 173 Millionen Euro für das
Nachholen der Basisbildung und für den Pflichtschulabschluss zur Verfügung gestellt werden. Bereits 2012 wurde diese Vereinbarung ja schon einmal abgeschlossen, diese Maßnahme gesetzt. Das soll jetzt fortgesetzt werden, es werden 23 000 Personen die Möglichkeit haben, Bildungsangebote in Anspruch zu nehmen, und 11 000 Personen können den Pflichtschulabschluss nachholen. (Beifall bei der ÖVP.)
Bildung muss in jedem Alter möglich sein, und da
sollten wir auch entsprechende Möglichkeiten zur Verfügung stellen.
Wir finden, das ist ein guter Schritt
in die richtige Richtung, und werden natürlich diesen Antrag sehr gerne
unterstützen. – Vielen Dank. (Beifall bei der ÖVP.)
13.13
Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Als Nächste zu Wort gemeldet ist die andere Vizepräsidentin, Frau Bundesrätin Doris Hahn. – Bitte sehr.
Bundesrätin Doris Hahn, MEd MA
(SPÖ, Niederösterreich): Frau
Präsidentin! Geschätzter Herr Minister! Werte Kolleginnen und Kollegen!
Liebe Gäste hier im Saal und zu Hause vor den
Bildschirmen! Bevor ich in meine Rede eingehe, zu den Ausführungen
von Herrn Kollegen Kofler nur eine kleine Aufklärung: Die Hauptschule gibt
es schon, ich weiß nicht, über zehn Jahre nicht mehr. Das
dürfte sich aber bis zur FPÖ noch nicht ganz durchgesprochen
haben, aber ist ja eine Kleinigkeit. (Beifall bei der SPÖ und bei
Bundesrät:innen der ÖVP. – Zwischenrufe bei der FPÖ.)
Ich möchte auch mit einem Zitat beginnen, nämlich
von einem Arzt und
Lyriker, Ernst von Feuchtersleben, der gemeint hat: „Wenn das Leben das
höchste Gut ist, so ist Bildung der Schlüssel zum höchsten
Gut.“ In diesem Sinne, glaube ich, kann man Bildung durchaus auch als
ganz, ganz wichtige Grundlage für ein selbstbestimmtes, für ein
erfülltes Leben, aber vor allen Dingen
auch für ein gesundes und zufriedenes Leben verstehen.
In weiterer Folge ist ein Bildungsabschluss auch eine ganz
essenzielle Frage der gesellschaftlichen Teilhabe. Das heißt, wenn wir
uns vorstellen – und ich
glaube, solche Situationen kennen wir alle –, wenn Menschen
vielleicht Schwierigkeiten haben, Verträge zu lesen oder Formulare
auszufüllen, oder wenn
schon der Beipackzettel eines Medikaments oder auch der Fahrplan
an der Bahnhofsanzeige zu einer schier überwindbaren Hürde werden,
dann geht das oftmals mit ganz großer Verunsicherung und unter
Umständen auch mit großer Scham einher.
Ich glaube, das ist durchaus nachvollziehbar und verständlich und führt in weiterer Folge auch dazu, dass Menschen sich zurückziehen, sich aus dem gesellschaftlichen, aus dem öffentlichen Leben zurücknehmen, und sie fallen leider vielfach auch aus dem Arbeitsmarkt, aus dem Arbeitsleben heraus.
Das heißt, Bildung ist mit ein ganz klar wesentlicher
Beitrag zu einer offenen und solidarischen Gemeinschaft und zu einer
zukunftsgerichteten Gesellschaft,
wie wir sie brauchen. Unter diesem Aspekt ist auch der vorliegende Gesetzentwurf
aus meiner Sicht zu betrachten.
Zu Grunde liegt ja unter anderem die Piaac-Studie, also das Programme
for the International Assessment of Adult Competencies der OECD. Diese Studie
gibt uns unter anderem auch großen Aufschluss über die Kompetenzen
Erwachsener in den Bereichern der Schlüsselkompetenzen, nämlich
Lesen, Schreiben, Rechnen – Kollegin Göll hat es schon
angesprochen. Da wird den Menschen in Österreich im Vergleich zu jenen in
anderen Nationen,
die an der Studie teilgenommen haben, leider eine eher unterdurchschnittliche
Lesekompetenz bescheinigt. (Ruf bei der FPÖ: Ja warum wohl?)
Zum Glück hat man diese
Problematik in der Bildungspolitik aber schon vor Jahren erkannt, und
unter Bundesministerin Claudia Schmied wurde damals
schon, 2012, finanziert von Bund und Ländern, aber auch vom
Europäischen Sozialfonds, die Initiative Erwachsenbildung ins Leben
gerufen, mit der
dann auch ein flächendeckendes standardisiertes Angebot geschaffen wurde,
damit auch eine entsprechende grundlegende Basisbildung sowie die Möglichkeit, den Pflichtschulabschluss nachzuholen, gewährleistet werden konnten.
Inzwischen, viele Jahre
später, hat man gesehen, dass das Angebot ein gutes ist, ein wichtiges
ist, dass das Angebot allerdings noch viel zu gering ist und
die Nachfrage immer größer wird. Teilweise gibt es bei den
Einrichtungen lange Wartelisten. Wir haben im Ausschuss auch mit den Experten
darüber gesprochen und sind informiert worden, dass knapp 70 Prozent
der Kursteilnehmer:innen in diesem Zusammenhang unter 25 Jahre alt
sind. Seit 2012
waren es insgesamt 10 500 Personen, die über die Initiative Erwachsenenbildung
den Pflichtschulabschluss nachgeholt haben, bei immerhin über
50 Einrichtungen. Das ist, glaube ich, eine Bilanz, die sich sehen lassen
kann.
Daher gibt es auch von unserer Seite die vollste Zustimmung zum vorliegenden Gesetzentwurf. Wir haben es schon gehört: Es werden immerhin neuerlich 170 Millionen Euro in die Hand genommen, um das Angebot noch weiter voranzutreiben und auszubauen.
Das bedeutet dann auch in
Zahlen, dass weitere 23 000 Menschen im Bereich der Basisbildung
unterstützt werden können und rund 11 000 Menschen
ihren Pflichtschulabschluss nachholen können. Das ist so weit positiv, da
können wir auf alle Fälle mitgehen.
Ich glaube, es muss in unser aller Interesse sein, und das
richte ich jetzt auch entsprechend an die FPÖ, die ja offensichtlich ihre
Zustimmung hier
nicht gibt, dass jeder und jede junge Erwachsene, die vielleicht irgendwo am
Bildungsweg verloren gegangen sind oder verloren gehen, auch die Möglichkeit erhalten,
diesen Weg, wenn auch später und vielleicht auch
über Umwege, weiterzugehen, denn wir wissen: Die Gründe dafür,
die Schule ohne Abschluss zu verlassen, sind vielfältig. Oftmals kann der
oder die Betroffene rein gar nichts dafür. Da geht es unter Umständen
auch um Krankheitsfälle, da geht es um Depression, da geht es um
schwierige Familienverhältnisse, auch um plötzliche
Schicksalsschläge und vieles mehr.
Das heißt, schön, dass sich hier auch über die Fraktionsgrenzen hinweg eine Einigung zeigt und, sagen wir es einmal so, weite Teile des parlamentarischen Prozesses dieser Investition positiv gegenüberstehen.
Spannend finde ich wie gesagt, dass ausgerechnet die
FPÖ da nicht zustimmt, schließlich ist die FPÖ immer die
Partei, die sich ganz gerne als die Partei
des kleinen Mannes bezeichnet. Dass das hier verweigert wird, finde ich
insofern ein bissel unverständlich (Bundesrat Spanring: Sie
verstehen vieles nicht!), als,
und so ehrlich müssen wir schon sein, gerade dieses Angebot eben nicht auf
die Bildungselite abzielt, sondern ganz stark und vor allem auf
einkommensschwache und armutsgefährdete Personen. Ich glaube, gerade aus
diesem Grund wäre es vielleicht an der Tagesordnung, darüber noch einmal nachzudenken
und hier zuzustimmen – aber wie gesagt, das muss die FPÖ auch
selbst entscheiden.
Eine kleine Anmerkung sei mir noch gestattet, was die Piaac-Studie betrifft: Es wurden im Zuge dessen ja auch Kompetenzen im Bereich der digitalen Bildung überprüft, und da kommt diese Studie leider auch zu – teilweise – erschütternden Ergebnissen, so ehrlich muss man es sagen.
Österreich belegt demnach bei Kompetenzstufe
drei – das ist sozusagen keine Raketenwissenschaft, das entspricht
ungefähr dem Europäischen Computerführerschein, was die
Kompetenzen betrifft – lediglich Platz 14 von
19 teilnehmenden Nationen. Das ist also nichts, worauf man sich in
Ruhe ausruhen kann und darf.
30 Prozent, also ein Drittel der 44- bis 65-Jährigen in Österreich geben an, dass sie über keine oder kaum Computerkenntnisse verfügen, und ich glaube, das sollte uns zu denken geben.
Das betrifft selbst die Jungen, also die Digital Natives, wenn man sie so nennen möchte, die grundsätzlich zwar viel ungehemmter und intuitiver mit digitalen Medien umgehen, was aber noch lange keine Garantie ist, dass auch die Kenntnisse dementsprechend sind.
Das heißt: Im Umgang mit Computer und Co hat Österreich einfach noch einen riesengroßen Aufholbedarf. Ich glaube, wir können das auch so interpretieren, dass das mit einer der Gründe dafür ist, dass Österreich im Vergleich zu vielen anderen Ländern der Digitalisierung einfach grundsätzlich skeptisch gegenübersteht.
Also besonders in diesem Bereich müssen wir
versuchen, alle Teile der Gesellschaft mitzunehmen, schließlich geht
es auch da wieder – wie zu Beginn
meiner Rede schon ausgeführt – in einem ganz hohen Maß um
gesellschaftliche Teilhabe, um Partizipation. Wir kennen das alle:
Bankgeschäfte gehen
heute nur noch digital, mit PC und Smartphone, ohne das geht es einfach nicht. (Beifall
bei der SPÖ.)
Selbst, wenn es nur um das Herunterladen des eigenen
Lohnzettels geht, wozu ich meine ID Austria brauche: Viele ältere
Menschen geben es zu: Ich
habe die Kenntnisse und die Kompetenz dazu nicht mehr. – Das erzeugt
einfach große Schwierigkeiten und große Verunsicherung.
Ich glaube, damit wird sich die Politik und ganz besonders
natürlich die Bildungspolitik auseinandersetzen müssen, und zwar
jetzt. Ich glaube,
dieser Skepsis – eigentlich ist es ein Mangel –
müssen wir möglichst schnell entgegenwirken. Das wäre vielleicht
meine Bitte ans Christkind oder vielmehr an den Minister.
Abschließend – weil es mir ein
großes Anliegen ist und ich aus dem Bereich komme – darf ich
an dieser Stelle, da wir uns ja wieder mit einer großen Grippewelle
im Bildungsbereich, in der Schule, im Kindergarten, in den elementarpädagogischen
Einrichtungen konfrontiert sehen, ein großes Dankeschön an alle
Pädagoginnen und Pädagogen, an alle Lehrkräfte, an alle
Schulleiterinnen und Schulleiter richten, die im Moment wirklich
Immenses leisten, die teilweise an ihre Grenzen gehen müssen, weil
einfach das Personal nicht da
ist, weil das Personal grundsätzlich fehlt oder weil es krank ist. Sie
haben wirklich meine Hochachtung, es ist eine ganz wichtige Aufgabe, die da
trotz aller Hindernisse und Schwierigkeiten erfüllt wird. Ich glaube, das
kann man nicht
hoch genug schätzen, das muss man wertschätzen. (Beifall
bei SPÖ, ÖVP
und Grünen.)
Die, die im Bildungsbereich immer wieder ganz gerne
vergessen werden, gehören natürlich auch dazu: alle
Freizeitpädagog:innen, Betreuer:innen, Sozialarbeiter:innen, auch die
Schulpsychologie darf ich nicht außen vor lassen. Ihnen allen sei ein
großes Dankeschön ausgerichtet, und ich hoffe, sie haben
ein paar schöne, erholsame Tage jetzt über Weihnachten, damit das
Jahr 2024 wieder voller Energie starten kann. – Vielen Dank. (Beifall
bei der SPÖ.)
13.23
Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Simone Jagl. Ich erteile ihr dieses. – Bitte schön.
Bundesrätin
Simone Jagl (Grüne, Niederösterreich): Frau Präsidentin! Willkommen, Herr Bundesminister!
Willkommen, Besucherinnen und Besucher hier bei uns im Haus! Werte Kolleginnen
und Kollegen! Ich finde es immer wieder spannend, wie es die FPÖ schafft,
vor allem bei Bereichen, in denen sie sich nicht wirklich auskennt, zu ihren
Lieblingsthemen zu kommen (Ruf bei
der FPÖ: Ja, weil’s stimmt!) – auch wenn es nicht
stimmt (Zwischenrufe der Bundesräte Leinfellner, Spanring
und Steiner), aber ja, dann muss man halt auf
Fakenews ausweichen und Fakten außer Acht lassen. (Bundesrat Steiner: ...
unglaublich gut erkannt! Unglaublich gut! – Zwischenruf des
Bundesrates Leinfellner.) – Genau. (Bundesrat
Steiner: ... unglaublich gut! Jetzt fang zum Lesen an einmal! Lesen
ist - -!)
Überlegen wir uns das einmal: Ein Kind kommt mit
ungefähr sechs Jahren in die Schule, idealerweise mit etwas mehr
Vorerfahrung als nur dem verpflichtenden Kindergartenjahr, und im
Laufe der Schullaufbahn erwirbt es nicht nur, aber im Wesentlichen ganz
essenzielle Grundkompetenzen. Wir haben
es schon gehört: Lesen, Schreiben, Rechnen, aber mittlerweile gehören
auch digitale Kompetenzen zu diesen Grundkompetenzen. Ich glaube, jede
und jeder hier herinnen, die oder der Kinder hat, kennt es von den eigenen Kindern,
dass es dann manchmal heißt: Ach, wozu brauche ich das denn
später? Mathematik, Lesen oder Schreiben ist mühsam! Wozu brauche ich
das?
Die meisten Kinder schaffen es aber, sich zumindest diese Kompetenzen im Laufe ihrer Schulzeit anzueignen. Das ist der Idealzustand. (Ruf bei der FPÖ: Sonst gehen sie zu den Grünen, ist auch okay! – Bundesrat Leinfellner: Und die anderen werden Parteimitglied bei den Grünen! – Bundesrat Steiner: Ja!)
Jetzt gibt es aber Umstände, die nichts mit kognitiven
Fähigkeiten zu tun haben – und da muss ich Kollegen Kofler
recht geben, auch nicht mit den Lehrenden, die wirklich ihr Bestes
geben –, sondern einfach Gegebenheiten, Umstände sind, die
diese ideale Bildungslaufbahn stören. Das können, wir haben es auch
schon gehört, Krankheiten sein oder unvorhergesehene Ereignisse,
wir wissen, da gehören (Ruf bei der FPÖ: Migration!) –
ja – tatsächlich
auch Fluchterfahrungen dazu, das sucht sich niemand aus.
Wir haben hier schon öfter darüber gesprochen,
dass Bildung in Österreich nach wie vor
zu einem großen Teil vererbt wird, auch aus einem
bildungsfernen –
sage ich einmal – Haushalt zu kommen kann die Schullaufbahn, den
schulischen Erfolg massiv beeinträchtigen. Manche Menschen verlieren aber
auch erst
im Erwachsenenalter den Anschluss. Die Herausforderungen im Zusammenhang mit
technologischen Neuerungen sind etwas, das vielen Menschen Probleme bereitet.
Die sozialen und ökonomischen Auswirkungen –
Kollegin Hahn hat es recht anschaulich ausgeführt – liegen
auf der Hand, die Betroffenen leiden unter Diskriminierung und
Minderwertigkeitsgefühlen. Es ist ein schambehaftetes Thema, wenn man
selbst merkt, dass die Kompetenzen einfach mangelhaft
sind, die Betroffenen täuschen über die mangelnden Kompetenzen
hinweg, sie täuschen teilweise sogar Familie und Freunde.
Gleichzeitig – und das sei
auch speziell an die FPÖ gerichtet – haben all diese Menschen
andere Kompetenzen, haben Potenziale, die wir nicht liegenlassen
können. (Beifall bei
den Grünen und bei Bundesrät:innen der SPÖ.) Alles andere ist volkswirtschaftlicher Irrsinn und sozialer sowieso.
Die beiden Programmteile, um die es heute geht, Basisbildung
und Nachholen des Pflichtschulabschlusses, richten sich im Besonderen an
Menschen
ab dem 15. Lebensjahr. Während die Angebote für die Basisbildung
vermehrt von Erwachsenen in Anspruch genommen werden, ist die Zielgruppe
beim Nachholen des Pflichtschulabschlusses eher jünger. Basisbildung
zeichnet sich auch besonders dadurch aus, dass sie wirklich auf die
individuellen Biografien der Menschen eingeht und auch mit den vorhandenen
Kompetenzen arbeitet, sich an diesen orientiert und auf diesen aufbaut.
Letztlich geht
es darum – das wurde auch schon ausführlich
besprochen –, die Bereiche des Lebens der betroffenen Personen zu
erfassen und die Handlungsmöglichkeiten zu erweitern. In
Österreich begann die Basisbildungsarbeit Ende der Achtziger-, Anfang
der Neunzigerjahre mit Kursangeboten in Wien, mittlerweile
gibt es zahlreiche wirklich tolle Angebote.
In diesem Zusammenhang möchte ich auf eine Sache
hinweisen, auf die
ich im Zuge meiner Vorbereitungen gestoßen bin: das Alfatelefon. Das ist
eine Hotline, die einerseits ganz niederschwellig Informationen zu Kursangeboten zur Basisbildung
gibt. Das ist auch anonym möglich. Andererseits bietet sie aber auch
Soforthilfe an, zum Beispiel, wenn es um das Ausfüllen von Formularen geht,
um das Verfassen von E-Mails, um schriftliche Tätigkeiten in der Arbeit
und so weiter. Das Ganze ist wie gesagt sehr niederschwellig
und über zahlreiche Kanäle möglich: telefonisch, per Mail, aber
auch über Messengerdienste. Das ist jetzt gar kein Widerspruch, denn
besonders diese Möglichkeiten helfen Betroffenen bei Problemen
hinsichtlich Sprache zu Text und im Umgang mit diesen Medien.
Super finde ich auch, dass wir jetzt die Bundesjugendvertretung in der Steuerungsgruppe dabei haben, weil ja Jugendliche wirklich auch sehr stark betroffen sind, das haben wir von Frau Kollegin Hahn schon gehört. Die Bundesmittel wurden um 30 Prozent auf 11,7 Millionen Euro pro Jahr erhöht,
und insgesamt wurde von 28 auf 35 Millionen Euro erhöht: Das ist wirklich gut angelegtes Geld, es ermöglicht die Weiterführung dieser wichtigen unentgeltlichen Angebote für Jugendliche und Erwachsene.
Wie gesagt: Wir dürfen niemanden zurücklassen, wir müssen alle Kompetenzen und Potenziale heben, auch von Menschen, die Krisen hinter sich haben. – Danke. (Beifall bei Grünen und ÖVP.)
13.29
Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesminister Martin Polaschek. – Bitte sehr, Herr Minister.
Bundesminister für Bildung,
Wissenschaft und Forschung Dr. Martin Polaschek: Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Meine sehr
geehrten Damen und Herren!
Sie haben zu Recht die Bedeutung dieser Maßnahmen gewürdigt. Ich
danke Ihnen auch dafür, weil diese wirklich sehr wichtig sind, um
Menschen, die
aus verschiedenen Gründen Bildungsabschlüsse nicht erreicht haben,
entsprechend zu unterstützen.
Es sei gerade auch hier in der Länderkammer noch einmal ausdrücklich erwähnt, dass ja nicht nur vonseiten des Bundes, mit Unterstützung des Europäischen Sozialfonds, Mittel zur Verfügung gestellt werden, sondern auch vonseiten der Länder über 58 Millionen Euro in diesen gemeinsamen Topf fließen.
Gestatten Sie mir, dass ich zu zwei Punkten direkt etwas ergänze; zum einen, weil Frau Bundesrätin Hahn das Thema Digitalisierung angesprochen hat: Gerade aus diesem Grund, weil die Digitalisierung alle unsere Lebensbereiche immer mehr betrifft, haben wir ein eigenes Unterrichtsfach digitale Grundbildung eingeführt, um den jungen Menschen sowohl die Chancen der Digitalisierung als auch deren Gefahren und Risiken nahezubringen.
Darüber hinaus ist es in die Lehrpläne, auch in der Primarstufe, als unterrichtsübergreifendes Thema eingeflossen, weil auch die Jüngeren schon sensibilisiert werden müssen, denn die Digitalisierung wird wie gesagt unser Leben
immer mehr beeinflussen.
Das betrifft natürlich auch die Erwachsenen,
und ja, es ist in unser aller Verantwortung, darauf zu achten, dass es keine
Digitalisierungsverlierer gibt, dass wir auch Menschen, gerade ältere
Menschen, die aus welchen Gründen auch immer mit der
digitalen Welt nicht so zurechtkommen, entsprechend zu unterstützen.
Ein Punkt, den Sie auch angesprochen haben, was die
Lehrerinnen und Lehrer angeht: Ja, wir müssen natürlich darauf
achten, dass wir möglichst viele,
auch gut ausgebildete, Lehrerinnen und Lehrer in die Schulen bekommen. Wir sind
intensiv an verschiedenen Maßnahmen dran.
Ich werte es als ein besonders schönes Signal, dass wir
auf einem richtigen Weg sind, dass allein
heuer, in diesem Studienjahr, über 900 Personen zusätzlich
Lehramtsstudien begonnen haben, das heißt, es gibt im Bereich
Lehramtsstudien österreichweit eine Zunahme von Studienanfängerinnen
und -anfängern
von 17 Prozent. (Zwischenruf der Bundesrätin Hahn.)
Das ist wirklich eine sehr große Zahl, und das stimmt mich guten Mutes, dass es uns gelingen wird, das Ruder herumzureißen und künftig wieder mehr Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung zu haben.
Abschließend, weil es auch Frau Bundesrätin Göll angesprochen hat: Lesen ist ganz wichtig, deshalb haben wir dieses Schuljahr unter das Stichwort Lesekompetenz gestellt. Wir werden natürlich auch über dieses Jahr hinaus Initiativen setzen, aber gerade Lesen ist meines Erachtens die wichtigste Kompetenz, die die jungen Leute brauchen, und deshalb ist das einer der Schwerpunkte in diesem Jahr.
Ich danke Ihnen allen für die breite
Unterstützung für diesen Gesetzentwurf und darf mich an dieser Stelle
für die gute Zusammenarbeit bedanken, und da
ich keine Regierungsvorlage mehr hier im Bundesrat zu vertreten habe, darf ich
Ihnen jetzt schon ein schönes Fest wünschen. – Vielen
Dank. (Beifall bei
ÖVP und Grünen sowie bei Bundesrät:innen der SPÖ.)
13.33
Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Vielen Dank.
Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor. Wünscht noch jemand das Wort? (Bundesrat Steiner hebt die Hand.) – Herr Kollege Steiner, bitte.
Bundesrat
Christoph Steiner (FPÖ, Tirol):
Frau Präsident! Ich fange einmal mit einem Zitat an: „Es ist keine
Schande nichts zu wissen, wohl aber, nichts
lernen zu wollen.“ Das passt ganz gut in die heutige Zeit, das passt ganz
gut zur Bundesregierung. Sie hat aus den vergangenen Jahren auch nichts
gelernt,
nach dem zu urteilen, was sie mit uns Österreichern aufgeführt hat.
Es
passt aber auch ganz gut zu den zugewanderten, nicht integrierbaren Bereicherern
aus dem Jahr 2015, weitergehend bis heute, unveränderte illegale Zuwanderung,
was wir dann auch im Bildungssystem – Herr Minister, Sie werden es
genau wissen – mit allen Auswirkungen büßen.
Worum geht es jetzt bei dem Gesetz? – Es geht um eine Bund-Länder-Vereinbarung, genauer gesagt um 117,2 Millionen Euro, von 2024 bis 2028, um Erwachsene den Pflichtschulabschluss nachholen zu lassen.
Es gibt das Gesetz – so viel zur
Genese – seit 2011; damals, Herr Minister, das war vor Ihrer Zeit,
war das einstimmig. Damals waren auch wir dabei. Wir
haben aber schon 2011 davor gewarnt und gesagt, es braucht Begleitmaßnahmen
bei dieser Aktion. Die gibt es bis heute nicht.
Und zwar: Wie viele bringt das tatsächlich in
Beschäftigung und Arbeit? Wie erfolgreich ist diese Aktion in ihrer
Gesamtheit? – Man weiß es nicht, Herr Minister. Sie wissen es
bis heute nicht, und seit 2011 gibt es das wieder, jetzt verlängern wir es
einfach so mir nichts, dir nichts wieder weiter, wissen
aber nicht, was uns diese 117,2 Millionen Euro wirklich bringen. Somit
verpufft ganz, ganz viel Geld nicht nachhaltig. (Beifall bei der FPÖ.)
Es ist aber leider Gottes
sinnbildlich für diese Regierung. Was wäre denn wichtig?
Natürlich wollen es die Grünen und die Sozialisten nicht hören.
Die
ÖVP probiert jetzt wieder, ein bisschen umzuschwenken, schauen wir einmal,
wie das funktioniert. – Großes Augenmerk ist auf die
Sprachbildung zu
legen, das ist so. Warum ist das
so? – Na logisch, wenn 60, 70, manchmal 80 Prozent der
Schüler in der Klasse mit nicht deutscher Muttersprache
sitzen, dann ist es halt einmal schwierig. Bei uns war das früher kein
Problem. (Bundesrat Schreuder: Na ja, die FPÖ-Plakate, die sind
auch ... Rechtschreib...!) – Geh, halt einmal den
Schlopfn! (Ah-Rufe bei ÖVP und Grünen.)
In meiner Bildungszeit war das
ganz einfach, da gab es eine Klasse mit 27 Schülern. (Bundesrat
Schreuder: Aha, du tust nie dazwischenrufen, oder? Tust du
nie dazwischenrufen, Steiner, oder was? Was soll das?) In dieser Klasse gab
es genau zwei mit nicht deutscher Muttersprache. So, und was ist dann passiert? – Die
zwei sind mitgenommen worden, die zwei wurden von den 25 anderen
mitgenommen, bilateral, in den Pausen, überall, nicht nur in der
Klasse, sondern überall. Die Freundeskreise waren ganz andere.
Natürlich wurden diese Kinder, die damals mit nicht deutscher
Muttersprache zu uns gekommen sind, in die Freundeskreise von uns integriert,
und da ist halt einmal Zillertalerisch gesprochen worden. Bei denen, bei meinen
Schulkollegen
von damals, merkt heute niemand, dass die damals mit nicht deutscher Muttersprache
gekommen sind, und das ist der große Unterschied!
(Beifall bei der FPÖ.)
Aber wenn man alles offen hat, wenn man jeden aus jedem Hergottsland einlädt und sagt: Kommt zu uns, hier fließen Milch und Honig!, dann haben wir das Problem, und dann büßen das auch leider Gottes unsere einheimischen Kinder. (Beifall bei der FPÖ.)
Was macht der Bildungsminister, seit er in Amt und
Würden ist? – Er hat es jetzt gerade selber gesagt: Vor
Weihnachten ist immer ein Mordsgesetzesreigen,
der Herr Bildungsminister bringt eine Gesetzesvorlage, die stammt nicht einmal
von ihm selber – ich habe es vorhin gerade
erklärt –, sondern ist lediglich
eine Verlängerung von 2011.
Es kracht im ganzen
Bildungssystem, überall gehen Löcher auf, dann stopft man
notdürftig ein Loch, und nichts Gescheites kommt heraus. Herr Minister,
nicht nur die Regierung versagt, Sie persönlich versagen in diesem
Ministerium kläglichst, Herr Minister, kläglichst! (Beifall bei
der FPÖ. – Zwischenbemerkung von Bundesminister Polaschek.)
Das muss man Ihnen dann halt schon zum Vorwurf machen, denn, Herr Minister, wer Bildung verschläft, produziert Klimaterroristen am laufenden Band. (Zwischenrufe bei den Grünen.) Das ist das Problem. (Beifall bei der FPÖ.)
Da spricht die Pisa-Studie eine
ganz klare Sprache. Auf dem Regierungsprogramm, das ja nicht Sie
mitverhandelt haben, weil Sie ja dann nachgerutscht sind, steht „Aus
Verantwortung für Österreich“. Wenn man jetzt bilanziert, ein
Jahr vor der Neuwahl, kurz vor Weihnachten, kann man sagen: Wir gehen verantwortungslos
mit Österreich um.
Jetzt sind aber im
Bildungsbereich vielleicht nicht Sie allein schuld, Herr Minister, denn die
Sozialisten haben auch schon einiges dazu beigetragen, dass wir
jetzt da sind, wo wir sind. In der Zweiten Republik, nur zur Aufklärung,
gab es nämlich ganz am Anfang einen Kommunisten als Bildungsminister, der
war das aber nur acht Monate lang, und seither gab es zehn von der ÖVP und
neun von den Sozialisten. (Bundesrat Schreuder: Zum Glück
niemanden
von der FPÖ!)
Was macht Bildung? Herr Schreuder, jetzt hör genau zu!
(Bundesrat Schreuder: Nein, ich höre nicht zu! Du sagst mir nicht,
ob ich zuhören soll oder nicht! Du
sagst mir nicht, ob ich zuhören soll oder nicht bei so einem
Blödsinn!) Was macht Bildung? – Bildung macht stark.
Bildung, Herr Schreuder, macht glücklich. Bildung rettet Leben. Bildung
schafft Perspektiven. Bildung stärkt das Selbstbewusstsein. (Ruf
bei der ÖVP: Ja, ja, ja! – Bundesrat Schreuder: Das
merkt
man an den FPÖ-Plakaten, die überhaupt vor Deutschfehlern nur so
strotzen!) Bildung macht Spaß und Bildung hält gesund. (Bundesrat
Schreuder: Ihr
tätets mehr Bildung brauchen!) Und: Bildung erfüllt alles.
Bildung ist auch gut, wenn man 2024 eine neue Regierung wählt. (Beifall
bei der FPÖ.)
Und, Herr Schreuder, wenn du sagst, das ist ein Blödsinn, dann weiß ich, warum du bei den Grünen bist.
Zu Frau Göll noch, die vorhin geredet hat: Ich darf Ihnen gratulieren – die ÖVP findet wieder dahin zurück, wo sie vor 20 oder 30 Jahren ursprünglich einmal gewesen ist. Sie haben gesagt: Bildung beginnt in der Familie. (Bundesrätin Miesenberger: Da haben wir nie was anderes gesagt!) Ich würde es erweitern: Die Familie ist die Keimzelle unserer Gesellschaft – und auch unserer Kinder für ihr zukünftiges Leben. (Beifall bei der FPÖ.)
Wenn die ÖVP wieder zurückfindet – back
to the roots –: herzliche Gratulation! Es freut uns, wenn ihr uns
andauernd kopiert, weil die Leute verstanden
haben, was mit der Kopiermaschine los ist.
Frau Kollegin Hahn hat auch gesagt, dass es ja schon
über zehn Jahre oder so keine Hauptschule mehr gibt. Leider Gottes hat die
sozialistische Partei (Bundesrätin Hahn: Sozialdemokratische
Partei!) die Hauptschule eingestampft und daraus eine Mittelschule gemacht.
Was hat sich verbessert, Frau Kollegin
Hahn? (Rufe bei der FPÖ: Nix! Nichts!) – Nichts. Es ist
alles schlechter geworden mit Ihrer ideologischen Mittelschule! Alles ist
schlechter geworden.
(Beifall bei der FPÖ.)
Frau Kollegin Hahn, noch als Abschluss zu Ihnen: Danke
für Ihre Belehrungen! (Bundesrätin Hahn: Bitte! Immer
gern!) Sie sind ja Lehrerin und somit aktiv
für unsere Bildung in Österreich tätig. (Bundesrat Schreuder:
Im Gegensatz zu dir!) Das haben Sie die letzten Jahrzehnte ja wunderbar und
toll gemacht – Pisa
lässt grüßen. Vielen Dank, Frau Kollegin Hahn! (Beifall bei der
FPÖ. – Bundesrat Schreuder: Das ist eine
Unverschämtheit!)
13.42
Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist
nicht der Fall. Somit ist die
Debatte geschlossen.
Wir gelangen zur Abstimmung. – Die Plätze sind eingenommen.
Ich ersuche jene
Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den
vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch
zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit.
Der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des
Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem
ein Finanzausgleichsgesetz 2024 erlassen wird sowie das
Finanzausgleichsgesetz 2017, das Umweltförderungsgesetz, das
Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz, das Transparenzdatenbankgesetz 2012
und das Bildungsinvestitionsgesetz geändert werden (2305 d.B.
und 2375 d.B. sowie 11360/BR d.B. und 11405/BR d.B.)
3. Punkt
Beschluss des
Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit
das Transparenzdatenbankgesetz 2012 geändert wird (2306 d.B.
und 2376 d.B. sowie 11406/BR d.B.)
4. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend eine Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG über die Etablierung einer gebietskörperschaftenübergreifenden Transparenzdatenbank (2314 d.B. und 2377 d.B. sowie 11407/BR d.B.)
Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Wir gelangen nun zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 4, über welche die Debatten unter einem durchgeführt werden.
Berichterstatterin zu den Punkten 2 bis 4 ist Frau Bernadette Geieregger. – Ich bitte um den
Bericht.
Berichterstatterin
Bernadette Geieregger, BA: Ich darf
Ihnen den Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des
Nationalrates vom 14. Dezember betreffend ein Bundesgesetz, mit
dem ein Finanzausgleichsgesetz 2024 erlassen wird sowie das Finanzausgleichsgesetz 2017,
das Umweltförderungsgesetz, das Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz,
das Transparenzdatenbankgesetz 2012 und das
Bildungsinvestitionsgesetz geändert werden,
zur Kenntnis bringen.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher gleich zur Antragstellung:
Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage mehrstimmig den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Ich komme zu Tagesordnungspunkt 3 und darf Ihnen auch den Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Transparenzdatenbankgesetz 2012 geändert wird, zur Kenntnis bringen.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher gleich zur Antragstellung:
Der Finanzausschuss stellt nach
Beratung der Vorlage einstimmig den Antrag, gegen den
vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch
zu erheben und dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß
Art. 44 Abs. 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu
geben.
Zu Tagesordnungspunkt 4 darf ich Ihnen ebenso den
Bericht des Finanzausschusses über
den Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend eine
Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG über die Etablierung
einer gebietskörperschaftenübergreifenden Transparenzdatenbank zur
Kenntnis bringen.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, daher komme ich gleich zur Antragstellung:
Der Finanzausschuss stellt nach
Beratung der Vorlage einstimmig den Antrag, gegen den
vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch
zu erheben.
Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Herzlichen Dank.
Bevor wir in die Debatte
eingehen, möchte ich gerne Herrn Bundesminister für Finanzen Magnus
Brunner begrüßen: Herzlich willkommen! (Beifall bei
ÖVP, SPÖ und Grünen sowie des Bundesrates Arlamovsky.)
Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Markus Steinmaurer. – Bitte sehr, Herr Bundesrat.
Bundesrat Markus Steinmaurer (FPÖ,
Oberösterreich): Frau
Präsidentin! Herr Minister! Liebe Kollegen im Bundesrat! Sehr geehrte
Zuseher zu Hause
und im Bundesratssaal! Bei TOP 2 geht es um die Dotierung eines Zukunftsfonds
und um die Finanzzuweisung vom Bund an die Länder und Gemeinden.
Grundsätzlich gehen uns diese Änderungen nicht weit genug. Die Gemeinden und die Länder werden ausgehungert, dadurch wird bei den Ländern eine gewisse Schockstarre verursacht. Wir fordern daher, dass der Finanzausgleich sofort aufgeschnürt wird, damit die Länder und Gemeinden mehr Geld bekommen. (Beifall bei der FPÖ.)
Die Einigung in den Finanzausgleichsverhandlungen kann nur als Grundsatzeinigung gesehen werden. Artikel 5 wird für inhaltlich richtig und notwendig erachtet, der Rest wird von uns abgelehnt.
Zu TOP 3: Der Aufnahme des neuen § 1 Abs. 3 des Transparenzdatenbankgesetzes 2012 in den Verfassungsrang wird zugestimmt.
Zu TOP 4, Vereinbarung
über die Etablierung einer gebietskörperschaftenübergreifenden
Transparenzdatenbank: In dieser Vereinbarung sind Bund,
Länder und Gemeinden übereingekommen und haben sich etwa in Bezug auf
die Überprüfung des Bestehens gleichgelagerter Förderungen, die
Durchführung personenbezogener
Abfragen, etwaige Doppelförderungen oder die Abstimmung von gebietskörperschaftenübergreifenden
Weiterentwicklungen im Koordinierungsausschuss geeinigt. Da die aktuellen
Krisen mehr denn je erfordern, dass Förderungen treffsicher und
zielgerichtet ausbezahlt werden,
sind Bund und Länder im Rahmen der Finanzausgleichsverhandlungen diesbezüglich
übereingekommen.
Diese Zielsetzung von Bund und Ländern wird mittels
der TDB flächendeckend ermöglicht. In diesem Sinne enthält die
Vereinbarung gemäß
Artikel 15a B-VG gemeinsame Prämissen für eine gebietskörperschaftenübergreifende
Verwirklichung. Ob es auf Dauer ausreicht, dass die Länder nur
jene Leistungen verpflichtend einmelden müssen, welche aufgrund derzeit
geltender Vereinbarungen bereits als Leistungsangebot in der TDB zu erfassen sind, muss
weiter verfolgt werden. Vonseiten der FPÖ-Bundesratsfraktion wird
TOP 4 zugestimmt. – Danke. (Beifall bei der FPÖ.)
13.48
Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Herzlichen Dank.
Als Nächster zu Wort gemeldet ist Mag. Christian Buchmann. – Herr Bundesrat, bitte sehr.
Bundesrat Mag. Christian Buchmann
(ÖVP, Steiermark): Sehr geehrte
Frau Präsidentin! Geschätzter
Herr Finanzminister! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ja, es geht um den Finanzausgleich. Der
Finanzausgleich regelt bekanntermaßen die Verteilung der Bundesfinanzmittel.
Die gemeinschaftlichen Bundesabgaben werden auf die Gebietskörperschaften
verteilt: auf den Bund, auf die neun Bundesländer und auf
die mehr als 2 000 Gemeinden und Städte im Lande. Diese
Maßnahme ist notwendig, um die Möglichkeit zu eröffnen,
die geplanten Ziele zu erreichen
und die geplanten Maßnahmen im Interesse der Bürgerinnen und
Bürger abzuarbeiten.
Der Ruf nach mehr Mitteln ist
immer verständlich, Herr Kollege Steinmaurer – die Frage ist
nur, woher die Mehrmittel kommen (Bundesrat Spanring:
Koste es, was es wolle!): Entweder gibt es ein entsprechendes
Wirtschaftswachstum, das mehr Mittel in die öffentlichen Kassen
spült – das ist in Zeiten
wie diesen besonders herausfordernd –, oder die Gemeindebürger
werden durch neue Steuern belastet. Letzteres ist nicht unbedingt ein Thema,
das meine Gesinnungsgemeinschaft besonders favorisiert. Daher: Der Ruf nach
mehr Geld ist relativ rasch ausgesprochen. Wie man tatsächlich mehr Mittel
lukrieren
kann, ist aber immer auch eine Frage dessen, wie man es mit der
Bevölkerung abspricht.
Ich spüre in den Gesprächen, die ich mit Unternehmerinnen, mit Unternehmern, mit Bürger:innen im Lande und auch in meiner Heimatgemeinde, der steirischen Landeshauptstadt, habe, wenig Sympathie dafür, neue Steuern einzuführen oder gar neue Steuern zu erfinden. (Beifall bei ÖVP und Grünen. – Bundesrätin Schumann: Lasst die Reichen reich sein! Schützt die Reichen!)
Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Finanzausgleich für die neue Periode geht von 2024 bis einschließlich 2027. Mit diesem Paktum werden 146 Milliarden Euro mobilisiert – eine gigantische Summe, die in diesen vier Jahren unter den Gebietskörperschaften verteilt wird. Es werden 12,5 Milliarden Euro an zusätzlichen Mitteln für die Länder und die Gemeinden möglich gemacht. Das ist insbesondere, wenn man sich die Ziele ansieht, die damit verbunden sind, ein großer Brocken an öffentlichem Steuergeld, der da eingesetzt ist.
Ich bin sehr froh, dass es nach
sehr harten, auch sehr schwierigen Verhandlungen gelungen ist –
ich gratuliere dem Finanzminister dazu, aber
auch den Landesfinanzreferenten, den Gemeinden und dem
Städtebund –, dass man sich gemeinsam zu einer Lösung
durchgerungen hat, auch einen Zukunftsfonds möglich zu machen, der
abbildet, dass es einen Ausbau bei den Kinderbetreuungsplätzen, beim
Thema der Elementarpädagogik geben wird –
für 2024 beispielsweise 500 Millionen Euro –, dass es
gelungen ist,
dem Flächenverbrauch und der Flächenversiegelung entsprechende
Maßnahmen entgegenzustellen, im Kapitel des Wohnens und des Sanierens
immerhin
auch 300 Millionen Euro oder, wenn es um
den Heizkesseltausch im Bereich Umwelt und Klima geht, ebenfalls
300 Millionen Euro im Jahr 2024 möglich zu machen.
Dazu kommt, dass es zusätzliche Mittel für strukturschwache Gemeinden gibt. Die werden, wenn ich es richtig gesehen habe, sogar verdoppelt. Auch die medizinische Versorgung im niedergelassenen Bereich – Stichwort Gesundheit – wird entsprechend ausgebaut.
Wenn wir über
strukturschwache Gemeinden reden, ist natürlich auch wichtig, zu
erwähnen, dass der Personennahverkehr entsprechend dotiert wird.
Sie alle haben möglicherweise mitbekommen, dass es gerade im Bereich der
Schülertransporte gewisse Schwierigkeiten in den Bundesländern und
in den Gemeinden gab, und auch dafür stehen zusätzliche Mittel zu
Verfügung. Ich glaube, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. (Beifall
bei der ÖVP.)
Mit dem Finanzausgleichspaktum ist auch verhandelt
worden – ich begrüße das
außerordentlich –, dass es zu einem Transparenzdatenbankgesetz
kommt.
Wie manche von Ihnen wissen, war ich eine Zeit lang Mitglied der
steiermärkischen Landesregierung. Ich habe vor rund zehn
Jahren – damals freiwillig, das war noch keine
Artikel-15a-Vereinbarung oder gesetzliche Vorgabe – für die
Ressorts, die mir zugeordnet waren, nämlich das Wirtschaftsressort und
auch das Kulturressort, eine solche Datenbank eingerichtet, die es den
Bürgerinnen und Bürgern des Landes möglich gemacht hat,
nahezu tagesaktuell zu
sehen, wohin öffentliche Gelder fließen.
Das wird seit damals beispielsweise von der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft, der SFG, unter dem Titel Einblick geöffnet – also transparente und offene Kassen – oder auch durch den Kulturförderungsbericht des Landes Steiermark. Landeshauptmann Christopher Drexler ist aktuell der Kulturreferent des Landes Steiermark und stellt die diesbezüglichen Daten auch tagesaktuell der Öffentlichkeit zur Verfügung. Damit ist einerseits Transparenz verknüpft und andererseits der Nachweis erbracht, dass diese Mittel sinnvoll investiert werden. Ich muss Ihnen sagen, an dem Tag, an dem das geschehen ist, haben auch die Debatten über so manche Förderungen aufgehört, weil die Menschen gesehen haben, für welche Projekte, für welche juristischen Personen, für welche natürlichen Personen diese Mittel zur Verfügung gestellt werden.
So gesehen: Danke für
diesen Schritt in die richtige Richtung! Ich glaube, das dient der Transparenz.
Es zeigt auch, dass wir uns sehr bewusst sind,
dass es möglicherweise in manchen Bereichen auch Doppelförderungen
gibt, die nicht im Sinne des Erfinders liegen und die damit in Zukunft
hoffentlich
auch eingedämmt werden können.
Für mich ist der Finanzausgleich eine Form des
gelebten Föderalismus. Es ist das stete Ringen um die Mittel und um die
zweckmäßige Verwendung dieser
Mittel, die zwischen den Gebietskörperschaften aufgeteilt werden. Damit
ist natürlich auch immer eine Diskussion über die
Kompetenzverteilung zwischen
den Gebietskörperschaften verbunden. Es ist aber jedenfalls im Interesse der Bürgerinnen
und Bürger, es ist im Interesse eines gelebten Föderalismus und
es ist im Interesse einer Zukunftsgestaltung, bei der es darum
geht, für die Elementarpädagogik, für Wohnen und Sanieren,
für Umwelt und Klima, für Nahverkehr und Schülertransporte auch
für jene Gemeinden,
die es manchmal sehr, sehr schwer haben, weil sie nicht in einem
Speckgürtel, sondern in peripheren Lagen liegen, trotzdem jene Mittel zu
erhalten,
die sie brauchen, um den Menschen, die in diesen Gemeinden leben, die in diesen
Regionen zu Hause sind, ein Stück Heimat zu öffnen. (Beifall bei
der ÖVP.)
13.56
Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Dr. Karl-Arthur Arlamovsky. – Bitte sehr, Herr Bundesrat.
Bundesrat MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky
(NEOS, Wien): Frau Präsidentin!
Sehr geehrter Herr Bundesminister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Das
neue Finanzausgleichsgesetz ist eine verpasste Chance. Der Finanzausgleich gehört
nämlich grundlegend reformiert. Stattdessen pumpt die Regierung
mehr Geld in ineffiziente Strukturen. Der neue Zukunftsfonds hat nur eine unverbindliche
Zielorientierung. Wir NEOS fordern – das ist in der Zwischenzeit hoffentlich
bekannt – eine radikale Entflechtung und Transparenz der Mittelflüsse
zwischen den Gebietskörperschaften, mehr Aufgabenorientierung und eine
echte Abgabenautonomie der Länder und Gemeinden. Die Ausgabenverantwortung
muss auch mit einer Einnahmenverantwortung
einhergehen.
Zum Zukunftsfonds: Dieser hat
einige positive Aspekte. Mit ihm kümmert man sich um Zukunftsbereiche wie Elementarbildung, Klima oder Energiewende.
Es gibt Ziele, die darin festgehalten werden, und es ist auch die Rede
von einer Evaluierung und einer Transparenz betreffend Mittelverwendung. Die
Zielsetzungen sind allerdings aus unserer Sicht zu wenig ambitioniert,
etwa auf den Gebieten des Ausbaus der erneuerbaren Energie oder der
Kinderbetreuung, und wichtige Ziele wie zum Beispiel die
Bodenversiegelung
fehlen überhaupt.
Ein Verfehlen der Ziele bleibt außerdem sanktionslos.
Die Gelder fließen, auch wenn die Ziele nicht erreicht werden
beziehungsweise gar nicht erreicht
werden können, wie das zum Beispiel bereits jetzt im Bereich der
Kinderbetreuung absehbar ist, weil es zu wenig Personal gibt.
In diesem Zusammenhang auch noch zur Transparenzdatenbank: Gegen diejenigen Änderungen der Transparenzdatenbank, die beschlossen werden sollen, ist nichts einzuwenden; einige Empfehlungen des Rechnungshofes wurden aufgegriffen. Es handelt sich aber wieder um ein Klein-Klein statt einer echten Reform. Wir NEOS fordern eine Ausweitung des Kreises der Einsichtsberechtigten, zum Beispiel auf den Nationalrat und den Bundesrat, und eine öffentliche Einsichtnahme zu den Zahlungen, die an juristische Personen wie Vereine und Unternehmen fließen und die über 2 000 Euro betragen.
Ebenfalls wurde die Empfehlung des Rechnungshofes für die Transparenzdatenbank nicht umgesetzt, dass auch die Gemeinden eine Einmeldepflicht haben sollen, speziell was sowohl das Leistungsangebot als auch deren Zahlungen betrifft. Deswegen können wir der Änderung der Transparenzdatenbank nicht zustimmen. – Danke sehr.
13.58
Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Mag. Sascha Obrecht. – Bitte sehr, Herr Bundesrat.
Bundesrat Mag. Sascha Obrecht (SPÖ,
Wien): Frau Präsidentin! Werter
Herr Minister! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Für mich ist das ein
bisschen eine ungewöhnliche Situation, so als Proredner eingeteilt zu
sein, wenn der Finanzminister da ist. (Heiterkeit bei Bundesrät:innen
von SPÖ, ÖVP
und Grünen. – Bundesminister Brunner: Stimmt
eigentlich! – Bundesrätin Eder-Gitschthaler: Ja, ist
für uns auch ungewöhnlich! – Bundesrat Buchmann:
Man kann ja auch gescheiter werden!) Ich habe tatsächlich
überlegt, was ich sagen kann.
(Beifall bei SPÖ und ÖVP sowie des Bundesrates Arlamovsky.)
Insofern fangen wir mit etwas Positivem an, damit es
praktisch auch eine Prorede ist: Der Finanzausgleich selbst stellt
für den Finanzminister sicher
eine der schwierigsten Verhandlungssituationen dar, die er überhaupt zu
bewältigen hat. Das ist zu einem Ergebnis gebracht worden, und das
ist für sich
schon eine Leistung, die man anerkennen kann
(Zwischenruf des Bundesrates Spanring),
und das tue ich hiermit auch ausdrücklich. (Beifall bei der ÖVP
sowie
des Bundesrates Schreuder.)
Es gab da ja auch einen breiten Konsens unter den Landeshauptleuten. Auch mein Landeshauptmann in Wien hat dann schlussendlich dem Finanzausgleich zugestimmt, also kann ich prinzipiell gar nicht dagegen argumentieren. (Bundesrätin Eder-Gitschthaler: Ja genau! Ja, das ist gescheit! – Zwischenbemerkung von Bundesminister Brunner.) Das liegt irgendwie nicht in der Natur der Sache – das verstehe ich schon, das ist klar.
Insofern werde ich es – jetzt kommt das Aber, das
haben Sie eh schon vermutet (Zwischenbemerkung von Bundesminister Brunner) –
aber vielleicht bei einer grundsätzlichen Kritik belassen. Ich
glaube, dass Sie in vielen Fällen leider die falschen Schwerpunkte setzen –
das liegt auch in der Natur der Sache, Sie vertreten
politisch andere Menschen, als ich das tue. Ich glaube, dass wir den Menschen
in Österreich ein grundlegendes Versprechen geben müssen, zumindest in meinem
politischen Verständnis, nämlich dass es, wenn sie sich in diesem
Land anstrengen, wenn sie etwas weiterbringen wollen, ihnen selbst und
ihren Kindern besser geht. Das ist, glaube
ich, ein Versprechen, das wir den Menschen schulden. Ich glaube,
dass dieses Versprechen von dieser Regierung
nicht wahrgenommen wird. (Beifall bei der SPÖ.)
Es gibt vielmehr ein anderes grundlegendes Versprechen,
nämlich jenes, dass es, wenn sie sich anstrengen, wenn sie ganz viel
arbeiten, dann am Ende kaum reichen wird, um über die Runden zu kommen. (Bundesrat
Buchmann: Das ist eine Unterstellung!) Es gibt das Versprechen: Wenn
Sie viel haben, dann werden
Sie viel behalten, weil wir es nicht angreifen werden! – Im
Gegensatz zum Kollegen bin ich nämlich der Auffassung, dass eine
Millionärsabgabe sehr
wohl nottut, um eine Schieflage in diesem Land zu beenden. (Beifall bei der
SPÖ.)
Den letzten Punkt will ich gar nicht zu ausführlich
beschreiben, weil wir
auch das in der Vergangenheit erlebt haben: Das dritte Versprechen ist, dass es
einem, wenn man sich mit der ÖVP gut stellt, von der Republik auch gerichtet wird.
Auch das ist ein Versprechen, das man vielleicht kritisieren muss und das in
Zukunft bei einer neuen Regierung anders sein sollte. – Das
sind so die drei Dinge, die ich mitgeben will.
Zur Transparenzdatenbank: Dem kann ich mich
anschließen, das halte ich prinzipiell für eine gute Sache.
Wenn wir zukünftig wollen, dass Gemeindeverbände auch
einmelden können, halte ich die Legistik für
unzureichend – das habe ich Ihren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern auch gesagt. Gebietskörperschaftsübergreifend
führt dazu – als Begriff schon per se ‑, dass
Gemeindeverbände nicht einmelden können, weil sie keine
Gebietskörperschaften
sind. Insofern wird da zukünftig, denke ich, tatsächlich juristisch
nachgebessert werden müssen. Ziel sollte sein, dass auch
Gemeindeverbände zukünftig
melden sollen. Ich glaube, da gibt es noch ein bisschen Bedarf und Stellen, an
denen man etwas nachholen sollte.
Insofern vielleicht abschließend noch: Ich darf heute
noch eine etwas kritischere Rede zu einem anderen Thema halten, die nicht den
Finanzminister trifft,
aber ich will vielleicht noch ein paar Zahlen mitgeben, die mich zum Denken anregen:
Die „Financial Times“, kein Blatt des Marxismus, hat die
fortgeschrittenen Volkswirtschaften der Welt und deren Performance in
diesem Jahr verglichen. Österreich ist auf Platz 33 von 35 gelandet,
wir sind Vorvorletzter.
Es mag schon sein, dass es eine punktuelle Betrachtung für ein Jahr ist,
aber es sollte uns zu denken geben.
Wifo-Chef Felbermayr sagt, das hat zwei Gründe: die
hohe Inflation und das geringe Wachstum. Für die hohe Inflation gibt
es unterschiedliche Erklärmuster. Der Finanzminister sagt, die
hohe Inflation liegt an den hohen Lohnabschlüssen, und er vergleicht
uns mit Belgien. Er sagt, Belgien hat ähnlich
hohe Lohnabschlüsse. – Der
Unterschied ist, dass Belgien eine Inflation von 0,7 Prozent hat
und wir eine von 5,3 Prozent haben. Die Lohnabschlüsse
können es also auch monokausal sicher nicht sein. Das halte ich
tatsächlich für eine unredliche Argumentation. (Beifall bei der
SPÖ.)
Da muss mehr gemacht werden, denn die Inflation frisst sich
bei uns
allen ein, auch im Alltag. Das wird die vordringlichste Aufgabe für
nächstes Jahr. Daran werden Sie (in Richtung Bundesminister Brunner),
daran wird die ÖVP, daran werden auch die Grünen gemessen werden. Ich
glaube, dass es sich nicht mehr ausgeht, dass man das Ruder
herumreißt – also für Sie zumindest, wir
sind ja nicht Teil der Regierung. Ich hoffe, dass eine Sozialdemokratie
in der nächsten Regierung vertreten sein wird, um die Scherbenhaufen, die
Folgen der Inflation, der viel zu hohen Inflation, aufräumen zu
können. – Vielen Dank. (Beifall bei der SPÖ.)
14.03
Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Marco Schreuder. – Bitte sehr, Herr Bundesrat.
Bundesrat Marco Schreuder (Grüne,
Wien): Frau Präsidentin! Sehr
geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Valorisierung der Sozialhilfe als
„Scherbenhaufen“ zu bezeichnen, das weise ich schon
zurück, Herr Kollege. (Bundesrätin Schumann:
Na geh! Eine Inflation, dass die Tür nicht zugeht!) Das
möchte ich schon deutlich sagen, denn das hat davor niemand gemacht,
sondern das hat diese Regierung gemacht. Ich verstehe schon, man hat
natürlich in vielen Bereichen unterschiedliche Schwerpunkte, das ist ja
auch in Ordnung, aber eines möchte ich
schon sagen: Die Schwerpunkte – und das ist von meinem Kollegen Buchmann
ganz klar hervorgehoben worden –, die wir in den Bereichen Klimaschutz,
Umweltschutz, Elementarpädagogik bereits vorbereiten, sind
schon auch soziale Maßnahmen, die wir zur Verfügung stellen, damit
Gemeinden und Länder das ausgeben können.
Jetzt habe ich – um
das noch zu sagen – vergessen zu sagen: Sehr geehrter Herr
Bundesminister! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir diskutieren hier über den Finanzausgleich,
und – wie es schon vorhin gesagt worden ist – dieser
stellt auch für uns im Bundesrat als Länderkammer natürlich
immer
einen der zentralen Punkte dar. Daran sieht man schon, wie wichtig es ist, dass wir in einer Demokratie eine Dialogfähigkeit aufrechterhalten.
Ich finde es sehr bedauerlich,
dass wir es im Bundesrat aufgrund dieser brutalen Attacken, wie ich sie gerade
hier erleben musste, nicht mehr schaffen, in
einen Dialog und in einen Austausch der unterschiedlichen Ideen zu kommen, weil
hier immer unter der Gürtellinie persönlich angegriffen wird. Der
Finanzausgleich zeigt eigentlich, wie wichtig Dialogfähigkeit in einer
Demokratie ist, wenn Länder, Gemeinden und der Bund gemeinsam zu
Lösungen für Österreich kommen müssen.
Deswegen möchte ich schon
sagen, dass die auf mich bezogenen Attacken von Herrn Kollegen Steiner von
vorhin eine brutalo-oppositionelle Vorgehensweise, ein Polithooliganismus sind, die ich zurückweisen muss.
Gerade diese Schizophrenie ist sichtbar: In vielen Ländern regiert
die FPÖ, und die
sind total schizophren. (Zwischenruf der Bundesrätin Doppler.)
Während Sie auf Länderebene sehr wohl Projekte mittragen und
mitverhandeln und auch Lösungen mitdiskutieren müssen, erleben wir
hier eine Brutalität, die ich wirklich nicht mehr ertrage – ich
sage es ganz ehrlich. (Beifall bei den Grünen und bei
Bundesrät:innen der ÖVP. – Die Bundesrätinnen Doppler
und Schartel: Dann musst du dein Mandat zurücklegen! –
Bundesrat Spanring: Rücktritt!)
So, jetzt konzentriere ich mich
aber auf den Finanzausgleich, weil der Zukunftsfonds tatsächlich ein
ganz zentraler Bestandteil dieses Finanzausgleichs
ist. (Bundesrat Spanring: Aber von Schizophrenie reden, von einer
Geisteskrankheit!) Dieser zentrale und wichtige Schritt in der
Zusammenarbeit (Bundesrat
Spanring: So ein Heuchler!) aller Gebietskörperschaften stellt
zusätzliche - - Wie haben Sie mich gerade genannt? (Bundesrat Spanring: Heuchler!) –
Frau Präsidentin! (Bundesrätin Doppler:
„Schizophren“! Das war repliziert auf „schizophren“!)
Präsidentin
Mag.a Claudia Arpa: Herr Kollege! Darf
ich bitte daran erinnern, dass wir im Hohen Haus einen wertschätzenden
Umgang pflegen? Vielleicht nehmen Sie das Wort
„Schizophrenie“ zurück, Herr Kollege, sonst muss ich Ihnen
einen Ordnungsruf erteilen. Nehmen Sie das zurück? (Bundesrat
Schreuder: Nein!) – Nicht. Dann erteile ich Ihnen jetzt
einen Ordnungsruf. – Bitte sehr. (Bundesrat Spanring –
erheitert –: Das ist jetzt in die Hose gegangen,
Herr Kollege Schreuder!)
*****
Bundesrat Marco Schreuder (fortsetzend): Wenn im Bundesrat Polithooliganismus betrieben wird und auf Länderebene Lösungen gesucht werden, ist es für mich politische Schizophrenie; dabei bleibe ich.
Wir haben drei zentrale Themen, die wir in diesem
Zukunftsfonds in den Vordergrund rücken. (Bundesrätin Hauschildt-Buschberger:
Es gibt ja auch kein
anderes Wort dafür!) Das ist zum Ersten die Elementarpädagogik,
zum Zweiten - -
Übrigens (in Richtung Präsidentin Arpa): Für „Heuchler“ gibt es keinen Ordnungsruf?
Präsidentin
Mag.a Claudia Arpa: Ich bitte Sie,
einfach in der Debatte weiterzugehen. (Bundesrat Schreuder:
Ich frage: Gibt es für „Heuchler“ keinen
Ordnungsruf?)
Herr Kollege! Wir hätten uns darauf geeinigt, dass wir
einen wertschätzenden Umgang pflegen, dass wir im Dialog bleiben. (Bundesrätin
Hauschildt-Buschberger: Für Schizophrenie gibt es kein anderes
Wort, wenn man diesen Zustand beschreiben will!) Ich möchte bitten,
dass wir uns in Zukunft daran erinnern,
dass es möglich ist, dass wir im Dialog bleiben. – Bitte sehr. (Bundesrat
Gross: Ja, aber dann betrifft es nicht den Marco Schreuder!)
Bundesrat Marco Schreuder (fortsetzend): Entschuldigung, in diesem Haus ist für das Wort Heuchler immer ein Ordnungsruf erteilt worden. Ich nehme zur
Kenntnis, dass Frau Präsidentin
Arpa für das Wort Heuchler keinen Ordnungsruf erteilt. Ich finde das sehr
erstaunlich, muss ich sagen. Ich finde das auch
sehr enttäuschend zum Abschluss Ihrer
Präsidentschaft, das möchte ich hier auch ganz deutlich sagen.
Wir haben drei große
Themen, die wir in diesem Zukunftsfonds behandeln: Das sind die
Elementarpädagogik zum einen, das Sanieren und Wohnen zum
Zweiten und Umwelt und Klima zum Dritten. Das ist wirklich ein großer
Schritt. Das sind zukunftsweisende Bereiche, in denen es besondere Anstrengungen auf allen
Ebenen geben wird. Die gewählten Ziele stellen gegenüber der bisherigen
Ausbaugeschwindigkeit schon eine große Verbesserung dar.
Wichtig ist, dass sich alle
Länder, übrigens auch die Länder mit einer FPÖ-Regierungsbeteiligung,
gemeinsam mit dem Bund zu diesen Zielen bekannt haben. Mit diesem
Zukunftsfonds gibt es jetzt – das möchte ich schon betonen,
weil von zu wenig Geld gesprochen wird – Geld für einen
Reformschub,
Geld, das es vorher nicht gab. Das muss man schon ganz deutlich sagen: Das ist
Geld, das es vorher nicht gab. (Bundesrätin Schumann: Aber keine
4,5 Milliarden, leider! Das ist ...!) Da können
wir wirklich stolz darauf sein, und da stellen wir wirklich viel für die
Gemeinden zur Verfügung.
Ich weiß, es gab auch
Kritik wegen der Sanktionierung der Zielerreichung. Da haben wir auch
etwas geschaffen – das finde ich ganz wichtig –: Im
Gesetzentwurf ist sehr klar geregelt, dass die Zielerreichung
evaluiert wird. Die Länder erhalten das Geld, und 2026 und 2028 wird dann
öffentlich gemacht werden, ob die Mittel zielbringend
eingesetzt wurden; sie müssen sich
also sehr wohl erklären.
Es ist auch Aufgabe unserer Fraktionen, dann
in den Ländern und Gemeinden diese Zielsetzungen zu kontrollieren. (Bundesrätin
Schumann: I wish you
good luck!)
Ein Vorwort sozusagen schon zu den kommenden Tagen: Eines der großen zentralen Projekte in dem Finanzausgleich ist natürlich die Gesundheitsreform. Dazu werden wir in den nächsten Tagen, vor allem meine Kollegin Claudia Hauschildt-Buschberger von unserer Fraktion, sehr ausführlich Stellung nehmen.
Das ist wirklich ein Riesenbrocken, der uns mit diesem
Finanzausgleich
gelungen ist. (Bundesrätin Schumann: Was heißt, das ist
gelungen?!)
In diesem Finanzausgleich ist uns noch etwas gelungen, was
eine langjährige Forderung des Rechnungshofes war: Die Länder sind
jetzt verpflichtet, Förderungen in diese Transparenzdatenbank einzumelden.
Das ist wirklich ein positiver Schritt für die Transparenzdatenbank und
gibt eine sehr wichtige Übersicht über die Förderlandschaft in
Österreich. Es ist schon gesagt worden: Je transparenter man solche
Förderungen macht, desto stärker ist das Vertrauen da,
desto stärker ist das Wissen da und desto seltener passiert natürlich
auch etwas, das nicht passieren soll, weil es öffentlich gemacht wird. Das
finden wir sehr gut: mehr Transparenz, mehr Wissen über die
Förderlandschaften in Österreich.
Zu den Schwerpunkten Elementarpädagogik, Wohnen und
Sanieren und Klimaschutz: Das sind wirklich Meilensteine. Ich möchte als
Bundesrat und als Vertreter eines Landes, nämlich Wien, deutlich sagen,
dass ich sehr froh
bin, dass wir das gemeinsam – alle Länder gemeinsam mit dem
Bund – geschafft haben. – Vielen Dank. (Beifall bei
den Grünen und bei Bundesrät:innen
der ÖVP.)
14.10
Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Markus Stotter. – Bitte sehr, Herr Bundesrat.
Bundesrat Markus Stotter, BA (ÖVP, Tirol): Geschätzte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Finanzminister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Geschätzte Zuseherinnen und Zuseher! Nach einem Jahr an zähen Verhandlungen, nach
circa 80 Sitzungen,
haben wir den Finanzausgleich so weit, dass wir ihn heute final
beschließen können. Bund, Länder, Städte und Gemeinden
haben
sich auf ein Paket verständigen können.
Ich versuche, abschließend zu den Verhandlungen ein
paar Eckdaten herauszustreichen. Worum
geht es im Wesentlichen? – Die Kernthemen sind sicher
Gesundheit und Pflege, und was man auch erwähnen muss: Erstmals findet
eine Valorisierung statt. Der Zukunftsfonds steht zum größten Teil
für Wohnen, Sanieren, Umwelt, Klima und Kinderbetreuung zur
Verfügung. Wenn man sich das durchrechnet, erkennt man: Es steht achtmal
so viel wie 2016
an frischem Geld zur Verfügung, das ist eine Steigerung von
300 Millionen Euro
auf 2,4 Milliarden Euro jährlich.
In Summe muss man aber festhalten, dass wir Gemeinden
zunehmend vor wachsenden Herausforderungen stehen. Jetzt spreche ich
natürlich als Bürgermeister. In meiner Gemeinde
erhöhen sich im nächsten Jahr allein die Ausgaben im Bereich Soziales
und Gesundheit um 12 Prozent, die Löhne steigen mit Vorrückungen
um circa 10 Prozent. In einer kleinen Gemeinde wie bei mir, 4 Millionen
Euro Budget, macht nur dieser Bereich auch 100 000 Euro aus. Die
Zinsbelastung hat sich im Vergleich zu den Vorjahren verändert, aber auch
die Energiekosten haben sich vervielfacht. Im Gegensatz dazu sind die Ertragsanteile,
wie wir wissen, nicht gestiegen. Wir müssen also weiterhin
genau hinschauen.
Ich glaube, der Finanzausgleich ist ein Schritt in die richtige Richtung – das hat Kollege Buchmann vorhin auch schon betont –, aber der Konjunkturmotor Gemeinden – ich habe immer ein Auge darauf – muss einfach laufen.
Meine Bürgermeisterkolleginnen und -kollegen im Saal
werden mir sicher beipflichten, wenn ich sage, es könnte immer ein
bisschen mehr sein oder
werden. (Bundesrätin Göll: Ja!) Wir haben aber schon
gehört, warum nicht mehr möglich ist. Zu Tode gejammert ist aber auch
gestorben: Ich glaube einfach,
dass es wichtig ist, den Finanzausgleich jetzt einmal wirken zu lassen.
Auch 2008 sind wir Gemeinden vor einer ungewissen Zeit
gestanden und haben diese gleich wie in der Coronapandemie mit Bravour
gemeistert. Dabei sind
uns der Bund und vor allem die Bundesregierung sehr zur Seite gestanden; deshalb
sind wir ja auch die Bürgermeisterpartei. (Beifall bei der
ÖVP. – Zwischenrufe der Bundesrät:innen Hahn
und Steiner.)
Jetzt komme ich wieder zum optimistischen Teil: Genau an den Optimismus glaube ich auch weiterhin und deswegen: Danke, Herr Finanzminister, für den Finanzausgleich! (Beifall bei der ÖVP und bei Bundesrät:innen der Grünen.)
14.14
Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Dominik Reisinger. – Bitte sehr, Herr Bundesrat.
Bundesrat
Dominik Reisinger (SPÖ, Oberösterreich): Geschätzte Frau Präsidentin! Herr
Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Liebe
Zuhörer:innen! Ich bin doch froh, dass heute der Finanzminister bei uns
ist,
wenn wir dieses wichtige Thema debattieren. Ich debattiere ehrlich gesagt
lieber mit dem zuständigen Minister als mit dem Staatssekretär wie
vor zwei Wochen. (Zwischenruf des Bundesrates Tiefnig.)
Als Kommunalsprecher werde ich mich natürlich
wieder – sonst würde ich meiner Verantwortung nicht
nachkommen – den Gemeindefinanzen widmen,
mich darauf fokussieren. Die Kritik fällt mir ein bisschen leichter als
meinem Kollegen Sascha Obrecht, denn ich komme aus einem
ÖVP-dominierten Bundesland, aus Oberösterreich. Das ist aber
bitte nicht falsch zu verstehen, denn ich sehe diese Diskussion, diese Debatte
nicht als verbale Auseinandersetzung, sondern als sachlichen
Austausch, der aber sehr, sehr viel Brisanz in sich hat, weil es um die
Finanzen der Kommunen wirklich extrem schlecht
bestellt ist.
Wir als SPÖ werden diesen Gesetzesanträgen zustimmen, aber nicht weil wir damit zu 100 Prozent einverstanden sind, sondern – ganz ehrlich – weil uns als
Opposition ein bisschen die Option fehlt: Wir
müssen das nehmen, was zur Verfügung gestellt wird, auch wenn es
zu wenig ist. (Bundesrat Himmer:
Man nimmt, was man kriegt! – Bundesminister Brunner:
Einstimmiger Beschluss!)
Ganz kurz: Wie sieht das Umfeld
aus, in dem wir uns befinden? – Die Wirtschaft schrumpft, die
Arbeitslosigkeit und die Verschuldung steigen, und die Teuerung rauscht
noch immer ungebremst durch das Land. Die Menschen
müssen weiter darunter leiden, und die Gemeinden fahren – das
muss ich festhalten –, nur weil Sie das Steuer nicht
herumreißen – der Finanzausgleich
wäre eine sehr, sehr große Chance
dafür gewesen –, ungebremst gegen die Wand.
Schauen wir uns die Situation in
den Gemeinden und Städten an: Vereinfacht könnte man sagen,
dass die Ausgaben und die Verantwortung steigen, die Einnahmen sinken. So werden
die Gemeinden und die Kommunen ausgehungert und – das ist
das Tragische – zu Bittstellern degradiert. Die Gemeindeautonomie
ist dadurch natürlich auch infrage gestellt. Das heißt, die Not
der Gemeinden wird immer größer und die Zahl der Abgangsgemeinden –
also jener, die nicht mehr ausgleichen können – nimmt
dramatisch zu. Nicht
nur in Oberösterreich werden 2024 – ich habe das schon vor zwei
Wochen gesagt – rund die Hälfte aller Gemeinden ihren Haushalt
nicht mehr ausgleichen können, und das ist eine sehr dramatische und
besorgniserregende Entwicklung. (Beifall bei der SPÖ.)
Gleichzeitig fehlen auch die
notwendigen finanziellen Spielräume für Investitionen in
wichtige Zukunftsbereiche – in die Kinderbildung oder auch in den
Klimaschutz –, und das schadet natürlich der regionalen
Wirtschaft und gefährdet dort die Arbeitsplätze, weil unsere
Projekte leider in den Schubladen
liegen bleiben müssen.
Jetzt komme ich zum Finanzausgleich, der diese Fehlentwicklung – das ist sie aus meiner Sicht – zwar etwas bremst, aber ihr keinesfalls nachhaltig entgegenwirkt, denn die Realität ist eine ganz andere, was wir jetzt anhand der Zahlen se-
hen.
Das versprochene Geld – wir hören das ja ständig in den
Debattenbeiträgen –
kommt bei den Gemeinden nicht an und vieles versickert in den Bundesländern.
Das hat jetzt sogar der ÖVP-dominierte Gemeindebund erkennen müssen.
Am Anfang hat er über das Ergebnis des Finanzausgleiches ja noch
mitgejubelt, jetzt kommt sozusagen die Erkenntnis, dass die Gemeinden
sehr, sehr große Schwierigkeiten haben, ihre Budgets zu erstellen, und
nun fordert er auf einmal neuerliche Gespräche mit dem Bund. Es ist
schade, dass
man diese Debatte nicht in den monatelangen Verhandlungen geführt hat, sondern
wenige Tage nach Abschluss der Verhandlungen zu dieser Erkenntnis kommt.
Jetzt noch ein paar Beispiele,
die diese Dramatik zeigen – diese Zahlen
sind unverrückbar –: Es wird
immer vom Zukunftsfonds gesprochen und der wird auch in alle Höhen
gelobt – 1,1 Milliarden Euro –, aber jetzt ist ja
die Katze
aus dem Sack, denn wir kennen die Zahlen. Ich nenne eine Zahl aus meiner Gemeinde
zum Thema Kinderbildung und Kinderbetreuung. Wir werden –
das ist eine Hochrechnung für nächstes Jahr – rund
400 000 Euro Abgangsdeckung zu leisten haben. Der Betrag, der
jetzt aus dem Zukunftsfonds
kommt, beträgt satte 68 000 Euro. Mit diesen
68 000 Euro soll man dann auch noch – das ist ja auch das
Ziel und der Wunsch der Regierung – die Zahl
der Betreuungsplätze ausbauen und so die Betreuungsquote steigern. –
Herr Finanzminister, bei aller Wertschätzung: Wie soll das
funktionieren? (Zwischenruf des Bundesrates Steiner.)
Ein weiteres Beispiel: Die SHV-Umlage für die Pflege
steigt um fast 20 Prozent, und allein diese Steigerung – auch
das habe ich schon gesagt – frisst die Steigerung bei den
Ertragsanteilen bis auf den letzten Euro weg. Weiters steigen der
Krankenanstaltenbeitrag um 7 Prozent, die Personalkosten um mehr
als 9 Prozent. All diese Posten, all diese Kosten erhöhen das Minus
in der Gemeinde. Sie können es drehen und wenden, wie Sie wollen, die
Gemeinden werden so über kurz oder lang in den Ruin getrieben,
und das wissen Sie auch.
Keine Kritik aber ohne
Lösungsvorschlag oder Lösungsansatz: Wir
hätten eigentlich im Nationalrat versucht, Lösungen zu
präsentieren, und auch einen Antrag gestellt – leider konnten
die Regierungsparteien dem nicht zustimmen.
Kurz zusammengefasst: Wir
fordern weiterhin die Rücknahme der Senkung der Körperschaftsteuer
auf Unternehmensgewinne (Beifall bei der SPÖ), die Nichtrückzahlung
des gewährten Sondervorschusses von 300 Millionen Euro und als
dritten Punkt zusätzliche Finanzmittel, die aber bitte nicht über
die Länder an die Gemeinden, sondern direkt an die Gemeinden gehen. (Zwischenbemerkung
von Bundesminister Brunner.)
Herr Minister, wir werden nicht lockerlassen.
Jeden Tag wird die Zahl der Gemeinden größer, die dieser Kritik
folgen. Es gibt, wenn Sie jetzt auf
krone.at nachlesen, auch einen sehr prominenten Unterstützer, nämlich
Ihren Landeshauptmann, Landeshauptmann Wallner, der ebenfalls Zusatzmillionen für die
Gemeinden fordert. (Rufe bei der SPÖ: Hört! Hört!) Also
so falsch können wir da mit unserer Kritik und Analyse ja nicht liegen.
Also bitte –
und ich formuliere es als Bitte – entlasten Sie jetzt sofort und vor
allem nachhaltig die
österreichischen Gemeinden und Städte! – Danke. (Beifall bei der SPÖ.)
14.22
Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Herzlichen Dank.
Bevor ich jetzt dem Herrn
Bundesminister das Wort erteile, möchte ich noch kurz etwas
erklären oder vielleicht einfach noch einmal darauf hinweisen,
dass hier in diesem Haus teilweise Ausdrucksweisen verwendet werden, die zunehmend
die Würde des Hauses verletzen, und ich bitte, darauf zu verzichten. Ich
erinnere auch daran, dass wir alle hier herinnen eine Vorbildwirkung haben und
es möglich ist, sich präzise und pointiert auszudrücken.
Ich richte diesen Appell jetzt
noch an Herrn Kollegen Bundesrat Steiner. Sie haben vorhin in der Debatte Kollegen Schreuder
gesagt, er solle – wie heißt
das? - - (Bundesrat Schreuder: Den Schlapfen halten!) –
Genau, er solle den - - – Danke. Ich würde bitten,
das einfach zu unterlassen. (Bundesrat Steiner:
Den Schlopfn, habe ich gesagt, auf Zillertalerisch!) – Ja, das
kann schon sein, dass das auf Zillertalerisch ist, aber vielleicht könnte
man sich etwas zurücknehmen – nehmen Sie das
zurück? (Ruf: Ja!) –, das ist aus meiner Sicht nicht
irgendetwas, das man tut. (Bundesrat Steiner: Das ist im Zillertal
etwas
Liebliches!)
Ich denke, im Zillertal kann das schon sein, aber es ist trotzdem aus meiner Sicht nicht angebracht, und dafür erteile ich Ihnen jetzt einen Ordnungsruf, nachträglich. – Danke schön. (Beifall bei der SPÖ und bei Bundesrät:innen der Grünen. – Bundesrat Steiner: Danke schön!)
*****
Ich bitte jetzt Herrn Magnus Brunner zu Wort. – Bitte.
Bundesminister für Finanzen Dr. Magnus
Brunner, LL.M.: Sehr geehrte
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Mitglieder des Bundesrates! Vielleicht darf
ich
zwei Dinge klarstellen oder relativieren: Herr Bundesrat Reisinger, ich bin
immer gerne im Bundesrat, das weißt du hoffentlich. Ab und zu, ja, das
stimmt, gibt
es Notwendigkeiten – wie heute leider auch –, dass ich
mich verabschieden muss. Heute werden wir hoffentlich endlich die
europäischen Fiskalregeln endbeschließen, und ich werde mich in
weiterer Folge vom Herrn Staatssekretär vertreten lassen
müssen. Zu deiner Beruhigung, aber du weißt es eh: Ich bin
selbstverständlich immer sehr gerne im Bundesrat. (Beifall bei der
ÖVP
und bei Bundesrät:innen der Grünen.)
Vielleicht eine Klarstellung, weil du jetzt die unterschiedlichen
Zugänge beziehungsweise auch die
Beschlussfassung des Finanzausgleichs kritisiert hast:
Es ist ein einstimmiger Beschluss aller Länder, aller neun
Bundesländer, übrigens auch
SPÖ-geführter Bundesländer, des Städtebundes, auch
SPÖ-dominiert,
des Gemeindebundes. (Bundesrat Reisinger: Ich habe
nicht ...!) – Du nicht, nein, nein. Ich sage nur, das jetzt
aufzuschnüren und neu nachzuverhandeln –
das hätten wir können, wir haben uns ein Jahr lang in über
100 Sitzungen damit auseinandergesetzt. Am Ende des Tages hat es Gott sei
Dank eine Lösung
im Sinne der Gemeinden, der Städte und der Bundesländer gegeben.
Ich bin auch
gespannt, wie die FPÖ in den Landtagen, in Oberösterreich, in Niederösterreich,
in Salzburg, entscheiden wird, ob sie den Finanzausgleich
mit unterstützt. (Bundesrat Steiner: Lass dich
überraschen!) – Ja, ich bin schon sehr gespannt, ob das
dann mit den 15a-Vereinbarungen auch entsprechend umgesetzt wird.
Zu Herrn
Bundesrat Obrecht – bevor ich dann im Detail auf die Tagesordnung
eingehe –: Ich unterhalte mich immer gerne mit Ihnen, und vielleicht
nur
zur Beruhigung oder um Ihnen die Sorge zu nehmen: Eurostat hat gerade gestern
klargestellt und veröffentlicht, wo sich Österreich befindet. Wir befinden uns,
was die Kaufkraft betrifft, unter den top drei Europas. Was den Konsum –
also am Ende des Tages den Wohlstand – betrifft, sind wir unter den
top zwei angelangt, und zwar zum einen mit all den Unterstützungsmaßnahmen,
zum anderen aber auch mit den strukturellen Reformen wie Abschaffung
der kalten Progression, Steuerreform und solchen Dingen. Wir sind also top drei
bei der Kaufkraft, top zwei beim Wohlstand und beim Konsum. (Beifall
bei
der ÖVP und bei Bundesrät:innen der Grünen.)
Ich darf mich nun aber wieder den Fakten und der
Tagesordnung, dem Finanzausgleich, widmen. Jetzt wurden nach sieben
Jahren – normalerweise finden sie alle fünf
Jahre statt – die Verhandlungen geführt. Der letzte Finanzminister
war Hans Jörg Schelling, wer der nächste sein wird, weiß ich
nicht, aber
dass es mich jetzt nach sieben Jahren trifft, ist jedenfalls Pech (erheitert),
würde ich einmal sagen.
Die Verhandlungen waren intensiv, ja, Bundesrat Obrecht hat
es angesprochen, wahrscheinlich das Intensivste, das ich in meiner politischen
Laufbahn bisher erlebt habe, aber auch das Spannendste am Ende des
Tages. Es geht wirklich um viel Geld, darum, das viele Geld, Steuergeld
übrigens, auch zu verteilen, korrekt zu verteilen, und deswegen verwundert
es natürlich auch nicht, dass es im letzten Jahr solch intensive
Verhandlungen gegeben hat. Wie gesagt:
ein Jahr lang mit über 100 Sitzungen.
Ich denke – und dafür möchte ich mich wirklich bei allen Verhandlern bedanken –, es war immer wertschätzend, und am Ende stand das Gesamtstaatliche über Eigeninteressen, und zwar über ganz konkreten. Jedes Bundesland hat einen anderen Zugang gehabt, hat eigene Interessen gehabt, die Städte, die Gemeinden, der Bund natürlich auch, und da am Schluss zu einer gesamtstaatlichen Verantwortung zu kommen ist, glaube ich, auch im Sinne der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, denn, wie gesagt, um deren Geld geht es auch.
Dass man natürlich nicht immer 100 Prozent aller
Forderungen durchsetzt, liegt, glaube ich, auch in der Natur der Sache bei
Verhandlungen, aber wir sind
uns da sehr nahegekommen und diese gesamtstaatliche Verantwortung hat sich dann
auch durchgesetzt. Und genau das, glaube ich, erwarten sich die Österreicherinnen und Österreicher auch: dass
man wertschätzend miteinander umgeht und dass man am Schluss
eben auch zu einer Lösung kommt. (Beifall
bei ÖVP und Grünen.)
Inhaltlich wurde
von den Bundesrätinnen und Bundesräten bereits das meiste
dargestellt, deswegen werde ich jetzt nicht auf die Details eingehen, aber
eine prinzipielle Neuerung möchte ich schon ansprechen. Mir war in den Verhandlungen
im letzten Jahr wichtig, dass man den Ländern, Städten und Gemeinden
nicht einfach so mehr Geld zur Verfügung stellt. Beim letzten Finanzausgleich –
wir erinnern uns oder manche von Ihnen, von euch erinnern sich –
waren es am Ende des Tages 300 Millionen Euro – ich nenne sie
immer die Schelling-Millionen –, die sozusagen zusätzlich
ausgegeben und übermittelt worden sind. Wir haben dieses Mal einen anderen
Zugang gewählt –
aber mehr Mittel, ja, die demografischen Herausforderungen im Gesundheitsbereich, im Pflegebereich, bei der Kinderbetreuung und natürlich auch die Herausforderungen für die Gemeinden waren allen klar, selbstverständlich.
Ich meine, man
kann immer alles kritisieren, aber eines kann man nicht kritisieren: Die
Bundesregierung hat sich schon immer der Verantwortung gegenüber den
Gemeinden gestellt. Ich erinnere an die kommunalen Investitionspakete, die wir geschnürt
haben, die wirklich sozusagen eine Erfolgsstory waren und mit denen sich sowohl
der Gemeindebund,
der Städtebund als auch, wie ich annehme, die anwesenden
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister durchaus immer zufrieden gezeigt
haben, weil –
und das ist schon ein wichtiger Punkt – damit das Geld direkt an die
Gemeinden geht.
Und ja, diese
Kritik nehme ich mit: Wie schaffen wir es, dass das Geld unmittelbar zu den
Gemeinden kommt? Das haben wir jetzt zum Teil geschafft. Beim Zukunftsfonds
beispielsweise, wenn es um die Kinderbetreuung geht,
wird die Hälfte aller Mittel, also 250 Millionen Euro, unmittelbar
den Gemeinden zur Verfügung gestellt, und für den anderen Teil
erwarte ich mir von den Bundesländern natürlich schon, dass dieser
dann schnellstmöglich, unbürokratisch von den Ländern auch
an die Gemeinden geht, selbstverständlich.
Da gibt es in manchen Bundesländern schon Lösungen, die sich sehen
lassen können, die gut sind. Ich weiß nicht, wie es in
Oberösterreich ist, in Niederösterreich weiß ich es, da
funktioniert es, glaube ich, sehr gut; in Tirol, glaube ich, auch. Das ist
jetzt natürlich Sache der Bundesländer, das
Geld dann auch an die Gemeinden weiterzugeben.
Noch ein Satz zur allgemeinen Situation: Das ist eben wirklich ein Paradigmenwechsel. Es gibt mehr Geld – ja, 2,4 Milliarden Euro zu 300 Millionen Euro letztes Mal vor sieben Jahren; das ist viel mehr Geld –, das ist wieder Steuergeld, und das bringt uns als Bund budgetär natürlich in eine nicht wahnsinnig angenehme Situation. Übrigens geht es dem Bund auch nicht besser als den
Ländern und den
Gemeinden, das ist, glaube ich, auch klar, weil auch
die Zinsbelastungen hauptsächlich den
Bund betreffen, aber okay.
Die demografischen
Herausforderungen mit den erwähnten Bereichen Pflege, Gesundheit und
Kinderbetreuung anzugehen war wohl allen ein Anliegen.
Das eben zum ersten Mal mit Reformen und Zielerreichungen zu verknüpfen
war, glaube ich, wichtig und notwendig und ein Paradigmenwechsel in
den Finanzausgleichsverhandlungen.
Der Zukunftsfonds mit 1,1 Milliarden Euro ist sozusagen ein neues Instrument. Wie gesagt liegt auch da der Fokus ganz klar auf der Kinderbetreuung, aber auch auf dem Wohnen, auf dem Sanieren, auf dem Ausbau der erneuerbaren Energien – darauf, auch dort ganz konkrete Ziele zu vereinbaren.
Ein Satz zu den Sanktionen – auch das hat uns in diesem Jahr und in diesen 100 Sitzungen beschäftigt –: Ja, über Sanktionen kann man natürlich reden, das Problem ist nur, verfassungsrechtlich geht das nicht. Es gibt keine verfassungsrechtliche Möglichkeit, Sanktionen in diesem Zusammenhang – dem Spiel zwischen Bund, Ländern und Gemeinden – auf den Weg zu bringen.
Was man aber sehr wohl machen
kann – und das haben wir versucht und, so glaube ich, auch
geschafft –, ist, dass man eben Ziele definiert und dass
es eine Evaluierung gibt, ob die Ziele auch erreicht worden sind –
und ganz ehrlich: Der Druck der Bevölkerung, des Rechnungshofes, der da zuschauen wird,
wird selbstverständlich dafür sorgen, dass diese Ziele auch erreicht
werden. (Vizepräsidentin Göll übernimmt den Vorsitz.)
Darüber hinaus haben wir ein Anreizsystem geschaffen, indem die Mittel, die sozusagen übrig bleiben, wenn die Ziele erreicht worden sind, dann für andere Projekte verwendet werden können. Das ist, glaube ich, Anreiz genug für Länder, für Gemeinden, für Städte, diese Ziele am Ende des Tages auch zu erreichen. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
Weil jetzt natürlich immer über die Gemeinden
gesprochen wird: Was schon auch wichtig ist, ist, dass wir genau deswegen –
weil wir wissen, dass beispielsweise die Grunderwerbsteuer momentan
selbstverständlich zurückgeht – diesen Vorgriff von
300 Millionen Euro im Jahr 2024 ermöglicht haben.
Ich glaube, es ist wichtig, diese Liquiditätsebene für 2024 zu
halten, und dann werden wir uns anschauen, wie es sich entwickelt. Wir gehen
davon aus,
dass das Wachstum wieder steigt – die Prognosen gehen auf bis zu
1 Prozent im nächsten Jahr –, und dann wird auch die
Grunderwerbsteuer wieder nach
oben gehen. Dann werden wir schauen, wie es sich weiterentwickelt, aber wie
gesagt, wir haben die Gemeinden sicher noch nie im Stich gelassen. (Beifall
bei ÖVP und Grünen. – Bundesrat Schennach: Ein
Widerspruch zum eigenen Landeshauptmann!)
Was mir in diesem Zusammenhang auch wichtig ist, ist dieses
Transparenzthema: Es ist auch das erste Mal, dass wir jetzt wirklich
verpflichtende Transparenz für die Länder durchgesetzt
haben. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, und auch da weise ich
darauf hin: Es geht um Steuergeld der Österreicherinnen und
Österreicher, und da transparent zu sein und eine verpflichtende
Einmeldung in die Transparenzdatenbank umzusetzen war ein Anliegen
für uns alle. Es war aber auch ein gegenseitiges Anliegen, und da bin
ich froh, dass es am Ende des Tages auch zu einem Verständnis der
Bundesländer (Bundesrat Schennach: Wallner sieht einiges
anders!) gekommen ist, um
die Fördermittel nachvollziehbar darzustellen, Doppelförderung zu
vermeiden und anderes.
Kurzum: Herzlichen Dank an alle! Es war wirklich ein
Mammutprojekt,
das wir da nach sieben Jahren umgesetzt haben und mit dem wir mit diesem Mehr
an Geld auch zum ersten Mal ganz konkrete Ziele und Reformen verknüpft
haben. Danke an alle Beteiligten: über alle Parteigrenzen hinweg und
über alle Gebietskörperschaften hinweg. – Danke. (Beifall
bei ÖVP und Grünen.)
14.34
Vizepräsidentin Margit Göll: Weitere Wortmeldungen dazu liegen nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Es ist dies nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir kommen zu den Abstimmungen, die über die gegenständlichen Tagesordnungspunkte getrennt erfolgen. – Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein Finanzausgleichsgesetz 2024 erlassen wird sowie das Finanzausgleichsgesetz 2017 und weitere Gesetze geändert werden.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Es ist dies die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Transparenzdatenbankgesetz 2012 geändert wird.
Dieser Beschluss ist ein Fall des Art. 44 Abs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz und bedarf daher der in Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder und mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen zu erteilenden Zustimmung des Bundesrates.
Ich stelle zunächst die für die Abstimmung erforderliche Anwesenheit der Mitglieder des Bundesrates fest.
Wir gelangen zunächst zur Abstimmung, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist einstimmig, vielen Dank. Der Antrag ist somit angenommen.
Nunmehr lasse ich über den Antrag abstimmen, dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Art. 44 Abs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, um ein Handzeichen. – Das ist auch einstimmig der Fall, vielen Dank. Somit ist der Antrag angenommen.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend eine Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG über die Etablierung einer gebietskörperschaftenübergreifenden Transparenzdatenbank.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist Stimmenmehrheit, und somit ist der Antrag auch angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988, das Umgründungssteuergesetz, die Bundesabgabenordnung, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Kommunalsteuergesetz 1993 und das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert werden (Start-Up-Förderungsgesetz) (2321 d.B. und 2378 d.B. sowie 11363/BR d.B. und 11408/BR d.B.)
6. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung für Unternehmensgruppen erlassen wird und die Bundesabgabenordnung sowie das Unternehmensgesetzbuch geändert werden
(Mindestbesteuerungsreformgesetz – MinBestRefG) (2322 d.B. und 2379 d.B. sowie 11409/BR d.B.)
Vizepräsidentin Margit Göll: Wir gelangen nun zu den Tagesordnungspunkten 5 und 6, über welche die Debatten unter einem durchgeführt werden.
Berichterstatterin zu den Punkten 5 und 6 ist Frau Bundesrätin Sandra Lassnig. Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatterin Sandra Lassnig: Ich darf Ihnen den Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988, das Umgründungssteuergesetz, die Bundesabgabenordnung, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Kommunalsteuergesetz 1993 und das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert werden, Start-Up-Förderungsgesetz, zur Kenntnis bringen.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher gleich zur Antragstellung:
Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage mehrstimmig den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Weiters darf ich Ihnen den
Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom
14. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz,
mit dem das Bundesgesetz zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung
für Unternehmensgruppen erlassen wird und die Bundesabgabenordnung sowie
das Unternehmensgesetzbuch geändert werden, zur Kenntnis bringen.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher auch da gleich zur Antragstellung:
Der Finanzausschuss stellt nach
Beratung der Vorlage einstimmig den Antrag, gegen den
vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch
zu erheben. – Danke.
Vizepräsidentin Margit Göll: Vielen Dank.
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat MMag. Dr. Karl-Arthur
Arlamovsky. – Ich erteile ihm das Wort. (Rufe bei der
SPÖ: Falsch!) Ich habe noch nicht weitergeschaltet,
Entschuldigung. (Bundesrat Schreuder: Der fehlt überhaupt
im Computer! – Bundesrätin Schumann: Das fehlt im
Computer! – Bundesrat Schreuder: Das fehlt im
Computer! – Ruf: Nein, nein, weiter unten! – Bundesrat
Schreuder: Das ist weiter unten!)
Herr Bundesrat Günter Kovacs. – Bitte.
Bundesrat Günter Kovacs (SPÖ, Burgenland): Frau Vizepräsidentin! Herr Bundesminister! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte ganz kurz noch auf deine Ausführungen, Herr Finanzminister, eingehen: Du hast vorhin erwähnt, wir seien top zwei in Europa, top drei in Europa. (Bundesminister Brunner: Ja!) – Wirklich top sind wir leider, leider bei der Inflation. Da sind wir, glaube ich, Erster in Europa, und das ist ja das, was die Menschen jeden Tag spüren und wirklich sehr hart spüren; sie spüren diese Teuerung. (Rufe bei der ÖVP: Kaufkraft! – Bundesrätin Schumann – in Richtung ÖVP –: Die Inflation ist ein riesiges wirtschaftliches Problem, Entschuldigung!) Und es geht weiter: Ab 1. Jänner kommt die CO2-Steuer, die diese Bundesregierung noch installiert hat (Bundesrätin Eder-Gitschthaler: Klimabonus!), für alle Pendlerinnen und Pendler wird das Leben also noch teurer. Das ist die Politik in Österreich, das sehe ich. (Beifall bei SPÖ und FPÖ.)
Ich sage Ihnen schon ganz ehrlich: Wenn mich nur noch 30 Prozent der Bevölkerung (Ruf bei der FPÖ: 28!) – Entschuldigung, 28 Prozent der Bevölkerung – unterstützen, dann würde ich schön langsam anfangen nachzudenken,
und nicht hereinschreien, dass alles
passt – unglaublich! (Beifall bei der
SPÖ sowie Beifall und Bravoruf bei der FPÖ.)
Kommen wir jetzt zu den zwei
Beschlüssen, die anstehen: Das ist auf der einen Seite eben das Start-Up-Förderungsgesetz, auf der anderen Seite das
Mindestbesteuerungsreformgesetz. Beim
Start-Up-Förderungsgesetz werden wir dagegenstimmen, und das hat
Gründe. Die Idee, dass Mitarbeiter sich quasi in ein
Unternehmen mehr einbringen können, selbstständig einbringen können,
wäre ja vielleicht gut, aber wenn man sich zum Beispiel die Stellungnahme
der Arbeiterkammer genau durchliest, sieht man, dass da natürlich schon
eine Gefahr dabei ist: Da wird nämlich der Betriebsrat völlig umgangen,
und so können dann Mitarbeiter wirklich zum Handkuss kommen (Bundesminister
Brunner: Nein!), die vielleicht ein, zwei Jahre in einem Unternehmen
praktisch als Unternehmer tätig sind und am Schluss die Dummen
sind, wenn eben – und das sehen wir jetzt gut – keine
Unterstützung da ist. Da möchte ich jetzt noch erwähnen: Gott
sei Dank gibt es eine Unterstützung
wie den ÖGB, Gott sei Dank gibt es eine Unterstützung wie die
Arbeiterkammer. (Beifall bei der SPÖ.)
Was passiert momentan? – 400 000 Menschen warten auf einen Kollektivvertrag (Bundesrätin Schumann: Weil Sie die Inflation nicht runtergebracht haben, ganz einfach!), den ihnen die Arbeitgeber bis heute nicht geben, und diese Menschen hätten sich vielleicht auch frohe Weihnachten verdient, schöne Weihnachten verdient, geruhsame Weihnachten verdient, damit sie auch wirklich positiv ins neue Jahr starten können. Vielleicht fangen ja die Dienstgeber heute noch zu überlegen an und ergreifen die ausgestreckte Hand des ÖGB, die ausgestreckte Hand der Interessenvertretung, die für diese 400 000 Menschen einsteht. (Beifall bei der SPÖ.)
Wie gesagt, beim Start-Up-Förderungsgesetz in der vorliegenden Form werden wir nicht dabei sein.
Beim Mindestbesteuerungsreformgesetz werden wir hingegen
dabei sein. Das ist unserer Meinung nach der erste Schritt. Es geht dabei zu
Beginn auch lediglich um 15 Prozent, das muss man auch einmal sagen; auf
15 Prozent hat man sich geeinigt. Wir werden dabei sein, aber das kann wie
gesagt nur
der erste Schritt sein. Jeder von den erwähnten Handelsangestellten zahlt,
glaube ich, zwischen 30 und
40 Prozent Steuer, das ist auch etwas zum Nachdenken. –
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. (Beifall bei der SPÖ.)
14.43
Vizepräsidentin Margit Göll: Weiters zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Mag. Harald Himmer. – Bitte.
Bundesrat Mag. Harald Himmer (ÖVP,
Wien): Sehr geehrte Frau
Präsidentin! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Sehr geehrte Damen und
Herren
hier im Saal und vor den Bildschirmen! Wir haben es auch heute wieder vom
Finanzminister gehört: Wir haben eine Wirtschaftspolitik, die sichergestellt hat (Bundesrätin
Schumann: Die uns belastet ... mein lieber Schwan!), dass
wir – gemessen am Konsum – bei der Kaufkraft und beim
Wohlstand im europäischen Spitzenfeld liegen.
Kollege Kovacs hat die Inflation als Indikator hergenommen, darüber haben wir hier auch schon öfter diskutiert, und natürlich ist es wichtig und richtig, inflationsdämpfende Maßnahmen zu setzen. (Bundesrätin Schumann: Das wäre gescheit!) Es ist aber auch eine Tatsache, dass für das reale Leben der Menschen die genannten Indikatoren der Kaufkraft und des Wohlstands die entscheidenderen sind. (Bundesrätin Schumann: Dank der tollen Lohnverhandlungen!)
Wir haben das Thema schon
einmal in einer Debatte gehabt: Sie haben
die sozialistische Regierung in Spanien bejubelt, wo es eine so hervorragend
niedrigere Inflation gibt – eine Regierung, die eine
Arbeitslosigkeit von 12,5 Prozent zu verantworten hat, eine Regierung, die
eine Jugendarbeitslosigkeit von 25 Prozent zu verantworten hat. (Bundesrätin
Schumann: Unsere
ist auch nicht so gering!) Den Jugendlichen in Spanien, die arbeitslos sind, denen es an Kaufkraft mangelt, denen es an Wohlstand mangelt, können Sie dazu gratulieren, dass sie eine niedrigere Inflation haben. (Beifall bei der ÖVP. – Zwischenruf des Bundesrates Schachner.)
Zu diesen Gesetzesvorlagen, die
wir heute hier beschließen – in gestürzter
Reihenfolge –: Es hätte mich ja wirklich gewundert, wenn bei
Tagesordnungspunkt 6, bei der zweiten Gesetzesvorlage, die jetzt zur
Beschlussfassung vorliegt, auch noch jemand dagegenstimmen würde. Im
Prinzip ist es ja
selten der Fall, dass wir Gesetzesmaterien im Steuerbereich zur Beschlussfassung
vorliegen haben, mit denen wir etwas beschließen, durch das nicht
die Österreicherinnen und Österreicher, sondern die Konzerne belastet
werden – zu Recht, weil es nicht so sein sollte, dass digitale
Großkonzerne
ihre Steuern nicht entrichten. Daher ist das natürlich eine sehr wichtige
Initiative, die zu einem guten Teil auch von Österreich ausgegangen
ist – im Ratsvorsitz, aber natürlich auch von (Ruf bei der
FPÖ: Hubert Fuchs!) den Mitarbeitern des Herrn Finanzministers. (Bundesrat
Steiner: Ja sicher, das kannst du schon zugeben!) Die
internationale Einigung ist bei einer Mindestbesteuerung wichtig, weil uns das
ja nur etwas nützt, wenn andere auch mitmachen. Wir setzen es jetzt einmal
in das österreichische Recht um, und ich bin sehr
froh, dass alle dabei sind.
Zum ersten Punkt noch einmal
zurückkommend – was die Start-up-Szene in Österreich
betrifft –: Generell ist es so, dass in Österreich etwa
35 000 bis 40 000 Unternehmen im Jahr gegründet werden. Das
sind nicht alles klassische Start-ups, aber da sind die Start-ups auch dabei,
und diese haben eine zentrale Bedeutung für die Volkswirtschaft,
weil es sich dabei ja sehr oft um Unternehmen handelt, die neue Ideen
haben, die innovative Ideen haben, die
die Volkswirtschaft auch im Bereich der digitalen Transformation sehr
maßgeblich voranbringen. Natürlich sind da viele junge
Unternehmen dabei, die
zum Teil auch ein hohes Risiko eingehen, denn eine gute Geschäftsidee zu
haben
ist das eine, diese tatsächlich zur Umsetzung zu bringen jedoch das wesentlich Schwierigere.
In die Geschichte gehen dann
jene Geschäftsideen ein, die ganz riesig geworden sind, und dann wirkt das
im Nachhinein auch immer so einfach: Man muss
nur eine Idee haben, sie umsetzen und ein paar Jahre später gibt es ein
großes Unternehmen und ein paar Menschen sind reich
geworden. – Das passiert natürlich nur in wenigen Fällen.
Für die Volkswirtschaft ist es aber sehr wichtig, dass man den innovativen
und den kreativen Kräften die Möglichkeit gibt,
neue Ideen zu umzusetzen, und in so einem Umfeld ist es besonders
wichtig, auch mit Unternehmensbeteiligungen Anreize zu setzen.
Bei dieser Gesetzesvorlage, die wir jetzt wahrscheinlich mit Mehrheit beschließen werden, ist die Idee, dass derjenige, der die Unternehmensbeteiligung bekommt, dann eben aufgrund des Umstandes, dass er die Beteiligung hat, nicht sofort steuerpflichtig wird, denn andernfalls würde ihm zwar eigentlich etwas Gutes getan, aber in Bezug auf die Liquidität würde es bedeuten, dass er – oder sie, um das richtig zu gendern – zunächst einmal etwas zahlen muss. – Das wird mit dieser Regelung umgangen, und das finde ich sehr positiv.
Das Thema Unterstützung der Start-ups steht heute,
glaube ich, etwas
später noch einmal auf der Tagesordnung – bei den Vorlagen aus
dem Justizbereich –, und zwar im Zusammenhang mit der
Flexibilisierung im Bereich der GmbH. Jetzt geht es eben um den
abgabenrechtlichen Teil, darum, einen Schritt zu setzen, durch den es
erleichtert wird, Jungunternehmer
in Österreich zu sein, innovative Ideen weiterzubringen, etwas zu machen,
das die Volkswirtschaft vorantreibt – damit dann, wenn sich viele
von diesen Unternehmen durchgesetzt haben und wiederum alle brav Steuern
zahlen, auch der nächste oder übernächste Finanzminister davon
berichten kann, was
für eine tolle Kaufkraft und was für einen großen Wohlstand wir
haben. – Vielen Dank. (Beifall bei der ÖVP und bei
Bundesrät:innen der Grünen.)
14.49
Vizepräsidentin Margit Göll: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Günter Pröller. – Bitte.
Bundesrat Günter Pröller
(FPÖ, Oberösterreich): Frau
Vorsitzende! Herr Minister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Werte
Zuseher hier im Saal und vor den Bildschirmen! Herr Minister, Sie können
immer wieder sagen, was
Sie alles gemacht haben, die ÖVP und die Grünen können immer all
das loben, was gemacht worden ist – Faktum ist: Es sieht
draußen anders aus. Sie können auch versprechen, was Sie in
Zukunft alles besser machen werden, aber das hilft Ihnen nichts. Diese
Bundesregierung hat das Urvertrauen in der Bevölkerung Österreichs
verloren. (Beifall bei der FPÖ.)
Es ist wie in einer
Partnerschaft: Wenn der Ehemann oder die Ehefrau den Partner betrügt,
belügt, dann kann es nur mehr eines geben: die Scheidung. (Bundesrat Schreuder:
Ein Blödsinn! Geh, komm!) Die österreichische Bevölkerung
wartet nur mehr darauf, sich von dieser Regierung zu trennen. (Beifall bei
der FPÖ.) Die Österreicher vergessen nicht, was Sie getan haben. (Bundesrat
Schreuder: Du hast eine Prorede!)
Wir kommen zu den zwei Tagesordnungspunkten, die sehr
komplex sind (Bundesrat Himmer: Und am Ende stimmst du der
Gesetzesvorlage zu! – Bundesrat Schreuder: Um die ginge es
auch wirklich!), Herr Kollege Himmer. (Bundesrat Himmer: Du bist
ein Proredner, nicht?) –Ja, aber bei dieser Regierung (Bundesrat
Himmer: Hauptsache, die Stimmung bleibt negativ! –
Zwischenruf der Bundesrätin Miesenberger), die macht,
was sie in den letzten drei Jahren gemacht hat, ist nichts, was man loben kann!
(Beifall bei der FPÖ. – Bundesrat Himmer: Ein
gutes Gesetz, aber es ist wichtig, dass die
Stimmung negativ bleibt!) In den
letzten drei Jahren war alles falsch, ob das das Asyl war, die
Inflation, die Sanktionen,
die Teuerungswelle. Die Österreicher haben kein Vertrauen, und deshalb
sind Sie bei 28 Prozent. (Bundesrat Himmer: Und letztlich
stimmst du jetzt der Gesetzesvorlage zu!)
Diesen zwei Tagesordnungspunkten werden wir
zustimmen. (Beifall und Bravorufe bei ÖVP und Grünen. –
Bundesrat Himmer: Wichtig ist, dass die Stimmung schlecht bleibt!) Das
ist sehr komplex, und eine Vielzahl - - (Zwischenbemerkung von
Bundesminister Brunner.) – Das eine hat ja mit dem anderen
nichts zu tun. (Neuerliche Zwischenbemerkung von Bundesminister Brunner.) –
Na, Sie können jetzt machen, was Sie wollen, Sie können uns jeden
Tag, ich weiß nicht, 1 000 Euro übergeben, die Leute
werden Sie nicht mehr wählen. (Beifall bei
der FPÖ.)
Kollege Himmer und Kollege Kovacs sind auf das
Start-Up-Förderungsgesetz schon eingegangen. Es wäre
vielleicht noch das eine oder andere Verbesserungspotenzial vorhanden. Auch die
dazu eingelangten Stellungnahmen zeigten, dass da noch Verbesserungsbedarf
wäre. Einerseits ist die Besteuerung kritisiert
worden – dass der Mischsteuersatz unnötig kompliziert
ist und nicht dem internationalen Standard entspricht –; die
Voraussetzungen für den Arbeitnehmer – international
üblicher wären kürzere Fristen –; die Voraussetzungen
für das Unternehmen – die Schwellenwerte sind viel zu niedrig,
die Schwellenwerte wurden unterhalb der für KMUs gängigen Definition von 249 Mitarbeitern
angesetzt.
Es wurden zwar einige Stellungnahmen in das Gesetz eingearbeitet,
es hätten aber vermutlich mehr sein können. Jungunternehmer
äußern häufig den Wunsch, dass sie verstärkt die eigenen
Mitarbeiter ans Unternehmen binden wollen,
um sie entsprechend am Unternehmenserfolg teilhaben zu lassen.
Selbstverständlich sollen die Firmen die Möglichkeit haben, das jenen
Mitarbeitern anzubieten, die sie langfristig halten wollen. Es ist auch
völlig sinnvoll,
diese Partnerschaft an den Verbleib im Unternehmen zu binden, weil es ja der
Sinn und Zweck dieser Idee ist, innerhalb solcher Start-up-Unternehmen
viele Gesellschafter zu haben.
Zu Tagesordnungspunkt 6, globale Mindestbesteuerung: Dieses Mindestbesteuerungsreformgesetz ist für faire Wettbewerbsbedingungen zwi-
schen den Unternehmen
dringend notwendig. Es gibt nach wir vor Unternehmen, die versuchen, ihre
Steuerleistung so zu optimieren, dass sie ihre Steuerpflicht in Länder mit
niedriger oder ganz niedriger Besteuerung auslagern. Daran ist sicher niemand
von uns interessiert. Es soll auch nicht sein, dass
sich einzelne Länder und einzelne Firmen dieser Verantwortung entziehen
können, deswegen ist es sinnvoll, dass bei multinationalen
Unternehmen – und
es geht da nur um ganz große – dieser Steuerflucht oder dieser
Gewinnverlagerung ein Stück weit ein Riegel vorgeschoben wird. Das
ist notwendig und selbstverständlich in Ordnung.
Ich möchte mich daher bei vor allem
österreichischen kleineren und mittleren Unternehmen und deren
Mitarbeitern bedanken. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zum
Wirtschaftswachstum, trotz der hohen Belastungen, für die die Regierung mitverantwortlich ist, und schaffen und
sichern vor allem Arbeitsplätze. Wir stimmen daher den
beiden Tagesordnungspunkten zu.
(Beifall bei der FPÖ.)
14.55
Vizepräsidentin Margit Göll: Weiters zu Wort gemeldet ist Frau Dipl.-Ing. Dr. Maria Huber. – Bitte.
Bundesrätin Dipl.-Ing. Dr. Maria Huber (Grüne, Steiermark): Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Minister! Herr Staatssekretär! Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Verehrte Zuseherinnen hier im Saal! – Heute sind überraschenderweise nur Damen anwesend. – Liebe Zusehende via Livestream! Die Gemüter haben sich jetzt Gott sei Dank wieder ein bisschen beruhigt. Ich weiß gar nicht, warum Kollege Pröller sich hier so aufregt, wenn er eigentlich beiden Tagesordnungspunkten am Ende des Tages eh zustimmt. (Beifall bei Grünen und ÖVP.)
Den Dank an die Klein- und Mittelbetriebe nehme ich gerne mit: Vielen Dank, die FPÖ bedankt sich auch bei mir, das ist sehr nett. (Heiterkeit der Rednerin. – Beifall bei Abgeordneten der Grünen sowie Heiterkeit und Beifall bei der
ÖVP.)
Das ist auch einmal etwas Neues
hier im Bundesrat, das muss man
ehrlich sagen. (Zwischenrufe der Bundesrät:innen Leinfellner und
Schartel.) – Ja, vielen Dank dafür; ich habe das schon
verstanden.
Kommen wir wieder zurück zum Thema! Bei diesen Tagesordnungspunkten geht es um zwei wirklich sehr, sehr wichtige Gesetzentwürfe. Ich möchte auf die beiden auch ganz kurz eingehen.
Zunächst gleich zum
Start-up-Paket: Kollege Himmer hat es schon erwähnt, bei diesem
Tagesordnungspunkt werden wir nur den ersten Teil beschließen. Dieses Start-up-Paket
ist aus meiner Sicht ein weiterer, wesentlicher Baustein, wenn es darum geht,
in Österreich ein Klima zu schaffen, in dem Spitzenforschung in
unserem Land betrieben werden kann, ein Klima zu schaffen, in dem die
Entwicklung neuer Technologien nachhaltig vorangetrieben werden kann, und
ein Klima zu schaffen, in dem wir innovativen Unternehmen die idealen
Voraussetzungen bieten, um sich gründen und um wachsen
zu können.
Gleichzeitig stärken wir
dadurch unseren Wirtschaftsstandort nachhaltig, denn es ist Fakt: Innovative
Unternehmen wachsen schneller, schaffen mehr Arbeitsplätze und sind
wesentlich krisenrobuster. Als Unternehmerin kann ich aus eigener Erfahrung
sagen: Langfristigen Erfolg erzielen Betriebe nicht
nur dadurch, dass sie es schaffen, Kunden an sich zu binden, sondern vor allem
dadurch, dass sie im Unternehmen ein perfekt eingespieltes Team haben,
das davon überzeugt ist, dass sich eine
Beschäftigung für sie auch dauerhaft lohnt.
Was braucht es dafür? – Da geht es
selbstverständlich darum, faire Löhne
und Gehälter zu zahlen, darüber hinaus ist es aber auch zwingend
erforderlich, für ein sehr gutes Arbeitsumfeld zu sorgen, gerade wenn es
darum geht,
hoch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig an das eigene
Unternehmen zu binden.
Für Start-ups ist es eine
sehr große Herausforderung, gerade die ersten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu gewinnen und ein Team zu formen, steht man doch immer in
unmittelbarem und direktem Wettbewerb zu etablierten Unternehmen und
großen Konzernen, wenn es um die besten Köpfe geht. Als umso
wichtiger sehe ich diese Möglichkeit an, als Gründerin Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter von Anfang an fair am wirtschaftlichen Erfolg des noch jungen
Unternehmens beteiligen zu können. Das sorgt dafür, dass sich die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stärker mit dem Unternehmen
identifizieren können, es sorgt für eine sehr hohe Motivation im
Team, wenn man selbst
auch am Erfolg beteiligt ist, und stellt so einen Anreiz dar, langfristig bei
einem jungen Unternehmen zu bleiben und sich somit zu einem wertvollen
Schlüsselmitarbeiter oder einer Schlüsselmitarbeiterin zu
entwickeln.
Wichtig ist auch –
das hat Kollege Himmer schon angesprochen –, dass wir hiermit
eine Regelung schaffen, durch die die Unternehmenswertanteile, die die Beschäftigten
bekommen, im Normalfall nicht wie bisher sofort versteuert werden müssen,
sondern erst zu dem Zeitpunkt, wenn die Mitarbeiterin
die Anteile verkauft oder das Unternehmen verlässt, weil im Prinzip ja
dann der Geldfluss erfolgt.
Abschließend noch ein
paar Sätze zum Mindestbesteuerungsreformgesetz: Auch ich freue mich, dass wir einen großen
Schritt vorankommen, wenn es darum
geht, internationale Multikonzerne gerechter zu besteuern, die bislang ja durch
kreative Konstrukte in der Lage waren, kaum oder gar keine Steuern zu
zahlen. Damit werden hoffentlich künftig Steueroasen weiter ausgetrocknet.
Das schafft vor allem faire Bedingungen
für alle Unternehmen in Österreich, und
selbstverständlich bietet das für den österreichischen Staat
auch eine zusätzliche Steuereinnahme.
Kurzum: eine gute Sache, und ich bitte daher wirklich um breite Zustimmung zu beiden Tagesordnungspunkten. (Beifall bei Grünen und ÖVP.)
14.59
Vizepräsidentin
Margit Göll: Ich darf auch
Staatssekretär Florian Tursky hier im Bundesrat herzlich begrüßen. –
Herzlich willkommen. (Beifall bei der
ÖVP, bei Bundesrät:innen von SPÖ und Grünen sowie des
Bundesrates Arlamovsky.)
Weitere Wortmeldungen dazu liegen nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Es ist dies nicht der Fall. Somit ist die Debatte geschlossen.
Wir kommen zur Abstimmung, die über die gegenständlichen Tagesordnungspunkte getrennt erfolgt. – Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein Start-Up-Förderungsgesetz.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Es ist dies die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein Mindestbesteuerungsreformgesetz.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte,
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates
keinen Einspruch
zu erheben, um ein Handzeichen. – Es ist dies die Einstimmigkeit.
Somit ist der Antrag angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein
Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz
1988, die Bundesabgabenordnung, das Gebührengesetz 1957, das
Privathochschulgesetz, das Fachhochschulgesetz und das
IST-Austria-Gesetz geändert werden (Gemeinnützigkeitsreformgesetz 2023 –
GemRefG 2023) (2319 d.B. und 2380 d.B. sowie 11361/BR d.B. und 11410/BR d.B.)
Vizepräsidentin Margit Göll: Wir gelangen nun zum 7. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatter ist Herr Bundesrat Mag. Franz Ebner. Ich bitte um seinen Bericht.
Berichterstatter Mag. Franz Ebner: Frau Präsidentin! Herr Staatssekretär! Ich bringe den Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988, die Bundesabgabenordnung, das Gebührengesetz 1957, das Privathochschulgesetz, das Fachhochschulgesetz und das IST-Austria-Gesetz geändert werden.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher gleich zur Antragstellung:
Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage mehrstimmig den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsidentin Margit Göll: Vielen Dank für den Bericht.
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Doris Hahn. – Bitte.
Bundesrätin
Doris Hahn, MEd MA (SPÖ, Niederösterreich): Frau Präsidentin! Geschätzter Herr
Staatssekretär! Werte Gäste hier im Saal und zu Hause vor den
Bildschirmen! Hoher Bundesrat! Ja, das Gemeinnützigkeitsreformgesetz steht
auf der Tagesordnung. Wenig Licht, viel Schatten!, muss ich sagen, oder, anders
formuliert, jetzt im weihnachtlichen Sinne: Die Erleuchtung sehe ich darin
nicht. Daher wird es auch unsererseits keine Zustimmung dazu geben.
Vorweg sagen und betonen muss
ich natürlich, dass auch für die Sozialdemokratie das Ehrenamt in
Österreich einen ganz hohen Stellenwert hat. Ich glaube, viele Länder
beneiden uns um unser ehrenamtliches System,
gerade auch was die Feuerwehren betrifft, was die Rettungsdienste betrifft. Da
beneiden uns viele, viele Länder um unser dicht geknüpftes
ehrenamtliches Netz. Das heißt, grundsätzlich sehen wir es
natürlich durchaus positiv, wenn man Spenden auch an kleine
gemeinnützige Vereine jetzt entsprechend vereinfachen und
steuerbegünstigen möchte. – So weit, so gut.
Wenn man aber ganz genau
hinschaut, dann findet man durchaus viele, viele Punkte, die hinterfragenswert sind, die kritisierenswert sind, und wir
sind
mit dieser Kritik bei Weitem nicht alleine. Ganz im Gegenteil, diverse
NGOs – Greenpeace, Volkshilfe, der Verein gegen
Tierfabriken –, aber auch die Arbeiterkammer, der ÖGB und viele
andere mehr stellen viele, viele Bereiche in diesem Gesetz infrage, und wenn
ich mir die NGOs anschaue, dann muss
ich sagen, das sind genau die, die es eigentlich betrifft, um die es in diesem
Gesetz eigentlich geht. Die sollten also wissen, wovon sie
sprechen – aber
schauen wir es uns einmal im Konkreten an!
Wo wir noch einigermaßen
mitgehen können und könnten, wäre jetzt diese neue
Freiwilligenpauschale – klein und groß. Kurz umrissen hier die
Zahlen, um diese noch einmal ins Gedächtnis zu rufen: Bei der kleinen
Pauschale geht es um höchstens
1 000 Euro pro Jahr für maximal 30 Kalendertage, die dann
steuerbefreit sein sollen, und bei der großen –
zum Beispiel für Katastrophenhilfe, für Ausbildner, Übungsleiter
und so weiter – um 50 Euro pro Einsatztag
und höchstens 3 000 Euro im Jahr.
Da können wir grundsätzlich noch mit, aber ich muss da jetzt viele Aussagen von NGOs und Vereinen zitieren, die da, und jetzt zitiere ich wörtlich, eine „Gefahr einer politischen Erpressbarkeit [...] infolge der Ermessensspielräume der Behörden“ sehen und feststellen, nämlich in puncto Bescheinigung der Gemeinnützigkeit und somit auch der Spendenabsetzbarkeit.
Aus meiner Sicht schon einigermaßen
skurril ist, dass jetzt bei der Aberkennung die Beschwerde nur dann
aufschiebende Wirkung hat, wenn die Behörde,
die sie zuvor auch aberkannt hat, damit
einverstanden ist. Das ist irgendwie skurril und das sehen
auch die NGOs entsprechend kritisch.
Kritisch zu sehen ist ebenfalls, dass jetzt die Bestätigung durch den Wirtschaftsprüfer entfällt. Auch das haben nicht nur wir angemerkt.
Aus Sicht auch der Arbeiterkammer muss man auch ganz genau hinschauen, was die Verwendung der Freiwilligenpauschale betrifft. Da gibt es durchaus auch die Gefahr, dass sie missbräuchlich verwendet wird, sozusagen als steuersparendes Arbeitsverhältnis herangezogen wird. Ich glaube, da braucht es ein ganz genaues Monitoring und da muss man ganz genau aufpassen, welche Tätigkeit dann auch wirklich so als freiwillig tituliert wird und dass hier kein Schlupfloch in irgendeiner Form gesucht und gefunden wird. (Beifall bei der SPÖ.)
Was aber gar nicht geht – und wir hatten das Bildungsthema
heute schon –,
das ist die Begünstigung der Spenden an Schulen, denn ich glaube,
wir alle wissen, wir müssen dann einmal genauer hinschauen, denn: An
welche Schulen wird denn gespendet, und wo wird
gespendet? – Das ist in Wahrheit wieder eine Förderung des
Bildungsbürgertums, der Bildungselite, wenn man so möchte. Ich glaube
nicht, dass Eltern, die ohnehin finanziell herausfordernde Zeiten
erleben – Inflation und so weiter, wir haben es heute schon
gehört –,
an Brennpunktschulen in Großstädten großartig Schulen fördern
könnten. Das heißt, Vorteile haben dadurch wieder die Schulen, die
es in Wahrheit vielleicht nicht so dringend brauchen wie
Brennpunktschulen.
Vor allen Dingen aber eines – ich glaube, darüber sollten wir uns eigentlich alle hier herinnen einig sein, und das hinterfrage ich insofern schon –: Ich glaube, es ist eine der Kernaufgaben des Sozialstaates, für entsprechende Bildung zu sorgen. Das an Private auszulagern wäre in Wahrheit ein demokratiepolitischer (Beifall bei der SPÖ) und sozialpolitischer Wahnsinn, den wir so nicht akzep-
tieren können. Ich glaube, wir alle wollen keine amerikanischen oder anglikanischen Verhältnisse. Das können wir in Österreich so nicht zulassen und nicht akzeptieren, dass hier Schulen von Großspendern in irgendeiner Form unterstützt werden. Das geht dann immer nur in eine ganz besondere und spezielle Richtung, nämlich im Normallfall in die konservative. Das können wir so also nicht akzeptieren, und daher wird es auch in diesem Zusammenhang zu diesem Tagesordnungspunkt keine Unterstützung unsererseits geben. – Vielen Dank. (Beifall bei der SPÖ.)
15.08
Vizepräsidentin Margit Göll: Weiters zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Silvester Gfrerer. – Bitte.
Bundesrat Silvester Gfrerer (ÖVP,
Salzburg): Frau Präsidentin! Werter
Herr Staatssekretär! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Geschätzte Damen
und Herren! Österreich ist wirklich ein einzigartiges Land in Europa und,
wie ich denke,
auf der ganzen Welt – und das meine ich im positiven
Sinn –, was Ehrenamt, Vereinsleben, Rettungs- und Einsatzorganisationen
und Gemeinnützigkeit betrifft. Ich glaube, da sind wir
sicherlich alle einer Meinung.
Österreich ist das Land
der Vereine. Es gibt in etwa 125 000 Vereine mit einer Mitgliederzahl
von ungefähr vier Millionen Menschen. Das ist europaweit
die höchste Dichte. Mitglied eines Vereins zu sein macht so viele Menschen stolz,
schafft Zusammenhalt und Vertrauen in der Gesellschaft und fördert
natürlich auch das Zusammenleben in jeder Gemeinde.
Viele Maßnahmen und
Gesetze wurden in der Vergangenheit gut vorbereitet und ausverhandelt, zum
Beispiel das Freiwilligengesetz. Wir haben damit
die Freiwilligeninfrastruktur auf Bundes- und auf Landesebene wesentlich gestärkt.
Das ist im Juli in Kraft getreten.
In der letzten Bundesratssitzung haben wir das Rettungs- und
Zivilschutzorganisationen-Unterstützungsgesetz beschlossen und
für das Ehrenamt allgemein die Grundlagen verbessert, damit die
ehrenamtlich tätigen Menschen
in ihren vielfältigen und verantwortungsvollen Aufgaben, getragen vom
ehrenamtlichen Engagement, ihre Einsätze gewissenhaft und erfolgreich
absolvieren können. Die freiwillige, ehrenamtliche Arbeit in
Österreich zu stärken und den erfolgreichen Weg fortzusetzen ist der
wahre Grund, weshalb das Gemeinnützigkeitsreformgesetz in dieser Form
vorliegt. Nun können wir
es beschließen. (Beifall bei der ÖVP.)
Die politischen Verhandlungspartner – und das ist
mir wirklich wichtig zu erwähnen –, die Bereichssprecher
der Regierungsparteien im Nationalrat, Abgeordneter Hanger und Frau Abgeordnete
Blimlinger, und natürlich auch der Finanzminister und die vielen
Expertinnen und Experten seines Ressorts,
haben über einen sehr langen Zeitraum gute Gespräche geführt,
viele Detailfragen ausdiskutiert und gute Ergebnisse geliefert. Das muss
man anerkennen. Ich möchte mich dafür auch herzlich bei
ihnen allen bedanken.
Eines ist bemerkenswert: In Österreich ist circa ein Drittel der Menschen ehrenamtlich, das heißt freiwillig tätig. Die Leistungen, also die Arbeit im Gemeinnützigen- und Freiwilligenbereich, die in den Freiwilligenorganisationen erbracht wird, im dritten Sektor, wie man sagt, kann man nicht hoch genug einschätzen. Sie ist in Wahrheit nicht bezahlbar. Rund 10 Milliarden Euro tragen die Freiwilligenorganisationen in Österreich zur Wertschöpfung bei. (Bundesrat Schennach: Der ÖGB zum Beispiel! – Bundesrätin Schumann: Genau, danke! 1,2 Millionen Mitglieder!) Das sind circa 4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Der ideelle Wert, das ist natürlich auch zu erwähnen, in Höhe dessen die Gesellschaft und ganz Österreich profitiert, ist nicht zu beziffern, aber jedenfalls um ein Vielfaches höher. Es werden Leistungen erbracht, die man mit Geld nicht aufwiegen kann.
Durch dieses Gesetz – das ist ein ganz wesentlicher und wichtiger Punkt – kommt es zu einer massiven Ausweitung der Spendenabsetzbarkeit. Es sind in
Zukunft alle Bereiche erfasst, die die Allgemeinheit fördern. Es ist zum Beispiel auch der Bereich Bildung von diesem Paket erfasst, ebenso erfasst sind der Bereich Sport – davon profitieren alle Vereine – und vieles mehr.
Der heutige Beschluss dient dazu, die für die
Gesellschaft so wichtige Arbeit von ehrenamtlich Tätigen steuerlich zu
unterstützen und für Rechtssicherheit zu sorgen. Er macht es auch
möglich, Aufwendungen, die durch Ausübung
des Ehrenamtes entstehen, mit der Freiwilligenpauschale einkommensteuerfrei und
auch sozialversicherungsfrei abzugelten. Das ist natürlich auch ein
sehr positiver und wesentlicher Punkt. Dabei geht es nicht um eine Lohnzahlung,
sondern darum, ehrenamtliche Arbeit zu erleichtern. Mit dem Beschluss
des Gemeinnützigkeitsreformgesetzes wird ein großes Reformpaket
umgesetzt. Ich hoffe auf breite Zustimmung. – Vielen Dank. (Beifall
bei der ÖVP sowie
des Bundesrates Gross.)
15.13
Vizepräsidentin Margit Göll: Weiters zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Dipl.-Ing.in Dr.in Maria Huber. – Bitte.
Bundesrätin Dipl.-Ing. Dr. Maria Huber (Grüne, Steiermark): Frau Präsidentin! Herr Staatssekretär! Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zusehende! Österreich ist das Land der Vereine und der Freiwilligen. Mein Vorredner hat es schon angesprochen: Wir haben die höchste Vereinsdichte in ganz Europa. Mehr als 3,7 Millionen Menschen in Österreich sind in einem Verein aktiv: von Sportvereinen, der örtlichen Blasmusik, Theatergruppen und anderen Kunst- und Kulturinitiativen bis hin zum Umwelt- und Tierschutz.
Ein lebendiges Vereinsleben spielt natürlich auch für den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft eine sehr, sehr wichtige Rolle und macht unsere Gemeinden lebenswert. Umso wichtiger ist es, dass wir heute hier mit diesem umfassenden Reformpaket einige Vereinfachungen und Verbesserungen für die gemeinnützigen Organisationen in unserem Land schaffen.
Die Möglichkeit zur Absetzbarkeit von Spenden wird massiv ausgebaut. Alle gemeinnützigen Organisationen sollen von einer Spendenbegünstigung profitieren können. Es zählen jetzt unter anderem auch Umwelt- und Tierschutz, Frauenförderung, Bildung, Kinder-, Jugend- und Familienfürsorge, Menschenrechte sowie Konsumentenschutz zu den spendenbegünstigten Zwecken. Ausschlaggebend ist künftig nur die Gemeinnützigkeit an sich, dadurch wird beispielsweise auch der Umwelt- und Tierschutz erstmals begünstigt.
Ich möchte, weil Frau Kollegin Hahn vorhin auf das Thema Bildung eingegangen ist, noch zwei Bildungsinitiativen, die man dank dieser Novelle nun unterstützen kann, hervorheben. Das ist auf der einen Seite Teach for Austria, ein Verein, der Lehrkräfte gezielt an Schulstandorte mit besonderen sozialen Herausforderungen bringt, und auf der anderen das Mentoringprogramm Sindbad, das benachteiligte Jugendliche bei der Lehrstellensuche begleitet. Es gibt in keinem Fall eine Beschränkung auf spezielle Bildungsinitiativen, wie die SPÖ das in den Raum gestellt hat. (Beifall bei den Grünen und bei Bundesrät:innen der ÖVP. – Ruf bei der SPÖ: Man kann auch das Lycée fördern!)
Für uns Grüne ist in jedem Fall auch klar, dass eine aktive Zivilgesellschaft sehr wichtig für jede Demokratie ist. Wir haben deswegen auch bei dieser Gesetzesänderung sehr genau darauf geachtet, dass zivilgesellschaftlicher Protest selbstverständlich möglich bleibt. Missbrauch zum Beispiel durch Finanzdelikte, Betrug oder durch gefährliche, gewaltbereite Gruppen, die die Verbreitung von Hass und Hetze fördern und sich als gemeinnützig tarnen, muss wirksam verhindert werden können.
NGOs wie Umweltschutzorganisationen, die schon bisher von der Spendenabsetzbarkeit umfasst wurden, werden selbstverständlich auch weiterhin umfasst. Bevor eine gemeinnützige Organisation in Gefahr gerät, ihre Spendenbegünstigung zu verlieren, müsste sie schon gegen eine ganze Reihe an Auflagen verstoßen.
Um in der Vollziehung auch eine Wahrung der Verhältnismäßigkeit sicherzustellen, gibt es zusätzlich eine regelmäßige Evaluierung im Rahmen des Spendenarbeitskreises im Finanzministerium, in dem unter anderem das Bündnis für Gemeinnützigkeit und der Fundraising Verband Austria als Dachverbände vertreten sind.
In diesem Sinne: Ich glaube, das ist eine sehr vernünftige Regelung, von der sehr, sehr viele Vereine und Initiativen in Österreich profitieren werden. Ich bitte daher um Ihre Zustimmung. – Vielen Dank. (Beifall bei Grünen und ÖVP.)
15.17
Vizepräsidentin Margit Göll: Weitere Wortmeldungen dazu liegen nicht vor. (Bundesrätin Schartel: Doch!)
Wünscht noch jemand das Wort? (Bundesrätin Schartel: Ich!) – Bitte, Frau Bundesrätin Schartel.
Bundesrätin
Andrea Michaela Schartel (FPÖ, Steiermark): Frau Vizepräsidentin! Werte Kollegen! Frau Kollegin Hahn
hat eine sehr engagierte Rede gehalten, aber ich muss ihr vorwerfen,
dass sie irgendwelchen Verschwörungstheorien anheimgefallen ist. (Bundesrat
Schreuder: Hahaha! Und das von der
FPÖ! – Bundesrätin Schumann: Der war gut!) Davon,
dass es jetzt Großspender geben wird, die sich sämtliche Schulen
kaufen, und amerikanische Verhältnisse bei uns eintreten, sind
wir weit, weit entfernt. (Bundesrätin Hahn: Ach so! Die Partei
des kleinen Mannes, ich weiß eh!)
Sie wissen es ganz genau: Es gibt so viele Eltern, die
Klopapier für die Schule kaufen müssen (Bundesrätin Hahn:
Das sollen jetzt Spender machen?), weil
es der Staat nicht zur Verfügung stellen kann, die Kopiergeld zur
Verfügung stellen, weil sonst nichts kopiert werden kann –
sie müssen für dies und für das zahlen. Sie schimpfen aufgrund
Ihrer Ideologie immer auf jene Menschen, die es überhaupt möglich
machen, Geld zu verteilen. Gäbe es nämlich in Österreich keine
Menschen, die gut verdienen, könnten Sie nicht von Ihren Themen
schwadronieren. (Beifall bei der FPÖ. – Bundesrätin Hahn:
Aha, aha! Na dann! – Bundesrätin Schumann: Wow,
großartig! – Bundesrat Schennach: Wow,
das war erhellend! – Bundesrätin Schumann: Das war jetzt
sehr erhellend! Jetzt kennen wir uns aus! – Ruf bei der SPÖ:
Das war jetzt ein Geschenk, danke!)
15.18
Vizepräsidentin Margit Göll: Wünscht noch jemand das Wort? – Es ist dies nicht der Fall. Somit ist die Debatte geschlossen.
Wir gelangen zur Abstimmung. – Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Es ist dies die Stimmenmehrheit. Somit ist der Antrag angenommen.
Beschluss des
Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit
dem das Umsatzsteuergesetz 1994, das Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992,
das Elektrizitätsabgabegesetz, das Erdgasabgabegesetz, das Kohleabgabegesetz
und die Bundesabgabenordnung geändert
werden (3777/A und 2381 d.B. sowie 11362/BR d.B. und
11411/BR d.B.)
9. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Einrichtung einer Bundeswettbewerbsbehörde (Wettbewerbsgesetz – WettbG) geändert wird (2382 d.B. sowie 11412/BR d.B.)
Vizepräsidentin Margit Göll: Wir gelangen nun zu den Tagesordnungspunkten 8 und 9, über welche die Debatten unter einem durchgeführt werden.
Berichterstatter zu den Punkten 8 und 9 ist Herr Bundesrat Ernest Schwindsackl. – Ich bitte um die
Berichte.
Berichterstatter
Ernest Schwindsackl: Frau
Präsidentin! Geschätzter
Herr Staatssekretär! Werte Kolleginnen und Kollegen! Ich bringe den
Bericht über den Beschluss des
Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz,
mit dem das Umsatzsteuergesetz 1994, das Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992,
das Elektrizitätsabgabegesetz, das Erdgasabgabegesetz, das
Kohleabgabegesetz und die Bundesabgabenordnung geändert werden.
Der ausführliche Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher gleich zur Antragstellung:
Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage einstimmig den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Zu
Tagesordnungspunkt 9: Ich bringe den Bericht über den Beschluss des
Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit
dem
das Bundesgesetz über die Einrichtung einer Bundeswettbewerbsbehörde geändert
wird.
Dieser Bericht liegt Ihnen ebenfalls bereits vor, ich komme zur Antragstellung:
Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage mehrstimmig den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. – Herzlichen Dank.
Vizepräsidentin Margit Göll: Vielen Dank für die Berichte.
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky. – Bitte sehr.
Bundesrat
MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky (NEOS, Wien):
Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Staatssekretär! Werte
Kolleginnen und Kollegen! Ich
möchte zu drei Aspekten, die hier in
dieser Debatte vorkommen, Stellung nehmen.
Zuerst einmal zum positiven Punkt: In Ziffer 2 bei
TOP 9 geht es darum, dass zur „Stärkung des
Wettbewerbsmonitorings [...] und einer damit einhergehenden verbesserten
Transparenz [...] die Beschränkung auf ausschließlich
öffentlich verfügbare Daten aufgehoben“ wird. – Das
sehen wir als positiven Punkt,
da wird die Bundeswettbewerbsbehörde gestärkt. Prinzipiell sind wir
ja dafür, dass die Bundeswettbewerbsbehörde gestärkt wird.
Was allerdings auf der anderen Seite passiert – jetzt komme ich zu den anderen zwei Aspekten, beide beurteilen wir negativ –, ist, dass im Zuge der Umsatzsteuerbefreiung von Fotovoltaikanlagen für die BWB eine Möglichkeit geschaffen werden soll, bei begründetem „Verdacht einer Verletzung der – bereits gesetzlich bestehenden – Verpflichtung zur Weitergabe von Abgabensenkungen gemäß § 7 PreisG 1992“ „eine Branchenuntersuchung im entsprechenden Wirtschaftszweig“ durchzuführen.
Jetzt sehen wir erstens die Umsatzsteuerbefreiung für
die Fotovoltaik nicht als den sinnvollsten Weg, um die Fotovoltaiknutzung
insbesondere im privaten Bereich, um den es jetzt geht, auszubauen.
Wir sind sehr dafür, dass die Fotovoltaiknutzung im privaten Bereich
ausgebaut wird, aber es gibt auf der einen Seite schon jetzt das
Problem, mit dem sich viele Interessenten konfrontiert
sehen, dass das Netz nicht ausreichend ausgebaut ist und sie
ihre Anlagen gar nicht anschließen dürfen – da
muss man ansetzen.
Wir finden – zweitens – auch, dass die
Umsatzsteuerbefreiung nicht der richtige Weg ist, um den Fotovoltaikausbau zu
unterstützen, und dass drittens bei
den zusätzlichen Kompetenzen – sagen wir einmal so; es ist ja
nicht irgendeine Kompetenz, sondern ein Auftrag an die
Bundeswettbewerbsbehörde – systemwidrig eingegriffen wird, weil
ja laut § 7 Preisgesetz der Bundesminister – in diesem
Fall Kocher – beziehungsweise in weiterer Folge die Bezirksverwaltungsbehörden,
die dann in seinem Namen einschreiten, die Kompetenz haben, darauf zu
achten, dass Preissenkungen, die sich daraus ergeben, dass Steuern entfallen
oder gesenkt werden, weitergegeben werden. Diese Kompetenz gibt es ja
jetzt schon. Wenn jetzt sondergesetzlich – muss man fast
sagen – die Wettbewerbsbehörde zusätzlich eingeschaltet wird, ist das – so würde ich fast sagen – ein Kompetenzkonflikt. Jedenfalls ist das keine systematische Legistik.
Auf jeden Fall ist diese Maßnahme nicht das, was im
Mai 2023 groß angekündigt wurde, nämlich eine
Stärkung der Wettbewerbsbehörde. Vielmehr schaut
es so aus, als würde sich Bundesminister Kocher in diesem Fall an der BWB
abputzen wollen. – Vielen Dank.
15.24
Vizepräsidentin Margit Göll: Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Christoph Stillebacher. – Bitte.
Bundesrat
Christoph Stillebacher (ÖVP, Tirol):
Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin! Sehr geehrter Herr
Staatssekretär! Hoher Bundesrat! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Bei den Tagesordnungspunkten 8 und 9 – die Punkte
gehören ja inhaltlich zusammen – geht es um die
Umsatzsteuerbefreiung bei Fotovoltaikanlagen bis zu einer bestimmten
Größe. Weiters geht es um die Änderung im Wettbewerbsgesetz,
das die Einrichtung einer Bundeswettbewerbsbehörde ermöglicht.
Für die Umsetzung dieser Umsatzsteuerbefreiung müssen diese besagten
Gesetzesänderungen beschlossen werden. Ich darf den Fokus
auf die drei wichtigsten Aspekte legen.
Der Umsatzsteuerbefreiung liegt zuallererst ein
umweltpolitischer Gedanke zugrunde, zum Zweiten – nicht minder
wichtig – eine wesentliche Bürokratievereinfachung, und
zum Dritten geht es um die Schaffung einer Kontrollinstanz. Der
umweltpolitische Gedanke ist ganz klar: Die Energiewende ist
ein Ziel dieser Bundesregierung, und daher fördern wir auch die Erzeugung
erneuerbarer Energie, insbesondere durch die Errichtung von
Fotovoltaikanlagen.
Wo stehen wir da in der Entwicklung? – Dazu darf ich Ihnen als Tiroler exemplarisch ein paar Zahlen aus meinem Bundesland präsentieren: Mit Ende 2022
existierten in Tirol bereits etwa 14 500 PV-Anlagen. Alleine zwischen
2021 und 2022 wurden rund 3 000 neue Anlagen errichtet, das entspricht
einem
Plus von 29 Prozent. Wir sind also grundsätzlich gut unterwegs, aber
noch weit weg vom Ziel. Derzeit deckt die Stromgewinnung aus PV-Anlagen nur
etwa 3 Prozent des Tiroler Strombedarfs. Das Ziel für 2050 ist, den
Anteil des PV-Stroms auf mindestens 30 Prozent auszubauen.
Aus umweltpolitischer Sicht
geht es also schlicht und einfach darum, dass möglichst viele
Menschen Fotovoltaikanlagen auf ihren Dächern oder Hauswänden montieren,
damit wir den Zielen näherkommen. Deshalb gibt es die Förderung
mittels Änderung des Umsatzsteuergesetzes: Die Änderung
des Umsatzsteuergesetzes bewirkt, dass bei kleineren PV-Anlagen 0 Prozent
Mehrwertsteuer anfallen. Die Anlagenbetreiber bekommen schlicht
eine Rechnung mit dem Nettobetrag und dazu 0 Prozent Mehrwertsteuer.
Der Entfall der Umsatzsteuer auf Fotovoltaikanlagen bringt aber zusätzlich eine wesentliche Vereinfachung der Bürokratie. Das heißt, was es bisher an Förderungen gegeben hat, wird jetzt in eine automatische Begünstigung durch den Entfall der Umsatzsteuer übertragen. Damit entfällt ein riesiger Aufwand für die Förderansuchen, die Prüfung der Anlagen, die Genehmigungen und die Bearbeitung von Förderanträgen. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
Die Einsparung beim
Verwaltungsaufwand ist somit immens. Umweltpolitisch und verwaltungstechnisch
sind das daher sehr wichtige und nutzbringende Novellen. Bei all dem
muss aber auch sichergestellt werden, dass keine Doppelförderung
passieren kann. Deshalb kann ein Anlagenbetreiber diese unbürokratische
Förderung nur in Anspruch nehmen, wenn er nicht gleichzeitig einen Antrag
auf Förderung nach dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz stellt
oder diesen schon vorher gestellt hat.
Ich darf noch den dritten Aspekt, die Novellierung des Wettbewerbsgesetzes, ansprechen. Diese Änderung dient nämlich genau dazu, dass die Wei-
tergabe dieser Mehrwertsteuerbefreiung von den
Herstellern oder von den Installierenden an die Konsumentinnen und
Konsumenten auch stattfindet.
Die Bundeswettbewerbsbehörde wird zu diesem Zwecke mit erweiterten Kompetenzen
ausgestattet. Sie kann zukünftig bei einer Branchenuntersuchung Einschau
in die Unternehmen nehmen. Bisher war das nicht möglich, jetzt bekommt sie
eben diese Kompetenzen. Die Wettbewerbsbehörde ist dann
in der Lage, zu kontrollieren, dass diese 0 Prozent nicht zu einem
Aufschlag beim Nettopreis führen.
Alles in allem schaffen diese Novellierungen aus meiner Sicht wirklich attraktive Voraussetzungen zum Bau von PV-Anlagen und zum Umstieg auf erneuerbare Energie. Ich bitte daher um Zustimmung zu diesen Punkten. – Danke vielmals. (Beifall bei der ÖVP.)
15.29
Vizepräsidentin Margit Göll: Weiters zu Wort gemeldet ist Herr Dr. Manfred Mertel. Ich erteile ihm das Wort.
Bundesrat Dr. Manfred Mertel (SPÖ, Kärnten): Sehr geschätzte Frau Bundesratspräsidentin in spe! Herr Staatssekretär! Liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Bundesrat! Ich möchte meine Rede in diese Richtung beginnen: Ich habe das letzte Mal sehr aufmerksam eine sehr hektische Debatte verfolgt, und in dieser hat Kollege Spanring einen weitergehenden Gedankengang ausgeführt. Er hat gesagt: Wir wollen in diesem Saal keine verweichlichten Debatten. – Übrigens darf ich sagen, Herr Kollege Spanring, ich höre immer gerne bei Ihren inhaltlichen Reden zu, weil sie doch pointiert und letztendlich interessant sind. (Beifall bei der FPÖ.)
Ich glaube, aber auch
festhalten zu müssen, dass genau das nicht eintreten darf: dass wir davon
ausgehen, miteinander ja nicht kuschelig zu sprechen, sodass es dann
im Endeffekt in diesem Saal Beleidigungen, Diffamierungen gibt, sondern
für mich ist es immer wichtig, dass wir den Respekt voreinander,
den Respekt vor Andersdenkenden haben und letztendlich auch den Gedankengang in unserem politischen Wettbewerb klar verfolgen können.
Ich glaube, dafür stehen Sie alle hier im Raum, und auch (in Richtung FPÖ) Ihre Fraktion wird dazu stehen, wenn es darum geht, Österreich voranzubringen und besser zu machen.
So weit meine
Gedankengänge zur letzten Sitzung, und gerade in diesem rhetorischen
Spannungsfeld von Wertschätzung und gleichzeitiger Kritik möchte
ich mich auch heute bewegen. Kollege Stillebacher hat mir ja einiges aufgelegt.
Ich glaube, darüber sollten wir reden, denn diese Umsatzsteuerbefreiung
geht ja eigentlich in diese Richtung: Die Umsatzsteuer ist eine
gemeinschaftliche Bundesabgabe. Wir haben auch gestern im Ausschuss gehört,
dass 650 Millionen Euro an Begünstigungen beziehungsweise an
Nichteinnahmen zu erwarten sind, und die Folgen sind natürlich, dass diese
Gelder dann nicht nur dem Bund fehlen, sondern auch den Ländern und den
Gemeinden. Wir haben ja heute im Zusammenhang mit dem
Finanzausgleich bereits gehört, dass es den Gemeinden nicht besonders gut
geht.
Es ist also einmal zu
erwähnen, dass das kein Geschenk des Bundes ist,
sondern dass das auch zulasten der Gemeinden und der Länder geht. (Beifall
bei der SPÖ.)
In diesem Zusammenhang stimme ich auch mit dem Kollegen von
den NEOS überein und möchte festhalten, dass wir schon auch auf diese
Situation
im Bereich Stromversorgung aufmerksam machen müssen, die vor allem
ältere Menschen betrifft, nämlich dass es eigentlich totale
Unklarheit gibt, wie
man mit der Energiewende umzugehen hat – auf der einen Seite will
man aufseiten der älteren Generation natürlich den Beitrag
leisten, bei der Energieversorgung auf Strom und so weiter umzustellen,
andererseits weiß man aber eigentlich nicht, wie das vorangehen soll.
Auf der einen Seite hört man, es fehlen 20 000 Fachkräfte, auf der anderen Seite sind die Unternehmen – das sieht man, wenn man sich mit Unternehmen beschäftigt – gar nicht mehr in der Lage, jemandem ein Anbot zu stellen, sondern sie sagen einfach: Die Nachfrage bestimmt den Preis! Und auch in diesem Zusammenhang gebe ich ihnen recht: Wer das Geld hat, dessen Energieversorgung wird umgestellt, wer das Geld nicht hat, muss also warten.
Das sind also große Probleme, die vor allem die ältere Generation betreffen. Man kann jetzt schon in den Zeitungen lesen, welche Modelle der älteren Generation angeboten werden, dass man vielleicht zu ihren Eigentumshäusern kommt, aber auch wenn man sagt: Wir kennen Modelle, bei denen wir das vielleicht vorfinanzieren!, so ist das doch unbefriedigend für die ältere Generation und macht eigentlich unsicher. Und genau diese Richtung müssen wir trotz alledem berücksichtigen, da wir natürlich diese Energiewende brauchen, und wir wünschen uns, dass es da vonseiten der Regierung einmal eine klare und konstruktive Zukunftsgestaltung gibt, dass man also wirklich weiß, wie man dem Ganzen als ältere Generation nachhaltig nähertreten kann.
Wir werden aber trotzdem bei diesem Punkt mit Ja stimmen, weil es – und das hat auch Kollege Stillebacher angekündigt – für Übergangsfälle bürgerfreundliche Erleichterungen gibt und weil auch Doppelförderungen ausgeschlossen werden.
Deshalb also von der SPÖ ein klares Ja zu diesem Punkt, trotzdem sollen die kritischen Worte meinerseits auch zum Nachdenken anregen, wie wir die Energiewende deutlicher und schneller vorantreiben können.
Ich komme zu Punkt 9 der Tagesordnung, zur
Wettbewerbsbehörde, und darf auch festhalten, dass die
Wettbewerbsbehörde unter Generaldirektor
Dr. Theo Tanner internationale Anerkennung bekommen hat, und gerade jetzt,
in einer Zeit, in der es um Inflationsbekämpfung, Teuerungsbekämpfung
geht, sollte man diese Behörde mit besseren Instrumenten ausstatten. Das
erschließt
sich daraus, dass es eine Sektorenuntersuchung gegeben hat, was
die Benzinpreise anlangt, und das Ganze
musste mit einem Bericht enden – weitere Maßnahmen
setzen, das heißt, genauere Untersuchungen durchführen, konnte
man nicht.
Auch wenn es ein Antrag beziehungsweise eine Anregung der
SPÖ war, dass man doch die Wettbewerbsbehörde vor den
Bezirksverwaltungsbehörden mit der Überprüfung
und mit der Einschau betrauen soll, werden wir diesem Punkt nicht zustimmen,
weil es eben verabsäumt wurde, gerade diese Zeit
zu nutzen, die Wettbewerbsbehörde mit
mehr Personal und einem höheren Budget auszustatten, denn
letztendlich wird nur ein gut funktionierender
Markt auch ein Beitrag für eine Inflationsdämpfung beziehungsweise
für den Kampf gegen die Teuerung sein. – Danke für Ihre
Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der SPÖ und bei Bundesrät:innen der ÖVP.)
15.36
Vizepräsidentin Margit Göll: Weiters zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Michael Bernard. – Bitte.
Bundesrat
Michael Bernard (FPÖ, Niederösterreich): Sehr geehrte Frau Vizepräsident! Herr
Staatssekretär! Kollegen im Bundesrat! Sehr geehrte Damen und Herren im
Saal und vor den Bildschirmen! Geht es um die Umsetzung
unter dem Schutzschirm ihrer Klimapolitik stehender Gesetze, ist bei dieser schwarz-grünen
Bundesregierung vieles – besser gesagt: alles –
möglich, egal ob dies für die österreichische Bevölkerung
erträglich ist oder nicht.
Die längst überfällige Änderung der
komplizierten Förderabwicklung wird spät, aber doch vorgenommen, weil
sie einen grünen Anstrich hat, und die
heute im Fokus stehende Änderung des Umsatzsteuergesetzes für
PV-Anlagen wird durchgeführt.
Zur Info für die
Zuhörer: Um eine Doppel- beziehungsweise Überförderung für
die Anträge bis zum 31. Dezember 2023, die sogenannten Übergangsfälle,
zu vermeiden, soll der Steuersatz von 0 Prozent nicht zur Anwendung kommen, wenn für die betreffende Fotovoltaikanlage ein Antrag auf Investitionszuschuss nach dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz bis 31. Dezember 2023 eingebracht wurde und diese nach dem 31. Dezember 2023 erstmals in Betrieb genommen wird.
Aber nun zu einem wirklich
passenden Zitat für die Arbeitsweise dieser Bundesregierung: Wo ein
Wille, da ist natürlich auch ein Weg – und wo er fehlt,
gibt es viele Ausreden. Bei Ihnen fehlt der Wille, dafür gibt es viele,
viele Ausreden und keine Taten. (Beifall bei der FPÖ.)
Geht es darum, die von uns
Freiheitlichen vorgeschlagenen Maßnahmen
zur temporären Senkung beziehungsweise zum gänzlichen Aussetzen der
Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel oder auf Energie umzusetzen, oder
um die Senkung der Mineralölsteuer, der Mehrwertsteuer auf Treibstoffe,
eine Rücknahme der NoVA-Erhöhung und vieles mehr, was seit Monaten
von
uns Freiheitlichen zum Wohle der Bevölkerung gefordert wird, kommen seitens
dieser grün-schwarzen Bundesregierung nur billige Ausreden.
Zum Beispiel für den Vorschlag, bei den Lebensmitteln die Mehrwertsteuer zu senken, war die Ausrede wortwörtlich, das sei eine schlechte Politik, nämlich eine Politik der Gießkanne, dass alle, auch die Reichen, etwas davon hätten. Jetzt frage ich mich, ob das bei diesem Gesetz, wenn es um die grüne Politik geht, anders ist. (Beifall bei der FPÖ.)
Oder: Die Senkung der
Mehrwertsteuer würde nicht weitergegeben werden, das könne man auch
gar nicht kontrollieren. – Was machen wir jetzt in diesem
Falle?
Die leidgeprüfte österreichische Bevölkerung kann diese abgedroschenen Phrasen nicht mehr hören, so viel kann ich Ihnen, Herr Staatssekretär, mitgeben. Aber Sie sind ja mit Ihren Bundesregierungskollegen nicht willens, die österreichische Bevölkerung im täglichen Leben einfach und unbürokratisch
wirklich zu entlasten. Im Gegenteil, stattdessen heizen Sie
weiter mit
Ihren Gesetzen die Inflation an.
Wir Freiheitlichen werden nicht müde werden, für den Wohlstand des österreichischen Volkes zu kämpfen, und wir werden nach den Wahlen 2024 für die österreichische Bevölkerung die vielen Steine, welche sie durch Ihre gesetzten Maßnahmen, durch Ihre Fehlpolitik in den Weg gelegt bekommen hat, gemeinsam mit der Bevölkerung wieder wegräumen. (Beifall bei der FPÖ. – Bundesrat Buchmann: Schauen wir einmal!)
Angesichts der
hohen Nachfrage nach PV-Anlagen werden wir aber der Gesetzesänderung
im Sinne der Autarkie der Österreicher und für eine bürgerfreundliche
Erleichterungsregelung, auch für alle Übergangsfälle, unsere
Zustimmung geben. Es wäre aber nicht die schlechteste Bundesregierung
aller
Zeiten, wenn sie nicht wieder auf die höchst notwendigen weiteren Schritte
in der Umsetzung der selbigen Maßnahmen in der Stromspeicherung
völlig vergessen hätte. Das würde auch die Spitze des fehlenden
Netzausbaus ein wenig abflachen.
Da
größtenteils der politische Wille für Eingriffe in die
oligopole Machtherrschaft der Landesenergieversorger völlig fehlt,
können wir auf den Zusammenschluss und die damit verbundene
Aufklärungsarbeit der Bundeswettbewerbsbehörde –
ausgestattet mit mehr Rechten – mit der E-Control
nur hoffen.
Man sieht, wie wichtig es ist, wenn, so wie
jetzt, eine Bundesregierung völlig versagt, eine funktionierende
Bundeswettbewerbsbehörde zu haben und
diese mit mehr Aufgaben und Rechten zielgerichtet auszustatten.
(Beifall bei der FPÖ.)
15.41
Vizepräsidentin Margit Göll: Weiters zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Dipl.-Ing. Dr. Adi Gross. – Bitte.
15.41
Bundesrat Dipl.-Ing. Dr. Adi Gross
(Grüne, Vorarlberg): Frau
Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Abgesehen von der Aufnahme
von einer Reihe
von Abgaben – das ist noch gar nicht gesagt worden – in
die sogenannte Quotenregelung bei Steuererklärungen – ich habe
auch nachlesen müssen,
was das ist – stehen die Änderungen, alle anderen, im
Zusammenhang mit der Umsatzsteuerbefreiung für Fotovoltaikanlagen, und
zwar nicht generell,
sondern für die Kleinanlagen bis 35 Kilowatt, also der Herabsetzung
der Umsatzsteuer, jetzt einmal für zwei Jahre, auf null.
Geschaffen wird tatsächlich eine notwendige Übergangsregelung, etwa für Anlagen, die heuer errichtet wurden, aber noch keine Förderung erhalten haben, und die sollen ja schließlich nicht durch den Rost fallen. (Rufe bei der SPÖ: Oje, oje! Aufpassen!) Damit wird eine unbeabsichtigte Lücke geschlossen.
Wen betrifft die
Umsatzsteuerbefreiung? – Das wird de facto die allermeisten privaten
Kleinanlagen betreffen und somit tatsächlich eine massive Verwaltungsvereinfachung
mit sich bringen. Es ist auch kein Antrag mehr notwendig, es ist nicht mehr notwendig, das ganze
Förderprozedere abzuführen.
Die durch die Umsatzsteuerbefreiung resultierende Förderhöhe
ist übrigens ungefähr gleich wie die bisherige
Investitionsförderung.
Der Zubau von Fotovoltaik ist nach wie vor enorm. Letztes Jahr wurden knapp über 1 000 Megawatt errichtet – 1 000 Megawatt! Für alle Nichttechniker:innen: Das ist ungefähr sechsmal die Leistung des Kraftwerks Freudenau, was letztes Jahr an Fotovoltaik zugebaut wurde.
Der Ausbau hat sich seit 2019 verfünffacht und ist mit
dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz förmlich explodiert. Man kann jetzt
ruhig sagen, dass das
EAG funktioniert – ein bisschen mit Understatement –,
aber klar, natürlich hat es auch durch die Bestrebungen, aus russischem
Gas auszusteigen, einen Schub gegeben.
Ende letzten Jahres konnte mit Fotovoltaik bereits eine Strommenge erzeugt werden, die äquivalent dem Stromverbrauch von 850 000 Haushalten – 850 000 Haushalten! – ist. (Beifall bei den Grünen.)
Wie es aussieht,
geht der Rekordausbau heuer weiter. Jedenfalls wurden in den bisherigen Calls
163 000 Förderzusagen erteilt. Da kann man also schon
zwei Sachen herauslesen, Herr Kollege Bernard: Völliges Versagen sieht doch
definitiv anders aus. Ich sehe darin ziemlich das Gegenteil. Was die Komplexität der
Förderung betrifft: Wenn alleine heuer 163 000 Leute das
geschafft haben, ist es sehr wohl beherrschbar. Ich habe das übrigens
schon selber gemacht. Das ist wirklich eine sehr, sehr komfortable Homepage,
auf der man den Förderantrag stellen kann. Trotzdem ist es
natürlich gut, das jetzt weiter zu vereinfachen.
600 Millionen Euro standen
heuer für die Fotovoltaikförderung zur Verfügung. Das ist schon
eine unfassbare Summe, wenn man ein bisschen schaut,
was es früher, vor unserer Regierungsbeteiligung, gegeben hat. Alle
privaten Standard-PV-Anlagen konnten heuer gefördert werden. (Beifall bei den
Grünen und bei Bundesrät:innen der ÖVP.)
Man kann sich
also auf die Rahmenbedingung verlassen. Die Vereinfachung, die jetzt gemacht
wird, trifft wirklich sehr viele: von den gerade vorhin zitierten
über 160 000 Förderzusagen, die heuer erteilt worden sind,
sind 154 000 Kleinanlagen bis 20 kW. Wenn es also
nächstes Jahr nur annähernd so weitergeht – und
es gibt natürlich keinen Grund, das nicht anzunehmen –, dann
müssen 150 000 Personen keinen Antrag mehr stellen.
Ich möchte schon auch noch dazusagen: Das ist jetzt nicht nur irgendwie etwas Technisches, sondern diese Anlagen – das sind kleine Anlagen, die sich übrigens auch rechnen – dienen dazu, für sich selbst – man kann sich übrigens auch beteiligen, man muss kein Haus haben – günstigen grünen Strom zu erzeugen. (Beifall bei den Grünen sowie der Bundesrätin Miesenberger.)
Ich finde halt schon, dass das auch ein wichtiger Aspekt ist, wenn man ein bisschen an die letzten zwei Jahre zurückdenkt und an die Debatten, die wir hier hinsichtlich der exorbitant hohen Strompreise geführt haben.
Natürlich
ist es evident, dass es bei solch einer Dimension von betroffenen Anträgen
oder Fällen eine Sicherstellung und eine Kontrollmöglichkeit braucht,
dass die Umsatzsteuersenkung auch an Endkunden weitergegeben wird;
das haben wir jetzt mehrfach gehört. Das geschieht jetzt mit einer
Erleichterung für die Bundeswettbewerbsbehörde, diese wird
gestärkt. Im Übrigen sei angemerkt,
dass es eine rechtliche Pflicht gibt, die Umsatzsteuersenkungen
weiterzugeben.
Jetzt kann
man – no na – darüber diskutieren, was die beste
Methode ist, den PV-Ausbau weiter voranzutreiben. Die Umsatzsteuersenkung, ja,
das ist
eine Möglichkeit. Ich möchte da schon zu bedenken geben, weil ich
dahin gehend von Kollegen Manfred Mertel so kritisiert wurde: Ihr habt
natürlich
auch bei anderen Gelegenheiten Umsatzsteuernullsetzungen gefordert, klar, das
habt ihr woanders auch gemacht, und da kritisiert ihr es. Ich möchte schon
noch einmal betonen: Es geht auch um eine günstige Energieversorgung –
vor allem: eine Stromversorgung ist ein
Grundbedürfnis –, und man kann es natürlich schon
auch so argumentieren, dass wir das mit diesen Kleinanlagen – da geht
es nicht um die großen Anlagen – natürlich auch mit
unterstützen.
Durch die
Umsatzsteuerbefreiung gibt es natürlich in Summe mehr Mittel –
weil das EAG ja nichts ist, womit das Volumen verändert wird, gibt es mehr
Mittel. Die Zahl ist genannt worden. Das ist wirklich eine relevante
Summe. Damit können nun verstärkt andere Anlagen gefördert
werden: betriebliche Anlagen, größere Anlagen, besonders innovative
Anlagen, die künftig auch
stärker gefördert werden sollen, um auch da die Innovationen
voranzutreiben.
Das werden wir brauchen, denn um
100 Prozent Ökostrom zu erreichen,
werden wir einen Zubau brauchen, der deutlich über den Zubau hinausgeht,
der vor drei Jahren im Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz verankert worden ist. Wir
haben inzwischen neue Entwicklungen: Das ganze Wasserstoffthema ist dort ja
nicht eingepreist, die Entwicklung hin zur Elektromobilität,
Diversifizierung Industrie, weg vom Gas hin zum Strom. Wir werden also viel,
viel mehr brauchen und werden diese Planbarkeit und diese Mittel dringend
benötigen, und da braucht es natürlich alle Akteure – ich
betone das, das ist nichts Einseitiges. Natürlich ist das Handwerk
gefordert, jetzt auch Kapazitäten aufzubauen; das
tun sie übrigens auch.
Da das immer wieder ins Treffen geführt
wird, fehlende Netzwerkkapazitäten: Ja, die gibt es, fehlend zum Teil,
aber da sind die Netzbetreiber verantwortlich, liebe Kolleginnen und
Kollegen. Das kann man nicht dem Bund umhängen.
Das steht jetzt schon im Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz
drinnen. Die Netzbetreiber haben vorausschauend entsprechend den Zielen – es ist also sogar auf das
EAG Bezug genommen – ihre Netze auszubauen. Jetzt haben
sie – sagen wir einmal: einige – die
letzten
Jahre gepennt.
Man kann die benennen, wer das alles sind, welche Gesellschaften. Andere haben fleißig ausgebaut. Also bitte da auch wirklich den Druck dorthin zu lenken, zumal es zu einem großen Teil auch Gesellschaften sind, die in Landesmehrheitseigentum sind.
Fotovoltaik ist ja nicht nur etwas Großartiges, um
Strom zu erzeugen, Fotovoltaik ist wunderschön. Darf ich Ihnen das
zeigen? (Der Redner hält ein Bild
in die Höhe, das eine Fassade, die mit Fotovoltaikpaneelen verkleidet ist,
zeigt.) Eine wunderschöne Fassade mit Fotovoltaik! Es macht sich
übrigens auf Fußballstadien ganz großartig, dafür
gibt es ein paar Beispiele. Fotovoltaik ist ja nicht nur schön, sondern
auch Wertschöpfung. (Der Redner hält ein weiteres Bild
in die Höhe, auf dem ein Arbeiter auf einer Fotovoltaikanlage zu sehen
ist. – Beifall bei den Grünen.)
Viele, viele Milliarden fließen in das lokale Handwerk, in die Elektrotechnik, Installateure, Dachdecker und so weiter und so fort; Komponentenhersteller,
wovon wir auch in Österreich eine Reihe haben, beispielsweise für Wechselrichter, profitieren davon.
So kann man eigentlich abschließend nur festhalten (erheitert): PV – wow! (Beifall bei den Grünen und bei Bundesrät:innen der ÖVP.)
15.51
Vizepräsidentin
Margit Göll: Herzlich
begrüßen bei uns im Bundesratssaal darf ich nun Frau
Staatssekretärin Mag. Susanne Kraus-Winkler. (Beifall bei
ÖVP, SPÖ, Grünen und NEOS.)
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Wünscht noch jemand das Wort? (Bundesrat Bernard: Ja!) – Bitte, Herr Bundesrat.
Bundesrat Michael Bernard (FPÖ, Niederösterreich): Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin! Liebe Kollegen! Ich muss mich aufgrund der Aussage von Herrn Gross noch einmal zu Wort melden. Es geht um den Vergleich betreffend Grundbedürfnisse. Wenn Sie sagen, dass Energie als Grundbedürfnis umsatzsteuerfrei sein muss, kann ich Ihnen recht geben. Sie haben aber einen Vergleich mit unserer Forderung gezogen, die Umsatzsteuer auf Nahrungsmittel zu reduzieren oder auf null zu setzen. Für uns sind Nahrungsmittel genauso ein Grundbedürfnis und etwas, worauf ein Recht besteht, wie die Energie.
Das Thema völliges Versagen habe ich ja auf die
Förderpolitik gemünzt,
denn wenn die Personen, die eine Förderung für eine Fotovoltaikanlage
beantragen wollen, um 12 Uhr in der Nacht am Computer sitzen und
warten
müssen, um schnell auf den Knopf zu drücken, damit sie sie irgendwie
bekommen, kann das nicht die richtige Förderpolitik sein. Darum habe
ich vom
völligen Versagen gesprochen. (Beifall bei der FPÖ.)
15.52
Vizepräsidentin Margit Göll: Wünscht noch jemand das Wort? – Es ist dies nicht der Fall.
Die Debatte ist somit geschlossen.
Wir kommen zur Abstimmung, die über die gegenständlichen Tagesordnungspunkte getrennt erfolgt. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Umsatzsteuergesetz 1994 und weitere Gesetze geändert werden.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Es ist dies die Stimmenmehrheit, und somit ist der Antrag angenommen.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Wettbewerbsgesetz geändert wird.
Ich ersuche jene
Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den
vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch
zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit,
und somit ist der Antrag angenommen.
Beschluss des
Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz
über die höhere berufliche Bildung (HBB-Gesetz) (2312 d.B.
und 2348 d.B. sowie 11376/BR d.B.)
11. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Emissionsschutzgesetz für Kesselanlagen geändert wird (2246 d.B. und 2347 d.B. sowie 11377/BR d.B.)
Vizepräsidentin Margit Göll: Wir gelangen nun zu den Tagesordnungspunkten 10 und 11, über welche die Debatten unter einem durchgeführt werden.
Berichterstatterin zu den Punkten 10 und 11 ist Frau Bundesrätin Elisabeth Wolff. – Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatterin Elisabeth Wolff, BA: Ich bringe den Bericht des Wirtschaftsausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz über die höhere berufliche Bildung.
Der Bericht liegt in schriftlicher Form vor, ich komme daher zur Antragstellung:
Der Wirtschaftsausschuss stellt
nach Beratung der Vorlage einstimmig
den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates
keinen Einspruch zu erheben.
Weiters bringe ich den Bericht des
Wirtschaftsausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember
2023 betreffend ein Bundesgesetz,
mit dem das Emissionsschutzgesetz für Kesselanlagen geändert wird.
Auch dieser Bericht liegt Ihnen vor, ich komme daher zur Antragstellung:
Der Wirtschaftsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage einstimmig den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsidentin Margit Göll: Vielen Dank für den Bericht.
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Mag. Christine Schwarz-Fuchs. Ich erteile ihr dieses.
Bundesrätin Mag. Christine Schwarz-Fuchs (ÖVP, Vorarlberg): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Frau Staatssekretärin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Geschätzte Zuseherinnen und Zuseher via
Livestream! Wie viele Österreicherinnen und Österreicher fahre
auch ich sehr gerne Ski. Warum erzähle ich das? –
Österreich, eine der führenden Skinationen, hat letztes Jahr bei
der Ski-WM in Méribel und Courchevel sieben Medaillen geholt; eine
beachtliche Leistung.
Die Frau Staatssekretärin
wird sich sicher auch freuen, wenn wir sehr
viel Werbung für die Skination Österreich machen. Aber warum sage ich
das? – Noch mehr Medaillen als im Skifahren konnte das österreichische
Team
heuer bei der Berufseuropameisterschaft in Polen gewinnen. Mit
18 Medaillen kamen unsere Fachkräfte zurück. Woran liegt
das? – Österreich ist Spitzenreiter bei der
beruflichen Ausbildung. (Beifall bei ÖVP und Grünen sowie
bei Bundesrät:innen der SPÖ.)
Nun ist es allerdings so, dass
gerade in Lehrberufen, in denen es keine Meisterprüfung gibt, die
Karriereleiter oft mit der Lehrabschlussprüfung endet.
Mit 18 Jahren in dem Beruf angekommen, in dem man bis zur Pension arbeiten
sollte, ohne eine Chance auf weitere höhere berufliche Bildung, das klingt
frustrierend für viele junge Leute. Damit der Berufsweg der Lehrausbildung
auch in Zukunft für die jungen Menschen bei uns im Land attraktiv bleibt,
ist es
umso wichtiger, dass wir mit der höheren beruflichen Bildung ein
neues Bildungssegment eröffnen, das gleichwertig mit einer
universitären Ausbildung ist.
Die höhere berufliche
Bildung wird berufspraktisch ausgerichtet und baut auf einem Lehrabschluss oder
einer mehrjährigen einschlägigen Berufspraxis
auf. Diese weiterführende Ausbildung wird auch eigene Abschlussbezeichnungen
bekommen, sodass in Österreich, im Land der Titel, auch stolz präsentiert werden
kann, welchen Abschluss man erzielt hat.
Mit den Abschlüssen
Höhere Berufsqualifikation, der sich im Nationalen Qualifikationsrahmen –
beziehungsweise NQR, wie man ihn auch nennt – in der
Stufe fünf befindet, dem Fachdiplom in der NQR-Stufe sechs und dem
Höheren
Fachdiplom in der NQR-Stufe sieben werden diese Ausbildungen einer
Matura an einer BHS, einem Bachelor und das Höhere Fachdiplom sogar dem
Master oder Magister gleichgestellt. (Beifall bei der ÖVP. –
Vizepräsidentin
Hahn übernimmt den Vorsitz.)
Mit diesem Gesetz schaffen wir
es, auch nach dem Lehrabschluss eine höhere Bildung in einem
qualitätsgeprüften Rahmen anzubieten, die vor allem
auch international anerkannt ist. Davon profitieren nicht nur die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer, sondern auch die Unternehmen, die sofort wissen, welche
Qualifikation sie von einem Bewerber oder einer Bewerberin mit
einem solchen Abschluss erwarten können.
Damit dieses neue Bildungssegment nun zum Vorteil von allen rasch und erfolgreich eingeführt werden kann, ist es entscheidend, den Unternehmen und den Fachkräften die höhere berufliche Bildung kommunikativ gut zu vermitteln. Wichtig ist vor allem, dass alle relevanten Akteure, das heißt Ministerien, Interessenvertretungen, AMS et cetera, eine gemeinsame Sprache finden, um die Bedeutung der höheren beruflichen Bildung zu vermitteln.
Die in der
gegenständlichen Gesetzesvorlage verankerte Dachmarke höhere berufliche
Bildung geht über die im Gesetz geregelten Qualifikationen hinaus
und soll eine gemeinsame Kommunikation für alle weiterführenden
berufsbildenden Qualifikationen erreichen, also zum Beispiel auch für
Meisterin
und Meister oder Ingenieurin und Ingenieur.
Dem laut der Gesetzesvorlage zu gründenden Beirat wird diesbezüglich eine wichtige Rolle zukommen.
Abschließend möchte ich betonen, dass die Lehre
eine der besten Ausbildungsformen ist. Wir werden auf der ganzen Welt um
diese duale Ausbildung beneidet, und durch die Einführung des neuen
Bildungssegments der
höheren beruflichen Bildung wird der Weg der dualen Ausbildung weiter aufgewertet.
(Beifall bei der ÖVP und bei Bundesrät:innen der Grünen.)
In der zweiten
Gesetzesvorlage – das heißt im
Tagesordnungspunkt 11 – geht es um eine Novelle zum
Emissionsschutzgesetz für Kesselanlagen. Mit dieser geplanten
Gesetzesänderung soll einerseits eine EU-Richtlinie umgesetzt werden und
andererseits ein Schreiben der Europäischen Kommission im Rahmen
eines Vertragsverletzungsverfahrens in Bezug auf die Umsetzung der Richtlinie
über Industrieemissionen Berücksichtigung finden.
Die Ziele dieser Novelle sind
einheitliche Standards im Hinblick auf die Schadstoffemissionen aus
Kesselanlagen in die Luft sowie eine Verwaltungsvereinfachung. Konkret
soll ein Register eingerichtet werden, in das mittelgroße Anlagen
mit einer Brennstoffwärmeleistung von mindestens 1 Megawatt und
weniger als 50 Megawatt eingetragen werden. Die Emissionen aus
diesen Kesseln sollen langfristig gesenkt werden. Das ist ganz wichtig für
unsere Umwelt, aber vor allem auch für die Luftqualität und somit
für die Menschen in unserem Land.
Ich bitte daher, auch dieser Gesetzesvorlage zuzustimmen. – Vielen Dank. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
16.01
Vizepräsidentin Doris Hahn, MEd MA: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Mag.a Sandra Gerdenitsch. – Bitte, Frau Bundesrätin.
Bundesrätin Mag. Sandra Gerdenitsch (SPÖ, Burgenland): Frau Präsidentin! Sehr geehrte Staatssekretärin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Werte Zuseherinnen und Zuseher zu Hause! Kollegin Schwarz-Fuchs hat den Inhalt des vorliegenden Gesetzesbeschlusses schon gut erklärt, vielen Dank.
Es ist begrüßenswert, weitere formale Höherqualifikationen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit beruflicher Erstausbildung zu etablieren. Es werden neue Bildungswege für Personen mit einem Lehrabschluss und mehrjähriger beruflicher Erfahrung eröffnet, es eröffnet Perspektiven der formalen beruflichen Höherqualifikation nach dem Lehrabschluss. Das könnte die Entscheidung
für die Lehre unter jungen Menschen attraktiver machen und gleichzeitig Berufsbildungsabschlüsse schaffen, die gleichwertig zu allgemeinen und hochschulischen Bildungsabschlüssen sind.
Ich komme aus einer
Unternehmerfamilie und mein Vater erzählt mir regelmäßig, wie
schwierig es ist, junge Menschen für den Lehrberuf zu begeistern. Oft
scheitert es auch an den Eltern, die sagen: Mein Kind soll es ja einmal besser
haben!, also da stimmt leider etwas nicht mit dem Image der Lehre.
(Beifall bei der SPÖ.)
Es gilt nun, die aktuellen
Berufsbilder neu zu definieren und mehr Aufklärungsarbeit im dualen
Ausbildungssystem zu schaffen. Ich glaube, das werden
wir uns – trotz der Lobgesänge der Frau Kollegin –
nicht ersparen, denn jungen Menschen soll vermittelt werden, dass sie nach
einer dualen Ausbildung
eine erfolgreiche Karriere in allen möglichen Bereichen starten
können. Junge Menschen sollten aber die Berufswelt auch schon
möglichst früh
kennenlernen.
Am Beispiel meines Bruders habe
ich gesehen: Die Lehre, gefolgt von der Meisterprüfung, hat zum
Unternehmertum geführt, er führt ein Unternehmen
mit 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ja, auch das geht im
sozialdemokratischen Bereich. Mit einer Lehre stehen viele Karrierewege
offen, aber es
braucht eben auch eine Verbesserung des Images des Lehrberufes.
Wir alle ergreifen einen Beruf, um uns das Leben leisten zu
können, und weil ich gerade am Wort bin und wir kurz vor Weihnachten
stehen, darf ich das
Wort an Sie richten (in Richtung Staatssekretärin Kraus-Winkler),
und ich würde Sie ersuchen, es an Ihre Kolleginnen und Kollegen in der
Bundesregierung weiterzugeben, da Sie ja letztendlich für das Wohlergehen
der Menschen im Land zuständig sind: Das Thema Wohnkosten lässt mich
irgendwie
nicht los. Sie lassen die Bevölkerung mit den hohen Wohnkosten weiterhin
sehr im Stich. Der neue Entwurf der Schmähpreisbremse ist nichts weiter
als
ein PR-Gag. (Zwischenrufe bei der ÖVP.) Jede vierte Person in
Österreich kann sich das Wohnen kaum noch leisten.
Ich sage Ihnen, wie und wo es geht: in Wien, in Kärnten und nicht zuletzt im Burgenland. (Heiterkeit bei der ÖVP.) Ja, in sozialdemokratisch geführten Ländern, wo man dazu Willen zeigt, ist vieles möglich. (Beifall bei der SPÖ. – Weitere Zwischenrufe bei der ÖVP.)
Ja, Sie wollen das vielleicht jetzt nicht hören, aber zum Beispiel im Burgenland wurden die Mieten im gemeinnützigen Bereich für zwei Jahre eingefroren. (Zwischenrufe bei der ÖVP. – Bundesrätin Eder-Gitschthaler: 2015 Salzburg!) Schwarz-blaue Länder, wie zum Beispiel Niederösterreich, verteuern das Wohnen. Das ist sehr schäbig, meine Damen und Herren!
In ein paar Tagen ist
Weihnachten. Sie, als christliche Partei, sollten sich vielleicht ein
bisschen etwas dabei denken. Angesichts der hohen Inflation
haben Sie nicht ausreichend Maßnahmen gesetzt, um den aktuellen Herausforderungen
zu begegnen.
Wenn ich mit der
Präsidentin der Volkshilfe Burgenland spreche, die die
Aktion Burgenland schenkt ins Leben gerufen hat, bei der sich die Zahl der zu
erfüllenden Wünsche fast verdoppelt hat – 700 Kinder
und Jugendliche
haben sich beworben, damit sie ein einziges Weihnachtsgeschenk
bekommen –, dann, muss ich sagen, ist das sehr schäbig für
ein reiches Land wie Österreich, wenn sich die Eltern nicht
einmal mehr für die Kinder Weihnachtsgeschenke –
Kleinigkeiten sind es zumeist, Dinge wie Schuhe oder ein Wintermantel – leisten
können. (Beifall bei der SPÖ. – Zwischenrufe bei der
ÖVP.) –
Ja, ich glaube eh, dass Sie sich das leider nicht vorstellen können. (Bundesrat
Himmer: Wo war das? Im Burgenland?)
Ich wünsche Ihnen friedvolle Weihnachtsfeiertage,
vielleicht kommen
Sie ein bisschen ins Denken. – Danke schön. (Beifall bei der
SPÖ.)
16.05
Vizepräsidentin Doris Hahn, MEd MA: Als Nächste zu Wort gelangt Frau Bundesrätin Andrea Michaela Schartel. Ich erteile ihr dieses.
16.06
Bundesrätin Andrea Michaela Schartel
(FPÖ, Steiermark): Frau
Vizepräsidentin! Frau Staatssekretärin! Liebe Kollegen! Frau
Gerdenitsch, ich möchte Ihnen
nur eines sagen: Sie haben jetzt den Bürgermeister von Wien so lobend
erwähnt. Der hat aber die Mieten auch erst gesenkt, nachdem er vorher
einmal ganz kräftig alles miteinander erhöht hat. Dann ist es
natürlich leicht, auf solche Dinge zu verzichten. (Bundesrätin Schumann:
Das ist nicht wahr!) Das ist die Wahrheit, das nur einmal zu
dieser Geschichte. (Weitere Zwischenrufe bei der SPÖ.) Also
das hat man sogar in allen Medien lesen können.
Jetzt kommen wir aber zum
Tagesordnungspunkt. Mir gefällt an diesem Tagesordnungspunkt eines
besonders, und das sollte man hervorheben: Da das Bildungssystem ja vor allem
ideologisch rot geprägt war, hat man nichts ausgelassen, um alles zu verakademisieren.
Es war also wichtig, dass eine Kindergärtnerin – denn nur
mehr dann ist sie etwas wert! – einen Bachelor oder
einen Master hat.
Jetzt besinnt man sich wieder und sagt ehrlich: Auch jene Menschen, die bei uns in Österreich zuerst sozusagen nur einen Pflichtschulabschluss haben, mit Freude eine Lehre machen und dann eine zusätzliche Qualifikation erwerben, sollen in diesem Beruf aufgewertet werden. Das ist ganz, ganz wichtig.
Es gibt noch etwas: Das sind
nicht immer nur Menschen, die eine Lehre machen, es gibt auch
Menschen – vor allem im kaufmännischen Bereich gibt es das
sehr oft –, die zum Beispiel eine berufsbildende Schule absolvieren,
die
einer Lehre gleichgestellt wird, und die sich dann in Form von Zusatzqualifikationen –
durch Wifi-Kurse, am BFI, an den diversen Steuerberaterkammern und so
weiter – wirklich gutes, qualifiziertes Wissen aneignen. Ich finde
es ganz, ganz wichtig, dass man diese Dinge stärkt.
Was aber in diesem Zusammenhang – und jetzt muss ich an alle Sozialpartner appellieren, die hier sitzen – ganz wichtig ist, ist, dass man diese neuen Zusatzqualifikationen aber bitte auch in die Kollektivverträge bei den Verwen-
dungsgruppen reinschreibt, damit
die Menschen das dann auch beim Gehalt spüren, dass sie eine
wesentlich verbesserte Qualifikation haben, denn die Maturanten stehen drinnen,
die Hochschulabsolventen stehen drinnen,
aber diese Zusatzqualifikationen stehen nicht drinnen. (Bundesrätin Schumann:
Machen Sie sich keine Sorgen!) Es wird ja wohl nicht zu viel verlangt sein,
Frau Obergewerkschafterin (Bundesrätin Schumann: Danke!),
dass man diese Bitte erfüllt, dass man für alle Arbeitnehmer endlich
auch einmal etwas Positives macht. – Danke. (Beifall bei der
FPÖ sowie der Bundesrätin Miesenberger.)
16.08
Vizepräsidentin Doris Hahn, MEd MA: Zu Wort gemeldet ist als Nächste Frau Bundesrätin Dipl.-Ing. Dr. Maria Huber. – Bitte schön.
Bundesrätin Dipl.-Ing. Dr. Maria Huber
(Grüne, Steiermark): Frau
Vorsitzende! Sehr geehrte Frau Staatssekretärin! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Liebe Besucherinnen und Besucher! Liebe Zusehende via Livestream!
Jungen Menschen Chancen und Perspektiven zu geben sehe ich als eine sehr
wesentliche Aufgabe der Politik an. Insofern freue ich mich besonders,
dass wir
heute bei diesem Tagesordnungspunkt betreffend höhere berufliche Bildung
die Weichen dafür stellen, dass jungen Menschen, die in unseren Betrieben
eine Lehre machen, künftig mehr Möglichkeiten zur praxisnahen
berufsbegleitenden Weiterbildung in ihrem Berufsfeld offenstehen werden.
Mit dem
Arbeitskräftemangel steigt auch der Bedarf an beruflicher Höherqualifikation
laufend an. Ich habe mir überlegt, was denkbare Beispiele wären,
und habe mich auf die Suche nach Weiterbildungen im Sinne dieser neuen
höheren beruflichen Bildung gemacht, damit man sich das besser
vorstellen kann.
Zum Beispiel – das wurde auch im Ausschuss erwähnt –: Eine Person mit einem Lehrabschluss als Dachdecker, Dachdeckerin oder Fassadenbauer, Fassadenbauerin macht eine Spezialisierung im Bereich Fotovoltaik oder Solarthermie.
Oder: Ein Rauchfangkehrer, eine
Rauchfangkehrerin macht aufbauend
auf den Lehrabschluss eine Höherqualifikation als Energie- und
Effizienzberater oder ‑beraterin.
Da geht es wirklich um einen
Paradigmenwechsel. Wir schaffen damit
einen komplett neuen Bildungspfad im nicht akademischen Bereich, und
beide – sowohl die hochschulisch-akademische Bildung als auch die
neue höhere berufliche Bildung – stehen wirklich gleichberechtigt
nebeneinander. Daher sind auch diese formalisierten Abschlüsse, die meine
Vorrednerin angesprochen
hat, und die Einreihung dieser Abschlüsse in den sogenannten Nationalen
Qualifikationsrahmen so essenziell.
Das Wichtigste ist
nämlich: Wir schaffen damit eine Wahlfreiheit in unserem Bildungssystem.
Jugendliche sollten auf ihre eigenen Fähigkeiten, Talente und Stärken
vertrauen können und die gleichen Chancen haben, denn am
Ende zählt im Idealfall die Qualifikation und nicht, wo man diese erworben
hat, ob akademisch oder in der beruflichen Praxis.
Junge Menschen sollen in
Zukunft im Betrieb dieselben Entwicklungschancen haben wie auf der
Schulbank oder an der Universität. Das halte ich für wirklich sehr
wichtig. Es geht ja schließlich um nichts Geringeres als um
unseren zukünftigen hoch qualifizierten Fachkräftenachwuchs, der die
besten Bedingungen in unserem Land vorfinden soll.
Es ist in jedem Fall ein Schritt, die Lehre weiter
aufzuwerten und so als
Option für unsere Jugendlichen künftig attraktiver zu machen. Ich
bitte daher wirklich um breite
Zustimmung. – Vielen Dank. (Beifall bei Grünen und
ÖVP.)
16.11
Vizepräsidentin Doris Hahn, MEd MA: Es liegen mir dazu keine weiteren Wortmeldungen mehr vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir kommen zur Abstimmung, die über die gegenständlichen Tagesordnungspunkte getrennt erfolgt. – Die Plätze sind eingenommen.
Wir gelangen also zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz über die höhere berufliche Bildung.
Ich ersuche jene
Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den
vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch
zu erheben, um ein Handzeichen. – Dies ist die Stimmeneinhelligkeit.
Der Antrag ist somit angenommen.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Emissionsschutzgesetz für Kesselanlagen geändert wird.
Ich ersuche jene
Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den
vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch
zu erheben, um ein Handzeichen. – Dies ist ebenfalls die Stimmeneinhelligkeit.
Der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, das Arbeitsmarktservicegesetz und das Ausbildungspflichtgesetz geändert werden (2307 d.B. und 2394 d.B. sowie 11369/BR d.B.)
13. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Ausländerbeschäftigungsgesetz und das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz geändert werden (3774/A und 2395 d.B. sowie 11370/BR d.B.)
Vizepräsidentin Doris Hahn, MEd MA: Wir gelangen somit zu den Tagesordnungspunkten 12 und 13, über welche die Debatten unter einem durchgeführt werden.
Berichterstatter zu den Punkten 12 und 13 ist Herr Bundesrat Günther Ruprecht. – Ich bitte um die Berichte.
Berichterstatter
Günther Ruprecht: Sehr geehrte Frau
Vizepräsidentin!
Sehr geehrte Frau Staatssekretärin! Ich darf Ihnen den Bericht des
Ausschusses für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz über den
Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein
Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, das
Arbeitsmarktservicegesetz und
das Ausbildungspflichtgesetz geändert werden, zur Kenntnis bringen.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher gleich zur Antragstellung:
Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz stellt nach Beratung der Vorlage einstimmig den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Weiters darf ich Ihnen den
Bericht des Ausschusses für Arbeit, Soziales
und Konsumentenschutz über den Beschluss des Nationalrates vom
14. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das
Ausländerbeschäftigungsgesetz und das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz
geändert werden, zur Kenntnis bringen.
Der Bericht liegt Ihnen ebenfalls in schriftlicher Form vor, ich komme daher gleich zur Antragstellung:
Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz stellt nach Beratung der Vorlage mehrstimmig den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsidentin Doris Hahn, MEd MA: Vielen Dank für die Berichte.
Wir gehen in die Debatte ein.
Als Erster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Günter Pröller. Ich erteile ihm dieses.
Bundesrat Günter Pröller (FPÖ, Oberösterreich): Frau Vizepräsidentin! Frau Staatssekretärin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Werte Zuschauer hier im Saal und vor den Bildschirmen! Mit den vorgeschlagenen Änderungen im Arbeitslosenversicherungsgesetz soll die finanzielle Unterstützung für Jugendliche und junge Erwachsene mit fehlender Arbeitsfähigkeit verbessert werden, eine Betreuung durch das Arbeitsmarktservice ermöglicht werden, um dadurch Chancengleichheit zu erreichen.
Ich freue mich persönlich, dass es für junge Menschen mit besonderen Bedürfnissen jetzt besser wird: mit einer Potenzialanalyse, mit individuellen Beratungsgesprächen und Jugendcoaching. Wir werden diesem Tagesordnungspunkt natürlich zustimmen.
Nun zum zweiten Teil, zum
Tagesordnungspunkt 13, bei dem das Ausländerbeschäftigungsgesetz
und das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz geändert werden:
Es ist halt wie in vielen anderen Bereichen: Diese Bundesregierung ist wirklich
am Ende. Es gibt überall Problemstellungen, Herausforderungen,
die diese Regierung durch ihr Handeln mitverursacht hat, und so auch
auf dem Arbeitsmarkt.
Frau Staatssekretärin, eine weitere Aufweichung der Arbeitsmarktpolitik
zugunsten von Billigstarbeitsplätzen, von Lohn- und Sozialdumping
darf es nicht
geben. Aktuell, im November, ist die Arbeitslosigkeit in Österreich um
7 Prozent gestiegen, Tendenz weiterhin steigend. Es gibt leider Gottes
eine steigende
Zahl an Konkursen von Unternehmen. Vor allem Klein- und Mittelbetriebe haben
immer größere Probleme, weil die Regierung, vor allem die ÖVP,
ihren Job
nicht macht.
Immer mehr Menschen verlieren
wie gesagt ihren Job, und leider müssen auch immer mehr Menschen in
Privatkonkurs gehen. (Bundesrat Buchmann:
Nimmst du immer dieselbe Rede?) Das heißt, die Aussichten sind
sehr düster. Die Arbeitslosigkeit wird jetzt über den Winter und auch
ins Frühjahr hinein
weiter stark zunehmen. In Zeiten, in denen die Arbeitslosigkeit steigt, ist es
ein falsches Signal, die Kriterien für die Rot-Weiß-Rot-Karte
hinunterzuschrauben. (Beifall bei der FPÖ.)
Weiters darf ich daran erinnern: Wir haben auf der einen Seite 50 000 Ukrainer im Land, über 80 000 Asylwerber in der Bundesversorgung, 200 000 Menschen in der Mindestsicherung. Auf der anderen Seite sollen die Kriterien für diese berühmte Rot-Weiß-Rot-Karte für Personen aus dem Ausland, also von außerhalb der Europäischen Union, im Bereich des öffentlichen Verkehrs geändert werden.
Ja, wir haben das Problem, dass wir zu wenige Busfahrer und Leute bei den ÖBB haben. Wenn man aber, geschätzte Damen und Herren, auf einem EU-weiten Arbeitsmarkt mit 400 Millionen Menschen keine geeigneten Arbeitskräfte findet, dann liegt das vielleicht auch an den derzeitigen Arbeitsbedingungen. Vielleicht sollte man da etwas verbessern. (Beifall bei der FPÖ.)
Das alles ist aber das Ergebnis Ihrer Politik. Sie haben über Jahrzehnte 100 000 unqualifizierte Menschen ins Land geholt, die uns auf dem Arbeitsmarkt nicht helfen, uns aber Milliarden Euro an Kosten verursacht haben, die den Österreichern jetzt fehlen. (Beifall bei der FPÖ.)
2024 soll noch ein Sonderbudget
am AMS in der Höhe von nicht weniger
als 75 Millionen Euro extra in die Qualifizierung von Asylberechtigten investiert werden.
Daher stellen wir folgenden Antrag:
Entschließungsantrag
der Bundesrät:innen Günter Pröller, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Schluss mit der unqualifizierten Zuwanderung in unser Arbeitsmarktbudget“
Der Bundesrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird
aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, die
Regelungen für ein Maßnahmenpaket gegen die sektorale
Arbeitslosigkeit in Österreich als Konsequenz der nachhaltig
wirtschaftsschädlichen COVID-19-Maßnahmen und einer unsinnigen
Sanktionspolitik in
Folge der Ukraine-Krise beinhaltet.
Dieses Maßnahmenpaket
soll sektorale Zuzugsbeschränkungen auf dem Arbeitsmarkt für
Nicht-EU-Bürger und EU-Bürger (befristet und unbefristet)
nach Maßgabe von Alter, Ausbildungsniveau, besonderen Bedürfnissen
und gesundheitlichen
Einschränkungen, bisheriger Berufstätigkeit, angestrebter
Berufstätigkeit und branchenspezifischer kurz-, mittel- und langfristiger
Konjunktur- und Arbeitsmarktprognose beinhalten. Insbesondere sollen
im Zuge dieser Maßnahmen auch die negativen Auswirkungen der
COVID-19-Krise und der Sanktionspolitik für den Arbeitsmarkt nachhaltig
korrigiert
werden.
Gleichzeitig sollten Langzeitarbeitslose und
Langzeitbeschäftigungslose mit nichtösterreichischer
Staatsbürgerschaft aus anderen EU-Staaten bzw. Drittstaaten bzw.
Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte durch eine degressive
Ersatzrate dazu motiviert werden, in ihre Heimatländer bzw.
in andere EU-Länder und Drittstaaten zurückzukehren oder weiterzuwandern.“
*****
Danke. (Beifall bei der FPÖ.)
16.19
Vizepräsidentin Doris Hahn, MEd MA: Der von den Bundesräten Günter Pröller, Kolleginnen und Kollegen eingebrachte Entschließungsantrag betreffend „Schluss mit der unqualifizierten Zuwanderung in unser Arbeitsmarktbudget“ ist genügend unterstützt und steht demnach mit in Verhandlung.
Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin. Dr.in Andrea Eder-Gitschthaler. – Bitte.
Bundesrätin Dr. Andrea
Eder-Gitschthaler (ÖVP, Salzburg):
Frau Präsidentin! Frau Staatssekretärin! Sehr geehrte Kolleginnen und
Kollegen! Sehr
geehrte Damen und Herren hier im Saal und wo immer sie uns zuhören und
zusehen! Kollege Pröller hat den Inhalt dieser beiden Tagesordnungspunkte schon
kurz erklärt. Naturgemäß sehen wir das anders, speziell
betreffend den 13. Tagesordnungspunkt.
Ich möchte allerdings
nicht gleich auf das Negative, das Bashing vonseiten der FPÖ eingehen,
sondern zuerst auf das Positive für Menschen mit Behinderungen, auf
den wichtigen 12. Tagesordnungspunkt eingehen. Da setzen wir heute
wirklich einen Meilenstein. Wie war es denn bisher für Menschen
mit Behinderung? – Mit dem 15. Lebensjahr wurde qualifiziert,
ob sie arbeitsfähig sind oder nicht. Das setzen wir künftig bis
zum 25. Lebensjahr aus.
Damit können diese jungen Menschen die Betreuung des AMS in Anspruch nehmen
und auch all die Angebote, die das AMS für alle Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer bietet, nützen. Das betrifft sowohl Fortbildungsangebote
als auch finanzielle Anreize; und damit wird eine weitere Gleichstellung von
Menschen mit Behinderung und Menschen mit Nichtbehinderung geschaffen.
Ich denke, das ist wirklich ein Meilenstein. Wir schauen
darauf, dass Menschen mit Behinderung Zeit haben, sich zu entwickeln.
Manche brauchen einfach länger, um in den Arbeitsmarkt zu kommen. Auch
deshalb ist das wirklich
ein sehr, sehr positiver Gesetzesbeschluss (Beifall bei ÖVP und
Grünen), den wir heute hier unterstützen. Wir haben im Ausschuss
gehört, dass es eine
Servicestelle geben wird, die sich zusammen mit dem
AMS speziell dieser Menschen annimmt, und auch dafür sind Gott sei
Dank die notwendigen
Mittel da.
Nun komme ich zum 13. Tagesordnungspunkt. Wir sehen das naturgemäß anders: Wenn ein Mangel an heimischen Buslenkern und Straßenbahnfahrern und generell an Personal im öffentlichen Verkehr besteht, dann muss man doch handeln. Wir können doch nicht zuschauen und sagen: Für die Kinder und die Schülerfreifahrt gibt es keine Buslenker mehr, bei den ÖBB gibt es keine (Ruf: Lokführer!) – danke! – Lokführer mehr!
Mit dieser Maßnahme kümmern wir uns darum, dass
Menschen aus der
EU einen noch besseren Zugang zu unserem Arbeitsmarkt bekommen und dass wir mit
der Rot-Weiß-Rot-Karte den Zugang auch für Menschen aus
Nicht-EU-Ländern erleichtern. Wir haben das ja auch im Ausschuss
besprochen. Die Rot-Weiß-Rot-Karte bedeutet, dass natürlich auf die
berufliche Ausbildung, die Sprachkenntnisse, das Alter und die
Berufserfahrung geschaut wird. Das ist ja nur gut und richtig. Man kann dann
immer noch feststellen, ob
diese Menschen geeignet sind oder nicht.
Wir handeln also, und wir schauen, dass die heimische
Wirtschaft gerade im Bereich der Buslenker, Straßenbahnfahrer und
Lokführer im öffentlichen Verkehr über genügend
Fachkräfte verfügt. Wir sehen das Glas nicht halb leer, sondern halb
voll – und darum bitte ich Sie um Zustimmung.
(Beifall bei ÖVP und Grünen.)
16.23
Vizepräsidentin Doris Hahn, MEd MA: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Daniel Schmid. – Bitte, Herr Bundesrat.
Bundesrat Daniel Schmid (SPÖ, Tirol): Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin! Sehr geehrte Frau Staatssekretärin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher! Auf Tagesordnungspunkt 12 werde ich nicht
näher eingehen. Wir von der Sozialdemokratie begrüßen diese Maßnahmen und werden dem selbstverständlich zustimmen.
Dafür erlauben Sie mir
bitte, etwas ausführlicher auf Tagesordnungspunkt 13 einzugehen. Als
ich vor circa einem Monat den Initiativantrag zur Fachkräfteverordnung
zugespielt bekommen habe, habe ich ihn mir natürlich angeschaut, und
ich habe meinen Augen nicht getraut. Seien Sie mir nicht
böse, aber um solch einen Initiativantrag zu erstellen, braucht es eine
ganze Portion Inkompetenz und Ignoranz, gepaart mit purer
Verzweiflung. –
Das muss ich an dieser Stelle jetzt wirklich einmal sagen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren! In den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gibt es gemäß der deutschen Onlineplattform Statista eine Erwerbsbevölkerung von 212 Millionen Menschen. Mit Oktober 2023 gab es in der Europäischen Union 13,2 Millionen Menschen ohne Arbeit. Wie Sie vielleicht bemerken, beziehe ich mich auf die Europäische Union mit ihren 27 Mitgliedstaaten und nicht ausschließlich auf Österreich. Bitte erklären Sie mir, weshalb es beispielsweise nicht möglich ist, ausreichend Buslenkerinnen und Buslenker zu rekrutieren! Wissen Sie was? – Sie suchen gar nicht!
Mit dieser Gesetzesänderung
entfällt die Arbeitsmarktprüfung. Das heißt, das
Arbeitsmarktservice sucht auf dem Arbeitsmarkt innerhalb der Europäischen Union
und in Österreich gar nicht mehr nach Buslenkerinnen und Buslenkern.
Ist das wirklich so? (Bundesrätin Eder-Gitschthaler: ... keine
gibt!) – Na, Entschuldigung, ist das wirklich so, haben wir den
ganzen europäischen Markt nach Personal abgegrast? Ich wiederhole noch
einmal: Gemäß Statista
gibt es eine Erwerbsbevölkerung von 212 Millionen. Seid mir also
nicht böse!
Nun zum Nächsten: Wir reden von Fachkräften. Wisst ihr, was
Fakt ist? –
In Wirklichkeit werden gerade bei den Buslenkerinnen und Buslenkern angelernte
Hilfsarbeiterinnen und Hilfsarbeiter – künftig zum Beispiel aus
Tunesien, Kolumbien oder von mir aus Vietnam – angeworben. (Bundesrätin
Eder-Gitschthaler: ... die Qualifikation haben!) Das geschieht, um
jahrelangen Versäumnissen diverser Verkehrsunternehmen und auch
zu einem gewissen
Teil Versäumnissen und der falschen Politik mancher Verkehrsverbünde entgegenzuwirken. Viele Verkehrsunternehmen leben von öffentlichen Aufträgen – die öffentlichen Aufträge werden von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern finanziert –, gehen dann aber ins Ausland und holen sich das Personal aus Drittstaaten. Ja, es gibt Verkehrsunternehmen, die eine ordentliche Personalpolitik betreiben. Das sind jene, die nicht verzweifelt Fahrerinnen und Fahrer suchen – die gibt es.
Ich möchte allerdings nicht den Eindruck zu erwecken, ich wäre
der große
Gegner der vom Personalmangel geplagten Verkehrsunternehmen. (Ruf bei der
ÖVP: Das klingt aber so!) – Nein, nein! Da gibt es immer
noch die Verkehrsverbünde, die entsprechend an den Vergabekriterien
arbeiten müssen. Wo wird denn gespart? – Gespart wird
überraschenderweise beim Personal. Wie
wird beim Personal gespart? – Indem es zum Teil massive
Versäumnisse bei der Zurverfügungstellung sozialer Infrastruktur, wie
zum Beispiel adäquater Aufenthaltsräume, oder auch sanitärer
Anlagen gibt. Daran mangelt es sehr häufig. (Beifall bei der
SPÖ.) Hinzu kommt, dass viele dann auch noch sogenannte geteilte
Dienste haben, die ja besonders familienfreundlich sind. Darauf werde ich noch
näher eingehen.
Verkehrsunternehmen, die keine geteilten Dienste haben und ihren Mitarbeiter:innen soziale Infrastruktur zur Verfügung stellen – ja, sehr geehrte Damen und Herren, es gibt auch Verkehrsunternehmen, die ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Wohnungen zur Verfügung stellen (Beifall bei der SPÖ) –, verlieren dann bei Ausschreibungen auch noch die öffentlichen Aufträge.
Was hat das zur Folge? – So kommt es, dass ein
Busfahrer oder eine Busfahrerin eines faktisch ausländischen Unternehmens
aus einem Nachbarland das
ÖBB-Klo am Bahnhof um 50 Cent benutzen (Zwischenrufe bei der
SPÖ) und die Pause in der öffentlichen Wartehalle eines Bahnhofs
verbringen muss –
so lange, bis er oder sie der nächsten Verkehrsleistung nachzugehen hat. (Bundesrat
Spanring: Wenn er überhaupt eine Pause hat!)
Ich rede jetzt zum Beispiel von Dienstteilern. Richtig toll wird es nämlich, wenn es einen Dienstteiler gibt. Was ist denn überhaupt ein Dienstteiler? – Ein Dienstteiler ist: Man beginnt in den frühen Morgenstunden, um die Hauptverkehrszeit abzuwickeln, dann hat man eine Dienstunterbrechung von mehreren Stunden, wird in den frühen Abendstunden zur Hauptverkehrszeit wieder eingesetzt und fährt bis in den Abend hinein. (Zwischenruf der Bundesrätin Schumann.)
Das Problem mit den langen
unbezahlten Dienstunterbrechungen ist, dass diese Zeit nachweislich nicht als
wirklich freie Zeit empfunden wird. (Bundesrätin Platzer: Herzlich
willkommen in der Gastronomie!) – Werte Kollegin, Sie kommen mit
der Gastronomie: Ja, es gibt in der Gastronomie die Zimmerstunde.
Wenn man aber – Hausnummer – in Innsbruck bei den
Innsbrucker Verkehrsbetrieben arbeitet und aus dem Ötztal kommt, dann
fährt man während des Dienstteilers nicht von Innsbruck ins
Ötztal und zurück, sondern dann kann es passieren, dass man
stundenlang unbezahlt in einem Warteraum hockt
(Beifall bei SPÖ und FPÖ), damit man in der Nacht wieder Bus
fahren kann – und dann wundern wir uns, dass wir kein Personal
kriegen. Seid mir nicht böse! Entschuldigung – ja, da komme ich
in Rage! (Zwischenrufe der Bundesrät:innen Schumann
und Steiner.)
Sehr geehrte Damen und Herren, was ist denn die Konsequenz
daraus? (Zwischenruf bei der FPÖ.) Die Konsequenz daraus sehen wir
bei den Innsbrucker Verkehrsbetrieben. Die hohe Fluktuation bei den
Fahrer:innen der IVB
führte ja bereits zum Ausfall von Fahrten und zu einer Ausdünnung des
Fahrplans. Deswegen hat die schwarz-rote Tiroler Landesregierung in guter
Tradition in ihrem Einflussbereich mit den
Sozialpartnern vereinbart, dass geteilte Dienste bei künftigen
Ausschreibungen grundsätzlich ausgeschlossen sind. Daher gilt mein
persönlicher Dank dem Tiroler ÖGB-Chef, Herrn Philip Wohlgemuth,
und seinem Team von der Gewerkschaft Vida, das sich tagtäglich für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einsetzt. (Beifall bei der SPÖ.)
Würde die öffentliche
Hand bei der Vergabe vermehrt auf faire und vernünftige Arbeitsbedingungen
pochen, würden so manche Unternehmer:innen –
in diesem Wort steckt ja unternehmen drin – endlich etwas
unternehmen. Man könnte eine gemeinsame Offensive in Sachen ordentliche
Arbeitsbedingungen starten und den Beruf endlich attraktivieren,
anstatt ständig wegen des Personalmangels zu sudern.
Den Bock abgeschossen haben Sie
aber mit der Aufnahme eisenbahnspezifischer Berufe in die
Mangelberufsliste. Seien Sie mir nicht böse, ich gebe Ihnen jetzt ein
wunderbares veranschaulichendes Beispiel betreffend den Lokführer und die
Lokführerin. Ja, Sie haben richtig gehört, Lokführerinnen und
Lokführer sollen künftig aus Sri Lanka, Kolumbien und Dschibuti
angeworben werden. (Bundesrat Spanring: Das ist jetzt aber
rassistisch! – Bundesrat Steiner: Sehr rassistisch!) Ich
zitiere aus einem Ausschnitt einer Jobbeschreibung für Lokführerinnen
und Lokführer (Zwischenruf des Bundesrates Tiefnig):
„Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und
Schrift“ – Zitatende.
Nun, eine abgeschlossene Berufsausbildung oder Matura versteht sich ja bei diesem
Berufsbild von selbst. Wissen Sie, was beispielsweise jemand aus Kolumbien macht,
wenn er oder sie einen entsprechenden Bildungsgrad hat und über sehr gute
Deutschkenntnisse in Wort und Schrift verfügt? – Vermutlich sehr
vieles, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit werden solche
Menschen nicht Lokführer, Fahrdienstleiter, Wagenmeister oder Zugbegleiter
in Österreich.
Was mir überhaupt nicht
einleuchtet: Mitte Juni erfahren wir von der Geschäftsführung eines
Eisenbahnverkehrsunternehmens aus den Medien, dass wir in Österreich bei
den Lokführer:innen keinen Personalmangel haben,
wir hätten gerade einmal einen erhöhten Personalbedarf. (Ruf bei
der SPÖ: Na geh!)
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn wir einmal vom West-Ost-Gefälle absehen, erkennen wir, dass es in Österreich mit Ausnahme Vorarlbergs
kein wirkliches Rekrutierungsproblem gibt. (Bundesrätin Eder: Oh!) Es scheitert einfach an den Ausbildungskapazitäten, einhergehend mit einer über Jahre hinweg völlig falschen Personalpolitik, das heißt, dass kein Personal ausgebildet wurde. Nun fehlt diesen Verkehrsunternehmen das Personal, und das fällt ihnen auf den Schädel. (Rufe bei der FPÖ: Christian Kern!)
Dann sagen die ÖBB: Durch die Aufnahme der
eisenbahnspezifischen Berufe in die Mangelberufsliste werde man ihre insgesamt
rund 3 000 ausgeschriebenen Stellen pro Jahr nunmehr besetzen
können. Ich weiß da nicht, ob ich zu weinen oder zu lachen anfangen
soll. Das schaue ich mir nämlich an, wie
viele Kolleginnen und Kollegen aus Tunesien, Kolumbien, Sri Lanka et cetera wir
künftig als Lokführer:innen, Fahrdienstleiter:innen und
Wagenmeister:innen begrüßen dürfen. Meine sehr
geehrten Damen und Herren, dieses Vorhaben wird sowas von einem Rohrkrepierer.
Ich komme langsam zum Ende: Im ursprünglichen
Gesetzentwurf war
angeblich noch eine gesetzliche Klarstellung enthalten, dass für die
Rot-Weiß-Rot-Karte ein existenzsicherndes Beschäftigungsangebot von
mindestens 30 Wochenstunden und die Anmeldung zur
inländischen Sozialversicherung erforderlich ist. Ich habe mich gestern im
Ausschuss erkundigt: Ja, das
stimmt wirklich, das stand im Entwurf so drinnen. Dann hat allerdings der
politische Prozess zwischen Türkis und Grün begonnen, und siehe
da: Weg ist
der Absatz. – Das ist ein völliger Wahnsinn. Das ist für
mich völlig unverständlich. (Ruf bei der FPÖ: Für
uns auch!) Letztendlich geht es dieser Bundesregierung nur darum,
billige Arbeitskräfte aus dem Ausland zu rekrutieren, statt endlich an
guten Arbeitsbedingungen zu arbeiten. Dass Sie diesen Absatz aus dem
Entwurf wieder herausgenommen haben, beweist das. (Beifall bei SPÖ und
FPÖ.)
Die schwarzen Schafe unter den Verkehrsunternehmen werden
belohnt, indem sie durch Ihre Maßnahmen vom Verbesserungsdruck befreit
werden, anstatt an den Arbeitsbedingungen arbeiten zu müssen.
Je mehr ich mich mit Stellenausschreibungen befasse, umso eher komme ich
zu dem Schluss,
dass Fachkräftemangel nicht bedeutet, dass man keine Fachkräfte
für eine Stelle findet. (Ruf bei der FPÖ: ... der Regierung auch
nicht!) Nein, das bedeutet,
man findet niemanden, der für so wenig Geld und/oder unter so schlechten
Rahmenbedingungen arbeiten will. (Beifall bei der SPÖ.)
Wir Sozialdemokrat:innen
sagen Ja zur Verkehrswende – sie ist notwendig –,
aber nicht auf Kosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund von Lohn-
und Sozialdumping, nicht auf Kosten der Ausbildungsqualität und damit einhergehend
auf Kosten der Sicherheit. Deshalb werden wir dieser Gesetzesänderung
nicht zustimmen. Es ist höchste Zeit, dass zum Wohle Österreichs
sowohl das Arbeitsministerium als auch das Verkehrsministerium wieder in
rote Hände kommen. – Danke. (Beifall bei der
SPÖ. – Bundesrat Steiner: Nein!
Nur das nicht! – Bundesrat Spanring: Nein!)
16.39
Vizepräsidentin
Doris Hahn, MEd MA: Inzwischen ist Frau
Bundesministerin für Justiz Dr.in Alma Zadić, die ich
an dieser Stelle recht herzlich begrüßen darf,
im Bundesrat eingetroffen. (Beifall bei ÖVP, SPÖ und
Grünen.)
Als Nächste ist Frau Bundesrätin Claudia Hauschildt-Buschberger zu Wort gemeldet. – Bitte schön.
Bundesrätin Claudia Hauschildt-Buschberger (Grüne, Oberösterreich): Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau Staatssekretärin! Sehr geehrte Frau Ministerin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher, hier im Saal anwesend und zu Hause! Wie meine Vorredner schon erwähnt haben, behandeln wir zwei Tagesordnungspunkte unter einem, TOP 12 und 13, und es ist mir wichtig, zu beiden Punkten etwas zu sagen.
Die Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes
ist tatsächlich ein wesentlicher, essenzieller und sehr wichtiger
Schritt in Bezug auf die Feststellung
von Arbeitsunfähigkeit bei Jugendlichen. Wir haben es gehört, derzeit
findet diese Feststellung der Arbeitsunfähigkeit schon im jungen
Alter von 15 Jahren
statt. Das führt schlussendlich dazu, dass die Betroffenen keinen Zugang zu Leistungen des AMS, insbesondere zu wichtigen Förderungs- und Begleitmaßnahmen, haben und so quasi schon in frühester Jugend auf dem Abstellgleis landen.
Das wird nun endlich
geändert und das ist, wie meine Vorredner:innen es
gesagt haben, ein wirklicher Meilenstein. (Beifall bei Grünen und
ÖVP.) Die jungen Menschen werden nun bis zu einem Alter, wir haben es
schon gehört, von 25 Jahren vom AMS und vom Sozialministeriumservice
betreut und eben beim AMS vorgemerkt.
Eines ist noch wichtig zu erwähnen, denn das wurde, glaube ich, noch nicht gesagt: Die Betroffenen können bis zum Alter von 25 Jahren nicht mehr verpflichtet werden, sich einer Feststellung der Arbeitsunfähigkeit zu stellen. Im Jahr 2023 darf es tatsächlich keinen Automatismus im Sinne von Sonderschule, Werkstatt und Sozialhilfe mehr geben.
Vielleicht ist es auch noch interessant, Folgendes aufzugreifen: Was wir heute tun, wird schon lange gefordert und richtet sich auch nach der UN-Behindertenrechtskonvention. Wir benutzen jetzt nicht mehr rein medizinische Kriterien, sondern wir orientieren uns am sozialen Modell von Behinderung.
Anstelle dieses automatischen Abschiebens in die Werkstatt, was bisher sehr oft passierte, soll eine intensive Zusammenarbeit von AMS und SMS – Sozialministeriumservice – stattfinden. Auch vom SMS werden in Zukunft arbeitsintegrative Maßnahmen finanziert werden. So kann mit Jugendlichen mit Behinderung ein Perspektivenplan entwickelt werden und es können Möglichkeiten zur Arbeitsmarktintegration aufgezeigt werden.
Dazu gibt es ganz spezielle Programme, zum Beispiel das Jugendcoaching. Ich habe erst kürzlich in Braunau eine Stelle der Volkshilfe besucht, die Jugendcoaching betreibt, und dort findet tatsächlich intensive Arbeit mit und an den
jungen Menschen statt, mit ganz hohem, sage ich jetzt einmal, Gelingfaktor: Teilqualifizierungslehre sei da genannt, es kommt auch die verlängerte Lehre zur Anwendung, die so auch weiterentwickelt wird.
Um die Integration von Menschen
mit Behinderung in den Arbeitsmarkt bestmöglich zu unterstützen,
werden auch noch 50 Millionen Euro aus dem Arbeitsmarktbudget
bereitgestellt. Der heutige Beschluss ist ein wichtiger
und weiterer wesentlicher Schritt zu einem inklusiven Arbeitsmarkt. Das kann
nicht der letzte Schritt sein. Wir bleiben dran. Bei Punkt 12 gehe ich von
breiter Zustimmung aus. (Beifall bei Grünen und ÖVP.)
Ich muss auch zu Punkt 13
und zu Kollegen Schmid etwas sagen, und zwar: Ich schätze die Expertise
und ich habe heute sehr viel oder zumindest einiges erfahren, was mir
zuvor in dieser epischen Breite nicht bekannt gewesen ist. Aufgefallen ist mir
und irritiert hat mich allerdings Folgendes: Warum sollten Menschen
aus Drittstaaten diese wichtige und wertvolle Arbeit nicht auch ausführen
können? Ich habe da immer so ein bisschen im Hinterkopf gehabt: Die werden
das nicht können! Warum sollen die das nicht können? (Zwischenruf
bei der FPÖ.) Wir sind alle Menschen, und ich glaube, dass es
nach entsprechender Ausbildung jedem Menschen möglich ist, Berufe auch
auszuüben. (Beifall bei Grünen und ÖVP.)
Vielleicht noch ganz kurz etwas aus der Praxis: Wie Sie
wissen, stamme
ich aus der Atterseeregion. Am 10.12. hat es österreichweit einen Fahrplanwechsel
gegeben, und bei mir in der Region hat sich das Angebot im öffentlichem
Verkehr erheblich verbessert. Das ist tatsächlich das, was wir wollen und
was wir auch brauchen. Nach der Einführung des Klimatickets wird
jetzt sukzessive und sehr intensiv am Ausbau des öffentlichen Verkehrs gearbeitet.
Was uns dazu fehlt, sind tatsächlich Arbeitskräfte,
insbesondere – das
fällt mir in meiner Region immer wieder auf – Busfahrerinnen
und Busfahrer, die sicherstellen, dass die Linie 565 tatsächlich in
guter Taktung von Seewalchen nach Vöcklabruck fährt.
Kollegin Eder-Gitschthaler hat
es schon angesprochen: Auch im Sinne der Schülerfreifahrt ist es
wichtig, in dieser Situation mehr Personal zu bekommen.
Bei mir in der Gemeinde ist es nämlich tatsächlich so, dass gewisse
Schulkinder schon um 6.30 Uhr abgeholt werden, damit sie dann um
7.45 Uhr mit der
Schule beginnen können, weil keine Möglichkeit besteht, zwei Busse
loszuschicken. – Busse wären vorhanden, aber es fehlen
Buslenker:innen. Ich glaube, das sollte für uns alle ein
Ansporn sein, diese Situation zu verbessern, und zwar mit verschiedenen
Mitteln – wobei ich überhaupt nicht abstreite,
dass die Arbeitsbedingungen sich verbessern müssen. (Beifall bei
Grünen und ÖVP.)
Was wir heute beschließen, ist natürlich kein Allheilmittel, aber es ist ein wichtiger Schritt. Deshalb ersuche ich auch bei diesem Punkt um Zustimmung. – Danke. (Beifall bei Grünen und ÖVP.)
16.46
Vizepräsidentin Doris Hahn, MEd MA: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Doch, Bundesrat Steiner hat sich
ein weiteres Mal zu Wort gemeldet. –
Bitte.
Bundesrat Christoph Steiner (FPÖ,
Tirol): Frau Vizepräsident!
Normalerweise rücke ich nicht zur Verteidigung der Sozialisten aus, aber
weil es ein Tiroler war: Herr Kollege Schmid, das passt. Du hast
da schon recht, auch wenn die grüne Fraktion das jetzt kritisiert hat. Man
muss sich einmal anschauen,
was da wirklich passiert. Du hast gefragt, wie es wohl wäre, wenn der
Busfahrer etwa aus Dschibuti käme; ich weite es ein bisschen aus: Wie
wäre es,
wenn der Taxifahrer im Zillertal aus Dschibuti kommt? – Da schaue
ich mir an, wie er das macht, wie er das schafft, wenn er Mitte Dezember oder
im
Jänner mit den Schneeketten und so weiter auf den Berg hinauffahren muss.
Das wird ein enormes Problem, glaubt mir das. (Zwischenrufe bei SPÖ
und Grünen.) – Ihr könnt euch jetzt wieder künstlich aufregen, aber ihr verschließt einfach die Augen vor der Realität: Das wird nicht funktionieren! (Beifall bei der FPÖ.)
Jetzt weitet man die Rot-Weiß-Rot-Karte aus und sagt, Deutsch ist
auch
keine Verpflichtung mehr, nur noch Englisch. Das will ich mir dann
anschauen, wie man sich dann austauscht. Das wird ein Riesenproblem. Ihr packt
das Problem nicht an der Wurzel, wie der Kollege von den Sozialisten gesagt
hat, und da hat er recht.
Ich hätte dir am Schluss
auch noch applaudiert, Kollege Schmid, wenn du
am Schluss nicht gesagt hättest: Deswegen wäre es super, wenn wieder ein Verkehrsminister
von den Sozis kommen würde. Da kann ich dir natürlich nicht
beipflichten, denn das wäre furchtbar fürs Land. Ansonsten hast du
mit deiner Rede komplett recht gehabt: Das wird ein Problem werden.
Da die Kollegin von den
Grünen vorhin gesagt hat – und deswegen bin ich eigentlich
rausgegangen –, dass in ihrer Region die Taktung so toll ist: Ich
bin aus Tirol. Bei uns im Bezirk Schwaz gibt es den Bahnhof Jenbach. Ich bin
seit 2018 im Bundesrat. Bis vor einem Dreivierteljahr bin ich zu jeder
Sitzung mit den ÖBB nach Wien gefahren. Seit einem Dreivierteljahr muss
ich aber leider – und das ist weit nicht so gfierig und
auch nicht stressfrei und unkompliziert – aufs Auto umsteigen.
Angefangen hat die ganze
Geschichte im deutschen Eck mit Ausfällen, Umbauten und so weiter,
das wissen wir eh alles – kein Problem. Jetzt aber, da
es übers deutsche Eck wieder geht, haben wir das Problem – die
Tiroler Kollegen werden mir beipflichten können –, dass der Zug
aus Wien in Jenbach
nur noch viermal am Tag Halt macht, und das war’s. (Bundesrat Gross:
Fährst
halt nach Wörgl!)
Wo soll ich hinfahren? (Bundesrates
Gross: Nach Wörgl zum Beispiel!) – Ach
so! Das heißt, ich fahre mit dem Auto quer durch Tirol, damit ich dann
zum nächsten Bahnhof komme. (Bundesrat Schreuder: Mit der
S-Bahn! – Weitere
Zwischenrufe bei den Grünen.) Das ist also der Zugang des Klimahysterikers Adi Gross, dass Christoph Steiner mit dem Auto durch halb Tirol fahren muss, um zu einem Bahnhof zu kommen. Gratuliere! (Beifall bei der FPÖ.)
Genau das ist die
verrückte Klimapolitik der hysterischen Grünen. Genau das bringt uns
auch dazu, dass man glaubt, man muss, wenn kein Wind geht,
Frau Kollegin von den Grünen, ein Windrad mit elektrischem Strom
betreiben. Genau das bringt uns dorthin, wo wir sind. (Beifall bei der FPÖ.)
Genau das hat uns diese Ideologie der
Grünen, der völlig verqueren Grünen, und auch diese –
wie soll man sagen?, wie heißt das Ministerium?, es hat ja einen ewig
langen Namen –, sagen wir, Klimaministerin eingebrockt. Wir sind so
froh, dass es spätestens in nicht einmal einem Jahr mit diesem Schrecken
vorbei sein wird. (Beifall bei der
FPÖ. – Bundesrat Schreuder – in Richtung
Vizepräsidentin Hahn –: Hysterisch darf man sagen, aber
schizophren nicht?)
16.50
Vizepräsidentin Doris Hahn, MEd MA: Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist somit geschlossen. (Bundesrat Schreuder: Hysterisch darf man sagen, aber schizophren nicht?)
Wir kommen somit zur Abstimmung,
die über die gegenständlichen Tagesordnungspunkte getrennt
erfolgt. (Rufe und Gegenrufe zwischen Bundesrat
Schreuder und Bundesrät:innen der SPÖ.) – Ich
darf um Ruhe bitten.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 und weitere Gesetze geändert werden.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte,
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des
Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das
ist die Stimmeneinhelligkeit, der
Antrag ist somit angenommen.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Ausländerbeschäftigungsgesetz und das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz geändert werden.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist somit angenommen.
Es liegt ein Antrag der Bundesräte Günter Pröller, Kolleginnen und Kollegen auf Fassung einer Entschließung betreffend „Schluss mit der unqualifizierten Zuwanderung in unser Arbeitsmarktbudget“ vor.
Ich lasse über diesen Entschließungsantrag
abstimmen und ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem
Entschließungsantrag zustimmen, ebenfalls um ein
Handzeichen. – Dies ist die Stimmenminderheit. Der Antrag auf Fassung
der gegenständlichen Entschließung ist somit
abgelehnt.
Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem zur Linderung der Inflationsfolgen bei den Wohnkosten das Mietrechtsgesetz, das Richtwertgesetz und das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz geändert werden (3. Mietrechtliches Inflationslinderungsgesetz – 3. MILG) (3558/A und 2398 d.B. sowie 11394/BR d.B.)
Vizepräsidentin Doris Hahn, MEd MA: Wir gelangen somit zum 14. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatterin hierzu ist Frau Bundesrätin Viktoria
Hutter. – Ich bitte
um den
Bericht.
Berichterstatterin Viktoria Hutter: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf Ihnen den Bericht des Justizausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem zur Linderung der Inflationsfolgen bei den Wohnkosten das Mietrechtsgesetz, das Richtwertgesetz und das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz geändert werden, 3. Mietrechtliches Inflationslinderungsgesetz, zur Kenntnis bringen.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme
daher gleich
zur Antragstellung:
Der Justizausschuss stellt nach Beratung der Vorlage mehrstimmig den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsidentin Doris Hahn, MEd MA: Vielen Dank für den Bericht.
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist als Erste Frau Bundesrätin Korinna Schumann. – Bitte, Frau Bundesrätin.
Bundesrätin Korinna Schumann (SPÖ, Wien): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Frau Bundesministerin! Werte Frau Staatssekretärin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuseherinnen und Zuseher! Jetzt ist es da, das Mietpreisbremserl. Eine Bremse ist es nicht geworden, es ist ein Bremserl geworden und – ganz ehrlich – dazu, es auch noch als Inflationslinderungsgesetz zu betiteln, muss man schon wahrlich Mut haben, und den haben Sie. Es wäre gescheiter gewesen, Sie hätten kein kleines Bremserl und keine Schmähpartie gemacht, sondern eine wirkliche Mietpreisbremse, denn eine solche brauchen die Menschen in diesem Land. (Beifall bei der SPÖ.)
Die Inflation ist ein riesiges Problem, und ich verstehe nicht, wie eine Wirtschaftspartei wie die ÖVP diese schwer belastende Inflation und eine Inflation,
die nicht schnell genug zurückgeht, nicht
als Problematik sehen kann.
Also das ist für mich wirklich unverständlich. Sie ist eine
Problematik und sie ist eine große Problematik für die Menschen,
weil die Preise nicht hinuntergehen, sondern nur ein bisschen mehr
höher werden. Es ist eine riesige Problematik für den
Wirtschaftsstandort und für die Konkurrenzfähigkeit unseres Landes.
Die Inflationshöhe, auf der wir uns befinden und die zu senken Sie nicht
geschafft haben, ist ein Problem für dieses Land. Es gehört auch
sehr viel Mut dazu, das kleinzureden, und den haben Sie anscheinend. (Beifall
bei der SPÖ.)
Vor 14 Tagen haben wir eine Dringliche genau zu diesem Thema Mietpreisbremse gemacht, die wir so dringend fordern, schon so lange dringend fordern, weil wir wissen, dass die hohen Mieterhöhungen, die 2022 und 2023 die Menschen getroffen haben, für diese eine unglaubliche Belastung sind. Wohnen in Miete wird für die Menschen immer teurer, und das ist eine schwere Last. Wir haben damals schon gesagt: Bitte macht etwas! Setzt die Mieten herunter! Greift in den Markt ein! Das ist jetzt ganz, ganz wichtig.
Sie haben nichts getan. Im
Gegenteil, Sie haben es durchlaufen lassen. Sie haben die Mieterhöhungen durchlaufen lassen, und das bedeutet für
die Menschen extreme Belastungen. Dann kam die Ankündigung, in
diesem Sommer kam die Ankündigung: Wir machen eine
Mietpreisbremse! – Wir haben uns alle gedacht: Endlich!
Jetzt haben sie erkannt, was alle wissen: Die Mietpreisbremse wäre
inflationssenkend, wäre wichtig für die Menschen. Was aber ist
herausgekommen? – Dieses kleine Bremserl. Es ist zu spät, es
ist nicht rückwirkend, sodass die Menschen nicht rückwirkend
entlastet werden. Bei
einer Höhe von 5 Prozent den Deckel einzuziehen, das ist wirklich
eine besondere Chuzpe, denn ganz ehrlich: Die Inflation geht hoffentlich
hinunter,
und dann wird das nicht einmal greifen. Der Deckel liegt viel zu hoch, das ist
ganz eindeutig klar.
Wo Sie hingreifen, das ist bei den niedrigen Mieten. Im sozialen Wohnbau, im geförderten Wohnbau, da machen wir den Deckel fest, aber bei den freien Mieten ist nichts gewesen, da machen wir keinen Deckel hinein, denn da müssen wir ja die Gewinne durchlaufen lassen; da greifen wir nicht hin.
Das ist nicht fair! Denn da gibt es
400 000 Menschen, die auch ganz dringend einen Mietpreisdeckel und
einen Stopp der Mieten brauchen, weil sie
nicht mehr wissen, wie sie das alles bezahlen sollen. Das ist Ihnen aber
völlig egal. Ganz ehrlich, es muss schon klar sein: Wenn die
Immobilienwirtschaft sich über ein
Inflationslinderungsgesetz oder Mietpreisdeckerl nicht aufregt, dann weiß
man: Sie haben nicht wehgetan, Sie haben jenen
nicht wehgetan, die mit Immobilien Gewinne machen. Denen haben Sie nicht
wehgetan. Die ÖVP ist die Hausherrenpartei und bleibt es, auch dieser
Mietpreisdeckel zeigt es wieder. Und die Grünen machen mit. (Beifall bei der SPÖ.)
Was mich besonders getroffen hat, ist, dass jene Politikerin
von den Grünen, die ich sehr
schätze, Kollegin Tomaselli – das ist wirklich eine gescheite
Frau –,
gesagt hat: Mit der SPÖ wäre das nicht gegangen, wir wollten in die
freien Mieten eingreifen, aber die SPÖ hat nicht die Zustimmung
für eine Verfassungsmehrheit gegeben! – Das ist eine reine
Unwahrheit! In keiner der Versionen, die vorgelegt worden sind, war jemals
vorgesehen, dass man in die freien Mieten eingreift. Das ist nicht fair! (Beifall bei der SPÖ.)
Ganz ehrlich: Ich wünsche, dass Sie besonders in jenen Wiener Bezirken, in denen die Grünen sehr stark sind, dann den Menschen auch sagen: Sie wollten nicht bei den freien Mieten eingreifen, Sie wollen, dass die Mieten explodieren! Das ist Ihr Wunsch, und das müssen Sie den Menschen dann aber auch eindeutig und ganz klar sagen. Wir werden das auch tun; auch das ist selbstverständlich. (Beifall bei der SPÖ.)
Jetzt würde ich Sie bitten: Nehmen Sie allen Mut zusammen und entlasten Sie die Menschen und gehen Sie mit unserem Entschließungsantrag mit!
Entschließungsantrag
der Bundesrät:innen Korinna Schumann, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Mietpreisstopp im freien Wohnungsmarkt“
Die unterzeichneten
Bundesrätinnen und Bundesräte stellen folgenden
Antrag:
Der Bundesrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung, insbesondere die Bundesministerin für Justiz, wird aufgefordert den eigenen Ankündigungen Taten folgen zu lassen und dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, die eine gesetzliche Begrenzung der Mietsteigerungen im sogenannten freien, nicht preisregulierten Wohnungsmarkt (Neubau) vorsieht."
*****
Das wäre es! Das wäre
der Antrag, dem Sie jetzt zustimmen können, womit Sie jenen Menschen, die jetzt am freien Mietmarkt
größte Probleme mit ihren Mieten haben, wirklich helfen
könnten. Wir werden sehen, wie Sie abstimmen werden. Im Nationalrat war es
eindeutig: Sie haben dagegen gestimmt.
Das werden wir aber den Menschen erzählen, denn es ist Tatsache.
Ganz ehrlich: Sie haben auch in
das Mietrecht nicht eingegriffen – das wäre so wichtig. Jede
dritte Miete ist bereits keine unbefristete mehr, sondern
eine befristete. Das heißt, wesentlich teurer und für die Menschen
eine riesige Belastung, weil Befristungen auslaufen, sie dann die Verträge
wieder erneuern müssen und sich dann die Mietpreise wieder
erhöhen.
Ganz ehrlich gesagt: Wir fordern, dass die Mieten bis 2025
eingefroren werden. Wir fordern einen Mietpreisdeckel für alle Mieten und
wir fordern, dass
sich der Deckel dem EZB-Leitzinssatz anpasst und höchstens 2 Prozent
beträgt. So schaut es aus, weil: Wohnen ist ein Menschenrecht, und die
Menschen
dürfen sich nicht fürchten davor, dass sie ihre Wohnung
verlieren, weil sie sich die Mieten nicht mehr leisten können. So kann man
mit den Menschen
nicht umgehen. Genieren Sie sich für dieses Mietpreisdeckerl und legen Sie
endlich etwas vor, das die Menschen wirklich entlastet! (Beifall
bei
der SPÖ.)
17.00
Vizepräsidentin Doris Hahn, MEd MA: Der von den Bundesräten Korinna Schumann, Kolleginnen und Kollegen eingebrachte Entschließungsantrag betreffend „Mietpreisstopp im freien Wohnungsmarkt“ ist genügend unterstützt und steht demnach mit in Verhandlung.
Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin MMag.a Elisabeth Kittl. – Bitte schön.
Bundesrätin MMag. Elisabeth Kittl, BA
(Grüne, Wien): Frau
Präsidentin! Sehr geehrte Staatssekretärin! Liebe Frau Ministerin! (Die
Bundesrät:innen
der SPÖ halten Tafeln mit den Aufschriften „Mietpreisstopp statt
PR-Schmäh!“ und „Runter mit den Wohnkosten!“ in die
Höhe.) Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Besucher:innen
hier und liebe Zuseher:innen vor den Bildschirmen! Wir beschließen heute für drei Viertel aller Mietwohnungen in
Österreich –
das sind etwa 2,5 Millionen Menschen – einen
Mietpreiserhöhungsstopp für 2024 und eine maximale Erhöhung von
5 Prozent für 2025. (Beifall bei
den Grünen und bei Bundesrät:innen der ÖVP.)
Wir
beschließen mit diesem Gesetz eine langfristige Vorhersehbarkeit
inflationsbedingter Erhöhungen. Das ist kein Bremserl, das ist keine
Schmähpartie,
und wenn Sie das sagen, liebe SPÖ, dann ist das eine Verhöhnung jener Menschen,
die um jeden Euro im Monat kämpfen. (Beifall bei den Grünen und
bei Bundesrät:innen der ÖVP. – Bundesrätin Schumann:
Geh bitte! – Ruf bei
der SPÖ: Hahahaha!)
Worum geht es
konkret? – Es werden die inflationsbedingten Erhöhungen der Kategoriemieten und der Richtwertmieten sowie der
gemeinnützigen Wohnungsmieten ausgesetzt und gedeckelt.
Zusätzlich werden die Erhöhungen von Kategorie- und Richtwertmieten zeitlich gleichgestellt. Das heißt,
die Kategoriemieten wurden bisher mehrmals im Jahr erhöht,
wenn sie die 5-Prozent-Hürde überschritten haben, und die
Richtwertmieten alle zwei Jahre.
Beide wie auch die gemeinnützigen Mieten können ab nun nur einmal im
Jahr erhöht werden, was einerseits der Übersichtlichkeit dient und
andererseits einen sogenannten Glättungseffekt gegen zu
sprunghafte oder zu häufige Mieterhöhungen hat. Beide aber,
Kategorie- und Richtwertmieten, dürfen
erst 2025 wieder erhöht werden. (Beifall bei den Grünen.)
Eigentlich müssten die Inflationswerte aus 2023 für die Mieterhöhung 2024 herangezogen werden. Damit würden die Mieten um knapp 10 Prozent erhöht werden. Sie werden aber um 0 Prozent erhöht. Sie werden um 0 Prozent erhöht, sie werden eingefroren. (Beifall bei den Grünen und bei Bundesrät:innen der ÖVP. – Bundesrätin Schumann: Immobilientreuhänder!)
SPÖ und
FPÖ stimmen dieser Erleichterung, einer Nullerhöhung 2024, nicht zu.
Das sind beide Parteien – und da können Sie Ihre Taferln noch
so hoch
halten –, Sie sind angeblich die Parteien, die Menschen vertreten,
die nicht mit Vermögen oder hohem Einkommen gesegnet sind, aber heute und
hier
vertreten Sie sie nicht. (Beifall bei den Grünen und bei
Bundesrät:innen der ÖVP.)
Die Mieten dürfen erst 2025 und 2026
wieder erhöht werden, sie steigen
aber nur gedeckelt, und zwar gedeckelt mit der Basis der Inflation von 2023 und
2024 im Vergleich. Das ist auch wichtig zu sagen, denn früher hätte
man
mit dem VPI 2000 sehr kompliziert erhöhen müssen. Diese
Berechnungsmethode wird jetzt nicht mehr angewendet, weil es eine immense
Mieterhöhung
wäre, sondern die Erhöhung wird nun mit 5 Prozent gedeckelt. Das
ist eine kluge und vereinfachte neue Regelung. (Beifall bei Grünen und
ÖVP. – Heiterkeit
bei der SPÖ.)
Bei den gemeinnützigen Wohnungen steht die nächste
Erhöhung 2024 ins Haus. Diese wird mit etwa 16 Prozent erwartet. Sie
wird aber mit 5 Prozent gedeckelt, also
mehr als 10 Prozent weniger betragen, und das ist eine signifikante
Entlastung für mehr als eine Million Menschen – und Sie stimmen
dem
nicht zu! (Beifall bei Grünen und ÖVP. –
Bundesrat Himmer: Die soziale Kälte
der SPÖ!)
Zum Argument und zu der Drohung, die
gemeinnützigen Wohnbauvereinigungen können nun nichts mehr
bauen, weil ihnen die Einnahmen fehlen: Wir
haben gestern im Ausschuss gehört, dass die Gemeinnützigen sehr
kapitalstark sind und dass ihnen sehr wohl Geld zur Verfügung steht, um
neu zu bauen
und wieder zu investieren. Ich frage mich: Was soll diese Angstmache?
Sie wissen genauso, zumindest hoffe ich das, dass wir mit dem Zukunftsfonds genau da einen Schwerpunkt setzen, damit nämlich sozialer und ökologischer Wohnbau gefördert wird: mit 1,5 Milliarden Euro die nächsten fünf Jahre. (Beifall bei Grünen und ÖVP.)
Damit wird die Bauwirtschaft, vor allem die
Bauwirtschaft im gemeinnützigen Bereich, angeregt und es wird leistbarer
Wohnraum geschaffen. Das ist
super, ganz einfach! (Beifall bei Grünen und ÖVP. –
Bundesrätin Schumann: Na dann!)
Zusätzlich schaffen mehr Genossenschafts- und Gemeindebauwohnungen, die gebaut werden, ein weiteres Angebot. Auch das ist eine preisdämpfende Maßnahme am Mietenmarkt und damit natürlich auch inflationsdämpfend.
Zudem dienen die Indexierungsgrenzen, die wir ab 2027 langfristig einsetzen, der Planungssicherheit und der Vorhersehbarkeit im Bau- und Wohnsektor, und das sind wichtige Bedingungen für ein kluges Investment.
Insgesamt sind nun
in ganz Österreich 2,5 Millionen Menschen von dieser Mietendeckelung
betroffen, sie sparen sich bis zu einer Monatsmiete pro Jahr, und das ist gut
und richtig. Es bleibt mir hier leider nichts anderes übrig,
als wieder darauf hinzuweisen – und ich wiederhole mich schon wie
bei der letzten Sitzung –, dass Sie immer nur auf die Regierung
bashen (Oh-Rufe bei
der SPÖ) und immer wieder sagen, es passiere nichts, aber
komischerweise wurde der Mietpreisdeckel vom Bund im Sommer
angekündigt, von Wien
wurde er für den Gemeindebau im Herbst angekündigt und kommt erst
2024; er betrifft auch 400 000 Menschen. (Beifall bei Grünen
und ÖVP.)
Dieser langfristige Mietpreisdeckel ist aber nicht die einzige wohnpolitische Maßnahme. Sie wissen, wir haben auch die unfairen Makler:innengebühren für die Mieter:innen abgeschafft. – Das hätten auch Sie alles machen können, aber jetzt wurde es von unserer Regierung gemacht. Die potenziellen Mieter:innen sparen sich bis zu zwei Monatsmieten bei der Suche einer Wohnung. (Beifall bei Grünen und ÖVP.)
Der mit
140 Millionen Euro dotierte Wohnschirm half bisher schon Tausenden Menschen, die mit ihrer Miet- und Energierechnung
in Rückstand geraten
sind – genauso wie der mit
675 Millionen Euro dotierte erhöhte Wohn- und
Heizkostenzuschuss Zigtausend Menschen unter die Arme greift. Beides
sind extrem treffsichere Maßnahmen. (Beifall bei Grünen und
ÖVP.)
Und ein wichtiger Maßnahmenmix: Dazu gehört auch eine verlängerte Strompreisbremse und die Senkung der Elektrizitäts- und Erdgasabgabe um 90 Prozent, sie erspart den Menschen ebenso viele Hunderte Euro im Jahr.
Nur diesen Mietpreisdeckel zu betrachten und
zu kritisieren ist äußerst kurzsichtig, denn diese Maßnahme
stellt nur einen kleinen Bruchteil der vielen Maßnahmen der Regierung
dar, um die Inflation zu dämpfen und die Kaufkraft zu
stärken. Es geht nämlich genau um diesen Maßnahmenmix, und ich
sage: Ja, dieser Maßnahmenmix kann sich sehen lassen, und daher ersuche
ich
Sie alle eindringlich, dem 3. Mietrechtlichen Inflationslinderungsgesetz
zuzustimmen. Jetzt haben Sie noch die Chance, den Menschen ein
entlastendes Weihnachtsgeschenk zu machen. – Danke. (Beifall bei
Grünen und ÖVP. – Zwischenrufe bei der SPÖ.)
17.08
Vizepräsidentin Doris Hahn, MEd MA: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky. – Bitte schön.
Bundesrat MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky
(NEOS, Wien): Frau Präsidentin!
Sehr geehrte Frau Bundesministerin! Sehr geehrte Frau Staatssekretärin!
Werte Kolleginnen und Kollegen! Ich muss gleich einmal damit anfangen, dass der
Kurztitel des Gesetzes ein bisschen ein Etikettenschwindel ist. Wie
man aus dem Langtitel ersieht, geht es natürlich nicht um eine
Inflationslinderung, weil durch diese Beschränkungen der
Wertsicherung die Inflation
so gut wie gar nicht tangiert wird. Gemeint ist natürlich eine Linderung
der Folgen der Inflation, die sich in einer Wertsicherung auswirken
würde.
Genauso, wenn da ab und zu von
Mietpreisdeckeln gesprochen wird, in dem Fall nicht so sehr in dem
Gesetz - - (Bundesrat Himmer: Wenn die Preise für Mieten runtergehen,
geht auch die Inflation runter!) – Nicht wirklich. Das
schlägt sich höchstens nach der Kommastelle nieder, sodass man es
nicht wirklich
merkt. (Bundesrat Himmer: Nach der Kommastelle? Man muss immer nach
der Kommastelle auch schauen!) – Auch den Zwischenruf des
Kollegen Himmer, den
man sonst nicht im Protokoll finden würde.
Wenn die ganze Zeit ein
Mietpreisdeckel gefordert wird: Den Deckel gibt es ja schon. Die regulierten
Mieten sind ein Mietpreisdeckel. Es geht dann
nur – quantitativ – um die Höhe dieses Deckels. Dann
aber davor einen Mietpreisdeckel einzuführen ist die Forderung nach
etwas, das es schon seit Jahrzehnten gibt.
Zum konkreten Gesetzesvorschlag – ich beginne mit dem Positiven; wir sehen mehr als eine sinnvolle Maßnahme in diesem Vorschlag –:
Erstens die Harmonisierung der Wertsicherungsberechnung bei den Richtwertmieten oder eigentlich bei den mietrechtlichen Richtwerten, bei den Kategoriemieten und im gemeinnützigen Bereich: Das halten wir für sehr sinnvoll.
Zweitens die Umstellung der
Wertsicherungsberechnung auf ein System,
bei dem die Durchschnittsinflation der letzten drei Jahre herangezogen
wird – was dann ab 2027 gelten wird –, um Spitzen zu
glätten und zu verhindern,
dass es dann, falls die Inflation in einem Jahr höher ist, in einem Jahr
auch bei den Wertsicherungen Ausreißer gibt: Das halten wir für
sinnvoll.
Darüber hinaus ist der
Vorschlag aber aus unserer Sicht unzureichend. Dieser Gesetzesvorschlag ist
symptomatisch für das Prinzip, das in der Politik der
türkis-grünen Regierung verfolgt wird. Erst wird man sich lange Zeit
koalitionsintern gar nicht einig, dann wird ein Vorschlag
präsentiert, für den ÖVP und
Grüne aber noch andere Parteien brauchen, damit er beschlossen wird, er
wird aber schon als Beschluss, als Erfolg kommuniziert und dann scheitern aber
die Verhandlungen.
Der Vorschlag, der jetzt am
Tisch liegt, beinhaltet aus unserer Sicht
drei wesentliche Probleme:
Er hilft nicht den Richtigen,
weil er ausschließlich in Sektoren eingreift, die bereits streng
reguliert sind und im Verhältnis deutlich niedrigere
Mieten aufweisen. Die Schere zwischen dem regulierten und dem unregulierten
Wohnungsmarkt geht so noch weiter auf. Die wirksamste Art der Mietenbremse, die
du (in Richtung Bundesrat Himmer) vorhin angesprochen hast, wäre
eine vernünftige Inflationsbekämpfung gewesen. Die Politik der Regierungsparteien
hat das aber in Österreich verabsäumt. Österreich hatte 2022 die
höchste Energieinflation in Westeuropa und hat jetzt die höchste
Mieteninflation in Westeuropa – das sind auch
Zweitrundeneffekte. (Beifall
bei Bundesrät:innen der SPÖ.)
Zweitens ist zu
befürchten, dass diese Regelung das Wohnungsangebot in den reglementierten
Sektoren nur noch weiter verknappt, was die Preise im
freien Sektor weiter in die Höhe treiben kann.
Drittens wird, anstatt Anreize
zu setzen, gerade im Altbau zu sanieren, wo sich die regulierten Mieten
befinden, den KMU-Vermieterinnen
und -Vermietern – nicht den großen Konzernen! –
durch diese Regelung finanzieller Spielraum genommen, gerade jetzt, da
thermische Sanierungen und nachhaltiger Heizungstausch extrem wichtig
wären. (Zwischenruf bei
der ÖVP.)
Was wir von den NEOS wollen:
Die Regierung hatte sich für diese Gesetzgebungsperiode zu Recht
vorgenommen, eine umfassende Reform des Wohnrechts zu verabschieden. Dazu
braucht es aber statt der Einzelmaßnahmen, die erst recht in
Bereichen zum Einsatz kommen, die bereits jetzt
stark regulierte Mieten haben, auch Förderprogramme, die künftig
treffsicher gestaltet werden und nicht diejenigen fördern, die bereits im
regulierten
Sektor verhältnismäßig niedrigere Mieten haben.
Es braucht außerdem mehr
Anreize, damit die Vermieterinnen und Vermieter Mieteinkünfte in
Sanierungen und Heizungstausch investieren. Die Vermieterinnen und
Vermieter haben ja nichts davon, wenn die Mieterinnen und Mieter niedrigere
Heizungskosten haben, aber wir als Österreich hätten
etwas davon, etwa durch eine Ökologisierung der Mietzinsberechnung. Wie
sage ich jetzt dazu? Es ist nicht nur die Energieeffizienz der Wohnung, sondern
auch der Heizwärmebedarf der Wohnung, der einen Unterschied dafür
machen kann, welche Miete verlangt werden kann – also eine
Ökologisierung der Mietzinsberechnung.
Wenn die Regierung wirklich die Kaufkraft der Menschen in Österreich sichern möchte, dann muss sie in Wirklichkeit die Steuern senken und die Einkommen entlasten. – Vielen Dank. (Beifall bei Bundesrät:innen der SPÖ.)
17.14
Vizepräsidentin Doris Hahn, MEd MA: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Sandra Lassnig. – Bitte schön. (Zwischenruf des Bundesrates Schennach.)
17.14
Bundesrätin
Sandra Lassnig (ÖVP, Kärnten):
Frau Vizepräsidentin! Die Taferl vermisse ich noch, sie wurden nur bei
einer Rede verwendet. (Zwischenruf des Bundesrates Schennach.)
Das hätte sich ja fast gar nicht ausgezahlt – so ein
großer Aufwand. (Beifall bei der ÖVP sowie der Bundesrätin Hauschildt-Buschberger. –
Bundesrat Mertel hält eine Tafel mit der Aufschrift „Runter
mit den Wohnkosten!“ in die Höhe. – Bundesrätin Schumann:
... Bundesrätin und
basht hin permanent! – Bundesrat Schennach: Kärntnerinnen
zeigen ja keine Taferl! – Weitere Zwischenrufe bei der
SPÖ.)
Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin! Frau Ministerin!
Frau Staatssekretärin! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen
hier im Bundesrat! Liebe Zuhörer und Zuseher! Ich darf und muss meiner Kollegin
Kittl wirklich recht geben (Rufe
bei der SPÖ: Ja! Ja genau!): Ihr hättet immer die
Möglichkeit gehabt und habt sie auch heute noch, dieser Entlastung der
Österreicher und Österreicherinnen zuzustimmen. (Beifall
bei der ÖVP und bei Bundesrät:innen der Grünen. –
Zwischenruf der Bundesrätin Schumann.)
Wir, die Bundesregierung, haben in den letzten Jahren und
Monaten auf Hochtouren gearbeitet (Bundesrätin Schumann: „Wir,
die Bundesregierung“?!), um den Österreicherinnen und
Österreichern zu helfen, sie zu entlasten, sie steuerlich zu
unterstützen, und auch, um die Inflation zu bekämpfen. (Bundesrätin
Schumann: Ja, das haben wir gemerkt!) Dass diese Maßnahmen und
Direktzahlungen gewirkt haben (Ruf bei der SPÖ: Ja genau!), sehr
geehrte Damen und Herren, zeigen die Zahlen. (Ruf bei der SPÖ: Ja
genau!) Die Inflation ist gesunken (Heiterkeit und Zwischenrufe bei der
SPÖ) und die Kaufkraft ist gestiegen, und das hat heute auch
unser Finanzminister schon erwähnt. (Beifall
bei der ÖVP. – Bundesrat Schennach: ... Villacher
Fasching!)
Auch ein aktueller Bericht des
Budgetdienstes zeigt, dass die Menschen mit geringem Einkommen von den
Maßnahmen profitieren (Bundesrätin Schumann: Wer
hat Ihnen das geschrieben, Frau Bundesrätin?!), und auch, dass die
Haushaltseinkommen höher sind. Kollegin Kittl hat das heute inhaltlich
schon sehr gut ausgeführt. Die Mieterhöhungen werden 2024, 2025 und
2026 auf 5 Prozent begrenzt. (Rufe bei der SPÖ: Danke, danke,
danke!) Das betrifft ungefähr 1,2 Millionen
Mietwohnungen mit Richtwert und Kategoriemieten sowie auch
Genossenschaftswohnungen im gemeinnützigen Bereich, sehr geehrte
Damen und Herren, und damit rund 2,5 Millionen Mieterinnen und Mieter
in Österreich. (Beifall bei ÖVP und Grünen. – Rufe
bei der SPÖ: Danke,
danke, danke!) – Gerne. (Bundesrat Schennach: Ganz
Österreich schreit Danke! – Bundesrätin Schumann:
Genau!)
Mit diesen Regelungen schaffen
wir eine weitere Entlastung. Im Hinblick
auf die Gehalts- und Lohnerhöhungen und auch auf die Pensionsanpassung ist
das 3. Mietrechtliche Inflationslinderungsgesetz ausgewogen und bringt
für die Menschen mehr Planbarkeit, auch mehr Rechtssicherheit und eine
weitere Entlastung. (Bundesrätin Schumann: Im Hinblick auf
die Lohnerhöhungen?!
Das ist mir neu!)
Sehr geehrte Damen und Herren, die Regierung setzt den Weg der Entlastungen in schwierigen Zeiten konsequent fort. (Bundesrätin Schumann: ... eine Lohnerhöhung kriegen, ja genau!) Ich habe es hier schon mehrmals gesagt und ich sage es auch immer wieder gerne: Wir sind und bleiben der starke Partner (Bundesrätin Schumann: Für die Hausherren!) der Bevölkerung im Kampf gegen die Teuerung und für Entlastung. (Beifall bei ÖVP und Grünen. – Zwischenrufe bei der SPÖ.)
So wie es vorhin Kollegin Gerdenitsch gesagt hat: Weihnachten steht kurz vor der Türe. (Ruf bei der SPÖ: Danke! Hat das auch die Bundesregierung gemacht?) Macht, Kolleginnen und Kollegen der SPÖ und vielleicht auch von FPÖ und NEOS, vielleicht doch noch eine gute Tat und stimmt dieser Entlastung (Heiterkeit und Zwischenrufe bei der SPÖ) für die Österreicher und Österreicherinnen zu! – Danke. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
17.17
Vizepräsidentin
Doris Hahn, MEd MA: Eine weitere Wortmeldung liegt von Herrn
Bundesrat Mag. Sascha Obrecht vor. – Bitte schön. (Ah-Rufe
von ÖVP und FPÖ in Richtung des
sich mit einer Tafel zum Redner:innenpult begebenden Bundesrates
Obrecht. – Beifall bei der SPÖ. – Heiterkeit und
Zwischenrufe bei
der ÖVP.)
Bundesrat
Mag. Sascha Obrecht (SPÖ, Wien):
Frau Präsidentin! Werte Frau Ministerin! Werte Frau Staatssekretärin!
Sehr geehrte Damen und Herren! (Der Redner stellt eine Tafel
mit der Aufschrift „Mietpreisstopp
statt PR-Schmäh!“ auf das Redner:innenpult.) Es ist ja nach dem
Schild gefragt worden, also kommt es natürlich auch, Frau Kollegin
Lassnig. (Beifall bei
der SPÖ. – Heiterkeit bei Bundesrät:innen der ÖVP.)
Ich darf das sagen: Sie waren bei einer Weltpremiere dabei.
Das war die erste Folge der Parlamentsserie Kittls Märchenstunde oder Bei
Kittl und Lassnig, auch ein sehr beliebtes Format. (Heiterkeit
und Beifall bei der
SPÖ. – Zwischenruf bei den Grünen.) Viel mehr als eine
Märchenstunde,
als ein PR-Schmäh war das aber nicht.
Ich komme gleich darauf zu sprechen. – Ich habe
nur bei meinen letzten Reden mehrfach darauf
vergessen, Entschließungsanträge einzubringen, und musste deswegen
noch einmal herauskommen. Bevor mein Klubsekretär wieder böse zu mir
schaut und mit mir schimpft, bringe ich ihn zuerst ein und erkläre
dann, warum ich ihn einbringe. (Heiterkeit bei SPÖ und ÖVP.)
Ich bringe folgenden Antrag ein:
Entschließungsantrag
der Bundesrät:innen Sascha Obrecht, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Wohnen in der Krise – umfassendes Maßnahmenpaket für leistbares Wohnen“
Der Bundesrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat und dem Bundesrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, die die notwendigen gesetzlichen Maßnahmen für einen Mietenstopp und eine umfassende Wohnrechtsreform enthalten, insbesondere
- die Rücknahme der Indexierungen der Richtwert- und Kategoriemieten vom 1. April 2023 und 1. Juli 2023, um die Erhöhungen von 15 bis 25% wieder auf das ursprüngliche Mietpreisniveau zurückzuführen und die Inflationsrate entsprechend zu dämpfen.
- das Einfrieren sämtlicher Mieten (inklusive preisungebundener Mieten und Geschäftsraumieten) bis Ende 2025, um auch hier die entsprechenden Entlastungseffekte zu erzielen.
- ab 2026 erfolgt die Indexierung nicht mehr nach VPI, sondern richtet sich am Leitzinssatz der EZB aus, maximal jedoch 2% p.a. gedeckelt.
- die Einführung eines
einheitlichen, transparenten neuen Mietrechts mit gesetzlich klar definierten Zu- und Abschlägen,
unabhängig vom Baujahr des Gebäudes (Universalmietrecht),
um das stark zerklüftete und unübersichtliche österreichische Mietrecht zu vereinheitlichen und
Rechtssicherheit sowohl
für Mieterinnen und Mieter, wie auch für Vermieterinnen und
Vermieter zu erreichen.
- die Wiedereinführung der
2018 unter der Regierung Kurz-Strache liquidierten Wohnbauinvestitionsbank
(WBIB) zur Sicherstellung der Finanzierung
des sozialen Wohnbaus und zur Abfederung der steigenden Kosten im sozialen
Wohnbau, um das zuletzt stark angestiegene Zinsniveau und die dadurch gestiegenen
Bau- und Wohnkosten auszugleichen
- die Wiedereinführung der Zweckwidmung der
Wohnbauförderung, um den Bundesländern zu ermöglichen den
sozialen Wohnbau zu forcieren und
genug leistbaren Wohnraum zu schaffen.
- die Zurverfügungstellung einer Wohnbaumilliarde für die Länder, um den sozialen Wohnbau anzukurbeln und um den Einbruch der Bauwirtschaft zu bekämpfen.
- die verfassungsrechtliche Absicherung der Widmungskategorie ‚sozialer Wohnbau‘, um die Rechtsunsicherheit im Kompetenzbereich des Volkswohnungswesens zu bereinigen.
- verfassungsmäßige Ermächtigung der Bundesländer zur Einführung von Leerstandsabgaben, die einen ausreichenden Lenkungseffekt versprechen, um den vorhandenen Leerstand zu mobilisieren und den bereits vorhandenen Wohnraum der Bevölkerung in ausreichendem Maße zur Verfügung zu stellen.
- die Einführung eines Zinsregulierungsgesetzes, das für bestimmte Grundbeträge einen Mindestzinssatz für Spareinlagen (angelehnt an die erfolgte Regelung in Frankreich) und einen Höchstzinssatz für Wohn- und Überziehungskredite festlegt.“
*****
Das wäre das
Maßnahmenpaket. Wenn wir dieses beschließen, geht es Österreich
weit, weit besser, vor allem den vielen Mieterinnen und Mietern.
(Beifall bei der SPÖ.)
Ich habe aber schon angekündigt, dass ich mich mit dem
PR-Schmäh der Bundesregierung genau auseinandersetze, und möchte
dazu zwei Beispiele
bringen, die ich erst vor Kurzem konkret erfragt habe: Das eine betrifft eine
Niederösterreicherin, die in einer nicht preisregulierten Wohnung
gewohnt
hat. Sie hat vor zwei Jahren für 76 Quadratmeter – sie war
Alleinerzieherin mit einem Kind – 680 Euro gezahlt, heute zahlt
sie 960 Euro – eine Steigerung
von 41 Prozent. (Bundesrätin Schumann: Wahnsinn!) –
Großartig, was die Regierung da gemacht hat, eine tolle Leistung!
In Wien (Rufe bei der SPÖ: Danke! Danke!) –
unregulierter Bereich, vielen Dank! –: 96 Quadratmeter: eine
Familie mit drei Kindern hat zunächst 970 Euro gezahlt, binnen der letzten zweieinhalb Jahre
ein Anstieg auf 1 346 Euro – eine Steigerung von
38 Prozent! Das ist eine wirklich tolle Leistung, da habt
ihr viel zustande gebracht, liebe Regierung, das ist wirklich, wirklich
großartig!
Das ist nicht das Einzige: Sie haben nicht nur nicht
eingegriffen, sondern
Sie versuchen, es so darzustellen, als würden Sie großartig etwas
machen. Ich erkläre Ihnen, wo Sie überall versuchen, die Leute
für dumm zu verkaufen:
Erstens haben Sie zunächst gesagt: Für einen
Mietpreisdeckel brauchen wir Verfassungsgesetze und die SPÖ wird nicht
mitgehen! – Kollegin Schumann hat völlig richtig gesagt: Ein
Vorschlag für einen umfassenden Mietpreisdeckel
lag nie vor! Und warum das ein Verfassungsgesetz braucht, versteht
überhaupt niemand, das ist juristisch absolut falsch. Insofern war das ein
Versuch,
der SPÖ den Schwarzen Peter für ein unausgereiftes Modell
zuzuschieben. Das ist unredlich und war juristisch falsch. (Beifall bei der
SPÖ.)
Zweiter Punkt, bei dem Sie die Österreicherinnen und
Österreicher für
dumm verkaufen wollten: August 2023, Sie kommen hierher und sagen: Wir machen
einen Mietpreisdeckel für nächstes Jahr – total
super! –, wenn die Mietpreise im nächsten Jahr um
5 Prozent steigen, dann ist gedeckelt, mehr geht nicht! –
Gleichzeitig sagen die Wirtschaftsforscher: 5 Prozent Inflation
wird es nächstes Jahr nicht geben! – Das war im August eine
super Maßnahme, wunderbar; zum Glück machen wir das auch nicht. (Beifall
bei der SPÖ.) –
Ich meine, das ist reines Für-blöd-Verkaufen der
österreichischen Bevölkerung.
Dann bringen Sie einen Wohnschirm auf den Weg –
eine Maßnahme,
die Personen, die mit ihren Mieten wirklich zu kämpfen haben, helfen soll.
(Bundesrätin Eder-Gitschthaler: Die hilft auch!) Da bin
ich dabei, das will ich auch, aber überlegen wir einmal, was da
tatsächlich dahintersteckt: Die Vermieterinnen und Vermieter
erhöhen, erhöhen, erhöhen, verlangen immer mehr,
die Mieter:innen können sich das nicht leisten – und wir
wickeln das jetzt als
Staat ab und geben den Mieter:innen das Geld, das von
einer Tasche,
nämlich der Tasche der Steuerzahler:innen, in die Tasche der Vermieter wandert. –
Das ist der Wohnschirm, das ist Ihr Wohnschirm! (Beifall bei
der SPÖ. – Bundesrätin Schumann: Genau!)
Sie klopfen sich auch immer toll auf die Schulter: Die
Richtwertmieten werden erst wieder 2025
steigen. Wie wäre es denn, wenn wir dieses Gesetz nicht
beschließen? Wie wäre das bei den Richtwertmieten? –
Genau so! 2024 werden die Richtwertmieten nicht angepasst. Diese Maßnahme
bestätigt nur den
Status quo und Sie feiern sich dafür. Ich verstehe es nicht, entweder es
ist tatsächlich Unwissenheit über die mietrechtliche Materie,
oder es ist bewusstes Täuschen
der österreichischen Bevölkerung. (Beifall bei der SPÖ.)
Sie sagen, Sie unterstützen
alle Österreicherinnen und Österreicher. Wie ist es denn in dem
Bereich, in dem das Mietrechtsgesetz nicht voll angewendet
wird? Wie ist das mit den 450 000 Mietverträgen, die insgesamt
eine Million Österreicherinnen und Österreicher
betreffen? – Dort zischt es durch, dort
zischt es einfach durch! Das erwähnen Sie nicht in Ihrer Rede, das kommt
einfach nicht vor. (Zwischenruf der Bundesrätin Kittl.) –
Frau Kollegin Kittl, ich
frage mich manchmal, wie das bei den Grünen in Wien abläuft, wenn man
sich überlegt, wie man Bundesrat oder Bundesrätin bei den Grünen
in Wien
wird. Ich glaube, im Jobassessmentcenter wird verlangt: In jeder Rede muss eine
Kritik an der Stadt Wien oder an der SPÖ vorkommen. – Das ist
wirklich
so, anders kann ich mir das nicht erklären. (Beifall bei der
SPÖ. – Bundesrat Himmer: Sonst wäre es ja
unredlich!) Bei diesen eine Million Menschen, bei denen es durchrennt,
profitiert einer, eine Person, nämlich der Vermieter und niemand
anderer als der Vermieter.
Liebe Österreicherinnen und Österreicher, ich
bitte Sie, mir bei einem Gedankengang zu folgen: Wenn Sie Erspartes haben
und es auf Ihr Sparbuch
legen, dann haben Sie jahrelang 0,125 Prozent bekommen; wenn es gut
gelaufen ist, haben Sie das bekommen. Überlegen Sie: Was wäre, wenn
Sie eine Wohnung gehabt hätten? Wenn Sie 2020 eine Wohnung gehabt
hätten und
diese nicht dem MRG unterliegen würde, hätten Sie
stattdessen 25 Prozent Rendite gemacht. Die Sparerinnen und
Sparer kriegen 0,125 Prozent, Vermieterinnen und Vermieter bekommen
25 Prozent. – Das ist die Politik
dieser Bundesregierung! (Beifall bei der SPÖ. –
Bundesrätin Eder-Gitschthaler: Der Vermieter muss auch
investieren!)
Insgesamt ist es ein PR-Schmäh. Sie versuchen, etwas
schönzureden, was nicht schön ist. Es gibt eine Prämisse, nach
der Sie in dieser Regierung arbeiten –
das zieht sich durch; es ist gut, wenn es vorbei ist –: Die
Prämisse bei
Ihnen lautet: Die Reichen kassieren, die vielen verlieren. – Das ist
zu wenig! (Beifall bei der SPÖ.)
17.26
Vizepräsidentin Doris Hahn, MEd MA: Der von den Bundesräten Mag. Sascha Obrecht, Kolleginnen und Kollegen eingebrachte Entschließungsantrag betreffend „Wohnen in der Krise – umfassendes Maßnahmenpaket für leistbares Wohnen“ ist genügend unterstützt und steht demnach mit in Verhandlung.
Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Herr Bundesrat, bitte.
Bundesrat
Christoph Steiner (FPÖ, Tirol):
Wir waren Zeuge und ich bin mir ein bisschen zurückversetzt vorgekommen,
nämlich in früher, als ÖVP und
SPÖ noch ein bisschen größere Sektoren hatten und der
Klassenkampf passiert ist. Dieser Klassenkampf war ganz interessant zum
Zuschauen, mittlerweile beteiligen sich ja auch die Grünen am
Klassenkampf, weil die Grünen irgendwie versuchen, sich hinüberzuretten,
doch noch irgendwie sozial zu sein, aber
von der ÖVP quasi mit all den Gesetzlichkeiten überrumpelt werden.
Kollegin Kittl, bei aller Liebe, und auch Kollegin von der ÖVP aus Kärnten (Bundesrätin Eder-Gitschthaler: Kollegin Lassnig!): Wenn man sich hierherstellt und sagt: Wir machen so viel, wir sind so toll und ihr seid jetzt bei unseren tollen
Geschichten, die die Leute entlasten, nicht dabei!, dann kommt mir immer der Gedanke
(Bundesrätin Jagl: Es stimmt! Es ist die Wahrheit!):
Spürt ihr euch noch? Lebt ihr schon noch im selben Österreich wie der
Rest – also nicht
wie die 28 Prozent, die euch angeblich
noch wählen, sondern wie der ganze Rest, nämlich
72 Prozent, die Restlichen in Österreich? Lebt ihr schon noch im
selben Land wie der Rest von Österreich? Das kann ja nicht sein! Ich kann
mich da ja nicht aus voller – oder zumindest aus gespielter
voller – Überzeugung herstellen und sagen: Wir sind so
toll! – Was hat sie, die von der ÖVP,
gesagt? – Wir sind der Partner der Österreicher für
leistbares Leben! (Beifall bei FPÖ und ÖVP. – Bundesrat
Himmer: So ist es richtig! So ist es auf den Punkt gebracht!)
Ja wisst ihr, was ihr in den
letzten Jahren aufgeführt habt? – Diese 72 Prozent, die
euch nicht mehr wählen, leben sicher nicht im selben Land, in dem ihr
zu leben glaubt. Für mich ist das irre, was es da oft an
Redebeiträgen gibt. Da denke ich mir: Das gibt es doch nicht, dass ihr
beinhart behauptet, ihr entlastet jetzt die
Österreicher! – Das macht ihr aber schon seit Jahren, nur geht
euch jetzt das Spielchen nicht mehr auf, also der Hütchenspielertrick hat
sich jetzt erledigt. Es ist nämlich so, dass es tief in die Geldtaschen
der österreichischen Steuerzahler geht. Es wird immer schwieriger
für Vertreter der Regierungsparteien. Die Kollegin von der ÖVP hat
auch fälschlicherweise gesagt: Wir von der Regierung! – Nein,
nein, ihr als Abgeordnete beziehungsweise Bundesräte
kontrolliert normalerweise die Regierung – nur
zur Erinnerung.
Wenn ihr euch dann aber immer hinstellt und sagt: Wir von den Regierungsparteien entlasten, diese Regierung entlastet!, und der Österreicher das vielleicht im ersten Moment glaubt, dann über Jahre aber nichts passiert, im Gegenteil, es noch schlimmer wird, dann könnt ihr euch die Schmähpartie abschminken, weil das, was ihr da aufführt, durchschaubar ist, weil es jetzt ans Eingemachte geht.
Der Österreicher ist
leidgeplagt, aber irgendwann hat er – die Schnauze voll,
darf ich nicht sagen – den Rand voll.
Frau Ministerin Zadić, Sie
sind eine feine, wirklich nicht unsympathische Frau – das muss ich
ganz ehrlich sagen (Heiterkeit des Bundesrates Himmer – Bundesrat Schreuder: ...
das ist furchtbar! – Bundesrat Buchmann: Das war jetzt eine
besondere politische Wertung!) –, eine der wenigen in dieser
Regierung,
die oft ordentliche Redebeiträge abgibt und sich, glaube ich, im Gegensatz
zu Ihren Kollegen von den Grünen schon noch selber spürt. Mit diesem
Gesetz aber (Bundesrat Schennach: Das ist ja nicht ...
Ministerium!), mit dieser Mietrechtsänderung, für die ihr euch
abfeiert, dass jetzt alles so günstig wird, macht ihr gar nichts, rein gar
nichts. (Präsidentin Arpa übernimmt den Vorsitz.)
Von der Teuerung brauchen wir
gar nicht zu reden. Kollege Obrecht und Kollegin Schumann haben den Deckel mit 5 Prozent erwähnt. Wenn wir
4,9 Prozent Teuerung haben, dann greift dieser Deckel gar
nicht mehr, aber die 4,9 Prozent fühlen sich wie 5, 6 oder
7 Prozent an. Seien wir uns also ehrlich:
Was ihr da aufführt, ist leider Gottes nichts als Fakepolitik –
das ist Fakepolitik! (Zwischenrufe der Bundesräte Buchmann und Himmer.)
Ihr von der Regierung könnt über Fakenews in der Coronazeit schimpfen. Ich weiß nicht, was schlimmer ist: ein Fakegesetz oder Fakenews? – Weitaus schlimmer ist ein Fakegesetz, und diese Regierung ist ein Fake für sich. Leider Gottes haben wir euch noch ein Jahr lang picken. – Danke schön. (Beifall bei der FPÖ. – Heiterkeit der Bundesräte Mertel und Wanner.)
17.31
Präsidentin
Mag.a Claudia Arpa: Weitere
Wortmeldungen liegen dazu nicht
vor.
Wünscht noch jemand das Wort? (Bundesrat Zauner hebt die Hand.) – Bitte sehr, Herr Bundesrat. (Bundesrat Steiner: Ganz spontan, schau!)
17.32
Bundesrat Matthias Zauner (ÖVP,
Niederösterreich): Sehr geehrte
Frau Präsidentin! Frau Bundesministerin! Sehr geehrte Damen und Herren!
Kollege Steiner hat die Frage gestellt: Was hat diese Bundesregierung denn gemacht? – Machen
wir einen Blick zurück! (Bundesrat Steiner: Nein, habe ich nicht
gesagt! Nein! Nein! Nein! Diese Frage habe ich nicht gestellt! Nein, korrigier
es
jetzt, das lasse ich mir nicht unterstellen! Nur weil du, ... überleg
dir etwas Besseres für deine Spontanrede da, deiner angeblichen! Einen
solchen Packen Zettel mit spontan ...! – Heiterkeit bei
ÖVP, SPÖ und Grünen. – Bundesrätin Eder-Gitschthaler:
Das macht ihr auch immer so! – Weitere Zwischenrufe bei ÖVP und
SPÖ.) –
Schön ist, dass es bei uns keine beschränkte Redezeit gibt, das
ist ja kein Problem. (Bundesrat Steiner: Ja, ich muss eh bis
morgen dableiben!) – Eben.
Was hat diese Bundesregierung
gemacht? – Ich lade dazu ein, einen Blick zurück zu machen (Unruhe
im Saal): Wir waren mit einer Pandemie konfrontiert und
die Aussagen damals waren: ein Wahnsinn, diese Pandemie; nach dieser Pandemie
wird es die große Rezession geben (Bundesrat Steiner: Ja eh,
wir sind mitten in einer Rezession!), es werden die Betriebe
geschlossen haben und wir werden mit einer Massenarbeitslosigkeit konfrontiert
sein. (Die Bundesräte Leinfellner und Spanring:
Ja! Ja!) Was war nach dieser Pandemie? (Bundesrat Spanring: Genau
das!) – Das Gegenteil. (Beifall bei der
ÖVP. – Heiterkeit
bei der FPÖ. – Bundesrat Leinfellner: Alles richtig
gemacht, gell? – Weitere Zwischenrufe bei der FPÖ.)
Nach der Pandemie kam die Energiekrise, und alle
Propheten – links
und rechts – haben uns prophezeit: Zu Weihnachten werden wir alle im
Kalten sitzen; die Gasspeicher sind leer; wir stehen kurz davor, dass wir nicht
wissen, wie wir in diesem Land heizen können! (Bundesrat Spanring:
Das hat uns über 2 Milliarden Euro zusätzlich gekostet,
aber das ist ja nur Steuergeld, gell!) – Was
war das Ergebnis? – Die Bundesregierung hat gehandelt, es war kein
kalter Winter und wir sind auch gut durch diese Energiekrise
durchgekommen. (Beifall
bei der ÖVP und bei Bundesrät:innen der Grünen. –
Zwischenruf der Bundesrätin Schumann.)
Was man sich natürlich
anschauen muss – das haben wir ja vor 14 Tagen in diesem
Haus schon einmal ausgeführt –: Ja, das Leben für die
Menschen ist
teurer geworden, das stimmt, die Preise sind gestiegen (Bundesrat Steiner:
Ah geh, was! Na geh!), die Inflation ist gestiegen. (Zwischenrufe bei
der FPÖ.) Nur: Die Inflation ist das eine, man muss ja immer das
gesamte Bild betrachten. Da
gibt es schon zwei ganz wesentliche Zahlen für Österreich. Ich
wiederhole sie gerne, obwohl wir sie vor 14 Tagen schon diskutiert haben.
Zunächst einmal die
Armutsgefährdung: Österreich hat diesbezüglich den sechstbesten
Wert in der Europäischen Union und liegt dreimal besser als der
EU-Durchschnitt. Zweitens die Kaufkraft: Österreich ist vom neunten auf
den siebenten Platz gestiegen (Bundesrätin Schumann: Danke an
die Gewerkschaften! Danke! – Bundesrat Babler: Danke!),
was die Kaufkraft in diesem Land betrifft. Damit sind die Werte auch
in diesem Bereich um 50 Prozent höher als der europäische Durchschnitt. (Beifall bei der
ÖVP. – Bundesrätin Schumann: ... verhandelt!)
Das sind Fakten, da muss man sagen:
Ja, Österreich steht besser da als andere Länder in der
Europäischen Union und Österreich steht auch besser da,
als es der linke und rechte Populismus wahrhaben möchte. (Beifall bei
der ÖVP. – Bundesrat Steiner: Da hast du dir irgendwas
falsch aufgeschrieben! – Ruf bei
der FPÖ: Ja, ich glaube auch! – Weitere Zwischenrufe bei der
FPÖ.) – Zahlen lügen nicht. (Bundesrat Spanring:
Zahlen eh nicht, aber ich kenne eine Partie, die
das gerne macht! Sie fängt mit Ö an und hört mit VP
auf! – Weitere Zwischenrufe bei FPÖ und SPÖ.) –
Geht es dann wieder? (Ruf bei der SPÖ: Immer!) –
Gut, fein.
Dann kommen wir zu Frau Kollegin Gerdenitsch. Ist sie hier? (Bundesrätin Gerdenitsch: Natürlich!) – Sie ist eh da, wunderbar. Es werden hier ja immer die großen Leistungen der Sozialdemokratie gelobt; wie toll die Sozialdemokratie ist und wie pfui-teufel die ÖVP ist und damit auch gleich die Grünen sind. (Beifall bei der SPÖ. – Rufe bei der SPÖ: Danke! – Bundesrat Schennach: Endlich einmal eine Aussage! – Weitere Zwischenrufe bei der SPÖ.) – Genau!
Wir wurden ja eine
Bundesratssitzung lang von der Sozialdemokratie mit Berichten aus der
„Wiener Zeitung“ gelangweilt. Das war, glaube ich, übrigens
einer von zwei Redebeiträgen des Bundesparteivorsitzenden. (Heiterkeit
bei der ÖVP. – Bundesrat Babler: Kannst du nur bis zwei
zählen? – Heiterkeit bei
der SPÖ.)
Es ist heute auch so ein
schöner Artikel in der „Wiener Zeitung“ erschienen (Oh-Rufe
bei der SPÖ – Ruf bei der SPÖ: Jetzt kommt’s!)
und auf diesen möchte
ich schon gerne eingehen. Wir kommen wieder einmal nach Wien. (Ruf bei der
SPÖ: Gott sei Dank! – Bundesrätin Schumann: Ja und
wir kommen nach Wiener Neustadt demnächst! Städtebund! –
Zwischenruf der Bundesrätin Hahn.) – Städtetag,
sehr gerne, Frau Vizepräsidentin, ich freue mich. (Bundesrätin Schumann:
Genau! Sehen Sie, Sie haben es schon gesagt!)
„Siebenmal im Jahr liegt
ein knappes Heftchen in den Brigittenauer Briefkästen. Acht Seiten stark, viel Werbung, wenig Text. Auf
den ersten Blick ein Prospekt. Die Artikel sind kurze
Lobeshymnen auf die lokale Politik. Es geht um Radwege,
Regenbogenzebrastreifen, das Parkpickerl, die Wahl des Präsidenten des Wiener
Fachverbandes für Trampolinspringen.“ (Heiterkeit bei der
ÖVP.) „Es ist klar, woher der Wind weht. Die Zeitung Unsere
Brigittenau steht
der SPÖ nahe. Sehr nahe. Layout und Inhalt sind rot. Die Ausgaben
können auf der Website der SPÖ Brigittenau heruntergeladen
werden.“ (Bundesrätin Miesenberger: So ein
Zufall! – Bundesrätin Schumann: Wie war das
mit ...?! – Weitere Zwischenrufe bei der SPÖ.)
„So weit, so gut. Parteinahe Zeitungen gibt es in
jedem Nest. Man kennt
sie, überfliegt sie beim Frühstück.“ (Bundesrätin Schumann:
Ich habe das Gefühl, man muss ...!) „Wirklich interessant
ist Unsere Brigittenau [...] erst auf Seite sechs. Unter der
Meldung, dass“ die „Bezirksvorsteherin [...] einem Ehepaar zur
Steinernen Hochzeit gratulierte, ist ein kleines Kästchen – das
Impressum der Zeitung.“
„Ein mächtiger Genosse“ (Bundesrat Steiner:
Ist das noch zum Thema?!): „Der ist ein mächtiger Mann mit
Einfluss auf Stadtplanung, Verkehr, Flughafen
und Bezirk. Als Gemeinderat sitzt er in vielen Ausschüssen und Gremien,
dem wichtigen Gemeinderatsausschuss für Innovation, Stadtplanung und Mobilität“. (Bundesrätin
Hahn: Ist das jetzt eine Vorlesung?) – Ja, ich lese so
vor, wie ihr uns vorgelesen habt (Bundesrätin Schumann: Nein,
wir haben nichts vorgelesen! Nein, nein! Herr Zauner, freie Rede in
dem Fall wäre gut! Freie Rede! – Zwischenruf der
Bundesrätin Hahn.) – Gemeint ist Erich Valentin.
Erich Valentin: 1994 gründete er Damm-Werbung und war
deren Geschäftsführer und Eigentümer, heute ist er laut
Website Head of Creation. „Gründer
und Patronanz, also die Leitung der Zeitung, ist der Verein zur Förderung
fortschrittlicher Politik. Der Vereinssitz ist mit dem Firmensitz der Damm
Werbung ident. Obmann ist Erich Valentin.“
Um es jetzt frei zu machen: Das ist also ein Konstrukt, bei
dem die Stadt Wien (Bundesrätin Schumann: Frei! Frei! Nicht
lesen, nicht lesen! Frei!), der Bezirk,
die Stadt inserieren. (Ruf bei der SPÖ: So wie in
Niederösterreich!) Insgesamt 25 351 Euro waren es
2022, in einer Zeitung, die der SPÖ nicht nur nahesteht, sondern die einer
SPÖ-Bezirksrätin gehört (Bundesrat Steiner: Ich bin
ausgestiegen, ich komme nicht mehr mit, worum
es geht! – Bundesrat
Kovacs: Ich weiß
auch nicht, warum er das gesagt hat! – weitere Zwischenrufe bei der
SPÖ)
und bei der ein SPÖ-Gemeinderat entsprechend agiert. Das
Netzwerk ist erfolgreich gemacht, die Reichweite ist beachtlich. (Bundesrätin
Schumann: Was
hat das mit der Miete zu tun?! Hausherrenparteien, jetzt machen
wir ...! – Bundesrat Spanring: Die werden von der
ÖVP gelernt haben! – Ruf bei der SPÖ: Um was
geht es jetzt da? – Weitere Zwischenrufe bei SPÖ und FPÖ.)
Ja, jetzt kommen wir zum Punkt:
Die SPÖ wirft uns in diesem Haus immer sämtliche Dinge vor (Bundesrätin
Schumann: Ja wenn’s wahr ist!) und gleichzeitig
hat sie mit Inseratenvergaben in Wien ein großes Thema (Bundesrätin
Schumann: Na, in Niederösterreich nicht! Nein! Überhaupt
nicht! – Bundesrätin Hahn:
Sowas gibt’s in Niederösterreich nicht!), wo es zeitgleich
Umwidmungen gibt – und
der SPÖ-Bundesparteivorsitzende schweigt
dazu. (Bundesrätin Schumann:
Jetzt wäre ein Applaus ...! – Bundesrat Schennach –
in Richtung ÖVP –: Ihr müsst applaudieren für
ihn! Er verhungert da draußen!) – Nein, ich verhungere
überhaupt nicht. (Bundesrat Schennach:
Applaus! – Weitere Zwischenrufe bei der SPÖ.)
Fakt ist, diese Bundesregierung hat es mit all den
Maßnahmen, die sie gesetzt hat, geschafft, dass die Kaufkraft
steigt, dass die Inflation sinkt und dass wir in der Armutsbekämpfung
bessere Ergebnisse erzielen. Wir brauchen
uns weder von links noch von rechts irgendwo belehren zu lassen. Wir werden
diesen Weg gehen und die Menschen weiter entlasten und auch durch alle
kommenden Krisen führen. – Vielen Dank. (Beifall und
Bravoruf bei der ÖVP sowie Beifall bei den Grünen.)
17.41
Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Günter Kovacs. – Bitte, Herr Bundesrat. (Bundesrat Himmer: Kovacs verteidigt Wien!)
Bundesrat Günter Kovacs (SPÖ,
Burgenland): Ich möchte nur ganz
kurz auf Kollegen Steiner reflektieren, der vorhin gefragt hat, ob sich
Grün und Schwarz noch spüren. Ich sage dir die Antwort: Na sicher
nicht! Die spüren sich
nicht mehr, das kann ich dir sagen. (Beifall bei SPÖ und FPÖ.)
Herr Zauner, Herr Bundesrat Zauner, Sie sind in Person die
Arroganz, die Überheblichkeit pur! (Beifall bei der SPÖ sowie
Beifall und Bravorufe bei der FPÖ.)
Das genau ist es, was die Österreicherinnen und Österreicher momentan
von der Regierung halten, nur 28 Prozent unterstützen euch. Ich als
Sozialdemokrat sage euch: Parteien, die damals, vor zwei Jahren, die
Hacklerregelung für Menschen, die 45 Jahre lang gearbeitet haben,
abgeschafft haben (Beifall
und Bravorufe bei der SPÖ sowie Beifall bei der FPÖ), die
Menschen ab 1. Jänner mit einer CO2-Steuer belasten, die
wieder die Pendlerinnen und Pendler belasten, die haben kein Recht, hier zu
stehen und zu sagen, sie hätten eine gute
Arbeit im Sinne der
Österreicher gemacht. – Herzlichen Dank. (Beifall bei
SPÖ und FPÖ.)
17.42
Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Weitere Wortmeldungen liegen jetzt noch vor. – Bitte, Herr Kollege Himmer.
Bundesrat Mag. Harald Himmer (ÖVP,
Wien): Hohes Haus! Frau Staatssekretärin!
Frau Präsidentin! Manchmal (Bundesrat Schennach: Frau
Ministerin!)
haben wir schon recht seltsame Diskussionen, wenn Kollege Matthias Zauner
rauskommt und sagt (Bundesrat Steiner: ... seltsam, das
stimmt!), er reflektiert auf eine Aussage von Kollegen
Steiner, der sozusagen metaphorisch sagt, diese Regierung hätte nichts
gemacht. (Bundesrat Steiner: Das habe ich
nie gesagt!) Dann reagiert Herr Steiner und macht 3 Minuten lang
Zwischenrufe, nein, das habe er nicht gesagt (Rufe bei der FPÖ: Hat er
ja nicht gesagt!), obwohl er sich tagaus, tagein, wann immer
er hier ans Rednerpult kommt, genau darum bemüht, zu sagen, dass diese
Regierung nichts für die Menschen
macht. Darum geht es ja eigentlich in Wahrheit in der Politik. Das kritisiert
ihr. Mit welchen Worten das auch immer stattfindet, ihr versucht das.
Noch eine kleine Korrektur, weil du gesagt hast, ehemals
habe die ÖVP hier einen großen Sektor gehabt: Die ÖVP hat
25 Mandate (Zwischenruf des Bundesrates Steiner), das
ist an sich nichts Ehemaliges, das ist die Realität, das ist die
Gegenwart. (Zwischenruf der Bundesrätin Doppler. –
Bundesrat Schennach:
Es geht um den Mietpreis! – Weitere Rufe bei der SPÖ: Mietpreisdeckel!) –
Es geht um den Mietpreisdeckel, und dieses Thema ist jetzt bereits dahin gehend
erweitert worden, dass Kollege Kovacs ans Rednerpult gekommen ist und über
Kollegen Steiner und über Kollegen Zauner gesprochen hat, und das Wort
Mietpreisdeckel ist bei Kollegen Kovacs nicht vorgekommen. (Bundesrätin
Doppler: Aber beim Babler auch nicht!)
Es geht natürlich insofern um den Mietpreisdeckel, als sich aus dem Mietpreisdeckel heraus eine Debatte entwickelt hat, wie sich die Menschen hier in dem Land das Leben sollen leisten können. Und dieser Konnex zwischen Mietpreisdeckel und der Frage, wie sich die Menschen in diesem Land das Leben leisten können sollen, ist nicht so weit hergeholt. (Beifall bei der ÖVP.)
Aus diesem Grund würde ich auch Rednern von der
Sozialdemokratie und von den Freiheitlichen bei Abschweifungen von diesem Thema
nicht unterstellen, dass sie nicht zur Tagesordnung sprechen. Aber
unser Recht ist es eben, dann auch darauf zu reflektieren. Daher kann es ja
nicht so sein, dass man hergeht und sagt, Herr Zauner habe überhaupt kein
Recht, etwas zu sagen. Ich bekomme sozusagen einen Ruf zur Sache. Da seid ihr
immer sehr heikel.
Im Angriff sehr, sehr frisch, im Angriff kommt der große Hammer, und wenn
dann die Volkspartei oder die Grünen
hie und da herausgehen und einmal
mit dem Hämmerchen ein bisschen zurückhauen (Nau-Rufe bei
der SPÖ), kommt das Geheule von links und von rechts. (Beifall bei
ÖVP und Grünen.)
Ihr von links und rechts braucht gar nicht so sehr zu
weinen, es gibt viele Maßnahmen, die diese Bundesregierung gesetzt
hat, und somit hat Kollege Zauner natürlich völlig recht gehabt,
das an dieser Stelle zu sagen, und dass ein Niederösterreicher Wien
kritisiert, das kann halt vorkommen. Wenn er mir
den Artikel von der Brigittenau gegeben hätte, hätte ich ihn auch
vorgelesen. Da er das sehr gut gemacht hat, bin ich natürlich dankbar
dafür, dass er diese Informationen hier gegeben hat.
Dass dann das Burgenland kommt, um Wien zu verteidigen, das
kommt in der SPÖ gar nicht so oft vor. (Heiterkeit und Beifall bei der
ÖVP.) Eine Koalition Doskozil/Babler ist ja an sich relativ
ausgeschlossen (Bundesrat Steiner – erheitert –:
Der war gut!), aber hat jetzt in diesem Fall hier fast stattgefunden.
Auch wenn wir jetzt von Herrn Kollegen Babler noch nichts gehört haben, so
ist er trotzdem indirekt hier ein bisschen vorgekommen. Das freut uns. (Beifall
bei der ÖVP.)
17.47
Präsidentin
Mag.a Claudia Arpa: Eine weitere Wortmeldung
liegt nun
vor. – Bitte, Herr Kollege Steiner.
Ich muss jetzt nur eine kurze Frage im Zusammenhang mit dem
Pult stellen (Bundesrat Himmer hat
während seiner Ausführungen mehrmals den Knopf
zum Hochstellen des Redner:innenpultes gedrückt, ohne dass es
hochgefahren ist): Funktioniert das
nicht mit dem Hochstellen? (Bundesrat Steiner – das
Redner:innenpult höher stellend –: Man muss nur drücken!) –
Ah, danke, es funktioniert doch.
Bundesrat Christoph Steiner (FPÖ,
Tirol): Nur ganz kurz: Sehr wohl, das
passt schon, wenn eine Diskussion
geführt wird – Herr Kollege Himmer, da hast
du völlig recht –, dann kann man sich natürlich
auch verteidigen und auch einmal abschweifen. Das bitte braucht man nicht zu
kritisieren vonseiten der
SPÖ, das ist gelebter Parlamentarismus. So sehe ich das. (Beifall bei
der FPÖ.)
Man kann es so oder so
machen – Kollege Zauner war super, er kommt
für eine angeblich völlig spontane Rede mit einem dicken Packerl
Zettel hier heraus. Kollege Zauner, ich habe dir gerne zugehört, nur
bin ich irgendwann
nach der ersten Minute aus dem Zug ausgestiegen, weil ich nicht mehr gewusst
habe, worum es jetzt eigentlich geht. Er hat da irgendetwas von der „Wiener Zeitung“
zitiert, kein Mensch weiß, worum es gegangenen ist. Aber gut, es war
sehr, sehr amüsant.
Wenn man sich zu einem Tagesordnungspunkt zu Wort meldet und
davor
nur zum Tagesordnungspunkt gesprochen worden ist, dann ist das natürlich
etwas anderes, dann sollte man schon zum Tagesordnungspunkt reden.
Aber Herr Kollege Zauner ist echt eine Sensation (erheitert), mir taugt
das ja wirklich mit den spontanen Geschichten, das ist eine coole Geschichte.
Wenn sie spontan und vorbereitet ist, dann muss sie krachen, Herr
Kollege Zauner – und das war ein Schas (Bundesrat Buchmann:
Hallo?!), leider
Gottes! (Beifall bei der FPÖ.)
Dem, was Herr Kollege Kovacs gesagt hat, muss ich zu 100 Prozent
beipflichten. Wenn Herr Kollege Zauner sich hier herausstellt, taugt mir das
immer ganz besonders. Er ist zu 100 Prozent der Sympathieträger der
ÖVP in Menschengestalt. Das freut mich. Und wenn Sie, Herr Kollege
Himmer, sich hier herausstellen und immer frei sprechen, gefällt mir
das ja, das ist super, das finde ich gut, aber oft einmal verstrudeln Sie sich
ein bisschen. Sie haben Herrn Kollegen Zauner verteidigt, er hätte zum
Mietrechtsänderungesetz gesprochen, und da muss ich Sie korrigieren, Herr
Kollege Himmer. Er hat einen Artikel aus
der „Wiener Zeitung“ vorgelesen (Rufe bei der ÖVP: Auch!
Auch!), in dem es darum gegangen ist, dass irgendein Paar die
diamantene Hochzeit in Wien gefeiert hat, um uns zu erklären, dass
die SPÖ in Wien ihr nahestehende Zeitungen betreibt, die aber nicht
als SPÖ gekennzeichnet sind. – Na was für
ein Neuigkeitswert! Das hat die SPÖ von der ÖVP gelernt oder
umgekehrt, aber das praktizieren beide
Parteien seit Jahrzehnten, also das ist keine Neuigkeit.
Dann gibt es die Tränen von links und von
rechts. – Ich kann nur für
unsere Fraktion, die jetzt hier herinnen rechts sitzt und auch politisch rechte
Politik macht, sagen: Wir weinen nicht, wir gehen sehr fröhlich in das
neue Jahr. – Ich glaube eher, dass bei den Umfrageergebnissen die
Tränen bei der ÖVP zu suchen sind. Das entscheidet natürlich die
Wahl, aber wenn
man sich draußen mit den Bürgern unterhält, ist die Stimmung
eindeutig. (Beifall bei der FPÖ.)
17.50
Präsidentin
Mag.a Claudia Arpa: Es liegt noch eine
weitere Wortmeldung vor. – Bitte, Herr Bundesrat Himmer. (Bundesrat
Schennach: ... nicht gleich einen
Sessel mitnehmen? – Ruf: Verzögern die Verbotsgesetz-Novelle!)
Bundesrat Mag. Harald Himmer (ÖVP,
Wien): Das ist ja – ich
verzichte jetzt auf alle Anreden – das, was mir an der FPÖ so
gefällt, und auch jetzt an dem Schmunzeln des Herrn Steiner, diesem
fröhlichen Schmunzeln, diesen Zugang zu haben: Dem Land geht es
schlecht – hervorragend! (Rufe bei der FPÖ:
Nein!) –, der FPÖ geht es gut. (Bundesrat Steiner: Du lebst in einer eigenen Welt! – Zwischenruf des Bundesrates Spanring.)
Das will ich ja nur den
Menschen sagen, die dieser Debatte folgen, damit man weiß, worum es hier
immer geht: Es geht darum, immer die schlechte Stimmung aufrechtzuerhalten.
Es ist wichtig, dass es eine schlechte Stimmung gibt, denn die Leute sollen
haß sein und sollen sagen: Es reicht uns, wir
wählen die FPÖ! – (Zwischenruf des Bundesrates Steiner.)
Deswegen kann man eben auch bei
Gesetzen, die nur gut sind (Bundesrätin Schumann: Aber nicht das
Mietpreisbremserl! Nicht das Mietpreisbremserl!) – weil es hier
um eine Mietzinsbremse geht; jeder, der diesem Gesetz zustimmt, hilft
den Menschen –, nicht hier hergehen und sagen: Ja, das hilft den
Menschen!, sondern man muss die Stimmung aufrechterhalten, und die Stimmung muss schlecht sein, denn wenn die Stimmung im
Land schlecht
ist, ist sie bei den Freiheitlichen gut. (Zwischenruf des Bundesrates
Steiner.)
Das ist halt der Egoismus der Freiheitlichen, und wir sind die, die wirklich für die Menschen sind. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
17.52
Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das
Wort? – Das sehe ich nun nicht, das ist nicht der
Fall. Somit ist die Debatte geschlossen.
Wir gelangen zur Abstimmung. – Die Plätze sind bereits eingenommen.
Ich ersuche jene
Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den
vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch
zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit.
Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist somit angenommen.
Es liegt ein Antrag der Bundesräte Korinna Schumann, Kolleginnen und Kollegen auf Fassung einer Entschließung betreffend „Mietpreisstopp im freien Wohnungsmarkt“ vor. Ich lasse jetzt über diesen Entschließungsantrag abstimmen.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte,
die diesem Entschließungsantrag zustimmen, um ein Handzeichen. (Zwischenruf
des Bundesrates Steiner.) – Ja. (Bundesrat Steiner:
Passt!) – Das ist die Minderheit.
Somit ist der Antrag auf Fassung der gegenständlichen Entschließung abgelehnt.
Es liegt ein Antrag der Bundesräte Mag. Sascha
Obrecht, Kolleginnen und Kollegen auf Fassung einer Entschließung
betreffend „Wohnen in der
Krise – umfassendes Maßnahmenpaket für leistbares
Wohnen“ vor. Ich lasse auch über diesen Entschließungsantrag
abstimmen.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte,
die diesem Entschließungsantrag zustimmen, um ein
Handzeichen. – Das ist die Stimmenminderheit.
Der Antrag auf Fassung der gegenständlichen Entschließung ist somit abgelehnt.
Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Verbotsgesetz 1947, das Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 2008, das Abzeichengesetz 1960, das Uniform-Verbotsgesetz und das Symbole-Gesetz geändert werden (Verbotsgesetz-Novelle 2023) (2285 d.B. und 2340 d.B. sowie 11364/BR d.B. und 11395/BR d.B.)
Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Wir gelangen nun zum 15. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatterin ist Frau Bundesrätin Klara Neurauter, und ich bitte um den Bericht. – Bitte.
Berichterstatterin
Klara Neurauter: Frau Präsidentin!
Grüß Gott, Frau Minister! Ich bringe Ihnen den Bericht des
Justizausschusses über den Beschluss
des Nationalrates vom 15. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit
dem das Verbotsgesetz 1947, das Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 2008,
das Abzeichengesetz 1960, das
Uniform-Verbotsgesetz und das Symbole-Gesetz geändert werden, Verbotsgesetz-Novelle 2023.
Der Bericht liegt Ihnen schriftlich vor, ich komme daher gleich zur Antragstellung:
Der Justizausschuss stellt nach Beratung der Vorlage mehrstimmig den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Herzlichen Dank.
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Arthur Spanring. – Bitte, Herr Bundesrat.
Bundesrat
Andreas Arthur Spanring (FPÖ, Niederösterreich): Frau Vorsitzende! Frau Bundesminister! Kollegen
im Bundesrat! Sehr geehrte Damen und
Herren zu Hause und hier im Saal! Wir diskutieren heute im Bundesrat eine
Novelle des NS-Verbotsgesetzes aus dem Jahre 1947. Infolge der
Gräueltaten durch das Naziregime wurde in Österreich nach Kriegsende
das Verbotsgesetz beschlossen; man wollte damit jegliche
Betätigung im nationalsozialistischen Sinne mit dem Ziel untersagen,
dass nie mehr wieder ein solches
Regime, das für einen schrecklichen Völkermord verantwortlich war, an
die Macht kommt. Es ist zwar eine Selbstverständlichkeit, aber leider muss
ich das erfahrungsgemäß –basierend auf unzähligen
gehässigen Meldungen, erst in der letzten Bundesratssitzung ist das wieder
passiert, und wegen den
vielen schlechten Schauspielern hier herinnen – auch ganz klar so
aussprechen:
Wir Freiheitliche lehnen den Nationalsozialismus, nationalsozialistische Wiederbetätigung in jeder Form genauso wie Judenhass in jedweder Prägung ab (Zwischenruf des Bundesrates Gross), und wir weisen auch jede verharmlosende Aussage, mit der man diese schreckliche Zeit mit uns in Verbindung bringen
will, aufs Schärfste zurück. (Beifall bei der FPÖ. – Zwischenrufe der Bundesrät:innen Gross und Jagl.)
Genauso lehnen wir auch Gewalt und Rassismus ab (Bundesrat
Gross: Genau!), und im Gegensatz zu anderen Parteien hier im Haus
lehnen wir auch
Krieg ab – egal, ob es um den Krieg Russlands mit der Ukraine, bei
dem es inzwischen Hunderttausende Tote und Verletzte gibt, oder um jenen
Krieg,
der jetzt im Gazastreifen schon 18 000 Menschen das Leben gekostet
und mehr als 49 000 Verletzte gefordert hat, geht.
Wir Freiheitliche sind die letzten Verteidiger der immerwährenden Neutralität in Österreich – und eine kleine Anmerkung am Rande: Bei der UNO-Vollversammlung in New York wurde für eine Resolution gestimmt, und zwar betreffend einen humanitären Waffenstillstand in Gaza. Österreich war eines der wenigen Länder, die sich dagegen ausgesprochen haben – und das ist eine Schande. Das ist eine Schande für Österreich! (Beifall bei der FPÖ. – Zwischenruf der Bundesrätin Jagl.)
Bis zu einem gewissen Punkt ärgert es mich ganz
ehrlich, dass ich es überhaupt ansprechen muss, dass wir das ablehnen,
weil das ja eine Selbstverständlichkeit ist (Bundesrätin
Jagl: Ja, genau!), und mir ist auch klar, dass es egal ist, wie oft
wir das hier zum Ausdruck bringen – egal, ob mit Worten oder mit
Taten –, es wird immer wieder welche geben, die –
besonders von Ihnen, von den Grünen (Bundesrat Gross: Weil man
es Ihnen nicht glaubt! Sie sind nicht glaubwürdig! Das ist euer Problem!);
Sie beweisen es gerade jetzt wieder – immer wieder versuchen, uns
ins extremistische Eck zu stellen, ganz einfach weil
das Ihre einzige Strategie ist. Politisch haben Sie nichts drauf, das ist
die Wahrheit! (Beifall bei der FPÖ.) Das ist Ihre einzige
Strategie. Sachpolitisch sind Sie chancenlos, und das ist halt der Grund (Bundesrat
Gross: Das
ist eure Strategie!), warum Sie so mit Untergriffen arbeiten. Genau das ist
es.
Zunächst einmal: Wenn es tatsächlich das Ziel
dieser Regierung ist oder
war, gegen die Wurzeln des Judenhasses in Österreich anzutreten, dann muss
ich Ihnen, Frau Minister, leider sagen, dass Sie mit dieser Novellierung
Ihr durchaus erstrebenswertes Ziel weit verfehlt haben, denn wenn eines in
persönlichen Gesprächen immer wieder ganz klar zum Ausdruck kommt,
dann das, dass sich die Juden in Österreich nicht vor irgendwelchen
stupiden und ungebildeten Neonazis fürchten, sondern vor dem immer weiter
voranschreitenden Islamismus. (Bundesrätin Jagl: Ja, da haben
wir es ja! Genau!)
Ganz offensichtlich kommt zu selten in die
Öffentlichkeit, wie oft Juden
in Österreich tatsächlich Opfer von Angriffen werden. Das beginnt mit
Gesten, aber auch zum Beispiel mit dem Herunterreißen der
Israelfahne – das ist
erst jetzt kürzlich wieder in der Seitenstettengasse in Wien passiert, in
Salzburg wurde sie bereits dreimal heruntergerissen, und eben erst vor Kurzem
ist
es beim Rathaus in Linz passiert, wo man zwei junge Syrer dabei erwischt hat,
aber auch in Klagenfurt, wo man versucht hat, die Israelfahne anzuzünden.
Und nein – besonders wieder in Richtung Grüne, die hier gerne
zwischenrufen –, das waren keine bösen Rechten; das waren jene
Menschen, die Sie ins
Land geholt und gelassen haben, meine Damen und Herren, besonders Sie von den
Grünen! (Beifall bei der FPÖ.)
Wir alle haben den Terroranschlag vom 2. November 2020
noch in schmerzlicher Erinnerung. Damals war der Täter ein Moslem,
der im jüdischen Viertel vier Menschen mit einer
Kalaschnikow erschossen und 17 weitere
teils schwer verletzt hat.
Jetzt kommen wir zum Kernthema: Warum will diese Regierung
dieses Gesetz, das zuletzt im Jahr 1992 novelliert wurde, ausgerechnet
jetzt verschärfen? – Nicht etwa wegen der
Gründe, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, und wegen der Angriffe,
die stattgefunden haben. Nein, die Coronademos
sind der Grund, Sie hören richtig: die Coronademos! Es wurde immer wieder,
auch hier herinnen, behauptet, dass bei diesen Demos der Antisemitismus Fuß gefasst
hätte. Wer so etwas behauptet, meine Damen und Herren, der ist falsch
informiert oder der informiert falsch – nur mit dem Unterschied:
Ihnen hier herinnen unterstelle ich blanke Absicht. (Beifall bei der
FPÖ.)
Das ging dann sogar so weit, dass der Vizekanzler dieser
Republik im Parlament mehrmals davon gesprochen hat, dass bei den Demos
„Demokratiefeinde, Staatsverweigerer, Rechtsextreme und Neonazis oft auch
an der Spitze herumspazieren“. – Zitatende. (Zwischenruf
bei den Grünen: Stimmt ja!) – Da höre
ich jetzt gerade von grüner Seite: „Stimmt ja!“ Wer so etwas
behauptet, ist falsch informiert oder der informiert falsch. (Beifall bei
der FPÖ.)
Im Gegensatz zu Ihnen allen, meine Damen und Herren, und im
Gegensatz
zum Vizekanzler war ich auf sehr vielen Demos. (Bundesrätin
Jagl: Ja
eben! – Bundesrat Leinfellner: Was war das jetzt: „Ja
eben“?!) Und ja, bei Hunderttausend
Menschen kann es auch vorkommen, dass ein oder zwei Verrückte darunter
sind, das kann man leider nicht verhindern, aber daraus
eine Verschärfung des NS-Verbotsgesetzes abzuleiten, das ist eine
komplette Themenverfehlung. (Bundesrat Gross: Sie informieren
falsch!)
Noch einmal: Im Gegensatz zu Ihnen hier herinnen war ich auf
vielen Demos, und was ich dort gesehen habe, waren keine Nazis und keine
Rechtsradikalen. Wissen Sie, was ich dort aber gesehen
habe? – Viele Menschen mit Israelfahnen. Davon gibt es sogar tolle
Fotos, auf einem bin auch ich
mit einer Demogruppe und all den Israelfahnen zu sehen. Da sind Juden mit uns
mitmarschiert, die genauso gegen das Coronaregime in Österreich aufgetreten sind,
ebenfalls aber auch hier in Österreich zum Ausdruck gebracht haben, dass
vieles, was in Israel in der Coronapolitik passiert ist, genauso wenig in
Ordnung war. Niemand von denjenigen, der eine Israelfahne hatte, musste auch
nur eine Sekunde lang Angst haben, dass ihm irgendetwas passiert. Diese
Israelfahnen waren Teil des friedlichen Protests der Demonstranten. (Beifall
bei der FPÖ.)
Ja, ich habe bei den Coronademos auch
Menschen gesehen, die Judensterne getragen haben, und ja, vielleicht war das
eine oder andere dabei, was
wirklich ungeschickt und überschießend war. (Bundesrat Schreuder:
Was heißt „ungeschickt“?!) Das, was bei den Coronademos
gemacht wurde, war vieles, aber mit Sicherheit keine
Verharmlosung und auch keine Verherrlichung des
Nationalsozialismus. Und ja,
meine Damen und Herren, vielleicht war
auch ich in einer meiner Reden ungeschickt und habe übers Ziel
hinausgeschossen, aber, meine Damen und Herren, das hatte nichts, aber
schon gar
nichts mit NS-Verharmlosung oder mit -Verherrlichung zu tun. Das Gegenteil ist
der Fall: Unser aller gemeinsames Anliegen war es, aufzuzeigen, dass sich
in der Coronazeit vieles in eine völlig falsche Richtung entwickelt hat
und dass vonseiten der Regierung totalitäre Tendenzen zu erkennen waren.
Das
war der Grund. (Beifall bei der FPÖ.)
Das, was bei den Demos passiert ist, stand unter dem Motto:
Wehret den Anfängen! Wer etwas anderes behauptet, der ist falsch
informiert oder
der informiert falsch. – Von Ihnen hier herinnen wissen wir es
schon: Da ist es Absicht.
Trotzdem, meine Damen und Herren, bin ich voll und ganz
davon überzeugt, dass vereinzelt genau diese Überspitzungen
in der Coronazeit notwendig waren, um Sie hier herinnen aufzuwecken und
wachzurütteln. Wäre das
alles nicht passiert, dann wären wir heute noch im sinnlosen
Maskenwahnsinn, wir wären im Testwahnsinn, wir wären im
Dauerlockdown, und jeder Österreicher müsste sich, ob er will
oder nicht, zweimal oder dreimal oder viermal im Jahr seine Zwangsspritze
abholen. Und sagen Sie nicht, dass es nicht so
wäre, denn genau so wäre es! (Beifall und Bravoruf bei der
FPÖ.)
Warum wir heute gegen diese
Novellierung Einspruch erheben, hat mehrere Gründe. (Bundesrätin Schumann:
Ja, warum?!) Erstens: Dieser Gesetzesvorschlag geht wie gesagt an
den tatsächlichen Problemen des Judenhasses in Österreich völlig
vorbei. Ganz aktuell übrigens: ein Vorfall an der Universität für angewandte
Kunst in Wien – gut aufpassen, liebe Grüne –, wo bei
einer Veranstaltung allen Ernstes behauptet wurde, es hätte den Angriff
der
Hamas auf Israel nicht gegeben. Ein jüdischer Student war dort vor Ort, es
gibt ein Video davon (Bundesrat Schreuder: Ich kenne das Video! Ich
kenne auch
den Studenten!); er hat das mitgefilmt, und daraufhin wurde er angegriffen.
Und jetzt frage ich Sie: Wo, glauben Sie,
sind diese Herrschaften dort auf der
Universität
für angewandte Kunst zu 99,9 Prozent politisch zu
verorten? – Richtig: ganz, ganz, ganz weit links. Somit
wäre es vielleicht einmal an der Zeit, dass man – auch von
Ihrer Seite – beide Augen öffnet und nicht immer
nur auf einem Auge blind ist und den Linksextremismus in Österreich nicht
erkennen will! (Beifall bei der FPÖ.)
Eines fällt schon auch
auf: dass Aktivisten und Politiker der Linken – eben gerade vorhin
da hinten passiert – immer wieder die freiheitliche Opposition in
die Nähe des Nationalsozialismus zu rücken versuchen. (Bundesrätin
Schumann: Warum stimmts ihr jetzt nicht zu? Ich verstehe es
noch immer nicht!) Die Kollegin hat vorhin allen Ernstes so quasi
reingeschrien, dass, weil ich bei der
Demo war, Rechtsextreme und Neonazis bei der Demo waren. – Da muss
man sich wirklich fragen, was da bei Ihnen falsch läuft.
Sie versuchen das immer wieder,
und das, obwohl wir Freiheitliche im Gegensatz zu dieser aktuellen schwarz-grünen
Regierung niemals die Grundrechte der Bürger in Österreich angetastet
haben, auch nicht in der Zeit, als wir Freiheitliche in der Regierung
waren. Das haben nur Sie gemacht. (Beifall bei
der FPÖ.)
Obwohl es immer wieder derartige NS-Vergleiche gab, sind mir
keine Verfahren oder gar Verurteilungen wegen Verharmlosung der NS-Zeit
bekannt. Das,
meine Damen und Herren, könnte sich jetzt aber ändern und zum
Bumerang für alle linken, sich moralisch erhaben fühlenden
Gutmenschen – so wie Sie
das ausleben – werden (Bundesrätin Schumann: Aber
dann könntets ja zustimmen!), denn jetzt wird dann jede Form der
Verharmlosung strafbar sein. Bisher
galt das nämlich nur für die gröbliche
Verharmlosung. Das Wort „gröblich“ wird jetzt gestrichen, und
solche Meldungen wie gerade eben von Ihnen würden dann darunterfallen.
(Bundesrat Steiner: Hoppala!) Das wurde offensichtlich von den
Linken nicht ganz zu Ende gedacht, aber es freut mich ganz besonders. (Beifall
bei der FPÖ. – Bundesrätin Schumann: Ja, dann
stimmt zu! – Bundesrat Schreuder: Dann stimmt zu!)
Ein Punkt, den wir sehr
kritisch sehen, ist, dass jede Verurteilung eines Beamten nach dem
NS-Verbotsgesetz automatisch zum Amtsverlust führt. (Bundesrat Gross: Ja,
selbstverständlich!) Es gibt jetzt
klare, einheitliche Regeln, die gut sind, und über diese setzt man
sich hinweg und schafft eine eindeutige Ungleichbehandlung. Wenn man wegen
sexuellen Missbrauchs von Unmündigen, wegen Verletzung der sexuellen
Selbstbestimmung, wegen Reisen für terroristische Zwecke (Bundesrätin
Schumann: Afghanistan!), wegen der Aufforderung zu einer
terroristischen Straftat oder dafür, dass man terroristische
Straftaten – wie zum Beispiel die der Hamas –
gutheißt, oder auch wegen der Preisgabe von Staatsgeheimnissen und so
weiter verurteilt wird, dann
kann man, sofern das Strafmaß bedingt ein Jahr und unbedingt sechs Monate
nicht überschreitet (Bundesrätin Schumann: Ja, genau!),
weiterhin Beamter bleiben. Wird man jedoch nach dem Verbotsgesetz zu
einer Strafe von nur einer Woche verurteilt, dann kommt es automatisch zum
Amtsverlust
mit all den daran geknüpften Konsequenzen. (Bundesrat Gross: Wir
sind beim Verbotsgesetz und nicht ...!)
Das, meine Damen und Herren,
ist eine ganz klare Ungleichbehandlung, die auch verfassungsrechtlich
höchst bedenklich ist. (Bundesrat Gross: ... Verbotsgesetz ...!) Das
wissen Sie ganz genau, und das wurde auch so angesprochen. Allerdings wird
das Gesetz heute in den Verfassungsrang gehoben, weshalb
der Verfassungsgerichtshof dann auch keine Möglichkeit mehr haben wird,
entsprechend einzuschreiten.
Und ja, ich weiß, was
jetzt für ein Argument kommen wird: Wir wollen
keine Nazis als Beamte. – Das wollen wir genauso wenig! (Bundesrat
Schreuder: Dann stimmt zu!) Wir wollen nicht, dass Menschen mit
einer derartigen Gesinnung Beamte sind, aber wir wollen genauso wenig (Bundesrat
Schreuder: Zustimmen!), dass dann jene Beamte sind, die die Hamas
gutheißen oder vielleicht gar als Lehrer einen sexuellen Übergriff
auf Kinder begehen und so
weiter; denn genau diese Straftaten sind es ja leider, die meist sehr gering bestraft werden, und diese Täter können dann im Beamtenstatus bleiben. (Bundesrätin Schumann: Stimmt ja nicht! Da gibt’s ja genug Verfahren!)
Ein weiterer verfassungsrechtlich
bedenklicher Inhalt in diesem Gesetz handelt von der Abnahme von
NS-Devotionalien. Erstens einmal muss man gleich vorwegnehmen: Wir haben den
Begriff Devotionalien immer kritisiert, weil er einfach völlig falsch ist.
Es wird damit eine Präsupposition geschaffen,
es wird von vornherein unterstellt, dass man irgendeine emotionale Bindung zu
einem entsprechenden Objekt hat und man es deshalb andächtig verehrt. (Zwischenruf
der Bundesrätin Schumann.) Das ist aber nicht der Fall. Das
alleine ist unpassend und viel besser zum Beispiel der Religion zuzuweisen.
Bisher ist es so, dass solche
Gegenstände abgenommen werden können, wenn man damit eine strafbare
Handlung gesetzt hat. Wenn man zum Beispiel
etwas fotografiert hat und es 50 Leuten
in der Whatsapp-Gruppe geschickt hat – schau, was ich Tolles
habe! –, dann ist es einem weggenommen worden –
gut so! Gut so, denn diese Leute sind ein bisschen dumm; aber gut.
Was aber jetzt, mit der
heutigen Novellierung, passiert, ist, dass einem einfach so ein
Sammlerstück zum Beispiel abgenommen werden kann, weil man zum Beispiel
vom Nachbarn denunziert wird, der einen nicht mag, oder weil man zum Beispiel
ein Bild seiner Großeltern (Bundesrat Schreuder: Man darf kein
Geschäft damit machen! Was ist das Problem?), auf dem der
Großvater in Uniform zu sehen ist, zu Hause hat. All das kann dann
passieren: dass einem das abgenommen wird; und wir alle wissen, dass es
überall in den Haushalten natürlich noch
viele Bilder gibt (Bundesrat Schreuder: ... ein Geschäft machen
...! – Zwischenrufe bei der ÖVP –
Zwischenruf des Bundesrates Gross), ohne dass diese Objekte in irgendeinem Zusammenhang
stehen. – Na, Herr Gross, Sie werden
ja auch nicht umsonst Adi heißen! Wer hat Sie denn Adi getauft?
Denken Sie einmal ein bisschen darüber nach, bevor Sie hier immer so
gescheite Aussagen tätigen! (Beifall bei der
FPÖ. – Zwischenrufe der Bundesrät:innen Gross und
Jagl. – Bundesrat Gross steht auf und begibt sich ans Mikrofon in der ersten Bankreihe.)
Das kann Ihnen abgenommen
werden (Bundesrat Gross: Zur Geschäftsordnung!), einfach so
(Bundesrat Gross: Frau Vorsitzende! Das geht nicht!), ohne eine
Verharmlosung oder Verherrlichung des Nationalsozialismus oder von Ähnlichem.
(Bundesrat Steiner: Adi, setz dich hin, das geht erst nachher!) –
Herr
Gross, Sie können sich dann eh gerne melden (Bundesrat Gross:
Nein, Sie entschuldigen sich jetzt, aber blitzartig!), das ist ja kein
Problem. (Bundesrat Gross –
in Richtung Präsidentin Arpa –: Das geht nicht! Sie haben es
gehört! Das geht doch nicht!)
Da entsteht, meine Damen und
Herren, im Strafgesetz etwas, was bisher in Österreich undenkbar war.
(Bundesrat Steiner: Setz dich hin! – Bundesrat Gross:
Es soll einen Ordnungsruf geben!) Es passiert eine Beweislastumkehr, denn
in
der Regel gilt im Strafgesetz: Jeder in Österreich ist so lange
unschuldig, bis man ihm seine Schuld
nachweisen kann. – Das ändert sich jetzt! Die Beweislastumkehr dreht
diese Nachweispflicht um, sodass der Beschuldigte Beweise finden muss,
dass er unschuldig ist. Das gibt es normalerweise im Strafrecht
nicht, und Sie schaffen das!
Das zieht sich jetzt vor allem
auch in den Bereich von Sammlern hinein; das zieht sich auch in den Bereich von
Menschen hinein, die wissenschaftlich arbeiten. Diese müssen
sich künftig automatisch freibeweisen. Da gab es auch entsprechend
viel Kritik von der Justiz sowie Stellungnahmen – diese haben
Sie alle vom Tisch gewischt und das getrost ignoriert. Dieses Gesetz würde
so vor dem Verfassungsgerichtshof sicher
nicht standhalten, aber wie schon erwähnt: Sie heben dieses Gesetz
einfach in den Verfassungsrang und somit umgehen Sie das Ganze.
Alles in allem kann man sagen: Es liegt uns hier eine
rechtsstaatlich bedenkliche Gesetzesnovelle vor, welche die echten Gefahren der
Jetztzeit ignoriert
und somit keinen Beitrag zur Bekämpfung des Judenhasses in Österreich leistet. (Beifall bei der FPÖ. – Bundesrat Schreuder: Zur Geschäftsordnung!)
18.14
Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Marco Schreuder hat sich zur Geschäftsbehandlung zu Wort gemeldet. – Bitte.
*****
Bundesrat Marco Schreuder (Grüne, Wien) (zur Geschäftsbehandlung): Ich kenne die Familiengeschichte von Herrn Adi Gross persönlich sehr gut; aber jemandem mit seiner Geschichte einen Vornamen vorzuwerfen, das geht nicht! (Zwischenruf der Bundesrätin Doppler.) Das geht nicht, und dafür muss es einen Ordnungsruf geben, weil man damit auch seine Eltern und seine ganze Familie beleidigt. Das ist auf einer persönlichen Ebene, wie es in diesem Haus nicht passieren darf. (Beifall bei Grünen und ÖVP sowie des Bundesrates Arlamovsky. – Bundesrat Steiner: Ja, wir haben ihn nicht getauft!)
18.15
*****
Präsidentin
Mag.a Claudia Arpa: Ich werde mir das Protokoll kommen lassen, und
dann schaue ich mir das an. – Danke schön. (Bundesrat Spanring:
Schauen Sie
sich auch die Zwischenrufe an!)
Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Marco Schreuder. – Bitte, Herr Bundesrat, Sie gelangen zu Wort.
Bundesrat
Marco Schreuder (Grüne, Wien): Frau
Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrte Frau
Ministerin! Es ist ein sehr, sehr ernstes Thema, das wir heute hier
besprechen. Es ist tatsächlich so – das ist meine
langjährige Erfahrung hier, auch als Angehöriger einer
Minderheit –, dass
immer, wenn ein Satz mit: Ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber!, Ich
habe ja
nichts gegen Juden, aber!, Ich habe ja nichts gegen Lesben und
Schwule, aber!, Ich habe nichts gegen Roma und Sintize, aber!, Ich habe nichts
gegen wen auch immer, aber!, beginnt, dass immer, wenn hinter ein
Ich-habe-nichts-gegen ein Aber gestellt wird, nichts Gutes dabei herauskommt.
Zu Ihrer Rede, Herr Kollege Spanring, muss ich sagen: Sie
haben eigentlich
sehr viele Argumente für dieses Gesetz vorgebracht und dann mit sehr
dünnen Argumenten gesagt, warum Sie ihm nicht zustimmen – und
diese Argumente erschüttern mich!
Wenn Sie wollen, dass mit NS-Devotionalien wieder Handel
betrieben werden kann – das haben Sie nämlich dann, das ist die
Schlussfolgerung –, dann
wollen Sie, dass man auf den Flohmärkten in Österreich, auf Willhaben
oder sonst wo Hakenkreuzsymbole einfach wieder verkaufen darf und damit
ein Geschäft machen kann! (Bundesrat Spanring: Hab ich nicht
gesagt! Das ist Ihre Schlussfolgerung!) – Nein, das ist die
Schlussfolgerung (Bundesrat Spanring:
Ja, Ihre!), wenn Sie das - - (Bundesrat Spanring: Ihre
Schlussfolgerung!) – Nein, das ist die logische
Schlussfolgerung! Sie wollen, dass damit wieder Geschäfte gemacht werden
können und dass Leute das im Internet verkaufen
können. (Bundesrat Spanring: Das passiert ja jetzt ...!) Und
das macht dieses Gesetz; es sagt: Nein, mit NS-Devotionalien darf man kein
Geschäft
machen!, und das ist richtig so! (Beifall bei Grünen und ÖVP sowie
bei Bundesrät:innen der SPÖ.)
Gegen eine Unterstellung
möchte ich mich hier auch wehren. (Zwischenruf des Bundesrates
Spanring.) – Herr Kollege Spanring, ich kann Ihnen gerne
Artikel
aus den Jahren 2012, 2013, glaube ich, zeigen. Einige, die damals schon im
Bundesrat waren, können sich vielleicht erinnern, dass es hier im
Bundesrat
einen Antrag gegeben hat, in dem Israel kritisiert wurde, und ich als einziger
Bundesrat dagegengestimmt habe. Übrigens hat die freiheitliche Bundesratsfraktion
die Verurteilung Israels mitgetragen. Ich habe damals einen, glaube ich,
zweiseitigen Artikel in der „Jerusalem Post“ bekommen. Ich
kann mich noch gut erinnern.
Das Wichtige für mich
damals – immer schon – war: Wenn man Israel für
etwas kritisiert, das andere Länder auch machen, und man diese nicht kritisiert,
dann ist das problematisch und dann hat das meistens einen antisemitischen
Grund. Und gegen diesen Antisemitismus habe ich mich damals aufgelehnt und
werde ich mich heute auflehnen.
Auch religiös motiviertem
Antisemitismus, auch muslimisch motiviertem Antisemitismus von Menschen,
egal welcher Herkunft und welcher Religion, werden wir als Grüne uns
mit aller Kraft entgegenstellen und sagen: Nein, gegen Antisemitismus, auch von
muslimischer Seite, werden wir Widerstand
leisten! Das geht nicht! (Beifall bei den Grünen und bei
Bundesrät:innen der ÖVP sowie des Bundesrates Arlamovsky.)
Und wenn linke Gruppierungen
antisemitische Äußerungen machen,
das vielleicht verstecken – meistens sind das so
antiimperialistische Gruppen; so heißt das dann meistens – und
es dann auch in antisemitischen Codes formulieren, wenn das von Links kommt,
dann werden wir sagen: Nein, das geht nicht, diesen Antisemitismus lehnen wir
ab! (Beifall bei den Grünen sowie
bei Bundesrät:innen von ÖVP und SPÖ.)
Der Antisemitismus, den wir seit Langem kennen und der die größten Gräueltaten in diesem Land vollbracht hat, der sechs Millionen Menschen das Leben gekostet hat, ist nach wie vor der nationalsozialistische Antisemitismus. Das war die widerlichste und grauenhafteste Fratze dieser Krankheit Antisemitismus.
Seit mehr als 75 Jahren kämpfen wir in
Österreich mit dieser Geschichte.
Wir haben das ja alles auch erlebt. Ich habe das als Jugendlicher erlebt. Ich
kann mich noch gut an die Auseinandersetzung erinnern, als Waldheim Präsidentschaftskandidat
war. Ich war selbst in der Schule im Jahr 1988,
als an 50 Jahre Anschluss erinnert worden ist. Ich war damals noch ein
Teenager – knapp, ich bin ein 1969er-Jahrgang – und
ich kann mich auch erinnern, dass mir plötzlich selbst bewusst wurde:
Moment! Was wäre mir als
schwulem Mann eigentlich passiert, wenn ich
damals gelebt hätte? –
Meine Eltern waren Zeugen Jehovas. Die wurden in Konzentrationslager gesteckt, und ich kannte in der Versammlung, wo ich
auch als Jugendlicher
immer hingehen musste, Menschen, die siebeneinhalb Jahre
Konzentrationslager überlebt haben. Und ich habe mich auch schon als
Jugendlicher intensiv
mit diesem Thema auseinandergesetzt.
Hier zu sagen, wir wollen nicht, dass Wiederbetätigung,
wir wollen nicht, dass Handel mit diesen Devotionalien, mit diesen
Symbolen – die für den Tod
von so vielen Menschen, für das Leid von so vielen Menschen, für
Raub, Mord, Totschlag und all das stehen – bestraft wird, dafür
fehlt mir einfach ein Verständnis. Mir fehlt auch das Verständnis
dafür, dass man sagt, dass Menschen, die dieser Ideologie huldigen,
weiter im Staatsdienst sein sollen.
Das ist einfach eine Grenze – wenn man die überschreitet, dann
geht das nicht mehr, dann kann man diesen Staat nicht repräsentieren. Ich
finde das
eigentlich selbstverständlich und ich wundere mich, dass ich das hier
verteidigen muss.
Vielleicht zur Erinnerung, worum es in dieser Gesetzesnovelle,
die wir hier machen, geht – das ist ja auch kein grünes Gesetz,
es ist kein schwarzes Gesetz, es ist kein
rotes Gesetz, sondern das ist ein ganz breit getragenes, von Menschen, von
der Zivilgesellschaft, von der Wissenschaft, von ganz vielen Expertinnen
und Experten auf diesem Gebiet zusammen erarbeitetes Gesetz –: Es
geht um die Ausweitung der inländischen Gerichtsbarkeit für nationalsozialistische
Wiederbetätigung, auch wenn sie im Ausland passiert. Es geht um die
Einziehung von NS-Devotionalien – wie Hakenkreuzfahnen, SS-Abzeichen und
andere Materialien –, sobald sie in den Handel kommen. Darum geht
es. Es geht um den Kampf gegen die Verharmlosung des Terrors und der
Gräuel der nationalsozialistischen Zeit. Es gibt eine höhere
Verurteilungsquote und, ja, es gibt den Amtsverlust bei Verurteilung –
nicht bei Verdacht, sondern bei Verurteilung – nach dem
Verbotsgesetz, und es gibt eine Erhöhung der Strafen.
Ich finde, das ist legitim, und ich finde, nach über
75 Jahren nach diesen Gräueltaten ist das schon richtig so, weil nun
einmal auch dieses Gesetz, das 75 Jahre alt war und vor 30 Jahren das
letzte Mal novelliert worden ist, natürlich angepasst werden muss an die heutige Zeit, an die heutigen digitalen
Wege,
die wir haben, an die Globalisierung, die damit auch mit dieser
Kommunikation, mit dem Handel, mit all dem zu tun hat. Ich finde, das ist ein
richtiger Weg,
und eigentlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, erschüttert es mich, dass
über so eine Selbstverständlichkeit in diesem Haus keine
Einstimmigkeit besteht. – Danke schön. (Beifall
bei Grünen, ÖVP und SPÖ.)
18.23
Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Bundesrätin Barbara Prügl. – Bitte sehr, Frau Bundesrätin.
Bundesrätin Barbara Prügl
(ÖVP, Oberösterreich): Frau
Präsidentin! Geschätzte Frau Ministerin! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Provokante NS-Propaganda im digitalen
Raum, Verleugnen des Holocausts, ungeniertes Radikalisieren in den
sozialen Medien, Geschäftemachereien mit NS-Devotionalien im
Internet – das ist jetzt nicht etwas, was man erfunden hat, sondern
das findet statt, und da stellt man sich die Frage:
Ist das eine Entwicklung der Zeit? – Nein. Dieser Entwicklung darf
man aber nicht tatenlos zusehen, geschweige denn darf das genährt werden.
Dagegen ist strikt vorzugehen.
Als Anfang der Neunzigerjahre
das Verbotsgesetz novelliert wurde, hat
das Internet gerade einmal Österreich erreicht – also noch
keine Spur von sozialen Medien, von digitalen Kommunikationskanälen
und Webshops.
Was die letzten 30 Jahre an technischen, an digitalen Entwicklungen
geschehen ist, ist im Grunde genommen gut – das ist nicht
abzustreiten –, doch den Schattenseiten müssen wir uns stellen.
Provokationen im Netz ohne direktes Gegenüber, Aufwiegelungen,
ohne dass deren Auswirkungen direkt spürbar werden, Nachrichten, ob
richtig oder
falsch, ob radikal oder hetzerisch, gehen mit einem Klick in Sekundenschnelle
um die Welt. Das macht ja etwas mit den Menschen, das macht etwas mit den
Leuten, das verändert und das beeinflusst. Besonders seit dem brutalen
Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel sind wir mit einer zunehmenden
Radikalisierung, einem steigenden Antisemitismus von Menschen und bestimmten
Gruppen in Europa und auch bei uns in Österreich konfrontiert,
und –
es wurde schon angesprochen – Staatsflaggen wurden von Gebäuden
gerissen und sogar verbrannt, Symbole des Antisemitismus oder von Terrororganisationen
werden ungehemmt auf Demonstrationen öffentlich zur Schau gestellt.
Dafür gibt es kein Verständnis, null Toleranz, und die Regierung
tritt dabei klar auf: klar gegen jegliche Form von Antisemitismus. (Beifall bei ÖVP und Grünen sowie des Bundesrates Schennach.)
Im Regierungsprogramm 2020–2024, also vor der Coronakrise, verankert und im nationalen Strategiepapier gegen Antisemitismus ausgearbeitet liegt die Novelle zum Verbotsgesetz nun vor. Wir wollen damit jeder Art von Extremismus, der Identifikationssymbole verwendet, entgegenwirken, damit sich Extremismus in unserer Gesellschaft nicht noch weiter ausbreiten kann.
Künftig ist also jegliches Relativieren, jegliche
Verharmlosung des nationalsozialistischen Völkermordes oder anderer
nationalsozialistischer Verbrechen gegen die Menschheit strafbar.
Damit können nun auch – wir haben es vorhin schon
gehört – Österreicherinnen und Österreicher, die vom
Ausland aus NS-Propaganda im Internet betreiben, zur Verantwortung gezogen
werden.
Sehr geehrte Damen und Herren, Symbole sind nicht nur
bloße Zeichen, sondern sie sind Botschaften, sind Zeichen der
Zugehörigkeit und des Interesses.
Das Tragen von Abzeichen der NSDAP zeigt das, das öffentliche Tragen von
Symbolen der Hamas, des Islamischen Staates, der Grauen Wölfe, der
PKK, der Hisbollah oder etwa der Identitären zeigt das – und
das wird aufgrund der vorliegenden Novelle, die empfindliche Strafen vorsieht,
nun auch
streng bestraft.
Für öffentlich
Bedienstete führt eine rechtskräftige Verurteilung – ich
wiederhole es gerne auch noch einmal – aufgrund eines Verstoßes
gegen das Verbotsgesetz zu einem zwingenden Amts- beziehungsweise Funktionsverlust. Das
ist notwendig, denn wir wollen keine Staatsdiener, die Sympathien dafür
haben. (Beifall bei ÖVP und Grünen, bei
Bundesrät:innen der SPÖ sowie
des Bundesrates Arlamovsky.)
Neu im
Verbotsgesetz ist auch die bessere Differenzierung in Grunddelikt und
Qualifikation. Das ist insofern wichtig, denn damit wird der Strafrahmen
bei Grunddelikten gesenkt. Das bedeutet, wir machen damit Diversion
möglich. Gerade Jugendliche und junge Erwachsene wissen leider oft gar
nicht,
dass sie eine Straftat begehen, oder ihnen ist das Unrecht der Tat nicht
bewusst. Da ist es bestimmt effektiver, ihnen die Diversion zu
ermöglichen. Damit
werden sie von Beratern unterstützt, sind in speziellen Programmen und
werden darin auch begleitet. Ich denke, das ist zielführender, als sie
strafrechtlich
zu verurteilen, weil eine Verurteilung vielleicht eine weitere Radikalisierung
nach sich ziehen könnte.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir als Vertreterinnen und Vertreter der Bevölkerung werden auch weiterhin dafür Sorge tragen, dass Radikalismus, Extremismus und Terrorismus bei uns keinen Platz haben. Das vorliegende Gesetzespaket ist ein notwendiger Rahmen dafür.
Gestattet mir, noch etwas zu sagen: Jede und jeder kann auch selbst durch ihr, sein Zutun zu einem guten Klima in der Gesellschaft beitragen – im Glauben an ein gutes und ein friedliches Österreich. (Beifall bei ÖVP und Grünen, bei Bundesrät:innen der SPÖ sowie des Bundesrates Arlamovsky.)
18.29
Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Stefan Schennach. – Bitte, Herr Bundesrat.
18.29
Bundesrat Stefan Schennach (SPÖ,
Wien): Frau Präsidentin! Sehr
geschätzte Frau Bundesministerin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die
letzten beiden Reden habe ich – in ihrem Inhalt, in ihrer
Tonlage – schon sehr der Thematik angemessen
empfunden, und gerade deswegen – ich weiß, lieber Adi Gross,
dieser Sektor (in Richtung SPÖ weisend) gefällt dir
nicht – tut es mir namens dieses Sektors sehr leid, dass das
gegenüber Ihnen respektive gegenüber
Ihren Eltern passiert ist. Das gehört sich nicht. Ich hoffe, die Frau
Präsidentin wird sich dazu noch äußern. (Beifall bei
SPÖ, ÖVP und Grünen sowie des Bundesrates Arlamovsky.)
Das NS-Verbotsgesetz entstand
1945, einen Monat nach Ende des schrecklichen Zweiten Weltkriegs, noch
unter dem vollen Eindruck des Mordens
und des Antisemitismus. Erst 1992 wurde die erste Novellierung daran vorgenommen,
und jetzt wird es wieder novelliert.
Frau Bundesministerin, ich habe
mich erkundigt, wie die Vorarbeiten zu diesem Gesetzentwurf waren. Ich
möchte Ihnen ein Dankeschön ausrichten, denn
die Arbeitsgruppe in Ihrem Ministerium hat
beispielhaft gezeigt, wie man gemeinsam in Würde und in
Respekt, unter Einbeziehung der Stellungnahmen im Begutachtungsverfahren, einen
Entwurf wesentlich verbessert – und das ist das, was wir heute hier
vorliegen haben.
Das novellierte
NS-Verbotsgesetz schafft einige Neuheiten. Die erste ist:
Jeder kennt den Begriff Kellernazis. Warum gibt es diesen
Begriff? – Weil in manchen Kellern unfassbare Mengen an NS-Devotionalien
lagern (Bundesrat Schreuder: Sie wurden gehortet!) –
ja, gehortet wurden. Was geschah in solchen Fällen bisher? –
Wenn man dieser Person nicht nachweisen
konnte, dass sie eine Wiederbetätigung begangen hat, dann musste dieser
ganze Schund, Mist und Müll zurückgegeben werden. Das ist jetzt
vorbei, und
ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist. (Beifall bei
SPÖ, ÖVP und Grünen sowie des Bundesrates Arlamovsky.)
Auch vorbei ist, dass Österreicher zum Beispiel nach
Teheran reisen und dort den Holocaust oder die Gaskammern verleugnen
können. Das ist vorbei,
jetzt greift dieses Gesetz gegenüber Österreichern und
Österreicherinnen auch bei Taten, die sie im Ausland begehen. Das ist eine
ganz essenzielle Notwendigkeit: die Ausdehnung der Strafgewalt auch auf
das Ausland. (Beifall bei SPÖ und ÖVP sowie der Bundesräte Arlamovsky
und Schreuder.)
Kommen wir zu den Sammlern und Forschern: Bitte, das ist ja
kein Gesetz, das das Dokumentationsarchiv des Österreichischen
Widerstandes bedroht,
das Beispiele zeigt, in welcher Geisteshaltung da gehandelt wird. (Zwischenruf
des Bundesrates Spanring.) Leute, die im Grunde Devotionalien
verherrlichen oder ausstellen, können natürlich eine
Bedrohung sein.
Die Novelle hat allerdings einen kleinen Beigeschmack:
Eigentlich sollte ein NS-Verbotsgesetz auch ein Handwerkszeug für den
berüchtigten Stammtisch
sein. Die Novelle enthält allerdings die kleine Regelung, dass, um sich
der Leugnung des Holocausts strafbar zu
machen, mindestens zehn Leute anwesend
sein müssen. Das ist ein Heruntersetzen von 30 – 30
waren es bisher, jetzt sind es zehn –, das alles schätze ich,
liebe Frau Bundesministerin, aber ich will
auch nicht, dass vor fünf Leuten im Gasthaus der Holocaust oder die Gaskammern
geleugnet werden. (Beifall bei der SPÖ.)
Was ich noch hervorheben möchte, ist, dass, je nach
Tatbestand, drei eigenständige Strafsätze enthalten sind. Das
heißt, es gibt Tatbestände mit einer Strafdrohung von sechs Monaten
bis fünf Jahren, es gibt Tatbestände, die mit einer Strafe von
fünf bis zehn Jahren bedroht sind, und welche von
zehn bis 20 Jahren. Da geht es um Tatbestände nach den Paragrafen 3g
und 3h.
Ich sage als jemand, der lange, 35 Jahre, Bewährungshelfer für das Bundesministerium für Justiz war – Sie alle erinnern sich an die Jugendlichen in Oberösterreich; mit denen muss man anders umgehen –: Wir brauchen Präventionsmaßnahmen. (Bundesrat Schreuder: Ja!) Das ist in diesem Gesetz drinnen. Das möchte ich besonders unterstreichen, weil nicht jedes Gesetz
Präventionsmaßnahmen vorsieht. Ich bin für Prävention und
nicht für das Gefängnis. (Beifall bei SPÖ und
Grünen sowie der Bundesräte Arlamovsky
und Preineder.)
Für diese drei, ich sage es einmal so, irregeleiteten
Jugendlichen ist es besser, dass sie mit den
Gräueltaten des Nationalsozialismus konfrontiert werden.
Ich bin da ganz bei Ihnen, Frau Bundesministerin, Sie haben
irgendwo – ich weiß nicht mehr wo, aber ich glaube, ich habe
es in einem Interview von Ihnen gelesen; falls nicht, können Sie mich
gleich korrigieren – gesagt: „Es reicht nicht aus, einfach
nach Mauthausen und wieder zurück zu fahren.“ Das ist keine
Prävention, das ist ein Einmal-Hin-und-Zurückfahren. – Das
heißt, es muss mehr sein, und deshalb ist auch politische Bildung so
wichtig.
Nun zu Ihnen, Herr Kollege Spanring: Sie waren auf vielen
Demonstrationen, haben Sie gesagt. Ich bin da mehrmals
erzwungenermaßen hineingeraten,
weil ich in der Zeit, in der die Straße den Demonstrant:innen gehört
hat, die Innenstadt durchqueren wollte. Was ich dort schon gesehen habe,
waren Menschen mit Judensternen (Bundesrat Steiner: Das hat er eh
gesagt! Das hat er ja gesagt!), und da war 88, HH und weiß ich was
drauf. (Bundesrat Steiner:
Nein, nein! – Bundesrat Spanring: So ein
Schwachsinn! – Bundesrat Steiner: Geh zum Augenarzt oder zu einem Doktor,
der ...! – Bundesrat Spanring: Das ist eine miese Unterstellung! –
Bundesrat Steiner: Eine glatte Lüge!) – Danke,
danke, ist okay. (Bundesrat Spanring: Die wären sofort verhaftet
worden von der Polizei!)
Wenn er das eh gesagt hat, dann
unterstreichen wir das hier ja nur. (Bundesrat Spanring: Wo war denn
die Polizei? Herr Kollege, erklär mir das! Das schau ich
mir an!) – Soweit ich weiß, war die Polizei mehr als oft
mit diesen Demonstrationen beschäftigt. (Bundesrat Spanring:
Du redest nur Blödsinn, wirklich! – Bundesrat Steiner:
Das ist reiner Schwachsinn!) Sie hatte wahrscheinlich mehr zu tun, als nur
nach dem Verbotsgesetz zu kontrollieren (Ruf bei der FPÖ:
Genau, jetzt auf einmal!), weil das in der Hochzeit der Pandemie war. (Bundesrat
Spanring: Zeig mir die Fotos, Schennach! Das hast du sicher
fotografiert!)
Noch einmal: Einer der Gründe, warum es auch bei den
Coronademonstrationen
zur Anwendung dieses Gesetzes gekommen ist, ist, dass es dort zu Verleugnungen, zum Missbrauch von Holocaust- und Nazisymbolen gekommen ist. (Ruf bei der FPÖ: Nein, nein!)
Gut, schreit weiter, es ändert nichts daran, dass ihr
heute hier dagegenstimmt. (Bundesrat Spanring: Diese Leute hätte
ich selber angezeigt! ... Genau so
wäre es gewesen! Das ist eine glatte Lüge von dir, eine glatte
Lüge!) Das müsst ihr mit eurem Gewissen ausmachen. (Bundesrat Steiner:
Keine Sorge!) Wir wissen auf jeden Fall, dass diese
Verschärfungen des Verbotsgesetzes nach so vielen Jahren nötig sind.
Es ist nach 1992 zu aktualisieren und auf den
heutigen Stand zu bringen. Das ist der richtige Schritt, und wir werden dieser
Novelle mit Freude zustimmen. (Beifall bei der SPÖ, bei
Bundesrät:innen
von ÖVP und Grünen sowie des Bundesrates Arlamovsky.)
18.38
Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Als Nächste zu Wort gemeldet hat sich Frau Ministerin Dr. Alma Zadić. – Bitte sehr, Frau Minister.
Bundesministerin für Justiz Dr. Alma Zadić, LL.M.: Frau Präsidentin! Geschätzte Mitglieder des Bundesrates! Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer! Das Verbotsgesetz gehört seit mehr als 75 Jahren zum österreichischen Rechtsbestand. Die letzte inhaltlich bedeutsame Novelle fand vor mehr als 30 Jahren statt. Das bedeutet, dass es angesichts der aktuellen Entwicklungen höchste Zeit war, dass wir eine Reform vornehmen. Als wir mit den Arbeiten begonnen haben, die Arbeitsgruppe einberufen haben, haben wir nicht damit gerechnet, dass das Thema Antisemitismus wieder so eine traurige und besorgniserregende Aktualität erfährt.
Seit den terroristischen
Gräueltaten der Hamas gegenüber der israelischen Zivilbevölkerung
am 7. Oktober verzeichnen wir auch in Österreich und in
Europa einen erschreckenden Anstieg an antisemitischen Übergriffen von
allen Seiten (Bundesrat Steiner: Importierter Antisemitismus!
Importiert! – Bundesrat Spanring: Richtig! –
Bundesrat Schreuder: „von allen Seiten“!) und
verharmlosende Aussagen über nationalsozialistische Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Wer heute in die sozialen Netzwerke schaut, muss zur Kenntnis nehmen, dass sich die Tatorte von Verbrechen nach dem Verbotsgesetz, aber auch die Gutheißung von Terrorismus oder Verhetzung in den digitalen Raum verlagert haben. Antisemitische, rechtsextreme, rassistische Straftaten werden häufiger im Internet begangen, Fakenews und Desinformation werden online gezielt eingesetzt, um unsere Demokratie zu schwächen. All dem müssen wir entschlossen entgegentreten, es ist unsere historische Pflicht. (Beifall bei Grünen und ÖVP sowie bei Bundesrät:innen der SPÖ.)
Das Verbotsgesetz entstand ja
unter dem Eindruck der begangenen Gräueltaten des Nationalsozialismus.
Niemals dürfen wir daher zulassen, dass diese Schrecken des
Nationalsozialismus vergessen werden. Nie wieder dürfen wir bei
Antisemitismus, bei Rechtsextremismus, bei Rassismus wegschauen. Deswegen ist
es unser Ziel, das Verbotsgesetz für die neuen Herausforderungen der Zeit
besser zu wappnen, und das heißt auch, antisemitische Übergriffe von
allen Seiten, egal in welcher Form, nicht zu tolerieren. (Beifall bei
Grünen und ÖVP sowie bei Bundesrät:innen der SPÖ.)
Ja, wir haben einiges
geändert, beispielsweise haben wir die inländische Gerichtsbarkeit
dahin gehend erweitert, dass auch im Ausland gesetzte Verhaltensweisen von
Österreichern erfasst sind. Dies gilt sowohl für Organisationsdelikte als
auch für Äußerungsdelikte. So ist zum Beispiel in Zukunft ein
österreichischer Holocaustleugner strafbar, wenn er die Tat im
Ausland begeht
und sie auch „geeignet ist, den
öffentlichen Frieden zu verletzen“. Wenn also beispielsweise
der Täter die Leugnung im Internet in Österreich abrufbar macht, dann
fällt er unter das Verbotsgesetz, und das ist auch richtig so.
Des Weiteren ist es, glaube ich,
auch richtig, dass man eine Unterscheidung trifft: Bei all den
Delikten haben wir eine Unterscheidung zwischen einem Grunddelikt und Delikten
mit besonderer Gefährlichkeit vorgenommen –
da ist die Strafdrohung eine wesentlich höhere. Das ist aus mehreren
Gründen richtig, aber aus einem ganz besonders – Abgeordneter
Schennach hat es
schon gesagt –: Es schafft bei Tatbeständen in § 3g
und § 3h des Verbotsgesetzes – das ist
„Nationalsozialistische Wiederbetätigung“ oder eben
„Leugnung des nationalsozialistischen
Völkermords“ – für Personen, die keine verfestigte
Ideologie haben, die Möglichkeit der Diversion. Ich halte das für
wichtig, weil es präventiv wirkt. Es wirkt präventiv. (Beifall bei
den Grünen sowie bei Bundesrät:innen von ÖVP und SPÖ.)
Im Vorfeld hat es ja die Sorge
gegeben: Ja, aber was genau bedeutet Diversion, gibt man jemandem ein Ticket
und schickt ihn nach Mauthausen und das reicht? – Nein, das reicht
natürlich nicht. Deswegen haben wir in den Erläuterungen
vorgesehen, dass wir in der Justiz uns dazu verpflichten, dass
wir spezielle Präventionsprogramme erarbeiten und es auch ein
entsprechendes Budget für diese Präventionsprogramme gibt, sodass die
auch wirklich
wirken, denn es geht uns ja darum, dass wir Personen, die keine verfestigte
Ideologie haben, erwischen und sie auf den richtigen Weg bringen.
(Beifall bei Grünen und SPÖ sowie bei Bundesrät:innen der
ÖVP.)
Was die Leugnung des
nationalsozialistischen Völkermords betrifft – das wurde schon erwähnt –, haben wir das
Tatbestandsmerkmal „gröblich“ gestrichen
und damit die Möglichkeit geschaffen, dass auch Teilleugnungen
unter das Verbotsgesetz fallen. Das führt auch in der Praxis zu einer
wesentlichen Erleichterung, denn bis jetzt war es immer schwierig: Was ist
denn eine gröbliche Leugnung? Deswegen
streichen wir das Wort „gröblich“, denn jegliche Leugnung soll
unter das Verbotsgesetz fallen.
Wir haben auch die Publizitätsschwelle von 30 auf zehn
Personen herabgesetzt. Da kam auch die Kritik: Was ist, wenn ich am Stammtisch
vor drei, vier,
fünf Personen den Holocaust leugne? – Das ist nicht nichts, das
ist und bleibt strafbar, zwar nicht nach dem Verbotsgesetz, aber nach dem
Verwaltungsstrafrecht. Auch dort haben wir etwas gemacht: Wir haben die
Strafen drastisch
erhöht, die Strafdrohung beträgt jetzt 10 000 Euro und im Wiederholungsfall 20 000 Euro, und das nicht nur in diesem Fall, sondern bei allen: beim Abzeichengesetz und beim Symbole-Gesetz – und da ist die Hamas ja mit umfasst. (Beifall bei den Grünen sowie bei Bundesrät:innen von ÖVP und SPÖ.)
Einen Punkt möchte ich schon erwähnen: dass die
Verurteilung nach
dem Verbotsgesetz bei einem Beamten, aber auch bei einem Vertragsbediensteten
zu einem sofortigen Verlust des Amtes oder zu einer vorzeitigen Auflösung des
Dienstverhältnisses führt. Ich halte das für richtig, denn ich
finde schon, dass jemand, der nach dem Verbotsgesetz verurteilt ist, in unserem
Staatsdienst einfach nichts zu suchen hat. Daher ist diese
Änderung besonders wichtig. (Beifall bei Grünen und SPÖ.)
Ich möchte mich an dieser Stelle bei den Mitgliedern
der Arbeitsgruppe bedanken, weil sie das Verbotsgesetz wirklich aus allen
Perspektiven durchleuchtet haben und eine Regelung gefunden oder
Vorschläge gemacht haben, die
wir großteils auch so umgesetzt haben. Ich möchte mich auch beim
Koalitionspartner und bei Verfassungsministerin Edtstadler für die
konstruktive Zusammenarbeit bedanken, insbesondere aber auch bei der
Sozialdemokratie, denn es war auf den letzten Metern schon wichtig, dass wir
erstens die Zweidrittelmehrheit sicherstellen und zweitens auch die
konstruktiven Vorschläge, die im Vorfeld gemacht wurden, in diesen
Gesetzestext einfließen. Herzlichen Dank dafür. (Beifall
bei Grünen und ÖVP sowie bei Bundesrät:innen der SPÖ.)
Herr Abgeordneter Spanring, ich schätze ja Ihre
konstruktiven Debattenbeiträge, das habe ich auch mehrfach
erwähnt, aber Sie haben in Ihrer
Rede auch gesagt, dass Sie bei Ihren Reden bei den Demonstrationen hin und
wieder über das „Ziel hinausgeschossen“ sind. (Bundesrat Spanring:
Vielleicht!) Ich muss Ihnen leider sagen, dass ich der
Meinung bin, dass Sie mit dieser Rede heute hier auch über das Ziel
hinausgeschossen sind, denn Adi Gross
so in diese unpassende Rede hineinzuziehen (Bundesrat Spanring: Na und
die Zwischenrufe, Frau Minister? Die Zwischenrufe haben Sie gehört,
oder?) halte ich
einfach für fehl am Platz, insbesondere wenn man seine Geschichte kennt. – Vielen Dank. (Beifall bei Grünen, ÖVP und SPÖ.)
18.47
Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Herzlichen Dank, Frau Minister.
Ich habe mir das
Protokoll kommen lassen. Es besteht ja die Möglichkeit, dass man aufeinander zugeht. Ich möchte da wie
Kollegin Prügl appellieren, die heute
so eine schöne Rede gehalten – aus meiner Sicht, wenn
ich das als Präsidentin einfach auch sagen darf – und gesagt
hat, dass wir ja alle selbst dafür verantwortlich sind, auch
„ein friedliches Österreich“ zu haben.
Deswegen möchte ich einfach einmal vorlesen, was da
gesagt worden ist. Herr Bundesrat Spanring, Sie haben gesagt: „Na, Herr Gross,
Sie werden ja auch
nicht umsonst Adi heißen! Wer hat Sie denn Adi getauft? Denken Sie einmal
ein bisschen darüber nach, bevor Sie
hier immer so gescheite Aussagen tätigen!“
Jetzt ist für mich die Frage: Möchten Sie sich da entschuldigen? (Bundesrat Spanring schüttelt den Kopf.) – Dann erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf, Herr Bundesrat Spanring. (Beifall bei ÖVP, SPÖ und Grünen. – Bundesrat Spanring: Okay, nehme ich zur Kenntnis!)
*****
Weitere Wortmeldungen liegen mir dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Bitte sehr,
Herr Kollege Leinfellner. (Bundesrätin Eder-Gitschthaler: Zufällig!
Spontan! – Bundesrat Leinfellner – auf dem
Weg zum Redner:innenpult –: Ja!)
Bundesrat Markus Leinfellner (FPÖ, Steiermark): Frau Präsidentin! Frau Bundesminister! Hohes Haus! Liebe Österreicher! Ganz spontan, ja – ich will
nicht sagen, dass ich mich nicht vorbereitet habe (Oh-Rufe
bei ÖVP und
SPÖ), denn ich habe ja schon geahnt, was kommt, aber das, was in
dieser Debatte wieder passiert ist, hat mich dann doch dazu bewegt, hier
herauszukommen, nämlich dieses Weinerliche. (Bundesrätin Platzer:
Das trifft wirklich ...!) Wenn das
Weinerliche ehrlich gemeint wäre, dann hätten Sie unsere ganze
Zustimmung.
Kollege Schreuder, du hast
gesagt, dem Antisemitismus werden wir Widerstand leisten müssen. Ja, ich
stimme dir zu 100 Prozent zu. Wenn das der Grund
für dieses Gesetz wäre, dann würde es keine einzige Gegenstimme
geben, da bin ich mir sicher. Du hast auch gesagt, Menschen, die dieser
Ideologie huldigen, haben im Staatsdienst nichts
verloren. – Ja, ich stimme dir auch da zu. Auch Kinderschänder
haben im Staatsdienst nichts verloren, aber da schaffen
wir es nicht, Frau Bundesminister, das gesetzlich zu verankern!
(Beifall bei der FPÖ.)
Zu dem, Kollege Schennach, was
du bei den Demonstrationen gesehen hast, kann ich dir nur sagen: Wenn wir das
gesehen hätten, dann hätten wir
selbst Anzeige gegen diese Personen erstattet. Weißt du, was wir wirklich
gesehen haben? – Menschen, die Angst haben, und Menschen, die
vor genau solchen Entwicklungen, die aufgrund dieser
schwarz-grünen Bundesregierung zweieinhalb Jahre in diesem Land
Einzug gehalten haben, warnen
wollten. (Beifall bei der FPÖ. – Bundesrätin Schumann:
Wo ist jetzt die Rede zum Verbotsgesetz?)
Frau Bundesminister, Sie haben von Fakenews, von
Desinformation im Internet gesprochen, Sie haben von einer präventiven
Wirkung der Paragrafen 3g
und 3h und der Möglichkeit der Diversion gesprochen, und auf das möchte
ich jetzt etwas genauer eingehen. Wir haben nach der Ausschusssitzung eine
schöne Statistik bekommen, die zeigt, dass in der Coronazeit die
Verharmlosung des Nationalsozialismus, wie das gerne von der Einheitspartei
bezeichnet
wird, in die Höhe geschossen ist.
Wisst ihr, was wirklich in die Höhe geschossen
ist? – Die Anzeigen sind in die Höhe geschossen: 2019 waren wir
bei 1 306 Anzeigen und bei 11,3 Prozent Verurteilungen.
Dann ist das Ganze in die Höhe geschossen, weil man gesagt hat: Na
das sind ja – wie hat sie der Vizekanzler genannt? – Neonazis, Rechtsextreme,
Faschisten! Ich weiß nicht, was er noch alles gesagt hat. Dann hat es auf
einmal 2 116 Anzeigen nach dem Verbotsgesetz gegeben, komischerweise
aber sind die Verurteilungen auf 6,5 Prozent gesunken. Im Jahr 2021
hat es, wenn ich jetzt § 3h hernehme, nur in 2,2 Prozent der
Fälle Verurteilungen gegeben. Das ist der wahre Grund, warum Sie dieses
Gesetz heute verschärfen, und das werde ich Ihnen auch anhand eines
konkreten Beispiels näherbringen. (Beifall bei der FPÖ.)
Man kann ja schon fast sagen, das, was Sie hier betreiben,
ist die
wahre Verharmlosung. (Bundesrätin Schumann: Nein, also!) Jemand
hat ein Facebook-Posting mit einem Gesundheitspass abgesetzt, meine sehr
geehrten Damen und Herren, und dazu gepostet: Ich bin den Menschen dankbar,
die noch Zeugnisse aus einer Zeit haben, die nie hätten in Vergessenheit
geraten sollen, und nun stehen wir an derselben Kreuzung! Dann gibt es einen
Kommentar dazu: Das ist der nächste Schritt der Markierung nach der Maske,
die zwar nicht hilft, aber die türkise Familie mitverdient!
Wisst ihr, was darauf folgte? – Eine Anzeige nach
dem Verbotsgesetz, meine sehr geehrten Damen und Herren, und das war dann genau
eine dieser Einstellungen. Weil Sie Regierungskritik nicht vertragen, meine
sehr geehrten Damen und Herren, wollen Sie heute nachschärfen! Das ist der
wahre
Grund. (Beifall bei der FPÖ. – Bundesrätin Schumann:
Na geh! – Bundesrat Schreuder: NS-Wiederbetätigung
ist keine Regierungskritik! Das ist doch nicht dasselbe! Entschuldigung! Das
ist nicht dasselbe! NS-Wiederbetätigung ist nicht Regierungskritik! Das
ist nicht dasselbe!)
Kollege Schreuder, jetzt hör einmal zu! (Zwischenruf des Bundesrates Gross.) – Kollege Gross, das würde ich mir anschauen lassen! Permanent irgendetwas herauszurufen, ohne gefragt zu sein, das würde ich mir wirklich anschauen
lassen! (Beifall bei der FPÖ. – Bundesrat Gross: Mein Gott, ihr armen Freiheitlichen! – Bundesrätin Hauschildt-Buschberger: Also in Zukunft keine Zwischenrufe mehr der FPÖ, ich freue mich! – Weitere Zwischenrufe bei den Grünen.)
Der nächste Kommentar: Bald kommen wir wieder in eine
Zeit, in der differenziert wird, und alle schauen zu, weil sie nichts
gelernt haben! – Ist das
eine Verharmlosung des Nationalsozialismus?– Ganz sicher nicht, meine
sehr geehrten Damen und Herren! Nach Ihrer Gesetzesänderung hätten
wir
da bei der Verurteilung nicht null stehen,
wir hätten bei der Verurteilung eins stehen. Und das ist das, was
Sie wollen, und deswegen ist dieses Gesetz schlicht und ergreifend abzulehnen,
Frau Bundesminister! (Beifall bei der FPÖ.)
Es gibt noch viele weitere Beispiele: Die Jagd auf Menschen kann beginnen! – Es gab eine Anzeige nach dem Verbotsgesetz. (Zwischenruf des Bundesrates Schreuder.) Und jetzt als Draufgabe – als Draufgabe! – ein Facebook-Posting mit einem Meerschweindlkäfig, hergerichtet nach der Wikingerzeit, mit der Aufschrift: Sisi. – Es gab eine Anzeige nach dem Verbotsgesetz, weil das Wikinger-S ausschauen soll wie die Runen damals im Zweiten Weltkrieg.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir das bestrafen
wollen – und ja, das wäre mit diesem Gesetz möglich –,
schützen wir niemanden, da schützen wir keine einzige
Volksgruppe (Bundesrat Schreuder: Dann haben wir wieder die
Hakenkreuze!), für die dieses Gesetz eigentlich gedacht gewesen wäre. Das,
was Sie da machen, ist nichts anderes als eine wirkliche Verharmlosung,
und dafür ist dieses Gesetz schlicht und ergreifend nicht gedacht,
meine sehr geehrten Damen und Herren. (Beifall bei der
FPÖ. – Bundesrat Schreuder: Also erlauben wir
wieder die Hakenkreuze?! Es geht um Ihre Wählerschaft! –
Bundesrat Schennach: Und die Liederbücher nicht vergessen!)
Eines kann ich Ihnen schon noch
sagen: Ganz egal, was Sie heute hier beschließen, die
Bevölkerung wird sich auch in Zukunft nicht alles von dieser Regierung gefallen
lassen. Wenn eine Regierung Ansätze wie diese hat und die Bevölkerung
vor totalitären Zügen warnt, wie es die letzten zweieinhalb
Jahre der Fall gewesen ist, wenn diese Bundesregierung den Menschen die Grund-
und Freiheitsrechte nimmt, dann kann man das Verhalten der Menschen, glaube
ich, nicht in Verbindung mit dem Verbotsgesetz bringen. Und wenn
unsere Bevölkerung auf die Straße geht, weil sie Angst vor einem
Genexperiment hat – ich sage nur Impfpflicht, Frau
Bundesminister–, dann
geht unsere Bevölkerung zu Recht auf die Straße, und ich bin froh,
dass sie auf die Straße gegangen ist. (Beifall bei der
FPÖ. – Bundesrat Himmer: Gott sei
Dank sind wir bei der Impfpflicht gelandet! Markus, das wäre
mein ...! Keine Rede ohne Impfpflicht!)
Wenn es das nicht gegeben
hätte, wenn es die Demonstrationen nicht gegeben hätte, dann
würden wir uns heute hier herinnen nicht über diese Gesetzesänderung
unterhalten, Kollege Himmer, das muss man auch einmal klar
und deutlich sagen! (Beifall bei der FPÖ.)
Das Wording zieht sich ja schon seit drei Jahren durch diese Bundesregierung. Kogler hat am 9.12.2021 bereits gesagt: „wenn Staatsverweigerer, Demokratiefeinde, Neonazis und Neofaschisten“ in unseren Straßen spazieren, und so weiter.
Frau Bundesminister, Sie missbrauchen das Verbotsgesetz, um
friedliche und rechtschaffene Bürger zu kriminalisieren. (Bundesrat Schreuder:
Hast du
das Gesetz gelesen?) Bei totalitären Fantasien muss jeder schön
still sein (Zwischenruf der Bundesrätin Kittl), das ist
das, was Sie wollen, nämlich diese Menschen in ein rechtes Eck stellen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, das ist die wahre Verharmlosung des
Nationalsozialismus. Schämen Sie
sich, Frau Bundesminister! (Beifall bei der FPÖ. –
Bundesrätin Kittl: Schämen Sie sich! – Bundesrat Schreuder: Geh bitte! Also! Das ist
ja wohl eine jenseitige ...!)
18.58
Präsidentin
Mag.a Claudia Arpa: Weitere
Wortmeldungen dazu
liegen mir zurzeit nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Somit ist die Debatte geschlossen.
Wir kommen nun zur Abstimmung, die Plätze wurden bereits eingenommen.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte,
die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates
keinen Einspruch
zu erheben, um ein Handzeichen. –
Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag
ist somit angenommen. (Bundesrätin Schumann:
War das keine Zweidrittelmaterie?)
Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das GmbH-Gesetz, das Aktiengesetz, das Genossenschaftsgesetz, das SE-Gesetz, das SCE-Gesetz und das Firmenbuchgesetz geändert werden (Gesellschaftsrechtliches Digitalisierungsgesetz 2023 – GesDigG 2023) (2228 d.B. und 2341 d.B. sowie 11396/BR d.B.)
Präsidentin Mag.a Claudia Arpa: Wir gelangen nun zum 16. Punkt der Tagesordnung.
Als Berichterstatterin ist Frau
Bundesrätin Barbara Prügl gemeldet. – Ich
bitte um den Bericht. Bitte sehr.
Berichterstatterin
Barbara Prügl: Ich bringe den
Bericht des Justizausschusses über den
Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2023 betreffend
ein Bundesgesetz, mit dem das GmbH-Gesetz, das Aktiengesetz, das
Genossenschaftsgesetz, das SE-Gesetz, das SCE-Gesetz und das Firmenbuchgesetz geändert werden,
Gesellschaftsrechtliches Digitalisierungsgesetz 2023.
Im Wesentlichen beinhaltet es die Einrichtung eines Systems zur Disqualifikation von Geschäftsführern und Vorstandsmitgliedern. (Vizepräsidentin Göll übernimmt den Vorsitz.)
Der genaue Inhalt liegt Ihnen schriftlich vor, ich komme daher gleich zur Antragstellung:
Der Justizausschuss stellt nach Beratung der Vorlage
mehrstimmig den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des
Nationalrates keinen Einspruch
zu erheben.
Vizepräsidentin Margit Göll: Vielen Dank für den Bericht.
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Dr. Manfred Mertel. – Bitte sehr.
Bundesrat Dr. Manfred Mertel (SPÖ, Kärnten): Sehr geschätzte Frau Präsidentin! Sehr geschätzte Frau Ministerin Dr. Zadić! Gestatten Sie mir, da das meine letzte Rede im heurigen Jahr ist, mich bei den Präsidentinnen für die Vorsitzführung, die nicht sehr einfach war, zu bedanken. Ich darf heute auch von einer Länderkampfstimmung hier sprechen, wenn ich das aus der Perspektive des Fußballs sehe. (Heiterkeit der Bundesrätin Neurauter.)
Ich habe heute vieles gehört, sehr aufmerksam die Debatten verfolgt und möchte jetzt vieles zum Ausdruck bringen, was mir dadurch auch am Herzen liegt.
Wenn wir von den Zahlen
ausgehen, die wir heute gehört haben – wir liegen dort und
dort, an der und der Position –, so möchte ich ein bisschen
einen Vergleich mit Trainern bringen, die an und für sich nicht erfolgreich
sind, weil sie das Spiel nicht verfolgen. Sie wissen zwar, wie hoch die
Passquote ist, sie
wissen auch, wie hoch der Spielanteil ist, aber sie bekommen das Spiel unter
den Mitmenschen eigentlich nicht mit.
Ich glaube, das sollten
wir verhindern, denn der zweite Aspekt, den ich noch einbringen
möchte, ist folgender: Als ich heute um 7 Uhr gefrühstückt
habe, bin ich auf einer Ebene mit anderen gesessen. Ich bin gesessen, die
anderen
haben schwer gearbeitet, das waren circa 20 Bauarbeiter, die ein
Mehrparteienhaus errichten. Ich habe mir dabei gedacht: Die stehen am
20. Dezember bei Wind, Sturm und bei Regen den Dienstgebern
zur Verfügung und machen einen tollen Job.
Dann habe ich mich erinnert und
habe zu mir gesagt: Von unserem Steueraufkommen kommen 85 Prozent von
den Konsument:innen und von
den Dienstnehmern. Und wenn wir das verfolgen, so sollten wir doch ein bisschen
auch zu dem heutigen Thema, Frau Dr. Zadić, zu dem wir sprechen,
einen Bezug herstellen. Wir sprechen ja von einer EU-Vorgabe, die in nationales
Recht umzusetzen ist, und die von disqualifizierten Geschäftsführern
spricht. Und warum stelle ich diesen Bezug her? – Weil mich heute
auch Kollege Steiner dazu animiert hat. Wenn Sie sich erinnern - - (Bundesrat
Schennach: Der ist nicht da!) – Ja, das
macht nichts, aber ich möchte diesen Vergleich bringen. Vielleicht lehnen
Sie ihn ab, aber vielleicht finden Sie etwas
dabei, was man in Zukunft verändern kann.
Wenn wir Kinder am ersten
Schultag in die Volksschule begleiten, so kommt uns in den Sinn: Was wird wohl
aus diesem Kind in sieben bis acht Jahren? Wir wünschen dem Kind eine
erfolgreiche Schullaufbahn. Wenn es dann vielleicht nach vier Jahren
Volksschule entweder in das Gymnasium oder in eine
neue Mittelschule eintritt, fragen wir uns: Was wird in den nächsten
sieben bis acht Jahren aus diesem Kind? Wird es eine Lehre machen? Wird es die
Matura anstreben? Wenn wir dann mit Blick auf dieses Kind in einem Alter von
15 Jahren die Überlegung anstellen, okay, er macht eine Lehre: Wird
er in
sieben oder acht Jahren vielleicht die Meisterprüfung machen? Wenn Leute
die Matura schaffen, dann werden wir uns überlegen, wie sie in den
nächsten
sieben Jahren vielleicht ihr Doktorat schaffen oder ihre Fortsetzung im
Berufsleben sehen.
Warum sage ich das? – Weil mich Kollege Steiner, wenn ich ihn so ansprechen darf, auf etwas gebracht hat. In diesem Saal sitzen drei Parteien, die in den letzten sieben Jahren die Regierungsverantwortung innegehabt haben. Die Österreicher werden sich fragen: Was ist eigentlich in diesen sieben Jahren alles passiert? Und jetzt komme ich wieder zu dieser Fehlpassquote, von der man sagt, die ist ja gar nicht so schlecht. (Bundesrat Schennach: Entschuldige, die haben
aber auch Regierungsverantwortung gehabt!) – Drei Parteien. (Ruf: ... vier Parteien ...!) Ich will sie nicht nennen, ich habe einen anderen Stil, aber ich glaube, jeder darf sich angesprochen fühlen, wenn er mitgewirkt hat.
Ich darf mich auf das beziehen,
was du jetzt als Einwand gebracht hast. Es
ist eine Partei hier im Saal, mit dem Kollegen Arlamovsky, die gar nicht
eingeladen worden ist (Bundesrat Schennach: Öh!) zu
Regierungsgesprächen. Der damalige Geschäftsführer hatte ja eine
ganz andere Vorstellung. Er hat gesagt, die
Sozialpartnerschaft, die über Jahrzehnte funktioniert hat, ist uns ein
Dorn im Auge. Und jetzt müssen wir wieder auf die Sozialpartnerschaft
zurückgreifen, um all die Probleme zu lösen.
Nun komme ich zu dem
eigentlichen Thema, Frau Dr. Zadić: dass die Geschäftsführerverantwortung
in einer Gesellschaft eine sehr wichtige ist und auch
eine Vorbildwirkung hat. Und wenn man sich den Gesetzesbeschluss des Nationalrates
anschaut, so kommt man doch darauf, dass wir sehr, sehr milde
mit betrügerischen, missbräuchlichen Gestaltungsformen in der
Geschäftsführung umgehen.
Wir sagen, es gibt keine
Ex-lege-Enthebung von dieser Funktion, sondern es muss eine rechtskräftige
Verurteilung vorliegen – das muss natürlich vorauslaufen,
das ist keine Frage –, aber er kann selbst seinen Rücktritt
erklären, und nach 14 Tagen sollte er seiner
Geschäftsführerposition enthoben
sein. Wenn er das nicht macht, so dauert es über Monate, dauert es
über Zeiträume, in denen wir nicht verfolgen können, was da
tatsächlich passiert.
Es ist also dann das Firmenbuchgericht am Zug, und wie schnell die Daten zur
Verfügung stehen, können wir alle nicht abschätzen.
Ich möchte zum Schluss kommen und Ihnen als Ministerin sagen – ich habe Ihnen das schon einmal im Juni, glaube ich, gesagt, als es um die Korruption gegangen ist –, dass wir vorbildhaft agieren müssen. Die Vorbildhaftigkeit oder Vorbildwirkung muss von uns politisch Tätigen vorangestellt werden. Und wenn wir uns nur in einer Aufgabenerfüllung begegnen, dass wir sagen,
wir müssen diesen Staat, dieser Gesellschaft und
letztendlich auch unseren Unternehmen dienlich sein, dann werde ich
auch die Frage beantworten können, die ich mir heute selbst gestellt habe:
Was wird aus diesen Bauarbeitern, die heute bei Wind, Sturm und Regen ihre
Arbeit für eine Immobilie, die sicherlich dann auch dem freien Markt zur
Verfügung gestellt wird,
wo wahrscheinlich wiederum Gewinne lukriert werden, verrichtet haben? Das ist
natürlich aus der Sicht der Unternehmer durchaus auch in Ordnung, aber
als ich daran gedacht habe, dass man die Hacklerregelung abgeschafft hat, ist
mir bei dem heutigen Anblick, obwohl ich in der warmen Stube gesessen bin,
kalt geworden. (Beifall bei der SPÖ.)
Meine sehr geschätzten Damen und Herren, ich darf
Ihnen, Frau Ministerin, sagen, ich glaube, dass Sie persönlich, Sie
selbst immer ein Bestreben haben,
die Dinge so zu sehen, wie sie eigentlich zu sehen sind, aber dass Ihnen
mit einem Koalitionspartner in Ihren Tätigkeiten doch sehr oft die
Hände gebunden sind. – Danke für die Aufmerksamkeit. (Beifall
bei der SPÖ.)
19.08
Vizepräsidentin Margit Göll: Weiters zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin MMag. Elisabeth Kittl. – Bitte.
Bundesrätin
MMag. Elisabeth Kittl, BA (Grüne, Wien):
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau Ministerin! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! (Bundesrat Schennach: Wien nicht
vergessen!) – Bitte? (Bundesrat Schennach: Wien nicht
vergessen!) – Liebe Wiener Kollegen und Kolleginnen! (Heiterkeit
bei Bundesrät:innen von SPÖ und Grünen.) Liebe
Zuseher:innen vor den Bildschirmen! Ganz kurz und leider relativ trocken, aber
ein bisschen schneller, möchte ich wieder zum Thema
zurückkehren. Ich habe zwar gedacht, Sie erzählen mir etwas, Herr
Kollege Mertel, über die Disqualifikation, nämlich auch im
Fußball.
Da habe ich mir gedacht, das interessiert mich, wie man da den Link schafft,
aber das machen Sie vielleicht dann später noch in der Pause.
Es geht heute darum, dass Personen, die mit einer mehr als
sechsmonatigen Freiheitsstrafe aufgrund von wirtschaftsnahen
strafbaren Handlungen rechtskräftig verurteilt werden, drei
Jahre lang nicht mehr als Geschäftsführer in einer GmbH, als
Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft oder Genossenschaft
oder Direktor:in einer Europäischen Genossenschaft tätig sein
dürfen.
Das Firmenbuch wird automationsunterstützt – ich glaube, das ist ganz wichtig in dem Fall – ab dem nächsten Jahr prüfen, ob so eine strafbare Handlung vorliegt, und falls sie vorliegt, disqualifiziert das quasi die Person als Vertretungsorgan dieser Kapitalgesellschaft, und das Firmenbuch fordert die Gesellschaft auf, diese disqualifizierte Person unverzüglich abzuberufen. Tut sie das nicht, wird diese Person innerhalb von zwei Monaten – das geht also maximal zwei Monate – von Amts wegen gelöscht, und die Person gilt als abberufen.
Diese Abberufung tritt damit
aber schon nach dem rechtskräftigen Urteil
ein, ohne dass es einer zusätzlichen gerichtlichen oder behördlichen
Entscheidung bedarf, also quasi ex lege. Das ist eigentlich das, was Sie
gefordert haben, liebe SPÖ. Das ist im Gesetz so vorgesehen, daher
könnten Sie jetzt zustimmen.
Wichtig ist aber da, und das
eben, weil es eine EU-Richtlinien-Umsetzung ist, dass es einen
grenzüberschreitenden Austausch von Informationen
über disqualifizierte vertretungsbefugte Gesellschaftsorgane zwischen
allen europäischen Handelsregistern über die EWR-Registervernetzung
gibt.
Dieses Gesetz ist in dem Sinn auch so wichtig, weil es die wirtschaftsnahen Delikte sind, die von einer Vertretung einer Kapitalgesellschaft ausschließen. Taxativ aufgezählt: Da geht es um Betrug, da geht es um Untreue, um Fördermissbrauch, um organisierte Schwarzarbeit und Geldwäscherei, um Absprachen, aber auch um Abgabenbetrug. Das sind Delikte, die zum Schaden von Personen führen, die mit der Gesellschaft zu tun haben, aber das sind
auch Delikte, die dem Sozialstaat schaden, weil der Sozialstaat um Abgaben gebracht wird, und die auch natürlich der Wirtschaft im Gesamten schaden, weil die Personen, die Gesellschaften, die sich redlich verhalten, einen Nachteil am Markt haben.
Es wurde in der Diskussion – nicht jetzt, aber schon
davor – auch behauptet, dass nun niemand mehr
Geschäftsführer:in werden will. Das ist meiner Meinung nach ziemlich realitätsfremd, denn einerseits
sind das gutbezahlte Jobs, und
zwar genau deswegen, weil sie mit Verantwortung einhergehen, und
zweitens greift die Disqualifizierung dieser Geschäftsführer:innen
oder vertretungsbefugten Personen von Kapitalgesellschaften nur dann, wenn
das strafrechtliche Delikt mit mehr als sechs Monaten Freiheitsstrafe bedroht
ist – und das
ist meistens mit einem Vorsatz, also mit einer absichtlichen Handlung verbunden.
Daher ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, warum die SPÖ und auch die FPÖ diese Regelung ablehnen, die eigentlich das Vertrauen in das wirtschaftliche Gebaren stärkt und vor allem grenzüberschreitende Rechtssicherheit vorantreibt. – Danke schön. (Beifall bei Grünen und ÖVP.)
19.13
Vizepräsidentin Margit Göll: Weiters zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Marlies Doppler. – Bitte sehr.
Bundesrätin Marlies Doppler
(FPÖ, Salzburg): Frau
Vizepräsidentin! Frau Minister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Es
wird heute ein Gesetz beschlossen, mit dem die EU-Digitalisierungsrichtlinie
umgesetzt werden soll, nämlich im Hinblick auf disqualifizierte
Geschäftsführer. Es geht darum, dafür zu sorgen, dass
Geschäftsführer, welche kriminelle und/oder betrügerische
Handlungen gesetzt haben, nicht mehr als Geschäftsführer in
einem Unternehmen
tätig sein dürfen. Das klingt ja so weit ganz gut. Jedoch ist der
Teufel wie so oft
im Detail verborgen. Daher können wir Freiheitliche
heute der Umsetzung
dieser EU-Richtlinie in das nationale Recht nicht zustimmen.
Es gibt keinen
abschließenden, taxativen Katalog, wann jemand nicht mehr als
Geschäftsführer eingesetzt werden darf, und genau das macht die Geschichte brandgefährlich,
denn durch die schwammige Formulierung besteht die Gefahr von Willkür in
diesem Bereich, und diese Gefahr ist eklatant. (Beifall
bei der FPÖ.)
Mit unserer Ansicht folgen wir auch dem Obersten Gerichtshof. Dieser hat nämlich gemeint, dass die Art und Weise, wie die Umsetzung erfolgt, viel zu weitläufig ist und am eigentlichen Ziel vorbeigeht, was fast schon richtlinienwidrig ist. Wie gesagt: Wir Freiheitliche können dieser Gesetzesvorlage aus diesen Gründen nicht zustimmen. – Danke schön. (Beifall bei der FPÖ.)
19.14
Vizepräsidentin Margit Göll: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Mag. Christine Schwarz-Fuchs. – Bitte.
Bundesrätin Mag. Christine Schwarz-Fuchs (ÖVP, Vorarlberg): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Frau Ministerin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Geschätzte Zuseherinnen und Zuseher vor den Bildschirmen! Worum es in dieser Gesetzesvorlage geht, hat meine Vorrednerin Bundesrätin Kittl schon im Detail ausgeführt, darum muss und werde ich darauf gar nicht mehr eingehen.
Ich möchte nun ein bisschen auf das eingehen, was meine Vorrednerin Marlies Doppler gesagt hat, und zwar dass es da um Willkür geht. (Bundesrätin Doppler: Dass die Gefahr besteht!) – Dass die Gefahr besteht, dass es um Willkür gehen könnte. (Bundesrätin Doppler: Bitte die Unterscheidung zu machen!)
Ganz generell ist es so, dass
die EU-Mitgliedstaaten bei der Festlegung, welche Tatbestände eine
Disqualifikation auslösen, frei sind. Um aber ein hohes
Maß an Rechtssicherheit zu gewährleisten, ist bei uns in
Österreich eben vorgesehen, dass ausschließlich eine
Verurteilung aufgrund von wirtschaftsnahen Delikten
ausschlaggebend ist. Das schränkt das Ganze also schon ein,
ich sehe da also keine Gefahr von Willkür. (Zwischenruf der
Bundesrätin Doppler.)
Es gibt ja sogar auch einen
entsprechenden Deliktskatalog, der die strafbaren Handlungen
aufzählt, die zu einer Disqualifikation führen. Die sind auch in der
Gesetzesvorlage angeführt. Ich möchte ein paar noch einmal nennen,
Kollegin Kittl hat eh auch schon einige aufgezählt. Wirtschaftsnahe
Delikte sind zum Beispiel Betrug, Untreue, Förderungsmissbrauch,
Vorenthaltung von Dienstnehmerbeiträgen zur Sozialversicherung oder
organisierte Schwarzarbeit, betrügerische Krida, Schädigung fremder
Gläubiger oder auch
Abgabenbetrug.
Die Disqualifikationen in
anderen Mitgliedstaaten, die dort vielleicht auch aufgrund anderer
Verurteilungen möglich sind, müssen in Österreich nicht
automatisch anerkannt werden. Damit alle EU-Mitgliedstaaten Informationen
über eine geltende Disqualifikation erhalten können, haben die
Mitgliedstaaten, wie wir bereits gehört haben, ein System zum
grenzüberschreitenden Informationsaustausch über disqualifizierte
Geschäftsführer einzurichten.
Die Zuständigkeit für diesen grenzüberschreitenden
Informationsaustausch wird für ganz Österreich dem Handelsgericht
Wien übertragen.
Die gegenständliche Gesetzesvorlage dient dem Schutz
der Allgemeinheit beziehungsweise außenstehender Dritter vor
ungeeigneten Geschäftsführern.
Das ist sehr wichtig, und daher bitte ich Sie alle um Zustimmung. –
Vielen Dank. (Beifall bei der ÖVP und bei Bundesrät:innen der
Grünen.)
19.18
Vizepräsidentin Margit Göll: Weitere Wortmeldungen dazu liegen nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Es ist dies
nicht der Fall. Somit ist
die Debatte geschlossen.
Wir gelangen zur Abstimmung. – Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein.
Ich ersuche jene
Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den
vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch
zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit,
somit ist der Antrag angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2023 betreffend ein
Bundesgesetz, mit dem ein Flexible-Kapitalgesellschafts-Gesetz erlassen
wird sowie
das GmbH-Gesetz, das Firmenbuchgesetz, das Rechtspflegergesetz,
das Notariatstarifgesetz, das Rechtsanwaltstarifgesetz, das Wirtschaftliche Eigentümer
Registergesetz und das Gerichtsgebührengesetz geändert werden (Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz
2023 – GesRÄG 2023) (2320 d.B. und 2342 d.B. sowie
11397/BR d.B.)
Vizepräsidentin Margit Göll: Wir gelangen nun zum 17. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatterin ist Frau Bundesrätin Sandra Lassnig. Ich bitte um ihren Bericht.
Berichterstatterin Sandra Lassnig: Frau Vizepräsidentin! Ich bringe den Bericht des Justizausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein Flexible-Kapitalgesellschafts-Gesetz erlassen wird sowie das GmbH-Gesetz, das Firmenbuchgesetz, das Rechtspflegergesetz, das Notariatstarifgesetz, das Rechtsanwaltstarifgesetz, das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz und das Gerichtsgebührengesetz geändert werden.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher gleich zur Antragstellung:
Der Justizausschuss stellt nach Beratung der Vorlage mehrstimmig den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. – Danke.
Vizepräsidentin Margit Göll: Vielen Dank für den Bericht.
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Mag. Elisabeth Grossmann. – Bitte.
Bundesrätin Mag. Elisabeth Grossmann (SPÖ, Steiermark): Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau Ministerin! Sehr geehrte Damen und Herren! Ja, Flexibilität ist also das neue Zauberwort bei Firmengründungen, flexible Kapitalgesellschaften sollen möglich werden.
Flexi-KG soll das Ding
heißen, schnell gegründet mit einer Urkunde, die auch von einem
Advokaten, einer Advokatin im EU-Ausland aufgesetzt werden kann.
Sie können dann auch Eintragungen im Firmenbuch vornehmen. Das Mindeststammkapital –
und damit der Haftungsstock – soll massiv reduziert
werden, Anteilsübertragungen können auch ganz flott, wie es geplant
ist,
ohne Notarin, ohne Notar stattfinden.
Gerade Notarinnen –
es gibt sehr wenige, leider! –, Notare, die bisher als über
Parteiinteressen stehende, neutrale Instanzen für besondere Prüfgenauigkeit und
Transparenz unverzichtbar waren, braucht es künftig für derartige
Gründungen eigentlich nicht mehr, weil ja alles easy-peasy und flott und
schnell und flexibel gehen soll.
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Werte Frau Ministerin! Das ist das absolut falsche Signal zum falschen Zeitpunkt. (Beifall bei der SPÖ.)
Wir bekommen ja ganz deutlich
vor Augen geführt, welch großer Schaden gerade durch verschachtelte
Firmenkonstruktionen angerichtet wird,
wie schwierig sich dann die Ermittlungsarbeiten gestalten und welche Probleme
da entstehen. Da gehen Schnelligkeit und Flexibilität wirklich auf Kosten
der Transparenz und der Sicherheit im Sinne der Haftungssicherheit. Das ist absolut
abzulehnen.
Positiv ist aber, dass diese Regierungsvorlage erstmals
ausschließlich in
der weiblichen Form formuliert ist. Das ist eine willkommene Abwechslung und
absolut begrüßenswert, macht aber den Inhalt leider nicht besser. (Beifall
bei der SPÖ.)
19.22
Vizepräsidentin Margit Göll: Weiters zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin MMag. Elisabeth Kittl. – Bitte sehr.
Bundesrätin MMag. Elisabeth Kittl, BA
(Grüne, Wien): Werte
Präsidentin! Liebe Frau Ministerin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe
Zuseher:innen vor
den Bildschirmen! Ja, zum ersten Mal wurde ein Gesetzentwurf geschrieben, der
in seiner Wortwahl nur Frauen zu adressieren scheint, aber Männer sind
natürlich mitgemeint.
Noch dazu handelt es sich um ein Gesetz über Start-ups, über Gründerinnen von Unternehmen, von Kapitalgesellschaften, ein Gesetz, das den Mut und die Innovationskraft unterstützt, ein Gesetz übers Wirtschaften und ein Gesetz über den Erfolg.
Was für ein Zeichen, mit
diesem Gesetzesinhalt Frauen direkt anzusprechen! Ja, das tut es unumwunden, es
spricht Frauen direkt an. Das tun auch viele
andere Gesetze, wenn sie in rein männlicher Form geschrieben sind, dann
sprechen sie nämlich direkt Männer an. Und ja, wir Frauen waren
vielleicht
immer mitgemeint, aber wir wurden nie angesprochen.
Die Sprache aber gibt uns die Möglichkeit, alle Gemeinten auch anzusprechen. Sogar das Internet kapiert das. Es kennt das Mitgemeinte gar nicht. Geben Sie Ärzte ein, dann kommen so gut wie nur Männer. Geben Sie Ärztinnen
ein, dann kommen nur Frauen. Das ist auch logisch,
denn das Bezeichnete
wird gezeigt. Das nennen wir auch Definitionsmacht. Wenn ich definiere,
dass Frauen bei Ärzten, Doktoren, Politikern, Präsidenten, Pflegern
oder
Lehrern mitgemeint sind, dann erkläre ich damit, dass die weiblichen Vertreterinnen
dieser Professionen nicht wichtig sind und sie daher nicht sichtbar sein
müssen.
Warum aber ist es durchaus
üblich, von Friseurinnen, Kassiererinnen, Kindergärtnerinnen und Krankenschwestern zu sprechen? Kommt dabei nur
ein Mann vor, wird sofort gegendert oder ein neues Wort erfunden.
Sprache
ist ein Machtinstrument und sie ist alles andere als zeitlos. Oder wollen wir
die Sprache von vor über 300 Jahren für Gesetzestexte
verwenden? – Natürlich nicht. Wir wollen, dass Frauen
sichtbar sind und dass sie gleichberechtigt sind. Mit der Form dieses Gesetzes
setzen wir dafür ein Zeichen. (Beifall
bei den Grünen sowie bei Bundesrät:innen von ÖVP und SPÖ.)
Ein letzter Satz noch, weil ich mir sicher bin, dass die FPÖ wieder die Traditionen hochhalten wollen wird: In Wirklichkeit aber – das zeigen Sie immer wieder! – fehlt es Ihnen am Willen, an der Schaffenskraft und an der Fähigkeit, sich auf die tatsächlichen und sich natürlich permanent verändernden Verhältnisse einzustellen, sowohl in der Gleichberechtigung als auch im Umweltschutz und im Unternehmensrecht. (Beifall bei den Grünen sowie bei Bundesrät:innen von ÖVP und SPÖ.)
Nun aber zum Inhalt des Gesellschaftsrechtsänderungspakets: Es wird nun eine neue innovative und international schon erprobte Gesellschaftsform, nämlich die flexible Kapitalgesellschaft, geschaffen. Sie ist eine Art Hybridform, eine Mischung aus den Vorteilen der Aktiengesellschaft und der veränderten GesmbH. Damit soll eine Gestaltungsmöglichkeit – das ist ein wichtiger Punkt – im Gesellschaftsvertrag geschaffen und ein geringeres Stammkapital angesetzt werden. Damit folgen wir den Bedürfnissen von Start-ups und deren Gründer:innen und machen Österreich auch für innovative Betriebe attraktiver.
Wir wissen auch, dass Neugründer:innen nicht immer die Reichsten sind, deswegen ist diese dauerhafte Herabsetzung auf 10 000 Euro durchaus begrüßenswert, sie befindet sich übrigens im europäischen Mittel.
Aufgrund dieser verringerten
Bemessungsgrundlage reduzieren sich als weitere gute Folge auch die dafür
notwendigen Notariatsgebühren wesentlich, die
bei der Errichtung solch einer Flexkap anfallen. Das betrifft in etwa
15 000 GmbH-Gründungen pro Jahr, also eine ganz schöne
Menge an Gründer:innen.
Um diesen modernen und meist
auch sogar hierarchieflachen, aber auch identifikatorischen
Unternehmensformen gerecht zu werden und um auch Anreize für Mitarbeitende
zu schaffen, zum Erfolg des Unternehmens beizutragen, wird es nun relativ
einfach die Möglichkeit geben, andere Personen durch Unternehmenswertanteile
am Gewinn des Unternehmens zu beteiligen. Ich betone wert so
sehr, weil es da nicht um Anteile geht, wie fälschlich gesagt
wurde oder wie vielleicht fälschlich verstanden wurde, es geht nicht um
eine Anteilsübertragung im klassischen Sinn, sondern es geht
eigentlich um die Gewinnanteilsübertragung.
Dass so etwas möglich ist,
wird im Gesellschaftsvertrag und von einem Notar beglaubigt. Es wird aber auch
im Gesetz vorgesehen, dass nur maximal 25 Prozent dieser Kapitalanteile an
Gewinnbeteiligungen ausgegeben werden dürfen. Das Wichtige daran ist:
Diese Gewinnbeteiligungen sind nicht mit
einem Stimmrecht verbunden, nehmen also keinen Einfluss auf das Unternehmen.
Zudem sind – wir haben es im Ausschuss gehört – das
Firmenbuch
und das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz uneingeschränkt
anwendbar.
Dieses von vielen Expert:innen – im
Justizministerium unter anderem –
drei Jahre lang ausgearbeitete und sehr wohl an internationalen Vorbildern ausgerichtete
Gesetz wird also kleinere und mittlere Unternehmen stärken
und fördern. Das ist meiner Meinung nach das richtige Signal, denn es
begrüßt
Innovation und stärkt den Binnenmarkt. – Vielen Dank. (Beifall bei den Grünen und bei Bundesrät:innen der ÖVP.)
19.28
Vizepräsidentin Margit Göll: Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Andreas Arthur Spanring. – Bitte.
Bundesrat
Andreas Arthur Spanring (FPÖ, Niederösterreich): Frau Vorsitzende! Frau Minister! Geehrte Damen
und Herren im Bundesrat! Liebe Zuschauer
hier herinnen und vor den Bildschirmen! Ich habe eine Frage an Frau Kollegin
Kittl, weil sie das so betont hat: Heißt das jetzt, es dürfen nur
Frauen diese Flexkap gründen? (Bundesrätin
Kittl: Nein, Sie haben es falsch verstanden, Sie sind mitgemeint!) – Aha, okay. Das hat so geklungen. Ich fühle
mich eh mitbetroffen. (Bundesrat Schreuder: Keine
Sorge, Sie dürfen auch! – Bundesrat Schennach: Keine
Diskriminierung für Spanring!)
Wir diskutieren also dieses
Flexible-Kapitalgesellschafts-Gesetz, gegen das wir auf jeden Fall aus mehreren
Gründen Einspruch erheben werden. Ein Grund, warum wir gegen diesen
Gesetzentwurf Einspruch erheben werden, ist, weil es bei der Übertragung
von Gesellschaftsanteilen einen neuartigen Akt gibt, dass man
nämlich – und die Grundidee ist gut – bei
erfolgreichen Start-ups Unternehmerbeteiligungen steuerlich begünstigen
kann. Wie gesagt,
das wäre nachvollziehbar. Das ist aber im Steuerrecht lösbar, dazu
braucht man sicher keine neue Gesellschaft zu erfinden, die wieder nichts
anderes als
ein neuerliches Experiment ist.
Wir erinnern uns an die GesmbH light. Das war ein Experiment, das erstens ordentlich schiefgegangen ist und zweitens Österreich damals zu einer internationalen Lachnummer abgestempelt hat.
Jetzt wird das Stammkapital der GesmbH quasi von 35 000 Euro auf 10 000 Euro heruntergesetzt. Das gab es zwischendurch schon, dann ist es wieder hinaufgesetzt worden, jetzt setzt man es wieder herunter. Also, es ist halt
nicht wirklich durchdacht, und durch diese Senkung wird natürlich der österreichische Staat auch wieder viel Geld verlieren. Das ist Ihnen eh wurscht – koste es, was es wolle –, weil Sie nach Ihrer Regierungszeit verbrannte Erde hinterlassen.
Übrigens: Es wäre zum Beispiel ein Ansatz gewesen, Gründung einfacher zu machen. Das ist aber auch nicht der Fall. Es ist nach wie vor relativ komplex, um nicht zu sagen: kompliziert. Also Verbesserungen sind da nicht wirklich erkennbar.
Eine neue Urkunde soll eingeführt
werden, die dann einen Notariatsakt ersetzt. In Österreich, denke ich,
weiß man, was ein Notariatsakt ist. Das ist das,
was allen Beteiligten immer irrsinnige Rechtssicherheit bietet. Das wird eben
da durch eine Anwaltsurkunde – auch von Anwälten aus anderen
Staaten –
ersetzt. Das ist in Wahrheit eine Hinunternivellierung unserer hohen Standards
in Österreich. (Beifall bei der FPÖ.)
Das ist vor allem deswegen verwunderlich, weil immer und überall der Kampf gegen Geldwäsche als Vorwand genommen wird, um diverse Gesetze durchzuboxen – Stichwort Bargeldabschaffung. Da wird jetzt aber ganz absichtlich eine Möglichkeit zur Geldwäsche neu geschaffen, die es bis dato nicht gab, und alle machen mit. Das ist in Wahrheit das völlig Absurde und Unverständliche daran.
Ein Gesetz sollte grundsätzlich Rechtssicherheit
bringen. Dieses Gesetz ist aber voller Experimente, und eines dieser
Experimente ist auch das Gendern. Natürlich muss ein Gesetz so
ausformuliert sein, dass es möglichst alle verstehen. Gendern bewirkt
aber halt einmal das genaue Gegenteil. (Bundesrat Schreuder: Mah, das tut uns leid! Sorry! So arm, der Herr
Spanring!) Lesen Sie einmal zwei längere Texte, von denen einer
gegendert und der andere ungegendert
ist! Sie werden draufkommen: Der ungegenderte Text ist einfach viel
schöner zu lesen. Das ist nun einmal so. (Beifall bei der
FPÖ. – Oh-Rufe bei der SPÖ.)
Dieses Gesetz ist jetzt in rein weiblicher Form
ausformuliert. Das ist ja an sich schon deshalb unsinnig, weil die deutsche
Sprache nicht männlich ist,
auch wenn Sie das so projizieren wollen. Das generische Maskulinum, das verwendet
wird, ist eine geschlechtsneutrale Formulierung (Bundesrat
Schreuder: Aber Migranten sollen
Deutsch lernen! Na servas!), mit der maskuline Substantive und
maskuline Pronomen etwas geschlechtsneutral zum Ausdruck bringen. Das
verstehen Sie nicht. Ich weiß, die deutsche Sprache ist schwer.
(Bundesrat Schreuder: Frau Zadić und ich wissen das! Wir sind zugewandert!) Besonders bei den Grünen gibt es wieder große Probleme.
Ich werde Ihnen auch gerne heute einige Beispiele bringen,
warum diese gesamte Genderdebatte, die wir jetzt haben, einfach nur
heuchlerisch und unehrlich ist. (Beifall bei der FPÖ. –
Zwischenruf der Bundesrätin Schumann.) Wir sprechen ja oft auch
außerhalb des Plenums miteinander über diverse
Dinge – man trifft sich nach einer Ausschusssitzung und redet
kurz –, und komischerweise oder, viel besser gesagt, Gott sei
Dank gendern da die
wenigsten von Ihnen, fast niemand gendert bei normalen Gesprächen. (Bundesrat
Schreuder: Aber Göttin sei
Dank könntest du wenigstens sagen!)
Merken Sie diese Unehrlichkeit? Entweder reden Sie gegendert
oder nicht, aber das machen Sie offensichtlich nicht. (Beifall bei der
FPÖ. – Bundesrat
Schreuder: Ich sage oft: Göttin
sei Dank!) Sie gendern eben nicht. (Zwischenruf
der Bundesrätin Schumann.)
Der größte Genderer ist ja jetzt Herr Schreuder, der sich
dafür einsetzt.
Ich bin mir sicher, Herr Schreuder, wenn Sie zu Hause bei Ihrer Familie
sind, dann gendern Sie auch nicht. (Bundesrat Schreuder: O ja!) Sie
werden
zum Beispiel auch nicht zu Hause zu Ihrem Mann sagen: Heute gab es viele
Redner:innenbeiträge von Bundesrät:innen vom Redner:innenpult aus,
welche von Zuschauer:innen verfolgt wurden. (Widerspruch bei der SPÖ
sowie des Bundesrates Schreuder.) – So reden Sie
miteinander zu Hause? Das erklärt
alles! Wahrscheinlich sagen Sie, wenn Sie zu Weihnachten zu Hause sind, auch nicht: Liebe Mama, lieber Papa, danke, dass es
euch gibt!, sondern Sie sagen:
Danke, lieber Elternteil eins, und danke,
lieber Elternteil zwei! – Haltet uns nicht alle für dümmer,
als ihr vielleicht selber seid. Nicht böse sein! (Beifall bei
der FPÖ. – Zwischenruf der Bundesrätin Schumann.)
Diese Scheinheiligkeit in der
Debatte haben wir ja hier im Plenum schon erlebt. Dasselbe haben wir mit den
Masken gehabt (Bundesrat Schreuder: Ja! Jetzt
sind sie da! Jawohl! Bullshitbingo! Bullshitbingo eins! Schnapserl trinken! –
Heiterkeit bei der SPÖ): Kameras an! – Oh, ich habe die
Maske aufgehabt! Waren
die Kameras weg, haben alle die Masken unten gehabt. Das ist einfach unehrlich,
aber das ist halt grün-schwarze Politik. (Bundesrätin Schumann:
Gendern
und Masken in einem! – Bundesrat Schreuder: Ja, jetzt fehlen
noch die Ausländer!)
Sie erklären uns ja
immer – Frau Kittl hat es gerade erklärt –, wie
wichtig
das Gendern ist, um die Frauen sichtbar zu machen. Ich kann Ihnen etwas zum
Thema Frauen sichtbar machen sagen (Zwischenrufe bei der SPÖ): Die
größte Gefahr für Mütter – Mütter: Sie
wissen, das sind die Elternteile eins beziehungsweise die gebärenden
Personen, die ihr Leben riskiert haben,
um uns auf die Welt zu bringen (Bundesrat Gross: Wir reden über
das Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz!) – und
Neugeborene besteht während der Geburt und unmittelbar danach. (Bundesrat
Gross: Zur Sache!) Schätzungsweise 2,8 Millionen
Mütter und Babys sterben jedes Jahr während der Geburt oder
unmittelbar danach. Das ist alle 11 Sekunden eine Mutter oder ein Neugeborenes
auf der ganzen Welt.
Sie wissen ganz genauso gut wie ich, dass das verhinderbar
wäre. Man bräuchte dafür eine bezahlbare, qualitativ
hochwertigere Gesundheitsversorgung.
Jetzt kommt’s: Berechnungen zufolge würde das pro Jahr
5 Milliarden Euro kosten. 5 Milliarden Euro: Wissen Sie, was das
ist? – Das ist der Betrag, den Österreich für den ganzen
Testwahnsinn hinausgehaut hat (Bundesrätin Huber: Zur Sache!),
der nichts gebracht hat (Beifall bei der FPÖ), nicht einmal Erkenntnisse.
Damit hätte man mehr als
zwei Millionen Frauen und Kinder retten können, aber das ist wahrscheinlich
der Grund, warum in Entwicklungsländern nicht
gegendert wird. (Bundesrätin Schumann: Ah! Ja!)
Darum: Ein rein weiblich
formuliertes Gesetz ist nichts anderes als ein Placebo der Gutmenschen, bei dem
man sich am Abend auf die Schulter klopft
und sagt: Wow! Schau, was wir heute wieder Tolles gemacht haben! (Bundesrätin
Schumann: Die Frauen sind nicht das FPÖ-Thema!) Ich kann Ihnen
sagen, gar
nichts haben Sie gemacht. Das, was ich Ihnen gerade gesagt habe,
wäre eine Politik für Frauen. (Beifall bei der FPÖ.)
Außerdem missachten Sie
mit der gegenderten Ausformulierung dieses Gesetzes den Willen der
Mehrheitsbevölkerung, denn weit mehr als zwei Drittel der Bevölkerung
wollen das Gendern nicht (Bundesrat Schennach: Aber die Mehrheit sind Frauen!), und Sie
zwingen uns den Willen einer Minderheit auf und verhunzen damit unsere Sprache.
Da passt der Spruch von Mario Barth, der gesagt hat: „Ich gendere nicht,
ich habe einen Schulabschluss“. (Beifall
bei der FPÖ.)
Weil wir heute schon eine
passende Debatte haben, kann ich auch da ein Beispiel bringen. Die Sprache,
meine Damen und Herren, entwickelt sich aus sich heraus. Es ist zwei Mal
versucht worden, eine Sprache von oben herab zu diktieren: einmal unter den
Nazis und einmal unter den Kommunisten. Das hat natürlich nur unter Druck temporär funktioniert, und sobald
der Druck
weg war, war die Sprache Gott sei Dank wieder normal, und das andere war
Gott sei Dank Geschichte. (Beifall bei der FPÖ.)
Wie gesagt: Der Großteil unserer Landsleute lehnt das Gendern
ab, und wir als FPÖ in Niederösterreich haben dem Ganzen auch
gemeinsam mit der ÖVP
einen Riegel vorgeschoben. (Bundesrätin Schumann: Gut gemacht,
ja! Danke, ÖVP! Ein Verbot, von oben diktiert! Genau!) Danke, Udo
Landbauer, kann ich da
nur sagen. (Beifall bei der FPÖ.)
Leider lässt sich die ÖVP auf Bundesebene aber
noch immer von den Grünen am Nasenring durch die Manege ziehen. Auch da
kann ich Sie aber beruhigen:
Mit einem Volkskanzler Herbert Kickl werden wir eine ordentliche Frauenpolitik
machen, die Frauen wieder wirklich etwas bringt (Bundesrätin Schumann:
„eine ordentliche Frauenpolitik“,
„ordentliche Frauenpolitik“, „ordentliche Frauenpolitik“!
Jawohl! – weitere Zwischenrufe bei der SPÖ), und das
Gendern wird dann Geschichte sein. (Beifall bei der FPÖ.)
19.38
Vizepräsidentin Margit Göll: Weiters zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Matthias Zauner. – Bitte sehr.
Bundesrat Matthias Zauner (ÖVP,
Niederösterreich): Frau
Präsidentin! Frau Bundesministerin! Sehr geehrte Damen und Herren! (Bundesrätin
Schumann: Sagen Sie was zur ordentlichen Frauenpolitik!) Österreich ist ein Land der
Gründerinnen und Gründer. 15 000 GmbHs sind im Vorjahr in
Österreich gegründet worden. Mit diesem heutigen Gesetz
wollen wir das Gründen einfacher machen und auch den Start-ups das
Gründen erleichtern. Es
geht darum, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und niederschwellige
Rahmenbedingungen für die besten Ideen in unserem Land zu schaffen.
Kollegin Grossmann, wenn Sie in
diesem Zusammenhang von Ermittlungsarbeit und verschränkten Konstruktionen
sprechen, dann hoffe ich doch, dass Sie
nicht alle unsere Gründerinnen und Gründer unter Generalverdacht
stellen (Bundesrat Schennach: Tut sie nie! Tut sie nie!),
sondern dass wir diejenigen in den Vordergrund stellen, um die es geht. (Beifall
bei der ÖVP.)
Es geht um flexiblere Möglichkeiten, die bislang
Aktiengesellschaften vorbehalten waren. Es geht darum, Regelungen zu schaffen,
die die Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterbeteiligung einfacher machen, und
es geht auch
um eine Flexibilisierung der Anteilsübertragung.
Und ja, meine
Damen und Herren, dieses Gesetz wurde nicht nur hier, sondern auch schon im
Nationalratsplenum, auch bei uns im Klub und davor auf
der einen Seite nach dem Inhalt und auf der anderen Seite nach der Form diskutiert.
Frau Bundesministerin, die Abfassung in weiblicher Form hilft
wohl keiner Unternehmerin und keiner Mitarbeiterin (Ah-Rufe bei der
SPÖ), aber der Inhalt dieses Gesetzes tut es.
Frau Bundesministerin, wenn Sie sich mit der
Abfassung in weiblicher Form
ein Denkmal setzen wollen, dann soll es so sein. Wir nehmen die Form
in Kauf, weil der Inhalt gut ist. Die Zustimmung zu diesem Gesetz werden Sie
von uns bekommen. (Beifall bei Bundesrät:innen der ÖVP. –
Bundesrätin Schumann:
Wo sind denn jetzt die
ÖVP-Frauen? Wo sind die ÖVP-Frauen?)
19.40
Vizepräsidentin Margit Göll: Das Wort ist nun bei Frau Bundesministerin Dr. Alma Zadić. – Bitte.
Bundesministerin für Justiz Dr. Alma
Zadić, LL.M.: Frau Präsidentin! Geschätzte Mitglieder des Bundesrates! Sehr
geehrte Zuseherinnen und Zuseher! Es
ist mir wirklich eine Freude, dass wir heute die flexible Kapitalgesellschaft
beschließen. Was als Austrian Limited im Jahr 2020 begann, wird
heute als flexible Kapitalgesellschaft hoffentlich einen mehrheitlichen
Zuspruch bekommen.
Wir setzen damit
zwei wichtige Maßnahmen um. Erstens schaffen wir eine neue Rechtsform.
Ich glaube, das ist wichtig, wir folgen damit auch internationalen Beispielen.
Wir machen nicht den Fehler der British Limited, ganz im Gegenteil, wir
machen diese flexible Kapitalgesellschaft für innovative
Start-ups und für Gründerinnen und Gründer besonders attraktiv,
aber gleichzeitig auch rechtssicher.
Außerdem setzen wir eine Sache um, die wir uns im Regierungsprogramm vorgenommen haben: Wir senken das gesetzliche Mindeststammkapital
auf 10 000 Euro ab, und zwar für
alle GmbHs, nicht nur für die flexible Kapitalgesellschaft, sondern
für alle. Ich glaube, das ist schon wichtig, denn
die gründungsprivilegierte GmbH, die bis jetzt 10 000 Euro
Mindeststammkapital erfordert hat, hat sich ja bewährt, und ich
glaube, es ist gut, dass
wir das jetzt so fixiert haben und die steuerlichen Nachteile für den
Staat quasi bewusst in Kauf nehmen.
Der Finanzminister hat in der Pressekonferenz
mit mir auch gesagt: Ja, das ist es uns wert! Es geht nämlich darum,
Gründer:innen, Gesellschafter:innen tatsächlich zu fördern und
eine Möglichkeit zu schaffen, dass gegründet wird. Österreich
ist ein Land der Innovationen, der Gründerinnen und Gründer,
und wir wollen alles daransetzen, dass innovative Köpfe nicht auswandern,
sondern in Österreich bleiben. (Bundesrat Schennach:
Schön!)
Was haben wir mit der flexiblen
Kapitalgesellschaft getan? – Erstens haben
wir eine Hybridform zwischen einer GmbH und
einer Aktiengesellschaft geschaffen. Die flexible Kapitalgesellschaft
baut grundsätzlich auf dem GmbH-Recht auf, das heißt, wenn man nicht
weiß, wie die Regelungen auszulegen sind, kann man ja
immer noch auf das GmbH-Recht blicken.
Wir führen auch eine besondere Klasse von
stimmrechtslosen Anteilen ein. Warum
ist das wichtig? –
Das ist wichtig, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Unternehmenserfolg
zu beteiligen. Gerade in der Anfangsphase, in dieser Phase der Innovation, in
der man Neues schaffen will und nicht
viel Kapital hat, erklären sich ja viele damit einverstanden, dass sie
mitwirken. Sie wollen natürlich auch Aktien dafür haben, wollen sich
am Unternehmen beteiligen. Wir schaffen dafür einen Rechtsrahmen. Bisher
wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch beteiligt, aber das Ganze
fand im rechtsfreien Raum statt. Daher ist es wichtig, dass es
einen Rechtsrahmen dafür gibt.
Wir haben auch die Anteilsübertragung flexibilisiert
und geöffnet. Damit
die Anteilsübertragung nicht mehr einem starren Notariatsakt unterliegt,
haben wir aus Rechtssicherheitsgründen eine Anwaltsurkunde geschaffen,
mithilfe
dieser die strengen Formerfordernisse zurückgefahren werden. Es gibt aufgrund der Anwaltsurkunde auch eine flexiblere Möglichkeit, Anteile zu übertragen.
Meine Damen und Herren, es ist die zentrale Aufgabe von uns Politikerinnen und Politikern, Innovationen zu ermöglichen, zu fördern und bestmöglich voranzutreiben.
Einen Punkt möchte ich schon ansprechen, weil er ja
doch die Debatte heute stark prägt, und das ist die weibliche Form dieses
Gesetzes. Es war mir
wichtig, dass das Gesetz in weiblicher Form geschrieben wird, weil es ein Wirtschaftsgesetz
ist und wir Gründerinnen, Gesellschafterinnen sichtbar machen wollen.
Es gibt so viele Frauen, die in der Wirtschaft tätig sind, es gibt so
viele Frauen, die gründen wollen. Ich möchte, dass sie
sichtbar sind. (Beifall bei den Grünen sowie bei
Bundesrät:innen von ÖVP und SPÖ.)
Dieses Gesetz ist eben nicht gegendert, dieses
Gesetz ist nur in weiblicher Form und im generischen Femininum
abgefasst – ja, das gibt es auch. Ich halte
auch die Debatte für bezeichnend, denn in dieser Legislaturperiode haben
wir Gesetze beschlossen, die nur im generischen Maskulinum verfasst waren,
und da hat es diese Aufregung nicht gegeben. Jetzt aber gibt es diese
Aufregung, und das halte ich für bezeichnend. Also insofern: Es ist ein
Zeichen dafür,
dass es richtig war, den Spieß einmal umzudrehen und das Ganze im
generischen Femininum zu machen. (Beifall bei den Grünen und bei
Bundesrät:innen
der SPÖ.)
Ich hoffe, dass der Gesetzesvorschlag trotz allem auf
breite Zustimmung stößt und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
(Beifall bei den Grünen sowie
bei Bundesrät:innen von ÖVP und SPÖ.)
19.46
Vizepräsidentin Margit Göll: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Es ist dies
nicht der Fall. Somit ist
die Debatte geschlossen.
Wir kommen zur Abstimmung. – Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein.
Ich ersuche jene
Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den
vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch
zu erheben, um ein Handzeichen. – Es ist dies die Stimmenmehrheit,
und somit ist der Antrag angenommen.
Beschluss des
Nationalrates vom 15. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem
das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch geändert wird (Abstammungsrechts-Anpassungsgesetz
2023 – AbAG 2023)
(3754/A und 2345 d.B. sowie 11365/BR d.B. und
11398/BR d.B.)
19. Punkt
Beschluss des
Nationalrates vom 15. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem
das Personenstandsgesetz 2013 geändert wird
(2354 d.B. sowie 11399/BR d.B.)
Vizepräsidentin Margit Göll: Wir gelangen nun zu den Tagesordnungspunkten 18 und 19, über welche die Debatten unter einem durchgeführt werden.
Berichterstatter zu den
Punkten 18 und 19 ist Herr Bundesrat
Christoph Stillebacher. Ich bitte um seine Berichte.
Berichterstatter Christoph Stillebacher: Ich bringe den Bericht über den Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch geändert wird.
Zusätzlich berichte ich über den Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Personenstandsgesetz 2013 geändert wird.
Die Berichte liegen Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher zur Antragstellung:
Der Justizausschuss stellt nach Beratung der Vorlagen mehrstimmig den Antrag, gegen die vorliegenden Beschlüsse des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsidentin Margit Göll: Vielen Dank für die Berichte.
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Markus Leinfellner. – Bitte.
Bundesrat Markus Leinfellner (FPÖ,
Steiermark): Frau Vorsitzende! Frau
Bundesminister! Hohes Haus! Liebe Österreicher! Dass wir in diesem Haus in
letzter Zeit Gesetze behandeln, die völlig an der Vernunft vorbeigehen,
ist
nicht neu, aber dass wir ein Gesetz behandeln, das auch an der Natur
vorbeigeht, das ist etwas Neues.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor der Sommerpause wurde der Mutter-Kind-Pass abgeschafft und durch einen Eltern-Kind-Pass ersetzt, und heute beschließen Sie ein Gesetz, nach dem eine Frau die Vaterschaft annehmen kann.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, Ihnen ist wirklich nicht mehr zu helfen. Bei so sinnlosen Gesetzesbestimmungen sind wir Freiheitliche nicht dabei. – Vielen Dank. (Beifall bei der FPÖ.)
19.49
Vizepräsidentin Margit Göll: Weiters zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin MMag. Elisabeth Kittl. – Bitte sehr.
Bundesrätin
MMag. Elisabeth Kittl, BA (Grüne, Wien):
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau Ministerin! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Vielen Dank an
den Vorredner für die Kürze der Ausführungen.
Ich würde wirklich gerne erleben, dass es uns endlich
egal ist, welches Geschlecht ein Mensch hat, den wir lieben, oder welches
Geschlecht die Person hat, die unseren Staat lenkt, die uns operiert, die uns
lehrt (Zwischenruf der Bundesrätin Doppler), die forscht,
die uns pflegt, die uns erzieht (Bundesrat Leinfellner: Ja, es
braucht halt einmal Manderl und Weiberl für ein ...!), die sich um
uns sorgt, uns liebt oder die unsere Familie ist. (Beifall bei
den Grünen.)
Es sind nämlich nicht die biologischen Geschlechtsmerkmale, die die Qualität unserer Elternschaft ausmachen – es ist unser Charakter, es sind unsere Werte, es sind unsere Fähigkeiten, es ist unsere Liebesfähigkeit und die Sorge um andere, vor allem im familiären Bereich. (Beifall bei den Grünen.)
Warum das vor allem für die FPÖ so schwer zu
verstehen ist, ist mir ein Rätsel. Diese Schwerfälligkeit erinnert
mich (Zwischenruf bei der FPÖ) – verzeiht
den Exkurs! – an den Foucault’schen biopolitischen Ansatz,
laut dem Geschlecht, Liebe und Fortpflanzung zu politischen
Steuerungsinstrumenten werden. Entscheidungen in Bezug auf Familie sollen
allerdings im Privatbereich liegen, Stichwort pro choice, worum es ja auch
immer wieder geht.
Heute gehen wir einen weiteren Schritt in Richtung
Gleichberechtigung aller Geschlechter (Bundesrat Spanring: Aller zwei
Geschlechter!) sowie der Gleichstellung von Ehe und eingetragener
Partnerschaft. (Ruf bei der FPÖ: Aber zwei Stiere können kein Kalb
kriegen!) Ich erkläre das auch kurz, weil es ja
in der Gott sei Dank sehr kurzen Rede vor meiner nicht erklärt wurde: In
aufrechter Ehe oder eingetragener
Partnerschaft von verschiedengeschlechtlichen Paaren wird von
Gesetz her vermutet, dass ein Kind von beiden Elternteilen gezeugt
wurde – egal, von wem das Kind tatsächlich stammt. Mit der
Geburt sind beide Ehepartner:innen oder eingetragene Partner:innen rechtlich
anerkannte Elternteile.
Bei zwei verheirateten Frauen oder eingetragenen
Partnerinnen war das
nicht beziehungsweise nur eingeschränkt der Fall – nämlich
dann, wenn eine medizinisch unterstützte Fortpflanzung vorgenommen wurde.
Wurde
das Kind anders gezeugt, waren nicht beide Elternteile automatisch rechtlich
anerkannte Elternteile. Diese Ungleichbehandlung beheben wir heute;
denn oft – und das wissen wir auch aus dem Ausschuss –
werden andere Wege der Zeugung gewählt, weil eine medizinisch
unterstützte Fortpflanzung
oft sehr teuer und hochkompliziert ist.
Mit der heutigen Gesetzesänderung wird nun auch die andere
Person in der Ehe oder eingetragenen Partnerinnenschaft mit einer Frau
automatisch – und
das ist der wichtige Punkt – als anderer Elternteil anerkannt, egal,
wie das Kind gezeugt wurde. Wenn die zweite Person in der Ehe oder
eingetragenen Partnerschaft der Fortpflanzung auch noch ausdrücklich
zustimmt, kann eine Feststellung der Nichtabstammung vor Gericht nicht begehrt
werden.
Das klingt sehr kompliziert, ist aber sehr wichtig, damit eben Abstammungsverhältnisse –
genauso wie in der verschiedengeschlechtlichen Ehe – dauerhaft
gesichert sind. Das ist auch wichtig für das Aufwachsen des Kindes, um
eine Sicherheit zu haben, wer die Eltern sind.
Ein Punkt ist nicht zu vernachlässigen: Dies
schützt auch Samenspender, damit diese nicht die Vaterschaft übernehmen
müssen. Das ist auch eine Art der Rechtssicherheit. Der Beschluss, dass
nächstes Jahr ein zentrales Register über Samen- und Eizellenspenden
einzurichten ist, ist höchst sinnvoll, denn es
ist extrem zu empfehlen, einen solchen Registereintrag vorzunehmen oder zumindest
bei der Zustimmungserklärung die Daten des Samenspenders aufzunehmen.
Wir wissen schließlich
aus vielen Studien, dass die Offenheit in der Erziehung und bei der Behandlung
der Familienverhältnisse oft nicht sehr einfach
ist und immer wieder eine sensible und auch sehr langfristige Auseinandersetzung mit dem Kind erfordert, aber extrem wichtig
für eine gute Entwicklung des Kindes und für
sein Selbstverständnis ist. Ich bin sehr froh, dass wir diese Regelung nun
endlich verankert haben. Sie hätte meiner Meinung
nach schon weit früher Eingang ins Gesetz finden sollen, denn es ist und
es war immer wahnsinnig enervierend und sehr traurig, dass nicht normative
Geschlechter oder Beziehungen enormen seelischen Strapazen und Behördenirrwegen ausgesetzt sind. Das ist natürlich auch für Kinder sehr anstrengend.
Nun werden diese Strapazen weniger und die soziale Familie wird abgesichert. Das ist gut so – denn vorzuschreiben, wer Familie sein kann, ist menschenrechtlich falsch; und sie jemandem zu verweigern ist höchst unmenschlich. (Beifall bei den Grünen und bei Bundesrät:innen der ÖVP.)
19.54
Vizepräsidentin Margit Göll: Zu Wort gemeldet ist Bundesrätin Viktoria Hutter. – Bitte.
Bundesrätin Viktoria Hutter
(ÖVP, Niederösterreich): Frau
Präsidentin! Geschätzte Frau Ministerin! Meine sehr geehrten Damen
und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Gerade vor Weihnachten besinnen wir
uns ja
immer wieder gerne auf die Familie. Die Feiertage will man im Kreise seiner
Liebsten verbringen. Doch was bedeutet Familie überhaupt? –
Wenn
man im Duden nach dem Wort Familie sucht, kommt man als Allererstes auf
folgende Definition: „aus einem Elternpaar oder einem Elternteil und
mindestens einem Kind bestehende [Lebens]gemeinschaft“. Das klingt
logisch und einfach: Eltern – im Idealfall zwei, wenn eben
noch beide vorhanden sind – und ein Kind oder mehrere Kinder.
Leider ist es aber nicht immer so einfach. Gerade wenn es um die Elternschaft in gleichgeschlechtlicher Ehe zweier Frauen geht, dann war das, gerade wenn das Kind aus einer nicht medizinisch unterstützten Fortpflanzung stammt – ein sehr sperriger Begriff –, bisher nicht so genau definiert. Der Verfassungsgerichtshof hat diesbezüglich Lücken im aktuellen Gesetz aufgedeckt. Darauf müssen wir rasch reagieren, und das werden wir mit dem heutigen Gesetz auch machen. Ansonsten hätte es auf alle Familien und Ehen unglaubliche Auswirkungen, wenn die automatische Vaterschaft beziehungsweise
Elternschaft wegfallen würde. Das würde eine Reihe an Komplikationen hinsichtlich Obsorge, Unterhalt, Erbrecht, Staatsbürgerschaft, Sozialversicherung und so weiter mit sich führen.
Bei einer medizinisch unterstützten Fortpflanzung – also der künstlichen Fortpflanzung – ist die Rechtslage klar und eindeutig. Da muss in Form eines Notariatsakts die Zustimmung aller beteiligten Personen gewährleistet sein. Bei einer nicht medizinisch unterstützten Fortpflanzung ist das insofern schwieriger, weil das ja meistens im privaten Bereich passiert und man da auch nicht so den Zugang hat. (Heiterkeit der Bundesrät:innen Miesenberger und Tiefnig.)
Darum haben wir gezielt darauf geachtet, eine niederschwellige Lösung zu finden, wodurch der Gang zum Notar nicht erforderlich, aber natürlich schon wünschenswert ist und dringend empfohlen wird, damit Unklarheiten, Unsicherheiten und Streitigkeiten, die im Nachhinein aufkommen könnten, im Vorhinein vermieden werden.
Durch dieses Gesetz soll ja in
erster Linie das Abstammungsverhältnis von Kindern gesichert und
geregelt werden, aber auch die Rechtssicherheit der Samenspender
gewährleistet werden. Wie Frau Kollegin Kittl schon gesagt hat: In einem
weiteren Schritt ist es ganz wichtig, ein zentrales Register für
Samen- und Eizellenspender einzurichten, damit auch das Recht von Kindern auf
Kenntnis ihrer genetischen Abstammung verbessert wird.
Weil ja Weihnachten vor der Tür steht und der Titel eines bekannten Weihnachtsliedes einfach so gut zu diesem Gesetz passt, möchte ich auch damit schließen und kann dank dieser Gesetzesänderung getrost sagen: „Ihr Kinderlein kommet“. (Heiterkeit und Beifall bei ÖVP und Grünen. – Zwischenruf der Bundesrätin Schumann.)
19.57
Vizepräsidentin Margit Göll: Zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Mag. Elisabeth Grossmann. – Bitte sehr.
19.58
Bundesrätin
Mag. Elisabeth Grossmann (SPÖ, Steiermark): Frau Präsidentin! Frau Ministerin! Meine sehr geehrten
Damen und Herren! „Ihr Kinderlein kommet“ –
mögen viele kommen! Nun kommt kurz vor Ablauf der verfassungsrechtlichen
Umsetzungsfrist für die Sanierung des § 144 ABGB endlich auch
diese Regierungsvorlage, die eben – es ist schon ausgeführt
worden – die beanstandete Diskriminierung im Abstammungsrecht
beseitigt. Das
ist gut so, deshalb stimmen wir hier auch zu.
Mein Kollege Troch hat im Nationalrat darauf hingewiesen, dass noch etwas fehlt oder besser reguliert gehört – nämlich der Datenschutz von Samenspendern, die anonym bleiben wollen. Da gilt es, eine Abwägung zwischen dem Auskunftsrecht des Kindes und diesen Datenschutzbedenken vorzunehmen. Das steht noch bevor und muss auch dringend geregelt werden. Es ist aber gut, dass jetzt diese Diskriminierung abgeschafft wird.
Wie gesagt, ganz freiwillig war es nicht, es wurde eine
Verpflichtung durch den Verfassungsgerichtshof aufgetragen. Ich glaube, sonst
hätte sich die
ÖVP da nicht so leicht getan. (Beifall bei der SPÖ sowie des
Bundesrates Schreuder. – Zwischenruf der
Bundesrätin Eder-Gitschthaler.)
19.59
Vizepräsidentin Margit Göll: Zu Wort gemeldet ist nun unsere Ministerin Dr. Alma Zadić. – Bitte.
Bundesministerin
für Justiz Dr. Alma Zadić, LL.M.:
Frau Präsidentin! Geschätzte Mitglieder des Bundesrates! Sehr geehrte
Zuseherinnen und Zuseher! Ja,
der Verfassungsgerichtshof hat die zentrale Norm im Abstammungsrecht aufgehoben
und uns aufgetragen, eine Verbesserung vorzunehmen.
Jetzt haben wir diese
Verbesserung vorliegen, und ich möchte mich zunächst einmal in aller
Deutlichkeit beim Koalitionspartner bedanken, denn ich
weiß, dass die Verhandlungen zu diesem Gesetz nicht einfach waren. Ich
schätze
es sehr, dass wirklich beide Parteien aufeinander zugegangen sind, obwohl man sich gerade in diesem Bereich in vielerlei Hinsicht schwergetan hat.
Wir haben nun endlich
Klarheit – und ich glaube, diese Klarheit ist sehr wichtig ‑,
nämlich Klarheit darüber, wer für das Kind die Obsorge
übernimmt und wer für das Kind den Unterhalt leisten wird,
wenn das Kind bei einem lesbischen Paar zur Welt kommt. Ganz zu schweigen
davon, was wäre, wenn wir da
keine Regelung getroffen hätten, welche Auswirkungen das auf die
Staatsbürgerschaft gehabt hätte und welche erbrechtlichen
Konsequenzen das gehabt hätte. Insofern ist es umso besser, dass
wir es jetzt kurz vor Jahresende geschafft haben, dafür eine Regelung
zu finden.
Künftig – und
ich glaube, das ist wichtig – werden gleichgeschlechtliche
Ehen mit verschiedengeschlechtlichen Ehen im Abstammungsrecht gleichgestellt.
Das heißt: Elternteil ist die Person, die das Kind anerkannt hat,
und zwar völlig unabhängig vom Geschlecht und völlig
unabhängig davon, ob und wie das Kind gezeugt wurde, ob medizinisch
unterstützt oder nicht.
Gleichgeschlechtliche Paare können nun unter denselben Bedingungen Kinder anerkennen, wie es heterosexuelle Paare schon bisher konnten. Ich glaube, das sorgt gerade im Abstammungsverhältnis für eine stabile Beziehung, sorgt für Rechtssicherheit, stärkt die Familie in sozialer Hinsicht und, das ist besonders wichtig, stellt das Kindeswohl in den Mittelpunkt. – Vielen Dank. (Beifall bei den Grünen sowie bei Bundesrät:innen von ÖVP und SPÖ.)
20.01
Vizepräsidentin Margit Göll: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist somit geschlossen.
Wir kommen zur Abstimmung, die über die gegenständlichen Tagesordnungspunkte getrennt erfolgt. – Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein.
Wir kommen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2023 betreffend ein Abstammungsrechts-Anpassungsgesetz 2023.
Ich ersuche jene
Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden
Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch
zu erheben, um ein Handzeichen. – Es ist dies Stimmenmehrheit,
somit ist der Antrag angenommen.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Personenstandsgesetz 2013 geändert wird.
Ich ersuche jene
Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den
vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch
zu erheben, um ein Handzeichen. – Es ist dies Stimmenmehrheit,
somit ist auch dieser Antrag angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2023 betreffend ein
Bundesgesetz, mit dem das Koordinator-für-digitale-Dienste-Gesetz
erlassen und
das KommAustria-Gesetz, das E-Commerce-Gesetz, das Allgemeine bürgerliche
Gesetzbuch, das Urheberrechtsgesetz, das Gerichtsgebührengesetz, das
Mediengesetz, die Strafprozeßordnung 1975, das Staatsanwaltschaftsgesetz,
das Bundesgesetz über die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen
mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, das Auslieferungs- und
Rechtshilfegesetz und das Telekommunikationsgesetz 2021 geändert werden
(DSA-Begleitgesetz – DSA-BegG) (2309 d.B. und 2344 d.B.
sowie 11366/BR d.B. und 11400/BR d.B.)
Vizepräsidentin Margit Göll: Wir gelangen nun zum 20. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatterin ist Frau Bundesrätin Viktoria
Hutter. – Ich bitte um
den
Bericht.
Berichterstatterin
Viktoria Hutter: Ich bringe den Bericht
des Justizausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom
15. Dezember 2023 betreffend
ein Bundesgesetz, mit dem das Koordinator-für-digitale-Dienste-Gesetz
erlassen und das KommAustria-Gesetz, das E-Commerce-Gesetz, das Allgemeine
bürgerliche Gesetzbuch, das Urheberrechtsgesetz, das
Gerichtsgebührengesetz, das Mediengesetz, die
Strafprozeßordnung 1975, das Staatsanwaltschaftsgesetz, das
Bundesgesetz über die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, das Auslieferungs- und
Rechtshilfegesetz und das Telekommunikationsgesetz 2021 geändert
werden – DSA-Begleitgesetz.
Der Bericht liegt Ihnen in
schriftlicher Form vor, ich komme daher gleich
zur Antragstellung:
Der Justizausschuss stellt nach
Beratung der Vorlage mehrstimmig den Antrag, gegen den
vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch
zu erheben.
Weiters bringe ich folgende Druckfehlerberichtigung zum Bericht des Justizausschusses, 11400 der Beilagen, vor:
Zur Korrektur eines technischen Versehens wird im gegenständlichen Beschluss der Kurztitel von „DAS-Begleitgesetz – DAS-BegG“ durch „DSA-Begleitgesetz – DSA-BegG“ ersetzt.
Vizepräsidentin Margit Göll: Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Andreas Arthur Spanring. – Bitte.
Bundesrat Andreas Arthur Spanring
(FPÖ, Niederösterreich): Frau
Vorsitzende! Frau Bundesminister! Kollegen im Bundesrat! Sehr geehrte Damen und
Herren Zuschauer hier und zu Hause! Wir haben es bei der Berichterstattung
gehört, aber auch generell – und es tut mir leid, Frau
Bundesminister,
ich muss das jetzt so drastisch sagen –: All das, was hier passiert
ist, ist ein Trauerspiel und zeigt, dass diese Regierung nichts Ordentliches
mehr
auf den Weg bringt. (Beifall bei der FPÖ.)
Am 17. Dezember 2020 habe ich bereits zum Kommunikationsplattformen-Gesetz gesprochen, und alles, was ich damals kritisiert habe, hat sich mehr oder weniger bewahrheitet. Übrigens hat der Europäische Gerichtshof auch aufgezeigt, dass dieses Gesetz europarechtswidrig war.
Heute sprechen wir über den DSA – nicht über den DAS, wie wir gehört haben ‑, sondern über Digital Services Act. Die Begutachtungsfrist – fangen wir einmal damit an – war drei Wochen. Es gibt, darauf weise ich übrigens sehr gerne hin, vom Bundeskanzleramt eine eindeutige Empfehlung, dass eine Begutachtungsfrist mindestens vier Wochen lang sein soll, aber das ignoriert diese Regierung seit Antritt dauernd.
Für diese Regierung ist
der Parlamentarismus, so schaut es aus, nur eine lästige Pflicht, und leider hat diese Regierung ihre
getreuen Erfüllungsgehilfen hier
im Bundesrat sitzen, aber auch im Nationalrat, nämlich die
türkis-schwarz-grünen Regierungsgehilfen, die zwar oft gar keine
Ahnung haben, aber immer
dann, wenn die Regierenden sagen: Jetzt!, brav ihr Händchen heben.
Den DSA gibt es seit Oktober 2022. Vorhin wurde über ein anderes Gesetz gesagt, dass man sich dafür drei Jahre Zeit genommen hat. Ich sage jetzt einmal: Man hat einfach so lange gebraucht, bis man irgendetwas auf den Weg gebracht hat, nämlich bis vorige Woche, dass man ein entsprechendes Begleitgesetz oder mehrere Begleitgesetze auf den Weg gebracht hat – um dann am Tag der Nationalratssitzung in den Morgenstunden noch einen Abänderungsantrag auszuschicken und dann zu Mittag zwei weitere Abänderungsanträge nachträglich auszuschicken. (Bundesrat Himmer: Aber das ist ja der Parlamentarismus, den du doch haben möchtest! Ist das nicht der Parlamentarismus, den du haben willst? Da ändert man eine Regierungsvorlage ab ...!)
Ja, das stimmt schon, Herr Himmer, aber jetzt sage ich dir etwas: Bis zur Abstimmung im Nationalrat war völlig unklar, was da überhaupt abgestimmt werden soll. (Bundesrat Himmer: Ja eben, aber Parlamentarismus ist so!) Deshalb haben wir heute sogar von der Schriftführerin gehört, dass da jetzt auch noch etwas korrigiert werden musste (Bundesrat Himmer: Ein Abänderungsantrag!), weil das einfach eine chaotische Flickschusterei der Sonderklasse bis zur letzten Minute war.
Dann wurde ein Antrag wieder zurückgezogen und ein anderer eingebracht. Es herrscht also Chaos pur (Ruf bei der ÖVP: Noch einmal: Das ist Parlamentarismus!), und ich wette, die Nationalratsabgeordneten, die dem zugestimmt haben, haben zwar zugestimmt, haben aber keine Ahnung, worüber sie da abgestimmt haben. (Beifall bei der FPÖ.)
Grundsätzlich und offiziell wird uns wieder erklärt werden, es gehe um Hass im Netz. Die Wahrheit schaut ganz anders aus: Dieses Gesetz dient nur einem Zweck, nämlich der Einschränkung und der Unterdrückung der Meinungs- und der Meinungsäußerungsfreiheit. Was noch dazukommt, ist die totale Überwachung aller Bürger im Netz. Der Schutz der Privatsphäre ist dann quasi Schall und Rauch. Big Brother is watching you, jetzt sind wir so weit!
Viele Datenschützer, aber auch Rechtsgutachter stellen diesem DSA ein verheerendes Zeugnis aus und sind der Meinung, dass dieses Gesetz gegen die Grundrechtecharta der EU verstößt.
Auch wenn sich hier und heute
besonders die Linksparteien über diese Gesetzgebung freuen, denken
Sie daran: Die nächste EU-Wahl kommt bestimmt,
und wie es ausschaut, werden sich die Machtverhältnisse Gott sei Dank Richtung
Mitte und Mitterechts verschieben, und vielleicht entpuppt sich
das von Ihnen so gut gemeinte Gesetz dann als Bumerang. (Beifall bei der
FPÖ.)
Noch ein kleines Bonmot am Rande: Während der Digital Services Act auch dazu dienen soll, das Mikrotargeting einzuschränken, verwendet die EU-Kom-
mission genau
dieses Instrument jetzt im Netz, um mit ihrer Werbung ganz gezielt
Personengruppen zu beeinflussen. Also nicht böse sein, aber das ist
ja an Doppelbödigkeit nur schwer zu überbieten! (Bundesrat Schreuder:
Ja, das war eh blöd!) Gut, in Österreich schafft das vielleicht
die ÖVP, aber
ansonsten ist das wirklich ein hinterlistiges Verhalten, das seinesgleichen
sucht.
Mit dem Digital Services
Act wird eben eine wahllose Überwachung aller sensiblen Daten
stattfinden. Meine Damen und Herren, überlegen Sie es sich künftig
vielleicht zweimal, wenn Sie Ihrem Liebsten oder Ihrer Liebsten
eine Whatsapp oder ein SMS, das anzüglich ist, schicken, denn vielleicht
liest
von der Leyen mit. (Beifall bei der
FPÖ.)
20.10
Vizepräsidentin Margit Göll: Zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin MMag. Elisabeth Kittl. – Bitte.
Bundesrätin MMag. Elisabeth Kittl, BA
(Grüne, Wien): Frau
Präsidentin! Sehr geehrte Frau Ministerin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Liebe Zuseher:innen vor den Bildschirmen! Ja, schon Ende 2020 haben
wir ein umfangreiches Gesetzespakt zur Bekämpfung von Hass im Netz
beschlossen, und Teil dieses Paketes war das
Kommunikationsplattformen-Gesetz, das unter anderem Betreiber:innen großer
Kommunikationsplattformen wie Facebook und Co dazu verpflichtete, ein
wirksames Beschwerdeverfahren für Nutzer:innen, die mit
strafrechtlichen Delikten wie Hass und Hetze konfrontiert
waren, einzurichten; und das war sehr gut so.
Nun wird dieses Gesetz durch den Digital Services Act der EU
abgelöst, der User:innen in Europa nun einheitlich vor illegalen Inhalten
und undurchsichtigen Algorithmen schützen wird. Ein Hauptaugenmerk des DSA
liegt darauf,
dass die Inhalte moderiert und nicht durch die User:innen selbst reguliert werden
und die Plattformen Transparenzregeln unterliegen. Ich werde dann
gleich dazusagen, warum ich das als gut erachte.
Der DSA wird ab
17. Februar 2024 unmittelbar in jedem Mitgliedstaat der Union gelten, und
heute beschließen wir eben die notwendigen Begleitgesetze.
Es geht um Haftungsregeln, um Sorgfaltspflichten, Transparenzberichtspflichten,
Pflichten zur Benennung von Kontaktstellen, Melde- und Abhilfeverfahren
für Posts bei Onlineplattformen,
Beschwerdemanagementsysteme für rechtswidrige Inhalte,
Werbevorschriften und Sanktionen bei Verstößen. Künftig wird also
nun europaweit Hass im Netz mit durchsetzbaren Sanktionen effizienter
bekämpft werden können. (Beifall
bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
Das ist deswegen ein wichtiger
Schritt, weil die Kommunikation auf solchen Plattformen eine extrem
öffentliche ist. Wir wissen es, geht so ein Post
viral, erreicht er viele Tausende Personen und schadet daher auch
viele Tausende Male. Daher freuen wir uns, dass die Regulierung der Onlineplattformen
nun gelingt und sie zur Verantwortung gezogen werden,
um Hass und Hetze einzudämmen und um einen zivilisierten Umgang miteinander
zu fördern.
Es geht beim Digital Services
Act aber auch um mehr Transparenz für Konsument:innen. Jede und jeder soll die Freiheit haben, selbst zu
entscheiden,
ob ihr Feed von einem Algorithmus sortiert wird oder nicht. Genauso
dürfen sensible Daten, wie zum Beispiel ethnische Zugehörigkeit,
politische Überzeugungen oder auch sexuelle Orientierung nicht mehr ohne
die Zustimmung der User:innen für personalisierte Werbung verwendet
werden.
Beides ist gut, denn es kann dazu beitragen, wieder ein
wenig Macht über die auf uns zuströmenden Informationen zu erhalten.
Das größte Ziel des
DSA aber ist, Mechanismen und bessere europaweite Behördenkooperationen zu
generieren, um rasch und kostengünstig illegale Inhalte von den Plattformen entfernen
zu können, denn Hass und Hetze, aber genauso auch demokratiegefährdende
Inhalte wie Desinformation können damit effizienter bekämpft werden.
Wir sehen, gerade jetzt wird
mit dem Verfahren gegen X von Elon Musk von der EU dieser Digital Services Act
zum Leben erweckt. Es wird ein Verfahren
gegen X wegen Verbreitung illegaler Inhalte und fehlender Einhaltung der Transparenzregelungen
eingeleitet. Wir haben gelesen, Musk wehrt sich und droht, sich aus der EU
zurückzuziehen. Ich muss sagen, wir werden ihm keine Tränen
nachweinen, denn es gibt, und ich möchte hier vielleicht ein Art indirekte Werbung
machen, auch demokratiefördernde Twitteralternativen, wie zum Beispiel
Mastodon, das ist eine auf Open Source basierte Alternative. (Zwischenruf
bei der FPÖ.) Sie verfügt über dezentrale Netzwerke und
keine Algorithmen.
Das ist deswegen für mich
so wichtig, weil Plattformen uns, aber vor allem auch der Jugend heute als
Informationsquelle dienen. Sie sind damit quasi die
vierte Säule der Demokratie. Sie müssen daher unbedingt rechtskonform
sein und ihr Aufbau muss transparent sein. (Beifall bei den Grünen und bei Bundesrät:innen der
ÖVP.)
Daher freuen wir uns über
diese Gesetze, denn wir sehen es als essenziell für eine
funktionierende Demokratie an, verlässliche Informationen für die Meinungsbildung und die Meinungsvielfalt zur
Verfügung zu stellen. Wir wissen auch, dass Desinformation und das
daraus folgende Informationschaos geopolitisch destabilisierend eingesetzt
werden und heute auch schon eine
Form der Kriegstechnik sind.
Daher sind diese neuen Regelungen ein Meilenstein gegen Hetze, aber auch gegen Manipulation und sie haben das Potenzial, einen neuen weltweiten Standard zu setzen. – Vielen Dank. (Beifall bei Grünen und ÖVP.)
20.15
Vizepräsidentin Margit Göll: Zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Klara Neurauter. – Bitte.
20.15
Bundesrätin Klara Neurauter
(ÖVP, Tirol): Sehr geehrte Frau
Präsidentin! Sehr geehrte Frau Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen
und Kollegen!
Werte Zuseher und Zuhörer! Meine Kollegin hat schon sehr viele
Einzelheiten dargelegt, sodass ich auch angesichts der fortgeschrittenen Stunde
nicht
mehr allzu sehr in die Einzelheiten gehen möchte. Was man aber wirklich
sagen muss: Was offline verboten ist, das muss auch online verboten sein. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
Wir nehmen nicht zur Kenntnis, dass im Netz beleidigt wird, dass jemand bloßgestellt wird, dass verhetzt wird oder Ähnliches.
Wichtig ist auch, dass wir nun eine europaweite Lösung haben, ein gemeinsames Gesetz, sodass für alle Mitgliedsländer eine Regelung gilt. Es ist so, dass mit unserem Gesetz Rahmenbedingungen gesetzt werden. Die großen Internetkonzerne müssen Ansprechpartner in Österreich benennen, sodass wir auch jemanden erreichen können. Es geht auch darum, dass die Verfahren beschleunigt werden, denn wenn Personen, meistens Frauen, von irgendwelchen Bloßstellungen betroffen sind, dann darf sich das Verfahren nicht ewig hinziehen – es muss schnell gehandelt werden.
Es ist auch geregelt, dass es
eine Koordinierungsstelle gibt. Die KommAustria hat auch in der Vergangenheit
bereits großes Know-how bewiesen und ist die richtige Stelle, um die
betroffenen Firmen und Plattformen zu regulieren und zu beaufsichtigen. Es wird
aber auch für die Nutzerinnen und Nutzer eine Streitbeilegungsstelle
geben, die bei der RTR GmbH, Fachbereich Medien angesiedelt wird. Wenn ich
also etwas bei einer großen Plattform melde und
die dem nicht nachkommt oder womöglich sogar mein Account gesperrt wird,
dann muss es auch eine außergerichtliche Stelle geben, an die man sich
wenden kann.
Es handelt sich nun um ein
wirklich lang verhandeltes Werk, an dem man vielleicht das eine oder
andere kritisieren kann, aber in der heutigen Zeit mit
den heutigen Herausforderungen ist dies notwendig. Ich nenne hier zum Beispiel
nur Desinformation und Destabilisierungstendenzen. Hass im Netz ist leider
eine traurige Realität, vor allem für Frauen. Wir erleben Sexismus,
wir
erleben Drohungen, wir erleben Bedrohungen, ganz zu schweigen von Deepfakes, die mithilfe von KI mittlerweile ja sehr
flächendeckend möglich sind.
Die Beratungsstelle für
Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit Zara
hat berichtet, dass seit Eröffnung der Beratungsstelle gegen Hass im Netz
im September 2017 bis August dieses Jahres 11 514 Onlinehassmeldungen
eingegangen sind. Das muss man sich einmal vorstellen!
11 514 Situationen, in denen ein Mensch in eine schwierige,
öffentlich peinliche Lage gebracht
worden ist.
Wir haben Gott sei Dank auf
österreichischer Ebene schon vor drei Jahren mit diesem
Hass-im-Netz-Bekämpfungs-Gesetz reagiert. Wie sich heute zeigt,
war es notwendig. Für Nutzerinnen und Nutzer ist es nicht egal, was im
Internet passiert, weil das Internet kein rechtsfreier Raum ist. Da braucht es
klare Schranken und Regulierungen.
Wir glauben, dass das mit dem
DSA gelingt und dass damit die Rechtsdurchsetzung wirklich zu schaffen ist. Es ist für uns auch wichtig, zu
wissen, welche
Macht Konzerne diesbezüglich haben und wer hinter verschiedenen Aktionen
steckt.
Zusätzlich wurde auch noch
eine Rechtsgrundlage für einen immateriellen Schadenersatz bei
Hasspostings geschaffen. Damit können Opfer auch außerhalb des
Medienrechts von demjenigen, der das Hassposting ins Netz gestellt hat,
Schadenersatz erlangen. Das ist eine Lücke, die wir mit
diesem Begleitgesetz schließen. (Beifall bei ÖVP und
Grünen.)
Wichtig ist, dass man jetzt auch von diesen verschiedenen
Instrumenten, die dieses Gesetz bietet, Gebrauch macht. Es sollen sich
Betroffene von
Hass im Netz schnell, einfach und kostengünstig zur Wehr setzen
können. Bitte
machen Sie im Falle des Falles Gebrauch davon, denn Hass im
Netz darf
niemals durchgehen! (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
20.21
Vizepräsidentin
Margit Göll: Zu Wort gemeldet ist Herr
Bundesrat
Stefan Schennach. – Bitte sehr.
Bundesrat
Stefan Schennach (SPÖ, Wien): Mit
dieser Verordnung über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und mit
dem DSA-Begleitgesetz über
digitale Dienste haben wir nichts vorliegen in Richtung Big brother is watching
you, sondern es ist eine Maßnahme, damit wir die Möglichkeit haben,
gegen diese irrsinnig großen Konzerne, international agierenden Konzerne
auch zu reagieren.
Wer wird denn hier reguliert? – Das sind Onlinevermittler und Plattformen, Marktplätze, soziale Netzwerke, Plattformen zum Teilen von Inhalten, Appstores, Onlineplattformen für Reisen und Unterkünfte.
Es geht darum, illegale und schändliche Aktivitäten im Internet und die Verbreitung vor allem von Desinformation zu verhindern. Damit erhöhen wir erstens die Haftung der Anbieter, stärken die Sorgfaltspflichten und schaffen ein transparentes und sicheres Onlineumfeld.
Der Digital Services Act ist am 27.10.2022 im Amtsblatt der
EU bereits veröffentlicht worden, und die Regeln treten am
17. Februar 2024 für alle Plattformen in Kraft. Schon seit
August 2023 aber gelten diese Regeln für Plattformen –
nur dass Sie das einmal wissen – mit mehr als 45 Millionen Nutzern und
Nutzerinnen. Das zeigt, welche Macht da auf der einen Seite steht. Damit
ist diese Verordnung in der gesamten EU unmittelbar anwendbar, und
das ist der ganz, ganz große Fortschritt.
Das Gesetz setzt die KommAustria und auch die RTR, vor allem aber die KommAustria, als Koordinator der digitalen Dienste ein. Es kommt da eine ganze
Reihe neuer Befugnisse und Aufgaben auf die KommAustria zu, zum Beispiel
die außergerichtliche Streitbeilegung, Vergabe des Status eines
vertrauenswürdigen Hinweisgebers, die Zuerkennung des Status für
zugelassene Forschung, die Entscheidung über Beschwerden und
Informations-, Berichts- und Übermittlungspflichten. Das ist also ein
erster und großer politischer Schritt auf gemeinschaftlicher
europäischer Ebene diese Plattformen betreffend gegenüber diesen
großen, mächtigen Konzernen. Damit schaffen wir eines: demokratische
und soziale Errungenschaften abzusichern.
Solch große Plattformen können vor allem im Desinformationsbereich auch eine Gefahr für die Demokratie darstellen, und deshalb gehört das auch abgewendet. Es werden Wahlen manipuliert, Meinungen unterdrückt und Blasen geschaffen.
Ich bin für den Europarat
der Berichterstatter für Slapps. Sowohl die Europäische Union
als auch der Ministerrat des Europarates als auch die Parlamentarische
Versammlung werden Spielregeln zu Slapps erlassen, das heißt zu
rechtlichen Outlets, die dazu geeignet sind, Meinungen zu unterdrücken
und Menschenrechtsanwälte zu knebeln.
Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen: Der verstorbene Prigoschin zum Beispiel war einer der Mover auf Slapps im Vereinigten Königreich. Jeder, der behauptet hat, dass er Chef der Wagner-Söldner ist, landete mit enormen Kosten vor Gericht. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir verhindern, dass Meinungen unterdrückt und Blasen geschaffen werden.
Bei Klara Neurauter war
ich ganz positiv überrascht, dass sie - - (Bundesrätin
Eder-Gitschthaler: Wieso?) – Vorsicht, Andrea, ich sage etwas Positives, du musst
dich nicht aufregen. Ich war überrascht, dass sie Zara als ein positives
Beispiel erwähnt hat. Ich möchte aber nicht verschweigen, dass es
ÖVP-Regierungsmitglieder waren, die die Förderungen für
Zara eigentlich abdrehen wollten und Zara fast ruiniert haben.
Liebe Frau Kittl, ich werde
heute nicht schlafen können, du hast vier Reden
ohne Wienkritik gehalten (Bundesrat Steiner: Du hast die ganze Zeit
geschlafen! – Heiterkeit bei ÖVP, FPÖ und
Grünen), aber wäre die Stadt Wien nicht gewesen, wäre Zara
nicht mehr am Leben. (Bundesrat Steiner: Du hast 90 Prozent der
Sitzung verschlafen!) Es geht darum, dass Einrichtungen wie Zara, Epicenter
Works und Internetombudsmänner nicht die nötigen finanziellen Ressourcen
haben.
Jetzt schaue ich Sascha Obrecht
an, weil ich mich dadurch erinnere, dass auch ich einen Entschließungsantrag
vorbereitet habe. (Allgemeine Heiterkeit.)
In diesem Entschließungsantrag geht es genau darum, dass diese
Organisationen, die auch von Frau Neurauter positiv genannt wurden, nicht
über die finanziellen Mittel verfügen, um all das zu
überprüfen. Deshalb folgender Entschließungsantrag:
Entschließungsantrag
der Bundesrät:innen Stefan Schennach, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Den Digital Services Act in der Praxis zum Leben erwecken“
Der Bundesrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, zur Unterstützung von Trusted Flaggern und außergerichtlichen Streitbeilegungsstellen ein eigenes Förderprogramm zu installieren, damit die in Frage kommenden Einrichtungen ihre wichtigen im Digital Services Act vorgesehenen Aufgaben auch vollumfassend wahrnehmen können.“
*****
Wir appellieren hier für die Unterstützung dieses Antrages.
Ich denke, Frau Bundesministerin, irgendwann müssen wir uns auch einmal darüber unterhalten, ob bei diesen vielen neuen Aufgaben für die KommAustria
und für die RTR die personelle Ausstattung
tatsächlich ausreichend ist.
Die KommAustria hat weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als die vergleichbaren
Einrichtungen in der Slowakei oder in Schweden. Ob sich
das ausgeht, werden wir jetzt in der Praxis genau beobachten. Ich hoffe, die
Regierung ist da gesprächsbereit, wenn es möglicherweise notwendig
sein wird, den Personalstand zu erhöhen. Derzeit sind sieben Mitglieder in
der KommAustria und zwischen zwölf und 15 Mitglieder bei der RTR dafür
verantwortlich. Das ist enorm viel Arbeit, die da auf diese beiden
Organisationen zukommt.
Wir unterstützen natürlich diesen Digital
Services Act vollinhaltlich und hoffen, dass er damit auch wirklich zum Leben
erweckt ist. – Danke. (Beifall bei
der SPÖ.)
20.29
Vizepräsidentin Margit Göll: Der von den Bundesräten Stefan Schennach, Kolleginnen und Kollegen eingebrachte Entschließungsantrag betreffend „Den Digital Services Act in der Praxis zum Leben erwecken“ ist genügend unterstützt und steht demnach mit in Verhandlung.
Frau Bundesministerin Dr. Alma Zadić, bitte.
Bundesministerin für Justiz Dr. Alma Zadić, LL.M.: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Geschätzte Mitglieder des Bundesrates! Ich trenne Sie jetzt vom Ende der Sitzung – keine Sorge, ich werde meine Redezeit nicht strapazieren. (Heiterkeit bei Bundesrät:innen der ÖVP.)
Zum DSA wurde ja schon vieles gesagt. Ich wollte aber
trotzdem die Gelegenheit ergreifen und mich auch bedanken, weil es trotz der
vielen unterschiedlichen Zugänge und der Diskrepanzen für mich immer
wieder eine Freude ist,
im Bundesrat zu sein. Allein heute sind einige Zitate gefallen wie „Ihr
Kinderlein kommet“. Ganz zu Beginn wurde auch Matthias Strolz zitiert: „Spürt
ihr
euch noch?“ – Das fand ich besonders lustig. (Heiterkeit
bei Grünen und ÖVP.)
Mein Highlight von heute,
angelehnt an Monty Python – wer es kennt:
Was haben die Römer jemals für
euch gemacht? –: Was hat diese Regierung jemals für euch
gemacht? (Bundesrat Schreuder: Ja, war super, das stimmt!) –
Ich weiß nicht mehr, von wem das kam, aber das fand ich besonders lustig.
(Zwischenruf bei der FPÖ.) Insofern: Was hat diese Regierung jemals
für euch gemacht? – Vieles. (Vizepräsidentin Hahn übernimmt
den Vorsitz.)
Ich wünsche auch allen frohe Weihnachten und erholsame
Festtage. Vielen Dank für die spannenden Debatten. Ich freue mich auf ein
spannendes Jahr 2024 mit Ihnen. – Danke schön. (Beifall
bei Grünen, ÖVP und SPÖ sowie
des Bundesrates Arlamovsky.)
20.31
Vizepräsidentin Doris Hahn, MEd MA: Es liegen mir keine weiteren Wortmeldungen mehr vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir gelangen somit zur Abstimmung.
Ich ersuche jene
Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den
vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch
zu erheben, um ein Handzeichen. – Dies ist die Stimmenmehrheit.
Der Antrag ist somit angenommen.
Es liegt weiters ein Antrag der
Bundesräte Stefan Schennach, Kolleginnen
und Kollegen auf Fassung einer Entschließung betreffend
„Den Digital Services Act in der Praxis zum Leben erwecken“ vor.
Ich lasse über diesen Entschließungsantrag abstimmen.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Entschließungsantrag zustimmen, um ein Handzeichen. – Dies ist die Stimmenminderheit. Der Antrag auf Fassung der gegenständlichen Entschließung ist somit abgelehnt.
Die Tagesordnung ist erschöpft.
Verlesung eines Teiles des Amtlichen Protokolls
Vizepräsidentin
Doris Hahn, MEd MA: Es liegt mir ein schriftliches Verlangen
von fünf Mitgliedern des Bundesrates
vor, das Amtliche Protokoll hinsichtlich der
Tagesordnungspunkte 1 bis 20 zu verlesen, damit dieser Teil des Amtlichen
Protokolls mit Schluss der Sitzung als genehmigt gilt. (Zwischenruf des
Bundesrates Schreuder.)
Ich werde daher so vorgehen. Ich verlese nunmehr diesen Teil des Amtlichen Protokolls:
„Tagesordnungspunkt 1
Abstimmung: Berichterstattung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen.
Tagesordnungspunkte 2 bis 4:
Abstimmungen:
TO-Punkt 2: Berichterstattung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen.
TO-Punkt 3: Berichterstattung:
Antrag, 1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch
zu erheben, wird angenommen, 2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates
gemäß Art. 44 Abs. 2 B-VG die verfassungsmäßige
Zustimmung zu erteilen, wird bei Anwesenheit von mehr
als der Hälfte der Mitglieder des Bundesrates und zwar mit der
erforderlichen Zweidrittelmehrheit angenommen.
TO-Punkt 4: Berichterstattung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen.
Tagesordnungspunkte 5 und 6:
Abstimmungen:
TO-Punkt 5: Berichterstattung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen.
TO-Punkt 6: Berichterstattung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen.
Tagesordnungspunkt 7
Abstimmung: Berichterstattung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen.
Tagesordnungspunkte 8 und 9:
Abstimmungen:
TO-Punkt 8: Berichterstattung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen.
TO-Punkt 9: Berichterstattung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen.
Tagesordnungspunkte 10 und 11:
Abstimmungen:
TO-Punkt 10: Berichterstattung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen.
TO-Punkt 11: Berichterstattung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen.
Tagesordnungspunkte 12 und 13:
Die Bundesräte Günter Pröller, Kolleginnen und Kollegen bringen zu TOP 13 einen Entschließungsantrag ein.
Abstimmungen:
TO-Punkt 12: Berichterstattung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen.
TO-Punkt 13: Berichterstattung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen.
Der Entschließungsantrag wird abgelehnt.
Tagesordnungspunkt 14
Die Bundesräte Korinna Schumann, Kolleginnen und Kollegen bringen den Entschließungsantrag Beilage 14/1 EA ein.
Die Bundesräte Mag. Sascha Obrecht, Kolleginnen und Kollegen bringen den Entschließungsantrag Beilage 14/2 EA ein.
Abstimmungen:
Berichterstattung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen.
Der Entschließungsantrag Beilage 14/1 EA wird abgelehnt.
Der Entschließungsantrag Beilage 14/2 EA wird abgelehnt.
Tagesordnungspunkt 15:
Abstimmung: Berichterstattung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen.
Tagesordnungspunkt 16:
Abstimmung: Berichterstattung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen.
Tagesordnungspunkt 17:
Abstimmung: Berichterstattung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen.
Tagesordnungspunkte 18 und 19:
Abstimmungen:
TO-Punkt 18: Berichterstattung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen.
TO-Punkt 19: Berichterstattung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen.
Tagesordnungspunkt 20:
Die Bundesräte Stefan Schennach, Kolleginnen und Kollegen bringen einen Entschließungsantrag ein.
Abstimmungen:
TO-Punkt 20: Berichterstattung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen.
Der Entschließungsantrag wird abgelehnt.“
*****
Erheben sich Einwendungen gegen die Fassung oder den Inhalt dieser verlesenen Teile des Amtlichen Protokolls? (Bundesrat Himmer: Ja, sag es noch einmal!) – Das ist nicht der Fall.
Das Amtliche Protokoll gilt
daher hinsichtlich der Tagesordnungspunkte 1 bis 20 gemäß
§ 64 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Bundesrates mit
Schluss
dieser Sitzung als genehmigt. (Beifall bei der
ÖVP. – Zwischenruf des Bundesrates Steiner. –
Bundesrat Schreuder: Moment!)
Einlauf und Zuweisungen
Vizepräsidentin Doris Hahn, MEd MA: Ich gebe noch bekannt, dass seit der letzten beziehungsweise in der heutigen Sitzung insgesamt drei Anfragen, 4139/J-BR/2023 bis 4141/J-BR/2023, eingebracht wurden.
Eingelangt sind
der Entschließungsantrag 406/A(E)-BR/2023 der
Bundesräte Korinna Schumann, Kolleginnen und Kollegen betreffend
„Personalaufstockung beim Arbeitsmarktservice und der
Arbeitsinspektion“, der dem Ausschuss für
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz zugewiesen wird
und der Entschließungsantrag 407/A(E)-BR/2023 der Bundesräte Marlies Doppler, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Erhaltung des Internationalen Gebrauchshundesports in all seinen Facetten in Österreich“, der dem Gesundheitsausschuss zugewiesen wird.
*****
Die Einberufung der nächsten Sitzung des Bundesrates ist bereits auf schriftlichem Wege erfolgt. Als Sitzungstermin ist morgen, Donnerstag, der 21. Dezember, 9 Uhr, in Aussicht genommen.
Ich wünsche einen schönen Abend, bis morgen um 9 Uhr!
Die Sitzung ist geschlossen.
Schluss der Sitzung: 20.37 Uhr
|
Impressum: Parlamentsdirektion 1017 Wien |