
Stenographisches Protokoll
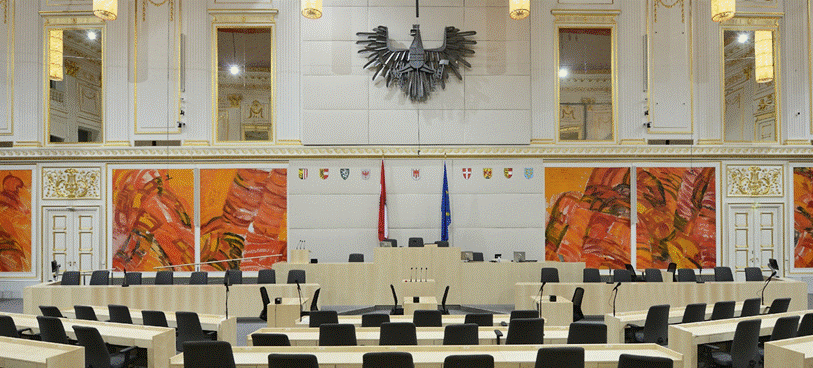
887. Sitzung des Bundesrates der Republik Österreich
Mittwoch, 19. Dezember 2018

Stenographisches Protokoll
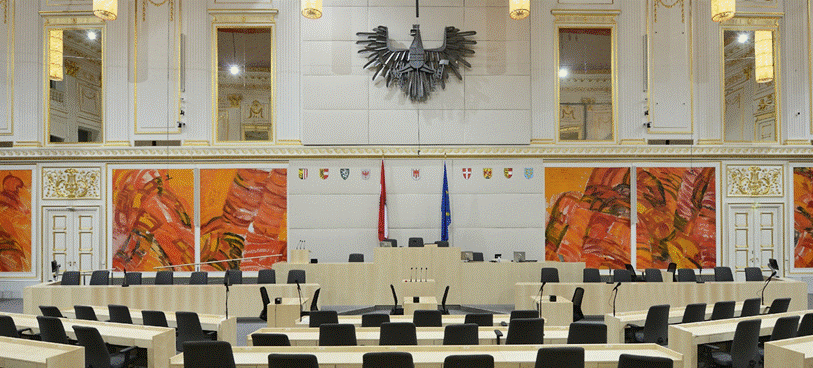
887. Sitzung des Bundesrates der Republik Österreich
Mittwoch, 19. Dezember 2018
887. Sitzung des Bundesrates der Republik Österreich
Mittwoch, 19. Dezember 2018
Dauer der Sitzung
Mittwoch, 19. Dezember 2018: 14.01 – 21.59 Uhr
*****
Tagesordnung
1. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Prüfung lohnabhängiger Abgaben und Beiträge erlassen wird und das Einkommensteuergesetz 1988, das Kommunalsteuergesetz 1993 und das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz geändert werden (Gesetz über die Zusammenführung der Prüfungsorganisationen der Finanzverwaltung und der Sozialversicherung – ZPFSG)
2. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das ÖIAG-Gesetz 2000, das Bundesimmobiliengesetz und das Finanzmarktstabilitätsgesetz geändert werden
3. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Tabakmonopolgesetz geändert wird
4. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Tabaksteuergesetz 1995 (TabStG) geändert wird
5. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Katastrophenfondsgesetz 1996 geändert wird
6. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Finanzausgleichsgesetz 2017 geändert wird
7. Punkt: Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und von Veräußerungsgewinnen samt Protokoll
8. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Symbole-Gesetz geändert wird
9. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Waffengesetz 1996 geändert wird
10. Punkt: Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Russischen Föderation über die gegenseitige Hilfeleistung bei Naturkatastrophen oder technischen Katastrophen und die Zusammenarbeit bei deren Prävention
11. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Grenzkontrollgesetz geändert wird
12. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Zivildienstgesetz 1986 geändert wird
13. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz zur Gewährleistung eines hohen Sicherheitsniveaus von Netz- und Informationssystemen (Netz- und Informationssystemsicherheitsgesetz – NISG) erlassen und das Telekommunikationsgesetz 2003 geändert wird
14. Punkt: Bundesgesetz über die Entwicklung und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Österreich (Standort-Entwicklungsgesetz – StEntG)
15. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das E-Government-Gesetz, das IKT-Konsolidierungsgesetz, das Signatur- und Vertrauensdienstegesetz, das Unternehmensserviceportalgesetz, das Bundesgesetzblattgesetz, das Zustellgesetz, die Bundesabgabenordnung, das Bundesfinanzgerichtsgesetz, das Meldegesetz 1991, das Passgesetz 1992 und das Personenstandsgesetz 2013 geändert werden
16. Punkt: Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeordnung 1994, das Bankwesengesetz, das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das Maklergesetz und das Versicherungsaufsichtsgesetz geändert werden (Versicherungsvermittlungsnovelle 2018)
17. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Wirtschaftskammergesetz 1998 geändert wird – WKG-Novelle 2018
18. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 1984, die Zivilprozessordnung und das Verbraucherbehörden-Kooperationsgesetz geändert werden (UWG-Novelle 2018)
*****
Inhalt
Bundesrat
Schreiben des Generalsekretärs des Bundesministeriums für Europa, Integration und Äußeres gemäß Art. 50 Abs. 5 B-VG betreffend Erteilung der Vollmacht zur Aufnahme von Verhandlungen über ein Rahmenabkommen über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Sicherheit zwischen der Republik Österreich und der Argentinischen Republik durch den Bundespräsidenten ................ 30
Schreiben des Bundesministers für Finanzen gemäß Art. 50 Abs. 5 B-VG betreffend Erteilung der Vollmacht zur Fortführung von Verhandlungen eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen zwischen der Republik Österreich und der Argentinischen Republik durch den Bundespräsidenten ............................................................................................................................... 33
Schreiben des Bundesministers für Finanzen gemäß Art. 50 Abs. 5 B-VG betreffend Erteilung der Vollmacht zur Ausweitung der Verhandlungen eines Protokolls zur Abänderung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik Korea zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen durch den Bundespräsidenten ......................................................................................................... 37
Schreiben des Bundesministers für Finanzen gemäß Art. 50 Abs. 5 B-VG betreffend Erteilung der Vollmacht für Verhandlungen eines Protokolls zur Abänderung des Abkommens zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung des Staates Katar zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt Protokoll durch den Bundespräsidenten ............................................................................................................................... 40
Absehen von der 24-stündigen Frist für das Aufliegen der gegenständlichen schriftlichen Ausschussberichte gemäß § 44 Abs. 3 GO-BR ............................................................................................ 43
Antrag des Bundesrates David Stögmüller, dem Gesundheitsausschuss zur Berichterstattung über den Antrag 238/A-BR/2017 der BundesrätInnen David Stögmüller, Kolleginnen und Kollegen betreffend „ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über Ausbildung, Tätigkeit und Beruf der Sanitäter“ geändert wird,
gemäß § 45 Abs. 3 GO-BR eine Frist bis 14. Februar 2019 zu setzen – Ablehnung 44, 149
Antrag des Bundesrates David Stögmüller, dem Unterrichtsausschuss zur Berichterstattung über den Selbständigen Entschließungsantrag 250/A(E)-BR/2018 der BundesrätInnen David Stögmüller, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Erhalt von Integrationsklassen an Sonderschulen“ gemäß § 45 Abs. 3 GO-BR eine Frist bis 14. Februar 2019 zu setzen – Ablehnung ................................................ 44, 150
Personalien
Verhinderungen .............................................................................................................. 10
Aktuelle Stunde (67.)
Thema: „Aktuelle Entwicklungen bei der Transparenzdatenbank“ ...................... 10
RednerInnen:
Karl Bader ..................................................................................................................... 10
Ewald Lindinger ........................................................................................................... 12
Josef Ofner ................................................................................................................... 15
Bundesminister Hartwig Löger ........................................................................... 17, 22
Ferdinand Tiefnig ......................................................................................................... 19
Andrea Kahofer ............................................................................................................ 20
Mag. Reinhard Pisec, BA MA ...................................................................................... 21
Bundesregierung
Schreiben des Bundeskanzleramtes betreffend Aufenthalt von Mitgliedern der Bundesregierung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union ...................................................... 27, 28
Vertretungsschreiben ..................................................................................................... 43
Nationalrat
Beschlüsse und Gesetzesbeschlüsse ............................................................................ 43
Ausschüsse
Zuweisungen .................................................................................................................. 23
Dringliche Anfrage
der BundesrätInnen Reinhard Todt, Kolleginnen und Kollegen an den Bundeskanzler betreffend „TAXI BUND“ (3604/J-BR/2018) .............................................................................................. 74
Begründung: Reinhard Todt ......................................................................................... 74
Bundeskanzler Sebastian Kurz .................................................................................. 75
Debatte:
Stefan Schennach ........................................................................................................ 78
Karl Bader ................................................................................................................ ..... 79
Gerd Krusche ............................................................................................................... 80
David Stögmüller .......................................................................................................... 82
Verhandlungen
1. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Prüfung lohnabhängiger Ab-
gaben und Beiträge erlassen wird und das Einkommensteuergesetz 1988, das Kommunalsteuergesetz 1993 und das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz geändert werden (Gesetz über die Zusammenführung der Prüfungsorganisationen der Finanzverwaltung und der Sozialversicherung – ZPFSG) (328 d.B. und 425 d.B. sowie 10070/BR d.B. und 10087/BR d.B.) ............................................................................................................... 44
Berichterstatterin: Marianne Hackl ................................................................................ 44
RednerInnen:
Andrea Kahofer ............................................................................................................ 45
Elisabeth Mattersberger .............................................................................................. 46
Rosa Ecker, MBA ......................................................................................................... 47
Bundesminister Hartwig Löger .................................................................................. 48
Annahme des Antrages der Berichterstatterin, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ..................................................................................................... 49
2. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das ÖIAG-Gesetz 2000, das Bundesimmobiliengesetz und das Finanzmarktstabilitätsgesetz geändert werden (367 d.B. und 426 d.B. sowie 10071/BR d.B. und 10088/BR d.B.) ................................ 49
Berichterstatterin: Marianne Hackl ................................................................................ 49
RednerInnen:
Dr. Andrea Eder-Gitschthaler ..................................................................................... 49
Dominik Reisinger ........................................................................................................ 51
Mag. Reinhard Pisec, BA MA ...................................................................................... 51
Bundesminister Hartwig Löger .................................................................................. 52
Annahme des Antrages der Berichterstatterin, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ..................................................................................................... 54
Gemeinsame Beratung über
3. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Tabakmonopolgesetz geändert wird (513/A und 428 d.B. sowie 10089/BR d.B.) ......... 54
Berichterstatter: Ing. Eduard Köck ............................................................................... 54
4. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Tabaksteuergesetz 1995 (TabStG) geändert wird (429 d.B. sowie 10090/BR d.B.) ......... 54
Berichterstatter: Ing. Eduard Köck ............................................................................... 54
5. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Katastrophenfondsgesetz 1996 geändert wird (368 d.B. und 430 d.B. sowie 10091/BR d.B.) 54
Berichterstatter: Ing. Eduard Köck ............................................................................... 54
6. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Finanzausgleichsgesetz 2017 geändert wird (370 d.B. und 431 d.B. sowie 10072/BR d.B. und 10092/BR d.B.) ......................................................................................................................................... 54
Berichterstatter: Ing. Eduard Köck ............................................................................... 54
7. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Vereinigten Königreich von
Großbritannien und Nordirland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und von Veräußerungsgewinnen samt Protokoll (326 d.B. und 432 d.B. sowie 10093/BR d.B.) ............................................................................................................................... 54
Berichterstatter: Ing. Eduard Köck ............................................................................... 54
RednerInnen:
Stefan Schennach ........................................................................................................ 55
Robert Seeber ............................................................................................................... 57
Peter Samt ..................................................................................................................... 59
Elisabeth Mattersberger .............................................................................................. 60
Gottfried Sperl .............................................................................................................. 61
Bundesminister Hartwig Löger .................................................................................. 62
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 3, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................... 63
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 4, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................... 63
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 5, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................... 64
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 6, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................... 64
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 7, 1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben und 2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen ....... 64
8. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Symbole-Gesetz geändert wird (377 d.B. und 419 d.B. sowie 10094/BR d.B.) ............ 64
Berichterstatter: Gottfried Sperl ................................................................................... 64
RednerInnen:
Martin Weber ................................................................................................................. 65
Georg Schuster ............................................................................................................ 67
Mag. Dr. Ewa Dziedzic ................................................................................................. 68
Günther Novak (tatsächliche Berichtigung) ................................................................. 70
Silvester Gfrerer ........................................................................................................... 71
David Stögmüller (tatsächliche Berichtigung) .............................................................. 72
Staatssekretärin Mag. Karoline Edtstadler ............................................................... 73
Anton Froschauer ........................................................................................................ 83
Annahme des Antrages des Berichterstatters, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ..................................................................................................... 84
9. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Waffengesetz 1996 geändert wird (379 d.B. und 421 d.B. sowie 10095/BR d.B.) ........ 84
Berichterstatter: Mag. Dr. Michael Raml ...................................................................... 84
RednerInnen:
Andreas Arthur Spanring ............................................................................................ 85
Ing. Bruno Aschenbrenner ......................................................................................... 87
Jürgen Schabhüttl ........................................................................................................ 88
Georg Schuster ............................................................................................................ 90
Michael Wanner ............................................................................................................ 91
Andreas Arthur Spanring (tatsächliche Berichtigung) ................................................ 92
Jürgen Schabhüttl (tatsächliche Berichtigung) ............................................................ 92
Staatssekretärin Mag. Karoline Edtstadler ............................................................... 93
Annahme des Antrages des Berichterstatters, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ..................................................................................................... 93
10. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Russischen Föderation über die gegenseitige Hilfeleistung bei Naturkatastrophen oder technischen Katastrophen und die Zusammenarbeit bei deren Prävention (256 d.B. und 423 d.B. sowie 10096/BR d.B.) ............................................. 94
Berichterstatter: Andreas Arthur Spanring ................................................................. 94
RednerInnen:
Stefan Schennach ........................................................................................................ 94
Gottfried Sperl .............................................................................................................. 95
Ing. Eduard Köck .......................................................................................................... 96
Staatssekretärin Mag. Karoline Edtstadler ............................................................... 96
Annahme des Antrages des Berichterstatters, 1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben und 2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen ........................................................... 97
11. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Grenzkontrollgesetz geändert wird (498/A und 424 d.B. sowie 10097/BR d.B.) ........... 97
Berichterstatter: Georg Schuster ................................................................................. 97
RednerInnen:
Martin Weber ................................................................................................................. 97
Mag. Dr. Michael Raml ................................................................................................. 99
Jürgen Schabhüttl ...................................................................................................... 100
Marianne Hackl ........................................................................................................... 102
Staatssekretärin Mag. Karoline Edtstadler ............................................................. 103
David Stögmüller ........................................................................................................ 104
Jürgen Schabhüttl (tatsächliche Berichtigung) .......................................................... 106
Annahme des Antrages des Berichterstatters, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................................................... 106
12. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Zivildienstgesetz 1986 geändert wird (380 d.B. und 422 d.B. sowie 10098/BR d.B.) 106
Berichterstatter: Mag. Dr. Michael Raml .................................................................... 107
RednerInnen:
David Stögmüller .................................................................................................... ... 107
Gottfried Sperl ............................................................................................................ 110
Mag. Marlene Zeidler-Beck, MBA ............................................................................. 111
Michael Wanner .......................................................................................................... 112
Martin Weber ............................................................................................................... 113
Staatssekretärin Mag. Karoline Edtstadler ............................................................. 114
Entschließungsantrag der BundesrätInnen David Stögmüller und Mag. Dr. Ewa Dziedzic betreffend „Notwendige Reformen des Zivildienstes in Österreich“ – Unterstützungsfrage – nicht genügend unterstützt 109, 110, 110
Annahme des Antrages des Berichterstatters, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................................................... 116
13. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz zur Gewährleistung eines hohen Sicherheitsniveaus von Netz- und Informationssystemen (Netz- und Informationssystemsicherheitsgesetz – NISG) erlassen und das Telekommunikationsgesetz 2003 geändert wird (369 d.B. und 418 d.B. sowie 10099/BR d.B.) ...................................... 116
Berichterstatter: Georg Schuster ............................................................................... 116
RednerInnen:
Andreas Arthur Spanring .......................................................................................... 116
Armin Forstner, MPA ................................................................................................. 117
Stefan Zaggl ................................................................................................................ 118
Staatssekretärin Mag. Karoline Edtstadler ............................................................. 119
Annahme des Antrages des Berichterstatters, 1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben und 2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Art. 44 Abs. 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen ............................................................... 120
14. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 12. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz über die Entwicklung und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Österreich (Standort-Entwicklungsgesetz – StEntG) (372 d.B. und 469 d.B. sowie 10075/BR d.B. und 10111/BR d.B.) ............... 120
Berichterstatterin: Marianne Hackl .............................................................................. 120
RednerInnen:
Günther Novak ........................................................................................................... 121
Robert Seeber ............................................................................................................. 122
Mag. Dr. Ewa Dziedzic ............................................................................................... 123
Gerd Krusche ............................................................................................................. 125
Bundesministerin Dr. Margarete Schramböck ....................................................... 127
Hubert Koller, MA ....................................................................................................... 130
Mag. Christian Buchmann ......................................................................................... 131
Michael Bernard ......................................................................................................... 133
Annahme des Antrages der Berichterstatterin, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................................................... 135
15. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 12. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das E-Government-Gesetz, das IKT-Konsolidierungsgesetz, das Signatur- und Vertrauensdienstegesetz, das Unternehmensserviceportalgesetz, das Bundesgesetzblattgesetz, das Zustellgesetz, die Bundesabgabenordnung, das Bundesfinanzgerichtsgesetz, das Meldegesetz 1991, das Passgesetz 1992 und das Personenstandsgesetz 2013 geändert werden (381 d.B. und 396 d.B. sowie 10112/BR d.B.) 135
Berichterstatterin: Marianne Hackl .............................................................................. 135
RednerInnen:
Mag. Marlene Zeidler-Beck, MBA ............................................................................. 135
Günther Novak ........................................................................................................... 136
Christoph Längle, BA ................................................................................................ 137
Bundesministerin Dr. Margarete Schramböck ....................................................... 138
Annahme des Antrages der Berichterstatterin, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................................................... 139
16. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 12. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeordnung 1994, das Bankwesengesetz, das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das Maklergesetz und das Versicherungsaufsichtsgesetz geändert werden (Versicherungsvermittlungsnovelle 2018) (371 d.B. und 397 d.B. sowie 10076/BR d.B. und 10113/BR d.B.) ............................................. 139
Berichterstatter: Robert Seeber .................................................................................. 139
RednerInnen:
Eva Prischl .................................................................................................................. 139
Dr. Magnus Brunner, LL.M. ....................................................................................... 140
Ing. Bernhard Rösch .................................................................................................. 141
Bundesministerin Dr. Margarete Schramböck ....................................................... 142
Annahme des Antrages des Berichterstatters, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................................................... 142
17. Punkt: Beschluss
des Nationalrates vom 13. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Wirtschaftskammergesetz 1998
geändert wird – WKG-
Novelle 2018 (506/A und 470 d.B. sowie 10077/BR d.B. und
10114/BR d.B.) ........... 142
Berichterstatter: Robert Seeber .................................................................................. 143
RednerInnen:
Hubert Koller, MA ....................................................................................................... 143
Mag. Christian Buchmann ......................................................................................... 144
Peter Samt ................................................................................................................... 146
Annahme des Antrages des Berichterstatters, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................................................... 147
18. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 13. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 1984, die Zivilprozessordnung und das Verbraucherbehörden-Kooperationsgesetz geändert werden (UWG-Novelle 2018) (375 d.B. und 398 d.B. sowie 10115/BR d.B.) ................................................................................................... 147
Berichterstatter: Robert Seeber .................................................................................. 147
RednerInnen:
Andrea Kahofer .......................................................................................................... 147
Dr. Magnus Brunner, LL.M. ....................................................................................... 148
Josef Ofner ................................................................................................................. 148
Bundesministerin Dr. Margarete Schramböck ....................................................... 149
Annahme des Antrages des Berichterstatters, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................................................... 149
Eingebracht wurden
Anfragen der BundesrätInnen
Mag. Elisabeth Grossmann, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz betreffend „Schutz von Kindern, die Opfer oder Zeugen von Gewalt in der Familie wurden“ (3602/J-BR/2018)
David Stögmüller, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Was hat BM Kickl mit dem „Hitler Geburtshaus“ in Braunau vor? (3603/J-BR/2018)
Reinhard Todt, Kolleginnen und Kollegen an den Bundeskanzler betreffend TAXI BUND (3604/J-BR/2018)
Anfragebeantwortungen
des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie auf die Anfrage der BundesrätInnen Michael Wanner, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Nahverkehrsmilliarde“ (3304/AB-BR/2018 zu 3577/J-BR/2018)
des Bundesministers für Landesverteidigung auf die Anfrage der BundesrätInnen David Stögmüller, Kolleginnen und Kollegen betreffend Einsatz von MilizsoldatInnen an den österreichischen Grenzen (3305/AB-BR/2018 zu 3573/J-BR/2018)
des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der BundesrätInnen David Stögmüller, Kolleginnen und Kollegen betreffend Folgeanfrage zur Anfrage „Unterbringung von Asylwerbenden/Drittstaatsangehörige“ (3306/AB-BR/2018 zu 3574/J-BR/2018)
des Bundesministers für Landesverteidigung auf die Anfrage der BundesrätInnen Hubert Koller, Kolleginnen und Kollegen betreffend Assistenzeinsatz an der Grenze (3307/AB-BR/2018 zu 3575/J-BR/2018)
des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der BundesrätInnen David Stögmüller, Kolleginnen und Kollegen betreffend häuslichem Unterricht und Externistenprüfung (3309/AB-BR/2018 zu 3576/J-BR/2018)
des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie auf die Anfrage der BundesrätInnen David Stögmüller, Kolleginnen und Kollegen betreffend Atomtransporte (3310/AB-BR/2018 zu 3589/J-BR/2018)
*****
der Präsidentin des Bundesrates auf die Anfrage der BundesrätInnen Mag. Dr. Ewa Dziedzic, Kolleginnen und Kollegen betreffend die Veranstaltung „Krampus, Nikolo und Co – Geschichte eines Brauchtums“ im Palais Epstein (3308/ABPR-BR/2018 zu 3600/JPR-BR/2018)
Beginn der Sitzung: 14.01 Uhr
Vorsitzende: Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M., Vizepräsident Ewald Lindinger.
*****
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf die 887. Sitzung des Bundesrates eröffnen.
Das Amtliche Protokoll der 886. Sitzung des Bundesrates vom 6. Dezember 2018 ist aufgelegen, unbeanstandet geblieben und gilt daher als genehmigt.
Als verhindert gemeldet sind die Mitglieder des Bundesrates Inge Posch-Gruska, Sonja Zwazl und Mag. Martina Ess, die alle mit Grippe im Bett liegen. Wir wünschen an dieser Stelle baldige Genesung. Frau Präsidentin Posch-Gruska wird versuchen, morgen doch hier zu sein.
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Wir gelangen zur Aktuellen Stunde mit dem Thema
„Aktuelle Entwicklungen bei der Transparenzdatenbank“
mit Herrn Bundesminister für Finanzen Hartwig Löger, den ich hier im Bundesrat herzlich begrüßen darf. (Allgemeiner Beifall.)
In der Präsidialkonferenz wurde Einvernehmen über folgenden Ablauf erzielt: Zunächst kommt je eine Rednerin/ein Redner pro Fraktion zu Wort, deren beziehungsweise dessen Redezeit jeweils 10 Minuten beträgt. Sodann folgt die Stellungnahme des Herrn Bundesministers, die ebenfalls 10 Minuten nicht überschreiten soll. Danach folgt wiederum je eine Rednerin/ein Redner pro Fraktion sowie anschließend eine Wortmeldung der Bundesräte ohne Fraktion mit jeweils 5-minütiger Redezeit. Zuletzt kann noch eine abschließende Stellungnahme des Herrn Bundesministers erfolgen, die nach Möglichkeit 5 Minuten nicht überschreiten soll.
Als Erster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Karl Bader. – Ich erteile es dir und darf dich noch einmal darauf aufmerksam machen, die 10 Minuten einzuhalten. (Bundesrat Bader – auf dem Weg zum Rednerpult –: Das wird sich ausgehen!)
Bundesrat Karl Bader (ÖVP, Niederösterreich): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst ein Danke an dich, Herr Bundesminister, dass wir heute die Gelegenheit haben, uns hier im Bundesrat über die aktuellen Entwicklungen im Hinblick auf die Transparenzdatenbank auszutauschen. Das ist ja ein Thema, zum dem man auf der einen Seite schon fast sagen könnte, es ist, was den Start der Umsetzung der Transparenzdatenbank betrifft, schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber es ist auf der anderen Seite natürlich weiterhin ein sehr, sehr wesentliches Thema und in jedem Fall aktuell.
Mit der Transparenzdatenbank wurde in den letzten sechs Jahren ein Instrument geschaffen, das einen Überblick auf der einen Seite über die Förderprogramme des Bundes und auch über die ausbezahlten Leistungen des Bundes und auf der anderen Seite auch über die Leistungen der Länder bieten soll. Derzeit sind 706 Leistungsange-
bote des Bundes und 1 880 Leistungsangebote der Länder online in der Datenbank. Somit kann sich jeder potenzielle Förderwerber, aber auch die öffentliche Hand einen guten, strukturierten Überblick über die staatlichen Förderungen und Transferzahlungen verschaffen.
Seit dem Jahr 2013 teilen die auszahlenden Stellen des Bundes der Transparenzdatenbank Förderungen an Leistungsempfänger elektronisch mit, seit Anfang 2017 tun das in einem Pilotprojekt, das schrittweise weiter ausgerollt wird, auch die Länder. Oberösterreich ist da schon in allen Bereichen aktiv, alle anderen Bundesländer im Bereich Umwelt und Energie.
Was den Datenschutz betrifft, der in diesem Zusammenhang jedenfalls auch zu erwähnen ist, ist klargestellt, dass nach der Einmeldung weder dem Bundesministerium für Finanzen als Betreiber der Datenbank noch sonst jemandem die personenbezogenen Daten zugänglich sind. Den Leistungsempfängern ist es aber möglich, einen entsprechenden Überblick, einen Auszug zu bekommen, was an Information vorhanden ist.
Sich überschneidende Fördergebiete und Themen können bereits jetzt durch die Analyse der Leistungsangebote identifiziert werden. Zur besseren Steuerung der Förderungen ist es auch aktuell schon möglich, anonymisierte Auswertungen der Daten zu machen. Alle Bundesländer, wie vorhin schon kurz angesprochen, liefern die Leistungsmitteilungen gemäß dem Finanzausgleichspaktum, das 2016 beschlossen wurde, in dem festgelegten Bereich Umwelt und Energie, Oberösterreich und Niederösterreich liefern alle Leistungsmitteilungen. Im Zuge des Paktums wurde auch vereinbart, dass entsprechende Analysen durchgeführt werden sollen, die heuer von Februar bis September auch schon erfolgt sind. Dabei geht es darum, die Potenziale aufzuzeigen und entsprechende Schlüsse für die Zukunft zu ziehen.
Das Portal hat insgesamt einen Mehrwert für die Nutzerinnen und Nutzer. Das ist ein klares Ergebnis, und das Ziel, einen allgemeinen Überblick über von der öffentlichen Hand finanzierte Geldleistungen zu geben, ist auch erfüllt und nachvollziehbar.
Wenn wir heute über aktuelle Entwicklungen sprechen, geht es nicht nur darum, was in der Vergangenheit, seit Einführung der Transparenzdatenbank, geschehen ist, sondern auch darum, was kommt und vorgesehen ist. Vom Bundesministerium für Finanzen, vom Herrn Finanzminister wurde eine Novelle vorgelegt – um die Transparenzdatenbank entsprechend weiterzuentwickeln –, die sich derzeit in Begutachtung befindet.
Was sind die wesentlichen Punkte? – Da geht es auf der einen Seite um die Abfrageberechtigungen; der Herr Bundesminister wird das noch im Detail ausführen. Es geht natürlich darum, dass der Zugang zu den sensiblen personenbezogenen Daten wie bisher streng reglementiert ist.
Ein wesentlicher Punkt ist auch die Frage des Wirtschaftlichkeitszwecks, das ist ja auch im Haushaltsrecht enthalten, dass Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit ein Thema sind. Es geht um die Verbesserung der Abfrageergebnisse und darum, dass die Meldungen nicht erst bei der Auszahlung der Förderungen erfolgen sollen, sondern bereits bei der Genehmigung.
Es geht natürlich auch um die Frage der Erfassung von Förderungen an Länder und Gemeinden; da soll auch ein weiterer Schritt gesetzt werden.
Ich möchte heute auch – ich habe vorher schon die zwei Beispiele Oberösterreich und Niederösterreich angeführt, die über die im Finanzausgleichspaktum vereinbarten Themen Umwelt und Energie hinaus Förderdaten einmelden – Anmerkungen zum niederösterreichischen Zugang machen. Es ist natürlich ein Anliegen der Bürgerinnen und Bürger, einen Nachweis zu haben, was mit ihren Steuergeldern passiert, wie damit umgegangen wird. Auf der anderen Seite ist es, wenn dieses Interesse der Bürgerinnen und Bürger da ist, natürlich auch Aufgabe der Politik, größtmögliche Transparenz zu
schaffen. Das bringt auf der einen Seite auch mehr Effizienz, und auf der anderen Seite schafft mehr Effizienz natürlich auch Spielräume in den Budgets der Länder. Das heißt, es gibt sowohl für die Gebietskörperschaften als auch – und vor allem – für die Menschen klare Vorteile.
Aus diesem Grund hat unsere Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner schon im Vorjahr den für Finanzen zuständigen Landesrat Ludwig Schleritzko beauftragt, sicherzustellen, dass alle verfügbaren Förderdaten aus Niederösterreich eingemeldet werden. Gemeinsam mit dem Herrn Bundesminister hat nach einem Austausch am 22. November eine Pressekonferenz stattgefunden, bei der klar und deutlich darüber informiert wurde, dass der Auftrag, alle Daten einzumelden, erfüllt ist. Damit ist Niederösterreich nach Oberösterreich das zweite Bundesland, das alle verfügbaren Daten eingemeldet hat.
Wir sprechen für Niederösterreich in Summe von 215 verschiedenen Förderleistungen, die jetzt erfasst sind und aktuell gehalten werden. Es gibt die großen Förderbereiche – Umwelt und Energie habe ich vorher schon erwähnt –, aber auch Kulturförderungen, Wohnbauförderungen, Sportförderungen, Wirtschaftsförderungen. Diese werden automatisiert eingemeldet. Es gibt ein paar Leistungen, die manuell eingemeldet werden, das betrifft aber nur insgesamt 3 Prozent der Förderleistung; der Großteil funktioniert schon automatisiert.
In der Pilotphase waren es an die 1 000 Fördermeldungen mit einem Volumen von 8,7 Millionen Euro. Schauen wir uns die Weiterentwicklung seit dem Vorjahr an: Es wurden im heurigen Jahr bis Ende November bereits 154 000 Fördermitteilungen des Landes Niederösterreich in die Transparenzdatenbank eingemeldet, und es sind 300 Millionen Euro, die an Gesamtvolumen eingemeldet sind.
Wir in Niederösterreich sehen die Transparenzdatenbank als Planungs- und Steuerungsinstrument. Es geht auch darum, festzustellen und zu überprüfen, ob Ziel und Zweck der Förderung erreicht wurden, ob die öffentlichen Mittel punktgenau eingesetzt wurden. Mit der Transparenzdatenbank, so sehen wir das in Niederösterreich, haben wir ein Instrument in der Hand, um die vorhandenen Mittel fair zu verteilen. Das ist uns ganz, ganz wichtig.
Natürlich werden – das ist ja ein ganz großes Ziel dieser Transparenzdatenbank – auch Mehrfachförderungen vermieden. Die Förderprozesse werden vereinfacht, der Verwaltungsaufwand wird minimiert, es gibt entsprechend auch Kampf gegen Missbrauch. Das alles gewährt diese Datenbank.
Ich habe Niederösterreich und Oberösterreich schon als Beispielbundesländer angeführt. Und es gilt natürlich, zum Abschluss noch einen Appell an alle anderen Bundesländer zu richten, ihre Daten auch einzumelden, den Mehrwert dieser Transparenzdatenbank zu erkennen und sie für die Arbeit in den einzelnen Bundesländern entsprechend zu nutzen. – Vielen Dank. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
14.12
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Danke.
Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Ewald Lindinger. Ich erteile es ihm.
Bundesrat Ewald Lindinger (SPÖ, Oberösterreich): Geschätzter Herr Präsident! Herr Bundesminister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Als ich heute Mittag einmal kurz die Pressemeldungen durchgelesen habe, ist mir etwas sofort in die Augen gesprungen: „Minister Löger will mehr Transparenz. Eine Aktuelle Stunde des Finanzministers im Bundesrat ist an sich nicht ungewöhnlich – heute, Mittwoch, will Hartwig Löger aber Tacheles mit den Ländervertretern im Bundesrat reden: Es geht um die Transparenzdatenbank, die seit bald zehn Jahren nahezu unbefüllt existiert. Eigentlich sollten die
Landesregierungen Transparenz in ihre Budgets bringen und dem Bund Einblick in die Daten geben, was aber nur sehr zögerlich passiert. Die Sitzung im Bundesrat [...] beginnt um 14 Uhr“.
Herr Bundesminister, ich bin schon gespannt auf das Tachelesreden in Ihrem Redebeitrag! (Bundesminister Löger: Danke! Ich auch!) Wir werden schon sehen, welcher Bundesländer Sie sich annehmen werden. Die Kolleginnen und Kollegen aus den Bundesländern werden das wahrscheinlich mit nach Hause nehmen und dann ihrer Landeshauptfrau oder ihrem Landeshauptmann übermitteln.
Die Transparenzdatenbank, in vielen Schriften kurz Tradaba genannt, ist seit 2013 zur Befüllung bereit, aber die Befüllung funktioniert ja nicht so, wie es ursprünglich gemeint war. Die Tradaba – man hat sich ja schon daran gewöhnt – gilt nur für Einzelpersonen; staatliche Leistungen, die sie von unterschiedlichen Ebenen, sprich Gebietskörperschaften – Bund und Land; die Gemeinden befüllen ja freiwillig –, bekommen, werden eingetragen. Wenn ich mir zum Beispiel ein E-Car kaufe und dafür eine Bundesförderung bekomme, dann steht drinnen, dass ich für mein E-Car eine Bundesförderung bekommen habe. (Bundesrätin Mühlwerth: Ja, und?!) Oder Landesförderung: Wenn ich im Wohnbaubereich eine Förderung bekomme, dann ist das einzutragen. Oder zum Beispiel, wenn in Zukunft die Gemeinden mehr eintragen: Wenn eine Familie eine Förderung bekommt, weil sie ein zweites oder drittes Kind im Kindergarten hat und dafür eine Förderung bekommt oder der Besuch für das dritte Kind vielleicht gratis ist oder wie auch immer das in den Gemeinden gemacht wird, scheint das als Förderung auf.
Mehrfachförderungen sollen mehr in den Vordergrund gerückt werden und auch Doppelförderungen von Bund und Land sollen identifiziert werden. Es kann aber auch Doppelförderungen geben, die als sinnvoll erachtet werden.
Wer kann die Daten abfragen? – Die Daten können nur jene Gebietskörperschaften abfragen, die die Datenbank auch befüllt haben. Wer keinen Kanal zur Transparenzdatenbank hat, kann auch nichts einfordern, kann keine Daten aus der Datenbank holen. Die Transparenzdatenbank ist ja keine Einbahn, sondern man befüllt sie mit Informationen und holt sich die Informationen heraus.
Das Projekt war vor sechs Jahren mit Zielen verbunden, die nur teilweise oder nicht erreicht wurden. Das stellt der Rechnungshof in seinem Bericht fest. Zum Beispiel ist das Ziel, eine gebietskörperschaftenübergreifende Leistungsdatenbank zu schaffen, teilweise erreicht worden. Leistungsangebote des Bundes und der Länder werden weitgehend eingemeldet, Zahlungen sind bislang aber nur vom Bund eingemeldet worden, teilweise aber unvollständig. Die Gemeinden waren in die Transparenzdatenbank nicht einbezogen. Das ist also teilweise erreicht worden.
Der „Informationszweck“, den so eine Datenbank erfüllen sollte – „Informationen über Leistungen im Transparenzportal, persönliche Abfragemöglichkeit der bezogenen Leistungen für einzelne Leistungsbeziehende“ –, ist laut Rechnungshofbericht auch nur teilweise erreicht worden. Sie sehen, geschätzte Damen und Herren, das ist laut Rechnungshof nur teilweise erreicht worden.
Der „Kontroll- und Missbrauchsverhinderungszweck“ ist aber überhaupt nicht erreicht worden. (Bundesrätin Mühlwerth: Na, und wer war da in der Regierung? Die SPÖ!) – Wer war der verantwortliche Minister? (Bundesrätin Mühlwerth: Aber ihr wart in der Regierung, oder?! – Weitere Zwischenrufe bei der FPÖ.) – Ja, aber wer war der Minister? (Bundesrätin Mühlwerth: Es ist immer so! Wir müssen jetzt alles nachholen, was ihr versäumt habt! Eh nichts Neues! – Weitere Zwischenrufe bei der FPÖ.) Ich mache jetzt keine Zuweisungen, aber man muss doch auf einen Rechnungshofbericht reagieren! Diesen Rechnungshofbericht kann man auch in die Debatte miteinbeziehen.
Es ist ja schon einiges eingereicht worden, es gibt ja schon einen Änderungsvorschlag. Die Begutachtungsfrist läuft, glaube ich, bis Jänner. Diesmal gibt es doch eine Begutachtungsfrist bis Jänner – es ist ja derzeit nicht bei allen Gesetzen so üblich, sondern die Begutachtungsfrist ist ja oft sehr kurz.
Der „Steuerungszweck für Fördermittelbereitstellung und Förderprogrammgestaltung“ ist auch nicht erreicht worden. Das wurde laut Rechnungshofbericht überhaupt nicht erreicht. Das heißt, es gibt sehr viel Arbeit, Herr Bundesminister, damit mit der Transparenzdatenbank auch wirklich das angestrebte Ziel erreicht werden kann.
Anstatt einer taxativen Liste der Steuerbegünstigungen soll in Zukunft eine pauschalere Formulierung für die Reduktion der Steuerbelastung vorgesehen werden. Mit einer Verordnungsermächtigung kann der Bundesminister Details vorsehen, aber es ist auch einiges damit verbunden. Es könnte damit zum Beispiel die begünstigte Besteuerung des 13. und 14. Monatsgehalts als Steuerbegünstigung dargestellt werden, und man könnte sagen, man schafft diese Steuerbegünstigung ab. Aber nein, die Regelung für das 13. und 14. Monatsgehalt ist eine Tarifmaßnahme und kann nicht als Steuerbegünstigung gesehen werden. Mit dieser Verordnungsermächtigung bestünde aber die Möglichkeit.
Geschätzte Damen und Herren! Ja, es ist viel zu tun, und das wäre ein wunderbares Instrument, das man auch im Bereich der Wirtschaft nutzen könnte. Man weiß zum Beispiel, dass es für die Gruppenbesteuerung überhaupt nur vage Schätzungen gibt, welche Steuerbegünstigung Großunternehmen, Konzerne haben.
Wir wissen aber auch, dass die Fördergebiete jetzt genau eingeteilt werden, es gibt zum Beispiel Verkehr, Tourismus, Umwelt, Sozialversicherung, Bildung und Forschung, Steuern, Bauen und Wohnen. Etliche Kategorien sind hier also genau definiert, damit der Bund und die Länder genaue Eintragungen nach Kategorien vornehmen.
Es könnten in Zukunft noch einige Fragen im Zusammenhang mit der Novelle zu beantworten sein. Der Datenschutz muss bei den Abfragen gewährleistet bleiben. Es kann nicht sein, dass der Datenschutz aufgeweicht wird.
Es müssen ja auch die Ministerien Eintragungen machen. Welche Ministerien haben noch keine Daten eingemeldet, haben die Transparenzdatenbank noch nicht beschickt? Es kann ja auch sein, dass das im Haus hier in Wien noch nicht gemacht wurde. Man kann nicht immer nur sagen, die Bundesländer erfüllen ihre Pflicht nicht, sondern man muss auch fragen, ob vielleicht auch hier in Wien noch einige Hausaufgaben zu machen und einige Ministerien noch säumig sind.
Die Präsidentin des Rechnungshofes war sehr skeptisch, was die Umsetzung der Datenbank betrifft, denn es werden noch immer Doppelförderungen aufgefunden. Das sagt aber nichts darüber aus, ob in verschiedenen Bereichen nicht Doppelförderungen doch sinnvoll sind, wenn zum Beispiel Familien gefördert werden.
Es kann nicht sein, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Die Förderung der Arbeitnehmer kennt man auf den Cent genau, bei den Firmen werden die Förderungen immer nur geschätzt. Es heißt immer, der Verwaltungsaufwand sei da zu groß. Ich glaube, dass im Verhältnis zu den kleinen Förderungen der Verwaltungsaufwand zur Ermittlung der gesamten Förderungen schon sehr, sehr hoch ist – das kann ich schon zugestehen –, aber bei den Großkonzernen geht es doch um Millionen, und da sagt man, der Verwaltungsaufwand für das Feststellen der Förderungen für die Transparenzdatenbank sei zu groß.
Geschätzte Damen und Herren! Es ist ursprünglich ein gutes Instrument, aber es ist ausbaufähig, und man muss schauen, dass alle in dieser Datenbank vertreten sind.
Der Datenschutz muss in Zukunft beachtet werden und es muss auch versucht werden, die Transparenzdatenbank auszubauen. – Danke. (Beifall bei der SPÖ.)
14.24
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Danke.
Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Josef Ofner. Ich erteile es ihm.
Bundesrat Josef Ofner (FPÖ, Kärnten): Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzter Herr Bundesminister! Werte Kollegen! Liebe Zuhörer hier im Plenarsaal und zu Hause via Livestream! Vor mehr als acht Jahren wurde hier im Bundesrat das Gesetz für die Transparenzdatenbank mit Mehrheit verabschiedet und derzeit ist die Novelle in Begutachtung, weshalb wir uns heute auch dieser Thematik widmen.
Dass im speziellen Bereich von öffentlichen Förderungen und Leistungen durch die Gebietskörperschaften Transparenz die höchste Priorität eingeräumt sein sollte, um vor allem Missbrauch und Mehrfachförderungen einen Riegel vorzuschieben, das war damals die Intention, ein solches Gesetz zu schaffen.
Seit Jahren fordern wir seitens der FPÖ die notwendige Transparenz im öffentlichen Bereich, stehen jedoch der derzeit gültigen Gesetzeslage unter anderem aus jenen Gründen kritisch und auch ablehnend gegenüber, die auch der Rechnungshof in seinem Bericht vom November 2017 kritisiert hat. Eine Transparenzdatenbank zu schaffen, um damit der Öffentlichkeit einerseits natürlich unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen eine möglichst umfassende Übersicht über Förderungen und Leistungen bieten zu können, andererseits aber auch die genannten Zielsetzungen hinsichtlich Transparenz, Missbrauchsverhinderung und Steuerung zu erreichen, sollte im Umgang mit öffentlichen Mitteln eigentlich ein Selbstverständnis sein. Betreffend die Umsetzung muss es jedoch so sein, dass sie zweckdienlich ist und dass sie unter wirtschaftlichen Maßstäben ausgeführt wird, damit ein entsprechender Mehrwert im Bereich der Transparenz und Auswertung der Daten erfolgen kann.
Was ist aber in der Vergangenheit passiert? – Es ist mit der Transparenzdatenbank ein komplexes und überfrachtetes Instrument entstanden, welches in der praktischen Anwendung der geplanten Kontrolle, der Steuerung der Verteilungsleistung und auch einem effizienten Einsatz teilweise entgegengestanden ist. Daher ist es die richtige Vorgangsweise dieser Bundesregierung und auch des Bundesministers, dass nun im Zuge der geplanten Novelle Adaptierungen und Verbesserungen ausgearbeitet werden, dass Empfehlungen des Rechnungshofes eingearbeitet werden und dieses Gesetz entsprechend repariert wird, um eine weiterführende Transparenzsteigerung zu erzielen.
Ich möchte daher auf einige Punkte dieser Novellierung, die mir wichtig erscheinen, eingehen. Der wohl wichtigste Passus zur Transparenzsteigerung ist in meinen Augen die Ausweitung der Leistungsempfänger hinsichtlich Gebietskörperschaften, vor allem von Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden, die bisher aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen keine Leistungsempfänger dargestellt haben. Diese Regelung soll entfallen; das ist gut so, denn wenn ein Staat Transparenz schaffen will, was ist dann naheliegender, als dass er seine Gebietskörperschaften anweist, auch diese Leistungen auszuweisen? Dass sich einige Bundesländer, wie wir schon gehört haben, beinahe dagegen verwahren oder nur zaghaft und nach Verhandlungen bereit sind, ihre Daten in Bezug auf die Einmeldungen einzupflegen, ist angesichts der Verwendung von Steuergeld grundsätzlich nicht nachzuvollziehen.
Ein wesentlicher Punkt ist aber auch die derzeit vorherrschende Komplexität und Unadministrierbarkeit, sodass die bestehende Leistungsangebotsverordnung durch eine entsprechende Transparenzdatenbank-Abfrageverordnung ersetzt wird. Wenn man be-
denkt, dass es über 2 500 Leistungsangebote gibt, dass 75 Prozent Länderleistungsangebote sind, so ist eine Vereinfachung und Verbesserung einfach vonnöten. Gerade wenn es um Transparenz geht, sollte es so sein, dass hinsichtlich der Einsichtsrechte die Abfrage und Auswertung dahin gehend gestaltet sein können, dass man eine möglichst triviale Zugangssituation schafft, natürlich wieder mit Ausnahme der sensiblen und geheimhaltungspflichtigen Daten, denn nur durch eine entsprechende praktische Nutzung kann diese Datenbank ihre Zielsetzung erreichen und Missbrauch vorbeugen. Vor allem ist ein wesentlicher Punkt damit verbunden: dass diese Datenbank dann auch entsprechend in Anspruch genommen wird.
In diesem Zusammenhang ist die Einmeldung heute schon behandelt worden. Natürlich ist es wichtig, dass die Einsichtsrechte, die die berechtigten Stellen haben, ausgeweitet werden und vor allem das Förderwesen hinsichtlich der Mehrfachförderungen entsprechend angegangen wird. Mehrfachförderungen kann man dadurch vermeiden, dass es schneller beziehungsweise bereits bei Gewährung der Leistungen und Förderungen eine Einmeldung gibt. Es wird dadurch die Möglichkeit geschaffen, sämtlichen abfrageberechtigten Förderstellen die notwendigen Informationen zukommen zu lassen, und es ist dadurch auch mit einer höheren Nutzung vor allem auf Länder- und Gemeindeebene zu rechnen. Das ist ja auch eines der genannten Ziele: dass eine stärkere Ausschöpfung des Potenzials erreicht werden soll, um den Zweck besser verfolgen zu können.
Natürlich spielt auch die Wahrung des Datenschutzes eine wesentliche Rolle, auch mit der Anhebung der Strafandrohung bei unberechtigten Abfragen. Das ist ebenso essenziell wie die Rechtevergabe an die betrauten Personen. Prioritär ist dabei aber, dass es vor allem eine strenge Einschränkung in Bezug auf die Abfrage von sogenannten sensiblen Daten durch die technische Umsetzung gibt.
Da ich bei der technischen Umsetzung bin, möchte ich schon noch einen bedeutenden Sachverhalt ansprechen: Der Rechnungshof hat in seinen Ausführungen auch erläutert, dass eine bestmögliche Ausschöpfung der Potenziale nur dann erreicht werden kann und damit in weiterer Folge eine Zielerreichung, wenn der Ausbau der Transparenzdatenbank zu einer gebietskörperschaftenübergreifenden Datenbank erfolgt und sämtliche Leistungen von Bund, Ländern und Gemeinden gleichermaßen erfasst werden.
Aufgrund der vorliegenden Novelle bin ich auch davon überzeugt, dass Sie, geschätzter Herr Bundesminister, diese Zielerreichung anstreben. Und Sie werden mir – es sind viele Bürgermeisterkollegen hier im Plenum vertreten – beipflichten, dass natürlich gerade auch in den Gemeinden der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit erfüllt werden muss und gleichzeitig natürlich auch Transparenz im Gemeindebereich gewährleistet sein soll.
Ich bin grundsätzlich davon überzeugt, dass sich keine Gemeinde dagegenstellen wird, die öffentlichen Förderungen und Leistungen über Einmeldungen öffentlich zur Verfügung zu stellen. Das Problem hinsichtlich der Implementierung der Leistungsangebote, aber auch der gewährten Förderungen ist derzeit, dass der entstehende Verwaltungsaufwand in keiner Relation zu den gewährten Förderbeträgen steht, denn gerade kleinere Gemeinden haben eine Vielzahl von finanziellen Förderungen, die nur ganz gering sind, oder auch von Sachleistungen und diese müssten derzeit personenbezogen eingemeldet werden.
Ich bin aber zuversichtlich, dass Sie diesbezüglich gemeinsam mit dem Gemeindebund einen Lösungsansatz und einen Modus Vivendi finden werden, um auch diese Leistungsangebote auf Gemeindeebene und die gewährten Förderungen mit einem wirtschaftlich vertretbaren Aufwand einpflegen zu können. Auf eine probate technische Umsetzung sollte dabei auch Rücksicht genommen werden.
Ein Kommunikationsleiter eines weltweit anerkannten Sportartikelherstellers hat einmal die These gewagt und gesagt: Transparenz und Erfolg bedingen sich gegenseitig. – Meine geschätzten Damen und Herren, ich bin der Überzeugung, dass das nicht nur für ein privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen gilt, sondern dass das vor allem für das Unternehmen Staat Gültigkeit haben muss, denn nur bestmöglich transparentes, verantwortungsvolles Handeln im Umgang mit Steuergeld unter Ausschluss von missbräuchlicher Verwendung wird einen gesamtwirtschaftlichen Erfolg bedeuten. (Beifall bei FPÖ und ÖVP.)
Das ist wiederum auch ein Erfolg für die Bürgerinnen und Bürger. Ich bin überzeugt davon, dass die Transparenzsteigerung im Rahmen der geplanten Novellierung auch eine weitere Erfolgssteigerung der Arbeit dieser Bundesregierung bedeuten wird. (Beifall bei FPÖ und ÖVP.)
14.33
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Danke schön.
Für eine erste Stellungnahme zu Wort gemeldet hat sich der Herr Bundesminister für Finanzen. Ich erteile es ihm und bitte, auch die Redezeit von 10 Minuten, wenn möglich, einzuhalten. – Bitte.
Bundesminister für Finanzen Hartwig Löger: Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren des Bundesrates! Liebe Zuseherinnen und Zuseher! Ich habe die Chance genutzt, auf Herrn Bundesrat Lindinger auch in dieser Form einzugehen: Ich selbst, gestehe ich, war überrascht über die Formulierung, die ich heute Morgen auch gelesen habe, nämlich dass ich Tacheles reden werde. Auch für mich war das im ersten Moment ein komischer Ansatz. Ich habe aber jetzt die Möglichkeit genutzt, die uns technisch zur Verfügung steht, um Tacheles nachzuschlagen. Ich wusste es, gestehe ich, nicht. Tacheles kommt aus dem Jüdischen, es bedeutet Ziel oder Zweck, also grundsätzlich nichts Böses. Und dann wird noch beschrieben: „Wer also Tacheles reden will, spricht Klartext, kommt ohne Umschweife auf den Kern der Sache.“ – So gesehen, glaube ich, brauchen wir uns also alle nicht zu fürchten, ich auch nicht, dass ich möglicherweise die Erwartungen nicht erfülle. Und auf der anderen Seite sind, glaube ich, Ängste in dem Fall auch nicht angebracht. (Beifall bei ÖVP, SPÖ und FPÖ.)
Ich möchte einleitend auch klarstellen, ich habe schon mehrmals die Chance gehabt und bin auch aufgefordert worden, zum Thema Transparenzdatenbank Stellung zu nehmen. Auch von journalistischer Seite her gibt es dazu immer wieder großes Interesse. Es hat eine lange Geschichte, eine mühsame Geschichte, was auch schon ausgeführt wurde.
In diesem Zusammenhang wurde ich immer gefragt, ob ich nicht daran denke, Strafen in irgendeiner Form für diejenigen oder gegen diejenigen, die nicht bereit sind, diese Transparenzdatenbank entsprechend zu befüllen oder zu nutzen, einzuführen. Bei einer solchen Gelegenheit habe ich immer gesagt, ich bin nicht der Krampus. – Das war von der Jahreszeit her durchaus passend, auch bei der damaligen Anfrage, jetzt ist der Nikolo aber auch schon vorbei.
Ich würde diese Novelle und diesen Vorschlag, den wir als Finanzministerium einbringen, gerne so verstehen – auch in dieser weihnachtlichen Zeit der Begutachtung, die noch bis 4. Jänner dauert –, dass wir hier wirklich etwas bereitstellen, auch vonseiten der Regierung, des Finanzministeriums, um es für diejenigen, die Nutzen daraus ziehen sollen, mehrwertig zu machen.
Unser Verständnis ist jetzt also nicht, nur etwas zu fordern, geschweige denn zu strafen, sondern das, was über Jahre an Diskussion gelaufen ist, was auch aus einer Analyse der letzten beiden Jahre hervorgeht, umzusetzen. Man hat sich ja im Jahr 2017 im
Finanzausgleichsgesetz darauf verständigt, zumindest einmal im Bereich Umwelt und Energie eine fixierte verpflichtende Einmeldung zu machen. Diese Analyse hat gezeigt, dass es Verbesserungspotenzial gibt, dass es auch aufseiten der Länder die Meinung gibt, dass wir eine Verbesserung des Systems schaffen müssen, denn es ist, so wie das jetzt auch von Bundesrat Ofner ausgeführt wurde, die Komplexität teilweise zu groß und zu stark.
Aus diesem Ansatz heraus entsteht jetzt diese Grundlage. Wir reden von über 17 Milliarden Euro, die bundesweit, österreichweit im Jahr 2017 in dem Bereich ausgegeben wurden. Im Jahr 2018 wird es vielleicht da oder dort eine andere Entwicklung geben, weil wir Bundesförderungen reduziert haben, aber in Summe sind es nahezu 5 Prozent unserer Gesamtwertschöpfung des Jahres. So gesehen ist es, glaube ich, schon wichtig, ein Augenmerk darauf zu haben, dass alle danach trachten, dass wir Doppel- und vielleicht sogar Dreifachförderungen in diesem Bereich hintanhalten.
Das ist die Basis. Bundesrat Bader hat einleitend ja auch dargelegt, was die Inhalte dieser Novelle und dieser Neuerungen sind. Ich glaube, der wichtigste Aspekt dabei ist, dass wir die Abfragemöglichkeiten und -berechtigungen für die Fördergeber verbessern. Das war eine große Forderung auch in dieser Diskussion in den ersten beiden Jahren, dass wir sicherstellen, dass es bessere Möglichkeiten bei der Abfrage gibt, dass es eine transparentere, klarere, eindeutigere Auskunftsgrundlage gibt. Das haben wir jetzt auch über diese Änderung, über diese Novelle eingebracht.
Was sich daraus auch ergeben wird, ist, wir werden einen Wirtschaftlichkeitszweck auch in diesem Rahmen darstellen. Ich glaube, es ist wichtig, dass alle, sowohl die Länder, die Gemeinden, aber auch der Bund erkennen, in welcher Form es diese Wirtschaftlichkeit und damit auch Sinnhaftigkeit von Förderungen gibt.
Ich möchte eines dazusagen – auch wenn ich vielleicht jetzt riskiere, eine Schlagzeile zu produzieren –: Es kann ja da oder dort auch bewusst und sinnvoll sein, dass man eine zusätzliche Förderung in einem Bereich vergibt. Es ist ja nicht verboten und man sagt ja nicht, dass es eine zweite Förderung gar nicht geben darf. Vielleicht handelt es sich ja um etwas, um ein Thema, wo es bewusst gemacht und auch wirklich sinnvoll und notwendig ist, aber die Wirtschaftlichkeit, die dahinter zu stehen hat, sollte trotzdem allen bewusst sein. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, den wir auch in dem Rahmen sehen müssen.
Es wurde einleitend auch schon angesprochen – ein ganz wichtiger Aspekt –, dass wir rechtzeitig die Information zur Verfügung stellen müssen. Das heißt, diese Novelle sichert auch, dass nicht erst dann, wenn die Förderung sozusagen zur Auszahlung gelangt, die Möglichkeit besteht, Förderungen über diese Datenbank zu erkennen, sondern schon dann, wenn bezüglich eines Anspruchs auf eine Förderung angefragt wird. Damit haben die Fördergeber rechtzeitig die Chance, zu reagieren, und damit auch, wie gesagt, die Effizienz dieser Förderungen entsprechend sicherzustellen.
Das Thema, das bereits erwähnt wurde, ist die Einbindung der Gemeinden, der Gemeindeverbände, auch transparent zu machen, wenn sie Förderungen erhalten. Ein offenes Wort dazu: Das ist auch eine Forderung aus dem Bereich des Rechnungshofberichts gewesen. Ich glaube, das ist im Sinne der Fairness, der gesamthaften Transparenz ein berechtigter Anspruch, den wir im Rahmen dieser Novelle genauso mitnehmen. Ich erwarte natürlich auch noch in den nächsten Tagen der Begutachtungszeit eine Diskussion darüber, aber ich hoffe, dass wir alle hier in diesem Haus Verständnis dafür haben, dass diese Forderung und dieser Wunsch durchaus richtig umzusetzen sein werden.
Es gibt dann noch Themen wie die Verbesserungen über den Statusbericht, nämlich dass die Fördernehmer, Fördernehmerinnen die Chance haben, früher Informationen
darüber zu bekommen, wie weit fortgeschritten die Bearbeitung ihres Förderungsantrags in dem Bereich ist. Das ist eine zusätzliche Serviceleistung, die diese Transparenzdatenbank auch für die Nutzung durch die Bürgerinnen, Bürger verbessert und sicherstellt.
Was auch wichtig ist – jetzt auch mehrmals von den Bundesräten erwähnt –, ist die Sicherstellung des Datenschutzes. Es ist gerade da die größte Vorsorge dafür zu treffen, dass es nicht dazu kommt, dass irgendwer auf irgendetwas schauen und damit irgendetwas anstellen kann. Wir haben dafür in dieser Novelle, im Vorschlag vorsorglich das Strafmaß für möglichen Missbrauch in diesem Bereich mehr als verdoppelt. Das heißt, da wird präventiv ein klares Signal gegeben, damit niemand auf dumme Gedanken kommt, um sich in irgendeiner Form missbräuchlich zu bedienen.
Es ist aber auch systemtechnisch vorgesehen, dass selbst das Finanzministerium, das der Betreiber dieses Instruments ist, keine gesamtheitliche Möglichkeit der Einsicht hat. Da ist also wirklich systemtechnisch eine Sicherung gegeben, dass nur der Fördergeber selbst die Chance hat, das entsprechend zu nutzen.
Zusammenfassend: Ich hoffe, dass es uns gelingt, dieses Thema mit diesem von uns gesetzten aktiven Verbesserungsvorschlag dorthin zu bringen, dass es uns mit dem Mehrwert, der für alle Fördergeberinnen und Fördergeber und genauso Fördernehmerinnen und Fördernehmer jetzt eigentlich schon gegeben ist, gelingt, einen weiteren positiven Schritt zu setzen. Ich gehe davon aus, es wird nicht mit einem Knopfdruck oder einem Schalter funktionieren, aber ich nenne die positiven Beispiele Oberösterreich, vor Kurzem gefolgt von Niederösterreich.
Ich hoffe, und das ist die Idee der heutigen Diskussion, dass es gerade über Sie als Bundesrätinnen und Bundesräte gelingt, dieses Thema positiv in die Länder hinauszutragen, damit wir da ein positives Signal an die Österreicherinnen und Österreicher senden. Es ist, wie in den Vorgesprächen erwähnt wurde, der Steuerzahler, die Steuerzahlerin, die diese Substanz letztendlich liefern. Ich glaube, es ist in unser aller Verantwortung, sie richtig und effizient einzusetzen.
In diesem Sinne hoffe ich auf eine weiterhin gute, konstruktive Diskussion und freue mich schon jetzt darauf, wenn wir die Chance haben, diesen guten Schritt zu setzen. – Danke. (Beifall bei ÖVP, SPÖ und FPÖ.)
14.43
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Ich mache darauf aufmerksam, dass die Redezeit aller weiteren Teilnehmer an der Aktuellen Stunde 5 Minuten nicht übersteigen darf.
Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Ferdinand Tiefnig. – Bitte, Herr Bundesrat.
Bundesrat Ferdinand Tiefnig (ÖVP, Oberösterreich): Sehr geehrter Herr Bundesminister! Herr Präsident! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren via Livestream! In einer Presseaussendung hat mein Bundesland Oberösterreich zur Transparenzdatenbank geschrieben: schlanker, schneller, übersichtlicher. – Ich glaube, das ist das Wichtigste: dass wir schneller, schlanker und übersichtlicher den Zugang dazu finden, wo mehr Förderungen stattfinden.
Oberösterreich zeigt mit 1,4 oder 1,5 Millionen Euro, die da im Jahr 2017 ausgeschüttet worden sind, dass Möglichkeiten offen sind, dies sicherlich noch zu verbessern. Die Gemeinden haben sich im letzten Finanzausgleich auch dazu bekannt, dementsprechend transparenter zu werden.
Zurückgehend zum Jahr 2008: Der damalige Finanzminister Sepp Pröll hat diese Transparenzdatenbank eingeleitet, denn in der Landwirtschaft ist es gang und gäbe, dass diese Förderungen schon jahrzehntelang öffentlich und personenbezogen sind. Jetzt hat sich da doch auch ein bisschen etwas verbessert, erst ab 1 250 Euro wird es personenbezogen veröffentlicht und auch die Mittel aus der Europäischen Union fließen dementsprechend in die Transparenzdatenbank ein.
Schaut man nach Schweden, so ist es dort kein Thema, dass sogar Löhne und Sozialleistungen transparent und öffentlich einsehbar sind. Leider haben wir in Österreich ein System, das immer wieder Neid hervorruft, wenn gesehen wird, dass jemand mehr hat, statt dass man sich darüber freut, dass sich einige etwas mehr leisten können und andere damit unterstützt werden, da diejenigen, die mehr leisten, Steuern zahlen. Mit diesen Steuern ist sorgsam umzugehen, denn Steuergeld ist hart verdientes Geld, um damit Leistungen für diejenigen zu erbringen, die es im Leben nicht so einfach haben. Diesbezüglich hat diese Regierung schon sehr viel gemacht.
Herr Finanzminister, Sie haben es schon angeschnitten: Es ist auch sehr wichtig, dass die Strafen mehr als verdoppelt worden sind, bei missbräuchlichem Umgang mit den Daten sind die Strafen von 20 000 Euro auf 50 000 Euro erhöht worden – ein wichtiger Schritt auch in Hinsicht darauf, dass Datenschutz gewahrt wird.
Ich bin sicher, dass die Weiterentwicklung auch in den anderen Bundesländern stattfinden wird. In Tirol hat man sich schon sehr weit vorgewagt, da macht man vielleicht sogar im kommenden Jahr den Abschluss und vollzieht diese Transparenzdatenbank wie in Oberösterreich und Niederösterreich. Es gibt natürlich die Bundeshauptstadt, die die Möglichkeit hätte, nicht weit weg vom Finanzministerium, diese Daten sogar persönlich zu überbringen; es ist für uns aber unverständlich, dass dort Daten nicht transportiert und veröffentlicht werden.
Es sind sicherlich die ersten Schritte eines Gesetzes, das schon lange auf dem Tisch liegt und auf den Weg gebracht werden sollte. Wir als Oberösterreicher sind interessiert daran, dass uns andere Bundesländer nachfolgen und wir laden sie natürlich herzlich dazu ein. Es ist sehr vernünftig, diese Transparenzdatenbank weiterzuentwickeln.
In diesem Sinne kann ich nur gratulieren, dass wir jetzt schon so weit sind, aber einer Weiterentwicklung ist sicherlich nichts entgegenzusetzen. – In diesem Sinne: Danke schön. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
14.47
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Vielen Dank.
Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Andrea Kahofer. Ich erteile es ihr.
Bundesrätin Andrea Kahofer (SPÖ, Niederösterreich): Hohes Präsidium! Werter Herr Bundesminister! Liebe Kollegen und Kolleginnen des Bundesrates! Werte Zuseher! Ich denke, es ist inhaltlich zur Transparenzdatenbank schon sehr viel gesagt worden. Ich bin in der glücklichen Lage, eine Bundesrätin aus Niederösterreich zu sein, ich darf also Lob in mein Bundesland mitnehmen.
Die Befüllung der Transparenzdatenbank, das Einmelden hat sich als nicht einfach dargestellt. Das ist in diesem Rechnungshofbericht, der auch schon sehr oft hier angesprochen wurde, deutlich zum Ausdruck gebracht worden. Ich möchte jetzt aber gar nicht über die Vergangenheit reden, die ist nun einmal so, wie sie war.
Die Novelle, die nun eingebracht wurde, hat einiges an sehr positiven Aspekten, eben auch, dass der wirtschaftliche Aspekt sehr stark forciert wird. Es freut mich, dass Sie
angesprochen haben, dass es teilweise sehr positiv sein kann, wenn Förderungen durchaus ein zweites Mal überdacht werden können oder ergänzt werden müssen. Ich halte es auch für sehr wichtig, dass ganz genau darauf geachtet wird, dass Kofinanzierungen keine Doppelförderungen sind; darauf soll es nicht hinauslaufen. Das wäre, denke ich, sehr kontraproduktiv.
Die Rechtzeitigkeit der Einmeldungen ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich bin auch sehr zufrieden damit, dass das in dieser Novelle auftaucht.
Was mich jetzt an dem vorigen Redebeitrag schon erschreckt hat und für mich ein Punkt ist, der sehr heikel ist, ist der Umgang mit diesen sensiblen Daten. Ich denke nicht, dass es mit Neidgesellschaft zu tun hat, wenn Leistungen, wenn staatliche Gelder, wenn Förderungen an Menschen vergeben werden, die in einer sehr, sehr schwierigen Lebenssituation sind. Das hat etwas mit Würde zu tun. Diese Daten sind nicht öffentlich zu machen, darauf lege ich größten Wert. (Beifall bei der SPÖ sowie des Bundesrates Stögmüller.)
Natürlich ist es im Allgemeinen so, dass es im Interesse der Bürger ist, diese Transparenz zu haben. Schlussendlich ist die Forderung sogar von Bürgerinnen und Bürgern gekommen, und daraus ist diese Transparenzdatenbank erwachsen.
Im Allgemeinen müssen wir sagen: Wir müssen die Begutachtung abwarten, wir müssen die Expertisen der Experten, der Sachverständigen abwarten. Der Novelle selbst, der Verbesserung ist überhaupt nichts entgegenzusagen, es ist nur begrüßenswert. – Danke schön. (Beifall bei der SPÖ.)
14.50
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Vielen Dank.
Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Mag. Reinhard Pisec. Ich erteile es ihm.
Bundesrat Mag. Reinhard Pisec, BA MA (FPÖ, Wien): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Finanzminister! Sehr geehrte Damen und Herren! Das Bemühen der Bundesregierung und im Speziellen ad personam des Herrn Finanzminister Löger, in die Verwendung der Steuergelder und Abgabengelder, die von den leistungsorientierten Bürgern und eigentlich von allen Bürgern Österreichs erbracht werden, Transparenz zu bringen, ist in jeder Hinsicht zu unterstützen.
Die 17 Milliarden Euro Förderungen pro Jahr werden über 53 000 Förderprogramme verteilt, und ja, man muss es wirklich sagen – ich habe es selber nicht geglaubt, als ich das in Erfahrung bringen konnte –: Von 50 Prozent dieser Förderungen ist gar nicht bekannt, wer diese erhält. Es ist also eine Förderung nach dem Zufallsprinzip. Das kann doch nicht sein, dass mit dem Steuergeld so umgegangen wird!
Es ist auch eine alte Forderung der FPÖ, wenn ich das in Erinnerung bringen darf, Transparenz in diesen Förderdschungel zu bringen. Diese Bundesregierung nimmt sich dessen nun an, und das ist in jeder Hinsicht hundertprozentig zu unterstützen.
Es ist auch deswegen unterstützenswert, weil im Zuge der eingeplanten und angedachten Steuer- und Abgabenreform Spielraum geschaffen werden muss. Das Wirtschaftsforschungsinstitut hat errechnet, dass 3,5 bis 5 Milliarden Euro an Einsparungen durch den Wegfall dieser unwesentlichen und zufallsartigen Mehrfachförderungen erreicht werden können, indem man nicht die Förderungen nach dem Sprühwassersystem ausgießt, sondern diese zielorientiert erbringt und jenen fördert, der es wirklich und tatsächlich notwendig hat und auch braucht; als Startkapital oder auch als Subvention, keine Frage.
Der Wirtschaftlichkeitszweck ist eine wichtige Sache, ein wichtiger Zusatz, der jetzt hier beschlossen werden wird, um auch die Sinnhaftigkeit und die Nutzbringung dieser Förderungen zu garantieren.
Wien ist aber wieder einmal anders: Heute habe ich im Landtag persönlich erfahren müssen, dass der Finanzstadtrat zu meinem Erstaunen gesagt hat, er bestehe sogar darauf, dass die Steuern und Abgaben in Wien so hoch bleiben. Daher ist es auch kein Wunder, dass in Wien kein Interesse an der Transparenzdatenbank besteht und nicht einmal eine Intentionserklärung dafür abgegeben wird, in Zukunft vielleicht einmal Änderungen anzudenken.
Ich möchte kurz in Erfahrung bringen, was wir Bürger und Mitarbeiter an Steuerleistung, an Abgabenleistung erbringen: Bei einem nicht so hohen Einkommen von 1 500 Euro brutto werden Steuer- und Abgabenleistungen von 20 Prozent bezahlt, wobei allein 15 Prozent für die Sozialversicherungen sind. Bei einem Monatsgehalt von 2 500 Euro brutto verdoppelt sich dieser Steuer- und Abgabensatz auf 30 Prozent. Die von Herrn Kollegen Lindinger angesprochenen ach so bösen Konzerne, die Unternehmer, Kapitalgesellschaften, GesmbH haben 45,63 Prozent an Steuern vom ersten Euro an zu zahlen. – Das sind die Leistungen, die wir Bürger, wir Unternehmer für den Staat erbringen, und daher fordern gerade wir Transparenz darüber ein, was mit diesem Geld passiert. (Beifall bei FPÖ und ÖVP.)
Ich möchte auch gar nicht das Krankenhaus Nord erwähnen, wo die Wiener das Geld ausschütten, als ob es kein Morgen gibt. (Bundesrätin Grimling: Geh bitte! – Bundesrat Weber: Alter Schuh!) Das ist heute nicht das Thema. Das Thema hier ist, dass alle Bundesländer gemeinsam an einem Strang ziehen und Land für Land – Wien zählt ja bekanntlich auch als Land – diese Transparenzdatenbank speisen, damit eben Erkenntnisse gewonnen werden können; was heute in der Zeit der Digitalität natürlich gar nicht schwer ist. Algorithmen zu bilden ist ein Automatismus, das ist natürlich auch kein Datenfriedhof, sondern das sind selbst errechnete Zahlen, die dann ausgewertet werden können.
Entlastung ist uns, ist der Bundesregierung – ich darf das im Sinne des Herrn Finanzministers natürlich sagen – wichtig, damit in Zukunft nach dieser Steuerreform alle mehr Netto vom Brutto in der Börse haben. Daher ein klares Ja zu dieser Transparenzdatenbank. – Vielen Dank. (Beifall bei FPÖ und ÖVP.)
14.55
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Vielen Dank.
Zur Abgabe einer abschließenden Stellungnahme hat sich nochmals der Herr Bundesminister für Finanzen zu Wort gemeldet. – Bitte, Herr Finanzminister.
Bundesminister für Finanzen Hartwig Löger: Herr Präsident! Liebe Bundesrätinnen und Bundesräte! Nur ganz kurz und vielleicht auf die Redebeiträge der einzelnen Bundesräte eingehend: Ich glaube, es ist wichtig, zu erkennen, dass es notwendig ist, sehr sensitiv zu sein. Ich glaube, wir alle müssen auch für uns erkennen, dass es darum geht, in gewisser Form Vertrauen in diese Tradaba – eine Abkürzung, die ich von Herrn Bundesrat Lindinger gelernt habe (Heiterkeit der BundesrätInnen Grimling und Lindinger) – zu entwickeln; ich glaube, das gehört auch dazu.
Wir haben jetzt die Chance, mit dieser Novelle wichtige, richtige Schritte zu setzen, um den Nutzen und auch die Benützung und die positive Einmeldung in diese Transparenzdatenbank weiterzuentwickeln. Wir müssen uns auch gegenseitig darauf verlassen können und das Vertrauen entwickeln, dass es nicht missbräuchlich in irgendeiner Form Verwendung findet.
Ich sage es ganz frei heraus: Es ist mein Interesse, gemeinsam mit Ihnen und damit gemeinsam mit den Ländern in Österreich das Vertrauen zu entwickeln, damit wir alle erkennen, welche Chance darin besteht, wenn wir diese Transparenz schaffen, um die Mittel im Eigeninteresse, nämlich auch im Interesse der Länder, im Interesse der Gemeinden als Fördergeber und natürlich auch im Interesse des Bundes noch besser, noch effizienter und richtiger und genauer einsetzen zu können. Damit haben wir alle die Chance, in unseren Rahmenbudgets diese Potenziale in der Effizienz entsprechend zu heben, um dann auch gemeinsam in der Lage zu sein, in einer besseren, in einer richtigeren Form unsere Verhandlungen, unsere Gespräche in den verschiedenen Bereichen zu führen.
So gesehen nehme ich aus der Diskussion ein durchaus breites Bewusstsein über die Richtigkeit dieser Schritte mit – im positiven Sinne, und ich wiederhole es bewusst: dies nicht im Sinne von Drohungen, sondern im Sinne der Einladung, diese Transparenzdatenbank zu befüllen.
In vollem Bewusstsein, so wie es Bundesrat Pisec angesprochen hat: Ja, wir wissen, dass Wien im Sinne eines Landes, einer Gemeinde eine Sonderstellung einnimmt, die gegeben ist. Auch das, glaube ich, kann man sich durchaus eingestehen, ich habe aber auch eine konstruktive Gesprächsbasis mit dem Bürgermeister und dem Stadtrat, und ich baue darauf, dass es uns gelingt, dieses gemeinsame Vertrauen zu entwickeln, um das gemeinsame, sinnhafte Nutzen der Transparenzdatenbank voranzutreiben.
Mein Appell ist, dass es uns gemeinsam gelingt, diese Botschaft auch in die jeweiligen Länder zu tragen. – Vielen Dank dafür. (Allgemeiner Beifall.)
14.58
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Danke, Herr Bundesminister.
Die Aktuelle Stunde ist beendet.
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Hinsichtlich der eingelangten, vervielfältigten und verteilten Anfragebeantwortungen und
eines Schreibens des Verbindungsdienstes des Bundeskanzleramtes betreffend den Aufenthalt eines Mitglieds der Bundesregierung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union
verweise ich auf die im Sitzungssaal verteilten Mitteilungen gemäß § 41 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Bundesrates, die dem Stenographischen Protokoll dieser Sitzung angeschlossen werden.
Ebenso verweise ich hinsichtlich der eingelangten Verhandlungsgegenstände und deren Zuweisungen im Sinne des § 19 Abs. 1 der Geschäftsordnung auf die gemäß § 41 Abs. 1 der Geschäftsordnung im Sitzungssaal verteilten Mitteilungen, die ebenfalls dem Stenographischen Protokoll dieser Sitzung angeschlossen werden.
Die schriftliche Mitteilung hat folgenden Wortlaut:
![]()
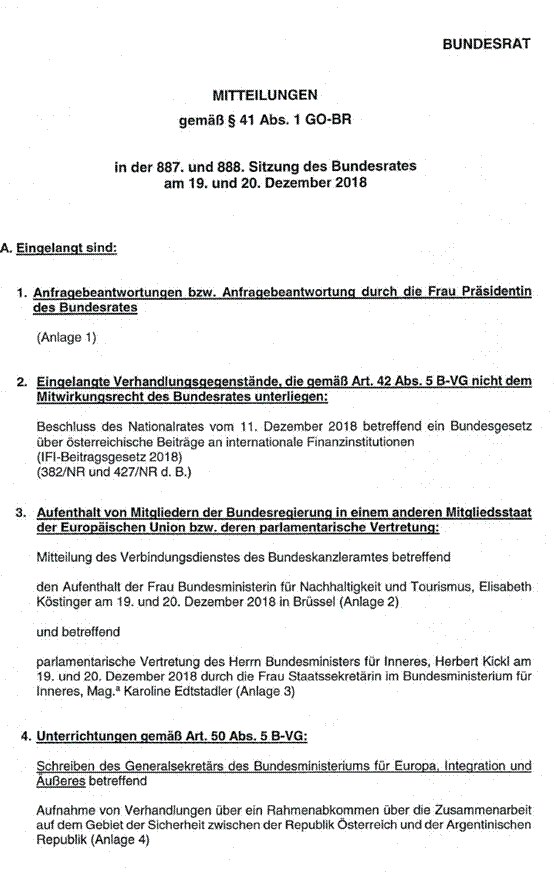
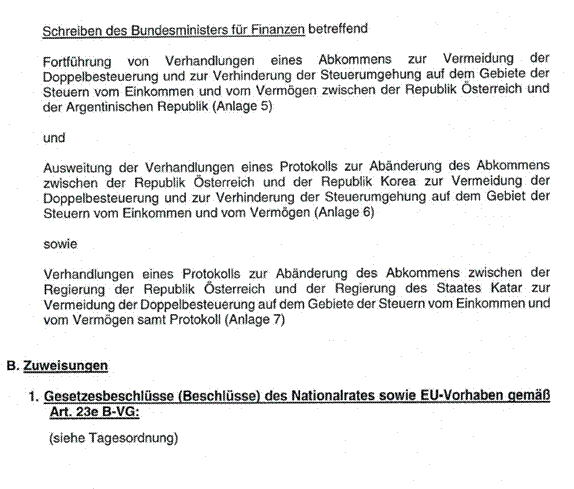
*****
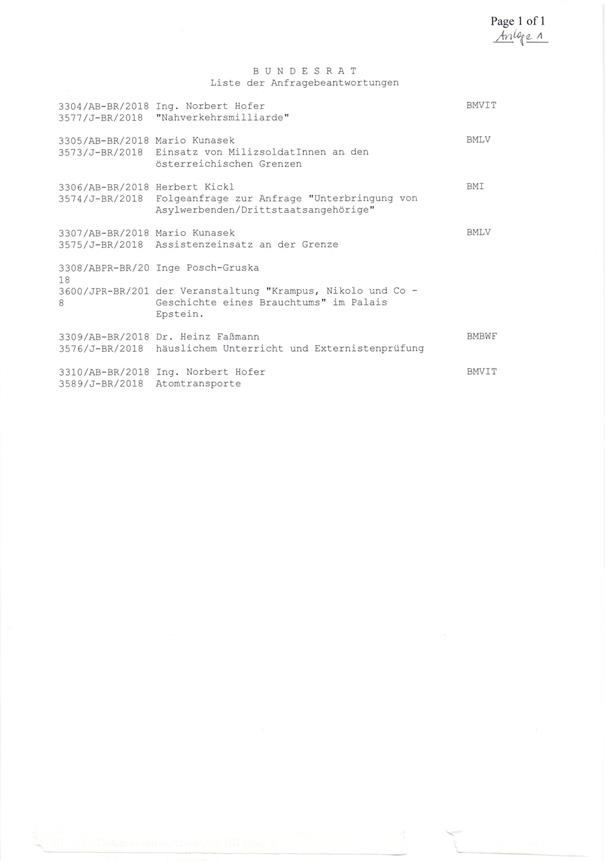
*****
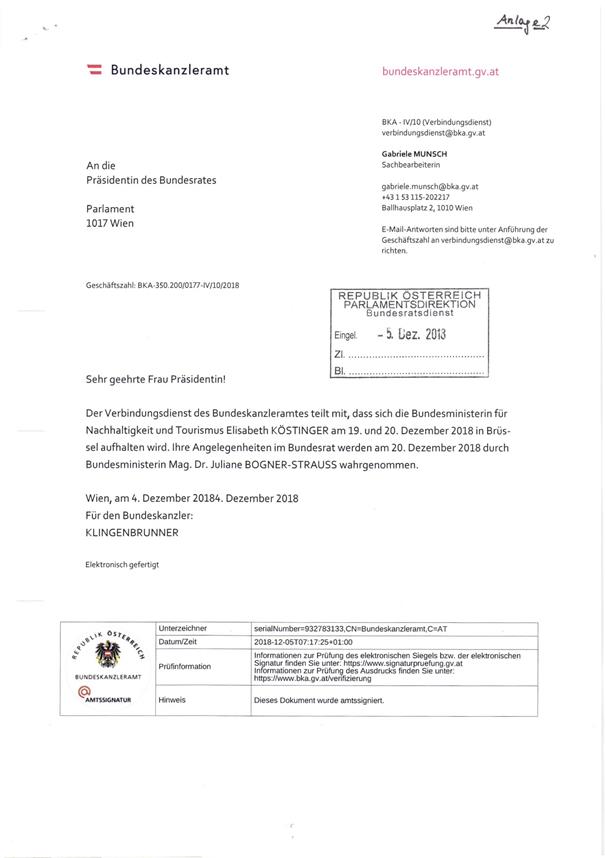
*****
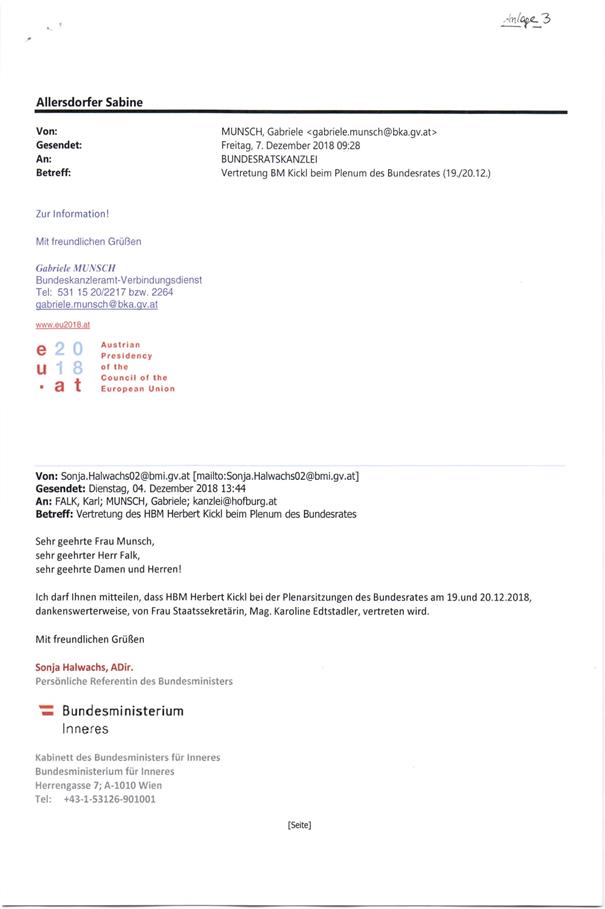
![]()

*****
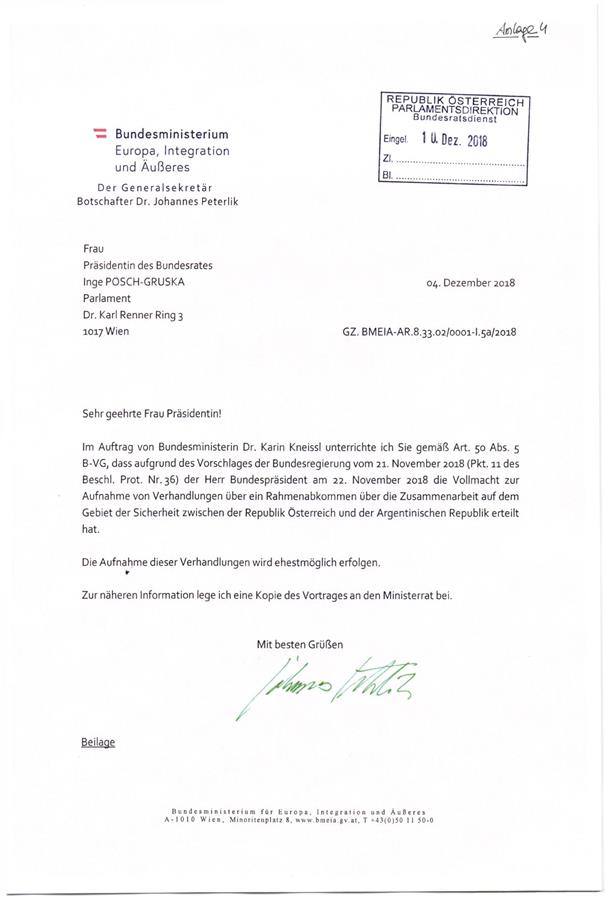
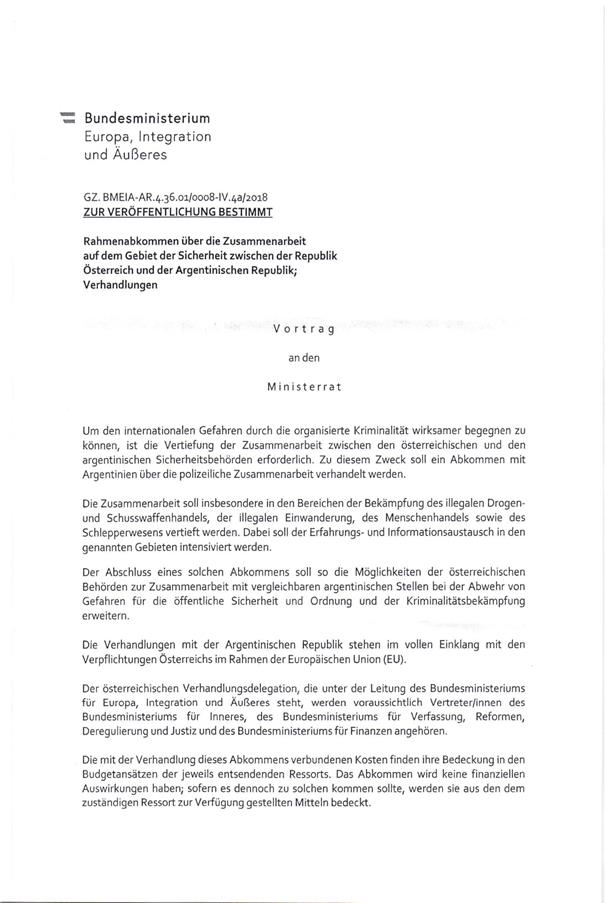
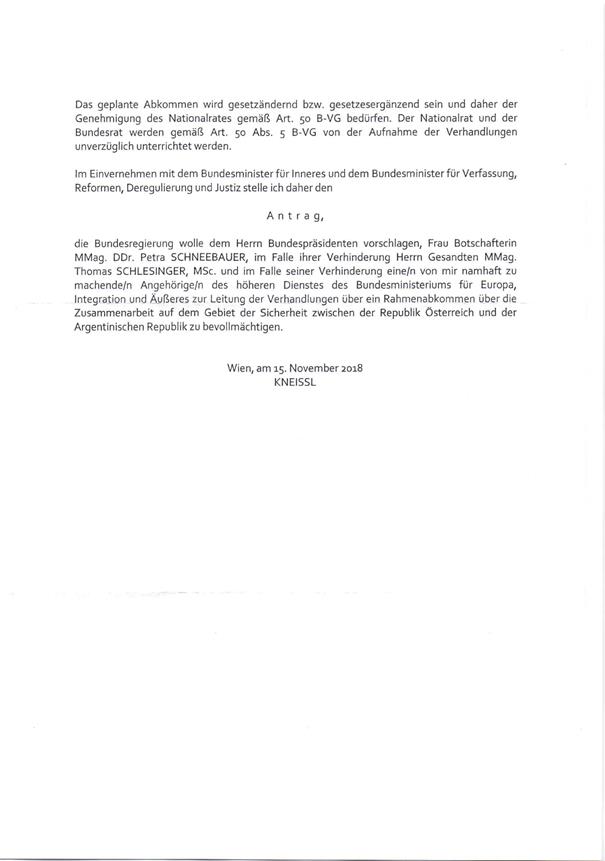
*****
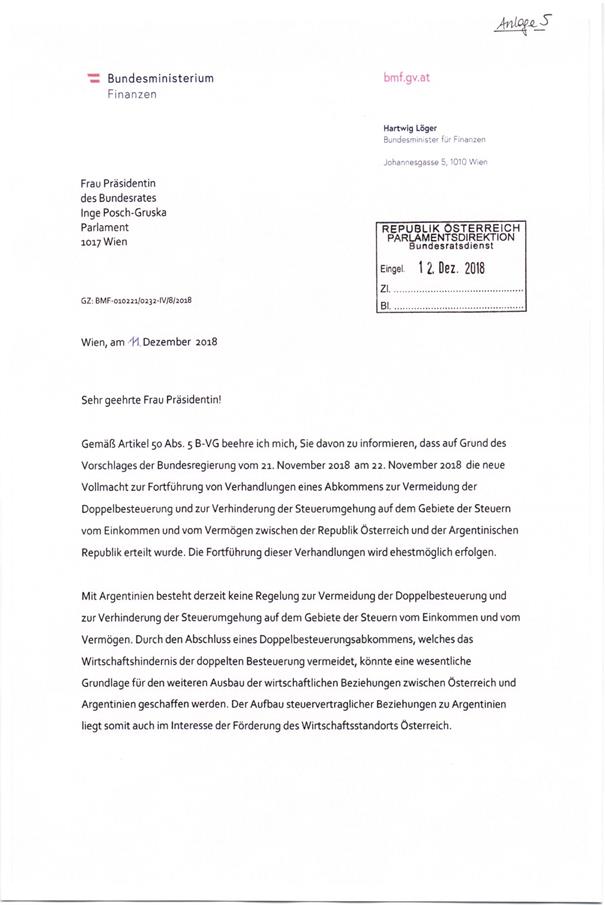
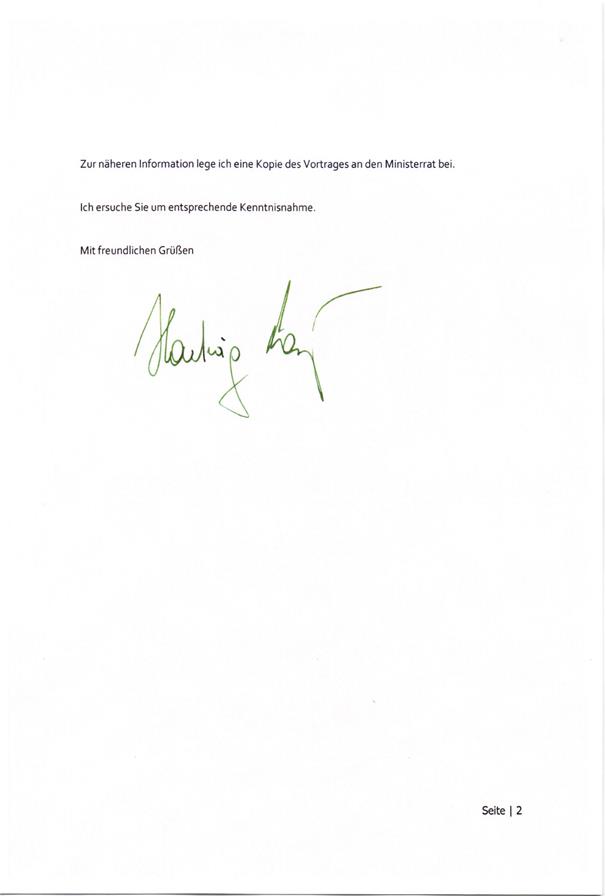
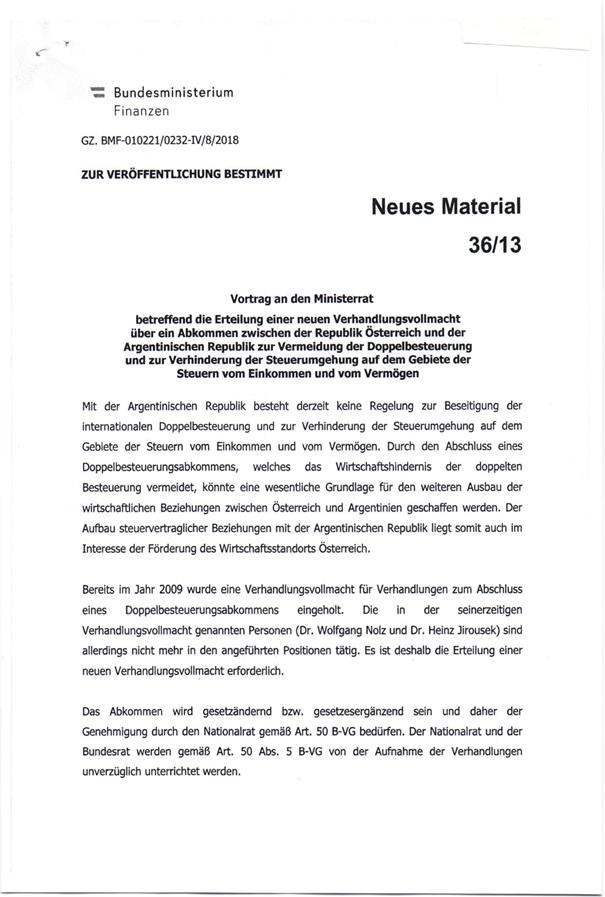
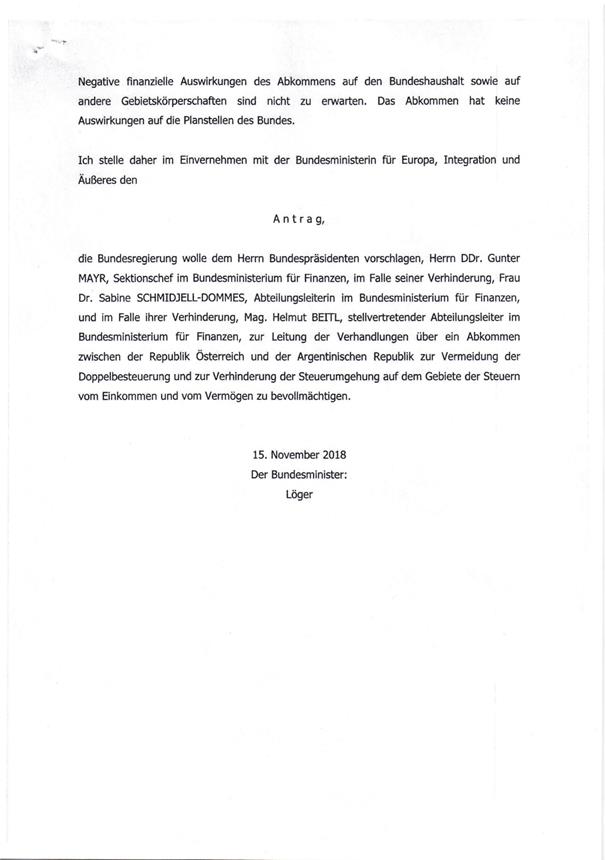
*****
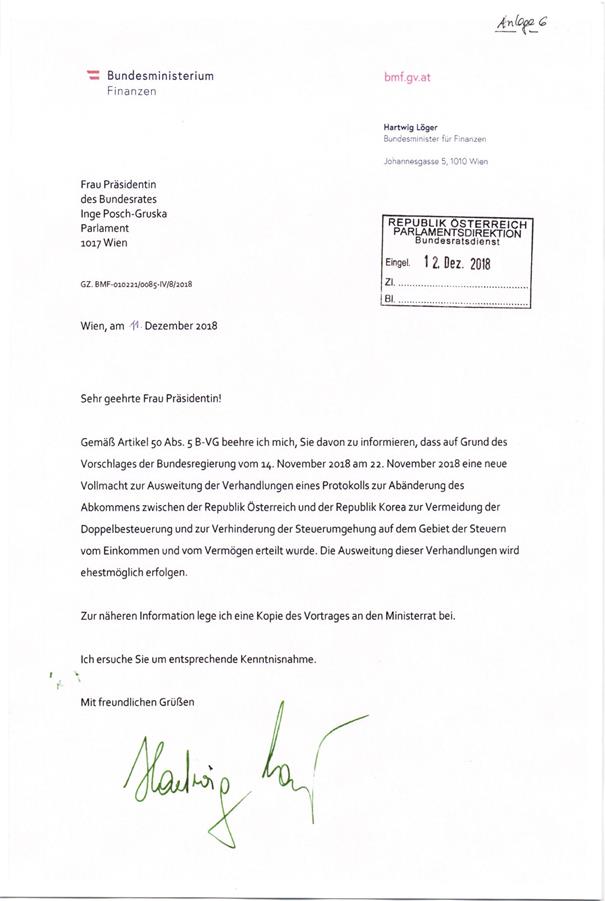
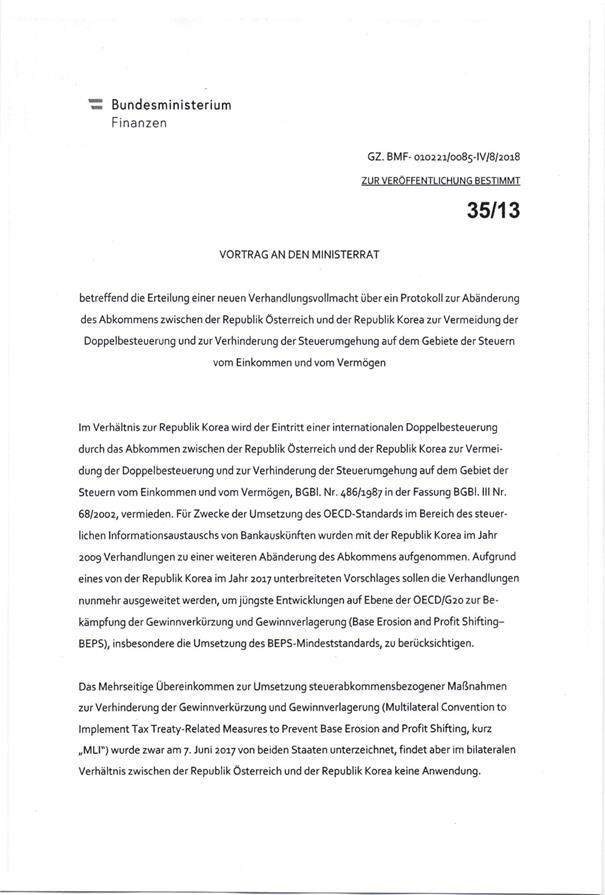
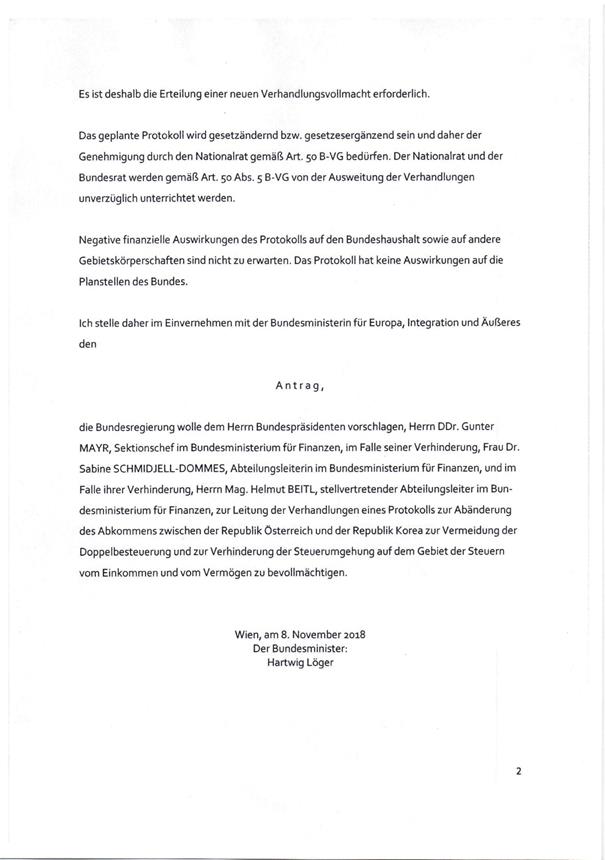
*****
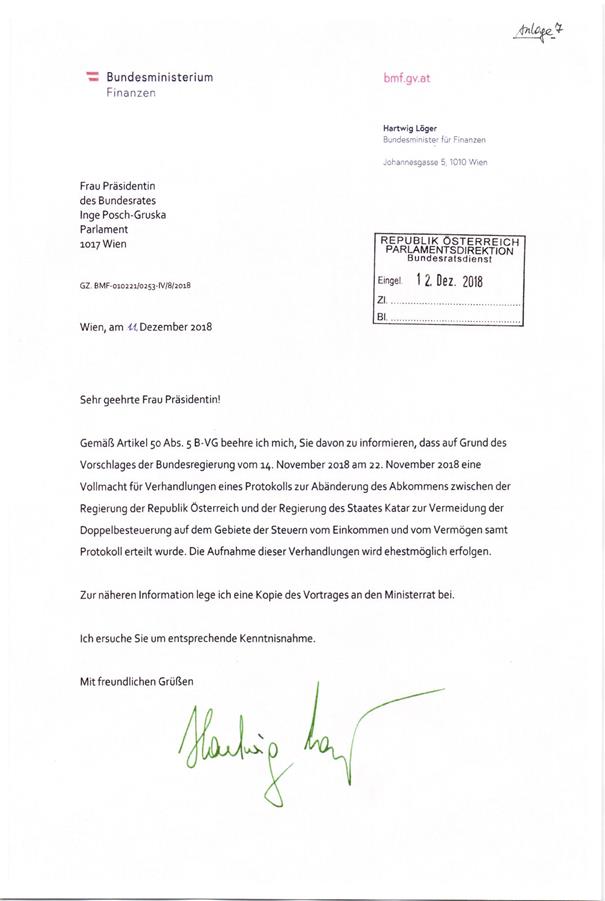
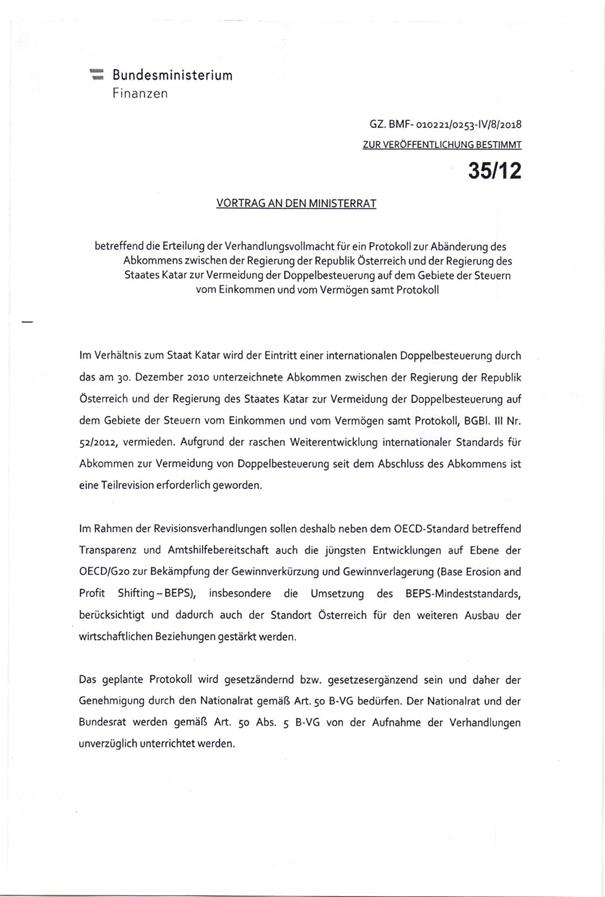
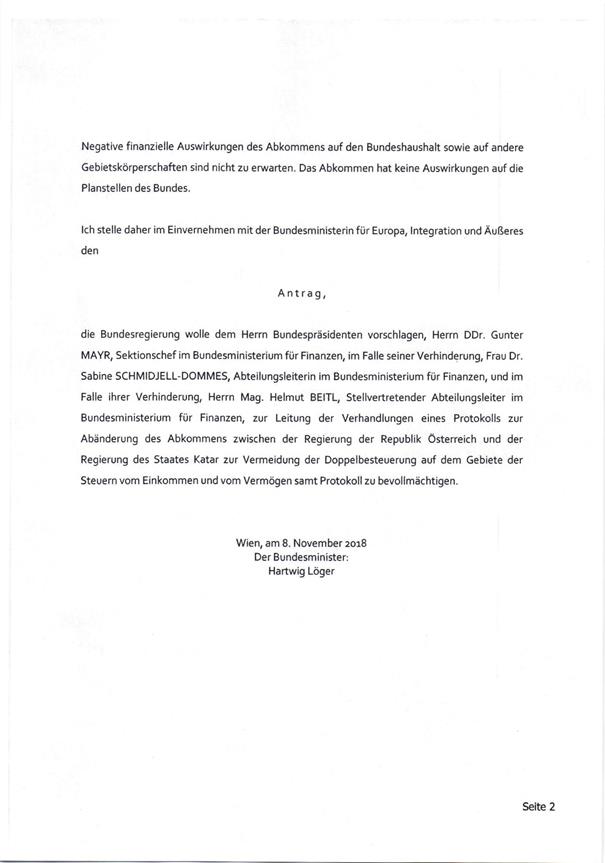
*****
Vertretung von Mitgliedern der Bundesregierung
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Weiters eingelangt ist eine Mitteilung des Verbindungsdienstes des Bundeskanzleramtes betreffend die parlamentarische Vertretung des Herrn Bundesministers für Inneres Herbert Kickl durch die Frau Staatssekretärin im Bundesministerium für Inneres Mag.a Karoline Edtstadler am 19. und 20. Dezember (siehe S. 28) sowie
ein Schreiben des Verbindungsdienstes des Bundeskanzleramtes betreffend den Aufenthalt von Herrn Bundesminister für Landesverteidigung Mario Kunasek von 20. bis 22. Dezember in Bosnien-Herzegowina bei gleichzeitiger Beauftragung von Frau Bundesministerin für Europa, Integration und Äußeres Dr. Karin Kneissl mit seiner Vertretung.
*****
Eingelangt und den zuständigen Ausschüssen zugewiesen wurden jene Beschlüsse des Nationalrates, die Gegenstand der heutigen Tagesordnung sind.
Die Ausschüsse haben ihre Vorberatungen abgeschlossen und schriftliche Ausschussberichte erstattet.
Absehen von der 24-stündigen Aufliegefrist
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Es ist mir der Vorschlag zugekommen, von der 24-stündigen Aufliegefrist der gegenständlichen Ausschussberichte Abstand zu nehmen.
Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die mit dem Vorschlag der Abstandnahme von der 24-stündigen Aufliegefrist der gegenständlichen Ausschussberichte einverstanden sind, um ein Handzeichen. – Das ist die Einstimmigkeit. Der Vorschlag ist somit mit der nach § 44 Abs. 3 der Geschäftsordnung des Bundesrates erforderlichen Zweidrittelmehrheit angenommen.
Behandlung der Tagesordnung
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Ich habe die zuvor genannten Verhandlungsgegenstände auf die Tagesordnung der heutigen Sitzung gestellt. Aufgrund eines mir zugekommenen Vorschlags beabsichtige ich, die Tagesordnungspunkte 3 bis 7 unter einem zu verhandeln.
Erhebt sich dagegen ein Einwand? – Das ist nicht der Fall.
Ankündigung einer Dringlichen Anfrage
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Bevor wir in die Tagesordnung eingehen, gebe ich bekannt, dass ein Verlangen im Sinne des § 61 Abs. 3 der Geschäftsordnung des Bundesrates auf dringliche Behandlung der schriftlichen Anfrage der Bundesräte Reinhard Todt, Kolleginnen und Kollegen betreffend „TAXI BUND“ an den Herrn Bundeskanzler vorliegt.
Im Einvernehmen mit den Fraktionsvorsitzenden wird die Behandlung dieser Dringlichen Anfrage um 17 Uhr erfolgen.
Fristsetzungsanträge
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Vor Eingang in die Tagesordnung gebe ich weiters bekannt, dass Herr Bundesrat David Stögmüller einen Fristsetzungsantrag gemäß § 45 Abs. 3 der Geschäftsordnung eingebracht hat, wonach dem Gesundheitsausschuss zur Berichterstattung über den Antrag der Bundesräte David Stögmüller, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein „Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über Ausbildung, Tätigkeit und Beruf der Sanitäter“ geändert wird, eine Frist bis 14. Februar 2019 gesetzt wird.
Den Bestimmungen der Geschäftsordnung entsprechend werde ich den Fristsetzungsantrag nach Erledigung der Tagesordnung zur Abstimmung bringen.
Ich darf weiters und schließlich bekannt geben, dass Herr Bundesrat David Stögmüller, Kolleginnen und Kollegen einen Fristsetzungsantrag gemäß § 45 Abs. 3 der Geschäftsordnung eingebracht haben, wonach dem Unterrichtsausschuss zur Berichterstattung über den Entschließungsantrag der Bundesräte Stögmüller, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Erhalt von Integrationsklassen an Sonderschulen“ eine Frist bis 14. Februar 2019 gesetzt wird.
Den Bestimmungen der Geschäftsordnung entsprechend werde ich den Fristsetzungsantrag nach Erledigung der Tagesordnung zur Abstimmung bringen.
Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Prüfung lohnabhängiger Abgaben und Beiträge erlassen wird und das Einkommensteuergesetz 1988, das Kommunalsteuergesetz 1993 und das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz geändert werden (Gesetz über die Zusammenführung der Prüfungsorganisationen der Finanzverwaltung und der Sozialversicherung – ZPFSG) (328 d.B. und 425 d.B. sowie 10070/BR d.B. und 10087/BR d.B.)
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Wir gehen nunmehr in die Tagesordnung ein und gelangen zu Punkt 1.
Berichterstatterin ist Frau Bundesrätin Marianne Hackl. Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatterin Marianne Hackl: Herr Präsident! Werter Herr Bundesminister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Ich bringe den Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Prüfung lohnabhängiger Abgaben und Beiträge erlassen wird und das Einkommensteuergesetz 1988, das Kommunalsteuergesetz 1993 und das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz geändert werden (Gesetz über die Zusammenführung der Prüfungsorganisationen der Finanzverwaltung und der Sozialversicherung).
Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 18. Dezember 2018 mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Danke für den Bericht.
Wir gehen in die Debatte ein.
Als Erste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Andrea Kahofer. – Bitte, Frau Bundesrätin.
15.04
Bundesrätin Andrea Kahofer (SPÖ, Niederösterreich): Hohes Präsidium! Herr Minister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Beim 7. Internationalen Speyrer Qualitätswettbewerb wurde Österreich im Themenfeld „Partnerschaftliche Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben“ für eine modernisierte Verwaltungsleistung prämiert – das war die GPLA, die gemeinschaftliche Prüfung lohnabhängiger Abgaben. Genau das wird heute hier mit diesem Tagesordnungspunkt in Abrede gestellt.
Es ist anscheinend so, dass jeder Bereich, der irgendwie die Selbstverwaltung der Krankenkassen betrifft, schleunigst verbannt werden muss; das geht gar nicht. Möglicherweise liegt es am Begriff partnerschaftlich, anscheinend geht das gar nicht. Diese Regierung nimmt sich jetzt heraus, dem Sozialversicherungsträger die Prüfkompetenz über die eigenen Abgaben zu entziehen. Selbst der Hauptverband – und ich glaube, wir alle wissen, dass der nicht rot dominiert ist (Bundesrätin Mühlwerth: Echt nicht?) – bezeichnet das als verfassungswidrig.
Andere Meinungen brauchen wir nicht. Wozu auch? Warum jemandem zuhören? Ihr habt die Weisheit ja ganz tief in euch. (Beifall bei der SPÖ. – Bundesrat Krusche: Genau, danke! – Bundesrat Samt: Das ist richtig! – Bundesrat Bader: Beste Aussage des heutigen Tages! – Bundesrat Seeber: Genau so ist es!)
Auch den Gemeinden und den Städten wird die Prüfkompetenz entzogen. Die große Frage ist, warum. Im Ausschuss wurde diese Frage ganz klar beantwortet: Effizienzsteigerung ist ja kein Thema – das wurde genau so gesagt –, es geht nicht darum, die Effizienz zu steigern, es geht nicht darum, Geld in die Haushaltskasse des Bundes zu spülen, überhaupt nicht. Na, warum machen wir es dann? – Wahrscheinlich weil den Arbeitgebern – ich war lange in einer Steuerberatungskanzlei – eine GPLA-Prüfung natürlich kein Vergnügen bereitet – no na ned, lustig ist es sicher nicht.
Das kann aber nicht der alleinige Grund sein. Einerseits wird zwar gesagt, es werde jetzt alles viel angenehmer für die Arbeitgeber, andererseits hören wir im Ausschuss, dass die Prüfungen in der Qualität und Quantität bleiben, in der sie jetzt sind. Wo liegt die Wahrheit? Das ist ja auch kein Grund, das ganze System umzustellen. Ich frage mich, wie die Prüfungen quantitativ gleich bleiben sollen, wenn wir wissen, dass in der Finanzverwaltung nur mehr jede dritte Stelle nach einer Pensionierung nachbesetzt wird. Das wird sich nicht ganz ausgehen. Alle GPLA-Prüfer, alle Mitarbeiter, die mit Stichtag Oktober 2018 mehrheitlich mit GPLA-Prüfungen beschäftigt waren, werden der Finanzverwaltung zugewiesen, bleiben aber Mitarbeiter der Sozialversicherungsträger. Die haben eine große Freude mit dem neuen System.
Ich persönlich frage mich – und das fragen sich neben mir viele –, wie das qualitativ ausschaut. Wird ein Finanzprüfer auf die gleichen Dinge Augenmerk legen wie ein Prüfer des Versicherungsträgers? Wird er Einstufungen kontrollieren? Wird er Anrechnungen von Vordienstzeiten kontrollieren? Auch die Frage nach den Schulungen wurde im Ausschuss damit beantwortet, dass es eventuell mehr gemeinsame Vorbereitungen geben wird. Vielleicht liegt es einfach daran, dass die mangelnde Kontrolle der Einstufungen schlussendlich ja nur den Dienstnehmer etwas kostet. Wenn ich eine Supermarktkassiererin anstatt in Entlohnungsstufe drei in zwei einstufe, kostet sie das innerhalb von zehn Jahren einen fünfstelligen Betrag von ihrem Bruttolohn. Das ist aber wahrscheinlich nicht so wichtig, weil das eine Bürgerin und keine Sponsorin ist. – Danke. (Beifall bei der SPÖ.)
15.08
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Elisabeth Mattersberger. – Bitte, Frau Bundesrätin.
15.09
Bundesrätin Elisabeth Mattersberger (ÖVP, Tirol): Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzter Herr Bundesminister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich melde mich heute zum Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem die Prüfungsorganisationen der Finanzverwaltung und der Sozialversicherung für die lohnabhängigen Abgaben und Beiträge zusammengeführt werden sollen, zu Wort und hoffe, einige von Kollegin Kahofers Aussagen entkräften zu können.
Ich bin in meinem Brotberuf selbstständige Bilanzbuchhalterin und Lohnverrechnerin und deshalb mit dieser Materie fast täglich konfrontiert. Im Jahr 2002 wurde bereits ein erster richtiger Schritt gesetzt, indem die Prüfungen der lohnabhängigen Abgaben von der Finanz und den Gebietskrankenkassen insofern gebündelt wurden, als man wechselseitige Prüfungen durchgeführt hat.
In der Praxis schaut das so aus, dass in einem Betrieb, der lückenlos geprüft wird, einmal ein Prüforgan der Finanz und das nächste Mal ein Prüforgan der Sozialversicherung die gemeinsame Prüfung der lohnabhängigen Abgaben, die sogenannte GPLA, durchführt.
Vor dem Jahr 2002 war es noch so, dass die Lohnsteuer, die Dienstgeberbeiträge und die Dienstgeberzuschläge von Prüforganen des Finanzamtes, die Sozialversicherungsbeiträge von Prüforganen der Gebietskrankenkassen und die Kommunalsteuer von Prüforganen der Gemeinden beziehungsweise Bezirkshauptmannschaften geprüft wurden. Dadurch waren die Unternehmen im Bereich der Lohnverrechnung mit sehr vielen Prüfungen konfrontiert. Die Installierung der wechselseitigen Prüfungen im Jahr 2002 war nicht nur ein richtiger, sondern auch ein besonders wichtiger Schritt.
Jetzt soll ein zweiter richtiger und wichtiger Reformschritt folgen, bei dem die Prüforgane der Sozialversicherung dem Bundesministerium für Finanzen zugewiesen und somit die zwei Prüfinstitutionen zu einer Prüfinstitution zusammengeführt werden. Dieser zweiter Reformschritt ist wichtig, da es in der Vergangenheit von den Prüforganen der beiden Prüfinstitutionen immer wieder verschiedene Rechtsauslegungen gegeben hat. Dieses Manko wird mit dem zu beschließenden Gesetz dahin gehend behoben werden, als zur Gewährleistung der fachlichen Unterstützung den Prüforganen beim Prüfdienst für lohnabhängige Abgaben und Beiträge ein Fachbereich eingerichtet wird.
Die unterschiedliche Rechtsauslegung war für die Betriebe ein Problem und hat zu Unsicherheit in den Unternehmen geführt. Wenn in einem Unternehmen eine Prüfung durchgeführt wird, dann muss sich das Unternehmen darauf verlassen können, dass die beanstandete oder eben nicht beanstandete Lohnabrechnung auch bei der nächsten Prüfung rechtlich gleich bewertet wird. Dies wird mit der Installierung des Fachbereichs gewährleistet sein, da die anzuwendenden Rechtsvorschriften in Zukunft bundeseinheitlich gleich ausgelegt werden. Das ist nicht nur für die Unternehmen ein Vorteil, sondern natürlich auch indirekt für die Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass es sich durch die Bündelung der Prüfungsexpertise und aufgrund der bundesweit einheitlichen Rechtsauslegung und der risikoorientierten Prüffallauswahl um eine wesentliche Verbesserung und Effizienzsteigung handelt. Ich darf somit im Namen meiner Fraktion empfehlen, keinen Einspruch gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates zu erheben. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
15.13
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Danke, Frau Bundesrätin.
Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Rosa Ecker. Ich erteile es ihr.
Bundesrätin Rosa Ecker, MBA (FPÖ, Oberösterreich): Sehr geehrtes Präsidium! Sehr geschätzter Herr Minister! Sehr geehrte Damen und Herren hier und zu Hause! Die Zusammenführung der Prüforganisationen von Finanzverwaltung und Sozialversicherung geht auf eine Empfehlung des Rechnungshofes zurück. Diese Empfehlung wird auch von einer Studie der London School of Economics, die großen Reformbedarf im Sozialversicherungssystem festgestellt hat, bestätigt. Wir kommen damit zu einer bundesweit einheitliche Rechtsauslegung, die Bürokratieabbau und trotzdem mehr Effizienz im System mit sich bringt.
Im Ablauf der Vorschreibungen und Einhebungen dieser Abgaben gibt es keine doppelten Strukturen mehr, und das muss zu mehr Effizienz führen, da nur mehr eine Stelle zuständig ist. Das führt natürlich zu Synergieeffekten, die Einsparungen ergeben müssen, denn Doppelprüfungen gehören – bis auf etwaige Einspruchsfälle – der Vergangenheit an.
Ab 1.1.2020 werden nicht mehr sowohl die Gebietskrankenkasse als auch das Finanzamt prüfen, sondern beide Prüfverfahren innerhalb der Finanzverwaltung zusammengefasst; sie erfolgen damit aus einer Hand – wie wir schon gehört haben –, nämlich vom Prüfdienst für lohnabhängige Abgaben und Beiträge. Der Prüfbeirat besteht weiterhin und wird die Interessen der Sozialversicherungen und der Kommunen gewährleisten, und es wird darauf geachtet, dass die Prüfpläne und Prüfbereiche eingehalten werden und eben auch Anlassprüfungen stattfinden.
Da die Finanzverwaltung schon seit dem Jahr 2003 bereits 50 Prozent der Prüfungen übernommen hat, denke ich mir, ist sie für diese Aufgabe bestens vorbereitet. Die bisher damit Beschäftigten in den Gebietskrankenkassen – das sind an die 300 Personen – werden in den Prüfdienst der Finanzverwaltung integriert; sie sind also auch bestens eingearbeitet. Auf längere Sicht soll ja auch die Einhebung der Beiträge durch die Finanzämter erfolgen. Aktuell hebt nämlich die Sozialversicherung – für die, die es nicht wissen – nicht nur die eigenen Beiträge ein, sondern etwa auch die Unfallversicherung, die Pensionsversicherungsbeiträge, den Wohnbauförderungsbeitrag, Einzahlungen in betriebliche Vorsorgekassen, und sogar die Arbeiterkammerumlage wird von der Gebietskrankenkasse einkassiert. Natürlich fällt dadurch ein gewaltiger Verwaltungsaufwand an und Kostentransparenz ist nicht gegeben.
Das Einkommensteuergesetz wird dahin gehend geändert, dass der Arbeitgeber nur mehr dann haftet, wenn er die Steuer tatsächlich unrichtig berechnet. Der Arbeitgeber haftet nicht aufgrund unrichtiger Erklärungen in Bezug auf den Steuerabzug. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber nicht verpflichtet ist, die Angaben des Arbeitnehmers – ob Anspruch auf Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag, in Zukunft auf den Familienbonus Plus oder auch auf den Pensionistenabsetzbetrag besteht – auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Sind wir uns ganz ehrlich: Ganz oft geht das auch gar nicht. In großen Firmen, wo man die Dienstnehmer nicht persönlich kennt, weiß man oft nicht, ob die Kinder bei ihm oder bei ihr wohnen.
Im Finanzausschuss des Nationalrates wurde ein Zusatzantrag eingebracht, der darauf abgezielt hat, die Freibetragsbescheide zu verändern. Ich sehe das als gute Serviceleistung für die Dienstnehmer, weil viele Arbeitnehmer die Veranlagung für 2017 schon gemacht haben. Wenn sie die zu erwartende Lohnsteuerrückvergütung im kommenden Jahr monatlich lukrieren wollen, dann haben sie die Möglichkeit, diesen Lohnsteuerfreibetragsbescheid anzufordern. Da es 2019 ja den Familienbonus Plus gibt und manche Freibeträge wegfallen, halte ich es für eine ganz gute Idee, dass man diese ausgestellten Freibeträge wieder neu erstellt, damit man Pflichtveranlagungen oder etwaige Nachforderungen einfach neu berechnen kann und vielleicht auch die Möglichkeit hat, mehr an Steuer zurückzubekommen als 2017.
Zu den Bedenken möchte ich festhalten: Die Finanzprokuratur hat festgestellt, dass es verfassungsrechtlich jedenfalls zulässig ist, die Prüfung der lohnabhängigen Abgaben in einer einheitlichen Prüfungsorganisation, die im Wirkungsbereich des Bundes etabliert ist, zusammenzuführen. In einem Gutachten hat Universitätsprofessor Harald Stolzlechner, Professor für öffentliches Recht an der Universität Salzburg, festgestellt, dass die Veränderungen der Beitragsüberprüfung und Beitragsänderung gegen keine Bestimmung der verfassungsrechtlichen Grundlage der sozialen Selbstverwaltung verstoßen.
Mit diesem Gesetz, denke ich, hat die Regierung wieder einen positiven Schritt im Bereich der Verwaltungsvereinfachung hin zu einer moderneren Verwaltung gesetzt und notwendige Reformen in die Wege geleitet. (Beifall bei FPÖ und ÖVP.)
15.17
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Danke.
Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesminister Hartwig Löger. Ich erteile es ihm.
Bundesminister für Finanzen Hartwig Löger: Herr Präsident! Liebe Bundesrätinnen und Bundesräte! Liebe Zuseherinnen und Zuseher! Ich möchte bewusst ganz kurz auf das Gesagte eingehen, sage aber vorweg Danke dafür, dass die bisherigen Rednerinnen die gute Arbeit, die die Prüferinnen und Prüfer beider Bereiche derzeit leisten, nicht infrage gestellt haben. Ich glaube, das ist voranzustellen und das ist auch die Grundlage dessen, was seit 2003 betreffend die GPLA-Prüfungen im positiven Sinne stattgefunden hat.
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir mit diesem Bewusstsein agieren und nicht versuchen, die beiden Systeme in diesem Bereich gegeneinander auszuspielen. Das bildet eine Basis, an der wir erkennen, dass jede der beiden Stellen durchaus gewisse Stärken und da oder dort aber auch Schwächen hat. Die Stärken wollen wir in dieser in Wirklichkeit schon seit 2003 gegebenen gemeinsamen Form jetzt auch mit einem strukturellen Schritt – nämlich der Zusammenführung im positiven Sinne – weiterentwickeln. Wir werden die Stärken des einen mit den Stärken des anderen verbinden und werden versuchen, die jeweiligen Schwächen, die in der Struktur vielleicht gegeben waren, entsprechend zu minimieren.
Dass die Veränderung auch Stress erzeugt, dass da Ängste entstehen, ist uns bewusst, diesbezüglich haben wir auch vorgesorgt, indem wir investieren und dafür sorgen, dass dieses Zusammengehen auch positiv untermauert ist. Es wurden auch schon die rechtlichen Bedenken angesprochen, die wir nicht sehen, weil es ja, wie gesagt, schon seit über 15 Jahren eine gelebte, auch positiv wirkende, gemeinsame Prüfung gibt.
Um noch einmal auf Frau Bundesrätin Kahofer zu reagieren: Ja, es gibt jetzt vordergründig nicht die Idee, dieses System durch Einsparungen im Personalbereich zu schwächen. Das heißt, die Effizienzsteigerung soll in erster Linie daraus kommen, dass es möglich ist, durch eine gemeinsame Grundlage, auch was die verfahrensrechtlichen Themen betrifft, nämlich über die Bundesabgabenordnung, in dem Bereich auch in der Verbindung zu den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern eine gemeinsame Sicherheit zu stellen. Wir werden sicherstellen können, dass es auch im Bereich der Prozesse beziehungsweise auch der dahinterliegenden IT-Strukturen zu einer Vereinheitlichung kommt, womit es auch zu Effekten kommt, die diese Effizienzsteigerungen mit sich bringen können. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
Ich gehe jetzt bewusst nicht auf die Vorteile, die darin liegen, ein – Frau Bundesrätin Mattersberger hat das ohnehin schon angesprochen –, sondern möchte jetzt noch einmal auf Bundesrätin Ecker eingehen: Es wurde auch Folgendes klargestellt – ich glau-
be, das ist eine wichtige Botschaft im Sinne der Selbstverwaltung und auch im Sinne der Verantwortung, die die Sozialversicherung auch weiterhin haben wird –: Diese hier jetzt zusammengeführte Prüfungseinheit wird im Anlassfall natürlich auch weiterhin Aufträge aus dem Sozialversicherungsbereich verantwortlich umzusetzen haben, das heißt, hier ist auch sichergestellt, dass dieses Elementum nicht verlorengehen kann. Es darf auch nicht verlorengehen, und das hat auch seinen Sinn, daher wird auch die Kraft und die Eigenständigkeit der Sozialversicherung gewahrt bleiben.
Ich erwarte hier jetzt keine sozusagen gemeinsame Entscheidung im Sinne des Antrages, aber ich hoffe, so wie hier in dem Bereich auch konstruktiv diskutiert wurde, dass wir da durchaus eine gemeinsame Linie sehen und das mit gutem Gewissen für Österreich und auch für seine Bürgerinnen und Bürger tun können. – Danke. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
15.21
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Danke, Herr Bundesminister.
Weitere Wortmeldungen dazu liegen nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir gelangen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das ÖIAG-Gesetz 2000, das Bundesimmobiliengesetz und das Finanzmarktstabilitätsgesetz geändert werden (367 d.B. und 426 d.B. sowie 10071/BR d.B. und 10088/BR d.B.)
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Wir gelangen zum 2. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatterin ist wiederum Frau Bundesrätin Marianne Hackl. Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatterin Marianne Hackl: Hohes Präsidium! Werter Herr Bundesminister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Ich bringe den Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das ÖIAG-Gesetz 2000, das Bundesimmobiliengesetz und das Finanzmarktstabilitätsgesetz geändert werden.
Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 18. Dezember 2018 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Ich danke für den Bericht.
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Dr. Andrea Eder-Gitschthaler. – Bitte, Frau Bundesrätin.
Bundesrätin Dr. Andrea Eder-Gitschthaler (ÖVP, Salzburg): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Diesen Tagesordnungspunkt betreffend die neue Staatsholding Öbag würde ich
unter aktives Beteiligungsmanagement für Österreich einreihen. Für mich ist das ein wichtiger und entscheidender Schritt.
Worum geht es, liebe Kolleginnen und Kollegen? – Die Österreichische Bundes- und Industriebeteiligungen GmbH, kurz Öbib genannt, verwaltet derzeit die großen Beteiligungen der Republik Österreich sowohl an börsennotierten Unternehmen wie der Österreichischen Post, der OMV und der Telekom Austria als auch an den anderen, nicht börsennotierten Unternehmen wie zum Beispiel der Casinos Austria AG.
Um den Wert dieser Beteiligungen zu erhalten, sie in Zukunft aktiv zu managen und damit das Vermögen der Österreicherinnen und Österreicher – und damit von uns allen – abzusichern, war es notwendig und wichtig, sie strategisch neu auszurichten. Die Österreichische Bundes- und Industriebeteiligungen GmbH, kurz Öbib, wird dazu in eine Aktiengesellschaft, in die Österreichische Beteiligungs AG, kurz Öbag, umgewandelt. – Vielen Dank, Herr Finanzminister! Diese Regierung packt an und handelt. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
Die wichtigsten Eckdaten dazu: Die derzeitige Öbib ist als Gesellschaft mit beschränkter Haftung ohne Aufsichtsrat und weisungsgebunden aufgestellt; das Management der Öbag wird künftig weisungsfrei agieren. Es wird wieder einen Aufsichtsrat geben, insgesamt neun Aufsichtsräte, und ein Beteiligungskomitee. Die Wahrnehmung der Arbeitnehmerinteressen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPÖ, ist durch drei von der Hauptversammlung zu wählende ArbeitnehmervertreterInnen im Öbag-Aufsichtsrat aus den drei nach Konzernumsatz gewichtet größten börsennotierten Öbag-Beteiligungen gewährleistet – damit haben wir auch das mitbedacht.
Auch die Öbag ist künftig über ihren Vorstand in den Aufsichtsräten der Beteiligungsgesellschaften vertreten. Das ist sehr wichtig, weil die Republik so Eigentümerinteressen mittel- und langfristig auch in Bezug auf Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen sicherstellen kann.
Neben den großen Beteiligungen wie OMV, Telekom, Post und Casinos Austria wird – jetzt neu – auch die Bundesimmobiliengesellschaft, also die BIG, unter das Dach der Staatsholding kommen. Der Verbund bleibt weiterhin im Eigentum des Finanzministeriums, die Beteiligung wird aber künftig von der Öbag mitverwaltet – also ein kompaktes neues Paket.
Zukäufe werden ausschließlich aus den Dividenden der Beteiligungen, derzeit über eine halbe Milliarde Euro pro Jahr, finanziert, und zwar im Rahmen des Limits, das der Herr Finanzminister vorgibt, und wenn der Aufsichtsrat das beschließt. Privatisierungen sind nicht angedacht; wir haben das im Ausschuss besprochen und auch so von den Expertinnen und Experten erfahren.
Damit handelt es sich hier also um ein industriepolitisches Riesenprojekt mit einem Portfoliowert von immerhin 23 Milliarden Euro – das ist natürlich ein beachtliches Projekt für Österreich und auch international.
Sie sehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Neuregelung ist im Interesse der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Unser Vermögen wird langfristig abgesichert, wir stärken damit den Wirtschafts- und Forschungsstandort Österreich, wir schaffen Arbeitsplätze für Österreich und sichern sie ab. Ich denke, das wollen wir alle, und darum freut es mich, dass wir hier gemeinsam einen Beschluss fassen können. – Vielen Dank, Herr Finanzminister, für Ihre Bemühungen! (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
15.27
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Dominik Reisinger. Ich erteile es ihm.
15.27
Bundesrat Dominik Reisinger (SPÖ, Oberösterreich): Geschätzter Herr Präsident! Werter Herr Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Werte Zuhörerinnen und Zuhörer! Wir haben es von der Vorrednerin gehört: Die Öbib wird von einer GmbH in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, die dann Öbag heißen wird. Diesem gegenständlichen Änderungsgesetzentwurf wird die SPÖ-Fraktion auch zustimmen. Bei einem Portfoliowert von rund 20 Milliarden Euro kann man gar nicht stark genug unterstreichen und mit Fug und Recht behaupten, dass es sich dabei um ein industriepolitisches Megaprojekt handelt. (Vizepräsident Lindinger übernimmt den Vorsitz.)
Mit dieser Umwandlung wird auch die Absicht verfolgt, die Staatsbeteiligungen zur Förderung und Stärkung des österreichischen Wirtschafts- und Forschungsstandortes neu auszurichten, denn mit einer börsennotierten Aktiengesellschaft verspricht man sich mehr Möglichkeiten, die staatlichen Beteiligungen besser zu handeln, wenn man so will, und so für nachhaltige Wertschöpfung zu sorgen.
Diese Reform wird von der SPÖ sowie von den Sozialpartnern grundsätzlich positiv betrachtet, es ist aber auch Aufgabe der Politik, optimale Rahmenbedingungen für einen gestärkten Industriestandort zu schaffen. Die ausgeschütteten Dividenden sollen aber, wenn es nach uns geht, nicht ins Budget fließen, sondern etwa in Form eines Österreichfonds für wichtige Zukunftsfragen reinvestiert werden.
Die Frau Kollegin hat es angesprochen: Es war darüber hinaus aber auch Voraussetzung für unsere Zustimmung, dass durch einen gemeinsamen Abänderungsantrag der SPÖ und der Regierungsparteien die Wahrung der Arbeitnehmerinteressen im Aufsichtsrat gewährleistet wird. Der neunköpfige Aufsichtsrat wird somit aus sechs Kapitalvertretern und drei Arbeitnehmervertretern zusammengesetzt sein. (Beifall bei der SPÖ.)
Abschließend ist aber die kurze Begutachtungsfrist von nur sehr, sehr wenigen Tagen kritisch zu beurteilen. Wenn die Regierung also ehrliches Interesse an der Einbindung der Opposition hat, sollte solchen Gesetzgebungsprozessen doch deutlich mehr Zeit eingeräumt werden. – Danke. (Beifall bei der SPÖ.)
15.29
Vizepräsident Ewald Lindinger: Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Mag. Reinhard Pisec. Ich erteile ihm dieses.
Bundesrat Mag. Reinhard Pisec, BA MA (FPÖ, Wien): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Finanzminister! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich darf mich ein bisschen an das Jahr 2014 zurückerinnern, als wir hier eine große Diskussion – jetzt nicht thematisch groß, aber doch – über die Inhalte der verstaatlichten Industrie Österreichs hatten, um es einmal so salopp zu definieren, über die Form der Kapitalgesellschaften, über die Rechtsform, zwischen einer Aktiengesellschaft und einer GesmbH abwägend.
Wir haben damals schon gesagt, dass die Aktiengesellschaft mit einem mehr oder minder in sich kompakten, selbstständig operativ tätigen Vorstand, einer Geschäftsleitung und einem kontrollierenden Aufsichtsrat für dieses riesige Volumen von Österreichs Staatsindustrie die bessere Rechtsform wäre als eine ganz banale GesmbH mit einer weisungsgebundenen Geschäftsleitung. In diesem Sinne wurde das jetzt von unserer gemeinsamen Bundesregierung nachgeholt, und es freut mich ganz besonders, dass die SPÖ eingesehen hat, dass der damalige sozialistische Bundeskanzler Faymann auf der falschen Seite gewesen ist.
Ich weiß natürlich, dass der Aufsichtsrat damals ein selbsterneuernder war, aber das hätte man auch so direkt in dieser Reform unterbringen können. Dieses Gesetz ist na-
türlich deswegen ein gutes Gesetz, weil wir im Unterschied zur Vergangenheit der Siebzigerjahre an eine aktive Beteiligung, ein aktives, positives Wertschöpfungsmanagement für diese österreichische Industrie denken und dies auch so handhaben wollen. Österreichs Industrie, die großen Vier – ich möchte sie so nennen; OMV, Telekom, Post und Verbund sind alle Börsenschwergewichte an der Wiener Börse –, leisten 500 Millionen Euro Dividende jährlich für das österreichische Staatsbudget und schaffen Arbeitsplätze für 100 000 Mitarbeiter. Auch daran sieht man gleich die Bedeutung der Wiener Börse und wie wichtig es ist, dass die Shareholder international gestreut werden, natürlich abgesehen von der Beteiligung der Republik Österreich.
Ich möchte einen Blick auf Österreichs Industrie insgesamt werfen, weil im Wort Industrie ja das lateinische Wort industria steckt, und das heißt Fleiß. Ich möchte kurz auf den Fleiß von Österreichs Industrie, auch der privaten Industrie, eingehen.
Österreich kann stolz auf seine Industrie sein: auf den Maschinenbau, auf die Papierindustrie, auf die Elektroindustrie, auf die maschinenverarbeitende Industrie, selbstverständlich auf die Kfz-Zulieferindustrie, die in der Steiermark sehr stark ist, und auf die Pharmaindustrie, die natürlich in Wien stark ist. Wenn man sie alle zusammenzählt, sind es insgesamt circa 30 000 Betriebe mit 600 000 Arbeitsplätzen, die für Österreichs Wertschöpfung in der Höhe von 20 Prozent des BIP tätig sind und ihre Leistung erbringen.
Wenn man die Exporte mitrechnet, kommen wir insgesamt auf eine Wertschöpfung, auf einen Anteil am Volkseinkommen von etwa 30 Prozent – und auf noch einmal 500 000 Arbeitsplätze, sodass wir insgesamt bei einem Volumen von sagenhaften 1,5 Millionen Arbeitsplätzen sind –, den allein Österreichs Industrie mit ihren Exporten darstellt, weil jedes zweite von dieser Industrie hergestellte Produkt in den Export wandert und weil wir ja eine offene, kleine Volkswirtschaft sind, die vom Export abhängig ist und diesen benötigt. Daher gehört dieser auch gefördert.
Ich möchte klarerweise auch auf die Innovation im Zeitalter der Digitalität, der permanenten Transformation, der Leistungserbringung, der Globalisierung, der internationalen Wertschöpfungsketten, denen wir uns stellen und an denen wir teilnehmen müssen, eingehen. Will man partizipieren und mit dem Volkseinkommen wachsend dazu beitragen, ist die innerbetriebliche Forschung ganz wichtig. Die innovativen Technologien, die empirischen Grundlagen werden in den Industrien geliefert, weil dort die Forschung stattfindet. Das sieht man ganz einfach an den Patenterteilungen, bei denen von zehn Patenten allein acht oder neun aus der Industrie stammen.
Die Industrie ist wichtig für den Standort Österreich und für unser Volkseinkommen, und mit der Wiener Börse, wenn ich das abschließend erwähnen darf, und der Industriellenvereinigung hat Österreichs Industrie zwei ganz tolle, aktive Institutionen, die sich um das Wohlergehen der Industrie – sowohl der privaten als auch der Beteiligungsindustrie der Republik Österreich – kümmern und deren Mitarbeiter auch aktiv unterstützen. – Vielen Dank. (Beifall bei FPÖ und ÖVP.)
15.34
Vizepräsident Ewald Lindinger: Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesminister Hartwig Löger. Ich erteile ihm dieses.
Bundesminister für Finanzen Hartwig Löger: Herr Präsident! Liebe Bundesrätinnen und Bundesräte! Liebe Zuseherinnen und Zuseher! Vorweg: Ich freue mich, dass wir sowohl an der Diskussion im Ausschuss des Parlaments als auch an jener im Nationalrat schon erkennen konnten, dass wir auf breiter Basis eine Zustimmung zu dieser Novelle des ÖIAG-Gesetzes erwarten können.
Es wurde, glaube ich, von Bundesrätin Eder-Gitschthaler schon sehr ausführlich und auch im Detail dargestellt, welche Volumina, welche Bedeutung und welche Inhalte diese Novelle hat. Dieses Portfolio von 23 Milliarden Euro – inklusive Verbund, der zwar im Eigentum des Ministeriums bleibt, aber über die Öbag mit Managementvertrag organisiert und gemanagt werden wird – bedeutet für jede Österreicherin und jeden Österreicher eine Beteiligung – und das ist ja die Beteiligung unserer Steuerzahlerinnen und Steuerzahler – im Ausmaß von rund 2 650 Euro. Da ist also in Österreich auch pro Kopf Interesse gegeben, und ich glaube, es ist wichtig, dass wir da auf breiter, gemeinsamer Basis wieder ein professionelles Management sicherstellen.
Es wurden die rund 5 Milliarden Euro an Steuern und Abgaben aus diesen Industriebereichen angeführt, die bei dem Volumen natürlich auch eine Relevanz, eine Bedeutung für die gesamte Budgetgebarung unseres Landes haben, weil sie dafür auch einen wichtigen Beitrag liefern.
Von Bundesrat Reisinger wurden die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Österreich in diesen für uns sehr relevanten und wichtigen Industriebereichen tätig sind, positiv erwähnt. Die Dividende von rund 500 Millionen Euro, wie sie von Ihnen und auch von Bundesrat Pisec angeführt wurde, ist natürlich ein elementum, das bedeutsam ist, und ich verstehe durchaus auch Ihren Hinweis, dass man sagt, das sollte auch in Richtung weiterer Beteiligungen und auch in Richtung Wirtschaftsförderung und Arbeitsplatzsicherung entsprechend genutzt und eingesetzt werden.
Ich möchte aber bewusst auch auf die Kritik betreffend Begutachtung, die im Vorfeld gekommen ist, eingehen. Ich will von meiner Seite ganz ehrlich sagen, das hat mehrere Aspekte. Ein Aspekt ist, dass ich glaube, dass man die Kirche im Dorf lassen muss. Dies ist eine Novelle einer Gesetzgebung, die mit sechs Seiten Umfang sozusagen eine durchaus überschaubare Grundlage im Sinne der gesetzlichen Änderung bedeutet.
Der zweite Aspekt ist – und lassen Sie mich das vielleicht auch ein bisschen zynisch formulieren –, dass die Begutachtung auf zehn Tage angesetzt war, das hat sich möglicherweise aufgrund der Herbstferien sozusagen auf Werk- oder Schultage, wenn man es so reduzieren will, eingeschränkt, aber es haben alle – alle, auch die im Sinne der Ressortrückmeldungen etwas Kritischen – rechtzeitig reagiert; eigentlich haben das alle sogar vier Tage vor Ablauf dieser Frist gemacht.
Ich sage auch dazu, es war bewusst meine Entscheidung, in diese kurze Begutachtung zu gehen. Es wurde überhaupt noch nie eine Novellierung des ÖIAG-Gesetzes in Begutachtung geschickt, wir haben also erstmalig eine Novelle des ÖIAG-Gesetzes in eine Begutachtung gebracht. Und ja, ich habe mich für diese kurze Frist entschieden, weil der Umfang überschaubar war und weil wir sichergehen wollten, dass wir die Chance haben, diese Novelle mit 1. Jänner in Kraft treten zu lassen, damit wir auch die Gelegenheit haben, möglichst rasch die Wirkung dieses neuen Gesetzes entfalten zu können. Das ist wichtig, um dieses aktive Beteiligungsmanagement mit den dann im späten Frühjahr und im Frühsommer beginnenden Hauptversammlungen der Beteiligungsgesellschaften realisieren zu können. Das heißt also, es ging darum, hier keine Zeit zu verlieren, sondern unser gemeinsames Interesse schnell in Wirkung zu bringen.
In Summe gesehen freue ich mich, dass es uns damit gelingen wird – davon gehe ich aus und ich hoffe auch auf Ihre Zustimmung auf breiter Basis –, für Österreich und unsere Bürgerinnen und Bürger wieder Qualität auch im Bereich dieser wichtigen Beteiligungen zu sichern, und ich bedanke mich auch für das entsprechende Vertrauen. – Danke. (Beifall bei ÖVP, SPÖ und FPÖ.)
15.39
Vizepräsident Ewald Lindinger: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir gelangen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Tabakmonopolgesetz geändert wird (513/A und 428 d.B. sowie 10089/BR d.B.)
4. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Tabaksteuergesetz 1995 (TabStG) geändert wird (429 d.B. sowie 10090/BR d.B.)
5. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Katastrophenfondsgesetz 1996 geändert wird (368 d.B. und 430 d.B. sowie 10091/BR d.B.)
6. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Finanzausgleichsgesetz 2017 geändert wird (370 d.B. und 431 d.B. sowie 10072/BR d.B. und 10092/BR d.B.)
7. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018
betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem
Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der
Steuerverkürzung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen
und von Veräußerungsgewinnen samt Protokoll (326 d.B. und
432 d.B. sowie 10093/BR d.B.)
Vizepräsident Ewald Lindinger: Wir gelangen nun zu den Tagesordnungspunkten 3 bis 7, über welche die Debatte unter einem durchgeführt wird.
Berichterstatter zu den Punkten 3 bis 7 ist Herr Bundesrat Ing. Eduard Köck. – Ich bitte um die Berichte.
Berichterstatter Ing. Eduard Köck: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Finanzminister! Ich bringe den Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Tabakmonopolgesetz geändert wird.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor. Ich komme daher zum Antrag:
Der Finanzausschuss stellt den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss keinen Einspruch zu erheben.
Weiters bringe ich den Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Tabaksteuergesetz 1995 geändert wird.
Der Bericht liegt in schriftlicher Form vor. Ich komme daher zum Antrag:
Der Finanzausschuss stellt den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss keinen Einspruch zu erheben.
Weiters bringe ich den Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Katastrophenfondsgesetz 1996 geändert wird.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor. Ich komme daher zum Antrag:
Der Finanzausschuss stellt den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Weiters bringe ich den Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Finanzausgleichsgesetz 2017 geändert wird.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor. Ich komme daher zum Antrag:
Der Finanzausschuss stellt den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Weiters komme ich zum Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und von Veräußerungsgewinnen samt Protokoll.
Auch dieser Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor. Ich komme daher zum Antrag:
Der Finanzausschuss stellt den Antrag,
1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben,
2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
Vizepräsident Ewald Lindinger: Danke für den Bericht.
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Stefan Schennach. Ich erteile ihm dieses.
Bundesrat Stefan Schennach (SPÖ, Wien): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, das sind jetzt gleich fünf Punkte, und ich sage gleich, dass wir bei zwei Punkten unsere Zustimmung erteilen werden, auch wenn ich hier stehe, um über alle Punkte – es gibt ja auch Kontra-Punkte – zu sprechen.
Wir haben eine ganze Aktuelle Stunde lang über Transparenz gesprochen, aber bei dieser Novellierung und bei dieser Umarbeitung des Finanzausgleichs gab es so wenig Transparenz, dass der Bildungsminister nicht einmal wusste, was da zu seinem Schaden passiert. Es ist zu befürchten, dass er es nicht wusste, denn so hat er es, wie ich höre, auch im Ausschuss des Nationalrates kundgetan.
Man hat sich ja in langen und mühsamen Arbeiten in den letzten Jahren darauf verständigt, einen aufgabenorientierten, kriterienbasierten, transparenten, objektiven und treffsicheren Finanzausgleich durchzuführen und das nicht mit der Gießkanne zu ma-
chen. In diesen Gesprächen zwischen den Ländern und dem Bund war eigentlich immer außer Streit gestellt, dass die Elementarpädagogik profitieren soll, das heißt die Gemeinden und Städte, die für die Elementarpädagogik zuständig sind. Nun aber liegt etwas vor, das genau das hinausgekippt hat, was man, laut all den damaligen Gesprächen, mit dem Finanzausgleich jetzt haben sollte, nämlich auch einen Chancenindex und dadurch auch Planungssicherheit bei der Elementarpädagogik. Das ist weg. Das ist einfach weg!
Ich meine, das sind drei, vier Jahre intensive Beratungen zwischen Bund und Ländern, in denen man den Chancenindex außer Streit gestellt hat – und das ist weg, ist einfach weg! Und der zuständige Bildungsminister sagt: Das habe ich nicht gewusst. – Das ist ja noch schrecklicher, wenn der dafür zuständige Minister sagt, er hat es nicht gewusst.
Wir haben ja die absurde Situation eines Gefälles bei der Elementarpädagogik von Land zu Stadt – und nicht umgekehrt –, weil natürlich in der Stadt ein viel höherer Aufwand für alle Förderungen, für alle Maßnahmen der Integration notwendig ist als in kleineren Landschulen oder Landkindergärten. (Bundesrat Rösch: Wieso? Wieso ist das so?) Und genau das, was immer außer Streit war, auch in allen Beratungen hier im Haus, basierte auf einer Studie des IHS, in der stand, dass im urbanen Bereich ein extrem höherer Förderbedarf besteht. (Bundesrätin Mühlwerth: Ja, dank eurer Bildungspolitik!) Der aber ist weg, und deshalb werden wir dem nicht zustimmen. (Beifall bei der SPÖ. – Ruf bei der FPÖ: Ah geh!)
Aber selbstverständlich stimmen wir der Verwendung und der Erhöhung von Mitteln aus dem Katastrophenfonds für die Gemeinde Gasen im Umfang von 3,2 Millionen Euro und für das Land Steiermark im Umfang von 2 Millionen Euro zu, damit der Hochwasserschutz dort durchgeführt und errichtet werden kann. Das ist richtig und wichtig. (Beifall des Bundesrates Buchmann.)
Ebenso stimmen wir dem Doppelbesteuerungsabkommen mit dem Vereinigten Königreich zu. Das letzte Doppelbesteuerungsabkommen war, man glaubt es nicht – manche hier sind damals noch gar nicht geboren gewesen –, 1969. Es ist deswegen wichtig, das jetzt zu machen, weil wir ja alle nicht wissen, wie die Brexit-Geschichte ausgehen wird. Laut allen Prognosen wird die Vereinbarung mit der Europäischen Union nicht durchgehen. Auch all die Abgeordneten von Westminster, egal von welcher Seite, mit denen ich in den letzten drei Wochen gesprochen habe, sagen, das geht nicht durch und das wird nicht durchgehen – viele in der Hoffnung auf ein zweites Referendum. Aber das ist Gambeln, Gambeln mit der Zukunft des Landes. Trotzdem müssen wir uns darauf vorbereiten, dass es auch zu einem harten Brexit kommen kann.
Was jetzt mit dieser Anpassung passiert, ist – und deshalb stimmen wir zu –, dass damit vor allem die aktuellen OECD-Standards erreicht werden und – was wichtig ist – dass man auf der Ebene des internationalen Steuerrechts endlich das System der digitalen Betriebsstätten verankert und damit auch die Onlineaktivitäten von internationalen Konzernen als Ort der Wertschöpfung erkennt. Das ist drinnen. Das heißt, das ist vielleicht ein bisschen ein Vorläufer und hoffentlich kommt die Digitalsteuer. (Beifall bei der SPÖ.)
Jetzt haben wir noch zwei heikle Punkte. Das ist zunächst das Tabakmonopolgesetz. Das ist so eine Sache, denn man weiß noch gar nicht, wie denn bei der Monopolverwaltung – es ist ja eine Empfehlung des Rechnungshofes gewesen, aufgrund derer die Regierung hier tätig ist – eigentlich die soziale und gesundheitspolitische wie auch fiskalpolitische Zielsetzung ausschauen soll, und gleichzeitig widerspricht das ja auch der Verwendung der Mittel aus Tabakprodukten. Das ist hier also völlig unklar, und ich lade den Herrn Minister wirklich ein, uns jetzt zu sagen, wieso wir hier etwas beschließen, obwohl wir noch überhaupt nicht wissen, ob die zukünftige Zielsetzung der Tätigkeit
der Monopolverwaltung nicht der Verwendung der Mittel aus Tabakprodukten widerspricht. Das ist nämlich möglich! Wenn man den Rechnungshofbericht dazu liest, zeigt es sich, dass da irgendwie keine Deckungsgleichheit gegeben ist.
Das heißt, man versucht die Umsetzung einer Empfehlung des Rechnungshofberichtes in einer sehr unklaren Art und Weise zu lösen. Für solch unklare Dinge sind wir nicht zu haben, deshalb stimmen wir dagegen. – Danke schön. (Beifall bei der SPÖ.)
15.50
Vizepräsident Ewald Lindinger: Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Robert Seeber. Ich erteile ihm dieses.
Bundesrat Robert Seeber (ÖVP, Oberösterreich): Hohes Präsidium! Verehrter Herr Minister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf bei meinen Ausführungen zu den Punkten 3 bis 7 zusammenfassend quasi die Essenz herauspicken und auch eine kleine Replik auf das, was Herr Schennach gesagt hat, geben. Ich möchte mit den Punkten Tabakmonopolgesetz und Tabaksteuergesetz beginnen und dann überleiten zum Katastrophenfondsgesetz, zum Finanzausgleichsgesetz und zu dem Steuerabkommen mit Großbritannien.
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich stehe heute auch nicht hier, um einen Vortrag über das Rauchen zu halten – das war ja schon bei anderen Gelegenheiten hier Usus –, sondern was ich sagen möchte, ist einfach, dass es Menschen, Personen gibt, die einem Hobby, einer Leidenschaft frönen wollen – das ist eine Tatsache. Wir reden da von mündigen, erwachsenen Bürgern. So hat sich eben mit der Verschärfung des Tabakgesetzes – ich spreche die Raucherproblematik an – einiges getan. Dass das Rauchen ungesund ist, wissen wir alle, und wir alle hier wissen auch, dass fast nirgends mehr stark diesem Hobby gefrönt wird. Da ist also schon eine Entwicklung in der Gesellschaft vorangegangen.
Wir können aber auch feststellen, dass es aufgrund dieser Entwicklung heute schon sehr viele alternative Modelle gibt, um eben einen Ersatz für die herkömmliche Zigarette zu finden, und die Wissenschaft hilft uns da ein bisschen weiter. Es gibt ja diese sogenannten Tabakheizsysteme. Das sind Kunststoffzigaretten – Sie kennen das alle –, und bei diesen wird nichts verbrannt, sondern es wird einfach Hitze erzeugt und es gibt 95 Prozent weniger Schadstoffe. Das heißt, wer diesem Hobby frönen will, schadet sich selbst nicht und auch nicht seinem Nachbarn oder seiner Umwelt; also eine sehr positive Sache.
Es gibt ja diese Dinge bereits im benachbarten Ausland, in Deutschland. Es kommt dadurch zu einem Abfluss von Geld in unser Nachbarland. 45 Länder weltweit haben diese Produkte, mehr als die Hälfte davon sind Länder in der EU. Wenn wir schon in Österreich sind, würde ich schon sagen, der Staat nimmt mit dem Tabak fast 2 Milliarden Euro im Jahr ein, und das Geld sollte schon im Land bleiben. Das wäre meine Meinung, und letztendlich ist das auch für die Wirtschaft und für die Trafikanten eine wichtige Basis.
Meine Damen und Herren! Wir haben, was das betrifft, auch einen illegalen Verkehr aus dem Ausland und wollen diesbezüglich hier in Österreich auch keine tschechischen Verhältnisse. Dort gibt es eine eigene Steuerkategorie, was das Rauchen betrifft. Wir sind da ein bisschen früher dran, und das finde ich einfach richtig. Richtig finde ich auch, dass der Verkauf in den Trafiken erfolgt, denn da sind wir wieder beim Jugendschutz und einfach auch bei der Wertschöpfung für unsere Trafikantinnen und Trafikanten, die es auch nicht ganz leicht haben.
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Katastrophenfondsgesetz wurde von Kollegen Schennach schon angesprochen. Der Anlassfall ist eben diese Tragödie der
letzten zwei Jahre. Es hat in der Steiermark im Ort Gasen vier Hochwässer gegeben, und es gibt hier einen Bedarf an Mitteln in Höhe von 13,5 Millionen Euro, um eine Verbauung zu errichten. Das ist nicht ganz wenig. 3,2 Millionen soll die Gemeinde Gasen selbst stemmen. Wie soll das gehen bei einer Gemeinde, die nicht einmal tausend Einwohner hat? – Daher hat es mich sehr gefreut, dass im Ausschuss Einstimmigkeit dazu geherrscht hat, dieser Gemeinde zu helfen, denn bedenken wir doch: Da geht es nicht nur ums Finanzielle, es geht auch um psychologische Dinge. Wer möchte, ganz ehrlich gesagt, immer in Angst leben, dass etwas passiert? Wenn es zu helfen gilt, würde ich sagen: Bauen wir die Barrieren in den Köpfen ab, egal ob jetzt ein Roter oder ein Schwarzer Landeshauptmann ist, helfen wir den Menschen! – Danke, das wurde gemacht.
Was das Finanzausgleichsgesetz betrifft, ganz kurz auch noch einmal ein Hinweis: Es ist letztendlich eine Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern. Es wird eine gesetzliche Basis, eine Grundlage der Finanzströme vom Bund an die Länder und speziell an die Gemeinden geschaffen. Es geht, Herr Kollege Schennach hat es angeschnitten, um die Elementarpädagogik in den nächsten vier Jahren bis zum Jahr 2022. Wir reden hier von 180 Millionen Euro im Jahr ab dem Jahr 2019; 142 Millionen kommen vom Bund und 38 Millionen von den Ländern.
Ich sage, bei diesem System ist wichtig, dass das Geld zu den Gemeinden kommt. Herr Kollege Schennach, ich muss dich da schon ein bisschen korrigieren: Du hast das Gießkannenprinzip angesprochen. Ich darf an dieser Stelle nur daran erinnern, dass Landeshauptmann Kaiser im rot regierten Kärnten genau das macht: Er teilt an die Eltern Geld nach dem Gießkannenprinzip aus. Das hast du anscheinend vergessen. Das, was ihr immer so sehr kritisiert habt – es gibt dort keinen Kinderbetreuungsplatz mehr, es gibt keine zusätzliche Zeit in Kinderbetreuungseinrichtungen, und jeder Elternteil bekommt mit der Gießkanne Geld ausgeschüttet –, passiert dort. Und dann stellst du dich hier her und sagst, das ist alles Gießkannenprinzip. Bitte zuerst die Hausaufgaben in Kärnten machen! Darum würde ich dich ersuchen. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Für mich ist wichtig, dass die Gemeinden das Geld direkt bekommen, denn wir wollen ja, dass die jungen Familien in den Orten bleiben und es dort zu keinen Parallelgesellschaften oder Abwanderungen kommt. Gerade für den ländlichen Bereich ist das sehr wichtig.
Last, but not least, was dieses Steuerabkommen zwischen Großbritannien und Österreich betrifft: Da geht es ja um nichts anderes als um eine Vermeidung der Doppelbesteuerung beziehungsweise um die Verhinderung der Steuerverkürzung. Es gibt ja seit dem Jahr 1969 ein Gesetz; das ist natürlich obsolet und gehört nachjustiert. Das macht man damit.
Als Wirtschaftler, als der ich hier stehe, sage ich, es geht letztendlich auch um den Standort Österreich. Kollege Schennach hat es gesagt: Keiner von uns weiß – wir lesen ein bisschen Kaffeesud –, was mit dem Brexit passiert. Eines aber ist klar, egal ob es ein harter Brexit oder ein weicher Brexit wird: Wir müssen, wir sollen und wir werden die Wirtschaftsbeziehungen mit Großbritannien aufrechterhalten. Das ist für mich sehr wichtig. Es geht um eine Verbesserung der Streitbeilegung und auch um mehr Rechtssicherheit.
Lieber Herr Minister! Danke für die engagierte Arbeit. Das macht Sinn! Und ich bitte um Unterstützung. – Danke. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
15.57
Vizepräsident Ewald Lindinger: Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Peter Samt. Ich erteile ihm dieses.
15.58
Bundesrat Peter Samt (FPÖ, Steiermark): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuhörer und Zuseher auf der Galerie und via Livestream! Ich werde zu drei Tagesordnungspunkten sprechen, nämlich zum Tabakmonopolgesetz, zum Tabaksteuergesetz und schlussendlich auch zum Doppelbesteuerungsabkommen mit Großbritannien und Nordirland. Kollege Sperl wird sich dann noch mit dem Katastrophenfondsgesetz und mit dem Finanzausgleichsgesetz beschäftigen.
Wenn nach Ansicht des Kollegen Schennach, und in diesem Fall spricht er ja für die SPÖ, jetzt beim Tabakmonopolgesetz Widersprüche auftreten, dann stelle ich einmal grundsätzlich fest: Entweder hat er es nicht ganz durchgelesen, oder es liegt vielleicht auch daran, dass die Gesinnungsgemeinschaft der SPÖ anscheinend grundsätzlich den Weg verfolgt, dafür einzutreten, dass man das Rauchen sowieso abschaffen sollte, was natürlich fiskaltechnisch für Österreich nicht ganz so gut wäre. (Zwischenruf der Bundesrätin Grimling.) – Ja, nicht alle, das wissen wir schon, Frau Kollegin Grimling. Wir wissen ja, es gibt auch bei der SPÖ ein paar Raucher.
Für uns ist es relativ klar, die Aufgaben, Ziele und Befugnisse der Monopolverwaltung GmbH werden mit dieser Änderung des Tabakmonopolgesetzes festgeschrieben.
Die Klarstellung der Zielsetzung der Monopolverwaltung folgt ja, wie Kollege Schennach auch schon gesagt hat, einer Anregung des Rechnungshofes, um strategische Unternehmensziele klarer aus dem Gesetz ableiten zu können. (Zwischenruf des Bundesrates Schennach.) Na ja, das passiert ja jetzt gerade – im Sinne der Gesundheitspolitik. Wir haben ja gerade davon geredet. Wir dürfen aber natürlich auch nicht die Trafikanten vergessen, die ja in Wirklichkeit davon leben. Die Trafikanten haben jetzt durch dieses Gesetz neben dem Recht, Tabakerzeugnisse zu verkaufen, auch die Verpflichtung, zum Beispiel im Jugendschutz aktiv zu werden. (Bundesrat Novak: Dass Leute sterben, ist auch klar!) Daher dienen die Aufgaben der Monopolverwaltung auch zur Verfolgung von gesundheits-, sozial- und fiskalpolitischen Zielen. – Das ist nicht okay? Passt euch das nicht? – Na gut. (Bundesrat Novak: Dass durch Tabakkonsum Leute sterben, ist auch klar!)
Das bedeutet aber im Klartext, dass neben der Bestellung der erforderlichen Anzahl von Trafikanten die Monopolverwaltung jetzt außerdem aufgerufen ist, auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zu achten und Bewerber um Trafiken zu beraten. Was aus meiner Sicht auch wesentlich ist, und ich verfolge das seit vielen, vielen Jahren: Die Vergabe der Trafiken unterliegt natürlich immer noch der sozialpolitischen Gründungsidee, nämlich der Bevorzugung der Kriegsinvaliden, die halt leider immer weniger werden, aber natürlich auch der Menschen mit Behinderungen.
Mit der Änderung des Tabaksteuergesetzes wird darauf reagiert – das haben wir auch gerade gehört –, dass im Laufe der letzten Jahre natürlich technische Innovationen stattgefunden haben; Kollege Seeber hat es gerade erklärt.
Es gibt vor allem diese neue, anscheinend doch sehr bahnbrechende Idee, diese Tabakerhitzungssysteme einzusetzen, das heißt, dass man eine eigene, etwas kürzere Zigarette nicht mehr abbrennt, sondern erhitzt, was de facto 95 Prozent weniger Schadstoffe für den Raucher selber und natürlich auch für sein Umfeld bedeutet. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte, dass man eine sinnvollere, gesündere Variante des Rauchens entwickelt hat, denn wir können uns dem nicht verschließen, dass Konsumenten rauchen wollen und rauchen werden, aber durch solche Entwicklungen eröffnen sich Möglichkeiten, die mit dazu beitragen, dass sie sich nicht selber und das Umfeld gesundheitlich schädigen. Ich glaube, das will keiner der Raucher, die nach wie vor rauchen werden. (Beifall bei der FPÖ und bei BundesrätInnen der ÖVP.)
Über den finanziellen Hintergrund brauchen wir nicht mehr so viel zu reden. Kollege Seeber hat es bereits erwähnt, es ist nicht im Sinne des Staates Österreich, dass er dabei zuschaut, dass Steuern auf Dinge, die in Österreich nicht erhältlich sind, sozusagen ins benachbarte Ausland abwandern. Deswegen ist es natürlich klar, dass wir diese annähernd 2 Milliarden Euro, die auch eine Grundlage für die Budgetkonsolidierung darstellen, bei uns in Österreich halten wollen, aber es geht natürlich auch darum, dass die Trafikanten dadurch eine zusätzliche Einnahmequelle haben, wie der Kollege auch schon gesagt hat, weil das Rauchen an sich wahrscheinlich doch rückläufig sein wird.
Damit ist für uns klar, dass wir diesen zwei Gesetzen, sowohl dem Tabakmonopolgesetz als auch dem Tabaksteuergesetz, natürlich zustimmen.
Zum letzten Punkt, dem Doppelbesteuerungsabkommen, vielleicht noch als Ergänzung: Kollege Schennach, wenn man sich Gesetze, ich denke vor allem an das Gemeinderecht und so weiter, anschaut, dann muss man sagen, ein Abkommen aus 1969, das ist noch nicht so alt. Das hat vielleicht mit uns zu tun, weil wir jetzt auch schon ein gewisses Alter haben, aber wir haben sehr, sehr viele Gesetze, die tatsächlich 30, 40 Jahre alt sind, aber doch regelmäßig novelliert worden sind und damit immer noch am aktuellen Stand sind. Klar ist aber, und das haben wir im Ausschuss sehr deutlich gehört, dass dieses Doppelbesteuerungsabkommen überholt ist, dass es überaltert ist und dass es nicht mehr den neuen Entwicklungen der Finanzgesetzgebung und des internationalen Steuerrechts entspricht.
Der kommende Brexit ist ein Thema, das zu einem guten oder schlechten Ende kommen wird, es wird uns auch weiterhin beschäftigen, aber unabhängig davon haben wir natürlich Sorge zu tragen, dass multinationale Unternehmen Differenzen zwischen dem Steuerrecht der einzelnen Staaten nicht dazu benutzen, um Steuern zu reduzieren oder für ihr Unternehmen überhaupt zu vermeiden. Deswegen wird das hier, auch von unserer Seite her natürlich, wie wir schon im Ausschuss gesehen haben, einstimmig verabschiedet werden. Ich glaube, das sind richtige und wichtige Schritte für die nächste Zukunft, vor allem in der Partnerschaft mit Großbritannien. (Bundesrat Schennach: Was habe ich anderes gesagt?) Völlige Zustimmung, ja; ich habe mich nicht beschwert, Herr Kollege Schennach, ich habe mich nicht beschwert. Das Tabakgesetz war für Sie unklar. (Bundesrat Schennach: Das ist okay!) Das ist in Ordnung. – Danke schön. (Beifall bei FPÖ und ÖVP.)
16.05
Vizepräsident Ewald Lindinger: Zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Elisabeth Mattersberger. Ich erteile dieses.
Bundesrätin Elisabeth Mattersberger (ÖVP, Tirol): Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzter Herr Bundesminister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Werte ZuseherInnen auf der Galerie und zu Hause via Livestream! Ich darf zu den Bundesgesetzänderungen, die unter einem verhandelt werden, wie folgt Stellung nehmen:
Als Erstes zur Novelle des Katastrophenfondsgesetzes: Mit dieser ist gesichert, dass die steirische Gemeinde Gasen finanzielle Mittel aus dem Katastrophenfonds erhalten wird. Die Gemeinde Gasen wurde allein in den letzten zwei Jahren von vier Hochwasserkatastrophen heimgesucht, wodurch ihr ein enormer finanzieller Schaden entstanden ist. Die bestehenden Schutzmaßnahmen reichen nicht aus, müssen neu dimensioniert und selbstverständlich auch finanziert werden. Deshalb ist dieser zu fassende Beschluss besonders wichtig und positiv zu bewerten.
Als Zweites möchte ich zum Beschluss betreffend das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Großbritannien und der Republik Österreich Stellung nehmen: Im Jahre 1969 wurde bereits ein Abkommen abgeschlossen, dieses Doppelbesteuerungsabkommen
entspricht aber nicht mehr den Standards im internationalen Steuerrecht. Vorrangige Ziele dieses Abkommens – und das sind sehr wichtige – sollen sein, dass die Auswirkungen im Hinblick auf den Brexit abgefedert werden, der Standort Österreich wirtschaftlich gestärkt wird und die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Österreich und Großbritannien intensiviert werden.
Als Drittes und Letztes noch ein paar Ausführungen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Finanzausgleichsgesetz 2017 geändert werden soll. Es geht um die Bund-Länder-Vereinbarung, sprich die gesetzliche Grundlage für die finanziellen Leistungen an die Länder, an die Gemeinden für Elementarpädagogik in den nächsten vier Jahren, also bis 2022. Wir sprechen hier von jährlich etwa 180 Millionen Euro, 38 Millionen Euro davon kommen von den Ländern und etwa 142 Millionen Euro vom Bund.
Mit dieser Artikel-15a-Vereinbarung wird die Finanzierung für den Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen, die sprachliche Frühförderung, die Verbesserung der Öffnungszeiten sowie die Bereitstellung eines bedarfsgerechten ganzjährigen ganztägigen Betreuungsangebotes bis zum Jahr 2022 sichergestellt. Damit wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert und ausgebaut und werden unsere Kinder, was besonders hervorzuheben ist, gefördert und unterstützt. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
16.08
Vizepräsident Ewald Lindinger: Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Gottfried Sperl. Ich erteile dieses.
Bundesrat Gottfried Sperl (FPÖ, Steiermark): Geschätzter Herr Präsident! Herr Bundesminister! Geschätzte Damen und Herren auf der Zuschauergalerie und via Livestream! Kolleginnen und Kollegen! Ich beziehe mich, wie schon angekündigt, auf den Bereich der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 2017. Es ist erfreulich, dass mit dieser Änderung des Finanzausgleichsgesetzes die gesetzliche Grundlage für die Zweckzuschüsse für die Elementarpädagogik der nächsten Kindergartenjahre auf Basis dieser 15a-Vereinbarung geschaffen wird.
Die Zweckzuschüsse dienen in erster Linie dem Ausbau der Kinderbildungs- und –betreuungsangebote, der sprachlichen Frühförderung und der Sicherstellung des beitragsfreien Besuchs von elementaren Bildungseinrichtungen. Mit dem Geld von etwa einer halben Milliarde Euro bis zum Jahr 2022 ist dieser Ausbau gesichert. Ich bin nicht der Meinung, dass das nur für den städtischen Bereich wesentlich ist, sondern ganz besonders auch für den ländlichen Bereich, aus dem ich komme. Wir haben im heurigen Jahr wieder einen Kindergarten eröffnet, worauf die Anmeldungszahlen gestiegen sind, mehr Kinder gekommen sind. Das hat zu einer eigenen Dynamik geführt – und damit zu einer Verbesserung für die Familien und deren Kinder. Das heißt also, diese Maßnahme hat sehr wohl auch am Land draußen eine gute Wirkung.
Ein Wort zur Aufhebung des § 15 betreffend Aufgabenorientierung: Wenn es in den Verhandlungen nicht möglich ist, eine Lösung zu finden, ja, dann muss man die Konsequenzen ziehen und diesen Passus streichen, denn ein Gesetz, das man nicht vollziehen kann, bringt nichts. Diese Streichung ist ja nicht eigenmächtig durch die Regierung erfolgt, sondern in Abstimmung mit den Ländern sowie dem Österreichischen Gemeindebund und dem Österreichischen Städtebund; es war also eine einvernehmliche Lösung.
Abschließend noch zur Änderung des Katastrophenfondsgesetzes, mit der Mittel für die Gemeinde Gasen freigegeben werden: Da sind wir uns alle einig. Was mich besonders freut, ist, dass nicht nur die Finanzierung des Anteils der Gemeinde, sondern bis zu einer Höhe von 2 Millionen Euro auch jene des Anteils des Landes übernommen
wird, damit nicht andere Gemeinden nachteilig betroffen sind, weil das Land für die Gemeinde Gasen mehr Geld aufbringen muss. Es ist wirklich sehr notwendig, vorbeugend im Katastrophenschutz tätig zu sein. Ich lebe selber in einem Bezirk, der in den letzten Jahren stark von solchen Katastrophen betroffen war; ich erwähne Niederwölz, Oberwölz, Sölkpass, Schöder.
Wenn man mit den Mitarbeitern oder den Chefs von der Wildbach- und Lawinenverbauung spricht, dann sagen sie, wir kommen mit dem Vorbeugen nicht nach, weil wir immer hintennach arbeiten müssen. Diese Mittel für den vorbeugenden Katastrophenschutz sind eine ganz wesentliche Sache; in meiner Gemeinde harren auch noch drei diesbezügliche Projekte der Umsetzung.
Mein Dank geht an die Mitarbeiter der Wildbach- und Lawinenverbauung, die alles daransetzen, um uns vor solchen Katastrophen zu bewahren. (Beifall bei FPÖ und ÖVP.)
16.12
Vizepräsident Ewald Lindinger: Zu einer abschließenden Stellungnahme hat sich der Herr Bundesminister zu Wort gemeldet. Ich erteile ihm das Wort.
Bundesminister für Finanzen Hartwig Löger: Herr Präsident! Liebe Mitglieder des Bundesrates! Liebe Zuseherinnen und Zuseher im Hause und auch zu Hause vor den Bildschirmen! Die Dynamik der heutigen Diskussion gibt noch die Chance, einen Zeitrahmen zu nutzen, aber keine Sorge, ich werde ihn nicht zur Gänze ausnutzen, sondern versuchen, in der Diskussion der letzten mein Ressort betreffenden Tagesordnungspunkte vielleicht das eine oder andere zusammenfassend noch zu ergänzen.
Zum Ersten, Finanzausgleichsgesetz: Ich mache kein Hehl daraus, dass ich auch nicht erfreut war, als die Länder und die Gemeinden kundgetan haben, dass sie keine Chance sehen, zu einer Einigung zu kommen, was die Aufgabenorientierung betrifft. Ich verspreche auch hier, dieses Thema spätestens im Rahmen der kommenden Finanzausgleichsgespräche auf jeden Fall auf den Tisch zu bringen. Das war eine positive Absicht, der erste Anlauf ist im Sinne der Pilotierung nicht gelungen, aber ich glaube, es ist von der Grundidee her durchaus ein passender Zugang. Möglicherweise war das Thema, bei dem wir diesen ersten Schritt versucht haben, nicht das absolut passende oder beste, aber ich denke, von der Grundidee her kann man dem durchaus folgen. Da müssen wir auf Bundesebene halt auch zur Kenntnis nehmen, auch hier jetzt in der Diskussion im Bundesrat, dass es da einen unterschiedlichen Zugang gibt.
Auf der anderen Seite die 15a-Vereinbarung im Sinne der Gewährung von Zweckzuschüssen: Ich glaube, wir können uns alle freuen, dass es gelungen ist, in nicht einfachen Verhandlungen, aber dann doch, ein gemeinsames Ergebnis mit den Ländern zu erzielen, sodass wir in der Lage sind, für die nächsten beiden Perioden einen höheren Zuschuss für die Elementarpädagogik sicherzustellen, wodurch sich eine bessere Grundlage für dieses Element im Bereich der Bildung ergibt. Genauso wie Bundesrat Schennach es angesprochen hat, ist es ein wichtiges Element, ein wichtiges Thema, und ich glaube, da brauchen wir gar nicht die Diskussion in puncto Regionalität zu führen. Ich glaube, es ist für ganz Österreich wichtig, dass wir in die Zukunft unserer nächsten Generationen investieren und Sorge dafür tragen, die notwendigen Mittel aufzubringen.
Zur Diskussion über Tabak, Tabakmonopol, Heat-not-Burn: Ich gestehe, als Nichtraucher tue ich mir in Diskussionen über das Rauchen immer schwer, aber ich bin durchaus bereit, das, was von Bundesrat Seeber angesprochen wurde, mitzunehmen. Ich glaube, wir sollten auch als Österreicherinnen und Österreicher bereit sein, zu akzeptieren, dass es Menschen gibt, die dem frönen. Ich bin auch froh darüber, dass es jetzt einen gesetzlichen Rahmen für eine Technologie, die für uns alle einen Mehrwert hat,
gibt, dass das jetzt in Österreich zumindest sinnhaft und gesetzlich gut geregelt ist. Über das Grundthema, glaube ich, brauchen wir im Rahmen des Finanzbereichs nicht zu diskutieren.
Was mich zusammenfassend bei den großen, wichtigen Themen besonders freut – jetzt lasse ich den Brexit beiseite; das Doppelbesteuerungsabkommen ist eine Grundlage, die wir gemeinsam nutzen sollten –: Ich glaube, das, was uns eint, und das ist ja das Erfreuliche, hoffe ich, auch für die Österreicherinnen und Österreicher, ist, dass wir auf Bundesebene, auch im Bundesrat, in der Lage sind, dort Unterstützung zu leisten, wo es notwendig ist. Österreich wurde in den letzten Jahren immer häufiger von Katastrophen getroffen, und die Gemeinde Gasen, um die es hier geht und für die wir hier eine Entscheidung erbitten, ist besonders exponiert und in besonderer Form betroffen. Ich glaube, das ist ein positives Signal für alle im Lande, dass wir gemeinsam dafür einstehen, wenn es notwendig ist, Beschlüsse für diese Hilfestellungen zu fassen. Auch dafür der Dank meinerseits, wenn wir das auf breiter Basis hier beschließen können.
Ich nutze die Gelegenheit – ich gestehe, ich habe nicht die Erfahrung, um zu wissen, ob das überhaupt angebracht ist; der Herr Präsident wird mir möglicherweise jetzt das Wort entziehen –, ich nutze die Chance, mich bei Ihnen allen für das erste Jahr, das ich als Regierungsmitglied hier verbringen durfte, zu bedanken. Ich erlebe die Diskussionen im Bundesrat in einer sehr konstruktiven und sehr qualitativen Form. Ich bedanke mich dafür. Nebst allen Differenzen, die inhaltlich gegeben sind, die ja in einer Demokratie im Positiven dazugehören, gelingt es hier, die Materien in einer sehr qualitativen Art und Weise zu diskutieren.
Ich freue mich, dass Sie bei Anträgen, die wir vonseiten der Regierung einbringen, Unterstützung geben, wenn es auch nicht immer einstimmig sein kann.
Ich wünsche Ihnen allen auch schon schöne Feiertage, wenn es erlaubt ist, in der Hoffnung, dass Sie mich nicht noch zusätzlich möglicherweise morgen oder wann auch immer einberufen werden. (Allgemeine Heiterkeit.) Sollte das sein, komme ich gerne wieder, aber, wie gesagt, sollte es nicht der Fall sein, dann wünsche ich Ihnen schon schöne Feiertage und freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit auch im nächsten Jahr, in dem ich Ihnen gerne wieder Rede und Antwort stehen werde. – Vielen Dank. (Allgemeiner Beifall.)
16.17
Vizepräsident Ewald Lindinger: Ich bedanke mich auch bei Ihnen, Herr Bundesminister, und darf feststellen, es ist auch Ihrerseits immer eine sehr angenehme Debatte, die Sie mit uns führen, danke! Ich wünsche Ihnen auch alles Gute, schöne Feiertage, und bis nächstes Jahr!
Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Es ist dies nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Die Abstimmung erfolgt getrennt.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Tabakmonopolgesetz geändert wird.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Tabaksteuergesetz geändert wird.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Katastrophenfondsgesetz 1996 geändert wird.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit angenommen.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Finanzausgleichsgesetz 2017 geändert wird.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend ein Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und von Veräußerungsgewinnen samt Protokoll.
Da der vorliegende Beschluss Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbereiches der Länder regelt, bedarf er der Zustimmung gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz.
Wir gelangen zunächst zur Abstimmung darüber, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist somit angenommen.
Nunmehr lasse ich über den Antrag abstimmen, dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit angenommen.
Ich begrüße in unserer Mitte Frau Staatssekretärin Edtstadler in Vertretung des Bundesministers. (Beifall bei ÖVP, SPÖ und FPÖ.)
Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Symbole-Gesetz geändert wird (377 d.B. und 419 d.B. sowie 10094/BR d.B.)
Vizepräsident Ewald Lindinger: Wir gelangen nun zum 8. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatter ist Herr Bundesrat Gottfried Sperl. Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatter Gottfried Sperl: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Sehr geehrte Frau Staatssekretärin! Kolleginnen und Kollegen! Ich bringe den Bericht des Ausschusses für innere Angelegenheiten über den Beschluss
des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Symbole-Gesetz geändert wird.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor. Ich komme daher gleich zur Antragstellung.
Der Ausschuss für innere Angelegenheiten stellt nach Beratung der Vorlage am 18. Dezember 2018 mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsident Ewald Lindinger: Danke für den Bericht.
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Martin Weber. Ich erteile dieses.
Bundesrat Martin Weber (SPÖ, Steiermark): Werter Herr Präsident! Frau Staatssekretärin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Eingangs möchte ich mich für die vorangegangene einhellige Zustimmung was das Katastrophenfondsgesetz und die steirische Gemeinde Gasen betrifft bedanken.
Nun aber zum Symbole-Gesetz: Alljährlich findet im kärntnerischen Bleiburg das sogenannte Ustascha-Treffen statt. Da treffen sich alljährlich ungefähr 10 000 bis 30 000 Teilnehmer, um dem kroatischen NDH-Staat zu huldigen. Diesen zumindest offiziell, formal unabhängigen Staat Kroatien mit dieser Bezeichnung gab es von 1941 bis 1945, de facto aber als Protektorat des Deutschen Reiches und des italienischen Reiches mit dem politischen, wirtschaftlichen und militärisch gestützten Regime, dessen Diktator Ante Pavelić war.
Dieser Staat führte in Anlehnung an Hitlerdeutschland ebenfalls Rassengesetze ein. Nach diesen wurden Hunderttausende Juden, Roma und vor allem Serben verfolgt, eingesperrt und ermordet. Das KZ Jasenovac war das größte Konzentrationslager in diesem Teil Europas.
Als Veranstalter dieses Treffens tritt der Bleiburger Ehrenzug auf, dem vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands klar eine geschichtsverfälschende Tendenz zur Umdeutung dieser Verbrechen zugeschrieben wird. Im ORF-„Report“ zu diesem Ustascha-Treffen im Jahr 2017 hat ein Teilnehmer bei einem Interview ganz klar Hitler verherrlicht und das Naziregime entsprechend bejubelt.
Der kärntnerische Landeshauptmann Peter Kaiser hatte mehrmals sein Missfallen, seinen Unmut über dieses Treffen der Ewiggestrigen kundgetan und auch den Innenminister zum raschen und entschlossenen Handeln aufgefordert, denn diese Veranstaltungen sind als kirchliche Veranstaltungen mit Prozession angemeldet worden und nicht als Veranstaltung nach dem Veranstaltungsgesetz oder als Kundgebung nach dem Versammlungsgesetz, was beides auf diese Veranstaltungen zutreffend würde.
Es gibt deswegen viele Punkte, von denen die Veranstalter profitieren. So können zum Beispiel Sprüche und Parolen auf Transparenten ungehindert transportiert werden, so können Ustascha-Symbole ungehindert getragen werden, so werden lautstark Ustascha-Lieder gesungen, und der in Kroatien verbotene Ustascha-Gruß wird immer wieder vor Ort gezeigt. Das alles kann eben unter dem Schutz dieser kirchlichen Veranstaltung stattfinden.
Das macht auch deutlich, dass wir dringend Maßnahmen brauchen, um dieser Lage endlich Herr zu werden, um direkt gegen diese Symbole eingreifen und gegen das Präsentieren und Tragen dieser Symbole vorgehen zu können. Das Abzeichengesetz von 1960 stellt das Tragen und Zurschaustellen von Abzeichen, Uniformen und Uniform-
teilen der in Österreich durch das Verbotsgesetz verbotenen Organisationen quasi unter Strafe und verbietet diese auch.
Unser Antrag zum Abzeichengesetz soll das um ausländische Organisationen, die mit diesen verbotenen Organisationen organisatorisch und inhaltlich zusammengearbeitet haben, erweitern und Uniformen, Abzeichen und dergleichen dieser Organisationen mit umfassen. Das würde zum einen bedeuten, dass wir konkrete Maßnahmen und Handhabe hätten, um unter anderem gegen die Ustascha vorzugehen. Das umschließt aber in dem Fall zum Beispiel auch die ungarischen Pfeilkreuzler, die spanischen Franco-Faschisten oder die italienischen Mussolini-Faschisten. (Bundesrat Schuster: Stalinisten sind kein Problem in Österreich ...!)
Zum Symbole-Gesetz: Wir begrüßen prinzipiell, dass auch die Ustascha im Symbole-Gesetz erwähnt ist. Wir finden es daher auch gut und richtig, dass man Maßnahmen ergreifen will, um gegen diese Organisationen und gegen diese Gruppierungen, wie gegen die Grauen Wölfe oder die Muslimbruderschaft, vorzugehen. – Damit das ganz klar und deutlich gesagt ist! (Bundesrat Rösch: Ein Al-Rawi in der Wiener SPÖ ...!)
Allerdings – und das zeigen ja auch die Stellungnahmen, die zu diesem Gesetz eingelangt sind – ist es für uns nicht erklärlich, wie die Auflistung dieser Organisationen, um die jetzt das Symbole-Gesetz erweitert werden soll, zustande gekommen ist. (Zwischenrufe bei der FPÖ.) Auch im Innenausschuss am vergangenen Dienstag konnte dies leider nicht zufriedenstellend beantwortet werden. Sie erscheint uns einfach willkürlich zusammengestellt. Man kann nicht feststellen, wo welche Grenzen gezogen worden sind.
Uns gehen auch konkrete Organisationen dabei ab. Was ist mit den rechtsextremen Identitären? Was ist mit den Staatsverweigerern? Was ist mit der Partei des Volkes? Warum finden sich zum Beispiel diese Organisationen nicht auf dieser Liste? Ist der Herr Innenminister gar auf einem Auge blind, zufällig auf dem rechten Auge? (Bundesrätin Mühlwerth: Wieso sind da die Stalinisten nicht drauf? Die Leninisten? Das kann man ewig verlängern!)
Was wir auch noch nicht einschätzen können, weil uns diese Auflistung offenbar auch noch nicht vorliegt, ist, um welche Symbole es denn wirklich konkret geht. Welche Symbole und welche Gesten sollen konkret aufgelistet werden? (Bundesrat Schuster: Steht genau drin im Gesetz!) Zu bedenken ist auch, dass, sobald diese Organisationen ihre Symbole ändern, dieses Gesetz oder die Verordnung zu diesem Gesetz auch ständig erweitert oder abgeändert werden muss.
Das Symbole-Gesetz wurde 2015 beschlossen, um gegen den Islamischen Staat und gegen die Al Kaida vorzugehen. Wir haben auch gefragt, ob es schon eine Evaluierung gibt, und man hat uns gesagt, dass dieses Gesetz entsprechend wirksam ist. Sie haben gesagt, diese Evaluierung wird erst nach fünf Jahren, also im Jahr 2020, stattfinden.
Ich habe schon ein bisschen die Befürchtung, es könnte sich um ein rein symbolhaftes Symbole-Gesetz handeln, weil die Umsetzung und Exekution wahrscheinlich doch ein wenig schwierig ist. Auch das haben wir unterschiedlichen Stellungnahmen zu diesem Gesetz entnommen.
All diese Gründe, vor allem die Willkürlichkeit dieser Auflistung, bringen uns dazu, dass wir heute diesem Symbole-Gesetz nicht zustimmen werden, weil wir eben die Willkürlichkeit in dieser Auflistung erkennen. Ob es letztlich wirkt, werden wir in Zukunft sehen, spätestens im nächsten Mai, denn dann wird sich nämlich zeigen, ob das Ustascha-Treffen in dieser Form, wie es stattgefunden hat, auch 2019 stattfinden wird und
ob das Symbole-Gesetz als konkrete Maßnahme auch tatsächlich wirkt. – In diesem Sinn ein herzliches Danke. (Beifall bei der SPÖ.)
16.31
Vizepräsident Ewald Lindinger: Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Georg Schuster. Ich erteile dieses.
Bundesrat Georg Schuster (FPÖ, Wien): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Staatssekretärin! Sehr geehrte Damen und Herren im Bundesrat, auf der Galerie und via Livestream! Kollege Weber hat es richtig erwähnt: Das Symbole-Gesetz wurde 2015 beschlossen, um gegen den Islamischen Staat, Al Kaida und deren Untergruppen vorzugehen. Ich glaube, wir sind uns auch alle einig – hoffentlich! –, dass es uns ein ganz großes Anliegen ist, Terrorismus, terroristische Straftaten und Aufrufe zu Gewalt zu verhindern.
Besonders schade ist es aber, dass sich die Opposition leider nicht dazu durchringen kann, dieses wichtige Gesetz, diese notwendige Maßnahme mit zu beschließen. Denn mit dieser dringend notwendigen Gesetzesänderung bekommen wir nun endlich ein Instrument in die Hand, um gegen solche Formen der Propaganda und Agitation strafend vorgehen zu können. Es war nämlich bisher leider auch so, dass wir bei vielen Fällen tatenlos zusehen mussten und auch nicht einschreiten konnten. Ich nenne hier ein Beispiel aus der Tageszeitung „Österreich“: „Syrer schwenkt Hisbollah-Flagge am Flughafen“.
Meine Damen und Herren, es sind nicht die ungarischen Pfeilkreuzler, die spanischen Franco-Faschisten oder die italienischen Mussolini-Faschisten, die hier in Österreich aktuell unseren Rechtsstaat bedrohen. Denn es ist schon ein Unterschied: Wir gehen nämlich auf die Bedrohungen ein, welche uns im Hier und Jetzt auf unserem Territorium betreffen! Deshalb ist diese Liste so, wie sie ist, meine Damen und Herren. (Beifall bei FPÖ und ÖVP.)
Deshalb ist auch – ich kann Ihnen gleich sagen, was auf der Liste steht, weil Sie es nicht haben herauslesen können – die sunnitisch-islamistische Muslimbruderschaft auf der Liste, deshalb sind auch die türkisch-nationalistischen Grauen Wölfe auf der Liste, deshalb sind auch die palästinensisch-islamistische Hamas, die separatistisch-marxistische kurdische Arbeiterpartei, der militärische Teil der Hisbollah und auch die Ustascha auf der Liste – lieber Herr Kollege, weil Sie sich nämlich vorhin hierhergestellt und gesagt haben: Man tut nichts gegen die Ustascha.
All diese Gruppierungen richten sich nämlich gegen unsere Grund- und Freiheitsrechte, gegen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. (Zwischenruf des Bundesrates Weber.) Dem muss ein Riegel vorgeschoben werden, meine Damen und Herren!
Weil die Ustascha angesprochen worden ist: Was haben denn die Sozialisten in Kärnten eigentlich in den letzten Jahren gegen das Ustascha-Treffen gemacht? – Ich darf schon daran erinnern, dass der Kärntner Landeshauptmann seit 2013 im Amt ist und nicht erst seit 2017, wo er sich einmal beim Herrn Minister beklagt hat. Mir ist auch keine entsprechende Vorgangsweise von Ihrem Landeshauptmann bekannt, dass er in Kärnten dem Treiben ein Ende gesetzt hätte. Irgendwelche Aktionen? – Nichts hat er gemacht, meine Damen und Herren! (Zwischenrufe bei der SPÖ.) Deshalb freut es mich umso mehr, dass die Bundesregierung jetzt endlich einmal eine juristische Handhabe gegen solche Aktivitäten haben wird. (Zwischenruf des Bundesrates Stögmüller.)
Ein Wort noch zu den Identitären, meine Damen und Herren (Zwischenrufe bei der SPÖ): Ich weiß, Sie sind ganz aufgeregt, denn das ist ganz schlimm und mühsam (Bundesrat Stögmüller: Erzählen Sie nicht die Unwahrheit!) – ich erzähle keine Un-
wahrheit, keine Sorge –, Sie verwechseln nämlich jetzt wieder einmal Birnen mit Äpfeln, denn Rechtsextremismus ist ja primär ein Fall für das Verbotsgesetz.
Das griechische Lambdazeichen ist ja wirklich kein eindeutiges Zeichen, das nur den Identitären zugeschrieben werden kann. Wenn Sie das griechische Lambdazeichen zur Liste hinzufügen würden, dann würden Sie nämlich auch ganz, ganz viele Homosexuellenvereine verbieten, weil auch sie dieses Zeichen verwenden, meine Damen und Herren. Ist das wirklich Ihre Intention, dass Sie auch diese Vereine verbieten wollen? – Das glaube ich wohl nicht; gerade die SPÖ nicht. (Bundesrat Weber: Und was ist mit den Staatsverweigerern? – Weitere Zwischenrufe bei der SPÖ.)
Wenn es nämlich nach Ihnen ginge – das Gefühl habe ich so ein bisschen –, dann würden Sie wirklich Vereine und Gruppierungen, nur weil sie Ihrem Weltbild nicht entsprechen, einfach verbieten. Das wäre dann wohl das Ende der Meinungsfreiheit, meine Damen und Herren! (Bundesrat Stögmüller: Die Identitären ...!)
Wenn wir schon dabei sind: Entschuldigen Sie sich lieber einmal für Ihren Stadtrat Hacker in Wien, der in den letzten Tagen ganz übel mit braunen Rülpsern aufgefallen ist, meine Damen und Herren! (Zwischenruf des Bundesrates Stögmüller.) Die Mindestsicherung mit dem Ariernachweis zu vergleichen, das ist ja wirklich letztklassig, meine Damen und Herren! Unglaublich ist das! (Beifall bei FPÖ und ÖVP.)
Meine Damen und Herren, ich bin der festen Überzeugung, dass das Symbole-Gesetz ein gutes und wichtiges Gesetz ist. Wenn es Nachbesserungsbedarf geben sollte, wird das auch mittels Verordnung möglich sein. Das steht ganz eindeutig in dem Gesetz, und wir werden das dann auch auf jeden Fall kundmachen, wenn das so ist. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. (Beifall bei FPÖ und ÖVP.)
16.36
Vizepräsident Ewald Lindinger: Zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Mag.a Dr.in Ewa Dziedzic. Ich erteile ihr dieses.
Bundesrätin Mag. Dr. Ewa Dziedzic (Grüne, Wien): Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Staatssekretärin! Werte Kollegen und Kolleginnen! Zwölf Monate Türkis-Blau: Es tut mir fast leid, dass ich hier nicht auf alle Details eingehen kann, sondern nur die Kurzfassung überbleibt, nämlich dass die ÖVP Politik für die Konzerne und ihre Klientel macht und die FPÖ Symbolpolitik auf allen Ebenen. Dieses Symbole-Gesetz ist sehr symbolisch dafür, wie Sie Politik machen und wie Sie Ihre Politik auch argumentieren.
Wir werden diesem Gesetz nicht zustimmen, und ich kann Ihnen auch gut erklären, wieso. In aller Kürze: Der Kollege hat es schon gesagt, die Auflistung ist vollkommen willkürlich. Und weiters: Sie ist auch eine Gefahr. Sie ist eine Gefahr für die Meinungsfreiheit, und zwar dann, wenn es eine willkürliche Auslegung dieses Gesetzes gibt.
Starke Demokratien – da werden Sie mir recht geben – sind, was die Meinungsfreiheit anbelangt, sehr weit gefasst in dem, was sie zulassen und was sie verbieten. Weniger gefestigte Demokratien haben mit Meinungsdelikten – wie mit dem beispielsweise in Österreich, auch das wurde schon erwähnt, 1947 beschlossenen Verbotsgesetz und dem damit in Zusammenhang stehenden Abzeichengesetz von 1960 – versucht, Abhilfe zu schaffen.
2015 – auch das war schon Thema – kam das Symbole-Gesetz hinzu, das wiederum Symbole der terroristischen, dschihadistischen Organisationen Islamischer Staat und Al Kaida unter Strafe stellte. Schon damals gab es Diskussionen darüber, ob das nicht einen Tabubruch darstellt und ob das nicht Tür und Tor dafür öffnet, dass es eben in Folge weitere willkürliche Verbote gibt.
Man könnte jedoch bei dem Gesetz von 2015 argumentieren, dass es sich bei den beiden um aktive Terrororganisationen handelt, die auch für Europa insofern wichtig sind, als dass es Anschläge seitens dieser in Europa gibt und sie natürlich auch eine Sicherheitsbedrohung für uns alle darstellen. Dagegen ist das jetzige Symbole-Gesetz deshalb willkürlich, weil es diese Sicherheitsbedrohung so, wie Sie sie herbeizitieren, hier in Österreich nicht gibt. (Zwischenrufe bei der FPÖ.)
Wie gesagt, es fehlt auch jegliche inhaltliche Begründung. Vollständig ist es auch nicht. Ich kann nur wiederholen: Deutschnationale rechtsextreme Symbole fehlen genauso wie die Symbole der Identitären – das finde ich ja fast schon amüsant, dass Sie sie mit dem Symbol der Homosexuellenvereinigungen vergleichen –, der Reichsbürger, aber natürlich auch jene serbischer oder russischer Rechtsextremer – die auch ihre Symbole haben, von denen wir aber wissen, dass die FPÖ gute Verbindungen zu ihnen pflegt. Die wurden allesamt ausgespart.
Ich kann es nur wiederholen: Die FPÖ macht nicht nur Symbolpolitik, sondern auch Symbolgesetze.
Wir haben schon gehört, wen das betrifft: Die Muslimbruderschaft, die Grauen Wölfe – auch da waren wir Grüne immer sehr aktiv im Hinweisen darauf, wie wichtig es ist, den Grauen Wölfen in Österreich Einhalt zu gebieten –, die kroatische Ustascha, die libanesische Hisbollah, die Hamas, aber auch die Arbeiterpartei Kurdistans PKK, wobei Sie mir auch recht geben werden, dass, wenn es um die Bekämpfung des IS ging, die PKK nicht gegen uns alle gearbeitet hat, sondern womöglich auch noch als Verbündete gelten könnte.
Explizit eingeschlossen wurden in den Gesetzestext – und das ist auch sehr symbolträchtig – Handgesten. Sie wissen, das beispielsweise bei der PKK verbreitete Victoryzeichen kann natürlich sehr schnell irgendwo auftauchen, und ich habe wirklich Angst davor, wie Sie da klare Kriterien aufstellen werden, wann dieses Verbot tatsächlich exekutiert werden wird und in welchem Ausmaß.
Ich halte es grundsätzlich für naiv, wenn man glaubt, mit diesen Symbolverboten tatsächlich ein wirksames Mittel gegen Ethnonationalismen oder irgendwelche Formen des politischen Islam gefunden zu haben. Keine – ich wiederhole: keine – dieser genannten Gruppen stellt, zumindest aktuell und konkret, eine Bedrohung für die Sicherheit in Österreich dar. (Zwischenrufe bei der FPÖ.)
Innenminister Kickl (Zwischenruf der Bundesrätin Mühlwerth) – Sie waren schon am Wort – sieht das natürlich vollkommen anders. Er hat in der Nationalratssitzung hervorgehoben, dass die Liste von Extremismusexperten und -expertinnen des Verfassungsschutzes ausgearbeitet worden ist. Ich darf Sie an die BVT-Affäre erinnern und auch daran, dass es grobe Vorwürfe gegen die bisherige Rechtsextremismusreferentin gegeben hat. (Zwischenruf des Bundesrates Schuster.) Ich denke, man muss auch genauer hinschauen, wer sich tatsächlich an der Ausarbeitung dieser Liste beteiligt hat. – Das ist das eine.
Er hat auch gemeint, dass genau jene Organisationen, die das Symbole-Gesetz jetzt umfasst, eine reale, konkrete Sicherheitsbedrohung für Österreich darstellen. – Da freue ich mich über konkrete Beispiele.
Wenn man genauer hinschaut, wird offensichtlich, dass Sie zumindest nicht genau gearbeitet haben, da doch beispielsweise die Symbolik der ägyptischen Muslimbruderschaft, die in Österreich überhaupt keine Rolle spielt, verboten wird (Zwischenruf des Bundesrates Schuster), während beispielsweise die bekannte türkische Millî Görüş, die uns in Österreich immer wieder beschäftigt hat, überhaupt nicht davon erfasst wird. So viel zur Vollständigkeit und auch dem Ernstnehmen Ihrer Symbolpolitik.
Jedenfalls denke ich, dass diese verschiedenen Richtungen, die bewusst in diese Liste aufgenommen worden sind, auch dazu gedient haben, um einem gewissen Widerstand gegen dieses Gesetz den Wind aus den Segeln zu nehmen, weil – ich nenne das Wort sehr bewusst – ich denke, dass dieses Gesetz ein Versuchsballon ist. Es ist deshalb ein Versuchsballon – und Innenminister Kickl hat das schon angedeutet –, weil es in Zukunft auch weitreichender ausgelegt werden kann, und zwar auch noch willkürlicher.
Einen autoritären Staat zu konstruieren, gelingt dann, wenn man möglichst viel rundherum verbietet. Zu relativieren, was bisher verboten ist, gelingt dann, wenn man nämlich andere Richtungen auch noch mitaufnimmt. (Zwischenrufe bei der FPÖ.) – Ja, ich weiß, das ist ein bisschen differenzierter und deswegen für Sie nicht so leicht nachzuvollziehen. (Beifall bei der SPÖ sowie des Bundesrates Stögmüller.)
Ich fasse das nochmals zusammen: Tatsächlich geht es darum, dass das bestehende Verbot nationalsozialistischer Symbole insofern relativiert wird, als dass immer mehr andere Symbole hinzukommen. Ich vermute, dass Sie damit nicht nur relativieren wollen, sondern dass Sie genau dieses Verbotsgesetz auch noch ins Lächerliche ziehen möchten. (Bundesrat Steiner: Und das sagt die Frau vom ...! – Weitere Zwischenrufe bei der FPÖ.)
Vielleicht haben sich einige von Ihnen die Mühe gemacht, tatsächlich die eingelangten Stellungnahmen zu lesen. Eine ist für mich schon einer Beachtung wert, und zwar jene der Kinder- und Jugendanwaltschaft Österreichs. Sie wissen, die waren Gründungsmitglied des Bundesweiten Netzwerks Extremismusprävention und Deradikalisierung. Am 23. Oktober 2018 wurde beim Präventionsgipfel die diesbezügliche österreichische Strategie vorgestellt. Auch die Kinder- und Jugendanwaltschaft Österreichs warnt vor diesem Gesetz.
Die Kinder- und Jugendanwaltschaft beschäftigt sich nicht nur mit Prävention und Deradikalisierung, sondern weist explizit darauf hin, dass genau solche symbolischen Verbotsgesetze, die hier geschaffen werden, dazu führen, dass man Jugendliche nicht abholt, sondern womöglich diejenigen, „die eventuell nur provozieren und auffallen wollen“, lediglich kriminalisiert.
Alles in allem kann ich Ihnen nur sagen, dass es wirklich wie eine gefährliche Drohung klingt, wenn im Nationalrat FPÖ-Abgeordnete darauf verweisen, dass es sich hierbei natürlich um Symbolpolitik handelt, aber auf der anderen Seite eine Verordnungsermächtigung ermöglicht wird, die dem Innenminister dazu dienen soll, flexibel auf neue Symbole zu reagieren. Wie das ausgelegt wird, darauf können wir gespannt sein.
Falls Sie heute Nachrichten gelesen haben, wissen Sie, der ORF hat berichtet: In Ungarn ist jetzt eine Liste von 200 Personen aufgetaucht. Soros wird wieder für die Demos vor Ort verantwortlich gemacht. Anton Pelinka, ein österreichischer Wissenschafter, taucht auf dieser Liste auf. (Bundesrat Steiner: Wissenschafter, na ja!)
Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass, wenn rechtsautoritäre Regierungen die Rechtsstaatlichkeit aushöhlen und Gesetze initiieren und beschließen, die willkürlich ausgelegt werden können, es in diesem Staat gefährlich wird. Das trägt nicht dazu bei, dass wir in Österreich sicherer leben, sondern im Gegenteil: Man muss sich wirklich vor Ihnen fürchten. – Vielen Dank. (Beifall bei der SPÖ. – Ruf bei der FPÖ: ... auswandern nach Polen!)
16.47
Vizepräsident Ewald Lindinger: Zu einer tatsächlichen Berichtigung hat sich Herr Bundesrat Günther Novak zu Wort gemeldet. – Bitte.
Bundesrat Günther Novak (SPÖ, Kärnten): Ich möchte eine tatsächliche Berichtigung machen, nämlich zur Rede des Bundesrates Schuster, der unseren Landeshauptmann
Dr. Peter Kaiser im Zusammenhang mit dem Ustascha-Treffen in Bleiburg angreift. Wir wissen alle – der Kollege hat das auch so ausgeführt –: Diese Veranstaltung ist als eine kirchliche Veranstaltung mit Prozession angemeldet und so war es die letzten Jahre auch immer. Das Land Kärnten hat keine Chance gehabt, diese Veranstaltung abzusetzen. (Zwischenruf des Bundesrates Schuster.)
Natürlich hat man versucht, sich rundherum zu positionieren, denn man hat ja in den Zeitungen immer wieder gelesen, welche Ausschweifungen dort stattgefunden haben. Man hat, nachdem Landeshauptmann Kaiser gewählt worden ist, beim Bundesministerium für Inneres darum angesucht, dass man ihn dabei unterstützt. Das hat dann mehrere Jahre gedauert.
Ich bitte Sie, Herr Abgeordneter Schuster, bei der Wahrheit zu bleiben. (Zwischenruf des Bundesrates Pisec.) Das ist eine tatsächliche Berichtigung betreffend unseren Landeshauptmann. (Beifall bei der SPÖ.)
16.48
Vizepräsident Ewald Lindinger: Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Silvester Gfrerer. Ich erteile es ihm. Ich mache darauf aufmerksam, dass um 17 Uhr die Behandlung einer Dringlichen Anfrage beginnen wird.
Bundesrat Silvester Gfrerer (ÖVP, Salzburg): Lieber Herr Präsident! Liebe Frau Staatssekretärin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Geschätzte Damen und Herren! Ich möchte mich aus zeitökonomischen Gründen – um 17 Uhr beginnt ja die Dringliche – kurz halten. Ich kann leider auf die Rede der Frau Kollegin nicht eingehen. Es würde auch nicht helfen. In einer halben Stunde würden wir uns auch noch nicht einig sein. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
Wenn wir heute das Symbole-Gesetz besprechen, diskutieren und beschließen, dann geht es in vielen Bereichen um Symbole, die eine Wirkung haben. Es gibt Symbole mit sehr positiver Wirkung, aber auch Symbole, die eine negative Bedeutung haben. Wenn Bevölkerungsgruppen versuchen, mit Symbolen und verschiedenen Handzeichen und Gesten eine Veränderung in der Gesellschaft auf Kosten der Sicherheit und der Stabilität in Österreich herbeizuführen, dann müssen wir uns wehren, dann muss man das richtigstellen und dann muss man da aktiv werden.
Im täglichen Leben in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Gesellschaft, im Alltag, in der Schule, im Kindergarten, überall wird Vorbildwirkung erzeugt, und da kann man positive Signale, Symbole und Meinungen streuen, aber auch negative. Um die Symbolwirkung geht es heute, um die Sicherheit in Österreich. Es geht darum, als Politik die Hauptverantwortung dafür zu übernehmen, um das Zusammenleben im Geiste des Dialogs, des Respekts und der gegenseitigen Wertschätzung weiterhin zu sichern.
Geschätzte Damen und Herren, dieses Gesetz wird ab 1. Jänner seine Gültigkeit haben. Jene Gruppierungen, die das Symbole-Gesetz vor vier Jahren umfasste, waren der Islamische Staat, Al Kaida und einige Nachfolgeorganisationen. Leider muss man heute feststellen, dass sich viele neue Gruppierungen und Gruppen gebildet haben, die für Österreich und seine Menschen eine Gefahr darstellen. Deshalb ist die Politik gefordert, da besteht Handlungsbedarf.
Die Zeit ist nicht stehen geblieben. Es müssen Symbole weiterer extremistischer Gruppierungen, deren Ziele zu den Grundwerten der Republik Österreich in Widerspruch stehen, in das Gesetz aufgenommen und verboten werden. Ich möchte diese Symbole nicht aufzählen, der Kollege hat das schon gemacht. Wenn das Gesetz Rechtswirksamkeit haben wird, besteht noch die Möglichkeit, über eine Verordnung weitere Themen oder Bereiche unterzubringen.
Dieses Gesetz wird nie zu 100 Prozent aktuell sein, weil sich in der Gesellschaft immer etwas verändern wird. (Bundesrat Schuster: Richtig!) Wenn ich heute auf der Autobahn einen Hunderter vorschreibe, dann habe ich den von einer Minute auf die andere festgelegt. Das Symbole-Gesetz wird immer wieder geändert werden müssen. Man wird immer die Entwicklungen beobachten und schnell darauf reagieren müssen. Es muss alles getan werden, und diese Regierung wird auch alles tun, damit das Zusammenleben im Geiste des Dialogs, die Sicherheit und der Respekt füreinander gewahrt werden.
Ich denke und ich bin überzeugt, dass jede Form von Gewalt der falsche Weg ist und auch in Zukunft verhindert werden muss. Unser Auftrag ist – und der wird auch immer aktuell sein –, die verfassungsrechtlich verankerte Werteordnung zu schützen sowie für die Menschen in Österreich die Rechte und Freiheiten zu schützen und die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit zu garantieren.
Mit diesem Gesetz können wir sicherstellen, dass Österreich eines der sichersten Länder der Erde ist und bleibt, und dass nicht so wie in Frankreich Demonstrationen eskalieren, die Demokratie mit Füßen getreten wird und viele Verletzte und auch Todesopfer zu verzeichnen sind. (Zwischenruf der Bundesrätin Dziedzic. – Zwischenruf bei der ÖVP. – Bundesrätin Dziedzic: Na schon, das hat er grad gesagt!)
Ich bin überzeugt, es wäre ein sehr positives Signal, wenn alle Fraktionen in diesem Haus diesem Gesetz zustimmen könnten, denn es ist ein sehr, sehr wichtiges Gesetz mit ganz klaren Regeln. Hass, Verherrlichung von Terrorismus, Hetze, Menschenverachtung, Gewalt und vieles mehr darf bei uns in Österreich niemals Platz haben! Unsere Regierung schaut darauf, dass Österreich sicherer wird. – Danke. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
16.53
Vizepräsident Ewald Lindinger: Herr Bundesrat Stögmüller hat sich zu einer tatsächlichen Berichtigung zu Wort gemeldet. – Bitte. (Bundesrat Längle: Der hat doch gar nicht geredet! Unglaublich! – Bundesrat Stögmüller – auf dem Weg zum Rednerpult –: Unglaublich, ja!)
Bundesrat David Stögmüller (Grüne, Oberösterreich): Ich möchte ganz kurz auf die vom Kollegen erwähnten Identitären eingehen. Es ist keine Organisation, Vereinigung oder ein Klub. Vom österreichischen Verfassungsschutz wird die Identitäre Bewegung wie folgt eingestuft:
„Die als ‚Bewegung‘ auftretende Szene, stellt die ‚Identität des eigenen Volkes‘ in den Mittelpunkt ihrer Propaganda. Unter dem Deckmantel das jeweilige Land respektive ‚ganz Europa‘ vor einer ‚Islamisierung‘ und vor Massenzuwanderung schützen zu müssen, wird auf einer pseudo-intellektuellen Grundlage versucht, das eigene rassistisch/nationalistisch geprägte Weltbild zu verschleiern. Die Distanzierung vom Neonazismus in öffentlichen Statements ist als taktisches Manöver zu werten, da sich in den Reihen der Bewegungseliten amtsbekannte Neonazis befinden und Kontakte in andere rechtsextremistische Szenebereiche bestehen.“
Das ist weder ein Verein noch ein Klub oder eine Organisation, sondern es handelt sich um eine vom Verfassungsschutz beobachtete Gruppe. – Danke. (Beifall bei der SPÖ sowie der Bundesrätin Dziedzic. – Bundesrat Schuster: Habe ich ja nicht gesagt! Habe ich was dagegen gesagt?)
16.54
Vizepräsident Ewald Lindinger: Zu Wort gemeldet hat sich Frau Staatssekretärin Mag. Karoline Edtstadler. Ich erteile es ihr.
Staatssekretärin im Bundesministerium für Inneres Mag. Karoline Edtstadler: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Mitglieder des Bundesrates! Ich habe der Diskussion jetzt sehr genau zugehört. Wenn man hinhört, dann ist es den einen zu wenig, den anderen ist es zu viel, und bei einer Verhandlung würde ich jetzt sagen: Wenn am Ende keiner zufrieden ist, dann hat man genau den richtigen Weg gewählt. Insofern können wir nicht so schlecht liegen. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
Das Symbole-Gesetz ist seit 1.1.2015 in Kraft und verbietet die Verwendung von Symbolen terroristischer, extremistischer oder vergleichbarer Gruppierungen. Jetzt muss man sagen, da sind bisher die Gruppierungen Islamischer Staat und Al Kaida enthalten gewesen. Jetzt ist es aber notwendig – und genau das ist mit der Novelle geplant –, diese Liste zu erweitern, denn es gibt auch Gruppierungen der Muslimbruderschaft, der Grauen Wölfe, der Kurdischen Arbeiterpartei, der Hamas und auch der militärischen Teile der Hisbollah und der vielbesprochenen Ustascha.
Wir alle wissen um dieses Phänomen und Problem und ich war selbst bereits einige Male damit befasst. Es ist noch eines – für diejenigen nämlich, denen es zu wenig ist – hier im Gesetz aufgezählt: Es werden auch sonstige Gruppierungen umfasst, die in Rechtsakten der EU als terroristische Organisationen angeführt werden, wobei die Bezeichnungen dieser Gruppierungen dann durch Verordnung der Bundesregierung zu erfolgen haben, ebenso wie bei Teil- und Nachfolgeorganisationen von umfassten Gruppierungen.
Das ist ein wichtiger Schritt, wir weiten das aus. Ich muss auch ganz klar sagen: Leider müssen wir ausweiten, weil die Tendenzen und die Entwicklungen eben in diese Richtung gehen, dass es nicht auf zwei Gruppierungen beschränkt bleibt, sondern dass da Entwicklungen stattfinden.
Es braucht aber noch mehr. Es wurde die Klarstellung angesprochen, dass unter Symbolen auch Handzeichen, Gesten umfasst sind. Wir reagieren also auf Entwicklungen, die gezeigt haben, dass in Österreich weitere Gruppierungen aktiv sind, deren Einstellungen – und das ist entscheidend, meine sehr geehrten Damen und Herren – dem liberaldemokratischen Rechtsstaat zuwiderlaufen. Da muss sich ein Rechtsstaat hinstellen und diese Liste ausweiten, denn das kann man in einem Rechtsstaat, in einer Demokratie nicht dulden, und dem kommen wir in diesem Gesetz nach. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
Die Symbole, die verwendet werden, werden ganz klar zur Verherrlichung von und zum Aufruf zu Gewalt missbraucht. Auch das ist etwas, das man nicht dulden kann. Das ist auch entsprechend zu sanktionieren. Es ist eben notwendig, um die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit auch in Zukunft absichern zu können. Einige haben es gesagt: Es geht um die Sicherheit in unserem Land und um deren Aufrechterhaltung. Da darf so etwas nicht aufkommen, nämlich – ich sage es noch einmal – etwas, das unserem demokratischen, liberalen Rechtsstaat zuwiderläuft.
Eines möchte ich auch noch betonen: Es geht ausschließlich um die Verwendung spezifischer Symbole von derartigen hier aufgelisteten Organisationen und keineswegs um irgendwelche religiösen Symbole oder um die Einschränkung von Grund- und Freiheitsrechten. Das ist klar zu trennen. Wir lassen uns unsere demokratischen Grundrechte auch nicht vor den Karren spannen; wir lassen nicht zu, dass Symbole für Aufrufe zu Gewalt missbraucht werden. Das muss klar sein und das ist in einem Rechtsstaat wie Österreich höchst notwendig, aber auch, meine Damen und Herren, selbstverständlich. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
Abschließend möchte ich nur noch bemerken, dass auch weiterhin natürlich das Verbotsgesetz Geltung hat – es ist eines der strengsten Gesetze, das wir haben – und
dass Vereinigungen wie die NSDAP oder auch Zeichen wie der Hitlergruß verboten sind; das ist natürlich gerichtlich strafbar. Das ist ein wesentliches Zeichen. Da haben wir aus unserer Vergangenheit natürlich die entsprechenden Lehren gezogen. Das ist bitte nicht in einen Topf zu werfen, das sind zwei Dinge, die man auseinanderhalten muss.
Ich möchte nur ein paar Worte an Herrn Bundesrat Weber richten: Ja, leider braucht es eine gewisse Flexibilität, denn die Entwicklung bleibt nicht stehen, sie geht voran. Wir setzen mit diesem Gesetz den richtigen Schritt zur richtigen Zeit, um unsere Demokratie, unseren Rechtsstaat zu schützen. Deshalb bitte ich Sie um Unterstützung, und zwar um breite Unterstützung zu diesem Gesetzentwurf. – Vielen Dank. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
16.59
Vizepräsident Ewald Lindinger: Danke, Frau Staatssekretärin.
Ich unterbreche nunmehr die Verhandlungen zu Tagesordnungspunkt 8.
der BundesrätInnen Reinhardt Todt, Kolleginnen und Kollegen an den Bundeskanzler betreffend „TAXI BUND“ (3604/J-BR/2018)
Vizepräsident Ewald Lindinger: Wir gelangen nunmehr zur Behandlung der Dringlichen Anfrage der Bundesräte Reinhard Todt, Kolleginnen und Kollegen an den Herrn Bundeskanzler.
Da die Dringliche Anfrage inzwischen allen Mitgliedern des Bundesrates zugegangen ist, erübrigt sich eine Verlesung durch die Schriftführung.
Ich bitte Sie jetzt noch um ein bisschen Geduld.
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M. (den Vorsitz übernehmend): Der Herr Bundeskanzler hat noch 1 Minute Zeit, zu kommen. (Bundeskanzler Kurz betritt den Saal.) – Ich begrüße Herrn Bundeskanzler Sebastian Kurz zur Behandlung der Dringlichen Anfrage. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
Ich erteile Herrn Bundesrat Reinhard Todt als erstem Anfragesteller zur Begründung der Anfrage das Wort. – Bitte.
Bundesrat Reinhard Todt (SPÖ, Wien): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bundeskanzler! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wie in der Begründung zur Dringlichen Anfrage ausgeführt wurde uns bekannt, dass ein Projekt aus der Konferenz der Generalsekretäre unter dem Arbeitsbegriff Taxi Bund kurz vor der Realisierung steht.
Ziel ist es, in einer Pilotphase sechs Kraftfahrzeuge anzukaufen, die für circa 150 Bedienstete des Bundeskanzleramtes, des Bundesministeriums für Landesverteidigung und des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort zur Verfügung stehen sollen. Dafür sind zusätzlich zehn Kraftfahrer und Kraftfahrerinnen notwendig, um die Beamten zu Terminen zu chauffieren. Das erscheint ja noch übersichtlich, doch in der Endausbauphase sollen circa 70 Kraftfahrzeuge mit rund 120 Kraftfahrern für die Beamten zur Verfügung stehen, damit diese sich chauffieren lassen können.
Es dürfte sich dabei um die Spitzenbeamtenschaft handeln, für die diese Dienste eingerichtet werden. (Ruf bei der FPÖ: Da sind sehr viele Konjunktive drinnen!) In Zeiten, in welchen die Bundesregierung angeblich im System sparen möchte, erscheint eine solche Maßnahme als völlig unangebracht. (Bundesrätin Mühlwerth: Aber schon viele hätt i, war i, tät i, nicht?!)
Symptomatisch ist dieses Projekt auch für den sogenannten Stil dieser Bundesregierung (Zwischenrufe bei der FPÖ – Bundesrat Rösch: Genau, Basti!), an den Betroffenen, dem Parlament und der Öffentlichkeit vorbei, hinter Nebelgranaten unsere Gesellschaft still und leise nach ihren Vorstellungen zu ändern. (Ruf bei der FPÖ: Ja, ist schon recht, Nebelgranate! – Heiterkeit bei der FPÖ.) – Genau. (Ruf bei der FPÖ: Jetzt musst du selber lachen!) Es ist aber auch der neue Stil der nun zu mächtig gewordenen Generalsekretäre, der ein solches an Größenwahn grenzendes Projekt erst ermöglicht. (Bundesrätin Mühlwerth: Größenwahn, darf er das sagen?!)
Es erinnert einen an die Jahre 1814 und 1815 (Bundesrätin Mühlwerth: Holler ist ein Ordnungsruf!), als in Wien im Rahmen des Wiener Kongresses ein Kutschenservice für die adeligen Verhandler organisiert wurde (Oje-Rufe bei der FPÖ), damit diese vom Wiener Volk nicht belästigt werden. (Beifall bei der SPÖ.)
Sehr geehrte Damen und Herren, eine Generalsekretärekonferenz ist kein Ministerrat. (Zwischenrufe bei der FPÖ.) Das monokratische Organ Bundesministerium wird vom Minister im Rahmen seiner Ministerverantwortung geleitet. Die Bundesverfassung kennt keine Generalsekretäre, keine ihrer Konferenzen und auch keinen Generalsekretärefuhrpark.
Unter dem Aspekt der Umwelt betrachtet erscheint dieses Vorhaben ebenfalls absurd. (Bundesrat Steiner: Und Sie sind als Präsident zu Fuß gegangen, oder was?! – Bundesrat Rösch: Also das ist peinlich! – Weitere Zwischenrufe bei der FPÖ.) Es handelt sich bei solchen Dienstfahrten meistens um innerstädtische oder sogar innerhalb des 1. Bezirks stattfindende Fahrten. Das Angebot der öffentlichen Verkehrsmittel ist großartig, und vielleicht wäre es für die Volksnähe auch der Spitzenbeamtenschaft manchmal empfehlenswert, mit den normalen Bürgerinnen und Bürgern konfrontiert zu werden.
Daneben bleiben noch viele Fragen unbeantwortet: Was passiert mit den bisherigen Dienstkraftfahrzeugen? Sind auch Privatfahrten oder Fahrten von und nach zu Hause zulässig? Was sagt eigentlich die Taxiinnung zu diesem Vorhaben? (Heiterkeit bei der FPÖ. – Bundesrätin Ecker: Die werden wir auch noch aushalten!)
All dies hätten wir gerne im Rahmen dieser Dringlichen Anfrage geklärt. Sie alle haben die Anfrage bekommen, und ich hoffe auf die Antworten. (Beifall bei der SPÖ.)
17.06
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Zur Beantwortung ist der Herr Bundeskanzler zu Wort gemeldet. – Bitte, Herr Bundeskanzler.
Bundeskanzler Sebastian Kurz: Sehr geehrter Herr Präsident! Frau Staatssekretärin! Sehr geehrte Damen und Herren Bundesräte! Es ist manchmal nicht so, wie es scheint, und manchmal auch nicht so, wie Sie es versuchen darzustellen. Ich versuche trotzdem, jetzt in aller Kürze die vielen mir gestellten Fragen zu beantworten, glaube aber, dass ich schon in meinen einleitenden Worten relativ schnell für Aufklärung sorgen kann.
Nein, die Taxiinnung wurde nicht befasst, und ich glaube, auch der Vergleich mit dem Jahr 1814 hinkt ein bisschen. Es geht auch nicht um die Bundesregierung, die Sie vielleicht schätzen oder auch nicht, denn die ist von diesem Vorhaben eigentlich überhaupt nicht betroffen.
Worum geht es? – Es geht um eine umfassende Strukturreform, die seitens der Bundesregierung für die Ministerien vorgesehen ist. Es soll eine gemeinsam abgestimmte Vorgehensweise in den unterschiedlichen Ressorts für einen effizienten Mitteleinsatz sorgen. Sie wissen wahrscheinlich, dass mit der Konferenz der Generalsekretäre be-
wusst auf die Idee gesetzt wurde, auch solche Reformprojekte anzugehen, die bis jetzt am Widerstand unterschiedlicher Ressorts gescheitert sind. Es gibt unzählige Projekte aus dem Regierungsprogramm, die wir den Generalsekretären mit dem Ziel, die Effizienz in der Verwaltung zu steigern, übertragen haben.
Ziel dieser Initiative ist es, die Bündelung und Zentralisierung des Fuhrparkmanagements sicherzustellen. Um ganz ehrlich zu sein, es ist eine Idee, die ich kenne, seit ich Teil der Bundesregierung bin. Die Umsetzung ist schlicht und ergreifend immer daran gescheitert, dass sich Sozialdemokratie und Volkspartei nie darauf einigen konnten, welches Ressort den Lead in dieser so wichtigen Aufgabe am Ende des Tages hätte.
Die Idee ist relativ einfach erklärt, nämlich Kosten in den Ressorts dadurch einzusparen, dass man sich die Ressourcen teilt – Fuhrparkmanagement ist das eine, aber es gibt noch viele andere technische Supportprozesse, die nicht in allen Ressorts individuell, einzeln durchgeführt werden sollen, sondern als Aufgabe gebündelt werden – und dass man im Fall der Notwendigkeit auf alle Ressourcen gleichzeitig zugreifen kann.
Ich bringe Ihnen ein Beispiel: Wenn wie zum Beispiel gestern das Afrika-Forum in Wien mit 800 Wirtschaftsvertretern, 50 Delegationsleitern aus der Europäischen Union, zahlreichen Regierungschefs, Außenministern und anderen stattfindet, dann ist es wichtig, dass Ressorts zusammenarbeiten. Es wäre vollkommen sinnlos, wenn nur die drei Chauffeure des Außenministeriums tätig wären und die anderen vielleicht zugemietet werden müssten. Es ist richtig und sinnvoll, dass man sich gegenseitig unterstützt. Eine Sicherstellung der gemeinsamen Ressourcennutzung ist das Ziel dieser Initiative. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
Ich glaube, damit eigentlich schon alles beantwortet und hoffentlich die Aufregung etwas gemildert zu haben. (Zwischenrufe bei der SPÖ.) Ich beantworte trotzdem jetzt noch einzeln all Ihre Fragen, weil ich davon ausgehe, dass Sie sich das von mir erwarten. (Ruf bei der SPÖ: Allerdings!) Ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt die teilweise etwas technischen Antworten vorlesen werde.
Zur Frage 1:
Am Pilotprojekt beteiligten sich das Bundesministerium für Landesverteidigung – zugleich Projektleitung des Projekts Fuhrparkmanagement –, das BMDW, das BMI und mein Ressort. Die Beteiligung am Pilotprojekt erfolgte durch die Ressorts auf freiwilliger Basis mit dem Ziel, Effizienz und Effektivität zu steigern. Es ist notwendig, dass die Ressorts ihre Tätigkeit rasch und effizient erbringen können und auf ihre Kernaufgaben fokussiert sind. Durch ein zentralisiertes modernes Fuhrparkmanagement wird diese Herausforderung unterstützt.
Zur Frage 2:
Der Ballhausplatz, zugleich Sitz des Bundekanzleramts, ist zentraler Standort im politischen und administrativen Geschehen. Es ist daher eine Selbstverständlichkeit, dass mein Ressort an diesem bedeutenden Projekt teilnimmt und mit gutem Beispiel vorangeht.
Zur Frage 3:
Alle Bundesministerien stellen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Mix an Transportmitteln zur Verfügung, um ihrem Mobilitätsbedarf gerecht zu werden. Vorrangig ist die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel vorgesehen, in Ausnahmefällen kommt es auch zum Einsatz von Dienstkraftfahrzeugen. Das Bundeskanzleramt hat derzeit sechs Dienstkraftfahrzeuge, die für den Bundeskanzler, die Frau Bundesministerin, den Herrn Bundesminister sowie alle weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Ressorts zur Verfügung stehen. Bei einem Fahrzeug handelt es sich um ein Elektroauto, welches im Frühjahr 2018 angeschafft wurde.
Mein Ressort hat dabei eine Vorbildfunktion im Bund im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes inne. Zukünftig werden im zentralen Fuhrparkmanagement verstärkt Fahrzeuge mit umweltschonenden Antriebsformen eingesetzt.
Zur Frage 4:
Nach dem derzeitigen Projektstand werden die vorhandenen Dienstfahrzeuge des Bundeskanzleramts in das zentrale Fuhrparkmanagement übergeführt.
Zu den Fragen 5 bis 8:
Die angebotenen Leistungen werden ausschließlich für Dienstfahrten zur Verfügung stehen. Im Bundeskanzleramt gehen wir davon aus, dass zwischen 30 und 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unterschiedlichen Funktionen das Service nutzen werden. Selbstverständlich richtet sich die Inanspruchnahme, wie generell üblich, nach den Erfordernissen des Dienstes.
Zur Frage 9:
Die Verrechnung von Taxikosten für Bedienstete des Bundeskanzleramtes wird wie bisher über das Ressort erfolgen.
Zur Frage 10:
Für den Echtbetrieb müssen grundsätzlich keine neuen Dienstkraftfahrzeuge beschafft werden, sondern die vorhandenen Fahrzeuge werden aus den einzelnen Ressorts in den gemeinsamen Fuhrpark überstellt. Es wird jedoch angemerkt, dass diese Analysen derzeit noch nicht endgültig abgeschlossen sind. Die Kostensätze werden derzeit ebenfalls im Projektteam analysiert und erstellt.
Zu den Fragen 11 und 12:
Die sechs Fahrzeuge (Ruf bei der SPÖ: Sechs Fahrzeuge?!) – sechs Fahrzeuge, ja, also zumindest was die Fragen 11 und 12 betrifft, ja – werden über eine Rahmenvereinbarung der Bundesbeschaffung GmbH abgerufen, das bedeutet, dass alle vergaberechtlich geltenden Vorschriften eingehalten wurden. Im Pilotbetrieb wird pro Fahrzeug ein durchschnittliches monatliches Leasinggeld in der Höhe von rund 500 Euro anfallen.
Zur Frage 13:
Für das Pilotprojekt werden keine neuen Kraftfahrer im Bundesdienst angestellt. Im Jahr 2018 belaufen sich die Personalkosten auf rund 45 000 Euro pro Kraftfahrer im Bundeskanzleramt.
Zur Frage 14:
Selbstverständlich nahmen ökologische Überlegungen eine zentrale Rolle im Projekt ein. Im Gegensatz zur bisherigen Praxis, bei der jedes Ressort seine eigenen Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer sowie Kraftfahrzeuge bereitstellt, sollen durch die gemeinschaftliche Nutzung der Fahrzeuge Synergieeffekte und klimafreundliche Auswirkungen erzielt werden. Auch sollen bisherige Dieselkraftfahrzeuge gegen Elektro- und Hybridmodelle, die für die Umwelt schonender sind, dort, wo es möglich und sinnvoll ist, ersetzt werden.
Natürlich wurden und werden auch die bestehenden Mobilitätsbedürfnisse kritisch hinterfragt. Es sollen nur dann Fahrzeuge aus dem Fahrzeugpool verwendet werden, wenn eine Fahrt nicht durch öffentliche Verkehrsmittel oder ein Weg zu Fuß verrichtet werden kann. Es werden auch Fahrscheine zur Verfügung gestellt.
Zur Frage 15:
Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei dem Projekt um ein Vorhaben, bei dem die Bündelung von Ressourcen, die in den einzelnen Ministerien bereits vorhanden sind, im Vordergrund steht. Dabei werden interne Synergieeffekte genutzt und die Effizienz gesteigert. Unter diesem Gesichtspunkt waren auch keine Gespräche mit externen Interessenvertretungen notwendig.
Abseits der Fragen im Detail: Wir werden natürlich sehr genau prüfen, ob Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Spitzenpositionen, die schon lange dem öffentlichen Dienst angehören und in der Zeit der Vorgängerregierung zu ihrer Tätigkeit berufen wurden, die Dienstfahrzeuge vielleicht überbordend verwenden. Wir hoffen aber, dass das nicht der Fall ist. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
17.15
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Vielen Dank für die aufklärende Beantwortung.
Wir gehen nunmehr in die Debatte ein.
Ich darf darauf aufmerksam machen, dass gemäß § 61 Abs. 7 der Geschäftsordnung die Redezeit eines jeden Bundesrates mit insgesamt 20 Minuten begrenzt ist.
Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Stefan Schennach. Ich erteile es ihm. (Bundesrat Rösch: Na die Gratulation wird ja nicht so lange dauern!)
Bundesrat Stefan Schennach (SPÖ, Wien): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bundeskanzler! Wir haben Ihre Worte jetzt vernommen. Wenn man im Sinne der parlamentarischen Kontrolle von Vorhaben – vor allem von Konferenzen, die es ja an sich in unserem Staatsaufbau gar nicht gibt – und Entscheidungen solcher Konferenzen erfährt, dann ist es das Recht der Parlamentarier, hier auch nachzufragen. (Ruf bei der FPÖ: Da hätte man vorher fragen sollen!)
Ich höre, Sie sind in diesen Überlegungen vom sorgsamen Mitteleinsatz und dem Gedanken, die Effizienz zu steigern, getrieben.
In der hinteren Reihe hat jemand zwischengerufen, ob der Präsident des Bundesrates ein Dienstfahrzeug verwendet hat. Ich hoffe, mittlerweile ist er aufgeklärt, dass es hier nicht um Regierungsmitglieder oder höchste Organe geht, sondern um höchste oder hohe Beamte. Es ist auch unbestritten, dass bei großen Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem Afrika-Forum, bei Großkonferenzen natürlich eine ganz andere Mobilitätsplanung erforderlich ist.
Die Frage aber ist – und es ist, glaube ich, eine berechtigte –: Man kann solch einen Fahrzeugpool machen, aber gibt es angesichts dessen, dass sich die meisten Ministerien in der Wiener Innenstadt befinden, überhaupt eine Notwendigkeit dafür, Beamte innerhalb der Wiener Innenstadt mittels eines Fahrzeugpools zu transportieren? – Im Rahmen der Wiener Innenstadt ist es mit Sicherheit möglich (Ruf bei der FPÖ: Ja!), erstens das öffentlich zu machen und zum Teil auch zu Fuß zu gehen. (Bundesrat Seeber: Österreich hat neun Bundesländer!)
Aber gut, es sollen jetzt die bestehenden Fahrzeuge zusammengeführt werden. Nun sieht es aber so aus, dass es ein Papier dazu gibt. Nach diesem Papier sollen nach einem Jahr des Pilotprojekts 70 Fahrzeuge und 120 Kraftfahrer und Kraftfahrerinnen dafür eingesetzt werden. Ob das jetzt noch der sorgsame Mitteleinsatz und die Effizienzsteigerung ist, überlasse ich der Beurteilung jeder einzelnen Person. Ich denke, dass das ein Ausbau ist. (Bundeskanzler Kurz: Es wird auf jeden Fall reduziert!) – Na ja, reduziert wird es nicht, weil die Autos der Minister (Bundeskanzler Kurz: Na ja,
schon!) nicht abgeschafft werden, denn die müssen ja unabhängig davon existieren. (Zwischenrufe bei der FPÖ.) – Entschuldigung, Moment, Moment! Wir reden über die Mittelnutzung und die Fahrzeugpoolnutzung durch oberste Beamte. Darüber reden wir, und ich denke (Ruf bei der FPÖ: Ahnungslos! Sagt, das war nix! – Bundesrat Steiner: Das ist ein Fettnäpfchen, in das ihr getreten seid! – Rufe bei der FPÖ: Entschuldigt euch!), dass die Benützung von Taxis und öffentlichem Verkehr und deren Verrechnung keine wirkliche Mehrbelastung ist. Ich frage mich: Wo wollen Sie da einen sorgsamen Mitteleinsatz machen? – Aber Sie wollen das recherchieren, und wir sind sicher, wir werden davon in Kenntnis gesetzt werden.
Wir fragen nur nach, da wir Einsicht in ein Dokument haben, in dem steht: 70 Kfz und 120 Kraftfahrer und Kraftfahrerinnen nach einem Jahr. Da gehen wir davon aus, dass das eine Ausweitung der Kosten ist. Die Kosten müssen Sie uns nach einem Jahr nachweisen oder darstellen, denn derzeit sieht es so aus.
Wir haben Ihre Antworten gehört, ich verstehe das. Für den Pilotbetrieb ist es machbar, drei Ministerien inklusive Bundeskanzleramt mit dem vorhandenen Personal zu versorgen. Es ist ja nach einem Jahr in einer größeren Weise geplant, und da haben wir die Sorge, dass es dann eine Ausdehnung und nicht ein sorgsamer Mitteleinsatz ist. – Danke. (Beifall bei der SPÖ. – Bundesrat Längle: Für was jetzt eine Dringliche? – Bundesrätin Mühlwerth: Das wissen sie selber nicht!)
17.20
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Danke.
Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Karl Bader. – Bitte.
Bundesrat Karl Bader (ÖVP, Niederösterreich): Sehr geehrter Herr Präsident! Hochgeschätzter Herr Bundeskanzler! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrter Herr Oberlehrer Schennach! (Heiterkeit bei ÖVP und FPÖ.) Ich danke sehr herzlich dafür, dass Sie uns erklärt haben, dass es das Recht der Bundesrätinnen und Bundesräte ist, Anfragen zu stellen. Selbstverständlich ist das ein wichtiges Instrument und ist in unserer Geschäftsordnung auch entsprechend geregelt. Es geht bei Anfragen für mich ganz einfach darum, klare Fragen zu stellen und darauf klare Antworten zu geben. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, ich danke dir sehr herzlich für die klaren Antworten, die du auf diese Fragen gegeben hast. (Beifall bei ÖVP und FPÖ. – Zwischenruf des Bundesrates Novak.)
Auch gegen die Fragen ist nichts einzuwenden – ich möchte das hier auch ausdrücklich festhalten –, aber das Rundherum ist für mich schon mehr als eigenartig. Das beginnt mit der APA-Meldung, in der Konstruktionen enthalten sind; das Ziel sei in einem anscheinend zugespielten Papier schon klar definiert, es gehe darum, dass es sich dabei um Spitzenbeamte handeln dürfte, die hier eine neue Mobilitätsgarantie mit neuen Dienstfahrzeugen bekommen.
Ich habe Herrn Kollegen Todt sehr genau zugehört: Es wurde uns bekannt, es wurde ein Papier zugespielt – nichts, wo es um Konkretes geht –, es sollte, es dürfte, es hätte, es wäre – alles im Konjunktiv. Ich habe schon den Eindruck, dass hier eine Nebelgranate gezündet wird, dass hier Mutmaßungen angestellt werden, dass möglicherweise ein Ablenkungsmanöver betrieben wird, wobei ich nicht weiß, wovon ihr überhaupt ablenken wollt, statt eigene Ideen einzubringen.
Die klare Antwort des Herrn Bundeskanzlers hat auch gezeigt, dass manches, was in der Begründung der Anfrage drinnen steht, an Absurdität ja fast nicht zu überbieten ist.
Die Beantwortung hat auch Klarheit gebracht, dass dieses Projekt keinesfalls ein doppelbödiges Projekt ist, dass dieses Projekt nichts mit Privilegien für Spitzenbeamte zu
tun hat. Ich glaube, dass man einem Bundeskanzler, der selbst sehr häufig Economy Class fliegt, auch abnehmen kann, dass er nicht für seine Spitzenbeamten Sonderklassen einführen will. (Bundesrat Schererbauer: Mit dem Zug fährt er!) Das kann man ihm abnehmen, das können Sie mir glauben.
Dem Bundeskanzler und der Bundesregierung geht es um neues Regieren, es geht um Veränderungen, es geht darum, Strukturen zu reformieren, und es geht um Sparen im System. Genau das verfolgt auch dieses Projekt, nämlich die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit zu steigern. Das ist das Ziel von Taxi Bund, das ist aber auch der Stil dieser neuen Regierung. Dieser Stil der neuen Regierung wurde ihr vorgeworfen: Ja, der Stil dieser neuen Regierung ist ein anderer, auch in der Auseinandersetzung mit der Opposition, auch im Diskurs, klar und deutlich. (Zwischenruf des Bundesrates Novak. – Bundesrat Weber: Keine Begutachtungen!) Wenn wir die Opposition so geringschätzen würden, wie Sie das dem Bundeskanzler gegenüber tun, dann brauchten wir viele Diskussionen gar nicht zu führen. Es ist ein neuer Stil in der Politik. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
Genau dieser neue Stil unterscheidet diese Regierung auch von der SPÖ. Ich kann mich noch an Minister erinnern – ich glaube, Verteidigungsminister –, die sich mit Privatfahrten aus Frankreich haben holen lassen und so weiter. (Bundesrat Seeber: Richtig! Der Herr Klug war das! – Bundesrat Pisec: Höret, höret!) Sie wissen genau, was ich meine.
Das unterscheidet uns von Ihnen, und diesen Unterschied zur Opposition und zum Stillstand, was die tägliche Arbeit der Regierung betrifft, spüren auch die Menschen; den spüren sie, den schätzen sie. Daher freue ich mich, dass wir in diesem einen Jahr gemeinsam für die Menschen in unserer Republik, für dieses Land viel weitergebracht haben. Ich freue mich auf ein zweites sehr, sehr erfolgreiches Regierungsjahr mit unserem Herrn Bundeskanzler, mit unserem Vizekanzler und den Damen und Herren der Bundesregierung. – Vielen Dank. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
17.25
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Danke.
Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Gerd Krusche. Ich erteile es ihm.
Bundesrat Gerd Krusche (FPÖ, Steiermark): Herr Bundeskanzler! Frau Staatssekretärin! Hohes Präsidium! Meine Damen und Herren! Herr Kollege Todt, Seifenblasen halten meistens länger als diese Dringliche Anfrage. (Heiterkeit und Beifall bei FPÖ und ÖVP.) Die Idee dieses Fuhrparkmanagements ist ja nicht neu, der Herr Bundeskanzler hat es ja bereits ausgeführt, die hat es schon in der Vorgängerregierung gegeben. Wie so vieles unter der Vorgängerregierung wurde es aber nicht umgesetzt. Dazu hat es uns benötigt und jetzt wird es umgesetzt. (Beifall bei FPÖ und ÖVP. – Bundesrat Weber: Ganz sicher!)
Diese Anfrage ist wirklich ein Lehrbeispiel, und wir werden uns überlegen, sie für die Schulung unserer jungen Abgeordneten heranzuziehen (Bundesrätin Mühlwerth: Wie man es nicht macht!): Sie ist schlecht recherchiert, sie ist schlecht begründet. Wie macht man eine Dringliche Anfrage nicht? – Dafür haben wir jetzt wirklich ein Schulbeispiel. (Heiterkeit und Beifall bei FPÖ und ÖVP. – Bundesrat Steiner: Die Roten werden schon ganz rot!)
Sie monieren eingangs in Ihrer Begründung, dass die Konferenz der Generalsekretäre ja gar keine Rechtsgrundlage hat. Gerade wir im Bundesrat müssten das ja wissen; da befindet sie sich in bester Gesellschaft, das ist ungefähr so wie die Landeshauptleutekonferenz, die auch keine Rechtsgrundlage hat. (Zwischenruf der Bundesrätin Hahn.)
Sie kritisieren mangelnde ökologische Überlegungen – ja was sind Elektro- und Hybridfahrzeuge denn sonst, wenn nicht ökologisch sinnvoll? Wenn die nicht ökologisch sind, dann können wir und die Beamten in Zukunft wirklich nur mehr mit dem Tretroller fahren, aber bitte nicht mit einem Elektroroller. (Beifall bei der FPÖ und bei BundesrätInnen der ÖVP.)
Wie bereits in der Beantwortung herausgekommen ist, ist das eindeutige Ziel die Schaffung eines einheitlichen Fuhrparkmanagements, nicht in jedem Ressort ein eigener Fuhrpark so wie bisher, sondern die Bündelung von Ressourcen und damit logischerweise und nachvollziehbarerweise eine Reduzierung der Zahl der Dienstfahrzeuge.
Es ist, glaube ich, noch nicht angesprochen worden, dass ja auch ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung geplant ist, es soll ja eine App geben, mit der dann die Fahrzeuge praktisch gebucht werden können. Das finde ich äußerst modern und zeitgemäß. Über den Einsatz ökologischer Technologien haben wir ja bereits kurz gesprochen.
Dass Fahrzeuge und Fahrer damit auch eingespart werden – nicht durch Entlassungen, sondern durch den natürlichen Abgang –, wird die Kosten reduzieren und nicht steigern, wie Sie glauben. Der Bund macht mit dieser Maßnahme eigentlich nur das, was für jedes moderne größere Unternehmen heute selbstverständlich ist: ein professionelles und optimiertes Fuhrparkmanagement.
Damit da keine Fehler passieren und das wirklich optimal läuft, finde ich die Idee des Pilotprojekts mit einigen – es sind offensichtlich vier und nicht drei, wie Sie gut recherchiert haben – beteiligten Ministerien sehr vernünftig, um das im kleinen Maßstab testen zu können.
Von Taxis ist überhaupt nicht die Rede. Es ist also schon etwas verwunderlich, dass Sie, meine Damen und Herren von der SPÖ, jetzt plötzlich zum Anwalt der Unternehmer werden. Das hat man in der Vergangenheit bei anderen Themen wie der Arbeitszeitflexibilisierung und bei Lohnverhandlungen noch nicht gemerkt. (Beifall bei FPÖ und ÖVP.)
Wenn ich Ihnen eines in dieser Debatte zugutehalten muss, dann ist es ein gewisses Verständnis für das Misstrauen, das Sie betreffend Fuhrparknutzung haben, denn schließlich war es ja Ihr ehemaliger Fraktionsvorsitzender im Bundesrat und Verteidigungsminister Klug, der sich das Dienstfahrzeug in die Schweiz nachkommen hat lassen, um dann privaten Urlaub in Frankreich zu machen. (Beifall bei FPÖ und ÖVP. – Oh-Rufe bei der FPÖ.)
Das einzig Positive an dieser Anfrage ist, dass ich damit die Gelegenheit hatte, erstmals von diesem innovativen Vorhaben Kenntnis zu erlangen.
Das Interpellationsrecht ist ja bereits angesprochen worden und das will natürlich niemand schmälern, aber das hätten Sie wirklich in einer normalen schriftlichen Anfrage auch ausüben können, ohne den Kanzler äußerst kurzfristig herzuzitieren. (Beifall bei FPÖ und ÖVP. – Bundesrat Beer: Sind wir jetzt schon so weit, dass du uns sagst, was wir machen dürfen?)
Zum Abschluss möchte ich noch eine persönliche Anmerkung machen: Herr Fraktionsvorsitzender, Herr Präsident des Bundesrates außer Dienst, ich habe dich als lösungsorientierten und kollegialen Menschen, als wertvolles Mitglied dieses Hauses kennen und schätzen gelernt. Ich finde es bedauerlich, dass du in deiner letzten Plenarwoche anscheinend noch einem Anfall von Profilierungsneurose unterliegst. (Bundesrat Beer: Ein Ordnungsruf! Profilierungsneurose! Was soll denn das? – Bundesrat Samt: Nicht wehleidig werden!) Morgen wirst du mit deiner nächsten Anfrage und einem zu erwar-
tenden Polizeibashing diesem Schauspiel noch die Krone aufsetzen. Du hättest dir einen würdigeren Abgang verdient. – Danke. (Beifall bei FPÖ und ÖVP.)
17.32
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Bundesrat Stögmüller, bitte. (Bundesrätin Mühlwerth: Darauf haben wir noch gewartet! Lass es einfach! Lass es einfach!)
Bundesrat David Stögmüller (Grüne, Oberösterreich): Als Vertreter der einzigen Partei, die weder Anfragesteller ist noch die Regierung vertritt, muss ich mich schon melden. Fraktionsobmann Bader hat gesagt: Wir gehen mit der Opposition in einem neuen Stil um. – Dann kommen hier aber Meldungen gegen die SPÖ zum Interpellationsrecht, das in der Geschäftsordnung des Bundesrates ein wichtiges Instrument ist, um die Bundesregierung zu kontrollieren. Man kann die alte Regierung gerne kritisieren, da haben wir Grüne viel Kritik geübt. Den neuen Stil spüre ich hier nicht, sondern zynische Meldungen, zynisches Reinschreien gegenüber der SPÖ. Ich bin jetzt kein Verteidiger der SPÖ, aber wenn das der neue Stil ist, dann frage ich euch schon (Bundesrat Seeber: Du bist schon Verteidiger! – Bundesrätin Ecker: Doch, der SPÖ!): Wenn das der neue Stil ist – na, habe die Ehre! Vielleicht sehen Sie es ja als Weihnachtsgeschenk, denn das Einzige, was ich gesehen habe, ist, dass die ÖVP ein paar Selfies und ein paar Fotos mit dem Herrn Bundeskanzler da hinten gemacht hat. Vielleicht können Sie noch ein paar machen, dann können Sie sich auch noch bei der SPÖ bedanken. (Beifall bei der SPÖ sowie der Bundesrätin Dziedzic.)
Noch einmal: Dieses Interpellationsrecht ist wichtig. Ja, vielleicht ist das Thema euch jetzt nicht so unbedingt wichtig, aber der SPÖ war es halt gerade wichtig. Ich finde es schon interessant, aktuelle Themen anzusprechen, zu hinterfragen. Ja, es muss halt der Kanzler auch einmal kommen. (Bundesrätin Mühlwerth: Dringlich war es nicht! – Weitere Zwischenrufe bei der FPÖ.) Das muss man ihm anrechnen, andere Bundesminister à la Kickl kommen ja gar nicht in den Bundesrat, der Bundeskanzler kommt zumindest. (Beifall bei der SPÖ sowie der Bundesrätin Dziedzic. – Zwischenruf des Bundesrates Spanring.)
Ich halte es trotzdem für ein spannendes Projekt, wenn man es schafft, den Fuhrpark zu reduzieren. Wenn das gelingt, finde ich das super, gerade auch, was die Elektromobilität betrifft. Das habe ich heute auch erfahren, ich finde das informativ, ich halte das auch für ein spannendes Thema. Wenn man es schafft, hier wirklich den ökologischen Fußabdruck in den Ministerien zu verkleinern, ist das großartig. Es ist schon Zeit geworden, da hat die alte Regierung auch nie wirklich etwas vorangebracht. Das jetzt ist gut. Vielleicht ist auch in diesem Bereich die Zeit endlich einmal reif.
Eines kann ich Ihnen aber schon versprechen: Wir werden natürlich im Zuge des Interpellationsrechts auch nachschauen, wie sich das im nächsten Jahr entwickelt und wie das dann wirklich umgesetzt worden ist. (Bundesrat Samt: Wenn ihr das dann noch machen könnt!)
Ich sage trotzdem Danke für diese parlamentarische Anfrage, denn sie hat dieses Thema auch hierher in den Bundesrat gebracht. Sorry, machen wir den Bundesrat nicht immer schlecht, sondern nehmen wir das, wenn die Opposition eine Dringliche Anfrage macht, auch einmal ernst und bereden wir es und lachen wir die Opposition nicht aus! Das wäre im Sinne des neuen Stils einmal notwendig. – Danke. (Beifall bei der SPÖ sowie der Bundesrätin Dziedzic. – Zwischenrufe bei der FPÖ.)
17.35
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Vielen Dank.
Wünscht dazu noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Ich bedanke mich beim Herrn Bundeskanzler für das spontane Kommen und für die Beantwortung der Fragen. – Vielen Dank. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Ich nehme die Verhandlungen zur Tagesordnung wieder auf. Wir setzen die Verhandlungen über Tagesordnungspunkt 8, Symbole-Gesetz, fort.
Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Anton Froschauer. Ich erteile es ihm.
Bundesrat Anton Froschauer (ÖVP, Oberösterreich): Geschätzter Herr Präsident! Hochgeschätzter Herr Bundeskanzler! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Bundesrates! Geschätzte Besucherinnen und Besucher! Da das Symbole-Gesetz vorhin schon sehr, sehr kontroversiell und vor allem sehr emotionell diskutiert wurde, möchte ich zum ursprünglichen Zweck des Gesetzes zurückkommen. Es geht hier um eine Abänderung, um eine Erweiterung eines Gesetzes, das noch sehr jung ist – 2014 entwickelt, 2015 in Kraft getreten.
Wo hat es eigentlich seinen Ursprung? – Man könnte ja sagen, terroristische Bedrohung hatten wir bereits in den Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts. Ich erinnere an die Rote Armee Fraktion, Brigate Rosse, ich erinnere an den militärischen Teil der PLO, der Palästinensischen Befreiungsorganisation.
Das war damals deutlich anders. Mittlerweile sind wir mit Formen des Terrorismus konfrontiert, die in der Gesellschaft weiterentwickelt werden, wo in der Gesellschaft mitten in Europa rekrutiert wird. Symbole, Gesten, Erkennungszeichen hat es zum damaligen Zeitpunkt bereits gegeben, mittlerweile wird aber damit ein Selbstverständnis und Selbstbewusstsein dieser terroristischen Organisationen transportiert, mittlerweile wird über diese Symbole und Gesten diese gemeinsame Erkennung vorangetrieben. Daher ist es wichtig, dem Einhalt zu gebieten.
Wenn Kollege Weber die Hoffnung daran knüpft, dass wegen dieses Gesetzes das Ustaschatreffen in Kärnten nicht mehr stattfinden wird können, muss ich dir die Hoffnung nehmen, Herr Kollege. Es ist eines, Veranstaltungen zu unterbinden, und es ist ein anderes, Zeichen, Symbole und Gesten zu unterbinden. Das sind zwei Paar Schuhe. (Bundesrätin Dziedzic: Das ist eine Frage der Definition!) – Nein, es ist keine Frage der Definition. Frau Kollegin, wenn Sie vorher zugehört hätten, wüssten Sie, ich habe versucht, die Genesis anzusprechen, nämlich dass sich hier die Formen des Terrorismus und die Formen, wie rekrutiert wird, massiv verändert haben. (Bundesrat Steiner: Sie hat es nicht verstanden!) Rekrutiert wird mittlerweile mitten in unserer Gesellschaft. Das hat sich massiv verändert.
Es ist auch der Vorwurf erhoben worden, dass es bei dieser Liste um Willkür geht. Es ist ganz eindeutig festgelegt, dass es sich um terroristische Organisationen handeln muss. Grundlage dafür sind einige definitive Ausprägungen dieser Formen. Was bedeutet Terrorismus? – Terrorismus bedeutet, auf Personen Gewalt auszuüben, in den meisten Fällen auf Minderheiten oder sonstige Gruppierungen. (Bundesrätin Dziedzic: Macht das die PKK in Österreich?) – Die PKK rekrutiert, das würden Sie sehen, wenn Sie mit offenen Augen herumgehen würden.
Es geht um Tötung und Entführung von Angehörigen ethnischer, religiöser oder sonstiger Minderheiten. Es geht darum, Strukturen eines Staates, ob das verfassungsrecht-
licher Natur ist, ob das wirtschaftlicher oder sozialer Natur ist, infrage zu stellen und zu zerstören. Das sind Ausprägungen von Terrorismus – Sie könnten hier viel lernen, Frau Kollegin, wenn Sie zuhören würden! –, und das ist die Grundlage, um diese Symbole zu verbieten.
Noch einmal zum Punkt Willkür: Es wird eine Ermächtigung für den Bundesminister geben, diese Liste weiterzuentwickeln, weil es notwendig ist, weil sich Terrorismus wie eine Hydra permanent verändert. Grundlage dafür – und das ist definitiv im Gesetz verankert – wird diese Liste sein, diese gemeinsame Liste der Europäischen Union, die jedes halbe Jahr überarbeitet und nötigenfalls ergänzt wird. Insofern halte ich das für ein wichtiges Gesetz. Es wird nicht, um noch einmal auf Kollegen Weber zurückzukommen, alle Probleme in diesem Bereich lösen. Es ist ein Element, um Schritt für Schritt dieser Hydra Terrorismus zu begegnen. Es ist ein Element, damit man einen Straftatbestand hat, um einschreiten zu können. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
Es wird das Verbotsgesetz nicht ersetzen, das bleibt aufrecht. Es wird das Abzeichengesetz nicht ersetzen, das bleibt aufrecht. Möglicherweise ist es notwendig, noch weitere Tatbestände einzuführen, um unserer Exekutive Möglichkeiten in die Hand zu geben, Terrorismus und all seinen Ausprägungen – damit meine ich nicht nur, wenn es passiert, sondern auch die Entwicklung, die Entstehung und die Rekrutierung – entgegentreten zu können.
In diesem Sinne ist diese Weiterentwicklung des Gesetzes ein guter Schritt. Ich bin überzeugt davon, dass diese Weiterentwicklung auch in kürzeren Abständen Platz greifen kann, dann, wenn es erforderlich ist. So gesehen ersuche ich um Ihre Zustimmung zu diesem Antrag, das Gesetz zuzulassen. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
17.42
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir gelangen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Waffengesetz 1996 geändert wird (379 d.B. und 421 d.B. sowie 10095/BR d.B.)
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Wir gelangen nun zum 9. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatter ist Herr Bundesrat Mag. Dr. Michael Raml. Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatter Mag. Dr. Michael Raml: Ich erstatte den Bericht des Ausschusses für innere Angelegenheiten über den Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Waffengesetz 1996 geändert wird.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher direkt zur Antragstellung.
Der Ausschuss für innere Angelegenheiten stellt nach Beratung der Vorlage am 18. Dezember 2018 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Danke für den Bericht.
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Andreas Spanring. Ich erteile es ihm.
Bundesrat Andreas Arthur Spanring (FPÖ, Niederösterreich): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Staatssekretärin! Werte Kollegen im Bundesrat! Werte Zuschauer auf der Besuchergalerie und vor den Bildschirmen! Mit der Umsetzung der EU-Richtlinie zum Waffenrecht durch die Regierung, allen voran durch das Innenministerium, ist es gelungen, diese schwierige und heikle Materie auf einen goldenen Mittelweg zu bringen. Das beweist auch die breite Zustimmung zu dieser Novelle.
Jeder Bürger soll das Recht haben, nach klaren Regeln, nach Vorgaben und Auflagen eine Waffe legal zu besitzen. Diese EU-Richtlinie, mit der ich persönlich, ehrlich gesagt, nicht die größte Freude hatte, wurde umgesetzt, ohne maßlos zu übertreiben. Diese Regierung steht dazu, es wird kein Gold Plating, also kein Übererfüllen von EU-Vorgaben in jeder Hinsicht und in allen Bereichen geben.
Somit profitieren alle bisherigen Waffenbesitzer auch von praktikablen Übergangsfristen. Es findet in vielen Bereichen eine Entbürokratisierung statt, insbesondere im Bereich der Sportschützen. Für die Jägerschaft wurde durch die Erlaubnis der Verwendung von Schallmodulatoren eine Erhöhung des Gesundheitsschutzes für Mensch und Tier erreicht – um genau zu sein, natürlich für den Jäger und den Jagdhund –, aber auch eine Erhöhung der Sicherheit durch das Führen von Faustfeuerwaffen, notwendig eben bei der Nachsuche von Schwarzwild.
Für mich wichtig und richtig war die Gleichstellung von Justizwachebeamten und Militärpolizisten, wenn es um den Waffenpass geht, sprich um die Erlaubnis zum Führen von Faustfeuerwaffen. Diese sind nun der Polizei gleichgestellt. Ein Danke dafür Innenminister Herbert Kickl, der von Anfang an ein offenes Ohr für die Anliegen der AUF-/FEG-Personalvertreter hatte. (Beifall bei der FPÖ und bei BundesrätInnen der ÖVP.)
Diese Liberalisierung – und davon bin ich überzeugt – stellt eine weitere Erhöhung der Sicherheit unserer Bevölkerung dar. Warum ist das so? – Aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen sagen, dass es keine bessere Ausbildung an der Waffe gibt als beim Bundesheer. Drill, das böse Wort, nichts anderes als das Überlernen von etwas, erzielt in der Ausbildung die mit Abstand besten Ergebnisse. Ein Soldat, ein Justizwachebeamter oder ein Polizist darf im Ernstfall nicht nachdenken müssen, wenn es darum geht, dass er wirklich einmal seine Waffe gebrauchen muss. Er hat zu handeln und in diesem Fall seine Dienstwaffe blind zu beherrschen. (Ruf bei der SPÖ: Nachdenken sollte man schon!)
Ich vergleiche das gerne mit einem Rallyefahrer. Für einen Rallyefahrer wird es auch nicht genug sein, die Grundkenntnisse des Führerscheinkurses zu haben, sondern er muss sein Fahrzeug in jeder Situation perfekt unter Kontrolle haben. Er muss in brenzligen Situationen reagieren und auch agieren können. Das passiert durch Drillausbildung.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt eine Studie des FBI. Hört, hört: Das amerikanische FBI veröffentlichte eine mehrteilige Studie über Schießereien. Darin wurden alle aktiven Schusswechsel aus den Jahren 2000 bis 2017 – also kein kurzer Zeitraum, sondern 2000 bis 2017 – untersucht. Das Ergebnis: Bewaffnete Bürger erhöhen die Sicherheit. Und nein, eines gleich vorweg, bevor das dann wieder von der linken Seite kommt, um das gleich klarzustellen: Niemand von uns will auch nur annähernd amerikanische Verhältnisse, was den Waffenbesitz angeht. (Zwischenrufe bei der SPÖ.)
Dort bekommt fast jeder ungeprüft eine Waffe, und das ist in meinen Augen natürlich verrückt und verantwortungslos. Trotzdem zeigt diese Studie eines ganz deutlich auf, nämlich dass bewaffnete Bürger eine Erhöhung der Sicherheit darstellen. (Zwischenruf des Bundesrates Schabhüttl.) Wenn jetzt wie bei uns – und das ist traurig, wenn ein Polizist dagegenspricht – sehr gut an der Waffe und nach den gesetzlichen Vorgaben ausgebildete Kollegen der Justizwache und Kameraden der Militärpolizei in ihrer Freizeit Waffen tragen dürfen, dann ist das eine ganz klare Erhöhung der Sicherheit, denn die wissen ja, was sie tun, nicht nur im Dienst, sondern, wie ich hoffe, sondern auch in der Freizeit.
Eine Erhöhung der Sicherheit bewirkt auch die Tatsache, dass Asylwerber und Asylberechtigte zukünftig keine Waffen oder in den meisten Fällen keine Messer mehr mit sich führen dürfen. Ich erinnere an den Sicherheitsbericht 2017, den hatten wir bei der letzten Bundesratssitzung auf der Tagesordnung. Es gab 1 060 Anzeigen von Angriffen mit Hieb- und Stichwaffen, und Tatsache ist, dass es im Jahr 2018 bereits 123 Angriffe mit Messern auf Polizisten gab.
In der Vergangenheit haben die vereinigten Linken und leider auch viele Unwissende bei uns nach Terroranschlägen immer eine Verschärfung des Waffenrechts gefordert. (Bundesrätin Hahn: Vorsicht! – Weitere Zwischenrufe bei der SPÖ.) Persönlich habe ich mir dann immer gedacht, was sie sich bei solchen Aussagen denken, als ob Terroranschläge mit legalen Waffen begangen würden. Nein, meine Damen und Herren, Terroranschläge werden nicht mit legalen Waffen begangen. Die Einzigen, die man mit einer Verschärfung des Waffenrechts bestraft, sind jene Menschen, die sich an Gesetze halten; rechtschaffene Bürger, die bestrafe ich mit einer Verschärfung des Waffenrechts, also genau jene, von denen im Normalfall sowieso keine Gefahr und kein Risiko ausgehen sollte.
Glauben Sie wirklich, dass sich Attentäter oder andere Verbrecher von einer Verschärfung des Waffenrechts abhalten lassen, eine Straftat zu begehen? – So nach dem Motto: Eigentlich wollte ich einen Terroranschlag verüben oder eine Bank überfallen, aber es gibt das neue Waffengesetz, ich darf keine Waffen mitnehmen, darum mache ich es nicht!? Ist das Ihr Ernst? Echt jetzt? Genau in diese Richtung geht das. – Das Gegenteil ist der Fall: Je mehr die Bevölkerung entwaffnet wird, desto leichteres Spiel haben Verbrecher.
Darum freut es mich, dass diese Änderungen im Waffengesetz mit Augenmaß und Hausverstand vorgenommen werden, unter anderem umgekehrt auch die Verschärfung im Bereich der psychologischen Gutachten, bis hin zur Zehnjahressperre für Personen, die ganz einfach keine Waffen tragen sollten, denn auch das gibt es. Das ist sehr positiv.
Eine Anekdote – ich war nicht dabei, aber ich will sie Ihnen trotzdem erzählen, weil es einen Kollegen und Freund von mir betroffen hat –: Ein Justizwachebeamter der Justizanstalt Wien-Josefstadt, Mitglied der Einsatzgruppe, also eigentlich besonders gut im Waffenumgang geschult, war 2016 in der Millenium City in Wien im Kino. Er hatte seine private Faustfeuerwaffe mit, und als er sich vor dem Kinobesuch um etwas bückte, das ihm hinuntergefallen ist, ist hinten seine Waffe kurz sichtbar geworden. Das hat jemand gesehen und der hat sofort die Polizei gerufen. Die Polizei und die Cobra sind ausgerückt. Es war noch dazu ein Batman-Film. Ich glaube, der eine oder andere von Ihnen wird sich erinnern, es gab im Jahr 2012 in Amerika, also in Aurora, einen Amokläufer, der bei einem Batman-Streifen damals zwölf Menschen erschossen und, ich glaube, 58 oder 60 verletzt hat.
Der Film hatte Überlänge, und in der Pause wurde mein Kollege von zivilen Cobra-Beamten eingekreist. Er hat gesehen, dass diese auf ihn zukommen, und hat sofort gewusst, dass da irgendetwas im Gange ist. Er hat perfekt reagiert, seine Hände ohne
vorherige Aufforderung gut sichtbar gehalten und gesagt, er ist zum Tragen der Waffe berechtigt. Für ihn war sofort klar, dass es sich dabei um zivile Polizei- und Cobra-Beamte handeln muss. Er hat ihnen auch gesagt, wo er die Waffe hat. Die haben ihm die Waffe abgenommen, sind mit ihm hinausgegangen, haben sich das alles angeschaut und haben die Papiere überprüft. Es war alles in Ordnung und der Abend konnte dann weitergehen.
Warum erzähle ich Ihnen das, meine Damen und Herren? – Ich erzähle das, weil ich das insgesamt als Erfolgsgeschichte empfinde, erstens weil mein Kollege völlig richtig und perfekt reagiert hat. Es haben die Beamten der Polizei und der Cobra perfekt agiert. Es hat derjenige, der den Typ mit der Waffe gesehen hat – der konnte ja nicht wissen, dass das ein Justizwachebeamter ist –, auch richtig reagiert, denn er hat sofort die Polizei angerufen und gesagt, da ist irgendetwas im Gange. Auch das war perfekt, es ist auch diese Zivilcourage zu begrüßen.
Am Positivsten an der ganzen Situation ist aber folgende Tatsache: Hätte es damals in der Millenium City aus irgendwelchen Gründen einen Zwischenfall gegeben, bei dem jemand mit einem Messer oder einer Waffe auf irgendjemanden losgegangen wäre, dann weiß ich, dass mein Kollege, den ich persönlich gut kenne und sehr schätze, dazwischengegangen wäre und dass er aufgrund dessen, dass er eine Waffe mithatte, auch in einer Extremsituation hätte einschreiten können. Er hätte damit Unschuldige vor Schaden bewahrt, vielleicht sogar Leben gerettet, weil die Polizei im Ernstfall ein, zwei Minuten dorthin gebraucht hätte. Alles in allem ist das also sehr positiv.
Die Änderungen im Waffengesetz sind zu begrüßen, weshalb wir Freiheitliche diesen Beschluss auch voll und ganz mittragen werden. (Beifall bei FPÖ und ÖVP.)
17.53
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Danke.
Bevor ich dem nächsten Redner das Wort erteile, würde ich ersuchen – auch wenn Zwischenrufe natürlich erlaubt und vollkommen in Ordnung sind –, das Niveau etwas zu halten und die Würde des Hauses zu beachten. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
Als Nächster zu Wort gemeldet ist Bundesrat Bruno Aschenbrenner. Ich erteile es ihm.
Bundesrat Ing. Bruno Aschenbrenner (ÖVP, Steiermark): Geschätzter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Staatssekretärin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer! Plop, da fällt er um, der Gangster, und keiner hat es mitbekommen. James Bond hebt seine schallgedämpfte Waffe, bläst den Rauch von der Mündung, und man hat wieder das Gefühl, schallgedämpfte Waffen töten schnell, leise und effizient.
All das ist nur ein Märchen. Vielmehr handelt es sich hierbei um, wie es auch im Gesetz steht, eine Vorrichtung zur Dämpfung des Schussknalles, um ein höchstmögliches Maß an Gesundheitsschutz zu erreichen. Die Schallwellen des durch den Schuss verursachten Lärms gelangen über das Mittelohr zum Innenohr, wo sich die Sinneszellen befinden. Bei der Schussabgabe einer Jagdwaffe kommt es zu Werten von über 150 Dezibel und Schalldruckspitzen unter drei Millisekunden. Diese führen durchaus zu irreversiblen Schäden der Haarsinneszellen.
Schallmodulatoren verringern je nach Bautyp und Ausführung diese Lärmspitzen um bis zu 35 Dezibel. Somit wird ein Wert erreicht, der unter dem medizinisch kritischen Wert von 137 Dezibel liegt. Ein schon vergleichsweise niedriger Schalldämpfungswert von 20 Dezibel ist gleichbedeutend mit einer Reduktion des Schalldruckes um nahezu 90 Prozent. Es ist also für die Jägerinnen und Jäger, welche das Weidwerk aktiv und regelmäßig ausüben, mit dieser Gesetzesänderung ein wesentlicher Beitrag für sie und
ihren vierbeinigen Jagdbegleiter zur Gesundheitsförderung erreicht worden, der mich persönlich, da ich selbst praktizierender Jäger und Jagdaufsichtsorgan bin, sehr freut.
Das ist auch die Schaffung der Regelung zum Führen einer Faustfeuerwaffe während der Ausübung der Jagd. Vor allem bei Nachsuchen von wehrhaftem Wild, wie es schon angesprochen wurde, etwa nach Wildunfällen, kommt es immer wieder zu sehr gefährlichen und brenzligen Situationen, vor allem im Siedlungsgebiet, aber auch in unwegsamem Gelände. Es handelt sich durchaus auch immer wieder um im Zuge von Verkehrsunfällen angefahrenes Wild. Es ist nicht immer der Jäger durch das Abgeben des Schusses schuld an einer Nachsuche.
In diesen Situationen ist ein gezielter Schuss mit Langwaffen oftmals nicht möglich. Der Schuss ist aus Sicht der Sicherheit für den Menschen, aber auch, um unnötiges Tierleid zu verhindern, mit Faustfeuerwaffen effizienter möglich.
Geschätzte Damen und Herren! Begrüßenswert ist ausdrücklich, dass künftig nicht nur die Organe der öffentlichen Sicherheitsdienste, sondern auch Mitglieder der Justizwache und der Militärpolizei ohne gesonderten Nachweis des Bedarfs einen Waffenpass erhalten können. Gefährdete Berufsgruppen brauchen Unterstützung und Rückhalt aus der Politik, und mit diesem Waffengesetz setzen wir ein klares Zeichen, dass wir sie nicht im Stich lassen, wie auch ein klares Zeichen gesetzt wird, wenn es um die Ausweitung des Waffenverbotes für bestimmte Drittstaatsangehörige geht.
Für manche sind die Stichwaffen, die sie bei sich tragen, ein Teil ihrer Persönlichkeit, für die Mitmenschen stellen sie allerdings eine große Gefahr dar. Die tragischen Zwischenfälle in Innsbruck und Steyr in den letzten Wochen, bei denen junge, unschuldige Menschen ihr Leben verloren haben, zeigen ganz klar, wie notwendig dieses Waffenverbot ist. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
Neben der Umsetzung der EU-Waffenrichtlinie, die die strenge Regelung in Bezug auf halbautomatische Schusswaffen mit großen Magazinen ebenso beinhaltet wie die Neukategorisierung, mittels derer Waffen mit glattem Lauf, sogenannte Flinten, in die Kategorie C übergeführt werden, wird auch dem Gutachtertourismus ein Riegel vorgeschoben. Persönlich halte ich die Wartefrist bei psychologischen Gutachten, wenn diese nicht positiv ausfallen, für sehr lobenswert. Die Wartezeit von einem halben Jahr sowie die zehnjährige Sperre nach drei negativen Gutachten, die es bisher nicht gab, geben Sicherheit.
Geschätzte Damen und Herren! Alles in allem ist das eine gelungene Gesetzesänderung mit klarem Bekenntnis zu mehr Sicherheit für unsere Bevölkerung und Wertschätzung für die öffentlichen Wachen, aber auch für mehr Gesundheit für unsere praktizierenden Jägerinnen und Jäger, was mich persönlich sehr freut. Ein großer Dank an unsere Bundesregierung! – Danke schön. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
17.59
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Jürgen Schabhüttl. Ich erteile es ihm.
Bundesrat Jürgen Schabhüttl (SPÖ, Burgenland): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geschätzte Frau Staatssekretärin! Kolleginnen und Kollegen hier im Hause! Ich bin ja als Proredner zu Wort gemeldet – aber beginnen möchte ich schon mit Folgendem: Wenn die Vorredner hier eine Rede zur Waffengesetznovelle mit Batman und James Bond anfangen, dann ist das, glaube ich, nicht der richtige Weg. (Bundesrätin Mühlwerth: Na da redet der Richtige!)
Man sollte den Zusehern schon vermitteln, dass wir hier eine Gesetzesänderung zur Sicherheit der Bevölkerung, zur Sicherheit gewisser Berufsgruppen et cetera erlassen.
Wenn dann ein Kollege der Exekutive – ich glaube, du bist von der Justizwache, Kollege Spanring – sagt, mehr bewaffnete Bürger würden mehr Sicherheit bringen, und mich anspricht, und sagt, das müsste ich als Polizist verstehen: Du wirst wahrscheinlich keinen Polizisten treffen, der sagt: Gebt den Leuten mehr Waffen, damit unsere Gesellschaft sicherer ist! – Das ist gerade das Gegenteil! (Beifall bei der SPÖ. – Bundesrat Spanring: Ich habe gesagt ...! – Bundesrat Schuster: Aber man kann auch nicht alle Waffenbesitzer kriminalisieren, oder?)
Jeder Polizist wird sagen: Weniger Waffen in der Gesellschaft, weniger Waffen in den Häusern, weniger Waffen irgendwo umgehängt bedeutet mehr Sicherheit für die Gesellschaft und bringt natürlich auch mehr Sicherheit für die Polizistinnen und Polizisten. (Bundesrätin Mühlwerth: Das mit dem sinnerfassenden ...!)
Zur Frau Staatssekretärin: Danke für das spontane Kommen, so sagt der Präsident immer. (Heiterkeit des Vizepräsidenten Brunner.) Ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse unseren Minister Kickl gar nicht. (Beifall bei der SPÖ sowie des Bundesrates Stögmüller.) Wenn Sie jedes Mal kommen und Ihre Expertise so sachlich und fachlich vorbringen, ist mir das lieber, als wenn der Minister, der eh nicht hier sein will (Bundesrat Samt: Mutmaßen, was Sie da tun!), widerwillig herkommt und dann auch dementsprechende Aussagen tätigt.
Mit den Änderungen des Waffengesetzes wird – jetzt kommen wir wieder zur Sache zurück – einerseits eine EU-Richtlinie umgesetzt, andererseits werden natürlich nationale Regelungen getroffen. Als wir den ersten Entwurf auf den Tisch bekommen haben, war ich, auch in der internen Besprechung, einer der Ersten, die diesen Gesetzentwurf in groben Zügen gutgeheißen haben, einer der Ersten, der gutgeheißten hat, dass es strengere Regelungen in Bezug auf umgebaute Schusswaffen, auf halbautomatische Schusswaffen gibt, weniger Magazinkapazität, dass es jetzt nur mehr drei Kategorien gibt – A, B und C; Abschaffung der Kategorie D –, dass es eine bessere Nachverfolgbarkeit von Schusswaffen durch Anzeige der Überlassung von Schusswaffen jeglicher Kategorie, auch bei einem Erwerb aus dem Ausland gibt oder dass es eine Meldeverpflichtung für Waffenhändler im Falle verdächtiger Transaktionen gibt.
Auch den nationalen Änderungen habe ich von Anfang an sehr viel abgewinnen können, sei es die Festlegung einheitlicher Kriterien für Sportschützen oder die Ausnahmeregelung für Jäger betreffend Schalldämpfer, die schon der Vorredner dargelegt hat; dies ist unserer Meinung nach auch eine Sache, mit der dem Gesundheitsschutz Rechnung getragen wird.
Dem Wunsch, dass Jäger in Ausnahmefällen Waffen der Kategorie B für die Nachsuche führen dürfen sollen, sind wir nach Rücksprache mit mir bekannten Jägern nachgekommen. Man muss das halt dann so sehen, wie es gemeint ist und im Gesetz steht: zur „Ausübung der Jagd“, der Nachsuche, also nicht generell, und immer gleichzeitig mit der Langwaffe, das heißt mit der normalen Schusswaffe – nicht getrennt und nicht, wenn das Tier dann erlegt ist, vielleicht irgendwo im Gasthaus.
Die Möglichkeit für Angehörige der Justizwache oder der Militärpolizei, einen Waffenpass zu bekommen, ist meiner Meinung nach grundsätzlich auch kein Problem. Auch die Aufhebung der Beschränkung auf Kaliber bis 9 Millimeter ist meines Erachtens mehr als okay. Die Einführung der sechsmonatigen Wartefrist, wenn jemand ein negatives waffenpsychologisches Gutachten bekommen hat, und einer Sperre von zehn Jahren nach drei negativen Gutachten ist für mich mehr als nachvollziehbar.
Prinzipiell möchte ich sagen, dass diese Änderung des Waffengesetzes ein gutes Beispiel dafür ist, dass man auch bei verschiedensten ideologischen Grundeinstellungen gemeinsam eine praktikable Lösung finden kann. Auch aufgrund der Unterstützung des von uns eingebrachten Abänderungsantrages im Ausschuss und auch der einstimmi-
gen Entschließung, die Kollege Wanner nach mir noch ausführen wird, werden wir diesem Gesetzentwurf zustimmen und ihn mit unseren Stimmen unterstützen.
Summa summarum, wie gesagt: Wenn ein wenig die Worte zurückgenommen werden und man sich auf das Wesentliche dieser Novellierung des Waffengesetzes besinnt, dann sind wir auf einer Linie, dann brauchen wir hier auch keine Diskussion zu führen. Wenn ich einem Bundesrat mit einem Ausspruch zu nahe getreten bin, dann will ich mich dafür entschuldigen. (Beifall bei der SPÖ sowie bei BundesrätInnen von ÖVP und FPÖ. – Ruf bei der FPÖ: Kein Problem!)
18.05
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Vielen Dank, auch für das Zurücknehmen der Emotionen. – Danke schön.
Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Georg Schuster. Ich erteile es ihm.
Bundesrat Georg Schuster (FPÖ, Wien): Sehr geehrter Präsident! Sehr geehrte Frau Staatssekretärin! Werte Zuseher auf der Galerie, vor den Fernsehgeräten und via Livestream! Die Änderung des Waffengesetzes setzt ja, wie wir bereits gehört haben, die EU-Richtlinie über die Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes von Waffen um und bringt mehrere Änderungen. Ich glaube, dass dieses geänderte Waffengesetz ein guter Mix aus notwendiger Verschärfung einerseits, aber auch notwendigen Erleichterungen und vor allem vereinfachter administrativer Verwaltung andererseits ist.
Verschärfungen gibt es, wir haben es schon gehört, bei Halbautomaten mit hoher Magazinkapazität, bei der psychologischen Überprüfung, aber auch der Abnahme von waffenrechtlichen Dokumenten sowie für Drittstaatsangehörige. Erleichterungen hingegen gibt es bei Jägern, Sportschützen, Justizwachebeamten und Militärpolizisten. Ganz wichtig noch – der Kollege hat es schon erwähnt – ist die Verschärfung beim waffenpsychologischen Gutachten: Bisher konnte dieser Test ja so oft wiederholt werden, wie man wollte, was zu diesem Bundeslandtourismus geführt hat. Glauben Sie mir eines, meine Damen und Herren: Jeder, der diesen Test nicht schafft, sollte besser wirklich keine Waffendokumente ausgestellt bekommen!
Nun, auch diese Wartefrist ist also sehr zu begrüßen, auch die Zehnjahressperre. Ich brauche darauf jetzt nicht noch einmal genauer einzugehen, die Kollegen haben es vorhin schon getan. Was aber noch nicht erwähnt worden ist: Die Abnahme waffenrechtlicher Dokumente wird dahin gehend verschärft, dass Jägern, die auch Waffen der Kategorie B besitzen, bei einem Waffenverbot zukünftig auch die Jagdwaffen abgenommen werden können. Das erscheint mir als ein wichtiger Schritt, und ich glaube nicht, dass das eine Diskriminierung den Jägern gegenüber ist.
Auch die Erweiterung des Schusswaffenverbots für Drittstaatsangehörige auf sämtliche Waffen ist leider eine notwendige Maßnahme. Wenn wir uns die Statistik ansehen, zeigt sich, es gibt immer mehr schwere Straftaten an unschuldigen Menschen, die vor allem mit Messern, also Hieb- und Stichwaffen verübt werden.
Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes sowie Justizwachebeamten, die mit Personen mit erhöhtem Gewaltpotenzial zu tun haben, wird die Ausstellung des Waffenpasses erleichtert, das ist auch positiv.
Betreffend die Sportschützen ist ganz wichtig, dass diese jetzt für den sportlichen Zweck mehr Waffen besitzen dürfen und damit erstmals Rechtssicherheit in diesem Bereich geschaffen wurde. Auch die Verhinderung von Gehörschäden durch die Verwendung von Schalldämpfern wurde schon angesprochen.
Alles in allem ist diese Novelle eine besonders gute Novelle, finde ich, und auch eine verwaltungsvereinfachende Maßnahme für die Behörden. Ich denke, dass gerade die Vereinheitlichung der Kategorisierung auf drei Waffenkategorien etwas Gutes ist.
Ich habe in meiner letzten Rede ein bisschen auf die Kollegen der Opposition geschimpft oder war ein bisschen ruppig, das gebe ich zu – was mich aber an dieser Gesetzesänderung besonders freut, ist, dass die Opposition im Nationalrat und auch hier im Bundesrat sehr konstruktiv an dieser Änderung des Waffengesetzes mitgearbeitet hat. Ich glaube, Sie sehen: Wenn man konstruktiv mit den Regierungsfraktionen zusammenarbeitet, ist es immer möglich, Ideen umzusetzen, wenn wir von euch, von Ihnen etwas bekommen. – Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. (Beifall bei FPÖ und ÖVP. – Zwischenruf des Bundesrates Weber. – Bundesrat Lindinger: Aber nur wenn es Sozialdemokraten sind!)
18.09
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Michael Wanner. Ich erteile es ihm.
Bundesrat Michael Wanner (SPÖ, Salzburg): Herr Präsident! Frau Staatssekretärin! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Geschätzte Zuhörer! Kollegen Spanring muss ich schon eines sagen: Ich habe die Militärakademie besucht – war davor Einjährig-Freiwilliger –, habe diese absolviert, aber weder wurde uns gelehrt, dass wir beim Hantieren mit Waffen nicht denken dürfen, noch haben wir das jemals gelehrt – das möchte ich einfach nur klar sagen, das ist ein Blödsinn. (Beifall bei der SPÖ. – Bundesrat Spanring: Sinnerfassend zuhören!) Der erste Spruch bei den Sicherheitsbestimmungen heißt: Hirn einschalten, dann die Waffe nehmen!
Mehr Waffen sind keine Garantie für mehr Sicherheit, das wissen wir mittlerweile. (Bundesrätin Mühlwerth: ... Blödsinn ...!) Dieses Märchen glauben anscheinend nur mehr die Trumps und die Waffenlobbyisten, und Ihre Studie, Kollege Spanring, kann ich nur Lockheed zuschreiben, denn solche Studien kommen in Amerika von der Waffenindustrie. Im Gegenteil: Gäbe es keine Waffen, würde es auch keine Waffenunfälle und auch keine Waffendelikte geben, das ist einmal eine ganz klare Ansage. Ich bin aber kein Träumer, und das sind wir alle nicht: Es gibt Waffen, im Privatbereich, im Exekutivbereich, es gibt auch illegale Waffen (Bundesrat Schuster: Viele illegale Waffen!), das ist so – aber gäbe es keine, gäbe es auch keine Waffendelikte. (Bundesrat Schuster: Na ja!)
Das Ziel dieses Gesetzes, das muss man schon sagen, ist nicht, dass jemand Rambo spielt, sondern Ziel ist, die höchstmögliche Sicherheit für alle Personen, für alle Österreicher, für alle Damen und Herren sicherzustellen – das ist die Intention dieser Gesetzesänderung, und nichts anderes. Da immer wieder neue Technologien entwickelt werden und auch neue Strömungen entstehen, müssen die Gesetze permanent nachjustiert und nachgeschärft werden, das ist ganz klar. Mit dieser Gesetzesänderung werden EU-Richtlinien umgesetzt und praxisbezogene Verwaltungsverfahren vereinfacht.
Ich möchte auf die Aspekte, die meine Vorredner schon angesprochen haben, nicht eingehen, sondern möchte erklären, warum wir als SPÖ da unter anderem zustimmen. Das sind zwei ganz wichtige Punkte: Der eine Punkt ist, dass im BVT-Untersuchungsausschuss herausgekommen ist, dass mehrere Personen in der extremistischen Szene Waffenpässe besitzen. Das ist ein hohes Sicherheitsrisiko: Die können sich, eine Waffe führend, in der Bevölkerung bewegen! Das ist nicht okay, deswegen auch diese Initiative. Da besteht ein erhebliches Gefahrenpotenzial gegenüber der Bevölkerung, aber auch den Exekutivkräften, wenn diese Waffen mitführen dürfen. Künftig darf also an Personen, die sich im Umfeld von kriminellen Organisationen bewegen – egal, ob ideologisch oder religiös motiviert –, die eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen, kein Waffenpass mehr ausgegeben werden.
Der zweite Punkt wurde schon angesprochen, und zwar, dass Jägern bei der Verhängung eines vorläufigen Waffenverbots auch die Jagdkarte abgenommen werden
kann. Das ist allerdings noch auszuverhandeln, denn wie wir wissen, sind ja für diesen Bereich die Landesregierungen zuständig. Ich denke aber, da könnte es durchaus eine saubere Lösung geben, es geht ja um den Sicherheitsaspekt, dass Menschen mit einer Jagdkarte über diese nicht zu einer weiteren Waffe kommen. Es geht da vor allem um den Bereich der häuslichen Gewalt, da ist das ein enormer Schutz und eine gute Initiative, die von uns eingebracht wurde – danke auch da für die Zustimmung.
Der dritte Punkt, den ich anschneiden möchte, ist der psychologische Test: dass man dazu erst nach sechs Monaten wieder antreten darf und nach drei negativen Gutachten zehn Jahre gesperrt ist, ist das eine. Ich darf aber auch eines zu bedenken geben: Wir wissen, Jägerinnen und Jäger sind bestens an Waffen ausgebildet und betreffend Sicherheitsbestimmungen geschult – sie sind aber die einzige Gruppe, die vom psychologischen Test ausgenommen ist. Die Schulung an der und die Handhabung der Waffe hat aber nicht unbedingt etwas mit einer psychologischen Eignung zu tun – ich denke mir, man könnte zukünftig darüber nachdenken, ob man in diese Richtung etwas macht. Ansonsten stimmen wir dem Gesetzesvorschlag zu. – Ich danke. (Beifall bei der SPÖ sowie der Bundesräte Tiefnig und Preineder.)
18.15
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Zu einer tatsächlichen Berichtigung zu den Ausführungen von Bundesrat Wanner hat sich Herr Bundesrat Andreas Spanring zu Wort gemeldet. – Bitte.
Bundesrat Andreas Arthur Spanring (FPÖ, Niederösterreich): Herr Kollege Wanner, ich habe nicht gesagt, dass man nicht nachdenken sollte, sondern – und ich glaube, Sie haben es auch verstanden, nur Sie wollen es nicht verstehen – es geht darum, dass man, wenn man eine Waffe benutzt, nicht nachdenken muss, wie man sie richtig bedient. Darum habe ich den Vergleich mit dem Rallyefahrer gebracht, der muss auch nicht nachdenken: So, jetzt kommt eine Kurve, ich lenke nach links, ich muss jetzt kuppeln und bremsen!; und bei der Waffe ist es dasselbe.
Bei der Drillausbildung – das haben Sie, glaube ich, auch in ihrer Einjährig-Freiwilligen-Ausbildung beim Bundesheer erfahren – übt man, die Waffe perfekt zu beherrschen; nicht mehr und nicht weniger. Was alles andere angeht: Wir sind in Gesetzen geschult. – Danke. (Beifall bei der FPÖ sowie der Bundesräte Bader und Seeber.)
18.16
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Zu einer weiteren tatsächlichen Berichtigung hat sich Bundesrat Schabhüttl zu Wort gemeldet. – Bitte.
Bundesrat Jürgen Schabhüttl (SPÖ, Burgenland): Ich möchte tatsächlich berichtigen, und das wird man auch im Protokoll lesen können: Im Kontext der Schulung und der Ausbildung (Bundesrat Weber: Drill!) sollen Polizisten und, ich glaube, Bundesheerangehörige nicht mehr nachdenken, wenn sie die Schusswaffe einsetzen – und das geht gar nicht. (Bundesrat Spanring: Es geht um die Handhabung!)
Ich habe nämlich auch einen Zwischenruf getätigt: Man muss immer nachdenken! Bei jedem Schusswaffengebrauch, und wenn es nur ganz kurz ist: Ohne Nachdenken geht gar nichts! Du hast es so gesagt, du musst das zur Kenntnis nehmen, es ist so. (Beifall bei der SPÖ. – Bundesrätin Mühlwerth: Setz dich nieder!)
18.16
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Damit hätten wir das geklärt.
Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Staatssekretärin Mag. Edtstadler. – Bitte.
18.17
Staatssekretärin im Bundesministerium für Inneres Mag. Karoline Edtstadler: Herr Präsident! Sehr geehrte Mitglieder des Bundesrates! Sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher! Ich darf mit der persönlichen Anmerkung von Ihnen, Herr Bundesrat Schabhüttl beginnen, die mich sehr freut. Ich kann mich nämlich erinnern, dass es auch andere Zeiten im Bundesrat gab, als bekannt wurde, ich komme in Vertretung des Herrn Bundesministers, die Freude enden wollend war und man immer wieder gesagt hat, man wolle aber den Herrn Bundesminister hier sehen. (Heiterkeit bei der SPÖ. – Bundesrat Stögmüller: Wollen nicht, aber ...!) Insofern freut mich das also persönlich sehr.
Ich möchte dazu auch sagen: Wir in der Regierung – und insbesondere auch der Herr Bundesminister und ich – ziehen natürlich an einem Strang. Das Bundesministerium für Inneres, ich habe das auch gestern bei der Weihnachtsfeier gesagt, hat ein derart großes Portfolio, dass aus diesem Grund dem Bundesminister eine Staatssekretärin an die Seite gegeben wurde. Ich darf Ihnen auch sagen, ich freue mich jedes Mal, zu Ihnen in den Bundesrat zu kommen! (Beifall bei ÖVP und FPÖ. – Bundesrat Seeber: Bravo!)
Nicht nur der vorweihnachtlichen Stimmung ist es geschuldet, sondern auch der Qualität des Gesetzentwurfs, dass hier Eintracht besteht, was die Zustimmung betrifft. Ich möchte jetzt nicht alles wiederholen, was bereits gesagt worden ist. Der wesentliche Punkt ist, dass aufgrund der Umsetzung der EU-Richtlinie eine Änderung vorzunehmen war und wir das dazu genutzt haben, nicht Gold Plating zu betreiben, sondern, ganz im Gegenteil, verwaltungsvereinfachende Maßnahmen vorzusehen, eine strengere Kategorisierung und ein strengeres Vorgehen bei psychologischen Tests einzuführen; das halte ich für eine ganz wesentliche Sache.
Eines möchte ich an dieser Stelle noch einmal sagen: Jeder einzelne Schusswaffengebrauch ist für sich extrem heikel, ist für sich eine Situation, in der man natürlich darüber nachdenken muss, ob man von der Schusswaffe Gebrauch macht oder nicht. Was aber hier gemeint war – auch von Personen, die ja damit zu tun hatten und haben, die das aus ihrem beruflichen Umfeld kennen –, ist, dass die Handhabung an sich nicht etwas sein darf, über das man nachdenken muss, denn dann wird es nämlich wirklich gefährlich.
Sehr oft ist es ja so, dass der Vorgang der Schussabgabe in Sekundenschnelle vor sich geht, und deshalb ist es eben notwendig, dass die betreffenden Personen entsprechend mit den Waffen umgehen können. Das ist selbstverständlich kein Ersatz dafür, dass über den Gebrauch an sich nachgedacht und auch abgewogen werden muss. Sie wissen das ja selbst aus dem Bereich, in dem Sie tätig sind, dass jeder Schusswaffengebrauch entsprechend untersucht wird.
Alles in allem möchte ich mich für die positiven Äußerungen bedanken, ich werde das selbstverständlich auch dem Herrn Bundesminister zur Kenntnis bringen, und jetzt freue ich mich auf die Abstimmung. – Danke. (Beifall bei ÖVP und FPÖ sowie bei BundesrätInnen der SPÖ.)
18.19
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Danke. Weitere Wortmeldungen dazu liegen nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir gelangen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Mehrheit, der Antrag ist somit angenommen.
10. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Russischen Föderation über die gegenseitige Hilfeleistung bei Naturkatastrophen oder technischen Katastrophen und die Zusammenarbeit bei deren Prävention (256 d.B. und 423 d.B. sowie 10096/BR d.B.)
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Wir gelangen nun zu Punkt 10 der Tagesordnung.
Berichterstatter ist Herr Bundesrat Andreas Spanring. Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatter Andreas Arthur Spanring: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Staatssekretärin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Ich bringe den Bericht des Ausschusses für innere Angelegenheiten über den Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Russischen Föderation über die gegenseitige Hilfeleistung bei Naturkatastrophen oder technischen Katastrophen und die Zusammenarbeit bei deren Prävention.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher zur Antragstellung.
Der Ausschuss für innere Angelegenheiten stellt nach Beratung der Vorlage am 18.12.2018 mit Stimmenmehrheit den Antrag,
1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben,
2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Danke für den Bericht.
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Stefan Schennach. Ich erteile es ihm.
Bundesrat Stefan Schennach (SPÖ, Wien): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geschätzte Frau Staatssekretärin! Wenn man will – und Sie haben ja vorhin auch betreffend die Debatte zum Waffengesetz erwähnt, mit welcher großen Mehrheit das angenommen wird –, dann braucht man nur ein bisschen Dialog. Es ist ein gutes Abkommen, und wir hätten das auch alle mitgetragen. Wir hatten nur einen kleinen Wunsch: nicht jetzt – sondern mit einer zwei- oder dreimonatigen Verschiebung, weil gerade jetzt nach dem Vorfall im Asowschen Meer ein Übergang zu business as usual wahrscheinlich nicht in Ordnung ist. Wie Kollege Köck und Frau Mühlwerth wissen, findet im Jänner in Straßburg eine Dringlichkeitssitzung zur Situation im Asowschen Meer statt.
Das Abkommen ist komplett in Ordnung, da geht es um Schadenersatzkosten, Einsatzkosten, Entschädigungen und darum, wie sie unkompliziert untereinander verrechnet werden, Erleichterungen bei Katastrophen und Hilfeleistungen bei Grenzübertritt und, und, und. Wir hätten dem gerne zugestimmt. Die Russische Föderation hat ungefähr 40 solche Abkommen, und solche Abkommen bedeuten ja immer: keine Sackgassen. Alleine die russische Frachtflotte wäre in einem Katastrophenfall schon etwas Interessantes, während wir wiederum etwas anderes einbringen; all das ist drinnen.
Wir haben gesagt, wir stimmen dem auch zu, aber nicht jetzt – nicht jetzt business as usual. Ab Februar oder März schaut die Situation anders aus – Weltsicherheitsrat, Dringlichkeitssitzung in Straßburg und so weiter und so fort –, aber so können wir nicht, weil
der kleine, minimale, zu respektierende Wunsch der Opposition war: nicht jetzt business as usual. Das Abkommen an sich ist aber gut. – Danke. (Beifall bei der SPÖ.)
18.24
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Gottfried Sperl. Ich erteile es ihm.
Bundesrat Gottfried Sperl (FPÖ, Steiermark): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Staatssekretärin! Geschätzte Damen und Herren auf der Galerie und via Livestream! Kolleginnen und Kollegen! Katastrophen kommen meistens zu einer Zeit, da man nicht damit rechnet, und an Orten, an denen man sie nicht erwartet. Die Hilfe nach Naturkatastrophen oder auch nach technischen Katastrophen muss rasch und unbürokratisch erfolgen. Da man aber im Vorhinein nicht weiß, in welchem Ausmaß und in welcher Qualität Hilfe benötigt wird, kann man sie nicht spezifisch vorbereiten. Was man aber vorbereiten kann, sind die grenzüberschreitenden Regeln und Vereinbarungen zwischen Staaten, um im Anlassfall entsprechend rasche Hilfe sicherstellen zu können.
Genau in diese Kategorie fällt das gegenständliche Abkommen zwischen den Regierungen der Russischen Föderation und der Republik Österreich. Es legt fest, welche Behörden im Einsatzfall zuständig sind: das BMI beziehungsweise das Ministerium für Zivile Landesverteidigung. Enthalten sind weiters einvernehmliche Festlegungen betreffend Art und Umfang der Hilfeleistung im Einzelfall – Experten, Hilfsmannschaften, Hilfsgüter –, die Erleichterung des Grenzübertritts mit den notwendigen Ausrüstungsgütern und Hilfsgütern, zum Beispiel Informationen darüber, wo Grenzübertrittstellen für die Hilfsmannschaften sind, welche Dokumente erforderlich sind et cetera. Es ist auch geregelt, dass die Hilfsmannschaften und Experten berechtigt sind, ihre Uniformen zu tragen. Hilfs- und Ausrüstungsgüter, die ein- und wieder ausgeführt werden, sind von den Zollabgaben befreit et cetera.
Beim Einsatz, zum Beispiel von Bundesheer oder Polizei, gilt das Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland beziehungsweise umgekehrt, bei uns, wenn Truppen aus dem Ausland kommen, das Truppenaufenthaltsgesetz. Geregelt ist der Einsatz von Luftfahrzeugen für das schnelle Heranführen von Hilfsmannschaften, wobei der Einsatz von militärischen Luftfahrzeugen gegenseitig abgesprochen sein muss.
Die Koordinierung und die Gesamtleitung der Rettungs- und Hilfsmaßnahmen sind ein wesentlicher Bereich, ebenso die Regelung von Kosten und Schadensfällen. Die entsprechenden Fernmeldeverbindungen müssen sichergestellt sein. Wichtig ist auch, dass die Bereitstellung der Kräfte freiwillig erfolgt.
Es sind also Regelungen, wie sie bereits mit vielen Staaten getroffen worden sind und wie sie sich bewährt haben. Die Russische Föderation hat mit sehr vielen Staaten in Europa und außerhalb Europas solche Abkommen, unter anderem mit Deutschland, Frankreich und den USA.
Die Ausarbeitung des Vertragswerks wurde vor zehn Jahren begonnen, war 2014 fertig, wurde dann aber wegen der Krise auf der Halbinsel Krim ausgesetzt. Nun hat man vonseiten des BMI einen Weg gefunden, auch dieses Problem zu lösen. Durch die Beifügung der Erklärung über den territorialen Geltungsbereich ist klar festgelegt, dass sich Österreich im Einklang mit der EU und den Vereinten Nationen bewegt. Somit steht der Zustimmung zu diesem Übereinkommen nichts mehr im Wege. Das Abkommen dient dazu, der jeweiligen Bevölkerung im Bedarfsfall rasch die notwendige Hilfe zukommen zu lassen. Es wäre daher selbstverständlich, dass alle Bundesräte
hier ihre Zustimmung zu diesem Übereinkommen erteilen. – Danke. (Beifall bei FPÖ und ÖVP.)
18.28
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Eduard Köck. Ich erteile es ihm.
Bundesrat Ing. Eduard Köck (ÖVP, Niederösterreich): Sehr geehrte Frau Staatssekretär! Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Abkommen wie dieses hat Österreich mit sehr vielen Ländern, damit man sich eben im Katastrophenfall gegenseitig helfen kann, und ich denke, das sind sehr gute Abkommen, weil man immer, wenn man Hilfe braucht, froh ist, wenn man Hilfe bekommen kann, und das gilt für beide Seiten. Es könnte ja auch uns treffen, dass wir Hilfe brauchen; deshalb denke ich, es wäre gut, wenn alle hier Anwesenden dieses Gesetz unterstützen, weil es wirklich ein gutes Abkommen ist.
Ich kann den Einwand, dass es nicht jetzt sein soll, nicht ganz teilen. Wir verhandeln über dieses Abkommen seit 2007, das ist also nicht irgendwie überstürzt, und jetzt haben wir endlich die Möglichkeit, es zum Abschluss zu bringen. Und ich meine, wenn man nicht will, dann findet man immer einen Grund; da sagt man einmal: Nicht jetzt!, und einmal: Nicht hier!, und dann: Nicht so! – Also das kann ich nicht wirklich verstehen.
Ich bitte, vielleicht doch noch einmal darüber nachzudenken und dieses Abkommen zu unterstützen, weil es ein gutes ist, wie ich meine. Wir werden das unterstützen. – Danke. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
18.29
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Zu Wort gemeldet hat sich Frau Staatssekretärin Edtstadler. – Bitte, Frau Staatssekretärin.
Staatssekretärin im Bundesministerium für Inneres Mag. Karoline Edtstadler: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Mitglieder des Bundesrates! Vielen Dank für all die positiven Anmerkungen. Österreich hat mit allen Nachbarländern Abkommen – mit einer Ausnahme: mit Italien gibt es keines. Auch mit anderen Staaten, mit Albanien, Jordanien, Kroatien, Marokko, Moldau, haben wir derartige Abkommen. All das betrifft die Katastrophenhilfe, und das wurde ja vielfach angesprochen. Deshalb, Herr Bundesrat Schennach, kann ich es einerseits ein bisschen nachvollziehen, andererseits verstehe ich es aber nicht, weil die Frage ist, wann der richtige Zeitpunkt ist, ein Abkommen zum Katastrophenschutz zu schließen.
Da geht es nicht um politische Fragen, sondern da geht es darum, dass man den Menschen in der Notsituation hilft und dass sich die Staaten gegenseitig unterstützen. Sie haben es ja selbst gesagt: Das ist keine Einbahnstraße, denn auch die Russische Föderation verfügt über hoch spezialisierte technische Kapazitäten, zum Beispiel strategische Transportkapazitäten, die, wenn es uns trifft, für uns auch von großer Notwendigkeit und eine wichtige Unterstützung sein können. (Vizepräsident Lindinger übernimmt den Vorsitz.)
Deshalb ist das Ziel einfach eine rasche und unbürokratische Unterstützung, nämlich vor allem auch für die Zivilbevölkerung, wenn es zu derartigen Katastrophen kommt. Ich finde, es ist einfach notwendig – ungeachtet dessen, was man sonst findet oder wo man Befindlichkeiten hat –, Abkommen zu haben, damit rasche, unbürokratische Hilfe geleistet werden kann. Daher würde ich Sie alle bitten, dieses Abkommen, losgelöst von anderen Dingen, zu unterstützen. – Vielen Dank. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
18.31
Vizepräsident Ewald Lindinger: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Es ist dies nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir gelangen zur Abstimmung.
Da der vorliegende Beschluss Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbereiches der Länder regelt, bedarf er der Zustimmung gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz.
Wir gelangen zunächst zur Abstimmung, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist somit angenommen.
Nun lasse ich über den Antrag abstimmen, dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Grenzkontrollgesetz geändert wird (498/A und 424 d.B. sowie 10097/BR d.B.)
Vizepräsident Ewald Lindinger: Wir gelangen nun zum 11. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatter ist Herr Bundesrat Georg Schuster. Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatter Georg Schuster: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich bringe den Bericht des Ausschusses für innere Angelegenheiten über den Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Grenzkontrollgesetz geändert wird.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher zur Antragstellung:
Der Ausschuss für innere Angelegenheiten stellt nach Beratung der Vorlage am 18. Dezember 2018 mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsident Ewald Lindinger: Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Martin Weber. Ich erteile ihm dieses.
Bundesrat Martin Weber (SPÖ, Steiermark): Herr Präsident! Werte Frau Staatssekretärin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der heutige Themenschwerpunkt innere Sicherheit wird auch mit diesem Tagesordnungspunkt fortgesetzt. Es geht, wie wir hörten, um das Grenzkontrollgesetz. Ich möchte dazu auf einen mir und uns sehr wichtigen Punkt eingehen.
Mit diesem Antrag, mit diesem Gesetz wird eine Befugnis für die Landespolizeidirektionen, genau genommen für den Landespolizeidirektor der jeweiligen Bundesländer, geschaffen, gemäß der er die Befehls- und Zwangsgewalt nicht nur an Organe des öf-
fentlichen Sicherheitsdienstes übergeben kann, sondern auch an andere Vertragsbedienstete. Sie müssen natürlich geeignet und geschult sein, das ist klar.
Unser Zugang als Sozialdemokratie ist aber: Wir brauchen keine Polizisten und Polizistinnen zweiter Klasse, die als Verwaltungsbedienstete auch eine Befehls- und Zwangsgewalt haben. Das lehnen wir ganz klar und deutlich ab. Was wir brauchen, sind Polizistinnen und Polizisten, die voll ausgebildet sind, damit die Sicherheit gewährleistet ist. Meiner und unserer Meinung nach ist die Sicherheit ein ganz wichtiges Grundbedürfnis jedes Bürgers, und wir brauchen da nicht verstärkt private Sicherheitsdienstleister.
Erst vor wenigen Wochen ist aufgeflogen, dass ein Rechtsextremer aus dem nahen Umfeld des bekannten Neonazis Gottfried Küssel als Securitymitarbeiter im Rahmen des parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur BVT-Affäre gearbeitet hat. Über eine private Sicherheitsfirma kam dieser rechtsextreme Privatsheriff sozusagen bis ins Innerste unserer Demokratie, ins Parlament (Bundesrat Schuster: Was hat das mit dem Grenzkontrollgesetz zu tun, bitte?), und das noch dazu bei einem ganz heiklen Untersuchungsausschuss, der sich mit skandalösen, sehr skandalösen Vorgängen befasst, in die auch der Innenminister sehr tief verstrickt ist. (Rufe bei der FPÖ: Was, bitte? Unglaublich!) Auf die versprochene lückenlose Aufklärung warten wir heute noch.
Dieses Beispiel zeigt uns, was passiert, wenn wir sensible Bereiche, für die eigentlich der Staat verantwortlich ist, in private Hände geben. (Bundesrat Rösch: Um was geht’s? Nicht was sagen und dann die Antwort schuldig bleiben!) Wir wollen keine Privatpolizei, wir wollen auch keine Teilpolizisten zweiter Klasse. Das Gewaltmonopol muss ganz klar und deutlich weiterhin in staatlicher Hand bleiben. (Beifall bei der SPÖ.)
Aus diesem Grund werden wir diesen Antrag auch ablehnen, denn was wir brauchen, sind voll ausgebildete Polizisten und Polizistinnen mit der bestmöglichen Ausstattung hinsichtlich Technik und Gerätschaft. (Ruf bei der FPÖ: Die habt ihr ja in Wien eingespart!) Diesbezüglich hat auch die Vorgängerregierung wichtige Maßnahmen geschaffen und eingeleitet, Stichwort: Bodycams, Stichschutzwesten und so weiter und so weiter.
Betreffend Polizei ist mir aufgefallen, dass 4 000 Polizisten zumindest planmäßig erfasst, aber budgetmäßig noch nicht dargestellt sind. Das ist ein bisschen wie ein Wunschzettel ans Christkindl. In diesem Kreis kann man es ja sagen: Wenn es die Eltern nicht kaufen oder vielmehr zahlen, wird es vom Christkindl nicht gebracht werden (Ruf bei der FPÖ: Ihr habt es eingespart, das ist der Unterschied!) – also bitte diese 4 000 Polizisten auch budgetmäßig darstellen! Ich weiß schon, dass Sie sehr engagiert sind, in diversen Zeitungen, dort und da Leute anwerben, aber diese Versäumnisse gab es schon unter Ihren Amtsvorgängern: dass zu wenig Personal aufgenommen worden ist, vor allem in jenen Bereichen – und das haben wir von der Sozialdemokratie immer bekrittelt –, in denen es auch immer genügend Bewerber und Bewerberinnen gegeben hat. (Heiterkeit bei der FPÖ.)
In den letzten zehn Jahren stellte immer euer Koalitionspartner den Innenminister. (Bundesrat Samt: Es gab auch einen roten Bundeskanzler! Ihr wart in der Regierung!) Der letzte SPÖ-Innenminister war ein sehr erfolgreicher, nämlich Karl Schlögl. (Beifall bei der SPÖ.)
Ein wichtiger Punkt ist: Wir haben in den letzten Jahren, fast Jahrzehnten, einen Boom von privaten Sicherheitsfirmen erlebt; eine Reglementierung mit einheitlichen Parametern haben die Innenminister der letzten zehn Jahre leider nicht zusammengebracht. Wer da wohl erfolgreich interveniert hat, dürfen wir raten. Eine Voraussetzung für einheitliche Parameter ist die Antwort auf die Frage, wann jemand von einer privaten Sicherheitsfirma eine Waffe tragen und welche Einsätze er führen darf.
Der bestehende Missstand gehört umgehend bereinigt, weil wir vernünftige Verhältnisse brauchen. Für die Sicherheit jedes einzelnen Staatsbürgers in Österreich muss dies gewährleistet und gesichert sein. – Danke. (Beifall bei der SPÖ.)
18.39
Vizepräsident Ewald Lindinger: Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Mag. Dr. Michael Raml. Ich erteile ihm dieses.
Bundesrat Mag. Dr. Michael Raml (FPÖ, Oberösterreich): Sehr geehrter Herr Präsident! Frau Staatssekretärin! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Herren auf der Galerie und zu Hause vor den Bildschirmen! Ja, wenn Herr Kollege Weber in der vorweihnachtlichen Stimmung schon das Christkind bemüht, dann, denke ich mir, ist möglicherweise ein großer Wunsch ans Christkind, den die FPÖ und auch die ÖVP seit Jahren gehabt haben, offenbar endlich erfüllt worden, nämlich der Wunsch ans Christkind, dass auch die SPÖ einmal umdenkt, wenn es darum geht, die österreichischen Grenzen zu schützen.
Es ist daher wirklich – das möchte ich in der weihnachtlichen Stimmung positiv erwähnen – erfrischend und erfreulich, wenn sich die SPÖ endlich für wirksame Grenzkontrollen einsetzt. Ich erinnere mich nämlich schon noch an das Jahr 2015, als euer Bundeskanzler Werner Faymann, das passt auch wieder zum Taxigewerbe, das wir heute schon von euch auf dem Tableau gehabt haben (Bundesrat Weber: Wer war der Innenminister? – Bundesrat Koller: Es gibt kein Weisungsrecht des Bundeskanzlers!) – na lasst mich ausreden! –, die Grenzen für alle Menschen auf dieser Erde geöffnet hat. Werner Faymann wollte gar nicht wissen, wer in unser Land hereinkommt. (Bundesrat Weber: Sobotka war Innenminister!) Der nachfolgende Kurzkanzler Kern hat diese Personen, die ihr nicht kontrollieren wolltet, kostenlos durch unser Land transportiert – eine Million Menschen, auf Kosten der österreichischen Steuerzahler! (Beifall bei FPÖ und ÖVP.)
Da muss ich wirklich sagen: Liebe Freunde von der SPÖ, dieser Sinneswandel, den ihr da herzeigt, verwundert mich, aber ich nehme das einmal grundsätzlich freudig zur Kenntnis! Es freut mich umso mehr, dass durch diesen Gesetzesbeschluss unsere Grenzkontrollen nicht nur mindestens gleich effektiv bleiben, sondern dass man damit auch gleichzeitig einsparen kann. (Bundesrat Weber: Sparen bei der Sicherheit!) Auch das Thema Einsparung ist aber bei der SPÖ noch nicht so ganz angekommen. (Bundesrat Weber: Kein Sparen bei der Sicherheit!) – Nein, du hörst mir nicht zu! Wir haben das heute schon gehabt: Ihr könnt nicht sinnerfassend zuhören, das ist euer Problem! (Beifall bei FPÖ und ÖVP.)
Das ist auch das Problem gewesen: Wenn man euch mit der Dringlichen Anfrage ein Stöckchen wirft, dann schnappt ihr nach diesem Stöckchen, ohne zu wissen, was denn dieses Stöckchen überhaupt genau bedeutet und wohin dieses Stöckchen geht – und heute ist es wie ein Bumerang zu euch zurückgekommen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPÖ! (Beifall bei FPÖ und ÖVP.)
Wir sparen nicht bei der Sicherheit, wir machen das System effizienter. (Bundesrat Weber: Sicherheit zweiter Klasse!) Im Ausschuss wurde uns dankenswerterweise vom zuständigen Ministerialbeamten ganz klar skizziert, wie es derzeit ausschaut und wofür dieses Gesetz gilt.
Es wurde durch einen Initiativantrag im Nationalrat klargestellt, dass es da einmal um die Grenzkontrollen am Flughafen Schwechat geht. Wie schaut es dort aus? – Das kennen wahrscheinlich die meisten von uns: Da gibt es einen sogenannten Glaskobel, wie er im Ausschuss genannt wurde, da sitzt ein voll ausgebildeter Polizeibeamter drinnen. Kollege Schabhüttl hat gesagt, er hat das auch jahrelang gemacht. – Du wirst es uns wahrscheinlich gleich noch erzählen.
Da wird nichts anderes gemacht, als dass der Beamte, ein voll ausgebildeter Polizeibeamter, einen Reisepass nach dem anderen kontrolliert und schaut, ob dieser gefälscht ist oder ob sonst eine Ungereimtheit vorhanden ist – das ist wichtig und in Ordnung! Wenn es dann aber zu einem Problem oder zu einer Ungereimtheit kommt, dann wird, das hat der Ministerialbeamte auch klargestellt, nicht der Polizist, der da drinnen sitzt, sofort selbst tätig, sondern er holt sich Unterstützung. Er kann ja nicht einfach diesen Wachposten verlassen, sondern er bekommt da Unterstützung.
So, und jetzt hat man sich die absolut berechtigte Frage gestellt: Braucht man – nicht mehr und nicht weniger – an einer Stelle, an der „nur“ – unter Anführungszeichen – Papiere durchgesehen werden, an der eine Erstkontrolle gemacht wird, und dann, wenn ein Problem oder eine Ungereimtheit herrscht, sowieso ein Polizeiorgan hinzugeholt wird, wirklich einen voll ausgebildeten Polizeibeamten oder kann man diese erste, primäre Kontrolle nicht einem besonders geschulten anderen Organ zukommen lassen? (Bundesrat Beer: Nicht Organ! Privat!) Da hat man gesagt: Ja, für diese eine Aufgabe gibt es und wird es künftig besonders geschulte Personen geben, Personen, die im Umgang mit Menschen besonders geschult sind, die im Bereich der Menschenrechte geschult sind, die natürlich auch die Praxis gut vermittelt bekommen.
Das alles ist im Ausschuss ganz klar festgestellt worden, wenn man aber nicht zuhören will, dann kann man sich natürlich wie heute bei eurer Dringlichen Anfrage künstlich an irgendein Stöckchen klammern. Ich kann Ihnen aber sagen: Im Sinne des Weihnachtsfriedens, denkt doch einmal ein bisschen um, sinnerfassend lesen und zuhören würde euch da auch nicht schaden! (Bundesrätin Grimling: Jetzt ist es damit aber auch einmal genug!) Wir sagen ganz klar: Wenn es darum geht, Grenzkontrollen effizient gestalten zu können, dann gibt es von uns eine ganz klare Zustimmung. (Beifall bei FPÖ und ÖVP.)
18.45
Vizepräsident Ewald Lindinger: Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Jürgen Schabhüttl. Ich erteile ihm dieses. (Bundesrätin Grimling – in Richtung FPÖ –: Sinnerfassend zuhören! – Bundesrat Raml: Ich kann zuhören!)
Bundesrat Jürgen Schabhüttl (SPÖ, Burgenland): Herr Präsident! Frau Staatssekretärin! Kolleginnen und Kollegen! Zuerst einmal zur Klarstellung: Auch jetzt gibt es noch keine Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers, das heißt, die Ministerien handeln in Eigenverantwortung. Das ist einmal die erste Klarstellung. (Beifall bei der SPÖ.)
Die zweite ist: Wenn Sie gestern sinnerfassend zugehört hätten, dann hätten Sie hier nicht die Aussagen gemacht, die Sie geäußert haben. Ich habe nicht gesagt, dass ich jahrelang im Kobel Dienst gehabt habe; die Bezeichnung Kobel ist von der Expertin aus dem Ministerium gekommen, und diese habe ich ja kritisiert. Das ist kein Kobel, sondern das ist eine Räumlichkeit, in der die Passkontrolle durchgeführt wird. Ich habe gesagt, ich habe am Flughafen Dienst gemacht und ich kenne die Situation dort. – Sinnerfassend zuhören! (Beifall bei der SPÖ.)
In der Praxis ist die Sache die: Wenn wir davon sprechen, dass wir am Flughafen Wien-Schwechat zusätzliches Personal brauchen, dann muss ich sagen, das wissen wir nicht erst jetzt und nicht erst heute, sondern das wissen wir schon lange, denn schon die letzten Jahre dort waren von Überstunden und Dienstzuteilungen geprägt.
Sie sind ja die Sicherheitspartei, die selbst ernannte Sicherheitspartei. (Bundesrat Raml: Ihr seid es auf einmal auch!) Es ist ja so, dass die selbst ernannte Sicherheitspartei jetzt das vorleben könnte, was sie uns immer vorgeworfen hat. (Bundesrat Schuster: Wir setzen es auch um!) Und was macht sie? – Dort, wo Exekutivkräfte, wo die Polizei ihren Dienst versieht, werden Polizistinnen und Polizisten eingespart. (Bun-
desrat Samt: Stimmt ja überhaupt nicht!) – Na sicher wird eingespart! (Bundesrat Schuster: Ihr habt Polizisten eingespart!) Es sind Verwaltungsbeamte, denen eine Aufgabe zugewiesen wird, die Exekutivdienstcharakter hat, und das ist es! (Bundesrat Krusche: Das ist eine komplette ...!)
Wenn Sie, Herr Doktor, wüssten, wie das Dienstradl dort aussieht, würden Sie wissen, dass es immer wieder Zeiten gibt, zu denen man die Passkontrolle durchführt, dass es Zeiten gibt, zu denen man dann die Arbeit, die man dort – unter Anführungszeichen – „aufreißt“, oder Übertretungen, die man feststellt, aufarbeitet, und dass es Zeiten gibt, zu denen man am Flughafengelände Sicherheitsdienst versieht. Ich sehe jetzt überhaupt nicht ein, wo man da Einsparungen vornehmen kann, und noch dazu nur in diesem einen Bereich. (Zwischenruf des Bundesrates Krusche.)
Jetzt stellen Sie sich einmal vor, Sie setzen Verwaltungsbeamte dort hin, die irgendeine Ausbildung haben, eine mehrwöchige oder mehrmonatige Ausbildung; die setzen Sie dort hin und die machen dort nur diese eine Tätigkeit. Gestern im Ausschuss ist davon gesprochen worden, dass diese Tätigkeit betriebsblind macht et cetera. Wenn man nur diese Tätigkeit durchführt, stundenlang nur Reisepässe kontrolliert und auch zur Aufarbeitung nicht herangezogen wird, auch keine sonstigen Tätigkeiten ausübt, wird das erst recht betriebsblind machen und kein Erfolg sein (Bundesrat Raml: Da gibt es genug Berufe!), das kann ich euch jetzt schon sagen. (Beifall bei der SPÖ.)
Wenn Sie das genau durchgelesen hätten und im Ausschuss auch sinnerfassend zugehört hätten, was der Experte vom Ministerium gesagt hat, dann würden Sie wissen, dass sich dieses Recht nicht nur auf den Flughafen Wien-Schwechat beschränkt, sondern auch auf alle anderen Flughäfen ausgedehnt werden könnte. (Bundesrat Schuster: Das ist für den Flughafen Schwechat vorgesehen!) Ja, es könnte ausgedehnt werden, es könnte auch auf die Schifffahrt ausgedehnt werden, das könnte alles machbar sein. (Bundesrat Raml: „Könnte“!) Das Gesetz gibt es her, es ermächtigt dazu, jemanden anzustellen, der nicht der Exekutive angehört.
Jetzt muss ich nochmals ausholen: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute aus eurer Exekutivgewerkschaft, sei das jetzt die AUF oder sei das die KdEÖ, das euphorisch gutheißen werden. Normalerweise müssten die jetzt aufspringen und sagen: Da werden langfristig Personalstellen für die Polizei, für die Exekutive eingespart und das wollen wir nicht! (Bundesrat Steiner: Die haben es im Gegensatz zu euch verstanden! Ihr wollt ja nicht!)
Faktum ist: Das ist eine ureigene Tätigkeit der Exekutive, der Polizei. Grenzkontrolle gehört genauso dazu wie Strafrecht, wie Verkehrsrecht et cetera. Dort sollten nur voll ausgebildete Polizistinnen und Polizisten sitzen, weil man dafür über Ausbildungen in verschiedensten Bereichen verfügen sollte, denn das, was Sie als Dokumente anschauen oder Reisepässe anschauen definieren, hat mit viel, viel mehr zu tun, als Sie sich das vielleicht vorstellen können. Es gibt ja nicht nur den Reisepass, es gibt ja auch eine persönliche Wahrnehmung. Wenn ein Polizist in verschiedensten Bereichen ausgebildet ist, dann hat er auch irgendwann diesen sechsten Sinn und kann dadurch schon etwas rauslesen. Außerdem fallen dort Suchtgiftdelikte et cetera an, und die arbeitet ein Polizist dort dann natürlich auch auf. Das ist die Tätigkeit, die ihm dann eben auch eine gewisse persönliche Befriedigung gibt – und nicht, immer nur vorne die Passkontrolle durchzuführen. Also ich sehe da kein Einsparungspotenzial.
Was spart man in Wirklichkeit ein? Was spart man ein? – Einen Polizisten, dem man die Gefahrenzulage nicht zahlen muss, einen Reservepolizisten, einen Assistenten, dem man vielleicht um 300 Euro weniger gibt. Man braucht gleich viele Leute, die Personenanzahl wird sich nicht ändern. Die Kontrollen an den Flughäfen werden mehr werden, weil das Passagieraufkommen ein höheres ist, und das Einsparungspotenzial ist gleich null.
Ich weiß schon, worum es geht. Es geht darum, dass man Stellen einspart, die man den Leuten versprochen hat. Die 4 000 Polizistinnen und Polizisten wurden uns allen versprochen. Der, der sich in der Materie genau auskennt, weiß ganz genau, dass in der nächsten Zeit mehr Polizistinnen und Polizisten in Pension gehen werden als überhaupt aufgenommen und ausgebildet werden können, und das ist eine Maßnahme, dass man da jetzt ein paar Hundert wieder ausgliedert. (Beifall bei der SPÖ. – Bundesrat Raml: Und wer war bis vor einem Jahr in der Bundesregierung und Bundeskanzler?)
Noch einmal – du redest immer vom Bundeskanzler –: Die Richtlinienkompetenz gibt es in Österreich nicht; das gibt es in Österreich nicht! (Bundesrat Raml: So einen Bundeskanzler zeig mir, der da nicht mitredet!) Jeder ist damit für sein Ressort selbst verantwortlich. Da ist der Koalitionspartner, da kann man sich hinwenden, aber ansonsten bist du hier an der falschen Adresse.
Die Frau Staatssekretärin wird es nochmals erläutern, worin da das Einsparungspotenzial liegt. Ich persönlich glaube, dass es keines gibt. Ich persönlich glaube, dass da in einem Bereich mit Hilfskräften oder Assistenten gearbeitet wird, in dem das weder notwendig noch zukunftsorientiert ist. Ich glaube, man sollte auch in Zukunft den bewährten Weg gehen, voll ausgebildete, gute Polizistinnen und Polizisten zu haben, die vielseitig einsetzbar sind, die viele, viele Attribute von Haus aus mitbringen, und nicht einen Teil auszugliedern und damit eine Tür zu öffnen, um vielleicht das nächste Mal da, das nächste Mal dort etwas auszugliedern. So werden die Exekutive und ihre Planstellen in Zukunft noch mehr ausgehungert. (Beifall bei der SPÖ.)
18.52
Vizepräsident Ewald Lindinger: Zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Marianne Hackl. Ich erteile ihr dieses.
Bundesrätin Marianne Hackl (ÖVP, Burgenland): Hohes Präsidium! Geschätzte Frau Staatssekretärin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Ich bin eigentlich sehr erstaunt; erstaunt über Bundesrat Schabhüttl, einen Kollegen aus dem Burgenland. (Bundesrat Schabhüttl: Der sich auskennt im Beruf!) – Ja, das möchte ich dir auf keinen Fall absprechen, weil ich weiß, dass du dich für die Sicherheit einsetzt. (Beifall bei der SPÖ.) Du sprichst dich jetzt aber gegen die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher aus. (Bundesrat Schabhüttl: Eben nicht!)
Bevor ich auf den Tagesordnungspunkt eingehe, möchte ich etwas aus dem Burgenland erzählen. Im Burgenland hat Landeshauptmannstellvertreter Tschürtz von der FPÖ eigens das Pilotprojekt Sicherheitspartner eingeführt; diese sind in den Dörfern unterwegs. Er hat einen Jahresbericht gemacht und will dieses Projekt jetzt auch flächendeckend auf das gesamte Burgenland ausweiten. Die Kosten für den Vollausbau werden rund 2 Millionen Euro betragen. Diese Sicherheitspartner gehen durch die Dörfer und deren Meldungen werden dann an die Polizei weitergegeben. Da geht es um überhängende Äste, Verschmutzungen von Straßen und Gehwegen und unversperrte Türen. Das wird aufgezeigt; das habe ich im Bericht des Herrn Landeshauptmannstellvertreters gelesen. Wenn es aber um die Sicherheit der ÖsterreicherInnen geht, um die Personen, die jetzt am Flughafen eingesetzt werden, sprichst du dich dagegen aus, obwohl ich weiß, dass du im Burgenland sehr hinter den Sicherheitspartnern stehst.
Jetzt aber zurück zum Tagesordnungspunkt: Ich bedanke mich bei denjenigen, die dem vorliegenden Gesetzentwurf zustimmen. Es ist ein entsprechender Modus gefunden worden, um das steigende Passagieraufkommen, mit dem wir besonders am Flughafen Schwechat konfrontiert sind, sicherheitstechnisch in den Griff zu bekommen. Dies wird auch von den Reisenden erwartet, und ich glaube auch, dass das in unser
aller Interesse ist, um sicher von A nach B zu kommen. Es geht einfach nur darum, auf intelligente Weise ein Personalproblem zu lösen.
Am Flughafen Schwechat haben wir ein Passagieraufkommen von derzeit 24 Millionen, ein Ansteigen auf 30 Millionen Passagiere ist in den nächsten zwei bis drei Jahren zu erwarten. So sollen in mehreren Tranchen vorerst 50 und letztlich bis zu 200 Vertragsbedienstete mit Sondervertrag neu und ausschließlich für diese Aufgabenstellung, ohne Befehls- und Zwangsgewalt und unbewaffnet, aufgenommen, ausgebildet und eingesetzt werden. Ich sehe darin betreffend den Arbeitsmarkt auch eine Chance für Menschen in der Altersgruppe zwischen 35 und 50 Jahren. So können die ausgebildeten Polizistinnen und Polizisten wieder jener Arbeit zugeführt werden, die ihrer Qualifikation entspricht. (Bundesrat Schabhüttl: Das ist ihre ureigene Arbeit!)
Es geht da um Personen, die von außerhalb des Schengenraums nach Österreich kommen wollen. Durch diese Maßnahme können interessierte Menschen Ausweiskontrollen durchführen, sich der Kinder annehmen, die ihre Eltern verlieren, und vieles, vieles mehr für die Sicherheit tun. Dazu muss man nicht mit einer geladenen Pistole herumlaufen. Das sind normale Tätigkeiten, die notwendig sind, um Sicherheit gewährleisten zu können. Dies ist einfach eine Maßnahme zur Überbrückung des Personalnotstandes, der sich in der letzten Zeit aufgebaut hat und der durch diese Regierung jetzt sukzessive abgebaut wird.
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Zum Abschluss möchte ich die Gelegenheit nutzen, der Führung des Flughafens Wien zu gratulieren. Besonders darf ich da jemanden erwähnen, der den Flughafen Wien wirtschaftlich nach vorne gebracht hat, den Geschäftsführer des Flughafens Wien-Schwechat, den Burgenländer Günther Ofner. Er wurde heuer zum Manager des Jahres gewählt, und dazu möchte ich ihm hier an dieser Stelle meine Wertschätzung aussprechen und weiterhin viel Erfolg wünschen. (Beifall und Bravorufe bei der ÖVP sowie Beifall bei der FPÖ.)
Die Novellierung des Grenzkontrollgesetzes trägt aus meiner Sicht zu einer effizienten Grenzkontrolle am Flughafen Schwechat im Teamwork zwischen Vertragsbediensteten mit Sondervertrag und Polizistinnen und Polizisten bei. Wir werden dieser Regulierung natürlich zustimmen. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
18.58
Vizepräsident Ewald Lindinger: Zu einer abschließenden Stellungnahme hat sich die Frau Staatssekretärin zu Wort gemeldet. Ich erteile ihr dieses.
Staatssekretärin im Bundesministerium für Inneres Mag. Karoline Edtstadler: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Mitglieder des Bundesrates! Ich beginne mit der guten Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass das Passagieraufkommen am Flughafen Wien – wir haben die absoluten Zahlen gehört – allein im September 2018 im Vergleich zum Vergleichszeitraum des Vorjahrs um 10,9 Prozent auf 2,7 Millionen Reisende gestiegen ist. Das ist deshalb eine gute Nachricht, weil das zeigt, dass das Ziel, Wien als Drehscheibe Richtung Osten zu etablieren, erreicht wurde. Es zeigt auch, dass der Ausbau jedenfalls weiterhin gerechtfertigt ist.
Die zweite Nachricht ist, dass ein Drittel all dieser Reisenden grenzkontrollpflichtig ist, und das ist natürlich ein erheblicher Aufwand. Und wieder komme ich darauf zurück, dass hier ja einige sitzen, die wirklich Expertise in diesem Bereich haben und wissen, wie das ist. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich, insbesondere das Stadtpolizeikommando Schwechat sind mit dieser permanenten Herausforderung, was den Personaleinsatz und auch – man kann es durchaus so benennen – den Personalmangel betrifft, konfrontiert, und deshalb wollen wir da mit einer Entlastung durch Grenzkontrollassistenten gegensteuern.
Es geht dabei nicht darum, dass man, wie das jetzt ein bisschen durchgeklungen ist, das hoheitliche Handeln an private Sicherheitsdienstleister auslagert. Nein, ganz im Gegenteil: Es sollen Vertragsbedienstete sein, weil es eben nicht notwendig ist, wie das einige ja schon angesprochen haben, dass an dieser Stelle Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes handeln.
Herr Bundesrat Weber, ich bin ganz bei Ihnen: Mit der Sicherheit spielt man nicht, mit der Sicherheit spielt man auf gar keinen Fall. Staatliches Handeln muss auch in staatlicher Hand bleiben. Ich glaube aber, diese Bunderegierung ist darin glaubwürdiger als jede Bundesregierung davor, dass ihr die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes ein ganz großes Anliegen ist. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
Es wurde vom Mangel an Polizeibeamtinnen und -beamten gesprochen: Dazu kann ich nur sagen, es wurde bereits im Frühling beschlossen, 4 100 zusätzliche Planstellen zu etablieren. Wir sind bereits dabei, zu rekrutieren. Das ist in dieser Legislaturperiode eine der größten Rekrutierungsmaßnahmen, die wir – ever hätte ich fast gesagt – seit ewig haben, weil nämlich zu diesen zusätzlichen Planstellen auch der Ersatz von Pensionierungen kommt; das ist in dieser Legislaturperiode ein exorbitant hoher Anteil, der da notwendig ist.
Nun haben wir aber natürlich die Tatsache – die ja grundsätzlich auch eine gute ist –, dass ein Polizeibeamter nicht von heute auf morgen in den Dienst gestellt werden kann, sondern dass eine gewisse Ausbildung notwendig ist. Wir haben zudem die Situation, dass nicht gleichzeitig unglaublich viele Personen ausgebildet werden können, weil wir die Ausbildner aus dem aktiven Dienst herausziehen müssen und da eine entsprechende Balance gefunden werden muss. Deshalb ist es gerade bei diesen Aufgaben, bei denen wir diese Grenzkontrollbeamten und Grenzkontrollassistenten nun einsetzen, so, dass das eben nicht ein Polizist durchführen muss – gerade was die Kontrolllinie 1 anlangt –, weil da keine exekutivspezifischen Anforderungen notwendig sind.
Damit, Herr Bundesrat Schabhüttl, sind wir bei den Einsparungen. Sie haben selbst gesagt, es gibt bei Grenzkontrollen oft diese Folgen, dass man dann jemandem nachgehen muss, es taucht vielleicht ein Suchtmitteldelikt auf oder es müssen irgendwelche Amtshandlungen vorgenommen werden, weil man beim Passabgleich feststellt, dass diese Personen in einer Fahndungsliste stehen. Genau da kommt nun der zielgerichtete Einsatz derjenigen ins Spiel, die dafür ausgebildet sind. Der, der den Pass kontrolliert, kann ein Vertragsbediensteter sein, und damit haben Sie die Entlastung. Ich hoffe, dass ich das nun auch für Sie verständlich dargestellt habe. Für mich liegt das eigentlich auf der Hand. Das müsste für Sie ja auch nachvollziehbar sein.
Wir wollen auch aus dem nicht polizeilichen Bereich rekrutieren, um uns sozusagen nicht gegenseitig die Mitarbeiter wegzunehmen. Das wird zu einer spürbaren Entlastung führen. Wenn es notwendig ist, dann sind die Beamten mit der entsprechenden exekutivspezifischen Ausbildung und Anforderung da, und wenn es durch andere zu leisten ist, dann wird das in Zukunft durch die Grenzkontrollbeamten und -assistenten geschehen. – Vielen Dank. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
19.02
Vizepräsident Ewald Lindinger: Zu Wort ist nun auch noch Herr Bundesrat David Stögmüller gemeldet. Ich erteile ihm dieses.
Bundesrat David Stögmüller (Grüne, Oberösterreich): Ich möchte immer, wenn wir Gesetze beschließen, kurz sagen, warum wir dagegen sind. Es geht für mich um eine grundsätzliche - - (Bundesrat Krusche: Das ist uns wurscht! – Weitere Zwischenrufe bei der FPÖ.) – Superschön, dass es dieser Regierungspartei egal ist, wie Mitglieder
des Bundesrates abstimmen. Das ist auch wieder ein Zeichen dafür, wie die FPÖ gegenüber Oppositionsparteien denkt. (Bundesrätin Mühlwerth: Ihr seid ja gar keine Partei!) Vielen Dank, das ist auch wieder der neue Stil, den wir heute ja schon von dieser Regierung kennengelernt haben. (Beifall bei der SPÖ.) Freie Abgeordnete – egal! Das ist es, was der FPÖ wirklich wurscht ist. (Neuerliche Zwischenrufe bei der FPÖ.) – Es ist so.
Ich rede aber dennoch zu diesem Thema. Dann rede ich halt zur ÖVP, die ist hier nicht so herabwürdigend wie die FPÖ. (He-Rufe bei der FPÖ.) Es geht für mich bei dieser Debatte auch um eine grundsätzliche Frage (Bundesrätin Mühlwerth: Ist ja gut!), nämlich darum, ob in Zukunft die Durchführung von Grenzschutz- und Passkontrollen eine hoheitsrechtliche Aufgabe ist und wer das macht. Ich frage mich, ob das Polizisten machen sollen oder irgendwelche Securitymitarbeiter, wobei mit diesem Gesetz etwas besser ausgebildeten Securitymitarbeitern eventuell auch Tür und Tor geöffnet wird. (Bundesrat Schuster: Die Frau Staatssekretärin hat das ja gerade widerlegt!)
Das ist schon eine Frage, die sich stellt. Jetzt beschließen wir das nur für Schwechat (Zwischenruf bei der FPÖ), als Nächstes kommt wieder der Entschließungsantrag durch das Parlament, und dann wird es auf einmal auch in Innsbruck und wo weiß ich noch überall plötzlich passieren und irgendwann ausgeweitet.
Es ist für uns Grüne schon auch ganz klar, dass seit Jahren darüber hinweggetäuscht werden soll – das ist leider das Innenministerium –, dass Polizeiposten geschlossen werden, es zu einem Polizeimangel in den ländlichen Regionen und in den Städten kommt, es ein - - (Ruf bei der FPÖ: Nicht von dieser Regierung!) – Das ist richtig: nicht von dieser Regierung. Es ist schon seit Jahren - - (Zwischenrufe bei der FPÖ.) – Sage ich ja! Es ist ja schön, wenn Sie das beenden, das kritisiere ich ja nicht. Hören Sie zu! Sie haben vorhin in Richtung SPÖ von sinnerfassendem Zuhören geredet – das müssen Sie auch machen! (Bundesrätin Mühlwerth: Am sinnerfassenden Zuhören musst du auch noch arbeiten!)
Ich habe gesagt, die letzten Innenminister haben das nicht geschafft und haben dieses Problem nicht erkannt. Ich weiß noch, wie unter den früheren Ministern Polizeiposten geschlossen wurden und die Zahl der Polizisten massiv reduziert wurde – das ist eine Aufgabe des Innenministeriums (Bundesrat Steiner: Immer kritisieren!) –, wodurch es zu einem massiven Polizeimangel gekommen ist. Das ist ganz klar ein Versagen. Es ist auch jetzt wieder schwer genug für die Polizeischulen, überhaupt geeignete Polizisten zu finden – das ist der nächste Punkt.
Eine Sorge habe ich auch noch, nämlich wo dann diese, nennen wir sie Schmalspursicherheitskräfte – ich glaube, die NEOS haben Schmalspurpolizisten dazu gesagt, ich sage eher Sicherheitskräfte –, angeworben werden. Wo kommen die her? – Man hat schon gehört, das AMS hat aufgerufen, dass sich Leute melden, die dafür geeignet sind. Das ist schön und gut, aber ich befürchte noch weitaus Schlimmeres, wenn man beachtet, wo Polizisten angeworben werden. Ich weiß, dass das Bundesministerium für Inneres in Zeitungen wie zum Beispiel „Alles Roger?“, „Wochenblick“ oder „Zur Zeit“ inseriert, also in rechtsextremen Zeitungen. (Hallo-Rufe bei der FPÖ.) Diese sind ganz klar rechts positioniert und in diesen werden Mitarbeiter für die Polizei angeworben. Das macht mir Sorgen. (Beifall bei der SPÖ. – Bundesrätin Mühlwerth: Mach mal halblang! Nennen wir dich linksradikal?)
Es geht mir nicht darum, zu sagen, dass alle Polizisten von dort geworben werden – um Gottes willen, hoffentlich nicht! Ich kenne genug Polizisten, die ganz klar nicht so sind. Es gibt aber in diesen Zeitungen Inserate und das macht mir Sorgen. (Bundesrat Schuster: Das ist es, wieso die Grünen abgewählt worden sind!) Ich will nicht wissen, wo dann diese Sicherheitskräfte angeworben werden und mit welchen Qualifikationen
sie eingestellt werden. Das macht mir Sorgen. Es macht mir auch Sorgen, dass es ausgeweitet werden kann.
Wir werden das auf jeden Fall beobachten und schauen, wie das weiterentwickelt wird. Wir werden diesem Gesetz heute nicht die Zustimmung geben. – Danke. (Beifall bei der SPÖ sowie der Bundesrätin Dziedzic. – Bundesrätin Mühlwerth: Über den „Falter“ wäre es natürlich besser! Linksradikales ...!)
19.06
Vizepräsident Ewald Lindinger: Es liegt eine Wortmeldung zu einer tatsächlichen Berichtigung von Bundesrat Schabhüttl vor. – Bitte.
Bundesrat Jürgen Schabhüttl (SPÖ, Burgenland): Wenn ich es so machen kann, dann mache ich es so: mit einer tatsächlichen Berichtigung.
Erste Berichtigung: Es sollen keine privaten Securitymitarbeiter aufgenommen werden, sondern das sollen Vertragsbedienstete mit einem Sondervertrag sein.
Die zweite Berichtigung: Kollegin Hackl, was hat ein Vertragsbediensteter mit einem Sondervertrag mit einem privaten Verein wie jenem im Burgenland zu tun? – Gar nichts! Außerdem unterstütze ich das sowieso nicht, das möchte ich hier auch ganz klar berichtigen.
Die dritte Berichtigung in Richtung der Frau Staatssekretärin (Zwischenruf des Bundesrates Schuster): Wenn man einen Exekutivbeamten wegnimmt und einen im Hinterhalt hat, dann sind es immer noch zwei. Wenn man statt des einen dort einen anderen hinsetzt, dann sind es auch zwei. Man spart da überhaupt nichts ein, denn da wird keiner weniger und keiner mehr, nur die Arbeit verteilt sich anders. (Bundesrat Schuster: Die Staatssekretärin zu berichtigen ist so peinlich!)
Die vierte Berichtigung: Man will vielleicht 4 000 ausbilden, aber man hat weder die Ausbildungsplätze in den Schulen noch die Lehrer dazu, und das wissen Sie auch ganz genau. (Zwischenruf des Bundesrates Schuster.) Darum sollte man der Bevölkerung auch sagen, dass wir da einen Handlungsbedarf haben und dass wir auch Ausbildungsplätze, Schulplätze und Lehrer dafür brauchen. – Danke schön. (Beifall bei der SPÖ. – Zwischenruf der Bundesrätin Mühlwerth.)
19.08
Vizepräsident Ewald Lindinger: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir gelangen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Zivildienstgesetz 1986 geändert wird (380 d.B. und 422 d.B. sowie 10098/BR d.B.)
Vizepräsident Ewald Lindinger: Wir gelangen nun zum 12. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatter ist Bundesrat Mag. Dr. Michael Raml. Ich bitte um den
Bericht.
Berichterstatter Mag. Dr. Michael Raml: Ich erstatte den Bericht des Ausschusses für innere Angelegenheiten über den Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Zivildienstgesetz 1986 geändert wird.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher direkt zur Antragstellung.
Der Ausschuss für innere Angelegenheiten stellt nach Beratung der Vorlage am 18. Dezember 2018 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsident Ewald Lindinger: Danke für den Bericht.
Wir gehen in die Debatte ein.
Als Erster ist Herr Bundesrat David Stögmüller zu Wort gemeldet. Ich erteile ihm dieses.
Bundesrat David Stögmüller (Grüne, Oberösterreich): Sehr geehrtes Präsidium! Sehr geehrte Frau Staatssekretärin! Sehr geehrte und werte Kolleginnen und Kollegen! Wir novellieren heute das Zivildienstgesetz mit zwei Schwerpunkten: Der eine ist die Einführung eines computerunterstützten Ausbildungsmoduls für Zivildiener und gleichzeitig auch für Vorgesetzte in Zivildiensteinrichtungen; der andere ist, dass Zivildiener zukünftig nach 24 Tagen Dienstunfähigkeit automatisch aus dem Zivildienst entlassen werden. Zusätzlich wurden auch noch ein paar Änderungen im Bereich der Anerkennung von Zivildienstträgern installiert beziehungsweise wurden die Bestimmungen auch verschärft. – So weit einmal die Einführung als Erstredner – so oft bin ich das ja nicht –, das, worum es also bei diesem Gesetz geht.
Ich selbst habe ja im Bereich des Zivildienstes, im Bereich der Zivildienerausbildung bei einer Rettungsorganisation gearbeitet und mache das nach wie vor noch ehrenamtlich. Ich kann also von mir schon behaupten, dass ich mich im Bereich des Zivildienstes auskenne und weiß, was in der Ausbildung passiert. Ich finde es natürlich grundsätzlich großartig und wichtig, wenn sich junge Menschen in der Geschichte Österreichs auskennen, wenn sie die Grundprinzipien der Verfassung kennen, den Stufenbau der Rechtsordnung, die Staatsgewalten, den Weg der Bundesgesetze, die Organisation der Verwaltung und der Gerichtsbarkeit, des Rechtsschutzes und der Kontrolle, die Grund- und Freiheitsrechte und so weiter und so fort.
Das ist ja prinzipiell alles gut und schön, aber – es tut mir leid, Frau Staatssekretärin – es ist doch nicht die Aufgabe einer Zivildienstorganisation, diese jungen Menschen im Bereich politische Bildung auszubilden. Das gehört doch in das Schulsystem, in die Ausbildung der jungen Menschen; das müssen diese doch in der Schule lernen und nicht mit 18, 19 oder 20 Jahren im Zivildienst noch einmal wiederholen, insbesondere wenn diese schon studiert haben, zum Beispiel Jus. (Bundesrat Pisec: Ewiges Lernen! – Weitere Zwischenrufe bei der FPÖ.)
Man kann doch nicht wirklich glauben, die politische Bildung in den Zivildienst aussourcen zu müssen – heraus aus dem Bildungssystem hinein in den Zivildienst. Das zeigt meiner Meinung nach ganz perfekt auf, dass man, bevor man den wirklich großen Brocken endlich angeht und reformiert – das Bildungssystem, in dem eigentlich genau diese Bildungslöcher gestopft werden müssen –, Extrastunden in den Zivildienst gibt, weil man da den leichtesten Widerstand hat und es hineinstopfen kann.
Zudem gibt es noch unglaublich viele Fragezeichen betreffend diese Novelle: Im Gesetzentwurf vermissen wir die konkrete Dauer des geplanten Ausbildungsmoduls. Es gibt da noch keinen Plan, es heißt, da ist für die Rettungsorganisationen oder die NGOs noch etwas in Entwicklung. Was soll dieses zusätzliche Modul für die Organisa-
tionen, für die Arbeit der Zivildiener draußen überhaupt bringen? Was soll die Organisation davon haben, dass sich der Zivildiener plötzlich mit Fragen der Verfassung oder der Bundesgesetzgebung auskennt? – Das ist schön und gut, aber er hätte das im Rahmen des Bildungssystems lernen sollen, dort aber vermissen wir es nach wie vor.
Da muss ich Sie noch einmal fragen, Frau Staatssekretärin: Warum hat man diese Aufgaben nicht in den pädagogischen Einrichtungen implementiert? – Das wäre es, was wir endlich angehen müssten. Wir müssten es endlich schaffen, politische Bildung im Bildungssystem zu implementieren.
Es gibt noch weitere Probleme und Fragezeichen betreffend diese Novelle wie zum Beispiel die Kosten. So muss das Modul während der Dienstzeit absolviert werden. Es steht zudem im Gesetz, dass in der Einrichtung die erforderliche technische Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden muss – die Einrichtung muss das tun, so steht es im Paragrafen, man kann nicht irgendwo anders hingehen, wie es im Ausschuss geheißen hat. Das heißt, die Kosten bleiben wieder bei den Organisationen hängen.
Natürlich erkenne ich die Intention der Bundesregierung an, und will es auch nicht schlechtreden. Noch einmal: Ich erkenne an, dass jungen Menschen dadurch Staatsbürgerkunde nähergebracht werden soll. Wir müssen aber darüber reden, ob es nicht sinnvoller wäre, das woanders zu tun, denn auch die Überwälzung von Kosten, von ganz klar staatlichen Aufgaben – die Bildung junger Menschen in Staatsbürgerkunde – auf gemeinnützige und mit Spendengeldern finanzierte Organisationen ist für mich allein schon ein Grund, dieser Novelle heute nicht zuzustimmen.
Auch betreffend § 19 des Zivildienstgesetzes – dieser beschreibt, dass ein Zivildiener nach einem Krankenstand von 24 Kalendertagen entlassen wird – bin ich, ehrlich gesagt, skeptisch – das sind sicher auch viele Organisationen. Sie müssen sich das dann auch in der Praxis anschauen. Gerade im Rettungsdienst ist es mir manchmal lieber, der Kollege, die Kolle- - – Entschuldigung, jetzt hätte ich fast gegendert, es ist der Zivildienerkollege – bleibt einmal einen Tag länger zu Hause, anstatt weitere Kollegen im Rettungsdienst oder Patienten anzustecken.
Oder: Stellen Sie sich vor, er hat einen Hexenschuss und soll einen Patienten tragen. Da sage ich zum Zivildiener, er soll lieber noch drei oder vier Tage länger im Krankenstand bleiben, bevor es zu einem Notfall kommt und er den Patienten nicht tragen kann, man ein zweites Rettungsauto braucht oder sogar eine lebensgefährdende Situation entsteht. In der Praxis wird sich zeigen, ob das überhaupt machbar ist oder dadurch wieder Probleme entstehen.
Wenn wir schon einmal das Thema Zivildienst hier im Parlament besprechen, darf ich gleich einmal grundsätzlich zu einer Reform des Zivildienstes aufrufen. 2013 gab es eine Volksbefragung zum Thema Wehrpflicht, wie Sie wissen. Rund 60 Prozent der Wahlberechtigten waren für die Beibehaltung der Wehrpflicht. Besonders spannend fand ich die Ergebnisse der Befragung nach der Volksbefragung: 80 Prozent der WehrpflichtbefürworterInnen haben den Zivildienst als ihr Hauptargument angegeben. Der Zivildienst war also der Grund, weshalb man die Beibehaltung der Wehrpflicht wollte. Daran sieht man, welche Bedeutung der Zivildienst in unserer Gesellschaft mittlerweile hat.
Glauben Sie mir, auch die Organisationen leben davon, dass die Zivildiener einen ordentlichen Zivildienst absolvieren können, dass es ihnen gut geht. Wichtig ist die Mundpropaganda, dass der Zivildiener zu seinem Bruder sagt: Dort beim Roten Kreuz, bei der Caritas oder dort und dort ist es gut, da machst du auch deinen Zivildienst! – Gerade in Zeiten geburtenschwacher Jahrgänge – die wir gerade haben – erkennt man ganz deutlich, welche Organisationen sich besonders um die Zivildiener kümmern und welche nicht.
Man weiß auch, welche Wertigkeit der Zivildienst in den Köpfen der Menschen hat, wir warten aber seit Jahren – bevor Sie wieder schreien: das betrifft nicht nur diese Bundesregierung – auf wirkliche Verbesserungen betreffend den Zivildienst. Die rechtliche und finanzielle Situation der Zivildiener spiegelt die Wertschätzung, die die Zivildiener eigentlich verdienen, nicht wider.
Nach wie vor müssen junge Menschen einen neunmonatigen Wehrersatzdienst leisten. Nach wie vor wird die Privatsphäre der Zivildiener bei Krankheit nicht respektiert. Sie haben das im Rahmen dieser Novelle leider auch nicht herausgestrichen. Nach wie vor müssen Zivildiener dem Vorgesetzten den Grund der Krankheit melden – das wäre nun eigentlich absurd, weil die 24 Tage ohnehin im Gesamten gerechnet werden. Das zu ändern hat man bei der Novellierung leider verabsäumt.
Auch die Basis von gewerkschaftlichen und arbeitsrechtlichen Dienstverhältnissen fehlt, wie die 38-Stunden-Woche oder angeglichene Urlaubsregelungen – neun Monate Dienst, zwei Wochen Urlaub. Es braucht da wirklich Reformen. Gleichen wir endlich auch die Dauer des Zivildienstes an jene der Wehrpflicht an, das wäre auch im Sinne der Gleichstellung!
Daher bringe ich folgenden Entschließungsantrag ein:
Entschließungsantrag
der BundesrätInnen David Stögmüller und Mag. Dr. Ewa Dziedzic betreffend „Notwendige Reformen des Zivildienstes in Österreich“
Der Bundesrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der folgende Punkte beinhaltet:
1) Der verpflichtende Zivildienst wird auf 6 Monate verkürzt.
2) Der Zivildienst soll freiwillig um bis zu 6 Monate verlängert werden können. Diese 6 Monate müssen kollektivvertraglich entlohnt werden. Es darf zu keinen Steh- und Ruhephasen mehr vor dem Studium, Ausbildung und Berufseinstieg nach dem Zivildienst kommen.
3) Für die nach dem Zivildienst einschlägigen Studien oder Ausbildungen soll das im Zivildienst Erlernte eindeutig und transparent anrechenbar sein (Ausbildung für die Tätigkeit in einem sozialen Beruf wie Familienhilfe, Altenpflege, Behindertenbetreuung, für die FH für Soziale Arbeit aber auch für Studien wie Psychologie oder Pädagogik).
4) Wenn ein Jugendlicher bei der Freiwilligen Feuerwehr oder beim Jugend-Rot-Kreuz schon ehrenamtlich tätig war, soll er sich Teile oder den gesamten Zivildienst anrechnen lassen können.
5) Im Bereich des Zivildienstes soll es zu einer Angleichung an die arbeitsrechtliche Situation von Sozial- und Gesundheitsberufen kommen: Normalarbeitszeit, Urlaubsanspruch, Streichung der restriktiven Krankenstands-Regelungen von Zivildienern, Reformierung bzw. Streichung von Dienstpflichtverletzungen und Strafandrohungen.
6) Anpassung der Grundvergütung an die Mindestsicherung auf € 863.-
7) Valorisierung des Zivildienstgeldes nach § 28 Abs. 4 ZDG“
*****
Werte Kolleginnen und Kollegen, der Zivildienst ist unbestritten eine wichtige Säule der Gesellschaft, daher ist es wichtig, den Zivildienst als Institution zu stärken, die Situation
der Zivildienstleistenden definitiv zu verbessern und die Trägerorganisationen abzusichern. Das haben sich – ganz ehrlich – insbesondere unsere Zivildiener und auch diese Organisationen verdient. – Vielen Dank. (Beifall der Bundesrätin Dziedzic.)
19.19
Vizepräsident Ewald Lindinger: Herr Bundesrat, legen Sie bitte den Antrag vor. (Bundesrat Stögmüller legt den Antrag vor.) – Der Antrag ist nicht genügend unterstützt, es fehlt eine Unterschrift, ich stelle daher die Unterstützungsfrage.
Unterstützt jemand von den Bundesrätinnen und Bundesräten den vorliegenden Entschließungsantrag? (Bundesrätin Mühlwerth – in Richtung SPÖ –: Da wird sich doch einer finden von euch, der das unterschreibt?!) – Nein. Er ist somit nicht genügend unterstützt und steht daher nicht mit in Verhandlung.
Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Gottfried Sperl. Ich erteile ihm dieses.
Bundesrat Gottfried Sperl (FPÖ, Steiermark): Geschätzter Herr Präsident! Frau Staatssekretärin! Geschätzte Damen und Herren auf der Galerie und via Livestream! Kolleginnen und Kollegen! Mit der vorliegenden Änderung des Zivildienstgesetzes sollen drei wesentliche Ziele erreicht werden, nämlich: Verbesserung der Steuerungs- und Aufsichtsfunktion des Bundes, Effizienzsteigerung der Zivildienstverwaltung und Attraktivierung des Zivildienstes.
Man folgt damit der Empfehlung des Rechnungshofes in seinem Prüfbericht aus dem Jahr 2015, und das stellt die Umsetzung des im Jahre 2017 beschlossenen Regierungsprogramms dar. Andererseits soll auch den Wünschen der Trägerorganisationen und den Bedürfnissen des Vollzugs nachgekommen werden.
Wir haben es schon gehört: Es wird ein computerunterstütztes Ausbildungsmodul betreffend die Staatsbürgerschaftskunde für Zivildienstleistende und Vorgesetzte samt Zertifizierung eingeführt. Die Voraussetzungen für die Anerkennung und den Widerruf der Anerkennung von Zivildiensteinrichtungen werden ergänzt. 2017 gab es 1 687 anerkannte Einrichtungen. Neu ist, dass der Landeshauptmann die genehmigte maximale Platzanzahl amtswegig senken kann.
Es werden auch neue Widerrufstatbestände aufgenommen, zum Beispiel: fehlender Nachweis betreffend ein positiv absolviertes E-Learning-Tool durch einen Vorgesetzten oder wenn drei Jahre kein Bedarf an Zivildienstleistenden gemeldet wurde; so können auch einige Karteileichen beseitigt werden.
Weiters: verstärkte Mitwirkung des Bundesministeriums für Inneres sowie der Zivildienstserviceagentur, Anhörungsrecht, Aufhebung von rechtswidrigen Bescheiden. Vorgesehen ist auch die vorzeitige Entlassung aus dem Zivildienst ab 24 Krankenstandstagen; bisher waren durchgehend 18 Tage dafür notwendig. 2017 betraf das immerhin 400 Zivildienstleistende.
Die Unzulässigkeit der Abgabe einer Zivildiensterklärung bei jeglicher Verurteilung wegen Waffengewalt wurde verschärft. Jetzt reicht jegliche rechtskräftige Verurteilung wegen Anwendung von Waffengewalt unabhängig von der Strafhöhe aus, um die Zivildienstpflicht aufzuheben. Eine bestimmte Strafhöhe der Verurteilung ist nicht mehr erforderlich.
Diese Maßnahmen dienen der Attraktivierung des Zivildienstes. Es ist unbestritten, dass die Zahl der Zivildiener in den Jahren 2010 bis 2015 zugenommen hat. Dies ging aber einher mit der geringer werdenden Attraktivität des Grundwehrdienstes durch die Demontage des Bundesheers, denn grundsätzlich wären alle wehrpflichtig. Da nun das
Militär wieder an Attraktivität gewinnt, werden auch die Zivildienstanträge wieder weniger, das heißt, das Militär hat wieder mehr Zulauf. Wir haben eine Summe an Wehrpflichtigen, und abhängig von der Attraktivität haben vielleicht einmal die mehr, das andere Mal die anderen; auch das muss man sehen. (Bundesrat Schennach: Gut, dass es den Darabos gegeben hat!) – Ja, der hat das Militär demontiert, das wissen wir.
Mit diesen Änderungen und der damit einhergehenden Erhöhung der Attraktivität wird der Zivildienst gestärkt, für viele junge Männer wird er dadurch vielleicht interessant. Der Zivildienst steht aber immer in Konkurrenz zum Militärdienst: Wenn der Wehrdienst attraktiver ist als der Zivildienst, dann wird es immer wieder entsprechende Konkurrenz geben. – Danke. (Beifall bei FPÖ und ÖVP.)
19.25
Vizepräsident Ewald Lindinger: Zu Wort gemeldet ist Frau Mag.a Marlene Zeidler-Beck. Ich erteile ihr dieses.
Bundesrätin Mag. Marlene Zeidler-Beck, MBA (ÖVP, Niederösterreich): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Staatssekretärin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuseherinnen und Zuseher! Vom Kindergarten bis zum Pflegeheim, von der Feuerwehr bis zum Rettungsdienst, von der Katastrophenhilfe bis zum Umweltschutz, vom Inland bis ins Ausland: Die Möglichkeiten, den Zivildienst zu absolvieren, sind heute so vielfältig wie noch nie.
14 907 junge Männer haben 2017 diese Chance genutzt, haben Zivildienst in Österreich gemacht und damit auch einen ganz wesentlichen Dienst an der Gesellschaft geleistet. Sie haben sich auch persönlich weiterentwickelt, viele von ihnen sind in dieser Zeit sicherlich auch über sich selbst hinausgewachsen.
Der Zivildienst ist heute, 40 Jahre nach seiner Einführung – ich glaube, das können wir mit Fug und Recht behaupten –, zu einer echten rot-weiß-roten Erfolgsgeschichte geworden: von den Wehrdienstverweigerern, als die sie früher bezeichnet wurden, über die Wehrersatzdienstleistenden am Rande der Gesellschaft zu einer tragenden Säule der österreichischen Zivilgesellschaft. Ich glaube, daher ist es nur richtig und gut, dass wir diese reale Weiterentwicklung jetzt auch formal in der Gesetzgebung abbilden.
Wir schaffen neue Chancen und Möglichkeiten für jene jungen Männer, die sich dafür entscheiden, Zivildienst in Österreich zu leisten. Wir schaffen aber auch beste Rahmenbedingungen für all jene, die Zivildienststellen anbieten, die akkreditiert sind. Nicht zuletzt, die Kollegen haben es angesprochen, stellen wir gerade in einer Zeit, in der es immer weniger Wehrdienstpflichtige gibt, in der wir einfach auch mit geburtenschwachen Jahrgängen zu kämpfen haben, maximale Effizienz sicher und gewährleisten, dass Zivildiener an jene Stellen kommen, an denen sie am meisten gebraucht werden.
Es ist schon einiges angesprochen worden, ich möchte noch einmal das Onlinetool herausgreifen: Wir nutzen damit die Möglichkeiten der Digitalisierung, um jungen Männern die Chance zu geben, ein Ausbildungszertifikat zu erwerben, etwas für sich persönlich mitzunehmen, von einem Basiswissen über die Geschichte bis zu den Grundlagen der österreichischen Rechtsordnung.
Ja, es gibt einige, die dieses Wissen bereits haben, die eigentlich nichts mehr tun müssen, als das Onlinetool zu absolvieren, aber es gibt auch einige, die dieses Wissen noch nicht haben, und da wollen wir ansetzen. Wir setzen im Bildungsbereich genauso an, Herr Kollege Stögmüller. Wir arbeiten am Fach Politische Bildung, wir arbeiten daran, dass in unseren Schulen mehr politische Bildung vermittelt wird, aber wir setzen auch da an. Ich glaube, bei diesem wichtigen Thema ist es nur richtig und gut, dass wir uns doppelt absichern.
Es müssen gleichzeitig auch jene eine Zertifizierung absolvieren, die die Zivildiener ausbilden, die sie anleiten. Ich glaube, es ist nur richtig und gut, dass den jungen Männern da wirklich kompetente Ansprechpartner zur Verfügung stehen. (Bundesrat Stögmüller: Das haben sie eh schon!)
Zusammenfassend möchte ich noch einmal festhalten, dass wir mit dieser Gesetzesnovelle einen, wie ich glaube, wichtigen Schritt setzen, um den Zivildienst qualitativ noch hochwertiger zu machen. Das ist ein Ziel, das sich unsere Bundesregierung gesetzt hat, daran hat unsere Staatssekretärin mit sehr viel Engagement gearbeitet. Ich freue mich, wenn wir das nun gemeinsam umsetzen. – Danke dafür. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
Ich bin überzeugt, dass wir diese rot-weiß-rote Erfolgsgeschichte damit fortsetzen. Ich glaube, es ist eine gute Nachricht für alle jungen Männer, die sich damit persönlich weiterentwickeln können, für die es vielfach auch eine persönliche Orientierung ist. Du hast es selbst angesprochen, du bist auch vom Zivildienstleistenden in den aktiven Rettungsdienst eingestiegen; da gibt es ganz, ganz viele. Das ist in einem Land der Freiwilligen auch ein ganz wesentlicher Beitrag für unsere Zivilgesellschaft. Allein in Niederösterreich sind es 600 000 Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und einen ganz wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass wir uns in Österreich so sicher fühlen, so wohlfühlen können – dafür ein großes Danke! (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
19.29
Vizepräsident Ewald Lindinger: Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Michael Wanner. Ich erteile ihm dieses.
Bundesrat Michael Wanner (SPÖ, Salzburg): Herr Präsident! Frau Staatssekretärin! Geschätzte Bundesrätinnen und Bundesräte! Diese Novelle ist ein Teil einer kontinuierlichen Weiterentwicklung im Bereich des Zivildienstes und bringt einige Verbesserungen.
Kollege Stögmüller! Ich verstehe es nicht ganz, eine Verbesserung kann ja nichts Schlechtes sein. Und wenn ich etwas dazulerne, dann lerne ich etwas dazu. (Bundesrat Stögmüller: Ja, aber was ist mit den Frauen? Die bekommen das nicht?) – Na ja, wollen Sie die auch zum Zivildienst oder zum Heer verpflichten? Nein, bleiben wir dabei, Verbesserungen sind ja grundsätzlich nichts Schlechtes. Ich glaube, sie kommen den fast 15 000 Zivildienern und fast 1 700 anerkannten Organisationen und Einrichtungen zugute.
Man sieht, dass die Zahl der Zivildiensterklärungen im Verhältnis zum Wehrdienst steigt. Wir wissen allerdings, dass die Gesamtzahl der tauglichen Wehrpflichtigen wesentlich und stark zurückgeht, in den letzten sieben Jahren von 40 000 auf 31 000, das heißt, es gibt 9 000 taugliche Wehrpflichtige weniger, und das zeigt sich natürlich auch im Bereich der Zivildiener, trotzdem gibt es noch 15 000.
Der Zivildienst ist ein fixer Bestandteil in unserer Gesellschaft, in unserem Österreich und hat wichtige Funktionen in der Öffentlichkeit und in unserem Sozialstaat. Vor allem in einer Zeit, in der die Menschen immer älter werden, benötigen sie vielseitige Hilfe. Worauf ich aber besonders hinweisen will, ist, dass der Zivildienst noch immer gesetzlich und tatsächlich ein Wehrersatzdienst ist. (Bundesrätin Mühlwerth: Genau!) Jetzt würde ich verstehen, wenn die Grünen sagen, sie wollen den Wehrersatzdienst abschaffen, da könnte man darüber reden, aber das war jetzt nicht der Antrag.
Der Zivildienst ist ein Wehrersatzdienst und darf meines Erachtens aber auf keinen Fall in Konkurrenz zu Fixangestellten im Sozial-, Sicherheits- und Gesundheitsbereich treten. Wir sagen, diese Systeme und diese Bereiche sollen stark unterstützt werden und diesen Bereichen muss dadurch auch geholfen werden.
Die Reduktion der Bürokratie und die Ziele dieser Novelle wiederhole ich jetzt nicht. Worauf ich schon eingehen will, ist, dass man auch im Bereich der Zivildienstträger hie und da eine Schulung machen kann, und wenn das alle drei Jahre ist, dann ist das auch nicht wirklich ein Problem. Wir wissen ja, dass die gut ausgebildet sind. Alle drei Jahre könnte aber eine Person aus diesem Bereich doch zu einer Schulung gehen, ich glaube, dass jede Verbesserung wie auch da eine gute ist.
Übrigens wird auch beim Bundesheer und nicht nur im Zivildienst Politische Bildung unterrichtet. (Bundesrat Stögmüller: Ja, eh!)
Die Zivildienstorganisationen in den verschiedenen Ländern – sie wurden teilweise schon erwähnt: Rotes Kreuz, Samariterbund, die Krankenhäuser, Feuerwehr, Altenwohnheime oder Pflegeeinrichtungen, Caritas, Diakonie und so weiter und so fort – machen hervorragende Arbeit in Österreich. Ich glaube, sie sollten auch hier im Parlament einmal hervorgehoben werden und es sollte ihnen Dank gezollt werden. (Allgemeiner Beifall.)
Der österreichische Zivildienst ist ein Erfolgsmodell, wir werden in Europa um dieses Modell beneidet, zahlreiche Absolventen des Zivildienstes finden in diesen Bereichen ihren Brotberuf oder arbeiten anschließend ehrenamtlich. Ich glaube, so sollte es zum Wohle unseres Sozialsystems weitergehen. – Danke. (Beifall bei der SPÖ.)
19.34
Vizepräsident Ewald Lindinger: Danke.
Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Martin Weber. Ich erteile ihm dieses.
Bundesrat Martin Weber (SPÖ, Steiermark): Werter Herr Präsident! Frau Staatssekretärin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zu dieser Novelle zum Zivildienstgesetz haben wir heute schon sehr viel gehört, auch positive Zahlen. (Bundesrätin Mühlwerth: Es ist zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem!) – Ich werde aber nicht wiederholen, was wir schon gehört haben.
Wir werden der Novelle zustimmen, das haben wir schon bekundet. Einen Wermutstropfen muss ich erwähnen, und zwar: Wenn man bei den Erläuterungen nachliest, heißt es da:
„Zudem sollen in Hinkunft Bescheide, die gegen Bestimmungen über die Anerkennung von Einrichtungen verstoßen, vom Bundesminister für Inneres aufgehoben werden können.“
Da stellt sich mir die Frage, warum das notwendig ist, wenn die Entscheidung doch ohnedies in der Zivildienstagentur erfolgt. Warum kann das nicht auch dort angesiedelt sein? In Summe ist es aber eine positive Novelle, eine Verbesserung eines guten Systems, darin sind wir uns alle einig.
Hervorheben möchte ich eine Einrichtung, in der Zivildiener in meiner südoststeirischen Heimat tätig sind. Ich bin im Bereichsfeuerwehrverband Radkersburg immer wieder auch als Bürgermeister in der Stadtgemeinde Mureck tätig, dort sind Zivildiener im Zivilschutzverband eingesetzt, ob es bei der Safety Tour der Kindersicherheitsolympiade ist, dort sind Zivildiener seit Jahren erfolgreich eingesetzt, oder im Landesaltenpflegeheim in Bad Radkersburg. Summa summarum wissen wir: Der Zivildienst ist ein österreichisches Erfolgsmodell, um das uns beinahe die ganze Welt beneidet. Mit dieser Novelle wird es verbessert, das ist grundsätzlich eine positive Geschichte, mit einem kleinen Wermutstropfen, mit dem wir aber leben werden. Wir werden daher dieser Novelle zustimmen. – Danke. (Beifall bei der SPÖ sowie bei BundesrätInnen von ÖVP und FPÖ.)
19.36
Vizepräsident Ewald Lindinger: Zu Wort gemeldet hat sich die Frau Staatssekretärin. Ich erteile ihr dieses.
Staatssekretärin im Bundesministerium für Inneres Mag. Karoline Edtstadler: Herr Präsident! Werte Mitglieder des Bundesrates! Der Zivildienst ist zweifelsohne eine Erfolgsgeschichte, und wir können stolz darauf sein, dass wir diesen Zivildienst haben, denn viele Bereiche mitten in unserer Gesellschaft könnten ohne die Arbeit dieser jungen Männer, die diese Arbeit mit großem Engagement leisten, nicht aufrechterhalten werden.
Viele Bereiche wären einfach auch kostentechnisch gar nicht zu bewerkstelligen, und deshalb wird der Zivildienst ja in drei Kategorien vom Bund gefördert. Ich möchte an dieser Stelle wirklich ein großes Danke an alle aussprechen, die im Zuge des Zivildienstes, egal in welcher Organisation, ihren Dienst an der Gesellschaft tun. Ich möchte aber auch sagen, dass laut jetzigem Gesetz, und das wird auch beibehalten, Zivildiener vorrangig zu den Rettungsorganisationen und zu den Katastrophenschutzeinrichtungen zugewiesen werden. Das ist notwendig und das ist richtig, denn dieses System ist – unabhängig vom Zivildienst – eines, wofür wir europaweit beneidet werden. Da ich fast zwei Jahre in Frankreich gelebt habe und auch ganz am Beginn meiner Zeit als Staatssekretärin von einem französischen Fernsehsender besucht und auch über unseren Zivildienst interviewt wurde, kann ich das aus eigener Erfahrung sagen.
Von dieser Stelle aus also ein großes Danke an alle Zivildiener. Was viele nicht wissen, wir haben es am Beispiel Bundesrat Stögmüller erfahren: Ganz viele von denen, die den Zivildienst machen, bleiben auch freiwillig dabei, und das ist unser Zusammenhalt in unserer österreichischen Gesellschaft, dieses Freiwilligenwesen, dieses ehrenamtliche Engagement – das gibt es woanders selten anzutreffen. (Allgemeiner Beifall.) Danke, das ist einen Applaus wert.
Der Grund für diese Zivildienstgesetz-Novelle, das möchte ich schon auch noch einmal im Detail ausführen, ist aber, dass wir einfach während der letzten Jahre – ich blicke dabei zurück bis zum Jahr 2010 – einen exorbitanten Rückgang an wehrpflichtigen jungen Männern hatten. Es ist ein Rückgang von knapp 40 000 im Jahr 2010 auf knapp 31 000 im Jahr 2017 zu verzeichnen, und 45 Prozent dieser jungen Männer absolvieren den Wehrersatzdienst, also den Zivildienst.
Im letzten Jahr, die Zahl ist schon genannt worden, sind es knapp 15 000 gewesen, genau 14 907, im heurigen Jahr, die Zahlen sind jetzt recht aktuell, sind es exakt 14 591. Die Zuweisung erfolgt, wie gesagt, vorrangig an Rettungs- und Katastrophenschutzeinrichtungen.
Grund für diesen Rückgang ist aber nicht nur, dass weniger von denen, die zur Stellung gehen, tauglich sind, sondern es sind vor allem die geburtenschwachen Jahrgänge. Meine Damen und Herren! Ich oder wer immer dann für Zivildienst zuständig ist, wird damit in den nächsten acht bis zehn Jahren zu kämpfen haben, das ist ein leichtes Auf und Ab auf niedrigem Niveau.
Ich bin heute auch in einer Tageszeitung mit einem Zitat präsent, ich habe gesagt, ich kann keine jungen Männer produzieren. Ja, ich habe einen dazu beigesteuert, in einem geburtenschwachen Jahrgang, 2001, der kommt erst zur Stellung. (Heiterkeit.) Ich kann aber diese jungen Männer nicht herzaubern, deshalb habe ich gesagt, wir müssen beim Gesetz ansetzen, wir müssen den Zivildienst attraktiver machen, wir müssen dafür sorgen, dass sich die jungen Männer dafür interessieren, und wir müssen ihnen auch etwas mitgeben, denn sie leisten für diese Gesellschaft sehr viel.
Hier, Herr Bundesrat, kommt auch das Onlinetool ins Spiel. Es geht darum, den Menschen etwas mitzugeben, denn jeder hat etwas davon, wenn er vom Funktionieren des
Rechtsstaates, wenn er von der Geschichte Österreichs etwas weiß. Nicht jeder kommt aus der Schule mit Matura, sondern viele steigen früher aus, gehen in eine Lehre, und wir wissen auch: Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung festigt das Wissen.
Was geben wir ihnen mit? – Um das auch zu sagen: Dieses Onlinetool ist für die, die in der Schule schon die entsprechende Bildung mitbekommen haben, innerhalb kürzester Zeit, nämlich weniger Stunden, wahrscheinlich einer Stunde, absolvierbar, und dann wird es in die Leistungsbilanz aufgenommen. Das ist ein kleiner Beitrag, aber etwas, was wir ihnen mitgeben können. Jeder, der bei der Rettung Dienst gemacht hat, weiß, dass man auch den Sanitäter absolviert und auch das etwas ist, was man mitgeben kann. Darum geht es mir!
Wenn ich beim Onlinetool bin, dann bleibe ich beim Onlinetool für die Ausbildner. Große Organisationen wie Rettungsorganisationen, das Rote Kreuz, Samariter, Johanniter, werden kein Problem damit haben, ihre Ausbildner dieses Onlinetool absolvieren zu lassen; überhaupt kein Problem, die sind geschult. Aber wir haben rund 1 700 Organisationen, die Zivildiener anfordern können. In kleinen Organisationen ist es überhaupt nicht selbstverständlich, dass es einen kompetenten Ansprechpartner für die Zivildiener gibt, der auch weiß, was Sache ist und wie man Zivildiener berät.
Ich komme noch zu einem Punkt, den Sie auch angesprochen haben, nämlich den 24 Tagen Krankenstand, nach denen dann die Unterbrechung des Zivildienstes passiert. Ja, es ist richtig, wir wollen damit auch Missbrauch verhindern. Sehr viele von den jungen Männern sind unglaublich engagiert! Es gibt aber immer wieder negative Ausnahmen, die dann mit Kettenkrankenständen – einen Tag wieder in der Organisation – einfach lange Zeit nicht da sind, de facto der Organisation nicht zur Verfügung stehen. Deshalb diese Unterbrechung nach 24 Tagen – aber nicht, wenn sich der Zivildiener im Rahmen des Zivildienstes verletzt hat. Das gilt nur dann, wenn es außerhalb des Zivildienstes geschieht oder zu Erkrankungen kommt. Also das ist auch etwas, wo man ganz genau hinschauen muss und die Intention des Gesetzes, in dem Fall der Änderung, berücksichtigen muss.
Eines noch zum Onlinetool: Es wird ab 1.7. zur Verfügung stehen. Und zwar müssen nicht die Zivildienstorganisationen die Zivildiener ausbilden, sondern die Zivildienstserviceagentur stellt die Inhalte auf der Homepage zur Verfügung. Es ist auch – und das sage ich auch dazu – eine Lex imperfecta, denn wenn ein Zivildiener dieses Onlinetool nicht absolvieren möchte, gibt es dafür keine Konsequenz, keine negative Konsequenz.
Es ist also ein Angebot, und ich sage Ihnen ganz offen: Als für den Zivildienst zuständige Staatssekretärin sehe ich hier eine große Chance, dass man einfach rund 14 500 – auf dem Niveau wird es etwa bleiben – junge Männer dazu bringt, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen, mit dem Gesetzwerdungsprozess auseinanderzusetzen und hier dann auch einen Nachweis für sich selbst mitzunehmen.
Alles in allem kann ich nur sagen: Es ist jetzt ein attraktiveres, moderneres Gesetzgebungswerk für den Zivildienst. Ich danke auch für die breite Unterstützung. Ich war jetzt fast ein bisschen überrascht davon, dass es hier sozusagen Gegenstimmen und Gegenmeinungen gibt, weil das im Nationalrat einstimmig durchgegangen ist – aber ja, klar. Ich danke Ihnen für die Unterstützung, und ich bitte Sie auch hier um eine breite Unterstützung für diesen Gesetzentwurf. – Ich danke Ihnen. (Beifall bei ÖVP, SPÖ und FPÖ.)
19.43
Vizepräsident Ewald Lindinger: Weitere Wortmeldungen dazu liegen nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir gelangen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz zur Gewährleistung eines hohen Sicherheitsniveaus von Netz- und Informationssystemen (Netz- und Informationssystemsicherheitsgesetz – NISG) erlassen und das Telekommunikationsgesetz 2003 geändert wird (369 d.B. und 418 d.B. sowie 10099/BR d.B.)
Vizepräsident Ewald Lindinger: Wir gelangen nun zum 13. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatter ist Herr Bundesrat Georg Schuster. Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatter Georg Schuster: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich erstatte den Bericht des Ausschusses für innere Angelegenheiten über den Beschluss des Nationalrates vom 11. September 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz zur Gewährleistung eines hohen Sicherheitsniveaus von Netz- und Informationssystemen (Netz- und Informationssystemsicherheitsgesetz – NISG) erlassen und das Telekommunikationsgesetz 2003 geändert wird.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor. Ich komme daher gleich zur Antragstellung.
Der Ausschuss für innere Angelegenheiten stellt nach Beratung der Vorlage am 18. Dezember 2018 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag,
1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben,
2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Art. 44 Abs. 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
Vizepräsident Ewald Lindinger: Danke für den Bericht.
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Andreas Arthur Spanring. Ich erteile ihm dieses.
Bundesrat Andreas Arthur Spanring (FPÖ, Niederösterreich): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Staatssekretärin! Werte Zuhörer und Zuschauer! Liebe Kollegen! Jeder von uns – zumindest fast alle – hat ständig sein Smartphone in der Hand. Wir verwenden E-Banking, wir bestellen online. Manche Haushalte, sogenannte Smart Homes, können komplett vom Handy oder Tablet aus gesteuert werden. Wir machen unseren Steuerausgleich online und sind Kunden bei verschiedensten Onlineanbietern.
Wir alle wissen, nicht alles kann hundertprozentig sicher abgesichert werden. Genauso ist es bei unserem Haus oder unserer Wohnung, auch diese können wir nicht zu 100 Prozent vor einem Einbruch schützen. Sie erinnern sich an den Sicherheitsbericht 2017, den ich heute schon einmal zitiert habe: Im Bereich Cybercrime gab es einen Anstieg um 28,2 Prozent.
All diese vorher genannten Dinge betreffen uns privat, und natürlich gibt es auch andere Bereiche, auf die wir vielleicht nicht direkt einwirken können, die aber sehr wohl direkt auf unser tägliches Leben einwirken. Denken Sie an kritische Infrastruktur: Energie, Verkehr, Bankwesen, Finanzinfrastruktur, Gesundheitswesen, Trinkwasserversorgung, digitale Infrastruktur oder Anbieter von digitalen Diensten.
Stellen Sie sich vor, was los ist, wenn wir einmal drei Tage keinen Strom haben! Ein Blackout, drei Tage; ich rede jetzt nicht von drei Wochen, sondern nur von drei Tagen. Oder Probleme im Bankwesen, wenn wir einige Tage nicht auf unser Geld zugreifen können. Oder die Wasserversorgung funktioniert nicht.
Hier muss man nicht mehr – wie aus alten Hollywoodstreifen bekannt – vor Ort mechanisch einwirken, sondern all diese Dinge sind heute computergesteuert. Natürlich ist diese Infrastruktur sehr gut abgesichert. Wir wissen aber auch, dass gerade das für Hacker oftmals eine Herausforderung ist, und im Worst Case sind auch kriminelle oder terroristische Angriffe möglich.
Für diese Regierung ist Cybersicherheit eine Priorität! Mit diesem Gesetz wird erstmals eine einheitliche Cybersicherheitsstandards-Umsetzung für Unternehmen der kritischen Infrastruktur sowie Einrichtungen des Bundes geschaffen, über die Landesgrenzen hinweg. Hier werden mit der Umsetzung dieser EU-Richtlinie Sicherheitslücken geschlossen. Die Ausarbeitung des Gesetzes erfolgte weitgehend in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Es wird auch entsprechende Übergangsfristen geben, die garantieren, dass alle betroffenen Unternehmen genügend Zeit haben, ihre Adaptierungen bei den IT-Systemen durchführen zu können.
Diesem Gesetz werden wir sehr gerne zustimmen. (Beifall bei FPÖ und ÖVP.)
19.48
Vizepräsident Ewald Lindinger: Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Armin Forstner. Ich erteile ihm dieses.
Bundesrat Armin Forstner, MPA (ÖVP, Steiermark): Geschätzter Herr Präsident! Frau Staatssekretärin! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Das Netz- und Informationssystemsicherheitsgesetz, das sogenannte NIS-Gesetz, soll geändert werden. Ziel ist die Schaffung von einheitlichen Cybersicherheitsstandards für Unternehmen und Einrichtungen des Bundes aus den Bereichen Energie, Verkehr, Bankwesen, Finanzwesen, Gesundheitswesen, Trinkwasserversorgung, digitale Infrastruktur und Anbieter von digitalen Diensten.
Ein weiteres Ziel sollte sein, dass die Bevölkerung vor den mit der Digitalisierung verbundenen Gefahren und Risiken entsprechend geschützt wird und digitale Sicherheitslücken in Österreich geschlossen werden. Es geht aber auch darum, Kriterien und Abläufe zu schaffen, um die für die Gesellschaft, die Wirtschaft oder den Staat wesentlichen Dienste vor Cyberangriffen zu schützen.
Als wesentliche Dienste sind folgende Bereiche definiert worden: Strombereich – komplette Infrastruktur; Kollege Spanring hat es schon erwähnt: man braucht sich nur vorzustellen, drei Tage oder etliche Stunden keinen Strom zu haben, was für Probleme das verursachen kann –, Energiebereich, Heizungen, Gesundheitswesen, Krankenhäuser, Hausärzte, aber genauso auch die Verkehrssysteme für Pkw und Lkw, man denke an Ampeln ohne Strom. Aber auch die Themen Bankwesen und Internetdienste sind damit als wesentliche Dienste erfasst.
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Cybercrime ist in der Zwischenzeit auch schon ein Begriff in der Bevölkerung geworden. Wenn wir uns den jährlichen Sicherheitsbericht ansehen – auch das hat Kollege Spanring vorhin schon erwähnt –, dann merken wir, dass die Fälle der mit Internet verbundenen Kriminalität Jahr für Jahr steigen. Auch in der Debatte über den letzten Sicherheitsbericht in der vorletzten Innenausschusssitzung hat uns Herr Generalmajor Lang ausführlich geschildert, was das heißt und was da in Zukunft noch auf uns zukommen könnte.
Was mit diesem Gesetz erreicht werden soll, ist eine stärkere Zusammenarbeit, ein Informationsaustausch zwischen den Unternehmen, zwischen betroffenen Organisationen und auch den Behörden selbst. Wenn wichtige Informationen ausgetauscht werden, kann man sich auch gegenseitig helfen. Ist irgendwo ein Angriff bekannt geworden, kann man Hilfestellungen für andere bieten, Sicherheitsvorfälle und Risiken analysieren und Maßnahmen setzen, damit man nicht selbst zum Opfer wird.
Mit dem Gesetz wird ein wichtiger Schritt zur Gewährleistung eines hohen Sicherheitsstandards in Österreich getan. Dies geschieht in den Unternehmen der kritischen Infrastruktur, von deren Diensten die Bürgerinnen und Bürger in ihrem täglichen Leben abhängig sind, so wie wichtige digitale Diensteanbieter und die Bundesverwaltung in Zukunft ihre digitalen Systeme vor Angriffen schützen müssen.
Um das Gesetz zukunftssicher zu machen und eine praxistaugliche Regulierung zu gewährleisten, wurde ein enger Dialog mit den Experten auf diesem Gebiet geführt. Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, die Bürger vor den mit der fortschreitenden Digitalisierung verbundenen Gefahren und Risiken zu schützen. Ich denke, dieses Gesetz ist ein wichtiger, ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. – Danke schön. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
19.51
Vizepräsident Ewald Lindinger: Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Stefan Zaggl. Ich erteile ihm dieses.
Bundesrat Stefan Zaggl (SPÖ, Tirol): Sehr geehrter Herr Vizepräsident! Sehr geehrte Frau Staatssekretärin! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher! Für uns alle ist der Cyberraum kaum noch wegzudenken, sei es beim Einkaufen, bei Banking, in den Schulen, wo viele ihre Hausübungen wie auch Überprüfungen mit E-Learning abwickeln. Viele Firmen und Behörden bieten bereits Leistungen über das Internet an.
Durch den für uns bereits selbstverständlichen Umgang mit dem Internet bieten wir natürlich große Angriffsflächen für die Cyberkriminalität. Mit diesem Gesetz wird uns auch im virtuellen Raum größere Sicherheit geboten. Das wird in Zukunft, da sich die Gesellschaft mit ihren Alltäglichkeiten und den internationalen Firmenabwicklungen noch stärker in den Cyberraum begibt, noch wichtiger.
Ich möchte Ihnen kurz die fünf Prioritäten der strategischen Vorstellungen der EU auf dem Gebiet der Cybersicherheit näherbringen. Das ist erstens die Widerstandsfähigkeit gegenüber Cyberangriffen, zweitens die drastische Eindämmung der Cyberkriminalität, drittens die Entwicklung einer Cyberverteidigungspolitik und von Cyberverteidigungskapazitäten im Zusammenhang mit der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik – kurz CSDP –, viertens die Entwicklung der industriellen und technischen Ressourcen für die Cybersicherheit. Der fünfte und letzte Punkt wäre die Entwicklung einer einheitlichen Cyberraumstrategie der EU auf internationaler Ebene und Förderung der Grundwerte der EU.
Mit der NIS-RL, die am 8. August 2016 in Kraft getreten ist, soll EU-weit ein hohes Sicherheitsniveau der Netz- und Informationssysteme erreicht werden. Vor diesem Hintergrund soll die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in strategischer und operationeller Hinsicht gestärkt sowie bestimmte wichtige private und öffentliche Anbieter zu angemessenen Sicherheitsmaßnahmen und zur Meldung erheblicher Störfälle verpflichtet werden. Die NIS-RL verpflichtet darüber hinaus die Mitgliedstaaten, eine nationale NIS-Strategie zu erarbeiten, die strategische Ziele, Prioritäten und Maßnahmen enthalten soll, um in den einzelnen Mitgliedstaaten ein hohes Sicherheitslevel der Netz- und Informationssysteme zu erreichen.
Das Netz- und Informationssicherheitsgesetz beinhaltet sieben Maßnahmen. Ich werde auf den Inhalt nicht direkt eingehen, ich werde nur die Schwerpunkte nennen.
Das wäre erstens die Weiterentwicklung und Koordination einer neuen Strategie für die Sicherheit von Netz- und Informationssystemen.
Dann haben wir zweitens die Einrichtung von nationalen Koordinierungsstrukturen zur Prävention sowie zur Bewältigung von Sicherheitsvorfällen.
Die dritte Maßnahme ist die Einrichtung von Computernotfallteams zur Unterstützung der Betreiber wesentlicher Dienste, Anbieter digitaler Dienste und Einrichtungen des Bundes und der Länder bei der Bewältigung von Risiken und Sicherheitsvorfällen.
Die vierte Maßnahme ist die Ermittlung der Betreiber wesentlicher Dienste.
Die fünfte Maßnahme ist die Pflicht zur Setzung geeigneter Sicherheitsvorkehrungen, eben Informations- und Meldepflicht, die sehr wichtig ist.
Maßnahme sechs: Einrichtung und Betrieb einer Meldesammelstelle und einer zentralen Anlaufstelle.
Die letzte Maßnahme: Betrieb und Nutzung von IKT-Lösungen, das heißt Informations- und Kommunikationstechnik.
Ebenso hat der Datenschutzrat, welcher als primäre Zielsetzung die Entwicklung des Datenschutzes in Österreich zu beobachten und Vorschläge für dessen Verbesserung zu erarbeiten hat, dies auch getan, und einige seiner Vorschläge wurden tatsächlich in die Regierungsvorlage aufgenommen.
Die Sicherheit unserer Bevölkerung ist auch im digitalen Zeitalter sehr wichtig. Mit diesem Gesetz können wir Cyberattacken verhindern beziehungsweise vermindern. Wir von der SPÖ werden diesem Gesetz natürlich zustimmen. – Danke für die Aufmerksamkeit. (Beifall bei der SPÖ sowie bei BundesrätInnen von ÖVP und FPÖ.)
19.56
Vizepräsident Ewald Lindinger: Zu Wort gemeldet hat sich die Frau Staatssekretärin. Ich erteile ihr dieses.
Staatssekretärin im Bundesministerium für Inneres Mag. Karoline Edtstadler: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Mitglieder des Bundesrates! Danke für die ausführliche Berichterstattung an meine Vorredner! Ich kann es jetzt ganz kurz machen, weil ich Ihnen nichts Neues mehr erzählen kann. Ich darf Ihnen aber noch mit auf den Weg geben, dass es nicht nur innerstaatlich eine absolute Priorität dieser Bundesregierung ist, für die Cybersecurity oder Cybersicherheit zu sorgen – Cybersecurity auch, aber halt auf Deutsch –, sondern auch eine Priorität in der jetzt ausklingenden EU-Präsidentschaft war.
Auch wenn das jetzt der erste Rechtsakt der Europäischen Union ist, der in nationales Recht umgesetzt wird, kann ich Ihnen prophezeien, ohne hellseherische Fähigkeiten zu haben: Das wird nicht der letzte sein, denn das ist ein Thema, das uns in Zukunft massiv beschäftigen wird und wo wir uns einfach schützen müssen, egal, ob es terroristische oder kriminelle Hintergründe sind, die es auf unsere kritische Infrastruktur abgesehen haben. Wir müssen uns davor schützen, und wir müssen, auch wenn wir diese Dinge tagtäglich verwenden, immer auch die Kehrseite der Medaille im Kopf haben und auch für die entsprechende Sicherheit sorgen.
Ich danke Ihnen für die wirkliche Eintracht auch in der Betrachtung dieses Gesetzes. Es kommt ja relativ selten vor, dass man wirklich ein ganz neues Gesetz schaffen kann. In diesem Fall ist das so gewesen, und da ist auch alles berücksichtigt, was die
unterschiedlichen Stakeholder eingebracht haben. In diesem Sinne noch einmal: Vielen Dank für Ihre Unterstützung, jetzt auch bei der Abstimmung! – Vielen Dank. (Beifall bei ÖVP, SPÖ und FPÖ.)
19.58
Vizepräsident Ewald Lindinger: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor. Die Debatte ist geschlossen.
Wir gelangen nun zur Abstimmung.
Dieser Beschluss des Nationalrates ist ein Fall des Art. 44 Abs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz und bedarf daher der Zustimmung des Bundesrates bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder und einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen.
Ich stelle einmal die Beschlussfähigkeit fest: Mehr als die Hälfte der Mitglieder des Bundesrates sind anwesend.
Wir gelangen zur Abstimmung darüber, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist somit angenommen.
Nunmehr lasse ich über den Antrag abstimmen, dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Art. 44 Abs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit unter Berücksichtigung der besonderen Beschlusserfordernisse angenommen.
Ausdrücklich stelle ich die verfassungsmäßig erforderliche Zweidrittelmehrheit fest.
Beschluss des Nationalrates vom 12. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz über die Entwicklung und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Österreich (Standort-Entwicklungsgesetz – StEntG) (372 d.B. und 469 d.B. sowie 10075/BR d.B. und 10111/BR d.B.)
Vizepräsident Ewald Lindinger: Wir gelangen nun zum 14. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatterin ist Frau Bundesrätin Marianne Hackl. Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatterin Marianne Hackl: Hohes Präsidium! Werte Frau Minister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich bringe den Bericht des Wirtschaftsausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 12. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz über die Entwicklung und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Österreich. (Vizepräsident Brunner übernimmt den Vorsitz.)
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, daher komme ich gleich zur Antragstellung.
Der Wirtschaftsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 18. Dezember 2018 mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Danke für den Bericht.
Bevor wir in die Debatte eingehen, darf ich Frau Bundesministerin Schramböck ganz herzlich bei uns begrüßen. – Schön, dass Sie da sind! Willkommen im Bundesrat! (Allgemeiner Beifall.)
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Günther Novak. Ich erteile es ihm.
Bundesrat Günther Novak (SPÖ, Kärnten): Sehr geehrter Herr Präsident! Frau Bundesministerin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren auf der Galerie! Liebe Zuhörer! Ich erinnere mich ein paar Wochen zurück, als wir hier in diesem Haus die Änderung der UVP beziehungsweise des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes beschlossen und besprochen haben. Nur allzu leicht durchschaubar war dieser Versuch der Regierung, unter dem Deckmantel der Verkürzung der Verfahrensdauer und der Verfahrensbeschleunigung die Rechte der Anrainer und der NGOs einzuschränken.
Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, und vielleicht fällt es auch Ihnen wieder ein, dass zukünftig in UVP-Verfahren NGOs nur zugelassen sind, wenn mehr als 100 Mitglieder nachgewiesen werden. Ich denke, dass das eine Vorgangsweise ist, die auf Kosten der Umwelt ausgetragen wird. Sie werden doch wohl nicht glauben, dass die Mitglieder der NGOs, auch wenn sie weniger als 100 sind und diese Voraussetzung nicht erfüllen, nicht trotzdem vor Ort sein werden, wenn sie der Meinung sind, dass sie gegen etwas ankämpfen müssen!
Alles, was damals an Kritikpunkten gegen diese Gesetzesänderung von mir und von uns vorgebracht wurde, gilt beim Standort-Entwicklungsgesetz umso mehr. Ich denke, dass dieses Gesetz von Anfang an gründlich missglückt ist. Schon der erste Entwurf wurde, wie wir wissen, von namhaften Experten als „rechtsfern“ bezeichnet und selbst der nun vorliegende Entwurf wird immer noch von wesentlichen Institutionen wie dem Rechnungshof, dem Dachverband der Verwaltungsrichter und dem Bundesverwaltungsgericht massiv kritisiert.
Auch wenn überschießende Regelungen aus dem ursprünglichen Entwurf entfernt wurden, bleibt dennoch die Grundessenz bestehen. Damals ging es nämlich um diesen Genehmigungsautomatismus, wobei die Verfahrensbeschleunigung lediglich mit der Einschränkung der Verfahrensrechte gleichgesetzt wurde. Anstatt die Behörden mit ausreichender Expertise und Personal auszustatten, installiert die Regierung eine zusätzliche Parallelstruktur in Form eines Beirats.
Welche Aufgabe hat dieser Beirat? – Er hat die Aufgabe, bei allen Projekten die Standortrelevanz zu beurteilen, was aus unserer Sicht eine deutliche Steigerung des Verwaltungsaufwands nach sich zieht, die mit Kosten von rund 400 000 Euro verbunden ist.
Da wird wieder einmal deutlich, dass unter dem Vorwand der Standortrelevanz Umweltgesetze übergangen und die Rechte von Anrainern und Anrainerinnen, von Umweltorganisationen, wie schon gesagt, und von Bundesländern gravierend eingeschränkt werden, wobei eine Verfahrensförderungspflicht mit Kostenersatz eingeführt wird. Äußerungsfristen werden beschränkt und zusätzlich werden die Veröffentlichungspflichten reduziert.
Wenn man sich das Gesetz anschaut, dann sieht man sehr klar die deutliche Handschrift der Wirtschaftskammer und der Industriellenvereinigung (Beifall bei der SPÖ), wobei ich mich darüber wundere, dass das Umweltministerium beziehungsweise die Frau Umweltministerin dazu beharrlich schweigen. (Bundesrat Schennach: Na ja, das ist so! Schweigen ...!)
Die Verkürzung der UVP-Verfahrensdauer ist, glaube ich, unser aller Anliegen. Beispiele, wie das gelingen könnte, gibt es genug. Daher gibt es von unserer Seite auf jeden Fall ein Ja zur Verfahrensökonomie und ein Bekenntnis zu einem stärkeren Wirtschaftsstandort Österreich.
Ich habe vorher die Wirtschaftskammer und die Industriellenvereinigung erwähnt. Bei uns im Ausschuss haben wir noch feststellen müssen: Es gibt ja zu diesem Thema den Standortanwalt, der kurzfristig eingeführt worden ist, übrigens auch mit einem Initiativantrag. Wir haben der zuständigen Auskunftsperson vom Bundesministerium die Frage gestellt: Wie wird denn dieser Standortanwalt dann eingesetzt werden? Welche Aufgaben wird er haben? Was wird er denn dort tun? – Die Antwort war: Da werden noch einige Probleme gelöst werden müssen.
Vielleicht ist es mittlerweile klar, was dieser Standortanwalt zu tun hat, aber zum damaligen Zeitpunkt wird es noch nicht klar gewesen sein, weil dieser Initiativantrag erst zwei Stunden vorher eingebracht wurde. Gestern hat uns auch die zuständige Auskunftsperson des Bundesministeriums keine Antwort darauf geben können. Wie auch immer, vielleicht erklärt uns das die Frau Bundesministerin. (Bundesrat Schennach: ... ist es auch nicht klar!)
Dieses Gesetz dient in der jetzigen Form allerdings nur der Aushebelung demokratischer Standards und, das habe ich auch ausgeführt, der Beschneidung der Rechte anderer. Das kann nicht das Ziel einer Reform sein und kann von uns daher nur abgelehnt werden. (Beifall bei der SPÖ sowie der Bundesrätin Dziedzic.)
20.07
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Als Nächster ist Herr Bundesrat Seeber zu Wort gemeldet. Ich erteile es ihm.
Bundesrat Robert Seeber (ÖVP, Oberösterreich): Hohes Präsidium! Sehr verehrte Frau Minister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir sind in einer Zeit der Hochkonjunktur, allerdings gibt es am Horizont die ersten Anzeichen dafür, dass die Konjunktur etwas abflaut. Aus wirtschaftlicher Sicht gibt es nur eine Antwort darauf: den Standort zu stärken. Genau in diese Richtung geht dieses Gesetz, das wir beschließen, denn eines ist klar: Lange Verfahren bremsen einen Standort.
Ein privater Investor wird sich hüten, hier zu investieren, wenn er weiß, dass ein Verfahren im Schnitt an die drei Jahre dauert. Wenn ich mir das vergegenwärtige, dass es drei Jahre dauert, bis man eine Firma aufsperren kann, dann erkennt man, dass man bis dahin schon lange in Konkurs ist. Ich glaube, das kann sich ein Privater nicht leisten, aber auch der Staat Österreich kann sich das nicht leisten.
Einige Beispiele möchte ich an dieser Stelle schon anführen: Ein Stichwort ist die dritte Piste am Flughafen in Schwechat, da reden wir jetzt von zehn Jahren; weiters wären der Semmeringbasistunnel oder die 380-kV-Salzburgleitung zu nennen. Aus eigener Erfahrung als Linzer Bürger möchte ich das Stichwort Westring erwähnen.
Ich habe einen Kollegen, Herrn Raml, vorhin gefragt: Weißt du eigentlich, wann das mit dem Westring angegangen ist? Nicht einmal ich kann mich daran erinnern. Ich glaube, das ist jetzt 40 Jahre her. Einmal waren es Nagetiere, dann war es eine Vogelart, dann waren es private Interessen. Das geht zulasten des Standorts, das erzeugt Kosten, das ist ein Wahnsinn. Das sind nur einige Beispiele.
Was macht man mit diesem Gesetz, liebe Kolleginnen und Kollegen? – Die UVP-Verfahren werden beschleunigt. Genau das braucht man. Es wird in keinen Instanzenzug und in keine Parteienstellung eingegriffen. Das Ministerium hat das durch Experten
überprüfen lassen. (Zwischenruf des Bundesrates Stögmüller.) Es ist verfassungskonform, es ist europarechtskonform, es geht in die richtige Richtung.
Der Expertenbeirat, den Kollege Novak angeschnitten hat – ich habe mir das auch gemerkt aus dem Ausschuss – kostet circa 500 000 Euro im Jahr. Da reden wir von Infrastrukturkosten. Es werden keine Aufwandsentschädigungen bezahlt, die machen das umsonst. Da geht es rein um Kosten, die mit der Infrastruktur zu tun haben.
Ich glaube, man kann dieses Argument sehr leicht entkräften. 500 000 Euro sind viel Geld, keine Frage, der Nichtbau der 380-kV-Leitung von Oberösterreich und Salzburg nach Kärnten verursacht 13 Millionen Euro Kosten im Jahr!
Kollege Günther Novak, du weißt, wovon ich rede. Da rede ich noch gar nicht von den Redispatchkosten, denn da reden wir gleich von 100 Millionen Euro im Jahr. Also was sind 500 000 Euro im Jahr? – Klar, es ist eine Summe, aber wenn man das gegenüberstellt, ist das lachhaft, und es ist richtig, einen Expertenbeirat zu installieren.
Wie funktioniert das? – Es gibt drei Stufen. Der Bund reicht gar nichts ein. Es gibt einen Projektwerber, der einreicht. Dann gibt es die zweite Stufe: Es geht zum Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaft. Da gibt es eine Vierwochenfrist – bitte aufpassen, eine Vierwochenfrist! –, dann gibt es ein Ja oder ein Nein. Dann geht es zum Expertenbeirat und dann kommt es zu einer Entscheidung des Bundesministeriums für Wirtschaft mit dem Verkehrsministerium, und da sind wir bei sechs Monaten, maximal einem Jahr. Und jetzt reden wir von knapp drei Jahren Verfahrensdauer bei diesen Verfahren! Das ist einfach ein Wahnsinn für den Standort, für die Arbeitsplätze und für die Wertschöpfung. Das ist für mich als Wirtschaftsmenschen ganz klar, meine Damen und Herren.
Dieses Argument mit dem Standortanwalt, das Kollege Günther Novak gebracht hat, habe ich mir auch gemerkt. Da gibt es noch einige Sachen zu klären, da hast du recht, aber eines ist klar: Bis jetzt wurde immer nur die Umwelt überproportional bei den öffentlichen Interessen berücksichtigt. Ich finde das nicht ganz gerecht, denn öffentliche Interessen betreffen nicht nur die Umwelt. (Zwischenruf des Bundesrates Stögmüller.) Auch ich bin für eine florierende Umwelt, aber es geht auch um Arbeitsplätze, lieber Kollege, es geht um Wertschöpfung und, wir haben es heute schon gehört, es geht um Versorgungssicherheit.
Versorgungssicherheit müsste eigentlich dir ein Anliegen sein, denn wenn es nicht zu dieser 380-kV-Leitung kommt, dann wird das mit der Elektromobilität und mit den Zielen der Energieeffizienz und mit den Energiezielen sehr schwer kompatibel sein. Das muss man halt immer gegenüberstellen. (Bundesrätin Mühlwerth: Aber du weißt doch, der Strom kommt aus der Steckdose!) – Der Strom kommt aus der Steckdose, da hast du recht, Frau Kollegin Mühlwerth.
Abschließend gesagt: Dieses Gesetz ist der richtige Ansatz. Als Wirtschaftler sage ich abschließend: In der Wirtschaft fressen die Schnellen die Langsamen. Ihr wisst alle, wir leben in einem Zeitalter der Digitalisierung und der Internationalisierung, und da ist die Wettbewerbsfähigkeit ein Schlüsselfaktor für unsere Zukunft.
Ich bedanke mich, Frau Minister, für das Engagement, dieses Gesetz zu machen, und ich ersuche um Unterstützung dazu. – Danke (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
20.14
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Als Nächste ist Frau Bundesrätin Dr. Dziedzic zu Wort gemeldet. Ich erteile es ihr. (Bundesrat Pisec: Jetzt wissen wir bald wieder, wie die Welt funktioniert!)
Bundesrätin Mag. Dr. Ewa Dziedzic (Grüne, Wien): Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Frau Ministerin! Werte Kollegen und Kolleginnen! Wenn sich nur die Wirtschaft
freut, sollten wir skeptisch werden. (Beifall bei der SPÖ sowie des Bundesrates Stögmüller.) Tatsächlich hat uns ja die Aushebelung der Umweltrechte genauso wie die Verschiebung und Aushebelung wichtiger, jahrzehntelang erkämpfter Kriterien im Umweltbereich hier im Bundesrat schon öfter beschäftigt. Zum Glück sind die Grünen nicht die Einzigen, die da zu Recht aufschreien, weil es nämlich um wirklich weitreichende und gleichzeitig sehr kurzsichtige Beschlüsse geht, die Sie hier fassen. Eines vorweg: Sie können sicher sein, durch diese Rechtsunsicherheiten wird dem Wirtschaftsstandort Österreich erst recht geschadet werden.
Ein Überblick: Die NEOS sprachen von „NGO-Schikane“. Liste JETZT meinte, dass da Wirtschaftsinteressen vor Umweltinteressen gestellt werden. Die SPÖ meinte, das Standort-Entwicklungsgesetz „greift tief und unverhältnismäßig in die Rechte von Anrainern, Umweltorganisationen und Bundesländern ein.“ Dazu kommt, „dass das Gesetz seinen Zweck“ – nämlich die Verfahrensbeschleunigung, die diesbezüglich immer wieder zitiert wird – „verfehlen wird, weil so die UVP-Verfahren weder einfacher noch schneller werden, sondern komplizierter, langwieriger“.
Das Bundesverwaltungsgericht hat ebenso Sorge angemeldet, ich zitiere: „Das Bundesverwaltungsgericht verfügt jedoch über keinen eigenen Sachverständigenapparat, und die Verfügbarkeit geeigneter Sachverständiger stellt schon jetzt“ – ich wiederhole für Sie extra: schon jetzt – „eines der Hauptprobleme bei der Durchführung zügiger Beschwerdeverfahren dar. Aus diesem Grund könnte es zu weiteren Verfahrensverzögerungen kommen.“
Greenpeace ortet Rechtsunsicherheit: Voraussichtlich werden etwa zwei Drittel der anerkannten Umweltorganisationen in Österreich künftig von Umweltverfahren ausgeschlossen, sagen sie. Weiters schafft das Standortgesetz de facto Umweltverfahren für Großprojekte wie Schnellstraßen, Mülldeponien oder Industrieanlagen ab und ist deshalb auch demokratiepolitisch ein Rückschritt, höchst intransparent und eindeutig von der Industrie diktiert. – Zitatende.
WWF fürchtet mehr „Umweltzerstörung“ in Österreich, und der Verein Virus, der Ihnen bekannt sein wird, meint: „Gemeinsam mit den Rechtwidrigkeiten und Rechtsunsicherheiten die sicher zum Einsatz von Rechtsmitteln und langfristigem Herausbilden neuer Judikatur führen wird, ist nicht von einer Verfahrensbeschleunigung sondern einer Verfahrensverzögerung auszugehen!“ – Das Gesetz enthält laut Virus weiters auch schikanöse Regelungen gegenüber den Verfahrensparteien.
Ich habe das alles deshalb zitiert, weil es wichtig ist, jenen eine Stimme zu geben, denen Sie diese kritische Stimme nehmen möchten. (Beifall bei der SPÖ sowie des Bundesrates Stögmüller.)
Jetzt ganz kurz zum Abänderungsantrag, nämlich zur Änderung des Wirtschaftskammergesetzes, mit der die Umweltanwaltschaften de facto ad acta gelegt werden, während an den Landeswirtschaftskammern Standortanwälte eingerichtet werden. Ich denke auch, dass sich die gewerbetreibenden Mitglieder darüber freuen werden, dass sie das in Zukunft mitfinanzieren dürfen. Pikant ist dabei, dass diese Standortanwälte Ihnen, Frau Ministerin, weisungsgebunden sind.
Ob das verfassungsrechtlich überhaupt haltbar ist, wird sich noch weisen. Tatsache ist nämlich, dass die Weisungsbefugnis keine Kompetenzgrundlage hat. Sie zeugt auch davon, dass Sie den Landesregierungen in diesem Fall misstrauen. Hier hätte eigentlich der Verfassungsdienst – und das ist Ihr Versäumnis – prüfen müssen, wie das aus Sicht der Länder ausschaut, weil die Vollziehung des UVP-Gesetzes nämlich in der autonomen Landesvollziehung liegt.
Zurück zum Standort-Entwicklungsgesetz: Abseits davon, dass damit, wie ich gesagt habe, rein gar nichts beschleunigt wird, sondern auf Biegen und Brechen die Gerichte
unter Zeitdruckdruck dazu gezwungen werden, könnte man schon meinen (Bundesrat Seeber: Stimmt nicht! Das heißt Wirtschaftsdenken, ganz einfach!) – nein, nein! –, und wirklich wichtige Nachbesserungen bei Großprojekten außer Acht gelassen werden, gibt es noch – da widerspreche ich Ihnen – einen Widerspruch zum EU-Recht. Es entspricht nämlich nicht der EU-UVP-Richtlinie. Das ist so, und es gibt dazu auch eine Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes. Auch das können Sie sich ja nochmals im Detail anschauen. Dass in Zukunft zusätzlich ein weisungsgebundener, intransparenter Standortbeirat Verfahren forcieren soll, widerspricht zudem der Aarhuskonvention, in der verankert ist, dass es ein Recht auf Umweltinformation gibt.
Es wird verbreitet, dass wir den Wirtschaftsstandort Österreich schwächen würden, wenn wir das so nicht umsetzen. (Bundesrat Seeber: Westring, 40 Jahre! Das sind Fakten!) – Fakten! Die Fakten, bitte, Herr Kollege, sind nämlich folgende: Nur bei etwa 2 bis 3 Prozent der UVP-Verfahren werden Genehmigungen nicht erteilt, sprich: nicht gleich erteilt. (Bundesrat Samt: Aber die Zeit spielt keine Rolle?!)
Die durchschnittliche Verfahrensdauer ab Vollständigkeit der Unterlagen liegt bei sieben Monaten – und genau da liegt der Hund begraben. Die Gerichte müssen nämlich teilweise den Projektleitern nachlaufen, um diese Unterlagen zu bekommen. Haben sie alle Unterlagen beisammen, dauert es überhaupt nicht mehr so lange, im Gegenteil, es wird, wie gesagt, in Zukunft noch länger dauern. Alles andere sind Ausreißer, das wissen wir, oder besonders kontroverse Verfahren, wobei ich finde, dass diese Prüfungen bei denen bisher sehr wohl Sinn gemacht haben.
Ich komme zum Schluss: Fast schon beeindruckend ist noch, wie fehlerhaft die Konstruktion dieses Gesetzes war und nach wie vor ist. Man kann es nicht oft genug wiederholen: Es verstößt gegen einfache Gesetze, wie Schutznormen aus Gewerbeordnung, Wasserrecht. Es verstößt gegen Verfassungsgesetze und Grundprinzipien der Bundesverfassung allein durch diesen erzwungenen Automatismus. Grundrechte betrifft es insofern, als das Recht auf ein faires Verfahren in Zukunft nicht mehr gewährleistet sein wird. Es betrifft auch Europarecht und Völkerrecht; das habe ich vorher schon anhand der Aarhuskonvention ausgeführt.
Alles in allem, liebe ÖVP- und liebe FPÖ-Kollegen und -Kolleginnen, haben Sie jedenfalls der Industrie eine schöne Bescherung gemacht, aber auf Kosten der Gesundheit, auf Kosten unserer Lebensgrundlagen und auf Kosten der Fairness, die wir in diesem Land hart erkämpft haben. (Bundesrat Pisec: Verbau der Steinhofgründe! Heumarkt! – Bundesrätin Mühlwerth: Karlsplatz! – Bundesrat Seeber: Es gibt auch eine Wirtschaft!) Sie müssen sich deshalb den Vorwurf gefallen lassen, dass es nicht ausgeglichen ist, wenn Sie den Fokus lediglich und ausschließlich auf die Wirtschaftsinteressen legen, und dass Sie nicht im Sinne der Bevölkerung, sondern im Sinne der großen, gierigen Geldgeber arbeiten. (Bundesrat Seeber: Es gibt auch einen Wirtschaftsstandort Österreich!)
Angesichts dessen, wie Sie das Umweltbudget laut Bundesfinanzrahmen gekürzt haben und in den nächsten Jahren kürzen werden, nämlich um 300 Millionen Euro – 300 Millionen Euro! –, können wir nicht mehr von Interessen im Sinne der Bevölkerung sprechen, sondern es wird noch einmal sichtbar, dass Ihre Interessen lediglich darin liegen, sich gewinnbringend gewisse Investoren zum Freund zu machen. – Vielen Dank. (Beifall bei der SPÖ sowie des Bundesrates Stögmüller.)
20.23
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Gerd Krusche. Ich erteile es ihm.
Bundesrat Gerd Krusche (FPÖ, Steiermark): Frau Bundesminister! Hohes Präsidium! Meine Damen und Herren! Das Gesetz regelt in zwei Hauptstücken zwei wesentliche
Dinge: erstens das Verfahren für die Bestätigung, dass ein Projekt standortrelevant und im besonderen Interesse der Republik ist, und zweitens verfahrensbeschleunigende Maßnahmen.
Meine Damen und Herren, durch dieses Gesetz wird keine Kröte, keine Fledermaus in ihren Rechten schlechtergestellt. (Beifall bei FPÖ und ÖVP.)
Frau Dziedzic, Ihre Aussage war sehr entlarvend, als Sie gesagt haben, was der Wirtschaft nützt, ist einmal grundsätzlich verdächtig. (Bundesrätin Dziedzic: Das habe ich nicht gesagt, das unterstellen Sie mir!) Ich möchte mich auch entlarven und sage: All das, was Sie so vehement bekämpfen, kann nicht so schlecht sein. (Heiterkeit und Beifall bei FPÖ und ÖVP.)
Sie sind, auch wenn Sie es nicht wahrhaben wollen, Teil dieser unserer Wirtschaft, in der wir uns alle bewegen und in der wir leben. Sie leben nicht am Mars, auch wenn ich es mir vielleicht manchmal wünschen würde. (Heiterkeit bei FPÖ und ÖVP. – Bundesrätin Dziedzic schickt dem Redner eine Kusshand.) Die Grünen sind überhaupt grundsätzlich gegen alles. Sie sind zwar für E-Mobilität, aber es ist heute bereits ein Zwischenruf gefallen: „Der Strom kommt aus der Steckdose“. – Wie er aber dort hinkommt (Zwischenrufe der BundesrätInnen Dziedzic und Stögmüller), ist Ihnen egal, denn sonst wären Sie nicht so vehemente Gegner der saubersten Energiegewinnung, die wir haben, der erneuerbaren Wasserkraft. Ich sage nur Murkraftwerk in Graz oder, jetzt anstehend, das Speicherkraftwerk auf der Koralm. Wer schreit als Erster und am lautesten dagegen? – Das seid immer ihr und die mit euch verbundenen NGOs! (Bundesrätin Dziedzic: Weil die Umwelt nicht sprechen kann!)
Über den Stufenbau, über die Schritte dieses Verfahrens brauche ich mich nicht mehr zu äußern, das hat Kollege Seeber schon sehr deutlich gesagt. Herr Kollege Novak kritisiert, dass es zu einer Steigerung der Verwaltungskosten kommt (Zwischenruf des Bundesrates Novak), aber das stimmt nicht, denn diese überlangen Verfahren kosten viel mehr als die 500 000 Euro pro Jahr.
Was das zweite Hauptstück, die Sonderbestimmung für die Genehmigungsverfahren, betrifft, so werden da insbesondere Regelungen getroffen, die im Wesentlichen ein vorsätzliches und mutwilliges Verzögern von Projekten hintanhalten sollen. Das heißt nicht, dass berechtigte und begründete Einwände in dem Verfahren nicht berücksichtigt werden. Schaut man sich aber die Praxis an, so kann man sich des Verdachts nicht erwehren, dass es manchmal sehr wohl der Fall ist, dass da nicht um der Sache wegen, sondern quasi aus sportlichen Gründen versucht wird, etwas um jeden Preis zu verhindern. (Bundesrat Seeber: Richtig!)
Und wenn Sie sagen: Im Durchschnitt dauern die Verfahren sieben Monate; wozu braucht man das also? – Ja, mit dem Durchschnitt ist das so ein Problem. Stehe ich mit einem Fuß im Eiswasser und mit dem anderen im kochenden Wasser, dann habe ich durchschnittlich eine angenehme Temperatur, aber es wird trotzdem nicht so fein sein. (Heiterkeit und Beifall bei der FPÖ. – Bundesrätin Dziedzic – erheitert –: Das merke ich mir!)
Solche nicht durchschnittlichen Verfahren gibt es halt auch in größerer Zahl. Das Beispiel Semmeringbasistunnel wurde bereits erwähnt. Wer hatte denn da Parteienstellung? – Nicht nur die großen Organisationen, sondern beispielsweise auch der Verein zum Schutz des Kobernaußerwaldes (Zwischenruf des Bundesrates Stögmüller) – mir ist nicht bekannt, dass der Kobernaußerwald irgendwo am Semmering liegt – oder die Gesellschaft für Herpetologie, diese beschäftigt sich mit Amphibien und Reptilien. So gesehen war das auch sehr gut bei der UVP-Novellierung, dass solche Scheinorganisationen da jetzt nicht mehr so leicht zugelassen werden. (Beifall bei der FPÖ sowie der Bundesräte Bader und Seeber. – Bundesrat Stögmüller: Ja, ja!)
Ich habe ein bisschen eine Ahnung von Infrastrukturprojekten, sie begleiteten mich mein gesamtes bisheriges Berufsleben. Das Unternehmen, bei dem ich beschäftigt bin, wurde 1987 gegründet. Eines der ersten größeren Projekte, die wir bearbeitet haben, war im Zuge des Erkundungsprogramms für den Semmeringbasistunnel. Nun, mittlerweile 30 Jahre später, dürfen wir endlich Projektbeteiligte bei der Bauausführung sein. – Das sei zur durchschnittlichen Verfahrensdauer gesagt.
Der volkswirtschaftliche Schaden, der durch solche Verzögerungen – andere Beispiele wurden ja auch bereits genannt – entsteht, ist gewaltig. Die Verfahren selbst werden teurer, aber auch die Projektkosten steigen, denn der Baukostenindex geht üblicherweise nach oben und nicht nach unten. Wir haben im Jahr 2007 einen Auftrag für die S 7, die Schnellstraße im Burgenland und in der Steiermark, bekommen. 2017, zu dem Zeitpunkt, als seinerzeit die Eröffnung geplant war, ist dieser Auftrag wieder aufgelebt, natürlich mit der entsprechenden Kostenindexierung.
Ganz gravierend ist, dass sich die Wirksamkeit von solchen Projekten massiv verzögert, beispielsweise beim Lobautunnel: Durch die Verzögerungen, die da entstehen, wird natürlich der tägliche Stau auf der Südosttangente prolongiert (Bundesrat Seeber: Richtig! – Bundesrätin Dziedzic: Kennen Sie die Studien zu ...?), und dieser verursacht nicht nur enorme volkswirtschaftliche Staukosten, sondern auch enorme Umweltschäden. (Beifall bei der FPÖ und bei BundesrätInnen der ÖVP.)
Das betrifft die öffentlichen Projektwerber, aber die privaten betrifft es mindestens genauso massiv, denn deren Finanzierungspläne und Kalkulationsgrundlagen kommen durch diese elendslangen Verzögerungen völlig aus dem Ruder. Es besteht natürlich die Gefahr, dass ein privater Projektwerber im Wissen solcher Probleme erst gar nicht anfängt, so etwas überhaupt betreiben zu wollen. (Bundesrat Seeber: Richtig, genau! Der wird sich hüten!)
Ich habe das Gesetz gelesen und habe mich sehr darüber gefreut: Es ist kurz, verständlich, logisch, was man von Gesetzen nicht immer sagen kann, und ich glaube, es wird sogar eine Vorreiterrolle spielen. Deutschland wird uns um dieses Gesetz beneiden, dort haben sie genau dieselben Probleme, sie heißen ein bisschen anders, dort sind es Planfeststellungsverfahren. Da ist es aber auch passiert, dass sie beim Projekt Stuttgart 21 dann, als man endlich begonnen hatte zu bauen und eine Baufirma den Schacht nach dem genehmigten Plan abstecken wollte, draufgekommen sind: Hoppla, da stimmt etwas nicht, das ist mittlerweile der Innenhof eines Seniorenheims.
Solche Fehlentwicklungen und die dadurch entstehenden Mehrkosten gilt es zu verhindern. Dieses Gesetz hat eine Vorbildwirkung, und ich freue mich schon jetzt auf die positiven Auswirkungen. (Beifall bei FPÖ und ÖVP. – Bravoruf des Bundesrates Seeber.)
20.32
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Zu Wort gemeldet hat sich Frau Bundesministerin Dr. Schramböck. – Bitte.
Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Dr. Margarete Schramböck: Herr Präsident! Liebe Mitglieder des Bundesrates! Werte Zuseherinnen und Zuseher! Lange Verfahren bremsen den Wirtschaftsstandort Österreich. Projektwerber und betroffene Anrainer, beide haben das Recht, eine Antwort zu bekommen, sie haben das Recht, zu wissen, ob Projekte realisiert werden oder nicht.
Ich erinnere an die dritte Piste, Sie alle kennen dieses Beispiel vom Flughafen Wien. Eindrucksvoll hat dieses Beispiel uns vor Augen geführt, wie lange es braucht. Es braucht über zehn Jahre, und das ist nicht das einzige Beispiel. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Projekte mit überlangen Verfahrensdauern. Ich zähle nur ein paar auf:
Semmeringbasistunnel, 380-kV-Leitung, Westring Linz – alle wurden heute schon genannt.
Was ist das Ziel? – Das Ziel ist nicht, eine positive Entscheidung zu bekommen. Das Ziel ist, eine Entscheidung zu bekommen, diese kann auch Nein heißen. Es wird immer wieder von vielen ignoriert, dass darauf Rücksicht genommen wird, dass wir eine Entscheidung innerhalb angemessener Zeit wollen. Diese langen Verfahren bremsen den Standort und damit auch die damit verbundenen Arbeitsplätze. Auch das ist wichtig anzusprechen.
Es sind nicht nur Arbeitsplätze, die davon betroffen sind, die unmittelbar mit diesem Projekt zusammenhängen, sondern es sind auch Arbeitsplätze in Regionen. Es geht dort um Projekte, um Regionen anzubinden, um es den Pendlern zu ermöglichen, leichter voranzukommen. Es geht um Infrastrukturprojekte der ÖBB, die es ermöglichen sollen, leichter mit den öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwo hinzukommen. Es geht um Projekte im Großraum Linz, die ermöglichen sollen, den Verkehr zu reduzieren und eine Verbesserung für die Anrainer bei gleichzeitiger Einhaltung der Umweltstandards zu erreichen.
Es geht nicht darum, irgendjemandem mehr Rechte einzuräumen, sondern es geht ausschließlich darum, zu beschleunigen. Es wird weder in die Parteienstellung noch in den Instanzenzug eingegriffen – das ist ganz, ganz wichtig –, es wird lediglich in die Verfahrensdauer eingegriffen, sodass diese beschleunigt wird.
Für mich ist eines schon ganz wichtig: Der Staat hat sich selbst – auch die Behörden erster Instanz – an die Fristen zu halten. Wir schauen ins UVP-Gesetz, wir sehen sechs Monate, neun Monate, zwölf Monate, aber niemand hält sich daran. Für mich steht der Staat nicht über dem Gesetz. Hält jemand eine Frist nicht ein, so wird er zur Rechenschaft gezogen; und das darf auch für den Staat gelten.
Lassen Sie mich kurz auf ein paar Themen eingehen, die hier angesprochen worden sind! Erstens einmal das Thema der Verfahrensdauern: Wenn Sie sich im 7. UVP-Bericht auf Seite 32 eine Grafik ansehen, so werden Sie sehen, dass im Jahr 2017 beispielsweise die Verfahrensdauer von Antragstellung bis Entscheidung von UVP-Verfahren exklusive der vereinfachten Verfahren im Durchschnitt 36,8 Monate gedauert hat. Wir haben einzelne Verfahren, die noch wesentlich länger dauern.
Ich habe mir auch genau angeschaut, wie das mit den Sachverständigen ist. Ja, Sie haben recht, auch das Thema der Sachverständigen werden wir uns anschauen und lösen müssen, weil es in der Vergangenheit, in den letzten zehn Jahren, nicht gelöst wurde. Und ja, das Thema der Sachverständigen ist eine Herausforderung. Als ich aber in die Verfahren blickte, so war ich sehr überrascht, zu sehen, dass die Verfahren so strukturiert beziehungsweise unstrukturiert sind, dass diese Sachverständigen die gesamte Zeit über dabeisitzen müssen. Natürlich haben wir einen Mangel an Sachverständigen, wenn diese Sachverständigen zu jedem Zeitpunkt mit dabei sein müssen, weil das Verfahren nicht strukturiert ist.
Wir haben mit diesem Gesetz das Verfahren auch so strukturiert, dass ein Richter, so wie er es beim Zivilrecht tut und wie es übrigens auch der Europäische Gerichtshof tut, am Beginn genau definiert, welche Themen wann abgehandelt werden. Da muss nicht der Experte, der Sachverständige für das Thema Luft dabeisitzen, wenn das Thema Abwasser behandelt wird. So ist es aber im Moment und so können die Verfahren nicht bleiben. Deshalb sind sie lange, deshalb konsumieren sie sehr viele Sachverständige.
Das wesentliche Thema ist für uns die Beschleunigung. Warum? – Um auch Klima- und Energieziele zu erreichen. Wir können diese Ziele nur erreichen, wenn wir mit diesen Projekten vorankommen. Schauen wir uns das an, so sehen wir, dass es Bundesländer gibt, in denen es überhaupt keine Verfahren mehr gibt – da gibt es keine Verfah-
ren mehr! Es gibt auch keine Verfahren mehr von Privaten, es sind nur mehr welche, bei denen die öffentliche Hand in irgendeiner Form beteiligt ist, um eben eine Region zu erschließen, um etwas möglich zu machen.
Niederösterreich sei als Beispiel genannt: Niederösterreich hat die meisten UVP-Verfahren. Und raten Sie, in welchem Bereich sie sind! – Windkraft. Um alternative Energie zu erzeugen, braucht es diese Projekte und diese Projekte brauchen auch eine schnellere Umsetzung.
Zum Thema Beirat: Sie haben ein bisschen die Verfahrensschritte angesprochen. Dieser Beirat bekommt kein Entgelt, das sind Experten, die aus allen Ministerien aus unterschiedlichsten Bereichen kommen. Es wird auch das Umweltministerium, das heißt, es wird immer der zuständige Minister sozusagen in die Pflicht genommen und mit eingebunden. Dann geht es an den Beirat, in dem Experten sein werden, die einen Vorschlag erteilen. Mit der nächsten Verordnung passiert nicht mehr als dass dieses Projekt einen Stempel bekommt, dass es von öffentlichem Interesse ist. – Mehr passiert nicht.
Daran geknüpft sind die Verfahrensbeschleunigungen, zum Beispiel für Windparks in Niederösterreich, zum Beispiel für Umfahrungen, zum Beispiel für ÖBB-Infrastrukturprojekte. Erst dann kommt das beschleunigte Verfahren zur Anwendung. Es kann nicht sein – ich betone das noch einmal –, dass sich unser Staat – also wir – nicht an die eigenen Gesetze hält. Das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
Es wurden auch die Themen Experten und Erstentwurf dieses Gesetzes angesprochen. Ja, dafür, dass Stellungnahmen eingebracht werden, ist eine Begutachtung gut. Es gab auch eine zusätzliche Sitzung des Wirtschaftsausschusses, es gab auch dort noch einmal Dinge, die eingebracht wurden; auch dafür, dass man sich das anschaut, ist eine Begutachtung gut.
Übrigens gibt es keinen Automatismus mehr in diesem Gesetz, er wurde durch einen Mechanismus ersetzt. Wir hatten viele Experten dabei, darunter zwei ganz besondere: Erstens war Professor Obwexer, er ist Europarechtsexperte, dabei und hat – ich habe es selbst gehört – auch sehr genau formuliert, dass das an das, was der Europäische Gerichtshof tut, angelehnt ist. Der Europäische Gerichtshof ist draufgekommen, dass er selbst Verfahrensdauern von vielen Jahren hat, und wendet denselben Mechanismus wie wir an. Der zweite war Dr. Bergthaler, er ist Professor für Umweltrecht in Linz, ein anerkannter Experte. Es war mir wichtig, auch ihn einzubinden; also nicht die Wirtschaft alleine. Das geht auf Augenhöhe. Es geht darum, raschere Entscheidungen zu bekommen und nicht jemanden zu bevorteilen oder zu benachteiligen.
Einige Dinge müssen geregelt werden. Ja, Ressourcen sind ein Thema und können ein Thema sein. Die Stellungnahmen waren aber folgende: Die Stellungnahmen beziehen sich auf Sachverständige, auf Ressourcen. Ich sage ganz klar, mit dieser Gestaltung, und zwar diesem einen Teil, dass man die Verfahren genauer und strukturierter macht, werden wir einiges einsparen.
Noch ein kurzer Hinweis zu den Kosten: Die Kosten, die angeführt sind, sind die Kosten, die für die Stelle im Ministerium angesetzt sind. Das sind vier Mitarbeiter. Ich bin es gewohnt, die Total Cost of Ownership zu betrachten, die Gesamtkosten für eine Volkswirtschaft, nämlich für Gesamtösterreich. Wenn diese Verfahren mit einer Dauer von zehn Jahren in erster Instanz auf 18 Monate verkürzt werden – mit einer guten Entscheidung am Schluss, die Ja oder Nein sein kann –, so kann mir niemand sagen, dass uns das mehr kostet als wir investieren. Es wird in der Vorphase etwas investiert, damit wir danach sehr viel einsparen können. – Herzlichen Dank. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
20.42
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Hubert Koller. Ich erteile es ihm.
Bundesrat Hubert Koller, MA (SPÖ, Steiermark): Herr Präsident! Liebe Frau Bundesministerin! Meine sehr geschätzten Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuschauer und Zuhörer! Zuerst möchte ich zu meinem steirischen Kollegen Krusche etwas sagen: Die Grünen oder Kollegin Ewa Dziedzic im Speziellen leben nicht auf dem Mars, sie warnen uns nur davor, dass wir hier auf der Erde bald marsähnliche Zustände haben werden. Das möchte ich einmal klarstellen. (Beifall bei der SPÖ sowie der BundesrätInnen Dziedzic und Stögmüller. – Bundesrätin Mühlwerth: Aber die handeln ganz anders in Wien als sie reden! Das ist eine Wiener Bundesrätin – überall interessiert sie die Bürgerinitiative - -! – Bundesrat Stögmüller: Geh doch ans Rednerpult!) – Frau Fraktionsvorsitzende, Sie dürfen selbst reden, Sie können sich zu Wort melden. (Bundesrat Pisec: In Wien zersägen die Grünen jeden Baum! Jeder Baum wird zersägt! – Bundesrat Schererbauer: Kettensägenmassaker! – Bundesrätin Mühlwerth: Ich nenne das heuchlerisch!)
Zum Zweiten möchte ich sagen, dass UVP-Verfahren nicht immer dafür ausschlaggebend sind, dass etwas nicht passiert. Beim Semmeringbasistunnel war es Ex-Landeshauptmann Pröll, der ihn viele, viele Jahre verhindert hat; das heißt, es gibt auch andere Gründe, und nicht nur das UVP-Verfahren, wie es bis jetzt durchgeführt wurde. (Zwischenrufe bei SPÖ und FPÖ.)
Unsere Fraktion, und das hat Kollege Novak bereits ausgeführt, hat natürlich Verständnis für das, was hier aufgezählt wurde und was Sie, Frau Ministerin, gesagt haben: für kürzere Verfahren, für effizientere Verfahren, für bessere Entscheidungsprozesse. Dieses Gesetz dient aber nur dazu, die Interessen der Wirtschaft zu befriedigen. Ein ÖVP-Politiker hat es in den Medien gesagt: Es ist Erntezeit!, und das trifft es, glaube ich, ganz genau. Deshalb werden wir diesem Gesetz auch nicht zustimmen, da dieses Gesetz wirklich nur der Aushebelung demokratischer Standards dient. (Beifall bei der SPÖ sowie der BundesrätInnen Dziedzic und Stögmüller.)
Meine sehr geehrten Damen und Herren, anstatt eine bessere Abstimmung der Planung der Projekte – wie wir es heute schon gehört haben – mit anderen Interessen zu stärken und die Projektwerber in den Verfahren besser zu führen und zu begleiten, anstatt einer Aufstockung der Behörden mit Expertise und Personal, also anstatt dieser sinnvollen Forderungen, geht man in Richtung Abschreckung: mit der Drohung der Verfahrensförderungspflicht mit Kostenersatz, der Beschränkung der Äußerungsfrist und der Reduzierung der Veröffentlichungsstandards.
Meine Damen und Herren, auch wenn, wie Sie gesagt haben, die Begutachtung vieles im Erstentwurf beseitigt hat, so war es schon besorgniserregend, dass man so etwas überhaupt vorlegt, obwohl so viele darin enthaltene Dinge eigentlich rechtswidrig waren. Die rechtswidrigen Dinge wurden zum Teil entfernt, aber es bleibt immerhin der bittere Beigeschmack, dass in diesem Gesetz die Verfahrensbeschleunigung mit der Einschränkung der Verfahrensrechte gleichzusetzen ist. (Beifall bei der SPÖ sowie der BundesrätInnen Dziedzic und Stögmüller.)
Alle rechtswidrigen Normen sind unserer Ansicht nach – Frau Kollegin Dziedzic hat es schon gesagt – nicht entfernt worden, sodass das Gesetz verfassungs- und EU-rechtlich anfechtbar bleibt. Mit dieser Ansicht stehen wir nicht alleine da – das wurde heute schon geäußert –: Der Bundesverwaltungsgerichtshof, der Rechnungshof, der Dachverband der Verwaltungsrichter, ja, sogar die Land- und Forstbetriebe Österreich, alle haben an diesem Gesetz Kritik geübt, haben gravierende Bedenken geäußert, auch bezüglich des hohen Verwaltungsaufwandes.
Dass vor der Entscheidung im Nationalrat noch kurzfristig ein Abänderungsantrag seitens der Regierungsparteien eingebracht wurde, der den Landes-Wirtschaftskammern durch einen Standortanwalt aus dem übertragenen Wirkungsbereich des Bundes Parteistellung bei allen UVP-Verfahren verschafft, war von dieser Regierung der Industrie fast zu erwarten. (Bundesrat Stögmüller: Schande! – Bundesrätin Mühlwerth: Ja, schämt euch in Wien! – Ruf bei der ÖVP: Genau!)
Zum Schluss möchte ich noch – es wurde ja sonst alles ausgeführt – etwas zur Verfahrensförderungspflicht mit Kostenersatz sagen: Einerseits kann ich dem ja beipflichten, dass diese Kosten für unnötige Verfahrensverzögerungen durch Einwände beziehungsweise Forderungen von diversen Gutachten, die schlussendlich keine Verfahrensrelevanz haben, in Zukunft dem Verursacher überwälzt werden sollen, andererseits soll aber dadurch nicht der Umstand eintreten, dass es durch diese Androhung zu einer Einschränkung der Verfahrensrechte kommt – auf den Punkt gebracht: dass sich Beteiligte mit Parteistellung, also auch NGOs, mit berechtigten Einwänden in Zukunft zurückhalten, da sie mögliche Kostenübertragungen fürchten. Das wäre nicht zweckdienlich für eine sachlich korrekte und gute Verfahrensführung im Sinne der Projekte. Deshalb werden wir diesem Gesetz nicht zustimmen. – Danke. (Beifall bei der SPÖ sowie der BundesrätInnen Dziedzic und Stögmüller.)
20.47
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Mag. Christian Buchmann. Ich erteile es ihm.
Bundesrat Mag. Christian Buchmann (ÖVP, Steiermark): Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzte Frau Bundesministerin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr geehrte Damen und Herren! Das heute in Diskussion stehende Standort-Entwicklungsgesetz ist aus meiner Sicht eine Maßnahme, die längst überfällig ist. Ich gratuliere der Frau Bundesministerin und ihrem Team dazu, einen Prozess gestartet zu haben, der auf der einen Seite das Regierungsprogramm umsetzt und auf der anderen Seite dazu beitragen wird, Investitionen in Österreich zu impulsieren, und zwar Investitionen der öffentlichen Hand in Infrastrukturmaßnahmen, und der für die Privatwirtschaft gleichermaßen ermöglicht, dass Verfahren zügiger und rascher abgewickelt werden.
Ich war in den vergangenen Jahren in beruflichen Funktionen, in denen ich die Chance hatte, mit sehr, sehr vielen Unternehmerinnen, Unternehmern und Firmenleitungen ins Gespräch zu kommen, mit ihnen über den Wirtschaftsstandort und auch die persönliche Situation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Betrieben und die Zukunft der Unternehmensentwicklung zu sprechen. Es war – und das können Sie mir glauben – bei diesen Gesprächen nicht in erster Linie eine Frage, was die Wirtschaftspolitik des Bundes oder eines Bundeslandes an Förderungen und Treibstoff für Investitionen zur Verfügung stellen kann. Ja, das ist manchmal im Bereich der Innovationen, im Bereich von Forschung und Entwicklung, bei Infrastrukturinvestitionen notwendig. Es war aber eben nicht die Frage des monetären Treibstoffes, die im Vordergrund gestanden ist, sondern die Frage, wie der Wirtschaftsstandort und damit die individuelle Entwicklung auch der Unternehmungen, die ja im Regelfall in einem internationalen Standortwettbewerb stehen, unterstützt werden kann. Da sind die Verfahren immer ein Thema gewesen, da ist die Bürokratie immer ein Thema gewesen, und da hat natürlich auch die Frage, wie man diese Verfahren beschleunigen kann, eine Rolle gespielt.
Meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen, ich bin wahrscheinlich der Einzige im Raum, der ein Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren selbst durchgeführt hat, und zwar im Auftrag der steiermärkischen Landesregierung. Ich kann Ihnen sagen, ich hätte mich gefreut, wenn es die Chance gegeben hätte, dieses Projekt in 36 Monaten
umzusetzen. Meine steirischen Kollegen wissen, wovon ich rede, von einem Motorsportprojekt im Aichfeld, das mittlerweile als Red-Bull-Ring bekannt ist.
Dafür haben wir, unter Aufbietung aller Kräfte, fünf Jahre gebraucht: dass ein solches Verfahren durchgeführt werden konnte, zu einem positiven Abschluss gebracht werden konnte und dass dann ein Investor – zu Beginn hätten es mehrere sein sollen, die sich alle im Laufe der Zeit verabschiedet haben, weil Sie gesagt haben, dieses Verfahren dauert zu lange – wie die Unternehmerpersönlichkeit Dietrich Mateschitz da war, der gesagt hat: In Ordnung, wir werden dieses Projekt mit Red Bull übernehmen, wir werden investieren!
Mittlerweile hat es mehrere 100 Millionen Euro Investitionen im Aichfeld, rund um den Ring und am Ringgelände gegeben. Die Motorsportveranstaltungen und alle anderen Veranstaltungen am Ringgelände sind der beste Beweis dafür, dass ein solches Projekt nicht nur der Wirtschaft, sondern insbesondere den Menschen in der Region, insbesondere den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Betrieben und auch am Ringgelände dient.
Frau Bundesministerin, deswegen mein Kompliment dafür, dass es möglich war, dieses Standort-Entwicklungsgesetz durchzusetzen und auch heute zur Beschlussfassung zu bringen. Es wird am Wirtschaftsstandort Österreich, und dazu zähle ich alle neun Bundesländer, eine gute Wirkung entfalten.
Es hat auch kritische Ausführungen dazu gegeben, die ich sehr ernst nehme. Frau Kollegin Dziedzic, Sie können mir glauben, es ist niemandem in der Wirtschaft egal, wie es um seine Umwelt bestellt ist, weil jeder in dieser Umwelt lebt – viele haben Familie, manche haben Kinder, die in dieser Umwelt leben –, und wir wollen das Beste für unsere Umwelt und damit für uns persönlich. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
Jetzt soll es ergänzend zu einer Umweltanwaltschaft auch eine Standortanwaltschaft geben, die nicht wirtschaftsfreundlich agiert – ich betone das, aus meiner Sicht nicht wirtschaftsfreundlich –, sondern wirtschaftsgerecht; das bedeutet eine Güterabwägung zu alldem, was mit Umwelt zu tun hat, aber natürlich auch zu alldem, was mit Arbeitsplätzen zu tun hat, was mit der Entwicklung eines Wirtschaftsstandorts zu tun hat. Gerade wir als Vertreter der Regionen im Hohen Haus sind sehr an einer regionalen Entwicklung interessiert, und solche Projekte finden sehr oft in den Regionen statt. Da stellt sich schon die Frage: Finden diese Investitionen tatsächlich statt oder finden sie nicht statt? In welchem Zeitrahmen können diese Investitionen stattfinden?
Darauf hat Kollege Krusche meiner Meinung nach auch sehr richtig hingewiesen: Zeit ist ein Faktor, der im Wirtschaftsleben eine große Rolle spielt, und am Beispiel des Red-Bull-Rings habe ich Ihnen ja gezeigt, dass Investoren auch weg sein und die Lust an solchen Projekten verlieren können, auch wenn sie vorher Bereitschaft gezeigt haben, investieren zu wollen. Das ist dann nicht nur eine Frage des Wirtschaftsstandorts und der Region, das ist dann auch eine Frage der Lebensqualität, denn ohne Arbeitsplätze und damit ohne Einkommen für die Menschen ist diese Lebensqualität nicht gegeben.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe das auch deshalb etwas emotionaler vorgetragen, weil ich unter anderem bei einer Gesinnungsgemeinschaft bin – bei der Österreichischen Volkspartei –, die die ökosoziale Marktwirtschaft in ihren Grundsätzen und in ihrem Parteiprogramm verankert hat. Sie können mir glauben, dass wir das schon sehr ausgewogen sehen, dass wir das Ganze sehen und dass wir das sehr vernetzt sehen.
Es hat niemand von uns Interesse daran, in einem Land zu leben, in dem die Umwelt mit Füßen getreten wird, sondern wir wollen die beste Umwelt haben. Wir wollen aber gleichzeitig auch der Wirtschaft signalisieren, dass Investitionen willkommen sind und
Standortentscheidungen willkommen sind. Wir garantieren euch, dass diese Standortentscheidungen innerhalb eines fairen und transparenten Verfahrens und innerhalb einer Zeitspanne, die wirtschaftsgerecht ist, abgewickelt werden. Ich betone das noch einmal – wirtschaftsgerecht und nicht wirtschaftsfreundlich –, weil uns allen bewusst ist, dass ein Verfahren eine gewisse Zeit braucht; und bei hochkomplexen Verfahren mit mehr als 20 Sachverständigen ist es nun einmal so, dass diese Verfahren eine gewisse Zeit brauchen.
Ich bin Frau Bundesministerin Schramböck sehr dankbar dafür, dass sie betont hat, dass es mittlerweile Strukturierungen im Verfahren gibt. Das halte ich für ganz besonders wichtig, weil ich es erlebt habe, dass auf einmal ein Sachverständiger aufgrund einer Krankheit oder aus Urlaubsgründen über Monate nicht da war und ein Verfahren dann gestanden ist. Das kann nicht unser Ziel sein. Wir müssen diese Verfahren strukturiert abwickeln, denn auch für den potenziellen Investor tickt ja dann auch – und das müssen Sie einmal betriebswirtschaftlich sehen – die Zinsuhr, weil nicht alles aus dem Eigenkapital heraus finanziert wird. Mancher Investor möchte selbst das Eigenkapital gerne verzinst haben, und deshalb spielt diese Zinsuhr auch eine wesentliche Rolle.
So gesehen können diese Verfahren rasch abgewickelt werden. Mit diesem Standort-Entwicklungsgesetz gibt es jetzt eine mehr oder weniger zeitliche Garantie. Wir werden ja dann in der Praxis sehen, wie die Gerichte das leben und wie zügig diese Entscheidungen fallen. Es gibt aber zumindest eine Garantie, dass die öffentliche Hand daran interessiert ist, dass Verfahren zügig und rasch abgewickelt werden – im Interesse des Wirtschaftsstandorts, im Interesse von Ökonomie und Ökologie, im Interesse von Arbeitsplätzen und einer positiven Weiterentwicklung der Wirtschaft in Österreich. – Danke vielmals. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
20.56
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Michael Bernard. Ich erteile es ihm.
Bundesrat Michael Bernard (FPÖ, Niederösterreich): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Bundesminister! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Bundesrates! Als freiheitlicher Bundesrat begrüße ich das neue Bundesgesetz über die Entwicklung und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Österreich natürlich. Da die Vorredner von ÖVP und FPÖ die meisten Details des neuen Standort-Entwicklungsgesetzes schon vorgebracht haben und Zeit, wie wir gehört haben, ja etwas Kostbares ist, werde ich nur nochmals ganz kurz zusammenfassen.
Der vorliegende Beschluss des Nationalrates trägt dem Umstand Rechnung, dass es bisher diverse Fristen in UVP-Verfahren gab, die jedoch einfach ignoriert wurden. Es ist nichts passiert, die Überschreitungen blieben vollkommen ohne Konsequenzen. Mit dem Standort-Entwicklungsgesetz verlangen wir nun von den Behörden schnellere Entscheidungen und schaffen viel rascher Klarheit und auch Rechtssicherheit, und zwar für beide Seiten, für die Betroffenen auf der einen Seite und auch für die andere Seite.
Ein funktionierender Wirtschaftsstandort und Umweltschutz schließen einander dabei aber nicht aus. Schnellere UVP-Verfahren sind nicht nur für den Standort, sondern auch für die Erreichung der Ziele der Klima- und Energiestrategie von wesentlicher Bedeutung. Gerade bei Vorhaben in Bezug auf die Energie- und die Mobilitätswende ist es unsere Aufgabe und ein wesentlicher Beitrag, da Schritte zu setzen. Unternehmer warten nicht auf uns; und die nachfolgenden Generationen werden kein Verständnis dafür haben, wenn wir nachher sagen: Ja, wir haben fünf oder zehn Jahre gebraucht, um eine Entscheidung zu treffen; ihr habt halt jetzt weniger Arbeitsplätze, ihr habt we-
niger Chancen am Markt, ihr seid weniger wettbewerbsfähig und auch eure Umwelt ist nicht besser geworden, weil wir nicht in der Lage waren, über Projekte, die im Dienste der erneuerbaren Energien stehen, oder über Schienenprojekte zu entscheiden.
Mit dem Standort-Entwicklungsgesetz werden ganz klare Strukturen geschaffen. Diese Strukturen werden mit einem Stufenplan ganz klar festgelegt. Die Regierungsleitlinie für nachhaltige Standortpolitik ist, Ökonomie und Ökologie im Einklang weiterzuentwickeln. Das vorliegende Standort-Entwicklungsgesetz beinhaltet genau diese Leitlinien. So können standortrelevante Vorhaben mit besonderem öffentlichen Interesse der Republik Österreich künftig mit folgenden Kriterien definiert werden: volkswirtschaftliche Aspekte, wie die Sicherung und die Schaffung von Arbeitsplätzen, maßgebliche Investitionsvolumen, relevante Tätigkeiten im Bereich der Forschung und Entwicklung, wesentliche Beiträge zur Steigerung der Netzleitungs- und Versorgungssicherheit, Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, wie zum Beispiel Bahnhofsbau, wesentliche Beiträge zur Mobilitäts- und Energiewende sowie wesentliche Beiträge zu einem wettbewerbsfähigen und nachhaltigen Wirtschaftsstandort.
Nun an die Adressen der SPÖ und der Grünen: Der Strom, wie wir es vorhin schon gesagt haben, kommt zwar aus der Steckdose, nur muss er aber vorher auch produziert und transportiert werden – Stichwort 380 kV-Leitung von Oberösterreich/Salzburg nach Kärnten.
Die Lebensmittel gibt es zwar im Supermarkt oder Gott sei Dank noch hie und da beim Nahversorger zu kaufen, aber auch diese müssen vorher produziert und anschließend auch geliefert werden. (Beifall bei FPÖ und ÖVP.)
Durch das neue Gesetz wird es in Zukunft nicht mehr möglich sein, solche Vorhaben, beispielsweise aus Altholz durch neue umweltgerechte Technologien einen Ersatzdieselkraftstoff namens Diethylether zu produzieren, jahrelang zu boykottieren. (Beifall bei FPÖ und ÖVP.)
Um eine annähernde Vollbeschäftigung in unserem schönen Heimatland zu schaffen, gilt es, nicht zu Donnerstagsdemos oder Ein-Jahr-Regierung-Demos, bei welchen sogar Rettungsautos bei ihrem Einsatz behindert werden, aufzurufen (Zwischenrufe bei der SPÖ – Bundesrat Stögmüller: ... Argumentation ...?), sondern, wie es die derzeitige Regierung verantwortungsvoll tut, die Rahmenbedingungen für die Entwicklung und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts so zu verbessern, dass es den österreichischen Unternehmen auch möglich ist, durch weitere Aufträge zusätzliche Arbeitnehmer zu beschäftigen. Ein stabiler und qualitätsvoller Wirtschaftsstandort ist ein Basisbaustein eines funktionierenden Staates. (Beifall bei der FPÖ.)
Wenig Verständnis habe ich andererseits für die Einwände der Opposition, die anscheinend aufgrund der positiven Regierungsarbeit aus Verzweiflung nur nach Haaren im Suppenteller sucht, nachdem ein Koch und ein Kellner ohne Haare am Kopf die Suppe serviert haben. (Beifall bei der FPÖ. – Zwischenrufe bei der SPÖ.)
Aufgrund der zu erwartenden positiven Auswirkung des neuen Bundesgesetzes werden wir Freiheitlichen keinen Einspruch gegen den Beschluss des Nationalrates erheben und freuen uns schon, dass das Gesetz mit 1. Jänner 2019 in Kraft tritt. (Beifall bei FPÖ und ÖVP.)
21.01
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Weitere Wortmeldungen dazu liegen nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir gelangen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 12. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das E-Government-Gesetz, das IKT-Konsolidierungsgesetz, das Signatur- und Vertrauensdienstegesetz, das Unternehmensserviceportalgesetz, das Bundesgesetzblattgesetz, das Zustellgesetz, die Bundesabgabenordnung, das Bundesfinanzgerichtsgesetz, das Meldegesetz 1991, das Passgesetz 1992 und das Personenstandsgesetz 2013 geändert werden (381 d.B. und 396 d.B. sowie 10112/BR d.B.)
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Wir gelangen nun zum 15. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatterin ist Frau Bundesrätin Marianne Hackl. Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatterin Marianne Hackl: Ich bringe den Bericht des Wirtschaftsausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 12. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das E-Government-Gesetz, das IKT-Konsolidierungsgesetz, das Signatur- und Vertrauensdienstegesetz, das Unternehmensserviceportalgesetz, das Bundesgesetzblattgesetz, das Zustellgesetz, die Bundesabgabenordnung, das Bundesfinanzgerichtsgesetz, das Meldegesetz 1991, das Passgesetz 1992 und das Personenstandsgesetz 2013 geändert werden.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher gleich zur Antragstellung.
Der Wirtschaftsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 18. Dezember 2018 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Danke für den Bericht.
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Mag. Marlene Zeidler-Beck. – Bitte, Frau Bundesrätin.
Bundesrätin Mag. Marlene Zeidler-Beck, MBA (ÖVP, Niederösterreich): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Bundesminister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuseherinnen und Zuseher! „Wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel richtig setzen.“ – Als Aristoteles das gesagt hat, hat er vermutlich noch nicht an die Digitalisierung gedacht, aber fest steht, für sie, für den technologischen Fortschritt gilt das ganz besonders. Deswegen bin ich sehr froh, dass unsere Bundesregierung das Thema Digitalisierung ganz oben auf die politische Agenda gesetzt hat und dass unsere Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort schon in ihrem ersten Jahr so viele Initiativen gesetzt hat und sozusagen ständig dabei ist, die Segel zu justieren. Vielen Dank dafür. (Beifall bei der ÖVP und bei BundesrätInnen der FPÖ.)
Bei diesem Segeljustieren ist heute ein ganz besonderer Tag, denn was es auf offener See braucht, sind Leuchttürme, das sind Punkte, an denen wir uns orientieren können, zu denen wir hinnavigieren können. Und mit all den Gesetzesänderungen, die unter diesem Tagesordnungspunkt heute beschlossen werden, legen wir das Fundament für einen solchen Leuchtturm, für das Leuchtturmprojekt oesterreich.gv.at.
Mit einer umfassenden Serviceplattform, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, kommen wir einem Wunsch der Bürger nach: dem Wunsch, Behördenwege, Amtswege zukünftig vermehrt digital absolvieren zu können. Wir schaffen unter einem einheitlichen Portal einen einheitlichen Zugang, fassen alle bestehenden Angebote zusammen und schaffen neue Angebote: vom Onlinebabypoint, der werdende Eltern schon durch die Schwangerschaft begleitet und bei dem man später dann auch die Geburtsurkunde online beantragen kann, bis zur digitalen An- und Abmeldung von Wohnsitzen, vom elektronischen Erinnerungsservice, wenn der Reisepass abläuft, bis zur Onlinebeantragung von Wahlkarten – und mit einem elektronischen Postfach, in dem man künftig noch mehr Behördendokumente einfach und digital online zugestellt bekommt.
Kurz gesagt, ich glaube, wir schaffen damit jene Serviceorientierung, die sich die Bürgerinnen und Bürger erwarten, die sie alle aus der Privatwirtschaft und aus ihrem persönlichen Umfeld kennen. Wir helfen ihnen, Zeit zu sparen, wir ermöglichen ihnen, dass sie rund um die Uhr Amtsgeschäfte erledigen können, wir ersparen ihnen mit einem One-Stop-Shop sozusagen ein Pilgern von einer Stelle zur anderen. Wir machen Behördenwege einfach und effizient – und das alles, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, als zusätzliches Angebot, als Ergänzung zu den analogen Möglichkeiten. Jeder, der Behördenwege nach wie vor persönlich erledigen möchte, kann das auch gerne tun.
Aus all diesen Gründen freue ich mich auf den neuen Leuchtturm oesterreich.gv.at und auch darauf, dass wir damit einen weiteren Schritt aus dem Regierungsprogramm dieser Bundesregierung umsetzen. In diesem Programm ist die Digitalisierung von zehn Behördenwegen eine ganz konkrete Maßnahme. Mit dem heutigen Beschluss sind es ab März 2019 jedenfalls einmal drei Behördenwege, im kommenden Jahr werden noch einige weitere folgen, und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir damit die Segel richtig gesetzt haben und in die Zukunft segeln. – Vielen Dank. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
21.07
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Danke.
Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Günther Novak. Ich erteile es ihm.
Bundesrat Günther Novak (SPÖ, Kärnten): Hohes Haus! Frau Bundesministerin! Es wurde schon sehr viel gesagt, aber als Bürgermeister, der hier steht, kennt man die Probleme, die vor Ort herrschen, und dass in diesem Bereich, im Bereich der Digitalisierung, jetzt sehr viel gemacht wird, ist einfach zu begrüßen. Dass der Bereich der Digitalisierung in Ihr Ressort, den Wirtschaftsbereich, gekommen ist und Ihnen damit auch der Wirtschaftsstandort übertragen worden ist, ist auch gut.
Wenn wir heute sehen – das ist ja schon gesagt worden –, dass Menschen, die unter Umständen aufgrund ihrer Arbeit die Zeit, in der das Amt offen ist, nicht nutzen können oder generell, weil sie nicht mobil sind, nicht die Möglichkeit haben, auf ein Amt zu kommen, über die Digitalisierung dann Tag und Nacht, rund um die Uhr Zugang dazu haben, dann kann man das alles nur gutheißen. Es wird in Zukunft noch sehr viele Dinge zu diesem Thema geben, die uns das Leben erleichtern.
Darüber hinaus kann man unter der Adresse oesterreich.gv.at nicht nur etwas eingeben, sondern man kann sich auch über viele, viele Dinge des täglichen Lebens informieren, um wieder up to date zu sein oder etwas zu hinterfragen.
Lassen Sie mich noch auf meine Vorrednerin zurückkommen: Für Eltern ist es sicherlich – wie soll ich das bezeichnen? – ein Leuchtturm für die Zukunft, dass man dann nicht mehr zur Meldestelle pilgern muss und nicht mehr nur dort, wo man ge-
boren wurde – so wie es war, als wir geboren wurden –, die Geburtsurkunde bekommt, sondern dass sie vor Ort abrufbar und ausdruckbar ist. Für die Bürgerinnen und Bürger wird es eine große Erleichterung sein, über E-Government Verwaltungsangelegenheiten vor Ort erledigen zu können.
Wichtig ist auch – zum Schluss kommend –, und das sollte man dabei schon noch bedenken, dass dies eine sinnvolle Ergänzung ist, dass es aber, wenn man die Dinge nicht so erledigen kann oder will, wie ich das jetzt gerade ausgeführt habe, trotzdem noch so ist, dass man die Behördengänge auch auf die herkömmliche, persönliche Art durchführen kann.
Wir alle, die, so wie wir, bei Gemeinden beschäftigt sind, wissen, wie oft Menschen, wenn sie ein bisschen älter sind, auch gerne deswegen zu uns kommen, um mit dem einen oder anderen sprechen zu können. Daher ist es wichtig, weiterhin die Möglichkeit zu haben, das vor Ort, in den Gemeinden oder den entsprechenden Behörden persönlich erledigen zu können. – Das ist am Land so; in der Stadt wird das wahrscheinlich nicht möglich sein.
Wir werden diesem Gesetz zustimmen. – Danke. (Beifall bei der SPÖ, bei BundesrätInnen der ÖVP sowie des Bundesrates Samt.)
21.10
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Vielen Dank.
Als Nächster ist Herr Bundesrat Christoph Längle zu Wort gemeldet. Ich erteile es ihm.
Bundesrat Christoph Längle, BA (FPÖ, Vorarlberg): Herr Vizepräsident! Geschätzte Frau Ministerin! Sehr geehrte Damen und Herren! Es steht eine Vielzahl an Gesetzen in Verhandlung. Im Wesentlichen geht es um eine Kompetenzbereinigung, eben um die Übertragung von Aufgaben an das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort.
Digitalisierung ist mittlerweile ja ein wichtiger Punkt in unserer Gesellschaft. Jeder von uns hat einen Computer, ein Handy, das geht altersmäßig hinunter bis zu den Allerjüngsten von uns. Auch schon Zehn-, Elf-, Zwölfjährige haben Handys, Smartphones und Computer.
Wir brauchen diese Geräte in unserem täglichen Leben, denn wir haben dadurch einige Vorteile – eben Schnelligkeit, Einfachheit, Hilfe für die täglichen Aufgaben sowohl im Privaten als auch im Beruf. Es ist auch möglich, schnell Informationen und Wissen abzufragen, und ich denke, das sind mittlerweile wichtige Tools für uns. Es zeigt auch, dass unsere Regierung sehr gut gearbeitet hat und dass es richtig war, ein Ministerium für Digitalisierung zu schaffen.
Das Zustellgesetz sagt aus, dass Behördenschreiben überwiegend in elektronischer Form abgefasst werden sollen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Ersparnisse bei Porto, Papier und Druckkosten. Auch die Schnelligkeit ist natürlich zu erwähnen, weiters eine gewisse Zeitersparnis, und vor allem, was den Bereich des Umweltschutzes angeht, gibt es weniger Verkehr und werden auch Toner und Papier eingespart, was auch nicht schlecht für die Umwelt ist.
Im Zusammenhang mit dem Meldegesetz, dem Passgesetz und dem Personenstandsgesetz gibt es eben eine Bürger- und Unternehmerplattform mit der Adresse oesterreich.gv.at, das wurde bereits erwähnt. Auch da gibt es einige Vorteile: Man kann dort digitale Angebote anschauen, man kann aber auch Behördengänge erledigen oder auch An- und Ummeldungen durchführen und es gibt auch ein Erinnerungsservice für Reisedokumente.
Von freiheitlicher Seite kann ich sagen, dass wir diesem Gesetz selbstverständlich gerne unsere Zustimmung erteilen werden. Und ich sage dazu: Willkommen im 21. Jahrhundert! (Beifall bei der FPÖ und bei BundesrätInnen der ÖVP.)
21.13
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Danke schön.
Als Nächste ist Frau Bundesministerin Dr. Schramböck zu Wort gemeldet. – Bitte, Frau Bundesminister.
Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Dr. Margarete Schramböck: Herr Präsident! Werte Mitglieder des Bundesrates! Liebe Zuseherinnen und Zuseher! Wir sprechen von einem Projekt, das uns vom E-Government zum Mobile-Government bringen soll.
Wir alle haben die Endgeräte immer dabei, unser Leben hat sich dadurch stark verändert, und wir wollen da einen Service anbieten, der es den Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht, einfach und zu den unterschiedlichsten Zeitpunkten, nämlich dann, wenn sie sich dafür entscheiden, darauf zuzugreifen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Wir wollen für den mobilen Teil dieses Vorhabens oesterreich.gv.at eine App schaffen, in der wirklich vieles verbunden ist, von Informationen bis zu tatsächlichen Behördenwegen. Das ist die wesentliche Innovation. Die Informationen kommen zusätzlich dazu. Sie werden dort auch eine Suchfunktion finden, die es Ihnen ermöglicht, Dinge ganz einfach zu suchen. Heute müssen Sie wissen, wo Sie suchen – beim Rechtsinformationssystem, bei help.gv.at oder bei den anderen Registern, die wir haben –, aber dann werden Sie eine sogenannte Volltextsuche machen können. Sie geben einfach „Haus erben“ oder sonst irgendetwas ein, und es werden Ihnen alle Informationen dazu angezeigt.
Ich bin eine der Wenigen, die das schon als Prototyp auf ihrem Handy haben, und ich kann Ihnen sagen, es wird gut werden, auch die verschiedenen Themen, die man dort abwickeln kann.
Vor einigen Tagen war ich mit jemandem unterwegs, es war eine Journalistin – die Reise ging nach London. Am Montag war die Abreise, und am Freitag davor hat sie gesagt: Oh Gott, ich habe vergessen, mein Pass ist abgelaufen! – Die App wird Sie in Zukunft rechtzeitig an das Ablaufen des Passes erinnern, sodass Ihnen da nichts mehr passieren kann. Und vor allem was die Kinder betrifft, haben wir eine Lösung eines Start-ups integriert. Sie können das auch abfotografieren in dem Fall – in Ihrem eigenen Fall ist das mit dem Register verbunden –, und so kann es Ihnen nicht mehr passieren, dass Sie das von den Kindern vergessen. Auch daran wird Sie das System erinnern.
Wichtig ist, dass das – anders als in Dänemark – freiwillig ist. In Dänemark hat man das vorgeschrieben und den normalen Amtsweg, dass man aufs Amt geht, wirklich abgeschafft. Das haben wir nicht vor, das werden wir nicht tun. Es hat jeder die Freiheit, die Leistung und das Angebot so zu konsumieren, wie er das selbst möchte: Einmal will man aufs Amt gehen, weil man gleichzeitig auch noch jemanden sehen und etwas anderes erledigen will, ein anderes Mal möchte man das von zu Hause aus machen.
Ein besonderes Baby von mir ist der Babypoint, wie er auch heißt. Das ist die Begleitung – das wurde schon angesprochen – der Eltern von der Feststellung der Schwangerschaft bis hin zur Namensgebung. Das heißt, es wird möglich sein, dem Kind einen Namen zu geben, das abzuschicken und dann die entsprechenden Dokumente zu bekommen.
Wir planen den ersten Schritt im März, und dazu ist die Änderung dieser elf unterschiedlichen Gesetze notwendig. Es gibt auch noch einen Plan zur Ausweitung: Mitte nächsten Jahres kommt dann die zweite Welle, und Ende des nächsten Jahres beziehungsweise am Beginn des übernächsten Jahres kommen die weiteren Services. – So werden wir uns da durcharbeiten.
Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung dabei, dieses Projekt in dem Sinne voranzutreiben, dass wir unsere Services als Staat in Richtung mehr Kundenfreundlichkeit für die Österreicherinnen und Österreicher verbessern. – Herzlichen Dank. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
21.16
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Frau Bundesminister, vielen Dank.
Weitere Wortmeldungen dazu liegen nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir gelangen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Einstimmigkeit. Der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 12. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeordnung 1994, das Bankwesengesetz, das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das Maklergesetz und das Versicherungsaufsichtsgesetz geändert werden (Versicherungsvermittlungsnovelle 2018) (371 d.B. und 397 d.B. sowie 10076/BR d.B. und 10113/BR d.B.)
Vizepräsident Dr. Magnus Brunner, LL.M.: Wir gelangen nun zum 16. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatter ist Herr Bundesrat Robert Seeber. Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatter Robert Seeber: Hohes Präsidium! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf den Bericht des Wirtschaftsausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 12. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeordnung 1994, das Bankwesengesetz, das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das Maklergesetz und das Versicherungsaufsichtsgesetz geändert werden, die Versicherungsvermittlungsnovelle 2018, zur Kenntnis bringen. (Vizepräsident Lindinger übernimmt den Vorsitz.)
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher gleich zur Antragstellung.
Der Wirtschaftsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 18.12. mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsident Ewald Lindinger: Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Eva Prischl. Ich erteile ihr dieses.
Bundesrätin Eva Prischl (SPÖ, Niederösterreich): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Ministerin! Werte Kolleginnen und Kollegen des Bundesrates! Sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher! Die Fraktion der Sozialdemokratischen Partei wird der vorliegenden Versicherungsvermittlungsnovelle nicht zustimmen. Der Gesetzestext ist uns zu unbestimmt und nicht präzise genug, die Begutachtungsfrist war zu kurz, und
es fehlen uns konkrete Inhalte, wie etwa bei der Weiterbildungsverpflichtung. Wir bemängeln vor allem, dass die Festlegung von Wohlverhaltensregeln und Informationspflichten sowie von Bestimmungen zur Vergütung über den Verordnungsweg erfolgen soll. Zentrale Punkte werden damit dem parlamentarischen Gesetzgebungsprozess entzogen.
Dass der Vertrieb über Vergleichswebsites in den Anwendungsbereich der Gewerberechtsnovelle fällt, ist grundsätzlich positiv, jedoch sollten Körperschaften öffentlichen Rechts unserer Meinung nach aus dem Regelungsbereich ausgenommen werden, da dort die Informationsausübung im Vordergrund steht und keine Gewinnerzielungsabsicht verfolgt wird.
Die Bestimmungen zur Ausübung der Tätigkeit entweder als VermittlerIn oder als AgentIn sind zu befürworten, denn die gleichzeitige MaklerInnen- und AgentInneneigenschaft erscheint in einer Person beziehungsweise Organisation unvereinbar.
Dass diese Vorlage eine Definition des Begriffs Vergütung vorsieht, ist ebenfalls grundsätzlich positiv zu bewerten. Jedoch ist die Auslagerung weiter gehender Bestimmungen zur Vergütung, also zur Provisionszahlung der selbstständigen VermittlerInnen auf eine zukünftige Verordnung, die nicht mehr einem parlamentarischen Abstimmungsprozess unterliegt, nicht optimal. Vor allem Provisionen aus Lebensversicherungen sollen auf die gesamte Laufzeit des Vertrages aufgeteilt werden. Das bringt den Konsumenten höhere Rückkaufswerte, meistens höhere Ablaufleistungen am Ende der Laufzeit, sprich höhere Nettorenditen.
Für den Bereich der Ausübung der Vermittlung als Nebentätigkeit und Nebengewerbe sind strengere Bestimmungen zur fachlichen Eignung notwendig. Die vorgeschlagenen Weiterbildungsverpflichtungen für Versicherungsvermittlungen sind vielfach unbestimmt. Es ist eine strenge Trennlinie zwischen Produkt- und Verkaufsschulungen und der angestrebten laufenden Weiterbildung erforderlich. Die Mindeststundenanzahl für Schulungslehrpläne für Gewerbetreibende oder das Personal soll laut dem Entwurf geringer ausfallen. Im Detail soll das wie funktionieren? Auch die Voraussetzungen, unter welchen Bedingungen sich die Mindeststundenanzahl um wie viel reduziert, stehen nicht in der Novelle. Wer legt nun das Ausmaß der Mindeststundenanzahl und die Größenordnung der Reduzierung fest? Ebenso unbeantwortet ist die Provisionsfrage.
Viele Fragen, aber keine entsprechenden Antworten, das ist für uns Sozialdemokraten nicht die richtige Vorgangsweise. Daher können wir dieser Novelle auch nicht zustimmen. – Danke schön. (Beifall bei der SPÖ.)
21.21
Vizepräsident Ewald Lindinger: Zu Wort gemeldet ist Herr Vizepräsident Dr. Magnus Brunner. – Bitte.
Bundesrat Dr. Magnus Brunner, LL.M. (ÖVP, Vorarlberg): Sehr geehrter Herr Präsident! Frau Bundesminister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe mitgezählt: Es waren fast mehr positive Dinge, die du angesprochen hast und wo ich das von dir Gesagte nur unterstützen kann. Ich bin also in diesem Fall sehr positiv überrascht.
Wir werden diesen Gesetzesbeschluss selbstverständlich unterstützen, weil wir mit der vorliegenden Novelle ja eigentlich eine EU-Richtlinie zum Versicherungsvertrieb umsetzen. Das wesentliche Ziel dabei ist zum einen, dass einheitliche Wettbewerbsbedingungen für alle Vertriebskanäle hergestellt werden, und zum anderen, dass es auch für den Versicherungsnehmer einen einheitlichen Schutz gibt.
Mit dem heute vorliegenden Beschluss werden die Tätigkeiten – du hast es angesprochen und auch als positiv vermerkt – des Versicherungsmaklers gewerberechtlich von den Tätigkeiten des Versicherungsagenten getrennt. Das bringt auch mehr Transpa-
renz für den Kunden, und es wird auf der anderen Seite auch Vertrauen und Qualität geschaffen, indem es eben Verpflichtungen zu Beratungen und auch regelmäßige Fortbildungen gibt. Liebe Kollegin, du hast gesagt, das ist zu unbestimmt, aber diese Fortbildungsvorschriften gibt es. Es wird auch dafür gesorgt, dass Versicherungsvermittler, auch solche, die auf Provisionsbasis arbeiten – das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt –, primär im Interesse der Kunden arbeiten und nicht honorar- und provisionsbasierte Interessen verfolgen können. Dadurch werden auch potenzielle Interessenkonflikte, die es vielleicht gibt, von vornherein ausgeschlossen.
Diese Umsetzung der Richtlinie bringt also allen etwas: eine Steigerung der Qualität, der Beratungsqualität auf der einen Seite – davon profitieren die Kunden –; zum anderen profitieren aber auch die Versicherungsvermittler, weil sie sich vom unqualifizierten und unlauteren Wettbewerber abgrenzen können. Ich glaube also, dass man dieser Novelle durchaus zustimmen kann. – Danke. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
21.24
Vizepräsident Ewald Lindinger: Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Ing. Bernhard Rösch. Ich erteile ihm dieses. (Bundesrätin Mühlwerth – in Richtung des sich zum Rednerpult begebenden Bundesrates Rösch –: Kurz! – Bundesrat Rösch: Der ist nicht mehr da! – Heiterkeit.)
Bundesrat Ing. Bernhard Rösch (FPÖ, Wien): Sehr geehrtes Präsidium! Werte Frau Minister! Ja, ich verstehe die SPÖ nicht (Bundesrat Weber: Das ist aber ganz was Neues! Du musst uns zuhören!), dass sie das nicht versteht. Hättet ihr vorher etwas gesagt, hätten wir es euch erklärt. Ihr hättet euch auch bei den Beamten darüber informieren können, die waren sehr kompetent und haben umfangreich Auskunft gegeben. Die haben nämlich genau zu diesen Punkten, die ihr nicht verstanden habt, gesagt, wo die stehen und wie man sie verstehen soll.
Und dass es sich hier um eine EU-Richtlinie handelt, die wir damit umsetzen – na no na. Ihr habt, wenn hier irgendeine EU-Richtlinie bekrittelt worden ist, immer gesagt: Na wie kann man nur! – Jetzt habt ihr hier eine EU-Richtlinie, die der Qualität dient, die Maklern und Agenturen und Kleinvermittlern und Fachvermittlern praktisch Wettbewerbsleitschienen gibt, innerhalb derer sie sich bewegen müssen, die lebenslanges Lernen vorsieht – was wir hier alle fordern, damit wir dort, wo wir hingehen und beraten werden, immer die besten Köpfe gegenübersitzen haben –, in der auch die 15 Stunden niedergeschrieben sind und dass diese 50 : 50 zwischen den Versicherungsbedingungen und dem, was auf dem Markt geboten wird, aufgeteilt sind und in der auch geregelt ist, was kann die Versicherung machen und was macht zum Beispiel dann ein externer Berater.
Das ist alles da drinnen gestanden. Ihr habt es nicht verstanden. Warum fragt ihr nicht vorher? Dann hätten wir es euch erklärt, denn es ist nämlich so wichtig, dass das jetzt auch kommt. Im Exklusivvertrieb bei den Versicherungen haben wir es ja schon umgesetzt, und da weiß ich, dass ihr ja dafür wart, nämlich genau für das Gleiche. Beim Exklusivvertrieb habt ihr damals gesagt – daran kann ich mich noch erinnern, das war vor eineinhalb Jahren –, das muss so sein; und wir haben auch gesagt, ja, das soll so sein. So, und jetzt kommen wir zu den Maklern und so weiter, ziehen da nach, und ihr sagt ganz einfach, da soll es nicht sein.
Es ist deswegen so wesentlich, weil es oft auch um Anlageprodukte, Versicherungsprodukte und andere Finanzprodukte geht, in die Kleinsparer ihr mühsam erspartes Geld investieren, und wenn dort die Leute nicht ordentlich ausgebildet sind und wenn dort nicht wirklich Konsumentenschutz in bester Form mitspielt, dann haben wir das riesige Problem, dass die Leute, die bis zur Pension gespart haben, dann oft vor dem Nichts stehen. Und wenn ihr das unterstützt, dann kann ich nur sagen, ich verstehe
euch nicht. Wenn es nur um Fundamentalopposition geht, dann verstehe ich das in diesem Punkt auch nicht.
Wir jedenfalls werden da zustimmen. (Beifall bei FPÖ und ÖVP.)
21.27
Vizepräsident Ewald Lindinger: Zu Wort gemeldet hat sich Frau Bundesministerin Dr.in Margarete Schramböck. Ich erteile ihr dieses.
Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Dr. Margarete Schramböck: Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Mitglieder des Bundesrates! Ja, es handelt sich um die Umsetzung einer Richtlinie der EU, der Versicherungsvertriebsrichtlinie. Diese wird umgesetzt, und es sollen damit zwei Dinge erreicht werden: auf der einen Seite Konsumenten zu schützen, Einzelne zu schützen, für sie Klarheit zu schaffen und mehr Qualität zu schaffen, aber auf der anderen Seite auch, Gold Plating zu vermeiden. Darum haben wir nicht noch etwas und noch etwas hinaufgepackt, wie es hier auch zusätzlich gefordert wurde. Das ist nicht unsere Vorgehensweise. Wir haben uns zum Thema Gold Plating committet, nicht noch auf europäische Verordnungen in großem Maße etwas aufzudoppeln.
Der Vorschlag, der jetzt vorliegt, hat mehrere wesentliche Inhalte, die für die Konsumenten Verbesserungen bringen. Das eine ist eine strengere Trennung der Versicherungsmakler und der Versicherungsagenten – wir haben es bereits gehört –, und diese Statusklarheit gibt natürlich auch mehr Sicherheit, wenn es um die Frage geht: Bei wem bin ich überhaupt? Bin ich bei einem Vertreter eines größeren Versicherungsunternehmens oder bei jemandem, der mich unabhängig über die unterschiedlichsten Produkte der verschiedensten Anbieter berät?
Was auch noch ganz wichtig ist, ist die regelmäßige Fortbildung. Das ist mir sehr, sehr wichtig, und so haben wir das auch entsprechend umgesetzt und auch festgelegt. Überhaupt erstmals ist auch das Thema Internetvertrieb ausdrücklich erfasst.
Zur Vermeidung von Missständen im Bereich der Versicherungsanlageprodukte gibt es in diesem Vorschlag auch erweiterte Strafsanktionen. Das grenzüberschreitende Tätigwerden wird ebenso geregelt, und Mechanismen zum Informationsaustausch werden vorgesehen.
Transparenz, Qualität, Statusklarheit, Fortbildung – das sind die wesentlichen Punkte dieses Vorschlags, und deshalb bitte ich Sie hier auch um Unterstützung. – Herzlichen Dank. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
21.29
Vizepräsident Ewald Lindinger: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Dies ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir gelangen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 13. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Wirtschaftskammergesetz 1998 geändert wird – WKG-Novelle 2018 (506/A und 470 d.B. sowie 10077/BR d.B. und 10114/BR d.B.)
Vizepräsident Ewald Lindinger: Wir gelangen nun zum 17. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatter ist Herr Bundesrat Robert Seeber. Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatter Robert Seeber: Hohes Präsidium! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf den Bericht des Wirtschaftsausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 13. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Wirtschaftskammergesetz 1998 geändert wird, die WKG-Novelle 2018, zur Kenntnis bringen.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor. Ich komme daher gleich zur Antragstellung.
Der Wirtschaftsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 18. Dezember 2018 mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsident Ewald Lindinger: Danke für den Bericht.
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Hubert Koller. Ich erteile ihm dieses.
Bundesrat Hubert Koller, MA (SPÖ, Steiermark): Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Frau Bundesministerin! Hohes Haus! Liebe Zuschauer und Zuhörer! Ja, das ist wieder ein Gesetz, dem wir als SPÖ nicht zustimmen können. (Bundesrat Rösch: Oje!) Diesmal richte ich meine Ausführungen nicht an die blaue Partei, an die FPÖ – da haben wir relativ wenig mitzuschwatzen, sowohl die FPÖ als auch die SPÖ –; es geht um die Wirtschaftskammer, die zu zwei Dritteln in schwarzer Hand ist, daher spreche ich jetzt eher in Richtung ÖVP. (Bundesrätin Mühlwerth: Bei euch ist es halt die Arbeiterkammer! Wo ist denn da der Unterschied?)
Wir haben da eben Sorge, dass die kleineren Unternehmer wieder ein bisschen zu kurz kommen und eher zu Beitragszahlern mutieren und die Großen wieder an die Macht kommen. (Bundesrätin Mühlwerth: Wie bei der Arbeiterkammer!) Das zeigt natürlich einerseits der wenig ambitionierte Wille zur wirklichen Reform des Wahlmodus für die nächsten Wirtschaftskammerwahlen 2020 und andererseits die Vorgangsweise, der wieder in letzter Minute im Nationalrat eingebrachte Abänderungsantrag der Regierungsparteien bezüglich der Machtausübung der Wirtschaftskammer als Standortanwalt für öffentlich relevante Projekte. Sie, Frau Bundesminister, haben ausgeführt, dass sehr viele Experten einbezogen waren. Da wundert es mich dann schon, dass das sozusagen erst 5 Minuten vorher eingebracht werden kann. Aus diesem Grund müssen wir das leider ablehnen.
Ja, liebe, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die Wahlbeteiligung – und ich glaube, da stimmen Sie alle zu – bei den Wirtschaftskammerwahlen erreichte, ich glaube, es war im Jahr 2015, mit 29,2 Prozent ihren Tiefststand. Bei der Wahl 2010 waren es immerhin noch 35,9 Prozent der Selbstständigen, die am Urnengang beteiligt waren. Das ist wirklich kein Ruhmesblatt und hat auch alle Beteiligten zum Nachdenken gebracht. (Bundesrätin Mühlwerth: 34 Prozent bei der Arbeiterkammerwahl ist auch nicht wirklich gut!)
Mit dieser Gesetzesänderung startet man zwar den Versuch – das muss ich ja zugeben –, für die kleineren Wahlgruppen Verbesserungen einzubringen, ein wirklicher Wurf ist aber nicht gelungen. Man hat schon ein bisschen den Verdacht, vielleicht zielt man gar nicht darauf ab, dass die kleinen Unternehmen, die Einpersonenunternehmen alle mit zur Wahl gehen und dass man das erleichtert, damit man sich dann sozusagen die Mehrheit ein bisschen besser beschaffen kann.
Im Nationalrat haben Kolleginnen und Kollegen Vorschläge eingebracht, ich möchte diese hier nicht wiederholen. Es hat einen Abänderungsantrag gegeben, den die Regierungsfraktionen aber zurückgewiesen haben.
Was lernen wir daraus? – Wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass die Wahlbeteiligung steigen muss. Das ist ein demokratischer Prozess, die Vertretungswahl; aber anscheinend tut diese geringe Wahlbeteiligung nur der Wirtschafts- und Führungselite gut. (Ruf: So wie bei der Arbeiterkammer!)
Zum Abänderungsantrag, der kurzfristig eingebracht wurde: Auf meine Frage an den Experten im Ausschuss – und da waren ja einige Kolleginnen und Kollegen vom Wirtschaftsausschuss dabei –, und zwar den zuständigen Experten aus dem Wirtschaftsressort, aus dem Bundesministerium für Wirtschaft, war dieser ein bisschen überrascht, denn ich habe gefragt, was er zum Organ Standortanwalt sagt. Wir alle mussten über die Antwort, die gekommen ist, ein bisschen lächeln. Das Ministerium oder zumindest die Mitarbeiter und Vertreter des Ministeriums waren gleich überrascht wie wir, dass so ein Antrag kommt, und der Experte konnte zu diesem Thema und zu dieser Funktion wenig bis gar nichts sagen. Wer das wohl durchgesetzt hat, diese Frage stelle ich hier in den Raum.
Es kommt aber noch ein bisschen schlimmer, was unsere Vermutungen betrifft. Allgemein ist es ja so, dass über das Vorliegen einer Standortrelevanz in Zukunft vom Wirtschaftsministerium im Einvernehmen mit dem Infrastrukturministerium innerhalb einer Frist – das haben wir heute schon bei Tagesordnungspunkt 14 gehört – von sechs Monaten auf Basis der Empfehlung eines sechsköpfigen Standortbeirats, dessen Mitglieder von sechs Ressorts nominiert werden, bestimmt wird. Die im Abänderungsantrag enthaltene Regelung kann aber auch dazu führen, dass künftig Sie, Frau Wirtschaftsministerin, über die weisungsgebundenen Standortanwälte direkt in die Verfahren der Länder als UVP-Behörden eingreifen können.
Wir wollen es ja nicht vermuten, aber das geht. Im Extremfall könnte das also dazu führen, dass das Wirtschaftsministerium einen aus Ländersicht gut begründeten Ablehnungsbescheid anfechten lassen kann, weil man dort der Meinung ist, dass dieser dem öffentlichen Interesse widerspricht. In § 19 Abs. 12 des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes heißt es dazu nämlich – ich zitiere –: „Der Standortanwalt hat in Genehmigungsverfahren Parteistellung und ist berechtigt, die Einhaltung von Vorschriften über öffentliche Interessen, die für die Verwirklichung des Vorhabens sprechen, geltend zu machen und zur Einhaltung dieser Vorschriften Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht sowie Revision an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben.“
Summa summarum kann also gesagt werden, dass dieses Gesetz wiederum Wirtschaftsinteressen vor Umweltinteressen stellt und von uns daher abzulehnen ist. – Danke. (Beifall bei der SPÖ.)
21.36
Vizepräsident Ewald Lindinger: Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Mag. Christian Buchmann. Ich erteile ihm dieses.
Bundesrat Mag. Christian Buchmann (ÖVP, Steiermark): Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzte Frau Bundesministerin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! In diesem Beschluss geht es um die Wirtschaftskammerorganisation. Sie wissen, das ist jener Organismus, der als Körperschaft öffentlichen Rechts gesetzlich zur Vertretung der Interessen seiner Mitglieder berufen ist.
Ich möchte mich im Zusammenhang mit der Wirtschaftskammerorganisation hier auch outen: Ich war in meinen jungen Jahren Mitarbeiter dieser Organisation, habe ihre Leistungsfähigkeit aus dem Inneren heraus kennengelernt. Ich habe sie als Funktionär in
meinem Heimatbundesland über mehr als ein Jahrzehnt weiterentwickeln dürfen, und ich schätze sie jetzt als Unternehmer außerordentlich, weil sie nämlich nicht nur die Interessenvertretung vornimmt, sondern mit ihren Serviceleistungen die österreichische Wirtschaft ganz entscheidend unterstützt, in den rechtlichen Beratungsleistungen genauso wie in der Außenwirtschaftsorganisation, und, was mir persönlich ein ganz besonderes Anliegen ist, weil sie auch in den Regionen durch ihre Regional- und Bezirksstellen gerade den vielen Tausenden Einpersonenunternehmungen, aber auch den kleinen und mittelständischen Unternehmungen ein wichtiger Partner bei Unternehmensentscheidungen ist, wenn es um deren Zukunft geht, wenn es um die Qualifizierung von deren Mitarbeitern geht, wenn Sie zum Beispiel an die Wirtschaftsförderungsinstitute in den Bundesländern und die Qualität der dort angebotenen Qualifizierungsleistungen denken.
In diesem Beschluss geht es um eine Novelle zu diesem Wirtschaftskammergesetz. Im Gegensatz zu meinem Vorredner schätze ich diese Novelle durchaus, weil sie auf der einen Seite gesetzliche Erfordernisse erfüllt, was notwendig ist. Sie wissen, dass wir in unserer Bundesverfassung Änderungen gehabt haben, Sie kennen die Judikatur des Verfassungsgerichtshofes, Sie wissen, dass wir aufgrund der Datenschutz-Grundverordnung Erfordernisse zu erfüllen haben – alles das wird mit dieser Novelle abgedeckt. Darüber hinaus gibt es technische Nuancen, was die Wahlrechte betrifft, es wird auch eine Schwachstelle ausgemerzt, die wir bei der Bundespräsidentenwahl 2016 schmerzhaft zu spüren bekommen haben.
So gesehen handelt es sich um eine technische Novelle und um keine Reform, wie vermeint und in den Raum gestellt worden ist, und ich glaube, es ist im Interesse des Wirtschaftsstandortes, dass die Wirtschaftskammer mit einer modernen Gesetzgebung ausgestattet wird.
Wir haben uns heute schon über die Standortqualitäten des Wirtschaftsstandorts, insbesondere über das Standort-Entwicklungsgesetz unterhalten. Da spielt der Standortanwalt eine besondere Rolle. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, lieber Kollege Koller, welche Körperschaft öffentlichen Rechts du gemeint hast, als du hier Vermutungen in den Raum gestellt hast. Ich habe das in der Wirtschaftskammerorganisation nicht erlebt, was du ihr unterstellst. Wie mir berichtet wurde, haben auch die Experten im Wirtschaftsausschuss deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die Novellen im Wahlrecht insbesondere die kleineren wahlwerbenden Gruppierungen unterstützen, was durchaus fair ist und was ich mittrage. So gesehen dürften deine Befürchtungen möglicherweise auf andere Kammern, aber nicht auf die Wirtschaftskammerorganisation zutreffen.
Betreffend Standortanwalt möchte ich schon sagen, dass ich diesen Standortanwalt für fair halte. Es gibt auf der einen Seite die Umweltanwaltschaften, die gemäß Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz ja ihre besondere Qualität haben; darüber könnten wir in einem Privatissimum lang diskutieren und ich könnte Ihnen meine persönliche Einschätzung dazu sagen, das sprengt aber den heutigen Abend. Auf der anderen Seite gibt es jetzt die vom Wirtschaftsministerium mitgetragene und aufgrund einer besonderen Aktion des Nationalrates noch eingeflossene Standortanwaltschaft. Ich halte es für fair, dass beide Seiten gehört werden. Audiatur et altera pars ist ein alter Grundsatz, der, glaube ich, der Entwicklung des Wirtschaftsstandorts guttut. Auch das ist eine Maßnahme, die aus meiner Sicht fair ist, wenn beide Seiten gehört werden. Entscheiden müssen ja dann in letzter Konsequenz entweder innerhalb der zeitlichen Frist die Behörde oder, sollten die Fristen überschritten worden sein, die Gerichte.
Also, all together: Das ist eine Novelle, die für die wahlwerbenden Gruppierungen bei der Wirtschaftskammerwahl Fairness bringt, technische Novellen, die uns rechtlich absichern. (Bundesrat Rösch: Das bräuchten wir bei der Arbeiterkammerwahl auch!) –
Ich wollte keine andere Körperschaft öffentlichen Rechts in den Raum stellen, aber wenn es hier angesprochen wird: An die habe ich gedacht. – Danke. (Beifall bei der ÖVP sowie Heiterkeit und Beifall bei der FPÖ. – Bundesrat Rösch: So etwas Undemokratisches wie die Arbeiterkammer findest du in Europa eh nimmer! – Zwischenrufe bei der SPÖ.)
21.42
Vizepräsident Ewald Lindinger: Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Peter Samt. Ich erteile ihm dieses.
Bundesrat Peter Samt (FPÖ, Steiermark): Herr Präsident! Frau Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Liebe verbliebene Zuschauer und jene, die die Debatte vielleicht noch via Livestream verfolgen! Novelle zum Wirtschaftskammergesetz: Lieber Hubert, manchmal sind wir nicht einer Meinung, aber das liegt fast in der Natur der Dinge.
Ich brauche jetzt nur mehr zusammenzufassen: Der Kern dieser Novellierung ist eine technische Novelle und hat vor allem mit den Unterstützungserklärungen zu tun. Die Zahl der notwendigen Unterstützungserklärungen pro Kandidatur war bislang zehn und wird jetzt auf sieben reduziert. Ich weiß schon, bei der Arbeiterkammer sind wir noch nicht ganz so weit, aber da bemühen wir uns; das wird schon werden. Das ist ein richtiger Schritt; auch um die Unklarheiten oder Schwierigkeiten, die es bei der Listenreihung geben kann, zu beseitigen, liegen sehr gute Lösungen vor.
Geschätzte Kollegen von der SPÖ, das dient vor allem den kleinen und mittleren Unternehmen, der Kandidatur der kleinen Fraktionen. Ich zähle mich ja bei der Wirtschaftskammer auch dazu, ich bin ja jetzt auch schon seit einiger Zeit dort tätig. Das ist ein Vorteil und das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist für jeden, der da drinnen ist, schwierig. So wie es teilweise für kleine Fraktionen in der Arbeiterkammer Unwegsamkeiten gibt, gibt es das auch in der Wirtschaftskammer, wo man als kleine Fraktion Schwierigkeiten hat, Unterstützungserklärungen zu bekommen, um kandidieren zu können. Diese Änderung ist daher eine tatsächliche Verbesserung. Betreffend die Wahlkarten, die Kuverts hat man sich an den für den Bund geltenden Lösungen, Regelungen orientiert, und, wie ich schon gesagt habe, betreffend die Reihung der strittigen Listenplätze ist auch eine Regelung vorgenommen worden.
Klar ist, dass ihr von der SPÖ aufgrund dessen, dass ihr vorhin beim Standort-Entwicklungsgesetz nicht habt mitgehen können, jetzt auch betreffend Standortanwalt nicht mitgehen könnt. Da geht es mir aber so ähnlich wie Kollegen Rösch vorhin: Das kann ich nicht verstehen, denn das ist ein Vorteil für die kleinen Unternehmen vor Ort. Nicht immer weiß man im Ministerium im weit entfernten Wien, was für Liezen zum Beispiel gerade klass wäre oder nicht, deswegen finde ich diese Lösung mit der Installierung des Standortanwalts sehr gut. Da immer nur zu vermuten, dass man da jetzt Einfluss nimmt, ist vielleicht manchmal doch zu weit gegriffen. Ich glaube, dass die Organisationen, vor allem die Landesorganisationen, sehr gut funktionieren, und deswegen kann ich auch nicht daran glauben, dass das auf diese Art missbraucht wird.
Zusammenfassend: Installierung eines Standortanwalts, Klarstellung hinsichtlich der Reihungen, Verbesserung der Rechtsstellung von körper- oder sinnesbehinderten Wählern – auch ein wesentlicher Faktor, den ich da erwähnen kann –, Präzisierung der Zusammensetzung und des Verantwortungsbereichs der Hauptwahlkommission, Reduktion der Zahl der Unterstützer von Wahlvorschlägen, Verbesserung der datenschutzrechtlichen Position betreffend die im Wirtschaftsparlament vertretenen Wählergruppen – daher unterm Strich von unserer Seite volle Zustimmung zu dieser Novellierung. (Beifall bei FPÖ und ÖVP.)
21.45
Vizepräsident Ewald Lindinger: Danke.
Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir gelangen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 13. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 1984, die Zivilprozessordnung und das Verbraucherbehörden-Kooperationsgesetz geändert werden (UWG-Novelle 2018) (375 d.B. und 398 d.B. sowie 10115/BR d.B.)
Vizepräsident Ewald Lindinger: Wir gelangen nun zum 18. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatter ist Herr Bundesrat Robert Seeber. Ich ersuche um den Bericht.
Berichterstatter Robert Seeber: Hohes Präsidium! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf den Bericht des Wirtschaftsausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 13. Dezember 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 1984, die Zivilprozessordnung und das Verbraucherbehörden-Kooperationsgesetz geändert werden, UWG-Novelle 2018, zur Kenntnis bringen.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher gleich zur Antragstellung.
Der Wirtschaftsausschuss hat nach Beratung am 18.12. mit Stimmenmehrheit den Antrag gestellt, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsident Ewald Lindinger: Ich danke für den Bericht.
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Andrea Kahofer. Ich erteile dieses.
Bundesrätin Andrea Kahofer (SPÖ, Niederösterreich): Herr Präsident! Werte Frau Minister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Warum wundert es mich gar nicht mehr? Selbst im Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Bundesrat Krusche: Ist etwas versteckt!) ist etwas versteckt. (Bundesrat Krusche: Etwas Böses!) – Herr Kollege, Sie wissen das schon, das finde ich gut. (Bundesrätin Mühlwerth: Auch da wieder ein Haar in der Suppe gefunden!)
Da geht es um den Schutz vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung, rechtswidriger Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen. Geschäftsgeheimnisse werden natürlich vom Arbeitgeber definiert, aber es ist ja auch ein berechtigtes Interesse der ArbeitnehmerInnen und vor allem der Arbeitnehmervertretungen, der Betriebsrätinnen und Betriebsräte, Zugang zu Informationen, die sie benötigen, zu bekommen. Schnell hat man aber auch da noch die Chance gesehen, die Sozialpartnerschaft auszuhöhlen. Anstatt mit klaren Regelungen, anstatt über eine ausgewogene Balance die Möglichkeit zu schaffen, den Arbeitnehmervertretern leichteren Zugang zu Informationen zu geben, hat man diesen Informationsfluss, die Informationsbeschaffung erschwert.
Die Sozialpartnerschaft auszuschalten ist auch da wieder gelungen. Die Betriebsrätinnen und Betriebsräte werden in keiner Weise eingebunden, deshalb kann die SPÖ
dem nicht zustimmen. (Beifall bei der SPÖ. – Bundesrätin Mühlwerth: Also doch ein Haar in der Suppe gefunden!)
21.49
Vizepräsident Ewald Lindinger: Zu Wort gemeldet ist Herr Vizepräsident Dr. Magnus Brunner. Ich erteile dieses.
Bundesrat Dr. Magnus Brunner, LL.M. (ÖVP, Vorarlberg): Sehr geehrter Herr Präsident! Frau Bundesminister! Wie war das vorher mit dem Haar in der Suppe von Kellnern ohne Haare? Das hat mir gut gefallen. In diese Richtung geht es jetzt natürlich auch. Ich verstehe das nicht ganz, es geht ja im Prinzip um etwas ganz anderes.
Erstens einmal handelt es sich hierbei wieder um die Umsetzung einer EU-Richtlinie, die wir beschließen, und diese Umsetzung trägt stark dazu bei, dass das Know-how unserer Unternehmer besser geschützt wird. Das ist eigentlich der Kern dieses Gesetzes, dieser Umsetzung der EU-Richtlinie, denn: Mehr Ideen und bessere Ideen bedeuten letztendlich auch mehr Innovation in Österreich. Das muss das Ziel sein, und wir sind verantwortlich dafür, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, und das tun wir heute auch mit diesem Gesetz.
Die UWG-Novelle ist ein weiterer Schritt in diese Richtung, weil dieses Gesetz durch den besseren Schutz des Know-hows dazu beiträgt, mehr Forschung und mehr Entwicklung in Österreich zuzulassen, zu kreieren. Für mehr Forschung und Entwicklung brauchen wir mutige Unternehmerinnen und Unternehmer, die innovative Ideen haben und dadurch auch mithelfen, den Wirtschaftsstandort Österreich weiter an der Spitze zu halten.
Um welche vertraulichen Informationen geht es da? – Diese vertraulichen, schützenswerten Geschäftsinformationen umfassen Daten, die ein Risiko für ein Unternehmen darstellen. Dazu gehören zum Beispiel Handelsgeheimnisse, Akquisitionspläne, finanzielle Daten, insgesamt also einfach das Know-how eines Unternehmens. Durch die ständig zunehmende Zahl geschäftlich relevanter Daten wird es immer wichtiger, diese Informationen vor unberechtigten Zugriffen schützen zu können.
Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, machen wir mit dieser Novelle. Wir schützen das Know-how unserer Unternehmen, unserer Unternehmerinnen und Unternehmer, und stärken dadurch auch den Wirtschaftsstandort Österreich. (Beifall und Bravorufe bei ÖVP und FPÖ.)
21.51
Vizepräsident Ewald Lindinger: Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Josef Ofner. Ich erteile dieses.
Bundesrat Josef Ofner (FPÖ, Kärnten): Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzte Frau Bundesministerin! Wie es mein Vorredner richtig gesagt hat: Es geht um einen wesentlichen Vorteil für unsere Unternehmen, und, liebe SPÖ, ein Unternehmen besteht aus Arbeitgeber und Arbeitnehmer, und nur gemeinsam und im Zusammenspiel können sie ein starkes Unternehmen bilden. Daher ist es natürlich auch wichtig, dass es so einen Schutz gibt, denn dies hängt in entsprechender Form auch mit den Arbeitsplätzen der Arbeitnehmer zusammen.
Eines muss man in dieser Hinsicht auch einmal wahrnehmen: Wenn es darum geht, Investitionen für Forschung und Entwicklung in den Unternehmen einzusetzen, dann ist damit auch die Erreichung eines Wettbewerbsvorteils für das gesamte Unternehmen verbunden, was in weiterer Folge wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit und den Markterfolg ist. Wenn man sich diese Dinge anschaut, kann ich es ja wirklich nicht nach-
vollziehen, welchen Zugang Sie zur Wirtschaft haben – das habe ich schon voriges Mal gesagt –, weil Sie einfach gegen alles, was für die Wirtschaft etwas Gutes bedeutet, sind.
Eines ist auch wichtig, nämlich, dass in Bezug auf das Know-how – ich glaube, darauf sollte man noch zusätzlich neben den rechtlichen Rahmenbedingungen abzielen – im täglichen Umgang in den Betrieben von Mitarbeitern, aber auch von den Unternehmern selbst eine interne Gefahr ausgeht, weil man aufgrund der Gewohnheit einen lockeren Umgang mit diesem Know-how hat, wodurch von innen oft etwas nach außen dringt. Man läuft aber natürlich auch Gefahr, kriminellen, externen Angriffen ausgesetzt zu sein, was da und dort oft unterschätzt wird. Ich glaube, dass auch in den Firmen interne Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung zusätzlich vonnöten sind.
Alles in allem ist damit eine Stärkung der Attraktivität Österreichs verbunden und, wie gesagt, vor allem die Sicherung von Arbeitsplätzen für die Arbeitnehmer, und selbstverständlich werden wir diesem Gesetz unsere Zustimmung geben. (Beifall bei FPÖ und ÖVP.)
21.54
Vizepräsident Ewald Lindinger: Zu Wort gemeldet ist Frau Bundesministerin Dr.in Margarete Schramböck. Ich erteile dieses.
Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Dr. Margarete Schramböck: Herr Präsident! Hohes Haus! Ja, wir setzen wiederum eine EU-Richtlinie um. In den Gesprächen in der Europäischen Union während des EU-Ratsvorsitzes habe ich mich darüber unterhalten, und siehe da, sozialdemokratisch geführte Länder stimmen dem ohne Probleme zu. Das sehe ich als ein ganz wesentliches Beispiel. Es sind vor allem die nordischen Staaten, die diese Richtlinie mitentwickelt haben. Wir haben sie damals einstimmig beschlossen und setzen sie auch entsprechend um.
Sie dient der effektiveren Bekämpfung von Industriespionage und der Handhabung von Geheimnisverrat. Sie dient dazu, ein reibungsloses Funktionieren von Forschung und Innovation im Binnenmarkt zu garantieren und damit sehr, sehr viele Arbeitsplätze abzusichern. Insbesondere im Wettbewerb mit Asien, der immer wieder genannt wird, widmen wir diesem Thema der Sicherung des Wissens, des Know-hows, der Patente, der Themen, die ein Unternehmen von anderen unterscheiden und uns wettbewerbsfähiger machen als andere, unsere Aufmerksamkeit. Darum ist es unsere Aufgabe, diese Entscheidung voranzutreiben. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung. Es ist unsere Aufgabe, Arbeitsplätze in Österreich zu sichern. Wenn dies andere auch nicht tun wollen, als Regierung ist das unsere Aufgabe. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.)
21.55
Vizepräsident Ewald Lindinger: Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir gelangen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen.
Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Die Tagesordnung ist erschöpft.
Vizepräsident Ewald Lindinger: Wir gelangen zur Abstimmung über den Antrag der Bundesräte Stögmüller, Kolleginnen und Kollegen, gemäß § 45 Abs. 3 der Geschäfts-
ordnung dem Gesundheitsausschuss zur Berichterstattung über den Gesetzesantrag betreffend „ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über Ausbildung, Tätigkeit und Beruf der Sanitäter (Sanitätergesetz – SanG)“ geändert wird, eine Frist bis 14. Februar 2019 zu setzen.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Fristsetzungsantrag zustimmen, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenminderheit. Der Antrag ist somit abgelehnt.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Antrag der Bundesräte Stögmüller, Kolleginnen und Kollegen, gemäß § 45 Abs. 3 der Geschäftsordnung dem Unterrichtsausschuss zur Berichterstattung über den Entschließungsantrag betreffend „Erhalt von Integrationsklassen an Sonderschulen“ eine Frist bis 14. Februar 2019 zu setzen.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Fristsetzungsantrag zustimmen, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenminderheit. Der Antrag ist somit abgelehnt.
Vizepräsident Ewald Lindinger: Ich gebe noch bekannt, dass seit der letzten beziehungsweise in der heutigen Sitzung insgesamt drei Anfragen, 3602/J-BR/2018 bis 3604/J-BR/2018, eingebracht wurden.
*****
Die Einberufung der nächsten Sitzung des Bundesrates ist bereits auf schriftlichem Wege erfolgt. Als Sitzungstermin ist morgen, Donnerstag, der 20. Dezember, 9 Uhr, in Aussicht genommen.
Für die Tagesordnung dieser Sitzung kommen insbesondere jene Beschlüsse in Betracht, die der Nationalrat am 22. November beziehungsweise am 12. und 13. Dezember verabschiedet hat, soweit diese dem Einspruchsrecht beziehungsweise dem Zustimmungsrecht des Bundesrates unterliegen.
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, aufgrund der Erkrankung unserer Präsidentin wird das sogenannte Open House in ihrem Büro morgen am Nachmittag abgesagt, da bei Fehlen eines von uns beiden Vizepräsidenten nicht immer einer im Präsidentenbüro und einer hier im Plenum anwesend sein und den Vorsitz führen kann. Ich ersuche um Verständnis dafür. Wir werden das vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt mit dem neuen Präsidenten nachholen können.
Ich wünsche noch einen schönen Abend!
Diese Sitzung ist geschlossen.
Schluss der Sitzung: 21.59 Uhr
|
Impressum: Parlamentsdirektion 1017 Wien Titelbild: ©Parlamentsdirektion/Johannes Zinner |