
Stenographisches Protokoll

32. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich
XXIV. Gesetzgebungsperiode
Freitag, 10. Juli 2009

Stenographisches Protokoll

32. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich
XXIV. Gesetzgebungsperiode
Freitag, 10. Juli 2009
32. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich
XXIV. Gesetzgebungsperiode Freitag, 10. Juli 2009
Dauer der Sitzung
Freitag, 10. Juli 2009: 9.07 – 21.54 Uhr
*****
Tagesordnung
1. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Wehrgesetz 2001, das Heeresdisziplinargesetz 2002, das Heeresgebührengesetz 2001, das Auslandseinsatzgesetz 2001, das Militärbefugnisgesetz, das Sperrgebietsgesetz 2002, das Munitionslagergesetz 2003, das Militärauszeichnungsgesetz 2002 und das Truppenaufenthaltsgesetz geändert werden (Wehrrechtsänderungsgesetz 2009 – WRÄG 2009)
2. Punkt: Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über den vorübergehenden Aufenthalt von Angehörigen des österreichischen Bundesheeres und Angehörigen der deutschen Bundeswehr auf dem Gebiet des jeweils anderen Staats (österreichisch-deutsches Streitkräfteaufenthaltsabkommen)
3. Punkt: Bericht über den Bericht der Bundesregierung über die Lage von Menschen mit Behinderungen 2008
4. Punkt: Bericht über den Antrag 450/A der Abgeordneten Ing. Norbert Hofer, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz vom 11. Dezember 1969 über die Einstellung und Beschäftigung Behinderter (Behinderteneinstellungsgesetz – BEinstG), BGBl. Nr. 22/1970, geändert wird
5. Punkt: Bericht über den Antrag 396/A(E) der Abgeordneten Sigisbert Dolinschek, Kolleginnen und Kollegen betreffend finanzielle Unterstützung von Menschen mit Behinderungen aufgrund von Diskriminierung
6. Punkt: Bericht über den Antrag 687/A der Abgeordneten Fritz Grillitsch, Mag. Kurt Gaßner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Marktordnungsgesetz 2007, das Marktordnungs-Überleitungsgesetz, das Pflanzenschutzmittelgesetz 1997, das Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz, das Pflanzgutgesetz 1997, das Pflanzenschutzgesetz 1995 und das Forstliche Vermehrungsgutgesetz 2002 geändert werden (Agrarrechtsänderungsgesetz 2009)
7. Punkt: Bericht über den Antrag 581/A(E) der Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber, Kolleginnen und Kollegen betreffend Maßnahmen gegen die ruinösen Folgen der EU-Milchmarktpolitik
8. Punkt: Bericht über den Antrag 72/A(E) der Abgeordneten Gerhard Huber, Kolleginnen und Kollegen betreffend Absicherung einer wirtschaftlich gesunden Milchwirtschaft
9. Punkt: Bericht über den Antrag 583/A(E) der Abgeordneten Ing. Norbert Hofer, Kolleginnen und Kollegen betreffend Erhaltung der heimischen kleinbäuerlichen Struktur und der Diversität von Arten und Ökosystemen
10. Punkt: Bundesgesetz zur Reduktion der Emissionen fluorierter Treibhausgase (Fluorierte Treibhausgase-Gesetz 2009)
11. Punkt: Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz zur Durchführung der REACH-Verordnung erlassen und das Chemikaliengesetz 1996 geändert wird
12. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Emissionszertifikategesetz und das Bundesgesetz über den zwischenstaatlichen Luftverkehr 2008 geändert werden
13. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über den Betrieb von Dampfkesseln und Wärmekraftmaschinen (Dampfkesselbetriebsgesetz – DKBG) geändert wird
14. Punkt: Bericht über den Antrag 686/A der Abgeordneten Dr. Martin Bartenstein, Wolfgang Katzian, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Ökostromgesetz geändert wird (Absetzung dieses Tagesordnungspunktes siehe S. 46)
15. Punkt: Sammelbericht über die Petitionen Nr. 1 bis 4, 6 bis 13 und 19 sowie über die Bürgerinitiativen Nr. 1 bis 4
16. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Führerscheingesetz (13. FSG-Novelle) und die Straßenverkehrsordnung 1960 geändert werden, sowie
Bundesgesetz, mit dem das Führerscheingesetz geändert wird (12. FSG-Novelle)
17. Punkt: Bericht über den Antrag 14/A der Abgeordneten Dr. Gabriela Moser, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Führerscheingesetz geändert wird
18. Punkt: Bericht über den Antrag 319/A der Abgeordneten Harald Vilimsky, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz vom 6. Juli 1960, mit dem Vorschriften über die Straßenpolizei erlassen werden (Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO. 1960), BGBl. Nr. 159/1960, geändert wird
19. Punkt: Bericht über den Antrag 330/A der Abgeordneten Harald Vilimsky, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz vom 6. Juli 1960, mit dem Vorschriften über die Straßenpolizei erlassen werden (Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO. 1960), BGBl. Nr. 159/1960, geändert wird
20. Punkt: Bericht über den Antrag 564/A(E) der Abgeordneten Sigisbert Dolinschek, Kolleginnen und Kollegen betreffend systematische Evaluierung der Verkehrssicherheitsmaßnahmen
21. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Kraftfahrgesetz 1967 geändert wird (31. KFG-Novelle), sowie
Bundesgesetz, mit dem das Kraftfahrgesetz 1967 geändert wird (30. KFG-Novelle)
22. Punkt: Bericht über den Antrag 134/A(E) der Abgeordneten Dr. Gabriela Moser, Kolleginnen und Kollegen betreffend Entwertung/Vernichtung des Typenscheins bei Pkw-Totalhavarien
23. Punkt: Bericht über den Antrag 527/A(E) der Abgeordneten Anton Heinzl, Dr. Ferdinand Maier, Kolleginnen und Kollegen betreffend Einsatz gegen die Zulassung von „Gigalinern“ auf europäischer Ebene
24. Punkt: Bericht über den Antrag 547/A(E) der Abgeordneten Dr. Gabriela Moser, Kolleginnen und Kollegen betreffend Nein zum Gigaliner (25-Meter-Monster-Lkw mit bis zu 60 Tonnen)
25. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Bundesbahngesetz, das Privatbahngesetz 2004 und das Eisenbahngesetz 1957 geändert werden
26. Punkt: Bericht betreffend den Bericht des Rechnungshofes, Reihe Bund 2009/1; Band 5 – WIEDERVORLAGE
27. Punkt: Bericht betreffend den Bericht des Rechnungshofes, Reihe Bund 2008/12
28. Punkt: Ersuchen des Landesgerichtes für Strafsachen Wien (GZ 111 Hv 52/09v) um Zustimmung zur behördlichen Verfolgung der Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Eva Glawischnig-Piesczek
29. Punkt: Ersuchen des Landesgerichtes für Strafsachen Wien (GZ 095 Hv 20/09w) um Zustimmung zur behördlichen Verfolgung des Abgeordneten zum Nationalrat Karl Öllinger
30. Punkt: Erste Lesung: Antrag der Abgeordneten Josef Bucher, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), BGBl. Nr. 1/1930 idgF, geändert wird (657/A)
*****
Inhalt
Nationalrat
Mandatsverzicht der Abgeordneten Mag. Ulrike Lunacek ......................................... 22
Angelobung der Abgeordneten Mag. Helene Jarmer ................................................. 22
Beschluss auf Beendigung der ordentlichen Tagung 2008/2009 der XXIV. Gesetzgebungsperiode des Nationalrates mit Ablauf des 13. Juli 2009 ................................................................... 297
Schlussansprache der Präsidentin Mag. Barbara Prammer ................................ 299
Personalien
Verhinderungen .............................................................................................................. 22
Ordnungsruf ................................................................................................................... 96
Geschäftsbehandlung
Antrag der Abgeordneten Dr. Josef Cap und Karlheinz Kopf gemäß § 49 Abs. 5 der Geschäftsordnung, Punkt 14 von der Tagesordnung abzusetzen – Annahme ...................................... 45, 46
Wortmeldung des Abgeordneten Mag. Werner Kogler betreffend Absetzung von Verhandlungspunkten von der Tagesordnung im Allgemeinen ................................................................................ 45
Antrag der Abgeordneten Josef Bucher, Kolleginnen und Kollegen, dem Finanzausschuss zur Berichterstattung über den Antrag 1/A der Abgeordneten Josef Bucher, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), BGBl. Nr. 1/1930, geändert
wird, gemäß § 43 Abs. 1 der Geschäftsordnung eine Frist bis 25. August 2009 zu setzen 46
Verlangen gemäß § 43 Abs. 3 der Geschäftsordnung auf Durchführung einer kurzen Debatte im Sinne des § 57a Abs. 1 GOG .......................................................................................................... 46
Redner:
Josef Bucher ........................................................................................................... ... 164
Mag. Christine Lapp ............................................................................................... ... 167
Hermann Gahr ........................................................................................................ ... 168
Mag. Dr. Manfred Haimbuchner ........................................................................... ... 170
Herbert Scheibner .................................................................................................. ... 171
Mag. Werner Kogler ............................................................................................... ... 173
Ablehnung des Fristsetzungsantrages ........................................................................ 175
Wortmeldungen zur Geschäftsbehandlung betreffend mögliche Abhör- und Beeinflussungsmaßnahmen im Bereich des Parlaments:
Heinz-Christian Strache ......................................................................................... ..... 46
Dr. Peter Pilz ............................................................................................................ ..... 47
Ing. Peter Westenthaler .......................................................................................... ..... 47
Karlheinz Kopf ........................................................................................................ ..... 48
Dr. Josef Cap ........................................................................................................... ..... 49
Antrag des Abgeordneten Herbert Scheibner, den Verfassungsausschuss gemäß § 46 Abs. 4 der Geschäftsordnung zu beauftragen, seine Arbeiten während der tagungsfreien Zeit fortzusetzen – Annahme 49, 298
Wortmeldungen in diesem Zusammenhang:
Herbert Kickl .......................................................................................................... 50, 52
Dr. Josef Cap ......................................................................................................... 50, 53
Karlheinz Kopf ....................................................................................................... 50, 51
Mag. Werner Kogler .............................................................................................. 51, 54
Herbert Scheibner ........................................................................................................ 52
Redezeitbeschränkung nach Beratung in der Präsidialkonferenz gemäß § 57 Abs. 3 Z. 2 der Geschäftsordnung .......................................................................................................... 55
Mitteilung der Präsidentin Mag. Barbara Prammer betreffend die Ergebnisse der außerhalb dieser Sitzung stattgefundenen Präsidialkonferenz ............................................................................. 175
Antrag der Abgeordneten Heinz-Christian Strache, Kolleginnen und Kollegen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur näheren Untersuchung der politischen und rechtlichen Verantwortung im Zusammenhang mit dem Ausspionieren von Abgeordneten und deren Mitarbeitern oder politischen Funktionären durch Angehörige des Bundesministeriums für Inneres, des Bundesministeriums für Justiz und des Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport gemäß § 33 Abs. 1 der Geschäftsordnung – Ablehnung ............................................................................................................ 275, 297
Bekanntgabe ................................................................................................................. 263
Verlangen gemäß § 33 Abs. 2 der Geschäftsordnung auf Durchführung einer kurzen Debatte im Sinne des § 57a Abs. 1 GOG ........................................................................................................ 263
Antrag der Abgeordneten Dr. Josef Cap, Karlheinz Kopf, Josef Bucher, Dr. Peter Pilz, Kolleginnen und Kollegen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Untersuchung von Abhör- und Beeinflussungsmaßnahmen
im Bereich des Parlaments gemäß § 33 Abs. 1 der Geschäftsordnung – Annahme .................................................................................................................. 275, 297
Bekanntgabe ................................................................................................................. 263
Verlangen gemäß § 33 Abs. 2 der Geschäftsordnung auf Durchführung einer kurzen Debatte im Sinne des § 57a Abs. 1 GOG ........................................................................................................ 263
gemeinsame Debatte:
Heinz-Christian Strache ......................................................................................... ... 286
Dr. Josef Cap ........................................................................................................... ... 289
Karlheinz Kopf ........................................................................................................ ... 290
Harald Vilimsky ....................................................................................................... ... 291
Mag. Ewald Stadler ................................................................................................. ... 293
Dr. Peter Pilz ............................................................................................................ ... 295
Wortmeldung des Abgeordneten Heinz-Christian Strache im Zusammenhang mit einer Mitarbeiterin des freiheitlichen Parlamentsklubs ..................................................................................... 296
Antrag der Abgeordneten Dr. Josef Cap, Karlheinz Kopf, Mag. Harald Stefan, Josef Bucher, Mag. Daniela Musiol, Kolleginnen und Kollegen, den Verfassungsausschuss hinsichtlich der Verhandlungsgegenstände:
1.) Antrag der Abgeordneten Dr. Peter Wittmann, Mag. Wilhelm Molterer, Dr. Walter Rosenkranz, Herbert Scheibner, Mag. Daniela Musiol, Kolleginnen und Kollegen betreffend Unterausschuss des Verfassungsausschusses „Verwaltungsreform“ (700/A)(E),
2.) Antrag der Abgeordneten Mag. Dr. Manfred Haimbuchner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz geändert wird (286/A),
3.) Antrag der Abgeordneten Josef Bucher, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz und das Rechnungshofgesetz geändert werden (460/A),
4.) Antrag der Abgeordneten Josef Bucher, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz und das Rechnungshofgesetz geändert werden (461/A),
5.) Antrag der Abgeordneten Mag. Daniela Musiol, Kolleginnen und Kollegen betreffend Erweiterung der Zuständigkeiten des Rechnungshofes (599/A)(E),
6.) Antrag der Abgeordneten Mag. Daniela Musiol, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz geändert wird (677/A),
gemäß § 46 Abs. 4 der Geschäftsordnung zu beauftragen, seine Arbeiten während der tagungsfreien Zeit fortzusetzen – Annahme ..................................................................................... 297, 298
Antrag der Abgeordneten Karlheinz Kopf, Dr. Josef Cap, Heinz-Christian Strache, Josef Bucher, Mag. Werner Kogler, Kolleginnen und Kollegen, den Finanzausschuss gemäß § 46 Abs. 4 der Ge
schäftsordnung zu beauftragen, seine Arbeiten während der tagungsfreien Zeit fortzusetzen – Annahme 298, 298
Antrag der Abgeordneten Karlheinz Kopf, Dr. Josef Cap, Kolleginnen und Kollegen, den Untersuchungsausschuss zur Untersuchung von Abhör- und Beeinflussungsmaßnahmen im Bereich des Parlaments gemäß § 46 Abs. 4 der Geschäftsordnung zu beauftragen, seine Arbeiten während der tagungsfreien Zeit fortzusetzen – Annahme ....................................................... 298, 298
Verlesung der vorgesehenen Fassung eines Teiles des Amtlichen Protokolls dieser Sitzung durch Präsidentin Mag. Barbara Prammer ........................................................................ 298
Genehmigung des verlesenen Teiles des Amtlichen Protokolls ............................... 299
Fragestunde (5.)
Gesundheit ................................................................................................................... 22
Dr. Sabine Oberhauser, MAS (26/M); Oswald Klikovits, Josef Jury, Karl Öllinger, Dr. Andreas Karlsböck
Dr. Erwin Rasinger (32/M); Martina Schenk, Dr. Kurt Grünewald, Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein, Erwin Spindelberger
Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein (29/M); Dietmar Keck, August Wöginger, Ursula Haubner, Dr. Kurt Grünewald
Dr. Wolfgang Spadiut (35/M); Dr. Kurt Grünewald, Ing. Norbert Hofer, Wilhelm Haberzettl, Mag. Dr. Beatrix Karl
Dr. Kurt Grünewald (34/M); Dr. Andreas Karlsböck, Johann Hechtl, Anna Höllerer, Maximilian Linder
Mag. Johann Maier (27/M); Franz Eßl, Gerhard Huber, Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber, Wolfgang Zanger
Karl Donabauer (33/M); Ernest Windholz, Karl Öllinger, Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein, Ing. Erwin Kaipel
Bundesregierung
Vertretungsschreiben ..................................................................................................... 22
Ausschüsse
Zuweisungen ......................................................................................................... 43, 274
Verhandlungen
Gemeinsame Beratung über
1. Punkt: Bericht des Landesverteidigungsausschusses über die Regierungsvorlage (161 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Wehrgesetz 2001, das Heeresdisziplinargesetz 2002, das Heeresgebührengesetz 2001, das Auslandseinsatzgesetz 2001, das Militärbefugnisgesetz, das Sperrgebietsgesetz 2002, das Munitionslagergesetz 2003, das Militärauszeichnungsgesetz 2002 und das Truppenaufenthaltsgesetz geändert werden (Wehrrechtsänderungsgesetz 2009 – WRÄG 2009) (239 d.B.) ............................................................................................................................... 55
2. Punkt: Bericht des Landesverteidigungsausschusses über die Regierungsvorlage (76 d.B.): Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über den vorübergehenden Aufenthalt von Angehörigen des österreichischen Bundesheeres und Angehörigen der deutschen Bundeswehr auf dem Gebiet des jeweils anderen Staats (österreichisch-deutsches Streitkräfteaufenthaltsabkommen) (255 d.B.) ................................................................ 56
Redner/Rednerinnen:
Kurt List ................................................................................................................... ..... 56
Stefan Prähauser .................................................................................................... ..... 58
Dr. Peter Pilz .......................................................................................................... 59, 69
Ing. Norbert Kapeller .............................................................................................. ..... 61
Heinz-Christian Strache ......................................................................................... ..... 63
Bundesminister Mag. Norbert Darabos .................................................................... 65
Herbert Scheibner .................................................................................................. ..... 67
Gerhard Köfer ......................................................................................................... ..... 68
Mag. Peter Michael Ikrath ...................................................................................... ..... 70
Dr. Peter Fichtenbauer ........................................................................................... ..... 70
Entschließungsantrag der Abgeordneten Mario Kunasek, Kolleginnen und Kollegen betreffend Belohnungen für Ausbilder in der Rekrutenausbildung – Ablehnung ...................... 72, 73
Annahme des Gesetzentwurfes in 239 d.B. .................................................................. 73
Genehmigung des Staatsvertrages in 255 d.B. ............................................................. 73
Gemeinsame Beratung über
3. Punkt: Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Bericht der Bundesregierung über die Lage von Menschen mit Behinderungen 2008 (III-23/241 d.B.) ..................................... 74
4. Punkt: Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 450/A der Abgeordneten Ing. Norbert Hofer, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz vom 11. Dezember 1969 über die Einstellung und Beschäftigung Behinderter (Behinderteneinstellungsgesetz – BEinstG), BGBl. Nr. 22/1970, geändert wird (253 d.B.) ................................................. 74
5. Punkt: Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 396/A(E) der Abgeordneten Sigisbert Dolinschek, Kolleginnen und Kollegen betreffend finanzielle Unterstützung von Menschen mit Behinderungen aufgrund von Diskriminierung (254 d.B.) .............................................. 74
Redner/Rednerinnen:
Ing. Norbert Hofer ................................................................................................... ..... 74
Ulrike Königsberger-Ludwig ................................................................................. ..... 80
Sigisbert Dolinschek .............................................................................................. ..... 81
August Wöginger ......................................................................................................... 83
Mag. Helene Jarmer ..................................................................................................... 84
Bundesminister Rudolf Hundstorfer .................................................................. 86, 97
Sonja Ablinger ........................................................................................................ ..... 88
Werner Neubauer .................................................................................................... ..... 89
Anna Höllerer .......................................................................................................... ..... 90
Dr. Martin Strutz ..................................................................................................... ..... 91
Johann Hechtl ......................................................................................................... ..... 92
Karl Öllinger ............................................................................................................ ..... 93
Staatssekretärin Christine Marek ............................................................................... 94
Jochen Pack ............................................................................................................ ..... 95
Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein .................................................................... ..... 96
Mag. Christine Lapp (tatsächliche Berichtigung) ........................................................ 97
Entschließungsantrag der Abgeordneten Ing. Norbert Hofer, Kolleginnen und Kollegen betreffend Gebärdensprachkurse für Eltern gehörloser Kinder – Ablehnung .......................... 77, 97
Entschließungsantrag der Abgeordneten Ing. Norbert Hofer, Kolleginnen und Kollegen betreffend progressive Ausgleichstaxe – Ablehnung ............................................................... 77, 98
Entschließungsantrag der Abgeordneten Ing. Norbert Hofer, Kolleginnen und Kollegen betreffend Inflationsanpassung des Pflegegeldes – Ablehnung ............................................... 79, 98
Kenntnisnahme des Berichtes III-23 d.B. ....................................................................... 97
Kenntnisnahme der beiden Ausschussberichte 253 und 254 d.B. ................................ 98
Gemeinsame Beratung über
6. Punkt: Bericht des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft über den Antrag 687/A der Abgeordneten Fritz Grillitsch, Mag. Kurt Gaßner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Marktordnungsgesetz 2007, das Marktordnungs-Überleitungsgesetz, das Pflanzenschutzmittelgesetz 1997, das Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz, das Pflanzgutgesetz 1997, das Pflanzenschutzgesetz 1995 und das Forstliche Vermehrungsgutgesetz 2002 geändert werden (Agrarrechtsänderungsgesetz 2009) (293 d.B.) ............................................................ 98
7. Punkt: Bericht des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft über den Antrag 581/A(E) der Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber, Kolleginnen und Kollegen betreffend Maßnahmen gegen die ruinösen Folgen der EU-Milchmarktpolitik (294 d.B.) .................................................................... 98
8. Punkt: Bericht des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft über den Antrag 72/A(E) der Abgeordneten Gerhard Huber, Kolleginnen und Kollegen betreffend Absicherung einer wirtschaftlich gesunden Milchwirtschaft (295 d.B.) ............................................................................................... 98
9. Punkt: Bericht des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft über den Antrag 583/A(E) der Abgeordneten Ing. Norbert Hofer, Kolleginnen und Kollegen betreffend Erhaltung der heimischen kleinbäuerlichen Struktur und der Diversität von Arten und Ökosystemen (296 d.B.) ........................................... 98
Berichterstatter: Jakob Auer ......................................................................................... 99
Redner/Rednerinnen:
Rupert Doppler ....................................................................................................... ... 128
Fritz Grillitsch .......................................................................................................... ... 128
Gerhard Huber ........................................................................................................ ... 129
Walter Schopf .......................................................................................................... ... 130
Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber .................................................................. 131, 150
Bundesminister Dipl.-Ing. Nikolaus Berlakovich ................................................... 135
Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber (tatsächliche Berichtigung) ............................... 137
Hermann Gahr ........................................................................................................ ... 138
Harald Jannach ....................................................................................................... ... 138
Gabriele Binder-Maier ............................................................................................ ... 140
Dr. Wolfgang Spadiut ............................................................................................. ... 141
Franz Eßl .................................................................................................................. ... 143
Maximilian Linder ................................................................................................... ... 144
Rosemarie Schönpass ........................................................................................... ... 144
Peter Mayer ............................................................................................................. ... 145
Josef Muchitsch ......................................................................................................... 146
Mag. Kurt Gaßner ....................................................................................................... 147
Jakob Auer .............................................................................................................. ... 148
Entschließungsantrag der Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber, Kolleginnen und Kollegen betreffend Verlängerung der Möglichkeit der ÖPUL-Betriebe, in die Maßnahme Biologischer Landbau einzusteigen – Ablehnung ................................................................................... 134, 151
Entschließungsantrag der Abgeordneten Gerhard Huber, Kolleginnen und Kollegen betreffend Einführung eines Sockelbetrages bei der Betriebsprämie für Vollerwerbslandwirte – Ablehnung 142, 152
Annahme des Gesetzentwurfes in 293 d.B. ................................................................ 151
Kenntnisnahme der drei Ausschussberichte 294, 295 und 296 d.B. .......................... 152
10. Punkt: Bericht des Umweltausschusses über die Regierungsvorlage (222 d.B.): Bundesgesetz zur Reduktion der Emissionen fluorierter Treibhausgase (Fluorierte Treibhausgase-Gesetz 2009) (233 d.B.) ............................................................................................................................. 152
Redner/Rednerinnen:
Ing. Hermann Schultes ........................................................................................... ... 152
Andrea Gessl-Ranftl ............................................................................................... ... 153
Erich Tadler ............................................................................................................. ... 154
Mag. Christiane Brunner ....................................................................................... ... 155
Bundesminister Dipl.-Ing. Nikolaus Berlakovich ................................................... 156
Nikolaus Prinz ......................................................................................................... ... 157
Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber ........................................................................ ... 158
Entschließungsantrag der Abgeordneten Dr. Gabriela Moser, Kolleginnen und Kollegen betreffend Weiterführung der Konjunkturmaßnahme „Sanierungs-Scheck“ – Ablehnung .. 158, 161
Annahme des Gesetzentwurfes ................................................................................... 160
11. Punkt: Bericht des Umweltausschusses über die Regierungsvorlage (224 d.B.): Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz zur Durchführung der REACH-Verordnung erlassen und das Chemikaliengesetz 1996 geändert wird (234 d.B.) ............................................................................................... 161
Redner/Rednerinnen:
Mag. Christiane Brunner ........................................................................................... 161
Erwin Hornek .............................................................................................................. 163
Mag. Josef Auer ...................................................................................................... ... 176
Erich Tadler ............................................................................................................. ... 177
Bundesminister Dipl.-Ing. Nikolaus Berlakovich ................................................... 178
Peter Stauber .............................................................................................................. 179
Entschließungsantrag der Abgeordneten Mag. Christiane Brunner, Kolleginnen und Kollegen betreffend REACH-Verordnung – Ablehnung ....................................................................... 162, 180
Annahme des Gesetzentwurfes ................................................................................... 180
12. Punkt: Bericht des Umweltausschusses über die Regierungsvorlage (230 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Emissionszertifikategesetz und das Bundesgesetz über den zwischenstaatlichen Luftverkehr 2008 geändert werden (235 d.B.) .......................................................................................... 180
Redner/Rednerinnen:
Dr. Susanne Winter ................................................................................................ ... 180
Mag. Josef Lettenbichler ....................................................................................... ... 181
Petra Bayr ................................................................................................................ ... 182
Erich Tadler ............................................................................................................. ... 183
Mag. Christiane Brunner ....................................................................................... ... 184
Bundesminister Dipl.-Ing. Nikolaus Berlakovich ................................................... 184
Johann Rädler ......................................................................................................... ... 186
Walter Schopf .......................................................................................................... ... 186
Gerhard Steier ......................................................................................................... ... 187
Annahme des Gesetzentwurfes ................................................................................... 188
Gemeinsame Beratung über
13. Punkt: Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Industrie über die Regierungsvorlage (223 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über den Betrieb von Dampfkesseln und Wärmekraftmaschinen (Dampfkesselbetriebsgesetz – DKBG) geändert wird (270 d.B.) ............................... 188
14. Punkt: Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Industrie über den Antrag 686/A der Abgeordneten Dr. Martin Bartenstein, Wolfgang Katzian, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Ökostromgesetz geändert wird (272 d.B.) (Absetzung dieses Tagesordnungspunktes siehe S. 46)
Redner/Rednerinnen:
Bernhard Themessl ................................................................................................ ... 188
Dr. Martin Bartenstein ............................................................................................ ... 189
Erich Tadler ............................................................................................................. ... 190
Wolfgang Katzian .................................................................................................... ... 190
Dr. Ruperta Lichtenecker ....................................................................................... ... 191
Franz Kirchgatterer ................................................................................................ ... 192
Mag. Christiane Brunner ....................................................................................... ... 193
Staatssekretärin Christine Marek ............................................................................. 194
Dr. Christoph Matznetter ........................................................................................... 195
Dr. Ruperta Lichtenecker (tatsächliche Berichtigung) .............................................. 196
Annahme des Gesetzentwurfes in 270 d.B. ................................................................ 197
15. Punkt: Sammelbericht des Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen über die Petitionen Nr. 1 bis 4, 6 bis 13 und 19 sowie über die Bürgerinitiativen Nr. 1 bis 4 (269 d.B.) ................... 197
Redner/Rednerinnen:
Bernhard Vock ............................................................................................................ 197
Mag. Rosa Lohfeyer ................................................................................................... 198
Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber ........................................................................ ... 199
Anna Höllerer .......................................................................................................... ... 200
Ursula Haubner ....................................................................................................... ... 201
Johann Hell .............................................................................................................. ... 203
Anna Franz .............................................................................................................. ... 203
Mag. Rainer Widmann ............................................................................................ ... 204
Hermann Lipitsch ................................................................................................... ... 208
Johannes Schmuckenschlager ............................................................................. ... 208
Dietmar Keck ........................................................................................................... ... 209
Mag. Katharina Cortolezis-Schlager .................................................................... ... 210
Erwin Spindelberger .............................................................................................. ... 210
Mag. Gertrude Aubauer ......................................................................................... ... 211
Ulrike Königsberger-Ludwig ................................................................................. ... 211
Gerhard Steier ......................................................................................................... ... 212
Entschließungsantrag der Abgeordneten Mag. Rainer Widmann, Kolleginnen und Kollegen betreffend: Atomkraft verhindern durch Forcierung erneuerbarer Energie, Ausschöpfen von Energieeinsparungs- und Strompreissenkungspotenzialen! – Ablehnung .................................................. 206, 213
Kenntnisnahme des Ausschussberichtes 269 d.B. ..................................................... 213
Gemeinsame Beratung über
16. Punkt: Bericht des Verkehrsausschusses über die Regierungsvorlage (221 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Führerscheingesetz (13. FSG-Novelle) und die Straßenverkehrsordnung 1960 geändert werden, sowie über die
Regierungsvorlage (180 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Führerscheingesetz geändert wird (12. FSG-Novelle) (257 d.B.) ........................................................................................................ 213
17. Punkt: Bericht des Verkehrsausschusses über den Antrag 14/A der Abgeordneten Dr. Gabriela Moser, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Führerscheingesetz geändert wird (258 d.B.) ...................................................................................................................... 213
18. Punkt: Bericht des Verkehrsausschusses über den Antrag 319/A der Abgeordneten Harald Vilimsky, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz vom 6. Juli 1960, mit dem Vorschriften über die Straßenpolizei erlassen werden (Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO. 1960), BGBl. Nr. 159/1960, geändert wird (259 d.B.) ........................................................................ 213
19. Punkt: Bericht des Verkehrsausschusses über den Antrag 330/A der Abgeordneten Harald Vilimsky, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz vom 6. Juli 1960, mit dem Vorschriften über die Straßenpolizei erlassen werden (Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO. 1960), BGBl. Nr. 159/1960, geändert wird (260 d.B.) ........................................................................ 213
20. Punkt: Bericht des Verkehrsausschusses über den Antrag 564/A(E) der Abgeordneten Sigisbert Dolinschek, Kolleginnen und Kollegen betreffend systematische Evaluierung der Verkehrssicherheitsmaßnahmen (261 d.B.) ................................................................ 213
Redner/Rednerinnen:
Harald Vilimsky .......................................................................................................... 214
Anton Heinzl ............................................................................................................ ... 215
Christoph Hagen ..................................................................................................... ... 216
Dr. Ferdinand Maier ................................................................................................ ... 217
Dr. Gabriela Moser ................................................................................................. ... 218
Bundesministerin Doris Bures ........................................................................ 219, 225
Mag. Rosa Lohfeyer ............................................................................................... ... 221
Stefan Markowitz .................................................................................................... ... 222
Franz Eßl .................................................................................................................. ... 223
Dietmar Keck ........................................................................................................... ... 223
Mag. Karin Hakl ....................................................................................................... ... 224
Hermann Gahr ........................................................................................................ ... 225
Annahme des Gesetzentwurfes in 257 d.B. ................................................................ 226
Kenntnisnahme der vier Ausschussberichte 258, 259, 260 und 261 d.B. ................... 227
Gemeinsame Beratung über
21. Punkt: Bericht des Verkehrsausschusses über die Regierungsvorlage (220 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Kraftfahrgesetz 1967 geändert wird (31. KFG-Novelle), sowie über die
Regierungsvorlage (90 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Kraftfahrgesetz 1967 geändert wird (30. KFG-Novelle) (262 d.B.) ........................................................................................................ 227
22. Punkt: Bericht des Verkehrsausschusses über den Antrag 134/A(E) der Abgeordneten Dr. Gabriela Moser, Kolleginnen und Kollegen betreffend Entwertung/Vernichtung des Typenscheins bei Pkw-Totalhavarien (263 d.B.) ...................................................................................................................... 227
Redner/Rednerinnen:
Bernhard Vock ........................................................................................................ ... 227
Peter Stauber .......................................................................................................... ... 228
Christoph Hagen ..................................................................................................... ... 229
Ing. Hermann Schultes ........................................................................................... ... 230
Dr. Gabriela Moser ................................................................................................. ... 231
Bundesministerin Doris Bures ................................................................................. 232
Mag. Josef Lettenbichler ........................................................................................... 233
Entschließungsantrag der Abgeordneten Christoph Hagen, Kolleginnen und Kollegen betreffend Beendigung der Benachteiligung von Wechselkennzeichen-Besitzern durch die Vignettenpflicht – Ablehnung 229, 234
Annahme des Gesetzentwurfes in 262 d.B. ................................................................ 233
Kenntnisnahme des Ausschussberichtes 263 d.B. ..................................................... 234
Gemeinsame Beratung über
23. Punkt: Bericht des Verkehrsausschusses über den Antrag 527/A(E) der Abgeordneten Anton Heinzl, Dr. Ferdinand Maier, Kolleginnen und Kollegen betreffend Einsatz gegen die Zulassung von „Gigalinern“ auf europäischer Ebene (264 d.B.) .................................................................................... 234
24. Punkt: Bericht des Verkehrsausschusses über den Antrag 547/A(E) der Abgeordneten Dr. Gabriela Moser, Kolleginnen und Kollegen betreffend Nein zum Gigaliner (25-Meter-Monster-Lkw mit bis zu 60 Tonnen) (265 d.B.) ...................................................................................................................... 234
Redner/Rednerinnen:
Erich Tadler ............................................................................................................. ... 235
Gabriele Binder-Maier ............................................................................................ ... 235
Dr. Gabriela Moser ................................................................................................. ... 236
Dr. Ferdinand Maier ................................................................................................ ... 238
DDr. Werner Königshofer ...................................................................................... ... 239
Bundesministerin Doris Bures ................................................................................. 240
Mag. Dr. Manfred Haimbuchner ............................................................................... 240
Entschließungsantrag der Abgeordneten Dr. Gabriela Moser, Ursula Haubner, Mag. Dr. Manfred Haimbuchner, Kolleginnen und Kollegen betreffend Verbesserungen der Lärmschutzmaßnahmen an der A 8 – Innkreis Autobahn – Ablehnung .................................................................. 237, 241
Ablehnung der dem schriftlichen Ausschussbericht 264 d.B. beigedruckten Entschließung 241
Kenntnisnahme des Ausschussberichtes 265 d.B. ..................................................... 241
25. Punkt: Bericht des Verkehrsausschusses über die Regierungsvorlage (227 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Bundesbahngesetz, das Privatbahngesetz 2004 und das Eisenbahngesetz 1957 geändert werden (299 d.B.) ...................................................................................................................... 241
Redner/Rednerinnen:
Mario Kunasek ............................................................................................................ 241
Anton Heinzl ............................................................................................................... 244
Christoph Hagen ..................................................................................................... ... 245
Dr. Ferdinand Maier ................................................................................................ ... 246
Bernhard Vock ........................................................................................................ ... 246
Dr. Gabriela Moser ................................................................................................. ... 247
Wilhelm Haberzettl ................................................................................................. ... 250
Bundesministerin Doris Bures ................................................................................. 251
Johann Rädler ......................................................................................................... ... 252
Mag. Josef Auer ...................................................................................................... ... 252
Johann Hell .............................................................................................................. ... 253
Entschließungsantrag der Abgeordneten Mario Kunasek, Kolleginnen und Kollegen betreffend Erhaltung der Gesäusebahn – Ablehnung ........................................................................... 243, 254
Entschließungsantrag der Abgeordneten Dr. Gabriela Moser, Kolleginnen und Kollegen betreffend Aufrechterhaltung des Schienen-Personenverkehrs durch das Gesäuse – Ablehnung 249, 254
Annahme des Gesetzentwurfes ................................................................................... 254
Gemeinsame Beratung über
26. Punkt: Bericht des Rechnungshofausschusses betreffend den Bericht
des Rechnungshofes, Reihe Bund 2009/1; Band 5 –
WIEDERVORLAGE (III-20/266 d.B.) 254
27. Punkt: Bericht des Rechnungshofausschusses betreffend den Bericht
des Rechnungshofes, Reihe Bund 2008/12 (III-11/267 d.B.) ....................................... 254
Redner/Rednerinnen:
Mag. Dr. Manfred Haimbuchner ........................................................................... ... 254
Stefan Prähauser .................................................................................................... ... 255
Hermann Gahr ........................................................................................................ ... 256
Kurt List ................................................................................................................... ... 257
Dorothea Schittenhelm .......................................................................................... ... 259
Konrad Steindl ........................................................................................................ ... 262
Ernest Windholz ...................................................................................................... ... 262
Mag. Werner Kogler ............................................................................................... ... 263
Mag. Rainer Widmann ............................................................................................ ... 265
Rechnungshofpräsident Dr. Josef Moser ............................................................... 266
Entschließungsantrag der Abgeordneten Anton Heinzl, Dr. Ferdinand Maier, Kolleginnen und Kollegen betreffend Einsatz gegen die Zulassung von „Gigalinern“ auf europäischer Ebene – Annahme (E 44) 260, 267
Kenntnisnahme der beiden Berichte III-20 und III-11 d.B. ............................................ 267
28. Punkt: Bericht des Immunitätsausschusses über das Ersuchen des Landesgerichtes für Strafsachen Wien (GZ 111 Hv 52/09v) um Zustimmung zur behördlichen Verfolgung der Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Eva Glawischnig-Piesczek (314 d.B.) .................................................................... 267
Annahme des Ausschussantrages .............................................................................. 268
29. Punkt: Bericht des Immunitätsausschusses über das Ersuchen des Landesgerichtes für Strafsachen Wien (GZ 095 Hv 20/09w) um Zustimmung zur behördlichen Verfolgung des Abgeordneten zum Nationalrat Karl Öllinger (315 d.B.) ................................................................................................. 268
Redner:
Mag. Harald Stefan ..................................................................................................... 268
Annahme des Ausschussantrages .............................................................................. 269
30. Punkt: Erste Lesung: Antrag der Abgeordneten Josef Bucher, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), BGBl. Nr. 1/1930 idgF, geändert wird (657/A) ................................................................................................... 269
Redner/Rednerinnen:
Josef Bucher ........................................................................................................... ... 269
Mag. Kurt Gaßner ................................................................................................... ... 270
Mag. Dr. Beatrix Karl .............................................................................................. ... 270
Christian Lausch ..................................................................................................... ... 271
Dieter Brosz ............................................................................................................. ... 272
Gerald Grosz ........................................................................................................... ... 273
Zuweisung des Antrages 657/A an den Verfassungsausschuss ................................ 274
Eingebracht wurden
Anträge der Abgeordneten
Stefan Petzner, Kolleginnen und Kollegen betreffend Einsetzung einer Untersuchungskommission in der Causa Albertina (728/A)(E)
Mag. Christiane Brunner, Kolleginnen und Kollegen betreffend Totalreform des Ökostromgesetzes (729/A)(E)
Bernhard Themessl, Kolleginnen und Kollegen betreffend die Abschaffung der täglichen Geringfügigkeitsgrenze (730/A)(E)
Christian Lausch, Kolleginnen und Kollegen betreffend bessere Entlohnung für Vertragsbedienstete des Justizwachedienstes in der Grundausbildung (731/A)(E)
Bernhard Themessl, Kolleginnen und Kollegen betreffend die Anhebung der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze (732/A)(E)
Mario Kunasek, Kolleginnen und Kollegen betreffend Dienstfreistellung von Bediensteten des öffentlichen Dienstes, die Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr sind (733/A)(E)
Alois Gradauer, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Rechnungshofgesetz 1948 geändert wird (734/A)
Mag. Birgit Schatz, Kolleginnen und Kollegen betreffend teilweise Erdverkabelung der 380-kV-Leitungen (735/A)(E)
Dr. Gabriela Moser, Kolleginnen und Kollegen betreffend Weiterführung der Konjunkturmaßnahme „Sanierungs-Scheck“ (736/A)(E)
Mag. Birgit Schatz, Mag. Ewald Stadler, Ing. Norbert Hofer, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Starkstromwegegesetz 1968 geändert wird (737/A)
Mag. Alev Korun, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die österreichische Staatsbürgerschaft geändert wird (738/A)
Sigisbert Dolinschek, Kolleginnen und Kollegen betreffend Einsatz von RFID Chips (739/A)(E)
Mag. Rainer Widmann, Kolleginnen und Kollegen betreffend Einrichtung eines Entschädigungsfonds nach österreichischem Muster in den Heimatstaaten der in Österreich aufgenommenen Heimatvertriebenen und ihrer Nachkommen (740/A)(E)
Josef Bucher, Kolleginnen und Kollegen betreffend BZÖ-Wirtschaftsbelebungspaket (741/A)(E)
Dr. Peter Fichtenbauer, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch (ABGB) geändert wird (742/A)
Anfragen der Abgeordneten
Mag. Judith Schwentner, Kolleginnen und Kollegen an den Bundeskanzler betreffend Einsparungspläne bei den Bundesbediensteten auf Kosten von Frauen (2734/J)
Mag. Judith Schwentner, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Frauen und öffentlichen Dienst betreffend Einsparungspläne bei den Bundesbediensteten auf Kosten von Frauen (2735/J)
Mag. Judith Schwentner, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten betreffend Einsparungspläne bei den Bundesbediensteten auf Kosten von Frauen (2736/J)
Mag. Judith Schwentner, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz betreffend Einsparungspläne bei den Bundesbediensteten auf Kosten von Frauen (2737/J)
Mag. Judith Schwentner, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend Einsparungspläne bei den Bundesbediensteten auf Kosten von Frauen (2738/J)
Mag. Judith Schwentner, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Gesundheit betreffend Einsparungspläne bei den Bundesbediensteten auf Kosten von Frauen (2739/J)
Mag. Judith Schwentner, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres betreffend Einsparungspläne bei den Bundesbediensteten auf Kosten von Frauen (2740/J)
Mag. Judith Schwentner, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend Einsparungspläne bei den Bundesbediensteten auf Kosten von Frauen (2741/J)
Mag. Judith Schwentner, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Landesverteidigung und Sport betreffend Einsparungspläne bei den Bundesbediensteten auf Kosten von Frauen (2742/J)
Mag. Judith Schwentner, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betreffend Einsparungspläne bei den Bundesbediensteten auf Kosten von Frauen (2743/J)
Mag. Judith Schwentner, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur betreffend Einsparungspläne bei den Bundesbediensteten auf Kosten von Frauen (2744/J)
Mag. Judith Schwentner, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie betreffend Einsparungspläne bei den Bundesbediensteten auf Kosten von Frauen (2745/J)
Mag. Judith Schwentner, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend betreffend Einsparungspläne bei den Bundesbediensteten auf Kosten von Frauen (2746/J)
Mag. Judith Schwentner, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wissenschaft und Forschung betreffend Einsparungspläne bei den Bundesbediensteten auf Kosten von Frauen (2747/J)
Dr. Ruperta Lichtenecker, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz betreffend Inanspruchnahme der freiwilligen Arbeitslosen-Versicherung für Selbständige (2748/J)
Dr. Ruperta Lichtenecker, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres betreffend: Wie sicher ist Linz? (2749/J)
Dr. Kurt Grünewald, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Gesundheit betreffend Pränataldiagnostik (2750/J)
Mag. Judith Schwentner, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wissenschaft und Forschung betreffend Frauenförderung an Universitäten (2751/J)
Mag. Judith Schwentner, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz betreffend die Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf die Beschäftigungssituation der Frauen (2752/J)
Mag. Judith Schwentner, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Frauen und öffentlichen Dienst betreffend Schutzzonen vor Abtreibungskliniken und Zugang zu Verhütungsmitteln (2753/J)
Mag. Judith Schwentner, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Gesundheit betreffend Zugang zu Verhütungsmitteln (2754/J)
Mag. Judith Schwentner, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres betreffend Schutzzonen vor Abtreibungskliniken (2755/J)
Mag. Christiane Brunner, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend betreffend seit über zehn Jahren ungelöstes Problem mit Infraschall-Emissionen eines Supermarkts in Wien 20 (Brigittenau/Pappenheimgasse) (2756/J)
Dr. Ruperta Lichtenecker, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend betreffend: Der Weg Österreichs in eine sichere Energiezukunft! (2757/J)
Mag. Werner Kogler, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend Daten zur Erbschafts- und Schenkungssteuer für das Jahr 2008 (Nachfolgeanfrage zu früheren Anfragen 270/J, 1393/J und 3568/J) (2758/J)
Dr. Ruperta Lichtenecker, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend betreffend Inanspruchnahme der freiwilligen Arbeitslosen-Versicherung für Selbständige (2759/J)
Mag. Dr. Wolfgang Zinggl, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur betreffend die Wiener Sängerknaben und die POK Pühringer Privatstiftung (2760/J)
Mag. Dr. Wolfgang Zinggl, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend betreffend den Konzertkristall der Wiener Sängerknaben im Augarten (2761/J)
Mag. Josef Auer, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres betreffend die Auflösung des Vereins „Akademische Burschenschaft Olympia“ (2762/J)
Gerhard Huber, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend betreffend Ausfuhrförderungen (2763/J)
Hannes Fazekas, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres betreffend Supervision für die Exekutive (2764/J)
Dr. Andreas Karlsböck, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres betreffend Betreuung von Einbruchsopfern (2765/J)
DDr. Werner Königshofer, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend Justizanstalt Innsbruck (2766/J)
Mario Kunasek, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Landesverteidigung und Sport betreffend Rekruten mit Wertungsziffer 4 bis 2 (2767/J)
Dr. Walter Rosenkranz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres betreffend ungültige Ausstellung von Reifeprüfungszeugnissen durch die Al Azhar International Schools Vienna und einen eventuellen Zusammenhang mit Schleppertätigkeiten (2768/J)
Dr. Walter Rosenkranz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten betreffend ungültige Ausstellung von Reifeprüfungszeugnissen durch die Al Azhar International Schools Vienna (2769/J)
Mag. Heidemarie Unterreiner, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur betreffend freien Eintritt in Bundesmuseen (2770/J)
Dr. Walter Rosenkranz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur betreffend ungültige Ausstellung von Reifeprüfungszeugnissen durch die Al Azhar International Schools Vienna (2771/J)
Dr. Walter Rosenkranz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wissenschaft und Forschung betreffend ungültige Ausstellung von Reifeprüfungszeugnissen durch die Al Azhar International Schools Vienna (2772/J)
Mag. Heidemarie Unterreiner, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur betreffend den Wassereintritt am 23. Juni 2009 und mutmaßliche Baumängel an der „Albertina“ (2773/J)
Mag. Heidemarie Unterreiner, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend betreffend den Wassereintritt am 23. Juni 2009 und mutmaßliche Baumängel an der „Albertina“ (2774/J)
Dr. Andreas Karlsböck, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie betreffend Zustand österreichischer Autobahnen (2775/J)
Mag. Dr. Manfred Haimbuchner, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres betreffend Zusage zum Polizeipersonalpaket für Oberösterreich (2776/J)
Dr. Andreas Karlsböck, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Gesundheit betreffend FSME-Impfung und Aufklärung (2777/J)
Heinz-Christian Strache, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend durch Raiffeisen veranlasste Kapitalerhöhungen der AUA (2778/J)
Ing. Norbert Hofer, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie betreffend für die ÖBB entstandene Kosten durch Gratisfahrten für Mitarbeiter und deren Angehörige (2779/J)
Ewald Sacher, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wissenschaft und Forschung betreffend die Errichtung eines Diplomstudiums für Zahnmedizin an der Donau-Universität Krems (2780/J)
Mag. Johann Maier, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz betreffend „Rückrufe von unsicheren (oder gefährlichen) Konsumgütern im Jahr 2008“ (2781/J)
Mag. Johann Maier, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Gesundheit betreffend „Rückrufe von unsicherem (oder gefährlichem) Kinderspielzeug im Jahr 2008“ (2782/J)
Mag. Johann Maier, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend betreffend „Sicherheitsanforderungen bei Produkten, Maschinen, Geräten, Ausrüstungen oder deren Teilen – behördliche Maßnahmen im Jahr 2008“ (2783/J)
Mag. Johann Maier, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betreffend „Vollziehung des Biozidgesetzes in Österreich“ (2784/J)
Mag. Johann Maier, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie betreffend „Rückrufe von unsicheren (und/oder gefährlichen) Kraftfahrzeugen“ (2785/J)
Mag. Johann Maier, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betreffend „Krebsgefahr durch Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe in Konsumgütern?“ (2786/J)
Dr. Peter Wittmann, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres betreffend Verfolgungshandlungen gegen Abgeordnete (2787/J)
Ing. Christian Höbart, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Gesundheit betreffend soziale Kosten des Drogenmissbrauchs (2788/J)
Mag. Dr. Manfred Haimbuchner, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres betreffend Kriminalitätsentwicklung in Oberösterreich erstes Halbjahr 2009 (2789/J)
Mag. Dr. Martin Graf, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend „Politische Verstrickungen im Fall Kohn/Madoff“ (2790/J)
Mag. Dr. Martin Graf, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend betreffend Gegengeschäfte, die im Zusammenhang mit der Anschaffung der Eurofighter stehen (2791/J)
Mag. Roman Haider, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend betreffend die Teilverkabelung einer 380-kv-Leitung durch sensible Gebiete in Salzburg (2792/J)
Mag. Roman Haider, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend betreffend Schaffung eines Bundesministeriums für Kultur, Sport und Tourismus (2793/J)
Mag. Roman Haider, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur betreffend Schaffung eines Bundesministeriums für Kultur, Sport und Tourismus (2794/J)
Dr. Johannes Hübner, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten betreffend die Rückstellung von Archivmaterial durch Sergej Lawrow (2795/)
Mag. Heidemarie Unterreiner, Kolleginnen und Kollegen an den Bundeskanzler betreffend Verlängerung des Film- und Fernsehabkommens (2796/J)
Mag. Roman Haider, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Landesverteidigung und Sport betreffend Schaffung eines Bundesministeriums für Kultur, Sport und Tourismus (2797/J)
Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Gesundheit betreffend Entlohnung von Hebammen (2798/J)
Ing. Norbert Hofer, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz betreffend Landesausstellung „Mahlzeit“ (2799/J)
Wolfgang Zanger, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betreffend Verwendung von Schummelschinken in Österreich (2800/J)
Wolfgang Zanger, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz betreffend Verwendung von Schummelschinken in Österreich (2801/J)
Wolfgang Zanger, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Gesundheit betreffend Verwendung von Schummelschinken in Österreich (2802/J)
Mag. Dr. Manfred Haimbuchner, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres betreffend Bleiberechtsanträge (2803/J)
DDr. Werner Königshofer, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend Auswirkungen der Machenschaften von Bernard Madoff aus Österreich (2804/J)
Mario Kunasek, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Landesverteidigung und Sport betreffend Umstieg von Soldaten in Zeitlaufbahnen in eine zivile Beschäftigung (2805/J)
Mario Kunasek, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Landesverteidigung und Sport betreffend Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit (2806/J)
Dr. Susanne Winter, Kolleginnen und Kollegen an den Bundeskanzler betreffend Informationsarbeit zur Europawahl (2807/J)
Dr. Susanne Winter, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Frauen und öffentlichen Dienst betreffend Informationsarbeit zur Europawahl (2808/J)
Dr. Susanne Winter, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten betreffend Informationsarbeit zur Europawahl (2809/J)
Dr. Susanne Winter, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz betreffend Informationsarbeit zur Europawahl (2810/J)
Dr. Susanne Winter, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend Informationsarbeit zur Europawahl (2811/J)
Dr. Susanne Winter, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Gesundheit betreffend Informationsarbeit zur Europawahl (2812/J)
Dr. Susanne Winter, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres betreffend Informationsarbeit zur Europawahl (2813/J)
Dr. Susanne Winter, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend Informationsarbeit zur Europawahl (2814/J)
Dr. Susanne Winter, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Landesverteidigung und Sport betreffend Informationsarbeit zur Europawahl (2815/J)
Dr. Susanne Winter, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betreffend Informationsarbeit zur Europawahl (2816/J)
Dr. Susanne Winter, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur betreffend Informationsarbeit zur Europawahl (2817/J)
Dr. Susanne Winter, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie betreffend Informationsarbeit zur Europawahl (2818/J)
Dr. Susanne Winter, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend betreffend Informationsarbeit zur Europawahl (2819/J)
Dr. Susanne Winter, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wissenschaft und Forschung betreffend Informationsarbeit zur Europawahl (2820/J)
Mag. Johann Maier, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend betreffend „Ski- und Snowboardunfälle – Sicherheit auf Skipisten“ (2821/J)
Mag. Johann Maier, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend „Ski- und Snowboardunfälle – Sicherheit auf Skipisten“ (2822/J)
Mag. Johann Maier, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres betreffend „Ski- und Snowboardunfälle – Sicherheit auf Skipisten“ (2823/J)
Mag. Johann Maier, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz betreffend „Ski- und Snowboardunfälle – Sicherheit auf Skipisten“ (2824/J)
Mag. Johann Maier, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Landesverteidigung und Sport betreffend „Ski- und Snowboardunfälle – Sicherheit auf Skipisten“ (2825/J)
Mag. Johann Maier, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Gesundheit betreffend „Ski- und Snowboardunfälle – Sicherheit auf Skipisten“ (2826/J)
Christoph Hagen, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres betreffend Verteilung von „Infozetteln“ durch die Wiener Polizei (2827/J)
Mag. Johann Maier, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend „Pensionskassengesetz 1990 – genehmigte Ertragserwartungen?“ (2828/J)
Christoph Hagen, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend Zusammenlegungen oder Schließungen von Bezirksgerichten oder Justizanstalten (2829/J)
Josef Bucher, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend Kommunalkredit Austria AG (2830/J)
Dr. Martin Strutz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie betreffend Verzögerungen bei der Koralmbahn (2831/J)
Gerhard Huber, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres betreffend den massiven Anstieg der strafbaren Handlungen gegen das Eigentum in Tirol durch organisierte Einbrecherbanden aus Georgien und Moldawien (2832/J)
*****
Karl Öllinger, Kolleginnen und Kollegen an die Präsidentin des Nationalrates betreffend Pensionskassenvorsorge von Abgeordneten des Nationalrats und Bundesrats (25/JPR)
Zurückgezogen wurde die Anfrage der Abgeordneten
Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie betreffend Amtsmissbrauch und Nötigung bei der ASFINAG Maut Service GmbH (2481/J) (Zu 2481/J)
Anfragebeantwortungen
der Bundesministerin für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Alev Korun, Kolleginnen und Kollegen (2023/AB zu 2004/J)
der Bundesministerin für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Alev Korun, Kolleginnen und Kollegen (2024/AB zu 2005/J)
des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend auf die Anfrage der Abgeordneten Bernhard Vock, Kolleginnen und Kollegen (2025/AB zu 2013/J)
des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz auf die Anfrage der Abgeordneten Karl Öllinger, Kolleginnen und Kollegen (2026/AB zu 2122/J)
Beginn der Sitzung: 9.07 Uhr
Vorsitzende: Präsidentin Mag. Barbara Prammer, Zweiter Präsident Fritz Neugebauer, Dritter Präsident Mag. Dr. Martin Graf.
*****
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Guten Morgen, meine Damen und Herren! Die Sitzung ist eröffnet.
Die nicht verlesenen Teile des Amtlichen Protokolls der 29. Sitzung vom 8. Juli 2009 sind in der Parlamentsdirektion aufgelegen und unbeanstandet geblieben.
Als verhindert gemeldet sind die Abgeordneten Mag. Donnerbauer, Praßl und Dr. Glawischnig-Piesczek.
Mandatsverzicht und Angelobung
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Von der Bundeswahlbehörde ist die Mitteilung eingelangt, dass Frau Abgeordnete Mag. Ulrike Lunacek auf ihr Mandat verzichtet hat und an ihrer Stelle Frau Mag. Helene Jarmer in den Nationalrat berufen wurde.
Da der Wahlschein bereits vorliegt und die Genannte im Haus anwesend ist, werde ich sogleich die Angelobung vornehmen.
Nach Verlesung der Gelöbnisformel durch die Frau Schriftführerin wird die neue Mandatarin ihre Angelobung mit den Worten „Ich gelobe“ zu leisten haben.
Ich ersuche nun die Frau Schriftführerin, Frau Abgeordnete Rosa Lohfeyer, um die Verlesung der Gelöbnisformel.
Schriftführerin Mag. Rosa Lohfeyer: „Sie werden geloben unverbrüchliche Treue der Republik Österreich, stete und volle Beobachtung der Verfassungsgesetze und aller anderen Gesetze und gewissenhafte Erfüllung Ihrer Pflichten.“
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Wir haben soeben die Worte „Ich gelobe“ nicht nur gehört, sondern auch gesehen, und ich begrüße die neue Abgeordnete recht herzlich in unserer Mitte. (Allgemeiner Beifall.)
Vertretung von Mitgliedern der Bundesregierung
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Ich gebe die Vertretung von Mitgliedern der Bundesregierung, welche sich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union aufhalten, wie folgt bekannt:
Der Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten Dr. Michael Spindelegger wird durch die Bundesministerin für Justiz Mag. Claudia Bandion-Ortner vertreten.
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Wir gelangen zur Fragestunde.
Die Fragestellungen durch die Damen und Herren Abgeordneten werden von den beiden Redner- und Rednerinnenpulten im Halbrund vorgenommen; die Beantwortung
durch den Herrn Bundesminister für Gesundheit vom Redner-/Rednerinnenpult der Abgeordneten.
Für die Anfrage- und Zusatzfragesteller und -stellerinnen jeder Fraktion ist jeweils 1 Minute Redezeit vorgesehen. Die Beantwortung der Anfrage durch den Herrn Bundesminister soll 2 Minuten, jene der Zusatzfragen jeweils 1 Minute betragen.
Wenige Sekunden vor Ende der jeweiligen Redezeit werde ich, so wie bisher, mit einem kurzen Glockensignal auf das Ende der Redezeit aufmerksam machen.
Ich teile auch mit, dass die Sitzung von 9.05 Uhr bis 13 Uhr vom ORF live übertragen wird.
Wir gelangen nun – um 9.11 Uhr – zur Fragestunde.
Bundesministerium für Gesundheit
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Ich beginne mit der 1. Anfrage, 26/M, der Frau Abgeordneten Dr. Oberhauser. – Frau Abgeordnete, bitte die Frage.
Abgeordnete Dr. Sabine Oberhauser, MAS (SPÖ): Frau Präsidentin! Guten Morgen, Herr Bundesminister, meine Frage an Sie:
„Wie wollen Sie die Inhalte des vom Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger vorgelegten Sanierungskonzepts politisch umsetzen?“
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Danke für die Anfrage, danke auch, dass es bei dieser Fragestunde das erste Mal ist, dass auch die Gebärdensprache hier im Parlament vertreten ist. Das freut mich.
Zur Frage der Frau Abgeordneten Oberhauser: Österreich hat eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Wir haben, um die Finanzierung sichern zu können, ein Sanierungskonzept in Auftrag gegeben, wo die Sozialversicherungsträger gemeinsam mit der Ärztekammer gebeten worden sind, ein nachhaltiges Sanierungskonzept mit den Vertragspartnern auf den Tisch zu legen. Das haben die Vertragspartner in ambitionierten Verhandlungen mit dem Hauptverband in einem neuen Konzept auch umgesetzt.
Das Papier enthält einige sehr, sehr gute Vorschläge, die eine ganz gute Grundlage für die Sicherung der Finanzierung sind. Wesentlich ist, dass es auf solidarischer Finanzierung aufbaut, weil kranke Menschen keinen Markt haben. Dieses Papier stellt sicher, dass die Menschen auch in der Krise eine gute Versorgung haben.
Wie will ich es umsetzen? Ich habe schon den Auftrag erteilt, die gesetzlichen Maßnahmen über den Sommer vorzubereiten. Wir wollen in der Bundesregierung dieses Konzept sozusagen abnehmen und dann auch einer parlamentarischen Umsetzung zuführen. (Beifall bei der SPÖ.)
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zusatzfrage? – Bitte, Frau Abgeordnete Dr. Oberhauser.
Abgeordnete Dr. Sabine Oberhauser, MAS (SPÖ): Im vorgelegten Sanierungskonzept sind auch Maßnahmen im Heilmittelbereich vorgesehen. Jetzt wissen wir, dass es einen Pharmarahmenvertrag zwischen dem Hauptverband und der Pharmawirtschaft gibt, der letztes Jahr unterzeichnet wurde.
Wie, denken Sie, können mit diesem Pharmavertrag die im Sanierungskonzept vorgesehenen Einsparungsmaßnahmen im Heilmittelbereich dennoch umgesetzt werden?
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Ich stehe grundsätzlich zum Vertrag. Wenn Verträge abgeschlossen werden, sind sie einzuhalten. Das Entscheidende ist, vertrauensbildend zu wirken. Wir müssen neue kluge Modelle entwickeln. Wir haben auch Unterstützung durch das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes zum Finanzierungssicherungsbeitrag im Hinblick auf eine steuernde Gesundheitspolitik, und wir werden in Verhandlungen treten.
Ich bekenne mich zu den Maßnahmen des ausverhandelten Sanierungspakets. (Beifall bei der SPÖ.)
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zusatzfrage? – Bitte, Herr Abgeordneter Klikovits.
Abgeordneter Oswald Klikovits (ÖVP): Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Ich wünsche einen schönen guten Morgen! Das von Ihnen, Herr Bundesminister, angesprochene Sanierungskonzept ist sicherlich ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, bringt aber noch nicht die gewünschten Einsparungsmaßnahmen. Es ist angedacht, unter Umständen noch weitere Maßnahmen zu setzen.
Sie wissen, dass wir in Österreich in etwa 10 000 Akutbetten zu viel haben, dafür 6 000 Pflegebetten zu wenig. Was werden Sie unternehmen, damit dieser Umstand bereinigt wird und damit auch dementsprechende weitere Einsparungsmaßnahmen vorgenommen werden können?
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Schönen guten Morgen! Herr Abgeordneter, aus meiner Sicht war jetzt der Auftrag, im niedergelassenen Bereich Maßnahmen zu setzen. Die Frage des Umgangs mit den Betten in den Krankenanstalten ist ein zweiter Schritt. Wir haben eine 15a-Vereinbarung, wo die Länder als Träger der Krankenanstalten aufgefordert sind, die österreichischen Pläne umzusetzen. Auch hier wollen wir durch mehr Transparenz den Trend unterstützen, kosteneffizient zu sein und auch die Ressourcen richtig einzusetzen. Da gibt es den Österreichischen Strukturplan Gesundheit, den wir weiterentwickeln.
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zusatzfrage? – Bitte, Herr Abgeordneter Jury.
Abgeordneter Josef Jury (BZÖ): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Herr Gesundheitsminister! – Frau Präsidentin, Sie werden es mir verzeihen, aber ich möchte auf kurzem Wege unseren ehemaligen Vizekanzler und Sozialminister Herbert Haupt auf der Galerie begrüßen. (Beifall beim BZÖ sowie bei Abgeordneten von SPÖ und ÖVP.)
Sehr verehrter Herr Minister, das österreichische Gesundheitssystem wird von einem Mehrkassensystem geprägt: 17 verschiedene Kassen, 17 verschiedene Prämien, 17 verschiedene Zugänge.
Gibt es in Ihrer Reform irgendeine Maßnahme, um die derzeitige Situation zu beenden, die Kassen zusammenzuführen, diese verschiedenen Sozialversicherungsträger zu harmonisieren, damit am Ende des Tages gleiche Leistung, gleiche Zugänge und gleiche Prämien herauskommen?
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Bitte, Herr Bundesminister.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Herr Abgeordneter, ich darf Ihnen mitteilen, dass es in Österreich ein Allgemeines Sozialversicherungsrecht gibt,
und das regelt mit Rechtsanspruch für alle Menschen die gleichen Leistungen und auch die gleichen Beiträge. Es gibt keine unterschiedlichen Beiträge und es gibt auch keine unterschiedlichen Leistungen in der sozialen Krankenversicherung.
Wir haben ein differenziertes System in den Bundesländern, das sicherstellt, dass die Menschen in den Bundesländern vor Ort die richtige Versorgung bekommen, und das ist sehr, sehr gut, weil die Verantwortlichen in den Bundesländern die örtlichen Gegebenheiten besser kennen und daher in der Lage sind, die richtige Versorgung vor Ort anzubieten. Das hat dazu geführt, dass das österreichische Gesundheitssystem zum besten Gesundheitssystem der Welt geworden ist, weil wir nahe am Patienten/an der Patientin arbeiten können. (Beifall bei der SPÖ sowie bei Abgeordneten der ÖVP.)
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Weitere Zusatzfrage? – Bitte, Herr Abgeordneter Öllinger.
Abgeordneter Karl Öllinger (Grüne): Guten Morgen, Herr Minister! Das Kassensanierungspaket, zu dem Sie stehen – der Finanzminister offensichtlich derzeit noch nicht –, würde eine deutliche Besserung für die Kassen bringen, das ist unbestritten, aber es würde noch keine nachhaltige Sanierung der Kassen bringen.
Jetzt, Herr Bundesminister, kommt aber noch die Krise dazu und damit bedeutende Beitragsverluste, so rechne ich jedenfalls, für heuer beziehungsweise für die nächsten Jahre. Wie beziffern Sie diese Verluste, und wie wollen Sie damit umgehen, Herr Bundesminister?
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Herr Abgeordneter, das ist ja genau das Problem: Wir haben eine Finanzierung der sozialen Gesundheit abhängig von den Lohneinkommen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und gerade in einer Krise gehen diese Einnahmen zurück. Wir haben reagiert. Ich habe reagiert, indem ganz klar jetzt der Auftrag ergangen ist, die Finanzierung mehr auch über Steuern sicherzustellen, damit wir den Lohnanteil reduzieren können. So werden wir ein weiteres Element von Sicherheit in die Finanzierung bringen, und das tun wir.
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zusatzfrage? – Bitte, Herr Abgeordneter Dr. Karlsböck.
Abgeordneter Dr. Andreas Karlsböck (FPÖ): Frau Präsidentin! Herr Minister, es wird bei dem vorliegenden Kassensanierungspaket immer nur von Einsparungen gesprochen. Eine besondere Form der Einsparung ist der Verzicht vieler sozial schwacher Menschen auf die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen aufgrund hoher Selbstbehalte.
Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, Herr Minister, um die unsozialen Selbstbehalte abzuschaffen und damit in Zeiten der Wirtschaftskrise eine nicht unwesentliche Barriere im freien Zugang zur Gesundheitsleistung zu beseitigen und damit ein Stück mehr an sozialer Fairness für die Schwächsten im Land herzustellen?
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Herr Abgeordneter, ich habe immer gesagt, dass ich von Selbstbehalten nichts halte. Selbstbehalte haben keine steuernde Funktion im Gesundheitswesen; sie schaden in Wirklichkeit dem Zugang dazu.
Ich werde mich immer bemühen, Selbstbehalte abzubauen. Gestern hat der Nationalrat auch einen Beitrag dazu geleistet, weil wir im 3. Sozialrechts-Änderungsgesetz
Selbstbehalte für eine Personengruppe abgebaut haben. Schritt für Schritt wollen wir Selbstbehalte eindämmen. (Beifall bei der SPÖ.)
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Wir gelangen nun zur 2. Anfrage, 32/M, des Herrn Abgeordneten Dr. Rasinger. – Bitte.
Abgeordneter Dr. Erwin Rasinger (ÖVP): Jeder Österreicher, der einmal im Ausland war, weiß das österreichische Spitalssystem zu schätzen. 2,5 Millionen Österreicher werden jährlich in den Spitälern aufgenommen. Zum Beispiel werden mehr Österreicher am grauen Star operiert – 60 000 –, als St. Pölten Einwohner hat. Das ist eine gewaltige Herausforderung – auch finanzieller Art.
Daher meine Frage, Herr Bundesminister:
„Wie sehen Ihre Vorstellungen und Ihr Zeitplan im Hinblick auf die Reform der Spitalsfinanzierung aus?“
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Herr Abgeordneter, bei der Spitalsfinanzierung geht es einmal darum, richtige Leistung am richtigen Ort zu erhalten. Wir haben eine ausgesprochen gute Struktur in den Krankenanstalten. Wir haben international anerkannte gute Leistungen in den Krankenanstalten. Es geht darum, die Menschen zur richtigen Leistung zu bringen und auch die richtige Leistung anzubieten.
Eine Reform ist aus meiner Sicht gerade im Gesundheitsbereich ein kontinuierlich ablaufender Prozess. Wir haben im Bereich der Spitalsfinanzierung eine gültige Artikel-15a-Vereinbarung, die 2013 ausläuft. Das Regierungsprogramm hat klar festgelegt, dass man bis 2011 Schritte setzen soll, um die Vorbereitungsarbeiten für eine weitere Artikel-15a-Vereinbarung zu treffen.
Ich habe bereits begonnen, wichtige Elemente herauszunehmen. Die Bundesgesundheitskommission hat erstens das Thema E-Medikation aufgegriffen, und es wurde gemeinsam über alle Bereiche versucht, hier Einsparungspotenziale zustande zu bringen.
Wir haben in der letzten Sitzung der Bundesgesundheitskommission beschlossen, die Transparenz der Abrechnung in den Krankenanstalten zu erhöhen; da gibt es auch ein Einvernehmen. Es geht jetzt auch darum, die Evaluierung der Leistungsorientierten Krankenhausfinanzierung vorzunehmen. Das wird bis Jahresende erfolgen. Es gibt auch eine Vereinbarung, Bereiche von präoperativer Diagnostik zu diskutieren.
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zusatzfrage? – Bitte, Herr Abgeordneter Dr. Rasinger.
Abgeordneter Dr. Erwin Rasinger (ÖVP): Wie Sie wissen, bin ich Arzt, und als Arzt liegen mir nicht nur die Finanzen am Herzen, sondern auch, was der Bürger wirklich an Leistungen bekommt und wie hoch die Qualität der Leistungen ist. Und die Leistungen sind beeindruckend. Ich erwähne nur: 20 000 Hüftprothesen und 15 000 Knieprothesen werden pro Jahr in österreichischen Spitälern gemacht. Das ist weltweit wirklich beeindruckend.
Herr Minister, trotzdem: Was werden Sie tun, um diese Leistungen qualitativ noch zu verbessern?
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Wir haben einen ganz wesentlichen Beitrag zu leisten, nämlich die integrierte Versorgung auszubauen, den Be-
handlungsprozess aus der Perspektive von Patientinnen und Patienten zu betrachten. Da brauchen wir übergreifende Versorgungsstrukturen. Das wird jetzt andiskutiert.
Wir haben auch schon eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich mit integrierter Versorgung, bei der Krankheit des Patienten beginnend bis hin zur Rehabilitation, befasst.
Hier gehen wir jeden Tag einen Schritt weiter. Wir wollen so die Versorgung der Menschen verbessern und damit auch die Qualität im gesamten Gesundheitsbereich kontinuierlich verbessern.
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zusatzfrage? – Bitte, Frau Abgeordnete Schenk. (Abg. Schenk begibt sich erst nach der Worterteilung zum Rednerpult.)
Ich darf an dieser Stelle ersuchen, sich als nachfolgender Fragesteller/nachfolgende Fragestellerin bereits vor Erteilung des Wortes zum nächsten Rednerpult zu begeben, damit wir die Zeit einhalten können.
Bitte, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete Martina Schenk (BZÖ): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Das österreichische Gesundheitssystem wird von einer Kassen-Klassenmedizin geprägt.
Gibt es in irgendeiner Form eine Maßnahme, um die derzeitige Situation zu beenden, dass Versicherte der Beamtenkasse ihren Arzt durchschnittlich eine Viertelstunde in Anspruch nehmen, Versicherte der Gebietskrankenkasse hingegen nur 2 Minuten?
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Ich gehe davon aus, dass es in Österreich keine Klassen- und Kassenmedizin gibt, sondern wir haben gleiche Rechte, insbesondere im Allgemeinen Sozialversicherungsrecht. Es geht immer darum, gute Leistungen den Patientinnen und Patienten angedeihen zu lassen. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig.
Wir müssen sicherstellen, dass sich Ärztinnen und Ärzte an die Patienten auch wenden können. Das ist mit einem durchorganisierten Behandlungskonzept, mit integrierter Versorgung auch möglich.
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zusatzfrage? – Bitte, Herr Abgeordneter Dr. Grünewald.
Abgeordneter Dr. Kurt Grünewald (Grüne): Frau Präsidentin! Geschätzter Herr Bundesminister! Es gibt schon Unterschiede zwischen PatientInnen. Das Österreichische Bundesinstitut für Gesundheitswesen hat die psychotherapeutische Versorgung in Österreich analysiert und eklatante Versorgungsmängel sichtbar gemacht.
Wie lange sollen psychisch Kranke weiter diskriminiert und sogar als Patienten dritter Klasse behandelt werden?
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Im Bereich der psychiatrischen, der psychologischen und der psychotherapeutischen Versorgung haben wir sicher Handlungsbedarf. Da besteht die Notwendigkeit, diese weiterzuentwickeln.
Wir haben auch im Bereich Kinderpsychiatrie Maßnahmen gesetzt, um die Versorgung zu verbessern. Wir haben aber die Schwierigkeit, dass gerade in den Regionen wenig Menschen bereit sind, Verträge mit den Kassen abzuschließen. Das ist ein Punkt, wo man Weiterentwicklung braucht und wo man daran arbeiten muss, dass die Situation verbessert wird.
Ich sage aber auch dazu, dass wir jedenfalls in den Zentralräumen eine gute Versorgung aufweisen können.
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zusatzfrage? – Bitte, Frau Abgeordnete Dr. Belakowitsch-Jenewein.
Abgeordnete Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein (FPÖ): Guten Morgen, Herr Bundesminister! Herr Bundesminister, Sie haben auf die Frage des Abgeordneten Rasinger geantwortet, es sei wichtig, die richtige Leistung am richtigen Ort zu haben. Da gebe ich Ihnen recht.
Es ist aber so, dass im Zuge der Verhandlungen über die Gesundheitsreform immer wieder durch die Medien gegeistert ist, dass es zu Standortschließungen bei den Krankenhäusern kommen wird.
Meine Frage daher: Wie viele Standortschließungen sind geplant? Welche Standorte im Speziellen sind davon betroffen?
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Vom Bundesministerium für Gesundheit und von meiner Seite aus sind keine Standortschließungen geplant. Die Planung im Bereich der Krankenanstalten ist in den Ländern vorzunehmen. Ich halte es aber trotzdem für notwendig, ständig zu überprüfen, wie die innere Organisation und der innere Aufbau von Krankenanstalten sind. Ich halte sehr viel davon, wenn es vernetzte Formen von Angeboten auch im ländlichen Raum und auch in Krankenanstalten gibt.
Ich kenne einige Krankenhäuser, die sich dieser Situation schon gestellt haben, etwa Oberndorf in Salzburg oder Wolfsberg in Kärnten. Da hat man gute Vorschläge entwickelt. In diese Richtung soll weitergearbeitet werden. (Beifall bei der SPÖ.)
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zusatzfrage? – Bitte, Herr Abgeordneter Spindelberger.
Abgeordneter Erwin Spindelberger (SPÖ): Herr Bundesminister! Zurückkommend auf die Finanzierung der Spitäler: Sie haben selbst gesagt, dass es eine Artikel-15a-Vereinbarung gibt, die im Jahre 2013 abläuft.
Wie kann das jetzt wirklich – das würde mich interessieren – vonseiten des Bundes in den Griff bekommen werden, zumal das ja Länderkompetenz ist? Jetzt nehme ich nur ein Beispiel her: Wenn der Landeshauptmann aus Niederösterreich sich rund um Wien – ob das in Baden, Neunkirchen, Mödling, Wiener Neustadt oder egal wo auch immer ist – neue Denkmäler im Spitalswesen setzt (Ruf: Hallo!), wie können wir das vom Bund aus in den Griff bekommen?
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Es gibt eine Artikel-15a-Vereinbarung, mit der festgelegt wurde – auch vom Bund aus gegenüber den Ländern –, paktierte Reformmaßnahmen zu setzen und den Österreichischen Strukturplan Gesundheit einzuhalten. Dieser wird in regionalen Strukturplänen Gesundheit umgesetzt. Da ist man in Niederösterreich noch nicht fertig. Insofern ist das ein Problem. Aber ich gehe davon aus, dass die Länder effektiv und effizient arbeiten und hier auch ihre Verantwortung wahrnehmen. Ich lade die Länder dazu ein, ein abgestimmtes Modell regional zu entwickeln. (Abg. Rädler: Gerade die Steirer!)
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Wir gelangen zur 3. Anfrage, 29/M, der Frau Abgeordneten Dr. Belakowitsch-Jenewein. – Bitte.
Abgeordnete Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein (FPÖ): Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Österreich hat eines der besten Gesundheitssysteme der Welt; das haben Sie bereits erwähnt. Dennoch ist es so, dass es in vielen Fachbereichen einen Mangel an Fachärzten gibt. Ich denke da beispielsweise an die Kinderpsychiatrie. Da gibt es einen eklatanten Mangel an Fachärzten. Aber auch in anderen Bereichen ist es so, dass Patienten oft monatelang warten müssen, bis sie einen Facharzttermin bekommen.
Daher meine Frage:
„Welche Maßnahmen werden Sie setzen, um dem Problem der Unterversorgung mit Fachärzten entgegenzuwirken und die flächendeckende Versorgung mit Fachärzten österreichweit sicherzustellen?“
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Frau Abgeordnete, wir haben in Österreich die beste Versorgung im Gesundheitswesen. Wir haben die Zahl der Fachärzte in den letzten zehn Jahren um 6,4 Prozent erhöht. Wir liegen europaweit im Spitzenfeld, was die Versorgung mit Fachärzten betrifft. Fachärzte sind in erster Linie auch in Spitälern tätig, und es ist festzuhalten, dass Österreich eine sehr hohe Spitalsdichte hat. Es gibt in Wirklichkeit kaum Menschen, die nicht in angemessener Zeit zu einer geeigneten ärztlichen Versorgung kommen können.
Was ist entscheidend bei der Frage, wo Facharztstellen eröffnet werden?
Erstens: Der erste Zugang zur ärztlichen Versorgung hat durch die Hausärzte zu erfolgen, und das ist in Österreich sehr, sehr gut gesichert. Der Hausarzt ist der erste Zugang zur Medizin.
Die Versorgung mit Fachärzten soll erfolgen nach Bevölkerungsstruktur, nach Bevölkerungsdichte, nach Verkehrsbedingungen, aber auch nach den Räumen, wo die Menschen arbeiten. Und wenn man weiß, dass viele Menschen im Zentralraum arbeiten, ist es natürlich so, dass die Gesundheitsversorgung über den Arbeitsplatz erfolgt.
Wie gesagt, wir haben in Österreich eine sehr, sehr gute Versorgung im Gesundheitsbereich. Ich habe in den angesprochenen Mängelfächern darauf hingewirkt, dass mehr Ärzte ausgebildet werden, damit auch in Zukunft die ärztliche Versorgung gesichert ist.
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zusatzfrage? – Bitte, Frau Abgeordnete Dr. Belakowitsch-Jenewein.
Abgeordnete Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein (FPÖ): Herr Bundesminister, nicht nur der Mangel an Fachärzten ist ein Problem, sondern es gibt auch verschiedene Kindertherapien, wo es einen absoluten Mangel gibt, beispielsweise bei der Ergotherapie für Kinder oder Logopädie für Kinder. Es gibt Bundesländer, wie etwa das Burgenland, Salzburg oder Kärnten, wo es keinen einzigen Logopäden mit Kassenvertrag gibt.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass es auch in diesen Bundesländern zu einer adäquaten Versorgung der Menschen kommen wird?
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Ich setze mich immer dafür ein, dass alle Menschen einen guten Zugang zu Versorgungsleistungen haben. Es muss sichergestellt werden, dass in jeder Region auch jene Leistungen angeboten
werden, die man im Erstbereich benötigt. Ich setze mich dafür ein, dass dort auch Verträge zustande kommen.
Mann muss aber die Gesamtentwicklung sehen. Ich kenne Bundesländer, die zum Beispiel Logopädie über Kindergärten durch das Land anbieten.
Wenn diese Versorgung sichergestellt wird, wird sich natürlich die niedergelassene Versorgung darauf aufbauen, und das ist auch gut. Wir brauchen eine integrierte Versorgung in allen Bereichen.
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zusatzfrage? – Bitte, Herr Abgeordneter Keck.
Abgeordneter Dietmar Keck (SPÖ): Herr Bundesminister, halten Sie es für zielführend, dass insgesamt eine größere Zahl von Vertragsarztstellen gesamtvertraglich vereinbart wird?
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Ich halte es für ein zentrales Element der Vertragsgestaltung zwischen der Ärztekammer und den Krankenversicherungsträgern, auch die Stellenpläne zu regeln. Damit hat man dort die Chance, Verantwortung für die Versorgung zu übernehmen und diese auch steuern zu können. Das ist wichtig. Man ist auch nah an den Patienten und Patientinnen, die ja die Versicherten sind. Es ist wichtig, die Verantwortung dafür übernehmen zu können, dass eine gute Versorgung vorliegt. Insofern ist es besonders wichtig, gerade im Bereich der Hausärzte, das heißt der Allgemeinmediziner, die Versorgung vor Ort sicherzustellen.
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zusatzfrage? – Bitte, Herr Abgeordneter Wöginger.
Abgeordneter August Wöginger (ÖVP): Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Wir haben in Österreich grundsätzlich eine gute ärztliche Versorgung, allerdings im Bereich der Fachärzte eine ungleichmäßige und ungerechte Verteilung derselben. Das wissen auch Sie als ehemaliger Obmann der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse. Es gibt auch einen Rechnungshofbericht dazu. Auch zahlreiche Studien belegen, dass vor allem die ländlichen Regionen zu wenige Fachärzte aufweisen.
Ein Beispiel: Mein Heimatbezirk Schärding hat vor einem Jahr nach intensivsten Bemühungen für 60 000 Einwohner einen zweiten Augenarzt erhalten. Das kann für die Zukunft keine geeignete Strategie sein.
Herr Bundesminister, was können und werden Sie dazu beitragen, die Situation vor allem für die ländliche Bevölkerung in diesem Bereich zu verbessern?
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Ich habe schon dazu beigetragen, weil sie nämlich einen zweiten Facharzt bekommen haben. Es geht darum, immer vor Ort die richtigen Bedingungen zu schaffen. Wir haben – ich habe das schon angesprochen – Verkehr und Bevölkerungsdichte als eine Grundlage zu sehen bei der Entscheidung, wo geeignete Standorte sind, und dort muss die Versorgung stattfinden.
Ich erinnere aber auch daran, dass gerade im ländlichen Raum in Oberösterreich eine sehr gute Krankenanstaltenversorgung vorliegt. Innerhalb von 20 Kilometern erreicht man die Versorgung in den Krankenanstalten. Das heißt, jederzeit kommen die Menschen zu einer ärztlichen Leistung.
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zusatzfrage? – Frau Abgeordnete Haubner, bitte.
Abgeordnete Ursula Haubner (BZÖ): Sehr geehrter Herr Bundesminister! Laut Reformpapier und auch nach Ihren jetzigen Aussagen wollen Sie die Versorgungsstruktur
mit Ärzten und Fachärzten zum Vorteil und zum Wohle der Patienten gestalten und auch reformieren. Meine spezielle Frage ist:
Wie sehen die in Ihrem Reformpapier angekündigten neuen Kündigungsbestimmungen für Ärzte aus, beziehungsweise was stellen Sie sich genau darunter vor?
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: In diesem Papier wurde zwischen Hauptverband und Ärztekammer festgelegt, dass die Frage der Kündbarkeit von Ärzten im Vertrag möglich wird. Insbesondere soll eine Altersgrenze eingeführt werden, mit deren Erreichen dann der Vertrag beendet wird, und es soll die soziale Härteklausel im Vertrag der Ärzte fallen.
Ich würde aber warnen, die Vertragskündigung überzubewerten. Viel wichtiger für die Versorgung ist es, dass die Ärztinnen und Ärzte bereit sind, den gemeinsamen Weg zu gehen, integrierte Versorgung tagtäglich mitzutragen.
Das Wichtigste dieses Papiers ist, dass die Ärzteschaft Ja dazu gesagt hat und bereit ist, im Dialog gute Ergebnisse für die Versorgung der Menschen zustande zu bringen.
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zusatzfrage? – Herr Abgeordneter Dr. Grünewald, bitte.
Abgeordneter Dr. Kurt Grünewald (Grüne): Sehr geehrter Herr Bundesminister! In Gesamtwestösterreich gibt es keine niedergelassenen Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie. WHO und EU fordern seit Langem in diesem Bereich intensive nationale Programme. Mann kann Gesundheitspolitik sowohl emotional wie auch ökonomisch betrachten. Betrachten wir sie nur ökonomisch, entstehen durch Nichtdiagnosen bei Kindern, durch zu späte Diagnosen und Behandlungen chronische Erkrankungen, die massive Kosten verursachen, dem Kind Schwierigkeiten in der Schule bringen und vieles andere mehr. Auch der Rechnungshof kritisiert das massiv.
Welche Initiativen wollen Sie setzen, um Anreizsysteme zu schaffen, Kassenstellen aufzumachen und Ausbildungslücken auf diesem Gebiet schneller zu schließen als bisher?
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Das Problem in der Kinderpsychiatrie liegt nicht bei den Kassenstellen, sondern bei dem Umstand, dass die Ausbildungsdauer in diesem Fach sehr, sehr lang ist, dass wenige Ärztinnen und Ärzte bereit sind, in dieses Fach zu gehen, und dass sie keine Chance zur Ausbildung haben.
Wir haben durch die gesetzliche Änderung im Rahmen der 12. Ärztegesetz-Novelle dafür gesorgt, dass in diesem Fach mehr Ausbildungsplätze geschaffen werden. Das ist ein Schritt, mit dem wir in diesem Bereich Verbesserungen zustande bringen wollen.
Insgesamt gehören im Bereich der Behandlung von Kindern, vor allem in der Kinderpsychiatrie, die Maßnahmen verstärkt, und ich habe ständig ein Auge darauf.
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Nun gelangen wir zur 4. Anfrage, 35/M, des Herrn Abgeordneten Dr. Spadiut. – Bitte.
Abgeordneter Dr. Wolfgang Spadiut (BZÖ): Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Meine Frage lautet:
„Das Gesundheitsreformpapier, das Ihnen von den Krankenkassen und den Ärzten übergeben wurde, fordert von Ihnen wörtlich ‚ein rasches Handeln und tief greifende
Reformen‘, um das mehr als sanierungsbedürftige österreichische Gesundheitssystem an die heutigen Anforderungen anzupassen. Wie sollen diese ‚tief greifenden Reformen‘ jemals umgesetzt werden, wenn bereits zu diesem wenig ehrgeizigen Vorschlag zwischen Ihnen und Ihrem Koalitionspartner ‚Stillstand‘ herrscht, und das, obwohl die ersten Maßnahmen bereits in diesem Herbst im Parlament verabschiedet werden müssten?“
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Herr Abgeordneter Spadiut, ich habe dieses Reformpapier gelesen, und ich habe diesen Satz in dem Papier, das mir übergeben worden ist, nicht wörtlich gefunden. Diese Sätze stehen nicht drinnen.
Zweitens: Was redet man hier von „Stillstand“? Dieses Papier ist ein sehr ehrgeiziges Papier, Einsparungspotenziale zustande zu bringen. Das Allerwichtigste in dem Papier ist, dass man bereit ist, einen gemeinsamen Weg zwischen Ärztinnen und Ärzten und den Krankenversicherungsträgern zu gehen, Versorgung vor Ort anzubieten und Reform am Patienten, an der Patientin zu machen.
Dazu brauchen wir die Ärztinnen und Ärzte. Ich bedanke mich bei der Ärztekammer, dass sie diese Bereitschaft gezeigt hat, die richtige Versorgung zu diskutieren, sie öffentlich zu machen, dass sie bereit ist, die Qualitäten zu erhöhen, sich auseinanderzusetzen mit der Qualität der medizinischen Versorgung konkret in der Praxis, wie sie beim Menschen ankommt, damit wir die gute Versorgung haben und damit diese auch weiterentwickelt wird.
Das ist ein ehrgeiziges Projekt, und es ist an der Zeit, dass wir die dafür vorgesehenen Mittel auch freigeben. (Beifall bei der SPÖ.)
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zusatzfrage? – Bitte, Herr Abgeordneter Dr. Spadiut.
Abgeordneter Dr. Wolfgang Spadiut (BZÖ): Herr Minister, die Kassen stehen laut Ihrem Reformpapier vor dem finanziellen Kollaps, und Sie haben weitere finanzielle Zuschüsse an Reformen geknüpft.
Wie viele Steuermittel sollen 2009 auch ohne Reformerfolg an die maroden Krankenkassen ausgeschüttet werden?
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Es gibt bereits einen Reformerfolg. Wir haben – ich habe es schon angekündigt – einvernehmlich die Arbeit zur E-Medikation gemacht. Es gibt auch eine Weiterentwicklung.
Wie viel Geld ist ausgeschüttet worden? – 45 Millionen € haben wir mit dem Budgetbegleitgesetz als kurzfristige Überbrückungshilfe gewährt. Wir haben sicherstellen können, dass auch Geld aus der Mehrwertsteuerabdeckung kommt. Das heißt, insgesamt wurden hier entsprechende Gelder verteilt. Es sind 97 Millionen € aus der Mehrwertsteuerrückvergütung, die jene Kassen bekommen, die negatives Eigenkapital haben.
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zusatzfrage? – Bitte, Herr Abgeordneter Dr. Grünewald.
Abgeordneter Dr. Kurt Grünewald (Grüne): Herr Bundesminister! Zum kostenintensivsten Faktor des Gesundheitswesens gehören die Krankenanstalten. Hier bleibt das Reformpapier auffallend schüchtern und vage. Ich zitiere nur, was zum Verantwortungsbereich der Länder im Reformpapier steht: Abstimmungen mit VertreterInnen der Bundesländer werden in Aussicht genommen.
Herr Bundesminister, Sie leiten kein Ministerium „Zur guten Aussicht“, sondern das Gesundheitsressort.
Daher: Wie können Sie den Ländern beibringen, dass es neben den Bundesländern auch eine Republik gibt und ein Gesundheitswesen, wo Sie auch Einfluss auf Krankenanstalten haben müssen?
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Der Auftrag an das Papier war ja, den niedergelassenen Bereich zu bearbeiten und nicht die Krankenanstalten.
Welche Möglichkeiten hat der Bundesgesundheitsminister, hier tätig zu werden? – Der Minister hat die Verfassung ernst zu nehmen, und die Verfassung sieht vor, dass es Aufgabe der Länder ist, die Krankenanstalten zu steuern und auch zu planen. Wir haben im Rahmen der 15a-Vereinbarung unsere Mitwirkung sichergestellt, und wir haben im Rahmen der Bundesgesundheitsagentur, der Bundesgesundheitskommission dazu beigetragen, dass es eine Weiterentwicklung gibt. Der Bundesstrukturplan Gesundheit ist ein Thema, wo wir handeln, und wir wollen die nächsten Schritte gehen, die ich heute bereits erwähnt habe.
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zusatzfrage? – Bitte, Herr Abgeordneter Ing. Hofer.
Abgeordneter Ing. Norbert Hofer (FPÖ): Sehr geehrter Herr Bundesminister, es gibt in Österreich reiche und arme Kassen. Das liegt oft nicht nur am Management, sondern auch an der demographischen Struktur im jeweiligen Bundesland.
Was kann man tun, damit es zu einem gerechten Ausgleich, zu einer gerechten Finanzierung der Kassen kommt?
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Wir brauchen in Österreich, wenn man dezentrale Strukturen will – und ich will das –, einen Ausgleich zwischen den Kassen. Wir brauchen aber auch eines: Die Unterfinanzierung, die der Rechnungshof festgehalten hat und die insbesondere von Bundesregierungen vor unserer Zeit gekommen ist, muss beseitigt werden. Insbesondere Bundesminister Grasser hat einen Feldzug gegen die Krankenkassen gestartet. Dieses Geld, das damals entzogen worden ist, muss wieder zurückfließen, damit dieser Ausgleich und diese Finanzierung auch sichergestellt werden können.
Wichtig ist auch, dass es einen solidarischen Ausgleich von Strukturunterschieden durch den Ausgleichsfonds und den Kassenstrukturfonds gibt. (Beifall bei der SPÖ.)
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zusatzfrage? – Bitte, Herr Abgeordneter Haberzettl.
Abgeordneter Wilhelm Haberzettl (SPÖ): Geschätzter Herr Bundesminister, das derzeit diskutierte Sanierungskonzept bildet an und für sich die Grundlage für die Etablierung des Kassenstrukturfonds sowie die Teilentschuldung durch das Bundesgesetz betreffend den Verzicht auf Bundesforderungen gegenüber Gebietskrankenkassen.
Sehen Sie durch diese indirekte Zuführung von Bundesmitteln eher eine Entwicklung in Richtung Verstaatlichung des Gesundheitssystems?
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Nein. Ich bin kein Freund eines staatlichen Gesundheitssystems. Wer die Zahlen kennt, weiß: Dort, wo man selbstverwaltete Gesundheitssysteme hat, dort kann man zwei Dinge am besten tun,
nämlich gute Sachleistungen für die Menschen sicherstellen – das ist das eine Wichtige –, und man schafft es besser – das ist das Zweite –, mit dem Geld auszukommen und das Geld auch richtig einzusetzen. Die Selbstverwaltung garantiert das in einem höheren Ausmaß als staatliche Bürokratie.
Insofern muss man aber auch Beiträge leisten, dass dieses System atmen kann. Mit dem Beitrag, den Feldzug früherer Finanzminister auszugleichen und das Geld zurückzugeben, gibt man Luft zum Atmen für eine gute Gesundheitsversorgung in ganz Österreich. (Beifall bei der SPÖ.)
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zusatzfrage? – Bitte, Frau Abgeordnete Dr. Karl.
Abgeordnete Mag. Dr. Beatrix Karl (ÖVP): Sehr geehrter Herr Bundesminister, Sie haben bereits mehrfach betont, dass wir in Österreich das beste Gesundheitssystem der Welt haben. Unser Gesundheitssystem leidet aber darunter, dass die Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Krankenversicherung zersplittert sind. Dies bedeutet eine Vielzahl von unübersichtlichen Finanzierungsströmen und eine weitgehend unkoordinierte Planung der Leistungserbringung.
Wir wollen für die Bürgerinnen und Bürger aber ein Gesundheitssystem, das auch im Hinblick auf Effizienz und Transparenz zu den besten zählt. Wie wollen Sie ein einheitliches Gesundheitssystem sicherstellen, das diesen Anforderungen gerecht wird?
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Grundsätzlich habe ich die Verfassung ernst zu nehmen und auch einzuhalten. (Abg. Strache: Was heißt „grundsätzlich“?), und hier gibt es durchaus noch Grenzen und Zuständigkeiten der Länder. Die zu beachten, ist eine Aufgabe eines Ministers.
Wir haben aber ganz konkrete gemeinsame Planungen in der Bundesgesundheitskommission – der Österreichische Strukturplan Gesundheit sieht das vor –, und ich denke, dass es notwendig ist, diesen Planungsbereich zu intensivieren. Wir haben auch – ich habe es schon gesagt – die Transparenz erhöht durch einen einstimmigen Beschluss in der Bundesgesundheitskommission, womit Transparenz über das Leistungsgeschehen und über das Finanzgeschehen auf der Ebene der Krankenhäuser eingeführt und verbessert wird.
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Wir gelangen nun zur Anfrage 34/M des Herrn Abgeordneten Dr. Grünewald. – Bitte.
Abgeordneter Dr. Kurt Grünewald (Grüne): Herr Bundesminister, wir stehen vor einer skurrilen Situation: Der ehemalige ÖVP-Abgeordnete Schelling verhandelt für den Hauptverband mit dem Präsidenten der Ärztekammer, auch ÖVP-Mann und im Proponentenkomitee einer Nationalratswahl, ein Reformpapier, und der ÖVP-Mann und Vizekanzler Finanzminister Pröll sagt: Mit uns nicht!
Herr Bundesminister, wie beurteilen Sie das Reformpapier angesichts dieser Reaktion des Finanzministers? Und konkret:
„Wie beurteilen Sie die zwischen Hauptverband und Österreichischer Ärztekammer vereinbarten Sparmaßnahmen, die auch Entlastungen der Kassen von kassenfremden Leistungen beinhalten, angesichts der Kritik des Herrn Vizekanzlers?“
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Grundsätzlich hat dieses Papier den Auftrag gehabt, ein Sanierungspapier für ausgabenseitige Maßnahmen vorzustellen. Der Hauptverband und die Ärztekammer haben gemeinsam darüber hinausgehende Aufgaben geleistet. Sie haben Vorschläge erarbeitet, wie zusätzliche Mittel aufgebracht werden können, und haben Rezeptgebührenobergrenze, haben die Finanzierung der Bundesgesundheitskommission angesprochen, wo Gegenfinanzierungen, die versprochen worden sind, von früheren Bundesregierungen nicht eingehalten worden sind. Diese Forderungen sind nachvollziehbar, sie sind auch in ihrer Höhe konkret beziffert und auch verständlich.
Ein Finanzminister hat natürlich die Gesamtfinanzen des Staates im Auge zu behalten, aber er hat auch formuliert, dass dieses Papier sehr viele positive Ansätze hat, und ich gehe davon aus, dass man in zwei wichtigen Schritten weitergehen kann:
Erstens jenen Teil des Papiers zu übernehmen, der überall auch akzeptiert ist. Da geht es um das ausgabenseitige Einsparungspotential.
Zweitens wird es notwendig sein, in Verhandlungen sicherzustellen, dass man über diese Gelder, die der Hauptverband benannt hat, auch verhandelt, auch mit dem Finanzminister verhandelt. Das wird jedenfalls beim Budget 2011 notwendig sein.
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zusatzfrage? – Bitte, Herr Abgeordneter Dr. Grünewald.
Abgeordneter Dr. Kurt Grünewald (Grüne): Herr Bundesminister, es ist wieder seltsam, dass die Politik den Kassen sehr wohl vorschreibt, dass sie eine Versorgung nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft zu gewährleisten haben, zweitens schreibt die Politik den Kassen vor, über welche Einnahmen sie zu verfügen haben, und schreit dann „Hilfe!“, wenn beides nicht zusammengeht.
Welche Methoden der Bewusstseinserweiterung stehen Ihnen beim Herrn Finanzminister zur Verfügung, damit er erkennt, dass er auch als Leiter des Finanzministeriums Verantwortung trägt, dass gesetzlich an die Kassen übertragene Aufgaben auch zu erfüllen sind?
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Ich werde mit allen Ministern, die das nicht so sehen, durchaus diskutieren und auch sehr, sehr deutlich machen, dass es notwendig ist, die Gesundheitsversorgung der Menschen zu sichern. Ich stehe zu guter Gesundheitsversorgung für die Menschen – auch in der Krise. Das werde ich auch laut und deutlich gegenüber allen in der Bundesregierung sagen, und da wird es auch eine Auseinandersetzung darüber geben.
Ich will gute Versorgung, und das Gesundheitssystem ist auch ein Stabilisator in der Wirtschaft. Wir haben viele Arbeitsplätze. Die Menschen können sich darauf verlassen, dass gute Versorgung auch in der Zukunft stattfindet. Und das wird jeder Minister dieser Republik einsehen. (Beifall bei der SPÖ.)
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zusatzfrage? – Bitte, Herr Abgeordneter Dr. Karlsböck.
Abgeordneter Dr. Andreas Karlsböck (FPÖ): Herr Minister! Für Herrn Vizekanzler Pröll sind die Einsparungen beim Sanierungspaket nicht hoch genug, und einzelne Punkte im Paket verursachen angeblich zu hohe Mehrkosten, deswegen werden die Gelder momentan blockiert.
Jetzt hört man, dass vor allem beim Großgeräteplan gespart und gekürzt werden soll. Unter Großgeräten versteht man diagnostische Geräte wie zum Beispiel die Magnet-
resonanz oder CTs. Rasche Diagnose ist aber eine wichtige Voraussetzung für eine rasche und kostendämpfende Therapie. Sie ist nicht zuletzt auch deshalb wichtig, um einen angsterfüllten Patienten möglichst rasch von der Ungewissheit über die Ursache seiner Beschwerden zu erlösen.
Können Sie garantieren, Herr Minister, dass bei knapper werdenden Mitteln die österreichischen Patienten weiterhin rasch zu ihrer Diagnose kommen und es hier zu keinen Einsparungen kommen wird?
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Bevor ich den Herrn Bundesminister um die Antwort ersuche, möchte ich noch einmal in Erinnerung rufen: Der nächstfolgende Redner bitte gleich zum freien Rednerpult! – Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Wir wollen effizient sein, aber nicht jede Krankheit braucht Großgeräte zur Diagnostik. Gute Ärztinnen und Ärzte können ihre Diagnosen auch anders erstellen.
Wir müssen zwei Dinge sicherstellen: Die richtige Leistung bei der richtigen Krankheit. Dafür müssen wir Großgeräte zur Verfügung haben. Wir haben in Österreich, international gesehen, eine viel zu hohe Gerätedichte. Die muss richtig einsetzt werden, sie muss auch im stationären Bereich eingesetzt werden, da muss man auch Vernetzungen zustande bringen. Wir sollten das Geld aber nicht in die Geräte investieren, wir müssen das Geld in die Versorgung der Menschen, in die ärztliche Versorgung investieren.
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zusatzfrage? – Bitte, Herr Abgeordneter Hechtl.
Abgeordneter Johann Hechtl (SPÖ): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Herr Bundesminister, meine Zusatzfrage: Ist aus Ihrer Sicht, Herr Bundesminister, die Forderung nach einer vollen Abdeckung der Aufwendungen, die sich bei den Krankenversicherungsträgern durch die Einführung der Rezeptgebührenobergrenze ergeben, berechtigt?
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Aus meiner Sicht ja. Die Forderung der Rezeptgebührenobergrenze war eine sozialpolitische Wohltat, die wichtig war. Sie kostet die Sozialversicherungsträger insgesamt an die 80 Millionen € – 78, haben wir berechnet –, und der Ersatz für diese Maßnahme liegt bei in etwa 38, 40 Millionen €. Da ist ein Mehrbedarf entstanden, und dieser sollte – da hat der Hauptverband recht – auch den Kassen zugeführt werden.
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zusatzfrage? – Bitte, Frau Abgeordnete Höllerer.
Abgeordnete Anna Höllerer (ÖVP): Herr Bundesminister, der Auftrag der Regierung an die Verhandler des Sanierungspakets der Krankenversicherungsträger in diesem Jänner war sehr klar und sehr deutlich, und sehr einfach formuliert hieß es eigentlich: Sparen, sparen, sparen!, sonst werden die sanierungsbedürftigen Kassen nicht mit Steuergeld konsolidiert.
Jetzt, ein halbes Jahr später, liegt das Papier vor. Die Ärztekammer und der Hauptverband haben verhandelt, und abgesehen von Änderungen bei den Nachbesetzungen von Arztstellen und im Honorarrecht zielen die meisten Sparmaßnahmen auf die Ausgaben für Medikamente ab. Weiters wird die bessere Abgeltung von kassenfremden Leistungen verlangt, also es wird verlangt, mehr Geld aus dem Steuertopf in das System einzubringen. Der Rechnungshofbericht sagt, dass kassenfremde Leistungen abzugelten sind.
Wo, Herr Bundesminister, sehen Sie die Möglichkeiten, in Ihrem Ressort, in Ihrem Budget kassenfremde Leistungen abzugelten?
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Grundsätzlich geht es darum, dass der Rechnungshof sehr deutlich gemacht hat, dass durch Veränderungen der Zahlungsströme von der sozialen Krankenversicherung hin ins Finanzamt die Schulden entstanden sind. Dort ist Geld entzogen worden.
Insofern ist es auch notwendig, dass man aus dem gesamten Staatshaushalt hier reagiert, und die Maßnahmen, die wir im Budgetbegleitgesetz gesetzt haben, gehen in diese Richtung, nämlich Entschuldung der Krankenkassen in drei Schritten mit jeweils 150 Millionen €, mit der Überdeckung der Mehrwertsteuervergütung, damit, dass man den Katastrophenfonds im Ausgleichsfonds aufgelöst hat. Da sind viele Maßnahmen gesetzt worden, die den Kassen dienen, die ein negatives Eigenkapital haben. (Beifall bei der SPÖ.)
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zusatzfrage? – Bitte, Herr Abgeordneter Linder.
Abgeordneter Maximilian Linder (BZÖ): Herr Bundesminister, mit welchen Mitteln wollen Sie die kassenfremden Leistungen, zum Beispiel Wochengeld, Krankengeld von Arbeitslosen oder die Zins- und Zinseszinszahlungen zur Schuldenabdeckung finanzieren?
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Wenn man die Schulden abdeckt, braucht man keine Zinsen und Zinseszinsen zu zahlen. Insofern haben wir klare Schritte gesetzt. Das Budgetbegleitgesetz regelt die Entschuldung der Gebietskrankenkassen klar mit 450 Millionen €. Wir haben insgesamt mehr als 730 Millionen € in zwei Jahren zur Verfügung gestellt. Diese Mittel werden da sein, und wir werden beim Budget 2011 die weiteren Schritte setzen müssen.
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Wir gelangen zur 6. Anfrage, 27/M, des Herrn Abgeordneten Mag. Maier. – Bitte.
Abgeordneter Mag. Johann Maier (SPÖ): Einen recht schönen, guten Morgen! Herr Bundesminister! Lebensmittelsicherheit ist ein zentrales konsumentenpolitisches Thema. Niemand will eine Lebensmittelvergiftung erleiden und zum Beispiel von Salmonellen befallen werden.
Die Agentur für Ernährungssicherheit ist für Analysen und für Risikobewertung in Österreich zuständig.
Meine konkrete Frage daher:
„Wie gedenken Sie, die langfristige finanzielle Absicherung der AGES sicherzustellen, damit die Ernährungs‑ und Gesundheitssicherheit der ÖsterreicherInnen auf hohem Niveau erhalten bleibt, der Standort Österreich attraktiv bleibt und das Verbrauchervertrauen in die Lebensmittel- und Arzneimittelkontrolle keinen Schaden erleidet?“
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Ich bin seit 2. Dezember 2008 Bundesminister für Gesundheit und damit auch Miteigentümer dieser Agentur für Lebensmittel- und Arzneimittelkontrolle. Die AGES hat eine wichtige Funktion, gerade
hinsichtlich der Ernährungs- und Gesundheitssicherheit. Letztere brauchen wir jeden Tag. Gerade bei der neuen Grippe und im Hinblick auf Medikamente merken wir das.
Aber auch die Landwirtschaft merkt das, wenn es darum geht, die guten österreichischen Produkte auch im Ausland zu verkaufen. Andere Länder wollen Sicherheit haben, dass die Produkte, die wir erzeugen, gut sind. Das ist die Funktion der AGES, und ich habe mich bei allen Verhandlungen dafür ausgesprochen, dass wir die Finanzierung der AGES verbessern und sichern.
Ich habe sie mit einer klaren Unterfinanzierung übernommen; meine Vorgänger haben das auch klar erkannt. Ich habe bei den Budgetverhandlungen um mehr Geld gestritten und gerungen. Wir werden nicht auskommen, ohne dass auch Dritte, die Leistungen der AGES in Anspruch nehmen, diese auch von ihrer Seite finanzieren.
Die Wirtschaft hat Interesse daran, gute Lebensmittel in Österreich zu haben und diese auch exportieren zu können, und aus dieser Sicht muss die AGES abgesichert werden. Ich sage in diesem Zusammenhang ganz deutlich: Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat die Aufgabe, hier auch Bewegung hineinzubringen. Dort ist man derzeit stur und will nichts tun, aber da ist Handlungsbedarf gegeben. (Abg. Dr. Pirklhuber: Ach so ist das!)
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zusatzfrage? – Bitte, Herr Abgeordneter Mag. Maier.
Abgeordneter Mag. Johann Maier (SPÖ): Herr Bundesminister, meine Zusatzfrage: Sie sind gemeinsam mit dem Landwirtschaftsministerium Miteigentümer. Wie teilen sich eigentlich die Kosten der AGES auf die beiden Bundesministerien auf?
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Die AGES gehört zu 50 Prozent dem Gesundheitsministerium und zu 50 Prozent dem Landwirtschaftsministerium.
Die Kostenstruktur ist umgekehrt. Wir finanzieren
60 Prozent und die Landwirtschaft finanziert 40 Prozent der
Leistungen. Auf der Einnahmenseite, also dort, wo Beiträ-
ge erwirtschaftet werden, ist der Anteil, der hereinkommt, gerade bei der AGES
PharmMed wesentlich höher als diese 60 Prozent, und im
Landwirtschaftsbereich ist der Anteil niedriger. Das heißt, im
Landwirtschaftsbereich sind zusätzliche Gelder aufzustellen, und es
ist notwendig, dass die AGES im Interesse der österreichischen Gesundheits-
und Ernährungssicherheit gesichert ist. (Beifall bei der
SPÖ.)
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Weitere Zusatzfrage? – Bitte, Herr Abgeordneter Eßl.
Abgeordneter Franz Eßl (ÖVP): Sehr geehrter Herr Bundesminister! Zweifelsohne ist uns Lebensmittelsicherheit wichtig. Wenn allerdings Bayern mit 10 Millionen Einwohnern zwei Lebensmittelinstitute hat und die AGES in Österreich für 8 Millionen Einwohner auf sechs Standorten 43 Institute und Analytikkompetenzzentren betreibt, dann stellt sich eine gewisse Unverhältnismäßigkeit dar.
Die Leistungen sind unbestritten, aber die Finanzierung ist, wie Sie schon selbst gesagt haben, nicht gesichert. Es fehlen für das nächste Jahr 30 Millionen.
Meine konkrete Frage: Wollen Sie diese Strukturen aufrechterhalten, und – wenn ja – welche Bevölkerungsgruppe werden Sie ganz konkret einladen, um nicht zu sagen: belasten, um diese Finanzierung zu übernehmen?
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Aus meiner Sicht ist die AGES in ihrer Struktur sehr gut aufgestellt. Sie hat international einen hervorragenden Ruf. Wir werden weltweit mit der AGES gut gesehen. Das Management hat den ständigen Auftrag, die internen Strukturen zu verbessern.
Auf die Frage, welche Personengruppen ihren Beitrag zahlen sollen, sage ich ganz einfach: Diejenigen, die einen Nutzen davon haben! (Zwischenruf der Abg. Silhavy.) Zu mir kommt nächste Woche ein Minister aus dem Ausland, der sich die AGES ansehen möchte, weil österreichische Landwirte Produkte in dieses Land liefern wollen und man dort eine gute Qualitätssicherung braucht. Das bietet die AGES, und da kann es von Großbauern und Exporteuren auch Beiträge geben. (Beifall bei der SPÖ.)
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Weitere Zusatzfrage? – Bitte, Herr Abgeordneter Huber.
Abgeordneter Gerhard Huber (BZÖ): Sehr geehrte Frau Präsident! Herr Bundesminister! Die AGES ist ein Sanierungsfall, den die ÖVP an Sie vererbt hat. Mich wundert, dass Sie als SPÖ-Minister dieses Erbe angetreten haben!
Mich würde jetzt interessieren – und ich bitte, sich nicht auf Lippenbekenntnisse zu beschränken! –, welche konkreten Maßnahmen Sie jetzt setzen werden, damit man die AGES sanieren kann und damit kein größerer Schaden entsteht. (Abg. Dr. Moser: Das haben wir ja vorausgesagt!)
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Die AGES ist kein Sanierungsfall. Die AGES ist unterfinanziert. Das ist ein Unterschied! Die AGES ist ein gutes Unternehmen, das in seiner Struktur gute Leistungen liefert. Es ist sicherzustellen, dass die AGES finanziert wird. Ich kämpfe beziehungsweise raufe darum, und ich werde sicherlich auch das Parlament in diesem Zusammenhang um Hilfe bitten.
Derzeit mauert das Landwirtschaftsministerium, wie ich schon gesagt habe, ich bin aber überzeugt davon, dass wir auch hier Schritte in der Weiterentwicklung zustande bringen werden.
Derzeit hat der Aufsichtsrat der Geschäftsführung den Auftrag erteilt, Sanierungskonzepte oder Finanzierungskonzepte zu erarbeiten. Dazu bekommen wir im September weitere Daten. Aber es führt kein Weg vorbei: Wir brauchen dort Geld. (Beifall bei der SPÖ.)
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Weitere Zusatzfrage? – Bitte, Herr Abgeordneter Dr. Pirklhuber.
Abgeordneter Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber (Grüne): Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Die Grünen haben schon 2003 klargemacht, dass das Finanzkonzept für die AGES scheitern wird. Jetzt ist das Faktum.
Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit ist auch für Lebensmittel zuständig. Die Konsumenten wünschen Wahlfreiheit, und diese Wahlfreiheit ist nur möglich, wenn die Lebensmittelkennzeichnungsmängel, im Konkreten bei der Herkunfts‑ und Ursprungsbezeichnung, endlich abgestellt werden. Wo Österreich draufsteht, muss auch Österreich drin sein.
Lebensmittel, die aus Produkten von Tieren bestehen, die mit Gentechnikfutter gefüttert werden, sind derzeit auf europäischer Ebene nicht kennzeichnungspflichtig.
Meine Frage an Sie, Herr Bundesminister: Welche Aktivitäten werden Sie auf EU-Ebene setzen, um diesen Mangel zu beheben, und welche Maßnahmen haben Sie in Österreich vorgesehen, um die Lebensmittelkennzeichnung im Sinne des KonsumentInnenschutzes zu verbessern?
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Ich habe mich mehrmals damit auseinandergesetzt, wie wir sicherstellen können, dass das, was außen draufsteht, auch innen drin ist. Dazu brauche ich die AGES, die das auch kontrolliert. Insofern ist es mir wichtig, dass die AGES funktionsfähig ist.
Wir haben auf Ebene der Europäischen Union eine Diskussion in der Frage Gentechnik und Verbraucherinformation geführt. Es gibt jetzt Schritte in diese Richtung, insbesondere mit der Novel-Food-Verordnung, die neu gestaltet werden wird. Auch diesbezüglich haben wir die nächsten Schritte gesetzt. Insgesamt muss sicher sein, dass Informationen an Konsumenten erfolgen.
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Weitere Zusatzfrage? – Bitte, Herr Abgeordneter Zanger.
Abgeordneter Wolfgang Zanger (FPÖ): Herr Bundesminister! In Anbetracht von Kunstkäse, Klonfleisch und jetzt auch noch Schummelschinken vergeht den Österreichern schön langsam der Appetit, weil sie nicht wissen, was sie auf die Teller bekommen. (Zwischenruf des Abg. Öllinger.)
Die Freiheitliche Partei hat, vor allem was Kunstkäse anlangt, die Initiative ergriffen, um eine Kennzeichnung herbeizuführen. Das ist im Rahmen eines Fünf-Parteien-Antrages gelungen, und wir werden jetzt eine ähnliche Initiative betreffend Schummelschinken ergreifen.
Meine konkrete Frage zum Thema Klon-Fleisch: Werden Sie sich auf europäischer Ebene dafür einsetzen, dass Klon-Fleisch in Europa nicht zugelassen wird?
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Grundsätzlich ist Klon-Fleisch zu kennzeichnen. Es wird in Europa übrigens derzeit nicht verkauft. Derzeit werden nur Zuchttiere geklont, nicht aber die Kinder dieser Zuchttiere, und es soll auch klargestellt werden, dass diese zu kennzeichnen sind. Das ist ein Beitrag, den wir leisten müssten, und für diesen Vorschlag wird sich die österreichische Bundesregierung verwenden. Es soll sichergestellt werden, dass die Konsumenten auch wissen, dass es sich um Fleisch handelt, das von geklonten Tieren in der zweiten Generation kommt.
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Wir gelangen zur Anfrage 33/M des Herrn Abgeordneten Donabauer. – Bitte.
Abgeordneter Karl Donabauer (ÖVP): Frau Präsident! Herr Bundesminister! Es ist eine Kernaufgabe der Staatspolitik und somit von uns allen, unser Gesundheitssystem finanziell nachhaltig abzusichern. Wir müssen allerdings auf die Veränderungen in der Gesellschaft und auf die angespannte Finanzsituation der Gebietskrankenkassen Rücksicht nehmen. Das erfordert neues Denken und neue Strategien, damit wir überhaupt diesen Status halten können. Und Veränderungen in einem dermaßen komplexen System erfordern, wie Sie selbst sagen, totalen Einsatz.
Herr Bundesminister, meine Frage lautet konkret:
„Wie beurteilen Sie die Vorschläge des Hauptverbandes zur Reform der Krankenkassen im Hinblick auf die Vereinbarung bei der Regierungsklausur in Sillian, die eine nachhaltige Kostendämpfung vorsieht?“
Und: Halten Sie diese Vorschläge überhaupt für umsetzbar?
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Frau Präsidentin! Herr Abgeordneter! Ich halte diese Vorschläge grundsätzlich für sehr positiv. Sie sind ambitioniert. Die Vertragspartner haben sich sehr mit den Themen auseinandergesetzt, die die Menschen berühren und bei denen es um ein Einsparungs- beziehungsweise Kostendämpfungspotential geht.
Die Probleme wurden auf den Tisch gelegt. Es wurde ein Kriterienkatalog für Honorarabschlüsse verfasst. Und es gibt ein Ökonomiegebot, welches aus meiner Sicht ganz entscheidend ist. Es wurde festgelegt, dass der Arzt oder die Ärztin nicht nur für den medizinischen Prozess Verantwortung übernimmt, sondern auch dafür, dass man mit den Kosten auskommt und das Sinnvolle tut und das nicht Sinnvolle nicht tut. Neue Gesellschaftsformen sollen ermöglicht und die Kooperation von Ärztinnen und Ärzten verbessert werden. Man hat sich mit Fragen der Öffnungszeiten von Arztpraxen und der Verbesserung der Qualität der medizinischen Versorgung auseinandergesetzt.
Für mich ist es ein ganz zentrales Element, die Versorgung der Menschen noch zu verbessern. Wir haben ein gutes System, und die Vertragspartner sind bereit, dieses System noch weiter zu verbessern. Wir haben außerdem sichergestellt, dass es durch Vertragspartner-Controlling einen Ausgleich gibt und man von den Besten im System lernen kann.
Die Ärztinnen und Ärzte sind bereit, die E-Medikation mitzutragen, sie sind bereit, die e-card zu nutzen und auch zu überprüfen, und sie sind auch bereit, nächste Schritte im Zusammenhang mit der elektronischen Gesundheitsakte zu gehen. Das halte ich für gut. Und auch betreffend den Bereich der Rezeptgebühren und Heilmittel sind gute Vorschläge enthalten.
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zusatzfrage? – Bitte, Herr Abgeordneter Donabauer.
Abgeordneter Karl Donabauer (ÖVP): Herr Bundesminister, wir haben eine Verwaltungskostenbegrenzung, und diese endet 2011.
Planen Sie, diese fortzuführen, und welche Überlegungen haben Sie betreffend IT-Bereich angestellt, der uns enorm viel Geld kostet?
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Es ist notwendig, dass man im IT-Bereich, der zu den Aufgaben der einzelnen Träger gehört, Synergien nutzt. Es gibt derzeit Maßnahmen im Hauptverband, die Rechenzentren zusammenzulegen und zu optimieren und dafür zu sorgen, dass auch einzelne Standardprodukte nur einmal entwickelt werden. Da hat man Tolles schon geleistet, und da wird man auch in Zukunft Tolles leisten.
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Weitere Zusatzfrage? – Bitte, Herr Abgeordneter Windholz.
Abgeordneter Ernest Windholz (BZÖ): Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Die Krankenkassen benötigen Steuergeld zur Sanierung. Die geplanten Reformen liegen jetzt zumindest zum Teil schon vor.
Meine konkrete Frage: Wie hoch müssen die seriös darstellbaren Einsparungen liegen, damit Sie solche Steuermittel zur Verfügung stellen?
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Steuermittel zur Verfügung zu stellen heißt nicht, irgendwelche Karotten in den Raum zu hängen, sondern wir
müssen Steuermittel zur Verfügung stellen, damit die Menschen unseres Landes die beste Versorgung haben; die Österreicherinnen und Österreicher verdienen beste Versorgung.
Wenn es die Feldzüge gegen die Krankenkassen nicht gegeben hätte, dann hätte man jetzt keine Finanzierungsprobleme. Diese gab es aber, und jetzt geht es darum, die Steuermittel, die man damals entzogen hat, wieder zurückzuführen. Das kann man jetzt tun. Und es ist immer Aufgabe von Krankenversicherungsträgern, zu optimieren, Kostendämpfungspotentiale zu finden.
Das hat man bei diesem Papier gemacht, und das ist auch schlüssig. (Beifall bei der SPÖ.)
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Weitere Zusatzfrage? – Bitte, Herr Abgeordneter Öllinger.
Abgeordneter Karl Öllinger (Grüne): Herr Bundesminister, ich möchte jetzt dem Gebärdendolmetscher zuschauen, wie er die Begriffe dolmetscht, die den Zuschauern und Zuhörern wahrscheinlich noch weniger sagen als unsereinem. All das sind Begriffe, die mit den Finanzen im Gesundheitssystem zu tun haben, und sie sind heute schon einmal gefallen: Krankenversicherungsträger, Ausgleichsfonds, Katastrophenfonds – wunderbar! –, Kassenstrukturfonds – Wahnsinn (mit Blick auf den Gebärdendolmetscher), das verstehe ich auch! –, Bundesgesundheitskommission, Gesundheitsplattform, Gesundheitsagentur, Hauptverband; all das sind Gremien, die mit der Finanzierung im Gesundheitssystem zu tun haben. (Zwischenrufe beim BZÖ.) Ein jeder ...
Präsidentin Mag. Barbara Prammer (das Glockenzeichen gebend): Herr Abgeordneter, Sie müssen die Frage formulieren! Sie haben keine einleitende Zeit mehr. Diese ist vorbei, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Karl Öllinger (Grüne): Ein jeder ist für irgendetwas zuständig, niemand für alles. Warum wird nicht von der Finanzierung in einer Hand gesprochen, und zwar auch von Ihnen? Warum wird nicht daran gearbeitet?
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Ich habe immer gesagt: Es geht nicht um Finanzierung aus einer Hand im Rechtsstaat, sondern es geht um Finanzierungsverantwortung, Planungsverantwortung und Steuerungsverantwortung in gemeinsamen Händen. Wir müssen Gesamtverantwortung für alle drei Bereiche übernehmen: Planung, Steuerung und Finanzierung.
Das ist Gesamtverantwortung, und diese müssen wir im Dialog erarbeiten. Nur im Dialog kommen wir zu guten Gesundheitsleistungen. (Beifall bei der SPÖ.)
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Weitere Zusatzfrage? – Bitte, Frau Abgeordnete Belakowitsch-Jenewein.
Abgeordnete Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein (FPÖ): Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Sie haben von dem Papier, das jetzt vorgelegt wurde, gesagt, dass es sehr ambitioniert ist. Es hat teilweise auch sehr gute Ansätze. Das Einsparungspotential ist aber von den Koalitionspartnern nicht als solches gesehen worden.
In diesem Papier ist aber wiederum keine Zusammenlegung der Krankenkassen enthalten, die wir schon seit Langem fordern, und auch der Rechnungshof hat uns dahin gehend recht gegeben, dass die Verwaltung in den Krankenkassen überbordende Kosten verursacht und dass die Zusammenlegung der Kassen ein Gebot der Stunde ist.
Meine Frage an Sie: Werden Sie sich dafür einsetzen?
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Bleiben wir bei der Wahrheit: Der Rechnungshof hat hinsichtlich der Zusammenlegung zwischen Pensionsversicherung der Arbeiter und der Angestellten festgestellt, dass dadurch kein Einsparungspotential verwirklicht werden konnte. Das sei nicht der Fall.
Ich habe das schon deutlich gemacht: Wenn wir nahe am kranken Menschen sein wollen, dann brauchen wir dezentrale Strukturen, und diese möchte ich aufrechterhalten. Das schafft die richtige Versorgung am richtigen Ort, und das ist das größere Einsparungspotential. (Beifall bei der SPÖ.)
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zusatzfrage? – Bitte, Herr Abgeordneter Kaipel.
Abgeordneter Ing. Erwin Kaipel (SPÖ): Herr Bundesminister, wir kennen Sie seit Anbeginn Ihrer Ministerschaft als Kämpfer für gesunde Kassen, damit diese auch ihren Aufgaben im Interesse der kranken Menschen nachkommen können.
Können Sie uns sagen, welche Maßnahmen Sie bisher gesetzt haben, um die finanzielle Situation der Gebietskrankenkassen zu entlasten?
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Gesundheit Alois Stöger, diplômé: Danke, Herr Abgeordneter, für diese Frage. Wir haben sicherstellen können, dass es im Geschäftsjahr 2009 mittels der Budgetbegleitgesetze 45 Millionen € Überbrückungsbeitrag für die Kassen mit negativem Reinvermögen gibt, wir haben sicherstellen können, dass die Rücklage im Ausgleichsfonds, dieser sogenannte Katastrophenfonds, aufgelöst wird, dadurch fließen 42 Millionen € an die Kassen zurück, und wir haben sicherstellen können, dass die GSBG-Mittel beibehalten werden – damit wird die Mehrwertsteuer ersetzt –, und diese übrig bleibenden Mittel werden jenen Kassen zur Verfügung gestellt, die negatives Eigenkapital aufweisen.
Wir haben sicherstellen können und auch ins Gesetz gebracht, dass es einen Kassenstrukturfonds gibt, damit erstmals Geld direkt vom Staat kommt, eine zweite Ebene zur Sicherung der Gesundheitsversorgung auch durch den Staat unter Beibehaltung des Beitragssystems, und wir werden die Teilentschuldung zustande bringen. (Beifall bei der SPÖ.)
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Ich bedanke mich beim Herrn Bundesminister. – Die Fragestunde ist beendet.
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Hinsichtlich der eingelangten Verhandlungsgegenstände und deren Zuweisung verweise ich gemäß § 23 Abs. 4 der Geschäftsordnung auf die im Sitzungssaal verteile Mitteilung.
Die Mitteilung hat folgenden Wortlaut:
A. Eingelangte Verhandlungsgegenstände:
1. Schriftliche Anfragen: Zurückziehung: 2481/J;
2. Anfragebeantwortungen: 2023/AB bis 2026/AB.
B. Zuweisungen in dieser Sitzung:
zur Vorberatung:
Ausschuss für Arbeit und Soziales:
Antrag 711/A(E) der Abgeordneten Mag. Dr. Wolfgang Zinggl, Kolleginnen und Kollegen betreffend Berechnung der Witwen- und Witwerpensionen,
Antrag 714/A(E) der Abgeordneten Karl Öllinger, Kolleginnen und Kollegen betreffend Kontrolle von Kurzarbeit,
Antrag 715/A(E) der Abgeordneten Mag. Birgit Schatz, Kolleginnen und Kollegen betreffend begleitende Auflagen und Maßnahmen zur Kurzarbeit,
Antrag 719/A(E) der Abgeordneten Bernhard Vock, Kolleginnen und Kollegen betreffend Förderung der Blindenführhundeausbildung nach Schweizer Vorbild,
Antrag 722/A(E) der Abgeordneten Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen betreffend die Notwendigkeit der Umsetzung von Maßnahmen zur Unterstützung der heimischen Bauwirtschaft und insbesondere des Baunebengewerbes;
Familienausschuss:
Antrag 707/A(E) der Abgeordneten Mag. Dr. Wolfgang Zinggl, Kolleginnen und Kollegen betreffend Weiterbezug der Familienbeihilfe während eines Praktikums in der EU;
Finanzausschuss:
Antrag 712/A(E) der Abgeordneten Mag. Dr. Wolfgang Zinggl, Kolleginnen und Kollegen betreffend Anhebung der Einkommensobergrenze hinsichtlich der Mietzinsbeihilfe,
Antrag 716/A(E) der Abgeordneten Dr. Gabriela Moser, Kolleginnen und Kollegen betreffend Weiterführung der Konjunkturmaßnahme „Sanierungsscheck“,
Antrag 725/A(E) der Abgeordneten Josef Bucher, Kolleginnen und Kollegen betreffend Ausweitung des Berufsfeldes von Bilanzbuchhaltern,
Antrag 726/A(E) der Abgeordneten Josef Bucher, Kolleginnen und Kollegen betreffend Ökoprämie;
Gesundheitsausschuss:
Antrag 713/A(E) der Abgeordneten Mag. Christiane Brunner, Kolleginnen und Kollegen betreffend Verbesserungen in der Schweinehaltung,
Antrag 727/A(E) der Abgeordneten Ursula Haubner, Kolleginnen und Kollegen betreffend Hepatitis-Impfung für Feuerwehrleute;
Ausschuss für Konsumentenschutz:
Antrag 718/A(E) der Abgeordneten Mag. Birgit Schatz, Kolleginnen und Kollegen betreffend Reform der Gütezeichenverordnung,
Antrag 723/A(E) der Abgeordneten Gabriele Tamandl, Mag. Johann Maier, Sigisbert Dolinschek, Wolfgang Zanger, Mag. Birgit Schatz, Kolleginnen und Kollegen betreffend Verbot der Benutzung von UV-Bestrahlungsgeräten durch Kinder und Jugendliche in Solarien (Sonnenstudios);
Umweltausschuss:
Antrag 721/A(E) der Abgeordneten Mag. Birgit Schatz, Kolleginnen und Kollegen betreffend Verkabelung von Starkstromleitungen;
Verfassungsausschuss:
Antrag 717/A(E) der Abgeordneten Mag. Daniela Musiol, Kolleginnen und Kollegen betreffend zweistufige Verwaltungsgerichtsbarkeit,
Antrag 724/A der Abgeordneten Mag. Daniela Musiol, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) geändert wird;
Verkehrsausschuss:
Antrag 708/A(E) der Abgeordneten Dr. Gabriela Moser, Kolleginnen und Kollegen betreffend rasche Umsetzung einfacherer und klarerer Regeln für den Radverkehr als Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit und zu einem klimafreundlicheren Verkehrsgeschehen;
Wissenschaftsausschuss:
Antrag 710/A(E) der Abgeordneten Mag. Dr. Wolfgang Zinggl, Kolleginnen und Kollegen betreffend Gleichstellung von Ausländerinnen und Ausländern bei der Studienbeihilfe,
Antrag 720/A(E) der Abgeordneten Mag. Rainer Widmann, Kolleginnen und Kollegen betreffend Umsetzung des Versprechens von BM Dr. Hahn zur Einrichtung einer Medizinischen Universität in Linz einen runden Tisch einzuberufen.
*****
Einwendungen gegen die Tagesordnung gemäß § 49 Abs. 5 GOG
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Ich gebe bekannt, dass die Abgeordneten Dr. Cap und Kopf im Sinne des § 49 Abs. 5 der Geschäftsordnung schriftlich die Absetzung des Punktes 14 von der Tagesordnung beantragt haben.
Hiebei handelt es sich um den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Industrie über den Antrag 686/A betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Ökostromgesetz geändert wird (272 der Beilagen).
Eine Absetzung kann vor Eingang in die Tagesordnung beschlossen werden und erfordert eine Zweidrittelmehrheit.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Absetzungsantrag ... (Abg. Strache: Zur Geschäftsordnung!) – Noch vorher? (Zwischenruf des Abg. Strache.) – Ich habe registriert, Herr Klubobmann, Sie möchten vor Eingang in die Tagesordnung zur Geschäftsordnung sprechen.
Wir gelangen zur Abstimmung ... (Abg. Mag. Kogler: Dazu! – Abg. Strache: Dazu nicht! – Abg. Mag. Kogler: Aber ich!) – Dann ersuche ich um deutlichere Signale.
Herr Abgeordneter Kogler, zur Geschäftsbehandlung. – Bitte.
10.23
Abgeordneter Mag. Werner Kogler (Grüne) (zur Geschäftsbehandlung): Frau Präsidentin, ja, wenn die Signale der Regierung ein bisschen eindeutiger wären!
Natürlich ist es ein Recht der Mehrheit des Hauses, einen Tagesordnungspunkt abzusetzen, aber der Hintergrund ist insofern erwähnenswert, als dass es jetzt immer wieder vorkommt, dass Tagesordnungspunkte auf Ausschuss-Tagesordnungen gesetzt werden, ohne dass dort wirklich debattiert wird (Zwischenruf des Abg. Dr. Pirklhuber), nur um hier im Plenum eine sogenannte Trägerrakete – ich glaube, das ist allgemein verständlich – zu haben, nämlich dafür, dass dann wieder etwas ganz anderes passiert, sollten sich irgendwelche neuen Umstände ergeben.
Genau diese neuen Umstände sind aber dann in Ausschüssen nicht verhandelt worden – wo wir doch immer wieder in der Öffentlichkeit behaupten, dass wir ein Arbeitsparlament sind, aber die Arbeit in den Ausschüssen passiert. Ich sage Ihnen nur Folgendes: Die Arbeit in den Ausschüssen wird zunehmend schwieriger, und das ist auch
wieder ein Hinweis darauf. Deshalb sollte das nicht unerwähnt bleiben. (Beifall bei den Grünen. – Ruf bei der ÖVP: Das hat mit der Geschäftsordnung nichts zu tun!)
10.24
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Wir gelangen zur Abstimmung über den Absetzungsantrag betreffend den 14. Punkt der Tagesordnung.
Ich ersuche jene Abgeordneten, die für die Absetzung dieses Tagesordnungspunktes sind, um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit angenommen.
Damit wird Punkt 14 von der Tagesordnung abgesetzt.
Die Nummerierung der nachfolgenden Tagesordnungspunkte wird aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit nicht geändert.
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Vor Eingang in die Tagesordnung teile ich mit, dass Herr Abgeordneter Bucher beantragt hat, dem Finanzausschuss zur Berichterstattung über den Antrag 1/A der Abgeordneten Bucher, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), BGBl. Nr. 1/1930, geändert wird, eine Frist bis zum 25. August 2009 zu setzen.
Ferner liegt das von fünf Abgeordneten gemäß § 43 Abs. 3 der Geschäftsordnung gestellte Verlangen vor, eine kurze Debatte über diesen Fristsetzungsantrag durchzuführen.
Diese kurze Debatte wird nach Erledigung der Tagesordnung, jedoch spätestens um 15 Uhr stattfinden.
Die Abstimmung über den Fristsetzungsantrag wird nach Schluss dieser Debatte stattfinden.
Zur Geschäftsbehandlung hat sich Herr Klubobmann Strache zu Wort gemeldet. – Bitte.
10.25
Abgeordneter Heinz-Christian Strache (FPÖ) (zur Geschäftsbehandlung): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich stelle den Antrag auf eine Sonderpräsidiale heute, denn der Spitzelskandal bezüglich des Abgeordneten Peter Westenthaler, der gestern und auch schon vorgestern sich aufzudecken begonnen hat, weitet sich aus.
Gestern wurde bekannt, dass das Telefon des Abgeordneten Peter Westenthaler vom Innenministerium illegal und rechtswidrig abgehört und überwacht wurde. Das Vorgehen ist von allen Parlaments-Klubobleuten auf das Schärfste verurteilt worden – das ist gut so –, wir haben aber nunmehr die Situation, dass dieser Skandal nur die Spitze eines Eisberges darstellt und sich ausgeweitet hat.
Es sind uns neue Dokumente zugespielt worden, die belegen – nämlich einwandfrei belegen! –, dass es ein Netzwerk von Innenministeriums-Beamten in Zusammenarbeit, im Auftrag der Grünen (Zwischenruf des Abg. Kickl) mit Stasi-Methoden gegen Abgeordnete dieses Hauses gibt, wo belegt wird, dass unter anderem Datenklau und Amtsmissbrauch auf höchster Expertenebene gegenüber freiheitlichen Abgeordneten, die
hier im Visier stehen, betrieben werden, Mitarbeiter dieses Hauses observiert werden, Abgeordnete dieses Hauses abgehört werden, offensichtlich Anfragen von Beamten des Innenministeriums für die Grünen aufbereitet und redigiert werden, Kontakte mit fremden Diensten zur Informationsbeschaffung gegen freiheitliche Politiker aufgenommen haben (Abg. Kickl: Unglaublich! Unglaublich!), in Zusammenarbeit von den Grünen mit dem DÖW und Beamten des Innenministeriums betreffend den Präsidenten Graf, Abgeordneten Peter Fichtenbauer, meine Person und auch Abgeordneten Lutz Weinzinger sowie Funktionären aus den Bundesländern Bespitzelungsaktivitäten stattfinden, Pressestrategien von Vertretern der Medien mit den Grünen in Akkordanz mit Vertretern des Innenministeriums entwickelt werden, Arbeits- und Expertenkreise rekrutiert werden (Zwischenruf des Abg. Dr. Pirklhuber) – mit Beamten des Innenministeriums – zur Informationsaufbereitung und Kampagnenbetreuung für die Grünen. (Weitere Zwischenrufe bei den Grünen.)
Und ich sage: Das ist skandalös! Das ist der größte Spitzelskandal der Zweiten Republik, und ich verlange daher eine Sonderpräsidiale auch für einen Untersuchungsausschuss (Beifall bei der FPÖ sowie bei Abgeordneten von SPÖ, ÖVP und BZÖ), denn der Herr Beamte Uwe Sailer hat im Auftrag des Abgeordneten Öllinger diese Spitzelkontakte beauftragt und ist in einem Spitzelnetzwerk tätig. Ich verlange auch den Rücktritt des Herrn Abgeordneten Öllinger – aber das sollten wir auch besprechen. (Beifall bei der FPÖ.)
10.28
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Abgeordneter Strache, ich hatte ohnedies vor, heute eine Sonderpräsidiale zu machen. Bei dieser Gelegenheit gebe ich auch gleich die Uhrzeit dafür bekannt, nämlich 13 Uhr. (Abg. Ing. Westenthaler: Nach der Fernsehzeit! Klar, damit es die Menschen nicht mehr mitkriegen!)
Als Nächster gelangt Herr Abgeordneter Pilz zu Wort.
10.28
Abgeordneter Dr. Peter Pilz (Grüne) (zur Geschäftsbehandlung): Frau Präsidentin! Danke, Herr Kollege Strache, dass jetzt erstmals ein Hinweis darauf existiert, dass das ÖVP-Innenministerium ein Instrument der grünen Partei ist. (Abg. Strache: ... -Watch!) Herzlichen Dank, dass Sie das unter dem Schutz Ihrer Immunität ohne einen einzigen Beweis oder Hinweis behaupten, aber Sie werden Gelegenheit haben, das hier vorzulegen. (Abg. Strache: Jetzt wissen wir, woher Sie die Informationen haben!)
Ich nehme das Thema zu ernst, um das den Strache-Äußerungen zu überlassen: In drei mir bekannten Fällen – einer davon ist der Fall Westenthaler – ist es zu illegalen Überwachungsmaßnahmen gekommen. Ich werde mir erlauben, in meiner späteren Rede zum Tagesordnungspunkt 1 diesem Haus dazu einige neue Fakten auf Basis von Dokumenten zur Kenntnis zu bringen.
Und ich schließe mich dem Wunsch nach einer Sonderpräsidiale, zu der Sie, Frau Präsidentin, jetzt eingeladen haben, an: Es ist sehr wichtig, dass sich dieses Haus gegen illegale Überwachungsmaßnahmen, die sich nicht nur gegen einzelne Abgeordnete, sondern gegen das Parlament als Ganzes richten, gemeinsam zur Wehr setzt! – Danke schön. (Beifall bei den Grünen.)
10.29
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zur Geschäftsbehandlung: Herr Abgeordneter Westenthaler. – Bitte.
10.29
Abgeordneter Ing. Peter Westenthaler (BZÖ) (zur Geschäftsbehandlung): Frau Präsidentin! Es wäre für die Fernsehzuseher, die noch bis 13 Uhr die Möglichkeit haben,
diese Sitzung zu verfolgen, sinnvoller, Sie würden die Präsidiale sofort einberufen und das Ergebnis dann auch noch in der Fernsehzeit bekannt geben, Frau Präsidentin Prammer! (Beifall bei BZÖ und FPÖ.)
Ich will aber angesichts der unglaublichen Dinge, die jetzt an die Oberfläche getreten sind, nicht in einen parteipolitischen Diskurs verfallen, sondern deutlich machen, wo wir uns derzeit befinden: Das ist ein großflächiger Skandal der Bespitzelung, der an die Grundfesten der Demokratie in diesem Land geht!
Wenn der Chefredakteur der „Salzburger Nachrichten“, Andreas Koller, heute schreibt, „Oppositionsabgeordnete sind nicht vor Bespitzelung durch Regierungsstellen sicher. Dies muss schleunigst geändert werden“, wenn die Tageszeitung „Heute“ schreibt, „das Vorgehen der BIA-Schnüffler hinterlässt einen schalen Nachgeschmack: Immer wieder wird auch gegen Journalisten und deren Informanten in der Polizei ermittelt“, und wenn Andreas Unterberger – und er bringt es auf den Punkt – den schweren Vorwurf erhebt, der sich durch die Bespitzelung ergibt, nämlich – ich zitiere wörtlich – „die Staatsanwälte im Raum Wien sind zur Gefahr für den Rechtsstaat geworden“, dann schlägt es wirklich dreizehn, Frau Präsidentin! (Allgemeiner Beifall.)
Dann geht es nämlich nicht mehr – ich möchte das ganz, ganz exakt trennen und abkoppeln – um den Bespitzelungsskandal Peter Westenthaler, Peter Pilz oder andere Abgeordnete, dann geht es nicht mehr um die Immunität von Abgeordneten, sondern dann geht es um Grund- und Freiheitsrechte von Politikern, von Rechtsanwälten, von Journalisten, von Ärzten, ja der ganzen Bevölkerung Österreichs! Und dagegen haben wir uns zu wehren, Frau Präsidentin! (Allgemeiner Beifall.)
Wir sind daher als parlamentarische, demokratische Vertretung der Bevölkerung Österreichs aufgefordert, solche Spitzelmethoden der Staatsgewalt, der Staatsanwaltschaft, des BIA zu bekämpfen, hier sofort einen Untersuchungsausschuss einzusetzen und mit diesen Methoden „abzufahren“, damit nie mehr wieder so etwas vorkommt, dass Zeugen als Beschuldigte behandelt werden, dass Beschuldigte bereits als Verurteilte behandelt werden und dass in diesem Land Menschenrechte mit Füßen getreten werden! – Danke schön. (Beifall bei BZÖ und FPÖ sowie bei Abgeordneten von SPÖ und ÖVP.)
10.32
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zur Geschäftsbehandlung: Herr Abgeordneter Klubobmann Kopf. – Bitte.
10.32
Abgeordneter Karlheinz Kopf (ÖVP) (zur Geschäftsbehandlung): Frau Präsidentin! Hohes Haus! Ich kann die von Klubobmann Strache erhobenen Vorwürfe selbstverständlich jetzt nicht verifizieren – niemand kann das –, aber sie sind so schwerwiegend, dass sie jedenfalls so wie alle Vorwürfe solcher Art gründlichst zu untersuchen sind. Da darf kein Zweifel bestehen bleiben! (Allgemeiner Beifall.)
Es darf in diesem Land überhaupt keinen Zweifel daran geben, dass die Grundrechte der Menschen insgesamt, aber natürlich insbesondere auch jene der gewählten Mandatare, zu schützen sind – dazu sind wir im Besonderen aufgerufen. Das, was Peter Westenthaler vorhin gesagt hat, gilt und ist hier absolut zu unterstreichen.
Ich begrüße darüber hinaus, dass Sie diese Sonderpräsidiale einberufen werden. Ich denke, in der Zwischenzeit sollte dann die Antwort der beiden Ministerinnen auf Ihren gestrigen Brief eingetroffen sein, sodass wir uns auch gleich darüber unterhalten können, und vor allem darüber reden können, wie wir mit diesen schwerwiegenden Vor-
würfen und mit der Untersuchung dieser Vorwürfe in Zukunft umgehen werden. (Beifall bei der ÖVP.)
10.33
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Gleichfalls zur Geschäftsbehandlung: Herr Klubobmann Dr. Cap. – Bitte.
10.34
Abgeordneter Dr. Josef Cap (SPÖ) (zur Geschäftsbehandlung): Ich möchte nur noch darauf hinweisen, dass in dem Brief der Frau Präsidentin auch die Frage enthalten ist, ob die Handys von noch mehr Abgeordneten abgehört wurden, und dass wir selbstverständlich aufgefordert sind, zu agieren, auch im Sinne dessen, was Herr Klubobmann Strache – was auch ich nicht überprüfen kann – hier aufgezeigt hat, nämlich dass das ein weit größeres Problem darstellt, als es das bislang war, als wir „nur“ – unter Anführungszeichen – die Abhörung des Kollegen Westenthaler diskutiert haben.
Ich halte das für eine ganz, ganz grundsätzliche Frage! Hier sind Grundrechte betroffen! Das kann heute hier im Haus und morgen beim einfachen Bürger und der einfachen Bürgerin sein. – Es ist unsere Aufgabe, dass wir hier lückenlos aufklären und dass hier lückenlos Klarheit geschaffen wird.
Daher hoffe ich, dass wir bei der Sonderpräsidiale auch einen Weg aufzeigen, wie wir diese Aufklärung in die Wege leiten, denn das halte ich für ganz essenziell, um gegenüber diesen Organen wieder Vertrauen herstellen zu können, denen diese Vorwürfe gemacht werden.
Ansonsten möchte ich auch namens meiner Fraktion sagen: Wir sind zutiefst betroffen und schockiert und sagen, wir wollen hier wirklich alle Schritte setzen, damit dann am Ende des Tages auch wirklich Aufklärung vorgewiesen werden kann. (Allgemeiner Beifall.)
10.35
Behandlung der Tagesordnung
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Es ist vorgeschlagen, die Debatte über die Punkte 1 und 2, 3 bis 5, 6 bis 9, 16 bis 20, 21 und 22, 23 und 24 sowie 26 und 27 der Tagesordnung jeweils zusammenzufassen.
Wird dagegen ein Einwand erhoben? – Das ist nicht der Fall.
Wir gehen in die Tagesordnung ein. (Abg. Scheibner: Frau Präsidentin!) – Herr Abgeordneter Scheibner zur Geschäftsbehandlung. – Bitte.
10.36
Abgeordneter Herbert Scheibner (BZÖ) (zur Geschäftsbehandlung): Frau Präsidentin! Nach dem Justizskandal, den wir in der vorigen Geschäftsordnungsdebatte diskutiert haben, möchte ich jetzt einen Antrag stellen, um dem Parlament die Möglichkeit zu geben, die Arbeiten in einem ganz wichtigen Bereich auch über die Sommermonate fortzusetzen. – Ich glaube, das erwarten die Menschen von uns.
Sie wissen, dass wir vor Kurzem einen Unterausschuss des Verfassungsausschusses zur Behandlung der Reform der Schulverwaltung eingerichtet haben. Der Rechnungshof hat hier Konzepte vorgelegt, wo man essenzielle Geldmittel, Steuergelder einsparen könnte. Gerade in einer Zeit, in der vor allem von Regierungsparteien immer wieder Steuererhöhungen zur Finanzierung der Krise angedacht werden, ist es notwendig, dass sich dieser Nationalrat mit Einsparungsvorschlägen in der Verwaltung auch über die Sommermonate hinweg beschäftigt.
Es war auch vom Bundeskanzler und vom Vizekanzler zugesagt – nach dem letzten Verfassungsausschuss bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, ob diese Zusage auch hält. Aber letztlich sind wir gegenüber dem Steuerzahler dafür verantwortlich, dass Einsparungen erzielt werden.
Deshalb stelle ich gemäß § 46 Abs. 4 der Geschäftsordnung den Antrag, den am 9. Juli 2009 eingesetzten Unterausschuss des Verfassungsausschusses auch über die Sommermonate hinweg in der tagungsfreien Zeit fortzusetzen. (Beifall beim BZÖ. – Zwischenruf des Abg. Krainer.)
10.37
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zur Geschäftsbehandlung: Herr Abgeordneter Kickl. – Bitte.
10.37
Abgeordneter Herbert Kickl (FPÖ) (zur Geschäftsbehandlung): Frau Präsidentin! Wir schließen uns diesem Antrag der Orangen an, weil es darum geht, hier einmal mehr ein Spiel aufzuzeigen, das vonseiten der Regierungsparteien leider in allzu wichtigen Materien allzu oft gespielt wird, dass man nämlich mit großem Aufwand – und zwar bei den Österreich-Gesprächen – der Bevölkerung vorzugaukeln versucht (Abg. Kopf: Frau Präsidentin!), dass man alle Hebel in Bewegung setzen wird, und das möglichst bald und möglichst nachhaltig tun wird, um Milliarden, die in diversen Bereichen dringend gebraucht werden und die in der Verwaltung – in diesem konkreten Fall in der Schulverwaltung – verborgen liegen, zu heben; das wäre notwendig.
Das war auch die Vorgangsweise, die bei diesen Gesprächen zugesagt wurde. – Jetzt sieht es so aus, als ob man das Ganze dann in einer Nacht-und-Nebel-Aktion wieder umdreht.
Das kann es nicht sein! Wir haben schon genug Zeit „verplempert“, und die Bevölkerung hat ein Recht darauf, dass in einem so wesentlichen Bereich wie der Bildungspolitik mehr passiert, als dass sich Lehrer mit der Bildungsministerin streiten, weil es darum geht, diese Milliarden endlich zu heben und damit besser heute als morgen anzufangen. (Beifall bei der FPÖ.)
10.38
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zur Geschäftsbehandlung hat sich Herr Klubobmann Dr. Cap zu Wort gemeldet. – Bitte.
10.38
Abgeordneter Dr. Josef Cap (SPÖ) (zur Geschäftsbehandlung): Ich glaube, dass meine Vorredner recht haben und dass es richtig ist, dass die Verwaltungsreform jetzt ein Gebot der Stunde ist. (Abg. Kopf: Frau Präsidentin! Es gibt auch das Recht auf ...!)
Es ist richtig, dass es einen Unterausschuss gibt, der mit seiner Arbeit ganz konkret beginnen wird, und es ist eine Selbstverständlichkeit, dass dieser Unterausschuss natürlich auch über den Sommer arbeiten soll. (Beifall bei der SPÖ.)
10.39
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zur Geschäftsbehandlung: Herr Klubobmann Kopf. – Bitte.
10.39
Abgeordneter Karlheinz Kopf (ÖVP) (zur Geschäftsbehandlung): Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Selbstverständlich sind auch wir gerne bereit, der Dringlichkeit dieses Anliegens, nämlich als ersten Teil einer umfassenden Verwaltungsreform den Bereich der Schulverwaltung zu behandeln und dort auch etwas vorwärtszubrin-
gen, Rechnung zu tragen, und wir werden diesem Antrag selbstverständlich zustimmen. (Allgemeiner Beifall.)
10.39
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zur Geschäftsbehandlung: Herr Abgeordneter Kogler, bitte.
10.40
Abgeordneter Mag. Werner Kogler (Grüne) (zur Geschäftsbehandlung): Frau Präsidentin! Na bitte, es geht ja, auch die Regierung bewegt sich! Gleichwohl das gestern am Abend noch anders ausgeschaut hätte. Und hätte in diesem Fall – man darf es ja aussprechen – Abgeordneter Scheibner nicht diesen Druck entwickelt, wer weiß, wie das hier ausgegangen wäre, da bin ich mir nicht sicher. – Erstens.
Zweitens brauchen wir als Parlament uns vom Kanzler und vom Vizekanzler ja auch nicht ausrichten zu lassen, wann wir wie zu tagen haben. Das machen wir uns schon selbst aus. In diesem Fall ist das auch selbst gelungen.
Der dritte und viel wesentlichere Punkt ist doch der, dass diese Verhandlungen auch vom Inhalt her etwas bringen sollen. Daher bringe ich hier – und das gehört genau zur Geschäftsordnungsdebatte – auch gleich noch an: Die Grünen werden ab sofort bei diesen Zweidrittelblöcken natürlich mitverhandeln, auch, um die Effizienzpotenziale zu heben, aber eines ist klar: Meistens brauchen wir auch die Länderzustimmung dazu. Und sollte sich herausstellen, dass die Bundesländervertreter, sprich: die Landeshauptleute, im Wesentlichen – wie schon jahrelang! – bei allen Verwaltungsbemühungen querschießen und sich nichts bewegt, dann werden wir den Tisch verlassen und das auch kundtun!
Wir können uns diese Politfolklore der Landeshauptleute auf Dauer nicht mehr leisten. Das wissen alle. (Beifall bei den Grünen sowie bei Abgeordneten von SPÖ, ÖVP und FPÖ.) Und da sollte man endlich einmal die Courage haben, auch aufseiten der ÖVP und der SPÖ, auf die eigenen Leute einzuwirken.
Es ist wirklich unerträglich: Sieben Jahre haben wir schon mit Verfassungskonvent und allem Möglichen herumgetan, nichts ist weitergegangen. Entweder geht jetzt etwas weiter, oder es nimmt in Zukunft niemand mehr, zumindest von ÖVP und SPÖ, das Wort „Verwaltungsreform“ in den Mund, denn das ist dann nicht mehr auszuhalten und niemandem mehr zuzumuten.
Zumutbar ist, dass wir jetzt eine gescheite Reform auf die Füße stellen und Schritt für Schritt abarbeiten. Man sieht ja, dass die Opposition bei Zweidrittelmaterien dabei ist, wenn es geht, damit man etwas weiterbringt. Ich hoffe, dass die Regierung das in anderen Fällen auch so hält. (Beifall bei den Grünen sowie der Abg. Ursula Haubner.)
10.41
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Ich erteile noch einmal das Wort Herrn Klubobmann Kopf. – Bitte.
10.42
Abgeordneter Karlheinz Kopf (ÖVP) (zur Geschäftsbehandlung): Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Kollege Kogler, jetzt haben wir uns gerade in aller Unaufgeregtheit darauf verständigt, diesen Unterausschuss des Verfassungsausschusses für permanent zu erklären und damit auch über den Sommer hinweg zu arbeiten, da besteht doch überhaupt keine Notwendigkeit – ich weise das wirklich auf das Entschiedenste zurück –, dass Sie jetzt hier Landeshauptleute, Landespolitiker in einer Art und Weise beschimpfen, die völlig unangebracht ist! (Beifall bei Abgeordneten der ÖVP.)
Lasst uns dieses Thema in aller Seriosität, in aller Anerkennung auch unterschiedlicher Standpunkte und unterschiedlicher Interessen zwischen Landes- und Bundesebene behandeln und lasst uns versuchen, zu einer Lösung zu kommen! Aber Vorabbeschimpfungen eines Teils der Verhandlungspartner macht wirklich keinen Sinn! (Beifall bei der ÖVP.)
Ich darf gleich ein Zweites ankündigen: Meine Damen und Herren, wir werden im Laufe der Debatte auch den Antrag stellen, den Finanzausschuss für permanent zu erklären, weil wir auch über den Sommer alles versuchen müssen, um die Blockade der Oppositionsparteien, insbesondere der Grünen, aufzuheben (Abg. Ing. Westenthaler: Sommerpause ...! – Abg. Grosz: Sommerpause abschaffen!) im Zusammenhang mit dem dringend zu lösenden Problem beim Bankgeheimnis. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Grosz: Sommerpause abschaffen!)
10.43
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Ich lasse jetzt klarerweise noch eine Runde an Rednern zu, denn das ist eine wichtige Debatte (Abg. Ing. Westenthaler: Es fällt uns noch etwas ein!), daher weiche ich auch vom Grundsatz ab.
Ich möchte aber eines schon jetzt anmerken: Wir haben ja heute am Ende der Tagesordnung den Beschluss auf Tagungsende zu fassen, und ich möchte gerne im Rahmen dieses Beschlusses, damit auch die Textierung ganz genau passt, die Permanenterklärung der beiden Ausschüsse, für die jetzt die beiden Anträge mündlich gestellt wurden, mit abstimmen lassen. Das möchte ich an dieser Stelle gleich anmerken. Ich möchte da keinen unsauberen Geschäftsordnungsbeschluss, sondern die genaue Textierung. Die gemeinsame Abstimmung lässt auch § 49 Abs. 4 zu.
Herr Abgeordneter Scheibner, bitte.
10.44
Abgeordneter Herbert Scheibner (BZÖ) (zur Geschäftsbehandlung): Frau Präsidentin! Ich bin sehr froh darüber, dass es jetzt gelingt, zumindest zwei Ausschüsse auch in der Sommerpause als Arbeitsausschüsse weiterzuführen. Vielleicht kann man sich dann doch auch unserem Wunsch anschließen, die tagungsfreie Zeit überhaupt abzuschaffen (Beifall beim BZÖ) und dass alle Abgeordneten – so wie jeder Arbeitnehmer in Österreich – mit dem normalen Urlaub auskommen, sodass wir hier auch im Sommer wichtige Fragen weiter diskutieren können.
Ich möchte den Abgeordneten Kogler ein bisschen in Schutz nehmen und sagen: Ich habe das nicht als Beschimpfung der Landeshauptleute empfunden. Selbstverständlich wollen wir ein gutes Verhältnis zu den Ländern und Landeshauptleuten, aber auf der anderen Seite brauchen wir gerade jetzt, wo es darum geht, im Bereich der Verwaltung einzusparen, um Steuererhöhungen zu vermeiden, eine klare Konsequenz. Es gibt kein Steuerfindungsrecht der Länder, sondern die Länder verteilen das Geld, das über die Bundessteuern hereinkommt, und deshalb haben die Länder auch die Verpflichtung, bei den Einsparungen im Verwaltungsbereich, wenn es um Pensionsprivilegien, wenn es um Verwaltungsvereinfachungen geht, konstruktiv mitzuarbeiten. (Beifall beim BZÖ.)
10.45
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zur Geschäftsbehandlung: Herr Abgeordneter Kickl. – Bitte.
10.45
Abgeordneter Herbert Kickl (FPÖ) (zur Geschäftsbehandlung): Frau Präsidentin! Ich muss die Ausführungen des Kollegen Scheibner gleich korrigieren beziehungsweise
ergänzen: Ich bin sehr froh darüber, dass jetzt große Einigkeit darüber herrscht, dass in zwei Ausschüssen die Arbeit über den Sommer fortgesetzt werden soll.
Auf noch etwas freue ich mich: Kollege Strache hat ja vorhin schon in seinen Ausführungen aufgezeigt und angedeutet, dass es in diesem Haus einen riesigen, einen gigantischen Spitzelskandal gibt, dessen Zentrum sich im Grünen Klub befindet, beim Kollegen Öllinger, wozu es eine Menge an Vorwürfen gibt, die zu untersuchen sein werden. Wir werden daher im Laufe des heutigen Tages einen entsprechenden Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zu dieser grünen Spitzelaffäre einbringen. Und nach den Aussagen aller Klubs, die ja sehr, sehr um Aufklärung in dieser Angelegenheit bemüht waren, weil das ja Dimensionen annimmt, die sich von Tag zu Tag potenzieren, gehen wir davon aus, dass dieser Antrag auch Zustimmung erfahren wird. Es wäre dann natürlich ideal – und genau das wünschen wir uns –, dass dieser Untersuchungsausschuss möglichst bald, das heißt im Sommer, seine Tätigkeit aufnimmt, um jenen, die hier der Demokratie einen Bärendienst erweisen, das Handwerk zu legen. (Beifall bei der FPÖ.)
10.46
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zur Geschäftsbehandlung: Herr Klubobmann Dr. Cap. – Bitte.
10.47
Abgeordneter Dr. Josef Cap (SPÖ) (zur Geschäftsbehandlung): Ich möchte wirklich davor warnen, auf der einen Seite zu sagen: Wir wollen im Unterausschuss für Verwaltungsreform konkrete, gute Arbeit leisten! – das ist auch wirklich wichtig, da kann man auch Kosteneinsparungen erzielen, was in der heutigen Zeit der knappen Kassen von größter Bedeutung ist; aber nicht nur in der heutigen Zeit, sondern auch langfristig –, auf der anderen Seite dann aber Landespolitiker zu beschimpfen, wohl wissend, dass wir, wenn wir eine Verwaltungsreform machen wollen, ein vernünftiges Arbeitsklima brauchen. Wir müssen uns mit Vertretern der Länder, wir müssen uns mit Vertretern des Bundes hier zusammensetzen.
Es gibt eine funktionierende Arbeitsgruppe in der Bundesregierung, die auch in diesem Bereich bereits sehr viel Arbeit leistet und auch weiter leisten wird. Das heißt, hier sind schon Initiativen gesetzt worden. Wir werden hier im Parlament unter Beteiligung der Oppositionsparteien ebenfalls, so hoffe ich, gute Arbeit leisten. Streiten hat keinen Sinn, das möchte niemand, damit würden wir auch nicht zu Ergebnissen kommen. Das ist das eine.
Das andere: Ich finde es sehr positiv, dass die genannten Ausschüsse über den Sommer arbeiten. Ich möchte aber etwas Grundsätzliches noch sagen: Ich weiß nicht, was die Vertreter des BZÖ machen, wenn sie dieses Haus verlassen. Denn: Es ist nicht richtig, das so darzustellen, als fände die Arbeit der Abgeordneten nur hier im Plenarsaal und in den Ausschüssen statt – und sonst arbeiten sie nichts. (Abg. Grosz: Der Herr Faul!) Wenn Sie das für Ihre Fraktion sagen, ist das Ihre Sache. (Abg. Grosz: Ihr Herr Faul ist das beste Beispiel!)
Wenn Sie hier das Haus verlassen und nachher in die Sauna, schwimmen oder schlafen gehen, dann ist das Ihre Sache. Aber hier sitzen Abgeordnete, die den Bürgerkontakt suchen, die in dieser Zeit in Wirklichkeit im Wahlkreis arbeiten. (Abg. Scheibner: Was soll denn das?) – Weil mir das langsam wirklich ... Ich glaube, dass Sie hier dem Parlament Schaden zufügen (Abg. Grosz: Ihr Herr Faul ist das beste Beispiel! Nomen est omen!), indem durch Sie der Eindruck erweckt wird, dass außerhalb dieses Hohen Hauses nicht gearbeitet wird! (Anhaltender Beifall bei SPÖ, ÖVP und FPÖ sowie bei Abgeordneten der Grünen. – Abg. Grosz: Ihr Herr Faul ist das beste Beispiel! – Weitere Zwischenrufe.)
Ich stelle fest: Wir arbeiten, und ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist außerhalb dieses Hauses, mit den Bürgerinnen und Bürgern – doch das BZÖ verlässt dieses Hohe Haus und arbeitet nicht mehr! Wenn das Ihr Beschluss ist, ist das Ihre Verantwortung! (Beifall bei SPÖ und ÖVP sowie bei Abgeordneten der FPÖ.)
10.49
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Die letzte Wortmeldung, die ich in dieser Geschäftsordnungsdebatte zulasse: Herr Abgeordneter Mag. Kogler. – Bitte.
10.49
Abgeordneter Mag. Werner Kogler (Grüne) (zur Geschäftsbehandlung): Frau Präsidentin! (Abg. Ing. Westenthaler: Neun Wochen keine Sitzung, das ist ja ein Wahnsinn!) Es ist schon richtig, die Arbeit der Abgeordneten findet nicht nur hier im Plenum und in den Ausschüssen statt, sondern auch sonst natürlich.
Es ist nicht gut, wenn sich die Abgeordneten da gegenseitig irgendetwas vorhalten. Letztlich steht das unter Beobachtung der WählerInnen, und die werden dann darüber entscheiden, wem sie das Vertrauen geben und wem nicht. Da können sie den Arbeitseifer, den vorgegebenen, behaupteten oder tatsächlichen, in ihre Entscheidung mit einfließen lassen.
Diese Debatte, die wir uns hier liefern, hat überhaupt keinen Sinn, und das ist auch nicht der wesentliche Punkt. Viel wesentlicher sind die Anwürfe des Kollegen Kickl, aber was die Bespitzelungsaffären gegenüber den Abgeordneten betrifft: selbstverständlich Untersuchungsausschuss – selbstverständlich! Sie können dessen sicher sein, dass Abgeordneter Pilz den Antrag schon schreibt, während Sie hier nur herumkeppeln.
Nächster Punkt: die Frage Föderalismus. – Es geht schlicht und ergreifend darum, dass wir schon jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang, erleben, dass dann, wenn wir uns auf Bundesebene einig sind – und wir hatten das schon in der Finanzverfassung –, die Bundesländer regelmäßig jene sind, die jeden Fortschritt verweigern. Deshalb bleibe ich dabei: Die Fortschrittsverweigerung in Sachen Verwaltungsreform findet sich in erster Linie auf Länderebene – und das muss man anmerken dürfen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass ja gerade Sie von den Regierungsparteien behaupten, dass dort so viel Einsparungspotenzial vorhanden wäre.
Letzter Punkt: Finanzausschuss. – Ja, selbstverständlich, wir haben uns darüber geeinigt, der Finanzausschuss wird für permanent erklärt, damit nämlich sichergestellt ist, dass die Verhandlungen zwischen den Parteien und allfällige Ergebnisse dann dort verabschiedet werden können. Es geht darum, dass wir einerseits ein Gesamtpaket zustande bringen, was die Steuerbetrugsbekämpfung betrifft – das ist eine gute Sache, da müssen wir noch ein bisschen etwas verbessern –, und andererseits ein Paket für transparentes Wirtschaften schaffen; Sie wissen ganz genau, dass das mit der Rechnungshofprüfkontrolle zu tun hat.
Es ist nur gut, wenn die drei Oppositionsparteien sich darin einig sind, alles unter einem abstimmen lassen zu wollen. Wenn Sie das ein Junktim nennen, dann darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie den ganzen Tag in ihren Verhandlungen nichts anderes tun. Das ist vielleicht auch etwas Gutes, denn wir alle sind dazu gewählt, etwas durchzusetzen. (Beifall bei den Grünen.)
10.52
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Ich halte abschließend noch fest, dass ich über die zwei gestellten Anträge auf Permanenterklärung allen fünf Fraktionen das entspre-
chende Croquis zur Verfügung stellen und im Zusammenhang mit dem Tagungsende abstimmen lassen werde.
*****
Wir gehen in die Tagesordnung ein.
Redezeitbeschränkung
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: In der Präsidialkonferenz wurde folgender Konsens über Gestaltung und Dauer der Debatten erzielt:
Es wurde eine Tagesblockzeit von 9 „Wiener Stunden“ vorgeschlagen, sodass sich folgende Redezeiten ergeben: SPÖ und ÖVP je 122 Minuten, FPÖ 108 Minuten sowie BZÖ und Grüne je 95 Minuten.
Für die Dauer der Fernsehübertragung durch den ORF von 10.55 Uhr bis 13.00 Uhr wurde folgende Redeordnung vereinbart:
Gemeinsame Debatte zu den Tagesordnungspunkten 1 und 2: eine RednerInnenrunde mit je 5 Minuten, insgesamt 25 Minuten, ein Regierungsmitglied mit 7 Minuten, eine Rednerrunde mit je 3 Minuten – das sind insgesamt 47 Minuten.
Gemeinsame Debatte zu den Tagesordnungspunkten 3 bis 5: Redezeit pro Fraktion 14 Minuten, eine RednerInnenrunde, ein Regierungsmitglied mit 7 Minuten, eine RednerInnenrunde, ein Regierungsmitglied mit 5 Minuten sowie allfällige weitere RednerInnenrunden – somit insgesamt 82 Minuten. (Abg. List begibt sich zum Rednerpult und bleibt dort stehen.)
Das Prinzip Contra/Pro gelangt nur so lange zur Anwendung, als Contra- beziehungsweise Pro-Redner innerhalb der oben angeführten Gesamtredezeit je Fraktion zur Verfügung stehen.
Herr Abgeordneter List, wir haben noch eine Abstimmung durchzuführen. Wir sind noch nicht so weit, dass der erste Redner drankommt. (Abg. Grosz: Im Gegensatz zum Herrn Faul ist er eben fleißig!)
Der den Vorsitz führende Präsident verteilt jeweils spätestens vor Beginn der letzten Runde nach Rücksprache mit den Klubvorsitzenden die für die letzte Runde verbleibende Redezeit zu gleichen Teilen auf die fünf Fraktionen – es muss dann eben mit berücksichtigt werden, dass jetzt weniger Minuten zur Verfügung stehen.
Weiters ist vorgeschlagen, dass tatsächliche Berichtigungen erst nach der Fernsehübertragung aufgerufen werden.
Wir kommen zur Abstimmung über diese Redeordnung.
Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem Vorschlag zustimmen, um ein diesbezügliches Zeichen. – Das ist einstimmig angenommen.
Bericht des Landesverteidigungsausschusses über die Regierungsvorlage (161 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Wehrgesetz 2001, das Heeresdisziplinargesetz 2002, das Heeresgebührengesetz 2001, das Auslandseinsatzgesetz 2001, das Militärbefugnisgesetz, das Sperrgebietsgesetz 2002, das Munitionslagergesetz 2003, das Militärauszeichnungsgesetz 2002 und das Truppenaufent-
haltsgesetz geändert werden (Wehrrechtsänderungsgesetz 2009 – WRÄG 2009) (239 d.B.)
2. Punkt
Bericht des Landesverteidigungsausschusses über die Regierungsvorlage (76 d.B.): Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über den vorübergehenden Aufenthalt von Angehörigen des österreichischen Bundesheeres und Angehörigen der deutschen Bundeswehr auf dem Gebiet des jeweils anderen Staats (österreichisch-deutsches Streitkräfteaufenthaltsabkommen) (255 d.B.)
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Damit kommen wir zu den Punkten 1 und 2 der Tagesordnung, über welche die Debatte unter einem durchgeführt wird.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Wir gehen in die Debatte ein.
Herr Abgeordneter List, Sie sind der Erste, der zu Wort kommt: Redezeit: 5 Minuten. – Bitte.
10.55
Abgeordneter Kurt List (BZÖ): Frau Präsidentin! Geschätzter Herr Bundesminister für Landesverteidigung! Meine Damen und Herren! Sie sehen hier den Unterschied zwischen einem orangen Abgeordneten, meiner Person, der fleißig ist und hier hinausgeht und auf seinen Redebeitrag wartet (Abg. Mag. Gaßner: Draußen steht und nichts tut!), um etwas zur Landesverteidigung zu sagen, und Ihrem Kollegen (Zwischenrufe bei der SPÖ), dem Kollegen Faul, der heute wieder nichts sagen wird. (Abg. Grosz: 14 000 € kassiert!)
Wir wollen, dass die Sommerpause abgeschafft wird (Zwischenruf des Abg. Mag. Ikrath), dass Sie, Herr Kollege Faul, ein Mal – ein Mal! – in Ihrem Leben hier in diesem Parlament etwas arbeiten und in einer Sommerpause in 65 Jahren hier ein Mal am Rednerpult auftauchen. (Beifall beim BZÖ.)
Das zu Ihnen, geschätzte Damen und Herren von der Sozialdemokratie. (Abg. Mag. Ikrath: Sie gehören in die Krabbelstube! – Abg. Faul: Schauen Sie sich Ihre Rede ...! – Weitere Zwischenrufe bei der SPÖ.)
Meine Damen und Herren, inhaltlich stimmt das BZÖ diesem neuen Gesetzestext im Wehrrechtsänderungsgesetz zu. Ich habe dem Kollegen Prähauser früher schon gesagt, dass wir vollinhaltlich zustimmen. (Abg. Mag. Gaßner: Jetzt haben Sie ausgearbeitet!) Politisch aber verlangen wir in der zweiten Lesung getrennte Abstimmung. Wir lehnen nämlich diese Verfassungsbestimmung ab. Von uns, dem BZÖ, werden SPÖ und ÖVP in der nächsten Zeit keine Zustimmung zu einer notwendigen Zweidrittelmehrheit bekommen.
Geschätzte Damen und Herren, diese politische Blockade ist notwendig (Abg. Mag. Ikrath: Das ist Verantwortungsverweigerung!), weil unsere konstruktive Arbeit hier laufend blockiert wird. (Abg. Mag. Ikrath: Verantwortungsverweigerung!) Sie versuchen immer mit allen Mitteln, die Arbeit der Opposition madig zu machen und die Rechte der Opposition auszuschalten. Das ist demokratiepolitisch ein Skandal! Wir werden uns aber zu wehren wissen. Wir werden uns wehren!
Wir wollen vermehrt Kontrolle, Kontrolle auf allen Ebenen, in allen Bereichen. Wir wollen, dass der Rechnungshof vermehrt kontrolliert, auch betreffend Eurofighter-Vertrag – Ihren Alleingang, Herr Bundesminister – und das Skylink-Debakel beim Flugha-
fen Wien (Ruf bei der ÖVP: Das gehört nicht zum Thema!); dort muss auch geprüft werden. (Abg. Mag. Ikrath: Zum Thema!)
Das gehört alles zum Thema, geschätzte Damen und Herren, und ich sage Ihnen, warum das alles zum Thema gehört: weil dort mit öffentlichen Geldern umgegangen wird. Dort wird Steuergeld eingesetzt, und jeder hat das Recht zu wissen – jeder vor dem Fernsehapparat –, was mit seinen Steuergeldern geschieht. Das ist unbedingt notwendig. Diese insgesamt 55 000 Bundesheerangehörigen, wenn man die Miliz dazu nimmt, müssen auch wissen, was mit ihren Sparbüchern, mit dem Bankgeheimnis geschieht.
Dazu noch Folgendes – das hat Klubobmann Kopf gesagt –: SPÖ und ÖVP wollen derzeit das österreichische Bankgeheimnis aufgeben. (Abg. Mag. Ikrath: Was hat denn das mit dem Wehrrechtsänderungsgesetz zu tun?) Sie wollen das Bankgeheimnis opfern! – Ich sage Ihnen, was das damit zu tun hat. Das hat ganz einfach damit zu tun, dass es viele Familien gibt, viele Bundesheerangehörige, die ein Sparbuch, die irgendwo ein Konto haben und die ein Recht darauf haben, zu wissen, dass Sie in nächster Zeit das Bankgeheimnis aufgeben wollen. Wir wollen das nicht! (Beifall beim BZÖ.)
Wir stellen uns hinter die Sparbücher, hinter die Österreicher und stützen und schützen das Bankgeheimnis! (Zwischenruf des Abg. Rädler.)
Geschätzte Damen und Herren, all das sind Forderungen, die wir durchsetzen wollen, und dann können wir gemeinsam etwas machen. (Abg. Silhavy: Und was ist mit dem Bundesheer? Kommen Sie einmal zur Sache!) Das ist alles zur Sache. Genau auf diese Zwischenrufe habe ich gewartet. (Anhaltende Zwischenrufe bei SPÖ und ÖVP. – Präsidentin Mag. Prammer gibt das Glockenzeichen.)
Sie verlieren die Nerven vor der Sommerzeit, meine Damen und Herren von ÖVP und SPÖ. Das ist doch nicht notwendig!
Jetzt zur Landesverteidigung, geschätzte Damen und Herren! (Abg. Mag. Ikrath: Ach so?!) Herr Bundesminister Darabos, Sie haben im Auftrag der SPÖ das Bundesheer in die schwerste Krise der Zweiten Republik geführt. Ich sage das hier nicht zum ersten Mal. Nach nur drei Jahren Amtszeit ist die Einsatzbereitschaft des Heeres massivst gefährdet. Vor diesen katastrophalen Entwicklungen wurden Sie ständig gewarnt, auch von ihren Offizieren im Generalstab.
Wir konnten uns kurz überzeugen: In einem Informationsbericht über die Heeresreform 2010 hieß es, diese sei im Zeitplan und werde umgesetzt. Ich sage, das war ein echter Türke, der hier aufgebaut wurde. (Präsident Neugebauer übernimmt den Vorsitz.)
Generalleutnant Commenda hat das hervorragend gemacht. Ich kenne ihn, er war mein Lehrer, Taktiklehrer, 1991; er weiß, wie das geht. Aber dass Sie, Herr Bundesminister Darabos, zwischenzeitlich auch schon wissen, was Tarnen und Täuschen ist und eine perfekte Tarnung vollzogen haben, das ist so, das stimmt so. (Beifall des Abg. Scheibner.)
Die Heeresreform 2010 ist einfach gescheitert. Es fehlt das notwendige Geld, und das hat Ihnen damals Ihr Vorsitzender der Bundesheer-Reformkommission gesagt, dass 2,5 Milliarden € fehlen, 1 Prozent des BIP.
Zusammengefasst, geschätzte Damen und Herren, ist zu sagen, das Bundesheer ist jetzt nur mehr eingeschränkt einsatzfähig und kann seine Aufträge nur teilweise erfüllen, wie etwa bei Katastrophen ähnlich dem Jahrhunderthochwasser im Jahr 2002. (Zwischenruf des Abg. Rädler.) Diesmal gibt es ein kleineres Hochwasser, wo 1 200 Leute im Einsatz sind.
Herr Bundesminister Darabos, wir wollen nicht, dass Sie sich jetzt als schlechtester Verteidigungsminister der Zweiten Republik fühlen, wie das in den Medien kommt, sondern wir wollen, dass Sie sich neben dem Sport wirklich auch der Landesverteidigung annehmen und die notwendigen Voraussetzungen für die Steigerung der Einsatzbereitschaft des Bundesheeres schaffen.
Schutz und Hilfe vom Bundesheer müssen garantiert werden. (Beifall beim BZÖ. – Abg. Rädler: Einrücken!)
11.00
Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Prähauser. – Bitte.
11.01
Abgeordneter Stefan Prähauser (SPÖ): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Hohes Haus! Dem Wehrrechtsänderungsgesetz 2009, mit dem das Wehrgesetz 2001 geändert wird, ging eigentlich eine sehr ersprießliche Ausschussarbeit voran, wo wir den Eindruck gewinnen konnten, dass Fragen wie Wehrpolitik, Bundesheer über Parteienhickhack hinaus behandelt werden. Wir haben uns im Ausschuss einstimmig für diese Änderung ausgesprochen.
Heute stelle ich fest, dass das nicht mehr so ist, wobei verschiedene Gründe dafür angeführt werden. Es ist das gute Recht jedes Abgeordneten, eine eigene Meinung zu publizieren oder kundzutun. Ich glaube aber, dass wir doch vielleicht versuchen sollten, das Bundesheer nicht als Instrument für politische Auseinandersetzungen heranzuziehen. Das Bundesheer hat es in Zeiten wie diesen ohnehin nicht leicht. Ich meine, meine Damen und Herren, dass gerade das Bundesheer, das wir ja schon vor ein paar Wochen wieder einmal totgeredet haben, in der letzten Zeit wieder bewiesen hat, was es zu leisten imstande ist.
Ich möchte bei dieser Gelegenheit allen Soldatinnen und Soldaten und auch allen anderen freiwilligen Helfern danken, die beim Hochwassereinsatz wieder in der vordersten Reihe gestanden sind und dazu beigetragen haben, ein unmöglich scheinendes Leben doch halbwegs zu bewältigen. (Beifall beim BZÖ.)
Meine Damen und Herren, das gilt aber auch für unsere Soldatinnen und Soldaten im Ausland oder im Assistenzeinsatz, die einen Auftrag des Nationalrates auf eine Art und Weise erfüllen, auf die wir stolz sein dürfen.
Es hat bereits 1960 mit den Auslandseinsätzen im Kongo begonnen – wissen wir heute natürlich nicht mehr, man redet ja nicht mehr darüber. Aber Österreich hat als kleines Land von Beginn an bei internationalen Einsätzen Hervorragendes geleistet und großen Respekt für unser Land eingefahren.
Meine Damen und Herren, diese Wehrrechtsreform bringt wesentliche Verbesserungen für die Soldatinnen und Soldaten, wesentliche Verbesserungen für Grundwehrdienerinnen und Grundwehrdiener, die in Zukunft den Dienst ableisten müssen.
Wir Sozialdemokraten sagen ganz klar: Wir stehen hier zur allgemeinen Wehrpflicht, wir stehen zur Miliz, wir stehen zu den Auslandseinsätzen und natürlich auch zu Strukturverbesserungen, die notwendig sind, wenn wir das alles wollen.
Wir wissen, dass es in einer finanziell schwierigen Situation nicht einfach sein wird, die nötigen Mittel zu bekommen. Ich glaube nicht, Herr List, dass die Heeresreform gescheitert ist. Die Heeresreform wird gestreckt. Anders ist es nicht möglich. Diese Dinge kosten auch Geld, das wir gemeinsam aufzubringen haben. Es darf nicht dazu führen, dass aufgrund von Mitteln, die dem Bundesheer zukommen, andere Ressorts benach-
teiligt werden. Wir wollen keinen Wettbewerb unter den Ressorts. Das verdient weder der Sozialbereich und schon gar nicht das Bundesheer.
Meine Damen und Herren, die schwierige finanzielle Situation hat das Bundesheer teilweise auch ein bisserl selbst mit zu verantworten, in welcher Form auch immer. Ich will jetzt letztendlich gar nicht über Panzerkäufe reden, die außer Defizit nichts gebracht haben. Wir werden heute noch darüber diskutieren. Auch die Anschaffung von Flugzeugen – wir haben das ausgiebigst diskutiert – hat natürlich Konsequenzen. Wir haben das aufzuzeigen versucht, sind aber bei Finanzminister Grasser auf taube Ohren gestoßen – und heute haben wir die Konsequenzen zu tragen.
Eigenartigerweise schreien genau jene, die am stärksten für dieses Flugzeug eingetreten sind, jetzt am lautesten: Herr Bundesminister Darabos, warum ist das alles so teuer?!
Jener Minister, der es geschafft hat, zu reduzieren, einzusparen, sollte plötzlich schuldig gemacht werden für einen Kauf, den andere zu verantworten haben! – Das allerdings lehnen wir ab. (Beifall bei der SPÖ.)
Ich habe das schon angeführt. Ich wollte heute eigentlich auch der Opposition Lob aussprechen, für die gute Diskussionsarbeit im Ausschuss danken. Das darf ich auch, das war auch so. Meine Enttäuschung darüber, dass es jetzt im Ausschuss nicht mehr gelingt, Einstimmigkeit herbeizuführen, möchte ich allerdings auch nicht verhehlen,
Eine weitere Änderung in diesem Gesetz führt auch dazu – und das ist mir ganz besonders wichtig –, dass die Bundesheer-Beschwerdekommission aufgewertet wird. Sie wird in Zukunft Bundesheerkommission für Beschwerdewesen heißen. Sie wird durch ihre Vorsitzenden vertreten, bei denen ich mich für ihre Arbeit wirklich bedanke, auch bei den Beamten, die sie unterstützen. Noch einmal herzlichen Dank!
Ich möchte aber auch den Offizieren und Verantwortlichen Folgendes nahelegen: Es darf nicht sein, dass Leute, die Beschwerde führen, das Gefühl haben, plötzlich gemobbt zu werden. Man muss mit Beschwerden auch umgehen können. Es ist immer wieder so, dass nachher das Gefühl herrscht: Es wäre besser gewesen, hätte ich mich nicht beschwert. Diese Einrichtung ist dazu da, gemeinsam das Beste für unsere Soldatinnen und Soldaten zu erreichen und, wenn Fehler gemacht werden, diese zu erkennen, zu diskutieren und abzustellen. Es sollte also keine Angst vor Repressalien geben.
Meine Damen und Herren, ich darf hier mit Stolz sagen: Österreich will auf sein Bundesheer, ja kann auf sein Bundesheer nicht verzichten. Wir sind stolz auf die Leistungen, die dort erbracht werden. Herr Minister Darabos, ich möchte mich ausdrücklich dafür bedanken, dass du den Angehörigen des Bundesheers das Gefühl gibst, für sie da zu sein. – Danke. (Beifall bei der SPÖ sowie des Abg. Amon.)
11.06
Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Dr. Pilz. – Bitte.
11.06
Abgeordneter Dr. Peter Pilz (Grüne): Meine sehr verehrten Damen und Herren! Im Wehrrechtsänderungsgesetz wird auch das Militärbefugnisgesetz geändert, und in diesem Militärbefugnisgesetz wollte der Verteidigungsminister ursprünglich (Abgeordnete von der FPÖ halten T-Shirts in die Höhe, auf denen geschrieben steht: „Euer Spitzel heißt Sailer“) den beiden Nachrichtendiensten ein volles Recht zum Onlinezugriff auf alle Datenbanken des Bundes, auch der Krankenhäuser und Stiftungen, einräumen.
Kolleginnen und Kollegen von der Freiheitlichen Partei ...
Präsident Fritz Neugebauer (das Glockenzeichen gebend): Darf ich Sie einladen – Ihre Botschaft wurde zur Kenntnis genommen –, bitte diese Demonstration einzustellen! – Ich danke.
Herr Dr. Pilz ist wieder am Wort.
Abgeordneter Dr. Peter Pilz (fortsetzend): Kolleginnen und Kollegen der FPÖ, ich weise Sie darauf hin, dass Sie das falsche T-Shirt hochhalten. Das richtige T-Shirt heißt: Eure Schande heißt Graf!, und das ist nach wie vor ein großes Problem (Zwischenrufe bei der FPÖ – Beifall bei den Grünen), das dieser Nationalrat mit Zweidrittelmehrheit zu lösen hat, denn jemand, der zu Recht (Zwischenruf des Abg. Strache) als ein einschlägig Tätiger in den politischen Kellern dieser Republik bezeichnet worden ist, darf sich nicht erfrechen, anderen Fraktionen hier Vorhaltungen zu machen, die wirklich jeder sachlichen Grundlage entbehren. (Abg. Strache: Der Spitzelskandal der Grünen!)
Also treten Sie zurück, Herr Präsident Graf (Beifall bei den Grünen), und verstecken Sie sich nicht hinter falschen Leibchen! (Zwischenrufe bei der FPÖ.) Meine Damen und Herren, ich verstehe die Aufgeregtheit der Freiheitlichen Partei, denn es wird nämlich im Bereich einer besonders sensiblen Materie in den nächsten Wochen ein heikler freiheitlicher Fall bekannt werden, der derzeit nur einigen wenigen Abgeordneten bekannt ist. Sie wissen genauso wie ich, vor welchem Fall besonders Abgeordneter Vilimsky Angst hat und jetzt Leibchen schwenkt. Aber ich werde heute nicht darüber reden, weil das noch der parlamentarischen Geheimhaltung unterliegt – noch! Dieser Fall wird nächste oder übernächste Woche öffentlich werden. (Abg. Grosz: Welcher Skandal?)
Jetzt reden wir über den Spitzelskandal im Zusammenhang mit dem Militärbefugnisgesetz. (Abg. Strache: Im Spitzelwesen kennt sich Herr Peter Pilz aus!) Ich werde Ihnen jetzt einige zusätzliche Informationen zum Fall des Abgeordneten Westenthaler vortragen. Das ist einer der seltenen Fälle, wo ich vollkommen seiner Meinung bin.
Mitte August 2008 hat eine Sitzung im Freiheitlichen Parlamentsklub, im BZÖ-Parlamentsklub – entschuldigen Sie, ich verwechsle das noch immer – stattgefunden, in der Abgeordneter Westenthaler BZÖ-Funktionäre einiger Drogendelikte bezichtigt, ein Handy in die Luft gehalten und erklärt hat, er könne dazu jederzeit Informationen aus der Bundespolizeidirektion Wien erhalten. (Oh-Rufe und Hört-Hört-Rufe bei der ÖVP.)
Diese Information ist Teil einer Anzeige bei der Kriminaldirektion I in Wien geworden, wo zu einem anderen Delikt ein dem BZÖ Nahestehender einvernommen worden ist und genau dies zu Protokoll gegeben hat.
Diese Information ist von der Kriminaldirektion I an das Büro für Interne Angelegenheiten weitergeleitet worden, die umgehend Anfang November die Staatsanwaltschaft verständigt hat.
Staatsanwalt Mag. Vecsey hat daraufhin unter der Aktenzahl 503 UT 1/09z das Büro für Interne Angelegenheiten mit Ermittlungen beauftragt. Mitte Oktober hat es einen Bericht des BIA an den Staatsanwalt gegeben. Ende Oktober hat es einen weiteren Ermittlungsauftrag an das BIA gegeben. Dieser hat am 8. Jänner 2009 durch Staatsanwalt und Richter zur Anordnung einer Rufdatenrückerfassung geführt. Diese Rufdatenrückerfassung ist durchgeführt worden – und erst nach der Rufdatenrückerfassung ist Abgeordneter Westenthaler vom BIA auf Anregung des Staatsanwaltes als Zeuge einvernommen worden. (Abg. Rädler: Woher haben Sie diese Information? – Abg. Neubauer: Woher wissen Sie das?)
Zwei Punkte sind meiner Meinung nach bedenklich, einer davon ist eindeutig rechtswidrig. Bedenklich ist, dass ein Abgeordneter eine Rufdatenrückerfassung über sich ergehen lassen muss – und erst dann einvernommen wird. Die ordnungsgemäße Vor-
gangsweise wäre umgekehrt. Möglicherweise illegal ist die Vorgangsweise, den Abgeordneten Westenthaler wie mich in einer anderen Causa als Zeugen zu befragen und damit das Immunitätsgesetz des Nationalrates zu umgehen. (Beifall bei den Grünen sowie des Abg. Grosz.) Meine Damen und Herren, so geht das nicht!
Wir haben hier gemeinsam, und zwar die Abgeordneten aller Fraktionen gemeinsam, ein großes Problem. Mir ist genau dasselbe passiert rund um die Strasser-E-Mails, wo ich einen Brief des Staatsanwaltes Walzi erhalten habe, der dem Büro für Interne Angelegenheiten den Auftrag erteilt – ich lese Ihnen nur den Schluss vor –:
Wir ersuchen „um Ergänzung des Sachverhalts durch zeugenschaftliche Einvernahme des AbgzNR Dr. Peter Pilz, wann und wo ihm der fragliche Mailverkehr zugekommen ist. ...
Falls Dr. Pilz im Besitz eines von UT“ –
unbekanntem Täter –
„übermittelten Datenträgers sein sollte, so wird ersucht um Abklärung, ob durch dessen Auswertung Informationen gewonnen werden können, die Rückschlüsse auf die Person des UT zulassen. Erforderlichenfalls wird um Übermittlung einer Anregung der Beschlagnahme ersucht.“
Da wird die Beschlagnahme eines Computers eines Abgeordneten vom Staatsanwalt angeregt und vorbereitet. (Zwischenruf des Abg. Rädler.) Wissen Sie, meine Damen und Herren dieses Hauses, was das für unsere Arbeit bedeutet: wenn ich keine Beschuldigtenrechte habe, wenn der Staatsanwalt auf meinen Computer mit Beschlagnahme zugreifen will? Da geht es nicht um den Abgeordneten Westenthaler und mich.
Präsident Fritz Neugebauer: Bitte um den Schlusssatz!
Abgeordneter Dr. Peter Pilz (fortsetzend): Ja, Herr Präsident! – Da geht es um Menschen, die sich voller Vertrauen an Abgeordnete wenden, glauben, wenn sie Missstände aufdecken und bekämpfen wollen, dass Abgeordnete unter vollem Schutz ihres Vertrauens diese Missstände im Parlament bekämpfen können. Und plötzlich erfahren sie, dass der Staatsanwalt seine Funktion missbraucht, das Immunitätsrecht und alle parlamentarischen Schutzrechte ignoriert, um auf sogenannte Lecks draufzukommen. (Beifall bei den Grünen sowie des Abg. Grosz. – Abg. Grosz: Das Gleiche kann einem Journalisten auch passieren, wenn er als Zeuge geführt und dann abgehört wird!)
11.13
Präsident Fritz Neugebauer: Sie haben die Redezeit weit überschritten, Herr Kollege.
Nächster Redner: Herr Abgeordneter Ing. Kapeller. – Bitte.
11.13
Abgeordneter Ing. Norbert Kapeller (ÖVP): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Werte Kollegen! Als Wehrsprecher meiner Partei möchte ich bei diesem Tagesordnungspunkt tatsächlich zum Heer reden, weil das auch Thema sein sollte.
Liebe Kollegen vom BZÖ, ich finde es schon eigenartig, wenn man vom Rednerpult aus sagt, man wird gewisse Beschlüsse, wenn sie auch inhaltlich richtig sind und man sie inhaltlich auch mittragen könnte, trotzdem nicht mittragen, weil man es mit etwas anderem verquickt.
Lieber Kollege List, das verstehe ich persönlich nicht. Dir als Offizier des Bundesheers hat es genauso wie mir als Wehrsprecher nur darum zu gehen, dass für das Heer das Beste herauskommt. Daher verstehe ich die vom BZÖ eingenommene Haltung nicht. (Beifall bei der ÖVP.)
Sachlich wurde vom Kollegen Prähauser eigentlich das gesamte Paket dargestellt. Auch ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich bei der Bundesheer-Beschwerdekommission – wie sie bisher geheißen hat – für ihre Arbeit herzlich bedanken. Ich denke, durch diese Aufwertung der Bundesheer-Beschwerdekommission erreichen wir auch eines: eine Art Demokratisierung im Heer, was wiederum bedeutet, den Soldatenberuf für Zivilisten attraktiver zu machen. Und das ist äußerst notwendig, um das Bundesheer in Funktion halten zu können.
Es gibt viel Gutes, es gibt aber auch einiges, was man hinterfragen muss und was man fordern muss. Daher möchte ich mit Folgendem beginnen. Wir haben in einer der letzten Ausschusssitzungen gehört, wo das Bundesheer jetzt in der Reform steht. Ich möchte noch mehr wissen. Ich möchte auch um eines bitten: Herr Bundesminister, setzen wir endlich gemeinsam eine externe Evaluierungskommission ein, damit wir in diesem schwierigen Transformationsprozess wirklich wissen, wo das Heer tatsächlich steht, wo nachzujustieren ist. Ich denke, der Blick von außen ist immer besser, als sich selbst zu überprüfen und selbst gutzuheißen, was bis jetzt geschehen ist.
Ich denke auch, dass es in Zeiten wie diesen, in denen es Budgetknappheit gibt, doch auch darum geht, die richtigen Akzente zu setzen, und ich halte es für besonders wichtig, im Beschaffungswesen ein paar Eckpunkte auch einzuhalten – dies auch in Zukunft.
Die Anschaffung des ATF, des Allschutz-Transportfahrzeuges, ist so wichtig für unsere Soldaten, die im österreichischen Namen im Ausland tätig sind, um den bestmöglichen Schutz bei ihrem Einsatz zu haben. (Beifall bei der ÖVP.) Dazu brauchen wir irgendeine Marke für den ATF. Kommt dieses Gerät, oder was tun wir damit?
Es ist aber auch das Update des AB 212, unseres Hubschraubers, für den Inlandseinsatz so notwendig. Dieser Hubschrauber muss bei jeder Witterung flugtauglich sein, um zu retten und um zu helfen. Wie sieht es da genau aus?
Zum Beschaffungswesen eine letzte Frage von mir: Wir haben Eurofighter, wir haben den Luftraum für unsere Bürgerinnen und Bürger zu überwachen. Daher brauchen wir auch ein entsprechendes Schulungsflugzeug, um die Piloten für diese Luftraumüberwachung auch künftig zu haben.
Ich möchte auch noch eine soziale Komponente erwähnen, die im Heer sehr, sehr wichtig ist. Ja, wir haben in einer der letzten Sitzungen für die von der Reform Betroffenen, für die, die derzeit aufgrund der Reform keinen Arbeitsplatz innehaben, im Heeresressort den § 113h Gehaltsgesetz verlängert – eine soziale Errungenschaft, damit die nicht ins Bodenlose fallen. Ich behaupte aber, wir müssen uns ab Herbst auch darüber Gedanken machen, was wir mit Mitarbeitern im Ressort machen, die aufgrund ihres Alters keinen entsprechenden Arbeitsplatz mehr finden werden können.
Wir müssen Vorruhestandsmodelle analog jenen der Lehrer in Erwägung ziehen, damit es wirklich auch soziale Treffsicherheit für jene gibt, die es sich nicht ausgesucht haben, ob die Reform in diesem oder jenem Sinn stattfindet. Wir haben Politik zu machen für jene, die im Heeresressort für unser aller Sicherheit, für unseren Schutz da sind, und das möchten wir auch entsprechend tun.
Abschließend möchte ich mich, sehr geehrter Herr Minister, für den Entschluss bedanken, die AirPower wieder abzuhalten. Die AirPower war ein voller Erfolg: mehr als 300 000 Besucher in zwei Tagen in Zeltweg, ein friedliches, ruhiges Miteinander. Ich habe als Polizeibeamter kaum eine Großveranstaltung beobachten dürfen, die so friedlich und so komplikationslos abgelaufen wäre.
Daher ein herzliches Dankeschön an die kompetenten Stellen, die diese Veranstaltung auch ausgerichtet haben. Ich denke, es war die beste Möglichkeit, dass unser Bundes-
heer eine Leistungsshow bietet, sein Leistungsspektrum darstellt. Ich denke, dies wäre eine Veranstaltung, die wieder im Zweijahresrhythmus abgehalten werden könnte. – Danke schön. (Beifall bei der ÖVP sowie bei Abgeordneten von SPÖ und FPÖ.)
11.18
Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Klubobmann Strache. – Bitte.
11.18
Abgeordneter Heinz-Christian Strache (FPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Minister! Kurz ein paar Worte zum Wehrrechtsänderungsgesetz. Die Änderung des Namens Bundesheer-Beschwerdekommission auf Parlamentarische Bundesheerkommission sehen wir positiv, ebenso, dass es jetzt bessere Aufschubmöglichkeiten für den Wehrdienstantritt geben wird, wenn junge Menschen sich in Ausbildung befinden und ein Studium machen. Das sind durchaus positive Veränderungen, die wir auch positiv sehen und durchaus unterstützen.
Angesichts des Spitzelskandals gegen Abgeordnete, der sich ausgeweitet hat, mit konkreten Informationen, Unterlagen, aus denen ich auch jetzt zitieren werde, ist klar, dass jetzt rege Betriebsamkeit im grünen Klub herrscht und hier nur mehr Hinterbänkler zu sehen sind. Der Rest ist offenbar im Klub der Grünen und versucht offenbar, Beweismittel wegzuschaffen.
Hektische Betriebsamkeit also, da offenbar zu Recht Nervosität bei Ihnen im grünen Klub ausgebrochen ist. (Zwischenruf der Abg. Dr. Moser.)
Eines steht fest: Eure Schande heißt Abgeordneter Öllinger! Eure Schande heißt Öllinger, und euer Spitzel heißt Sailer. (Beifall bei der FPÖ.)
Es steht fest – dokumentiert und mit Unterlagen belegbar –, dass ein Beamter des Innenministeriums, der für den Verfassungsdienst als EDV- und IT-Spezialist tätig war und der heute für das Stadtpolizeikommando in Linz tätig ist, mit dem Herrn Abgeordneten Öllinger in Kontakt steht (Ah-Rufe bei der FPÖ), und dass der Herr Abgeordnete Öllinger bei dem Beamten Uwe Sailer in Auftrag gegeben hat, Personen zu kontrollieren, zu recherchieren (Rufe bei der FPÖ: Unglaublich!), dass Abgeordnete dieses Hauses auch in einem dokumentierten Bereich von Unterlagen vorkommen, der uns vorliegt.
Da kommt meine Person vor, und es finden auch Herr Abgeordneter Fichtenbauer oder Herr Präsident Graf Erwähnung, bis zum Abgeordneten Weinzinger. – Das ist ein Skandal! Sie haben einen Spitzelskandal zu verantworten, den größten Spitzelskandal der Zweiten Republik! (Beifall bei der FPÖ. – Rufe und Gegenrufe zwischen Abgeordneten von FPÖ und Grünen.)
Vor diesem Hintergrund muss man schon einmal gewisse Fragen stellen und auch die Laptop-Diebstähle und Einbrüche in Ministerbüros in einem völlig anderen Licht sehen. (Abg. Dr. Moser: Sie haben so viel Butter auf dem Kopf!) Das sollte man da auch durchaus einmal erwähnen. (Abg. Dr. Moser: Es tropft und tropft!)
In einem Brief schreibt Herr Abgeordneter Öllinger:
Lieber Herr Sailer! Ich muss erst die Tagesordnung der Plenartage durchforsten, ob der Verteidigungsminister noch kommt. Ich will ihm klarmachen, dass ich eine saubere und rasche Antwort erwarte, wobei das unter anderem sehr leicht abgetan werden kann, Datenschutz und so. – Zitatende.
Na, klar, wenn es darum geht, dass man gegenüber anderen tätig wird, da ist der Datenschutz für die Grünen nicht wichtig! (Zwischenrufe der Abgeordneten Dr. Moser und Dr. Walser.)
Weiters schreibt Abgeordneter Öllinger: Mein Problem ist, dass ja die Wahlen sehr rasch im Herbst stattfinden –
gemeint sind wohl die Landtagswahlen in Oberösterreich! –
und erfahrungsgemäß in den letzten Wochen es kaum mehr möglich ist, Geschichten wie diese zu platzieren. Also wenn Sie hier eine Möglichkeit sehen, dass ich zu zusätzlichen Infos –
schreibt Abgeordneter Öllinger an Uwe Sailer! –
aus anderen Quellen komme, die belegen, dass der Herr Detlef Wimmer – ein Funktionär aus Oberösterreich – irgendetwas mit dem BFJ zu tun hat, dann bitte sofort mitteilen. Das gibt einen ordentlichen Schub für diesen Landtagswahlkampf. – Zitatende. (Ah-Rufe bei der FPÖ.) Das ist der Herr Kollege Öllinger! (Abg. Vilimsky: Wahnsinn!)
Ich frage Sie, Herr Minister Darabos: Hat Herr Abgeordneter Öllinger, wie er dem Beamten des Innenministeriums Uwe Sailer schon angedeutet hat, schon das Gespräch mit Ihnen gesucht, um Sie vielleicht auch dahin gehend schon einmal indirekt – oder vielleicht auch direkt – ein bisschen zu schubsen, dass Sie beim Datenschutz nicht so genau sind, wenn da eine Anfrage kommt, damit sie vielleicht rechtzeitig und auch noch ohne Datenschutzkriterien vor der oberösterreichischen Wahl Beantwortung findet, damit wieder eine Kampagnisierung vorgenommen werden kann? – Das ist die Methode, die Sie leben – eine Spitzelwesenmethode, Herr Öllinger, aufgrund derer Sie zurücktreten sollten! (Abg. Vilimsky: Das sind Methoden!) Sie sind dieses Hauses nicht würdig! (Beifall bei der FPÖ. – Abg. Vilimsky – in Richtung Grüne –: Nazi-Methoden!)
Herr Abgeordneter Öllinger, Sie treten Freiheits- und Grundrechte mit Füßen – dokumentierbar! Sie treten Menschenrechte mit Füßen, und ich sage, es wird daher notwendig sein, einen Untersuchungsausschuss in dieser Causa einzurichten.
Sie, Herr Öllinger, belegen mit diesen Unterlagen, dass auf Basis dieser Dokumente und Unterlagen eine Verselbständigung von Beamten im Innenministerium durchaus möglich ist, welche ein Spitzelwesen, einen Staat im Staat geschaffen haben und für Sie tätig werden! (Abg. Dr. Moser: Ihre Unterlagen sind Schmierzettel, sonst nichts!)
Ich weiß nicht, was vielleicht noch dahintersteht, warum der Herr Uwe Sailer für Sie tätig geworden ist. Vielleicht zahlen Sie ihm auch etwas dafür, damit er für Sie tätig werden kann. Vielleicht zahlen Sie ihm auch etwas dafür! (Ruf bei der ÖVP: „Angefüttert!“) Da passt dann auch das Anti-Korruptionsgesetz perfekt in diesen Rahmen, und das sollten wir hier auch beleuchten. (Beifall bei der FPÖ.)
In diesen Unterlagen ist auch enthalten, wie dann der Herr Öllinger vom Beamten Uwe Sailer angeschrieben wird, und ich halte fest: Nach Durchsicht dieser Unterlagen ist klar, der Beamte, der den Telefonabhörskandal von Peter Westenthaler zu verantworten hat, hat sofort suspendiert zu werden, aber auch der Beamte Uwe Sailer, und zwar aufgrund dieser vorliegenden Protokolle. (Beifall bei der FPÖ.)
Abschließend möchte ich sagen: Das ist nicht tragbar! Wir verlangen volle Aufklärung (Abg. Öllinger: Ja, bitte!) und werden auch der Öffentlichkeit volle Aufklärung zukommen lassen. (Beifall bei der FPÖ sowie bei Abgeordneten des BZÖ.)
11.24
Präsident Fritz Neugebauer: Zu Wort gelangt Herr Bundesminister Mag. Darabos. – Bitte.
11.24
Bundesminister für Landesverteidigung und Sport Mag. Norbert Darabos: Hohes Haus! Herr Präsident! Danke für die Möglichkeit, dass wir über das Wehrrechtsänderungsgesetz reden können. (Abg. Vilimsky – in Richtung Grüne –: Grüne Nazi-Methoden! Das sind Ihre Methoden! – Abg. Dr. Walser: Das sind Ihre Methoden! – Abg. Vilimsky: Nein, das sind Ihre Methoden! – Präsident Neugebauer gibt das Glockenzeichen.) Ich bedauere – das sage ich ganz offen –, dass die Diskussion über diesen sehr wichtigen Bereich überschattet wird von ... (Anhaltende Rufe und Gegenrufe zwischen Abgeordneten von FPÖ und Grünen.)
Präsident Fritz Neugebauer: Herr Bundesminister Darabos ist am Wort!
Bundesminister für Landesverteidigung und Sport Mag. Norbert Darabos (fortsetzend): Ich bedauere, dass diese Debatte von einer zugegebenermaßen wichtigen Diskussion überschattet wird und möchte nur, da ich ja hinter den Rednern sitze, für das Österreichische Bundesheer festhalten, dass das Österreichische Bundesheer mit dieser Diskussion absolut nichts zu tun hat, ebenso wie die Novelle, die wir heute zu beschließen haben, nichts mit dem Bankgeheimnis zu tun hat. (Beifall bei der SPÖ.)
Ich möchte die Gelegenheit dazu nutzen – das ist im Interesse der österreichischen Bevölkerung –, ein mehrfaches Dankeschön zu sagen. Mein Dank gilt den Soldatinnen und Soldaten, die seit 23. Juni im Hochwassereinsatz stehen – im Schnitt an die 700 Männer und Frauen mit 137 000 Stunden Arbeitseinsatz –, die dazu beigetragen haben, neben den anderen Einsatzorganisationen wie der Freiwilligen Feuerwehr oder den Berufsfeuerwehren (Abg. Pendl: Rettungsorganisationen), eines der größten Hochwasser in Österreich zumindest zu lindern und zu bekämpfen, und die jetzt nach wie vor bereit sind, in Mannstärken von mehr als 700 Mann auch bei den Aufräumarbeiten dabei zu sein. Ich denke, das ist auch im Sinne des österreichischen Parlaments, dass man sich bei diesen Soldatinnen und Soldaten bedankt. (Beifall bei der SPÖ sowie bei Abgeordneten von ÖVP, FPÖ und BZÖ.)
Wir – das Österreichische Bundesheer – zeigen damit, dass wir kein Selbstverwaltungskörper sind, sondern eine der besten Einsatzorganisationen Österreichs, und das oft als Schlagwort titulierte Konstrukt „Schutz und Hilfe“ ist eben kein Schlagwort, sondern es zeigt sich, dass das Österreichische Bundesheer in der Lage ist, willens ist, wenn Not am Mann/an der Frau ist, zu helfen – und das auch im Sinne der Bevölkerung tut! Das kann man nicht hoch genug einschätzen.
Ich möchte dazusagen – weil diese Diskussion auch zum Teil in den Ausschüssen geführt wurde –: Wir können jederzeit 10 000 Soldatinnen und Soldaten für Katastrophenschutz aufbieten. Daneben haben wir noch 800 Soldatinnen und Soldaten im Assistenzeinsatz an der Ostgrenze. – Auch da ein offenes Wort – das wird in gewissen Wiener Zirkeln nicht so gerne gehört (Abg. Scheibner: „Wiener Zirkeln“!) –, auch da haben wir die Bevölkerung hinter uns, in der Ostregion, in Niederösterreich und dem Burgenland, die stehen dazu.
Wir haben 1 200 Soldatinnen und Soldaten in Auslandseinsätzen, auch dieses Engagement für UNO-Einsätze wird international registriert. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon lobt Österreich bei jeder Gelegenheit als eines jener Länder, das personell am stärksten an UN-Auslandseinsätzen mitwirkt. Und wir haben, wie gesagt, eben im Schnitt mehr als 700 Soldatinnen und Soldaten im Hochwassereinsatz gehabt. Das heißt, das Österreichische Bundesheer ist leistungsstark, ist leistungsbereit, ist kompetent und hat deshalb auch einen guten Ruf in der österreichischen Bevölkerung.
Wir haben nebenbei noch die AirPower09 veranstaltet. Wir haben eine Großübung im Raum Allentsteig mit 2 100 Soldatinnen und Soldaten durchgeführt. Da soll jetzt noch irgendjemand in Österreich sagen, die Leistungsbereitschaft des Österreichischen
Bundesheeres bestehe nicht! – Sie besteht natürlich, und sie wird auch in Zukunft bestehen. (Beifall bei der SPÖ.)
Es gäbe sehr viel zu gewissen Redebeiträgen zu sagen, obwohl sehr wenig über diese Novelle gesprochen wurde. Ich möchte aber ganz kurz auf diese Novelle eingehen. Ich bin ein bisschen traurig darüber, dass die Einstimmigkeit, die in den Ausschüssen geherrscht hat, jetzt plötzlich aufgeweicht wurde, eben weil man es mit dem Bankgeheimnis junktimiert.
Man hat sich im Landesverteidigungsausschuss dazu durchgerungen, das einstimmig zu beschließen. Das wird jetzt nicht erfolgen. Ich danke aber trotzdem all jenen, die dafür stimmen, weil es aus meiner Sicht einfach eine wichtige Novelle ist, und ich sage auch, warum sie wichtig ist: Wir haben eine strukturelle Überarbeitung des Wehrgesetzes 2001 durchgeführt, und es beinhaltet wesentliche Verbesserungen für Grundwehrdiener. Der Mensch steht im Mittelpunkt dieser Novelle. Der Grundwehrdiener ist die Basis des Österreichischen Bundesheeres.
Deshalb ist genau das, was heute beschlossen wird, so wichtig, nämlich Verbesserungen bei der Einberufung. Da geht es etwa darum, dass man diese aufschieben kann, wenn man eine Fachhochschulausbildung absolviert. Das halte ich nicht für ein Ausnutzen eines Privilegs, sondern ganz im Gegenteil, es ist für das Österreichische Bundesheer eine wichtige qualitative Maßnahme, denn solche Grundwehrdiener, die nach ihrer Fachhochschulausbildung zum Bundesheer kommen, sind natürlich auch in der Qualität ihrer Arbeit stärker gefordert, können noch mehr leisten und sind – Herr Kollege Ikrath, Sie werden sich ja noch zu Wort melden – auch ein potentielles Feld für uns, was den Milizgedanken betrifft, weil sie neue Qualitäten ins Österreichische Bundesheer einbringen können. Insofern bin ich all jenen dankbar, die dieser Novelle zustimmen werden.
Das Österreichische Bundesheer ist tief in der österreichischen Gesellschaft verankert, und ich halte es – das möchte ich heute auch noch einmal erneuern – für ganz wichtig, dass wir – als neutrales Österreich, im Gegensatz zu anderen europäischen Staaten – den Weg gewählt haben, das Bundesheer aus Kadersoldaten, Grundwehrdienern und aus der Milizkomponente zusammenzusetzen. Das ist einerseits gut für die Durchmischung des Österreichischen Bundesheeres und andererseits, aus meiner Sicht, auch demokratiepolitisch ganz wichtig.
Wir haben auch im Bereich soziale Betreuung einiges an Verbesserungen vornehmen können. Die Verbesserung im Bereich der sozialen Betreuung – auch für Angehörige – halte ich für eine ganz, ganz wichtige Maßnahme. Sie haben das – mit Ihrer Zustimmung, die ja jetzt hoffentlich erfolgen wird – auch erkannt und wir werden somit auch in diese Richtung tätig werden, die grundsätzlich richtig ist.
Zur parlamentarischen Bundesheer-Beschwerdekommission: Zwei der Vorsitzenden, die ehemaligen Abgeordneten dieses Hauses Toni Gaál und Paul Kiss, sind ja heute hier unter uns. Ich möchte mich für Ihre Arbeit bedanken! (Beifall bei Abgeordneten von SPÖ und ÖVP für die auf der Galerie sitzenden Vorsitzenden der parlamentarischen Bundesheer-Beschwerdekommission Anton Gaál und Paul Kiss.)
Ich sehe es genau so, wie es Kollege Kapeller gesagt hat: Die Beschwerdekommission ist keine feindliche Einrichtung für das Österreichische Bundesheer, sondern eine Hilfe für den Minister. Die parlamentarische Kontrolle ist einfach wichtig.
Lieber Toni, lieber Paul, danke vielmals für eure Arbeit! Wir haben in den letzten Jahren sehr gut zusammengearbeitet. Ihr habt den Finger auf die Wunde gelegt, das war wichtig; und die Änderungen, die wir jetzt durchführen – nämlich eine zusätzliche Mög-
lichkeit zu schaffen, dass ihr auch ein Rederecht in den Ausschüssen bekommt –, halte ich für gut und richtig. Ich darf euch ermuntern, in diesem Sinne weiterzuarbeiten.
Ich habe meine Redezeit schon überschritten und darf mich daher noch für Ihre Zustimmung zu diesem Gesetz bedanken und damit schließen. (Beifall bei der SPÖ sowie bei Abgeordneten der ÖVP.)
11.32
Präsident Fritz Neugebauer: Als Nächster gelangt Herr Abgeordneter Scheibner zu Wort. – Bitte.
11.32
Abgeordneter Herbert Scheibner (BZÖ): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich darf mich dem Dank an die Beschwerdekommission anschließen. Gerade wenn ich meinen ehemaligen Kollegen und Freund Toni Gaál hier sehe, darf ich auch einmal Folgendes sagen: Als wir erfahren haben, dass es einen SPÖ-Verteidigungsminister geben soll, haben wir uns alle gewünscht, dass er der Minister sein wird, weil dann wahrscheinlich die Dinge, die sich in den letzten Jahren im Verteidigungsministerium abgespielt haben, nicht passiert wären. (Abg. Heinzl: Na geh!) Schade, dass die Entscheidung nicht auf Toni Gaál gefallen ist. (Beifall beim BZÖ sowie des Abg. Dr. Pilz.)
Wenn Sie das anders sehen, dann mag das so sein. Herr Minister, Sie haben zwar ... (Zwischenrufe der Abgeordneten Faul und Mag. Josef Auer.) – Kollege Faul! Ja, er wird wieder munter heute! Bei der Landesverteidigung bitte ganz still sein, denn dabei geht es wirklich um etwas sehr Wichtiges und nicht um deine Selbstdarstellung!
Herr Bundesminister Darabos, wir stimmen Ihnen beim Dank an die Soldaten des Bundesheeres zu, die jetzt wirklich mit unermesslichem Einsatz im Hochwasser für die Bevölkerung gekämpft haben. Aber dieses selbstgefällige Lob, dass alles in Ordnung sei, das ist unangebracht. Diese Soldaten – die ihr Leben und ihre Gesundheit für die Sicherheit dieses Landes einsetzen – erwarten sich, dass ein Minister an der Spitze steht, der nicht alles gesundbetet, sondern auch ganz klar sagt, was notwendig ist, um die Einsatzbereitschaft herzustellen und zu erhalten. (Beifall beim BZÖ. – Abg. Bucher: Sie haben einen Selbstverteidigungsminister!)
Sie brauchen einen Minister, der auch dann etwas sagt, wenn es darum geht, mehr Geld zu bekommen; der für die Soldaten und die Notwendigkeiten kämpft und nicht sagt: Ich bin ja froh, dass ich jetzt das Sportressort habe, jetzt darf ich wieder ein paar Pokale verteilen, das ist alles, was wichtig ist, und ansonsten möchte ich mich mit den Problemen nicht befassen! Darum geht es, meine Damen und Herren! (Abg. Faul: ... Eurofighter hinausgeschmissen, Herr Scheibner!)
Sie haben gesagt, dass jetzt 1 200 Soldaten im Einsatz waren und dass alles in Ordnung ist. Sie wissen ganz genau, dass das Hochwasser 2002 12 000 Soldaten erfordert hat, die wir heute nicht mehr hätten. (Beifall beim BZÖ sowie bei Abgeordneten der ÖVP. – Abg. Faul: Sie haben es ruiniert, Herr Scheibner! Sie haben das Heer ruiniert mit sinnlosen Einkäufen!) Darüber müssen wir diskutieren, meine Damen und Herren, denn Sie können nicht garantieren, dass ein derartiges Hochwasser nicht nächstes Jahr oder schon in wenigen Wochen wieder kommt.
Sie haben die Miliz angesprochen, meine Damen und Herren. Im Gegensatz zu dir, lieber „Oberg’scheiter“, bin ich auch ein Milizsoldat. (Neuerlicher Zwischenruf des Abg. Faul.) Herr Minister, ich habe meine Einberufung für den September bekommen; ich werde dieser Einberufung natürlich nachkommen. (Beifall beim BZÖ.)
Welchen Auftrag haben wir als Milizsoldaten? Es gibt nach wie vor keinen Auftrag für die Miliz. Tausende Österreicher und auch Österreicherinnen stellen sich freiwillig in den Dienst dieser Sache – und es gibt keinen Auftrag. – Sie wissen es. Es gibt auch
nicht die Möglichkeit, diese Milizsoldaten – etwa für den Katastrophenschutz oder die Terrorabwehr – einzuberufen. Das sind die Dinge, über die Sie sich unterhalten sollten.
Wenn wir schon über die Flugzeuge reden, meine Damen und Herren, dann lassen Sie mich dazu sagen: Sie sind – aus parteipolitischen Gründen – zu Lasten der Sicherheit und zu Lasten des Bundesheeres einen schlechten Kompromiss eingegangen. Allein die Stornogebühren wären schon ein so hoher Betrag gewesen wie der, um den Sie jetzt reduziert haben; und nicht einmal das reduzierte Geld haben Sie für das Bundesheer eingefordert, aber das würde man sich von einem aktiven Verteidigungsminister erwarten. Wir hoffen, dass bald einmal Leute kommen werden – so wie es Toni Gaál gewesen ist –, die wirklich mit dem Herzen und mit dem Verstand hinter dem Bundesheer stehen. (Beifall beim BZÖ. – Abg. Faul: Hoffentlich kommen nie mehr Leute wie Scheibner, nie mehr!)
11.35
Präsident Fritz Neugebauer: Als Nächster gelangt Herr Abgeordneter Köfer zu Wort. – Bitte.
11.35
Abgeordneter Gerhard Köfer (SPÖ): Geschätzter Herr Präsident! Hohes Haus! Herr Bundesminister! Herr Kollege Scheibner, in Ihrer Zeit als Verteidigungsminister hatten Sie maximal 12 000 Soldaten im Einsatz. Bei diesem Hochwassereinsatz sind 14 000 Soldaten zur Verfügung gestanden. – So viel zur Richtigstellung. (Abg. Scheibner: Wer sagt das? Der Bundesminister?) – Nehmen Sie es so hin, wie es ist!
Es ist spannend mitzuerleben, wie man aus einem Landesverteidigungsausschuss einen Bankgeheimnisausschuss machen und einen Spitzelskandal thematisieren kann, ganz zu schweigen von diesen peinlichen Angriffen gegen den Kollegen Faul – die möchte ich aber in dieser Form nicht kommentieren.
Geschätzte Damen und Herren! Nicht nur inmitten Europas stehen täglich hunderte gut ausgebildete und motivierte österreichische Soldatinnen und Soldaten im internationalen Friedenseinsatz, sie leisten nicht nur im Kosovo, sondern auch im Tschad und am Golan einen wertvollen Beitrag zur Sicherheit der dort in Konflikten lebenden Bevölkerung. (Abg. Dr. Königshofer: ... es sich leisten kann! ... Sicherheit im Tschad, im Kosovo! ... französische Fremdenlegionäre!)
Um für derartige internationale Friedenseinsätze bestmöglich ausgebildet zu sein, bedarf es neben einer hochmodernen Ausrüstung auch einer international anerkannten Vorbereitung. Da unsere Armee bei Friedenseinsätzen mit Streitkräften anderer Nationen zusammenarbeiten muss, finden immer öfter gemeinsame Übungen in Kompaniestärke mit Armeeeinheiten der Bundesrepublik Deutschland statt.
Gemäß deutschem Recht ist es aber für den Aufenthalt fremder Truppen notwendig, ein bilaterales Abkommen zu schließen. Das Streitkräfteaufenthaltsabkommen zwischen Österreich und Deutschland stellt nunmehr die österreichische Truppenpräsenz bei gemeinsamen Übungen auf deutschem Boden auf eine gesetzmäßige Basis.
Meine Damen und Herren! Militärische Kooperationen, vor allem mit der Bundesrepublik Deutschland, waren in den vergangenen Jahren immer schon sehr erfolgreich und für beide Seiten von Vorteil, und – wie ich es selbst miterleben durfte – auch von einer besonderen Kameradschaft getragen. Profitiert Österreich zum Beispiel von den ausgezeichneten Flugtrainingsmöglichkeiten der deutschen Armee, so kann Österreich wiederum mit seiner exzellenten Hochgebirgsausbildung und der damit verbundenen Erfahrung – wie sie auch beim Jägerbataillon 26 gegeben ist – bei den deutschen Soldatinnen und Soldaten punkten. Vor allem alpine Kriseneinsätze sind nach den verhee-
renden Naturkatastrophen durchaus weltweit denkbar, und unser Know-how auf diesem speziellen Gebiet ist international anerkannt.
Abschließend möchte ich allen österreichischen Soldatinnen und Soldaten – besonders meinen Soldaten vom Jägerbataillon 26, die sich derzeit im Ausland, wo auch immer in der Welt, befinden – meinen Dank für ihre internationale Friedensmission aussprechen und ihnen alles Gute wünschen. Ich wünsche ihnen vor allem aber, dass sie alle wieder gesund nach Hause kommen. (Beifall und Bravorufe bei der SPÖ.)
11.38
Präsident Fritz Neugebauer: Als Nächster gelangt Herr Abgeordneter Dr. Pilz zu Wort. – Bitte. (Oje-Rufe bei der ÖVP.)
11.38
Abgeordneter Dr. Peter Pilz (Grüne): Meine sehr geehrten Damen und Herren! Im Zusammenhang mit dem Militärbefugnisgesetz nehme ich noch einmal zum Spitzelskandal, von dem der österreichische Nationalrat betroffen ist, Stellung. (Abg. Strache: Jetzt wissen wir, woher er die Informationen hat! Vom Herrn Sailer!) Zum Ersten bin ich dafür, dass wir alle Vorwürfe ernst nehmen – auch jenen gegen den Abgeordneten Öllinger, der einer privaten Firma von Uwe Sailer, nämlich einem Institut für Datenforensik, einen Auftrag erteilt hat. (Ruf bei der ÖVP: Oberspitzel und Schnüffler! – Rufe bei der FPÖ: Bitte! Bitte! – Abg. Vilimsky: Unglaublich! Amtsmissbrauch! Der Verfassungsschutz ...! – Abgeordnete von der FPÖ halten T-Shirts mit der Aufschrift „Euer Spitzel heißt Sailer“ in die Höhe.)
Ich bin dafür, dass alle Vorwürfe – auch die der Freiheitlichen Partei – im Rahmen eines Untersuchungsausschusses geklärt werden. (Abg. Strache: Jetzt wird’s spannend! Ein Beamter nimmt Privataufträge an!) Ich gehe davon aus, dass kein Abgeordneter dieses Hauses irgendetwas zu verbergen hat, und ich gehe auch davon aus, dass alle Abgeordneten dieses Hauses ein gemeinsames Interesse an einer Aufklärung haben.
Deswegen werden wir heute den Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Untersuchung der Spitzelaffäre stellen. (Abg. Dr. Graf: Haben eh schon wir ...!) All diese Fakten und alle Vorwürfe, die von Abgeordneten in diesem Zusammenhang geäußert werden, sollen dort untersucht werden.
Ich schlage zwei Themen vor, nämlich erstens: die unzulässige Überwachung von Abgeordneten, egal, ob durch Staatsanwälte, Polizeibeamte und auf wessen Anstiftung auch immer, und zweitens: die Tätigkeit von Abgeordneten für ausländische Nachrichtendienste unter Inkaufnahme einer Schädigung des österreichischen Parlaments und seines Ansehens. – Diese beiden Themenkomplexe sollen von einem Untersuchungsausschuss untersucht und geklärt werden.
Ich bin dafür, dass der Nationalrat die Einsetzung dieses Untersuchungsausschusses heute am Ende der Haussitzung nicht nur beschließt, sondern ihn auch für permanent erklärt. (Präsident Neugebauer gibt das Glockenzeichen.)
Die Menschen haben ein Recht auf einen Nationalrat, dem sie vertrauen können und dem sie auch Informationen über Missstände geben können. Sie sollen sich in vollem Vertrauen an Abgeordnete aller fünf Fraktionen in dem Wissen, dass hier nicht überwacht und nicht bespitzelt wird, wenden können. (Präsident Neugebauer gibt neuerlich das Glockenzeichen.) Es geht um unser gemeinsames Ansehen.
Ich ersuche Sie, der Einsetzung dieses Untersuchungsausschusses heute zuzustimmen. (Beifall bei den Grünen.)
11.41
Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Mag. Ikrath. – Bitte.
11.41
Abgeordneter Mag. Peter Michael Ikrath (ÖVP): Herr Präsident! Herr Verteidigungsminister! Ich selbst bin Milizoffizier und muss vorab eines feststellen: dass ich von der Debatte, wie sie bisher – mit einer einzigen Ausnahme – von den Oppositionsrednern geführt wurde, nicht nur zutiefst enttäuscht bin, sondern sie mich sehr traurig stimmt. Wir haben heute einmal die Chance, den Menschen im Saal, aber vor allem den vielen Menschen zu Hause vor den Fernsehschirmen darzustellen, welche Verdienste ihren Kindern, ihren Partnern, auch ihren Vätern, die Dienst beim Bundesheer leisten, zukommen – egal, an welchem Ort und in welcher Funktion.
Aber seitens der Opposition wird diese Möglichkeit durch Konzentration auf ein ganz anderes Themenfeld pervertiert. (Abg. Kickl: Sie haben nicht verstanden, dass das Sie auch betrifft!) Ich möchte das darstellen: Kollege List hat 5,38 Minuten gesprochen, davon ganze 90 Sekunden lang zum Thema. Kollege Pilz hat insgesamt 9 Minuten gesprochen, davon überhaupt nicht zum Thema Bundesheer, zum Thema der Soldaten. Kollege Strache hat am Anfang seiner Ausführungen als Alibi 20 Sekunden lang dazu gesprochen – und in der Folge kein Wort mehr. (Zwischenruf des Abg. Petzner.)
Ist denn das wirklich das Anliegen, das die Opposition mit dem Bundesheer, mit den Menschen, die für uns alle dort dienen, verbindet – nämlich: gar keines? (Abg. Kickl: Sie reden jetzt auch nur am Rande davon!) Ja, ganz offenkundig ist es so. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) Dann soll man aber auch keine Krokodilstränen vergießen.
Für mich am erschütterndsten ist das Verhalten des Kollegen List – selbst auch Offizier –, der einem Gesetz im Ausschuss noch zustimmt, weil er es als sinnvoll erachtet, und jetzt wegen einer Parteitaktik, die überhaupt nichts mit den Problemen und dem Engagement unserer Soldatinnen und Soldaten zu tun hat (Abg. Dr. Moser: Mit der Sicherheit!), die Zustimmung verweigert. – Das ist pervers! Mit seiner Verantwortung als Abgeordneter so umzugehen, ist erschütternd! (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
Nehmt euch ein Beispiel an Herbert Scheibner (Beifall bei ÖVP und BZÖ), der Einzige aus den Reihen der Opposition, der wirklich auf die gestellte Thematik eingegangen ist; er war aber auch ein sehr guter Verteidigungsminister. (Neuerlicher Beifall bei ÖVP und BZÖ.) – Das aber, was sich die Opposition sonst bietet, ist deprimierend.
Ich sage allen, die so wenig Ernsthaftigkeit mit dem Heer verbinden, nur parteipolitische Agitation heute hier betreiben (Abg. Kickl: Was machen Sie denn da?): Wir werden das Bundesheer weiter ernst nehmen. Wir werden mit dieser Novelle den Grundwehrdienst so verbessern, dass er wieder Basis wird für die Menschen, sich freiwillig für eine Funktion in der Miliz zu melden und sich dort weiter zu engagieren mit all ihrer Kompetenz. Wir brauchen die Miliz (Präsident Neugebauer gibt das Glockenzeichen), und wir werden ihr seitens der ÖVP weiter den Rücken stärken und für unser Bundesheer das tun, wozu die Opposition offensichtlich nicht mehr bereit ist. (Beifall bei der ÖVP.)
11.44
Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Dr. Fichtenbauer. – Bitte.
11.45
Abgeordneter Dr. Peter Fichtenbauer (FPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Hohes Haus! Lieber, von mir äußerst geschätzter Kollege Michael Ikrath! In meiner Eigenschaft – in aller Unbescheidenheit – als höchstrangiger
Milizoffizier der Abgeordneten dieses Hauses (Beifall bei der FPÖ) und als Verteidigungssprecher der Freiheitlichen Partei erkläre ich die unverbrüchliche Haltung und Unterstützung der Freiheitlichen Partei – zurzeit gerade mal eben kurz Oppositionspartei – zum österreichischen Bundesheer. (Neuerlicher Beifall bei der FPÖ.)
Zweitens: Wir werden der heutigen Vorlage die Verfassungsmehrheit verschaffen. Die Freiheitliche Partei steht zu ihrem im Verteidigungsausschuss gegebenen Wort und stimmt zu. (Beifall bei der FPÖ.)
Drittens: Wahr ist aber, dass es einen Sündenkatalog von ÖVP-Ministern zum Ruinieren des Bundesheeres gegeben hat. Als Höhepunkt ist diesbezüglich darzustellen: Platter kürzt den Wehrdienst auf sechs Monate. – Das ist eine Attacke gegen die Miliz – „Treffer querschiffs“ würde ein Marineur sagen –, mit der wir erheblichste Probleme haben. (Beifall bei der FPÖ.)
Nächster Punkt: Der Katalog, der heute zur Debatte steht, ist vielfältig, einen Bereich möchte ich beleuchten. Es ist wichtig, dass in § 25 des Militärbefugnisgesetzes nunmehr die Möglichkeit eingeräumt wird, dass Erkenntnisse militärischer Organe und Dienststellen, die mit den Aufgaben nachrichtendienstlicher Aufklärung und Abwehr betraut sind, auch anderen Dienststellen – auch dem Bundesamt für Verfassungsschutz – übermittelt werden dürfen, wenn bedrohliche Erkenntnisse beim Heer erkannt werden. Das war bisher gesetzlich nicht möglich. – Zur Aufhellung der Kenntnisse der Bevölkerung und der Abgeordneten; das kann man sich ja a priori nicht wirklich vorstellen, dass eine terroristische oder schwer kriminelle Bedrohung per Zufall nachrichtendienstlich erkannt wird, nach den Regeln des bisherigen Gesetzes die zivilen Dienststellen aber nicht informiert werden konnten. Das ist ein wichtiger Punkt, über den alle Leute Bescheid wissen sollen.
Weiterer Punkt: Die großen Leistungen des Heeres sind ohne die gedeihliche Tätigkeit der in Ausbildung stehenden Soldaten nicht denkbar.
Als Anerkennung für diese Tätigkeit bringe ich folgenden Antrag ein:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Kunasek, Kolleginnen und Kollegen betreffend Belohnungen für Ausbilder in der Rekrutenausbildung
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Der Bundesminister für Landesverteidigung und Sport wird aufgefordert, den für die Ausbildung der Rekruten im Jahr 2009 verantwortlichen Soldaten Dank und Anerkennung auszusprechen sowie für diese Leistungen analog zur Vorgangsweise im Jahr 2007 eine monetäre Belohnung zur Verfügung zu stellen.“
*****
(Beifall bei der FPÖ.)
Schlusssatz: Wenn das Hochwasser am höchsten, ist der Soldat am nächsten. Es lebe das Bundesheer! – Danke. (Beifall bei der FPÖ sowie bei Abgeordneten der SPÖ.)
11.48
Präsident Fritz Neugebauer: Der soeben eingebrachte Entschließungsantrag steht mit in Verhandlung.
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
des Abgeordneten Kunasek und weiterer Abgeordneter betreffend Belohnungen für Ausbilder in der Rekrutenausbildung
eingebracht im Zuge der Debatte über den Tagesordnungspunkt 1, Bericht des Landesverteidigungsausschusses über die Regierungsvorlage (161 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Wehrgesetz 2001, das Heeresdisziplinargesetz 2002, das Heeresgebührengesetz 2001, das Auslandseinsatzgesetz 2001, das Militärbefugnisgesetz, das Sperrgebietsgesetz 2002, das Munitionslagergesetz 2003, das Militärauszeichnungsgesetz 2002 und das Truppenaufenthaltsgesetz geändert werden (Wehrrechtsänderungsgesetz 2009 - WRÄG 2009) (239 d.B.), in der 32. Sitzung des Nationalrates, XXIV. GP, am 10. Juli 2009
Ende November 2007 hat das Kommando Einsatzunterstützung einen Befehl über Belohnungen für Ausbilder in der Rekrutenausbildung herausgegeben.
Der Inhalt lautete wie folgt:
„Der Herr Bundesminister hat sich bei zahlreichen Truppenbesuchen im Jahr 2007 von der hohen Einsatzbereitschaft und dem hohen Engagement der Truppe überzeugen können. Daher ist es dem Herrn Bundesminister ein besonderes Bedürfnis, den für die Ausbildung der Rekruten verantwortlichen Soldaten und Soldatinnen hierfür Dank und Anerkennung auszusprechen, sowie diese, als zusätzliche Motivation, mit einer monetären Belohnung zu begleiten. Durch den Herrn Bundesminister wurden daher zusätzliche Belohnungsgelder für Ausbilder in der Rekrutenausbildung für das Jahr 2007 zur Verfügung gestellt.
Durch die Dienststellen sind Meldungen bis 04. Dezember 2007 an KdoEU/G1 vorzulegen.
Diese Meldungen haben zu enthalten
Name des Ausbilder
wie viele Monate der Ausbilder im Jahre 2007 in der Ausbildung tätig war.
Sollten durch die Bediensteten, die in der Ausbildung tätig waren, noch besondere belohnungswürdige Leistungen erbracht worden sein, könnten diese in den Vorschlägen besonders (erhöhte Belohnung) berücksichtigt werden.
Um jeglichen möglichen Misskredit gegenüber dieser sichtbaren, leistungsauszeichnenden Maßnahme hintanzuhalten, ist allerdings sicherzustellen, dass tatsächlich auch nur jenen Ausbildern eine Belohnung zugesprochen wird, deren Dienstleistung nicht durch negative Vorkommnisse (z.B. disziplinäre Vergehen) beeinträchtigt wurde und der zu Grunde liegenden Absicht der Belohnungsmaßnahme zuwider laufen würde.“
Danach gab es leider keine Bestrebungen mehr, eine Belohnungen für Ausbilder in der Rekrutenausbildung zur Verfügung zu stellen.
Auf Grund der hervorragenden Leistungen unserer Soldaten in der Ausbildung von Rekruten sollte es als Anerkennung für diese Leistungen wieder eine Belohnung geben.
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Der Bundesminister für Landesverteidigung und Sport wird aufgefordert, den für die Ausbildung der Rekruten im Jahr 2009 verantwortlichen Soldaten Dank und Anerkennung auszusprechen, sowie für diese Leistungen analog zur Vorgangsweise im Jahr 2007 eine monetäre Belohnung zur Verfügung zu stellen.“
*****
Präsident Fritz Neugebauer: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
Wir kommen zu den Abstimmungen.
Zunächst: Abstimmung über den Entwurf betreffend Wehrrechtsänderungsgesetz 2009 in 239 der Beilagen.
Hiezu liegt ein Verlangen auf getrennte Abstimmung der Abgeordneten List, Kolleginnen und Kollegen vor.
Ich werde zunächst über die vom erwähnten Verlangen auf getrennte Abstimmung betroffenen Teile und schließlich über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes abstimmen lassen.
Da der vorliegende Gesetzentwurf Verfassungsbestimmungen enthält, stelle ich zunächst im Sinne des § 82 Abs. 2 Z 1 der Geschäftsordnung die für die Abstimmung erforderliche Anwesenheit der verfassungsmäßig vorgesehenen Anzahl der Abgeordneten fest.
Wir kommen zur getrennten Abstimmung über Artikel 1 ZZ 9b, 9c und 9e in der Fassung des Ausschussberichtes, und ich ersuche jene Damen und Herren, die diesen Teilen des Gesetzentwurfes zustimmen, um ein bejahendes Zeichen. – Das ist einstimmig angenommen.
Schließlich komme ich zur Abstimmung über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang in der Fassung des Ausschussberichtes. – Das ist mehrheitlich mit der verfassungsmäßig erforderlichen Zweidrittelmehrheit angenommen.
Wir kommen sogleich zur dritten Lesung.
Ich bitte jene Damen und Herren, die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, um ein diesbezügliches Zeichen. – Das ist die Mehrheit.
Ich stelle fest, dass die verfassungsmäßig erforderliche Zweidrittelmehrheit erreicht worden ist. Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung angenommen.
Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Kunasek, Kolleginnen und Kollegen betreffend Belohnungen für Ausbilder in der Rekrutenausbildung.
Wenn Sie dem beitreten, bitte ich um ein Zeichen. – Der Antrag findet keine Mehrheit, ist abgelehnt.
Wir kommen weiters zur Abstimmung über den Antrag des Landesverteidigungsausschusses, dem Abschluss des gegenständlichen Staatsvertrages: Abkommen mit der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über den vorübergehenden Aufenthalt von Angehörigen des österreichischen Bundesheeres und Angehörigen der deutschen
Bundeswehr auf dem Gebiet des jeweils anderen Staats, in 76 der Beilagen gemäß Artikel 50 Abs. 1 Z 1 Bundes-Verfassungsgesetz die Genehmigung zu erteilen.
Wenn Sie dem zustimmen, bitte ich um ein Zeichen. – Das ist angenommen.
Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Bericht der Bundesregierung über die Lage von Menschen mit Behinderungen 2008 (III-23/241 d.B.)
4. Punkt
Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 450/A der Abgeordneten Ing. Norbert Hofer, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz vom 11. Dezember 1969 über die Einstellung und Beschäftigung Behinderter (Behinderteneinstellungsgesetz – BEinstG), BGBl. Nr. 22/1970, geändert wird (253 d.B.)
5. Punkt
Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 396/A(E) der Abgeordneten Sigisbert Dolinschek, Kolleginnen und Kollegen betreffend finanzielle Unterstützung von Menschen mit Behinderungen aufgrund von Diskriminierung (254 d.B.)
Präsident Fritz Neugebauer: Wir kommen zu den Punkten 3 bis 5 der Tagesordnung, über welche die Debatte unter einem durchgeführt wird.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Ing. Hofer. – Bitte.
11.52
Abgeordneter Ing. Norbert Hofer (FPÖ): Herr Präsident! Werte Mitglieder der Bundesregierung! Hohes Haus! Meine Damen und Herren! Die Zeiten werden härter, das ist wohl schwer zu bestreiten, die schwierige Situation auf dem Arbeitsmarkt wird uns in den nächsten Monaten treffen, und davon betroffen sind viele arbeitende Menschen in Österreich, viele Menschen, die sozial schwach sind, und natürlich auch behinderte und pflegebedürftige Menschen. Es zeigt uns auch der vorliegende Bericht, dass behinderte Menschen sehr, sehr stark von Armut betroffen sind. 20 Prozent – jeder fünfte Mensch mit einer Behinderung – der behinderten Menschen sind von Armut betroffen. Viele von Ihnen kennen vielleicht die Situation von pflegebedürftigen Menschen aus dem eigenen Bekannten- oder Verwandtenkreis. Man rutscht sehr, sehr rasch in die Armutsfalle.
Daher müssten wir – es werden sich bald, in den nächsten Monaten, Schwierigkeiten für uns ergeben –, bei allen Herausforderungen, die wir als Politiker zu bewältigen haben, gemeinsam mit der Wirtschaft, mit der Bevölkerung, mit den arbeitenden Menschen darauf achten, dass wir die soziale Ausgewogenheit wahren und uns für jene einsetzen, die sich nicht helfen können. Das, meine Damen und Herren, ist etwas ganz Wesentliches! (Beifall bei der FPÖ.)
Es gibt einen großen Bereich, der vom Berichtswesen in Österreich noch nicht erfasst ist, obwohl es über fast alles Berichte gibt, und das ist die Situation von Menschen, die in Pflegeheimen untergebracht sind. Es gab eine Studie aus Deutschland, die Erschre-
ckendes ans Tageslicht befördert hat, nämlich die Tatsache, dass dort viele pflegebedürftige Menschen schlecht versorgt werden mit Trinkwasser, mit Flüssigkeit, auch schlecht ernährt werden, weil das Personal zu überlastet ist und diese Aufgaben nur schwer bewältigen kann. Die Menschen dort werden am frühen Nachmittag ins Bett gesteckt, weil dann eben Ruhe ist; sie liegen sich aufgrund dieser langen Zeit oft wund.
Es ist ein Missstand an und für sich, dass es einen derartigen Bericht über diese Situation in Österreich nicht gibt. Es gibt in unserem Land sehr viele Pflegeheime, mit großer Sicherheit werden in überwiegender Mehrheit behinderte und pflegebedürftige Menschen dort auch erstklassig versorgt, von erstklassigem Personal, das wirklich engagiert an die Arbeit herangeht, aber es wird auch bei uns so wie in Deutschland einige Fälle geben, wo das eben nicht der Fall ist. Wir als verantwortliche Politiker brauchen diesen Bericht, um auch darauf reagieren zu können. Deshalb bitte ich Sie, Herr Sozialminister, einen derartigen Bericht für Österreich auf Schiene zu bringen. Ich glaube, dass er für uns eine gute Arbeitsgrundlage sein wird, um die richtigen Maßnahmen zu setzen.
Wir werden aus diesem Bericht dann auch erkennen können, unter welchem Druck das Personal in diesen Pflegeheimen zu arbeiten hat. Das ist wirklich physische und psychische Schwerarbeit, die dort geleistet wird. – An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön dafür (Beifall bei der FPÖ), ein herzliches Dankeschön an die vielen Tausenden Mitarbeiter in Pflegeheimen und an die Hunderttausenden Menschen, Angehörigen, die Angehörige zu Hause pflegen und betreuen. (Neuerlicher Beifall bei der FPÖ.)
Ich komme jetzt zu unseren Anträgen, die wir noch besprechen werden. Bezüglich einer Behindertenvertrauensperson habe ich einen Antrag eingebracht, den wir heute beraten. Es geht mir darum, dass die Behindertenvertrauensperson gleiche Rechte und Pflichten hat wie die anderen Personalvertreter. Die Behindertenvertrauensperson hat aber im Betrieb kein Stimmrecht. Es gibt keinen vernünftigen Grund dafür, dass diese Behindertenvertrauensperson, die sich für die Anliegen der behinderten Arbeitnehmer in einem Betrieb einsetzt, kein Stimmrecht hat. Daher bitte ich Sie, diesem Antrag Ihre Zustimmung zu geben. Das kostet nichts, das tut auch nicht weh, aber es hilft den Betroffenen außerordentlich.
Ich habe einen weiteren Antrag vorbereitet, den ich heute noch einbringen will, und dieser Antrag betrifft Eltern von Kindern, die gehörlos sind; gerade heute ist auch ein guter Anlass, diesen Antrag einzubringen. Es gibt in Schweden ein Modell, das ich sehr empfehlen möchte. In Schweden haben die Eltern gehörloser Kinder die Möglichkeit, einen Gehörlosenkurs zu absolvieren, und dieser Gehörlosenkurs wird von der Gemeinschaft, von öffentlicher Hand finanziert. Die Gebärdensprache ist nicht einfach zu erlernen, man braucht viele, viele Stunden, um diese Sprache zu erlernen. Einige von uns schauen den Gebärdendolmetschern heute ganz interessiert zu, man lernt die eine oder andere Vokabel, aber bis man diese Sprache wirklich beherrscht, vergeht einige Zeit.
Wenn man ein Kind hat, das gehörlos ist, dann müssen die Eltern diese Sprache auch erlernen.
Daher bringe ich folgenden Antrag ein:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Ing. Hofer, Kolleginnen und Kollegen betreffend Gebärdensprachkurse für Eltern gehörloser Kinder
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, alle erforderlichen Schritte zu setzen, damit Eltern vor der Einschulung eines gehörlosen Kindes ein Anspruch auf den Besuch eines kostenlosen Kurses in Österreichischer Gebärdensprache gewährt wird.“
*****
(Beifall bei der FPÖ.)
Ein weiterer Antrag, den ich einbringen möchte, betrifft die Ausgleichstaxe; das Modell der Ausgleichstaxe funktioniert nur leidlich. Ich möchte, dass kleine Unternehmen nicht stärker belastet werden, ich möchte aber darauf hinweisen, dass große Unternehmen viel mehr die Möglichkeit haben, dieser Einstellungspflicht nachzukommen, vor allem auch die öffentliche Hand ist hier sehr gefragt.
Daher bringe ich das Modell einer progressiven Ausgleichstaxe ein.
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Ing. Hofer, Kolleginnen und Kollegen betreffend progressive Ausgleichstaxe
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, im Rahmen einer Novelle zum Behinderteneinstellungsgesetz eine progressive Ausgleichstaxe vorzusehen.“
*****
Nun zu meinem letzten Antrag, meine Damen und Herren. Dieses Thema habe ich schon oft angesprochen, es steht im Zusammenhang mit der Armut, unter der pflegebedürftige und behinderte Menschen oft zu leiden haben. Ich halte es für notwendig – da wir auch so viel Geld in die Hand genommen haben, um notleidenden Finanzinstituten unter die Arme zu greifen, die sich die Probleme zum großen Teil selbst eingebrockt haben –, dass wir jetzt auch den Schritt setzen, beim Pflegegeld eine Inflationsanpassung vorzunehmen. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt dafür. Dieses Geld fließt nicht irgendwohin ab, dieses Geld geht direkt in die Kaufkraft, denn: Das kann man nicht sparen! Diese Menschen brauchen dieses Geld ganz dringend.
Ich bringe daher folgenden Antrag ein:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Ing. Hofer, Kolleginnen und Kollegen betreffend Inflationsanpassung des Pflegegeldes
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, schnellstmöglich alle erforderlichen Schritte zu setzen, um das Pflegegeld so anzupassen, dass es inflationsbereinigt dem Wert bei dessen Einführung im Jahr 1993 entspricht. In Zukunft soll zudem eine jährliche Indexanpassung des Pflegegeldes sichergestellt werden.“
*****
(Beifall bei der FPÖ.)
11.59
Präsident Fritz Neugebauer: Bevor ich der Frau Abgeordneten Königsberger-Ludwig das Wort erteile, verlautbare ich Folgendes: Es wäre in der ersten Runde theoretisch laut Beschlussfassung möglich, dass jede Rednerin/jeder Redner 14 Minuten spricht. Das geht sich bis 13 Uhr nicht mehr aus. Ich bitte also darum, die vorgesehene Minutenzahl nicht zu überschreiten. Das müssten maximal 10 Minuten sein, ich würde dann ein Glockenzeichen geben.
Die drei Entschließungsanträge, die Kollege Hofer eingebracht hat, stehen mit in Verhandlung.
Die drei Anträge haben folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Ing. Hofer, Dr. Belakowitsch-Jenewein, Kickl und weiterer Abgeordneter betreffend Gebärdensprachkurse für Eltern gehörloser Kinder
eingebracht im Zuge der Debatte zum Tagesordnungspunkt 3, Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Bericht der Bundesregierung über die Lage von Menschen mit Behinderungen 2008 (III-23/241 d.B.)
in der 32. Sitzung des Nationalrates am 10. Juli 2009
Die Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) ist für gehörlose Menschen in Österreich ein unverzichtbares Mittel der Kommunikation. Besondere Bedeutung kommt der Gebärdensprache in der Schulbildung zu, da wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge der bilinguale Unterricht die beste Unterrichtsform für gehörlose Kinder darstellt.
Es ist zudem aber auch notwendig, dass die Eltern gehörloser Kinder ÖGS fehlerfrei beherrschen, um ihnen beim Lernen wie auch im Alltag unterstützend zur Seite stehen zu können. ÖGS zu erlernen ist aber in der Regel nur mit einem großen Aufwand zu bewerkstelligen und kann für die Eltern eine beträchtliche finanzielle Belastung bedeuten.
Schweden geht hier einen guten Weg und gewährt den Eltern gehörloser Kinder vor der Einschulung des Kindes einen kostenlosen Gebärdensprachenkurs im Ausmaß von 240 Stunden.
In Österreich gibt es jedoch nicht nur kaum Frühförderung für Kinder in ÖGS, sondern auch keine Ermutigung für die Eltern, ÖGS zu lernen und ihren Kindern beim Erlernen der Gebärdensprache zu helfen. Es ist daher eine ähnliche Regelung wie in Schweden anzustreben.
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, alle erforderlichen Schritte zu setzen, damit Eltern vor der Einschulung eines gehörlosen Kindes ein Anspruch auf den Besuch eines kostenlosen Kurses in Österreichischer Gebärdensprache gewährt wird.“
*****
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Ing. Hofer, Dr. Belakowitsch-Jenewein, Kickl und weiterer Abgeordneter betreffend progressive Ausgleichstaxe
eingebracht im Zuge der Debatte zum Tagesordnungspunkt 3, Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Bericht der Bundesregierung über die Lage von Menschen mit Behinderungen 2008 (III-23/241 d.B.)
in der 32. Sitzung des Nationalrates am 10. Juli 2009
Viele Unternehmer aber auch zahlreiche öffentliche Dienststellen kommen ihrer in § 1 Abs. 1 Behinderteneinstellungsgesetz festgelegten Pflicht, auf je 25 Dienstnehmer mindestens einen begünstigten Behinderten einzustellen, nicht nach. Es muss jedoch angestrebt werden, die Arbeitslosigkeit unter Menschen mit Behinderung zu senken. Viele Behinderte sind für einen Arbeitsplatz genauso qualifiziert, wie Personen ohne Behinderung. Sie werden oft unterschätzt und bekommen deshalb seltener die Chance, ihre Fähigkeiten am Arbeitsmarkt und für ein Unternehmen unter Beweis zu stellen.
Derzeit kaufen sich viele Unternehmer, aber auch die öffentliche Hand, mit der Ausgleichstaxe von ihrer Pflicht frei. Ziel der gesetzlich verankerten Beschäftigungspflicht muss aber in erster Linie sein, die Bedingungen für behinderte Arbeitnehmer am Arbeitsmarkt zu verbessern.
Es soll daher eine progressive Ausgleichstaxe eingeführt werden, die vor allem größeren Betrieben einen Anreiz bietet, ihrer Pflicht nach § 1 Abs. 1 BEinstG zur Einstellung mehrerer behinderter Arbeitnehmer nachzukommen. Für den ersten begünstigten Behinderten, der zu beschäftigen wäre, ist nach wie vor der in der Verordnung des Sozialministers festgestellte Betrag zu entrichten. Künftig soll der Sozialminister jedoch nicht die Ausgleichstaxe sondern den Ausgangswert feststellen, der nur für den ersten begünstigten Behinderten, der zu beschäftigen wäre, als Ausgleichstaxe gilt. Für jeden weiteren begünstigten Behinderten, der zu beschäftigen wäre, setzt sich die Ausgleichstaxe aus jener Ausgleichstaxe der vorhergehenden nicht beschäftigten Person und der Hälfte des Ausgangswertes zusammen. Die Ausgleichstaxe ist jedoch mit dem Fünffachen des Ausgangswertes gedeckelt. Stellt ein Unternehmen beispielsweise zehn begünstigte Behinderte nicht ein, obwohl es dazu verpflichtet ist, errechnen sich die Ausgleichstaxen wie folgt:
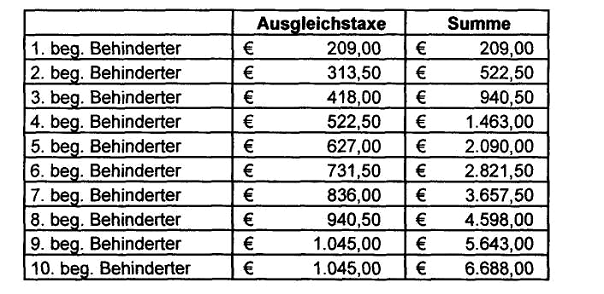
Die Ausgleichstaxe für die zehnte Person, die einzustellen wäre, würde das Fünffache des Ausgangswertes überschreiten, dies ist aufgrund der Deckelung jedoch nicht möglich.
Ein Unternehmen, das seiner Pflicht zur Einstellung von drei begünstigten Behinderte nicht nachkommt, zahlt also statt wie bisher 627 Euro jeden Monat 940,50 Euro. Ein Großunternehmen, das zwischen 250 und 274 Mitarbeiter beschäftigt und keinen begünstigten Behinderten eingestellt hat, hat monatlich nicht wie bisher 2.090 Euro sondern 6.688 Euro an Ausgleichstaxen zu entrichten.
Besonders hingewiesen sei darauf, dass diese Maßnahme keine Verschlechterung für Kleinunternehmen (unter 50 Beschäftigte) mit sich bringt, denen es aufgrund einer geringen Anzahl an Mitarbeitern und der Struktur des Unternehmens unter bestimmten Umständen schwerer fallen kann, einen geeigneten Arbeitsplatz für einen begünstigten Behinderten bereitzustellen. Kleinunternehmen müssen nie mehr als einen begünstigten Behinderten einstellen und sind daher von der progressiven Ausgleichstaxe auch nicht betroffen.
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, im Rahmen einer Novelle zum Behinderteneinstellungsgesetz eine progressive Ausgleichstaxe vorzusehen.“
*****
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Ing. Hofer, Dr. Belakowitsch-Jenewein, Kickl und weiterer Abgeordneter betreffend Inflationsanpassung des Pflegegeldes
eingebracht im Zuge der Debatte zum Tagesordnungspunkt 3, Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Bericht der Bundesregierung über die Lage von Menschen mit Behinderungen 2008 (III-23/241 d.B.)
in der 32. Sitzung des Nationalrates am 10. Juli 2009
Menschen mit Behinderung sind eine inhomogene Gruppe und müssen als solche mit ihren jeweiligen Bedürfnissen berücksichtigt werden. Dabei ist es wesentlich, dass Menschen mit Rechten ausgestattet werden und nicht als Hilfsempfänger gesehen werden. Ziel unterstützender Betreuung muss die Integration und ein möglichst selbstbestimmtes Leben sein.
Eine gute Versorgung im Fall der Pflege- und/oder Betreuungsbedürftigkeit ist ebenso wie bei Krankheit, Unfall oder Behinderung eine Kernaufgabe des Sozialstaates. Ohne das Freimachen von Finanzmitteln lässt sich das Problem nicht lösen. Die Finanzierung darf nicht durch den Haushalt der Betroffenen erfolgen, aber auch nicht auf Kosten der Pfleger und Betreuer. Wenn die Finanzierung von Pflegenden und Betreuenden nicht solidarisch erfolgt und das Risiko weiter überwiegend privat getragen werden muss, kann die Schwarzarbeit in diesem Bereich nicht bekämpft werden.
Im Jahr 2005 wurden in Österreich 3,046 Mrd. Euro oder 1,2 % des BIP für Langzeitpflege aufgewendet. Trotz steigender Zahl an Pflegegeldbeziehern hält sich aufgrund ausgebliebener Inflationsanpassungen des Pflegegeldes seit 1997 die Ausgabenquote für Langzeitpflege auf konstantem Niveau. Dies natürlich auf Kosten der betroffenen Pflegebedürftigen und der Angehörigen. Zum Vergleich: Die Ausgaben für Pflege betragen in Dänemark 2,8 % des BIP.
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, schnellstmöglich alle erforderlichen Schritte zu setzen, um das Pflegegeld so anzupassen, dass es inflationsbereinigt dem Wert bei dessen Einführung im Jahr 1993 entspricht. In Zukunft soll zudem eine jährliche Indexanpassung des Pflegegeldes sichergestellt werden.“
*****
Präsident Fritz Neugebauer: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Königsberger-Ludwig. – Bitte.
12.00
Abgeordnete Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ): Herr Präsident! Herr Minister! Frau Staatssekretärin! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich sehr darüber, dass der Bericht über die Lage von Menschen mit Behinderungen im Plenum behandelt wird, wenngleich ich auch ein bisschen traurig darüber bin, dass durch die Geschäftsordnungsdebatte vorher die Zeit für die Behandlung dieses wichtigen Berichts eingeschränkt ist, aber das ist nun einmal so. Ich finde es schade, die Menschen mit Behinderung hätten sich die gesamte Zeit verdient.
Dieser Bericht gibt uns die Möglichkeit, auf der einen Seite über die Anforderungen der Menschen mit Behinderungen zu sprechen, aber auch auf der anderen Seite die bereits getroffenen Maßnahmen für die Menschen mit Behinderungen aufzuzeigen. Er gibt uns gleichzeitig auch die Möglichkeit, über die zukünftigen Herausforderungen zu sprechen. Und der Bericht beinhaltet – das ist auch sehr wichtig – eine Reihe von vielen praktischen Informationen für das Fachpublikum, aber auch für die Menschen mit Behinderungen.
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Menschen mit Behinderungen sind keine heterogene Gruppe, das ist eine Gruppe mit sehr speziellen Bedürfnissen, mit sehr unterschiedlichen Forderungen und auch sehr unterschiedlichen Anforderungen. Ich denke, genau so vielfältig muss sich auch die Politik für Menschen mit Behinderungen gestalten. Am Ende muss aber immer eines stehen, nämlich die Teilhabe, die Inklusion der Menschen mit Behinderungen am sozialen und am wirtschaftlichen Leben. (Beifall bei der SPÖ.)
Die Anstrengungen der Bundesregierung gehen genau in diese Richtung. Wenn man sich den Bericht ansieht, sieht man auch, dass große Fortschritte im Bereich der Behindertenpolitik erzielt worden sind. Ich erinnere nur an die Anerkennung der Gebärdensprache – ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein in der Politik für behinderte Menschen. Ich erinnere an den Beschluss des Behinderten-Gleichstellungspakets und an dessen Novellierung. Ich erinnere an die Einsetzung des Behindertenanwalts, an das Bundespflegegeldgesetz, wodurch das Pflegegeld erhöht wurde. Und ich erinnere auch an die Ratifizierung der UN-Konvention für Menschen mit Behinderungen, wobei Österreich eines der ersten Länder gewesen ist, das diese UN-Konvention ratifiziert hat.
Daneben hat es auch eine Reihe von bewusstseinsbildenden Maßnahmen gegeben. Ich bin überzeugt davon, dass diese bewusstseinsbildenden Maßnahmen genauso wichtig sind wie gesetzliche Rahmenbedingungen. Wir haben das Jahr der Chancengleichheit ins Leben gerufen im Jahr 2007. Ich bin überzeugt davon, dass das ganz,
ganz wichtige Maßnahmen sind, um die Bevölkerung, um die nicht behinderten Menschen für die Probleme von Menschen mit Behinderungen zu sensibilisieren, das aufzuzeigen und natürlich vor allem Verbesserungen herbeizuführen.
Ich bin aber auch überzeugt davon, dass sich gerade in diesem Bereich in den letzten Jahrzehnten vieles getan hat, speziell auch im Selbstverständnis im Umgang mit Menschen mit Behinderungen. Wir sind noch lange nicht am Ziel – davon bin ich auch überzeugt –, aber es ist ein großer Auftrag für die Zukunft, weiterhin an Verbesserungen der Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderungen zu arbeiten.
Ich habe schon gesagt, der Bericht zeigt uns aber auch, wo die Herausforderungen der Zukunft liegen, und die sind sehr vielfältig. Sie beginnen im Bereich der Bildung. Wenn man sich ansieht, dass 38 Prozent der Menschen mit Behinderungen lediglich einen Pflichtschulabschluss haben, so ist einfach Handlungsbedarf gegeben. Bei der Erwerbstätigkeit ist auch noch viel zu tun. Die Beschäftigungsquote von Menschen mit Behinderungen ist mit 34 Prozent fast um die Hälfte niedriger als bei Menschen, die nicht behindert sind. Das schlägt sich natürlich auch im Einkommen nieder. Wir haben heute schon vom Herrn Kollegen Hofer gehört, dass behinderte Menschen deswegen auch doppelt so stark von Armut betroffen sind wie nicht behinderte Menschen.
Die Sozialleistungen in Österreich reduzieren zwar die Armutsgefährdung deutlich, dennoch bin ich überzeugt davon, dass man gerade in diesem Bereich noch sehr viel Anstrengung in der Politik unternehmen muss. Für mich gehört hier vor allem dazu, Menschen mit Behinderungen die Integration in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen, weil ich davon überzeugt bin, dass selbstbestimmtes Leben untrennbar mit Erwerbsarbeit verbunden ist. Ich bin daher auch sehr froh und dankbar, dass Bundesminister Hundstorfer eindeutig zugesagt hat, dass es im Bereich der so wichtigen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen keine Einsparungen geben wird. So werden auch in Zukunft Beschäftigungsprojekte, Clearing-Stellen, Coaching-Stellen, die Arbeitsassistenz, das UnternehmerInnen-Service, die integrative Berufsausbildung, um nur einige zu nennen, weiterhin ihre wichtige Arbeit für Menschen mit Behinderungen leisten können. Darüber bin ich wirklich äußerst froh. (Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordneten der ÖVP.)
Geschätzte Damen und Herren, ich bin aber auch überzeugt davon, dass wir speziell im Bereich der Bewusstseinsbildung für UnternehmerInnen noch einiges tun müssen, damit die UnternehmerInnen erkennen, dass behinderte Menschen wertvolle MitarbeiterInnen sind, die leistungswillig, leistungsbereit und leistungsfähig sind. (Beifall bei der SPÖ sowie des Abg. Wöginger.)
12.05
Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Dolinschek. – Bitte.
12.05
Abgeordneter Sigisbert Dolinschek (BZÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bundesminister! Frau Staatssekretärin! Der Bericht über die Lage von behinderten Menschen im Jahr 2008 ist ein aufschlussreiches Nachschlagewerk über sämtliche Bereiche der Behinderung in Österreich, denn Behinderungen können unterschiedlichster Art sein. Auf der einen Seite gibt es die dauerhafte Beeinträchtigung, die natürlich am schlimmsten ist, aber auch die vorübergehende. Ich denke nur daran, dass es zirka 70 000 Personen gibt, die vorübergehend einen Beinbruch haben und dadurch auch ein gewisses Handicap haben. Aber das Thema ist natürlich die dauerhafte Beeinträchtigung; das sind in Österreich immerhin 20,5 Prozent, die ständig mehr oder weniger in ihrem Leben eingeschränkt sind.
Die Beeinträchtigungen sind unterschiedlichster Art. Der eine hat eine Sehbehinderung, der andere eine Hörbehinderung, es gibt eine körperliche Behinderung und eine geistige Behinderung. Wenn man bedenkt, dass 7 Prozent der Bevölkerung eine Beeinträchtigung haben, dann sind das doch 580 000 Menschen in Österreich. 50 000 Personen sind auf einen Rollstuhl angewiesen, geschätzte Damen und Herren. Das ist schon eine beträchtliche Zahl.
Was diese Personen, die es im Leben nicht so leicht haben, aber besonders brauchen, ist Anerkennung.
Und vor allem eines: Die Armutsgefährdung von Menschen mit Behinderungen ist besonders groß und liegt derzeit bei zirka 20 Prozent.
Es ist so, dass die Armutsgefährdungsquote bei Menschen mit Behinderungen quasi doppelt so hoch liegt wie bei Menschen, die keine Behinderung haben. Deswegen ist auch die Öffentlichkeit gefordert – vor allem wir von der Politik –, für diese Leute entsprechende Mittel zur Verfügung zu stellen.
Es ist so, dass die Einkommenssituation eine wesentliche Rolle spielt. Und es ist notwendig, ein eigenes Einkommen zu haben, sozialversicherungsrechtlich abgesichert zu sein, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Bei uns ist alles darauf abgestellt, ob man ein Einkommen hat, versichert ist und später auch eine Pensionsleistung daraus bezieht. Deswegen ist das so wichtig. Außerdem stärkt es das Selbstwertgefühl jedes einzelnen Menschen mit Behinderung, geschätzte Damen und Herren. Es ist daher wichtig, dass wir in diesem Bereich dementsprechend reagieren.
Man kann darüber diskutieren, ob die Ausgleichstaxe angehoben wird, die bei 209 € liegt. Man kann darüber diskutieren, wo sich die betroffenen Behinderten selbst uneinig sind, nämlich: Soll man den besonderen Kündigungsschutz für Menschen mit Behinderungen in Betrieben aufheben oder nicht? Derjenige, der einen Job hat, sagt: Um Gottes Willen, nicht aufheben! Derjenige, der keinen Job hat, sagt: Bitte hebt den Kündigungsschutz auf, dann bekomme ich leichter eine Beschäftigung! – So ist es eben einmal.
Was aber in Österreich besonders gut ist, ist, dass der Bund seine Einstellungsverpflichtung in den Ministerien und in den einzelnen Dienststellen bisher zu 95,6 Prozent erfüllt. (Demonstrativer Beifall der Abg. Königsberger-Ludwig.) Es ist bei der Exekutive und bei den Lehrern noch ein gewisses Manko vorhanden, aber überall anders wird sie eigentlich übererfüllt, vor allem im Sozialministerium und im Gesundheitsministerium, geschätzte Damen und Herren. (Beifall beim BZÖ und bei Abgeordneten der SPÖ.)
In der Privatwirtschaft ist es natürlich schwierig, vor allem in einer Zeit der Wirtschafts- und Finanzkrise, dass die Leute verstärkt einen Job bekommen. Herr Bundesminister Hundstorfer, ich richte das jetzt an Ihre Adresse: Ich weiß, dass Ihnen die Menschen mit Behinderungen am Herzen liegen, aber die sogenannte Behinderten-Milliarde ist im Budget für 2009 und 2010 von 78 Millionen € pro Jahr im Jahr 2007 auf 72 Millionen € herabgesetzt worden. Das ist also um 6 Millionen pro Jahr weniger.
Das trifft natürlich jene Personen, die einen Job am Arbeitsmarkt brauchen. Mit dieser Behinderten-Milliarde werden die Ausbildungsassistenz, die Assistenten am Arbeitsplatz, vor allem die Clearing-Stelle, diese wichtige Schnittstelle zwischen Schule und Beruf, und so weiter finanziert. Hier wird praktisch zurückgefahren. Sie sollte man in Zukunft wieder hinaufsetzen.
Geschätzte Damen und Herren, es wäre noch so viel dazu zu sagen, was in diesem Bereich zu verbessern ist. Mir reicht die Zeit heute dafür überhaupt nicht. Ich möchte nur noch eines sagen, das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz, das mit 1. Jän-
ner 2006 in Kraft getreten ist, hat eine wesentliche Verbesserung gebracht, schließt Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen weitgehend aus. (Zwischenruf des Abg. Bucher.) Aber wir müssen daran weiter arbeiten und die Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung vorantreiben.
Sehr geehrte Damen und Herren! Ich komme schon zum Schluss. Wir sollten gemeinsam alles unternehmen, um die Situation von Menschen mit Behinderungen zu verbessern, damit sie es im Leben ganz einfach besser haben als bisher. (Beifall beim BZÖ.)
12.11
Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Wöginger. – Bitte.
12.11
Abgeordneter August Wöginger (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Frau Staatssekretärin! Herr Bundesminister! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der vorliegende Behindertenbericht 2008 beinhaltet die Ergebnisse einer Befragung von 8 195 zufällig ausgewählten Personen zum Thema Menschen mit Beeinträchtigungen – durchgeführt von der Statistik Austria im Auftrag des Sozialministeriums.
Der Bericht zeigt, meine Damen und Herren, dass die Behindertenpolitik der letzten beiden Legislaturperioden effektiv war. Die Beschäftigungsoffensive greift, wenngleich die Wirtschaftslage sehr schwierig ist und es noch immer viele arbeitslose, behinderte Menschen gibt. Neben der Finanzierung der Adaptierung von Arbeitsplätzen und von Lohnzuschüssen wurde die Arbeitsassistenz geschaffen, die Arbeitsplätze am Arbeitsmarkt vermittelt. Ziel der Beschäftigungsoffensive ist es, dass behinderte Menschen nicht in Beschäftigungstherapien arbeiten, sondern Arbeitsmöglichkeiten in der freien Wirtschaft erhalten. Darum geht es, meine sehr geschätzten Damen und Herren! Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen wollen keine Sonderbehandlungen in separaten Anstalten. Sie wollen eine ganz normale Integration am Arbeitsmarkt. Das kennen wir auch von unseren Sprechtagen. (Beifall bei der ÖVP.)
Es ist unsere Aufgabe, dass wir weiterhin Rahmenbedingungen schaffen, die es Menschen mit Beeinträchtigungen auch ermöglicht, einen Arbeitsplatz in unseren Betrieben in der freien Wirtschaft zu bekommen und auch ein Zusammenarbeiten mit den anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gewährleistet. Unterstützend half dabei vor allem die persönliche Assistenz am Arbeitsplatz – es gibt sie bundesweit seit 2004 –, die ich besonders hervorheben möchte, und die integrative Berufsausbildung. Derzeit gibt es mehr als 3 600 Lehrverträge im Rahmen der integrativen Berufsausbildung. Ich möchte auch den öffentlichen Dienst erwähnen, der hier dieser Aufgabe, nämlich Menschen mit Beeinträchtigungen einzustellen, mit über 95 Prozent nachkommt. Herr Präsident! Auch Ihnen herzlichen Dank dafür. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der SPÖ.)
In diesem Zusammenhang, meine Damen und Herren, darf ich auch unseren Behindertensprecher Franz-Joseph Huainigg erwähnen. Ich bedanke mich bei ihm ganz außerordentlich für seinen unermüdlichen Einsatz für Menschen mit Behinderungen. (Beifall bei der ÖVP sowie bei Abgeordneten von SPÖ und Grünen.)
Behindertenpolitik ist keine Minderheitenangelegenheit, sondern eine gesellschaftliche Notwendigkeit. Der Bericht zeigt auch, dass viele wichtige Gesetze und Maßnahmen auch in den Bundesländern umgesetzt wurden, meine Damen und Herren. So zum Beispiel wurde in Oberösterreich im Jahre 2008 das Chancengleichheitsgesetz beschlossen. Das ist sicherlich ein Meilenstein in der Sozialpolitik. Verschiedenste präventive Maßnahmen und Leistungen sollen Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen ein normales Leben und eine umfassende Eingliederung in die Gesell-
schaft ermöglichen, um die Chancengleichheit zu erreichen. Das ist und war das Ziel dieses Gesetzes.
Heute steht besonders die Situation gehörloser Menschen im Mittelpunkt. Abschließend möchte ich darauf noch eingehen. Es gibt eine Premiere. Eine Nationalratssitzung wird in Gebärdensprache übertragen. Das ist eine wesentliche Verbesserung für gehörlose Menschen. Die Grundlage dafür wurde 2005 gelegt, als man das in den Verfassungsrang erhoben hat. Ich begrüße ganz herzlich, auch namens meiner Fraktion, Frau Kollegin Jarmer! – Herzlich Willkommen! (Allgemeiner Beifall.)
Auch den Dolmetscherinnen und Dolmetschern, die meiner Meinung jetzt hier im Haus Höchstleistungen erbringen: herzlichen Glückwunsch zu Ihren Leistungen! (Allgemeiner Beifall sowie Beifall von Staatssekretärin Marek.)
Meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen! Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen müssen der Gesellschaft etwas wert sein. Es ist unsere Aufgabe, den Schwächeren gerade in ihren Lebenssituationen zu helfen. Wir müssen die Rahmenbedingungen gerade für diese Menschen weiterhin verbessern. Das ist eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft. (Allgemeiner Beifall.)
12.15
Präsident Fritz Neugebauer: Nun gelangt Frau Abgeordnete Mag. Jarmer zu Wort. – Bitte. (Demonstrativer Beifall bei Grünen und ÖVP.)
12.16
Abgeordnete Mag. Helene Jarmer (Grüne) (in Übersetzung durch die Gebärdensprachdolmetscherin): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Minister! Hohes Haus! Werte Kollegen, werte Kolleginnen! Liebe Behindertengemeinschaft! Sie alle wissen, ich bin gehörlos und deshalb sitzt mir gegenüber eine Gebärdensprachdolmetscherin. Sie leiht mir nun ihre Stimme und ihr Ohr. Das Ziel ist, dass Sie meine Rede jetzt barrierefrei mitverfolgen können.
Meinen Namen kennen Sie, aber nicht meinen Gebärdennamen. (Abg. Mag. Jarmer gebärdet ihren Vornamen.) Helene also. Gebärdennamen haben nichts mit dem Namen an sich zu tun, sondern sie haben mit einer Besonderheit, mit einem besonderen Merkmal, mit einem Charakteristikum einer Person zu tun.
Ich möchte ein Beispiel eines berühmten Politikers bringen, den Sie alle kennen: Schüssel. (Abg. Mag. Jarmer gebärdet den Gegenstand Schüssel.) Das wäre die Gebärde Schüssel. Aber diese Gebärde Schüssel würde jetzt nicht wirklich passen. Er hat die Gebärde, die vom Mascherl kommt. (Abg. Mag. Jarmer gebärdet den Nachnamen des Abgeordneten Dr. Schüssel und formt mit ihren Händen ein Mascherl.) Schüssel. (Allgemeine Heiterkeit.)
Wolfgang Schüssel trägt zwar nicht mehr sein Mascherl, aber die Gebärde bleibt. Genauso wie meine Gebärde für Helene (Abg. Mag. Jarmer gebärdet ihren Vornamen und deutet dabei mit ihren Händen die Haarlänge an) weiterhin besteht, obwohl ich mittlerweile kurzes Haar trage.
Wir haben heute einen ganz besonderen Tag und eine Premiere hier im Hohen Haus erlebt. Sie haben zwei Gebärdensprachdolmetscher erlebt, damit 10 000 gehörlose Menschen und GebärdensprachbenützerInnen die Parlamentsdebatte mitverfolgen können. Mein besonderer Dank gilt Frau Nationalratspräsidentin Prammer und der Parlamentsdirektion, dem Präsidium und den ParlamentsmitarbeiterInnen. – Danke. (Allgemeiner Beifall.)
Das hier ist nun ein Anpassen an die besonderen Bedürfnisse gehörloser Menschen. Behinderung hat verschiedene Gesichter – und ein Gesicht davon ist die Gehörlosig-
keit. Ich möchte mich an dieser Stelle auch beim ORF bedanken, dass er heute und auch in Zukunft die kompletten Parlamentsdebatten ausstrahlen wird. Somit haben gehörlose Menschen zu Hause und ebenso jene, die hier auf der Galerie sitzen, die Möglichkeit, die Parlamentsdebatte mitzuverfolgen.
Bevor ich jetzt auf den Behindertenbericht eingehe, möchte ich noch kurz etwas über Gebärdensprache bringen. Über das Wort „Österreichische Gebärdensprache“ wundern sich viele, denn sie gehen davon aus, dass die Gebärdensprache eine internationale Sprache ist. Das ist sie nicht. Wir haben nationale Gebärdensprache und sogar dialektale Varianten. Sie sind jetzt wahrscheinlich erstaunt.
Ich möchte Ihnen gerne ein paar Beispiele bringen.
In der österreichischen Gebärdensprache ist das (die entsprechende Gebärde vorzeigend) die Gebärde „Danke“. Sie können mitmachen: „Danke“ – versuchen Sie es! Im Chinesischen sieht „Danke“ anders aus – das hängt von der Kultur ab –: Man verneigt sich, wenn man sich bedankt. Würde man diese Gebärde in Österreich verwenden, würde sie „Kugelschreiber“ bedeuten. (Heiterkeit.)
Und ein Beispiel zu Dialektvarianten: Im steirischen Dialekt heißt es „machen“, in Tirol sieht es ganz anders aus: Machen. (Jeweils die entsprechende Gebärde vorzeigend.) Also auch wir in der Gebärdensprache haben Dialekte. Sie kennen das ja von den gesprochenen Sprachen.
Es gibt auch eine amerikanische Gebärdensprache, American Sign Language. Sie ist sozusagen die Weltsprache der Gehörlosen, das Pendant zum Englischen.
Ich möchte gerne ein paar Gebärden zeigen und möchte Sie einladen, mit mir mitzumachen. Bewegen Sie sich ein wenig! (Heiterkeit.)
Parlament (eine Art Halbkreis formend): Das hängt von den Sitzreihen ab, und Sie sitzen hier in dieser besonderen Form.
Abgeordnete. – Was glauben Sie, wie die Gebärde aussieht? (Abg. Mag. Jarmer klopft mehrmals aufs Rednerpult. – Heiterkeit.) Kommt vom Tischklopfen: Abgeordnete.
Jetzt zu einer etwas schwierigeren Gebärde: Behindertengleichstellungsgesetz (eine ausladende Bewegung mit beiden Armen formend). Ich denke, das ist besonders für Sie eine wichtige Gebärde.
Sie werden sich vielleicht Gedanken machen, wie Sie mit mir jetzt wirklich zusammenarbeiten können. Ich bin gehörlos. Ich höre nichts, ich höre wirklich nichts. Und gleich vorab: Schreien nützt nichts (Heiterkeit) – ich höre nichts.
Ich bitte Sie, deutlich zu sprechen, aber jetzt nicht in einer Überartikulation, sondern langsam, und ich bitte Sie um einen Blickkontakt, denn der ist sehr wichtig für mich.
Wie können Sie mich nun erreichen? – Per SMS, per E-Mail, es gibt Chat-Programme, und Sie können auch mit mir telefonieren. Ich habe eine Gebärdensprachdolmetscherin, so wie hier jetzt, ganz einfach. – So viel zum Umgang mit Ihnen. (Allgemeiner Beifall.)
Ich weiß, ich bin immer sehr schnell, und ich muss erst lernen, Pausen zu machen.
Nun zur Grammatik der österreichischen Gebärdensprache und der Gebärdensprache. Sie ist völlig anders aufgebaut. Eine Gebärde ist ein Wort oder mehrere Wörter. Man kann es vergleichen mit dem Chinesischen. Es gibt auch im Chinesischen Schriftzeichen, die jeweils ein Wort bedeuten. Deshalb braucht auch meine Gebärdensprachdolmetscherin immer etwas länger; damit Sie sich nicht wundern.
Ich selbst bin gehörlos, bin eine gehörlose Behindertensprecherin, und mir liegen alle Anliegen aller behinderten Menschen am Herzen – egal ob es sich um gehörlose, um blinde Menschen, um RollstuhlfahrerInnen, um ältere Menschen, um Mobilitätseingeschränkte, um Mehrfachbehinderte handelt. Mir sind wirklich alle Anliegen wichtig, aber in diesem Zusammenhang ist es für uns besonders wichtig, für uns hier, dass wir eine bindende Festhaltung, eine schriftliche Festhaltung treffen: Wir müssen behinderten Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben ermöglichen. (Allgemeiner Beifall.)
Nun zum Behindertenbericht. – Unabhängig von meiner Parteizugehörigkeit wundere ich mich darüber, ich wundere mich wirklich über diesen Behindertenbericht und welches Verständnis von Behinderung und behinderten Menschen hier zutage tritt.
Zum Beispiel: Das Bundesministerium für Inneres sagt, Wahllokale haben keinen barrierefreien Zugang für RollstuhlfahrerInnen und mobilitätseingeschränkte Menschen, weil das Schulgebäude schon älter ist und man es nicht barrierefrei gestalten kann.
Ein anderes Beispiel, das ich gelesen habe: Da heißt es, es gibt Schulen, da wird österreichische Gebärdensprache angeboten. Aber in Wahrheit dürfen LehrerInnen gehörlose Kinder unterrichten, ohne eine einzige Gebärde zu beherrschen! Ich bin selbst Lehrerin. Und Sie haben wirklich richtig gehört: LehrerInnen dürfen gehörlose Kinder unterrichten, ohne dass sie Gebärden können! Stellen Sie sich einmal vor, wenn eine Französischlehrerin kein einziges Wort Französisch könnte! Was würden da wohl die Eltern hörender Kinder sagen?
Der Behindertenbericht muss beinhalten, welche konkrete Schritte zu setzen sind. Die Leute, die etwas verändern wollen, die wirkliche Barrierefreiheit erreichen möchten, brauchen diese Schritte, müssen wissen, was sie zu tun haben.
Zum Abschluss möchte ich gerne sagen: Was das Behindertengleichstellungsgesetz angeht, möchte ich mich gerne mit Ihnen und mit allen BehindertensprecherInnen an einen Tisch setzen, damit wir dieses Gesetz wirklich verändern. Die Politik kann das Leben behinderter Menschen wirklich revolutionieren! Wir haben 1,6 Millionen behinderte Menschen hier in Österreich, und wir können deren Leben verbessern. Wir müssen an die Menschen von morgen und von übermorgen denken! (Allgemeiner Beifall.)
Zum Schluss möchte ich noch gerne – und bitte, erlauben Sie mir das – einen kurzen Kontext zur Wirtschaftskrise herstellen. Ich erinnere mich noch an unseren ehemaligen Bundeskanzler Schüssel. Er sagte, Politik kann keine Arbeitsplätze schaffen. – Er hat sich geirrt: Die GebärdensprachdolmetscherInnen hier beweisen genau das Gegenteil. (Heiterkeit.)
Auf eine gute, barrierefreie Zusammenarbeit! – Danke. (Allgemeiner Beifall. – Abg. Mag. Kogler überreicht Abg. Mag. Jarmer einen Blumenstrauß.)
12.27
Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Bundesminister Hundstorfer. – Bitte.
12.27
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz Rudolf Hundstorfer: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Frau Abgeordnete Mag. Jarmer, ich darf Sie auch im Namen der Regierung hier recht herzlich begrüßen. Sie haben eines bewirkt in diesem Haus, was ich in einer meiner Vorgängerfunktionen – Sie wissen, ich habe schon eine gewisse politische Karriere – vor über acht Jahren als Vorsitzender des Wiener Gemeinderates verfügt habe, dass nämlich die Sitzungen mittels Gebärdendolmetsch übersetzt werden und somit auch der Öffentlichkeit zugänglich sind. Ich danke, dass das Parlament nachgezogen hat, und ich danke Ihnen, dass Sie dieses
Nachziehen veranlasst haben. Das einmal dazu. (Beifall bei SPÖ und Grünen sowie bei Abgeordneten von ÖVP und BZÖ.)
Ich möchte auf ein paar Punkte eingehen und ein paar Punkte auch noch einmal klarstellen. So möchte ich etwa klarstellen, die Behindertenmilliarde ist zwar im Budgetansatz, den Sie lesen, geringer, aber effektiv ist sie nicht geringer, denn – ich habe das schon im Budgetausschuss gesagt – im Effektiven haben wir es durch Rücklagenauflösung auf der einen Seite und durch einigermaßen intelligentes Sparen auf der anderen Seite zustande gebracht, dass wir mehr Geld ausgeben.
Wir haben im Vorjahr 172,5 Millionen € für Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation beziehungsweise Integration ausgegeben, und heuer werden wir für das Gleiche 175 Millionen € ausgeben.
Wie machen wir das? – Einerseits, wie ich schon gesagt habe, durch Sparmaßnahmen, durch Rücklagenauflösung beziehungsweise auch durch Vorziehen von Mitteln des Europäischen Sozialfonds. Das heißt, es gibt hier keinen Rückschritt, sondern es gibt einen Fortschritt, weil es natürlich gerade in Zeiten, wie wir sie jetzt in wirtschaftlicher Hinsicht erleben, nicht passieren darf, dass behinderte Menschen oder Menschen mit besonderen Bedürfnissen rasch aus dem Arbeitsprozess gedrängt werden, dass Menschen rasch gekündigt werden. Nein, das wollen wir nicht und werden wir auch nicht zulassen! (Beifall bei der SPÖ.)
Ich kann es auch hier noch einmal wiederholen: Wir haben bei geschützten Werkstätten in Österreich wirtschaftliche Probleme; das ist kein Geheimnis. Wir haben vor allem bei den vier geschützten Werkstätten, die sehr viel mit dem Automotiven Sektor zusammengearbeitet haben, Probleme, denn die Aufträge sind weggebrochen.
Ich habe dort veranlasst, auf der einen Seite Kurzarbeit einzuführen und auf der anderen Seite mit zinsenlosen Darlehen zu überbrücken. Es wird dort bei den Arbeitsplätzen – es sind über 2 000 – nichts passieren! Wir werden diese Einrichtungen weiterhin aufrechterhalten.
Ich möchte auch noch auf einen Punkt speziell eingehen, nämlich auf die Frage: Wie können wir gehörlosen Kindern helfen, verstärkt helfen? Das ist einerseits – Herr Ing. Hofer, Sie wissen das ganz genau – Angelegenheit der Länder, aber ich putze mich nicht ab, weil wir uns natürlich über die Clearing-Stelle bemühen, auch wenn etwas nicht in unserer Kompetenz liegt, da oder dort zu helfen, weil wir speziell auch den Familien, die in einer sozialen Schieflage sind, zu helfen versuchen. Das sind Individualhilfen, das gebe ich offen zu, aber trotzdem wird hier geholfen.
Im Übrigen gibt es in einigen Bundesländern ja bereits auch die von Ihnen verlangten Kurse.
Was sehr gut funktioniert, ist die berufliche Integration von Gehörlosen, weil wir hier sehr wohl Assistenz am Arbeitsplatz, in der Lehrstelle, in der Berufschule zur Verfügung stellen. Über die Firma Siemens ist gestern sehr viel gesprochen worden, über Jobabbau, aber gerade die Lehrwerkstätten der Firma Siemens sind hier ein Paradebeispiel und ein Vorzeigeprojekt, wie man berufliche Integration von Menschen mit speziellen Bedürfnissen vorantreiben kann. Allein dort sind sieben oder acht Jobs für Gebärdendolmetscher geschaffen worden, die Jugendliche während ihrer gesamten Lehrzeit begleiten. Das wollte ich Ihnen noch gesagt haben.
Zum Schluss kommend noch einmal eine klare Aussage: Es wird keinen Rückgang bei Geldmitteln geben bezüglich der beruflichen Rehabilitation, der beruflichen Integration von Menschen mit speziellen Bedürfnissen, ganz im Gegenteil. Wir sind hart am Arbei-
ten, dass es mehr Geldmittel für diesen Sektor gibt, und alleine heuer sind es rund 3 Millionen €. (Beifall bei der SPÖ.)
12.32
Präsident Fritz Neugebauer: Nach Rücksprache mit den Klubverantwortlichen setze ich für die nächste Runde die Redezeit für alle Rednerinnen und Redner mit je 3 Minuten fest.
Zu Wort gelangt nun Frau Abgeordnete Ablinger. – Bitte.
12.32
Abgeordnete Sonja Ablinger (SPÖ): Herr Präsident! Herr Minister! Frau Staatssekretärin! Ich möchte auch im Namen meiner Fraktion die neue Abgeordnete Mag. Helene Jarmer, die jetzt hinausgegangen ist, glaube ich, wie auch immer, herzlich begrüßen – Sie werden es ihr ausrichten – und ihr auch sagen, dass wir uns auf die Kooperation freuen und ihren Empfehlungen zu entsprechen versuchen, da sie uns ja schon aufgeklärt hat, wie wir mit ihr in Kommunikation treten können. Ich begrüße sie herzlich, auch wenn sie jetzt nicht im Saal ist. (Beifall bei SPÖ und Grünen.)
Ich möchte mich im Zusammenhang mit dem Behindertenbericht ganz kurz auf die besondere Situation behinderter Frauen konzentrieren. Natürlich fällt auch hier wieder auf, dass Frauen im Besonderen benachteiligt sind, weil sie als Frauen und als Behinderte benachteiligt sind. Die statistischen Daten belegen das ganz eindeutig. Frauen mit Behinderung sind seltener erwerbstätig als Männer mit Behinderung, sie beziehen geringere Leistungen, sie bekommen seltener krankheitsbedingte Pensionen, und ihr durchschnittlicher Leistungsbezug aus diesen Pensionen ist etwa nur halb so hoch wie der von Männern. Außerdem sind sie auffallend öfter Opfer von Gewalt beziehungsweise sexualisierter Gewalt.
Dieser schlechte Status vieler Frauen mit Behinderung scheint so etwas wie eine schicksalhafte Zwangsläufigkeit von Krankheit, Arbeitslosigkeit und Armut zu suggerieren. Dazu stellt auch der Behindertenbericht 2008 fest, dass der Umstand der Mehrfachdiskriminierung für viele Frauen prägend für ihren weiteren Lebensverlauf ist.
Es ist eben diese Spirale nach unten, und das ist der entscheidende Punkt für die Politik: Es geht darum, diese Spirale nach unten zu durchbrechen. Diese Spirale beginnt mit Krankheit, Behinderung, Arbeitslosigkeit, Armut, und dann kommt es zum Verlust eigenständiger Lebensführung, wie meine Kollegin Königsberger-Ludwig ja schon angesprochen hat. Insofern ist es richtig und gut, dass die Maßnahmen des bundesweiten arbeitsmarktpolitischen Behindertenprogramms des Sozialministeriums eben auf diese Spirale nach unten Rücksicht nehmen.
Ich möchte aber abschließend, Herr Bundesminister, ein Projekt aus Oberösterreich bewerben und Ihnen ans Herz legen. Die Frauenstiftung Steyr hat ein Projekt entwickelt, das die Arbeitsmarktintegration gehörloser beziehungsweise hörbeeinträchtigter Frauen verbessern will, mit speziellem Coaching, mit spezieller Begleitung, Einzelcoaching, und es basiert alles, was sie vorschlagen, auf dem, was die Frauen selbst formuliert haben. Und das halte ich für ganz wesentlich. Außerdem ist damit eine Sensibilisierung der regionalen Unternehmen verbunden, die da noch sehr zögerlich sind, aber viele Potentiale dabei unterstützen.
Ich würde mich freuen, wenn wir dieses Projekt in Steyr finanzieren könnten, denn behinderte Frauen haben ein Recht auf eigenständiges Leben. Die verbesserte Integration am Arbeitsmarkt ist eine Grundvoraussetzung für die Eigenständigkeit, und als sozialdemokratischer Klub werden wir das immer im Fokus haben. – Ich danke Ihnen. (Beifall bei der SPÖ.)
12.35
Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Neubauer. – Bitte.
12.36
Abgeordneter Werner Neubauer (FPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Sehr geehrte Frau Staatssekretärin! Sehr geehrter Herr Bundesminister, Sie haben gestern im Rahmen einer Anfragebeantwortung bei drei Fragen von Abgeordneten dieses Hauses gemeint, Sie können in diesen Fällen nicht helfen, und in einem Fall haben Sie gesagt, Sie wollen nicht helfen.
Für mich war es sehr betrüblich, das zu hören, denn eines muss ich schon feststellen: Wenn jemand in die Politik geht und solche Aussagen tätigt, dann muss ich mich fragen, ob so jemand in der Politik überhaupt noch tragbar ist. Wenn jemand von vornherein Lösungen ausschlägt und nicht danach sucht, dann ist das gerade im Behindertenbereich einfach unzumutbar! (Beifall bei der FPÖ.)
Gerade jenen, denen das Schicksal nicht gerade wohlgesonnen war, solche Mitteilungen zu machen, sehr geehrter Herr Bundesminister, ist ein Schlag in das Gesicht all derjenigen, die sich ehrenamtlich täglich bemühen, wie beim Österreichischen Zivilinvalidenverband, für diese Menschen etwas Gutes zu tun. Herr Bundesminister, das sollten Sie sich wirklich einmal merken. (Bundesminister Hundstorfer: Ich weiß nicht, wovon Sie reden!?)
Ich vermisse in diesem Bericht, den Sie hier vorgelegt haben, dass der Mensch hier nicht mehr im Mittelpunkt steht, dass er einfach zu einem statistischen Faktor wird. Ich vermisse gerade von Ihnen, Herr Bundesminister, hier die soziale, menschliche Wärme. Aber zeigt nicht gerade der Umgang mit den Schwächsten unserer Gesellschaft, wie wir mit unserer Gesellschaft insgesamt umgehen? Es gäbe sehr viel zu tun, Herr Bundesminister, und ich darf Ihnen in aller Kürze einige Punkte nennen.
Es gibt große Probleme bei Eltern, die sich mit behinderten Kindern in den Ruin getrieben fühlen, weil es keine ausreichenden finanziellen Unterstützungen gibt.
Es gibt in der Betreuung von Schwerstbehinderten, die mehrfach behindert sind, einen Pfusch, der von einem zum anderen fortgeschrieben wird. Es gibt Menschen, wie die DiplombehindertenpädagogInnen, die in ihrer Kompetenz beschnitten sind. Es gibt Krankenschwestern, die wiederum Tätigkeiten ausüben dürfen, die andere nicht machen dürfen. Damit hat man jetzt als Augenauswischerei den Berufsstand des Pflegehelfers geschaffen. Der darf auch wieder Dinge nicht machen, die andere hingegen dürften.
Warum ist es in Österreich nicht möglich, dass alle eine einfache Kompetenz haben, die auch rechtlich abgesichert ist? Meine sehr geehrten Damen und Herren, das muss doch endlich möglich sein! (Beifall bei der FPÖ.)
Es gibt auch in der mobilen Betreuung ein Problem, das wir ansprechen möchten. Warum können Frauen, die behinderte Kinder zur Welt bringen, nicht vom Spital weg betreut werden, indem man ihnen erläutert, welche Möglichkeiten sie haben, in den ersten Monaten über die Runden zu kommen, etwas, das bei nichtbehinderten Kindern schon gang und gäbe ist? Aber offenbar sind hier Wählerstimmen mehr gefragt als menschliche Wärme gegenüber behinderten Kindern.
Von den Schikanen und Behinderungen möchte ich nur zwei erwähnen. In Linz, bei der Linz AG, wird, wenn ein Behinderter um eine Ermäßigung ansucht und einen Ausweis des Bundessozialamtes vorlegt, diesem schnöde gesagt: Das interessiert uns nicht! Und ins Schmetterlingshaus kann ein spastischer Rollstuhlfahrer, wenn er einmal den Ausweis vergessen hat, eben nicht hinein.
Das muss sich schnellstens ändern, Herr Bundesminister! Tun Sie endlich was dafür – das wäre Ihr verdienstvoller Auftrag. (Beifall bei der FPÖ.)
12.39
Präsident Fritz Neugebauer: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Höllerer. – Bitte.
12.40
Abgeordnete Anna Höllerer (ÖVP): Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Staatssekretärin! Werter Herr Bundesminister! Sehr geehrte – und jetzt möchte ich dieses Zeichen probieren, das ich gerade von meiner Frau Kollegin Jarmer gelernt habe. Es war ein bisschen schnell, da hat sie schon recht. Die Gebärdensprache ist für uns nicht ganz so leicht nachzuvollziehen, aber es ist höchst interessant, miterleben zu können, wie korrekt die Übersetzungen funktionieren. Und dafür auch ein herzliches Dankeschön an die Damen, die die Gebärdensprache übersetzt haben. (Allgemeiner Beifall. – Ruf: Und den Herrn!) – An den Herrn selbstverständlich auch.
Der Behindertenbericht 2008 stellt eine wichtige Dokumentation und Analyse der Situation der Menschen mit Behinderung in Österreich dar. Es ist in diesen Behindertenbericht auch eine Umfrage mit eingeflossen, die von der Statistik Austria durchgeführt wurde, und es wurden 8 195 Personen befragt. 20,5 Prozent aller Befragten haben eine dauerhafte Beeinträchtigung angegeben. Das sind, hochgerechnet, 1,7 Millionen Personen in der österreichischen Wohnbevölkerung, die eine Behinderung haben. Dauerhafte Beeinträchtigungen sind natürlich auch sehr stark altersabhängig, aber trotzdem muss man sich die Frage stellen, wie die Betreuungs- und Pflegesituation der behinderten Menschen jedes Alters in Österreich aussieht.
Wir haben im Jahr 2008 eine Novelle zum Gesundheits- und Krankenpflegegesetz verabschieden können, und da hat sich unser Kollege und Behindertensprecher Franz-Joseph Huainigg ganz besonders angestrengt, hier eine gute und positive Lösung zu finden. Es geht darum, dass mit dieser Novelle auch eine wichtige und sinnvolle Flexibilisierung des Tätigkeitsbereiches für Personenbetreuer im Rahmen der 24-Stunden-Betreuung und der persönlichen Assistenz geschaffen worden ist. Dadurch können die in der Pflege Tätigen für eine bestimmte behinderte Person, die im Privathaushalt lebt, zeitlich eingeschränkt und kontrolliert, delegiert Arbeiten vollbringen.
Hier ist auch eine Regelung für die behinderten Menschen, die in familienähnlichen Wohnstrukturen leben, notwendig, denn auch diese müssen über diese Möglichkeit verfügen können, für Tätigkeiten, die an ihnen vollbracht werden, bestimmte Personen zuständig machen zu können, die tagtäglich mit ihnen in einer Betreuungssituation sind und mit ihnen arbeiten.
Besonders hervorheben möchte ich auch die im Behindertenbericht explizit angeführte Qualitätssicherung für Menschen mit Behinderungen und pflegebedürftige Menschen. Insbesondere im Rahmen des Kompetenzzentrums Pflege, das in der Sozialversicherungsanstalt der Bauern angesiedelt ist, wird von hundert diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegepersonen bundesweit bei allen Pflegegeldbeziehern intensivst kontrolliert. Es werden Hausbesuche durchgeführt. Bei 17 200 Personen haben diese im Jahr 2008 stattgefunden. Es wurden lediglich bei 63 Personen Mängel festgestellt und bei vier Personen eine Verwahrlosung festgestellt. Das heißt, die Pflege im Privathaushalt funktioniert.
Selbstverständlich heißt das, dass weitergearbeitet werden muss – dass weitergearbeitet werden muss im Sinne einer besseren Lebenssituation für behinderte Menschen. Da sind die Politik und die Gesellschaft gefordert. (Beifall bei der ÖVP sowie bei Abgeordneten der SPÖ.)
12.43
Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Dr. Strutz. – Bitte.
12.43
Abgeordneter Dr. Martin Strutz (BZÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Ich möchte zunächst auch seitens meiner Fraktion die Frau Abgeordnete Jarmer recht herzlich willkommen heißen, und ich möchte mich für ihren ersten Debattenbeitrag bedanken. Ich glaube, dass sie damit in den Köpfen der Entscheidungsträger und auch in den Köpfen von uns Abgeordneten mehr bewegt hat als alle Behindertenberichte der Bundesregierung in der Vergangenheit. (Beifall beim BZÖ sowie der Abg. Mag. Wurm.)
Die Bundesregierung legt einen Behindertenbericht vor. Ich würde Sie bitten: Sprechen wir nicht von Behinderten, sprechen wir von Menschen mit Beeinträchtigung! „Hindern“, „behindern“, das ist negativ besetzt. Semantisch sollten wir ein Zeichen setzen und sagen: Wir wollen und wir müssen fördern, wir müssen unterstützen!
Es ist unsere Verpflichtung in einer reichen Gesellschaft, in der wir leben, für die schwächeren, für die beeinträchtigten Menschen mehr zu tun. Und dieser Bericht ist kein Ruhmesblatt für die Bundesregierung. Er zeigt deutlich, dass wir noch akuten Handlungsbedarf haben.
Rein statistisch haben wir mehr Personen mit Beeinträchtigung. Vor allem möchte ich auch darauf hinweisen, dass die Zunahme von Kindern, die bereits mit Beeinträchtigung auf die Welt kommen, eine sehr dynamische ist. Dennoch stellen wir in Summe weniger finanzielle Mittel zur Verfügung.
Ich möchte mich an dieser Stelle auch beim ehemaligen zuständigen Minister Herbert Haupt, der hier anwesend ist, recht herzlich bedanken. Er ist es gewesen, der die Behindertenmilliarde – damals noch in Schilling – eingeführt hat und als Erster ein Zeichen gesetzt hat, dass wir natürlich Geld in die Hand nehmen müssen, um diesen Personenkreis zu unterstützen. (Beifall beim BZÖ.)
Es darf nicht sein, meine Damen und Herren, dass eine Beeinträchtigung zu Armut führt. Wenn wir uns die Statistik in diesem Bericht anschauen, dann sehen wir, dass bereits mehr als 20 Prozent der Beeinträchtigten unmittelbar armutsgefährdet sind. Vor allem Frauen trifft es hier, die natürlich eine geringere Erwerbsbindung haben und eine soziale Situation, die wirklich prekär ist. Hier haben wir akuten Handlungsbedarf.
Ich glaube aber, dass der Bundesregierung der politische Wille und die Bereitschaft fehlt, sich auch für beeinträchtigte und pflegebedürftige Menschen einzusetzen. Die jährliche Valorisierung des Pflegegeldes ist bisher noch immer nicht umgesetzt worden. Die Verbesserung bei der Weiterversicherung für pflegende Angehörige ist weiterhin auf der Agenda. Es fehlt ein Gesamtkonzept für den Pflegebereich. Hier, Herr Bundesminister, haben Sie Handlungsbedarf!
Ich möchte abschließend noch auf eine Initiative des BZÖ verweisen: Wir treten für die Errichtung eines Fonds ein und fordern diese, um Menschen mit Beeinträchtigung bei Diskriminierung finanziell zu unterstützen. Obwohl das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz regelt, dass niemand aufgrund einer Behinderung unmittelbar oder mittelbar diskriminiert werden darf, sind nach wie vor die Benachteiligungen für diese Menschen evident. Und wenn sie zu ihrem Recht kommen wollen, dann haben sie große finanzielle Lasten zu tragen. Wir treten dafür ein, dass in Ihrem Ministerium, Herr Minister Hundstorfer, ein derartiger Fonds geschaffen wird.
Abschließend möchte ich sagen: Wir leben in einer reichen Gesellschaft, wir haben die Gnade, nicht beeinträchtigt zu sein, und wir haben die Verpflichtung, uns für diesen Personenkreis einzusetzen. Das heißt erstens: mehr finanzielle Mittel, und zweitens:
die Forderungen dieser Personen ernst zu nehmen und umzusetzen. (Beifall beim BZÖ sowie des Abg. Gahr.)
12.47
Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Hechtl. – Bitte.
12.47
Abgeordneter Johann Hechtl (SPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Geschätzte Frau Staatssekretärin! Geschätzte Damen und Herren des Hohen Hauses! Wir sprechen heute über einen Bericht, der sich mit einer Gruppe von Personen befasst, denen in der Gesellschaft eine spezielle Stellung zukommt. Behinderte Menschen, die leider immer noch den Status einer Randgruppe haben, bedürfen unserer besonderen Aufmerksamkeit. Die Politik, wir im Hohen Haus, wir als Gesellschaft haben die Aufgabe, unsere Arbeits- und Sozialpolitik, unser Schulsystem und unsere Gesetzgebung an den Bedürfnissen dieses Personenkreises zu orientieren.
Der Bericht der Bundesregierung 2008 bescheinigt, dass wichtige Aufgaben und wichtige Anliegen für behinderte Menschen bereits umgesetzt wurden und sich weitere Anliegen derzeit in der Umsetzungsphase befinden. Ich denke dabei an Maßnahmen wie die Optimierung der Beschäftigungsoffensive, damit der steigenden Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderung entgegengewirkt wird, die Bereitstellung von finanziellen Mitteln für diverse Projekte, die „Aktion 500“ und die Fortsetzung dieser Aktion durch Job Coaching und einige Maßnahmen mehr, gerade für behinderte Jugendliche.
Auch die erst kürzlich beschlossenen Maßnahmen im Rahmen des Einkommensteuergesetzes, die Erweiterung der steuerlichen Absetzbarkeit der Betreuungskosten für behinderte Kinder bis nunmehr zum vollendeten 16. Lebensjahr, all das sind Maßnahmen, die gerade auch den behinderten Personen zugute kommen.
Auch wenn die angeführten Punkte zeigen, dass für behinderte Personen bereits Wichtiges getan wurde, liegt es an uns, geschätzte Damen und Herren, weitere Schritte in Richtung lückenlose Integration von behinderten Menschen und vollkommene Gleichstellung zu setzen.
Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es einer konsequenten Weiterentwicklung der Anliegen der Behinderten und auch einer stetigen Weiterentwicklung des Behinderteneinstellungsgesetzes. Ich möchte festhalten, dass die Verbesserung der Rechtsstellung der Behinderten uns Sozialdemokraten ein zentrales Anliegen ist und auch im Regierungsprogramm festgeschrieben wurde. Mit der Einrichtung einer Arbeitsgruppe unter Einbeziehung der Vertreter aller Sozialpartner und der Behindertenorganisationen wird die Umsetzung des Regierungsprogramms und die Rechtsstellung der Behindertenvertrauenspersonen im Sinne der behinderten Menschen meiner Ansicht nach in geeigneter Weise gewährleistet.
Betreffend Rechte und Pflichten behinderter Personen möchte ich auf das Arbeitsverfassungsgesetz verweisen, gemäß dem der Betriebsrat die betriebliche Interessenvertretung aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – ich betone: aller! – ist und auch der Behinderte/die Behinderte das aktive und das passive Wahlrecht hat und somit bei der Zusammensetzung des Betriebsrates eine wichtige Mitbestimmung hat. Geschätzte Damen und Herren! Dennoch ist es notwendig, dass dem Behindertenausschuss eine noch weiterreichende rechtliche Stellung zukommt.
Ich möchte abschließend betonen, dass wir trotz beachtlicher Erfolge und Fortschritte noch lange nicht am Ziel angelangt sind. – Danke. (Beifall bei der SPÖ.)
12.51
Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Öllinger. – Bitte.
12.51
Abgeordneter Karl Öllinger (Grüne): Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte mich zunächst einmal bei all jenen Kollegen, die das getan haben – und es waren etliche –, für die sehr freundliche bis sogar herzliche Aufnahme der Kollegin Jarmer bedanken. Das ist nicht selbstverständlich, wenn jemand Neuer ins Parlament kommt, das wissen wir. Aber auch die Unterstützung, die das Parlament gegeben hat, damit hier Gleichstellung stattfinden kann, und auch Ihre Unterstützung für diese Anliegen ist sicher wichtig und notwendig. Danke schön! (Beifall bei den Grünen sowie des Abg. Jury.)
Zum Behindertenbericht selbst: Das Problem dieses Berichtes – und darauf sind wir auch in der Ausschussberatung deutlich eingegangen – stellt sich auch hier rein personell dar. Es sitzen hier der Bundesminister für Soziales und die Frau Staatssekretärin aus dem Bundesministerium für Wirtschaft (Staatssekretärin Marek: Und Jugend!) – und Jugend –, es ist aber eigentlich die gesamte Bundesregierung, die hier sitzen müsste und diesen Bericht auch verantworten müsste. Meine Kollegin Jarmer hat schon auf einen Punkt hingewiesen, an dem man sehr deutlich sehen kann, dass dieser Bericht neben Passagen, die auch tatsächlich okay sind – auch wenn sie nur berichten –, auch Passagen enthält, die nicht nur nicht okay sind, sondern die ihrerseits schon fast wieder diskriminierend wirken.
Eine dieser Passagen betrifft die barrierefreien Wahllokale. Ich lese Ihnen diese Passage vor – sie stammt vom Innenministerium –:
„Die beschriebene Rechtslage stellt einen Kompromiss zwischen den berechtigten Wünschen Wahlberechtigter mit Behinderungen und den faktischen Möglichkeiten dar. Zu bedenken ist nämlich, dass die Mehrzahl der etwa 13.000 Wahllokale bei bundesweiten Wahlen in Schulen oder Gasthäusern untergebracht ist und ein Umbau anlässlich einer Wahl kaum umsetzbar ist. Aus Kostengründen besteht für die nähere Zukunft bezüglich dieser Bestimmung auch wenig Handlungsspielraum, um eine für Personen mit Behinderungen noch“ – noch?! – „großzügiger gestaltete Rechtslage zu normieren.“
Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen! Da wird klar vom Innenministerium geschrieben: Ja, wir sind leider nicht in der Lage. Wahllokale sind in Schulen und in Gasthäusern, die können wir aus Kostengründen nicht barrierefrei ausgestalten. Und „noch großzügiger“ als das Nichtausgestalten werden wir in den nächsten zehn Jahren nicht sein können – aus Kostengründen.
Das ist, mit Verlaub, nicht nur zu wenig, sondern das ist tatsächlich feindlich beziehungsweise diskriminierend gegenüber den Behinderten!
Abschließend noch folgender Punkt: Weil in diesem Behindertenbericht ja auch der Bericht des Behindertenanwalts enthalten ist, möchte ich doch, obwohl Herr Haupt jetzt nicht anwesend ist – oja, er sitzt noch da! –, darauf hinweisen. Ich danke auch allen Fraktionen dafür, dass sie dem Anliegen der Kollegin Haidlmayr, dass nämlich der Bericht der Behindertenanwaltschaft hier im Behindertenbericht enthalten ist, nachgekommen sind. Es sind aber auch die einzelnen Punkte aus dem Kapitel von Herrn Haupt erwähnenswert. Ich greife hier nur einen heraus: die fehlenden Valorisierungen im Steuerrecht für Behinderte, wo seit über 20 Jahren nicht mehr angepasst wurde. – Es ist ein lesenswertes Kapitel, es weist auf Versäumnisse hin, die weniger im Sozialressort als in den vielen anderen Ressorts zu finden sind. (Beifall bei den Grünen.)
12.55
Präsident Fritz Neugebauer: Zu Wort gelangt nun Frau Staatssekretärin Marek. – Bitte.
12.55
Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend Christine Marek: Herr Präsident! Herr Bundesminister! Meine Damen und Herren! Frau Abgeordnete Jarmer, ich freue mich sehr, dass Sie heute als erste gehörlose Abgeordnete angelobt wurden. Ich durfte bei der 95-Jahr-Feier des Österreichischen Gehörlosenbundes dabei sein. Es war für mich eine wichtige Erfahrung, und ich würde allen Abgeordneten dieses Hauses und vielen Menschen in Österreich wünschen, diese Erfahrung zu machen, weil es ein Stück mehr ermöglicht, auch Menschen mit Behinderung – und zwar aller Arten von Behinderung – als selbstverständlich integriert zu erleben und damit auch einen selbstverständlichen Umgang zu haben. Da ist, glaube ich, in unseren Köpfen in Hinblick auf die Bewusstseinsbildung noch sehr viel an Arbeit zu tun. Ich freue mich sehr auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit. (Beifall bei der ÖVP sowie bei Abgeordneten der Grünen.)
Ich glaube, wir haben – Herr Bundesminister Hundstorfer hat von seinem Bereich schon sehr viel gesagt – in den letzten Jahren sehr viel getan, aber wir sind natürlich bei Weitem noch nicht am Ende des Weges, gerade was die Barrierefreiheit auf allen Ebenen betrifft. Ein ganz wichtiges Thema ist, auch in der Infrastruktur Erleichterungen und echte Barrierefreiheit zu schaffen, beispielsweise wenn man die Barrierefreiheit von Arztpraxen, von Gesundheitseinrichtungen betrachtet: Hier könnte manches schneller gehen. Auch im Tourismus haben wir vonseiten des Wirtschaftsministeriums vor zwei Jahren eine neue eigene Homepage für Angebote im touristischen Bereich für Menschen mit Behinderung präsentiert.
Aber ich möchte auch – gerade als Staatssekretärin, die für die Familien zuständig ist – den Bereich der Familien ansprechen, denn Menschen mit behinderten Kindern beziehungsweise Familien, in denen ein Familienmitglied behindert ist, stehen vor vielen, vielen Herausforderungen. Das haben auch Vorredner bereits gesagt. Wir haben hier letztes Jahr einerseits die Familienbeihilfe erhöht, aber auch bei der steuerlichen Absetzbarkeit Maßnahmen gesetzt – auch wenn es natürlich immer mehr sein könnte, Herr Abgeordneter Öllinger, das ist klar. Aber ich glaube, wir haben hier ein breites Spektrum, was ganz wichtig ist.
An dieser Stelle sei auch dem jetzigen Behindertenanwalt Herbert Haupt ein Dankeschön gesagt, der damals, 2001, als zuständiger Minister ein eigenes Konzept erarbeitet hat, damit die österreichischen Familienberatungsstellen österreichweit flächendeckend auch besonders einen Schwerpunkt auf die Beratung von Familien mit einem behinderten Familienmitglied setzen. Da sind wir mit 23 spezialisierten Beratungsstellen österreichweit fast am Ziel. Und danke auch, Herbert Haupt, für die engagierte Arbeit in den letzten Jahren, gerade für und mit behinderten Menschen! (Beifall bei ÖVP und BZÖ.)
Meine Damen und Herren! Ich möchte meine Ausführungen gerne mit einer Anmerkung zu folgendem Thema abschließen: Gerade wenn es um das Thema Menschen mit Behinderung, Kinder mit Behinderung geht, sollten wir in unserer Diskussion in der nächsten Zeit auch eines nicht vergessen – wir haben dazu auch im Regierungsprogramm etwas festgehalten –, nämlich dass es auch Maßnahmen bedarf, um Eltern zu begleiten und zu unterstützen, die ein Kind erwarten, für das die Diagnose lautet, dass dieses Kind mit Behinderung zur Welt kommen wird, sprich: „Schadensfall“ Kind mit Behinderung.
Ich glaube, dass wir in der Beratung, in der Begleitung dieser werdenden Eltern noch ganz viel zu tun haben, und ich hoffe sehr, dass wir eine breite Diskussion führen und
konstruktive Lösungen erarbeiten werden, die gerade diesen werdenden Eltern Hilfestellung geben und auch die Entscheidung für ein Kind, auch wenn es mit einer Behinderung zur Welt kommen wird, erleichtern – denn diese Entscheidung ist schwer genug. – Danke. (Beifall bei der ÖVP sowie der Abg. Csörgits.)
12.59
Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Pack. – Bitte.
12.59
Abgeordneter Jochen Pack (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bundesminister! Frau Staatssekretärin! Meine Vorredner sind ja schon auf den Bericht eingegangen, und man sieht, dass er sehr ausführlich ist und dass es in diesem Bereich einiges an positiven Beispielen gibt.
Da jetzt Frau Staatssekretärin Marek hier anwesend ist, möchte ich auch einen Bereich erwähnen, der mir besonders wichtig ist. Wir haben viel über soziale Absicherung, über die Möglichkeit, ein Arbeitsverhältnis einzugehen et cetera gesprochen. Zu einem vollkommen integrierten Leben gehört aber natürlich auch, dass man seine Freizeit frei, vor allem barrierefrei genießen kann. Barrierefreier Urlaub ist in dem Zusammenhang ein wesentliches Stichwort. Wenn man sich dieses Kapitel im Bericht ansieht, dann wird dort der Freizeitwirtschaft und der Tourismuspolitik in Österreich ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt. Ich möchte zum Beispiel die TOP-Tourismus-Förderung erwähnen. In deren Rahmen werden Betriebe unterstützt, die Maßnahmen setzen, um den Zugang von beziehungsweise die Nutzung durch Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen. (Präsident Dr. Graf übernimmt den Vorsitz.)
Das Thema barrierefreier Urlaub hat sich schon in zahlreichen Projekten, die auch seitens der öffentlichen Hand unterstützt werden, in Prospekten, in Plattformen niedergeschlagen. Als Hartberger Regionalmandatar bin ich natürlich besonders stolz darauf, dass eine zu Beginn kleine Initiative der Behinderten-Selbsthilfe-Gruppe Hartberg mit ihrer Plattform „barrierefreierurlaub.at“ mittlerweile zu einem fixen Bestandteil des Tourismus in Österreich geworden ist. Diese Gruppe widmet sich diesem Thema; sie hat auch jetzt wieder Projekte eingereicht, um das Thema barrierefreier Urlaub und den barrierefreien Zugang zu Tourismusbetrieben auch in Zukunft weiter bearbeiten zu können.
Wenn man sich diesen Bereich anschaut, erkennt man, dass es in Zukunft wichtig sein wird, dass wir uns ein bisschen anstrengen, um einheitliche Erhebungsmethoden und Qualitätskriterien zu entwickeln, damit wirklich überall in Österreich ein barrierefreier Urlaub auch ein barrierefreier Urlaub ist, wie wir ihn uns vorstellen. (Beifall bei der ÖVP.)
Ich möchte noch ganz kurz erwähnen, dass sich Unternehmerinnen und Unternehmer sehr wohl sehr um die Einstellung von Menschen mit Behinderung bemühen, das aber eben nicht immer möglich ist. Gerade von größeren Betrieben ab 25 Mitarbeitern wird ja auch, wenn dies nicht möglich ist, ein entsprechender finanzieller Beitrag geleistet.
Zur Freizeit gehört natürlich der Sport. Auch in diesem Bereich stellt der Bericht ein gutes Zeugnis aus. Es geben uns ja auch die Erfolge bei verschiedenen Sportveranstaltungen recht. Sie zeigen, dass wir in diesem Bereich sehr gut unterwegs sind, dass die Fördersysteme passen. Es fällt nur auf, dass man in Zukunft bereits beim Sportstättenbau etwas mehr auf barrierefreie Zugangsmöglichkeiten achten sollte. Da wird schon einiges getan, aber da sollten wir uns ein bisschen mehr bemühen. Was die Fachverbände betrifft, sollten wir darauf schauen, dass noch mehr Experten zum Themenbereich Behindertensport in den einzelnen Sportverbänden und Fachverbänden vorhanden sind. Ein gutes Beispiel dafür ist die SPORTUNION. (Beifall bei der ÖVP.)
13.03
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als nächste Rednerin zu Wort gelangt Frau Abgeordnete Dr. Belakowitsch-Jenewein. Eingestellte Redezeit: 3 Minuten. – Bitte.
13.03
Abgeordnete Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein (FPÖ): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Frau Staatssekretärin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Behinderten in Österreich haben es nach wie vor sehr schwer. Das haben wir heute schon ausführlich gehört. Was aber immer wieder untergeht, sind Familien mit behinderten Kindern, die zwar eine Zuwendung in Form einer doppelten Familienbeihilfe erhalten, aber in dem Moment, in dem sie vielleicht auch noch Pflegegeld für ihre behinderten Kinder beantragen, ist ein Teil dieser doppelten Familienbeihilfe wieder weg. Wenn schon die Frau Staatssekretärin für Familie hier anwesend ist, dann ist darauf hinzuweisen, dass das ein Umstand ist, der raschest, schleunigst beendet werden sollte. Das ist etwas, das wirklich asozial ist. (Ruf bei der SPÖ: Das stimmt nicht!) – Natürlich stimmt das, Frau Kollegin! Erkundigen Sie sich! Das ist ein Umstand, der die Eltern wirklich finanziell belastet. Ich meine, Österreich kann es sich leisten, diesen Menschen auch bei Bezug von Pflegegeld die doppelte Familienbeihilfe in voller Länge auszubezahlen. (Beifall bei der FPÖ.)
Wir haben gestern mehrfach gehört, wie schwierig es für behinderte Menschen ist, zu einer sozialen Absicherung zu kommen, wenn sie in den Arbeitsprozess eingegliedert sind. Sehr viele behinderte Menschen arbeiten für ein Taschengeld, und das ist ebenfalls eine Schande in diesem Land. Es ist daher dringend notwendig, dass man auch hier endlich den Hebel ansetzt, dass man diese Menschen als gleichwertig behandelt, dass auch diese Menschen zu ihrem Recht kommen und nicht als Arbeitnehmer dritter, vierter, fünfter Klasse gewertet werden, sondern dass sie dieselben Rechte haben wie nicht behinderte Menschen. (Beifall bei der FPÖ.)
Meine Damen und Herren, eines ist mir jedoch ein ganz besonderes Anliegen, weil es schon auch ein bisschen zeigt, wie Österreich in Wahrheit dasteht: Es gibt eine Reihe von OGH-Urteilen, in denen behinderte Kinder als Schaden anerkannt worden sind. – Ich weiß, Herr Bundesminister, Sie sind dafür nicht wirklich allein verantwortlich, es fällt in den Verantwortungsbereich des Justizministeriums. (Zwischenrufe bei der SPÖ.) – Na ja, er sitzt mit in der Regierung, er sitzt als Minister mit in der Regierung.
Herr Bundesminister, ich würde Sie wirklich bitten, dass Sie mit der Justizministerin dahin gehend Kontakt aufnehmen, dass solche menschenunwürdigen Urteile in Zukunft nicht mehr gefällt werden.
Es gab im Sommer 2008 ein Urteil. Da hat eine Mutter geklagt, weil sie drei statt zwei Kinder bekommen hatte. Weil alle drei Kinder gesund waren, waren sie kein Schaden. Wenn ein Kind behindert ist, gilt es als Schaden. (Abg. Mag. Lapp: Darum ist es in der Klage nicht gegangen!) Es ist eine Schande für Österreich, dass in Österreich mittlerweile bereits drei Kinder als Schaden gelten und für drei Kinder Ärzte beziehungsweise Krankenhäuser Geld bezahlen müssen, weil sie als Schaden gelten. (Abg. Mag. Lapp: Sie lügen!)
Meine Damen und Herren, das ist eine Schande! Und ich bitte Sie wirklich, Herr Bundesminister, sich hiefür einzusetzen, dass solche Schandurteile in Österreich nicht möglich sind. (Beifall bei der FPÖ. – Abg. Mag. Lapp: Der Schaden war nicht das Kind!)
13.05
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Für den Vorwurf der Frau Abgeordneten Lapp an die Rednerin Dr. Belakowitsch-Jenewein, sie lüge, erteile ich einen Ordnungsruf. (Abg. Krist: Das ist aber die Wahrheit, Herr Präsident!)
Zu einer tatsächlichen Berichtigung hat sich Frau Abgeordnete Mag. Lapp zu Wort gemeldet. Ich erteile ihr das Wort und erinnere an die einschlägigen Bestimmungen für tatsächliche Berichtigungen in der Geschäftsordnung. – Bitte.
13.06
Abgeordnete Mag. Christine Lapp (SPÖ): Frau Kollegin Belakowitsch-Jenewein hat gesagt, dass der Oberste Gerichtshof im vergangenen Jahr 2008 ein Urteil gefällt hätte, dass ein behindertes Kind ein Schaden gewesen wäre. – Das ist nicht der Fall.
Der Oberste Gerichtshof hat dezidiert festgehalten, dass der Schaden darin bestanden hat, dass der Familie keine weitere und keine adäquate Untersuchung zugekommen ist, und hat in seinem Urteil auch festgehalten, dass behinderte Kinder natürlich kein Schaden sind. (Beifall bei der SPÖ.)
13.07
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Der Herr Bundesminister möchte sich zu einer Stellungnahme zu Wort melden. – Bitte.
13.07
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz Rudolf Hundstorfer: Meine Damen und Herren! (Rufe und Gegenrufe zwischen Abgeordneten von SPÖ und FPÖ.) – Darf ich um eine Sekunde Aufmerksamkeit bitten? Ich möchte bei aller Emotionalität des Themas zwei Dinge klarstellen: Ja, bei Pflegegeldzuerkennung werden von der erhöhten Familienbeihilfe 60 € beim Pflegegeld eingerechnet. Das heißt, es bleibt weiterhin eine Erhöhung, aber 60 € werden abgezogen. Dies nur zur sachlichen Klarstellung. – Das ist einmal Punkt eins.
Und eine zweite Klarstellung sei mir hier auch gestattet: Ja, ich bin Mitglied dieser Bundesregierung, ich bin gerne Mitglied dieser Bundesregierung, aber wir sollten uns über eines im Klaren sein: Ich will nicht in einem Staat leben, in dem es Gerichte gibt, die von Weisungen von Regierungen abhängig sind.
Wir haben weisungsfreie Gerichte, wir haben weisungsfreie Höchstgerichte, und dieses Rechtsgut lasse ich mir nicht nehmen. So unangenehm, so schwierig, so kompliziert die Sachlage bei diesen Kindern auch ist, gar keine Frage, so lasse ich mir von Ihnen nicht nahelegen, dass ich Weisungen erteilen sollte, damit Höchstgerichte anders entscheiden. – Danke. (Beifall bei SPÖ und ÖVP sowie bei Abgeordneten der Grünen.)
13.08
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Damit schließe ich die Debatte.
Wünscht eine der Berichterstatterinnen ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall.
Wir gelangen zur Abstimmung, die ich über jeden Ausschussantrag getrennt vornehme.
Zunächst kommen wir zur Abstimmung über den Antrag des Ausschusses für Arbeit und Soziales, den vorliegenden Bericht der Bundesregierung III-23/241 der Beilagen über die Lage von Menschen mit Behinderungen zur Kenntnis zu nehmen.
Ich bitte jene Damen und Herren, die für diese Kenntnisnahme eintreten, um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist die Mehrheit und somit angenommen.
Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Ing. Hofer, Kolleginnen und Kollegen betreffend Gebärdensprachkurse für Eltern gehörloser Kinder.
Ich bitte jene Damen und Herren, die für den Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist die Minderheit und somit abgelehnt.
Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Ing. Hofer, Kolleginnen und Kollegen betreffend progressive Ausgleichstaxe.
Ich bitte jene Damen und Herren, die für den Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. – Auch das ist die Minderheit und somit abgelehnt.
Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Ing. Hofer, Kolleginnen und Kollegen betreffend Inflationsanpassung des Pflegegeldes.
Ich bitte jene Damen und Herren, die für den Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. – Auch das ist die Minderheit und somit abgelehnt.
Wir gelangen weiters zur Abstimmung über den Antrag des Ausschusses für Arbeit und Soziales, seinen Bericht 253 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen.
Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes Zeichen. – Das ist die Mehrheit und somit angenommen.
Schließlich kommen wir zur Abstimmung über den Antrag des Ausschusses für Arbeit und Soziales, seinen Bericht 254 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen.
Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes Zeichen. – Auch das ist die Mehrheit und somit angenommen.
Bericht des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft über den Antrag 687/A der Abgeordneten Fritz Grillitsch, Mag. Kurt Gaßner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Marktordnungsgesetz 2007, das Marktordnungs-Überleitungsgesetz, das Pflanzenschutzmittelgesetz 1997, das Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz, das Pflanzgutgesetz 1997, das Pflanzenschutzgesetz 1995 und das Forstliche Vermehrungsgutgesetz 2002 geändert werden (Agrarrechtsänderungsgesetz 2009) (293 d.B.)
7. Punkt
Bericht des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft über den Antrag 581/A(E) der Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber, Kolleginnen und Kollegen betreffend Maßnahmen gegen die ruinösen Folgen der EU-Milchmarktpolitik (294 d.B.)
8. Punkt
Bericht des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft über den Antrag 72/A(E) der Abgeordneten Gerhard Huber, Kolleginnen und Kollegen betreffend Absicherung einer wirtschaftlich gesunden Milchwirtschaft (295 d.B.)
9. Punkt
Bericht des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft über den Antrag 583/A(E) der Abgeordneten Ing. Norbert Hofer, Kolleginnen und Kollegen betreffend Erhaltung der heimischen kleinbäuerlichen Struktur und der Diversität von Arten und Ökosystemen (296 d.B.)
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Wir gelangen nun zu den Punkten 6 bis 9 der Tagesordnung, über welche die Debatte unter einem durchgeführt wird.
Auf eine mündliche Berichterstattung zu den Punkten 7 bis 9 wurde verzichtet.
Zum Vorbringen einer Berichtigung zu Punkt 6 erteile ich dem Berichterstatter, Herrn Abgeordnetem Auer, das Wort. – Bitte.
Berichterstatter Jakob Auer: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! In Ergänzung als Berichterstattung zum Agrarrechtsänderungsgesetz 2009, 293 d. B.: Das Agrarrechtsänderungsgesetz 2009 hat im Ausschuss umfangreiche Abänderungen erfahren. Da die im Abänderungsantrag angehängten Erläuterungen für die Rechtsinterpretation von Bedeutung sind, möchte ich diese als Berichterstatter ergänzen.
Der Text wird bereits im Plenum verteilt, es erübrigt sich daher eine Verlesung. Der Text findet sich aus Gründen der Übersichtlichkeit zusammen mit der Begründung auch im Internet unter dem Punkt „Geschichte“ beim Ausschussbericht als Information. – Herzlichen Dank.
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Der Herr Berichterstatter hat schon mitgeteilt, dass gemäß § 53 Abs. 4 GOG die soeben dargestellte Berichtigung aufgrund ihres Umfanges an die Abgeordneten hier im Saal verteilt wurde. Sie steht somit mit zur Debatte. Ich danke für die Ausführungen.
Die Information zum Bericht hat folgenden Wortlaut:
Information zum Bericht
des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft vom 1. Juli 2007 in 293 d. B. (XXIV. GP)
über den Antrag 687/A der Abgeordneten Fritz Grillitsch, Mag. Kurt Gaßner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Marktordnungsgesetz 2007, das MarktordnungsÜberleitungsgesetz, das Pflanzenschutzmittelgesetz 1997, das Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz, das Pflanzgutgesetz 1997, das Pflanzenschutzgesetz 1995 und das Forstliche Vermehrungsgsgutgesetz 2002 geändert werden (Agrarrechtsänderungsgesetz 2009)
Im erzählenden Teil des oben zitierten Berichts (Dokument „Berichterstattung“) wurde ausgeführt, dass im Zuge der Debatte die Abgeordneten Fritz Grillitsch und Mag. Kurt Gaßner einen Abänderungsantrag eingebracht haben, der mit Stimmenmehrheit angenommen wurde. Die Begründung dieses Antrages wurde im Bericht wiedergegeben, die im Abänderungsantrag angehängten Erläuterungen hierzu wurden aber nicht beigedruckt.
Da die Erläuterungen für die Rechtsinterpretation von Bedeutung sind, werden auch diese nachfolgend informativ angeführt. Zum besseren Verständnis werden sowohl die Begründung aus dem ursprünglichen Ausschussbericht als auch die Erläuterungen im vollen Umfang wiedergegeben:
„Begründung
zum Agrarrechtsänderungsgesetz 2009
Begründung
zu Artikel 1 und 2 (Änderung des Marktordnungsgesetzes 2007 sowie des Marktordnungs-Überleitungsgesetzes)
Problem:
Die Verordnung (EG) Nr. 73/2009 mit gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen im Bereich der Gemeinsamen Agrarpolitik ersetzt die bisherige Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 und enthält die im Rahmen des Gesundheitschecks der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) vorgesehenen Umsetzungsmaßnahmen im Bereich der Direktzahlungen.
Ebenso wurden die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 über eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte geändert und insbesondere Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Auslaufen der Milchquotenregelung vorgesehen.
Ziel:
Die Ausgestaltung der inhaltlichen Spielräume soll durch eine Änderung des MOG 2007 erfolgen. Die Änderungen im Bereich der Direktzahlungen werden mit 1. Jänner 2010 wirksam, die Mitteilung an die Europäische Kommission über die vom Mitgliedstaat getroffenen Umsetzungsmaßnahmen hat jedoch bereits vor dem 1. August 2009 zu erfolgen.
Inhalt/Problemlösung:
Umsetzung der im Rahmen des GAP-Gesundheitschecks eingeräumten Spielräume im Bereich der Direktzahlungen, insbesondere zur weiteren Einbeziehung bisher produktionsgekoppelter Stützungen in die Betriebsprämienregelung bei weiterer Beibehaltung der Mutterkuhprämie und dem Grundsatz der Fortführung des bisherigen Betriebsprämienmodells
Möglichkeit der einzelbetrieblichen Zuteilung der Milchquotenerhöhung ab 2009 nach Maßgabe der jeweils aktuellen Marktlage und der Absatzmöglichkeiten im Milchsektor
Möglichkeit zur Teilnahme an optionalen Gemeinschaftsprogrammen (wie zum Beispiel Schulobstprogramm oder kostenlose Abgabe von Erzeugnissen aus Beständen der Intervention an Bedürftige in der Gemeinschaft)
Alternativen:
Grundlegende Umgestaltung der Betriebsprämienregelung für den Zeitraum bis längstens 2013
Keine einzelbetriebliche Milchquotenzuteilung
Auswirkungen des Regelungsvorhabens:
Finanzielle Auswirkungen:
Durch die vorgesehenen Maßnahmen entsteht der AMA ein Aufwand für Software-Programmierung, Verwaltung und Abwicklung in Höhe von insgesamt 929 900 € im ersten Jahr, für die Entkoppelung der Flächenzahlung für Schalenfrüchte im Jahr 2011 ein Aufwand in Höhe von 31 000 € und für die Entkoppelung der restlichen sektorbezogenen Stützungen im Jahr 2012 ein Aufwand von 84 000 €.
Wirtschaftspolitische Auswirkungen:
Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich:
Die vorgesehene Umsetzung hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich. Die Beibehaltung der produktionsgekoppelten Mutterkuhprämie dient insbesondere auch der Sicherung der Bewirtschaftung bestimmter ungünstigerer Produktionsgebiete. Mit der sogenannten Milchkuhprämie sollen die strukturellen Nachteile der österreichischen Milchbetriebe im EU-Vergleich
abgefedert werden, um einerseits die Aufrechterhaltung der Milchproduktion zu gewährleisten und andererseits eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Milcherzeuger im Hinblick auf das Auslaufen der Milchquotenregelung zu ermöglichen.
Auswirkungen auf Verwaltungslasten für Unternehmen:
Durch den Schwellenwert von 100 € für die Direktzahlungsgewährung (§ 8 Abs. 2) verringert sich die
Zahl der Antragsteller um rund 3 500 Betriebsinhaber. Die weitere Einbeziehung produktionsgekoppelter Zahlungen (§ 8 Abs. 3 Z 1) sowie die verpflichtende digitale Ermittlung der Referenzparzellen (§ 28 Abs. 3) bringt gleichzeitig eine Vereinfachung beim Sammelantrag. Nach Berechnung in der BRIT-Datenbank (gemäß § 10 Abs. 1 der Standardkosten-Richtlinien, BGBl. II Nr. 233/2007) verringern sich die Verwaltungslasten für Unternehmen um rund 4 Mio €/Jahr.
Durch die Möglichkeit der Beantragung eines Härte- oder Sonderfalles (§ 8 Abs. 3 Z 2 bis 4) entstehen zusätzliche Verwaltungslasten in Höhe von 8 500 €.
Für die Gewährung der Milchkuhprämie (§ 8 Abs. 4) entstehen infolge Verwendung der Daten aus der Rinderdatenbank keine weiteren Verwaltungslasten.
Die Verwaltungslasten für die Milchquotenzuteilung (§ 10 Abs. 2 Z 1a) betragen 2 752 €/Jahr (maximal für die Dauer von fünf Jahren).
Auswirkungen in umweltpolitischer Hinsicht, insbesondere Klimaverträglichkeit:
Das Regelungsvorhaben ist nicht klimarelevant.
Auswirkungen in konsumentenschutzpolitischer sowie sozialer Hinsicht:
Keine
Geschlechtsspezifische Auswirkungen:
Keine
Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union:
Der Entwurf sieht Umsetzungsmaßnahmen vor, zu denen der Bund auf Grund des im Gemeinschaftsrecht verankerten Gestaltungsspielraums berechtigt bzw. verpflichtet ist.
Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens:
Keine.
Begründung
zu Artikel 3 (Änderung des Pflanzenschutzmittelgesetzes 1997)
Problem:
Mit dem vorliegenden Gesetz werden die Bestimmungen der vereinfachten Zulassung von Pflanzenschutzmitteln an die Judikatur des EuGH angepasst.
Der Ermächtigung des Bundesministers zur Erlassung einer Verordnung über die Gebühren in Vollziehung des Pflanzenschutzmittelgesetzes 1997 ist durch den § 6 des Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetzes, BGBl. I Nr. 63/2002, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 143/2008, obsolet.
Ziel und Problemlösung:
Durch den vorliegenden Entwurf soll zwecks Umsetzung der Judikatur des EuGH eine Vorschrift über eine zusätzliche Voraussetzung für die vereinfachte Zulassung von Pflanzenschutzmitteln vorgesehen werden.
Die Aufhebung der Ermächtigung des Bundesministers zur Erlassung einer Verordnung über die Gebühren in Vollziehung des Pflanzenschutzmittelgesetzes 1997 dient der Rechtsbereinigung.
Alternativen:
Keine.
Auswirkungen des Regelungsvorhabens:
Finanzielle Auswirkungen:
Keine kalkulierbaren Auswirkungen.
Wirtschaftspolitische Auswirkungen:
Auswirkungen in umweltpolitischer Hinsicht, insbesondere Klimaverträglichkeit:
Das Regelungsvorhaben ist nicht klimarelevant.
Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich:
Keine kalkulierbaren Auswirkungen.
Auswirkungen auf die Verwaltungslasten für Unternehmen:
Es werden keine wesentlichen Auswirkungen auf die Verwaltungslasten für Unternehmen verursacht.
Auswirkungen in konsumentenschutzpolitischer sowie sozialer Hinsicht:
Keine Auswirkungen.
Geschlechtsspezifische Auswirkungen:
Keine Auswirkungen.
Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens:
Keine.
Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union:
Es erfolgt eine Anpassung an die Judikatur des EuGH.
Begründung
zu Artikel 4 (Änderung des Pflanzgutgesetzes 1997)
Problem:
Es besteht die Notwendigkeit der Umsetzung der Richtlinie 2008/90/EG in innerstaatliches Recht.
Ziel und Problemlösung:
Durch den vorliegenden Entwurf sollen zwecks Umsetzung der obgenannten Richtlinie Vorschriften betreffend die Umstellung der Zulassung von Versorgern auf eine bloße Registrierung, eine Anpassung der Sortenlisten für Obstarten, ein Zertifizierungsverfah-
ren für Obstpflanzgut sowie eine Präzisierung der „amtlichen Prüfung“ vorgenommen werden.
Weiters sind aufgrund der Erfahrungen der Vollzugspraxis einige Änderungen bei Probenahmen sowie bei Akkreditierungen von Labors vorgesehen.
Alternative:
Beibehaltung des bisherigen Zustandes. Hinsichtlich der Umsetzung der Richtlinie 2008/90/EG keine.
Auswirkungen des Regelungsvorhabens:
Finanzielle Auswirkungen:
Keine kalkulierbaren Auswirkungen.
Wirtschaftspolitische Auswirkungen:
Auswirkungen in umweltpolitischer Hinsicht, insbesondere Klimaverträglichkeit:
Das Regelungsvorhaben ist nicht klimarelevant.
Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich:
Die rechtzeitige Umsetzung der Rechtsvorschriften in nationales Recht trägt dazu bei, dass österreichischen Firmen ermöglicht wird, ihre Produktion rechtzeitig den neuen Gemeinschaftsrechtsvorschriften anzupassen und so auf dem gemeinschaftlichen Markt präsent zu sein.
Auswirkungen auf die Verwaltungslasten für Unternehmen:
Keine wesentlichen Auswirkungen, da derzeit bereits alle betroffenen Betriebe erfasst sind. Die vorgeschlagene Neuregelung, wonach von einem Akkreditierungssystem auf ein Meldesystem umgestellt wird, hat nur Auswirkungen auf Betriebe, die die Tätigkeit neu aufnehmen. In Anbetracht des sehr kleinen österreichischen Marktes ist dabei nur von einer sehr kleinen Zahl an Betrieben, die die Tätigkeit eines Versorgers neu beginnen, auszugehen.
Auswirkungen in konsumentenschutzpolitischer sowie sozialer Hinsicht:
Keine Auswirkungen.
Geschlechtsspezifische Auswirkungen:
Keine Auswirkungen.
Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens:
Keine.
Verhältnis zu Rechtsvorschriften der EU:
Die Rechtsvorschriften dienen der Umsetzung der Richtlinie 2008/90/EG (32009L0090) und stehen im Einklang mit Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft.
Begründung
zu Artikel 5 (Änderung des Pflanzenschutzgesetzes 1995)
Problem:
Es besteht aufgrund von Vorschriften von Drittländern die Notwendigkeit, Durchführungsvorschriften für die innerstaatlichen Anforderungen bei der Ausfuhr von Pflanzen,
Pflanzenerzeugnissen und sonstigen geregelten Gegenständen zu erlassen. Weiters wären die Vorschriften hinsichtlich der Probenahme der Judikatur des Europäischen Gerichtshofes anzupassen. Es erscheint ebenso erforderlich, die Vorschriften für die Durchführung der Kontrolle von Verpackungsmaterial aus Holz zu ergänzen. Im Zusammenhang mit dem Schmuggel artenschutzrechtlich geschützter Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse besteht auch Bedarf an der Klarstellung der phytosanitären Einfuhrerfordernisse.
Ziel und Problemlösung:
Durch den vorliegenden Entwurf sollen Vorschriften für Ausführer von Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen und sonstigen geregelten Gegenständen hinsichtlich der Verpflichtung zu Registrierung, Kennzeichnungs- und Verplombungssystemen und phytosanitären Sicherstellungen aufgenommen werden. Bei der Kontrolle von Verpackungsmaterial aus Holz mit Ursprung in Drittländern soll es zu einer Neuausrichtung der Kontrollen kommen. Die bisherigen Probenahmevorschriften sind mit der neueren Judikatur des Europäischen Gerichtshofes nicht mehr kongruent und sollten daher entfallen. Weiters erscheint eine Ergänzung der Strafbestimmung hinsichtlich der Ahndung der Einfuhr von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen ohne gültiges Pflanzengesundheitszeugnis im Zusammenhang mit dem Schmuggel artenschutzrechtlich geschützter Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse angebracht.
Alternative:
Beibehaltung des bisherigen Zustandes.
Auswirkungen des Regelungsvorhabens:
Finanzielle Auswirkungen:
Die Vollziehung der Kontrolle von Verpackungsmaterial aus Holz mit Ursprung in Drittländern verursacht Kosten in Höhe von ca. 18 500 EUR.
Wirtschaftspolitische Auswirkungen:
Auswirkungen in umweltpolitischer Hinsicht, insbesondere Klimaverträglichkeit:
Das Regelungsvorhaben ist nicht klimarelevant.
Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich:
Die Anpassung der Vorschriften beim Export dient der Möglichkeit, auf phytosanitäre Anforderungen von Drittländern rasch zu reagieren und dient somit der österreichischen Exportwirtschaft und hat somit positive (wenn auch nicht präzise kalkulierbare) Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich.
Auswirkungen auf die Verwaltungslasten für Unternehmen:
Die allfällige Änderung der Verwaltungslasten für Unternehmer infolge der Änderung der Exportvorschriften ist abhängig von allfälligen Anforderungen der Drittländer, die erst in Zukunft wirksam werden, so dass die Novelle derzeit keine unmittelbaren Auswirkungen zeitigt.
Auswirkungen in konsumentenschutzpolitischer sowie sozialer Hinsicht:
Keine Auswirkungen.
Geschlechtsspezifische Auswirkungen:
Keine Auswirkungen.
Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens:
Keine.
Verhältnis zu Rechtsvorschriften der EU:
Die Rechtsvorschriften dienen einerseits der Durchführung von internationalem Recht und stehen in Einklang mit diesbezüglichen Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft. Andererseits dienen die Vorschriften der Anpassung an die Judikatur des Europäischen Gerichtshofes und stehen somit im Einklang mit Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft.
Begründung
zu Artikel 6 (Änderung des Forstlichen Vermehrungsgutgesetzes 2002)
Probleme:
Nach 6-jähriger Anwendungszeit des Gesetzes wurde im Rahmen der Vollziehung festgestellt, dass Ergänzungen und Korrekturen im Gesetz notwendig sind. Daher wurde die Novelle als erforderlich erachtet.
Ziele:
Novellierung des Forstlichen Vermehrungsgutgesetzes 2002
Inhalt/ Problemlösung:
Wildlingsgewinnung wird auch in der Kategorie „ausgewählt“ möglich
VO Ermächtigungen für Zulassungszeichen auch bei „quellengesichert“ und für bestimmte Baumarten bei Wildlingsgewinnung
Meldepflicht für Erntebeginn auf 1 Woche verkürzt
Überprüfung des Stammzertifikats auch bei quellengesichertem Vermehrungsgut und bei qualifiziertem Vermehrungsgut für Klone und Klonmischungen
Vermengung von Saatgut auch in der Kategorie „qualifiziert“ möglich
Aufbewahrungspflicht von Betriebsaufzeichnungen von 10 auf 7 Jahre gekürzt
Verfolgungsverjährungsfrist auf 2 Jahre erhöht, Geldstrafenhöhe auf 7000,- € reduziert
Alternativen:
Keine.
Auswirkungen des Regelvorhabens:
Finanzielle Auswirkungen:
Da mit der vorliegenden Gesetzesänderung kein Mehraufwand verbunden ist, da zB Kontrollbefugnisse bei der Einfuhr nunmehr entfallen, kommt es zu keinen zusätzlichen Kosten.
Wirtschaftspolitische Auswirkungen:
Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich :
Keine Auswirkungen auf die Verwaltungslasten für Unternehmen:
Mit der vorliegenden Gesetzesänderung sind keine zusätzlichen Informationsverpflichtungen verbunden.
Auswirkungen in umweltpolitischer Hinsicht, insbesondere Klimaverträglichkeit, konsumentenschutzpolitischer sowie sozialer Hinsicht:
Keine und das Vorhaben ist auch nicht klimarelevant.
Geschlechtsspezifische Auswirkungen:
Keine
Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union:
Der Entwurf sieht Maßnahmen vor, zu denen der Bund aufgrund zwingender Vorschriften des Gemeinschaftsrechtes verpflichtet ist.
Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens:
Keine.
Erläuterungen
zu Artikel 1 (Änderung des Marktordnungsgesetzes 2007)
A. Allgemeiner Teil
Hauptgesichtspunkte des Entwurfs
Mit dem sogenannten GAP-Gesundheitscheck ist die in Art. 64 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 vorgesehene Überprüfung der Umsetzung der Betriebsprämienregelung und deren Auswirkungen im Bereich der Markt- und Strukturentwicklungen vorgenommen worden.
Aufgrund der dabei gewonnenen Erfahrungen hat sich gezeigt, dass bestimmte Elemente des Stützungsmechanismus angepasst werden müssen und insbesondere bisher (noch) vorgesehene produktionsgekoppelte Zahlungen in die Betriebsprämienregelung einbezogen werden sollen.
Ebenso soll das Funktionieren der Betriebsprämienregelung vereinfacht werden. So soll der unverhältnismäßig hohe Aufwand für die Verwaltung von Kleinbeträgen durch die Einführung eines Schwellenwerts verringert werden.
Die Hauptbestandteile der Betriebsprämienregelung werden beibehalten. Die Sektoren, in denen derzeit noch produktionsgekoppelte Zahlungen gewährt werden, sollen schrittweise (im Zeitraum 2010 bis 2012) in die Betriebsprämienregelung einbezogen werden, wobei die Mutterkuhprämie aufgrund ihrer besonderen Bedeutung für die Landwirtschaft in bestimmten Regionen auch weiterhin als gekoppelte Maßnahme beibehalten werden kann.
Von der grundsätzlich vorgesehenen Möglichkeit eines Betriebsprämienmodellwechsels wird nicht Gebrauch gemacht. Der Hauptgrund liegt darin, dass der Gesundheitscheck lediglich eine Zwischenstufe darstellt, jedoch keine spezifischen Maßnahmen zur Vorbereitung auf die Gemeinsame Agrarpolitik nach 2013 (deren Grundzüge und finanzielle Ausgestaltung derzeit noch völlig offen sind) enthält. Im Hinblick auf die berechtigten Erwartungen der Betriebsinhaber in Bezug auf Planbarkeit und Rechtssicherheit soll daher vermieden werden, dass in rund fünfjährigen Abständen neuerlich gravierende, administrativ und finanziell aufwändige Umgestaltungen im Bereich der Direktzahlungen vorgenommen werden, die zwar im Einzelfall durchaus größere Abweichungen zum Status quo bringen können, im Großen und Ganzen aber keinen spezifischen Effekt zeigen.
Um die Auswirkungen des Auslaufens der Milchquoten aufgrund struktureller Nachteile in der Milchproduktion zu dämpfen, besteht die Möglichkeit einer besonderen Stützung innerhalb bestimmter gemeinschaftsrechtlich determinierter Grenzen. Die weitere Aus-
gestaltung der Stützung in Form einer tierbezogenen Zahlung (Milchkuhprämie) ist im MOG 2007 vorzusehen.
Bereits bisher war vorgesehen, dass die Milchquote lediglich bis zum 31. März 2015 fort besteht. Mit schrittweisen Quotenerhöhungen von fünf mal 1% soll ein reibungsloser Übergang erfolgen und eine übermäßige Korrektur nach dem Auslaufen der Quotenreglung vermieden werden. Diese Quotenerhöhungen sollen bei entsprechender Marktlage und gegebenen Absatzmöglichkeiten im Milchsektor durch Verordnung einzelbetrieblich den Lieferquoten zugeteilt werden können, wobei der schon bisher im MOG 2007 enthaltene Grundsatz der linearen Zuteilung zur Anwendung kommt.
Durch eine Änderung beim Zuweisungssatz (Saldierung) soll auf stärkere Überlieferungen der einzelbetrieblichen Milchquote gezielter Bedacht genommen werden.
Im Gemeinschaftsrecht sind auch verschiedene Gemeinschaftsaktionen vorgesehen, deren Inanspruchnahme für den Mitgliedstaat optional ist (zum Beispiel Schulobstprogramm gemäß Art. 103ga oder kostenlose Abgabe von Erzeugnissen aus Beständen der Intervention an Bedürftige in der Gemeinschaft gemäß Art. 27 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007). Durch das MOG 2007 soll der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft ermächtigt werden, eine Teilnahme an derartigen Aktionen vorzusehen.
Finanzielle Auswirkungen
Der bei der AMA entstehende Aufwand gliedert sich folgendermaßen auf:
|
Maßnahme |
Aktivität |
Betrag |
|
Schwellenwert |
Programmierung, Verwaltung im Rahmen der normalen Betriebsprämien-Abwicklung |
39 000 € |
|
Entkoppelung Schlachtprämie |
Programmierung, Verwaltung, Druck und Porto für Infoschreiben an Landwirte |
135 000 € |
|
Entkoppelung Qualitätsprämie für Hartweizen und Prämien für Eiweißpflanzen |
Programmierung, Verwaltung, Druck und Porto für Infoschreiben |
60 000 € |
|
Entkoppelung Flächenbeihilfe für Hopfen |
Programmierung, Verwaltung, Druck und Porto für Infoschreiben |
21 000 € |
|
Entkoppelung Flächenzahlung Schalenfrüchte (2011) |
Programmierung, Verwaltung, Druck und Porto für Infoschreiben |
31 000 € |
|
Entkoppelung im Sektor Kartoffelstärke (2012) |
Programmierung, Verwaltung, Druck und Porto für Infoschreiben |
64 000 € |
|
Entkoppelung der Verarbeitungsbeihilfen Faserflachs und ‑hanf sowie Trockenfutter (2012) |
Programmierung, Verwaltung, Druck und Porto für Infoschreiben |
20 000 € |
|
Nationalrat, XXIV.GPStenographisches Protokoll32. Sitzung / Seite 108 Härte- und Sonderfälle |
Programmierung und Verwaltung |
200 000 € |
|
Milchkuhprämie |
Programmierung und Abwicklung im ersten Jahr |
340 000 € |
|
Milchquotenzuteilung |
Programmierung, Druck und Porto für Zuteilungsbescheide sowie Bearbeitung der gesondert eingereichten Anträge |
134 900 € |
Kompetenzgrundlage:
Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung dieses Gesetzes ergibt sich aus § 1 MOG 2007.
B. Besonderer Teil
Zu Artikel 1 (Änderung des MOG 2007)
Zu Z 1 (§ 7 Abs. 5):
Das gemeinschaftliche Marktordnungsrecht sieht unter anderem auch (durch Mittel aus dem EG-Haushalt finanzierte bzw. geförderte) Programme vor, deren Beteiligung dem Mitgliedstaat offen steht. Beispiele für derartige optionale Programme sind die kostenlose Abgabe von Erzeugnissen der Interventionsbestände an besonders bedürftige Menschen in der Gemeinschaft (Art. 27 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007), die Beihilfe für die Abgabe von Obst und Gemüse an Kinder („Schulobstprogramm“) gemäß Art. 103ga der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 oder die Diversifizierungsbeihilfe im Zuckersektor (Art. 6 der Verordnung (EG) Nr. 320/2006 mit einer befristeten Umstrukturierungsregelung für die Zuckerindustrie in der EG). Da die Entscheidung über die Teilnahme an derartigen Programmen vor allem auch von der jeweils aktuellen Marktlage und der wirtschaftlichen Situation abhängig ist, soll keine verpflichtende Inanspruchnahme vorgesehen werden, sondern dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft diese Entscheidung übertragen werden. Im Falle einer (zusätzlichen oder anteiligen) Finanzierung des Programms durch den Mitgliedstaat ist das Finanzierungsverhältnis nach dem in § 3 LWG festgelegten Schlüssel (60:40-Aufteilung zwischen Bund und Länder) anzuwenden.
Zu Z 2 (§ 8):
Zur besseren Verständlichkeit wird der gesamte § 8 neu gefasst, wobei die bisherige Regelung für das Antragsjahr 2009 weiterhin anwendbar bleibt (siehe § 32 Abs. 6).
Abs. 1 ist mit Ausnahme des aktualisierten Verweises auf die neue Direktzahlungs-Verordnung (EG) Nr. 73/2009 unverändert geblieben.
Mit Abs. 2 wird der Schwellenwert für die Gewährung von Direktzahlungen mit 100 € festgesetzt. Nach Art. 28 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 kann der Schwellenwert 100 € oder 1 ha betragen bzw. – im Fall von Österreich – auf 200 € oder 2 ha erhöht werden. Der Geldbetrag ist aus abwicklungstechnischer Sicht einfacher, da im Falle von Besonderen Ansprüchen gemäß Art. 44 der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 jedenfalls der Geldbetrag zur Anwendung zu kommen hat. Gegen den Ha-Wert spricht
auch, dass der Wert der Zahlungsansprüche eine extrem große Bandbreite aufweist. Der 100 €-Schwellenwert steht auch in angemessenem Verhältnis zu den mit der Antragsabwicklung verbundenen Kosten, eine Anhebung des Schwellenwerts ist aus diesem Grunde nicht notwendig.
Abs. 3 regelt die Details zur Betriebsprämienregelung.
In Z 1 wird in Umsetzung der Art. 63 bis 67 der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 die Einbeziehung bisher noch produktionsgekoppelter Stützungen festgelegt. Der Zeitpunkt für die Einbeziehung ist dabei je nach Regelung unterschiedlich festgelegt. Während das Gemeinschaftsrecht vorschreibt, dass die spezifische Qualitätsprämie für Hartweizen und die Flächenbeihilfe für Hopfen im Jahr 2010 und die Verarbeitungsbeihilfen für Trockenfutter sowie Faserflachs und -hanf und die Prämie für Kartoffelstärkeerzeuger im Jahr 2012 zu entkoppeln sind, können die Prämie für Eiweißpflanzen, die Schlachtprämie, die Flächenzahlung für Schalenfrüchte sowie die Beihilfe für Stärkekartoffelerzeuger frühestens 2010 und müssen spätestens 2012 einbezogen werden. Grundsätzlich soll - zur Erzielung einer weitestgehenden Vereinfachung und zur Senkung der Verwaltungskosten - die Einbeziehung zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgen, sodass die meisten Stützungsregeln bereits 2010 entkoppelt werden. Die Flächenzahlung für Schalenfrüchte wird erst 2011 entkoppelt, da die zugrundeliegende Fläche – im Jahr 2010 aufgrund der Ausnahme für Obst- und Gemüsekulturen – nicht beihilfefähig ist. Damit wäre im Fall der sofortigen Einbeziehung im Jahr 2010 eine Nutzung der Zahlungsansprüche mit diesen Flächen nicht möglich. Die Beihilfe für Stärkekartoffelerzeuger soll gleichzeitig mit der Prämie für Kartoffelstärke („Industrieprämie“) im Jahr 2012 entkoppelt werden. Für den Bezugszeitraum, konkret die in diesen Jahren gewährten produktionsgekoppelten Stützungen, wird der Zeitraum 2006 bis 2008 bestimmt. Dieser Zeitraum liegt innerhalb des gemeinschaftsrechtlich vorgegebenen Zeitrahmens von „einem oder mehreren Jahren im Zeitraum 2005 bis 2008“. Für die Schlachtprämie könnten auch die Jahre 2000 bis 2002 als Bezugszeitraum gewählt werden. Lediglich für den Stärkekartoffelbereich wird auf die im Anbauvertrag des Wirtschaftsjahres 2010/11 erfassten Mengen abgestellt. Diese Festlegung entspricht der gemeinschaftsrechtlichen Vorgabe “in einem bestimmten Jahr“. Die Verarbeitungsbeihilfen für Trockenfutter sowie Faserflachs und -hanf und die Prämie für Kartoffelstärkeerzeuger werden entsprechend den Mengen laut Anbau- oder Lieferverträgen im Bezugszeitraum in die Betriebsprämienregelung einbezogen und stehen dann den Betriebsinhabern in Form von (höheren oder zusätzlichen) Zahlungsansprüchen zu. Für die Berechnung des Referenzbetrags werden die prämienfähigen Produktionseinheiten (das sind die Anzahl Hektar, Rinder bzw. die von den Verträgen erfassten Mengen, für die eine Stützung gewährt wurde) herangezogen und mit einem Prämiensatz multipliziert, der sich aus dem verfügbaren Gesamtbetrag dividiert durch die Anzahl der prämienfähigen Produktionseinheiten ergibt. Auf diese Weise kann eine bestmögliche Ausnützung der Gesamtbeträge erfolgen.
Der in Z 2 für die Anerkennung der Härtefälle festgelegte Grenzwert (15% und 100 €) orientiert sich am bisher in § 5 Abs. 2 Marktordnungs-Überleitungsgesetz im Zuge der Einführung der Betriebsprämienregelung festgelegten Grenzwert (15% und 500 €), da aber das Prämienvolumen der in Betracht kommenden Sektoren geringer ist, wird der €-Betrag entsprechend reduziert. Die Härtefälle müssen in Konnex mit den einzubeziehenden Sektoren stehen.
Für die Anerkennung der Sonderfälle (Z 3) wurde der Grenzwert (10% und 200 €) gegenüber dem bisherigen Grenzwert für den Sonderfall Investition in Produktionskapazitäten für die Tierhaltung (10% und 1 000 €) ebenfalls reduziert. Die Sonderfälle müssen in Konnex mit den einzubeziehenden Sektoren stehen. Es sind insgesamt zwei Kategorien an Sonderfällen festgelegt, nämlich Investitionen in Produktionskapazitäten
für die Rinderhaltung sowie der Kauf von beihilfefähigen Flächen, die zu einer Erhöhung der Direktzahlungen in den einzubeziehenden Sektoren (Hartweizen, Eiweißpflanzen,..) geführt haben. Als neu geschaffene Standplätze bzw. zugekaufte Flächen sind nur jene zu berücksichtigen, die bei der Ermittlung des Referenzbetrags noch nicht enthalten waren. Die Neuschaffung von Standplätzen ist dabei nachzuweisen durch die Baupläne, die der Baubewilligung oder Bauanzeige zugrunde gelegt worden sind. Für die konkrete Ermittlung der tatsächlich neu geschaffenen Standplätze sind die Tierschutzstandards heranzuziehen, bereits vor der Investition bestehende Standplätze sind jeweils in Abzug zu bringen. Der zusätzliche Referenzbetrag von 30 € je neu geschaffenen Standplatz ist der durchschnittliche Wert, der sich aus der Nutzung dieser Standplätze und der möglichen Gewährung von Schlachtprämien für Rinder (einschließlich Kälber)/Jahr ergibt. Im pflanzlichen Sektor ist der Kauf von Ackerflächen, mit denen ein (erweiterter) Anbau von einzubeziehenden Kulturen erfolgt ist, maßgeblich. Flächen, die für Hopfenkulturen genutzt werden, sind dabei vom Begriff „Ackerflächen“ ebenfalls erfasst. Der zusätzliche Referenzbetrag im pflanzlichen Sektor ist ebenfalls ein Durchschnittswert, der sich aus dem Verhältnis der Hartweizenprämie zu Anbauflächen bzw. Eiweißpflanzenbeihilfe zu Anbaufläche usw. errechnet. Die pauschalierten Sätze ermöglichen eine vereinfachte Handhabung, ohne die Situation in den betreffenden Sektoren jedoch außer Acht zu lassen.
Z 4 regelt die nähere Vorgangsweise zur Finanzierung der Entkoppelungsmaßnahmen. In einem ersten Schritt werden die Sonderfälle bedeckt, die restlichen Mittel dienen zur Finanzierung der Härtefälle und der Entkoppelung allgemein. Im Jahr 2010 wird dabei ein eigener Topf für die Schlachtprämie gebildet (zur Finanzierung der Sonderfälle im Bereich der Investition in die Rinderhaltung, der Härtefälle und der Entkoppelung der Schlachtprämie) sowie ein Topf mit den Gesamtbeträgen Hartweizen, Eiweißpflanzen und Hopfen (zur Finanzierung der Entkoppelung im pflanzlichen Sektor unter Bedachtnahme auf die sektorspezifischen Sonder- und Härtefälle). Ebenso wird im Jahr 2012 für alle zu entkoppelnden Sektoren ein gemeinsamer Topf gebildet. Da die Sonderfälle in einem Schritt bedeckt werden, ist gleichzeitig durch eine Grenze (5% des Gesamtbetrags) und allfälliger aliquoter Einkürzung sicherzustellen, dass keine übermäßige Bevorzugung der Sonderfälle erfolgt.
Z 5 enthält die Verlängerung der bereits bisher in § 8 Abs. 2 Z 10 vorgesehenen Neubeginnerregelung um ein weiteres Jahr. Der Betriebsneubeginn wird mit frühestens 15. Mai 2009 festgelegt, bei einem früheren Betriebsneubeginn ist bereits im Jahr 2009 die Antragstellung möglich.
Die in Z 6 enthaltenen Anwendungsmöglichkeiten der Kompression von Zahlungsansprüchen sind ident mit der bisher in § 8 Abs. 2 Z 4 enthaltenen Regelung.
Die Z 7 (Ausschluss von Obst- und Gemüseflächen von den beihilfefähigen Flächen bis einschließlich 31. Dezember 2010) – bisher § 8 Abs. 2 Z 12 – und Z 8 (Bestimmung der Zeitpunkte zur Überprüfung der Einhaltung der landwirtschaftlichen Mindesttätigkeit im Falle der Nutzung von Besonderen Ansprüchen) – bisher § 8 Abs. 2 Z 5 – werden – abgesehen von einer Anpassung an den Verweis auf die Verordnung (EG) Nr. 73/2009 – unverändert übernommen. Z 9 bestimmt den regionalen Durchschnittswert der Zahlungsansprüche. Dieser ist bereits in § 5 Abs. 7 Marktordnungs-Überleitungsgesetz festgelegt und soll für die Zuteilung von Zahlungsansprüchen an Neubeginner auch im MOG 2007 verankert werden. Z 10 enthält eine Verordnungsermächtigung zur Zulässigkeit einer außerlandwirtschaftlichen Nutzung beihilfefähiger Flächen sowie zur möglichen Nutzung beihilfefähiger Flächen bei außergewöhnlichen klimatischen Bedingungen (bisher § 8 Abs. 2 Z 8). Die außerlandwirtschaftliche Nutzung im Fall höherer Gewalt oder außergewöhnlicher Umstände ist an sich bereits in Art. 34 Abs. 2 letzter Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 geregelt. Mit
Erlassung einer Verordnung soll für großräumige, über bloß einzelne Betriebe hinausgehende Fälle höherer Gewalt eine generelle Vorgangsweise vorgesehen werden können. Eine derartige Vorgangsweise wurde zuletzt für die Nutzung beihilfefähiger Flächen für die vorübergehende Lagerung von Windwurfholz (Windwurf- Verordnung 2008, BGBl. II Nr. 119) gewählt.
Z 11 sieht mit Wirksamkeit ab dem Antragsjahr 2006 die Zuweisung zusätzlicher Zahlungsansprüche bzw. die Erhöhung bestehender Zahlungsansprüche an Betriebsinhaber in besonderer Lage vor, die die maßgebliche Investition bereits bis zum gemeinschaftsrechtlich vorgesehenen Stichtag gesetzt haben. Da bis zum Antragsjahr 2005 nicht alle Voraussetzungen für die Anerkennung erfüllt gewesen sind, soll eine neuerliche Beurteilung auf Basis des Jahres 2006 erfolgen. Der für eine Zuteilung zur Verfügung stehende Gesamtbetrag wird mit 300 000 € begrenzt.
Z 12 sieht in Anwendung des Art. 43 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 bei Übertragung von Zahlungsansprüchen ohne gleichzeitige Übertragung von beihilfefähigen Flächen vor, dass 30% der Zahlungsansprüche für die nationale Reserve einbehalten werden. Damit soll der Übertragung von Zahlungsansprüchen mit Flächen der Vorrang eingeräumt werden.
Abs. 4 enthält die näheren Regeln zur Umsetzung der in Art. 68ff der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 enthaltenen Möglichkeiten der Gewährung einer besonderen Stützung. Eine Anwendung dieser besonderen Stützung wird vorgesehen, um die Auswirkungen des Auslaufens der Milchquoten zu dämpfen und somit zur Aufrechterhaltung der Milchproduktion beizutragen. Mit einem direkten Bezug zur Milchproduktion ist die Gewährung einer tierbezogenen Zahlung (Milchkuhprämie) das am besten geeignete Instrumentarium. Die technische Abwicklung in Bezug auf die Beantragung sowie die Ermittlung der prämienfähigen Tiere kann gemeinsam mit der Mutterkuhprämie erfolgen, da bei letzterer schon derzeit die Milchkühe in Abzug zu bringen sind. Milchkühe sind alle auf dem Betrieb zu den entsprechenden Stichtagen zur Berechnung der Mutterkühe vorhandenen Kühe, wobei jene Kühe, für die eine Mutterkuhprämie gewährt wird, in Abzug zu bringen sind. Entsprechend dem gemäß Art. 68 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 geforderten Abstellen auf wirtschaftlich anfällige Formen der landwirtschaftlichen Tätigkeit im Milchsektor soll eine Obergrenze an maximal prämienfähigen Milchkühen vorgesehen werden. Diese Obergrenze ist durch Verordnung näher zu bestimmen und darf höchstens das 2,5-fache der Milchkuhanzahl eines durchschnittlichen österreichischen Betriebes betragen. Für das Kalenderjahr 2010 ist dabei von einer durchschnittlichen Milchkuhanzahl von zwölf Stück auszugehen. Bei entsprechender Strukturentwicklung ist die durchschnittliche Milchkuhanzahl anzupassen. Die Milchkuhprämie ist primär durch die Verwendung der sogenannten „ungenutzten Mittel“ der für Österreich verfügbaren nationalen Obergrenze gemäß Anhang VIII der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 – berechnet gemäß Art. 69 Abs. 7 der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 – zu bedecken. Auch eine allfällig vorhandene nationale Reserve kann dafür verwendet werden. Zusätzlich kann durch Verordnung eine nationale Beihilfe im Höchstausmaß von 55% des zulässigen Höchstbetrags (dieser entspricht 3,5% der nationalen Obergrenze) für die Bedeckung der Milchkuhprämie herangezogen werden. Für diese nationale Beihilfe ist das Finanzierungsverhältnis nach dem in § 3 LWG festgelegten Schlüssel (60:40-Aufteilung zwischen Bund und Länder) anzuwenden. Der Prämienbetrag je Milchkuh ist jährlich aufgrund der verfügbaren Mittel sowie der Gesamtanzahl an prämienfähigen Milchkühen zu berechnen, wobei als Grundsatz festgehalten wird, dass entsprechend der Kostendegression (durchschnittliche Vollkostendegression laut den Buchführungsergebnissen der Milchviehspezialbetriebe) Kategorien zu bilden sind und die Prämienhöhe je Kategorie in abgestufter Höhe gewährt wird.
Die Abs. 5 bis 7 entsprechen weitgehend den bisherigen Abs. 3 bis 5. In Abs. 5 Z 3 lit. b wird für die Mutterkuhzusatzprämie anstelle des bisher vorgesehenen Fixbetrags eine Obergrenze von bis zu 30 € nach Maßgabe der verfügbaren finanziellen Mittel festgelegt. In Abs. 7 wird eine Verordnungsermächtigung zur Festlegung der Anwendbarkeit von Bestimmungen der Mutterkuhprämienregelung für die Gewährung der Milchkuhprämie aufgenommen.
Zu Z 3 (§ 10 Abs. 2):
Da die Verordnung (EG) Nr. 1788/2003 über die Erhebung einer Abgabe im Milchsektor nunmehr Bestandteil der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 (Verordnung über die einheitliche GMO) geworden ist, ist das Zitat entsprechend anzupassen.
Zu Z 4 (§ 10 Abs. 2 Z 1a und 1b):
Die im Rahmen des GAP-Gesundheitschecks beschlossenen Milchquotenerhöhungen sollen grundsätzlich einzelbetrieblich zugeteilt werden. Dazu ist aber eine genauere Beurteilung der Marktlage und der Absatzmöglichkeiten im Milchsektor notwendig, sodass die tatsächliche Zuteilung durch Verordnung zu bestimmen ist. Die Zuteilung erfolgt nach dem in Z 1 verankerten Grundsatz in einem Prozentsatz der bestehenden einzelbetrieblichen Lieferquote, wobei – wie beim letzten Zuteilungsverfahren – der Milcherzeuger aktiv sein muss (d.h. im abgelaufenen Zwölfmonatszeitraum Milch angeliefert haben muss) und keine Quote im Rahmen der Handelbarkeit abgegeben haben darf. Aus verwaltungstechnischen Gründen wird eine Mindestzuteilungsmenge von 100 kg festgesetzt.
Die gewählte Form der Antragstellung basiert auf der Überlegung, dass in der Vergangenheit 98,8% der in Betracht kommenden Milcherzeuger die Quotenzuteilung beantragt haben. Überdies hat jeder Betriebsinhaber, der Direktzahlungen erhalten will, einen Beihilfeantrag (Sammelantrag bzw. Mehrfachantrag) abzugeben. Es wird daher fingiert, dass der im Kalenderjahr, in dem der Zwölfmonatszeitraum der jeweiligen Zuteilung beginnt, eingereichte Sammelantrag dann auch als Antrag auf Milchquotenzuteilung gilt, wenn die weiteren Voraussetzungen vorliegen. Milcherzeuger, die jedoch keine Quotenzuteilung wollen, sollen die Möglichkeit der Abmeldung haben. Da dies nur eine Minderheit an Milcherzeugern ist, ist diese Vorgangsweise sowohl für die Agrarmarkt Austria als auch für die Milcherzeuger die kostengünstigste Variante. Milcherzeuger, die – aus welchen Gründen immer – keinen Sammelantrag stellen wollen, sollen analog zur Möglichkeit der Abmeldung die Möglichkeit der expliziten Beantragung haben.
Gemäß Z 1b soll für von Betriebsinhabern mit Betriebssitz in Österreich bewirtschaftete Almen in Vorarlberg, die sich teilweise auch auf deutschem Staatsgebiet befinden (bzw. an Vorarlberg angrenzende Almen, die sich zur Gänze auf deutschem Staatsgebiet befinden), und von Deutschland aus nur schwer zugänglich sind, eine Zuteilung österreichischer Direktverkaufs-Quoten erfolgen. Damit sollen die derzeit vorhandenen deutschen Direktverkaufs-Quoten ersetzt werden. Diese Vorgangsweise wurde auch in einer zwischenstaatlichen Vereinbarung zwischen dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz der Bundesrepublik Deutschland und dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft im Einverständnis mit der Europäischen Kommission festgelegt. Insgesamt handelt es sich dabei um rund 400 t Direktverkaufs-Quote, die auf diese Weise zugeteilt werden soll.
Zu Z 5 (§ 10 Abs. 2 Z 2 lit. c):
Ab dem mit 1. April 2009 beginnenden Zwölfmonatszeitraum 2009/10 erfolgt eine Änderung hinsichtlich der von den Milcherzeugern, die ihre einzelbetriebliche Milch-
quote überliefern, zu entrichtenden Überschussabgabe. Durch eine Änderung beim Zuweisungssatz (Saldierung) soll auf stärkere Überlieferungen gezielter Bedacht genommen werden.
Zu Z 6 (§ 10 Abs. 2 Z 2 lit. d):
Im Zuge des GAP-Gesundheitschecks (siehe dazu Verordnung (EG) Nr. 72/2009) wurde zur Hintanhaltung einer zu starken Steigerung der Milchanlieferung in den Zwölfmonatszeiträumen 2009/10 und 2010/11 (das heißt, wenn mehr als 106% der im Zwölfmonatszeitraum 2008/09 maßgeblichen nationalen Quote für Lieferungen angeliefert werden) eine erhöhte Überschussabgabe von 150% vorgesehen. Diese erhöhte Überschussabgabe soll analog zur normalen Überschussabgabe auf alle Überlieferer aufgeteilt werden.
Zu Z 7 (§ 10 Abs. 2 Z 2a):
Für die Überschreitung der einzelstaatlichen Quote für Direktverkäufe war bislang (versehentlich) keine Regelung zur Saldierung von Überschreitungen der einzelbetrieblichen Quoten mit Unterschreitungen vorgesehen. Nunmehr wird klargestellt, dass die für Anlieferungen geltenden Regeln auch für den Bereich des Direktverkaufs gelten sollen.
Zu Z 8 (Entfall § 10 Abs. 2 Z 3):
Damit Milcherzeugern, die ihr Lieferverhalten der Marktlage und insbesondere der massiv gesunkenen Nachfrage anpassen, kein zusätzlicher Nachteil durch Kürzung der Quote bei Unterausnützung (bisher bei weniger als 70% Ausnutzung der Milchquote) droht, entfällt die bisherige Umsetzung eines gemeinschaftsrechtlichen Spielraums.
Zu Z 9 (§ 10 Abs. 2 Z 4):
Es wird klargestellt, dass für die Wiederzuteilung einer Quote, die wegen totaler Inaktivität der nationalen Reserve zugeschlagen wurde, die bisher für die teilweise Inaktivität geltenden Regeln Anwendung finden.
Zu Z 10 (§ 12 Abs. 2):
Das Zitat ist auf die neue Verordnung (EG) Nr. 73/2009 anzupassen.
Zu Z 11 (§ 28 Abs. 3):
Für die Erlassung einer Verordnung im Bereich der Identifizierung der landwirtschaftlichen Flächen im Rahmen des integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems soll eine eigene gesetzliche Grundlage geschaffen werden. Als Referenzparzelle (das ist gemäß Art. 2 Z 26 der Verordnung (EG) Nr. 796/2004 eine geografisch abgegrenzte Fläche mit einer individuellen, im GIS registrierten Identifizierungsnummer) wird der Grundstücksanteil am Feldstück festgelegt. Ebenso ist eine verpflichtende digitale Ermittlung der Referenzparzellen erforderlich, die durch die AMA oder gemäß § 6 Abs. 2 beauftragte Stellen durchzuführen ist.
Zu Z 12 (§ 32 Abs. 4 bis 6):
Da die in § 8 umgesetzten Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 – abgesehen vom Entfall der 10-Monatsfrist und der Stilllegungsverpflichtung – erst ab dem Jahr 2010 wirksam werden, ist das Inkrafttreten explizit zu regeln (Abs. 4).
Verordnungen sollen jedoch bereits ab Verlautbarung erlassen werden können, damit die notwendigen technischen Umsetzungsarbeiten innerhalb des Zeitplans erfolgen können.
Der derzeit gültige § 8 bleibt somit für Sachverhalte, die sich bis 31.12.2009 verwirklicht haben, weiter in Geltung (Abs. 6). Da anstelle der 10-Monatsfrist seit dem Antragsjahr 2008 vom Mitgliedstaat ein Stichtag – spätestens der letzte Tag zur Änderung des Beihilfeantrags – festzusetzen ist und die Stilllegungsverpflichtung bereits 2009 nicht mehr anwendbar ist, wurde in diesen Bereichen die Anwendbarkeit entsprechend verkürzt. Für die Zuweisung von Zahlungsansprüchen aus der nationalen Reserve erfolgt im Gemeinschaftsrecht insofern eine Änderung, als der bisherige Zuteilungswert im Ausmaß des regionalen Durchschnittswerts der Zahlungsansprüche gestrichen wird. Da dieser Wert jedoch auch aktuell noch Basis für die Zuteilung an Neubeginner ist, ist dies entsprechend im MOG 2007 klarzustellen.
Erläuterungen
zu Artikel 2 (Änderung des Marktordnungs-Überleitungsgesetzes):
Die INVEKOS-GIS-Verordnung, die die Details zur Identifizierung der Flächen regelt, steht derzeit in Gesetzesrang. Da insbesondere die Referenzparzelle neu definiert wird und dazu entsprechende Änderungen erforderlich sind, soll diese Verordnung zum 31. Juli 2009 aufgehoben und durch eine neue Verordnung auf Basis des § 28 Abs. 3 MOG 2007 ersetzt werden.
Erläuterungen
zu Artikel 3 (Änderung des Pflanzenschutzmittelgesetzes 1997)
Allgemeiner Teil
Bisher geltende Regelungen:
Bisher galt das Pflanzenschutzmittelgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 60, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 55/2007.
Wesentlicher Inhalt und Neuerungen des Entwurfes:
Anlass dieser Novelle ist das Urteil des EuGH vom 21. Februar 2008, Rechtssache C-201/06, Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen die Republik Frankreich. Der Gerichtshof hat festgestellt, dass der gemeinsame Ursprung des Referenzprodukts mit einem in einem anderen Staat, der Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraums ist, zugelassenen Produkt für die vereinfachte Zulassung von Pflanzenschutzmitteln herangezogen werden kann.
Des Weiteren wird eine Anpassung der im Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz, BGBl. I Nr. 63/2002, normierten Verordnungsermächtigung des Bundesamtes für Ernährungssicherheit (BAES) zur Erlassung von Gebührentarifen für Tätigkeiten unter anderem nach dem Pflanzenschutzmittelgesetz 1997, BGBl. I Nr. 60/1997, vorgenommen.
Sonstige Bestimmungen betreffen redaktionelle beziehungsweise praxisbedingte Anpassungen (Kennzeichnung, Werbung, Beschlagnahme etc.).
Finanzielle Auswirkungen:
Durch die teilweise Verlagerung der Maßnahmen im Zuge der Kontrollen auf das BAES ist eine geringfügige Entlastung der Bezirksverwaltungsbehörden zu erwarten. Es sind
keine kalkulierbaren beziehungsweise bloß geringfügige Auswirkungen auf den Haushalt des Bundes beziehungsweise der AGES zu erwarten.
Kompetenzgrundlagen:
Der Entwurf einer Novelle dieses Bundesgesetzes findet seine Rechtsgrundlage in Artikel 10 Abs. 1 Z 12 B- VG („Regelung des geschäftlichen Verkehrs mit Pflanzenschutzmitteln“) und Z 4 („Bundesfinanzen“).
Besonderer Teil
Zu Z 1 (§ 3 Abs. 2):
Die bisherige Bestimmung wird ergänzt durch die Regelung über die Ausnahme vom Erfordernis der Zulassung bei der Lagerung zur Abfallbeseitigung (Z 3), wobei die Beweislastumkehr wie in den bisher geltenden Z 1 und 2 normiert ist. Die Bestimmungen des zweiten und dritten Satzes dienen der Klarstellung und entsprechen der Judikatur (VwGH vom 27. März 2008, Zlen. 2007/07/0038, 0136).
Zu Z 2 (§ 3 Abs. 4):
Diese Bestimmung dient der Klarstellung. Für die gemäß § 12 Abs. 10 zugelassenen Pflanzenschutzmittel ist die Bestimmung unumgänglich zur Erfüllung des gesetzlichen Kontrollauftrags, da sie im Inland keinem gesonderten Zulassungsverfahren unterzogen werden. Die Zulässigkeit des Inverkehrbringens der gemäß § 12 Abs. 10 zugelassenen Pflanzenschutzmittel wird für alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere den Verwender, eindeutig bestimmbar.
Zu Z 3 (§ 11 Abs. 2):
Im Beschwerdefall Nr. 2006/4245 war die vereinfachte Zulassung von Pflanzenschutzmitteln (gemeinsamer Ursprung der zu vergleichenden Pflanzenschutzmittel als Zulassungsvoraussetzung) Gegenstand eines Schriftwechsels der Dienststellen der Europäischen Gemeinschaften mit der Österreichischen Bundesregierung. In der mit Gründen versehenen Stellungnahme (2. Stufe des Vertragsverletzungsverfahrens) wurde auf die Feststellung des Verwaltungsgerichtshofes in den Erkenntnissen vom 18. November 2004, Zl. 2001/07/0166, und vom 28. April 2005, Zl. 2001/07/0152, 0157, hingewiesen, dass „die Auffassung, ein Antrag auf vereinfachte Zulassung nach § 11 PMG sei bereits mangels Erfüllung der Vorraussetzung desselben Ursprungs im Sinne des § 11 Abs. 2 Z 1 PMG 1997 abzuweisen, nicht mit dem Gemeinschaftsrecht im Einklang stehe.“
Der VwGH lehnte das Ersuchen, die Frage des gemeinsamen Ursprungs von Pflanzenschutzmitteln dem EuGH vorzulegen, ab.
Aus diesen Gründen wurde die Bestimmung des gemeinsamen Ursprungs des Referenzprodukts und des parallel einzuführenden Pflanzenschutzmittels aufgehoben (Agrarrechtsänderungsgesetz 2007, BGBl. I Nr. 55/2007).
In der Folge war der gemeinsame Ursprung der Wirkstoffe der zu vergleichenden Pflanzenschutzmittel als Zulassungsvoraussetzung Gegenstand eines weiteren Schriftverkehrs der Dienststellen der Kommission der Europäischen Gemeinschaften mit der Österreichischen Bundesregierung (ergänzende mit Gründen versehene Stellungnahme).
Mit der vorgesehenen Normierung des gemeinsamen Ursprungs des Referenzprodukts und des parallel einzuführenden Pflanzenschutzmittels als Zulassungsvoraussetzung wird der geltende § 11 an die aktuelle Judikatur des EuGH, Urteil vom 21. Februar
2008, Rs. C-201/06, Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen die Republik Frankreich, angepasst. Der EuGH hat entgegen der Rechtsauffassung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften und des Verwaltungsgerichtshofes eine Klarstellung über die Zulassungsvoraussetzungen im vereinfachten Verfahren vorgenommen.
Die bisher geltenden Z 1 und 2 werden redaktionell angepasst.
Zu Z 4 (§ 20 Abs. 4):
Die bisherige Regelung wird zum Schutz des Erwerbers von Pflanzenschutzmitteln ergänzt durch das Verbot von irreführenden Angaben in der Kennzeichnung, insbesondere über die Herkunft des Produkts, den Inhalt (quantitative oder qualitative Zusammensetzung) oder das Vorliegen eines Referenzprodukts bzw. eines vereinfacht zugelassenen Produkts (nach § 11).
Zu Z 5 (§ 20 Abs. 6):
Mit dieser Bestimmung soll gewährleistet werden, dass bei vereinfachten Zulassungen bzw. gemäß § 3 Abs. 4 gemeldeten Produkten, die keine deutschsprachige Originalkennzeichnung aufweisen, im Falle von Überklebungen mit der deutschsprachigen Kennzeichnung zumindest die wichtigsten Bestandteile der Originalkennzeichnung weiterhin sichtbar bleiben müssen, um die Überprüfbarkeit zu ermöglichen, ob es sich bei dem in Verkehr gebrachten Pflanzenschutzmittel tatsächlich um jenes Produkt handelt, das nach § 11 zugelassen bzw. nach § 3 Abs. 4 gemeldet ist.
Zu Z 6 (§ 24 Abs. 1):
Diese Bestimmung soll im Interesse der Erwerber von Pflanzenschutzmitteln für mehr Transparenz bezüglich der Verfügbarkeit der Produkte sorgen.
Zu Z 7 und 8 (§ 25 Abs. 1 und Abs. 2):
Abs. 1 dient der Klarstellung und betrifft die Voraussetzung für die Rechtmäßigkeit des Inverkehrbringens aufgrund einer Meldung nach § 3 Abs. 4 von gemäß § 12 Abs. 10 zugelassenen Pflanzenschutzmitteln. Abs. 2 dient der Präzisierung der bisherigen Meldungen und es wird der seitens des Lebensmittel- und Veterinäramtes (FVO) im Rahmen der Kontrollen erhobenen Forderung entsprochen (GD(SANCO)/7652/2005-MR).
Zu Z 9 (§ 27 Abs. 4 Z 2 lit. d und e):
Diese Bestimmung steht im Zusammenhang mit § 3 Abs. 2, da eine Regelung über die Ausstellung von Importbestätigungen für die Fälle des Inverkehrbringens ohne Zulassung bisher fehlte.
Zu Z 10 (§ 28 Abs. 9):
Mit § 29 Abs. 3 neu wird die bisherige Bestimmung des § 28 Abs. 9 obsolet.
Zu Z 11 (§ 29):
Es hat sich in Krisenfällen als äußerst wichtig erwiesen, dass bereits vor der tatsächlichen Feststellung eines Verstoßes den Aufsichtsorganen ausreichende Möglichkeiten zur Verfügung stehen müssen, um angemessen und rasch im Falle eines Verdachtes oder Verstoßes reagieren zu können. Nach der derzeitigen Rechtslage war der Handlungsspielraum der Aufsichtsorgane sehr eingeengt und unflexibel, da als Maßnahmen bei Feststellung von Verstößen im Wesentlichen nur die Anzeige oder die vorläufige Beschlagnahme in Betracht kamen.
In der vorgesehenen Bestimmung des Abs. 1 werden die einzelnen, behördlichen Maßnahmen näher präzisiert. Bei Vorliegen von Zuwiderhandlungen rückt damit die Herstellung des rechtmäßigen Zustands in den Vordergrund. Die bereits geltende Bestimmung über die Erstattung der Anzeige wird um die Fälle der mangelhaften Durchführung von Maßnahmen (Abs. 3) erweitert.
Die Möglichkeit vom Absehen einer Anzeige nach der Bestimmung des Abs. 4 wird ebenfalls auf die in Z 1 und 2 geregelten Fälle ausgedehnt, wobei die Z 2 der Bestimmung des § 21 Abs. 1 Verwaltungsstrafgesetz 1997, BGBl. Nr. 1991/52, nachgebildet wurde.
Die bisher geltenden Abs. 3, 5 bis 8 und 10 werden redaktionell angepasst und entsprechen den Bestimmungen Abs. 7, 9 bis 12 und 14 neu.
Die Verlängerung der Frist in Abs. 8 für die Durchführung der Beschlagnahme ist aufgrund der aufwendigen Untersuchungen der Pflanzenschutzmittel erforderlich, allerdings beginnt die Frist bereits ab Durchführung der vorgenommenen Beschlagnahme und nicht erst nach Einlangen der Anzeige bei der Bezirksverwaltungsbehörde zu laufen.
Zur Sicherung der Strafverfolgung unter Berücksichtigung der gefährlichen Eigenschaften vieler Produkte wird in der Bestimmung des Abs. 13 die Möglichkeit der sofortigen Vollstreckbarkeit von Geldleistungen auch im Hinblick auf die teilweise umfangreichen Kosten, die von kleineren Bezirksverwaltungsbehörden nicht getragen werden können, festgelegt. Im Übrigen wird der bisher geltende Abs. 9 übernommen.
Zu Z 12 (§ 30 Abs. 1 Z 3):
Die bisherige Bestimmung wurde an die nunmehr gegebenen technischen Möglichkeiten (EDV-Systeme) angepasst.
Zu Z 13 (§ 30 Abs. 2 bis 4):
Die Konkretisierung in den Abs. 2 bis 4 werden im Hinblick auf die lückenlose Rückverfolgbarkeit und die Notwendigkeit einer wirksamen Kontrolle im Sinne des Art. 17 der Richtlinie 91/414/EWG erforderlich.
Zu Z 14 (§ 32):
Die Ermächtigung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zur Erlassung von Gebührentarifen ist aufgrund des § 6 Abs. 6 des Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetzes, BGBl. I Nr. 63/2002 in der geltenden Fassung, obsolet. Diese Bestimmung ist daher aufzuheben.
Mit der Einräumung von Parteistellung, Rechtsmittelbefugnis und Beschwerderecht des Bundesamtes für Ernährungssicherheit in Verwaltungsstrafverfahren gemäß § 34 Abs. 4 durch das Bundesgesetz, BGBl. I Nr. 55/2007, sind alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten des BAES jedenfalls behördliche Tätigkeiten nach dem Pflanzenschutzmittelgesetz 1997.
Zu Z 15 und 16 (§ 34 Abs. 1 Z 1 lit. f und Z 2 lit. e und f):
Entsprechend der Festlegung von behördlichen Maßnahmen gemäß § 29 und der Konkretisierung der Pflichten der Geschäfts- und Betriebsinhaber gemäß § 30 Abs. 2 bis 4 sind auch die Strafbestimmungen anzupassen.
Zu Z 17 (§ 35 Abs. 1):
Mit dieser Bestimmung soll unabhängig vom Ausgang eines allfälligen Strafverfahrens die Sicherung der mit Verfall bedrohten Produkte gewährleistet werden.
Zu Z 18 (§ 37 Abs. 13):
Diese Bestimmung ist eine Übergangsbestimmung und soll die Anpassung an die Kennzeichnungsvorschriften ermöglichen.
Zu Z 19 (§ 39):
Diese Bestimmung dient der Aktualisierung der umgesetzten Richtlinien und Verordnungen.
Erläuterungen
zu Artikel 4 (Änderung des Pflanzgutgesetzes 1997)
Allgemeiner Teil
Bisher geltende Regelungen:
Bisher galt das Pflanzgutgesetz 1997, BGBl. Nr. 73, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 110/2002.
Wesentlicher Inhalt und Neuerungen des Entwurfes:
Durch den vorliegenden Entwurf sollen zwecks Umsetzung der obgenannten Richtlinie Vorschriften betreffend die Umstellung der Zulassung von Versorgern auf eine bloße Registrierung, eine Anpassung der Sortenlisten für Obstarten, ein Zertifizierungsverfahren für Obstpflanzgut sowie eine Präzisierung der „amtlichen Prüfung“ vorgenommen werden.
Weiters sind aufgrund der Erfahrungen der Vollzugspraxis einige Änderungen bei Probenahmen sowie bei Akkreditierungen von Labors vorgesehen.
Finanzielle Auswirkungen:
Nachdem mittlerweile nach 12 Jahren Geltung des Gesetzes bereits alle einschlägigen Betriebe erfasst sind und die bisherigen Zulassungen von Gesetzes wegen als Registrierung von Versorgern gelten, ist diesbezüglich kein Kostenaufwand gegeben. Bei Betrieben, die neu die Aufnahme in das amtliche Register beantragen, ist davon auszugehen, dass die Erstellung des Bescheides durch Bedienstete der Verwendungsgruppe A 1/A (A 1/GL- A 1/4) zu erfolgen hat. Aufgrund der Umstellung des Systems von einer Akkreditierung auf eine Registrierung hat unmittelbar anlässlich der Aufnahme in das Register keine Prüfung vor Ort zu erfolgen (sofern sich nicht aus den dem Antrag beigefügten Unterlagen ein Prüfbedarf ergibt), so dass diesbezüglich keine Kosten anfallen. Die bisherige regelmäßige Überprüfung der Betriebe bei der Erzeugung und dem Inverkehrbringen des Pflanzgutes, die im übrigen in der Regel im Zusammenhang mit den Überprüfungen nach dem Pflanzenschutzgesetz 1995 erfolgen, bleibt unverändert, so dass sich auch hier kein erhöhter Kostenaufwand ergibt. Es ist seriöserweise nicht abschätzbar, wie viele Betriebe neu den Antrag auf Aufnahme in das amtliche Register stellen werden, so dass der diesbezügliche Aufwand nicht kalkulierbar ist. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass dem Kostenaufwand der zuständigen Behörde eine kostendeckende Gebühr gegenübersteht.
Kompetenzgrundlagen:
Der Entwurf einer Novelle dieses Bundesgesetzes findet seine Rechtsgrundlage in Artikel 10 Abs. 1 Z 12 B- VG:
Regelung des geschäftlichen Verkehrs mit Saat- und Pflanzgut, einschließlich der Zulassung und bei Saat- und Pflanzgut auch der Anerkennung.
Besonderer Teil
Zu Z 1 und 2 (§ 1 Abs.1 Z 3 und § 2 Z 14):
Diese Bestimmungen dienen der Umsetzung von Art. 1 (Anwendungsbereich) und Art. 2 Z 4 (Begriffsbestimmung „Klon“) der Richtlinie 2008/90/EG.
Zu Z 3 bis 6 (§ 2 Abs. 2 Z 1 bis 4):
Mit dem vorliegenden Entwurf sollen die in Art. 2 Z 5 bis 8 der Richtlinie 2008/90/EG (Begriffsbestimmungen „Vorstufenmaterial“, „Basismaterial“, „Zertifiziertes Material“ und „CACMaterial“ umgesetzt werden.
Zu Z 7 (§ 3):
Da aufgrund der Richtlinie 2008/90/EG einige Änderungen im Bereich des Inverkehrbringens von Obstpflanzgut vorgesehen sind, wäre eine Aufspaltung der Anforderungen für Pflanzgut von Zierpflanzenarten und Gemüsearten einerseits sowie Obstpflanzgut andererseits vorzunehmen. Mit den neugefassten Abs. 2 und 3 sollen Art. 3 und Art. 9 der Richtlinie 2008/90/EG umgesetzt werden.
Zu Z 8 (§ 4 Abs. 3):
Die vorliegende Bestimmung dient der Umsetzung von Art. 7 der Richtlinie 2008/90/EG.
Zu Z 9 (§ 6 Z 3):
Da mit der Richtlinie 2008/90/EG die bisher in der Richtlinie 92/34/EWG vorgesehenen Bestimmungen für „virusfreies“ bzw. „virusgetestetes“ Material gestrichen wurden, hätte die diesbezügliche Regelung im Pflanzgutgesetz zu entfallen.
Zu Z 10 (§§ 8 und 9 samt Überschriften):
Aufgrund Artikel 5 der Richtlinie 2008/90/EG erfolgt eine Systemumstellung: das bisher vorgesehene Autorisierungsverfahren mit Zulassung der Versorger wird durch ein Anmeldeverfahren mit amtlicher Registrierung der Versorger ersetzt. Aus diesem Grunde wären die bisherigen die Versorger betreffenden Vorschriften entsprechend anzupassen. Die die Zulassung von Labors regelnden Vorschriften sollten dagegen im Grundsatz unverändert bleiben. Es soll hier lediglich eine Klarstellung dahingehend erfolgen, dass als anerkannte Labors nur solche gelten können, die bestimmte Mindestqualitätsstandards erfüllen.
Aus den oben angeführten Gründen (Systemumstellung) wären auch die Vorschriften betreffend Aberkennung der Zulassung entsprechend anzupassen.
Zu Z 11 und 13 (§ 11 Abs. 1 und Abs. 7):
Aufgrund von Erfahrungen der Vollzugspraxis erscheinen einige Anpassungen, insbesondere im Bereich der Probenahme erforderlich. So soll einerseits klargestellt werden, dass so wie auch in anderen Bereichen für Entnahme von behördlichen Proben keine Entschädigung an Betriebe erfolgt, dass aber die Entnahme demzufolge auch nur in dem für die ordnungsgemäße Probenahme unbedingt erforderlichen Ausmaß erfolgen darf. Weiters soll zur Sicherung eines wissenschaftlichen Mindeststandards das Bundesamt für Ernährungssicherheit mittels einer in den Amtlichen Nachrichten des Bundesamtes kundzumachenden Verordnung Einzelheiten über die Diagnosemethodik festlegen.
Zu Z 12 (§ 11 Abs. 5):
Zur Umsetzung des Art. 2 Z 5 bis 7 der Richtlinie 2008/90/EG wäre eine Präzisierung der Pflicht der zuständigen Behörde, amtlich zu prüfen, dass das Pflanzgut bei seiner
Erzeugung und beim Inverkehrbringen die einschlägigen Anforderungen erfüllt, vorzusehen.
Zu Z 14 (§§ 12 und 13 samt Überschriften):
Die Richtlinie 2008/90/EG bringt Änderungen auch bei der Eintragung von Sorten (die Eintragung der Sorte ist Voraussetzung für das Inverkehrbringen) mit sich. So entfällt die bisher bestehende Möglichkeit, wonach der Versorger selbst eine Sortenbeschreibung vornehmen konnte. Im Gegenzug wird dafür die Möglichkeit eröffnet, dass in anderen Mitgliedstaaten eingetragene Sorten als allgemein bekannte Sorten in das Sortenregister aufgenommen werden können.
Die Änderung des § 13 dient vor allem der Anpassung an die durch die Richtlinie 2008/90/EG veränderte Nomenklatur, hat aber keine grundlegenden inhaltlichen Änderungen zur Folge.
Zu Z 15 (§ 19 Z 14):
Infolge der Umsetzung der Richtlinie 2008/90/EG wäre ein entsprechender Umsetzungshinweis aufzunehmen.
Zu Z 16 (§ 20 Abs. 6):
Die Inkrafttretensbestimmung ist erforderlich, da die Richtlinie 2008/90/EG zwar bis zum 31. März 2010 umzusetzen ist, die Rechtsvorschriften jedoch gemäß Art. 20 der Richtlinie erst ab dem 30. September 2012 anzuwenden sind. Die Übergangsbestimmung im letzten Satz soll klarstellen, dass die bisherigen Zulassungen von Versorgern als Registrierungen nach der neuen Gesetzesfassung gelten und keine gesonderten Verfahren nötig sind.
Erläuterungen
zu Artikel 5 (Änderung des Pflanzenschutzgesetzes 1995)
Allgemeiner Teil
Bisher geltende Regelungen:
Bisher galt das Pflanzenschutzgesetz 1995, BGBl. Nr. 532, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 87/2005.
Wesentlicher Inhalt und Neuerungen des Entwurfes:
Es besteht aufgrund von Vorschriften von Drittländern die Notwendigkeit, Durchführungsvorschriften für die innerstaatlichen Anforderungen bei der Ausfuhr von Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen und sonstigen geregelten Gegenständen zu erlassen. Durch den vorliegenden Entwurf sollen Vorschriften für Ausführer von Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen und sonstigen geregelten Gegenständen hinsichtlich der Verpflichtung zu Registrierung, Kennzeichnungs- und Verplombungssystemen sowie phytosanitären Sicherstellungen aufgenommen werden.
Weiters wären die Vorschriften hinsichtlich der Probenahme der Judikatur des Europäischen Gerichtshofes anzupassen. Die bisherigen Probenahmevorschriften sind mit der neueren Judikatur des Europäischen Gerichtshofes nicht mehr kongruent und sollten daher entfallen.
Es erscheint ebenso erforderlich, die Vorschriften für die Durchführung der Kontrolle von Verpackungsmaterial aus Holz zu ergänzen, es soll zu einer Neuausrichtung der Kontrollen mit Schwerpunktverlagerung an die Ersteintrittstellen kommen.
Die vorgeschlagenen Strafbestimmungen sind einerseits aufgrund der Ergänzung der Regelungen für den Export von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen in Drittländer erforderlich. Andererseits erscheint aufgrund der Erfahrungen der Vollzugspraxis eine Klarstellung der Regelungen dahingehend erforderlich, dass, insbesondere im Zusammenhang mit dem Schmuggel artenschutzrechtlich geschützter phytosanitär kontrollpflichtiger Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, effektive Strafbestimmungen zur Ahndung der Einfuhr derartiger Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse vorliegen.
Finanzielle Auswirkungen:
Bisher wurden rund 900 Kontrollen pro Jahr anlässlich der Überprüfung von Verpackungsmaterial aus Holz mit Ursprung in Drittländern durchgeführt.
Durch die Umstellung des Kontrollsystems auf Schwerpunktkontrollen an Ersteintrittstellen in Verbindung mit einer risikobasierten Überwachung im Inland ist von einer deutlichen Verringerung der Kontrolltätigkeit auszugehen. Durch diesen risikobasierten Ansatz soll es bei einem vergleichbaren Grad an phytosanitärer Sicherheit zu einer spürbaren Entlastung der betroffenen Wirtschaftskreise kommen. Die Auslastung der Kontrolle an der Ersteintrittstelle (das ist jener Ort, an dem eine kontrollpflichtige Sendung erstmals in das Zollgebiet der Europäischen Gemeinschaft eintritt) ist naturgemäß gewissen Schwankungen der Handelsströme unterworfen, es wird jedoch von durchschnittlich 100 Kontrollen pro Jahr ausgegangen, wobei eine Kontrolldauer von 1,5 Stunden (einschließlich der notwendigen Reisezeit) angenommen wird. Die Kontrolle wird von Bediensteten der Verwendungsgruppe A2/B (GL – A2/4) vorgenommen werden, so dass 150 Stunden zu je 34,98 EUR (einschließlich Zuschlägen für Sachaufwand und Verwaltungsgemeinkosten) anzusetzen sind.
Die risikobasierte Überwachung im Inland ist zwar auch abhängig vom Auftreten spezifischer Schadorganismen, es wird aber auch hier von maximal 100 Kontrollen pro Jahr auszugehen sein. Aufgrund des höheren Anteils an Reisezeit wird hier von einer durchschnittlichen Kontrolldauer von 2 Stunden ausgegangen. Somit werden 200 Stunden Kontrolldauer (Vollziehung durch Bedienstete der Verwendungsgruppe A 2/B, A 2/GL-A 2/4) zu je 34,98 EUR anzusetzen sein.
An Personalkosten für Zeitaufwand, berechnet nach den Ansätzen der Kundmachung betreffend die Richtwerte für die Durchschnittspersonalausgaben/-kosten, die Durchschnittsmietkosten und den kalkulatorischen Zinssatz, ist somit von ca. 12 240 EUR auszugehen. An Raumkosten für 2 Kontrollorgane (Standort Wien, einfacher Nutzungswert) werden 2990 EUR angesetzt. An Laborkosten ist bei maximal 20 repräsentativen Proben pro Jahr von Kosten von 3000 EUR auszugehen. Des weitern fallen Schulungskosten von 260 EUR pro Jahr an.
Es werden anlässlich der Kontrolle von Verpackungsmaterial aus Holz mit Ursprung in Drittländern voraussichtlich Gesamtkosten von 18 490 EUR pro Jahr entstehen. Eine kostendeckende Gebühr steht den anlässlich der Kontrolle an der Ersteintrittstelle auflaufenden Kontrollkosten in jedem Einzelfall gegenüber, den anlässlich der risikobasierten Überwachung auflaufenden Kosten steht eine kostendeckende Gebühr in jenen Fällen gegenüber, in denen von der zuständigen Behörde eine Übertretung der einschlägigen Vorschriften festgestellt wurde.
Die anlässlich der Vollziehung der Exportvorschriften anfallenden Kosten können nicht seriös kalkuliert werden, da der anfallende Arbeitsaufwand in jedem Fall von den Anforderungen der Drittländer abhängt. Es ist jedoch jedenfalls davon auszugehen, dass
die Erstellung der Bescheide betreffend die Aufnahme in das amtliche Register durch Bedienstete der Verwendungsgruppe A1/A (A1/GL-A 1/4) zu erfolgen hat. Die Vornahme von Kontrollen in den Betrieben oder beispielsweise die Anbringung von Plomben hat dagegen durch Bedienstete der Verwendungsgruppe A 2/B (A 2/GL-A 2/4) zu erfolgen. Den dabei jeweils anfallenden Aufwendungen steht jedenfalls eine kostendeckende Gebühr gegenüber.
Kompetenzgrundlagen:
Der Entwurf einer Novelle dieses Bundesgesetzes findet seine Rechtsgrundlage in Artikel 10 Abs. 1 Z 2 B- VG:
Warenverkehr mit dem Ausland.
Besonderer Teil
Zu Z 1 und 2 (§ 2 Z 1 und Z 22):
Die vorgeschlagene Neugestaltung der Z 1 soll eine bessere Übersichtlichkeit der Begriffsbestimmung zur Folge haben. Die in der Z 22 enthaltene Begriffsbestimmung erfolgt im Zusammenhang mit der Festlegung von Vorschriften hinsichtlich der Ausfuhr in Drittländer.
Zu Z 3 (§ 5 Abs. 5):
Die bisher in § 5a Abs. 4 enthaltene Bestimmung soll aus Gründen der Klarstellung in § 5 als eine die Kontrollorgane treffende Verpflichtung aufgenommen werden.
Zu Z 4 (Entfall § 5a):
Die bisher bestehenden Regelungen hinsichtlich der Probenahme sind mit der nunmehrigen Judikatur des europäischen Gerichtshofes (Rs C 276-2001, Steffensen) nicht mehr kongruent. Es erscheint daher ein Entfall der bisherigen Bestimmung angebracht.
Zu Z 5 (§ 10 Abs. 3):
Aufgrund der Erfahrungen der Praxis erscheint bei der Kontrolle von Verpackungsmaterial aus Holz mit Ursprung in Drittländern eine Neuausrichtung erforderlich. Diese Anpassung soll im Sinne des Art. 13 Abs. 3 der Richtlinie 2000/29/EG eine Verlagerung der Erstkontrolle auf jenes Verpackungsholz, das in Österreich in das Zollgebiet der Gemeinschaft eintritt, bewirken. Da aber naturgemäß eine erhebliche Zahl an Verpackungsmaterialien aus Holz mit Ursprung in Drittländern über andere Mitgliedstaaten nach Österreich gelangt, soll weiterhin eine Überprüfung von Betrieben im Bundesgebiet erfolgen, allerdings aufgrund einer risikobasierten Auswahl.
Zu Z 6 bis 8 (§ 14 Abs. 2, 6 letzter Satz und 7):
Der bisher enthaltene Regelungsinhalt, wonach der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft durch Verordnung ein Formblatt für die Antragstellung festzulegen hat, sollte entfallen. Die Antragstellung soll zwecks Verwaltungsvereinfachung nunmehr auch in anderen technisch möglichen Formen erfolgen können. Ein Musterantrag wird als Service auf der Homepage des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft sowie des Amtlichen Österreichischen Pflanzenschutzdienstes zum Herunterladen bereitgestellt werden.
Der nunmehr vorgeschlagene Inhalt des § 14 Abs. 2 beinhaltet die Möglichkeit für Betriebe, beim örtlich jeweils zuständigen Landeshauptmann die Aufnahme in ein amtliches Verzeichnis zu beantragen, sofern bestimmte Drittländer dies als Voraussetzung für die Ausfuhr von Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen oder sonstigen phytosanitär geregelten Gegenständen vorschreiben.
Zu Z 9 (§ 30 Abs. 1):
Mit dieser Regelung soll sichergestellt werden, dass auch bei Nichtvorliegen eines gültigen Pflanzengesundheitszeugnisses entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können.
Zu Z 10 (§ 34 Abs. 6 bis 8):
Aufgrund der seit 2005 in Kraft befindlichen revidierten Fassung der Internationalen Pflanzenschutzkonvention, insbesondere dessen Art. IV Z 2 lit. g, sind die Vertragsstaaten (zu denen die Europäische Gemeinschaft sowie sämtliche 27 Mitgliedstaaten gehören) verpflichtet, durch geeignete Verfahren sicherzustellen, dass die phytosanitäre Sicherheit von zu exportierenden Sendungen hinsichtlich Zusammensetzung und Verhinderung eines Neu- oder Wiederbefalls vom Zeitpunkt der Ausstellung eines Pflanzengesundheitszeugnisses bis zum Verlassen des Hoheitsgebietes des Vertragsstaates garantiert wird.
Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es einiger Anpassungen und Ergänzungen der bisher geltenden Bestimmungen für die Anforderungen an die Ausführer von phytosanitär kontrollpflichtigen Sendungen.
Diesbezüglich soll dem Ausführer ermöglicht werden, beim örtlich zuständigen Landeshauptmann die Aufnahme in ein amtliches Verzeichnis zu beantragen (Abs. 6).
Weiters soll die Möglichkeit eröffnet werden, dass der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft durch Verordnung spezifische Kennzeichnungs- und Verplombungssysteme festlegen kann, sofern diese für die Ausfuhr in Drittländer erforderlich sind (Abs. 7).
Abschließend wäre auch klarzustellen, dass Exporteuren verboten ist, ab dem Zeitpunkt der Ausstellung des Pflanzengesundheitszeugnisses durch die zuständige Behörde bis zum Zeitpunkt des Verlassens des Bundesgebietes Änderungen an der Sendung, die die phytosanitäre Sicherheit derselben gefährden könnten, vorzunehmen.
Zu Z 11 und 12 (§ 36 Abs. 1 Z 19 und 31):
Die Anpassung der Z 19 in den Strafbestimmungen soll klarstellen, dass insbesondere auch die Verletzung der Verpflichtung, phytosanitär kontrollpflichtige Sendungen nur mit einem gültigen Zeugnis einführen zu dürfen, zu ahnden ist. Diese Frage ist insbesondere anlässlich des Schmuggels von Sendungen, die artenschutzrechtlich geschützte Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse enthalten, von Bedeutung.
Die Anfügung der Z 31 in die Strafbestimmungen soll sicherstellen, dass Übertretungen der Verpflichtung der Exporteure, keine Änderung vorzunehmen, die die phytosanitäre Sicherheit der zu exportierenden Sendung gefährden, effektiv geahndet werden können.
Erläuterungen
zu Artikel 6 (Änderung des Forstlichen Vermehrungsgutgesetzes 2002)
Allgemeiner Teil
Hauptgesichtspunkte des Entwurfes:
Das Forstliche Vermehrungsgutgesetz 2002 dient der Umsetzung der Richtlinie 1999/105/EG des Rates vom 22.12.1999 über den Verkehr mit forstlichem Vermehrungsgut, welche bis zum 1. Jänner 2003 zu erfolgen hatte.
Zweck des Gesetzes ist die Bereitstellung von hochwertigem und identitätsgesichertem forstlichen Vermehrungsgut für die Erhaltung und Verbesserung der Wohlfahrtswirkungen des Waldes, die Förderung der Forstwirtschaft sowie die Erhaltung und nachhaltige Nutzung forstgenetischer Ressourcen. Dabei sind wissenschaftliche Erkenntnisse und forstliche Erfahrungen einzubeziehen.
Mit dem BFW-Gesetz 2004 wurde das Bundesamt für Wald namentlich geschaffen und wurde der hoheitliche Wirkungsbereich ua mit der Übertragung der Vollzugsaufgaben des Forstlichen Vermehrungsgutgesetzes festgelegt. Daher hat nunmehr in allen diesbezüglichen Bestimmungen die Wortfolge „und Forschungszentrum“ zu entfallen.
Kompetenzgrundlage:
In kompetenzrechtlicher Hinsicht stützt sich das im Entwurf vorliegende Bundesgesetz auf
- Art. 10 Abs. 1 Z 2 („Waren- und Viehverkehr mit dem Ausland“) im Hinblick auf die Regelungen über die Ein- und Ausfuhr von forstlichem Vermehrungsgut,
- Art. 10 Abs. 1 Z 4 („Bundesfinanzen“) im Hinblick auf die Regelungen über die Gebühren,
- Art. 10 Abs. 1 Z 8 („Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs“) und
- Art. 10 Abs. 1 Z 10 („Forstwesen“) des B-VG.
Besonderer Teil
Zu Z 1 (§ 2 Z 2 lit.c):
In der Begriffsbestimmung wird nunmehr die Bezeichnung „Wildlinge“ ausdrücklich angeführt.
Zu Z 2 (§ 2 Z 16 lit.a):
Siehe dritter Absatz im „Allgemeinen Teil“ der Erläuterungen.
Zu Z 3 (§ 4 Abs. 5):
Bei der Kategorie „quellengesichert“ wird nunmehr auch eine Verordnungsermächtigung geschaffen, um das Zulassungszeichen zu definieren.
Zu Z 4 (§ 6 Abs. 1, 2 und 7):
Siehe dritter Absatz im „Allgemeinen Teil“ der Erläuterungen.
Zu Z 5 (§ 6 Abs. 9):
Neue VO-Ermächtigung, damit in Saatguterntebeständen nur bestimmte Baumarten als Wildlinge geworben werden können.
Zu Z 6 bis Z 8 (§ 8, § 10, § 11):
Siehe dritter Absatz im „Allgemeinen Teil“ der Erläuterungen.
Zu Z 9 (§ 12 Abs. 1 Z 1):
Die Meldefrist des beabsichtigten Erntetermins wurde von einem Monat auf „eine Woche“ verkürzt.
Zu Z 10 (§ 12 Abs. 4 Z 7):
Siehe dritter Absatz im „Allgemeinen Teil“ der Erläuterungen.
Zu Z 11 (§ 12 Abs. 6 Z 3):
Ergänzung zur VO-Ermächtigung, um das Zulassungszeichen für Wildlinge der Kategorie „quellengesichert“ zu definieren.
Zu Z 12 (§ 12 Abs. 8):
Überprüfung des Stammzertifikats durch das Bundesamt für Wald und Ungültigkeitserklärung mit Bescheid, wenn Bestimmungen nicht eingehalten wurden.
Zu Z 13 (§ 13 Abs. 1 Z 1):
Die Meldefrist des beabsichtigten Erntetermins wurde von einem Monat auf „eine Woche“ verkürzt.
Zu Z 14 (§ 13 Abs. 1 Z 5):
Siehe dritter Absatz im „Allgemeinen Teil“ der Erläuterungen.
Zu Z 15 (§ 13 Abs. 3 Z 3):
Bei der bestehenden VO-Ermächtigung wurden die Baumarten und das Zulassungszeichen für Wildlinge der Kategorie „ausgewählt“ ergänzt.
Zu Z 16 (§ 13 Abs. 7):
Überprüfung des Stammzertifikats durch das Bundesamt für Wald und Ungültigkeitserklärung mit Bescheid, wenn Bestimmungen nicht eingehalten wurden .
Zu Z 17 (§ 13 Abs. 8):
Die Gewinnung von Wildlingen soll auf der gesamten Zulassungseinheit (=Saatguterntebestand) erfolgen, um eine hohe genetische Vielfalt zu gewährleisten.
Zu Z 18 (§ 15 Abs. 1 Z 1):
Die Meldefrist des beabsichtigten Erntetermins wurde von einem Monat auf „eine Woche“ verkürzt.
Zu Z 19 (§ 15 Abs. 1 Z 5):
Siehe dritter Absatz im „Allgemeinen Teil“ der Erläuterungen.
Zu Z 20 (§ 15 Abs. 6):
Überprüfung des Stammzertifikats durch das Bundesamt für Wald und Ungültigkeitserklärung mit Bescheid, wenn Bestimmungen nicht eingehalten wurden.
Zu Z 21 (§ 16 Abs. 1):
Die Meldefrist der beabsichtigten Gewinnung von Pflanzgut wurde von einem Monat auf „eine Woche“ verkürzt.
Zu Z 22 (§ 16 Abs. 4):
Siehe dritter Absatz im „Allgemeinen Teil“ der Erläuterungen.
Zu Z 23 (§ 16 Abs. 5):
Überprüfung des Stammzertifikats durch das Bundesamt für Wald und Ungültigkeitserklärung mit Bescheid, wenn Bestimmungen nicht eingehalten wurden, wird nunmehr auch bei vegetativem Vermehrungsgut möglich.
Zu Z 24 und Z 25 (§ 17 Abs. 1 Z 1 bis 4):
Die Ziffer 5 in Absatz 1 entfällt, da Wildlinge jetzt eindeutig in den Kategorien „quellengesichert“ und „ausgewählt“ geregelt werden.
Zu Z 26 (§ 17 Abs. 5):
Dieser Absatz 5 wird umformuliert.
Zu Z 27 (§ 17 Abs. 6):
Korrektur eines Zitierfehlers (statt: Populus ssp. richtig: Populus spp.).
Zu Z 28 (§ 17 Abs. 7):
Dieser Absatz 7 wird umformuliert.
Zu Z 29 (§ 20 Abs. 1 und 5):
Siehe dritter Absatz im „Allgemeinen Teil“ der Erläuterungen.
Zu Z 30 (§ 20 Abs. 1 Z 2):
Die Vermengung von Saatgut wurde auf alle drei Kategorien erweitert, um praxisgerecht handeln zu können. Kleine Mengen von Plantagensaatgut können dann auch vermengt werden, wenn die Saatgutuntersuchung durchgeführt wurde und das Bundesamt ein neues Stammzertifikat ausstellte.
Zu Z 31 (§ 23 Abs. 5):
Korrektur eines Zitierfehlers (statt: Populus ssp. richtig: Populus spp.).
Zu Z 32 bis Z 34 (§ 24, § 27 und § 28):
Siehe dritter Absatz im „Allgemeinen Teil“ der Erläuterungen.
Zu Z 35 und Z 36 (§ 29):
Durch die neuen EU Mitgliedstaaten bleibt eigentlich in der Praxis nur mehr Amerika als Drittstaat für den Saatgutimport übrig. Die Absätze 2 und 3 können entfallen, da in Zukunft Zollprobenentnahmen und Untersuchungen nicht mehr effektiv und notwendig erscheinen.
Zu Z 37 (§ 30):
Die Absätze 1 bis 8 werden gestrichen und erfolgt eine Neuformulierung, da sich die Bestimmung gleichfalls auf Drittstaaten bezieht und es sinnvoll erscheint, nur mehr das Bundesamt für Wald mit der Einfuhrkontrolle zu befassen.
Zu Z 38 (§ 31):
Die zwei Absätze entfallen und wird die Bestimmung vereinfacht neu formuliert. Die Geschäftszahl des Bescheides (Einfuhrbewilligung) ist die Stammzertifikatsnummer bei Importen von Vermehrungsgut aus Drittstaaten. Laut Richtlinie 1999/105/EC muss ein Stammzertifikat für ein importiertes Vermehrungsgut ausgestellt werden.
Da die Zollprobe beim Saatgut entfällt und keine Untersuchung vom Bundesamt für Wald durchgeführt wird, entfällt auch die Untersagungsmöglichkeit.
Zu Z 39 und Z 40 (§ 32 und § 33):
Siehe dritter Absatz im „Allgemeinen Teil“ der Erläuterungen.
Zu Z 41 (Überschrift zu Abschnitt 6):
In der Überschrift wird der „Ernteunternehmer“ ergänzt.
Zu Z 42 (§ 34 Abs. 1 und 3):
Hier wurde der Ernteunternehmer ergänzt.
Zu Z 43 (§ 34 Abs. 3):
Siehe dritter Absatz im „Allgemeinen Teil“ der Erläuterungen.
Zu Z 44 und Z 45 (§ 35 Abs. 1):
Auch hier wird der Ernteunternehmer ergänzt und angeführt, welche Bücher er führen muss.
Zu Z 46 (§ 35 Abs. 2):
Die Betriebsaufzeichnungen sind nunmehr nicht mehr zehn Jahre sondern sieben Jahre aufzubewahren.
Zu Z 47 und Z 48 (§ 36 und § 37):
Siehe dritter Absatz im „Allgemeinen Teil“ der Erläuterungen.
Zu Z 49 (§ 37 Abs. 5):
Auch hier wird der Ernteunternehmer ergänzt.
Zu Z 50 (§ 38):
Siehe dritter Absatz im „Allgemeinen Teil“ der Erläuterungen.
Zu Z 51 bis Z 55 (§ 39):
Während der 6-jährigen Vollziehung des Forstlichen Vermehrungsgutgesetzes 2002 zeigte sich, dass die Verjährungsfrist von 6 Monaten nach § 31 Abs. 2 Verwaltungsstrafgesetz zu kurz ist. Da die Betriebskontrollen innerhalb von 3 Jahren erfolgen, konnten in der Praxis bisher Verwaltungsübertretungen, insbesondere hinsichtlich unrichtig ausgestellter Lieferscheine (Rechnungen), oftmals erst nach Ablauf der 6-monatigen Verfolgungsverjährungsfrist festgestellt werden. Daher war in diesen Fällen eine Ahndung der in § 39 normierten Verwaltungsstraftatbestände nicht mehr möglich.
Auch im Saatgutgesetz 1997 ist eine Frist von zwei Jahren für die Verfolgungsverjährung aus ähnlichen Erwägungen normiert.
Aus vergleichbaren Gründen wurde daher diese Regelung übernommen, um nunmehr auch die Möglichkeit zu schaffen, die Einhaltung des Gesetzes samt den Straftatbeständen effektiv zu vollziehen.
Dafür wurde die Höhe der Geldstrafenandrohung vereinheitlicht für alle Straftatbestände auf 7000.- € herabgesetzt, in Anlehnung an das Forstgesetz.
Zu Z 56 (§ 41):
Die Gebührenerlassung hat nunmehr nach dem BFW-Gesetz 2004 zu erfolgen. Es sind Tarife für forstliches Vermehrungsgut zu erlassen, die mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen derart festgelegt werden, dass jener Aufwand, der aufgrund der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes entsteht, kostendeckend abgegolten wird.
Zu Z 57 (§ 42 Abs. 1):
Siehe dritter Absatz im „Allgemeinen Teil“ der Erläuterungen.
Zu Z 58 (§ 42 Abs. 2):
In § 3 Abs. 2 und 3 BFW-Gesetz 2004 wurde das Bundesamt für Wald im Rahmen der nach dem Forstlichen Vermehrungsgutgesetz übertragenen hoheitlichen Vollzugsaufgaben Behörde und gleichzeitig normiert, dass gegen Bescheide des Bundesamtes für Wald eine Berufung an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zulässig ist. Die diesbezügliche Regelung in Abs. 2 wurde damit inhaltlich geändert, gegenständlich erfolgt nunmehr auch die formale Änderung der Rechtsmittelmöglichkeit.
Zu Z 59 (§ 44 Abs. 1):
Neuformulierung des Textes; keine inhaltliche Änderung.
Zu Z 60 (§ 47):
Aufgrund eines Redaktionsversehens wurde diese Paragrafenbezeichnung übergangen.
Zu Z 61 (§ 48):
Nachnummerierung aufgrund des vorgenannten Redaktionsversehens.“
*****
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als erster Redner zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Doppler. Eingestellte Redezeit: 3 Minuten. – Bitte.
13.14
Abgeordneter Rupert Doppler (FPÖ): Herr Präsident! Herr Minister! Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Hohes Haus! Die FPÖ bekennt sich, wie auch aus unserem Entschließungsantrag 583/A(E) hervorgeht, zu unserer heimischen Landwirtschaft.
Wir brauchen keine Agrarfabriken und kein Gentechnikgesetz, wo nur die Profitgier im Vordergrund steht. Was wir brauchen, ist ein Maßnahmenpaket, damit es unserer Landwirtschaft so geht, dass die Bauern, die Bäuerinnen und die Jugend von ihrer Wirtschaft wieder anständig leben können und nicht am Hungertuch nagen müssen, sodass immer mehr Höfe verlassen und nicht mehr bewirtschaftet werden. (Beifall bei der FPÖ.)
Schlussendlich ist sonst die Versorgung der Bevölkerung mit heimischen, gesunden Produkten nicht mehr gewährleistet. Die Agrarförderungen stopft man in den Rachen der Lebensmittelindustrie, anstatt sie den Bauern zu geben. Wir Freiheitliche wollen nicht, dass unsere Enkelkinder nur noch Kunstkäse und Kunstfleisch essen müssen, weil es die Bauern und deren Produkte nicht mehr gibt. – Herzlichen Dank. (Beifall bei der FPÖ.)
13.15
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Grillitsch. Eingestellte Redezeit: 4 Minuten. – Bitte.
13.15
Abgeordneter Fritz Grillitsch (ÖVP): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Man braucht nicht von „Agrarfabriken“ zu sprechen, denn in Österreich gibt es die nicht. In Österreich haben wir eine bäuerliche Landwirtschaft, eine kleinstrukturierte Landwirtschaft, und es ist wichtig, in diesem Hohen Haus wirklich ein klares Bekenntnis zu dieser kleinbäuerlichen Landwirtschaft abzugeben.
Gerade in diesen Tagen, in denen wir durch die aktuelle Wettersituation, durch diese starken Regenfälle und die Überschwemmungen bis hin zu Murenabgängen in weiten Teilen Österreichs vor großen Herausforderungen stehen, wovon natürlich insbesondere die Landwirtschaft betroffen ist, bin ich sehr froh, dass unsere Bundesminister Josef Pröll und Niki Berlakovich für die Opfer, die es da gegeben hat, Sofortmaßnahmen ergriffen haben, um entsprechend rasch helfen zu können, denn rasche Hilfe ist immer die beste Hilfe. Herzlichen Dank dafür, Herr Bundesminister! (Beifall bei der ÖVP.)
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben jetzt mehr als acht Monate in diesem Hohen Haus das Agrarrechtsänderungsgesetz verhandelt. Ich bin sehr froh, dass es
letztlich doch möglich war, noch vor dem Sommer das Agrarrechtsänderungsgesetz im Landwirtschaftsausschuss durchzubringen und heute auch im Plenum zu beschließen, weil es für die österreichischen Bäuerinnen und Bauern wichtig ist, dass sie wieder Rechtssicherheit haben.
Wir hätten bis 1. August 2009 nach Brüssel melden müssen, ob wir die Health Check-Maßnahmen umgesetzt haben oder nicht, und die Konsequenzen bei einer Nichtumsetzung hätten großen Schaden für die österreichischen Bäuerinnen und Bauern in einem Ausmaß von nahezu 100 Millionen € bedeutet. Daher bin ich froh, dass die Bäuerinnen und Bauern diese Finanzgrundlage und diese Rechtssicherheit wieder haben, vor allem auch die betroffenen Milchbauern, weil es möglich war, auch dieses Milchmaßnahmenpaket jetzt im Hohen Haus beschließen zu können. (Abg. Huber: Erläutern Sie uns das, bitte!)
Wir wissen alle, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, dass am Milchmarkt derzeit eine sehr, sehr schwierige Situation besteht. Keiner von uns ist in der Lage, den Preis zu bestimmen, sondern wir können im besten Fall Rahmenbedingungen schaffen, sodass es wieder möglich ist, entsprechend Bewusstsein zu bilden und den Bauern jene Rechtssicherheit zu geben, die sie brauchen.
Daher bin ich froh darüber, dass wir jetzt aufgrund des zu hohen Angebots nicht die Quoten aufstocken, sondern dass unser Landwirtschaftsminister Niki Berlakovich einen klaren Vorschlag gemacht und gesagt hat: Wir setzen die Quotenaufstockung jetzt aus. Ich glaube, das ist ein gutes Signal, ein gutes Zeichen auch an die Konsumenten in Österreich, dass wir bereit sind, die Dinge selbst anzugehen und der Situation entsprechende, richtige Schritte zu setzen.
Die sofortige Verschärfung der Saldierung ist eine wichtige Maßnahme – und nicht die Abschaffung der Saldierung, wie das natürlich in vielen Versammlungen und auch im Ausschuss stark diskutiert wurde. Die Verschärfung der Saldierung ist das Wesentliche in diesem Milchmaßnahmenpaket, weil wir damit nicht jenen helfen, die jetzt stark und ganz bewusst überliefern, sondern vor allem den kleinen bäuerlichen Produzenten, die aus Sorge um ihre Existenz und aus Sorge um ihren Arbeitsplatz in dieser Situation in der Milchproduktion bleiben und logischerweise dann auch versucht sind, mehr Milch zu produzieren.
Ich bin froh darüber, dass auch die Mutterkuhprämien wieder sichergestellt sind. Ich bin froh, dass wir die Milchkuhprämie einführen und das Geld auch von Brüssel abholen können. Also summa summarum ein gutes Paket für die österreichischen Bäuerinnen und Bauern, insbesondere für die Milchbauern. Ich kann nur an die Oppositionsparteien appellieren: Wenn Sie wirklich Verantwortung tragen wollen, dann stimmen Sie heute diesem Paket zu! (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der SPÖ.)
13.19
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als nächster Redner zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Huber. Eingestellte Redezeit: 3 Minuten. – Bitte.
13.19
Abgeordneter Gerhard Huber (BZÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bundesminister! Hohes Haus! Tu nicht schimpfen, hat mein Vorredner zu mir gesagt. – Ich werde nicht schimpfen. Ich werde ganz sachlich und ohne jede Polemik dieses Thema, das wirklich ein Trauerthema ist, abhandeln. Man erlebt als Jungabgeordneter, wie man in diesem Ausschuss in eine ohnmächtige Position kommt; man kann nichts tun. Ihr habt die Chance komplett verschlafen, wirklich etwas umzuschichten, die Fördermittel gerecht umzuschichten. (Abg. Grillitsch: Gestern hast du mich noch gelobt dafür!)
Da muss ich jetzt einmal Herrn Abgeordnetem Gaßner wirklich Respekt zollen, denn er hat im Ausschuss gesagt: Ja, ich stimme zu, das war eine Einigung von Cap und Kopf. – Ich weiß nicht, ist das eine Regierungskrise, wenn die Klubobleute, die in der Landwirtschaft wahrscheinlich wenig Erfahrung haben, das Ergebnis im Vorhinein abstellen? Wie auch immer.
Sie wollen weiterhin die Raiffeisen-Genossenschaften beziehungsweise die Großbauern fördern, sie wollen die Pfründe Ihrer Bauernbündler absichern; aber unsere Lösungen – die Bauern werden es wissen, das BZÖ und die gesamte Opposition hat sehr viele hervorragende Lösungsansätze eingebracht (Abg. Hornek: Zum Beispiel?!) –, habt ihr alle niedergestimmt, sei es im Milchsektor, sei es bei der Fleisch- oder bei der Mehrwertsteuer!
Diese Milchkuhprämie, die Sie jetzt so als Allheilmittel darstellen ... (Neuerlicher Zwischenruf des Abg. Hornek.) – Gewöhnen Sie sich bitte einmal das dumme Zwischenrufen ab! Melden Sie sich stattdessen zu Wort, dann können wir weiterreden! (Beifall beim BZÖ. – Abg. Hornek: Ein Beispiel?!)
Diese Milchkuhprämie, die Sie als Allheilmittel anpreisen, bringt dem Landwirt 0,006 Cent – das ist, bitte, überhaupt nichts! (Abg. Grillitsch: Bei 20 Kühen 1 000 €! Da kannst du nicht sagen, dass das nichts ist!) Und auf der anderen Seite nehmen Sie ihm alles weg. Es wäre so wichtig gewesen, Gerechtigkeit einzubringen, einen gerechten Sockelbetrag einzuführen und wirklich die kleinen Landwirte, die im Vollerwerb sind, in ihrer Existenz abzusichern – aber nein, Sie sind immer dagegen. Das ist fast schon wie ein Machtmissbrauch!
Der Minister kann nun alles. Im Gesetz steht: „bestimmbar oder begrenzt“. Aber wer bestimmt, wer begrenzt und was bestimmbar ist, das steht wieder nicht drinnen! Die Opposition wird sich gut überlegen, ob dieses Gesetz nicht womöglich der Verfassungsgerichtshof kontrollieren wird müssen.
In meiner Anfrage zur AGES habe ich den Herrn Bundesminister Stöger gefragt, was er konkret machen wird, damit die AGES saniert wird. Darauf gibt er mir wortwörtlich zur Antwort, die AGES sei ein gesunder Betrieb – und im zweiten Satz hat er gesagt, im September werde er das Sanierungskonzept vorlegen. Bitte, das ist eure Politik!
Abschließend möchte ich nur Folgendes sagen: Das BZÖ und ich, wir werden nicht müde werden! Und, lieber Kollege Grillitsch: Bitte lenkt irgendwann ein! Tut nicht eure Macht ... Du sprichst nur von Mehrheiten. Wenn ich von der Wahrheit spreche, sprichst du von den Mehrheiten. Entscheidet anders – im Sinne der Bauern! (Beifall beim BZÖ sowie der Abg. Mag. Brunner.)
13.22
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Schopf. 3 Minuten Redezeit. – Bitte.
13.23
Abgeordneter Walter Schopf (SPÖ): Herr Präsident! Herr Minister! Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Ich sage gleich vorweg: Unsere Fraktion wird dieser Vorlage die Zustimmung geben.
Ich sage aber auch, dass es im Zuge dieser Gespräche, dieser Verhandlungen natürlich auch eine Reihe von Bereichen gegeben hat, in denen wir noch keine Einigung erzielt haben, in denen wir aber mit unserem Koalitionspartner – man kann das durchaus so sagen – doch die Vereinbarung erzielt haben, dass wir über diese offenen Themen, wo es vor allem um die Interessen der kleinen Bauern und Bäuerinnen in dieser Republik geht, noch reden und verhandeln werden.
Meine Damen und Herren, weil einer meiner Vorredner den Verantwortlichen der SPÖ im Landwirtschaftsbereich, unseren Sprecher Kurt Gaßner, erwähnt hat, möchte ich auch Folgendes sagen: Es ging nicht darum, ob man mit irgendjemandem von der ÖVP – in diesem Fall mit dem Klubobmann – einen Deal vereinbart hat.
Ich war bei vielen Gesprächen im Ausschuss dabei und kann feststellen: Es gibt eine Reihe von Regelungen, bei denen man, wenn man sie genau liest, Kurt Gaßners Handschrift erkennt. Er ist es vor allem, der immer wieder versucht – ich wiederhole mich –, die Interessen der kleinen Bauern zu vertreten. Ich denke, es ist wichtig, dies hier festzustellen. Und dir, lieber Kurt, ein herzliches Danke dafür! (Beifall bei der SPÖ. – Abg. Dr. Pirklhuber: Kennt er sich aber wirklich aus?!)
Einer der offenen Punkte, in dem wir – das sage ich auch ganz offen – bisher vergeblich versucht haben, eine Einigung erzielen – aber wir werden auch hier nicht lockerlassen! –, ist die Novellierung des Forstgesetzes. Da gerade Schwammerlsaison, Pilzsaison ist, wissen wir ja alle, dass sich zurzeit die Vorfälle häufen, wo Waldeigentümer auch bei einer Entnahme von weniger als zwei Kilo an Pilzen pro Person und Tag eine Bezahlung verlangen.
Meine Damen und Herren, wir wissen auch sehr genau, dass bei diesem Thema in Österreich Rechtsunsicherheit besteht. Ich denke, es wäre notwendig und wichtig, in diesem Bereich eine Novellierung vorzunehmen, um Rechtssicherheit zu erhalten. Diese Rechtssicherheit ist für den ländlichen Raum von größter Bedeutung. Ich glaube, das ist auch für die Waldbesitzer und für den Tourismus ein sehr wichtiger Punkt.
Wenn man das Regierungsübereinkommen liest, so gibt es darin eine klare Formulierung. Ich möchte daraus zitieren: „Das Sammeln von Pilzen und Beeren muss entsprechend der aktuell bestehenden Rechtslage weiterhin möglich bleiben.“
Das ist auch unsere Position. Wir versuchen durchzusetzen, dass diese Position mit diesem Gesetz novelliert wird. – Danke. (Beifall bei der SPÖ.)
13.26
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Dr. Pirklhuber. 7 Minuten Redezeit. – Bitte. (Abg. Großruck: Das sind 7 Minuten zu lang!)
13.26
Abgeordneter Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber (Grüne): Herr Kollege Großruck, es sind zu wenig Bauernbundfunktionäre im Raum. Es geht um 700 Millionen €. Nicht einmal die Bauernvertreter der ÖVP, die diese schlechte Gesetzesnovelle zu verantworten hat, sofern man dem Kollegen Gaßner Glauben schenken soll Man muss feststellen: Es ist wirklich traurig. (Zwischenruf des Abg. Ing. Schultes.)
Es ist eine Tragödie. – Hören Sie mir kurz zu, Kollege Schultes! (Abg. Mag. Kogler – in Richtung des Abg. Ing. Schultes –: Er will etwas sagen!) – Warum ist es eine Tragödie? Damit Sie die Sache verstehen: Wir wollen ja Verantwortung übernehmen. Es ist ja nicht so, dass die Opposition nicht bereit wäre, ernsthaft über die Dinge zu diskutieren. Aber wer verweigert denn diese Diskussion? Nicht nur im Ausschuss, schon das Prozedere ist skandalös!
Punkt eins: Der Minister bringt am 9. März 2009 eine Marktordnungsgesetz-Novelle in die Begutachtung. Wir haben gesagt: Wunderbar, jetzt kommt Bewegung ins Spiel. Begutachtungstermin: 14. April – und danach Schweigen, Schweigen, Schweigen. Wir warten permanent darauf, dass diese Umsetzung der EU-Agrarreform ins Parlament, in den Ausschuss kommt – nicht so.
Dann kommt der Antrag der Kollegen Grillitsch und Gaßner. Darin gibt es einen ganz kurzen Absatz, rein technischer Natur, der auf die Marktordnung Bezug nimmt, eingebracht im Juni 2009. Einige Stunden vor dem Ausschuss gibt es eine über 40-seitige Erläuterung beziehungsweise Konkretisierung – die alles beinhaltet: Da geht es um 700 Millionen €, um die ganze Obergrenze, um die gesamte Betriebsprämie, um die gesamte Marktordnung, um die gesamte Umsetzung des Europäischen „Health Check“ der Agrarpolitik. Sie sind nicht bereit, nicht fähig, mit uns im Ausschuss darüber zu diskutieren. (Abg. Grillitsch: Pass auf, was du sagst!) Wir werden Ihnen das konkret belegen können.
Punkt zwei, nämlich die Erläuterungen, die Sie jetzt vorgestellt haben, die hier im Haus verteilt wurden: Was soll das, bitte? Erläuterungen zu einem Gesetzestext gehören in den Ausschuss und dort diskutiert. Ich fange jetzt nicht an, mit Ihnen jeden Detailpunkt dieser wirklich umfangreichen Materie zu diskutieren, das ist einfach unmöglich! (Abg. Ing. Schultes: Du bist ja sonst so schlau!)
Und warum verweigern Sie ein Expertenhearing? Wir verlangen das. (Abg. Ing. Schultes: Schau in der Geschäftsordnung nach, dann wirst du sehen, dass das dort genau so drinsteht!) Herr Bundesminister, nicht einmal ein Experte des Ministeriums war bereit oder fähig – Sie genauso wenig –, dazu Stellung zu nehmen, ob das Ministerium an einem Antrag zweier Abgeordneter mitgearbeitet hat.
Sie bringen ein europäisches Agrarpaket über einen Initiativantrag zweier Abgeordneter ein, weil Sie offensichtlich nicht bereit sind, Ihre Regierungsverantwortung wahrzunehmen. (Abg. Ing. Schultes: Ein bisschen präpotent sind wir schon!) Das muss ich annehmen, tut mir echt leid, weil ich nicht verstehen kann, wie Sie hier vorgehen.
Worum ginge es nämlich? Es ginge um eine Reform der europäischen und österreichischen Agrarpolitik. Es ginge darum, den Bäuerinnen und Bauern nicht Sand in die Augen zu streuen, sondern ihnen klar zu zeigen, dass da Reformbedarf besteht, dass der Reformweg weitergeht.
Ich zitiere direkt aus der Verordnung 73/2009 vom Jänner – die ist nämlich umgesetzt darin –, da heißt es konkret unter Punkt 26 in den Erläuterungen:
„Die Empfänger können daher nicht davon ausgehen, dass die Förderbedingungen unverändert bleiben, und sollten auf mögliche Änderungen insbesondere aufgrund wirtschaftlicher Entwicklungen oder der Haushaltslage vorbereitet sein.“
Punkt eins: Es kommt zu Änderungen, weil die wirtschaftliche und politische Situation das erfordert.
Punkt zwei: Was will die Kommission? – Die Kommission will, dass die Gemeinschaftsstützungen, die Gelder der Agrarpolitik, ich zitiere wieder, „der landwirtschaftlichen Bevölkerung eine angemessene Lebenshaltung“ garantieren. – Und zwar nur der landwirtschaftlichen Bevölkerung, nicht den agrarindustriellen Exportbetrieben, die Sie offensichtlich in Sonntagsreden kritisieren, wie Red Bull, aber auf der anderen Seite diesen Industrieunternehmungen die Stange halten. Das kann und will ich nicht verstehen, tut mir echt leid! (Abg. Ing. Schultes – in Richtung des Präsidenten Dr. Graf –: Herr Präsident, was haben wir verbrochen?! – Abg. Mag. Kogler: Ist ja ein Ordnungsruf!)
Was die soziale Gerechtigkeit dieses Agrarfördermodells betrifft, sagt die Kommission ja auch unmissverständlich Folgendes – das sollte auch zitiert werden, weil es eine Debatte ist, damit man sieht, dass nicht alles schlecht ist, was in Europa diskutiert wird, und es ist ziemlich schlimm, wenn diese Dinge im Haus, im Ausschuss, im Parlament nicht ausreichend gewürdigt werden –:
„Die Aufteilung der direkten Einkommensbeihilfen auf die landwirtschaftlichen Betriebsinhaber ist gekennzeichnet durch die Zuteilung eines großen Anteils der Zahlungen an eine recht kleine Anzahl großer Begünstigter. Es ist klar, dass größere Begünstigte nicht dasselbe Niveau an individueller Beihilfe brauchen, damit das Ziel der Einkommensbeihilfe wirksam erreicht wird.“
Eine ganz klare, präzise, sozial korrekte Feststellung der Kommission.
Dabei ist die Kommission noch lange nicht so radikal wie das Europaparlament, die würden schon lange etwas geändert haben! (Abg. Ing. Schultes: Das ist die soziale Kommission!) Und wer blockiert es? Ich schaue den Kollegen Gaßner an. Es ist ein Trauerspiel, seien wir ehrlich! Ich gestehe dir zu – und das ist durchaus ernst gemeint –, dass du es wirklich als schlimme Tatsache erleben musstest, dass so agiert wurde, aber dann frage ich mich: Warum stimmt ihr diesem Entwurf wirklich zu?
Weißt du, wofür diese Fristsetzung zählt, die Kollege Grillitsch mit 1. August 2009 angesprochen hat? – Diese Frist ist Kernfrage der Umsetzung eines Regionalmodells. Diese EU-Verordnung ermöglicht den Einstieg in ein gerechteres, sozialeres und ökologischeres Regionalmodell. Ja, und dazu gibt es eine Frist: der 1. September 2009, wenn wir das mit 1. Jänner 2010 umsetzen wollen.
Es bleibt die Möglichkeit – das ist an die Adresse der SPÖ gerichtet –, die letzte Möglichkeit, das ist der 1. September 2010. Wir haben jetzt eineinhalb Jahre Zeit, eine Agrarreform in Österreich auf den Weg zu bringen, um genau das zu erreichen – und nicht Stillstand bis 2013, wie das der Bauernbund will. Es gibt eine Mehrheit in diesem Haus, die nicht Stillstand will, sondern Sicherung bäuerlicher Arbeitsplätze, Chancen für die ländlichen Regionen, die sozial, gerecht und ökologischer sind.
Sie wissen es, Herr Bundesminister, in den Begutachtungen des Gesetzes gibt es eine Stellungnahme der Arbeiterkammer, Stichwort: Einstieg ins Regionalmodell. Das ist auch eher bei Ihnen zu Hause, soweit ich informiert bin.
Was ist mit diesen Ansätzen, Kollege Gaßner, was ist mit den Lippenbekenntnissen der SPÖ? Das Milchpaket – ich erinnere mich an unsere wirklich ernsthafte Diskussion in Marbach mit den Vertreterinnen und Vertretern der IG-Milch –: Nichts ist passiert, weder im Ausschuss noch sonst wo, und das ist auch traurig. Wenn Sie einer Interessengruppe ein Angebot machen, dann halten Sie bitte diese Versprechen und stehen Sie eben zu diesen schlechten Entscheidungen! Streuen Sie den Menschen nicht Sand in die Augen, denn das führt zu Demotivation und letztlich zu Depression in der Landwirtschaft – und diese tut uns nicht gut, denn wir brauchen die Landwirtschaft für unsere Lebensmittel.
Ich möchte Ihnen abschließend klarmachen: Wir werden diese Gesetzesmaterie – für deren ernsthafte Prüfung wir natürlich kaum Zeit hatten – auch in Hinsicht auf verfassungsrechtliche Schwächen und Fehler abklopfen. Wir haben über den Sommer Zeit dazu. Wir werden das ernsthaft prüfen und auch mit den anderen Oppositionsfraktionen beraten, ob diese Geschichte halten wird. Wenn nicht, können Sie sicher sein, dass wir alle rechtlichen Mittel ausschöpfen und bis zum Verfassungsgericht gehen werden.
Ich möchte noch eines erwähnen: 2009 ist der letzte Moment, um in den Biolandbau einzusteigen – eine Maßnahme im ökologischen Bereich. Wir sind Vorreiter in Europa. Danach gilt ein Einstiegsstopp bis 2013. Bisher gab es dazu von Ihnen, Herr Bundesminister, keine einzige Initiative!
Ich bringe daher folgenden Antrag ein:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Pirklhuber, Kolleginnen und Kollegen betreffend Verlängerung der Möglichkeit der ÖPUL-Betriebe, in die Maßnahme Biologischer Landbau einzusteigen
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Der Landwirtschaftsminister wird aufgefordert, die Möglichkeit für ÖPUL-Betriebe, in die Maßnahme Biologischer Landbau einzusteigen, bis zum Ende der Programmperiode 2013 zu verlängern und sich auf EU-Ebene für eine entsprechende Kofinanzierung einzusetzen.“
*****
Meine Damen und Herren, eine Baustelle heißt Agrarpolitik, und diese Baustelle ist leider nicht aufgeräumt, sondern sie bleibt, was sie ist: ein öko-sozialer Trümmerhaufen! Wir sind aufgerufen, hier endlich einmal Sauberkeit und Ordnung hereinzubringen und eine Politik der Zukunft zu gestalten! – Danke schön! (Beifall bei Grünen und FPÖ.)
13.35
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Der soeben eingebrachte Entschließungsantrag ist ausreichend unterstützt, steht im Zusammenhang mit der Grundmaterie und daher auch mit in Verhandlung.
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
des Abgeordneten Pirklhuber betreffend Verlängerung der Möglichkeit der ÖPUL-Betriebe, in die Maßnahme Biologischer Landbau einzusteigen, eingebracht im Zuge der Debatte über den Bericht des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betreffend das Agrarrechtsänderungsgesetz 2009 (293 d.B.)
Immer mehr BetriebsführerInnen tragen sich mit dem Gedanken, auf biologische Wirtschaftsweise umzustellen. Die Förderung für den biologischen Landbau im Agrarumweltprogramm (ÖPUL) ist eine wesentlicher Anreiz dafür. Jedoch haben die ÖPUL-Betriebe im Herbst 2009 letztmalig die Möglichkeit, in die Maßnahme Biologischer Landbau einzusteigen und damit ab 2010 die Bio-Förderung zu erhalten. Danach ist ein Einstiegsstopp in die Bio-Förderung bis Ende 2013 verhängt.
Diese Maßnahme ist nicht nur völlig unakzeptabel, sondern auch kontraproduktiv hinsichtlich der Zielsetzung des Bio-Aktionsprogramms, das den Anteil von Bio-Flächen an der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche bis 2010 auf 20% steigern will.
Diese Schikane widerspricht auch dem Regierungsprogramm S. 66, wo zu lesen ist: „Der Biologische Landbau hat bewiesen, dass produktive, umweltschonende und marktorientierte Bewirtschaftung gleichzeitig möglich ist. Der Ausbau der biologischen Landwirtschaft ist daher ein lohnendes Ziel und eine entsprechende Förderung inkl. Vermarktung erforderlich.“
Besonders absurd scheint dieser Einstiegstopp vor allem auch deshalb, weil der Biolandbau durch den Verzicht auf energieintensive Pflanzenschutz- und Düngemittel, den Aufbau gesunder Humusböden zur CO2-Bindungg und Tierhaltung im ökologischen Kreislauf einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz leistet. Dies wird auch durch eine neueren Studie der Universität für Bodenkultur belegt.
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
Der Landwirtschaftsminister wird aufgefordert, die Möglichkeit für ÖPUL-Betriebe, in die Maßnahme Biologischer Landbau einzusteigen, bis zum Ende der Programmperiode 2013 zu verlängern und sich auf EU-Ebene für eine entsprechende Kofinanzierung einzusetzen.
*****
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Zu Wort gelangt Herr Bundesminister Dipl.-Ing. Berlakovich. – Bitte.
13.35
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Dipl.-Ing. Nikolaus Berlakovich: Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Vorneweg: Herzlichen Dank an die Vertreter der Regierungsparteien, dass hier das Agrarrechtsänderungsgesetz beschlossen wird, dass man sich geeinigt hat.
All jene, die monatelang Lippenbekenntnisse abgegeben haben, man solle der österreichischen Milchwirtschaft helfen, und es dann im entscheidenden Moment nicht tun, müssen das verantworten – anstatt sich hierherzustellen, großartig zu moralisieren und zu sagen, was man nicht alles machen hätte sollen. Dieses Gesetz ist eine konkrete Hilfe, es ist eine vernünftige und kluge Lösung, um der Milchwirtschaft in einer extrem schwierigen Situation zu helfen. Daher danke, dass wir dieses Gesetz hier auf die Reihe bringen! (Beifall bei der ÖVP.)
Wir haben über dieses Thema in der Tat schon länger diskutiert. Es ist unbestritten, dass die Situation dramatisch ist. Die Preissituation im Milchbereich war vor eineinhalb Jahren sehr gut. Dann kam es in Europa zu einem Anstieg der Produktion, außerdem brechen entscheidende Märkte weg: der chinesische Markt – Sie erinnern sich an die gepanschte Milch – und der osteuropäische Markt.
Außerdem hat die europäische Lebensmittelindustrie – das ist ein entscheidender Punkt – aufgrund des hohen Milchpreises die Milch aus der Rezeptur verdrängt, zum Beispiel beim Speiseeis, aber auch in anderen Bereichen. Dort fehlen etwa 30 bis 40 Prozent der europäischen Milch, die bisher in der Industrie verarbeitet wurde, und diese Milch ist plötzlich am Markt. Das ist eine Entwicklung, für die niemand aus der Agrarpolitik etwas kann, das sind einfach Marktgegebenheiten.
Daher haben wir von Anfang an – ich seitens des Ministeriums, aber auch viele politische Kräfte – daran gearbeitet, Angebot und Nachfrage ins Gleichgewicht zu bringen, das ist unser vorrangiges Ziel. Sie wissen, dass die Europäische Union es bisher immer abgelehnt hat, in den Markt einzugreifen – dieser regle sich von selbst, war der Ansatz. Daher war die Agrarkommissarin auf meine Einladung mehrmals in Österreich, und auch in Brüssel wurde darauf gedrängt, dass die EU in den Markt eingreift. Und wir waren erfolgreich: ja, sie tut es!
Sie macht, was sie bisher nicht gemacht hat: Interventionskäufe – das heißt, es wird Butter und Magermilchpulver aus dem Markt aufgekauft, auf Lager; sie macht Exporterstattungen – es werden Milchprodukte aus der Europäischen Union hinaus verkauft, um den Markt eben zu räumen.
Wir sehen, dass die EU in diesem Bereich noch mehr machen muss. Daher bin ich stolz darauf, dass unsere Initiative Erfolg gehabt hat. Sie erinnern sich: Wir haben schon zu Beginn des heurigen Jahres ein österreichisches Milch-Memorandum verfasst, das von Deutschland, Ungarn, Slowenien und der Slowakei unterstützt wurde. Mittlerweile, nach Monaten, wird es auch von Frankreich unterstützt, und man spricht auf der europäischen Ebene von der französisch-deutsch-österreichischen Initiative für die Milchwirtschaft.
Wir können stolz darauf sein, dass wir zu den drei führenden Ländern zählen, die für die Milchbauern kämpfen. Jetzt, vor Kurzem wurde eine unserer Hauptforderungen erfüllt, nämlich: Die Europäische Union wird die Intervention und die Exporterstattung verlängern. Diese wäre Mitte bis Ende August ausgelaufen. Die EU wird sie verlängern, weil sie sieht, dass noch immer zu viel an Milch und Milchprodukten am europäischen Markt ist – um eben den Markt zu entlasten. Das ist für uns ein entscheidender Punkt, ich bin sehr froh darüber.
Wir haben dort auch andere Dinge angesprochen: zum Beispiel, dass es auch eine Exporterstattung für Käse geben soll – das ist bisher nicht im Regime, soll aber ebenfalls erfolgen –, sowie zum Beispiel, dass das Schulmilch-Angebot erweitert wird. Die Kinder wollen heute nicht mehr nur Schulmilch trinken, sondern auch Molkeprodukte und, und, und. Auch darüber befindet die Europäische Union. Es gibt also viele Dinge, die wir in Gang bringen.
Es hat sich im Übrigen der Europäische Rat, also auch die Regierungschefs, mit dem Thema Milch befasst. Dabei wurde unsere Forderung ebenfalls unterstützt, die darin besteht, dass die Europäische Union früher den Milchmarkt dahin gehend analysiert, ob das Quoten-Auslaufen Sinn macht. Es gibt eben viele, viele Dinge, die einfach wichtig sind, weil wir – das leugnet niemand – für die Milchwirtschaft eine sehr, sehr schwierige Situation haben. Und daher ist dieses Agrarrechtsänderungsgesetz wichtig – weil ich dadurch überhaupt die Möglichkeit bekomme, den Milchbauern zu helfen!
Die Milchkuhprämie ist ein Punkt. Wir müssen bis 1. August der Europäischen Union melden, ob wir die Mittel, die dort zur Verfügung stehen, auch einlösen wollen. Und es war immer ein Grundsatz der österreichischen Politik insgesamt und auch der Agrarpolitik, dass, wenn Gelder in Brüssel zur Verfügung stehen, wir dieses Geld auslösen, jeden Euro und jeden Cent. Dazu stehe ich!
Daher ist es wichtig, dass wir den Beschluss machen – weil wir nämlich jetzt der Europäischen Union mitteilen können: Die Mittel, in etwa 12 Millionen €, können wir auslösen, werden sie auch bundesseitig bedecken – das ist in dieser angespannten Budgetsituation wichtig –, und wir werden auch eine Kofinanzierung durch die Länder bekommen, damit wir die Milchkuhprämie an die Milchbauern auszahlen. Niemand sagt, dass das das allein Seligmachende ist, aber es ist ein wichtiger Teil der Unterstützung für die Milchwirtschaft!
Darüber hinaus wird es im Zusammenhang mit dem Recovery Plan zusätzliche Mittel aus nicht ausgeschöpften Agrarmitteln geben, die auch verwendet werden, um Investitionsmaßnahmen, Weidemaßnahmen für die österreichischen Milchbauern zu ermöglichen. In Summe ist das ein Paket von in etwa 50 Millionen €, die seinerzeit von meinem Vorgänger zugesagt wurden und jetzt durch dieses Gesetz Realität werden.
Wichtig ist auch – das wurde vom Kollegen Grillitsch erwähnt –, dass es mir jetzt gesetzlich ermöglicht wird, dass ich die einprozentige Milchquotenerhöhung aus dem Health Check, die es jedes Jahr gibt, einbehalten darf. Das werde ich auch tun, weil ich im Milchbereich, wo wir nach wie vor ein Überangebot haben, nicht zusätzlich die Produktion stimulieren will.
Ich komme auch in die rechtliche Situation, die es mir ermöglicht, die Saldierung zu verschärfen. Ich bin gegen eine Abschaffung der Saldierung. Und da Sie immer wieder das Schlagwort vom „kleinen Bauern“ erwähnen: In etwa die Hälfte der österreichischen Milchbauern überliefert. Da sind große Betriebe dabei, aber auch viele, viele kleine Betriebe, die die Milchquote überliefern. Jetzt geht es schon darum, dass wir hier mit Augenmaß vorgehen und einen Ausgleich schaffen, eben eine Saldierung haben, dass zwischen denen, die unterliefern, und jenen, die überliefern, gegengerechnet wird. Diejenigen, die aber extrem überliefern, sozusagen das System ausnützen wollen, sollen stärker zur Kasse gebeten werden. Das passiert jetzt, das können wir jetzt machen, und das ist wichtig.
Meine Damen und Herren, Sie müssen aber auch bedenken, dass das Geld, das von den Milchbauern bezahlt wird, nach Brüssel geht. Wir können das nicht national verwenden; wir haben es versucht, aber das geht nicht. Daher ist es nicht sinnvoll, dass wir die Saldierung abschaffen, sondern wir verschärfen sie für diejenigen, die das System ausnützen. Dazu stehe ich auch.
Viele, viele andere Dinge sind hier im Agrarrechtsänderungsgesetz enthalten. Das ist absolut notwendig, aber es steht Ihnen natürlich frei, das auf Verfassungsrechtlichkeit hin und so weiter zu prüfen. (Abg. Dr. Pirklhuber: Richtig: „viele, viele andere Dinge“!) – Herr Kollege Pirklhuber! Eines sage ich Ihnen: Sie stellen sich hier her und reden von den Kleinbauern und sagen, dass die Förderungen falsch verteilt sind. (Abg. Dr. Pirklhuber: Ja, selbstverständlich!) – Wissen Sie, dass im Schnitt die Biobauern flächenmäßig größer sind als die konventionellen Bauern? – Sie sind flächenmäßig größer! Und ein Sinn des Umweltprogramms ist es, auch flächenstarke Betriebe ins Umweltprogramm zu bekommen (Abg. Dr. Pirklhuber: Das ist ja absurd, was Sie argumentieren!) – wenn ein Betrieb plötzlich keine Entschädigung mehr bekommt, keine Prämie, dann steigt er aus dem Programm aus (Abg. Dr. Pirklhuber: Jetzt werden die Biobauern schon hergenommen, um falsche Agrarpolitik zu argumentieren!) –, und dann ist der nachhaltige, der ökologische Weg, den wir in Österreich gehen, sinnvoll. Zu dem stehe ich auch. Der macht uns einzigartig in Europa, das ist richtig! Aber daher hat es einen Sinn, dass auch flächenstarke Betriebe hier mittun.
Wenn Sie Industriebetriebe erwähnen, die aus dem Agrartopf Prämien bekommen, so hat das auch einen Sinn: weil die zum Beispiel europäischen Zucker nehmen und nicht auf dem Weltmarkt billigen Zucker einkaufen. Das ist genau das Problem bei der Milch: Dort gibt es eine derartige Prämie nicht, und daher kaufen die Industriebetriebe Pflanzenfett aus Übersee, Kokosfett, und verwenden es für die Speiseeis-Produktion.
Beim Zucker haben wir ein derartiges System noch – das läuft im Übrigen jetzt aus –, aber deswegen stehen Industriebetriebe da und bekommen einen Zuschuss, weil sie europäischen Zucker verwenden. Das nützt den Bauern, den Arbeitern, der Wertschöpfung in Österreich und insgesamt in Europa.
In diesem Sinne noch einmal herzlichen Dank an die Regierungsparteien, dass das beschlossen wird – eine wichtige Weichenstellung und große Hilfe für unsere Milchbauern! – Danke. (Beifall bei der ÖVP.)
13.43
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Zu einer tatsächlichen Berichtigung hat sich Herr Abgeordneter Dr. Pirklhuber zu Wort gemeldet. Ich erinnere nachdrücklich an die einschlägigen Bestimmungen der Geschäftsordnung und erteile ihm das Wort. – Bitte.
13.43
Abgeordneter Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber (Grüne): Herr Präsident! Ich habe sehr überlegt, ob das passt, aber wenn ein Minister behauptet, die Opposition würde
nur moralisieren, dann muss ich leider tatsächlich berichtigen, dass hier bei diesem Tagesordnungspunkt drei Anträge der Opposition – von jeder Oppositionspartei ein konkreter Vorschlag – auf der Tagesordnung stehen. (Zwischenrufe bei der ÖVP.) Da können Sie, Herr Minister, auch wenn das eine Wertbeurteilung ist,
13.44
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Herr Kollege Pirklhuber, jetzt haben Sie sogar selbst gesagt, dass das eine Wertbeurteilung ist, und Sie wissen ganz genau, dass eine Wertbeurteilung nicht tatsächlich berichtigbar ist.
(Beifall bei den Grünen für den das Rednerpult verlassenden Abg. Dr. Pirklhuber.)
Als Nächster gelangt Herr Abgeordneter Gahr zu Wort. Freiwillige Redezeitbeschränkung: 2 Minuten. – Bitte.
13.44
Abgeordneter Hermann Gahr (ÖVP): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Dieses Agrarrechtsänderungsgesetz wurde natürlich sehr stark vom Thema „Milch“ geprägt, aber ich glaube, wir setzen mit dem heutigen Schritt ein Signal, dass wir hinter der österreichischen Landwirtschaft und hinter den österreichischen Milchbauern stehen.
Was kann die Politik machen? Was kann die Interessenvertretung machen? Was können die Verarbeitungsbetriebe beitragen? Was kann der Handel beitragen? Was können die Konsumenten beitragen? Wie können wir den Markt verändern? Was können aber vielleicht auch die Bauern da und dort beitragen? – Ich glaube, es ist die Summe von vielen Gründen, die auf den Milchpreis einwirkt.
Wir haben im Ausschuss über die Saldierung diskutiert, und ich habe mir das genau angeschaut, Kollege Pirklhuber. Die Abschaffung der Saldierung wäre einfach unverantwortlich gewesen, weil es dazu geführt hätte, dass 24 000 Überlieferer zur Kasse gebeten worden wären. Ich glaube, die Verschärfung ist der richtige Ansatz.
Das Zweite, das wir nicht beeinflussen können, ist die Gebietskulisse. Ich habe mir ein Bild gemacht: Wir haben derzeit in Europa einen Milchpreis zwischen 18 Cent und 52 Cent in Südtirol. Das beweist eigentlich, dass dieser Milchpreis eine sehr starke regionale Prägung hat. Wir haben den Beweis, dass wir in Österreich derzeit einen Preis zwischen 26 Cent, 38 und 40 Cent für normale Milch – nicht Biomilch – haben.
Ein weiterer Beweis für die regionalen Unterschiede ist, dass wir in Deutschland derzeit ein Billigangebot von 49 Cent pro Liter haben, und in Italien, in Südtirol der Liter Milch 1,15 € kostet. Das beweist eigentlich insgesamt, dass man über das Thema „Milch“ kein Pauschalrezept „drüberstricken“ kann, sondern dass wir uns bemühen müssen, einerseits den regionalen Markt zu fördern, auf der anderen Seite die Produktkennzeichnung anzukurbeln und den Produktnutzen, den wahren Wert der Milch, besser zu vermitteln. (Präsident Neugebauer übernimmt den Vorsitz.)
In diesem Sinne bin ich froh über dieses Paket. Diese 26 Millionen € sind ein kleiner Beitrag, aber ein wichtiger Beitrag, ein Motivationsbeitrag für unsere Milchbauern. Daher bitte ich, dass alle zustimmen. – Danke. (Beifall bei der ÖVP.)
13.46
Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Jannach. – Bitte.
13.46
Abgeordneter Harald Jannach (FPÖ): Geschätzter Herr Präsident! Herr Bundesminister! Wir diskutieren heute das Agrarrechtsänderungsgesetz, und ich muss sagen, allein wie das zustande gekommen ist, das ist schon mehr als hinterfragenswert. Wir
erhalten – das hat Kollege Pirklhuber schon angesprochen – nicht einmal einen Tag vor der Ausschusssitzung ein Konvolut von 40 Seiten, und mir kann niemand erzählen, auch du nicht, lieber Kollege Gaßner, dass ihr zwei das ausverhandelt habt, denn da stehen lateinische Formulierungen drin, die ihr wahrscheinlich nicht einmal versteht – ohne euch da nahetreten zu wollen. (Abg. Großruck: Hallo, hallo, hallo! – Abg. Mag. Gaßner: Ich habe ein humanistisches Gymnasium besucht! – Weitere Zwischenrufe bei der SPÖ.)
Ich wollte Ihnen nicht nahetreten, aber es legt den Verdacht nahe, wenn so ein Konvolut vorliegt, dass das doch nicht von den Abgeordneten selbst verfasst worden ist, sondern aus dem Ministerium kommt. Aber die Krönung ist das, was heute passiert ist: Der Bericht, den wir im Ausschuss diskutieren hätten sollen, der wird heute fünf Minuten vor der Sitzung vorgelesen. Da soll man sich dann ernsthaft damit befassen? – Das ist wirklich eine Frechheit!
Herr Minister, ich muss Sie schon fragen: Wie geht man da mit dem Parlamentarismus um, wie will man da die Opposition ernsthaft einbinden? Wie können Sie verlangen, dass wir einem Gesetz zustimmen, das uns heute fünf Minuten vor dem Ausschuss-Tagesordnungspunkt zur Kenntnis gebracht wird? – Das können Sie wirklich nicht verlangen. Sie können sich für diese Vorgangsweise wirklich schämen, weil das eine Untergrabung des Parlaments ist. (Beifall bei der FPÖ.)
Meiner Ansicht nach gibt es zwei Gründe dafür. Der erste Grund – das wäre ganz schlimm – legt den Verdacht nahe, dass das überheblich ist, dass man sagt, man ignoriert den Ausschuss, man ignoriert das Parlament, das interessiert uns nicht. Der zweite Grund könnte sein, dass es einfach die Angst davor ist, die Sache der Landwirtschaft im Plenum oder im Ausschuss ernsthaft zu diskutieren.
Es hat für mich einen ganz, ganz bitteren Beigeschmack, dass sich die SPÖ auf dieses Marktordnungsgesetz jetzt einlässt, denn, lieber Kollege Gaßner, du hast selbst im Ausschuss gesagt, dass das nicht das gescheiteste Gesetz ist, aber es gebietet eben die Parteiräson und der Koalitionsfriede, dass man dieser Sache zustimmt.
Zwei Stunden für ein Gesetz zur Verfügung zu stellen, das, wie schon Kollege Pirklhuber gesagt hat, 700 Millionen € an Budget umfasst, ist gelinde gesagt eine Frechheit. (Zwischenruf des Abg. Großruck.)
Bezüglich Ausschuss, Herr Minister und Kollege Grillitsch vom Bauernbund, muss ich sagen: Jede Fraktion, die einen Antrag im Ausschuss einbringt, erläutert diesen Antrag. Im Landwirtschaftsausschuss jedoch muss die Opposition von der ÖVP, die dieses Gesetz vorbereitet hat, verlangen, dass sie eine Stellungnahme dazu abgibt. Dann müssen die Ministersekretäre von hinten dem Herrn Minister und den Abgeordneten von der ÖVP die Spickzettel austeilen, damit sie überhaupt über diesen Gesetzesantrag berichten können. Das ist ja haarsträubend!
Deswegen wissen wir auch, dass ihr das nicht selbst gemacht habt, sondern dass das eine Regierungsvorlage ist, und das ist eigentlich ganz schlimm. (Zwischenruf des Abg. Grillitsch.) Man hätte wesentlich mehr Zeit aufwenden können, um das ernsthaft zu diskutieren.
Noch eine Begründung gibt es, warum das nicht von euch gemacht worden ist: Dieses Gesetz gibt dem Minister sämtliche Rechte, alles wird in Zukunft über die Verordnung des Ministers geregelt, und man will diese Sache nicht mehr im Ausschuss des Parlaments und hier im Nationalratssitzungssaal diskutieren.
Zum Inhalt dieses Gesetzes, das da so gelobt wird, dass die Milchkuhprämie jetzt die Rettung der Bauern sein werde, muss ich sagen: Herr Minister, Ihre Rede müssten Sie mit einem Amen abschließen, wenn Sie hier mit dem Weihrauchkessel herauslau-
fen und betonen, wie gut das alles sei. Bitte, das macht nicht einmal 1 Cent pro Liter Milch aus! Wie wollen Sie denn das retten?
Sie, Herr Minister, sagen: Ja, wir werden jetzt den Bauern mit der Milchkuhprämie das Überleben sichern! – Aber dadurch, dass die Mengenregelung in Europa aufgegeben wurde und Sie das in Österreich nachvollzogen haben, nehmen Sie den Bauern Tausende Euro weg und geben ihnen jetzt 50 €, 60 €, 70 € zurück und behaupten, das werde die Bauern retten! (Zwischenrufe der Abgeordneten Grillitsch und Eßl.) Das ist wirklich eine Frotzelei, was Sie hier betreiben. (Neuerliche Zwischenrufe der Abgeordneten Grillitsch und Eßl.) – Sie können noch so viel dazwischenschreien. Bitte gehen Sie dann heraus und reden Sie dann! Sie brauchen nicht herauszuschreien. Das ist ja unhöflich!
Herr Bundesminister Berlakovich, Sie machen nichts im Bereich des Agrardiesels. Frankreich hat noch immer den wesentlich billigeren Diesel; 50 Prozent billiger als in Österreich. Sie schaffen keine Wettbewerbsgleichheit. Sie haben keine Mittel mehr für Agrarinvestitionskredite; in den Ländern werden die Investitionsförderungen gekürzt. (Beifall bei der FPÖ.)
Liebe Freunde von der SPÖ, Sie können nicht die Bauern um des Koalitionsfriedens willen verkaufen, und sie werden mit diesem Marktordnungsgesetz verkauft!
Lieber Kollege Grillitsch, Sie von der ÖVP und vom Bauernbund stecken über die Regierung den ÖBB Millionen hinein, Sie stecken der AUA Millionen hinein, schaffen aber kein Rettungspaket für die heimischen Landwirte. (Abg. Grillitsch: Nicht immer schlafen! – Zwischenruf des Abg. Eßl.) – Wenn Sie herausgehen und sagen: Wir stehen voll hinter den Bauern!, dann hat man schon den Verdacht, dass Sie deswegen hinter den Bauern stehen, damit Sie diesen hier in Wien und in Brüssel leichter in den Rücken fallen können. (Beifall bei der FPÖ.)
Bitte – und das ist wirklich ein Appell auch als Bauer – tun Sie etwas und reden Sie nicht nur! Gehen Sie nicht heraus, um Sonntagsreden zu halten, sondern unternehmen Sie bitte etwas! (Beifall bei der FPÖ.)
13.52
Präsident Fritz Neugebauer: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Binder-Maier. – Bitte.
13.52
Abgeordnete Gabriele Binder-Maier (SPÖ): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Meine Damen und Herren! Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege Jannach, ich gebe Ihnen recht, was die Interessenvertretungen betrifft, dass die manchmal sehr unterschiedlich sind, vor allem im Bereich der Förderungen. Ich gebe Ihnen nicht recht, wenn es darum geht, öffentliche Gelder als zu gering für die Landwirtschaft zu bewerten. Ich denke, da gibt es ein sattes Volumen. (Abg. Eßl: Da gebe ich ihm wieder recht! – Allgemeine Heiterkeit.)
Herr Kollege Jannach, Sie irren auch im Zusammenhang mit meinem Kollegen Gaßner: Nicht nur, dass er ein Kämpfer für Gerechtigkeit in der Landwirtschaft ist, er hat auch in Latein maturiert. – So viel sei dazu gesagt.
Meine Damen und Herren! Kurt Gaßner hat auch im Ausschuss unsere Zustimmung sehr genau definiert, nämlich dass es weitere Gespräche geben muss und dass offene Fragen noch einer Lösung zugeführt werden müssen. Es geht uns um faire Bedingungen und um sichere Arbeitsplätze für die Menschen, die in der Landwirtschaft tätig sind.
Meine Damen und Herren, es wird sich weisen, inwieweit jetzt tatsächlich die Ybbstaler Milchbäuerin, der Ybbstaler Milchbauer von der Beschlussfassung dieses Gesetzes profitieren.
Heute ist zu lesen, dass die europäischen Milchbauern überlegen, einen Streik zu organisieren. Wir haben nach wie vor massive Probleme beim Milchpreis.
Es sind insgesamt noch einige Aspekte offen, die das Agrarrechtsänderungsgesetz noch betreffen. Einige Punkte möchte ich erwähnen: Es ist noch offen, was den freien Zugang zu unseren Wäldern betrifft; Kollege Schopf ist schon darauf eingegangen. Es ist auch noch die Frage offen, wie weit der Faktor Arbeitskraft, wie weit der Faktor Arbeitserschwernis bei der Vergabe von Fördermitteln berücksichtigt wird, weil die Bedingungen sehr unterschiedlich sind, und es ist auch noch die Frage der finanziellen Absicherung der AGES offen.
Dabei geht es um Gesundheit, es geht um die Sicherheit bei den Lebensmitteln und in letzter Konsequenz um den Schutz der Bäuerinnen, um den Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten.
Meine Damen und Herren, gleichwertige Bedingungen und Regelungen werden weiterhin diskutiert bis hin zu einer – auch darüber kann diskutiert werden – Grundsicherung der Bäuerinnen und Bauern in Österreich. Es geht uns tatsächlich nicht um parteipolitisches Geplänkel. Es geht auch nicht um die Interessenvertretungen. Es geht nicht um den Bauernbund, sondern uns geht es um die Bäuerinnen und Bauern.
In diesem Sinne wünsche ich den Bäuerinnen und Bauern Österreichs einen schönen Sommer und hoffentlich eine ertragreiche Ernte. (Beifall bei der SPÖ sowie des Abg. Ing. Schultes.)
13.55
Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Dr. Spadiut. – Bitte.
13.55
Abgeordneter Dr. Wolfgang Spadiut (BZÖ): Herr Präsident! Herr Minister! Meine Damen und Herren! Die derzeitige Entwicklung nicht nur auf dem Milchmarkt, sondern im Lebensmittelbereich allgemein bringt sehr viele landwirtschaftliche und bäuerliche Betriebe in finanziell schwierige Situationen. Darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren.
Die Folge ist, dass vor allem Hofübernahmen immer seltener werden. Meistens werden die landwirtschaftlichen Betriebe dann nur mehr im Nebenerwerb weitergeführt. Allein die Tatsache, dass nur mehr ein kleiner Teil der Landjugend aus landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetrieben kommt, unterstreicht diese Aussage. Vor allem die Hoferben sehen in den hohen Fixkosten eines landwirtschaftlichen Betriebes eine zu große Belastung und entscheiden sich deshalb immer öfter für das Betreiben einer Nebenerwerbslandwirtschaft. Dies führt unweigerlich zu einer extensiven Bewirtschaftung mit all den dazu gehörenden negativen Auswirkungen.
Nicht nur das, diese Personen belasten auch zusätzlich den Arbeitsmarkt. In der jetzigen Zeit der Wirtschaftskrise gewinnt die Landwirtschaft immer mehr an Wertigkeit, bedeutet doch das Betreiben einer eigenen Landwirtschaft einen sicheren Arbeitsplatz. Diese Arbeit müsste aber entsprechend entlohnt werden. (Beifall beim BZÖ.) Es müsste reichen, um eine Familie ernähren zu können. Das ist in der jetzigen Situation aber sicher nicht der Fall.
Zur Abfederung dieser Umstände und als Hilfestellung für Betriebe von Vollerwerbslandwirten soll es zur Einführung eines Sockelbetrages bei der Betriebsprämie kom-
men. Diese Prämien sollen aber nicht zusätzlich das Budget belasten, sondern sie sollen durch gerechte Umschichtungen der Förderungen finanziert werden. Es ist ja nicht nachvollziehbar, dass es Betriebe gibt, die über 500 000 € an Förderungen bekommen. Die anderen bekommen gerade einmal ein Taschengeld. (Abg. Eßl: Warum?) – Ja, das frage ich Sie! Wie sollen das die Bauern wissen, wenn Sie es nicht einmal wissen? (Beifall beim BZÖ.)
In diesem Zusammenhang bringe ich folgenden Antrag ein:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Huber, Linder, Dr. Spadiut, Kolleginnen und Kollegen
„Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft wird aufgefordert, einen Sockelbetrag bei der Betriebsprämie von mindestens 7 000 € für Vollerwerbslandwirte sicherzustellen.“
*****
Danke. (Beifall beim BZÖ.)
13.58
Präsident Fritz Neugebauer: Der Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht.
Ich bitte nur, jeweils der guten Ordnung halber immer hinzuzufügen: „Der Nationalrat wolle“ dies „beschließen“. – Ich gehe davon aus, dass auch das der Wille gewesen ist.
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
des Abgeordneten Huber, Linder Dr. Spadiut, Kolleginnen und Kollegen betreffend Einführung eines Sockelbetrages bei der Betriebsprämie für Vollerwerbslandwirte
eingebracht im Zuge der Debatte über den Bericht des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft über den Antrag 687/A der Abgeordneten Fritz Grillitsch, Mag. Kurt Gaßner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Marktordnungsgesetz 2007, das Marktordnungs-Überleitungsgesetz, das Pflanzenschutzmittelgesetz 1997, das Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz, das Pflanzgutgesetz 1997, das Pflanzenschutzgesetz 1995 und das Forstliche Vermehrungsgutgesetz 2002 geändert werden (Agrarrechtsänderungsgesetz 2009) (293 d.B.)
Die derzeitige Entwicklung nicht nur auf dem Milchmarkt, sondern im Lebensmittelbereich allgemein, bringt sehr viele landwirtschaftliche und bäuerliche Betriebe in finanziell schwierige Situationen. Vor allem Hofübernahmen werden immer seltener und meistens werden die landwirtschaftlichen Betriebe nur mehr im Nebenerwerb weiter geführt.
Vor allem die „Hoferben“ sehen in den hohen Fixkosten eines landwirtschaftlichen Betriebes ein zu große Belastung und Entscheiden sich immer öfter für das Betreiben einer Nebenerwerbslandwirtschaft. Dies führt unweigerlich zu einer extensiveren Bewirtschaftung mit allen dazugehörigen negativen Auswirkungen.
Zur Abfederung dieser Umstände und als Hilfestellung für Betriebe von Vollerwerbslandwirten, soll es zur Einführung eines Sockelbetrages bei der Betriebsprämie kommen.
In diesem Zusammenhang stellen die unterfertigen Abgeordneten folgenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft wird aufgefordert, einen Sockelbetrag bei der Betriebsprämie von mindestens 7.000 € für Vollerwerbslandwirte sicher zu stellen.“
*****
Präsident Fritz Neugebauer: Als Nächster gelangt Herr Abgeordneter Eßl zu Wort. – Bitte.
13.58
Abgeordneter Franz Eßl (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bundesminister! Meine geschätzten Damen und Herren! Leider habe ich jetzt nicht 10 Minuten, um alles zu beantworten. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man darauf hinweist, dass mit diesem Agrarrechtsänderungsgesetz wesentliche Punkte vor allem im Marktordnungsgesetz geändert werden, die wirklich den Bauern zugute kommen.
Wenn wir die Entkoppelung der Direktzahlungen mit einer Härte- und Sonderfallregelung beinhaltet haben, dann soll das Entbürokratisierung bedeuten. Wenn ein Milchpaket geschnürt wird, das 50 Millionen € ausmacht, 26 Millionen € davon pro Jahr für die Milchkuhprämie und durchschnittlich 24 Millionen € für die Ländliche Entwicklung zur Verfügung gestellt werden können, dann ist das natürlich nicht das, womit jetzt die Bauern das große Einkommen erzielen können.
Die Preisentwicklung am Milchsektor jedoch findet in Europa statt – egal, ob wir das wollen oder nicht. Dieses Milchpaket haben wir zusätzlich herausgehandelt. In anderen Ländern hat man gar nichts gemacht. Ich behaupte, es ist ein Unterschied, ob ein Bauer jetzt 1 000 € zusätzlich bekommt oder nicht. (Zwischenruf des Abg. Dr. Pirklhuber.) Das sollte man zur Kenntnis nehmen.
Und man sollte auch bei der Wahrheit bleiben! Herr Kollege Jannach, diese Erläuterungen, diese 40 Seiten haben Sie einen Tag vor der Ausschusssitzung bereits in der Hand gehabt, hätten Sie lesen können. Das, was heute nachgereicht worden ist, ist nur der Beidruck bei den Protokollen. Mehr war das heute nicht. (Abg. Jannach: Seien Sie einfach ehrlich!)
Folgendes noch: Wenn wir die Agrarpolitik in den letzten Jahren und Jahrzehnten so gemacht hätten, wie Sie das wollen, dann gäbe es heute die Hälfte der Bauern in Österreich nicht mehr! (Beifall bei der ÖVP. – Ironische Rufe bei FPÖ, BZÖ und Grünen.)
Schauen Sie sich die Entwicklung in den anderen Ländern an! Wo gibt es diese Strukturen noch? Ein bisschen in Slowenien, in der Schweiz und in Teilen von Bayern, sonst gibt es sie in Europa nicht mehr. Nur weil wir so eine gute Agrarpolitik gemacht haben, haben wir heute die Situation, dass wir noch so viele Bauern haben (Beifall bei der ÖVP), die Leistungen erbringen, die hochqualitative Lebensmittel erzeugen, die unsere Landschaft entsprechend gestalten.
Ich darf mich bei diesen Bäuerinnen und Bauern für diese Leistungen bedanken, und wir kämpfen dafür, dass sie auch in der Zukunft entsprechende Gegenleistungen dafür erhalten. (Beifall und Bravorufe bei der ÖVP. – Abg. Jannach: Amen!)
14.01
Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Linder. – Bitte.
14.01
Abgeordneter Maximilian Linder (BZÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzter Herr Minister! Das Thema kleinbäuerliche Strukturen ist etwas, das uns allen am Herzen liegt, den Bauernvertretern genauso wie auch den Konsumenten. Die wünschen sich kleine Produktionseinheiten, um noch zu wissen, woher das Produkt kommt.
Damit man aber diese kleinbäuerlichen Strukturen aufrechterhalten kann, sind Nischenarbeiten notwendig, ist es notwendig, die Produktion auf kleine, enge Nischen zu konzentrieren, sie zu forcieren, und das ist natürlich arbeitsintensiv. Es verlangt, dass die ganze Familie dazu steht, mitarbeitet, dass die Kinder genauso wie die Hofübergeber weiterhin im Betrieb arbeiten, mit dabei sind und ihren Arbeitsbeitrag leisten. Das heißt, in jedem Betrieb sind es zwei, drei Arbeitskräfte, die eigentlich gratis mitarbeiten, damit man diese Nischenproduktion aufrechterhalten kann und damit man auch weiterhin bestehen kann.
Viele alte Bauernhof-Übergeber entschließen sich, wenn sie übergeben, ihr Ausgedinge ins Grundbuch eintragen zu lassen, es dort festzuschreiben, um abgesichert zu sein. Ich wage es heute zu sagen, dass es bei dieser Entwicklung, bei dieser Förderpolitik, bei der man die Bauern immer wieder motiviert, zu investieren, Ställe zu bauen, wodurch viele, viele Bauern in Verschuldung geraten, glaube ich, richtig ist, dass sie ihr Ausgedinge eintragen und absichern lassen. Leider hat das Eintragen des Ausgedinges aber auch zur Folge, dass sie keine Ausgleichszulage beziehen können, dass sie um die Medikamentenbefreiung umfallen und auch viele andere Möglichkeiten nicht in Anspruch nehmen können.
Was ich dabei vor allem verurteile: Wenn sich dann doch die Situation ergibt und die Bauern dieses Recht, dieses eingetragene Ausgedinge streichen lassen, wenn sie bereit sind, darauf zu verzichten und das aus dem Grundbuch herauszunehmen, so wird das nicht mehr akzeptiert, und sie haben weiterhin mit den finanziellen Nachteilen zu kämpfen. (Ruf bei der ÖVP: Keine Ahnung!) Ich habe jetzt erst wieder von einem Bauern einen Fall berichtet bekommen, der das herausstreichen hat lassen, aber leider die Ausgleichszulage trotzdem nicht beanspruchen kann.
Ich glaube, liebe Kollegen, sollte es uns wirklich etwas wert sein, die kleinbäuerliche Struktur aufrechtzuerhalten, so wäre das ein kleiner Schritt. Vielen kleinen Bauern würde es helfen, dass die Eltern am Hof bleiben, dass sie verzichten, mit dem Ausgedinge in das Grundbuch zu gehen, und so wenigstens über die Ausgleichszulage eine etwas akzeptablere Pension bekommen könnten.
Vielleicht gelingt es uns
in dieser Legislaturperiode, das zur Gänze herauszunehmen und
so der kleinbäuerlichen Struktur zu helfen. (Beifall beim BZÖ
sowie der
Abg. Dr. Moser.)
14.04
Präsident Fritz Neugebauer: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Schönpass. – Bitte.
14.04
Abgeordnete Rosemarie Schönpass (SPÖ): Herr Präsident! Herr Minister! Sehr geehrte Damen und Herren! Dieser vorliegende Gesetzentwurf bringt in erster Linie Änderungen zur Herstellung des Marktgleichgewichtes auf dem Milchsektor. Wie bereits berichtet, liegt uns ein Kompromiss vor. Dieser erste Schritt soll eine erste Maßnahme darstellen.
Die Ursache für den dramatischen Verfall der Milchpreise in Österreich und in der EU liegt in der Überproduktion von Milch. Verhandlungsziel der SPÖ war ein weitaus rigoroserer Eingriff, der die Unterlieferer belohnt und die Überlieferer stärker bestraft hätte. (Abg. Dr. Pirklhuber: Das hätte die Milchbauern ganz umgebracht!) Die Strafzahlungen für Überproduktion an die Europäische Union machen alleine für heuer 8 Millionen € aus. Dieses Geld könnte sinnvoller verwendet werden.
Sehr geehrte Damen und Herren, die betroffenen Bäuerinnen und Bauern benötigen eine rasche, deutlich wirksamere und marktentlastende Mengensteuerung. Die ÖVP war nicht bereit, weiter reichende Maßnahmen zu beschließen. (Beifall des Abg. Huber.)
Ich betone explizit – wir haben das bei der letzten Sitzung des Landwirtschaftsausschusses auch sehr deutlich gesagt –, dass wir von der SPÖ uns eine viel weitreichendere Lösung erwartet hätten (Abg. Gahr: Zum Beispiel?) und dadurch in absehbarer Zeit ein fairer und gerechter Milchpreis möglich geworden wäre.
Unsere Zustimmung zu dem heute vorliegenden Gesetz erfolgt unter Hinweis darauf, dass weitere Gespräche zu den Bereichen Milch, AGES sowie Forste geführt werden. (Abg. Dr. Pirklhuber: Gespräche! Die schauen wir uns an, die Gespräche!)
Sehr geehrte Damen und Herren! Fast könnte man meinen, dass das Milchbauernsterben von der ÖVP gewollt sei. (Beifall des Abg. Huber.) Ich zitiere aus einem Artikel meiner Ortsbauernschaft, in dem es heißt:
„Des ghert amoi gsågt! Zum Nachdenken: Täglich schließen 9 Bauernhöfe mit 97 Kühen in Österreich für immer die Stalltüre.“
Und: „Die Industriebetriebe erhalten die größeren Agrarsubventionen: z.B. 2008: Rauch Fruchtsafthersteller 9,5 Mio. Euro.“ – Das sagt Ihre Bauernschaft.
Deshalb ersuche ich Sie alle: Unterstützen Sie die SPÖ bei ihren Forderungen für unsere österreichische Landwirtschaft und unsere Konsumentinnen und Konsumenten, die gerne bereit sind, österreichische Produkte zu kaufen! – Danke. (Beifall bei der SPÖ. – Abg. Dr. Pirklhuber: Sie könnten sie unterstützen, indem Sie nicht mitstimmen!)
14.07
Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Mayer. – Bitte.
14.07
Abgeordneter Peter Mayer (ÖVP): Herr Präsident! Geschätzter Herr Bundesminister! Ich habe gerade vernommen, die ÖVP unterstützt das Milchbauernsterben, stelle aber somit gleichzeitig fest: Als einziger Milchbauer bin ich hier als Vertreter für die ÖVP, in den anderen Parteien finden sich gar keine Milchbauern im Nationalrat. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Jannach: Das stimmt nicht!)
Geschätzte Damen und Herren, mich freut ganz besonders bei der Umsetzung der Milchkuhprämie, dass hier nicht auf regionale Bedürfnisse eingegangen wird und es sie nur für die Ausgleichszulagenregionen gibt, sondern für alle kleinstrukturierten Milchviehbetriebe in Österreich. Das ist nämlich der Punkt.
Wenn hier vom Abgeordneten Huber unterstellt wird, dass die Milchkuhprämie nicht viel ausmacht für den einzelnen Betrieb, dann gilt das wahrscheinlich auch für einen Milchviehbetrieb, in dem 50 bis 60 Milchkühe gemolken werden. Aber wenn wir uns das anschauen und sehen, dass ein Betrieb mit 10 Milchkühen 600 € direkt erhält oder ein Betrieb mit 20 Milchkühen 1 000 € jährlich zusätzlich durch diese Milchkuhprämie erhält, dann muss man das auch feststellen und anerkennen. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Huber: Aber 10 000 nehmen Sie weg!)
Mich freut ganz besonders, dass sich die anderen Fraktionen auch sehr für die Agrarpolitik interessieren und sich hier einsetzen, aber man muss auch kontrollieren, ob diese Agrarpolitik von den Betroffenen, nämlich von den Bäuerinnen und Bauern, auch akzeptiert wird. Man muss hier irgendetwas suchen, um das feststellen zu können. Ein guter Parameter hierfür ist sicher die Landwirtschaftskammerwahl. Ich nehme hier das Abschneiden der Grünen bei der Landwirtschaftskammerwahl in Oberösterreich her, mit 2,21 Prozent. (Abg. Gahr: Was? Das ist vernachlässigbar!)
Wenn ich merke, dass meine Art der Agrarpolitik nur von 2,21 Prozent der Betroffenen anerkannt wird, dann muss ich mir doch etwas anderes einfallen lassen, meine Damen und Herren. (Beifall bei der ÖVP. – Ruf bei der ÖVP: Bravo! So ist es!)
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, machen wir Agrarpolitik nicht für politische Minderheiten, sondern für unsere Bäuerinnen und Bauern, und stimmen wir diesem Agrarrechtsänderungsgesetz zu! – Danke. (Beifall und Bravorufe bei der ÖVP. – Abg. Dr. Haimbuchner – in Richtung ÖVP –: Bei der nächsten Landwirtschaftskammerwahl wünsche ich Ihnen viel Glück!)
14.09
Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Muchitsch. – Bitte.
14.10
Abgeordneter Josef Muchitsch (SPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Ich gebe zu, ich bin zwar kein Bauer mehr, aber ich darf trotzdem etwas dazu sagen, nachdem ich in meiner Jugendzeit in einer Landwirtschaft gearbeitet habe.
Ja, wir stehen zur österreichischen Landwirtschaft, und ich glaube, mittlerweile sind sich alle in diesem Saal dessen bewusst, dass die Agrarförderungen neu verteilt werden müssen – ich glaube, mittlerweile alle. (Abg. Dr. Pirklhuber: Alle? Nein, alle nicht! Ihr von der Regierung nicht!) Sogar der landwirtschaftliche Sonderausschuss hat in seiner Sitzung am 15. Juni 2009 der EU und ihren Mitgliedstaaten empfohlen, darüber nachzudenken, dass wir ein neues, gerechtes Fördersystem bei den Direktzahlungen brauchen, welches fair, rechtskonform, flexibel und wirksam sein soll.
Das Fördersystem in Österreich muss verändert werden. Ich rufe in Erinnerung: 60 000 Betriebe erzielen keine EU-Betriebsprämie, 120 000 erzielen eine EU-Betriebsprämie. Diese Zahlen hier vorne zeigen (der Redner hat vor sich ein Plakat stehen und verweist auf dieses), dass 35 000 Bauern 48 € im Monat erhalten und sechs Großbauern monatlich im Durchschnitt über 50 000 € erhalten. Es kann mir jetzt keiner in diesem Saal erklären, dass das gerecht und fair ist, dass es unter den Bauern welche gibt, die eine 1300-fach höhere Förderung erhalten! Ich muss sagen, es gibt genug Möglichkeiten, hier eine Umverteilung vorzunehmen. (Abg. Dr. Pirklhuber: Sagen Sie auch, dass Sie jetzt in der Wirtschaftskrise Arbeitsplätze vernichten bei den Milchbauern!)
Lieber Fritz Grillitsch, bei aller Wertschätzung, hier haben wir uns in der SPÖ entschlossen, diesen ersten Schritt mitzugehen, das heißt, hier zuzustimmen, aber weitere Schritte müssen sicherlich folgen. Aus diesem Grund unser Appell an die ÖVP, unser Appell an unseren Landwirtschaftsminister: Wir müssen dazu Gespräche aufnehmen, denn die Leute draußen sehen nicht ein, dass es so etwas wie dieses Fördersystem, das wir derzeit in Österreich haben, überhaupt geben kann! Wir müssen neu umverteilen, wir müssen die kleinen Bauern stärken und darauf achten, dass nicht noch mehr Große die Kleinen schlucken! (Abg. Dr. Pirklhuber: Sie müssen noch weitergehen! Sie müssen das auch an die europäische Ebene weitergeben!)
In diesem Sinne mein Appell und mein Wunsch an die ÖVP, in weitere sinnvolle Gespräche einzutreten, um für die kleinen Bauern eine Verbesserung herbeizuführen. – Danke schön. (Beifall bei der SPÖ sowie bei Abgeordneten von FPÖ, Grünen und BZÖ. – Abg. Dr. Pirklhuber: Ihr habt unsere Unterstützung! – Abg. Jannach: Es gäbe eh eine Mehrheit dafür!)
14.12
Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Mag. Gaßner. – Bitte.
14.12
Abgeordneter Mag. Kurt Gaßner (SPÖ): Herr Präsident! Herr Minister! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Zunächst eine Feststellung zu der immer wieder geäußerten Forderung: Ja, stimmt doch endlich einmal mit uns mit!, an uns, die SPÖ, gerichtet. Es gibt eine Mehrheit in diesem Haus für eine gerechtere Agrarpolitik.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, die SPÖ befindet sich in einer Koalition mit der ÖVP, und wir sind der Meinung, es ist besser, zu reden und zu verhandeln und etwas weiterzubringen als neu zu wählen. Das einmal grundsätzlich. (Beifall bei der SPÖ sowie bei Abgeordneten der ÖVP. – Zwischenrufe bei Grünen und FPÖ.) Noch dazu in Zeiten wie diesen werden Sie uns nicht auseinanderbringen, wiewohl es mir ein großes Anliegen ist, sehr, sehr exakt über manche Dinge zu reden.
Wir haben lange über diese Agrarrechtsänderung verhandelt, und es ist ein eher bescheidendes Ergebnis dabei herausgekommen. Aber wir haben zugestimmt, wir haben – meine VorrednerInnen haben das schon gesagt – aus dem einfachen Grund zugestimmt, um Gelder aus Brüssel für die Landwirtschaft nicht zu verhindern. Das ist eine klare Aussage. Sie würden uns sonst sehr wohl vorwerfen, dass durch unsere Streiterei Gelder in Brüssel liegengeblieben wären. Also das ist damit auf jeden Fall einmal ausgeschlossen.
Es ging im Wesentlichen immer wieder um Milch, Milchmarkt, Milchbauern, Existenzen von Milchbauern, und ich habe mich sehr, sehr häufig mit Milchbauern getroffen, auch in Marbach, wie du schon angeschnitten hast, Herr Kollege Pirklhuber, und ich habe eines nicht verstanden, nämlich warum sich die ÖVP und meine Verhandlungspartner so fest auf ihr Modell versteift haben, ohne dass man nur ein bisschen Bewegung gezeigt hätte. Das habe ich nicht verstanden, bis ich dann – und das muss ich hier leider auch einmal ganz klar sagen – in einem Bauernbund-Strategiepapier einige Dinge nachlesen konnte, die für mich deutlich machten, warum nichts weitergeht. Ich bitte hier schon die ÖVP und vor allem den Agrarklub in der ÖVP, sich das einmal genau anzuhören und zu überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre, über diesen Schatten zu springen.
In diesem Bauernbund-Informationsschreiben heißt es gleich einmal vorab: „Weiters wird der Bauernbund den politischen Druck auf die SPÖ im Parlament erhöhen, um eine rasche Beschlussfassung des Marktordnungsgesetzes zu erwirken.“
Das ist die Ausgangsvoraussetzung. (Abg. Jannach: Druck ausüben? Benötigen Sie das?)
Dann lese ich dort weiter – und das ist spannend, das ist sehr spannend! –: „Ein wesentlicher Eckstein einer ,privatwirtschaftlich organisierten Marktordnung oder marktwirtschaftlich organisierten Mengenmanagements‘ im Sinne unserer Bauern sind Verarbeitungsunternehmen ...“
Das heißt also, hier ist ein Ideologiebruch geschehen. Jetzt plötzlich schickt man die Milchbauern auf den freien Markt. Okay, soll so sein, aber wozu brauche ich dann noch Subventionen, wenn wir diese Milchbauern auf den freien Markt schicken? Ich glaube
aber nicht, dass die Mehrheit der Bauern diesen freien Markt überleben würde. Wir bekennen uns dazu, dass unsere Landwirtschaft, unsere klein strukturierte Landwirtschaft auch weiterhin gefördert werden muss. (Beifall bei der SPÖ.)
Und das Dritte, das ich hier noch gefunden habe, hat mich schon sehr geärgert, muss ich sagen:
„Grundvoraussetzung ist eine geschlossen Vorgangsweise von Bauernbund, Landwirtschaftskammer Österreich und Raiffeisen.“ (Abg. Huber: Das ist ja unglaublich!)
Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Grundvoraussetzung für die weitere Entwicklung und für die weitere Vorgangsweise der Bauernbund, die Landwirtschaftskammer und Raiffeisen sind, dann sind die Verhandlungen natürlich sehr, sehr schwer zu führen. Ich bitte Sie wirklich, sich das zu überlegen.
Ein Wort noch zu Fördergerechtigkeit, Health-Check et cetera. Darüber konnten wir gar nicht mehr reden. (Abg. Dr. Pirklhuber: Eben!) Unser Bundeskanzler hat gefordert, dass das Fördersystem überprüft wird. Daraufhin hat der Herr Grillitsch ihn medial gleich einmal ordentlich zurechtgewiesen, also nicht zurechtgewiesen in koalitionärer Art. Er hat ihm jedenfalls nicht geantwortet, hat ihm Unwissenheit vorgeworfen und was weiß ich sonst noch.
Ich sage euch, ich sage dir, lieber Kollege Grillitsch, der Herr Bundeskanzler hat recht gehabt, denn das Fördersystem gehört überprüft. Und zwar warum? Ich bekomme am 26. Juni ein Schreiben eines Bauern, der im Betreff sagt: Herbeiführung von Gerechtigkeit bei landwirtschaftlichen Subventionen. Dieser Bauer bedankt sich – ich will das hier nicht vorlesen –, aber wissen Sie, was er beiheftet? Er heftet einen Kleinanzeiger aus einer Zeitung bei – ich denke, es sind die Bezirksblätter in Niederösterreich –, und in diesem Kleinanzeiger steht folgende Annonce: Verkaufe 6 Zahlungsansprüche. – Und die Telefonnummer steht auch dabei.
Ist das korrekt, dass wir Steuergelder, die in Förderungen gehen, am Markt verhandeln und kaufen können? Darüber müssen wir reden! Darüber muss gesprochen werden, wenn es uns ein Anliegen ist, dass wir unsere Landwirtschaft so erhalten und die Existenzen unserer Bauern, die Arbeitsplätze unserer Bauern nicht verlieren und gefährden.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, daher bin ich sehr froh darüber, dass auf parlamentarischer Ebene vereinbart wurde, hier weiter zu verhandeln, hier weiter zu reden. Ich glaube, unsere Bauern haben sich das verdient.
Da Kollege Pirklhuber gesagt hat, ich hätte ein Versprechen abgegeben: Ich bin mit der IG Milch laufend im Kontakt. Wir werden sie auch in Zukunft informieren und beiziehen, weil ich nicht glaube, dass die IG Milch so unrecht hat, weil in ganz Europa so gehandelt wird. – Danke schön. (Beifall bei der SPÖ.)
14.19
Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Auer. – Bitte.
14.20
Abgeordneter Jakob Auer (ÖVP): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Da Herr Kollege Gaßner aus einem Strategiepapier der ÖVP (Abg. Mag. Gaßner: Bauernbund!) oder des Bauernbundes hier zitiert hat, darf ich ihn daran erinnern, dass es vor der letzten Wahl ein Strategiepapier der SPÖ gegeben hat, wo man versucht hat, dem Bauernbund Schwierigkeiten zu machen.
Ich kenne ein Strategiepapier der FPÖ, wie Agrarpolitik aussehen sollte. Derartige Papiere gibt es mehr als genug!
Herr Kollege Gaßner, wenn Sie meinen, damit könnte man etwas öffentlich machen, was besonders bemerkenswert wäre, tut es mir wirklich leid, dass Ihr agrarisches Wissen nicht größer ist. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Mag. Gaßner: Raiffeisen ist eh dabei!)
Und der freie Markt, lieber Kollege Kurt Gaßner: Da darf ich schon daran erinnern, dass wir den Bauern den EU-Beitritt sozusagen mit dem freien Markt dargestellt haben. Da gab es eine Staatssekretärin, die meinte, der Konsument werde sich durch den EU-Beitritt einen Tausender im Monat sparen. Das war der berühmte Ederer-Tausender. – Auch schon vergessen, meine Damen und Herren!
Herr Kollege Gaßner, es wurde hier interessanterweise auch ausgeführt, wer aller für die Bauern zur Verfügung stünde. Und da wäre es schwierig zu verhandeln, meintest du, weil hier Raiffeisen, Molkereigenossenschaften und so weiter involviert sind. Es gab doch eine Gruppe von Bauern, die meinten, besonders klug zu sein, als sie im letzten Jahr gekündigt haben (Zwischenruf des Abg. Huber) und jetzt hilferufend, Herr Kollege Huber, zu den Genossenschaften gekommen sind, zu jenen Mitgliedern, die man vorher belächelt, beschimpft und verhöhnt hat, meine Damen und Herren! Jetzt waren die agrarpolitischen Vertreter wieder die Richtigen. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Dr. Pirklhuber: Das stimmt ja gar nicht! Jakob, das ist falsch!)
Agrarpolitische Populismuspolitik kann man bald machen, aber wenn es darum geht, den Bauern zu helfen, da sind dann wieder die agrarischen Vertreter des Bauernbundes, der Molkereien und der Genossenschaften gefragt! (Beifall bei der ÖVP. – Zwischenrufe beim BZÖ.)
Wenn Kollege Muchitsch in seiner Breite als Gewerkschafter hier herauskommt, dann freut mich das – ich freue mich über eine derart geballte Kraft –, aber es wäre schon schön, auch darüber nachzudenken, ob es besonders klug ist, wenn eine Arbeiterkammer besondere Aktionen startet mit der Aussage, dass die Lebensmittel in Österreich nicht leistbar, zu teuer und so weiter sind. Da vergisst man offensichtlich, dass im Bauernstand, im vor- und nachgelagerten Bereich 530 000 Beschäftigte Arbeit und Brot finden! – Wollen Sie die Äste selber absägen, meine Damen und Herren?! (Beifall bei der ÖVP. – Zwischenrufe bei der SPÖ.)
Noch ein Wort zu den Förderungen. Besonders bemerkenswert ist – und da war dann plötzlich Stille; nichts zu hören –, wenn man sieht, welche Firmen, welche Organisationen, auch Naturschutzorganisationen, unter dem Deckmantel der Bauern Förderungen lukrieren. Da höre ich nichts! Schauen Sie einmal nach, wer wirklich die Förderungen kassiert, wofür die Bauern ihren Rücken hinhalten müssen! Selbst die Breitbandförderung für das Klein- und Mittelgewerbe auf dem Land wird unter dem agrarischen Titel abgewickelt! Da sollten Sie applaudieren und nicht ständig alles so negativ darstellen, meine Damen und Herren! (Beifall und Bravorufe bei der ÖVP. – Zwischenrufe bei SPÖ und BZÖ.) – Ihr agrarisches Wissen, Herr Kollege, ist so schmal wie ein Millimeter, also zu wenig.
Herr Bundesminister Berlakovich hat nach langen Krämpfen und Kämpfen – das gebe ich gerne zu –, aber letztendlich vernünftigen Diskussionen zwischen Fritz Grillitsch und Kurt Gaßner doch etwas zustande gebracht, und wir sollten uns freuen, dass zumindest eine kleine Hilfe für die schwer betroffenen Bauern möglich ist. Wir stimmen daher diesem Agrarrechtsänderungsgesetz zu.
Ich sage Ihnen ganz offen: Wenn wir glauben, weiterhin so Agrarpolitik machen zu können, dann täuschen wir uns, wir alle miteinander hier in diesem Haus! (Beifall bei der ÖVP.)
14.24
Präsident Fritz Neugebauer: Als Nächster – Kollege Grosz, darf ich Sie dann zu mir bitten – gelangt Herr Abgeordneter Dr. Pirklhuber zu Wort. – Bitte.
14.24
Abgeordneter Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber (Grüne): Herr Kollege Auer, ich verstehe Ihre Aufregung überhaupt nicht. Sie wissen, ich habe eine gewisse Wertschätzung für Ihren Blick auf die Dinge, den Sie haben, und manchmal ist das sicher auch angemessen und angebracht. Aber ich sage Ihnen eines: Polemik in einer Sache wie dieser ist nicht angebracht, denn da geht es um Existenzen bei den Milchbäuerinnen und Milchbauern, und zwar um Hunderte bäuerliche Familien! (Beifall bei den Grünen sowie bei Abgeordneten des BZÖ.)
Wenn Sie hier die Genossenschaften als die großen Retter hinstellen, dann schauen Sie sich doch einmal die Verträge an! Das sind Knebelungsverträge, wo den Bauern verboten wird, Streikmaßnahmen zu ergreifen. (He-Rufe bei der SPÖ.) – Ja, so schaut es aus in Waidhofen! So schaut es aus in Waidhofen! (Zwischenrufe bei SPÖ und ÖVP.)
Das wird den Bauern von den bäuerlichen Genossenschaften aufs Auge gedrückt – und das wird von Ihnen als Hilfe zu verkaufen versucht! Das ist unwürdig! Das ist sittenwidrig! Also hören Sie auf zu polemisieren gegen Bäuerinnen und Bauern, die für ihre Interessen kämpfen!
Setzen wir uns zusammen an einen Tisch! (Abg. Grillitsch: Was tust du, Pirklhuber?) – Ja, was tu’ ich? Ich versuche etwas Licht ins Dunkel der österreichischen Agrarpolitik zu bringen. Das ist es, Kollege Grillitsch. Das tue ich, und zwar konsequent. (Beifall bei den Grünen sowie bei Abgeordneten des BZÖ. – Abg. Grillitsch: Mit deinen Ideen bist du Vorreiter für eine industrialisierte Landwirtschaft!)
Damit Sie sehen, dass wir die Dinge ernst nehmen: Wir werden in der getrennten Abstimmung sehr wohl sogar einigen Punkten zustimmen, die nicht effizient sind, wie beispielsweise der Milchkuhprämie. Aber warum stimmen wir denen zu? Einerseits, wie Sie richtig sagen, Kollege Gaßner, weil es Mittel sind, die wir von der EU abholen. Das ist richtig, und wir werden daher diesem Punkt auch zustimmen. Der Hauptgrund ist eigentlich der, dass es das Ende jeder Hoffnung ist, wenn man einem Ertrinkenden den Strohhalm aus der Hand nimmt. Das ist aber keine Lösung! Der Minister hat zu Recht gesagt, es ist keine Lösung.
Aber ich erwarte genau das, was Kollege Gaßner hier angekündigt hat, und das ist die Chance und die Herausforderung: Im Herbst ernsthaft zu beginnen, wirklich Agrarpolitik zu machen. Es geht nicht darum, hier im Plenum die Dinge immer wieder zu erklären. Ich weiß, das langweilt manche, das finden manche etwas zu komplex und technisch, aber es ist notwendig, endlich einmal im Ausschuss zumindest Expertinnen und Experten zu hören, und zwar ernsthaft – und nicht husch-pfusch die Dinge zu diskutieren.
Kollege Grillitsch, Sie haben nicht einmal im Ausschuss zu Ihrem eigenen Antrag Stellung genommen, und heute waren es 4 Minuten – 4 Minuten! Da hat Kollege Jannach völlig recht, das ist einfach nicht ernst zu nehmen. Das ist unser Problem mit Ihrer Bauernpolitik. Daher werden wir heute in getrennter Abstimmung einigen Punkten zustimmen, aber in dritter Lesung die Gesetzesmaterie ablehnen. – Danke schön. (Beifall bei den Grünen.)
14.27
Präsident Fritz Neugebauer: Herr Kollege Grosz, Sie haben die Chance, von der Bank aus in Richtung des Kollegen Auer eine kurze Bemerkung zu machen. (Abg.
Grosz: Ich nehme den Ausdruck „Mörder des Bauernstandes“ zurück! – Zwischenrufe bei der ÖVP.) – Kollege Auer, ist das zur Kenntnis genommen? (Abg. Jakob Auer nickt.) – Ich bedanke mich.
Weitere Wortmeldungen hiezu liegen nicht vor.
*****
Bevor ich zur Abstimmung komme, möchte ich, weil sich sehr zeitnah ein doch sehr bedeutendes Ereignis während dieser Debatte abgespielt hat, folgende Mitteilung machen:
Der Herr Bundespräsident hat mit Entschließung einigen Kolleginnen und Kollegen unseres Hauses hohe Ehrenzeichen verliehen. Die wurden jetzt von der Frau Präsidentin überreicht, und ich möchte in unser aller Namen sehr, sehr herzlich gratulieren – ich lasse die Titel weg –: der Frau Abgeordneten Christine Muttonen, Karin Hakl, Ursula Haubner, dem Kollegen Kurt Grünewald, Kollegen Jakob Auer und dem ausgeschiedenen Dr. Erwin Niederwieser. Herzlichen Glückwunsch! (Allgemeiner Beifall.)
*****
Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
Wir kommen zu den Abstimmungen.
Zunächst gelangen wir zur Abstimmung über den Entwurf betreffend Agrarrechtsänderungsgesetz 2009 in 293 der Beilagen.
Hiezu liegt ein Verlangen des Abgeordneten Dr. Pirklhuber auf getrennte Abstimmung vor.
Ich werde daher zunächst über die von dem erwähnten Verlangen auf getrennte Abstimmung betroffenen Teile und schließlich über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes abstimmen lassen.
Wir kommen zur getrennten Abstimmung über Artikel 1 Z 2 hinsichtlich § 8 Abs. 3 Z 5, Abs. 4 und Abs. 5 Z 3 sowie die Artikel 4, 5 und 6 in der Fassung des Ausschussberichtes.
Ich ersuche jene Damen und Herren, die dem zustimmen, um ein Zeichen. – Das ist angenommen.
Ich komme zur Abstimmung über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Entwurfes samt Titel und Eingang in der Fassung des Ausschussberichtes und bitte auch hier um ein zustimmendes Zeichen. – Das ist angenommen.
Wir kommen zur dritten Lesung.
Wer dem Entwurf auch in dritter Lesung zustimmt, den bitte ich um ein Zeichen. – Der Entwurf ist auch in dritter Lesung angenommen.
Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Dr. Pirklhuber, Kolleginnen und Kollegen betreffend Verlängerung der Möglichkeit der ÖPUL-Betriebe, in die Maßnahme Biologischer Landbau einzusteigen.
Wenn Sie dafür sind, bitte ich um ein Zeichen. – Der Antrag bleibt in der Minderheit und ist damit abgelehnt.
Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Huber, Kolleginnen und Kollegen betreffend Einführung eines Sockelbetrages bei der Betriebsprämie für Vollerwerbslandwirte.
Wer dem beitritt, bitte ich um ein Zeichen. – Das ist die Minderheit. Abgelehnt.
Wir kommen nun zur Abstimmung über den Antrag des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft, seinen Bericht 294 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen.
Wenn Sie dem zustimmen, bitte ich um ein Zeichen. – Das ist angenommen.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Antrag des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft, seinen Bericht 295 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen.
Bitte um Ihr zustimmendes Zeichen. – Das ist angenommen.
Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft, seinen Bericht 296 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen.
Wenn Sie dem zustimmen, bitte ich auch hier um ein Zeichen. – Das ist angenommen.
Bevor ich den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufe, möchte ich die Fraktionsverantwortlichen darauf hinweisen, dass wir heute vor Eingang in die Tagesordnung den Tagesordnungspunkt 14 von der Tagesordnung abgesetzt haben. Wenn sich unter diesem Gesichtspunkt etwas an der Rednerliste ändert, dann möge man das bitte rechtzeitig bekanntgeben.
Bericht des Umweltausschusses über die Regierungsvorlage (222 d.B.): Bundesgesetz zur Reduktion der Emissionen fluorierter Treibhausgase (Fluorierte Treibhausgase-Gesetz 2009) (233 d.B.)
Präsident Fritz Neugebauer: Wir kommen zum 10. Punkt der Tagesordnung.
Auf eine Berichterstattung wurde verzichtet.
Die erste Wortmeldung kommt von Herrn Abgeordnetem Ing. Hermann Schultes. – Bitte.
14.32
Abgeordneter Ing. Hermann Schultes (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Wir haben einige Gesetze, die im Zusammenhang mit chemischen Stoffen stehen, heute zur Behandlung – später REACH; jetzt geht es um die fluorierten Treibhausgase. Da gibt es einen Zusammenhang, weil es um die Umsetzung von EU-Richtlinien und um das Einhalten internationaler Vereinbarungen geht.
Fluorierte Treibhausgase, das sind Gase, die wie CO2 wirken, klimaschädlich sind, es sind Fluorchlorkohlenwasserstoffe oder fluorierte Kohlenwasserstoffe. Sie haben eine ähnliche Wirkung wie Stickstoffoxide, CO2, Methan und Schwefelhexafluorid, sind also ebenfalls in dieser „Liga“ der gefährlichen Gase. Und diese sollen in Zukunft besser kontrolliert werden, wofür es entsprechende Ausbildungen geben soll.
Die Frage ist: Ist es möglich, das Freiwerden dieser Gase, das Austreten in die Atmosphäre zu verhindern?
Es scheint nicht sehr wichtig zu sein, aber ich möchte darauf hinweisen, dass die Europäische Union die Verpflichtung übernommen hat, den CO2-Ausstoß beziehungsweise den Ausstoß von klimaschädlichen Gasen um rund 330 Millionen Tonnen zu reduzie-
ren. Alleine der Beitrag dieser fluorierten Treibhausgase macht umgerechnet auf CO2-Äquivalente rund 100 Millionen Tonnen aus, möglicherweise schon bis zum Jahr 2010.
Wenn es uns gelingt, in diesem kritischen Bereich Reduktionen zu erreichen, dann ist der Druck zur Reduktion bei CO2 nicht ganz so groß, obwohl er groß genug bleibt. Deswegen ist dieses komplexe Gesetz wichtig und in der Frage des Klimaschutzes sehr bedeutsam.
Gerade in diesen Tagen haben sich ja die großen Staatenlenker wieder darauf verständigt, das Thema Klimaschutz ernst zu nehmen. 1997 wurde das Kyoto-Protokoll unterschrieben, so lange ist das her, und noch immer gibt es viele, die meinen: „Ach Gott, wir brauchen das nicht so ernst nehmen! Das bildet sich jemand ein. Es ist vielleicht auch gar nicht so wichtig.“
Ich glaube, dass es auch in Österreich noch sehr viele gibt, die diese Meinung vertreten, leider auch in den diversen Spitzengremien. Wenn ich mir anschaue, wie die Reaktionen zum Thema Ökostromgesetz in Österreich sind, dann glaube ich, dass es sowohl in der Arbeiterkammer wie auch in der Industriellenvereinigung noch Leute gibt, die glauben, dass man so wie die Krise auch den Klimawandel irgendwie aussitzen kann und dass dann die Welt wieder schön ist, wenn man sich nur möglichst lange nicht rührt. (Beifall bei der ÖVP.)
Im Augenblick erleben wir, dass so getan wird, als ob mit vielen Milliarden aus des Steuerzahlers Kasse die Krise zugedeckt werden könnte. Ich habe manchmal den Eindruck in dieser Diskussion – diese findet ja eigentlich nicht statt, sind doch nur Blockade und Betonieren das Thema –, dass so mancher glaubt, dass nach der Krise – so wie man es jetzt schon gewöhnt ist – auch die hohen Ölpreise durch neue Ölpreissubventionen ausgeglichen werden können, weil wir ja den Weg in die alternativen Energieformen bis dahin versäumt haben und auf Öl zu jedem Preis angewiesen sein werden.
Ich sage an dieser Stelle: Ich finde das verantwortungslos, und ich glaube, dass wir in der nächsten Zeit die Diskussionstemperatur ein wenig steigern sollten, denn jene, die gerade in der letzten Zeit sehr intensiv die Solidarität des Staates in Anspruch genommen haben, um über die Krise zu kommen, sollten auch über Lösungsmodelle nachdenken, wie wir nach der Krise mit weniger Versorgungsabhängigkeit in Österreich leben und in eigener Wertschöpfung mehr Energie produzieren können. Ein dringender Aufruf. – Danke. (Beifall bei der ÖVP.)
14.36
Präsident Fritz Neugebauer: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Gessl-Ranftl. – Bitte.
14.36
Abgeordnete Andrea Gessl-Ranftl (SPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Minister! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wie bereits vom Kollegen Schultes erwähnt, regelt das Protokoll von Kyoto neben den Treibhausgasen Kohlendioxid, Methan und Distickstoffoxid eine Gruppe von synthetischen Gasen auf Kohlenwasserstoffbasis, die sogenannten fluorierten Treibhausgase oder auch F-Gase genannt. Die Emission dieser F-Gase ist weit geringer als jene der anderen Gruppe, aber die Auswirkung auf das Treibhausklima ist um ein Vielfaches höher.
Der uns vorgelegte Gesetzentwurf soll nun der Durchführung und Überwachung der Europäischen F-Gase-Verordnung in Österreich sowie den Maßnahmen zur Erfüllung der gemeinschaftsrechtlichen Pflichten Österreichs dienen.
Die vermehrten Unwetterkatastrophen, die gerade jetzt wieder unser Land heimsuchen, zeigen uns schon, wie rasant der Klimawandel eigentlich fortschreitet. Die wichtigste Maßnahme im Klimaschutz ist die Verringerung der Treibhausgase, und daher sehe ich es als unser aller Pflicht, zu trachten, dass dieses Gesetz so rasch wie möglich in Kraft tritt. Dass dieses Gesetz dann vollzogen wird und die Übertretungen bestraft werden, ist wohl selbstverständlich. Doch ob die relativ milde Strafbestimmung dann auch definitiv die gewünschte abschreckende Wirkung zeigt, ist zu untersuchen und meines Erachtens bei Bedarf zu assimilieren.
Doch dies allein ist noch immer zu wenig, soll doch das Umweltbewusstsein der Öffentlichkeit noch mehr sensibilisiert werden, wobei das Umweltbewusstsein und das Umweltverhalten meist sehr weit auseinanderklaffen. Unsere Aufgabe als Politikerinnen und Politiker ist es, mit gutem Beispiel voranzugehen, denn auch kleine Beiträge, wie zum Beispiel keine Spraydosen zu kaufen, die F-Gase enthalten, zeigen schon Vorbildwirkung. Wir wissen, dass speziell Konsumentinnen und Konsumenten durch ihr umweltbewusstes Kaufverhalten das Erzeugen von umweltfreundlichen Produkten fördern können.
Werte Kolleginnen und Kollegen, eine EU-weite Reduktion der Emissionen von F-Gasen ist aber meiner Meinung nach nur der erste Schritt in die richtige Richtung bezüglich unseres Klimawandels. Da der Treibhauseffekt bereits weltweit zu verspüren ist, müssten solche Gesetze auch über EU-Grenzen hinaus zum Tragen kommen.
Ich fordere Sie alle noch einmal auf, das Fluorierte Treibhausgase-Gesetz 2009, welches wirklich von großer Dringlichkeit ist, schnellstens zu verabschieden. – Danke. (Beifall bei der SPÖ sowie bei Abgeordneten der ÖVP.)
14.38
Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Tadler. – Bitte.
14.38
Abgeordneter Erich Tadler (BZÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Minister! Hohes Haus! Wir haben den Umweltausschuss verlassen, weil der Umgang mit der Opposition, den die Regierungsparteien an den Tag legen, nicht unbedingt der netteste, der schönste und der erträglichste ist. (Abg. Rädler: Politik ist nicht nett!) Ja, danke, Herr Grillitsch! (Abg. Hornek: Der hat ja gar nichts gesagt!) Im Ausschuss werden die oppositionellen Kontrollrechte mehr oder minder mit Füßen getreten.
Die Umweltverträglichkeit und deren Prüfung ist noch immer Angelegenheit des Umweltausschusses, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Minister.
Wo bitte ist der inhaltliche Zusammenhang, dass der Antrag vom Ausschuss gestellt werden kann und in einem anderen Ausschuss in Verhandlung genommen wird? Durch die Formulierung „im inhaltlichen Zusammenhang“ in der Geschäftsordnung hat der Gesetzgeber zum Ausdruck gebracht, dass ein bloß loser Zusammenhang mit dem auf der Tagesordnung stehenden Verhandlungsgegenstand als Voraussetzung für einen solchen Ausschussantrag gemäß § 27 Abs. 1 der Geschäftsordnung nicht genügt, Herr Hörl. (Abg. Hörl: Beleidigte Leberwurst! – Präsident Neugebauer gibt das Glockenzeichen.) Na heute will er nicht! (Abg. Ing. Westenthaler: Das sollte er zurücknehmen! – Abg. Grosz: Das war genauso wie bei mir!)
Der Verhandlungsgegenstand und der Gegenstand des Ausschussantrages müssen vielmehr in einem inhaltlichen Bezug zueinander stehen. Wissen Sie, Herr Hörl, wer das geschrieben hat? – Der ehemalige VP-Klubdirektor Zögernitz in seinem Kommentar zur Geschäftsordnung, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Sämtliche Novellen zum UVP-Gesetz werden immer im Umweltausschuss erledigt. Sie hatten also, Herr Minister, zwei Jahre lang Zeit, die Umweltverträglichkeitsprüfung neu zu gestalten. Dennoch haben Sie dieses Gesetz in einer Husch-Pfusch-Aktion in einen anderen Ausschuss – meines Erachtens in den falschen Ausschuss – gebracht und durchpeitschen lassen.
Herr Minister, Sie haben gestern gesagt, Interessen prallen aufeinander. Herr Minister, alle Interessen unter einen Hut zu bringen ist sehr, sehr schwierig. Sie aber haben nur die Interessen der Wirtschaftskammer ... (Zwischenruf des Abg. Dr. Matznetter.) – Sie kommen gleich dran beim Dampfkesselgesetz, Herr ehemaliger Staatssekretär! – Herr Minister, Sie haben nur im Interesse der Wirtschaftskammer und der Industrie agiert, hingegen die Interessen der Bürger und deren Sorgen und Ängste nicht beachtet.
Unsere Aufgabe ist es aber, Herr Minister, auch auf die Lebensqualität der Menschen zu schauen und diese zu erhalten.
Nun zur Regierungsvorlage, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Die F-Gase sind 22 000 Mal klimaschädlicher als Kohlendioxid. Wir haben es im Umweltbereich geschafft, die FCKWs aus unserem Leben zu streichen. Die Anwendungsbereiche für fluorierte Treibhausgase sind vielfältig und gehen über die der ozonschädigenden Stoffe noch weit hinaus; das haben wir schon gehört.
Wir werden deshalb diesem Gesetz auch unsere Zustimmung geben, denn wir treten heute schon für die Zukunft ein. (Beifall beim BZÖ.)
14.42
Präsident Fritz Neugebauer: Herr Kollege Hörl (Abg. Hörl betritt soeben den Sitzungssaal), Sie kommen gerade zum richtigen Zeitpunkt herein. Ich gebe Ihnen noch die Chance, mit dem Kollegen wieder friedlich verbal zu verkehren. Ich bekomme dann das Signal der friedlichen Einigung, des Handshakes. Okay? (Abg. Hörl nickt.)
Zu Wort gelangt nun Frau Abgeordnete Mag. Brunner. – Bitte.
14.42
Abgeordnete Mag. Christiane Brunner (Grüne): Herr Präsident! Herr Minister! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer! Der Klimawandel ist in Österreich angekommen. Ich glaube, nach den Ereignissen der letzten Wochen ist es unbestritten: Österreich hinkt gewaltig bei der Erfüllung der Kyoto-Ziele hinterher! Wir liegen um 36 Prozent über den Zielvorgaben und werden da auch mit massiven Strafzahlungen zu kämpfen haben.
Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dass wir diese Fakten endlich ernst nehmen, dass wir sie erkennen und dass endlich auch gehandelt wird. Da reichen schöne Worte und Einzelaktionen nicht aus, sondern da braucht es ein wirklich umfassendes Maßnahmenpaket.
Herr Landwirtschaftsminister, da frage ich Sie schon: Wo bleibt das Klimaschutzgesetz, das Ihr Vorgänger schon in Angriff genommen hat und wo seither nichts weitergegangen ist? Was ist mit der Förderung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien? Da tut sich überhaupt nichts. (Abg. Hornek: Das stimmt ja nicht! – Abg. Grillitsch: Das macht unser Umweltminister!) Das wäre schön! Mir ist es noch nicht aufgefallen, dass das ein Umweltminister ist. (Abg. Hornek: Das ist nicht richtig!)
Was ist mit dem „Sanierungs-Scheck“? – Der „Sanierungs-Scheck“ ist eine effiziente Maßnahme, was den Klimaschutz angeht, eine effiziente Maßnahme, was Konjunkturbelebung angeht, und hilft den Haushalten, um endlich aus der Energiepreisfalle zu kommen.
Deshalb bringe ich folgenden Antrag ein:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Dr. Gabriela Moser, Mag. Christiane Brunner, Kolleginnen und Kollegen betreffend Weiterführung der Konjunkturmaßnahme „Sanierungs-Scheck“
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, die Konjunktur- und Klima-Aktion ‚Sanierungs-Scheck‘ möglichst umgehend, spätestens aber im nächsten Frühjahr fortzusetzen und die entsprechenden Mittel bereitzustellen.“
*****
Die Reduktion von fluorierten Kohlenwasserstoffen ist ein wichtiger Schritt, ist ein erster Schritt, ist aber nur ein sehr kleiner Schritt. In diesem Fall haben wir in Österreich ausnahmsweise einmal sogar strengere Bestimmungen, als sie uns von der EU vorgegeben werden. Ich fordere Sie auf, Herr Landwirtschaftsminister, dass Sie diese strengeren Bestimmungen auch beibehalten. (Beifall bei den Grünen.)
In den meisten Fällen ist es ja so, dass die österreichische Umweltpolitik nur mehr das erfüllt, was uns die EU vorgibt, nur mehr Mindeststandards erfüllt oder sogar säumig ist. Ich denke da etwa an das UVP-Gesetz, das wir vor Kurzem debattiert haben, wo lediglich den Mindestanforderungen entsprochen wurde, oder an die Wasserrahmenrichtlinie, wo wir säumig sind, oder auch an die Novellierung des Immissionsschutzgesetzes-Luft, wo es um die Feinstaubzonen in Österreich geht und wo ein wesentlicher Beitrag zum Gesundheitsschutz der österreichischen Bevölkerung zu leisten wäre.
Das Hinterherhinken und der Umstand, dass lediglich die Mindeststandards erfüllt werden, sind Ausdruck fehlenden politischen Willens. Darin zeigt sich aber ganz offensichtlich auch ein strukturelles Problem, das auch darin zum Ausdruck kommt, dass wir in Österreich seit dem Jahr 2000 kein eigenständiges Umweltministerium mehr haben. Da wundert es mich nicht, wenn die Umwelt Schritt für Schritt unter die Räder kommt. Daher bin ich der Meinung, dass Österreich endlich ein starkes und unabhängiges Umweltministerium braucht. – Danke. (Beifall bei den Grünen.)
14.46
Präsident Fritz Neugebauer: Ist der Entschließungsantrag, Frau Kollegin, der hier avisiert worden ist, eingebracht? (Abg. Mag. Brunner: Ja! – Ruf bei der ÖVP: Von wem? – Abgeordnete von den Grünen besprechen sich.) Gut. Bei anderen Wortmeldungen ist das ja noch möglich. Kein Problem!
Zu Wort gelangt nun Herr Bundesminister Dipl.-Ing. Berlakovich. – Bitte.
14.46
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Dipl.-Ing. Nikolaus Berlakovich: Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Herzlichen Dank für die positiven Wortmeldungen, die die Wichtigkeit dieses Themas unterstreichen. In der öffentlichen Debatte zum Klimaschutz wird oft oder hauptsächlich nur von CO2 gesprochen, tatsächlich sind die Treibhausgase, wie es eigentlich richtiger wäre, viel umfassender zu sehen. Und damit beschäftigt sich auch der Inhalt des vorliegenden Gesetzes.
Die fluorierten Treibhausgase haben eine ungleich schädlichere Dimension, als es das CO2 hat. Sie haben es gehört: Sie sind bis zu 22 000 Mal schädlicher als das Kohlen-
dioxid. Also das bedeutet schon, dass das ein Riesenthema ist. Das wird in der öffentlichen Debatte oft gar nicht dementsprechend gewürdigt, ist aber wichtig, und daher danke ich für die Wortmeldungen, mit denen dieses Gesetz unterstützt wird, und für die Bereitschaft, hier Schritte zu setzen.
Obwohl seitens der Wirtschaft bereits sehr viel gemacht wurde, um die fluorierten Treibhausgase zu reduzieren, kommen sie doch noch vor, beispielsweise als Kältemittel in Kühl- und Klimaanlagen oder als Treibgase in Schaumstoffen und Spraydosen, als Löschgase in Brandschutzanlagen und auch als Isoliergas in Hochspannungsschaltanlagen.
Das heißt, da gibt es nach wie vor einen Anwendungsbereich – nicht nur bei uns, sondern europaweit und weltweit. Daher ist es wichtig, dass wir mit diesem Gesetz die EU-Verordnungen vollziehen und überwachen, die Gegenstand einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung dieser Treibhausgase sind, wo die Reduktion nicht nur der klimarelevanten Treibhausgase, sondern im Speziellen auch der fluorierten Treibhausgase ein klares Ziel ist.
Was auch wichtig und Gegenstand dieses Gesetzes ist, ist der Umstand, dass es Anforderungen gibt an die Qualifikation beziehungsweise Zertifizierung von Personal und Unternehmen, die im Wirtschaftsbereich in der täglichen Arbeit mit derartigen Substanzen zu tun haben. Im Sinne der Gesundheit und des Umweltschutzes ist das ganz wichtig. Das ist ein wesentlicher Teil unserer Umweltpolitik, wo wir schon sehr große Anstrengungen unternommen haben, um unsere Ziele auf den verschiedensten Ebenen zu erreichen. Daher ist auch das für uns ein wesentliches Ziel.
Abschließend noch einmal herzlichen Dank für Ihre konstruktive Mitarbeit und dafür, dass wir hier diesen Weg gemeinsam gehen. – Danke. (Beifall bei der ÖVP sowie bei Abgeordneten der SPÖ.)
14.49
Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Prinz. – Bitte.
14.49
Abgeordneter Nikolaus Prinz (ÖVP): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Sehr geehrte Damen und Herren! Frau Kollegin Brunner, ich darf Ihnen ohne Umschweife sagen: Das Lebensministerium mit den Kompetenzen Landwirtschaft und Umwelt, die gut zusammenpassen, ist bei Minister Berlakovich in sehr guten Händen. Das hat man jetzt auch an der Rede des Ministers gehört, wo er wieder seine Kompetenz unter Beweis gestellt hat.
Am Beispiel der fluorierten Kohlenwasserstoffe sieht man, dass schon seine Vorgänger in den letzten Jahren da schon Wesentliches geleistet haben, weil wir eine weitaus bessere Ausgangsbasis haben, um die Ziele bei der Reduktion zu erreichen, was deshalb sehr wichtig ist, weil die fluorierten Kohlenwasserstoffe wesentlich schädlicher sind als beispielsweise Kohlenmonoxid. (Beifall bei der ÖVP.)
Lieber Kollege Erich Tadler, wir verstehen uns als Sitzreihennachbarn sehr gut, allerdings muss ich dir ehrlich sagen: Du hast heute bei deiner Rede die falsche Platte erwischt, und zwar insofern, als 90 Prozent davon ein völlig anderes Thema betroffen haben, nämlich den Tagesordnungspunkt 13.
Es ist wirklich nicht notwendig, dass man so lange nachtrauert, wenn man selbst die Sitzung verlassen hat. Ich würde sagen: Das nächste Mal sind wieder alle live dabei, und es wird miteinander gearbeitet, dann kommt auch etwas Gutes heraus. In diesem Sinne: nicht gar so lange nachtrauern! (Beifall bei der ÖVP.)
Meine Damen und Herren, ich glaube, dass dieses Gesetz, das uns vorliegt, wirklich ein wesentlicher Schritt in Richtung Verbesserung, ein wesentlicher Schritt in Richtung Klimaschutz ist.
Herr Minister Berlakovich, wir werden diesem gerne zustimmen. (Beifall bei der ÖVP.)
14.50
Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Dr. Pirklhuber. – Bitte.
14.50
Abgeordneter Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber (Grüne): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Es ist durchaus erfreulich, wenn es auch Initiativen gibt, die man gemeinsam tragen kann. Trotzdem, es bleibt dabei: Es geht darum, die Sanierungsrate deutlich zu erhöhen. Wir halten es für notwendig, da verstärkt Anstrengungen zu unternehmen. Reden ist das eine, Kollege Prinz, handeln das andere.
Stichwort: Umweltverträglichkeitsprüfungs-Gesetz und Novelle zum Ökostromgesetz. Letzteres ist wirklich mehr als überfällig. Auf eine Novelle, die wirklich in die Zukunft weist, warten wir bis heute.
Ich bringe jetzt den Entschließungsantrag vollständig ein, den meine Kollegin Brunner schon erläutert hat.
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Dr. Gabriela Moser, Mag. Christiane Brunner, Kolleginnen und Kollegen betreffend Weiterführung der Konjunkturmaßnahme „Sanierungs-Scheck“
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, die Konjunktur- und Klima-Aktion ‚Sanierungs-Scheck‘ möglichst umgehend, spätestens aber im nächsten Frühjahr fortzusetzen und die entsprechenden Mittel bereitzustellen.“
*****
Danke schön. (Beifall bei den Grünen.)
14.51
Präsident Fritz Neugebauer: Der Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht und steht mit in Verhandlung.
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Dr. Gabriela Moser, Mag.a Christiane Brunner, Kolleginnen und Kollegen betreffend Weiterführung der Konjunkturmaßnahme „Sanierungs-Scheck“
eingebracht im Zuge der Debatte über den Bericht des Umweltausschusses über die Regierungsvorlage (222 d.B.): Bundesgesetz zur Reduktion der Emissionen fluorierter Treibhausgase (Fluorierte Treibhausgase-Gesetz 2009) 23 d.B.
Neben der verstärkten Nutzung von erneuerbaren Energiequellen – wie etwa in Form von Ökostrom – ist vor allem auch mehr Energieeffizienz nötig, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Besonders effektiv sind diesbezüglich Aktivitäten im Bereich der
thermischen Sanierung von Gebäuden. Als eine zentrale Konjunkturmaßnahme initiierte die Bundesregierung auf vielfache, langjährige Anregung hin die Aktion „Sanierungsscheck“ für private und betriebliche Objekte. Dabei wird gleichermaßen wirtschafts-/beschäftigungspolitischen und umwelt-/klimapolitischen Notwendigkeiten nachgekommen. Nicht zuletzt auf Grund der aktuellen Studien des IPCC der UNO und von Nicholas Stern sowie der gemeinsamen Klimaschutzziele der EU gewinnen Maßnahmen zur Minimierung des Energieeinsatzes und Verringerung des CO2-Ausstoßes gerade im Baubereich erhebliche Dringlichkeit. Hier kann es im Gegensatz zu anderen Bereichen zu einer klassischen Win-win-Situation kommen: Energie- und Kosteneinsparung bei gleichzeitigem Wirtschafts- und Beschäftigungsimpuls.
Zur Erreichung des Kyoto-Klimaschutzziels sind besonders Maßnahmen zur ökologischen Modernisierung des Wohngebäudebestands notwendig. Die vom Ministerrat bereits im Juni 2002 beschlossene Nationale Klimastrategie hält dazu u.a. fest:
„Der weitaus größte Raumwärmebedarf fällt in Gebäuden für Wohnzwecke an (ca. 75 %). Die Treibhausgas-Reduktionspotentiale können in diesem Bereich sowohl durch ordnungspolitische Maßnahmen als auch durch zielgerichtete Anreizfinanzierungen (Wohnbauförderung) sowie Änderung sonstiger Rahmenbedingungen mobilisiert werden. Um das angestrebte Reduktionspotential von 1,6 Mio t CO2-Äquivalent pro Jahr durch (zusätzliche) thermisch-energetische Sanierungsmaßnahmen erreichen zu können, muss über einen Zeitraum von 10 Jahren die thermisch-energetische Sanierungsrate von (in den 90er Jahren) etwa 1 % auf zumindest 2 % des Altbestandes angehoben, und eine Verknüpfung mit energetischen Verbesserungen/Optimierungen vorgenommen werden. (....)
Als Alternative oder als Ergänzung zum förderungspolitischen Ansatz eignet sich auch der Eingriff über das Ordnungsrecht. So sind von verschärften bauordnungsrechtlichen Wärmeschutzanforderungen bei Sanierung bestimmter Gebäudeteile bzw. für Generalsanierungen der Gebäudehülle längerfristig erhebliche Energieeinsparungen zu erwarten. Anreize für wärmetechnische Sanierungen im zivilrechtlichen Wohnrecht (§ 3 Abs. 2 Z 5 MRG; Ausschussfeststellung zu § 31 Abs. 1 WEG 2002) können ebenso dazu beitragen, die Sanierungsraten auf das für die Erreichung der Klimaschutzziele erforderliche Ausmaß zu erhöhen. Auch im Neubausektor wären die in der Wohnbauförderung bestehenden Anreize im Hinblick auf Ökologie und Energieeinsparung weiter zu verstärken bzw. als allgemeine Förderungsvoraussetzung zu gestatten, und besondere Anreize für Niedrigstenergie- und Passivhäuser zu schaffen.“
Bereits in verschiedenen Regierungsübereinkommen fanden bzw. finden sich Bekenntnisse zur thermischen Sanierung und Steigerung der Sanierungsraten.
Der Raumwärmebereich stellt mit einem Reduktionspotential von ca. vier Mio Tonnen CO2-Äquivalent einen wichtigen Bereich im Hinblick auf die Erreichung des österreichischen Klimaschutzzieles dar.
Neben ökologischen Aspekten sprechen vor allem beschäftigungs- und wirtschaftspolitische Argumente für eine thermische Sanierungsoffensive.
Das WIFO schätzt das Investitionsvolumen im Bereich
der thermischen Sanierung
zur Erreichung des Kyoto-Ziels auf jährlich 530 Mio €. Bis
2010 wären insgesamt 5.109 Mio € notwendig, was einen
Aufwand von 2.044 Mio € an öffentlichen Mitteln allein
für die thermische Sanierung voraussetzt. Dies bedeutet auf Basis der
derzeitigen Förderintensität einen zusätzlichen jährlichen
Förderaufwand von 200 Mio €.
Damit könnte die Sanierungsrate von den derzeitig 0,5 % auf die notwendigen 2 % erhöht, jährlich 750.000 t CO2-Emissionen und 120 Mio € Energiekosten eingespart werden. Außerdem entstünden 11.400 Arbeitsplätze jährlich!
Ein besonders hoher Sanierungsbedarf besteht im Ein- und Zweifamilienhaus-Bereich und bei den Eigentumswohnungen. Dies umfasst zirka 1,1 Millionen Objekte in Österreich. Vor diesem Hintergrund führte die Bundesregierung in ihrem Konjunkturpaket II eine besondere Förderaktion in Form eines einmaligen Sanierungsschecks ein. Dafür wurden 100 Mio Euro bereitgestellt, die zur Hälfte dem privaten und zur anderen Hälfte dem gewerblichen Bereich zur Verfügung stehen.
Im Bereich des privaten Wohnbaus liegen bereits an die 10.000 Anträge vor, wobei eine durchschnittliche Förderung von 4.400 € pro Antrag gewährt wird, sodass Investitionen in der Höhe von durchschnittlich 35.000 € getätigt werden. Laut Aussagen von BM Berlakovich führt jeder Euro an Fördermitteln zu einer Investition von 5 bis 6 Euro. In Summe lösen 100 Mio Euro Bundesförderung eine Investitionsvolumen von 500 bis 600 Mio Euro aus, wodurch dem Budget wieder mindestens 100 Mio an Mehrwertsteuer-Einnahmen zufließen. Damit trägt sich die Sanierungsförderung auch kurzfristig aus Sicht des Staatshaushalts selbst.
Anfang Juli waren bereits die Fördermittel dank der zahlreichen Anträge ausgeschöpft, nicht zuletzt deshalb, da im Bereich der Bundesförderung nicht auf die soziale Situation Rücksicht genommen, sondern die Förderung unabhängig vom Einkommen vergeben wird. Sowohl beschäftigungspolitisch also auch wirtschafts- und umweltpolitisch erwies sich der „Sanierungsscheck“ somit auch in der realen Umsetzung als „Win-win-Projekt“ ersten Ranges.
Die Fortsetzung des entsprechenden Engagements der Öffentlichen Hand und konkret des Bundes ist daher sinnvoll und nötig. Dies umsomehr, als zahlreiche Interessierte bereits einen Energieausweis als Voraussetzung für die Antragstellung anfertigen ließen und mehrere hundert Euro dafür investierten, nunmehr jedoch trotz dieser Vorleistung leer ausgehen würden, wenn keine Fortsetzung erfolgt.
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden
Entschließungsantrag:
Der Nationalrat wolle beschließen:
Die Bundesregierung wird aufgefordert, die Konjunktur- und Klima-Aktion „Sanierungsscheck“ möglichst umgehend, spätestens aber im nächsten Frühjahr fortzusetzen und die entsprechenden Mittel bereitzustellen.
*****
Präsident Fritz Neugebauer: Weitere Wortmeldungen hiezu liegen nicht vor. Die Debatte ist geschlossen.
Wir kommen nun zu den Abstimmungen.
Wir kommen zunächst zur Abstimmung über den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 222 der Beilagen.
Wer für diesen Entwurf ist, den bitte ich um ein diesbezügliches Zeichen. – Das ist einstimmig beschlossen.
Wir kommen zur dritten Lesung.
Wer dem auch in dritter Lesung zustimmt, den bitte ich um ein entsprechendes Zeichen. – Der Gesetzentwurf ist auch in dritter Lesung einstimmig beschlossen.
Ferner kommen wir zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Dr. Gabriela Moser, Kolleginnen und Kollegen betreffend Weiterführung der Konjunkturmaßnahme „Sanierungs-Scheck“.
Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem Entschließungsantrag beitreten, um ein bejahendes Zeichen. – Das ist die Minderheit. Abgelehnt.
Bericht des Umweltausschusses über die Regierungsvorlage (224 d.B.): Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz zur Durchführung der REACH-Verordnung erlassen und das Chemikaliengesetz 1996 geändert wird (234 d.B.)
Präsident Fritz Neugebauer: Wir kommen nun zum 11. Punkt der Tagesordnung.
Auf eine mündliche Berichterstattung wird verzichtet.
Die erste Wortmeldung kommt von Frau Abgeordneter Mag. Brunner. – Bitte.
14.53
Abgeordnete Mag. Christiane Brunner (Grüne): Danke, Herr Präsident! – Die REACH-Verordnung enthält Bestimmungen über Beschränkungen und Informationspflichten, was bestimmte chemische Stoffe angeht. Die Umsetzung dieser Verordnung beziehungsweise wie deren Einbeziehung in das nationale Recht erfolgt ist, ist für uns maximal eine Übergangslösung oder eher eine Notlösung. Im vorliegenden Gesetz wird nämlich nicht sichergestellt, dass Menschen, vor allem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, über die Wirkungen von bestimmten chemischen Stoffen informiert werden; ich spreche da vom Sicherheitsdatenblatt. Auch über die ökologischen Auswirkungen gibt es keine ausreichenden Informationen.
In diesem Gesetz wird im Gegensatz zum vorangegangenen Gesetz auf die Unterstützung des Umweltbundesamtes verzichtet. Und was für mich als Tierschutzsprecherin auch besonders zu kritisieren ist, ist der Umstand, dass durch dieses neue Gesetz alle Chemikalien, auch ältere, noch einmal getestet werden und es daher noch einmal zu diesem Zweck Tierversuche geben wird, und dabei werden Millionen von Tieren draufgehen.
Wir lehnen das ab, und ich bringe daher folgenden Antrag ein:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Mag. Brunner, Freundinnen und Freunde betreffend REACH-Verordnung
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft wird aufgefordert, dem Nationalrat bis Juni 2010 einen Vorschlag für ein novelliertes Chemikaliengesetz vorzulegen. Der Vorschlag soll sich am Begutachtungsentwurf ‚ChemG 2008‘ orientieren und insbesondere im Konsens mit Umweltbundesamt, Bundesarbeitskammer und Allgemeine Unfallversicherungsanstalt erstellt werden.“
*****
(Beifall bei den Grünen.)
Dieses Gesetz ist, wie schon gesagt, maximal eine Notlösung und zeigt wieder einmal, dass es in Umweltfragen in Österreich eher darum geht, Notlösungen zu schaffen, anstatt wirklich konstruktive Umweltpolitik zu betreiben. Daher bin ich wiederum der Meinung: Österreich braucht ein starkes und unabhängiges Umweltministerium! – Danke. (Beifall bei den Grünen.)
14.55
Präsident Fritz Neugebauer: Der Entschließungsantrag wurde ordnungsgemäß eingebracht und steht mit in Verhandlung.
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Mag. Brunner, Freundinnen und Freunde betreffend REACH-Verordnung
eingebracht im Zuge der Debatte über den Bericht des Umweltausschusses über ein Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz zur Durchführung der REACH-Verordnung erlassen und das Chemikaliengesetz 1996 geändert wird (234 d.B.)
Durch die europäische Chemikalienpolitik (REACH-Verordnung) werden Hersteller und Importeure chemischer Stoffe verpflichtet, sich bei der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) zu registrieren. Dazu kommt die Beschränkung bestimmter Stoffe und Zubereitungen und die Einführung eines Zulassungsregimes für besorgniserregende Stoffe. Die Registrierung von Stoffen, der inhaltlich wichtigste Teil der REACH-Verordnung, ersetzt die bisherige Anmeldepflicht für neue Stoffe im Chemikaliengesetz 1996.
Das Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz zur Durchführung der REACH-Verordnung erlassen und das Chemikaliengesetz 1996 geändert wird, implementiert die Vorgaben der europäischen Chemikalienpolitik in das österreichische Recht.
Grundsätzlich ist dabei festzuhalten, dass das gegenständliche Gesetzesvorhaben nur als Übergangslösung betrachtet werden kann und dass einer konsistenten Neuregelung – wie sie etwa als ChemG 2008 vorgeschlagen wurde – entschieden der Vorzug zu geben ist. Im Vorblatt zum Gesetz ist auch festgehalten, dass die Neufassung des Chemikaliengesetzes 1996 eine Alternative zum bestehenden Gesetz dargestellt hätte, aus zeitlichen Gründen soll aber nunmehr das gegenständliche Gesetzesvorhaben verabschiedet werden.
Insbesondere fehlen beim gegenständlichen Gesetzesvorhaben klare Regelungen und Aktualisierungen im Bezug auf das Sicherheitsdatenblatt.
Das Sicherheitsdatenblatt (SDB) stellt in österreichischen (Klein)Betrieben hinsichtlich des Gesundheitsschutzes von ArbeitnehmerInnen und KonsumentInnen und auch hinsichtlich der ökologischen Auswirkungen von Stoffen und Zubereitungen das wichtigste und bekannteste Informationsmedium dar. Klare Regelungen zum Sicherheitsdatenblatt sind daher besonders dringlich. Insbesondere müssen die Bestimmungen zum Sicherheitsdatenblatt an die REACH-Verordnung angepasst werden und die Pflicht zur Weitergabe von Sicherheitsdatenblättern muss ausgedehnt werden. Zum Beispiel sollen Sicherheitsdatenblätter für alle Zubereitungen und Stoffe – und nicht nur für gefährliche – verpflichtend mitgeliefert werden müssen und auch das Arbeitsinspektorat muss Zugang zu den Sicherheitsdatenblättern erhalten. Weiters ist auch die Nennung der Stoffe im Sicherheitsdatenblatt zu normieren.
Im gegenständlichen Gesetzesentwurf ist zur Vollziehung der REACH-Verordnung das Einvernehmen des BMLFUW mit dem BMWFJ vorgesehen. Die alleinige Zuständigkeit
des BMLFUW für jene Bereiche, die die Wirtschaft nicht betreffen, ist im Sinne der Einfachheit und Zweckmäßigkeit zu bevorzugen.
Ein weiterer Kritikpunkt am gegenständlichen Gesetzesvorhaben besteht darin, dass darin, anders als im Entwurf "ChemG 2008", die Unterstützungsfunktion durch das Umweltbundesamt, wie sie auch gemäß dem Umweltkontrollgesetz vorgesehen ist, nicht dezidiert angeführt wird.
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden
Entschließungsantrag:
Der Nationalrat wolle beschließen:
Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft wird aufgefordert, dem Nationalrat bis Juni 2010 einen Vorschlag für ein novelliertes Chemikaliengesetz vorzulegen. Der Vorschlag soll sich am Begutachtungsentwurf "ChemG 2008" orientieren und insbesondere im Konsens mit Umweltbundesamt, Bundesarbeitskammer und Allgemeine Unfallversicherungsanstalt erstellt werden.
*****
Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Hornek. – Bitte.
14.55
Abgeordneter Erwin Hornek (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Frau Kollegin Brunner, wir haben einen hervorragenden Umweltminister, und daher ist Ihre Forderung obsolet. (Beifall bei der ÖVP.)
Sehr geehrte Damen und Herren! Das Chemikalienrecht der Europäischen Union wurde in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt. Da eine gemeinschaftliche Verpflichtung besteht, muss Österreich nachjustieren.
Das Chemikalienrecht der Europäischen Union wurde in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt und verbessert. Die REACH-Verordnung regelt die behördlich überwachte Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe und basiert auf der Eigenverantwortung der Industrie.
Es dürfen nur Stoffe in Verkehr gebracht werden, welche registriert sind. Jeder Hersteller oder Importeur muss für Stoffe, die in die REACH-Verordnung fallen, eine eigene Registriernummer haben. Die Bewertung dieser Stoffe kann auch ein Beschränkungs- oder ein Zulassungsverfahren nach sich ziehen.
Bei Beschränkungen sind einzelne Anwendungen des Stoffes verboten. Bei zulassungspflichtigen Stoffen sind alle Anwendungen des Stoffes verboten, es sei denn, man bekommt eine Zulassung für eine bestimmte Anwendung.
Ziel der REACH-Verordnung ist es, die Verantwortlichen der chemischen Industrie stärker in die Pflicht zu nehmen und Gefahren sowie Risken von gefährlichen Chemikalien durch bessere Datengrundlage zukünftig noch früher erkennbar zu machen und beseitigen zu können.
Die EU hat mit dem Erlass der REACH-Verordnung einen wesentlichen Schritt in der Chemikalienpolitik für den sicheren Umgang mit gefährlichen Stoffen gesetzt. Das Chemikaliengesetz aus 1996 soll vorrangig an die REACH-Verordnung angepasst werden. Das heißt, Regeln, die nicht der Europäischen Union entsprechen, müssen aufgehoben werden, und es sollen einzelne Verwaltungsvereinfachungen erzielt werden. Dazu
ist zu sagen, dass das österreichische Chemikaliengesetz aus 1996 weitgehend bestehen bleibt wie bisher.
Die Besonderheit der REACH-Verordnung ist die Erweiterung der Kommunikation der Lieferkette. Die Anwender erhalten Aufgaben und Pflichten. Sie müssen zum Beispiel Informationen zur Verwertung des Stoffes an den Hersteller melden. Damit kann der Hersteller geeignete Risikominderungsmaßnahmen empfehlen.
Das wichtigste Instrument bei der Kommunikation bleibt das Sicherheitsdatenblatt. Doch künftig muss zusätzlich die Registriernummer angegeben werden. Gegebenenfalls sind Angaben zur Beschränkung beziehungsweise Zulassungspflicht auf dem Blatt aufzuzeichnen.
Sehr geehrte Damen und Herren! Dieser Vorschlag des Chemikaliengesetzes ist EU-konform und dient zur Erfüllung der Gemeinschaftspflichten Österreichs. Ich bitte Sie um Ihre Zustimmung. (Beifall bei der ÖVP sowie bei Abgeordneten der SPÖ.)
14.59
Präsident Fritz Neugebauer: Im Hinblick darauf, dass wir um 15 Uhr mit der Kurzdebatte beginnen, werde ich den nächsten Redner jetzt nicht mehr aufrufen.
Ich unterbreche nunmehr die Verhandlung über den Tagesordnungspunkt 11 zur Durchführung einer kurzen Debatte.
Kurze Debatte über einen Fristsetzungsantrag
Präsident Fritz Neugebauer: Wir gelangen nun zur Durchführung einer kurzen Debatte.
Die kurze Debatte betrifft den Antrag des Abgeordneten Bucher, dem Finanzausschuss zur Berichterstattung über den Antrag 1/A der Abgeordneten Bucher, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), BGBl. Nr. 1/1930 geändert wird, eine Frist bis zum 25. August 2009 zu setzen.
Nach Schluss dieser Debatte wird die Abstimmung über den gegenständlichen Fristsetzungsantrag stattfinden.
Wir gehen in die Debatte ein.
Ich mache darauf aufmerksam, dass gemäß § 57a Abs. 1 der Geschäftsordnung kein Redner länger als 5 Minuten sprechen darf, wobei der Erstredner zur Begründung über eine Redezeit von 10 Minuten verfügt. Stellungnahmen von Mitgliedern der Bundesregierung oder zu Wort gemeldeten Staatssekretären sollen nicht länger als 10 Minuten dauern.
Das Wort erhält zunächst der Antragsteller, Herr Abgeordneter Ing. Bucher. – Ich erteile es ihm. (Ruf bei der ÖVP: „Ingenieur“?! – Abg. Ing. Westenthaler: Hat er von mir geerbt! – Heiterkeit.)
15.01
Abgeordneter Josef Bucher (BZÖ): Herr Präsident! Hohes Haus! Den Ingenieurtitel habe ich von meinem Vorgänger Peter Westenthaler geerbt. (Ruf bei der ÖVP: Einem Ingenieur ist nichts zu schwör!) – Ich gebe ihn gerne wieder zurück: Du hast ihn dir redlich verdient, lieber Peter.
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Bündnis Zukunft Österreich hat am 28. September letzten Jahres einen sehr weitreichenden Antrag eingebracht, der uns
heute gerade in Anbetracht der Bauskandale rund um den Flughafen Wien wahrscheinlich gelegen kommt wie nie zuvor.
Wir haben – das war der erste Antrag in dieser Gesetzgebungsperiode mit der bezeichnenden Aktenzahl 1/A (Abg. Mag. Steinhauser: ... 1a!) – schon damals gefordert, was wir seit vielen, vielen Jahren in diesem Hohen Haus verhandeln und diskutieren, nämlich die Ausweitung der Prüfkompetenz des Rechnungshofes, der uns als Organ des Nationalrates in sehr, sehr vielen Angelegenheiten zu Hilfe kommt – wenn wir entscheidungsreife Beschlüsse fassen, wenn wir Hilfestellungen brauchen, wenn wir Beratung brauchen – und der uns auch bei vielen staatsnahen Unternehmen Einsicht gewährt, was dort an Optimierungen und Besserstellungen zu erfolgen hat.
Wir haben immer sehr viel Vertrauen in den Rechnungshof und vor allem auch in die Führung des Rechnungshofes gehabt, weil wir glauben, dass hier wirklich ein parteiunabhängiger, ein sehr kompetenter und vor allem auch ein sehr anerkannter Rechnungshofpräsident an der Spitze eines Gesamtunternehmens steht, das österreichweit einen sehr guten Ruf genießt.
Wir wollen diese Kompetenz des Rechnungshofes weiter ausdehnen in Richtung aller Unternehmen, an denen die Republik Österreich Anteile hält. Derzeit ist es ja nur möglich, Betriebe mit einem Staatsanteil von 50 Prozent zu prüfen. Dieser Prozentsatz soll auf 25 Prozent herabgesetzt werden, damit wir auch Betriebe und ausgelagerte Unternehmen prüfen können, die vor allem eine sehr große Unternehmensbedeutung haben und daher auch im Interesse einer entsprechenden Prüfung stehen.
Man darf hier, so glaube ich, eines niemals außer Acht lassen, nämlich dass der Rechnungshof nicht nur prüft, sondern auch berät, und diese Beratungsleistung, die sehr hochstehend ist, ist zudem kostenlos; das sage ich auch in Richtung der Bürgermeister, weil es ja im Sektor des BZÖ, der Grünen und auch der FPÖ unser aller Wunsch ist, dass wir diese Prüfkompetenz auch auf die Gemeinden ausdehnen (Beifall beim BZÖ), weil es Sinn macht, dass wir quer durch Österreich – von Vorarlberg bis ins Burgenland – auch die Gemeinden untereinander vergleichen können, gemeinsame Benchmarks setzen, um den Entscheidungsträgern auf der Ebene der Gemeinden die Gewissheit zu geben, dass ihre Gemeinde gut geprüft ist, jederzeit geprüft werden kann und natürlich auch eine gewisse Vergleichbarkeit vorhanden ist.
Das würde in Summe auch die Entscheidungen auf Gemeindeebene erleichtern und dazu beitragen, dass vielleicht der eine oder andere Unsinn, der in der Vergangenheit passiert ist – ich denke nur an die Cross-Border-Leasing-Geschäfte –, rechtzeitig unterbunden und erst gar nicht mit dem Geld der öffentlichen Hand, mit dem Geld der Steuerzahler spekuliert würde, meine sehr geehrten Damen und Herren. (Beifall beim BZÖ. – Zwischenruf des Abg. Hörl.)
Das wäre ein kleiner Auszug unserer Vorsätze, die wir hier im Hohen Haus schon seit einigen Jahren haben, was die Ausweitung der Prüfkompetenzen anlangt. Und gerade jetzt, in den letzten Wochen, ist es ja ruchbar geworden, warum der Ruf nach dem Rechnungshof so viel Sinn macht, so dringend und notwendig ist, gerade wenn man sich betreffend das Projekt Terminal Skylink am Flughafen Wien anschaut, was dort alles in den letzten Jahren passiert ist, was dort rot-schwarze Parteigünstlinge und Funktionäre an Geld verschleudert haben: Nachdem es einen Kostenvoranschlag von 400 Millionen € gegeben hat, ist die derzeitige Zwischenbilanz irgendwo bei 900 Millionen gelegen! Das ist also der zweite Wirtschaftskrimi nach dem AKH-Skandal, der zweitgrößte Bauskandal der Zweiten Republik.
Und da ist es wichtig, dass der Rechnungshof einen Auftrag von der öffentlichen Hand erhält (Beifall beim BZÖ – Zwischenruf des Abg. Jury), dort einmal Einschau zu halten, dort einmal auch die Verantwortlichen herauszufiltern, denn die ersten Reaktionen ha-
ben ja gezeigt, dass sich geradezu niemand verantwortlich fühlt: Der Herr Häupl nicht, der Herr Pröll nicht! Beide tun so, als hätten sie keinen Einfluss auf das Unternehmen, wo doch jeder weiß, dass sie nicht nur den Vorstand, sondern auch den Aufsichtsrat bestellen. (Zwischenruf des Abg. Schopf.)
Es gibt etwas in diesem Unternehmen, das geradezu außergewöhnlich und einmalig ist, nämlich dass man einen Vorstand beschließt und bestimmt, ohne dass man den Aufsichtsrat befragt. – Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist wirklich einmalig in der Unternehmensgeschichte! Da frage ich mich, wo da die ÖVP bleibt, wo der Aufruhr in der ÖVP bleibt, gerade bei jenen, die immer behaupten, dass sie Wirtschaftskompetenz besitzen. – Das sind Dinge, wo man sich wirklich fragen muss, ob in dieser Republik noch alles im Lot ist.
Wir haben auch den Appell der SPÖ verstanden, der in die Richtung gegangen ist, dass Sie an die Vernunft der Opposition appellieren, wir sollen doch nicht das eine mit dem anderen junktimieren. – Ich stelle jetzt den Zusammenhang mit dem Amtshilfe-Durchführungsgesetz her, bezüglich dessen wir gesagt haben, dass das, was darin passiert, nämlich dass wir ausländische Steuerbetrüger, Steuersünder schützen, nicht durchdacht ist.
Dieses Gesetz ist voller Lücken, ist sehr
mangelhaft! Wir haben das einige Male aufgezeigt, wir haben auch unsere
Bedenken geäußert, im Finanzausschuss sehr seri-
ös und sehr sorgfältig geprüft, aber vonseiten der
Regierungsparteien ist in keiner Weise irgendwann einmal ernsthaft der Weg
beschritten worden, jene Bedenken, die wir gehabt haben, entsprechend zu
recherchieren und zu überprüfen. So kann man einfach nicht mit den
Bedenken der Opposition umgehen, wenn man will, dass die Opposition einem
solchen Gesetz die Zustimmung gibt! (Beifall beim BZÖ sowie des Abg.
Mag. Kogler.)
Wenn man sich die letzten Entscheidungen und die letzten Handhabungen der Regierungsparteien anschaut, wie Sie mit uns, mit der Opposition, umgehen – ich erinnere nur an den Unterausschuss des Rechnungshofausschusses, in dem wir die AUA und die Zustände rund um die AUA behandeln wollten –, kann man nur sagen: Das ist nicht redlich, das ist nicht sorgsam! Es ist auch nicht verantwortungsvoll, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn man hier im Hohen Haus das in der Geschäftsordnung begründete Ziel ableitet, einen „kleinen Untersuchungsausschuss“ einrichten zu dürfen und dann vonseiten der Regierungsparteien ständig geblockt wird und von diesen ständig alles unternommen wird, damit es zu keiner Aufklärung kommt.
Wir haben versucht, die wirklichen Entscheidungsträger, die hinter diesem AUA-Debakel stehen, vorzuladen (Abg. Mag. Kogler: Richtig!), und es sind alle Personen, die wir vorladen wollten, immer wieder von den Regierungsparteien abgeblockt worden. (Abg. Mag. Kogler: Die wichtigen!)
Da muss man sich wirklich fragen: Wo bleibt denn Ihr Gewissen, wenn es darum geht, Licht ins Dunkel zu bringen? – Sie wollen alles vertuschen, alles verheimlichen, alles zudecken! (Abg. Hornek: Herr Kollege, die waren doch alle da!) Das kann ja nicht im Interesse eines gewählten Nationalratsabgeordneten sein! Es muss doch auch in Ihrem Interesse sein, dass Sie die Dinge aufklären wollen, beispielsweise bei der AUA, beispielsweise jetzt beim Skylink. Wir sollten doch im Interesse der Anleger handeln, wir sollten im Interesse der Steuerzahler handeln. Diese haben ein Anrecht darauf, zu erfahren, was alles hier passiert ist, meine sehr geehrten Damen und Herren! (Beifall beim BZÖ.)
Das ist ein Riesenskandal, der hier abläuft (Zwischenruf des Abg. Hornek), betreffend den man sich schon fragen muss – wenn 20 Prozent die Stadt Wien, 20 Prozent das Land Niederösterreich hält, insgesamt 40 Prozent, der Beherrschungstatbestand vor-
handen ist –, warum Sie nicht einwilligen, dass wir den Skylink endlich prüfen, warum Sie nicht einwilligen, dass wir alle staatsnahen Unternehmen ab einem Anteil von 25 Prozent einer Rechnungshofkontrolle unterziehen.
Das ist doch nur im Interesse der Anleger! Jeder von Ihnen, der ein Aktienpaket irgendeines Unternehmen besitzt, wird von sich aus das natürliche Interesse haben, dass in diesem Unternehmen alles richtig läuft, dass auch die Kontrolle funktioniert, dass der Vorstand entsprechend redlich nach kaufmännischen Gesichtspunkten handelt. Das ist doch im ureigensten Interesse der Anleger!
Damit schützen wir die Anleger, damit befruchten wir auch den Drang der Anleger, in die Unternehmen zu investieren, und vor allem geht es darum, dass wir, sobald öffentliche Mittel zum Einsatz kommen, sobald Steuermittel zum Einsatz kommen, auch den Steuerzahler schützen und ihm die Gewähr geben, dass in den jeweiligen Unternehmen die Dinge richtig laufen. (Beifall beim BZÖ.)
Daher bitte ich Sie, diesem Fristsetzungsantrag Ihre Zustimmung zu geben, damit wir dem Rechnungshof endlich jene Legitimation zukommen lassen, die dieser braucht, damit er nicht jahrelang um das Recht streiten muss, den Flughafen Wien zu prüfen. – Danke sehr. (Beifall beim BZÖ.)
15.10
Präsident Fritz Neugebauer: Die Redezeit der nunmehr zu Wort gemeldeten Abgeordneten beträgt jeweils 5 Minuten.
Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Mag. Lapp. – Bitte.
15.11
Abgeordnete Mag. Christine Lapp (SPÖ): Herr Präsident! Hohes Haus! Herr Klubobmann Bucher, den Vorwürfen, die Sie vorhin erhoben haben, nämlich dass die Regierungsparteien nur vertuschen und verdecken wollen und eigentlich kein Interesse daran haben, wie das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler eingesetzt wird, möchte ich Folgendes entgegenhalten (Zwischenruf des Abg. Petzner): Betreffend das Skylink-Projekt des Flughafens Wien haben sich gestern hier im Hohen Haus alle Parlamentsfraktionen, alle Abgeordneten darauf geeinigt, dass wir im Rahmen der Gesetze tätig werden und dass die Frau Präsidentin des Nationalrates an die Vorstände der Flughafen Wien AG ein Schreiben richtet (Zwischenruf des Abg. Dr. Königshofer), damit der Rechnungshof eventuell die Möglichkeit zur Prüfung bekommt. (Präsidentin Mag. Prammer übernimmt den Vorsitz.)
Herr Bucher, Sie setzen ja immer auf Ihre wirtschaftlichen Kenntnisse! Diese Kenntnisse müssten Sie auch dann einsetzen können, wenn Sie sich anschauen, wie Aktiengesellschaften et cetera organisiert sind. (Abg. Bucher: Na, wie sind sie denn organisiert?) – Das ist der eine Punkt.
Weiters möchte ich den Vorwurf ansprechen, dass im Unterausschuss des Rechnungshofausschusses die wirklichen Entscheidungsträger nicht gehört, weil nicht geladen werden konnten. (Abg. Mag. Kogler: Stimmt ja!) Ich frage Sie: Wir hatten Michaelis, Ötsch, Malanik, Bierwirth, einige Professoren, einen Belegschaftsvertreter ... (Abg. Bucher: Das sind Entscheidungsträger? – Abg. Mag. Kogler: Wo war ...?!) – Wer sind für Sie die wirklichen Entscheidungsträger?
Und vor allem: Wenn Ihre Kolleginnen und Kollegen vom BZÖ im Unterausschuss immer nur mit den Anträgen und den Ladungen gewunken haben und, wenn Sie diese Ladungen nicht erfüllt bekommen haben, davongestürmt sind und keine Mitarbeit im Ausschuss geleistet haben, dann, denke ich mir, sollten Sie auch auf eine seriöse parlamentarischer Arbeit hinwirken, dann würden wir mehr miteinander reden können! (Beifall bei der SPÖ. – Abg. Neubauer: Wollen Sie damit sagen ...?!)
Ich möchte zum Thema kommen, und ich denke mir, bei diesem Punkt, dass die Prüfungskompetenzen des Rechnungshofes ausgeweitet werden sollen, haben wir eine sehr große Bandbreite. Der Antrag, den wir hier heute debattieren, behandelt den Umstand, dass der Rechnungshof in öffentliche Unternehmen mit – jetzt – einem Anteil der öffentlichen Hand ab 50 Prozent, dann mit 25 Prozent, gehen kann. Wir haben auch noch die Bandbreite bei den Gemeinden, bei den EU-Förderungen und bei den Agrarförderungen.
Ich meine, dass wir hier in diesem Haus uns alle einig sind, dass die Arbeit des Rechnungshofes, seine Prüfungen, eine wichtige Arbeit ist, um Vorgänge offenzulegen, um Transparenz aufkommen zu lassen, um die Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit in der Verwaltung, in Betrieben et cetera anzuschauen.
Dass die Senkung der notwendigen Höhe der Anteile der öffentlichen Hand auf 25 Prozent ein wichtiges Anliegen ist und auch vonseiten des Rechnungshofpräsidenten immer wieder aufs Tapet gebracht wird, ist hier gleichfalls bekannt. Dennoch ergeben sich derzeit einige Hürden: Ich möchte Richard Schenz zitieren, der in der heutigen „Presse“ Folgendes gemeint hat:
„Jede öffentliche Diskussion über ihr Geschäftsgebaren (...) schade aber den börsennotierten Unternehmen und damit dem Finanzplatz Wien.“
Ich denke, auf dieses Argument muss man eingehen können (Zwischenruf des Abg. Mag. Kogler), denn uns ist wichtig, dass darauf geachtet wird, dass der Rechnungshof nach einem gesetzlichem Auftrag, den wir ihm erteilen, tätig werden kann.
Nach der Wirtschafts- und Finanzkrise ist es so, dass sich Investoren ein bisschen schüchterner und zurückhaltender verhalten. Das ist schade, aber es wäre auch eine Chance für Unternehmen, eine zusätzliche Bestätigung zu bekommen, wenn der Rechnungshof die Möglichkeit einer Prüfung bekäme, denn Prüfungen des Rechnungshofes können andere Perspektiven bringen. Dies wäre ein zusätzlicher Pluspunkt und auch ein Wettbewerbsvorteil durch ein sozusagen parlamentarisches, demokratisches Qualitätssiegel.
Die Diskussionen werden uns bei der Verwaltungsreform begleiten, die Diskussionen werden uns in unserer weiteren politischen Arbeit begleiten, und ich denke, in Verantwortung für den Wirtschaftsstandort und in Verantwortung für das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler müssen wir uns auch ausreichend Zeit dafür nehmen, alle Argumente abzuwägen und eine gute Entscheidung zu treffen. (Beifall bei der SPÖ.)
15.16
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Als nächster Redner gelangt Herr Abgeordneter Gahr zu Wort. 5 Minuten Redezeit. – Bitte.
15.16
Abgeordneter Hermann Gahr (ÖVP): Frau Präsident! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Der heutige Fristsetzungsantrag des Kollegen Bucher ist, denke ich, ein Antrag, um wieder einmal einen Wunsch in Erinnerung zu rufen und einen Anlass dazu zu benützen, hier etwas einzufordern. Kollege Bucher, Sie haben von sehr viel Vertrauen in den Rechnungshof gesprochen. – Ja, auch wir haben sehr viel Vertrauen in den Rechnungshof: Der österreichische Rechnungshof genießt einen außerordentlich guten Ruf! Wir haben auch sehr viel Vertrauen in das derzeitige System. (Abg. Bucher: ... Vorstände am Flughafen auch!)
Wenn Sie sich fragen, ob in der Republik alles im Lot ist, so meine ich, dass in Österreich die öffentliche Finanzkontrolle – beginnend bei den Gemeinden über Gemeindeverbände über Bezirksverwaltungsbehörden, Länder, Landesrechnungshöfe bis zum Bundesrechnungshof – funktioniert. Wir hier haben den Auftrag, dass die Kontrolle
funktioniert, und der Rechnungshof prüft derzeit 4 600 öffentliche Unternehmungen, Gemeindeverbände, Länder, Kammern, Ministerien, Sozialversicherungen und so weiter.
Insgesamt hat der österreichische Rechnungshof – Kollege Kogler wird mir das bestätigen; wir waren ja einmal bei einer internationalen Tagung – auch international ein sehr hohes Ansehen, und wir sollten hier nicht immer den Rechnungshof mit unnötigen Diskussionen ins Blickfeld stellen, sondern sollten ihn arbeiten lassen und sollten die Kontrolltätigkeiten zulassen. (Beifall bei der ÖVP.) – Es gibt nichts zuzudecken, es gibt keinen Skandal und es gibt auch keinen Anlassfall, hier von heute auf morgen tätig zu werden! (Abg. Jury: Skylink!)
Betreffend Skylink wurde gestern ganz klar der Auftrag mitgegeben, und alles wird seinen Lauf nehmen. Ich denke, auch diese Frage Skylink wird gelöst und einer Kontrolle zugeführt werden. Hier hat der Rechnungshof die Möglichkeit, aber wir müssen das ja nicht unbedingt beantragen.
Betreffend diese zusätzlichen Wünsche und Prüfkompetenzen, Kollege Bucher, möchte ich einmal sagen, dass ich glaube, dass wir es in Österreich derzeit so haben, dass wir alle eine Verwaltungsreform erwarten, und ich meine, jeder von uns will mehr Effizienz und weniger Bürokratie.
Kollege Bucher, ich schätze dich eigentlich sehr ob deiner Wirtschaftskompetenz, aber diese Frage habt ihr zu wenig oder überhaupt nicht aus dem Blickwinkel der Wirtschaft betrachtet, denn ich glaube, es ist so, dass wir in Österreich einen sehr erfolgreichen Weg der Privatisierungen gegangen sind, dass wir in Österreich einen Mix aus Privat und Staat haben – und genau hier fängt die Sensibilität bei diesem Thema an.
Der Rechnungshof prüft vielleicht, aber der Umgang mit und das Umfeld von Prüfungen ist der zweite Schauplatz. (Zwischenruf des Abg. Bucher.) Und was kann der Staat verändern, Kollege Bucher, wenn er 25 Prozent besitzt und der private Eigentümer 75 Prozent? – Bitte? (Abg. Bucher: Aber in Tirol habt ihr das ja! Auf Landesebene habt ihr das ja!) – Ja, aber diesbezüglich haben die Länder die Möglichkeiten, und ich glaube, es gibt überhaupt keine Möglichkeit, dass man damit Missstände aufzeigt.
Es ist ja auch da wieder so: Wenn Investoren abgeschreckt werden, wenn Privatisierungserlöse geschmälert werden oder börsennotierte Unternehmen Schaden erleiden, ich glaube, das können wir alle nicht verantworten!
Die ÖVP hat hier eine klare Position und eine klare Verantwortung: Wir stehen zum Wirtschafts- und Arbeitsstandort Österreich! Wir sind eine Partei, die den Mix aus Privat und Staat immer sehr klar in den Mittelpunkt gestellt hat, uns geht es um eine nachhaltige Wirtschaftspolitik.
Es gibt einen ganz unverdächtigen Zeitzeugen, Professor Korinek. Dieser sagt: Der Eigentümerschutz der privaten Mehrheitseigentümer ist zu berücksichtigen und muss gewahrt bleiben. – Zitatende.
Ich glaube, darum geht es in dieser Frage. Es ist auch eine Frage, wie man Wettbewerb öffentlich darstellt und wie man insgesamt solche Rechnungshofberichte öffentlich darstellt. Es geht einfach darum, dass die mediale Darstellung sehr oft auch Gefahren mit sich bringt.
Die ÖVP lehnt diesen Fristsetzungsantrag also ab. Es gibt dazu jetzt keinen Anlass, und für Schnellschüsse stehen wir nicht zur Verfügung. Wir geben in der derzeitigen Situation der Wirtschaft Rückhalt und Vertrauen und auch einen gewissen Spielraum. Ich meine, es ist wichtig, dass das Zusammenspiel insgesamt funktioniert.
Abschließend möchte ich noch sagen: Ich stehe auch dafür, dass beim Thema Skylink die Vorstandsdirektoren gut beraten wären, wenn sie mit dem Rechnungshof kooperieren würden. Aber insgesamt, glaube ich, sind der Prüfauftrag und die Prüfkompetenz in Österreich in guten Händen.
Wir stehen zum Rechnungshof und zum derzeitigen System. – Danke. (Beifall bei der ÖVP.)
15.20
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Dr. Haimbuchner. Redezeit: 5 Minuten. – Bitte.
15.20
Abgeordneter Mag. Dr. Manfred Haimbuchner (FPÖ): Frau Präsidentin! Werte Damen und Herren Kollegen! Hohes Haus! Herr Kollege Gahr sagt, die ÖVP stehe zum Rechnungshof. – Ja, das ist in Ordnung, wenn Sie zum Rechnungshof stehen, aber es ist unverständlich, warum Sie da nicht mitstimmen. Das ist wirklich unverständlich! (Beifall bei FPÖ und BZÖ.)
Ich weiß überhaupt nicht mehr, welche Eiertänze Sie in Zukunft noch aufführen werden.
Wenn Sie fragen, was es bringen soll, wenn man zulässt, dass die Rechnungshofkontrolle auch bei einer 25-Prozent-Beteilung möglich ist, muss ich sagen: Also bis zu 25 Prozent ist der Euro des Steuerzahlers nichts wert, ab 50 Prozent ist er mehr wert, denn da darf man dann kontrollieren?! (Abg. Hornek: Das ist ja Unsinn! Sie haben keine Ahnung!) Diese Logik müssen Sie mir wirklich einmal erklären. Das ist keine Logik, das ist nach dem Motto: Die Erde ist eine Scheibe.
So kommt mir auch die Argumentation vor, wenn man vom Wirtschaftsstandort Österreich spricht. (Zwischenruf des Abg. Dr. Bartenstein.)
Ich bin überhaupt der Meinung, schauen Sie sich einmal andere Länder an. Es gibt ja in anderen europäischen Staaten Modelle, bei denen ab einem Euro Beteiligung öffentliche Kontrolle stattfindet. Sie werden doch nicht behaupten, dass das alles wirtschaftsfeindliche Staaten wären.
Sie fürchten sich offensichtlich vor dem Rechnungshof. (Abg. Gahr: Überhaupt nicht!) Aber die Rechnungshofberichte sind sehr neutral, sie sind sehr fair gehalten und enthalten eine Reihe von Empfehlungen, die übernommen werden sollten.
Sie reden ständig von der Verwaltungsreform. Ich gebe da eigentlich Herrn Van der Bellen recht, wenn er sagt, dass er das von der Verwaltungsreform bald nicht mehr hören kann. Ich verstehe das, denn Sie hätten in den vergangenen Jahren eine Zweidrittelmehrheit gehabt – man brauchte ja vor allem eine Staatsreform, eine Aufgabenreform –, aber Sie haben sie überhaupt nicht genutzt. (Zwischenruf des Abg. Bucher.)
Derzeit bremst sogar Herr Landeshauptmann Pühringer, der gesagt hat: Wenn eine Verwaltungsreform in einem zu großen Ausmaß stattfinden sollte, dann würde man die mehr oder weniger blockieren. – Daran sehen wir schon, wohin der Zug in Zukunft fährt. Man möchte da ganz einfach nicht reformieren, weil es um den Schutz von Einflussbereichen geht; von Einflussbereichen, die seit 1945 zwischen Rot und Schwarz aufgeteilt wurden. Und das lehnen wir entschieden ab, da muss es einmal eine Änderung geben, meine sehr verehrten Damen und Herren. (Beifall bei FPÖ und BZÖ.)
Zum Thema Skylink: Auch da wird ein Eiertanz sondergleichen aufgeführt. (Zwischenruf bei der ÖVP.) Kollege Cap hat erst gestern wieder gesagt, dass er sich nicht vorwerfen lässt, dass es da keine Kontrolle gibt, und dass er das alles nicht mehr hören kann. Andererseits ist man dann aber nicht einmal dazu bereit, einen Entschließungs-
antrag zu unterstützen, mit dem die Bundesregierung aufgefordert wird, auf die Länder einzuwirken. Nicht einmal dazu sind Sie bereit! (Zwischenruf des Abg. Dr. Bartenstein.)
Herr Kollege Bartenstein, wenn Sie schon einen Zwischenruf machen: Bitte melden Sie sich zu Wort, gehen Sie zum Rednerpult – Sie sagen ja, an die „Budel“, um bei Ihrem Wortschatz von gestern zu bleiben – und schildern Sie Ihre Erfahrungen aus der Wirtschaft! Erklären Sie uns allen einmal, was Controlling in der Wirtschaft bedeutet! Da können Sie sich in einen vernünftigen Diskurs stürzen, aber ich bitte Sie, nicht irgendwelche Zwischenrufe zu machen, weil Sie die Kontrolle des Rechnungshofes in dieser Art und Weise nicht haben wollen.
In den Ausschüssen wurde auch mehrmals diskutiert, warum zumindest die abstrakte Möglichkeit bestehen sollte, die Gemeinden zu prüfen. Davon ist überhaupt keine Rede. Das wird immer als Argument verwendet von Frau Kollegin Schittenhelm, die gerade nicht im Saal ist, die immer sagt, jetzt werde man schon von der BH geprüft, ihr werde schon ... (Abg. Schittenhelm: Ich bin da! – Weitere Zwischenrufe bei der ÖVP.) – Da sind Sie, ja, Entschuldigung, Frau Kollegin, Sie sind ja sogar sehr auffällig gekleidet, ich hätte Sie gar nicht übersehen dürfen. (Abg. Steibl: Ein bisschen charmanter ...!)
Frau Kollegin, Sie sagen immer wieder: Jetzt werden wir schon so oft kontrolliert!, und haben recht damit – auch da gebe ich Ihnen recht –, es kann auch nicht sein, dass einmal die Bezirkshauptmannschaft, dann die Gemeindeaufsicht und dann vielleicht noch einmal der Landesrechnungshof kontrolliert und der Bundesrechnungshof (Zwischenruf des Abg. Gahr), aber die abstrakte Möglichkeit, dass man jede Gemeinde kontrollieren kann, sollte bestehen.
Es gibt kleine Gemeinden, die ein Millionen-Euro-Budget haben, die nicht mehr ein und aus wissen, die nicht wissen, wie sie in Zukunft die Straßenbeleuchtung zahlen sollen, die nicht wissen, wie sie die Sozialhilfeverbandskosten zahlen sollen, wie sie die Krankenanstaltenbeiträge zahlen sollen. Ich glaube, dass viele Bürgermeister froh wären, wenn sie mit dem Rechnungshof eine Anlaufstelle hätten, weil dieser letztendlich auch gute Empfehlungen abgibt. Er kann ja auch beratend zugezogen werden – und so sollte man den Rechnungshof auch sehen. Sie sehen den Rechnungshof immer mehr oder weniger – ich möchte nicht sagen, als Feind – als unliebsames Element, das vielleicht zu weitgehend kontrolliert.
Insofern treten wir für die Fristsetzung ein. Wir unterstützen den Antrag des BZÖ, wobei ich erwähnen möchte: Für uns ist es wichtig, dass in Zukunft auch die Empfänger von Direktzahlungen der Europäischen Union überprüft werden können sollen (Zwischenrufe bei der ÖVP), die Prüfung von Wohnbauträgern, die Prüfung von Unternehmen, die vom Staat Unterstützung in Form finanzieller Zuschüsse oder Haftungsübernahmen erhalten. Wir wollen eine umfassende Kontrolle, eine Kontrolle, die sicherstellt, dass jeder Euro gut verwendet wird in dieser Republik. – Danke. (Beifall bei der FPÖ.)
15.26
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Nun gelangt Herr Abgeordneter Scheibner zu Wort. 5 Minuten Redezeit. – Bitte.
15.26
Abgeordneter Herbert Scheibner (BZÖ): Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Herr Abgeordneter Gahr, das war jetzt schon sehr lustig, nämlich wenn Sie sagen, Sie seien gegen einen Schnellschuss in der Frage der Ausweitung der Rechnungshof-Kompetenzen. – Schnellschuss, haben Sie das ernst gemeint, Herr Kollege? (Zwischenruf des Abg. Gahr. – Abg. Mag. Kogler: Es sind ja erst die Dinosaurier gestern
ausgestorben!) Wissen Sie eigentlich, wie lange wir schon hier im Hohen Haus über diese Frage diskutieren? (Abg. Gahr: Von gestern auf heute!) – Von gestern auf heute? Dann haben Sie in den letzten Jahren wahrscheinlich geschlafen oder waren mit irgendetwas anderem beschäftigt, jedenfalls nicht mit der wichtigen Frage, dass wir unserem Organ – der Rechnungshof ist auch Ihr Organ; er ist ein Prüforgan von Ihnen als Abgeordnetem dieser Republik – selbstverständlich die bestmöglichen Prüfkompetenzen geben müssen, in unserem Interesse, Herr Kollege! (Beifall beim BZÖ sowie des Abg. Mag. Kogler.)
Meine Damen und Herren, Sie wissen, dass nicht erst Präsident Moser immer wieder darauf hinweist, sondern dass auch schon sein Vorgänger Fiedler immer wieder darauf hingewiesen hat, dass es da Nachholbedarf gibt. Und Sie reden jetzt von einem Schnellschuss, das ist doch wirklich merkwürdig.
Aber dann stehen Sie wenigstens dazu, ganz offen, und sagen Sie: Okay, lassen wir die Fristsetzung zu!, damit Sie möglichst rasch auch Ihre Meinung zur Kenntnis bringen können, nämlich dass Sie dagegen sind. Dann argumentieren Sie das, übernehmen Sie aber auch gegenüber der Öffentlichkeit die Verantwortung dafür, dass Sie gegen die Kontrolle der Verwendung öffentlicher Gelder, von Steuergeldern, durch den Rechnungshof sind. Das haben Sie dann letztlich zu erklären. (Beifall beim BZÖ und bei Abgeordneten der Grünen.)
Es geht um nichts anderes als darum, dass wir dem Rechnungshof die Möglichkeit geben wollen, überall dort, wo öffentliche Gelder verwendet worden sind, ob das Subventionen, Zuschüsse bei Bauprojekten oder Gemeindegelder sind, die Verwendung zu prüfen.
Wir wollten das auch beim Bankenrettungspaket, meine Damen und Herren. Da geht es um Milliardenbeträge, und niemand kann wirklich überprüfen, ob dieses Geld auch dort ankommt, wohin es kommen soll, etwa zu den kleinen und mittelständischen Unternehmungen.
Bei den Gemeinden – das ist ja, glaube ich, der Hintergrund, weil Sie viele Bürgermeister haben, die sich dagegen wehren. Aber da frage ich mich: Warum denn? Wenn Sie ein rechtschaffener Bürgermeister sind – und ich gehe einmal davon aus, dass alle Bürgermeister rechtschaffen sind –, dann haben Sie doch kein Problem damit, dass der Rechnungshof diese Rechtschaffenheit auch entsprechend dokumentieren kann. (Zwischenruf des Abg. Hörl.) Warum sind Sie denn dann dagegen?
Es gibt Gemeinden, die sind Riesenapparate, die haben Wirtschaftsbetriebe, die haben riesige Budgets, und niemand lässt den Rechnungshof da hineinschauen! Und warum? – Aber gerade jetzt – und das wäre sehr aktuell – bei der Wirtschaftskrise ist ja herausgekommen, was manche Gemeindevorstände – unabhängig von der Fraktion – glauben, was sie sind. (Abg. Mag. Kogler: Jawohl!) Die glauben, sie sind Anlageberater, Börsengurus. Aber dann sollen sie das mit ihrem eigenen Geld machen und nicht mit dem Steuergeld ihrer Gemeindebewohner. (Beifall beim BZÖ sowie bei Abgeordneten von Grünen und FPÖ.)
Darum geht es, meine Damen und Herren. Du weißt ganz genau, wie viele Millionen da verzockt worden sind. Das wird dann alles unter den Teppich gekehrt. Und genau deshalb wollen wir diese Ausweitung der Prüfkompetenzen. Erzählen Sie mir dann nicht, was alles zu überprüfen ist!
Es gibt kein Steuerfindungsrecht der Gemeinden und der Länder für deren Aufgaben, sondern das sind Bundessteuern. Wir müssen für die Steuereinnahmen auch den Kopf hinhalten, daher wollen wir auch überprüft haben, wohin diese Gelder fließen und wofür sie verwendet werden.
Genau so ist das auch bei den Unternehmungen, bei denen es eine staatliche Beteiligung gibt, denn es geht letztlich ja auch darum, welchen politischen Einfluss es da gegeben hat.
Herr Kollege Gahr, welche Investoren lassen sich davon abschrecken, dass der Rechnungshof prüft? Jeder Investor, lieber Freund, hat Interesse daran, dass mit seinem Geld ordentlich umgegangen wird. (Abg. Dr. Haimbuchner: Der müsste froh sein!) Und der Rechnungshof ist da wirklich objektiv, der Rechnungshof ist bar jedes Verdachts, dass er irgendwie parteipolitisch agiert. Jeder Investor hat Interesse daran, denn wenn der Rechnungshof prüft, weiß er dann und kann auch sicher sein, dass mit seinem Geld ordentlich umgegangen wird. Darum geht es doch. (Beifall beim BZÖ. – Abg. Kopf: Das ist nicht das Thema!)
Aber Sie wollen auch nicht, dass, wie zum Beispiel beim Skylink, die politische Verantwortung aufgedeckt wird, denn das sind Ihre parteipolitischen Entscheidungen. Es ist ja lustig: Herr Häupl hat damit nichts zu tun! Herr Landeshauptmann Pröll hat damit nichts zu tun! (Abg. Mag. Kogler: Nein!) Auch Herr Kaufmann hat damit nichts zu tun – er ist in allen Sitzungen dabei gewesen. (Abg. Mag. Kogler: Der ist ja seit 15 Jahren dort, hat aber praktisch nichts ...!) – Hat nichts damit zu tun. Wofür haben die eigentlich ihr Geld bekommen?
Ich erinnere mich gut daran, dass bei jeder Eröffnung eines neuen Ausbauteiles des Flughafens all diese Herrschaften, die Politiker, anwesend waren (Abg. Mag. Kogler: Na sicher!) und gesagt haben: Das ist auch unser Erfolg, was wir alles tun für diese Region, für den Wirtschaftsstandort! (Zwischenrufe bei der SPÖ.) – Wenn die bei den positiven Dingen, bei den Eröffnungen dabei sind, dann sollen sie auch die Verantwortung übernehmen, wenn etwas schiefgeht. Und ein Kontrolleur – ein objektiver Kontrolleur – muss als entscheidende Instanz her, und das ist der Rechnungshof.
Deshalb: Verweigern Sie die Prüfung nicht, sondern sorgen Sie dafür, dass unser Organ endlich die notwendigen Kompetenzen bekommt! (Beifall beim BZÖ und bei Abgeordneten der Grünen.)
15.31
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zu Wort gelangt nun Herr Abgeordneter Mag. Kogler. 5 Minuten Redezeit. – Bitte.
15.31
Abgeordneter Mag. Werner Kogler (Grüne): Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Jetzt bin ich auch animiert, mir wie der Vorredner Scheibner über den Zeitbegriff des Kollegen Gahr, der für die ÖVP gesprochen hat, Gedanken – um nicht zu sagen: Sorgen – zu machen. Wenn dieser Teil einer Verfassungsreform, der die Rechnungshof-Prüfkompetenzen betrifft, ein Schnellschuss sein soll, dann schreiben Sie zumindest die Biologiebücher in Tirol um, denn dann sind erst gestern die Dinosaurier ausgestorben. (Beifall bei Grünen und BZÖ.)
Es ist ja so, dass zu Beginn jeder Legislaturperiode – auch in dieser war es so –, eigentlich schon seit dem Jahr 2000, glaube ich, ähnliche, fast gleiche Anträge immer wieder vorgelegt wurden. Jedenfalls war ja im Konvent – in all diesen Details, bis auf das Bankenpaket, denn da konnte man ja nicht wissen, was in diesem Sektor alles auf uns zukommt – schon alles da. Das ist ja nichts Neues.
Im Übrigen habe ich mir die Protokolle des Konvents angesehen. Und, Herr Kollege Pendl, im Präsidium hat sich die sozialdemokratische Fraktion bereits im Jahr 2005 dafür ausgesprochen, dass eine öffentliche Beteiligung an Unternehmen im Ausmaß von 25 Prozent plus eins schon ausreichend sein soll für eine Prüfkompetenz. Also
lesen Sie einmal nach, was Ihre Vertreter damals gesagt haben; die haben sich dabei vielleicht auch etwas gedacht.
Aber so ist es eben in diesem Haus: Immer dann, wenn es einem nicht passt, ist es ein Schnellschuss, und dann, wenn es einem passt, werden eineinhalb Stunden vor einer Ausschusssitzung 40 oder mehr Seiten übermittelt, dann wird die Sitzung unterbrochen, denn es ist ohnehin wurscht, es ist ohnehin der falsche Ausschuss, oder es werden zwei Tage Zeit gegeben. Ob dann die Abgeordneten an irgendeinem Freitag um 8 Uhr in der Früh Zeit haben oder nicht, ist auch wurscht, da hat man dann einfach zu erscheinen. Das ist kein Schnellschuss, das ist ausreichend.
Das ist einfach nicht mehr auf die Waage zu kriegen! Die hat eine enorme Schräglage, und damit müssen Sie sich auch einmal auseinandersetzen. Da müssen Sie einiges ins Lot bringen, das ist überhaupt eine Voraussetzung für ein vernünftiges Gespräch (Zwischenruf des Abg. Dr. Bartenstein), dann kann man wieder einiges – ja, Kollege Bartenstein, genau so ist es; Sie haben ja sicher Verständnis dafür, immerhin sind Sie ein Verhandlungsprofi – über bestimmte Geschichten, die uns schon seit Wochen und insbesondere in den letzten Tagen begleiten, wieder anders reden.
Aber gehen wir die Punkte einmal kurz durch – sie alle sind aus der Sicht meiner Fraktion sehr vernünftig –, reden wir einmal in aller Ruhe darüber.
Prüfkompetenzen für Gemeinden: Noch einmal, das ist a priori kein Misstrauen gegenüber den Bürgermeistern oder sonst etwas, sondern es geht darum, dass die Gemeinden nachweislich massive Probleme haben – zum Teil machen sie sich diese selbst, und die sollten wir dann schon bemerken oder auch aufzeigen (Zwischenruf des Abg. Großruck), und zum anderen sind es objektive Probleme, die wir eigentlich durch andere Finanzausgleichsgesetze oder sonstige Maßnahmen zu lösen hätten. Auch das wäre ein Ergebnis. (Abg. Großruck: Lehrmeister Kogler ...!)
Kein Mensch glaubt oder möchte haben, dass der Rechnungshof jede Gemeinde prüft. Wir von der Opposition, jedenfalls ich als Vorsitzender des zuständigen Ausschusses, stehen in guter Zusammenarbeit mit dem Rechnungshofpräsidenten und sind die Letzten, die das wollen, denn der Rechnungshof würde damit ja lahmgelegt werden. Es geht doch nur darum, dass die Prüfkompetenz grundsätzlich besteht und nach bestimmten schlauen Kriterien dort nachgeschaut wird, wo es allenfalls einen gewissen Voranhaltspunkt gibt, nachzuschauen. Das kann man ganz leicht mit entsprechenden Kriterien wie etwa Budgetkennzahlen, aber auch anderen machen – vor allem in den ausgelagerten Betrieben der Gemeinden.
Stellen Sie sich vor, wir haben eine Gemeinde mit 19 999 Einwohnern. (Abg. Großruck: Die werden eh geprüft! Die werden eh bisher auch geprüft! Der kennt sich nicht aus!) Da kann nicht einmal geprüft werden.
Also, wenn ich so wenig Ahnung hätte wie Sie, würde ich nicht so laut zwischenrufen. Das finde ich schon sehr mutig. (Abg. Großruck: Der hat doch keine Ahnung! Da redet der Blinde von der Farbe!) Was haben Sie denn gemacht mit dem Kollegen? (Beifall bei den Grünen.) – Aber wir wollten das Ganze heute ein bisschen friedlicher angehen.
Das ist einfach eine vernünftige Sache. Gerade bei den Gemeinden ist die prophylaktische Wirkung des Rechnungshofes sehr gut. Ich habe Ihnen ein paar Mal vom Beispiel Hartberg erzählt. Weil Sie immer sagen: Es gibt ja den Kontrollausschuss! – Wo war denn der Kontrollausschuss? Eine einzige Oppositionspartei hat dort dagegen gehalten. Was war dann mit der Bezirkshauptmannschaft? – Nichts war. Ich darf daran erinnern, dass in Hartberg Millionen verzockt wurden. Millionen!
Die nächste Geschichte ist das Beste: Es wird ja immer von der Gemeindeaufsicht des Landes gesprochen. Aber die steckt ja in der Regel mit unter einer Decke, und dort war es auch so. Ich habe Ihnen das schon ein paar Mal erklärt.
Mittlerweile gehen wir in der Steiermark dazu über, die Gemeindeaufsicht zu reformieren, weil sie nicht Aufsicht, sondern selbst ein Fall für die Aufsicht und die Überprüfung ist. (Zwischenruf des Abg. Großruck.) Das ist der Zustand, und damit wollen Sie eine Rechnungshofprüfung abwinken! Das ist doch völlig absurd. Das können Sie gar nicht ernst meinen.
Bei den 25 Prozent ist die Sache völlig klar. Es sagt schon der Kleinanlegervertreter Rasinger, dass es gescheit wäre, wenn beim Skylink eine öffentliche Prüfung auch im Interesse der Anleger durchgeführt würde, weil das Unternehmen das „vergurkt“ hat. Die wollen jetzt selbst Haus- und Hofgutachter beauftragen – Herr Kaufmann, der schon ewig dort ist. So kann es ja nicht gehen!
Das Beste kommt natürlich zum Schluss: Beim Bankenpaket wird es nicht anders gehen, als dass eine Rechnungshofkontrolle stattfindet – auch aus der Sicht der Abgeordneten dieses Hauses. Sie haben unsere Zustimmung bekommen, aber unter der Voraussetzung, dass wir auch kontrollieren können. Die Voraussetzungen haben Sie nicht eingehalten, und jetzt bedienen wir uns des Organs, das dem Nationalrat zusteht. Ohne Rechnungshofkontrolle für die Banken werden Sie nicht mehr weit springen. (Beifall bei Grünen, FPÖ und BZÖ.)
15.37
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Abgeordneten Bucher, Kolleginnen und Kollegen, dem Finanzausschuss zur Berichterstattung über den Antrag 1/A der Abgeordneten Bucher, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), BGBl. Nr. 1/1930, geändert wird, eine Frist bis zum 25. August 2009 zu setzen.
Ich bitte jene Damen und Herren, die für den Fristsetzungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist die Minderheit. Der Antrag ist somit abgelehnt.
*****
Information der Präsidentin über Ergebnisse der Präsidialkonferenz
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Bevor ich die Verhandlungen über den Punkt 11 der Tagesordnung wieder aufnehme, darf ich Sie, meine Damen und Herren, ganz kurz über die Ergebnisse der Präsidialsitzung informieren.
Es konnte Übereinstimmung erzielt werden, dass in Fragen der Immunität und des Immunitätsrechts eine Arbeitsgruppe eingesetzt wird, die aus je einem Mitglied aller Fraktionen zusammengesetzt sein und unter meinem Vorsitz stehen wird. Diese wird sich auch auf Basis des Briefes, der uns vonseiten der Frau Justizministerin zugegangen ist, mit dieser Frage beschäftigen.
Es werden auch die Erfahrungen einfließen, die der Immunitätsausschuss in den letzten Jahren mit dem Immunitätsrecht gemacht hat. Diese Arbeitsgruppe wird auch über den Sommer arbeiten.
Wir gehen davon aus, dass wir bis zum Herbst Erkenntnisse darüber haben werden, inwieweit es Interpretationsspielräume gibt, die nicht in unserem Interesse sind, nicht
im Interesse des Immunitätsrechts, und halten uns damit natürlich auch die Möglichkeit einer gesetzlichen Änderung offen.
Ich möchte mich an dieser Stelle auch sehr herzlich beim Zweiten Präsidenten bedanken, der es uns ermöglicht hat, die Präsidiale durchzuführen, und Ihnen eine Sitzungsunterbrechung erspart hat, um so die Sitzung nicht in die Länge zu ziehen. (Allgemeiner Beifall.)
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Ich nehme die Verhandlungen über den 11. Punkt der Tagesordnung wieder auf.
Zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Mag. Auer. Die gewünschte Redezeit beträgt 3 Minuten. – Bitte.
15.40
Abgeordneter Mag. Josef Auer (SPÖ): Frau Präsidentin! Geschätzter Herr Minister! Kollegin Brunner von den Grünen hat ja heute richtigerweise gesagt, dass der Klimawandel – leider, sage ich dazu! – bei uns angekommen ist. Sie haben aber auch gesagt, dass die gesetzlichen Regelungen, die jetzt zur Beschlussfassung anstehen, eine Notlösung seien, und da muss ich Sie schon korrigieren.
Wenn man das Wort „REACH“, das ja nicht „ankommen“ im englischen Sinn heißt, sondern eine Abkürzung, ein Akronym ist, übersetzen würde, dann wäre das ein Ankommen der REACH-Verordnung, und genau darum geht es heute. Die REACH-Verordnung, die ja auf EU-Ebene bereits existiert, kann erst durch die heutige Beschlussfassung dieses Gesetzes in das österreichische Recht aufgenommen werden. Dazu braucht es eben diese zwei Fakten, dass die REACH-Verordnung bei uns auch umsetzbar ist und dass es zur Kompatibilität mit dem Chemikaliengesetz kommt. Das ist auf alle Fälle Fakt.
Einige andere Fakten wurden schon genannt. Das Sicherheitsdatenblatt wurde bereits vom Kollegen von der ÖVP erwähnt, das brauche ich nicht mehr anzuführen.
Ein weiterer wichtiger Punkt – auf das wurde noch nicht hingewiesen – ist, dass es gemäß diesem Entwurf in der Vollziehung zu keinem erhöhten Personal- und Sachaufwand kommt. Das müsste eigentlich die Vertreter der Freiheitlichen und auch des BZÖ freuen, weil ja gerade Sie auch immer diejenigen sind, die einerseits Verbesserungen für die Bürger verlangen – was wir natürlich auch wollen –, aber andererseits schreien, dass die Zahl der Beamten zum Beispiel geringer sein soll, die man aber in der Vollziehung braucht. Das ist ein Widerspruch, also etwas, das diametral auseinandergeht. Ich habe in Ihren Augen auch ein bisschen Zustimmung gesehen.
Zum Entschließungsantrag und zum ganzen Themenkreis Chemikaliengesetz möchte ich nur sagen, dass uns dieser Umstand ja schon lange bewusst ist. Der Herr Minister weiß, dass es ja schon Bestrebungen gegeben hat und dass sogar für den Herbst bereits weitere Verhandlungen angesetzt sind. Was Sie vergessen haben, ist, dass es in diesem Zusammenhang natürlich auch die Anpassung der CLP-Verordnung an den ArbeitnehmerInnenschutz braucht. (Abg. Neubauer – auf leere SPÖ-Reihen zeigend –: Wo sind Ihre Genossen?) Die haben eine Stehinformation.
Ich komme jetzt zu Ihnen von der blauen Reichshälfte, wenn ich so sagen darf. Ich bin Chemielehrer, und Chemie ist die Lehre von den Stoffen und Stoffumwandlungen. Da bin ich schon bei dem Thema, das mir am Herzen liegt und das ich unbedingt anbringen will. Was will ich sagen? Lehre will ich jetzt nicht mit Doppel-E interpretieren, aber
die Stoffumwandlungen. Sie wandeln nämlich immer wieder Fakten um, Sie kommen mit Halbwahrheiten und auch mit Unwahrheiten.
Gerade heute, nur zwei Beispiele: Herr Neubauer – nicht hinter dem Laptop verstecken! –, Sie haben heute etwas Unwahres behauptet. Sie haben über Minister Hundstorfer etwas Unwahres gesagt, nämlich dass er gar nicht wollte. Das hat er nicht gesagt. (Zwischenruf des Abg. Neubauer.)
Bei den Ausführungen der Frau Kollegin Belakowitsch-Jenewein hat es heute sogar eine tatsächliche Berichtigung gebraucht, weil sie eben auch nicht richtig waren.
Herr Vilimsky oder Herr Weinzinger, Sie von der blauen Hälfte sind genau die, die immer an die Demokratie erinnern, oft sogar uns Sozialdemokraten. Wir sind die Hüterinnen und Hüter der Demokratie, und Sie machen Folgendes: Sie machen hier im Herzen der Demokratie, hier im Parlament bei einer Abstimmung Derartiges, was dann Herr Vilimsky ganz flapsig mit seiner „linken Zech’n“ entschuldigen wollte. Das ist in meinen Augen nicht gut. (Abg. Ing. Hofer: Schauen Sie einmal Ihre Reihen an!)
Ich komme zu Ihrem Klubobmann, den ich ja schon einmal als „Parlamentstouristen“ bezeichnet habe. Der war heute überhaupt nur ganz kurz am Vormittag während der Fernsehübertragungszeit da, und jetzt glänzt er durch Abwesenheit. (Mit Verweis auf die leeren SPÖ-Reihen Zwischenrufe und ironische Heiterkeit bei der FPÖ.) Das sage ich Ihnen dann nächstes Mal, da ich meine, meine Zeit schon fast ausgeschöpft zu haben. Das Licht fängt nicht an zu blinken – warum, weiß ich nicht.
Wissen Sie, was mein Sohn über Ihren HC Strache gesagt hat? – Er hat gesagt: „St“ steht für Sankt, und dann kommt nur noch „Rache“. Und das ist genau das, was ich ihm vorwerfe. Mit Sankt meine ich, dass sich Strache hinter Kirchlichem versteckt, dass er sich nicht einmal scheut, das Kreuz zu zücken für seine niederen Interessen, möchte ich jetzt sagen, und er sät Missgunst und Rache. Und das tut der Demokratie nicht gut. (Beifall bei der SPÖ. – Zwischenrufe bei der FPÖ.)
15.45
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Abgeordneter – und für alle: Es ist tatsächlich so, dass sich die Lampe beim Rednerpult ab und zu ohne Zutun ausschaltet. Ich ersuche alle Abgeordneten, selbst ein wenig auf die Zeit zu achten. Ich werde die Anlage über den Sommer überprüfen lassen.
Als Nächster zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Tadler. 3 Minuten. – Bitte.
15.46
Abgeordneter Erich Tadler (BZÖ): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Herr Minister! Hohes Haus! Es beruhigt sich wieder alles. Kollege Haberzettl ist ja auch da; es sind also doch ein paar Leute von der SPÖ hier.
Das erklärte Ziel von REACH ist es, auf dem europäischen Markt für unsere Zukunft Vorsorge zu treffen. Es sollen sich keine Chemikalien mit unbekannten Gefährdungspotenzialen im Umlauf befinden. Durch die Änderung des Gesetzes soll eine verbesserte Informationsgrundlage im Bereich von Chemikalien geschaffen und eine wesentliche Verbesserung der Chemikaliensicherheit herbeigeführt werden.
Seit 40 Jahren sind in der EU Sicherheitsvorschriften für den Handel von Chemikalien in Kraft. Dennoch ist die Bilanz sehr ernüchternd. Nur für die wenigsten der etwa 30 000 im Handel erhältlichen chemischen Stoffe stehen verlässliche Informationen über deren Gefährlichkeit zur Verfügung. Greenpeace zum Beispiel spricht in diesem Zusammenhang von über 100 000 ungeprüften Chemikalien, die es auf dem europäischen Markt gibt. Sie landen in unseren Elektrogeräten, und von dort gelangen sie dann teilweise in den menschlichen Körper.
Die Frage, die sich wohl jeder vernünftige Mensch stellt, ist: Sind diese Chemikalien wirklich so unbedenklich? Bislang musste die Chemieindustrie nicht einmal grundlegende Umwelt- und Gesundheitsdaten bekannt geben. Über 90 Prozent aller Chemikalien, die sich heute auf dem europäischen Markt befinden, sind nicht auf ihre Folgen für Gesundheit und Umwelt geprüft.
Nichtsdestotrotz bleiben auch mit der REACH-Verordnung karzinogene, krebserregende, die Fruchtbarkeit beeinträchtigende und hormonell wirksame Chemikalien erlaubt, wenn die Hersteller behaupten, sie angemessen kontrollieren zu können.
Nach Ihrer Auskunft, Herr Minister, stellen das geplante Vorhaben und die damit verbundenen Änderungen des Chemikaliengesetzes nur eine Zwischenlösung dar, da die Umsetzungsfrist bis 2010 läuft und eine Gesamtänderung des Chemikaliengesetzes erforderlich ist. Wir werden uns also in absehbarer Zeit erneut mit dieser Thematik befassen müssen.
Herr Minister, warum können wir eigentlich nicht abwarten und erst dann Gesetze beschließen? – Danke. (Beifall beim BZÖ.)
15.48
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Es hat sich Herr Bundesminister Dipl.-Ing. Berlakovich zu Wort gemeldet. – Bitte, Herr Bundesminister.
15.48
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Dipl.-Ing. Nikolaus Berlakovich: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die EU hat in Form der hier diskutierten REACH-Verordnung einen wichtigen ersten Schritt in Richtung einer neuen Chemikalienpolitik gesetzt, die sinnvollerweise nicht nur national geregelt werden kann, sondern international, vor allem jedenfalls im gesamten EU-Raum Regelungsbedarf hat. Es kommen immer wieder neue Substanzen auf den Markt, die umfassend untersucht werden müssen, und da ist es sinnvoll, dass dies auf europäischer Ebene funktioniert. Ziel ist ja eine verpflichtende Registrierung der chemischen Stoffe, dass wir Informationen über diese Chemikalien sammeln und eben auch risikoreduzierende Maßnahmen setzen, um natürlich Menschen und die Umwelt zu schützen.
Durch diese breitere Datengrundlage, die wir erhalten werden, sollen Gefahren und Risken verhindert oder früh erkannt und nach Möglichkeit auch beseitigt werden.
Die REACH-Verordnung zielt auf das Vorsorgeprinzip ab, also ein wichtiger Punkt, und vor allem wird eine neue zuständige Stelle auf europäischer Ebene eingerichtet, und zwar die Europäische Chemikalienagentur, kurz ECHA genannt, und zwar in Helsinki, wo rund 500 Expertinnen und Experten aus allen EU-Mitgliedstaaten beschäftigt sind, um diese sehr wichtige und diffizile Thematik zu behandeln. Wie gesagt, das Spektrum der Substanzen und Chemikalien ist ein sehr breites.
Worauf wir stolz sein können, ist, dass den Vorsitz im obersten Organ der ECHA, nämlich im Verwaltungsrat, ein Österreicher innehat, und zwar ein leitender Beamter aus meinem Ressort, Dr. Thomas Jakl – er ist heute hier anwesend –, der Leiter der Chemieabteilung des Lebensministeriums. Herzliche Gratulation und alles Gute für dieses wichtige Amt! (Beifall bei der ÖVP.)
Das zeigt schon, dass wir Menschen haben, Frauen und Männer, die bereit sind, auf internationaler Ebene Verantwortung zu übernehmen, die aber auch kompetent genug sind, diese Verantwortung zu erhalten. Daraus können Sie ersehen, dass die Chemikalienpolitik wie insgesamt die Umweltpolitik für uns eine sehr wichtige ist, die auch an Personen festgemacht wird. Wir werden alles dazu tun, um im Rahmen unserer öster-
reichischen Gesetzgebung die EU-Verpflichtungen einzuhalten, vor allem mit dem absoluten Ziel, Menschen, Natur und Umwelt zu schützen.
Herzlichen Dank Ihnen allen für Ihre positiven Beiträge und Ihre Zustimmung. (Beifall bei der ÖVP.)
15.51
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Nun gelangt Herr Abgeordneter Stauber zu Wort. Ich stelle die Uhr auf 2 Minuten. – Bitte.
15.51
Abgeordneter Peter Stauber (SPÖ): Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Werte Zuhörer! Im Umweltrecht der Europäischen Union zeigen sich sehr deutlich Fortschritte der europäischen Integration, wie Sie, Herr Bundesminister, gerade erwähnt haben. Besonders das Chemikalienrecht wurde in den letzten Jahren stark weiterentwickelt und umfasst nun zusätzliche, direkt geltende Verordnungen, für deren Anwendung es in Österreich noch keine ausdrücklichen gesetzlichen Begleitvorschriften gibt. Daher war es auch unbedingt notwendig, zur Überwachung und Durchsetzbarkeit der neuen Verordnungen bundesgesetzliche Vorschriften zu erlassen.
Im Wesentlichen enthält die heute zu beschließende Regierungsvorlage ausschließlich Durchführungsregelungen zu direkt geltenden europarechtlichen Vorschriften, die jedenfalls in innerstaatliches Recht umgesetzt werden müssen.
Die REACH-Verordnung und damit die sogenannte neue europäische Chemikalienpolitik gilt seit dem 1. Juni 2007 in den Mitgliedstaaten und ist als gemeinschaftsrechtliche Verordnung unmittelbar anzuwenden. Allerdings müssen die Mitgliedstaaten auch flankierende Maßnahmen zur Überwachung der Bestimmungen der REACH-Verordnung sowie geeignete Sanktionen gegen Verstöße festlegen, was wir hiemit in Form dieses Gesetzes machen.
Den materiell wichtigsten Teil der REACH-Verordnung stellen die Bestimmungen in den Abschnitten 1 bis 3 über die Registrierung von Stoffen dar. Außerdem normiert diese Verordnung in den Abschnitten 4 und 5 auch eine Reihe von Verpflichtungen für Beteiligte einer Lieferkette, also für Hersteller, Importeure, Händler, berufliche Verarbeiter und Verwender von chemischen Stoffen und Gemischen. Grundsätzlich richtet sich also die REACH-Verordnung primär an den beruflichen, den gewerblichen und industriellen Sektor und nicht in erster Linie an die Konsumenten, Endverbraucher und Arbeitnehmer.
Dennoch enthält die REACH-Verordnung auch einige Regelungen, die für die Konsumenten und Arbeitnehmer direkt relevant sind. Erwähnenswert und wichtig ist hier, dass die Arbeitgeber den Arbeitnehmern die im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen für alle gefährlichen Stoffe, denen die Arbeitnehmer ausgesetzt sein könnten, nachweislich zur Kenntnis zu bringen haben.
Außerdem wird die ECHA auch Listen der besonders besorgniserregenden Stoffe auf ihrer Website veröffentlichen und im Internet kostenlos alle über die Registrierung erhaltenen, nicht vertraulichen und elektronisch erfassten Informationen zur Verfügung stellen.
Alles in allem ist das also eine wichtige gesetzliche Regelung, die auch zur Sicherheit von Mensch und Natur beitragen wird. – Danke schön. (Beifall bei der SPÖ sowie des Abg. Jakob Auer.)
15.54
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
Der Herr Berichterstatter wünscht kein Schlusswort.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 224 der Beilagen.
Ich ersuche jene Damen und Herren, die für diesen Gesetzentwurf sind, um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist mit Mehrheit angenommen.
Wir kommen zur dritten Lesung.
Ich bitte jene Damen und Herren, die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter Lesung ihre Zustimmung geben, um ein Zeichen. – Das ist wiederum mehrheitlich angenommen. Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung angenommen.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Mag. Brunner, Kolleginnen und Kollegen betreffend REACH-Verordnung.
Ich bitte jene Damen und Herren, die für diesen Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen. – Das ist die Minderheit und damit abgelehnt.
Bericht des Umweltausschusses über die Regierungsvorlage (230 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Emissionszertifikategesetz und das Bundesgesetz über den zwischenstaatlichen Luftverkehr 2008 geändert werden (235 d.B.)
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Wir gelangen zum 12. Punkt der Tagesordnung.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Wir gehen in die Debatte ein.
Als Erste zu Wort gelangt Frau Abgeordnete Dr. Winter. Gewünschte Redezeit: 3 Minuten. – Bitte.
15.55
Abgeordnete Dr. Susanne Winter (FPÖ): Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Minister! Werte Kollegen und Kolleginnen! Grundsätzlich darf ich für die FPÖ vorweg sagen, dass wir dieser Vorlage, diesem Bundesgesetz leider nicht zustimmen können, und zwar aufgrund zahlreicher Kritik sowohl aus dem nationalen als auch aus dem internationalen Raum. International deswegen: Flugverkehr ist global, ist international, daher wird das Gesetz auch entsprechende Auswirkungen auf verschiedene Länder haben.
Bei dieser Vorlage handelt es sich um eine EU-Richtlinie, die bereits seit 2005 im internationalen Recht verankert ist, denn seit 2005 gibt es bereits den Handel mit Emissionen für verschiedene Branchen. Diese neue Verordnung bewirkt eigentlich eine Erweiterung, und zwar in der Richtung, dass ab 2012 auch der Flugverkehr mit einbezogen werden soll.
Was heißt eigentlich Emissionshandel? – Da gibt es verschiedene Definitionen. Die einfachste habe ich in einem bundesdeutschen Tourismusprospekt gefunden: Geschäft mit schmutziger Luft. Es wird, im Gegensatz zu unserer Bundesregierung, dort sehr in Frage gestellt, ob es sich dabei auch um ein umweltpolitisches Instrument handelt.
Da wir in Österreich ja nicht gerade federführend in der Luftfahrt sind, habe ich mir erlaubt, zur Unterstützung unserer Kritikpunkte nationale und internationale Statements einzuholen.
Erstens einmal bedeutet diese neue Lösung, dass es sich hier doch um eine wettbewerbsverzerrende Vorschrift handelt – das behauptet jedenfalls der Lufthansa-Sprecher in der „Financial Times Deutschland“ vom 5. Juni 2009 –, und zwar deshalb, weil es sich ja nur um Flüge handelt, die von einem EU-Flughafen weggehen oder dort landen. Ausgeschlossen und somit wettbewerbsverzerrend sind internationale kontinentale Umsteigverbindungen, die sehr oft auch das Umfliegen Europas beinhalten.
Ein zweiter Kritikpunkt, nur kurz angerissen, ist die Treibhausgasemission. Es stimmt schon, die des Flugverkehrs macht nur 3 Prozent der Gesamt-EU-Emission aus, sie hat sich aber in den letzten Jahren verstärkt. Wenn man jedoch die wirtschaftliche Lage mit einbezieht, dann sieht es laut Meinung des Chefs der International Air Transport Association folgendermaßen aus: Weltweit werden die Fluglinien 2009 mehr als die bislang prognostizierten 4,7 Milliarden Dollar verlieren. Das heißt, die wirtschaftliche Grundlage dafür hat sich auch geändert.
Der dritte Kritikpunkt ist noch der Anhang 1a zu § 2. Da gibt es eine taxative Aufzählung von Ausnahmen, von Flügen, die da nicht mit einbezogen worden sind. Dazu gehören die Flüge von Staatschefs und von regierenden Monarchen. Ich glaube, auch die EU, auch wir Österreicher müssten hier ein Zeichen in Richtung Privilegienabbau setzen. Aber das ist in solchen Tintenburgen wohl ziemlich schwer zu vertreten. (Beifall bei der FPÖ.)
15.59
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Mag. Lettenbichler mit gewünschten 4 Minuten Redezeit. – Bitte.
15.59
Abgeordneter Mag. Josef Lettenbichler (ÖVP): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Geschätzter Herr Umweltminister! Hohes Haus! Ja, die Ursachen für den viel diskutierten Klimawandel und deren Auswirkungen sind vielfältig. Auch unsere Konsumgesellschaft und die damit verbundene Lebensweise tragen das Ihre dazu bei.
Österreich hat sich für die kommenden Jahre hohe, ambitionierte Klimaschutzziele gesetzt. So sollen zum Beispiel bis zum Jahr 2020 34 Prozent der Energie aus erneuerbaren Energieträgern bezogen werden. Zur Erreichung dieser Ziele haben jedoch alle Bereiche ihren Beitrag zu leisten – auch die Luftfahrtsbranche.
Derzeit machen die Treibhausgasemissionen dieses Sektors, wie wir soeben gehört haben, EU-weit in etwa 3 Prozent aus. Sie drohen jedoch weiterhin zu steigen, und der Kampf gegen den Klimawandel wird dadurch nicht einfacher.
Die Europäische Union hat in diesem Zusammenhang in einer Richtlinie vorgegeben, den Luftverkehr in das System für den Handel mit Emissionszertifikaten mit einzubeziehen. Bis zum Februar 2010 ist diese Richtlinie in österreichisches Recht umzusetzen, und wir werden heute die Ausweitung des Emissionszertifikategesetzes beschließen.
Aber was bedeutet dies in der Praxis? – Luftfahrzeugbetreiber werden verpflichtet, Tonnenkilometerleistungen und CO2-Emissionen ab 2010 zu überwachen und darüber zu berichten. Sie können zur Erfüllung der Klimaschutzziele in weiterer Folge Zertifikate ankaufen oder Gutschriften verwenden.
Aber gerade in der auch für die Luftfahrtbranche wirtschaftlich sehr schwierigen Zeit ist es aus meiner Sicht nicht sinnvoll, zu strenge Auflagen anzuwenden. Es muss, wie auch überall sonst, ein ausgewogener Kompromiss zwischen einer notwendigen Rücksichtnahme auf die Umwelt und einer vernünftigen wirtschaftlichen Entwicklung gefunden werden.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Vertreter der Industrie- und Schwellenländer haben sich gestern in L’Aquila gemeinsam zum Ziel gesetzt, die Erderwärmung auf 2 Grad zu begrenzen. Das Forum der größten Volkswirtschaften der Welt, dem 17 Länder angehören, schloss sich einer entsprechenden Zielsetzung der G8 vom Vortag an.
Einig ist man sich auch darüber geworden, dass zusätzliche finanzielle Mittel aufgewendet werden müssen, um den Klimaschutz weiter voranzutreiben. Man sieht also, es geht in der weltweiten Klimaschutzpolitik einiges voran. Mit der Umsetzung dieser EU-Richtlinie wollen wir einen weiteren wichtigen Schritt setzen, um unsere Ziele zu erreichen. – Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit! (Beifall bei der ÖVP.)
16.02
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Nun gelangt Frau Abgeordnete Bayr zu Wort. Ich stelle die Uhr wunschgemäß auf 3 Minuten. – Bitte.
16.02
Abgeordnete Petra Bayr (SPÖ): Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben es jetzt schon zweimal gehört: Auch wenn der europäische Flugverkehr in Summe nur 3 Prozent der europäischen Treibhausgasemissionen ausmacht, ist es, glaube ich, trotzdem ein sehr, sehr wichtiger Schritt, den Flugverkehr auch in das ETS – in das Emission Trading System – mit einzubeziehen, weil man dann auch mehr Steuerungsmöglichkeiten in Richtung des Senkens desselbigen hat.
Ein Problem ist in der Tat, dass der Flugverkehr auch aufgrund der immer noch sehr billigen Tickets jetzt durch die Wirtschaftskrise zwar etwas gebremst ist, aber tendenziell doch sehr stark zunimmt, und mit ihm der Treibhausgasausstoß.
Es war in dem Gesetz ursprünglich auch eine Passage enthalten, die dann leider der Finanzminister „hinausgekickt“ hat, in der es darum gegangen wäre, die Einnahmen, die wir in Österreich durch diesen Emissionszertifikatehandel erzielen, zweckgebunden zu verwenden – einerseits zweckgebunden für Klimaschutzmaßnahmen sowohl im Inland als auch im Ausland, oder andererseits aber auch für Forschung in diesem Sektor in Richtung der Frage, wie man denn den Flugverkehr, technisch gesehen, auch sauberer – sprich, mit weniger Emissionen behaftet – machen kann.
Wie gesagt, diese Passage ist leider weg. Es ist fein, dass es mit einer Ausschussfeststellung gelungen ist, dennoch den Willen des Parlaments zu dokumentieren, dass wir genau diese Zweckbindung für wichtig und notwendig halten, denn wir wissen alle, wir werden in naher und auch in ferner Zukunft sehr viel Geld dafür aufwenden müssen, das Klima zu schützen, die Treibhausgasemissionen zu senken, Alternativen zur Kohlenstoffwirtschaft zu finden.
Wir werden das sowohl auf nationaler Ebene brauchen – ich halte es immer für sinnvoll, Treibhausgasemissionen vor allem im Inland zu senken, denn das bringt Wertschöpfung, das generiert Arbeitsplätze und das macht Sinn, weil es unsere CO2-Basis hier senkt –, aber wir werden andererseits spätestens im Dezember dieses Jahres bei den Verhandlungen in Kopenhagen klarerweise auch Solidarität demonstrieren müssen und auch aufgefordert sein, für jene armen Länder der Welt, die am meisten unter dem Klimawandel leiden, ihn aber nicht verursacht haben – denn verursacht haben ihn zu nahezu 100 Prozent nur die reichen Länder (Abg. Scheibner: Das stimmt aber nicht! Das ist nicht richtig!) –, Töpfe zu dotieren, Ausgleichsfinanzierungen zu finden und Geld zur Verfügung zu stellen.
By the way, zur Tagung der G8, weil das mein Vorgänger auch angesprochen hat: Ich vernehme die Ankündigungen des Gipfels sehr wohl, finde es auch fein, dass es eine Einigung auf die Begrenzung der Erderwärmung um 2 Grad gegeben hat, nur: Deklarationen alleine helfen, wie wir wissen, noch nicht. Ich kenne eine Reihe von Beschlüs-
sen der G8 aus den letzten Jahren, zum Beispiel zur Frage der Erhöhung der Entwicklungsfinanzierung, denen selten Taten gefolgt sind.
Es wird letztendlich drauf ankommen, mit welchen nationalen Maßnahmen sich die Staaten, die jetzt in L’Aquila Beschlüsse gefasst haben, auch realpolitisch verpflichten. Zum Zweiten denke ich, wir sollten auch irgendwann einmal über die Frage der Besteuerung von Kerosin reden. Dass Kerosin nicht besteuert wird, kommt aus einer Zeit zu Beginn des letzten Jahrhunderts, als es darum ging, die damals junge Technologie Luftverkehr zu fördern. Das ist mittlerweile jedoch etwas überholt, denn diese hat sich ziemlich etabliert. – Danke. (Beifall bei der SPÖ.)
16.05
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Nun gelangt Herr Abgeordneter Tadler zu Wort. Redezeit: 3 Minuten. – Bitte.
16.05
Abgeordneter Erich Tadler (BZÖ): Sehr geehrte Frau Präsident! Herr Bundesminister! Hohes Haus! Wie kann es sein, dass die Bundesregierung von Schuldenanhäufung und Krise spricht und der Flugverkehr bis jetzt keiner Mineralölbesteuerung unterliegt? Es ist höchste Zeit, dass der Flugverkehr in den Zertifikatehandel eingebunden wird.
Allerdings muss ich zugeben, dass es in der Flugbranche ja seit geraumer Zeit nicht gar so lustig zugeht und dass dort nicht alles zum Besten steht. Die hohen Kerosinpreise, Billigkonkurrenz, Flugangst durch Terroranschläge und diverse Unfälle in den letzten Wochen schlagen nicht unbedingt gut zu Buche.
Wie viele Arbeitsplätze in letzter Zeit verloren gegangen sind und noch verloren gehen werden, ist nicht absehbar. 3 700 Arbeitsplätze sollen zum Beispiel, wie wir gestern gehört haben, bei der BA – der British Airways – verloren gehen, 200 bei Tyrolean und an die 1000 bei den Austrian Airlines.
Bereits bis Ende August müssen die Fluglinien laut EU zeigen, wie sie in den kommenden Jahren die verbrauchte Kerosinmenge korrekt messen wollen. Hält eine Fluglinie diese Frist nicht ein, geht sie bei der Vergabe von kostenfreien Emissionszertifikaten leer aus, und es drohen ihr Kosten in Millionenhöhe. Wie sollen das die kleineren Fluglinien aushalten und durchstehen? Dabei geht es ja um sehr viel Geld.
Die Lufthansa etwa schätzt, dass sie ab 2012 jedes Jahr für einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag Zertifikate zukaufen muss. TUIfly rechnet mit einem niedrigen zweistelligen Millionenbetrag. Da beide gut vorbereitet sind, können sie damit rechnen, dass sie bei der EU einen großen Anteil der Zertifikate gratis erhalten. Sonst würde es deutlich teuerer werden, auch für die Fluggäste, an die ja die Kosten meistens weitergegeben werden.
Ausgenommen werden, wie meine Kollegin schon gesagt hat, die Militär-, Zoll-, Polizei-, Such- und Rettungsflüge, Flüge für medizinische Einsätze und zur Katastrophenhilfe einschließlich Brandbekämpfungsflüge sowie Flüge zu humanitären Zwecken im Auftrag der Vereinten Nationen.
Anbieter der Golfregion wie die Emirates machen aus Europa meist nur einen Zwischenstopp in Dubai und müssen somit nur für Teilstrecken Zertifikate kaufen. Daher fordern die Europäer Nachbesserungen und pochen auf eine globale Lösung. – Danke. (Beifall beim BZÖ.)
16.08
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Nun gelangt Frau Abgeordnete Mag. Brunner zu Wort. 2 Minuten gewünschte Redezeit. – Bitte.
16.08
Abgeordnete Mag. Christiane Brunner (Grüne): Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Landwirtschaftsminister! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Geschätzte Zuseherinnen und Zuseher! Es ist heute schon mehrfach angesprochen und offensichtlich zur Kenntnis genommen worden, dass der Klimawandel in Österreich angekommen ist.
Ich möchte noch einmal an Sie appellieren, dass wir endlich handeln müssen, auch hier in Österreich. Bezüglich der Änderung des Emissionszertifikategesetzes finde ich es positiv, dass endlich auch die Luftfahrt und die Emissionen aus dem Luftverkehr berücksichtigt und in den Emissionshandel aufgenommen werden.
Das ist ein erster Schritt, ein wichtiger Schritt, aber wiederum nur ein sehr kleiner Schritt. Gerade einmal 3 Prozent der Treibhausgasemissionen in der gesamten Europäischen Union gehen auf die Luftfahrt zurück.
Jetzt möchte ich damit nicht sagen, dass wir das vernachlässigen können und nichts tun müssen. Wir müssen Maßnahmen ergreifen, wir müssen die Emissionen der Luftfahrt berücksichtigen, aber damit darf es nicht getan sein, sondern wir brauchen weitere Maßnahmen, gerade im Verkehr – in der Luft genauso wie auf der Straße.
Herr Landwirtschaftsminister, da müssen Sie sich auch für eine EU-weite Kerosinsteuer einsetzen! Wir brauchen mehr öffentlichen Verkehr, auch hier in Österreich, damit die Menschen endlich unabhängig werden von teuren Benzin- und Dieselpreisen, und wir brauchen mehr Initiativen in Richtung Elektromobilität, damit auch Menschen in ländlichen Regionen ohne teures Benzin und Diesel mobil sein können.
Aber was passiert stattdessen in Österreich? – Wir erleben einen Autobahn- und Schnellstraßenausbau quer durchs ganze Land. Mehr Verkehr bedeutet einfach auch mehr Emissionen – und Verkehr ist nun einmal unser Hauptproblem beim Klimawandel.
Herr Landwirtschaftsminister, Sie müssen sich auch gegenüber dem Verkehrsministerium durchsetzen, wenn wir den Klimawandel in Österreich ernst nehmen wollen. Das haben Sie bisher nicht getan, und daher bin ich nach wie vor der Meinung, dass Österreich ein starkes und unabhängiges Umweltministerium braucht. – Danke. (Beifall bei den Grünen.)
16.10
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Nun gelangt Herr Bundesminister Dipl.-Ing. Berlakovich zu Wort. – Bitte.
16.10
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Dipl.-Ing. Nikolaus Berlakovich: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Hohes Haus! Das Thema Klimaschutz und Klimawandel hat in den letzten Tagen die öffentliche Meinung beherrscht, der G 8-Gipfel hat sich in einer ziemlichen Breite mit dem Thema befasst. Wenn die wichtigsten Wirtschaftsmächte der Welt plus die entscheidenden Schwellenländer – wie China, Indien, Brasilien, Mexiko oder Südafrika – zusammenkommen, dann ist das schon sehr bedeutsam.
Das zeigt auch die Wichtigkeit des Themas, nämlich weltweit. Bisher ist es in vielen politischen Zirkeln besprochen worden, so auch auf einer großen Expertenkonferenz in Bonn, bei der 4 500 Expertinnen/Experten und Beamte in Vorbereitung der großen Klimakonferenz in Kopenhagen Ende des Jahres 2009 zusammenkamen. Es ist ein mühsamer und zäher Prozess, zweifellos, weil die Interessen – die ja da sind – gewaltig sind. Es gibt Wirtschaftsinteressen, Interessen der Nationalstaaten, Fragen der ökonomischen Entwicklung und auch die Sorgen der Entwicklungsländer, wie sie mit dieser
ganzen Entwicklung zurande kommen, und so weiter und so fort. Sie kennen diese Diskussion.
Insofern ist es erfreulich, dass sich am G 8-Gipfel die großen Wirtschaftsmächte und auch die Schwellenländer auf das 2-Grad-Celsius-Ziel verständigt und sich zu seiner Einhaltung verpflichtet haben. Wir wollen keine stärkere Erwärmung unseres Klimas. Das ist schon einmal ein Fortschritt und bemerkenswert, weil das bisher von vielen geleugnet wurde und kein gemeinsames Ziel war, das man vor Augen hatte, wiewohl man schon auch gesehen hat, wie mühsam es ist, konkrete Reduktionsziele im Bereich der Treibhausgase zu erreichen, wenn dann China und Indien nein sagen, dann sagt Russland nein, und so geht es weiter.
Also Sie sehen, es ist ein sehr schwieriger Prozess, aber wir geben die Hoffnung nicht auf und arbeiten auf allen Ebenen. Auch Österreich ist mit seinen Experten auf breitester Ebene – auch in Zusammenarbeit mit den NGOs – dabei, damit wir am Ende des Jahres in Kopenhagen ein Weltklimaschutzabkommen erreichen. Das ist absolut wichtig – auch im Sinne der Lebensqualität der Menschen –, und daher halte ich es für sinnvoll und wichtig, dass alle Bereiche erfasst werden.
Schauen Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren von den Grünen, Ihr Problem ist, dass Sie nie mit etwas zufrieden sind. Man kann es Ihnen so und so nicht recht machen. Das ist das Problem mit Ihrer Glaubwürdigkeit. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Dr. Pirklhuber: Das stimmt ja gar nicht!)
Anstatt sich darüber zu freuen, dass erstmals der Flugverkehr erfasst wird, sagen Sie: Ja schon, aber eigentlich müssten viele andere Dinge geschehen. (Abg. Dr. Pirklhuber: ... Emotion! Du darfst nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, Herr Minister! – Zwischenruf der Abg. Dr. Lichtenecker.) Gerade der Flugverkehr hat auch, was die Symbolik betrifft, zweifellos vieles für sich. Sie kennen vielleicht – oder auch nicht, ich kenne sie jedenfalls – die Diskussionen der Bevölkerung. Die Menschen sagen: Jeder Einzelne muss etwas tun, und da, schaut euch die Flugzeuge an, die sind ausgenommen!
Daher geht es einfach darum, dass alle Sektoren erfasst werden: die Wirtschaft, der Verkehr, die Industrie, aber natürlich auch der Flugverkehr. (Abg. Dr. Lichtenecker: Unsere Unterstützung haben Sie!) Die historischen Gründe, warum im Gegensatz zum Straßenverkehr der Flugverkehr von der Mineralölsteuer ausgenommen wurde, wurden bereits erwähnt. Ich halte es daher für wichtig, dass jetzt ein System eingeführt wurde – nämlich der Emissionszertifikatehandel –, um den Flugverkehr erstmals ins Boot mit hineinzunehmen, damit auch dieser seinen Beitrag leistet. Politisch machbar war die Kerosinbesteuerung auf europäischer Ebene nicht, realistisch war hingegen dieses System, und es bringt auch etwas und macht Sinn.
Von großer Bedeutung und entscheidend ist, dass Zug um Zug alle dazukommen. Das System gilt nur auf europäischer Ebene, also ist der Einwand, warum die Schweiz oder andere Staaten nicht dabei sind, berechtigt. Auch da gibt es ein starkes Bemühen der Europäischen Union – auch im Sinne der Wettbewerbsgleichheit –, dass beispielsweise die Schweiz erfasst wird und dann Zug um Zug auch andere Sektoren. Jedenfalls halte ich es für wichtig, dass dieser Sektor im Emissionszertifikatesystem mit dabei ist und dass wir in Österreich – aber auch international – konsequent Klimaschutzmaßnahmen ergreifen, um die Lebensqualität für die jetzige und die kommenden Generationen zu sichern. – Herzlichen Dank Ihnen allen! (Beifall bei der ÖVP sowie bei Abgeordneten der SPÖ.)
16.14
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Rädler. Freiwillige Redezeitbeschränkung: 3 Minuten. – Bitte. (Abg. Hornek: Erklär uns, was
ein Flieger ist! – Abg. Rädler – auf dem Weg zum Rednerpult –: Das werd ich gleich machen!)
16.15
Abgeordneter Johann Rädler (ÖVP): Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich ersuche um Nachsicht, um mir nicht einen Ordnungsruf einzuhandeln, wenn ich jetzt nicht zum Luftverkehr, zum Emissionskataster und zum Handelssystem spreche, sondern zur Lufthoheit, die die Bürgermeister in den Gemeinden über die Stammtische haben sollten. (Abg. Hörl: Begeisterung! – Beifall bei Abgeordneten der ÖVP.)
Ich möchte kurz auf das Bezug nehmen, was die Vorredner von der Opposition gesagt haben, nämlich dass der Rechnungshof auch Prüfkompetenzen für kleinere Gemeinden übertragen bekommen soll. Ich sage Ihnen aus der Praxis in Niederösterreich, aus unserer Gemeindetätigkeit, dass wir den Bürgern verpflichtet sind. Wir haben vielfältige Aufgaben, und es wird immer mehr an die Gemeinden zur Durchführung übertragen. Wir sind auch sehr offen gegenüber Prüfungstätigkeiten. (Zwischenruf des Abg. Dr. Walser.)
Es gibt die interne Überprüfungsmöglichkeit, die Gebarungseinschau der Opposition – die unangekündigt eine Einschau durchführen kann, so ist das in Niederösterreich –, es gibt die Gebarungseinschau des Landesrechnungshofes und es gibt das Finanzministerium, das eine Einschaumöglichkeit hat.
Ich frage mich, wer jetzt noch eine Einschaumöglichkeit haben soll, noch dazu, wo wir in den letzten Tagen darüber diskutiert haben, dass wir 3 Milliarden € einsparen wollen und dass das nur durch einen Verwaltungsabbau geht. Da frage ich mich wirklich, wie viele Beamte in ganz Österreich in den Gemeinden seitens des Rechnungshofes unterwegs sein müssten. Ich verwahre mich gegen solche Begehrlichkeiten vielleicht frustrierter ehemaliger Rechnungshofpräsidenten oder auch der Opposition. Da bin ich als Bürgermeister dagegen! (Beifall bei der ÖVP.)
Nun auch ganz kurz zur heute behandelten Problematik: Es ist eine wichtige, stolze und mutige Maßnahme, in Zeiten, in denen der Flugverkehr um 10 Prozent zurückgeht, ein umweltpolitisches Zeichen zu setzen und zu sagen: Ja, wir sind bereit, auch den Luftverkehr mit einzubeziehen, genauso wie wir im Bereich der Industrie in den vergangenen Jahren über Emissionszertifikate ein Zeichen gesetzt haben!
Ich freue mich, dass es durch die Ausschussfeststellung gelungen ist, dass die Mittel auch dafür verwendet werden, das System zu finanzieren, und dass außerdem die Möglichkeit besteht, dass die vorhandenen Mittel auch in Österreich in den Klimaschutz investiert werden. – Danke. (Beifall bei der ÖVP.)
16.17
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Nun gelangt Herr Abgeordneter Schopf zu Wort. Freiwillige Redezeitbeschränkung: 2 Minuten. – Bitte.
16.17
Abgeordneter Walter Schopf (SPÖ): Frau Präsidentin! Herr Minister! Meine Damen und Herren! Ich möchte ebenfalls einiges zu dieser Emissionsproblematik sagen. Meine Damen und Herren, es hat ja bereits im Ausschuss eine kurze Diskussion gegeben, in der ich den Herrn Minister konkret nach den Kyoto-Zielen gefragt, aber keine detaillierte Auskunft erhalten habe. Ich wiederhole die Frage: Herr Minister, wir alle wissen – sogar verschiedene Institutionen sagen es und es gibt manche Expertisen darüber –, dass wir von diesen Zielen nicht nur weit entfernt sind, sondern dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass wir diese Ziele, die wir uns gemeinsam gesteckt haben, nicht erreichen werden. Nun nochmals an Sie die Frage: Gibt es weitere Initiativen und
Maßnahmen, um dieses Problem doch noch einigermaßen in den Griff zu bekommen und zu lindern?
Meine Damen und Herren, es wird ja seit einigen Monaten – seit dem Klimagipfel in Bali – darüber diskutiert und darum gerungen, welche Nachfolgeregelung zu Kyoto letztendlich vereinbart wird. Bei dieser Konferenz sind ja eine Reihe von gemeinsamen Maßnahmen vereinbart worden, unter anderem wurde der UN-Klimaschutzfonds eingerichtet und ein umfassender Technologietransfer für Entwicklungsländer vereinbart; aber vor allem ging es darum, gemeinsame Überlegungen anzustellen, um auf der Konferenz in Kopenhagen – die ja im Dezember dieses Jahres stattfinden wird – einen Nachfolgevertrag zu unterzeichnen. Ich denke, es wäre doch für das Hohe Haus nicht uninteressant, wenn Sie als Minister uns die geplanten Initiativen für diese Konferenz und vor allem die Position unserer Republik zu dieser Konferenz darlegen. – Danke. (Beifall bei der SPÖ.)
16.19
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Steier. Gewünschte Redezeit: 2 Minuten. – Bitte.
16.20
Abgeordneter Gerhard Steier (SPÖ): Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Auf Grundlage der auf europäischer Ebene beschlossenen Einbeziehung des Flugverkehrs in das EU-Emissionshandelssystem novellieren wir das Zertifikategesetz und das Bundesgesetz über den zwischenstaatlichen Luftverkehr. Bekanntlich erfolgt ja ab dem Jahr 2012 für alle Fluggesellschaften, die in Europa starten und landen, eine Einbeziehung in diesen Emissionshandel.
Alle Fluggesellschaften, die in Europa landen beziehungsweise starten, müssen künftig für 15 Prozent ihrer CO2-Emissionen Zertifikate kaufen. Ziel ist es, die CO2-Emissionen bis zum Jahr 2012 um 3 Prozent und ab dem Jahr 2013 um 5 Prozent zu verringern. – An sich ein tolles Ziel, und in den Vorgaben, das haben meine Vorredner schon gesagt, kann damit umweltpolitisch durchaus etwas bewirkt werden.
Mit der heute hier im Hohen Haus zu beschließenden Novellierung werden die Luftverkehrsbetreiber verpflichtet, ab 1. Jänner 2010 ihre CO2-Emissionen zu überwachen und jährlich darüber auch Bericht zu erstatten. Die Einbeziehung des Luftverkehrs in den Emissionshandel war längst überfällig. In diesem Wachstumssektor haben sich die Werte vom Jahr 1990 bis zum Jahr 2006 um mehr als 70 Prozent erweitert.
In einer zunehmend globalisierten Welt ist Mobilität ein wichtiges Merkmal, nicht nur für den Warenaustausch, sondern auch für die Freizeit und damit die Lebensqualität. Fest steht, der Trend zum Fliegen wird sich fortsetzen – umso wichtiger ist es, Wachstum und Umweltschutz im Luftverkehr angemessen auszubalancieren, denn die Emissionen aus den jährlichen Zuwachsraten im Flugverkehr fressen die Effekte neuer Technologien und der Flottenmodernisierungen auf. Der Wiener Flughafen setzt hier in Zukunft auf das Modell, dass ältere Flugzeuge, die viel Lärm erzeugen, auch entsprechend höhere Abgaben werden bezahlen müssen, neue Flugzeuge hingegen – und damit ist die Steuerungsfunktion erreicht – werden geringere Abgaben zahlen.
Es stellt sich die Frage, wie gut sich die Fluglinien in Richtung Start des Emissionshandels vorbereitet haben, denn das erste Überwachungskonzept, sozusagen der Fitnesstest für den Emissionshandel, ist dem Lebensministerium bis Ende August 2009 vorzulegen.
Letztendlich geht es um viel Geld. Je besser vorbereitet, desto höher die Wahrscheinlichkeit, Zertifikate nicht teuer zukaufen zu müssen, und damit auch die Chance für die KonsumentInnen, dass die Auswirkungen des Emissionshandels für den Flugverkehr
auf die Ticketpreise nicht allzu hoch sein werden. – Danke schön. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.)
16.22
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
Der Herr Berichterstatter wünscht kein Schlusswort.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 230 der Beilagen.
Ich ersuche jene Damen und Herren, die für diesen Gesetzentwurf sind, um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist mehrheitlich angenommen.
Wir kommen sogleich zur dritten Lesung.
Ich bitte jene Damen und Herren, die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, um ein entsprechendes Zeichen. – Das ist wiederum mehrheitlich angenommen. Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung angenommen.
Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Industrie über die Regierungsvorlage (223 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über den Betrieb von Dampfkesseln und Wärmekraftmaschinen (Dampfkesselbetriebsgesetz – DKBG) geändert wird (270 d.B.)
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Wir gelangen nun zum 13. Punkt der Tagesordnung.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Wir gehen in die Debatte ein.
Als Erster gelangt Herr Abgeordneter Themessl mit gewünschten 3 Minuten Redezeit zu Wort. – Bitte.
16.23
Abgeordneter Bernhard Themessl (FPÖ): Frau Präsidentin! Frau Staatssekretärin! Hohes Haus! Meine Damen und Herren Abgeordneten! Aufgrund dessen, dass Sie die Novelle des Ökostromgesetzes selbst von der Tagesordnung abgesetzt haben, wird meine Wortspende relativ kurz ausfallen.
Zu Tagesordnungspunkt 13, zum Dampfkesselbetriebsgesetz, werden wir unsere Zustimmung geben – und zum Ökostromgesetz lassen Sie mich bitte auch ein paar Worte anmerken.
Da Sie diese Materie an den Ausschuss rückverwiesen haben, gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass Sie beim Ökostromgesetz vielleicht generell einmal umdenken werden. Sie wissen ja, dass nicht nur wir, sondern auch andere Oppositionsparteien in diesem Haus seit zwei Jahren fordern, das Ökostromgesetz grundsätzlich auf ganz andere, neue Aktualitäten umzustellen, es einmal grundsätzlich zu überdenken. Als Wirtschaftssprecher ist mir das deshalb sehr wichtig, weil in Deutschland das Erneuerbare-Energien-Gesetz gezeigt hat, dass innerhalb kürzester Zeit Tausende zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden können. Gerade in Zeiten einer Wirtschaftskrise wäre es daher sehr wichtig, auch in Österreich in diesem Bereich einmal grundsätzlich umzudenken.
Das heißt, ein neues Ökostromgesetz unter ganz anderen Voraussetzungen zu schaffen, ähnlich dem deutschen Vorbild, würde bedeuten, dass wir nicht nur energiemäßig weniger vom Ausland abhängig wären, sondern darüber hinaus auch die Möglichkeit hätten, Zigtausende zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen, was in Zeiten wie diesen wichtig wäre.
Nachdem Sie sich innerhalb der Regierungsparteien offensichtlich bei der Novellierung auf Kleinigkeiten nicht haben einigen können, hoffe ich, dass Sie jetzt den großen Wurf angehen, dann werden Sie auch mit unserer Mithilfe und unserer tatkräftigen Unterstützung rechnen können. – Danke. (Beifall bei der FPÖ sowie des Abg. Dr. Walser.)
16.25
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Nun gelangt Herr Abgeordneter Dr. Bartenstein zu Wort. Gewünschte Redezeit: 5 Minuten. – Bitte.
16.25
Abgeordneter Dr. Martin Bartenstein (ÖVP): Frau Präsidentin! Frau Staatssekretärin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Nein, Herr Abgeordneter Themessl, das ist nicht unsere Absicht gewesen, das Ökostromgesetz im Ganzen zu erneuern! Die Regierungsfraktionen sind weiterhin der Auffassung, dass das, was Österreich, was unser Wirtschafts- und Energieminister nach Brüssel notifiziert hat, etwas Gutes ist und wir diese Ökostrom-Novelle wollen oder eigentlich wollten.
Jetzt komme ich zu den zwei Punkten, weswegen wir, abgesehen von einer notwendigen technischen Änderung, eine Ökostrom-Novelle vorbereitet haben, die wir heute zurückgezogen haben, und zwar aus gutem Grund, aber im Rahmen dieser Plenarsitzung hätten wir noch gerne zwei Ergänzungen vorgenommen; die erste – falls es doch gelungen wäre, gemeinsam mit der EU-Kommission in Sachen Notifizierung zu einem Konsens zu kommen. Es hat ja ein sehr wesentliches, hochrangiges Meeting am Mittwoch dieser Woche, also vorgestern, stattgefunden – Schweisgut, Sektionschef Losch, Kabinettschef der Kommissarin Kroes und andere –, aber leider Gottes haben sich dort die Fronten tendenziell eher verhärtet. Es sieht nicht so aus, als ob die Kommission insbesondere den sogenannten Industriedeckel akzeptieren wollte, jedenfalls nicht ohne vertieftes oder Hauptprüfungsverfahren.
Das heißt, wir waren hier gewissermaßen Gewehr bei Fuß, aber ohne dieses Okay der Kommission geht es nicht. Die Kommission wird nun wahrscheinlich am 22. Juli schriftlich dazu Stellung nehmen, und auf Basis dieser schriftlichen Stellungnahme – Kollege Katzian und ich haben uns auch hier an unseren Wirtschafts- und Energieminister gewandt – wird sich dann Minister Mitterlehner mit der Industrie in Verbindung setzen, weil wir dieser in dieser Sache im Wort sind.
Zweiter Punkt, weswegen wir an sich an eine Ökostrom-Novelle gedacht haben: Die Rohstoffsituation als Substrat für die Biogasproduktion hat sich zuletzt leider wiederum so entwickelt, dass wir der Auffassung sind, dass es hier einen erneuten Rohstoffzuschlag braucht. Verhandlungen sind im Gange, auch auf einem guten Weg, aber wir haben diese noch nicht abgeschlossen; deshalb auch die Absetzung dieses Antrages von der Tagesordnung heute Vormittag.
Ich glaube, es ist gute Sitte, dass ich das Hohe Haus über die näheren Motive aus Sicht der Regierungsfraktionen informiert habe. – Herzlichen Dank. (Beifall bei der ÖVP.)
16.28
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Abgeordneter Tadler ist der nächste Redner. 3 Minuten. – Bitte.
16.28
Abgeordneter Erich Tadler (BZÖ): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Frau Staatssekretärin! Hohes Haus! In der Änderung des Bundesgesetzes über den Betrieb von Dampfkesseln und Wärmekraftmaschinen, kurz Dampfkesselbetriebsgesetz genannt, wollen Sie eine Kompetenzentflechtung bei der Qualifikation der Betriebswärter einführen. Und da stellt sich für mich die Frage, wie das im vorliegenden Gesetzentwurf stattfinden soll.
In § 5 der Regierungsvorlage zur Änderung des Dampfkesselbetriebsgesetzes wird von Hilfspersonen gesprochen, die dem § 3 Abs. 2 entsprechen sollten. Wenn Sie allerdings § 3 Abs. 2 genauer lesen, wird Ihnen auffallen, dass nur eine fachlich befähigte Person für diesen Dienst verwendet werden darf. Diese fachliche Befähigung wird in § 3 Abs. 3 näher beschrieben: Diese Person muss eine entsprechende praktische Verwendung absolviert haben und anschließend ihre Kenntnisse durch Ablegung einer Prüfung in dem jeweiligen Prüfungsgebiet nachgewiesen haben. – Was ist dann mit der von Ihnen vorgeschlagenen Hilfsperson, die dem § 3 Abs. 2 entsprechen soll? Was ist dann mit dieser Person?
Dass man eine Angleichung der Gesetze auf EU-Niveau, vor allem wenn eine Richtlinie vorgegeben wurde, durchführen muss, liegt wohl auf der Hand. Eine Angleichung über die Anerkennung ausländischer Zeugnisse ist ebenso notwendig, um Fachpersonal aus dem Ausland einstellen zu können, meine Damen und Herren! – Nur eine Möglichkeit im Gesetz vorzusehen, um Ausgleichsmaßnahmen vorzuschreiben, reicht wohl nicht, um die Gefahren weitestgehend auszuschließen. Deshalb erweckt diese Regierungsvorlage den Eindruck, dass hier wieder einmal zu schnell gehandelt wurde.
Im Zuge der Debatte im Ausschuss wurde dann auch noch die UVP-Novelle an den Wirtschaftsausschuss verwiesen. – Frau Staatssekretärin, um den inhaltlichen Zusammenhang zwischen den Bestimmungen betreffend die Qualifikation eines Betriebswärters und betreffend die Überprüfung von Auswirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen wirklich zu erkennen, dazu benötigt man eine sehr ausgeprägte Phantasie. (Beifall beim BZÖ.)
16.31
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Nun gelangt Herr Abgeordneter Katzian zu Wort. Redezeit: 6 Minuten. – Bitte.
16.31
Abgeordneter Wolfgang Katzian (SPÖ): Frau Präsidentin! Frau Staatssekretärin! Meine Damen und Herren! Ich glaube, wir haben in der letzten Stunde viele Beiträge zum Thema Energie im Allgemeinen mitverfolgt, wodurch deutlich geworden ist, dass die Energiethematik ein wichtiges Zukunftsfeld ist und eine starke europäische Dimension hat. Nicht nur durch die Ausführungen von Herrn Dr. Bartenstein im Hinblick auf das Ökostromgesetz, auch durch die Hinweise zur Erreichung der 20-20-20-Ziele, zu denen sich Österreich verpflichtet hat, ist das in den letzten Diskussionsbeiträgen sehr deutlich geworden.
Ich bin überzeugt davon, dass wir alle Anstrengungen unternehmen müssen, um diese Diskussionen voranzutreiben, gemeinsam zu Lösungen zu kommen, damit wir unseren Planeten den nächsten Generationen so zur Verfügung stellen, wie wir selbst ihn vorgefunden haben.
Beim Dampfkesselbetriebsgesetz ist schon darauf hingewiesen worden, dass es die Pflicht des Betriebswärters ist, für einen energieeffizienten Betrieb von Dampfkesseln zu sorgen. Damit ist deutlich, dass das Thema Energieeffizienz eine Querschnittmaterie ist und wir sämtliche Potenziale in diesem Zusammenhang nützen müssen.
Energieeffizienz beschränkt sich aber, wie gesagt, nicht auf diesen Bereich allein, es ist notwendig, weitere Schritte zu setzen und weitere Maßnahmen voranzutreiben. Insbesondere geht es um die Realisierung der vorhandenen Potenziale, die in einem Masterplan Energieeffizienz dargestellt werden sollen, und darauf aufbauend darum, konkrete Maßnahmenvorschläge für die wichtigsten Bereiche – Gebäude, Mobilität und Industrie – zu erarbeiten.
Die öffentliche Hand hat hier sicher eine Vorbildfunktion. Wir sollten daher, wenn es uns ernst ist mit der Energieeffizienz, überlegen, diese bei öffentlichen Ausschreibungen als ein wichtiges Kriterium zu etablieren. Wir können damit auch einen wichtigen Beitrag zur Bewusstseinsbildung leisten.
Im Regierungsprogramm ist die Forderung nach einer Energieeffizienzgesetzgebung verankert. Wie diese konkret aussehen soll, wird noch Gegenstand von Diskussionen sein. Die Erreichung der bereits angesprochenen Zielvorgaben, zu denen sich Österreich verpflichtet hat, wird aber nur möglich sein, wenn wir es schaffen, den Energieendverbrauch zu stabilisieren. Dafür benötigt man effektive Instrumente. Ich persönlich würde jedenfalls einen Rahmen auf bundesgesetzlicher Ebene präferieren und nicht neun verschiedene Maßnahmen in den einzelnen Bundesländern.
Die Energieeffizienz ist eine der zentralen Säulen eines nachhaltigen Energiesystems, und ich glaube, wir wissen alle, dass sie ein Teil in einem größeren Gesamtzusammenhang zur Erstellung einer energiepolitischen Gesamtstrategie ist: die Entwicklung von Aktionsplänen und Maßnahmenbündeln in den Bereichen Bauen, Wohnen, Mobilität, Energiewirtschaft, Gewerbe und Industrie und Maßnahmen zur Stabilisierung des Energieverbrauches und verstärkte Nutzung erneuerbarer Energieträger.
Der Prozess zur Erstellung dieser Strategie ist schon gestartet worden. Es geht darum, möglichst viele Stakeholder, möglichst viele Beteiligte in den Prozess einzubinden. Ich glaube, dass die Maßnahmen, die jetzt in den einzelnen Unterarbeitsgruppen diskutiert werden, auch in einer Querschnittmaterie diskutiert werden müssen (Beifall bei der SPÖ), wobei darauf geachtet wird, welche unterschiedlichen Wechselwirkungen in den einzelnen vorgeschlagenen Maßnahmen zueinander zustande kommen.
Zum Ökostromgesetz möchte ich, ergänzend zu dem, was Herr Dr. Bartenstein gesagt hat, noch sagen, dass wir selbstverständlich in Gesprächen sind, auch über den Rohstoffzuschlag. Wir diskutieren das gemeinsam, ebenso wie auch viele andere sozialpolitischen Anliegen. – Danke schön. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.)
16.35
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Frau Abgeordnete Dr. Lichtenecker ist die nächste Rednerin mit einer gewünschten Redezeit von 4 Minuten. – Bitte.
16.35
Abgeordnete Dr. Ruperta Lichtenecker (Grüne): Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau Staatssekretärin! Hohes Haus! Dieser Änderung des Dampfkesselbetriebsgesetzes, wie sie uns heute vorliegt, werden wir zustimmen. Das ist in dieser Form ein durchaus wichtiger Schritt. Da es hier um die Qualifikationsanforderungen von Betriebswärtern geht, die zuständig sind für Schiffsmaschinen und Lokomotiven, sind wir beim Thema Mobilität, und wenn wir bei der Mobilität sind, sind wir sehr schnell beim Thema CO2 und beim Klimawandel.
Herr Dr. Hübner und Herr Gradauer von der FPÖ haben es heute besonders witzig gefunden, als Kollegin Brunner gesagt hat, der Klimawandel sei in Österreich angekommen. Es stellt sich aber die Frage: Warum hat die Kollegin das gesagt? Was ist denn in den letzten Wochen passiert, das signifikant dafür ist? – Es gibt in Österreich seit Wochen und quer durch das ganze Land an vielen Orten Überschwemmungen, Starkregenfälle – etwas, das völlig ungewöhnlich ist. Und das, geschätzte Kolleginnen und
Kollegen, ist ganz klar darauf zurückzuführen, dass der Klimawandel in Mitteleuropa angekommen ist.
Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik hat ganz eindeutig festgelegt, dass es seit 190 Jahren in verschiedenen Gebieten nicht mehr so starke Regenfälle gegeben hat; vom Salzkammergut über das oberösterreichische und niederösterreichische Alpenvorland, quer drüber, bis hin zum Raum Eisenstadt. Denken Sie daran, was Sie in den letzten Wochen in den Zeitungen gelesen haben! Einfamilienhäuser überschwemmt, Murenabgänge, Straßen zerstört, Betriebe ruiniert! Schäden in Millionen-, in Zigmillionenhöhe wird das verursacht haben. Dass das alles auf den Klimawandel zurückzuführen ist, darin sind sich die Klimaexperten einig.
Ich weiß nicht, was für die Kollegen von der FPÖ daran so witzig ist, wenn Menschen zu Schaden kommen, die Natur und ganz wichtige betriebliche Infrastruktur zerstört werden. Vielleicht sollten Sie einmal darüber nachdenken, was denn das für Konsequenzen hat für die betroffenen Menschen, für die betroffenen Unternehmen.
Dass das Folgen des Klimawandels sind, das sagen verschiedene Experten: Frau Professor Kromp-Kolb, der IPCC-Bericht, Schweizer Klimaforscher, Forscher an amerikanischen und englischen Universitäten. Alle sagen ganz klar, Derartiges wird sich jetzt häufen, wir werden nicht mehr davon reden können, dass es 190 Jahre dauern wird, bis diese Dinge wieder passieren.
Das, Frau Staatssekretärin, muss ein ganz klarer Auftrag für eine Doppelstrategie sein. Zum einen: Konsequenzen im Hochwasserschutz mit Renaturierungen; damit zu beginnen, den Flüssen ihre Räume zurückzugeben, das heißt, die Bauordnung zu verändern, die Raumordnung richtig zu gestalten. Zum anderen – auch ein Auftrag an die Bundesregierung –: zu versuchen, die Mittel, die für den Hochwasserschutz für die Jahre 2012 bis 2016 vorgesehen sind, vorzuziehen, sie in den nächsten zweieinhalb Jahren zu investieren, um die Menschen und die Unternehmen zu schützen und gleichzeitig auch Arbeitsplätze zu schützen. – Das ist dringend notwendig.
Selbstverständlich erfordert die Situation auch einen konsequenten Klimaschutz, und das bedeutet einerseits natürlich Ökostromgesetz, aber andererseits – ganz wichtig! – auch Forschungsschwerpunkte genau in den Bereichen Energieeffizienz und Erneuerbare zu setzen, einen österreichweiten Ökoenergie-Cluster zu schaffen. Das, Frau Staatssekretärin, wäre der Auftrag an den Wirtschaftsminister, an Ihr Ministerium: die Schwerpunktsetzung bei der Internationalisierungsoffensive und selbstverständlich eine Totalreform des Ökostromgesetzes.
Wie erfolgreich man ist, wenn Grün regiert – Herr Kollege Themessl von der FPÖ hat das vorhin erzählt –, zeigt das Ökostromgesetz in Deutschland, und wie erfolgreich Grün ist, wenn es regiert, zeigt Rudi Anschober in Oberösterreich sehr gut.
Wir hatten diese Woche in Oberösterreich den Spatenstich für das größte Photovoltaik-Kraftwerk in Österreich. Herr Dr. Bartenstein! Frau Staatssekretärin! Wir laden Sie gerne ein, dieses nach Fertigstellung zu besichtigen. Das läuft mit einer Kapazität von 1 Megawatt. Wir produzieren 1 Gigawatt Strom pro Jahr. Wir sind sehr stolz darauf. Das ist die Zukunft! Ich sage Ihnen, die Sonne wird uns keine Rechnung schicken, sondern uns helfen, das Klima zu schützen. (Beifall bei den Grünen.)
16.40
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Kirchgatterer. 3 Minuten Redezeit. – Bitte.
16.40
Abgeordneter Franz Kirchgatterer (SPÖ): Frau Präsidentin! Frau Staatssekretär! Im vorliegenden Punkt geht es um Energieeffizienz. Es geht um Sicherheit von Dampfkes-
seln, von Wärmekraftmaschinen, um Regelungen für die Betriebswärter – darauf wurde schon eingegangen –, um ihre Ausbildung, ihren Einsatz, die Prüfungen und die Prüfkommissäre. Dadurch sollen Sicherheit und Energieeffizienz gewährleistet werden.
Zur Energieeffizienz darf ich auf einen starken Impulsgeber hinweisen, der mehr als 100 000 Menschen anzieht, 912 Aussteller mehr als zufrieden macht und eine sehr positive Entwicklung nimmt. Ich spreche hier von der jährlichen Energiesparmesse Wels, die im März dieses Jahres um 6 Prozent mehr Besucher begrüßen konnte.
Betreffend Ökoenergie und erneuerbare Energie haben wir in Österreich hervorragende Betriebe, die international einen sehr guten Ruf genießen. Der Innovationsscheck für die Klein- und Mittelbetriebe von Ministerin Doris Bures, die thermische Sanierung im Konjunkturprogramm, der Klimafonds, aber auch die Wohnbauförderung in Oberösterreich von Landesrat Hermann Kepplinger sind vorbildliche Beispiele für äußerst erfolgreiche Aktivitäten. Auch die positiven Aktivitäten der Gemeinden und Städte möchte ich besonders erwähnen.
Meine Damen und Herren, vielfältige Initiativen, ein breites Angebot, Begeisterung der jungen Menschen für Forschung – all das sind positive Signale. Versorgungssicherheit und leistbare Energie für alle ist das zentrale Ziel.
Natürlich gibt es auch Irrwege – Irrwege, die die Nachhaltigkeit falsch bewerten oder weit zu optimistisch einschätzen. Weitere technische Entwicklungen werden den Energieanteil von außen minimieren, hier in Österreich, aber auch in der EU. – Danke. (Beifall bei der SPÖ.)
16.43
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Nun gelangt Frau Abgeordnete Mag. Brunner zu Wort. 4 Minuten Redezeit. – Bitte.
16.43
Abgeordnete Mag. Christiane Brunner (Grüne): Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau Staatssekretärin! Hohes Haus! Geschätzte Zuseherinnen und Zuseher! Was die Regierungsparteien heute wieder gemacht haben, und zwar das Ökostromgesetz von der Tagesordnung zu nehmen, spiegelt genau das wider, was Sie in den letzten zweieinhalb Jahren in Österreich mit dem Ökostrom machen, nämlich verzögern, verzögern, verzögern! Und in Zeiten von Klimawandel und Wirtschaftskrise finde ich das grob fahrlässig. (Beifall bei Grünen und BZÖ.)
Auch wenn dieser Tagesordnungspunkt gestrichen wurde und wir über das Dampfkesselbetriebsgesetz reden, werde ich mir erlauben, zum Ökostromgesetz zu reden, denn ich glaube, wenn das Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren mit dem Dampfkesselbetriebsgesetz in Verbindung steht, dann tut es das Ökostromgesetz auch, denn in der einen oder anderen Ökostromanlage kommen auch Dampfkessel zum Einsatz. (Heiterkeit des Abg. Kopf.)
Wir haben in den letzten Tagen wieder salbungsvolle Worte über erneuerbare Energie gehört, Güssing wurde zitiert. Aus meinen Aktivitäten dort fällt mir aber auch das eine oder andere Gesicht hier im Saal auf, das sich dort gerne hat fotografieren lassen. Ich finde es eigentlich sehr scheinheilig, wenn man das für sich in Anspruch nimmt, sich fotografieren lässt, dann aber tatsächlich nichts anderes tut, als hier zu blockieren. (Beifall bei den Grünen.) Solche Aktivitäten, wie es sie in Güssing gegeben hat, gehen jetzt leider nicht mehr; sie gehen in Güssing nicht mehr, sie gehen auch nirgendwo anders in Österreich, und zwar dank der Blockadepolitik von SPÖ und ÖVP.
Und schieben Sie die Schuld jetzt nicht auf die EU! Jetzt heißt es, na ja, die Europäische Kommission hat das nicht notifiziert. – Ja, die Europäische Kommission muss das notifizieren, sie hat es noch nicht notifiziert, aber da muss man auch genau dazusagen,
warum, nämlich wegen der Ausnahmeregelungen für die energieintensive Industrie. Es hat sehr wohl Angebote vonseiten der Kommission gegeben, dass unproblematische Teile sofort notifiziert werden könnten und sich im Bereich Ökostrom, in der Ökoenergiebranche in Österreich damit zumindest ein bisschen etwas tun kann und der Beginn von Aktivitäten zustande kommen kann.
Österreich ist zu über 70 Prozent von Energieimporten abhängig und wir bezahlen jährlich zweistellige Milliardenbeträge dafür, dass wir Energie, Energieträger aus dem Ausland importieren. (Abg. Bucher: 11,7!) – 11,7 ist zweistellig. – Und Sie halten es trotzdem nicht für notwendig, endlich ein funktionierendes Ökostromgesetz auf den Weg zu bringen. Seit zweieinhalb Jahren haben wir in Österreich einen Ausbaustopp. Das bedeutet Blockade, was die Unabhängigkeit von Österreich in der Energieversorgung angeht, das bedeutet Blockade für die Ökoenergiebranche, die eine innovative Branche ist und große Zukunft hat, das bedeutet Blockade bei Arbeitsplätzen. Tausende von Arbeitsplätzen könnten geschaffen werden, aber all das verhindern Sie mit Ihrer Blockadepolitik.
Wir haben daher heute einen Selbständigen Antrag eingebracht, weil wir endlich eine Totalreform des Ökostromgesetzes brauchen. Es wäre auch gut, wenn die Novelle in Kraft treten würde, damit wenigstens ein bisschen etwas passiert, aber sie ist nicht ausreichend. Langfristig brauchen wir eine Totalreform des Ökostromgesetzes in Österreich.
Wir brauchen eine Erhöhung der Förderdauer und angemessene Tarife. Wenn Sie schon immer von Versorgungssicherheit und Finanzierungssicherheit reden, dann müssen Sie genau das auch der Ökobranche geben; und dazu brauchen wir dieses Gesetz.
Das Ökostromgesetz ist für mich das Herzstück der Energiewende. Diesbezüglich würde ich mir erwarten, dass der Landwirtschaftsminister und der Wirtschaftsminister – sie sind beide nicht da – das auch zur Kenntnis nehmen. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass dies das Wichtigste sein wird, wenn Sie Ihre Energiestrategie auf den Weg bringen wollen, erfolgreich auf den Weg bringen wollen.
Von einem Umweltminister würde ich mir erwarten, dass er sich auch hier gegenüber dem Wirtschaftsminister durchsetzt. Das ist überhaupt nicht passiert! Daher bin ich der Meinung, dass wir in Österreich ein starkes, unabhängiges Umweltministerium brauchen. (Beifall bei Grünen und BZÖ.)
16.47
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Nun hat sich Frau Staatssekretärin Marek zu Wort gemeldet. – Bitte.
16.47
Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend Christine Marek: Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren des Hohen Hauses! Ich werde wieder zur Sache zurückkommen, zu dem, was hier zur Abstimmung steht.
Ich glaube, wir bauen auf einem sehr guten und hohen Sicherheitsniveau beim Dampfkesselbetriebsgesetz, dem Bundesgesetz über den Betrieb von Dampfkesseln und Wärmekraftmaschinen, auf. Wir haben ein hohes Niveau beim Personal, das natürlich auch diese Sicherheitsgarantie abgibt. Das heißt, die Qualifikation ist ganz wichtig. Wir entflechten nun die Regelungen, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Schiffsmaschinen und Lokomotiven betätigen, betrifft. Dies ist ja in einem anderen Gesetz bereits ausreichend geregelt. Einerseits wird dieser Teil weggenommen, andererseits werden die grenzüberschreitende Anerkennung, die berufliche Qualifikation und so weiter erleichtert, ohne den Verwaltungsaufwand zu vergrößern.
Damit haben wir bei sehr hohem Sicherheitsniveau geringere Kosten für die Betreiber der Anlagen, aber auch für die Behörden. Ich denke, das ist gerade in der jetzigen Situation ein wichtiges Ziel.
Ich möchte zum Herrn Abgeordneten Tadler vom BZÖ Folgendes sagen: Er hat hier gemeint, das könne er nicht ganz nachvollziehen, da sei etwas nicht ganz korrekt beziehungsweise nicht ausreichend verhandelt worden. Später sind eben allfällige Anpassungsmaßnahmen notwendig, wenn keine staatlich zertifizierte Ausbildung nachzuvollziehen ist. Allfällige Anpassungslehrgänge durchzuführen und zu verlangen, das ist wohl etwas, was im Sinne der Sache, im Sinne der Sicherheit und im Sinne des grenzüberschreitenden Europa ist. Hier sind wir auf einem ganz guten Weg.
Herr Abgeordneter Tadler hat hier noch hinsichtlich des § 3 Abs. 2 kritisiert, dass die Qualität nicht sichergestellt wäre. Ich kann nur empfehlen, dies in Verbindung mit dem § 5 Abs. 1 zu sehen. Da wird es noch eine entsprechende Spezifizierung durch Verordnung geben.
Was ich ein wenig spannend gefunden habe, ist, dass sich Herr Abgeordneter Tadler auf die Diskussion im Ausschuss bezogen hat. Meines Wissens – vielleicht habe ich das falsch in Erinnerung, Herr Abgeordneter – hat es die Opposition vorgezogen, im Ausschuss nicht anwesend zu sein. (Abg. Dr. Lichtenecker: Die Grünen waren da! – Abg. Mag. Kuzdas: Zehn Minuten!) – Das BZÖ, Frau Abgeordnete, hat hier die Diskussion im Ausschuss angesprochen.
Herr Abgeordneter Tadler, wenn Sie dagewesen wären, hätten Sie das im Ausschuss einbringen können. Ich glaube, wir haben hier ein gutes Gesetz zur Abstimmung zu bringen und zu beschließen. Ihre Kritikpunkte sehen Sie bitte in Verbindung mit den beiden Paragraphen! Und nur in dieser Verbindung macht das Sinn. Ich glaube, dass es hier ein qualitativ äußerst gutes Gesetz geben wird. – Danke. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
16.51
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Nun gelangt Herr Abgeordneter Dr. Matznetter zu Wort. Gewünschte Redezeit: 3 Minuten. – Bitte.
16.51
Abgeordneter Dr. Christoph Matznetter (SPÖ): Frau Präsidentin! Frau Staatssekretärin! Ich habe mich dennoch zu Wort gemeldet, obwohl wir gerade diesen Ökostromteil von der Tagesordnung abgesetzt haben. Bleiben wir einmal beim Dampfkesselbetriebsgesetz. (Abg. Dr. Lichtenecker: Gern!) Da Herr Kollege Tadler – so heißt er, glaube ich – beim vorletzten Punkt und auch jetzt erneut das Problem releviert hat, ob dazu ein §-27-Geschäftsordnungsantrag denkbar ist, sage ich: Danke, dass Sie das zitiert haben. Wir können nämlich diese Gelegenheit nützen, auch jenen Abgeordneten, die den Ausschuss leider verlassen haben, eine kleine Hilfestellung zu geben, nämlich hier zu diskutieren, wie es begonnen hat.
Dieses Gesetz regelt den Betrieb von Dampfkesseln, und zwar ganz genau jene Punkte, die einen wesentlichen Teil bei der Umweltverträglichkeitsprüfung ausmachen, nämlich die Frage, wie lange der Wärter bei einer solchen Wärmekraftmaschine – das sind zum Beispiel Kraftwerke, die betrieben werden – anwesend sein muss, welche Qualifikation er haben muss, wenn er krank ist oder auf Urlaub geht, wie sichergestellt ist, dass dort nicht eine Immission stattfindet.
Was sonst steht in einem engen Zusammenhang mit dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, in dem genau das die Fragestellungen sind, die geprüft werden müssen? – Daher war es ein enger Zusammenhang und kein loser und auch im Sinn von Dr. Zögernitz daher ein ganz passender Antrag nach § 27 GOG.
Nun zum zweiten Teil, der von Frau Mag. Brunner angesprochen wurde, die das Ökostromgesetz angeführt hat. Sie müssen sich schon entscheiden, was Sie wollen: Einerseits kritisieren Sie, dass keine Trägerraketen dahin gehend da sind, dass zum passenden Gesetz die endgültige Gesetzesbestimmung verhandelt werden kann, andererseits beschweren Sie sich aber darüber bis zu dem Punkt, wo Ihre Fraktion auszieht, dass dies nach § 27 GOG angepasst wird. Und dann beschweren Sie sich darüber, dass vorbereitend ein Ökostromgesetz für den Fall da ist, dass eine Entscheidung der Kommission erfolgt, wir in der Lage sind, rasch anzupassen – genau das, was Sie jetzt eingefordert haben, nämlich rasch Maßnahmen zu setzen. (Abg. Dr. Pirklhuber: ...! Das ist das Problem! Das ist ja völlig absurd!)
An dieser Stelle – und weil heute die Frage AUA auch dringender wird – Folgendes: Die Kommission ist keine Jukebox, wo man quasi fünf Wünsche einwirft und wo das gewünschte Stück dann herauskommt. Das können wir in mehreren Stücken lernen. Leider müssen wir auch lernen, dass auch große Firmen, die zum Beispiel unsere Airline kaufen wollten, nicht immer – sagen wir einmal – ideal vorgehen und offenbar auch von diesem „Glauben“ ausgehen. Wir werden lernen müssen, dass wir die europäischen Rechtsvorschriften sehr ernst nehmen müssen, vielerorts Dinge nicht als selbstverständlich annehmen können, nach der Devise, es sei eine „gmahte Wiesen“, und dass wir uns noch besser darauf vorbereiten müssen, dass solche Dinge auch einmal nicht funktionieren können. (Abg. Dr. Pirklhuber: Machen Sie bessere Gesetze! Warten Sie nicht!)
Herr Kollege, Sie brauchen sich nicht so aufzuregen, das ist ja eine Einladung dazu, auch für die Opposition, gemeinsam jetzt schon mitzuwirken, dass wir vielleicht im September/Oktober eine Ökostromgesetz-Novelle machen, bei der wir vielleicht eine All-Parteien-Einigung zustande bringen. Genau das wäre eine Chance, Frau Kollegin, das in diesem Falle so vorzubereiten, dass wir dann nicht jahrelang ein Problem mit den Nostrifikationsverfahren wegen einer Beihilfe haben.
In diesem Sinne lade ich Sie herzlich ein, statt aus dem Ausschuss auszuziehen, mitzumachen! – Danke. (Beifall bei SPÖ und ÖVP. – Abg. Brosz: Tatsächliche Berichtigung!)
16.54
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zu einer tatsächlichen Berichtigung hat sich Frau Abgeordnete Dr. Lichtenecker zu Wort gemeldet. Frau Abgeordnete, Sie kennen die Bestimmungen: zunächst den zu berichtigenden, dann den berichtigten Sachverhalt in 2 Minuten. – Bitte.
16.55
Abgeordnete Dr. Ruperta Lichtenecker (Grüne): Frau Präsidentin! Frau Staatssekretärin! Kollege Matznetter, du sagtest, dieses Gesetz sei im unmittelbaren Zusammenhang mit der UVP zu sehen. (Abg. Steibl: Ihr seid per du?)
Das ist es nicht, denn es geht rein um die Ausbildungsschiene und die Qualifikationsanforderungen. (Beifall bei den Grünen.)
Ich zitiere hier aus dem Vorblatt und den Erläuterungen: „Auswirkungen in umweltpolitischer Hinsicht, insbesondere Klimaverträglichkeit: Keine.“
Also es gibt keinen Zusammenhang mit dem UVP-Gesetz. Hören Sie endlich mit diesem Märchen auf! (Beifall und Bravorufe bei den Grünen.)
16.55
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
Wünscht der Herr Berichterstatter ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall.
Wir gelangen nun zur Abstimmung über den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über den Betrieb von Dampfkesseln und Wärmekraftmaschinen geändert wird, samt Titel und Eingang in 223 der Beilagen.
Ich ersuche jene Damen und Herren, die für diesen Gesetzentwurf sind, um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist einstimmig angenommen.
Wir kommen sogleich zur dritten Lesung.
Ich bitte jene Damen und Herren, die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, um ein entsprechendes Zeichen. – Das ist wiederum einstimmig. Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung angenommen.
*****
Ich mache darauf aufmerksam: Tagesordnungspunkt 14 wurde abgesetzt.
Sammelbericht des Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen über die Petitionen Nr. 1 bis 4, 6 bis 13 und 19 sowie über die Bürgerinitiativen Nr. 1 bis 4 (269 d.B.)
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Wir gelangen jetzt zum 15. Punkt der Tagesordnung.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Wir gehen in die Debatte ein.
Als Erster zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Vock. 3 Minuten gewünschte Redezeit. – Bitte.
16.57
Abgeordneter Bernhard Vock (FPÖ): Hohes Haus! Im Ausschuss waren wir uns darüber einig, dass die Petitionen, insbesondere dann, wenn sie von vielen Bürgern unterstützt werden, aufgewertet werden sollen und die Arbeit des Ausschusses aufgewertet werden soll. Es ist jetzt 17 Uhr, die Tageszeitungen sind geschrieben, die ORF-Kameras sind abgeschaltet, ich sehe hier keine Aufwertung des Ausschusses.
Wie schaut es generell mit der Arbeit des Petitionsausschusses aus? – Mehrere Bürger richten hilfesuchend ein Ansuchen an einen Abgeordneten, dieser stellt zum Beispiel die Petition „Gegen die Auflassung von Hainburger Haltestellen“ oder die Petition „Fahrplanänderung der ÖBB im Weinviertel“. Das BMVIT erklärt sich einfach als nicht zuständig; Sammelbericht, heute hier Endstation. – Variante eins.
Variante zwei. Abgeordnete des Hauses erkennen ein Problem, suchen mittels Unterschriften Zustimmung zu ihrer Petition „Weg mit den ORF-Gebühren“, die 162 000 Bürger unterschrieben haben. Was passiert? – Kurze Stellungnahme vom Bundesministerium für Finanzen und vom BKA; Enderledigung heute.
Oder Variante drei. Eine Bürgerinitiative sammelt Unterschriften zum Thema „Stopp Mochovce 3 & 4“. Wiederum Stellungnahme vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft. Dieses sagt sogar, dass die von der Bürgerinitiative angeführten sicherheitstechnischen Bedenken grundsätzlich zu Recht bestehen. Aber was passiert dann? – Enderledigung heute im Sammelbericht.
Was haben alle drei Varianten gemeinsam? – Zwei kurze, nicht öffentliche Debatte im Petitionsausschuss, heute eine Enderledigung und Sammelbericht.
Wenn uns keine besseren Lösungen für die Probleme der Bürger einfallen, dann wundert es mich nicht, wenn sich viele Bürger frustriert von der Politik abwenden. Arbeiten wir gemeinsam an einer Aufwertung der Bürgeranliegen! (Beifall bei der FPÖ sowie des Abg. Dr. Pirklhuber.)
16.59
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Nun gelangt Frau Abgeordnete Mag. Lohfeyer mit gewünschten 3 Minuten Redezeit zu Wort. – Bitte.
16.59
Abgeordnete Mag. Rosa Lohfeyer (SPÖ): Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! In den zwei Sitzungen des Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen in diesem ersten Halbjahr wurden in den jeweiligen Einlaufbesprechungen 30 Petitionen und neun Bürgerinitiativen behandelt. Der vorliegende Sammelbericht über diesen Zeitraum umfasst nunmehr 13 Petitionen und vier Bürgerinitiativen.
Die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger waren sehr vielfältig und reichten eben, wie schon erwähnt, von Verkehrsanliegen über Umwelt-, Gesundheits- und Landwirtschaftsthemen bis zur Sicherung von Postdienstleistungen und der Forderung nach Kinderrechten und Tierschutz im Verfassungsrang.
Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich für die gute Zusammenarbeit mit den Ausschussmitgliedern aller Fraktionen bedanken. Begrüßenswert ist, dass das Mindestalter für die Unterstützung von Bürgerinitiativen von 19 auf 16 Jahre gesenkt wurde. Es gab Anfang Juli bereits eine erste BürgerInneninitiative von Schülerinnen und Schülern für mehr Schülermitbestimmung und Schuldemokratie.
Begrüßenswert ist auch, dass die Petitionen und Bürgerinitiativen am Ende einer Gesetzgebungsperiode nicht mehr verfallen, sondern dem neu gewählten Nationalrat zugewiesen werden, wenn die Beratungen eben noch nicht abgeschlossen sind.
In der gemeinsamen Diskussion tauchte aber auch die Frage auf, wie wir den Ausschuss aufwerten können. Ich meine, es geht zum Ersten darum, wie wir das Petitionsrecht als Chance zum Dialog zwischen BürgerInnen und Staat weiterentwickeln können, und zum Zweiten darum, welcher Stellenwert dem Ausschuss im Rahmen des parlamentarischen Geschehens eingeräumt wird. Da meine ich auch die Redezeit und eben auch vielleicht die Übertragung in der Fernsehzeit. Das wurde auch in der vorigen Gesetzgebungsperiode schon mehrmals angesprochen. (Präsident Dr. Graf übernimmt den Vorsitz.)
Wir haben geplant, dem Geschäftsordnungskomitee im Herbst dazu gemeinsame Vorschläge zu unterbreiten. In Deutschland zum Beispiel wurde das Petitionsrecht aufgewertet und erhielt einen festen Platz im Grundgesetz. Seit 2005 können BürgerInnen dort ihre Anliegen nicht nur schriftlich einbringen, sondern auch mit Hilfe eines Web-Formulars über das Internet an den Ausschuss senden. Bereites zehn Prozent der Eingaben gehen in dieser Form ein, und jeder kann in einem Diskussionsforum auch mitdiskutieren.
Ich denke, auf diese Art und Weise lässt sich auch besser und komfortabler politische Mitsprache überregional vernetzt organisieren. Diese Einrichtungen in Deutschland könnten auch für uns Vorbild und Richtschnur für mehr Bürgernähe und Bürgerbeteiligung sein.
Ich freue mich, dass im Ausschuss die Bereitschaft vorhanden ist, diesen Dialog zwischen BürgerInnen und Parlament weiter zu verbessern und auszubauen. Wir von der
sozialdemokratischen Fraktion werden uns aktiv für eine Weiterentwicklung stark machen. (Beifall bei der SPÖ.)
17.02
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Dr. Pirklhuber. Eingestellte Redezeit: 6 Minuten. – Bitte.
17.02
Abgeordneter Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber (Grüne): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Hohes Haus! Die Bürgerinnen und Bürger, die Petenten, alle Menschen, die etwas bewegen wollen, erwarten sich von den Abgeordneten, dass diese ihre Anliegen ernst nehmen. Das ist einmal die erste und, wie ich glaube, wichtigste Herausforderung, denn das bedeutet wirklich, die Dinge zu prüfen und alle Möglichkeiten auszuschöpfen, dass diese Anliegen auch ernst genommen werden.
Die Kollegin Lohfeyer hat zu Recht gemeint, diesen Reformbedarf sehen eigentlich die meisten Mitglieder im Ausschuss; ich hoffe, alle. Sie haben auch kurz Deutschland erwähnt, den Deutschen Bundestag, die Online-Petitionsrechte: Ja, das ist zum Beispiel eine Innovation gewesen, die 2005 begonnen und 2008 in Deutschland institutionalisiert worden ist.
Wie viele Petenten haben sich an solchen Dingen beteiligt? Wie viele Bürgerinnen und Bürger? – Hunderttausende haben sich konkret an solchen wichtigen Dingen beteiligen können, und das ist eine Chance in einer Web-Gesellschaft, in der Vernetzung ein Thema ist. Es werden hier auch Verfahren von Partizipation entwickelt, die modern ist, die junge Menschen einlädt, die aber auch alte Menschen nutzen können. Wenn sie entsprechend geschult sind und dazu bereit sind, können auch alte Menschen diese Medien nutzen. Das ist eine Chance für alle BürgerInnen.
Es gäbe ja auch jetzt schon Möglichkeiten, die leider in den letzten Jahren kaum mehr genützt wurden, zum Beispiel die Möglichkeit von Enquete-Kommissionen des Petitionsausschusses, also dass wir hier auch ExpertInnen selbst laden. Sich einmal auf Basis der jetzt bestehenden Geschäftsordnung das Spektrum anzuschauen, wäre unsere erste Aufgabe bis Herbst. Wir werden das von unserer Seite gerne tun.
Das Zweite sind Beteiligungsverfahren. Ich lese Ihnen kurz aus einer Pressemitteilung vor, damit Sie sehen, was möglich wäre.
Konkret geht es um öffentliche Petitionsberatung zum Nichtraucherschutz. – Am Montag, dem 15. Jänner 2007 tagte der Petitionsausschuss erstmals in einer öffentlichen Sitzung, um neun Petitionen zum Nichtraucherschutz zu beraten. – Zitatende. Das war eine öffentliche Sitzung im Deutschen Bundestag.
Das ist auch ein Punkt. Gerade wenn es um Bürgerinitiativen und Petitionen geht, sollten wir uns ernsthaft Gedanken darüber machen, ob es nicht klug wäre, den Ausschuss grundsätzlich öffentlich zu machen oder bestimmte Sitzungen öffentlich zu machen und unter bestimmten Voraussetzungen auch die Bürgerinnen und Bürger zur Diskussion einzuladen.
Gleichzeitig waren in dieser Sitzung in Deutschland auch Vertreter der entsprechenden Fachausschüsse anwesend. Es waren Vertreter auch der Ministerien anwesend, und es war das Parlamentsfernsehen anwesend, das diese Sitzung live übertrug. Das ist eine Umsetzung im Deutschen Bundestag, die diese Dinge öffentlich macht und BürgerInnenbeteiligung bringt.
Das wäre vielleicht eine Variante oder eine Perspektive. Wir könnten uns das einmal in einer gemeinsamen Exkursion – eine Anregung, möglicherweise eine kluge Überlegung – vor Ort anschauen, auch alle technischen Voraussetzungen, jemanden vom
Haus hier mitnehmen, um zu schauen, was sich bei uns im Parlament umsetzen lassen würde.
Zur jetzigen Praxis der Stellungnahmen und der entsprechenden Bewertung und, ehrlich gesagt, leider Missachtung mancher Petitionen. – Der Kollege hat schon die Bürgerinitiative „Stopp Mochovce“ angesprochen, und ich muss sagen: Es ist schon eigenartig, wenn ein Minister dem Petenten, der Bürgerinitiative in dem Fall, recht gibt. Der Minister spricht ganz explizit davon, dass die angeführten sicherheitstechnischen Bedenken grundsätzlich zu Recht bestehen. Er beschreibt auch den aktuellen Stand der Verhandlungen mit der Slowakei et cetera; das ist alles korrekt dargestellt in dieser Stellungnahme
Aber der Minister sagt selbst: Darüber hinaus werden im Zuge des erwähnten Sicherheitsdialogs die vom Betreiber angekündigten Verbesserungen, die auch die von der Bürgerinitiative angeführten Sicherheitsaspekte betreffen, weiter zu prüfen sein. Daher erscheint es zum gegenwärtigen Zeitpunkt verfrüht, diesbezüglich endgültige Aussagen zu treffen. – Zitatende.
Meine Damen und Herren, eine solche Bürgerinitiative dann nur zur Kenntnis zu nehmen, halte ich für den falschen Weg. Das sollte – und das war auch unser Vorschlag – in den Umweltausschuss gehen, weil dort die Fachabgeordneten mit dem Minister über diese Frage weiter verhandeln und weiter diskutieren sollten, wenn es offen ist und wenn hier weiter Bedenken bestehen und nicht klar ist, wie die Slowakei das macht. (Beifall bei den Grünen.)
Abgesehen davon, dass die Bürgerinitiative eine sehr kluge und richtige Frage gestellt hat, nämlich: Warum wird eigentlich keine alternative Strategie umzusetzen versucht? Warum wird nicht mit der Slowakei über alternative Energien diskutiert?
Wenn man in Bratislava ist, am Hauptplatz sitzt oder dort in der Stadt unterwegs ist und in die Ebene hinunterschaut, dann sieht man auf die österreichischen Windparks – aber sie selbst haben keine. Ist das nicht auch eine Strategie, gemeinsam mit der Slowakei, mit den Vertretern dort an einer regionalen, mitteleuropäischen, erneuerbaren Energie-Strategie zu arbeiten, ihnen einen Ausstieg schmackhaft zu machen?
Natürlich haben sie ein Problem. Sie haben ein Problem mit der Energieversorgung, aber wir müssen ihnen helfen, diese Lösungen im Eigeninteresse sinnvoll und zukunftsorientiert zu machen. 150 Kilometer Entfernung Wien – Mochovce! Bitte, wenn dort wirklich etwas schiefgeht, sind wir alle betroffen, ist ganz Österreich massiv betroffen. Die Energien dorthin zu legen, das wäre aus unserer Sicht mehr als notwendig.
Daher: Nehmen Sie bitte solche Dinge nicht nur zur Kenntnis, sondern versuchen wir doch, die Dinge ernsthaft in den Ausschüssen weiterzuverhandeln und Strategien zu entwickeln, damit diese Anliegen so weit getragen werden, dass die BürgerInnen das Gefühl haben, dass dahinter die Energie der gesamten Politik steht!
Ein Bekenntnis gegen die Kernkraft gibt es ja parteiübergreifend. – Danke schön. (Beifall bei den Grünen sowie der Abg. Mag. Wurm.)
17.09
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als Nächste zu Wort gelangt Frau Abgeordnete Höllerer. Eingestellte Redezeit: 3 Minuten. – Bitte.
17.09
Abgeordnete Anna Höllerer (ÖVP): Herr Präsident! Hohes Haus! Ja, sie haben alle recht, meine Vorredner, wenn sie behaupten, es sind berechtigte und ernstzunehmende Anliegen der Bürgerinnen und Bürger, die mittels Petition von den Abgeordneten überreicht oder mittels Bürgerinitiativen in den Ausschuss eingebracht werden. Die Mit-
glieder dieses Ausschusses nehmen diese Bürgerinitiativen und Petitionen ernst. Sie wurden auch ordnungsgemäß verhandelt, und wir haben uns wirklich auch intensiv in den Einlaufbesprechungen mit den einzelnen Themen befasst. Wir haben überlegt, wie wir damit umgehen, wohin sie geleitet werden können, und es gab auch in vielen Dingen eine Übereinstimmung.
Wir haben sehr konstruktiv gearbeitet, und ich bedanke mich auch dafür. Für mich ist es eine neue Möglichkeit, mich in einem Ausschuss einzubringen, und ich finde diese Zusammenarbeit wirklich eine gelungene.
Sie, Herr Kollege, haben jetzt auch aufgezeigt, dass mit manchen Petitionen und Bürgerinitiativen nicht so umgegangen worden wäre, wie es die Bürgerinitiativen verdient hätten. Herr Abgeordneter Pirklhuber, Sie haben ganz spezifisch Mochovce angesprochen und die diesbezügliche Bürgerinitiative erwähnt, haben aber vergessen zu sagen, dass eine sehr umfangreiche Stellungnahme des Landwirtschaftsministers vorliegt, wo auf alle Kritikpunkte genauestens eingegangen wird und natürlich gesagt wird, dass die Bedenken der Bürgerinnen und Bürger zu Recht bestehen, dass aber die Kernenergie für unser Land keine zukunftsverträgliche Option darstellt.
Es steht weiters drinnen, dass Österreich allerdings die nationale Souveränität anderer Staaten, auch wenn es um die Wahl der Energieträger geht, anerkennen muss und dass die österreichischen Sicherheitsinteressen im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten – auch jetzt und immer – im Sinne des legitimen Schutzbedürfnisses der Bevölkerung bestens genutzt werden.
Herr Pirklhuber, wir haben eine weitere Petition, zu der auch Sie heute schon im Rahmen eines anderen Tagesordnungspunktes Stellung genommen haben bezüglich der Verbesserung des Umweltprogramms 2007 und wo Sie einen Neueinstieg in dieses Programm verlangen. Auch hier gibt es eine umfassende Stellungnahme des Landwirtschaftsministeriums, die dem Ausschuss zugegangen ist und mit der wir uns auch befasst haben, worüber wir debattiert haben, in der genau festgehalten ist, dass ab 2013 eine neue Programmperiode beginnt und dass solche Verträge, die fünf Jahre lang dauern, darüber hinaus dauern würden und es aus diesem Grund selbstverständlich nicht sinnvoll wäre, Neueinstiege möglich zu machen. Verbesserungen seien mittels Verordnung immer möglich, heißt es.
Begrüßen möchte ich, dass wir uns überlegen, diesem Ausschuss einen neuen Stellenwert zu geben, und dass wir uns vor allem zusammensetzen wollen, um über eine Reform des Ausschusses für Bürgerinitiativen und Petitionen zu diskutieren und darüber nachzudenken. Ich denke, dass wir bis in den Herbst hinein auch von allen Fraktionen diesbezüglich eine Stellungnahme haben werden, und ich bin sicher, dass es uns gelingen wird, den Ausschuss aufzuwerten, wenn wir da an einem Strang ziehen. Das müssen uns ganz einfach diese Anliegen der Bürgerinnen und Bürger wert sein. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
17.12
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als Nächste zu Wort gelangt Frau Abgeordnete Haubner. Ebenfalls 3 Minuten eingestellte Redezeit. – Bitte.
17.13
Abgeordnete Ursula Haubner (BZÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Ich darf mich erstmals als seit 14 Tagen gewählte Obfrau des Petitionsausschusses hier zu Wort melden und möchte feststellen, dass ich all das unterstreichen kann, was meine Vorrednerinnen und Vorredner bezüglich des Procedere, des Ablaufes im Petitionsausschuss gesagt haben, und dass ich das voll unterstütze.
Ich glaube, der Petitionsausschuss ist ein sehr wichtiger Ausschuss. Und so, wie er jetzt abläuft, ist er ein besonderer Ausschuss, ein Ausschuss, in dem man sich eigentlich inhaltlich mit den Fragen nicht beschäftigt, sondern letztendlich überlegt: Wo kann man diese Petition, diese Bürgerinitiative hinschieben? Das Beste, was den Bürgerinnen und Bürgern passieren kann, ist, dass die Petition, die Bürgerinitiative einem Ausschuss zugewiesen wird, denn dort besteht die Möglichkeit, im Rahmen einer Gesetzeswerdung oder zumindest in Form eines neuerlichen Antrages diskutiert und vielleicht auch sogar im Plenum beraten zu werden.
Ich denke, das ist einfach zu wenig. (Bravorufe bei Abgeordneten der SPÖ.) Das ist zu wenig, denn jeder von uns, der draußen aktiv unterwegs ist, wird immer wieder mit Problemen konfrontiert. Oft sind es sehr kleine regionale Sachen. Ich denke etwa nur daran, was wir letztes Mal verhandelt haben: Da ist es um die Landbriefträger in Kleinsölk oder um eine Schottergrube in Pichling bei Linz gegangen. Aber das sind Dinge, die für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort eminent wichtig und von großer Bedeutung sind.
Jeder Politiker, der mit diesem Problem konfrontiert wird, wird die Bürger unterstützen und wird sagen: Macht eine Petition, macht eine Bürgerinitiative und so weiter!, und man weckt Hoffnungen, die, wenn wir ganz ehrlich sind, in diesem Petitionsausschuss dann fast, sage ich, zunichte gemacht werden.
Darüber müssen wir uns wirklich sehr bald Gedanken machen. Und ich bin sehr froh und bedanke mich auch bei den Fraktionsvorsitzenden der anderen Parteien, dass wir hier wirklich einen gemeinsamen Weg finden wollen. Es gibt aus jeder Fraktion verschiedene Anregungen, verschiedene Ideen, die wir jetzt zu sammeln planen und die wir dann gemeinsam im Herbst auch dem Geschäftsordnungskomitee übermitteln wollen, um hier wirklich einmal die ersten Schritte zu setzen.
Wir sind uns alle einig darüber, dass wir dringenden Handlungsbedarf haben. Für mich ist auch nicht ganz nachvollziehbar, wenn wir Petitionen, die von Tausenden Menschen unterschrieben wurden – ich denke nur an die Abschaffung der ORF-Gebühren oder an die Bürgerinitiative „Aktion Leben“, wo es darum geht, Österreich kinder- und familienfreundlicher zu machen –, bloß zur Kenntnis nehmen, und das war es dann.
Daher sage ich: Es ist hier dringender Handlungsbedarf gegeben; das derzeitige Procedere ist nicht befriedigend. Wir müssen nicht nur den Ausschuss aufwerten, sondern wir müssen die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger aufwerten (Beifall beim BZÖ), damit diese nicht nur bei Wahlen ihr Votum abgeben können, sondern zwischen den Wahlen auch dieses Mittel der direkten Demokratie anwenden können.
Ich glaube, es wäre auch nicht uninteressant, dass man ähnlich, wie es Berichte zur sozialen Lage gibt, einen Bericht über die Situation der Menschen mit Behinderungen und Ähnliches oder einen Bildungsbericht, in regelmäßigen Abständen auch einen Bericht über die Basisdemokratie abfasst und diesen Bericht auch hier im Parlament diskutiert, ihn auch im Ausschuss natürlich entsprechend vorbereitet, damit man vor allem auch hier klar nachvollziehen kann: Was ist mit diesen Petitionen und Bürgerinitiativen eigentlich passiert? Was haben wir hier gemacht?
Das ist nur eine Anregung, aber ich denke, wir werden das gemeinsam in einem Paket erarbeiten. Ich bin gerne bereit, hier an einer Reform mitzuarbeiten, um das effizienter zu gestalten und vor allem auch unsere Glaubwürdigkeit im Hinblick darauf, wie wir mit Bürgeranliegen umgehen, zu stärken.
In diesem Sinne freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit. (Beifall beim BZÖ sowie bei Abgeordneten der SPÖ.)
17.17
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Hell. Eingestellte Redezeit: 2 Minuten. – Bitte.
17.18
Abgeordneter Johann Hell (SPÖ): Geschätzter Herr Präsident! Geschätzte Damen und Herren! Wir haben in den letzten Reden bereits einiges über den Sammelbericht des Ausschusses gehört. Das Petitionsrecht ist eine der wenigen direkten Möglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger, mit ihren Anliegen direkt an die Mitglieder des Parlaments heranzukommen. Hinter all diesen Anliegen stehen Menschen, die in Sorge und Verzweiflung von uns Hilfe erwarten.
Ich darf hier zwei dieser Anliegen herausgreifen, in denen der Ausschuss eine Kenntnisnahme empfohlen hat. Es sind Thematiken des öffentlichen Personennahverkehrs. Ich möchte die Kenntnisnahme der Petitionen 3 und 4 hier zum Anlass nehmen, um die Problematik, die auch von meinen Vorrednern bereits angesprochen worden ist, hier noch einmal aufzuzeigen.
Bei der Petition 3 geht es um Befürchtungen, dass die ÖBB-Haltestelle in Hainburg aufgelassen wird, und bei der Petition 4 geht es um die Verschlechterung des Zugangebotes nach dem Fahrplanwechsel im Dezember 2008. In beiden Fällen wurde eine Stellungnahme des BMVIT eingeholt. In beiden Stellungnahmen wird betont, dass das Ministerium kein Weisungsrecht hat und es eigentlich Sache des Unternehmens ÖBB ist, hier entsprechende Maßnahmen zu setzen, in Absprache mit den Ländern, hier konkret mit der NÖVOG.
Mir ist bewusst, dass auf die ÖBB ein enormer Kostendruck zukommt und dass viele Wünsche und Anregungen aus der Bevölkerung nach wirtschaftlichen Kriterien betrachtet werden müssen. Ich sage daher auch Danke dafür, dass sich die ÖBB-Personenverkehr AG innerhalb von wenigen Wochen dann bereit erklärt hat, diese Fahrplanänderungen zurückzunehmen oder den Wünschen anzupassen.
Eine Form der Erledigung von Petitionen haben wir heute noch nicht angesprochen, nämlich: wenn sie sich selbst erledigen. In diesem Fall haben wir diese Situation gehabt.
Offen bleibt allerdings die Frage, wie wir zukünftig mit solchen Petitionen umgehen, wo wir einfach eine Stellungnahme bekommen: Ist nicht möglich.
Hier bin ich bei meinen Vorrednerinnen und Vorrednern: Ich sehe hier auch enormen Handlungsbedarf. Ich glaube, es geht hier um die Anliegen der betroffenen Bürgerinnen und Bürger, die einfach auch spüren müssen, dass mit ihren Petitionen auch ein Nutzen und ein Sinn verbunden sind. Nur so werden wir unserer Aufgabe auch gerecht. – Danke. (Beifall bei der SPÖ sowie bei Abgeordneten der ÖVP.)
17.20
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als nächste Rednerin gelangt Frau Abgeordnete Franz zu Wort. Eingestellte Redezeit: 2 Minuten. – Bitte.
17.21
Abgeordnete Anna Franz (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte auf die von der „Aktion Leben“ eingebrachte Bürgerinitiative „Mit Kindern in die Zukunft!“ eingehen. In dieser Bürgerinitiative werden verschiedene berechtigte Maßnahmen für ein kinder- und elternfreundliches Österreich gefordert. Diese Petition wurde dann im Ausschuss zur Kenntnis genommen, mit der Begründung, dass die Forderungen weitgehend erfüllt sind.
In einem Punkt ist aber ein oberstgerichtliches Urteil angesprochen, das sehr problematisch ist. Danach ist ein Arzt, der eine Schwangere nicht ausreichend über erkenn-
bare Anzeichen einer drohenden Behinderung aufklärt, grundsätzlich für den gesamten Unterhaltsaufwand des zur Welt gebrachten behinderten Kindes haftbar. Staatssekretärin Marek hat heute schon in der Debatte über den Behindertenbericht darauf hingewiesen.
Die Folgen dieses Urteils sind weitreichend: Einerseits besteht die Gefahr, dass es zu einer Art Absicherungsmedizin kommt – Ärzte könnten bei nicht genau feststellbaren Behinderungen unter Umständen zu einer Sicherheitsabtreibung raten –, aber auch die werdenden Eltern sind natürlich verunsichert.
Dieses Urteil, meine ich, darf nicht hingenommen werden. Die Auffassung, dass der für ein unerwünschtes Kind zu leistende Unterhaltsaufwand einen erstattungsfähigen Schaden darstellt, widerspricht meines Erachtens den ethischen Grundvorstellungen.
Deshalb habe ich dazu eine Petition eingebracht mit dem Ziel, im Schadenersatzrecht eine entsprechende Änderung herbeizuführen. Im Regierungsprogramm wurde das auch schon festgelegt und außer Streit gestellt. Deshalb bin ich froh und hoffe, dass es eine rasche gesetzliche Umsetzung gibt. (Beifall bei der ÖVP.)
17.23
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Dr. Widmann. Eingestellte Redezeit: 5 Minuten. – Bitte.
17.23
Abgeordneter Mag. Rainer Widmann (BZÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Der Petitionsausschuss gibt uns die Möglichkeit, anhand der zweiten Bürgerinitiative „Stopp Mochovce“ auch über die Energiepolitik oder über das Versagen dieser Regierung in der Atompolitik zu diskutieren. Diese Bürgerinitiative ist heute bereits mehrfach erwähnt worden, und es ist festgestellt worden, dass in Mochovce ein gefährlicher West-Ost-Mix verwendet wird, das Kraftwerk befindet sich in einem Erdbebengebiet, und darüber hinaus wurden beispielsweise keine Alternativen geprüft, die sinnvoll wären.
Das Lebensministerium schreibt in der Stellungnahme, die bereits an anderer Stelle zitiert worden ist:
„Österreich lehnt die energetische Nutzung der Kernenergie ab – u. a. weil sie weder mit den Prinzipien nachhaltiger Entwicklung in Einklang zu bringen ist noch eine kostengünstige und zukunftsverträgliche Option zur Bekämpfung des Klimawandels darstellt.“
Ich frage jetzt diese Regierung, die nicht anwesend ist, was sie denn getan hat gegen den Klimawandel und dafür, dass Österreich energieautark wird, und dafür, dass wir damit letztlich auch glaubwürdig in der Anti-Atom-Politik sind. (Beifall beim BZÖ sowie der Abg. Dr. Moser.)
Sie hat nichts getan, außer in Sonntagsreden zu sagen, dass sie gegen Atomenergie ist (Abg. Mag. Kogler: Richtig! Wenn es keinen Sonntag mehr gibt, gehen ihnen die Reden aus!), außer in das Regierungsprogramm hineinzuschreiben, sie betreibe eine Anti-Atom-Politik. Konkrete Fakten, mit Zahlen und Daten hinterlegt, finden nicht statt. Und das ist der Punkt.
Das heißt, diese Atompolitik ist gescheitert, so etwa bei Temelín – da interessiert sich diese Regierung nicht für einstimmige Nationalratsbeschlüsse, die etwa vorsehen, dass man eine Völkerrechtsklage gegen Temelín einbringt. Sie interessiert sich nicht dafür, was mit den Euratom-Mitteln passiert; sie interessiert sich nicht dafür, dass man diese Mittel besser etwa für erneuerbare Energie einsetzen könnte; und sie interessiert sich letztlich auch nicht für Mochovce.
Das heißt, eine glaubwürdige Anti-Atom-Politik ist gescheitert, und die Regierung hat – und das ist eigentlich das Schlimme dabei – auch verabsäumt, im eigenen Bereich die Hausaufgaben für ein energieautarkes Österreich zu machen. Ich darf daran erinnern, dass diese Regierung, diese Stillstandsregierung, vor knapp einem Jahr angekündigt hat, es wird einen Masterplan für erneuerbare Energien geben. – Es gibt bis heute nicht einmal ordentlich eingesetzte Arbeitskreise, wie ich höre. Man bemüht sich irgendwie kompliziert, mit den Ländern etwas auf die Füße zu stellen. Stattfinden tut es derzeit nicht.
Das ist schade, denn wir vom BZÖ haben in der Zwischenzeit ein Energiekonzept/-programm auf den Tisch gelegt. (Zwischenruf der Abg. Dr. Lichtenecker.) Wir haben auch in Form von Metastudien dargelegt, dass Österreich durchaus in der Lage wäre, Kollegin Moser und Kollegin Lichtenberger (Abg. Dr. Lichtenecker: -ecker! Lichtenecker!), energieautark zu werden. Es ist möglich! Aber diese Regierung macht das nicht, obwohl es eigentlich ihre ureigenste Aufgabe wäre.
Was macht diese Regierung? – Sie macht 100-Millionen-Mickeymouse-Programme in der thermischen Sanierung, obwohl ein Vielfaches davon notwendig und richtig wäre, obwohl Sie wissen, dass thermische Sanierung ein Jobmotor wäre, dass sie dazu beitragen würde, das Klima zu schützen, und dass sie auch helfen würde, Energie einzusparen.
Dem – so kann man eigentlich die Sache zusammenfassen – schaut diese Regierung, wie das Häschen der Schlange, ins Auge und sagt: Na ja, schauen wir halt zu, wie die Renaissance der Atomkraft auf europäischer Ebene stattfindet!, und sie tut nichts dagegen.
Im Gegensatz dazu anerkennt aber etwa der Chef der Energie Control oder auch der Chef der Wirtschaftskammer Leitl, dass die Strompreise in Österreich viel zu hoch sind, gerade auch für die KMUs, aber auch für die kleinen Stromabnehmer. Der Verbund-Chef sagt sogar, die Strompreise werden nächstes Jahr massiv steigen. Ich glaube, es kann nicht Aufgabe einer Energiepolitik sein, dass man zusieht, wie einerseits Atomkraftwerke gebaut werden, dass man nichts tut, um erneuerbare Energien auszubauen, dass man zusieht, wie die Strompreise lustig in die Höhe steigen. Die eigene Wirtschaftskammer sagt, sie sind viel zu hoch – aber tun tut man nichts dagegen! Das ist eine echte Schande, ein Versagen in der Energiepolitik! (Beifall beim BZÖ sowie bei Abgeordneten der Grünen.)
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich komme auf das Ökostromgesetz zurück. Ich kann Ihnen ehrlich sagen, mich rufen inzwischen auch Vertreter der Regierungsfraktionen als Energiesprecher an und ersuchen mich, ihnen zu helfen, weil sie sagen: Da geht nichts weiter beim Ökostromgesetz! Das liegt draußen in Brüssel. Der Wirtschaftsminister tut nichts, der Umweltminister auch nicht, und wir laufen Gefahr, dass die eine oder andere Biomasseanlage zugesperrt werden muss, weil man dort mangels geeigneter, guter Einspeisetarife nicht mehr in der Lage ist, wirtschaftlich zu agieren. – So weit sind wir!
Wenn das Ökostromgesetz erst ein Jahr dahinschlummert, dann frage ich mich: Wenn irgendein Beamter in Österreich einen Akt länger als ein halbes Jahr liegen lässt, Sie wissen, was dann passiert? Dann kann man einen Devolutionsantrag stellen! – Bei der EU ist das offenbar anders: Da liegt das ein Jahr draußen, und man schaut zu, wie nichts passiert. Da schlage ich vor: Wenn die EU nichts macht oder der zuständige Minister nicht in der Lage ist, hier etwas voranzubringen, dann muss man das den Nationalstaaten rückverweisen, damit man das Gesetz trotzdem durchsetzen kann, um der erneuerbaren Energie zum Durchbruch zu verhelfen.
Meine Damen und Herren, Sie sehen also: Wir brauchen einen Masterplan für Energie, und diese Regierung hat ein Jahr verstreichen lassen, sie hat gar nichts getan. Sie hat nichts getan für die Energieeffizienz, sie hat nichts getan fürs Energiesparen, sie hat nichts getan für die erneuerbaren Energien, sie hat nichts getan im Forschungs- und Entwicklungsbereich, um hier Österreich zukunftsfit zu machen. Es fehlt ihr die Ernsthaftigkeit, und das Einzige, was überbleibt, ist: Viel reden, wenig tun oder gar nichts tun – beim Masterplan insbesondere.
Daher bringe ich jetzt erneut einen Antrag ein, um diese Regierung und diese Regierungsfraktionen etwas zu unterstützen und ihnen etwas weiterzuhelfen. Ich bin guter Dinge, dass Sie das tun werden, wenn Sie Ihren großen Worten auch endlich Taten folgen lassen.
Daher bringe ich folgenden Antrag ein:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Widmann, Haubner, Hagen, Kolleginnen und Kollegen
„Die Bundesregierung beziehungsweise die ressortzuständigen Bundesminister werden aufgefordert, gerade im Sinne der Notwendigkeit einer glaubwürdigen Politik gegen die Kernkraft dem Nationalrat umgehend einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der geeignet ist, den derzeitigen Stillstand im Ökostrombereich zu beenden.“ – Also: Ökostromgesetz!
„Darüber hinaus geht der Nationalrat in diesem Zusammenhang davon aus, dass die heimischen Energieversorgungsunternehmen nicht zuletzt vor dem Hintergrund der gesunkenen Großhandelspreise diese Senkung im Sinne einer Entlastung der Konsumentinnen und Konsumenten und insbesondere der kleinen und mittleren Unternehmen auch umgehend an die Endverbraucher weitergeben.“
*****
Also: Niedriger Strompreis!
Unterstützen Sie das! Tun Sie etwas! (Beifall beim BZÖ.)
17.29
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Der soeben eingebrachte Entschließungsantrag ist ausreichend unterstützt, steht im Zusammenhang mit der Grundmaterie und daher auch mit in Verhandlung.
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Mag. Widmann, Haubner, Hagen, Kolleginnen und Kollegen betreffend Atomkraft verhindern durch Forcierung erneuerbarer Energie, Ausschöpfen von Energieeinsparungs- und Strompreissenkungspotentialen!
eingebracht am 10.07.2009 im Zuge der Debatte zum Sammelbericht des Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen über die Petitionen Nr. 1 bis 4, 6 bis 13 und 19 sowie über die Bürgerinitiativen Nr. 1 bis 4 (269 d.B.)
Die mit dem gegenständlichen Sammelbericht mitbehandelte Bürgerinitiative Nr. 2 zielt darauf ab, den Fertigbau und eine Inbetriebnahme des AKW Mochovce zu verhindern.
In diesem Zusammenhang wird seitens der Bürgerinitiative zurecht kritisiert, dass alternative Szenarien zur Atomkraft, wie erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Stromeinsparungen überhaupt nicht untersucht wurden.
Gerade hier ist Österreich gefordert, um jenen den Wind aus den Segeln zu nehmen, die als einen der Vorteile von Atomkraft den daraus resultierenden billigen Strom hervorstreichen. Aus diesem Grund ist es daher auch erforderlich, dass durch die Forcierung von erneuerbaren Energien, sowie durch die Weitergabe von Strompreissenkungen auch an die Konsumentinnen und Konsumenten, Bestrebungen zur Renaissance der Atomkraft ein Riegel vorgeschoben wird.
Die Realität in Österreich ist jedoch eine andere. Neben dem evidenten Stillstand im Ökostrombereich ist die Preissituation am heimischen Energiemarkt nach wie vor sehr angespannt. Die Strompreise für KMU sollten deutlich niedriger sein als das, was wir derzeit haben,“ waren die klaren und unmissverständlichen Worte des Chefs der e-controll GmbH Walter Boltz in einer entsprechenden Stellungnahme vom 15. Juni 2009 (OTS191/15.06.2009) und führt weiter aus, dass es vor allem bei kleinen und mittleren Unternehmen massive Benachteiligungen gebe. Das betrifft insbesondere die mangelnde Transparenz der Tarife ebenso wie die derzeitige asymmetrische Gestaltung der Preisgleitklauseln.
In dieselbe Kerbe schlägt der Präsident der Wirtschaftskammer Österreichs, wenn er in diesem Zusammenhang feststellt, dass zwar die Großhandelspreise massiv gesunken sind - und zwar von 116 Euro/MWh im Juli des Vorjahres auf 68 Euro/MWh im Juli 2009 – jedoch die KMU davon kaum etwas spüren.
Im Gegenteil. Die Arbeiterkammer kritisiert in einer entsprechenden Aussendung die unerfreuliche Tatsache, dass die Strompreise nicht nur nicht gesunken sondern im vergangenen Jahr sogar um fünf Prozent gestiegen sind und fordert daher die Energieversorger auf, die sinkenden Preise auch an die Konsumenten weiterzugeben.
Im Sinne einer Forcierung der erneuerbaren Energien sowie einer dringlichen Entlastung der Stromkunden und insbesondere der kleinen und mittleren Unternehmen, für die gerade in Krisenzeiten auch die Höhe der Energiekosten mitentscheidend für den weiteren Unternehmenserfolg sind, ist es daher ein Gebot der Stunde, dass die Energieversorgungsunternehmen die mittlerweile erfolgte Halbierung der Großhandelspreise auch an ihre Kunden weitergeben.
Aus diesen Gründen stellen die unterfertigten Abgeordneten daher nachstehenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung bzw. die ressortzuständigen Bundesminister werden aufgefordert, gerade im Sinne der Notwendigkeit einer glaubwürdigen Politik gegen die Kernkraft dem Nationalrat umgehend einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der geeignet ist, den derzeitigen Stillstand im Ökostrombereich zu beenden.
Darüber hinaus geht der Nationalrat in diesem Zusammenhang davon aus, dass die heimischen Energieversorgungsunternehmen nicht zuletzt vor dem Hintergrund der gesunkenen Großhandelspreise diese Senkung im Sinne einer Entlastung der Konsumentinnen und Konsumenten und insbesondere der kleinen und mittleren Unternehmen auch umgehend an die Endverbraucher weitergeben.“
*****
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Lipitsch. Eingestellte Redezeit: 2 Minuten. – Bitte.
17.30
Abgeordneter Hermann Lipitsch (SPÖ): Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen, liebe Kollegen! Die Möglichkeit, Petitionen und Bürgerinitiativen einzubringen, nehmen die Menschen ernst. Sie erwarten sich aber vom Hohen Haus auch eine dementsprechende Behandlung, wie meine Vorrednerinnen und Vorredner bereits angemerkt haben.
Unter den im Sammelbericht aufgeführten 17 Punkten sticht besonders der Bereich Verkehr mit fünf Punkten heraus. Ich möchte die Petition 2, überreicht von den Abgeordneten Mag. Rosa Lohfeyer und Mag. Johann Maier sowie vom Vizebürgermeister von Bischofshofen, Hansjörg Obinger, kurz beleuchten. In dieser Petition wird der ehestmögliche Bahnausbau Pass Lueg gefordert, mit der Errichtung der Tunnelkette Golling – Werfen.
Neben Aspekten des Klima- und Umweltschutzes betonen die Einbringer vor allem Sicherheitsgründe sowie die Beseitigung von Langsamfahrstellen. Aus Witterungsgründen – Lawinen, Hochwasser – kommt es zu Unterbrechungen dieser Bahnstrecke. Davon betroffen ist auch die Strecke Richtung Graz und Klagenfurt, die, weiterführend Richtung Slowenien und Italien, bereits öfters unterbrochen war. Der Ausbau über die Tauern, eine weitere Engstelle, wurde ja abgeschlossen. Attraktive Bahnfahrzeiten zwischen Salzburg Stadt und den südlichen Landesteilen wären hier die positiven Zusatzeffekte. Aus all diesen Gründen wird die Errichtung einer Tunnelkette für sinnvoll und notwendig erachtet.
In der eingeforderten Stellungnahme des Bundesministeriums für Verkehr wird festgehalten, dass der Ausbau der Bahnstrecke im Rahmen der rollierenden Fortschreibung des Rahmenplanes mitbetrachtet wird. Das Bundesministerium hält fest, dass ein Ausbau mit Vorteilen für den Nah- und Regionalverkehr verbunden wäre, wie es die Einbringer gefordert haben.
Dieses Anliegen zeigt auf, wie wichtig und richtig die Entscheidung unserer Bundesministerin Doris Bures ist, intensiv in den Infrastrukturausbau der Bahn zu investieren, damit solche Anliegen baldigst umgesetzt werden können. (Beifall bei der SPÖ.)
17.31
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als Nächster gelangt Herr Abgeordneter Schmuckenschlager zu Wort. Eingestellte Redezeit: 2 Minuten. – Bitte.
17.32
Abgeordneter Johannes Schmuckenschlager (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzte Damen und Herren! Ich möchte auf zwei Petitionen speziell eingehen. Und zwar geht es dabei einerseits um die Straffreiheit für Nicht-Impfen bei der Blauzungenkrankheit. Hier gilt es festzuhalten, dass die Blauzungenkrankheit eine Tierseuche ist und als solche auch zu behandeln ist. In der Petition wird gesagt, dass 80 000 bäuerliche Betriebe von der Impfpflicht betroffen sind. – Die Impfpflicht ist leider die Konsequenz. Betroffen sind sie von der Blauzungenkrankheit! (Beifall des Abg. Eßl. – Zwischenruf des Abg. Dr. Pirklhuber.)
Die Impfpflicht gibt vielmehr den Betrieben die Sicherheit, dass ihre Tierbestände und somit ihre Wirtschaftsgrundlage gesund erhalten bleiben – und nicht, so wie in manchen anderen europäischen Staaten, elend zugrunde gehen müssen.
In der Petition wird angeführt, dass Betriebe, die die Zwangsimpfung aus Tierschutz- oder aus Management-Gründen verweigern, strafbefreit gehören. – Sie meinen also,
Betriebe sollten aus „Management-Gründen“ – also aus Geldoptimierungsgründen – nicht impfen und damit die Existenz anderer Betriebe gefährden? – Ich glaube, das kann bei dieser heiklen Materie wirklich nicht der Sinn sein.
Weiters fordern Sie die Prolongierung des Neueinstiegs sowie Verbesserungen im ÖPUL-Programm. Dieses Programm garantiert unseren Bauern den Erhalt von Geldern für erbrachte Umweltleistungen. Es gibt ihnen die Garantie, diese Vergütungen – mit Verträgen bis 2013 fixiert – zu erhalten, und damit eine Sicherheit für die nächsten Jahre, die sicherlich wirtschaftlich noch sehr turbulent sein werden.
Es wird von Ihnen auch eine von der AMA unabhängige Schiedsstelle für Förderwerber gefordert. – Ich möchte darauf hinweisen, dass die AMA gerade mit ihrer restriktiven Vorgehensweise, mit ihrem Aufzeigen und Kontrollieren – was für die Betroffenen sicherlich nicht immer angenehm ist – der Garant dafür ist, dass Fördergelder auch dort ankommen, wo sie hingehören. Nicht zuletzt wird auch immer wieder durch den Bericht der EU und dadurch, dass wir keine Mittel zurückzahlen müssen, weil wir sie eben so gut vergeben, bestätigt, dass hier die Arbeit hervorragend erledigt wird.
Viele Diskussionen des heutigen Tages zu agrarpolitischen Themen sind sehr vielschichtig geführt worden, aber in einem sind wir uns ganz bestimmt sicher: dass wir das Wohl der landwirtschaftlichen Betriebe in unserem Land im Auge behalten.
In Ihrer Petition haben Sie einen Punkt zur Förderung der bäuerlichen Kompostierung angeführt. – Ich habe manchmal die Befürchtung: Wenn die Agrarpolitik zu grün wird, führen wir bald nicht die Diskussion über die bäuerliche Kompostierung, sondern können bald die bäuerlichen Betriebe kompostieren. (Beifall bei Abgeordneten der ÖVP. – Abg. Dr. Haimbuchner – in Richtung ÖVP –: Er hätte sich aber einen Zwischenapplaus auch einmal verdient!)
17.34
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als Nächster gelangt Herr Abgeordneter Keck zu Wort. Eingestellte Redezeit: 2 Minuten. – Bitte.
17.35
Abgeordneter Dietmar Keck (SPÖ): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Vor acht Jahren bin ich zum ersten Mal hier vor Ihnen gestanden und habe Sie mit dem großen Problem in Sachen Petitionen und Bürgerinitiativen konfrontiert. Es waren keine Vorwürfe gegen die Petitionen – die ich auch damals und bis heute vorgebracht habe –, es waren auch keine Vorwürfe gegen die Arbeit des Ausschusses, sondern es waren Vorwürfe gegenüber der Geschäftsordnung, nämlich gegenüber dem Umstand, dass sämtliche Petitionen und Bürgerinitiativen mit dem Ende der Legislaturperiode ihre Gültigkeit verloren haben. Das hat bedeutet, dass zum Beispiel eine Petition gegen das Lkw-Parken in Wohngebieten aus Linz in dieser Gesetzgebungsperiode zum dritten Mal eingebracht werden musste, damit sie an den Verkehrsausschuss weitergeleitet werden konnte.
Es gibt weitere Beispiele zuhauf: Da gibt es Tierschutzpetitionen zum Schutz der Orang-Utans (Beifall bei der SPÖ), es gibt Bildungspetitionen, es gibt Umweltschutzpetitionen – sie alle sind verfallen aufgrund dieses Passus, den wir in der Geschäftsordnung gehabt haben. Verfallen ist damit aber auch der Glaube der Betroffenen an unser Parlament.
Ich möchte mich daher wirklich bedanken, denn das Drängen über den Ausschuss all diese Jahre hindurch hat geholfen, die Geschäftsordnung wurde ja geändert. Petitionen und Bürgerinitiativen verfallen nicht mehr, und wir können denen, die diese Petitionen und Bürgerinitiativen einreichen, sagen, dass diese sehr wohl – in den Ausschüs-
sen, oder was immer der Petitionsausschuss entscheidet und tut – natürlich behandelt werden. (Beifall und Bravorufe bei der SPÖ.)
17.36
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Mag. Cortolezis-Schlager. Eingestellte Redezeit: 2 Minuten. – Bitte.
17.37
Abgeordnete Mag. Katharina Cortolezis-Schlager (ÖVP): Herr Präsident! Hohes Haus! Ich darf inhaltlich zur Petition Nummer 12 betreffend Ausweitung des Rechtsunterrichts in Handelsakademien und Handelsschulen, eingebracht vom Abgeordneten Auer, Stellung nehmen. In dieser Petition wird sowohl Politische Bildung als eigenes Fach für Handelsakademien und Handelsschulen gefordert als auch diagnostiziert, dass die Wirtschaftspädagogen derzeit keine ausreichende Ausbildung in der Politischen Bildung haben. Die Stellungnahme des BMUKK zeigt auf, dass Politische Bildung im Zusammenhang mit Recht in den Handelsakademien und Handelsschulen gelehrt wird.
Wir haben dies zur Kenntnis genommen, denn wichtig ist für die Bürgerinnen und Bürger, dass Politische Bildung tatsächlich in höchster Qualität unterrichtet wird. (Beifall bei der ÖVP.)
Bundesministerin Schmied kündigte bereits für 2008 mehr Politische Bildung an. Es ist im Moment noch bei der Ankündigung geblieben. Wir brauchen auch ein gemeinsames Konzept für die Politische Bildung zwischen der Sekundarstufe 1 und der Sekundarstufe 2. Ich möchte mich daher dafür einsetzen, dass wir eine flächendeckende Evaluierung der Politischen Bildung vornehmen, mit dem Qualitätsmanagementsystem der Berufsbildung, das heißt, die gesamte Berufsbildung evaluieren, aber auch die AHS-Oberstufe, denn das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip.
Bei der Aus- und Weiterbildung für die Pädagoginnen und Pädagogen muss die Qualität gesichert werden. Wir brauchen mehr Politische Bildung in den Lehrplänen und in den Schulen, wir brauchen aber keine aktiven Politiker und Politikerinnen im Hochschulrat der Pädagogischen Hochschule. Es ist daher wichtig, dass aktive Politiker künftig auch in den Pädagogischen Hochschulen im Hochschulrat nicht mehr vertreten sind. Hier bedarf es einer Novelle zu den Pädagogischen Hochschulen. Seit gestern ist das UG für die Pädagogischen Hochschulen das neue Vorbild, der Leuchtturm. Ich fordere daher Bundesministerin Schmied eindrücklich auf, sich das UG als Vorbild für eine Reform der Pädagogischen Hochschulen zu nehmen. (Beifall bei der ÖVP.)
17.39
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als nächster Redner gelangt Herr Abgeordneter Spindelberger zu Wort. 2 Minuten Redezeit. – Bitte.
17.39
Abgeordneter Erwin Spindelberger (SPÖ): Meine Damen und Herren! Im Jänner dieses Jahres hat es unter der Bevölkerung der steirischen Gemeinde Kleinsölk einen richtigen Aufschrei gegeben, als ruchbar wurde, dass den von der Post geplanten Restrukturierungsmaßnahmen auch der Landbriefträger dieser Gemeinde zum Opfer fallen soll. Das hat schlussendlich dazu geführt, dass über 300 der 596 Einwohner zählenden Gemeinde eine Petition unterfertigt haben, mit dem mehr als berechtigten Wunsch, dass die postalische Versorgung weiter aufrechterhalten bleiben möge.
In diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass es den besorgten Bewohnerinnen und Bewohnern von Kleinsölk auch darum ging, aufzuzeigen, dass es einfach nicht sein kann, dass Menschen ohne eigenes Fahrzeug, aber auch ältere Menschen
in diesem entlegenen Tal, in dieser auf 986 Höhenmeter liegenden Gemeinde künftig von der Versorgung mit Geld-, Brief- oder Paketsendungen abgeschnitten werden.
Kollegin Haubner hat bereits gesagt, dass es wirklich berechtigte Anliegen sind, die es gilt, hier im Parlament umzusetzen. Stellen Sie sich einmal vor, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie es jemandem geht, der von solchen Einrichtungen der Daseinsvorsorge einfach abgeschnitten wird – und das alles nur, weil sich der Postvorstand eingebildet hat, dass er alles nur mehr betriebswirtschaftlich betrachten muss.
Ich finde es wichtig, dass Kollegin Hakel als zuständige steirische Abgeordnete diese Petition im Parlament eingebracht hat, denn das hat dazu geführt, dass letztendlich Schwung in die ganze Sache gekommen ist. Die österreichische Post hat dem BMVIT, welches sich in dieser Angelegenheit dankenswerterweise eingeschaltet hat, entgegen ihrer ursprünglichen Intention mitgeteilt, dass auch in Zukunft eine flächendeckende, qualitativ hochwertige Versorgung der Bevölkerung von Kleinsölk mit Postdienstleistungen gesichert bleibt und eine kompetente Zustellerin dort ihren Dienst versehen wird. – Man sieht, auch Petitionen können mit einem Happy End enden. (Beifall bei der SPÖ.)
17.41
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als nächste Rednerin gelangt Frau Abgeordnete Mag. Aubauer zu Wort. Eingestellte Redezeit: 2 Minuten. – Bitte.
17.41
Abgeordnete Mag. Gertrude Aubauer (ÖVP): Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Einige Vorredner haben es ja schon angesprochen, und Sie hören es wahrscheinlich auch immer wieder: Bürger beklagen, „die da oben“ – gemeint sind die Politiker – bestimmen sowieso über unsere Köpfe hinweg. – Das mag manchmal schon zutreffen, aber es gibt eben die Instrumente Petition und Bürgerinitiative. Diese Möglichkeit, so meine Erfahrung, ist aber viel zu wenig bekannt.
Es sind ja schon Vorschläge gekommen, man möge doch diese Debatte zu einer anderen Zeit abhalten, etwa in einer Zeit, in der das Fernsehen live überträgt. Ich hätte einen anderen Vorschlag.
Sehr geehrter Herr Präsident, eine Anregung: Das Parlament sollte eine spezielle, groß angelegte Informationskampagne starten mit dem Inhalt, Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung aufzuzeigen – mit dem Ziel, einen besseren Wissensstand darüber zu erreichen. Ich erhoffe mir davon, dass sich viele Menschen mehr mit Politik beschäftigen, mehr ihre Wünsche einbringen, mehr Interesse an der Politik zeigen. Das wäre also eine mögliche Initiative gegen die Politikverdrossenheit.
Es zeigt sich ja – und das beweist dieser Bericht –, dass sich Bürger gerne und gut engagieren. Alle Vorschläge, die Arbeit des Ausschusses zu verbessern – hier sind ja schon einige Vorschläge gekommen –, werden wir gerne unterstützen, denn Ziel ist es ja, die beste Lösung für die Bürgerinnen und Bürger zu erreichen.
Ich denke, in diesem Ziel sind wir alle vereint. – Danke schön. (Beifall bei der ÖVP sowie bei Abgeordneten der SPÖ.)
17.43
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als nächste Rednerin gelangt Frau Abgeordnete Königsberger-Ludwig zu Wort. Es sind ebenfalls 2 Minuten Redezeit eingestellt. – Bitte. (Abg. Pendl – in Richtung der sich zum Rednerpult begebenden Abg. Königsberger-Ludwig –: Das wird eine gute Rede!)
17.43
Abgeordnete Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ): Herr Präsident! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen des Hauses! Eine Petition, bei der wir alle gefordert sind, über die
wir sicher noch viel diskutieren werden und auch viele, wie ich glaube, einer Meinung sind, ist die Petition Nummer 19, die besagt, dass Kinderrechte in den Verfassungsrang gehoben werden sollen. Diese Petition wurde von den „Kinderfreunden Oberösterreich“ eingebracht, die im Vorjahr eine entsprechende Unterschriftenaktion aufgelegt haben.
Dieses Anliegen, geschätzte Damen und Herren, hat schon eine sehr, sehr lange Geschichte. Bereits am 20. November 1989 wurde die UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet. 192 Staaten haben in dieser Zeit diese Kinderrechtskonvention ratifiziert. Auch Österreich hat am 26. Jänner 1990 die Konvention unterschrieben, und seit 5. September 1992 ist sie formal in Kraft.
Am 4. Juli 1994 wurde ein Entschließungsantrag des Parlaments an die Regierung verabschiedet/beschlossen, der noch einmal fordert, die Kinderrechte in den Verfassungsrang zu heben. Leider ist das bis heute nicht gelungen. Nun haben die „Kinderfreunde Oberösterreich“, die auch von der Plattform „Kinder haben Rechte“ und natürlich auch von unserer Jugendsprecherin, Angela Lueger, die diese Petition unterstützt, unterstützt werden, 11 648 kleine und große Unterschriften gesammelt, wie sie selber in ihrer Petition sagen, und wollen noch einmal einen Versuch starten, die Kinderrechte in den Verfassungsrang zu heben.
Es werden so wichtige Forderungen aufgestellt wie Schutz vor Ausbeutung, Recht auf Bildung, Recht auf Entfaltung der Persönlichkeit, Recht auf Partizipation, Schutz vor körperlicher und seelischer Gewalt und vor allem auch, dass Kinderrechte bei Gericht einklagbar sind.
Diese Petition ist dem Verfassungsausschuss zugewiesen worden, wo sie hingehört. Ich bin sicher, dass am Schluss etwas Positives herauskommen wird, damit die Kinder die tatsächlichen Sieger sind. (Beifall bei der SPÖ.)
17.46
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als vorläufig letzter Redner hiezu zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Steier mit ebenfalls 2 Minuten Redezeit. – Bitte.
17.46
Abgeordneter Gerhard Steier (SPÖ): Herr Präsident! Meine geschätzten Damen und Herren! Eines der bestechendsten Merkmale des Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen ist sicher die Vielfalt der dort behandelten Themen. Auch der heute zu besprechende Sammelbericht enthält eine sehr bunte und breite Palette an Themen, von Verkehr über Bildung bis hin zu Kinderrechten. Auf eine Petition möchte ich näher eingehen, und zwar konkret auf die Petition Nummer 9 meines Kollegen Keck.
Diese Petition spricht sich gegen das Lkw-Dauerparken im Siedlungsgebiet aus. Tatsache ist, dass das Transportgewerbe einen wichtigen Pfeiler des täglichen Wirtschaftslebens darstellt und Stellplätze für die Brummis vielerorts sicher Mangelware sind. Allerdings hat sich die Regelung in der Straßenverkehrsordnung, die ein Parkverbot im Ortsgebiet weniger als 25 Meter von Siedlungsgebieten vorsieht, in der Praxis als unzureichend herausgestellt.
Meine geschätzten Damen und Herren, die Verkehrssicherheit der AnrainerInnen kann durch dauerparkende Lkw beeinträchtigt sein, genauso wie eine Belastung durch Lärm und Abgase eintreten kann. Mit der Forderung, den in der Straßenverkehrsordnung erwähnten Abstand von 25 auf 100 Meter zu erweitern, wird sich demnächst der Verkehrsausschuss zu befassen haben. – Danke für Ihre Aufmerksamkeit. (Beifall bei der SPÖ.)
17.48
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist somit geschlossen.
Wünscht die Frau Berichterstatterin ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall.
Wir gelangen nun zur Abstimmung über den Antrag des Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen, seinen Bericht 269 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen.
Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes Zeichen. – Das ist mit Mehrheit so angenommen.
Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Mag. Widmann, Kolleginnen und Kollegen betreffend: Atomkraft verhindern durch Forcierung erneuerbarer Energie, Ausschöpfen von Energieeinsparungs- und Strompreissenkungspotenzialen!
Ich bitte jene Damen und Herren, die für diesen Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist die Minderheit und somit abgelehnt.
Bericht des Verkehrsausschusses über die Regierungsvorlage (221 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Führerscheingesetz (13. FSG-Novelle) und die Straßenverkehrsordnung 1960 geändert werden, sowie über die
Regierungsvorlage (180 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Führerscheingesetz geändert wird (12. FSG-Novelle) (257 d.B.)
17. Punkt
Bericht des Verkehrsausschusses über den Antrag 14/A der Abgeordneten Dr. Gabriela Moser, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Führerscheingesetz geändert wird (258 d.B.)
18. Punkt
Bericht des Verkehrsausschusses über den Antrag 319/A der Abgeordneten Harald Vilimsky, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz vom 6. Juli 1960, mit dem Vorschriften über die Straßenpolizei erlassen werden (Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO. 1960), BGBl. Nr. 159/1960, geändert wird (259 d.B.)
19. Punkt
Bericht des Verkehrsausschusses über den Antrag 330/A der Abgeordneten Harald Vilimsky, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz vom 6. Juli 1960, mit dem Vorschriften über die Straßenpolizei erlassen werden (Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO. 1960), BGBl. Nr. 159/1960, geändert wird (260 d.B.)
20. Punkt
Bericht des Verkehrsausschusses über den Antrag 564/A(E) der Abgeordneten Sigisbert Dolinschek, Kolleginnen und Kollegen betreffend systematische Evaluierung der Verkehrssicherheitsmaßnahmen (261 d.B.)
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Wir gelangen nun zu den Punkten 16 bis 20 der Tagesordnung, über welche die Debatte unter einem durchgeführt wird.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Zu Wort gemeldet hat sich Herr Abgeordneter Vilimsky. Eingestellte Redezeit: 3 Minuten. – Bitte.
17.50
Abgeordneter Harald Vilimsky (FPÖ): Herr Präsident! Frau Bundesminister! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben unter diesem Tagesordnungspunkt unter anderem eine Vertiefung und Verbreiterung der Mopedausbildung zur Debatte und zur Beschlussfassung vorliegen. Prinzipiell meine ich, das ist etwas Gutes. Es ist ein richtiger Weg, überall dort, wo Ausbildungsdefizite sind, diese Ausbildungsdefizite auch Zug um Zug zu beseitigen. (Beifall bei der FPÖ.)
Auf der anderen Seite bedeutet diese Verbesserung der Ausbildung auch ein Mehr an Kosten, und mittlerweile sind wir an einem Punkt angelangt, an dem etwa die Ausbildungskosten für den Zweiradbereich generell ein Ausmaß erreicht haben, dass keine Verhältnismäßigkeit mehr zu den Anschaffungskosten gegeben ist. Das hat auch eine – aus meiner Sicht – schlechte Entwicklung zur Folge, nämlich die, dass immer weniger Zweiräder genutzt werden.
Aufgrund dessen können auch Potentiale für die Verkehrspolitik nicht genutzt werden. Ein Zweirad verbraucht weniger an Energie, ein Zweirad verbraucht weniger an Platz, und da wäre es doch gut, den Zweiradverkehr bewusst zu fördern. Ich versuche seit Jahren, dem Zweiradverkehr etwas auf die Beine zu helfen, eine Verbesserung zu erreichen, aber ich stoße bei der Regierung leider immer wieder auf taube Ohren. Das ist etwas, was aus meiner Sicht nicht gut ist, was verbesserungswürdig ist.
Man kann Defiziten nicht allein damit begegnen, dass man die Ausbildung verbessert. Eine Verbesserung der Ausbildung ist etwas durchaus Richtiges, wenn die Unfallzahlen steigen, und das war auch einer der Beweggründe, diese Führerscheingesetznovelle zu beschließen. Man hat als Gesetzgeber aber auch die Pflicht, auch andere Unfallursachen zu beseitigen. Ich denke etwa an rutschige Bodenmarkierungen – ein Klassiker als Ausrutschursache für Zweiradfahrer, Mopedfahrer – oder etwa auch an Kopfsteinpflaster, das ein sehr rutschiger Fahrbahnbelag ist. Da müsste man auch etwas machen.
In diesem Zusammenhang erlaube ich mir auch, eine neue Debatte zu eröffnen, und ich hoffe, Sie verstehen das nicht als Angriff, sondern als konstruktiven Beitrag. Ich sehe eine große Ausbildungsnotwendigkeit im Bereich der Straßenverkehrsordnung für Fahrradfahrer, weil man gerade im urbanen Bereich im Zusammenleben zwischen Fahrradfahrern und Autofahrern immer mehr an Anarchie erlebt. (Beifall bei der FPÖ.)
Denken Sie an das Fahren gegen die Einbahn, denken Sie etwa an Fahrradfahrer, die so ein „Wagerl“ hinter sich herziehen, in dem zwei, drei Kinder drinnen sind. Das kann aus meiner Sicht nicht einer modernen Verkehrssicherheitspolitik entsprechen. Denken Sie daran, dass immer wieder bei Gehsteigübergängen Fahrradfahrer – oft gar nicht mit böser Motivation, sondern vielleicht, weil sie es einfach nicht wissen – mit einem Höllentempo von 30, 40 km/h den Gehsteig queren. Ein Autofahrer, der abbiegt, kann sie gar nicht im Sichtkegel haben, und es muss damit eigentlich zu einem Unfall kommen. Dem gegebenen Regelungsbedarf wird jedoch nicht entsprochen. Da hoffe ich also auf eine gute Diskussion.
Meine Damen und Herren! Wir werden dieser Novelle unsere Zustimmung deshalb nicht geben, weil darin auch die Verkehrsstrafen enthalten sind, wobei bei diesen eine kräftige Erhöhung beschlossen werden soll. Als Motivation und Begründung dafür wird
angegeben, dass man EU-Bürger auch in ihrer Heimat verfolgen könne. Es kann aber nicht sein, dass man wegen weniger EU-Bürger – das liegt vielleicht im Promillebereich – das Ganze auch für alle Österreicher weiter verteuert.
Bei aller Notwendigkeit, weil Strafen auch etwas Gutes und Erzieherisches haben, darf es aber nicht so sein, dass die Strafzahlungen ins allgemeine Budget einfließen, statt sie etwa in einen Verkehrssicherheitstopf zu geben und damit für alle Verkehrsteilnehmer Gutes zu tun. – Danke sehr. (Beifall bei der FPÖ.)
17.54
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als nächster Redner zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Heinzl. 3 Minuten Redezeit. – Bitte.
17.54
Abgeordneter Anton Heinzl (SPÖ): Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Bundesminister! Hohes Haus! Mit den heute vorliegenden Gesetzesänderungen ist ein ganzes Paket für mehr Verkehrssicherheit auf Österreichs Straßen geschnürt worden. Es sind zahlreiche handfeste und solide Maßnahmen für mehr Verkehrssicherheit in Österreich.
Leider wird bei uns nicht nur Schnellfahren, sondern auch Alkohol am Steuer immer noch als Kavaliersdelikt gesehen, und so wird es eben in Zukunft höhere Strafen für Hochrisikolenker geben. Es wird nicht nur auf Geldstrafen gesetzt, sondern auch auf bewusstseinsbildende Maßnahmen.
Auch für die Sicherheit einer weiteren Risikogruppe im Straßenverkehr wird gesorgt: Die Mopedausbildung wird verbessert. Mehr Fahrpraxis im Straßenverkehr hilft den Jugendlichen, vor allem den Jugendlichen, die tatsächlichen Gefahren besser einschätzen zu können.
Hohes Haus! Sehr geehrte Damen und Herren! Das von Bundesministerin Doris Bures geschnürte Paket wird, und davon bin ich wirklich überzeugt, für mehr Verkehrssicherheit in Österreich sorgen. Es ist einfach zielorientiert und praxisnah. Es ist ein wichtiger Schritt zu unserem, wie ich meine, gemeinsamen verkehrspolitischen Ziel, keine Verkehrstoten mehr beklagen zu müssen.
Um das Verkehrssicherheitspaket noch weiter zu optimieren, möchte ich zur Ergänzung folgenden Antrag einbringen:
Abänderungsantrag
der Abgeordneten Anton Heinzl, Dr. Ferdinand Maier, Kolleginnen und Kollegen betreffend den Gesetzesantrag im Bericht des Verkehrsausschusses über die Regierungsvorlage (221 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Führerscheingesetz (13. FSG-Novelle) und die Straßenverkehrsordnung 1960 geändert werden sowie über die Regierungsvorlage (180 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Führerscheingesetz geändert wird (12. FSG-Novelle) (257 d.B.)
Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen:
Der im Titel bezeichnete Gesetzesantrag wird wie folgt geändert:
Artikel 1 Ziffer 20 der 12. FSG-Novelle lautet:
„20. In § 43 wird folgender Abs. 17 angefügt:
(17) § 1 Abs. 6, § 4 Abs. 8, § 4c Abs. 2, § 24 Abs. 1, 3, 3a und 6, § 26 Abs. 2, § 30b Abs. 3, § 31, § 37a und § 41 Abs. 9 jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2009 treten mit 1. September 2009 in Kraft.“
Begründung:
In der vorgeschlagenen Fassung der 12. FSG-Novelle fehlt die Inkrafttretensbestimmung für die Kindersicherungskurse im Rahmen des Vormerksystems (§ 30b Abs. 3). Diese ist jedoch unbedingt erforderlich, da die verordnungsmäßigen Bestimmungen erst geschaffen werden müssen (in der Durchführungsverordnung gemeinsam mit dem Verkehrscoaching) und außerdem die Behörden mit derartigen Neuregelungen nicht „überfallen“ werden sollen.
*****
Danke schön. (Beifall bei der SPÖ.)
17.58
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Der soeben eingebrachte Abänderungsantrag ist ausreichend unterstützt, steht im Zusammenhang mit der Materie und daher mit in Verhandlung.
Als nächster Redner zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Hagen. Ebenfalls 3 Minuten eingestellte Redezeit. – Bitte.
17.58
Abgeordneter Christoph Hagen (BZÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Ministerin! Hohes Haus! Zuerst einmal das Gute an dieser – jetzt bekomme ich den richtigen Ausdruck nicht mehr heraus – Summe von Gesetzesinitiativen und Gesetzesvorschlägen, die auf dem Tisch liegen. Das BZÖ begrüßt die Gebührenfreiheit bei der Neuausstellung des C- und D-Führerscheines bei der Weiterbildung von Berufskraftfahrern. Das ist eine positive Maßnahme.
Wir würden uns diese Maßnahme allerdings auch für die Behinderten wünschen, die eine befristete Lenkerberechtigung haben. Wir haben dazu im Finanzausschuss bereits seit Langem einen Antrag eingebracht. Der schimmelt so vor sich hin, und da sind Sie leider nicht immer ganz glaubwürdig. Wenn man gestern die Debatten zum Behindertenbereich gehört hat, muss man sagen, Sie haben viel gefordert, viel schöngeredet. So kleine Maßnahmen vergessen Sie dann aber, nur weil das ein paar Euro weniger in die Staatskasse bringt.
Damit bin ich auch schon beim Punkt Staatskasse. Sie novellieren das Führerscheingesetz. Im Mopedbereich – darauf wird dann Kollege Markowitz noch zu sprechen kommen – gibt es Sicherheitsmaßnahmen, die sehr positiv zu sehen sind. Darauf gehe ich jetzt aber nicht genauer ein. Was mich aber schon stört, ist die Erhöhung der Strafen für Schnellfahren unter dem Motto Verkehrssicherheit. (Zwischenruf der Abg. Dr. Moser.)
Jetzt erkläre ich Ihnen einmal ein paar Dinge aus der Praxis: Fakt ist, dass hier Mindeststrafen von 70 € bei Rasern bei einer Geschwindigkeit von 30 km/h angesprochen werden, im Ortsgebiet bei 40 km/h, und das geht dann hinauf: auf Freilandstraßen 50 € bis 150 € plus Führerscheinentzug.
Und jetzt kommt das Interessante: Es ist sozusagen Mode, dass man in jeder Gemeinde eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h generell einführt, egal, wie gut oder wie lange die Straße ausgebaut ist. Wenn da einer 50 oder 60 km/h fährt, so ist das bei einer Straße, die gut ausgebaut ist, wo keine Häuser sind, kein Rasen.
Das Verbot gilt aber generell im Ortsgebiet, also auch für diese besagten Strecke. Das ist für mich kein Raser, sondern jemand, der dort angemessen fährt. Weil man das aus gewissen Gründen nicht plakativ mit Schildern machen will, sondern das generell
macht, wird der Staatsbürger wieder zur Kasse gebeten – damit die Staatskasse stimmt.
Ärgerlich ist es, wenn das Argument kommt, dass dabei auch ausländische Autofahrer zur Kasse gebeten werden sollen, und dass das mit 70 € europaweit besser gehe. Und dann lese ich hier (der Redner zitiert aus einem Schriftstück):
„Viele Staaten verweigern Zusammenarbeit – Das Eintreiben von Geldstrafen bei ausländischen Verkehrssündern ist für die Behörden zum bürokratischen Spießrutenlauf geworden. Viele Staaten verweigern die gesetzlich vorgeschriebene Zusammenarbeit.“
Und wenn man das auf ORF-ON weiter liest, sieht man da: „Abkommen mit über zehn Staaten“ – und bei den meisten funktioniert das nicht.
Frau Minister, wer wird wieder zur Kasse gebeten? – Der österreichische Autofahrer! So geht das nicht, meine Damen und Herren! (Beifall beim BZÖ.)
Noch ärger ist Folgendes: Bisher gab es, wo diese Abkommen nicht bestanden haben, die Lösung, eine Sicherheitsleistung einzuheben, aber das geht jetzt nicht mehr; das heißt, der ausländische Autofahrer kommt ungeschoren davon. Das kann es nicht sein! Ich sage beziehungsweise wir vom BZÖ sagen: Mehr Exekutive auf die Straße, aber nur zum Überwachen, nicht zum Abkassieren!
Damit komme ich zum nächsten Punkt – auch darauf muss ich noch kurz eingehen: Es gibt im LPK Wien einen Befehl, von der Polizei aus, dass die Beamten auf die Straße zu gehen haben und möglichst viele Strafen einheben sollen. Das ist nur Geldbeschaffung, das dient der Sicherheit in keinster Weise! Sie sollen auf die Straße gehen, um zu überwachen, zu kontrollieren, für die Sicherheit zu sorgen und um die Kriminalitätsstatistik zu verbessern. (Beifall beim BZÖ.)
Es gibt eine BZÖ-Forderung, den bundeseinheitlichen Strafenkatalog ohne Straferhöhung zu forcieren.
Jetzt möchte ich noch kurz auf den Antrag des Kollegen Vilimsky mit den Lkw-Überholverboten eingehen: Ich finde das notwendig. Wer auf der A 8 in Oberösterreich fährt, der sieht das. Sie ist schmal, zweispurig. Das ist eine Katastrophe, was hier für Brummirennen veranstaltet werden! Da gehört eine Lösung wie in Tschechien her: ein Überholverbot auf zweispurigen Straßen.
Weiters müssen dreispurige Zonen geschaffen werden, und dort sollen Lkw-Fahrer überholen dürfen. Ich glaube, das trägt deutlich zur Verkehrssicherheit bei. So müsste man es machen, Frau Minister. Ich kann Ihnen das nur ans Herz legen. (Beifall beim BZÖ.)
18.03
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Dr. Maier. 3 Minuten Redezeit. – Bitte.
18.04
Abgeordneter Dr. Ferdinand Maier (ÖVP): Herr Präsident! Frau Bundesminister! Meine Damen und Herren! Wir haben uns am Beginn dieses Jahres, de facto fast am Beginn dieser Legislaturperiode, vorgenommen, ein Verkehrssicherheitspaket zu schnüren, das aus mehreren Punkten besteht. Es liegt heute vor, und ich glaube, dass uns damit etwas gelungen ist, das wahrscheinlich am Beginn dieses Jahres viele nicht vermutet hätten.
Ich bin froh darüber, dass wir heute die Frage des Mopedführerscheins für jene Jugendliche, die dieses Zertifikat erreichen müssen, beschließen. Ich bin auch froh, dass wir, auch wenn die Frage der Strafen unterschiedlich gesehen wird, die Strafen für
Alkolenker neu regeln, dass wir aber auch die Bestrafung des Schnellfahrens neu regeln. Ich erinnere: Ich glaube, es war im Dezember 2007, als es im Ministerrat quasi eine Vorlage gab, die diese Strafen anbelangt hat. Ich würde meinen, dass da noch etwas zu wenig Augenmaß gegeben war; daher ist es, glaube ich, eine sehr positive Entwicklung.
Froh bin ich auch über Folgendes, und das haben wir heute nicht in diesem Paket, aber wir haben es in der Diskussion de facto angesprochen, nämlich die Gefährdung bei unbeschrankten Bahnübergängen, und dass wir im Rahmen des Konjunkturprogramms und im Rahmenprogramm in diesem Bereich einen Schwerpunkt gesetzt haben. Die Frau Bundesminister hat eine Verdoppelung der Absicherung von Bahnübergängen zugesagt. Froh bin ich auch darüber, dass wir, was die Frage der Kindersicherheit anbelangt, eine Maßnahme vorgeschlagen haben, sodass es hier zu einem abgerundeten Paket kommt.
Ich denke aber, man sollte ungeachtet dessen durchaus auf die Verkehrssicherheitsstatistik verweisen und auch darauf, das hier, was die Radfahrer anbelangt, vielleicht ein Problem stärker als bisher ins Auge gefasst werden soll.
Die Unfallstatistik des Jahres 2008 zeigt ja, dass 10 Prozent der zu Tode gekommenen Unfallopfer Radfahrer sind. Insofern glaube ich, dass man bei der Frage der Verkehrssicherheit gerade darauf ein besonderes Augenmerk legen sollte. Ich hoffe, dass wir im Sinne der Arbeit des Verkehrssicherheitsbeirates auch hier die dementsprechenden Maßnahmen setzen.
Ein Letztes noch, was das Vormerksystem und die Weiterentwicklung des Vormerksystems anbelangt: Diese Debatte läuft. Ich verfolge sie mit großem Interesse, bin aber nur nicht sicher, ob es klug ist, weitere Punkte ins Vormerksystem aufzunehmen. Daher warte ich einmal ab, was dazu die Gelehrten und Experten sagen. Wir sind für diese Diskussion offen. Ich glaube nur, die Punkte zu erhöhen – ist gleich mehrere Punkte hineinzunehmen – kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein. – Danke vielmals. (Beifall bei der ÖVP sowie des Abg. Heinzl.)
18.07
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Zu Wort gelangt Frau Abgeordnete Dr. Moser. 6 Minuten Redezeit. – Bitte.
18.07
Abgeordnete Dr. Gabriela Moser (Grüne): Frau Ministerin! Meine Damen und Herren! Ich wiederhole nicht die verschiedenen Verbesserungen in Sachen Verkehrssicherheit – die Frau Ministerin wird es ja selber sicherlich noch einmal groß an die Glocke hängen.
Ich bin froh darüber, dass wir das gemeinsam weitertragen werden. Ich bin aber nicht froh, dass dieser Schritt so zögerlich vor sich gegangen ist, dass es so lange gedauert hat, bis dieser Schritt unternommen wurde, und dass noch weitere wichtige Maßnahmen fehlen, die im Verkehrssicherheitsprogramm 2002 bis 2010 sehr wohl enthalten sind. Da haben wir uns ja gemeinsam das Ziel gesetzt, die Zahl der Menschen, die Opfer von Verkehrsunfällen werden, zu reduzieren – Todesopfer wie Verletzte.
Gerade deshalb, Herr Kollege Maier, bin ich mir sicher, dass die Experten im Verkehrssicherheitsbeirat, was die Verbesserung des Vormerksystems anlangt, sehr wohl unsere Meinung teilen – die Meinung nämlich, die ich Ihnen auch in einem eigenen Entschließungsantrag zukommen habe lassen –, dass Delikte zusätzlich aufgenommen werden müssen.
Sie alle wissen – das bestreitet niemand, auch die Frau Ministerin weiß es –: Die größte Verkehrsunsicherheitsproblematik liegt in überhöhter oder nicht angepasster Ge-
schwindigkeit. Dieses Hauptdelikt für Verkehrsunfälle, bei denen Menschen sterben – wöchentlich stirbt eine Familie auf Österreichs Straßen –, diese Hauptursache findet sich nicht im Vormerksystem! Das ist völlig unverständlich, und im europäischen Vergleich sind wir da mehr als hinterwäldlerisch.
Darum habe ich den Antrag gestellt. Und Sie wollen ihn heute ablehnen, obwohl Sie sagen, Sie beraten weiter über die Reform des Vormerksystems? Heute wird schon abgelehnt, was am wichtigsten wäre – genauso wie unser Vorschlag, dass Handytelefonieren am Steuer auch ein Vormerkdelikt werden soll!
Deshalb unser großer Wermutstropfen bei Ihrer Vorgangsweise: Wir können außerdem, was Ihren Vorschlag für die Reform des Führerscheingesetzes anlangt, nicht mitgehen – bei dieser Schmalspur-Verkehrscoaching-Geschichte für Delikte im Alkoholbereich, die über 0,8 Promille liegen! Ich verstehe überhaupt nicht, dass Menschen, die unter 0,8 Promille ein Strafmandat erhalten, besser geschult und gecoacht werden sollen, als die, die darüber liegen. Das ist inkonsistent, das ist Blödsinn. Darum haben wir auch die getrennte Abstimmung verlangt.
Dann noch zu dem einen Aspekt, zu dieser Alkohol-Frage: Frau Ministerin, Sie wissen ja auch, dass laut gestriger Statistik – auch die verschiedenen Aussendungen und Berichte in den Medien zeigen es – die Zunahme von Verkehrsunfällen, die unter Alkoholeinfluss passiert sind beziehungsweise verursacht wurden, horrend ist: ein Drittel mehr Unfälle wegen Alkohol! Und Sie gehen hier noch immer quasi mit Glacéhandschuhen vor!
Im europäischen Vergleich schaut es viel strenger aus: da sind die Limits tiefer, die Strafen höher. Und selbstverständlich sind auch wir dafür, dass mehr Exekutivbeamte vor Ort durch Kontrolltätigkeit dafür sorgen, dass die Menschen gar nicht erst in Versuchung kommen, Verkehrsverstöße zu unternehmen. Aber das alles funktioniert nur, wenn auch das Strafausmaß entsprechend ist, Kontrolle und Strafe ineinandergreifen und auch durch Coaching sinnvolle Maßnahmen gesetzt werden. – Danke schön. (Beifall bei den Grünen.)
18.11
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Zu einer Stellungnahme hat sich Frau Bundesministerin Bures zu Wort gemeldet. – Bitte.
18.11
Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie Doris Bures: Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die ersten Statements in der Debatte haben gezeigt: Was dem einen zu viel ist – nämlich dem BZÖ –, was Strafhöhen betrifft, ist dem anderen zu wenig – wie jetzt Frau Abgeordnete Moser erklärt hat.
Ich kann Ihnen nur sagen: Ich bin davon überzeugt, dass das Verkehrssicherheitspaket, das Sie heute hier verabschieden, auf Folgendes Bedacht nimmt: Wo liegen die Schwierigkeiten? Was können wir gesetzlich dazu beitragen, dass bei uns weniger Menschen Opfer von Verkehrsunfällen werden und dabei gar ihr Leben verlieren? Davon war diese Novelle getragen, die ich vorgelegt habe und die wir auch gemeinsam diskutiert haben, wo wirklich viele Dinge wirklich eingebracht wurden.
Ich kann Ihnen mitteilen, dass bei uns in Österreich im Jahr 2008 über 39 000 Verkehrsunfälle mit Personenschaden passiert sind, dass dabei über 50 000 Menschen verletzt werden, und dass 679 Menschen dabei sogar ihr Leben lassen mussten.
Diese Zahlen sind dramatisch, obwohl sie – man könnte ja sagen, das sei ein Trost – rückläufig sind. Ich finde sie aber dramatisch genug, sodass wir versuchen müssen, alles zu unternehmen, um das menschliche Leid, das damit verbunden ist, zu reduzieren.
Ich habe genau dort angesetzt, wo wir, wie ich in diesen sieben Monaten im Ressort des Verkehrsministeriums feststellen konnte (Zwischenruf der Abg. Dr. Moser), die Hochrisikogruppen haben. Das kann man in drei Bereiche zusammenfassen. Daher bedanke ich mich dafür, dass wir das heute auch in einem Paket schnüren können.
Die erste Hochrisikogruppe stellen jene dar, die alkoholisiert ein Auto lenken und rasend unterwegs sind. Sie müssen sich das vorstellen: Jede Woche stirbt ein Mensch im Straßenverkehr, weil ihn ein alkoholisierter Lenker um sein Leben bringt. Viermal in der Woche stirbt in Österreich ein Mensch, weil ein anderer rücksichtsloserweise rasend auf den Straßen unterwegs ist! Daher finde ich es angebracht, dass wir sagen: Das ist kein Kavaliersdelikt! Wir treten dagegen auf! Wir wollen ein Verhalten im Straßenverkehr, das nicht dazu führt, dass unschuldige Menschen in ihrem Leben, in ihrer Gesundheit gefährdet werden!
Daher erhöhen wir die Strafen und führen ein Verkehrscoaching ein, damit die Sensibilität bei jenen Autofahrern steigt, die so ein Verhalten an den Tag legen. Und: Ich bin der Auffassung, dass das so wichtig ist, dass es nicht nur um die Frage der Strafen, der Strafhöhen und des Verkehrscoaching geht, sondern das vordergründige Ziel ist, dass das auch eingehalten wird!
Daher bin ich dafür, dass die Exekutive personell besser ausgestattet wird, dass wir mehr Polizistinnen und Polizisten auf der Straße haben, die die Ausführung dessen kontrollieren, was Sie heute hier beschließen! (Beifall bei der SPÖ.)
Außer Alkoholisierten und Rasern gibt es eine Gruppe, die mir sehr am Herzen liegt, nämlich junge Menschen – daher all die Verbesserungen in der Mopedausbildung, die wir heute hier beschließen.
Es sind vor allem junge Menschen, die Mopedunfälle erleiden. 60 Prozent aller Mopedunfälle geschehen in den ersten sechs Monaten nach der Führerscheinausbildung. Das zeigt, dass die Ursache für diese Unfälle eine nicht vorhandene Fahrpraxis ist.
Ich glaube daher, dass es der richtige Ansatz ist, zu sagen, dass wir auch in der Mopedführerscheinausbildung, was die Fahrpraxis betrifft, in Zukunft zwei Stunden im Straßenverkehr vorschreiben – und das auch mit einem gewissen Augenmaß, so, dass wir sagen: Junge Menschen, die mobil sein wollen, sollen nicht mit einem Ausbildungssystem konfrontiert sein, das sie sich nicht leisten können.
Wir haben daher gesagt: Reduzieren wir auf der einen Seite ein bisschen die Theoriestunden und erhöhen wir die Praxisstunden! Schaffen wir auch Möglichkeiten dafür, dass diese Ausbildung in den Fahrschulen mit zwei Mopedfahrern gemacht wird, damit das auch für die jungen Menschen leistbar ist, damit sie mobil sein können.
Unser Ziel muss es sein, dass sie in Zukunft besser ausgebildet sind, sodass wir weniger junge Leute haben, die bei einem Mopedunfall womöglich verunglücken.
Der dritte Bereich, der mir sehr wichtig ist, wo wir laut allen Statistiken eine negative Entwicklung haben, ist die Sicherheit unserer Kinder.
Wenn jedes fünfte Kind, das heute im Auto sitzt, ungesichert ist – das ist doppelt so viel als noch vor ein paar Jahren, was einen Rückgang an Verkehrssicherheit und Sicherheit für unsere Kinder bedeutet –; wenn wir wissen, dass für ein Kind die Gefahr zu verunglücken im Auto größer ist als auf der Straße – im Auto verunglücken, weil sie nicht gesichert sind, mehr Kinder als auf der Straße beziehungsweise auf dem Weg in die Schule –, dann, glaube ich, gibt es da Handlungsbedarf!
Daher bin ich froh über all die Maßnahmen, die wir setzen: dass Erwachsene, die Kinder im Auto mitführen und nicht sichern, beim zweiten Mal ein Coaching bekommen und darüber informiert werden – weil sie sich oft der Gefahren nicht bewusst sind,
denen sie ihre Kinder aussetzen. Es ist wichtig, dass sie darüber informiert werden, was es bedeutet, wenn man ein Kind nicht angeschnallt und ohne Kindersitz ins Auto setzt, und dass das auch Konsequenzen hat.
Herr Abgeordneter Hagen, ich möchte Ihnen als Exekutivbeamtem Folgendes sagen: Ich finde, mit 80 km/h durch das Ortsgebiet zu rasen, wo Menschen sich auf den Straßen befinden und glauben, auf Schutzwegen eigentlich sicher zu sein, ist höchst verantwortungslos! Wenn Autofahrer mit 80 km/h durch ein Ortsgebiet rasen, dann finde ich es nicht in Ordnung, wenn gerade Sie als Exekutivbeamter sagen, es sei zu viel, wenn diese Leute 70 € Mindeststrafe zahlen. Ich glaube, das ist das Mindeste, was man bei derart verantwortungslosem Verhalten als Gesetzgeber verlangen kann! (Beifall bei der SPÖ. – Abg. Hagen: Davon habe ich auch nicht gesprochen!)
Was die Sicherung unserer Kinder im Auto sowie Kindersitze betrifft, möchte ich abschließend sagen: Die Sicherheit unserer Kinder ist mir ein sehr großes Anliegen. Wir haben eine Informationsbroschüre erstellt. Es ist mit einigen Bundesländern – und ich ersuche Sie auch um Unterstützung, damit wir das in allen Bundesländern machen können – gelungen, durchzusetzen, dass diese Informationsbroschüre auch diesen Babypaketen beigelegt wird, die eine Familie bei der Geburt eines Kindes erhält. (Beifall bei der SPÖ.)
Es ist mir gelungen, im Mutter-Kind-Pass einen Hinweis darauf zu bringen. Ich ersuche Sie wirklich, das zu unterstützen. Ich glaube, es ist ein gutes Paket, das uns einen Schritt weiter dazu führen soll, dass wir Leid, Krankheit und Unfalltote so weit wie möglich vermeiden. Ich glaube, es ist der Zustimmung dieses Hohen Hauses würdig. Herzlichen Dank an alle, die nach bestem Wissen und Gewissen daran mitgearbeitet haben, dass es auf Österreichs Straßen in Zukunft mehr Sicherheit gibt. – Danke. (Beifall bei der SPÖ.)
18.19
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Zu Wort gelangt Frau Abgeordnete Mag. Lohfeyer. 2 Minuten Redezeit. – Bitte.
18.19
Abgeordnete Mag. Rosa Lohfeyer (SPÖ): Herr Präsident! Frau Ministerin! Hohes Haus! Wir beschließen heute mit den vorliegenden Novellen des Führerscheingesetzes ein sehr notwendiges Paket zu mehr Verkehrssicherheit.
Die Unfallstatistiken zeigen einmal mehr eine dramatische Entwicklung, insbesondere bei Unfällen mit Alkolenkern und mit jungen Mopedfahrern. Sie machen deutlich, wie wichtig die Umsetzung weiterer gezielter Sicherheitsmaßnahmen in diesem Bereich ist.
Gerade in den Sommermonaten häufen sich Unfälle mit stark alkoholisierten Verkehrsteilnehmern, daher: Höhere Strafen, längere Führerscheinentzugsdauer sowie ein Verkehrscoaching beim ersten Delikt ab 0,8 Promille sollen deutlich machen, dass Alkohol am Steuer nicht zu tolerieren ist und eine massive Gefahr für das eigene Leben und das Leben unschuldiger Menschen darstellt.
Dieses Paket sieht auch eine Verschärfung der Strafen für Lenker mit überhöhter Geschwindigkeit vor, und es wird künftig eine Mindeststrafe für Raser geben. In der 12. FSG-Novelle wird auch eine intensivere praktische Ausbildung zum Erwerb des Moped-Ausweises geregelt. Es wurde schon erwähnt, dass eine verpflichtende zweistündige Fahrt im Verkehr, nicht nur am Platz, vorgesehen ist, und dass mit der Vereinheitlichung der Ausbildung und mehreren Praxisstunden die gestiegenen Unfallzahlen gesenkt werden sollen.
Im Bereich Kindersicherung – die Ministerin hat bereits darauf hingewiesen – schafft diese Novellierung eine Rechtsgrundlage für die Einführung von Kindersicherungskursen bei wiederholtem Verstoß gegen die Sicherungspflicht.
Es ist wichtig, den VerkehrsteilnehmerInnen klarzumachen, dass ungesicherte Kinder im Auto in höchstem Maße gefährdet sind. Besonders wichtig finde ich auch – wie schon von der Ministerin angesprochen – die geplanten weiteren Aktionen für junge Familien zu diesem Thema mit neuen Infobroschüren und Foldern in mehreren Sprachen.
Mit den vorliegenden Maßnahmen beschließen wir ein Stück mehr Verkehrssicherheit, aber weitere bewusstseinsbildende Kampagnen, Schwerpunktaktionen und Kontrollen für mehr Verkehrssicherheit werden wir sicher benötigen. (Beifall bei der SPÖ.)
18.22
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als nächster Redner zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Markowitz. 3 Minuten freiwillige Redezeitbeschränkung. – Bitte.
18.22
Abgeordneter Stefan Markowitz (BZÖ): Herr Präsident! Sehr geehrte Bundesministerin! Hohes Haus! Das Moped ist für Jugendliche sicher ein spannendes Fortbewegungsmittel, aber auch das mit Abstand gefährlichste. Durch die steigenden Zulassungszahlen von Mopeds kommt es auch zu steigenden Unfallzahlen bei MopedlenkerInnen. 45 Prozent der 15- bis 19-Jährigen, die im Straßenverkehr verunglücken, waren mit dem Moped unterwegs. Vor allem bei den 15 bis 16-Jährigen ist die Zahl der Unfallopfer alarmierend hoch.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Jahre 2007 hatten 6 017 MopedlenkerInnen einen Verkehrsunfall. Davon waren 3 400 Verunglückte 15 oder 16 Jahre alt. Die Zahl der bei einem Unfall verletzten 15-jährigen MopedfahrerInnen hat sich in den Jahren 2003 bis 2007 mehr als verdoppelt, und 2008 verunglückten mehr als 6 000 MopedfahrerInnen. Das sind alarmierende Zahlen, und hier müssen wir entschieden entgegenwirken.
Es war daher längst an der Zeit, eine Reform der Fahrausbildung zu erarbeiten, nämlich eine Ausbildung in vier Stufen: Sechs Praxisstunden auf einem abgesperrten Platz, zwei Praxisstunden im Straßenverkehr, sechs Theoriestunden und eine Theorieprüfung.
Das bedeutet für alle Fahranfänger – die meisten davon sind ja 15 Jahre alt –, dass die Theoriestunden, wie erwähnt, von acht auf sechs verkürzt und die Praxisstunden dementsprechend angehoben werden.
Was die Kosten betrifft, Frau Ministerin, haben wir ausgerechnet, dass die Mehrkosten 40 € bis 50 € betragen, und einige Versicherungen haben bereits ihre Bereitschaft signalisiert, einen Prämiennachlass zu gewähren, und zwar jenen Lenkern, die nach den neuen Vorschriften ausgebildet wurden.
Das Üben auf einem Mopedsimulator kann die Verkehrssicherheit erhöhen, damit Jugendliche sich im Straßenverkehr sicherer fühlen können. Gut finde ich auch die Aktion „Mopeds in Town“, organisiert von der Arge 2Rad. Seit dem Start diverser Aktionen im Jahr 2007 sind die Unfallzahlen in Wien deutlich zurückgegangen. Diese Organisation sollte unserer Meinung nach bundesländerübergreifend arbeiten.
Sehr geehrte Frau Bundesministerin, nur die Umsetzung dieser Reform alleine wird nicht reichen. Ich fordere die Bundesregierung hiermit auf, die Aufklärungsarbeiten an den Schulen zu erhöhen und eine Kampagne zu entwickeln, damit Jugendliche auf
ihren Zweirädern sicherer auf Österreichs Straßen unterwegs sein können. – Vielen Dank. (Beifall beim BZÖ.)
18.24
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als nächster Redner gelangt Herr Abgeordneter Eßl zu Wort. 3 Minuten freiwillige Redezeitbeschränkung. – Bitte.
18.25
Abgeordneter Franz Eßl (ÖVP): Herr Präsident! Frau Bundesministerin! Meine geschätzten Damen und Herren! Wir haben heute ein Sicherheitspaket in Verhandlung, das unter anderem auch die Straßenverkehrsordnung und das Führerscheingesetz ändert. Von meinen Vorrednern ist schon erwähnt worden, dass ein wesentlicher Punkt die Mopedfahrer betrifft. Die Anzahl der 15-jährigen Lenker ist gestiegen, es haben aber leider auch die Unfälle dieser Gruppe zugenommen. Daher ist es richtig und wichtig, dass man in diesem Punkt einen Schwerpunkt setzt, nämlich bessere Ausbildung und Praxisbezogenheit zu vermitteln. Ich glaube, das ist sehr positiv zu vermerken.
Ein zweiter Punkt ist, dass das Gesetz Änderungen bei den Sanktionen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen beinhaltet sowie Strafverschärfungen beim Lenken von Kraftfahrzeugen in alkoholisiertem Zustand. Es ist allerdings nicht nur von Geldstrafen die Rede, auch der Führerscheinentzug beziehungsweise bewusstseinsbildende Maßnahmen sind in diesem Gesetz geregelt.
Ich möchte mich klar dazu bekennen, dass bei Vergehen Strafen notwendig sind. Allerdings möchte ich eine Anregung einbringen, denn gleiche Strafen haben nicht immer bei jedem die gleiche Auswirkung. Gerade in den ländlichen Gebieten, wo es oft keine öffentlichen Verkehrsmittel und auch keine Taxis gibt, kommt ein längerer Führerscheinentzug oft einem Berufsverbot und einer Verhinderung der Berufsausbildung gleich. Für die Zukunft sollte man vielleicht einmal die Anregung überdenken, ob es dafür nicht irgendwelche Ersatzmaßnahmen geben könnte, wie zum Beispiel soziale Dienste zu verrichten oder Ähnliches.
Dritter Punkt: Ich freue mich, dass wir im § 91 eine praxisbezogene Regelung gefunden haben. Durch die Streichung des praxisfremden Abs. 4 tragen wir dazu bei, dass in Zukunft Hunderte, wenn nicht Tausende Kilometer Weidezäune wieder legal verwendet werden dürfen.
Gestatten Sie mir einen kleinen Vorgriff auf den nächsten Tagesordnungspunkt, bei dem die Anhebung des zulässigen Gesamtgewichtes bei Milchtransporten beschlossen wird. Wir haben heute in mehreren Punkten die schwierige Situation der Milchwirtschaft diskutiert, und mit dieser Maßnahme können wir wieder ein Scherflein dazu beitragen, dass die Wettbewerbsfähigkeit verbessert wird. Ich ersuche, dass wir dem auch entsprechend zustimmen.
Was die Fahrzeughöhen bei Stroh- und Tiertransporten betrifft, so sollten wir in Zukunft darüber sicherlich noch reden. – Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, und ich bitte um Zustimmung zum Gesetz. (Beifall bei der ÖVP.)
18.28
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als nächster Redner gelangt Herr Abgeordneter Keck zu Wort. Freiwillige Redezeitbeschränkung: 2 Minuten. – Bitte.
18.28
Abgeordneter Dietmar Keck (SPÖ): Frau Präsident! Meine Damen und Herren! (Zwischenruf des Abg. Dr. Bartenstein.) – Nein, Kollege Bartenstein, nach knapp drei Tagen muss man etwas zur Auflockerung beitragen, und ein befreiendes Lachen über
alle Fraktionsgrenzen hinweg ist doch etwas Wunderbares, oder? (Beifall bei der SPÖ.)
Meine Damen und Herren, die Frau Minister hat es ja schon gesagt, eines der größten Probleme, die wir im Straßenverkehr ertragen müssen, ist Alkohol am Steuer. Leider ist es für viele sogar ein Kavaliersdelikt, sich nach ein paar Gläsern Bier, nach ein paar Gläsern Wein oder nach hochprozentigen Schnäpsen noch hinter das Lenkrad zu setzen und auf eigene Gefahr nach Hause zu fahren. Leider, meine Damen und Herren, passiert so etwas niemals nur auf eigene Gefahr, denn eine dramatisch verlängerte Reaktionszeit oder das Überschätzen der eigenen Fahrkünste trifft immer wieder völlig Unbeteiligte an diesen Dingen. Unfälle mit schweren Verletzungen, Kinder als Beteiligte oder Todesfälle sind immer wieder in den Schlagzeilen der Tageszeitungen.
Schockierend ist, dass wir trotzdem gerade beim Alkohol am Steuer immer wieder auch von Wiederholungstätern lesen. Die Novelle des Führerscheingesetzes soll diesem Problem nun mit aller Härte zu Leibe rücken. Ich begrüße das, denn ich muss es auch hier so sagen, wie ich es im Ausschuss gesagt habe: Es ist für mich untragbar, dass überhaupt Alkohol getrunken werden darf, wenn danach noch ein Auto gelenkt werden soll.
Meine Damen und Herren, ich bin lange als Notfallsanitäter bei einer Rettungsorganisation mitgefahren. Wenn man zu einem Unfall gerufen wird, der durch Alkohol am Steuer verursacht wurde, und man sich dort um sehr schwer verletzte Personen und auch um Kinder kümmern muss, ist das eine große Tragik.
Ich bin sehr froh darüber, Frau Minister, dass wir dieses Gesetz geschaffen haben. Das setzen wir um, dazu stehen wir, und dazu möchte ich dir, liebe Frau Minister, recht herzlich gratulieren! (Beifall bei der SPÖ sowie des Abg. Jakob Auer.)
18.30
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als nächste Rednerin gelangt Frau Abgeordnete Mag. Hakl zu Wort. Freiwillige Redezeitbeschränkung: 2 Minuten. – Bitte.
18.30
Abgeordnete Mag. Karin Hakl (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Frau Bundesminister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Alkohol am Steuer ist kein Kavaliersdelikt. Es ist richtig und es ist gut, dass hier die Strafen verschärft werden, aber ganz grundsätzlich glaube ich, dass wir uns in Zukunft auch noch einmal sehr tiefgehend mit dem gesamten Verkehrsstrafenregime auseinandersetzen müssen.
Während hier hohe, scharfe Strafen richtig, notwendig und gut sind, schießen wir meiner Meinung nach beim nächsten Tagesordnungspunkt, nämlich bei den Verkehrsstrafen wegen zu schnellen Fahrens, da und dort ein wenig übers Ziel. Klar ist: Raser gehören scharf bestraft.
Frau Bundesminister, das Gesamtpaket ist in Ordnung, ich kann aber trotzdem nicht wirklich verstehen, dass wir tatsächlich bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von nur 10 km/h eine Verkehrsstrafe von 30 € verhängen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass Strafen, die nicht mehr nachempfunden werden können, weil niemand versteht, dass und warum sie verhängt werden, nur dazu beitragen, dass die Leute sich nicht mehr an die Vorschriften halten.
Frau Bundesminister, 30 € sind für die meisten Menschen in Österreich sehr viel Geld. Das ist zwar die niedrigste Strafe, die wir haben, aber wenn ich um 10 km/h zu schnell fahre, so ist das ein so geringer km/h-Satz, dass, wenn der Tacho nicht richtig funktioniert, ich zum Teil gar nicht mehr darauf achten kann. Ich glaube, hier haben wir danebengelangt. Ich hoffe, dass wir das bei der nächsten Novelle beseitigen können, und da ich der Überzeugung bin, dass wir eine umfassende Straßenverkehrsnovelle haben
werden – die seit fünf Jahren immer wieder versprochen wurde und seit fünf Jahren nicht kam –, bin ich sicher, dass wir die Gelegenheit haben werden, das auch zu tun.
Ich bitte Sie, Frau Bundesminister, die Straßenverkehrsordnung ganz grundsätzlich zu novellieren und dabei auch darauf einzugehen, dass bei Verkehrsstrafen nicht bei 10 km/h Geschwindigkeitsüberschreitung Strafen in dieser Höhe angesetzt werden. – Danke. (Beifall bei der ÖVP.)
18.33
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als nächster Redner gelangt Herr Abgeordneter Gahr zu Wort. 2 Minuten freiwillige Redezeitbeschränkung. – Bitte.
18.33
Abgeordneter Hermann Gahr (ÖVP): Herr Präsident! Frau Bundesminister! Ich glaube, es ist schon alles gesagt. Über die Parteigrenzen gibt es Zustimmung; dass es unterschiedliche Zugänge gibt, ist, glaube ich, ganz normal. Aber Tatsache ist, dass wir trotz Strafen, Kontrollen, Schulung und Ausbildung und Beratung, aber auch Prävention ein Problem haben mit Alkohol am Steuer und mit Raserei. In letzter Zeit, das darf ich auch ganz offen sagen, hat es mehrere Fälle gegeben, bei denen auch Drogen im Einsatz waren. Wir müssen all diese Dinge so angreifen, dass wir sie umsetzen können und dass sie auch kontrollierbar sind.
Frau Bundesminister Bures hat es ja sehr eindringlich gesagt, es gibt viele Opfer, und unsere Pflicht in der Politik ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, um dem entgegenzutreten. Aufklärung hat in der Vergangenheit sehr wohl massiv stattgefunden, aber man kann nie genügend aufklären, und für mich ist es ganz wichtig, dass das Thema „Prävention“ verstärkt Einzug hält. Das Verkehrscoaching mit vier Stunden ist eine kluge und sinnvolle und gleichzeitig auch faire Maßnahme.
In diesem Sinne können wir dem zustimmen. Wir sollten aber die Dinge weiterentwickeln, die Experten einbinden und weitere Schritte setzen. Jedes Opfer im Straßenverkehr ist eines zu viel! – Vielen Dank. (Beifall bei der ÖVP sowie der Abg. Mag. Wurm.)
18.34
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Frau Bundesminister Bures hat sich zu Wort gemeldet. Ich erteile es ihr.
18.34
Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie Doris Bures: Herr Präsident! Hohes Haus! Noch einmal herzlichen Dank für die doch breite Zustimmung, auch wenn man sich in einzelnen Punkten, in die eine oder andere Richtung nuanciert, mehr oder auch weniger gewünscht hätte.
Was mir jetzt ganz wichtig ist, damit die Diskussion nicht in die falsche Richtung läuft: Frau Abgeordnete Hakl, es gibt gar keine Veränderung in der Novelle, was Geschwindigkeitsüberschreitungen von 10 km/h betrifft. Das Einzige, was diese Novelle jetzt festschreibt, ist, dass es, wenn es zu einer Überschreitung von über 30 km/h der vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzung kommt – und das war ein Beispiel, das ich auch genannt habe, nämlich wenn jemand im Ortsgebiet, statt mit 50 km/h zu fahren, mit 80 km/h durchrast –, dann eine Mindeststrafe von 70 € geben soll. Ich finde, das ist ein Zeichen dafür, dass wir auch in der österreichischen Gesetzgebung sagen: Rasen ist kein Kavaliersdelikt. 70 € ist die Mindeststrafe – das ist das, was jetzt eingeführt wird. (Zwischenruf der Abg. Mag. Hakl.)
Frau Abgeordnete Hakl, ich bin aber ohnehin froh, denn Sie stimmen ja zu. Aber ich sage Ihnen noch etwas, warum das mit der Mindeststrafe so wichtig ist. Wir haben darüber gesprochen, dass es natürlich nicht sein kann, gerade jetzt in der Urlaubszeit,
dass Touristen, Menschen, die von Deutschland nach Italien auf Urlaub fahren, völlig straffrei gehen, wenn sie auf Österreichs Straßen rasen. Das wollen wir nicht, das möchte ich nicht. Daher ist die Mindeststrafe von 70 € die rechtliche Voraussetzung dafür, dass die Innenministerin in Zukunft die Möglichkeit hat – weil das nämlich über der Bagatellgrenze liegt –, auch über die Staatsgrenzen hinaus die Strafverfolgung vorzunehmen.
Wir haben die Frontfotografie eingeführt, wir haben die Mindeststrafen eingeführt, und ich finde, das ist richtig und das ist auch angemessen. Im Übrigen gibt es uns, Frau Abgeordnete, auch die Chance klarzustellen, dass das, was für alle in diesem Land gilt, auch für jene gilt, die durch Österreich durchfahren und nicht die Staatsbürgerschaft haben. – Danke. (Beifall bei der SPÖ.)
18.37
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Damit ist die Debatte geschlossen.
Wünscht der Herr Berichterstatter ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall.
Wir gelangen zur Abstimmung, die ich über jeden Ausschussantrag getrennt vornehme.
Zunächst kommen wir zur Abstimmung über den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Führerscheingesetz (12. FSG-Novelle) und die Straßenverkehrsordnung geändert werden, in 257 der Beilagen.
Hiezu liegt ein Abänderungsantrag der Abgeordneten Heinzl, Dr. Ferdinand Maier, Kolleginnen und Kollegen vor.
Weiters liegt ein Verlangen auf getrennte Abstimmung der Abgeordneten Dr. Moser vor.
Ich werde zunächst über die von dem erwähnten Abänderungsantrag sowie vom Verlangen auf getrennte Abstimmung betroffenen Teile – der Systematik des Gesetzentwurfes folgend – und schließlich über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes abstimmen lassen.
Wir kommen zur getrennten Abstimmung über Artikel I Ziffern 10 und 13 in der Fassung des Ausschussberichtes.
Ich ersuche jene Mitglieder des Hohen Hauses, die sich für diese Teile des Gesetzentwurfes aussprechen, um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist die Mehrheit und somit angenommen.
Nun gelangen wir zur Abstimmung über den Abänderungsantrag der Abgeordneten Heinzl, Dr. Ferdinand Maier, Kolleginnen und Kollegen betreffend Artikel I Ziffer 20.
Wer diesem Antrag seine Zustimmung erteilt, den ersuche ich um ein bejahendes Zeichen. – Auch das ist mit Mehrheit angenommen.
Weiters gelangen wir zur getrennten Abstimmung über Artikel II Ziffer 1 in der Fassung des Ausschussberichtes.
Ich bitte jene Mitglieder des Hohen Hauses, die diesem Teil des Gesetzentwurfes beitreten, um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist die Mehrheit und somit angenommen.
Schließlich komme ich zur Abstimmung über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang in der Fassung des Ausschussberichtes.
Ich bitte jene Damen und Herren, die hiefür ihre Zustimmung erteilen, um ein bejahendes Zeichen. – Auch das ist mit Mehrheit so angenommen.
Wir kommen sogleich zur dritten Lesung.
Ich bitte jene Damen und Herren, die auch in dritter Lesung für den vorliegenden Gesetzentwurf sind, um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist die Mehrheit. Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung angenommen.
Weiters kommen wir zur Abstimmung über den Antrag des Verkehrsausschusses, seinen Bericht 258 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen.
Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes Zeichen. – Das ist mit Mehrheit angenommen.
Nun gelangen wir zur Abstimmung über den Antrag des Verkehrsausschusses, seinen Bericht 259 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen.
Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes Zeichen. – Das ist ebenfalls mit Mehrheit angenommen.
Wir gelangen ferner zur Abstimmung über den Antrag des Verkehrsausschusses, seinen Bericht 260 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen.
Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes Zeichen. – Auch das ist mit Mehrheit angenommen.
Schließlich kommen wir zur Abstimmung über den Antrag des Verkehrsausschusses, seinen Bericht 261 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen.
Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes Zeichen. – Auch das ist mit Mehrheit angenommen.
Bericht des Verkehrsausschusses über die Regierungsvorlage (220 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Kraftfahrgesetz 1967 geändert wird (31. KFG-Novelle), sowie über die
Regierungsvorlage (90 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Kraftfahrgesetz 1967 geändert wird (30. KFG-Novelle) (262 d.B.)
22. Punkt
Bericht des Verkehrsausschusses über den Antrag 134/A(E) der Abgeordneten Dr. Gabriela Moser, Kolleginnen und Kollegen betreffend Entwertung/Vernichtung des Typenscheins bei Pkw-Totalhavarien (263 d.B.)
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Wir gelangen nun zu den Punkten 21 und 22 der Tagesordnung, über welche die Debatte unter einem durchgeführt wird.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Vock. Eingestellte Redezeit: 3 Minuten. – Bitte.
18.42
Abgeordneter Bernhard Vock (FPÖ): Hohes Haus! Unter Tagesordnungspunkt 21 gibt es viele formelle Punkte, mit denen wir uns auch anfreunden könnten, wäre da nicht schon wieder eine versteckte Abzocke der Autofahrer: eine Mindeststrafe von
70 € bei Geschwindigkeitsüberschreitungen. Das heißt, wenn ich jetzt statt 30 km/h 34 km/h fahre – diese berühmte „Geschwindigkeitsraserei“ im Ortsgebiet –, dann kostet mich das vielleicht schon 70 €. Das ist eine Abzocke von Autofahrern, und es kann nicht sein, dass der Autofahrer immer wieder zur Budgetsanierung herangezogen wird! Es ist nichts anderes! (Zwischenrufe bei der SPÖ.)
Daher sagen wir zum Autofahrer als Melkkuh der Nation: nein, danke!
Zu Tagesordnungspunkt 22, dem Antrag von Frau Dr. Moser: Wir sehen das Problem, dass es immer wieder einen Missbrauch von Typenscheinen geben kann. Aber wir sehen auch das Problem, dass zahlreiche Autowracks auf öffentlichem oder privatem Grund entsorgt werden, indem der Besitzer das Auto dort einfach abstellt, und man den Eigentümer dann nicht mehr feststellen kann. Die Zulassungsbehörde stellt nämlich nicht den Letztbesitzer fest, sondern nur denjenigen, bei dem das Auto zuletzt angemeldet war.
Das heißt, im Sinne der Umwelt muss es auch weiterhin möglich sein, diese Umweltgefahr, dass Flüssigkeiten aus dem Wrack austreten, zu verhindern. Und das kann ich nur, wenn ich auch weiterhin sicherstelle, dass Autowracks auch ohne Typenschein entsorgt werden können.
Daher begrüßen wir Freiheitlichen eine Verschärfung der derzeitigen Regelung, wir fordern aber zum Schutze der Umwelt, dass auch künftig die Entsorgung von Wracks ohne Typenschein möglich ist. (Beifall bei der FPÖ. – Abg. Dr. Moser: Dagegen spricht ja eh nichts!)
18.44
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als nächster Redner gelangt Herr Abgeordneter Stauber zu Wort. Eingestellte Redezeit: 2 Minuten. – Bitte.
18.44
Abgeordneter Peter Stauber (SPÖ): Herr Präsident! Frau Bundesministerin! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Die 30. Novelle zum Kraftfahrgesetz ermöglicht nun auch die optionale Beantragung einer Chipkarten-Zulassung anstelle einer Zulassungsbescheinigung aus Papier. (Beifall bei der SPÖ.) Ich denke, dass hierbei wichtig ist, dass es sich bei der Chipkarten-Zulassungsbescheinigung um ein wirklich optionales System handelt und der einzelne Zulassungsbesitzer dementsprechend völlige Wahlfreiheit hat, ob er die Papierbescheinigung oder die Chipkarte nimmt.
Die 31. KFG-Novelle setzt im Wesentlichen die Rahmenrichtlinie zur Schaffung eines Rahmens für die Genehmigung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge in innerstaatliches Recht um.
Ganz besonders geht es hier um eine Sache, die immer wieder diskutiert wird, und zwar: Wer darf mit Blaulicht fahren? Auch das wird hier neu geregelt. Es geht um die gesetzliche Erlaubnis für die Führung des Blaulichts für alle im Sanitätergesetz genannten Rettungsdienste, wodurch jetzt die individuellen Bewilligungen durch den Landeshauptmann wegfallen und der Verwaltungsaufwand in Zukunft sicher reduziert wird.
Zum Schluss noch ein kurzes Wort zum Kollegen Eßl, der die Erhöhung des Gesamtgewichtes für die Rohmilchtransporte erwähnt hat. (Abg. Grillitsch: Das ist schon wichtig!) Ich möchte nur darum ersuchen, dass diese Erhöhung nur für Rohmilchtransporte herunten im Tal und nicht für kleine Bergstraßen genehmigt wird, denn das würde natürlich große Probleme für die Gemeinden mit sich bringen. Wenn es im Tal passiert, wird es kein Problem sein. – Danke schön. (Beifall bei der SPÖ sowie des Abg. Linder.)
18.45
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als nächster Redner gelangt Herr Abgeordneter Hagen zu Wort. Eingestellte Redezeit: 3 Minuten. – Bitte.
18.45
Abgeordneter Christoph Hagen (BZÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Frau Minister! Die vom Kollegen vorhin angesprochene Regelung betreffend Blaulicht-Fahrzeuge finden wir positiv – leider ist nicht alles in diesem Gesetz so positiv. Deshalb werden wir beim Tagesordnungspunkt 21 dagegen stimmen.
Kurz erklärt: Diese Chipkarten-Zulassungsbescheinigung finden wir nicht ideal, da auf der Karte selbst zu wenige Informationen ablesbar sind. Das heißt, jeder Beamte müsste so ein Lesegerät mitschleppen, um all die Daten einsehen zu können, die auf dem Chip gespeichert sind. Ich weiß nicht, ob das bei Verkehrskontrollen zielführend ist. Deswegen bevorzugen wir da die Papierlösung.
Ich möchte noch kurz auf den Antrag der Grünen eingehen. Er ist zwar in gewisser Hinsicht verständlich, aber nach unserer Ansicht nicht ausgereift. Deshalb wird auch dieser nicht unsere Zustimmung erlangen.
Nun zu einem Thema, das uns vom BZÖ sehr stark bewegt, und zwar geht es hier um die Wechselkennzeichen-Besitzer, die auf ihren Fahrzeugen doppelt Vignetten picken müssen, und das sehen wir nicht ein. Sie zahlen zweimal, obwohl sie die Straße mit dem Fahrzeug nur einmal benützen können.
Wir bringen deshalb folgenden Antrag ein:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Hagen, Dolinschek, Tadler, Markowitz, Kolleginnen und Kollegen betreffend Beendigung der Benachteiligung von Wechselkennzeichen-Besitzern durch die Vignettenpflicht
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird ersucht, die Beendigung der Benachteiligung von Wechselkennzeichen-Besitzern sicherzustellen und rasch Gesetzesvorschläge vorzulegen, welche die Verwendung einer weitgehend kostenneutralen Mehrfachvignette für Zulassungsbesitzer von Wechselkennzeichen vorsehen.“
*****
Danke schön. (Beifall beim BZÖ.)
18.48
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Der soeben eingebrachte Entschließungsantrag ist ausreichend unterstützt und steht mit in Verhandlung.
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Hagen, Dolinschek, Tadler, Markowitz, Kolleginnen und Kollegen betreffend Beendigung der Benachteiligung von Wechselkennzeichen-Besitzern durch die Vignettenpflicht
eingebracht im Zuge der Debatte über den Bericht des Verkehrsausschusses über die Regierungsvorlage (220 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Kraftfahrgesetz 1967 geän-
dert wird (31. KFG-Novelle) sowie über die Regierungsvorlage (90 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Kraftfahrgesetz 1967 geändert wird (30. KFG-Novelle) (262 d.B.)
Viele Besitzer von Kraftfahrzeugen in Österreich schätzen die Möglichkeit eines Wechselkennzeichens. Dieses kann für bis zu drei Fahrzeuge verwendet werden. Trotzdem muss nach den derzeitigen Bestimmungen bei der Benützung von Autobahnen und Schnellstraßen bei jedem Fahrzeug bis 3,5 Tonnen eine zeitabhängige Maut (Vignette) bezahlt werden. Dies belastet vor allem Zulassungsbesitzer mit Wechselkennzeichen, da sie durch die Klebepflicht der Vignette bei jedem Fahrzeug zwei- bis dreifach zur Kasse gebeten werden, obwohl sie nur mit jeweils einem Fahrzeug auf der Autobahn oder Schnellstraße unterwegs sein können.
Laut Volksanwaltschaft gibt es in Österreich rund 370.000 Besitzer von Wechselkennzeichen. In der Praxis werden Kraftfahrzeuge mit Wechselkennzeichen vor allem bei Zweitautos, Oldtimer und bei allen nicht ständig in Gebrauch stehenden Fahrzeugen zugelassen. Voraussetzung ist aber, dass sie alle das gleiche Kennzeichenformat besitzen und in dieselbe Obergruppe (Kraftrad, Kraftwagen, etc.) fallen. Jedoch wird nur ein Zulassungsschein, indem alle Fahrzeuge eingetragen sind, ausgestellt. Schließlich ist die motorbezogene Versicherungssteuer und die -prämie bei allen Kraftfahrzeugen unter 3,5 Tonnen nur für jenes Fahrzeug zu bezahlen, welches der höheren Steuer unterliegt.
Daher darf die Benachteiligung der Betroffenen, für jedes Auto eine eigene Vignette kaufen zu müssen nicht länger aufrecht bleiben. Eine Änderung bei der Entrichtung der zeitabhängigen Maut ist dringend erforderlich.
Dieser darf aber nicht die Fortsetzung der Benachteiligung beinhalten.
Mit einem Zuschlag soll eine weitgehend kostenneutrale Mehrfach-Vignette umgesetzt werden. Dabei dürfen lediglich die Kosten des Materialaufwandes für die zusätzlichen Vignetten aufgeschlagen werden.
Aus diesen Gründen stellen die unterfertigten Abgeordneten nachstehenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird ersucht, die Beendigung der Benachteiligung von Wechselkennzeichen-Besitzern sicherzustellen und rasch Gesetzesvorschläge vorzulegen, welche die Verwendung einer weitgehend kostenneutralen Mehrfachvignette für Zulassungsbesitzer von Wechselkennzeichen vorsehen.“
*****
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als nächster Redner gelangt Herr Abgeordneter Ing. Schultes zu Wort. Eingestellte Redezeit: 4 Minuten. – Bitte.
18.48
Abgeordneter Ing. Hermann Schultes (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzte Frau Bundesministerin! Hohes Haus! Wir haben in der heutigen KFG-Novelle einige wesentliche Punkte, die auch die Landwirtschaft betreffen, unter anderem das berühmte Thema mit der Gewichtszulassung für Milchtransportwagen.
Die Geschichte ist eine spannende. Für die Bürgermeister zur näheren Erläuterung: Milch wird abgeholt, je nachdem, wie viel gerade anfällt. Es ist bei den Kühen leider so, dass sie nicht ganz verlässlich jeden Tag gleich viel geben. Daher müssen die Milch-
transporter immer mit einer gewissen Reservekapazität fahren. Wenn die Reservekapazität bei 44 Tonnen ansteht, dann gibt es einen Zugwagen und einen Anhängewagen. Der Anhängewagen bleibt im Tal, wird unten angefüllt von Bauern, die die Milch hinbringen, und der Zugwagen fährt hinauf. Und wenn er jetzt die Möglichkeit hat, statt 40 Tonnen beim letzten Bauern auf 44 Tonnen aufzuladen, dann heißt das, dass die Gesamtkapazität schlichtweg besser ist, die Logistik billiger wird und er unnötige Fahrten vermeidet. Das ist im Sinne aller, und das ist in Wirklichkeit der Sinn dieser ganzen Regelung. Deshalb sind wir zufrieden.
Ein zweiter Punkt hängt mit der europäischen Einteilung der Traktoren-Typisierung zusammen. Wir haben da bis jetzt einen Punkt gehabt, wo es für die Traktoren, wenn sie schneller als 40 km/h laufen, geheißen hat, dass 25 Prozent des Gesamtgewichtes das Traktor-Mindestgewicht sein muss. Das hatte zur Folge, dass größere Traktoren geringere Lasten ziehen durften als Traktoren, die nur bis 40 km/h zugelassen wurden. Diese Ungeschicklichkeit des Gesetzes wird jetzt beseitigt und die entsprechende Bestimmung der Realität, das heißt der Entwicklung der Traktoren, angepasst.
Ein Punkt ist noch dabei, der mir persönlich sehr gut gefällt. Als Umweltsprecher begrüße ich sehr, dass Fahrräder mit elektrischem Hilfsantrieb bis zu 600 Watt Leistung und einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h weiterhin als Fahrräder gelten und vom KFG ausgenommen sind. Das ist eine sehr praktische Geschichte, denn da kann man mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren, man plagt sich nicht, man ist nicht verschwitzt und kommt doch ordentlich an. Das ist sozusagen das Fahrrad, auch wenn es elektrisch ist, für den täglichen Gebrauch. (Beifall des Abg. Grillitsch.)
Ich freue mich, dass sich Herr Präsident Grillitsch über das so besonders freut, sodass ich ihm die Freude mache, dass ich ihm die Minute schenke, weil es ein langer Tag wird, und mit der Rede aufhöre. (Beifall bei der ÖVP sowie bei Abgeordneten der SPÖ.)
18.50
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als nächste Rednerin gelangt Frau Abgeordnete Dr. Moser zu Wort. Eingestellte Redezeit: 5 Minuten. – Bitte.
18.50
Abgeordnete Dr. Gabriela Moser (Grüne): Frau Ministerin! Meine Damen und Herren! Kollege Schultes! Ihre Argumentation: mehr Milch, mehr Tonnen – wir sollen also mehr oder weniger akzeptieren, dass die Belastung von verschiedenen Straßenzügen, gerade auch von Güterwegen erhöht wird, dass 44-Tonnen-Milchtransporter drüberrollen. (Abg. Grillitsch: Sind Sie gegen die Milchbauern?) – Nein, ich bin überhaupt nicht gegen die Milchbauern. Ich bin dafür, dass jede Milchbäuerin und jeder Milchbauer ordentlich versorgt wird und dass die dort angekommene Milch ordentlich zur Molkerei gebracht wird. (Abg. Grillitsch: Wo ist der Pirklhuber? Haben Sie das dem Pirklhuber schon erzählt? Sie sind gegen die Milchbauern!)
Ich bin dagegen, dass wir Limits hinauflizitieren, die uns letztlich – Herr Kollege Grillitsch, passen Sie auf! – auf EU-Ebene in die Bredouille bringen. Sie wissen genau, die Argumentation Schwedens, Deutschlands, auch der Niederlande in Richtung 60-Tonnen-Gigaliner ist sehr massiv. Wenn wir jetzt schon unsere 40 Tonnen erhöhen auf 44, wie sollen wir dann argumentieren, dass wir nicht zusätzliche 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 Tonnen haben wollen? Wie soll ich da argumentieren?
Darum sagen wir, 40 Tonnen sind genug. Das ist EU-weit klar geregelt. Wir wollen keine Liberalisierung, keine Aufweichung dieser Grenzwerte, und darum haben wir die Zustimmung insgesamt gekoppelt mit der Ablehnung dieses Punktes.
Noch einen kurzen Satz zur Frage der Vernichtung oder Unkenntlichmachung der Typenscheine, wenn Wracks entsorgt werden. Wir wissen, es gibt sehr, sehr viele Autodiebstähle. Unlängst ist ja den Medien zu entnehmen gewesen, in Wien werden im europäischen Vergleich die meisten Autos gestohlen. Und diese gestohlenen Autos werden dann oft mit falschen Typenscheinen verkauft, mit Typenscheinen, die bei der Entsorgung von Wracks organisiert werden. Die Wracks werden praktisch dem Schredder überantwortet, und der Typenschein bekommt ein neues Leben in Form eines gestohlenen Autos.
Da wollen wir eingreifen und eine klare gesetzliche Regelung haben: Wenn das Fahrzeug nicht mehr existiert, soll der Typenschein – genauso wie ein altes aufgelöstes Sparbuch – entweder gestempelt, gelocht oder durch irgendeine Prägung unkenntlich gemacht werden. Das ist eine ganz einfache Vorgangsweise.
Sie selber haben ja das Problem auch ernst genommen beziehungsweise als existent erachtet. Ich verstehe überhaupt nicht, warum Sie unseren Vorschlag, der gerade aus Wirtschaftskreisen kommt, auch aus Kreisen der verschiedenen Werkstätten und aus Kreisen, die mit Wracks zu tun haben, einfach ablehnen. Jetzt wollten wir endlich einmal einen wirtschaftsfreundlichen Vorschlag machen – und das wird schon wieder negativ gesehen. Gleich wird wieder vonseiten der Regierungsfraktionen gemauert. Das ist keine Kultur! Ich bin sie leider schon lange gewöhnt, aber sie ist kindisch. (Beifall bei den Grünen.)
18.54
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Zu einer Stellungnahme hat sich Frau Bundesministerin Bures zu Wort gemeldet. – Bitte.
18.54
Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie Doris Bures: Herr Präsident! Hohes Haus! Die Novelle zum Kraftfahrgesetz soll den Autofahrerinnen und Autofahrern vor allem ein gewisses Service bieten, nämlich vor allem, was das Scheckkartenformat des Zulassungsscheines betrifft. Seit drei Jahren besteht ja bereits die Möglichkeit, einen Führerschein in diesem Format zu bekommen. Von den rund 5 Millionen Führerscheinbesitzern, die es in Österreich gibt, ist es immerhin schon ein Drittel, das in dieser kurzen Zeit gesagt hat, ja, es ist für sie handlicher, angenehmer, einen Führerschein im Scheckkartenformat zu haben.
Daher schaffen wir heute die rechtliche Voraussetzung dafür, dass man weder mit Führerschein noch mit Zulassungsschein im Papierformat unterwegs sein muss. Wie das auch im Handel und in vielen anderen Bereichen schon üblich ist, bieten wir mit dieser gesetzlichen Möglichkeit jetzt auch in diesem Bereich ein zeitgemäßes Service an, und, wie gesagt, beim Führerschein wurde das wirklich sehr gut angenommen.
Ich sage das deshalb, weil die Diskussion wieder damit begonnen hat, dass es die Intention dieser gesetzlichen Regelungen wäre, den Autofahrerinnen und Autofahrern wieder einmal das Leben schwerer zu machen.
Herr Abgeordneter Vock, ich kann Ihnen nur sagen: Mein Motiv, das mich treibt, etwas zu unternehmen, ist, dass wir weniger Raser auf den Straßen haben. Es geht mir nicht darum, hier jemanden abzuzocken. Es wandert von diesem Geld auch gar nichts ins BMVIT. Das ist ein absurdes Motiv, das Sie hier unterstellen. Mein Motiv dafür, dass wir all diese Maßnahmen setzen, die jetzt auch das Hohe Haus beschlossen hat, ist, dafür zu sorgen, menschliches Leid zu verhindern. (Beifall bei der SPÖ.)
Ich möchte noch einmal darauf hinweisen: Durch Rasen verlieren vier Menschen in der Woche ihr Leben! Ich glaube, das ist das Motiv, das uns gemeinsam als verantwor-
tungsbewusste Politikerinnen und Politiker leiten muss – anstatt hier irgendwelche Dinge an den Haaren herbeizuziehen.
Mit der jetzigen Novelle gibt es vor allem mehr Geld für die Verkehrssicherheit, für den Verkehrssicherheitsfonds, nämlich durch die Anhebung des Verkehrssicherheitsbeitrags für Wunschkennzeichen. Seit 20 Jahren ist dieser Beitrag gleich geblieben, allemal ist es jetzt Zeit für eine Anhebung. Und das Zweite ist, ein Service für die Autofahrerinnen und Autofahrer anzubieten, und das finde ich gut. – Danke. (Beifall bei der SPÖ.)
18.56
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als vorläufig Letzter hiezu zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Mag. Lettenbichler. Eingestellte Redezeit: 3 Minuten. – Bitte.
18.56
Abgeordneter Mag. Josef Lettenbichler (ÖVP): Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Bundesministerin! Liebe Besucher aus dem Bezirk Kitzbühel! Hohes Haus! Mit der heute zur Diskussion stehenden KFG-Novelle gibt es fortan die Wahlmöglichkeit, anstelle der Zulassung aus Papier eine solche aus PVC im Chipkartenformat zu beantragen. Für die Bearbeitungsdauer erhält der Zulassungsbesitzer eine auf acht Wochen befristete Zulassung in Papierform.
Angehoben wird weiters der Beitrag für Wechselkennzeichen von 145 auf 200 €. Ein aus meiner Sicht durchaus gerechtfertigter Betrag, wenn man bedenkt, dass seit 20 Jahren hier keine Erhöhung mehr vorgenommen wurde.
Verschärfungen sind vorgesehen bei Verweigerung, sein Fahrzeug abwiegen oder kontrollieren zu lassen.
Was die Erleichterungen für den landwirtschaftlichen Bereich betrifft, hat mein Kollege Schultes die Änderungen bereits dargestellt.
Letztlich soll bei mit Messgeräten festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitungen von 20 bis 30 km/h eine Organstrafverfügung von bis zu 70 € sofort eingehoben werden.
Wir haben im Ausschuss auch über einige andere verkehrspolitische Themen diskutiert, die ebenfalls heute bereits diskutiert wurden.
Zum Antrag von Kollegin Moser darf ich erwähnen, dass dieser eher im Justizausschuss zu behandeln sein wird, da es sich um einen Missbrauchsvorwurf handelt.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit dieser KFG-Novelle stellen wir uns auf die Veränderungen, die sich natürlich auch im Verkehrsbereich ergeben haben, ein. Es geht darum, dass wir die Verkehrssicherheit erhöhen und die Verkehrskontrolle insgesamt effizienter gestalten. Es geht darum, dass wir gesetzliche Erleichterungen, Anpassungen und Verbesserungen vornehmen.
Insgesamt also sinnvolle Gesetzesänderungen, die allesamt die Verkehrssicherheit erhöhen sollen. – Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. (Beifall bei der ÖVP.)
18.58
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
Wünscht der Herr Berichterstatter ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall.
Wir gelangen nun zur Abstimmung, die ich über jeden Ausschussantrag getrennt vornehme.
Zunächst kommen wir zur Abstimmung über den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Kraftfahrgesetz geändert wird (30. KFG-Novelle), in 262 der Beilagen.
Hiezu liegt ein Verlangen auf getrennte Abstimmung der Abgeordneten Dr. Moser vor.
Ich werde zunächst über die von dem erwähnten Verlangen auf getrennte Abstimmung betroffenen Teile und schließlich über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes abstimmen lassen.
Wir kommen zur getrennten Abstimmung über die Ziffern 4 und 32 in der Fassung des Ausschussberichtes.
Ich ersuche jene Mitglieder des Hohen Hauses, die diesen Teilen ihre Zustimmung geben, um ein diesbezügliches Zeichen. – Das ist die Mehrheit und somit angenommen.
Schließlich komme ich zur Abstimmung über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang in der Fassung des Ausschussberichtes.
Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu ihre Zustimmung erteilen, um ein bejahendes Zeichen. – Auch das ist mit Mehrheit angenommen.
Wir kommen sogleich zur dritten Lesung.
Ich bitte jene Damen und Herren, die auch in dritter Lesung für den vorliegenden Gesetzentwurf sind, um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist die Mehrheit. Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung angenommen.
Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Hagen, Kolleginnen und Kollegen betreffend Beendigung der Benachteiligung von Wechselkennzeichen-Besitzern durch die Vignettenpflicht.
Ich bitte jene Damen und Herren, die für diesen Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist die Minderheit. Abgelehnt.
Ferner kommen wir Abstimmung über den Antrag des Verkehrsausschusses, seinen Bericht 263 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen.
Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes Zeichen. – Das ist mit Mehrheit angenommen.
Bericht des Verkehrsausschusses über den Antrag 527/A(E) der Abgeordneten Anton Heinzl, Dr. Ferdinand Maier, Kolleginnen und Kollegen betreffend Einsatz gegen die Zulassung von „Gigalinern“ auf europäischer Ebene (264 d.B.)
24. Punkt
Bericht des Verkehrsausschusses über den Antrag 547/A(E) der Abgeordneten Dr. Gabriela Moser, Kolleginnen und Kollegen betreffend Nein zum Gigaliner (25-Meter-Monster-Lkw mit bis zu 60 Tonnen) (265 d.B.)
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Wir gelangen nun zu den Punkten 23 und 24 der Tagesordnung, über welche die Debatte oder einem durchgeführt wird.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Zu Wort gemeldet ist als Erster Herr Abgeordneter Tadler. Eingestellte Redezeit: 3 Minuten. – Bitte.
19.02
Abgeordneter Erich Tadler (BZÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Frau Minister! Hohes Haus! Vorab: Das BZÖ wird dem Antrag gegen die Gigaliner zustimmen. Das BZÖ begrüßt diese Forderung, da die Gigaliner durch ihre Überlänge die Unfallgefahr für andere Verkehrsteilnehmer maßgeblich erhöhen. Auch das Gewicht der überlangen Fahrzeuge – hier reden wir von 60 Tonnen – stellt eine ernorme Gefahr für die anderen Verkehrsteilnehmer dar. Bei einem Unfall, der vielleicht unschuldig Menschen das Leben kostet, können die Einsatzkräfte nicht einmal mit ihren Bergegeräten vor Ort dazukommen.
Es gibt aber auch noch andere Gründe, diesem Antrag zuzustimmen, etwa Österreichs topographischen Gegebenheiten. Lkw sind ja bis zu 25 Meter lang. Aus der Vergangenheit kennt ja jeder unsere Winter, und wir wissen auch, dass da die Straßen stärker strapaziert werden. Man denke nur an die Tauern Autobahn oder an die Brenner Autobahn, die dieser Belastung nicht lange standhalten würden.
Von Brüssel lassen wir uns sowieso nicht diktieren, wie und wann wir unsere Straßen weiterhin zu bauen haben, Frau Minister. Auch der zuständige Fachverband der Wirtschaftskammer Österreich steht dem Ansinnen Brüssels negativ gegenüber, sogar sehr ablehnend gegenüber. Und eigentlich sollte es auch aus Brüssel einen Vorschlag geben, der die Verlagerung der Transporte von der Straße auf die Schiene vorschlägt, meine Damen und Herren. Doch mir kommt es schön langsam vor, als ob wir in Brüssel – und das wissen wir schon lange – nur Lobbyisten haben. (Beifall beim BZÖ.)
19.03
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als Nächste zu Wort gelangt Frau Abgeordnete Binder-Maier. Eingestellte Redezeit: 2 Minuten. – Bitte.
19.03
Abgeordnete Gabriele Binder-Maier (SPÖ): Sehr geehrte Frau Minister! Meine Damen und Herren! Es geht bei den vorliegenden beiden Anträgen um die sogenannten Gigaliner, um Riesenfahrzeuge. Von vielen von Ihnen werden schon die Sattelschlepper als etwas Ungeheuerliches und manchmal auch als sehr bedrohlich empfunden.
Nun gibt es innerhalb der EU Bestrebungen, sogenannte Gigaliner, Monsterfahrzeuge zuzulassen. Mein Kollege hat schon erwähnt: Diese sind 25 Meter lang und wiegen 60 Tonnen. Interessant ist, dass es innerhalb der EU eine Studie gab, im Rahmen welcher einerseits positive Auswirkungen festgestellt wurden, aber andererseits auch negative Auswirkungen aufgezeigt wurden. Zum einen wurde die negative Auswirkung auf die Verkehrsicherheit festgestellt, und zum anderen, dass es dadurch aufgrund der geringeren Kosten zu einer verstärkten Rückverlagerung des Verkehrs von Schiene und Schiff auf die Straße kommen würde und dass dadurch für die Infrastruktur höhere Kosten und höhere Erhaltungskosten entstehen würden.
Es gibt ein klares verkehrspolitisches Nein vom Bundesministerium und von Bundesministerin Bures. Denn: Wir müssten Straßen verändern – allein in Niederösterreich gibt es unzählige Kreisverkehre –, damit dieses Riesenfahrzeug im Kreis fahren könnte, und wir müssten Brücken verändern und so weiter und so fort.
Außerdem ist zu erwähnen, dass die Zulassung absolut in Widerspruch zur europäischen Verkehrspolitik und auch zur österreichischen Verkehrspolitik steht und dass wir auch auf die landschaftlichen Gegebenheiten in Österreich Rücksicht nehmen müssen. Deshalb eine klares Nein und eine klare Unterstützung für die Vorgangsweise der Ministerin, in Österreich und auch in Europa. (Beifall bei der SPÖ.)
19.05
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als Nächste zu Wort gelangt Frau Abgeordnete Dr. Moser. Eingestellte Redezeit: 4 Minuten. – Bitte.
19.06
Abgeordnete Dr. Gabriela Moser (Grüne): Frau Ministerin! Meine Damen und Herren! Liebe Vorrednerin, wenn du schon dafür bist, dass wir weder in Österreich noch in Europa Gigaliner haben, dann müsstest du eigentlich unserem Antrag zustimmen, denn unser Antrag spiegelt sich in den Forderungen der Gewerkschaft wider.
Kollege Haberzettl, deine Forderungen sind in unserem Antrag genau wiedergegeben, weil – und der Hund liegt ja im Detail – der Regierungsantrag nur gegen eine europäische Zulassung von Gigalinern ist, wir aber auch wollen, dass in den Nationalstaaten keine Gigaliner zugelassen werden, denn was nützt es uns, wenn es auf europäischer Ebene sozusagen nicht möglich ist, aber sehr wohl in Deutschland. Dann stehen die deutschen 60-Tonnen-Gigaliner vor unseren Grenzen.
Da sind wir derselben Meinung wie zum Beispiel die Gewerkschaft oder die europäischen Eisenbahnerverbände. 60-Tonnen-Gigaliner sind die größte Konkurrenz für den Güterverkehr auf der Schiene. Daher appelliere ich an Sie: Überlegen Sie sich das noch einmal und stimmen Sie unserem Antrag zu, denn er hat das breitere fachliche Fundament und er ist der bessere und wirksamerer Riegel gegen Gigaliner!
Außerdem hätte ich noch ein weiteres Anliegen, wo es, wie ich meine, einen Allparteienkonsens geben müsste, und dieses betrifft die Lkw-Verkehr-Belastung der AnrainerInnen. Dabei geht es darum, durch Lärmreduktionsmaßnahmen und durch Lärmschutzmaßnahmen sozusagen Autobahnstücke verträglicher zu machen für AnrainerInnen. Da haben wir in Oberösterreich mit der A 8 ein Strecke, die mit dem Transitverkehr, dem Lkw-Verkehr eine stärkere Belastung darstellt als zum Beispiel die Brenner Autobahn. Dort leben Menschen direkt an einer Ost- und West-Transitachse ohne ausreichenden Lärmschutz.
Daher möchte ich folgenden Antrag einbringen:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Dr. Moser, Ursula Haubner, Dr. Haimbuchner, Kolleginnen und Kollegen betreffend Verbesserungen der Lärmschutzmaßnahmen an der A 8 – Innkreis Autobahn
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie wird beauftragt, gemeinsam mit der ASFINAG endlich Verhandlungen mit dem Land Oberösterreich, den Bürgermeistern und der Schutzgemeinschaft „Lebensraum A8“ über deutliche Nachjustierungen und Verbesserungen des Lärmschutzes an der gesamten A 1 aufzunehmen, um für die betroffene Bevölkerung eine Lärmentlastung mit dem Ziel einer maximalen Belastung von 50 Dezibel zu erreichen.“
*****
Frau Ministerin, es liegt alleine an Ihnen, für die Menschen, die an der A 8 leben, die unter schrecklicheren Bedingungen leben als die AnrainerInnen am Brenner, endlich eine Regelung zu treffen, die sie wieder in der Nacht schlafen lässt und die sie am Tag auch wieder ihr Anwesen genießen lässt. Tatsache ist nämlich: Die Autobahn ist größtenteils später gebaut worden, als die dort lebenden Menschen dorthin gezogen sind. Und wie kommen jetzt die dort lebenden Menschen dazu, dass sie nicht nur in ihrer Le-
bensqualität beeinträchtigt werden, sondern das auch ihr Vermögen, sprich: der Wert ihrer Liegenschaft, massiv abgewertet wird durch den Lkw-Lärm, durch den Verkehrslärm, der durch den Ausbau der A 8 sicherlich nicht weniger werden wird, sondern noch mehr.
Daher appelliere ich noch einmal an alle in diesem Haus vertretenen Parteien, dieses lokale Anliegen, dieses regionale Anliegen der Menschen ernst zu nehmen. Und Sie, Frau Ministerin, können doch nicht den Dialog verweigern! Stimmen Sie doch zu! (Beifall bei den Grünen.)
19.09
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Frau Kollegin, Sie haben beim Vortrag des Entschließungsantrages offensichtlich irrtümlich „A 1“ vorgelesen. Ich nehme an, dass die A 8 gemeint war, so wie es im Text steht. (Abg. Dr. Moser: Ja, A 8!) Das berichtigen wir demgemäß.
Dann teile ich mit, dass der soeben eingebrachte Entschließungsantrag ausreichend unterstützt ist und mit zur Verhandlung steht.
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Dr. Moser, Ursula Haubner, Dr. Haimbuchner, Kolleginnen und Kollegen betreffend Verbesserungen der Lärmschutzmaßnahmen an der A 8 – Innkreisautobahn
eingebracht im Zuge der Debatte über Bericht des Verkehrsausschusses über den Antrag 527/A(E) der Abgeordneten Anton Heinzl, Dr. Ferdinand Maier, Kolleginnen und Kollegen betreffend Einsatz gegen die Zulassung von "Gigalinern" auf europäischer Ebene (264 d.B.)
Der von Straßen,- Schienen- und Flugverkehr verursachte Lärm ist in den letzten Jahren zu einer ernsten Belastung für die Bevölkerung geworden. Oberösterreich ist aufgrund seiner geographische Lage und seines hohen Anteils an industrieller Produktion von Transit- und Güterverkehr und den damit einhergehenden Lärmemissionen besonders betroffen. Die Belastung der Menschen entlang der Autobahnen und speziell an der A8 Innkreisautobahn hat längst ein unerträgliches Maß erreicht. Die A8 ist Teil der europäischern Transitroute (Achse West-Südosteuropa) und wird derzeit täglich von durchschnittlich 45.000 KFZ mit einem LKW-Anteil von 40 % - 50 % befahren. Sie hat somit die doppelte Belastung der Brennerautobahn A13 und nahezu die dreifache der Tauernautobahn A10. Gerade der hohe LKW-Anteil, der in Österreich seinesgleichen sucht, verursacht eine enorme Lärmbelastung vor allem in den Nachtstunden.
Verkehrsprognosen zeigen, dass insbesondere der Güterverkehr an der Innkreisautobahn in den nächsten Jahren weiterhin steigen wird – laut dem Gesamtverkehrskonzept Oberösterreich 2008 wird das Güterverkehrsaufkommen auf Oberösterreichs Straßen im Vergleichszeitraum 2000 bis 2030 um 33 Prozent ansteigen.
Die A8 Innkreisautobahn zwischen dem Knoten Wels und der Grenze Suben wurde von 1984 bis 1990 erbaut. Die damals von Seiten des Bundes gewählte ortsnahe Trassenführung führt durch dicht bebautes Gebiet. Insbesondere die Gemeinden Pichl bei Wels, Kematen, Meggenhofen; Weibern, Aistersheim, Haag am Hausruck, Pram, Ort im Innkreis und Antiesenhofen sind davon besonders betroffen.
Große Hoffnungen wurden daher auf die Generalsanierung der Autobahn gesetzt, da im Zusammenhang mit dem Ausbau eine umfangreiche Sanierung auf verstärkte Lärm-
schutzmaßnahmen gehofft wurde. Es muss demnach auch beachtet werden, dass durch die hohen Lärmbelastungen eine große Wertminderung der Häuser (lt. Immobilien-Wertermittlungen von Banken und beeideten Gutachtern bis 30 % in Einzelfällen, vor allem im ländlichen Raum, bis zur Unverkäuflichkeit) entstanden ist und daher der eventuelle Verkauf wirtschaftlich in keinem Verhältnis zum ursprünglichen Wert steht. Große Zuversicht setzten die Anrainerinnen und Anrainer daher in die von der ASFINAG angekündigte Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP).
Doch durch die festgelegte Sanierung der bestehenden Autobahn wurde die Hoffnung auf ein UVP zunichte gemacht. Dies hat großen Unmut in der Region ausgelöst. Da die Belastung durch den Lkw-Verkehr aber weiter steigen wird befürchten die betroffenen Anrainerinnen und Anrainer, dass der geplante Lärmschutz nicht ausreichen wird.
Daher könnte durch eine streckenweise Verwendung von gebogenen Lärmschutzwänden im Bereich von besonders belasteten Siedlungsgebieten entlang der A 8 zum Beispiel weitere 5-6 dB an Lärmreduktion erreicht werden. Mit einer Aufbringung von lärmarmen Belägen (z.B. Splitt-Mastix-Belag) sind ebenfalls Geräuschminderungspotentiale bei PKW um bis zu 6 dB und bei LKW um bis zu 5 dB möglich. Auch der Einsatz einer Abschnittskontrolle zur Überwachung von Tempolimits (Section Control) und der damit verbundenen Geschwindigkeitsreduzierung würde eine Reduktion des Lärmpegels von 1 dB bis 2 dB bringen.
Aus diesen Gründen stellen die unterfertigten Abgeordneten nachstehenden
Entschließungsantrag:
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie wird beauftragt, gemeinsam mit der ASFINAG endlich Verhandlungen mit dem Land Oberösterreich, den Bürgermeistern und der Schutzgemeinschaft „Lebensraum A8“ über deutliche Nachjustierungen und Verbesserungen des Lärmschutzes an der gesamten A8 aufzunehmen, um für die betroffene Bevölkerung eine Lärmentlastung mit dem Ziel einer maximalen Belastung von 50 Dezibel zu erreichen.“
*****
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Dr. Maier. Eingestellte Redezeit: 3 Minuten. – Bitte.
19.10
Abgeordneter Dr. Ferdinand Maier (ÖVP): Herr Präsident! Frau Ministerin! Meine Damen und Herren! Ich hätte Frau Dr. Moser ohnehin darauf hingewiesen, dass Sie das korrigiert.
Was die A 8 betrifft, so wird das Ganze sehr intensiv geprüft. Selbstverständlich gibt es diesbezüglich Anliegen, und es werden ja auch Maßnahmen gesetzt werden. Ich meine, man sollte da schon mit einem gewissen Augenmaß vorgehen und einmal abwarten, wie sich die geplanten Maßnahmen, wie etwa das Aufbringen von lärmminderndem Asphalt, sogenannten Flüsterasphalt, oder eine Tempoüberwachung, die verstärkt vorgenommen wird, insbesondere für Lkw in der Nacht, aber auch ein verstärkter Einsatz von Radargeräten bis hin zur Section Control, auswirken.
Das alles sollten wir zunächst einmal abwarten und schauen, wie sich das auswirkt. Dann können wir Gespräche aufnehmen, dazu sind wir gerne bereit, und ich gehe davon aus, dass wir dann auch eine Zustimmung finden werden. Dann, wenn wir einmal
wissen, wie sich das auswirkt, wird auch die Frau Bundesministerin mit am Tisch sitzen.
Ein weiterer Punkt: die Gigaliner. Frau Dr. Moser, sicher ist, dass in dieser Gegend keine Gigaliner fahren werden. Darüber sollten Sie doch froh sein.
Ich bin erstaunt, dass Sie unserem Antrag nicht beitreten, denn damit entsprechen wir der Notwendigkeit, gerade jetzt, wo den EU-Vorsitz Schweden innehat, die Gigaliner zu verhindern. Dazu wird die Frau Bundesminister aufgefordert – ich gehe davon aus, sie fühlt sich in Brüssel sehr wohl –, dort min Verve und Vehemenz diese Forderung zu vertreten mit ihren Kolleginnen und Kollegen.
Zu Ihrer Sorge, was die Verkehrspolitik in Deutschland betrifft: Ich gehe davon aus, dass die Frau Bundesministerin mit dem Kollegen in Deutschland darauf einwirken wird, dass auch dort keine Gigaliner zugelassen werden, sodass keine über die Grenzen kommen können. – Danke schön. (Beifall bei der ÖVP.)
19.12
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Dr. Königshofer. Eingestellte Redezeit: 3 Minuten. – Bitte.
19.12
Abgeordneter DDr. Werner Königshofer (FPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Bundesminister! Meine Damen und Herren! Hohes Haus! Hierbei handelt es sich um einen Entschließungsantrag von ÖVP und SPÖ an die Bundesregierung zur Verhinderung von Monster-Lkw, genannt Gigaliner, vor allem für unser Land, für den Bereich der alpinen Straßen.
Meine Damen und Herren, ich will ja gar nicht sagen, dass Gigaliner immer und überall nicht einsetzbar wären. Es hat durchaus einen Sinn, wenn diese Lkw durch die australische Wüste über Hunderte Kilometer planierte Rollbahn fahren. Genauso macht es einen Sinn, wenn zum Beispiel in Schweden über Schneerollbahnen Hunderte Kilometer lang mit Gigalinern schweres Rundholz transportiert wird. Das kann durchaus Sinn machen. Deshalb, Frau Kollegin Moser, können wir uns Ihrem Antrag nicht anschließen, der ein generelles Gigaliner-Verbot in allen EU-Staaten zum Ziel hat, sondern wir unterstützen den Entschließungsantrag von ÖVP und SPÖ.
Man sieht an der Gigaliner-Problematik wieder, dass sich die Herrschaften in Brüssel offenbar wenig Gedanken über die europäische Geographie machen. Anscheinend hat man nicht bedacht, dass sich mitten durch Europa ein großer Gebirgszug, genannt die Alpen, zieht und dass dort ganz andere Verkehrs- und klimatische Verhältnisse herrschen als in der ungarischen Tiefebene, auf den Rollbahnen Schwedens oder Spaniens und so weiter.
Meine Damen und Herren, ich komme aus Tirol und habe mich mit Transporteuren dort unterhalten und erfahren, dass es massive Probleme beim Einsatz dieser Monster-Lkws gäbe, und zwar auf den Bergstrecken. Stellen Sie sich einmal vor: Auf der A 13, der Brenner Autobahn, wälzen sich an einem heißen Sommertag zehn Gigaliner hintereinander Richtung Brenner (Abg. Mag. Wurm: Über die Europabrücke!) – über die Europabrücke, sagt die Frau Kollegin Wurm. Was wird dann passieren, Frau Kollegin Wurm? – Dann ist die Asphaltdecke der Brenner Autobahn kaputt. Dann können wir die Autobahn sperren.
Oder denken Sie daran, was ein Gigaliner auf Gefällestrecken bedeutet, welche Wucht solch ein 60-Tonnen-Lkw hat – das ist ungefähr das doppelte Gewicht eines Jumbo Jets, einer Boeing 747 –, was passiert, wenn der nicht mehr zu halten ist, welche Gewalt da ausgelöst werden würde!
Außerdem verbrauchen oder emittieren diese Gigaliner auch wesentlich mehr CO2 – und das lehnen wir ab!
Ein Letztes ist noch anzumerken: Wenn Gigaliner vorgeschrieben werden würden und wir diese zulassen müssten, dann wären große und teure Adaptierungen unserer Straßen und Autobahnen – ich denke zum Beispiel an Kreisverkehre – notwendig.
Meine Damen und Herren, wir können nicht jeden Unsinn, der in Brüssel ausgedacht wird, in Österreich umsetzen – nicht nur aus Kostengründen, sondern auch deshalb, weil es zu gefährlich wäre.
In diesem Sinne sagen auch wir: Wir müssen dagegen ankämpfen, wir wünschen der Regierung dabei viel Erfolg, und wir werden uns diesem Antrag anschließen. – Danke. (Beifall bei der FPÖ.)
19.15
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Zu einer Stellungnahme hat sich Frau Bundesministerin Bures zu Wort gemeldet. Ich erteile es ihr.
19.16
Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie Doris Bures: Ja, es ist mein erklärtes Ziel, dass wir keine Gigaliner, keine Monster-Lkw auf Österreichs Straßen haben. Daher möchte ich mich bei all jenen, die diesen Antrag unterstützen, dafür bedanken, dass Sie damit einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass wir auf europäischer Ebene wirklich dafür sorgen, dass wir in Österreich keine Gigaliner auf unseren Straßen haben und ein Verbot des grenzüberschreitenden Verkehrs von Gigalinern in ganz Europa. – Herzlichen Dank für die Unterstützung! (Beifall bei der SPÖ sowie bei Abgeordneten der ÖVP.)
19.16
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Vorläufig letzter Redner dazu: Herr Abgeordneter Dr. Haimbuchner. Eingestellte Redezeit: 2 Minuten. – Bitte.
19.16
Abgeordneter Mag. Dr. Manfred Haimbuchner (FPÖ): Herr Präsident! Frau Bundesministerin! Die Frau Kollegin Dr. Moser von der grünen Fraktion hat einen Entschließungsantrag eingebracht, und ich glaube, Sie hat versehentlich zu erwähnen vergessen, dass dieser Entschließungsantrag von der Frau Kollegin Haubner vom BZÖ und von mir von der FPÖ unterstützt wird. Ich glaube, es wäre angebracht gewesen, das beim Antrag auch zu erwähnen, Frau Kollegin Moser. (Zwischenruf der Abg. Dr. Moser.)
Wir fordern hier insbesondere die oberösterreichischen Abgeordneten auf, diesen Antrag zu unterstützen. Kollege Großruck – er kommt aus dem Bezirk Grieskirchen – und Kollege Wöginger, wir alle wissen, dass beim Ausbau der A 8, den man nicht Ausbau nennen kann, derzeit viele Fehler gemacht werden. Das kommt halt heraus, wenn es eine schwarz-grüne Regierung in Oberösterreich gibt. (Zwischenruf des Abg. Großruck.)
Man sollte an dieser Stelle auch klar sagen, dass die Bürger auch entsprechend unterstützt werden sollen. (Neuerlicher Zwischenruf des Abg. Großruck.)
Kollege Großruck, bitte kommen Sie nachher hierher zum Rednerpult und erklären Sie der Bevölkerung im Hausruckviertel, warum man sich nicht für einen entsprechenden Lärmschutz einsetzt!
Schauen Sie, es ist dort ganz anders, wo es eine freiheitliche Gemeinde gibt, wie zum Beispiel in Steinhaus bei Wels, da gibt es einen ordentlichen Lärmschutz. Nehmen Sie sich daran ein Beispiel! – Vielen Dank. (Beifall bei der FPÖ.)
19.18
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
Wünscht der Herr Berichterstatter ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall.
Wir gelangen nun zur Abstimmung, die ich über jeden Ausschussantrag getrennt vornehme.
Zunächst kommen wir zur Abstimmung über die dem Ausschussbericht 264 der Beilagen angeschlossene Entschließung.
Ich bitte jene Damen und Herren, die hierfür eintreten, um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist die Minderheit. Abgelehnt. (Abg. Grosz: Das war der Regierungsantrag! Das ist klar abgelehnt, Herr Präsident! – Weitere Rufe beim BZÖ: Abgelehnt!) Ist abgelehnt! Selbstverständlich.
Wir gelangen weiters zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Dr. Gabriela Moser, Ursula Haubner, Dr. Haimbuchner, Kolleginnen und Kollegen betreffend Verbesserungen der Lärmschutzmaßnahmen an der A 8 – Innkreis Autobahn.
Ich bitte jene Damen und Herren, die für diesen Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist die Minderheit. Abgelehnt.
Ferner gelangen wir zur Abstimmung über den Antrag des Verkehrsausschusses, seinen Bericht 265 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen.
Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes Zeichen. – Das ist mit Mehrheit angenommen.
Bericht des Verkehrsausschusses über die Regierungsvorlage (227 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Bundesbahngesetz, das Privatbahngesetz 2004 und das Eisenbahngesetz 1957 geändert werden (299 d.B.)
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Wir gelangen nun zum 25. Punkt der Tagesordnung.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Zu Wort gemeldet ist als Erster Herr Abgeordneter Kunasek. Eingestellte Redezeit: 3 Minuten. – Bitte.
19.20
Abgeordneter Mario Kunasek (FPÖ): Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Wir Freiheitlichen haben uns ja auch schon im Ausschuss gegen die vorliegende Regierungsvorlage ausgesprochen. Vor allen Dingen die Kritik des Rechnungshofes hat uns dazu bewogen, einiges kritisch anzumerken, wie wir auch die Vermutung hegen, dass diese Umstrukturierung der Bundesbahnen eigentlich dazu dienen soll, einige unliebsame Vorstände loszuwerden beziehungsweise andere mit teuren Beratungsleistungen hoch zu entlohnen. – Wir werden auch heute hier diese Regierungsvorlage nicht unterstützen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte aber diese Gelegenheit auch noch dazu nutzen, ein Thema anzusprechen, das für uns in der Steiermark sehr wichtig ist, das ist die geplante Stilllegung der Gesäusebahn mit 1. September 2009.
Geschätzte Kolleginnen und Kollege, diese Stilllegung löste in der Region massive Kritik und Widerstand aus. Bewohner, Reisende, aber auch Bürgermeister und Politiker aller Parteien haben sich gegen diese geplante Stilllegung und gegen diese Maßnahme ausgesprochen. Das führte sogar dazu, dass ÖVP, SPÖ und Grüne gemeinsam im Landtag Steiermark einen Antrag eingebracht haben, der sich gegen diese Stilllegung ausspricht.
Ich möchte auch heute hier einen Entschließungsantrag der Abgeordneten Kunasek, Dr. Kurzmann, Dr. Winter, Zanger und weiterer Abgeordneter betreffend Erhaltung der Gesäusebahn einbringen:
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie und der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend werden aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass
1. die ,Gesäusebahn‘ als prioritärer Verkehrsträger für den Personennahverkehr erhalten bleibt,
2. umgehend Verhandlungen mit der ÖBB aufgenommen werden, um
die bestehenden Verkehrsdienstverträge dahingehend abzuändern, dass eine nachhaltige Sicherung der Bahnlinie durch das Gesäuse gewährleistet wird und zusätzliche Busangebote nicht mit der Bahnlinie konkurrieren, sondern diese lediglich punktuell ergänzen,
ein bedarfsorientiertes Fahrplanangebot in Abstimmung mit den Gemeinden erarbeitet und die Komfortqualität der Gesäusebahn attraktiviert werden und
3. gemeinsam mit dem Land Steiermark ein touristisches Attraktivierungskonzept vorgelegt wird, um die Auslastung der Gesäusebahn zu steigern.“
*****
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich ersuche Sie – vor allem die steirischen Abgeordneten sind gefordert –, diesen Antrag entsprechend zu unterstützen, zumal auch die Argumentation für die Stilllegung für uns nicht nachvollziehbar ist. So wird beispielsweise angeführt, dass der Winterdienst zu teuer sei, obwohl die Schneeräumung trotzdem auch jetzt weiter passieren muss, weil ja die Strecke für den Güterverkehr weiterhin betrieben wird. Auch die angebliche mangelnde Auslastung dieser Strecke ist wohl eher auf wenig durchdachte Fahrpläne und mangelnde Anschlusskonzepte zurückzuführen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich fordere Sie eindringlich auf, diesen Antrag zu unterstützen und diesen wichtigen Schritt auch für die Verkehrsverbindung sicherzustellen und eine weitere Ausdünnung im Bereich der Infrastruktur in der Region Gesäuse zu verhindern! (Beifall bei der FPÖ.)
19.23
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Der soeben eingebrachte Entschließungsantrag ist ausreichend unterstützt, steht im Zusammenhang mit der Materie und daher mit in Verhandlung.
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Kunasek, Dr. Kurzmann, Dr. Winter, Zanger und weiterer Abgeordneter betreffend Erhaltung der Gesäusebahn
eingebracht im Zuge der Debatte zu TOP 25, Bericht des Verkehrsausschusses über die Regierungsvorlage (227 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Bundesbahngesetz, das Privatbahngesetz 2004 und das Eisenbahngesetz 1957 geändert werden (299 d.B.), in der 32. Sitzung des Nationalrates, XXIV. GP, am 10. Juli 2009
Mit 1. September 2009 wird laut Aussagen des ÖBB-Pressesprechers Alfred Ruhaltinger der Personenverkehr auf der Gesäusestrecke der Bundesbahnen eingestellt. Stattdessen soll für die betroffenen Gemeinden an der Bahnlinie – die Gemeinden Admont, Johnsbach/Gstatterboden, Hieflau, Landl/Großreifling, Weißenbach-St. Gallen und Kleinreifling – ein entsprechendes Bus-System etabliert werden.
Begründet wird die Streichung der Personenzüge seitens der ÖBB unter anderem mit folgenden Argumenten: Nur zwischen zwei und 17 Einsteiger würden die Strecke pro Tag benützen, was einen Jahresverlust von 2,2 Millionen Euro verursache. Zudem sei eine Aufrüstung der Strecke für schnellere Personenzüge mit 15 bis 20 Millionen Euro im Vergleich zu der tatsächlichen Auslastung nicht verhältnismäßig. Die Gesäusestrecke sei vor allem für den Güterverkehr bedeutend.
In der Region erhöht sich nun der Widerstand gegen diese Pläne. Bewohner, Reisende, die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden sowie Politiker sämtlicher Couleurs sprechen sich gegen die vollständige Einsparung der Personenzüge aus.
Die Eisenbahnstrecke durch das Gesäuse – historisch erwachsen aus der Kronprinz Rudolfbahn – gehört zu den schönsten Bahnstrecken Österreichs und führt zudem durch den einzigarten gleichnamigen Nationalpark. Das mehr als 11.000 Hektar große Nationalparkgebiet zwischen Admont und Hieflau ist ein Naturjuwel und weit über die Bezirksgrenzen hinaus als beliebtes Freizeit-, Erholungs- und Forschungsgebiet bekannt. Alljährlich besuchen mehr als 26.000 Menschen aus dem In- und Ausland den Park.
Neben dem touristischen Aspekt ist die Bahnstrecke zwischen St. Valentin (NÖ) und Selzthal (Stmk) im besagten Bereich ein wichtiges Verkehrsmittel für Bahnreisende und Pendler. Besonders nach Oberösterreich und Niederösterreich könnte mit einem passenden Anschlusskonzept ein gewaltiger Schritt in der öffentlichen Verkehrsversorgung gesetzt und für die Fahrgäste eine echte Alternative zum PKW geschaffen werden. Durch schlechte Fahrpläne kommt es derzeit jedoch zu massiven Verzögerungen im Bahnhof Kleinreifling, weshalb eine Fahrt von Steyr nach Graz über Linz schneller bewältigt werden kann, als durch das Gesäuse. Die besagten Fallzahlen über zu geringe Auslastung sind daher selbst Produkt einer verfehlten Verkehrsplanung bei den Bundesbahnen.
Busse sind zwar als Zubringer nützlich, haben aber als ganzheitliches System in einer weitläufigen und topografisch schwierigen Region nicht notwendige Schnelligkeit, um Züge zu substituieren. Bei der angekündigten Verdopplung der Busverbindungen in der Region von 22 auf 44 ist zudem die Frage berechtigt, ob es wirtschaftlicher ist, die bisherigen Passagieranzahl auf noch mehr Verkehrsmittel zu verteilen und damit eine Umweltmehrbelastung an Schadstoffen herbeizuführen.
Zudem wird die Vorgehensweise der Bundesbahnen scharf kritisiert. Noch im März hieß es von einer Pressesprecherin, dass von einer definitiven Einstellung keine Rede
sei und Überlegungen existieren, alternativ Busse einzusetzen bzw. Bus und Schiene ergänzend zu nutzen. Nur wenige Monate später, nämlich am 18. Juni 2009, wird in einer Tageszeitung die vollkommene Stilllegung des Personenverkehrs verkündet. Ein anderer Pressesprecher erklärt in diesem Beitrag weiters, dass diese Pläne bereits mit den Bürgermeistern besprochen wurden. Die Bürgermeister bestätigen zwar die Gespräche, jedoch nicht die endgültige Durchsetzung dieser Maßnahme.
Mit der angekündigten Streichung der Personenverkehrszüge wird ein fatales Signal gesetzt und die regionale Infrastruktur der Region Gesäuse und darüber hinaus die des Bezirkes Liezen dem Sparstift zum Opfer geworfen. Die Österreichischen Bundesbahnen unterliegen dem gesetzlichen Auftrag nach infrastruktureller Versorgungssicherheit für regionale Gebiete und dürfen sich nicht vor unbequemen Regionalbahnstrecken wie der Salzkammergut-, Ybbstal,- oder Mürztalbahn verschließen.
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie und der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend werden aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass,
1. die „Gesäusebahn“ als prioritärer Verkehrsträger für den Personennahverkehr erhalten bleibt,
2. umgehend Verhandlungen mit der ÖBB aufgenommen werden, um
die bestehenden Verkehrsdienstverträge dahingehend abzuändern, dass eine nachhaltige Sicherung der Bahnlinie durch das Gesäuse gewährleistet wird und zusätzliche Busangebote nicht mit der Bahnlinie konkurrieren, sondern diese lediglich punktuell ergänzen,
ein bedarfsorientiertes Fahrplanangebot in Abstimmung mit den Gemeinden erarbeitet und die Komfortqualität der Gesäusebahn attraktiviert werden und
3. gemeinsam mit dem Land Steiermark ein touristisches Attraktivierungskonzept vorgelegt wird, um die Auslastung der Gesäusebahn zu steigern.“
*****
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Heinzl. Eingestellte Redezeit: 3 Minuten. – Bitte.
19.24
Abgeordneter Anton Heinzl (SPÖ): Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Bundesministerin! Hohes Haus! Neben dem Verkehrssicherheitspaket steht heute ein weiteres wesentliches verkehrspolitisches Thema auf der Tagesordnung, nämlich die ÖBB-Reform.
Gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise ist es wichtig, dass die ÖBB einen Handlungsrahmen bekommen, mit dem sie arbeiten können, um im internationalen Wettbewerb zu bestehen. – Mit der heute zu beschließenden Strukturreform ist das möglich: Wir schaffen schlanke und effizientere ÖBB.
Damit entstehen gewaltige Einsparungen: Bei den Overhead-Kosten bei der Verwaltung erwarten wir Einsparungen von über 20 Prozent, durch die Effizienzsteigerung im
Infrastrukturausbau erwarten wir eine Kostenreduktion von gleichfalls um die 10 Prozent.
Wichtig, Hohes Haus, ist, dass die ÖBB in Zukunft schneller, flexibler und damit kundenfreundlicher agieren können.
Die Notwendigkeit der ÖBB-Reform steht außer Frage: Bisher war die Unternehmensstruktur bis auf die dritte Ebene gesetzlich vorgegeben. Solch ein starres Grundgerüst zwängt ein Unternehmen in ein Korsett und verhindert sein Wachstum. Neu- und Ausbau sowie Instandhaltung des gesamten Netzes sind jetzt nicht mehr in getrennter Hand – es ist wieder zusammen, was eben zusammengehört: Bau AG und Infrastruktur AG werden wieder zu einer Gesellschaft vereinigt.
Was für den Bereich der Infrastruktur gilt, das gilt für die ÖBB als Ganzes – es gibt wieder klare Strukturen, eine Holding und drei Gesellschaften: die Infrastruktur AG, die Personenverkehr AG und die Rail Cargo bilden das Grundgerüst. Darauf aufbauend kann die Struktur, je nach Bedarf, freier als bisher weiterentwickelt werden, ohne dass ständig neue gesetzliche Regelungen notwendig sind.
Hohes Haus! Mit der neuen Struktur schaffen wir für die ÖBB die Möglichkeit, noch kundenorientierter zu arbeiten. Wir befreien die ÖBB aus einem starren Korsett und geben diesem Unternehmen wieder neue Luft und damit die Möglichkeit, gesund zu wachsen. Ich bin mir sicher, dass die ÖBB diese Chancen auch ergreifen werden.
Sehr geehrte Frau Bundesministerin, ich gratuliere Ihnen zu dieser Regierungsvorlage! – Danke schön. (Beifall bei der SPÖ. – Abg. Grosz: Wir wissen nur noch nicht, ob sie auch beschlossen wird! Weil wie diese Regierung ...!)
19.26
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Hagen. Eingestellte Redezeit: 3 Minuten. – Bitte. (Rufe und Gegenrufe zwischen den Abgeordneten Grosz und Heinzl.)
19.26
Abgeordneter Christoph Hagen (BZÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Frau Minister! Hohes Haus! Im Gegensatz zum Kollegen Heinzl von vorhin sehen wir keine Notwendigkeit zur Änderung der derzeitigen ÖBB-Struktur.
Selbst der Rechnungshof ist davon nicht überzeugt! Im Rechnungshofbericht steht, dass durch „die beabsichtigte Gründung von zwei Tochtergesellschaften für Bauangelegenheiten und die (...) Trennung in zwei gesonderte Zuschussverträge (...) es zu einer bloßen Verlagerung, aber zu keiner Lösung der bisher zwischen der ÖBB-Infrastruktur Bau AG und der ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG bestandenen Schnittstellenproblematik“ kommt.
Also selbst der Rechnungshof zweifelt, dass diese Lösung hier richtig ist.
In mir steigt ein bisschen der Verdacht hoch, dass hier eine politische Säuberungsaktion stattfinden soll, dass hier ein wenig umdisponiert wird (Abg. Heinzl: Herr Kollege! ... hat aber das Gesetz gemacht, das wissen Sie schon!) – Sie waren schon am Wort, Herr Kollege! –, dass man hier die letzten Überbleibsel der schwarz-blauen beziehungsweise schwarz-orangen Koalition beseitigen möchte.
Ein Herzensanliegen ist mir, Frau Minister – das hat der Kollege aus der Steiermark schon angesprochen –, die Erhaltung von Kleinst- und Privatbahnen, um da Mobilität und in gewisser Weise auch etwas Tradition aufrechtzuerhalten. Wir haben eine schöne Natur, wir haben Naturjuwele, und hier sollten wir darauf achten, dass diese Juwele noch erhalten bleiben, auch mit diesen Privatbahnen, die dem Fremdenverkehr zu Diensten sind – und hier müsste man unterstützend vorgehen. Einen kleinen positiven
Schritt von Ihnen habe ich da schon gesehen: Sie sind ein wenig auf die Länder zugegangen, und ich glaube, mit einer gemeinsamen Lösung wird es hier sicher ein positives Ende geben. – Ich möchte Ihnen ganz besonders die Ybbstalbahn ans Herz legen, natürlich auch die Ennstalbahn, wie vorhin angesprochen, oder viele weitere.
Etwas gewundert hat mich letztens, was in den Medien über die ÖBB zu lesen war, und zwar stand da am 3. Juli sinngemäß Folgendes: Gratistickets – Steuer in Millionenhöhe nachzuzahlen von den ÖBB. – Diesbezüglich wundert es mich, dass nicht darauf Bedacht genommen worden ist, diese Steuergeschichten zu regeln. Ich wundere mich aber auch, dass die ÖBB-Mitarbeiter nach wie vor gratis mit dem Zug unterwegs sein können – ich glaube, es gibt keinen anderen staatlichen Betrieb, wo noch solche Vergünstigungen an die Mitarbeiter ausgegeben werden. (Abg. Scheibner: Und vor allem steuerfrei! Steuerfrei!)
Frau Minister, ich glaube, es gibt viel zu tun! Es sollte aber nicht Ihr Ziel sein, alles, was im Bereich der ÖBB unter Blau-Schwarz beziehungsweise Blau-Orange gemacht worden ist – und dort sind sehr viele positive Sachen dabei –, ohne Rücksicht auf Verluste zu zerschlagen. – Danke schön. (Beifall beim BZÖ.)
19.29
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Dr. Maier. Eingestellte Redezeit: 4 Minuten. – Bitte.
19.30
Abgeordneter Dr. Ferdinand Maier (ÖVP): Herr Präsident! Frau Bundesminister! Meine Damen und Herren! An sich wäre viel zu sagen zu diesem Thema (Zwischenruf der Abg. Dr. Moser), und in 4 Minuten, so würde ich meinen, ist so viel zu sagen wie in 2 Minuten, daher sollte man auch mit 2 Minuten das Auslangen finden.
Dies ist Wirklichkeit eine Weiterentwicklung der Bundesbahnreform des Jahres 2003, mit der die ersten richtigen Schritte in die richtige Richtung gerichtet wurden. (Zwischenrufe der Abgeordneten Mag. Josef Auer und Haberzettl.) Dies ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, nämlich zu mehr Transparenz, besserer Kostenverfolgung und vor allem Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit im Sinne der Liberalisierung sowohl im Güterverkehr, wie wir sie schon haben, als auch im Personenverkehr, wo diese noch kommen wird.
Ein Hinweis – das können wir jetzt eben nicht ausdiskutieren –: Die Frage der allgemeinen Nebengebühren und der Umstand, dass diese in die Bemessungsgrundlage der Pensionen einbezogen werden, sollte ein Thema sein, das uns vielleicht künftighin ein wenig beschäftigt. – Aber das nur als ein Aviso für künftige Diskussionen zum Thema ÖBB. (Beifall bei der ÖVP.)
19.31
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als nächster Redner zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Vock. Eingestellte Redezeit: 3 Minuten. – Bitte.
19.31
Abgeordneter Bernhard Vock (FPÖ): Hohes Haus! In der „Presse“ vom 19. Juni wird der Verdacht geäußert, dass diese Zusammenlegung nur passiert, damit ein Aufsichtsratsvorsitzenden-Stellvertreter Geschäfte mit den ÖBB machen kann. Es fällt ja sowieso auf, dass die ÖBB sehr viele Geschäfte mit ihren Aufsichtsräten machen. Die Kanzlei dieses Eduard Saxinger, der sogar namentlich als Aufsichtsratsvorsitzenden-Stellvertreter genannt ist, soll die Verträge für diese Zusammenlegung machen. Er hat das jetzt großzügig abgelehnt, aber man weiß, dass er in den letzten Jahren sowieso über 200 000 € „eingesackt“ hat. Ich wiederhole noch einmal: als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender über 200 000 € an Geschäften mit den ÖBB!
Lieferungen an beziehungsweise von nahestehenden Unternehmungen oder Personen waren 2007 noch 20,4 Millionen €, 2008 waren es schon 23,6 Millionen € – wobei 2007 die Aufsichtsräte noch namentlich genannt wurden, 2008 hat man das tunlichst unterlassen, denn sonst könnte man ja feststellen, wer alles an den ÖBB nebenbei verdient.
Ich mache den Aufsichtsräten gar keinen Vorwurf, dass sie Geschäfte mit den ÖBB machen – das würde jeder probieren –, aber für mich ist die Frage: Wer vergibt solche Aufträge, und zu welchem Zweck? Will ich vielleicht das Kontrollorgan ein bisschen mundtot machen?
Zu diesem Gesetz ist mir auch Folgendes aufgefallen: Wie jedes Gesetz ist es in die Begutachtung gegangen. Sowohl der Rechnungshof als auch die Wirtschaftskammer haben eine negative Begutachtung abgegeben, und der Städtebund hat gleichfalls eine negative Begutachtung abgegeben – der Städtebund zum Beispiel mit den Worten seines Generalsekretärs Dr. Weninger:
„Es kann nicht sein, dass Städte und Gemeinden nun das Missmanagement der ÖBB der vergangenen Jahre ausbaden sollen.“ (Abg. Dr. Moser: Darum ist ja etwas geändert worden!)
Und: „Es ist Aufgabe der ÖBB und nicht der Städte und Gemeinden, die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten, die in diesem Land mit der Bahn fahren. Und zwar im bestmöglichen Ausmaß.“
Und die Wirtschaftskammer sagt: „Grundsätzlich abgelehnt wird jedoch eine neue Zuordnung von Verschubaufgaben zu der als ÖBB-Produktion GmbH (neu) bezeichneten derzeitigen ÖBB-Traktion GmbH.“
Wir sind jetzt daher sehr gespannt, wie die Bürgermeister hier im Hohen Haus und die Unternehmer der Regierungsparteien auf die Empfehlungen ihrer Interessenvertretungen agieren. – Oder brauchen wir keine Begutachtungen mehr? (Beifall bei der FPÖ sowie der Abgeordneten Scheibner und Jury.)
19.34
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als nächste Rednerin zu Wort gelangt Frau Abgeordnete Dr. Moser. Eingestellte Redezeit: 4 Minuten. – Bitte.
19.34
Abgeordnete Dr. Gabriela Moser (Grüne): Frau Ministerin! Meine Damen und Herren! Es ist schon bezeichnend, dass es eine Mehrheit in diesem Haus gibt, die für 60-Tonnen-Gigaliner eintritt und damit den ÖBB massiv Konkurrenz auf der Straße macht. (Abg. Binder-Maier: Aber geh!)
Ich denke, Ihr Abstimmungsverhalten beim vorhergehenden Tagesordnungspunkt ist wirklich ein Eklat! (Beifall bei Grünen und BZÖ.) – Zuerst argumentieren Sie dafür, und bei der Abstimmung bleiben Sie sitzen. Wo kommen wir denn da hin?! – Da versteht man wirklich die Systematik nicht mehr! Sie sind ja nicht einmal in der Lage, den Fehler zu erkennen, sonst hätten Sie längst im Zuge dieser Debatte einen Antrag eingebracht (Abg. Kopf: Kommt schon noch! Kommt schon noch! – Abg. Rädler: ... Sorgen!), der Ihren Schnitzer endlich ausmerzt.
Sie können ja froh sein, dass wir als Opposition etwas wacher sind, etwas reger sind und etwas schneller sind (weitere Zwischenrufe bei der ÖVP), und noch dazu kompetenter! (Beifall bei Grünen, FPÖ und BZÖ.)
Die armen Österreicherinnen und Österreicher, die auf solche Mehrheiten angewiesen sind! Ein Glück, dass es ein Drittel in diesem Parlament gibt, das wirklich die Sorgen der Menschen ernst nimmt! (Beifall bei Grünen, FPÖ und BZÖ. – Zwischenruf des Abg. Ing. Kapeller.)
Auf diese Sorgen möchte ich jetzt noch im Zusammenhang mit den ÖBB ein bisschen näher eingehen, denn auch hier haben Sie von SPÖ und ÖVP einiges übersehen. (Zwischenruf der Abg. Binder-Maier.) Und zwar war im ursprünglichen Entwurf vorgesehen, dass kein jährlicher Bericht über die gemeinwirtschaftlichen Leistungen – das heißt das, was die ÖBB an Leistungen erbringen und wir als Steuerzahler und Republik bei ihnen einkaufen – mehr verfasst wird. Das war in Ihrem ursprünglichen Antrag: Der Bericht über die gemeinwirtschaftlichen Leistungen fällt weg. Keine Transparenz mehr sozusagen über die Angebote der ÖBB, die immerhin pro Jahr mit an die 600 Millionen € eingekauft werden!
Wir waren es, die draufgekommen sind, dass diese Transparenz von Ihnen einfach gestrichen wird! Sie sind später auch draufgekommen, dass das notwendig ist: dass es notwendig ist, dass die Öffentlichkeit, dass die Parlamentarier erfahren, was mit ihrem Steuergeld bei den ÖBB passiert.
Nun ist es für Sie – wirklich kindisch wie eh und je – undenkbar, dass dieses Anliegen der Opposition als eigener Antrag angenommen wird. Das ist unannehmbar für Sie! Uns ist es ja nicht zu blöd: Wir liefern Ihnen die Informationen, und Sie machen dann einen Regierungs-Abänderungsantrag in unserem Sinn. – Soll sein, wir stimmen dem zu.
Wir Grünen stimmen auch der Gesetzesänderung zu, weil wir bereits im Jahr 2003 festgestellt und analysiert haben, dass die ÖBB-Filetierung, die unter Schwarz-Blau vorgenommen wurde, in den Abgrund führt, dass diese also sehr, sehr viele Nachteile hat: betrieblicher Natur, finanzieller Natur. Und immerhin hat es – jetzt haben wir 2009 – an die sechs Jahre gedauert, dass diese große Schnittstellenproblematik in den ÖBB beseitigt wird.
Ich sage Ihnen, die ÖBB sind leider eine Dauer-Baustelle, und wir werden noch mehr Anträge einbringen und noch mehr Reformschritte vornehmen müssen, damit der öffentliche Nahverkehr, dessen Rückgrat die ÖBB bilden, insgesamt wirklich funktioniert. Ich will jetzt die Zeit nicht überstrapazieren, sondern darauf hinweisen: Öffentlicher Nahverkehr heißt auch Verbindungen in den Regionen.
Deswegen bringe ich noch einen Entschließungsantrag ein, und zwar gegen die Auflassung des Personenverkehrs im Gesäuse – das Gesäuse, die Bergsteigerregion für die Wiener im vorigen Jahrhundert, im vorvorigen Jahrhundert. Das brauchen wir weiterhin, dass wir als Personen mit der Bahn ins Gesäuse fahren können!
Der Nationalrat wolle beschließen:
Der Nationalrat spricht sich für den Erhalt der „Gesäusebahn“ als prioritärer Verkehrsträger für den Personenverkehr aus und fordert die Bundesregierung und insbesondere die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie auf,
1. umgehend Gespräche mit den ÖBB aufzunehmen, um
a) dafür zu sorgen, dass eine nachhaltige Sicherung der Bahnlinie durch das Gesäuse gewährleistet wird und zusätzliche Busangebote nicht mit der Bahnlinie konkurrieren, sondern diese lediglich punktuell ergänzen,
b) darauf hinzuwirken, dass ein bedarfsorientiertes Fahrplanangebot in Abstimmung mit den Gemeinden erarbeitet und gleichzeitig die Komfortqualität der Gesäusebahn attraktiviert wird, um die Fahrgastzahlen zu steigern,
c) insbesondere die Tagesrandverbindungen nach Wien und Graz zu stärken,
2. ergänzende Maßnahmen im ÖV zu unterstützen, die speziell auch auf die Sondersituation der Gemeinde Johnsbach Bedacht nehmen, und
3. an einem touristischen Attraktivierungskonzept mitzuwirken, um die Auslastung der Gesäusebahn zu steigern.
*****
Gerade angesichts der beginnenden Urlaubssaison: Stimmen Sie diesem Antrag zu! – Danke. (Beifall bei den Grünen sowie bei Abgeordneten von FPÖ und BZÖ.)
19.39
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Der soeben eingebrachte Entschließungsantrag ist ausreichend unterstützt, steht im Zusammenhang mit der Materie und daher auch mit in Verhandlung.
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Dr. Gabriela Moser, Mag. Werner Kogler, Mag.a Christiane Brunner, Kolleginnen und Kollegen betreffend Aufrechterhaltung des Schienen-Personenverkehrs durch das Gesäuse
eingebracht im Zuge der Debatte über den Bericht des Verkehrsausschusses über die Regierungsvorlage 227 d.B.: Bundesgesetz, mit dem das Bundesbahngesetz, das Privatbahngesetz 2004 und das Eisenbahngesetz 1957 geändert werden (299 d.B. XXIV.GP)
Seitens der ÖBB wurde kürzlich in den Raum gestellt, kurzfristig mit 1.9.2009 – somit mitten in der Tourismus- und Bergsaison – den Personenverkehr auf der Bahnstrecke durch das Gesäuse einstellen zu wollen. Argumentiert wurde dies mit – in der angegebenen Höhe nicht nachvollziehbaren – großen Einsparungen, die solcherart zu lukrieren wären, und zu geringer Auslastung.
Der Nationalpark Gesäuse hat den großen Vorteil, direkt mit der Eisenbahn erreichbar zu sein. Der schienengebundene Personenverkehr durch das Gesäuse ist für den Nationalpark und die umliegende Tourismusregion eine unverzichtbare Infrastruktur. Die Anreise mit der Eisenbahn wird von der Nationalpark Gesäuse GmbH aktiv beworben. Derzeit nutzen vor allem Schulen (etwa im Rahmen der Schullandwoche) das Angebot, mit der Eisenbahn das Gesäuse zu bereisen (ca. 7.000 SchülerInnen im Jahr 2008). In Hinkunft soll der Nationalpark Gesäuse am nationalen und internationalen Tourismusmarkt verstärkt im Mehrtagestourismus positioniert werden. Gerade in Ballungsräumen verfügen viele Menschen über keinen eigenen PKW und suchen daher vermehrt nach Urlaubsdestinationen, wo eine Anreise mit der Eisenbahn möglich ist. Das kann für den Nationalpark Gesäuse ein wichtiges Auswahlargument sein. Auch aus ökologischen Gründen ist es wichtig, den Nationalpark schadstofffrei erreichen zu können.
Die geplante Streichung der Fahrpläne durch das Gesäuse ist daher aus touristischer, regionalwirtschaftlicher und ökologischer Sicht abzulehnen. Auch die Bürgermeister der künftigen Kleinregion „Gesäuse-Eisenwurzen“ haben sich jüngst bei einem Treffen in Johnsbach geschlossen für die Aufrechterhaltung des Personenverkehrs der Gesäusebahn ausgesprochen.
Im Steiermärkischen Landtag wurde ein entsprechender Antrag für den Erhalt der „Gesäusebahn“ als prioritären Verkehrsträger für den Personenverkehr bereits gemeinsam von SPÖ, ÖVP und Grünen eingebracht und am 30.6.2009 im Infrastrukturausschuss sowie am 7. Juli im Landtag einstimmig angenommen.
Der Bund sollte sich diesem einstimmigen Anliegen aller im Stmk Landtag vertretenen Fraktionen nicht verschließen.
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden
Entschließungsantrag:
Der Nationalrat wolle beschließen:
Der Nationalrat spricht sich für den Erhalt der "Gesäusebahn" als prioritärer Verkehrsträger für den Personenverkehr aus und fordert die Bundesregierung und insbesondere die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie auf,
1. umgehend Gespräche mit den ÖBB aufzunehmen, um
a) dafür zu sorgen, dass eine nachhaltige Sicherung der Bahnlinie durch das Gesäuse gewährleistet wird und zusätzliche Busangebote nicht mit der Bahnlinie konkurrieren, sondern diese lediglich punktuell ergänzen,
b) darauf hinzuwirken, dass ein bedarfsorientiertes Fahrplanangebot in Abstimmung mit den Gemeinden erarbeitet und gleichzeitig die Komfortqualität der Gesäusebahn attraktiviert wird, um die Fahrgastzahlen zu steigern,
c) insbesondere die Tagesrandverbindungen nach Wien und Graz zu stärken,
2. ergänzende Maßnahmen im ÖV zu unterstützen, die speziell auch auf die Sondersituation der Gemeinde Johnsbach Bedacht nehmen, und
3. an einem touristischen Attraktivierungskonzept mitzuwirken, um die Auslastung der Gesäusebahn zu steigern.
*****
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als nächster Redner zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Haberzettl. Eingestellte Redezeit: 2 Minuten. – Bitte.
19.39
Abgeordneter Wilhelm Haberzettl (SPÖ): Geschätzter Herr Präsident! Frau Bundesministerin! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Eigentlich müsste man die Diskussion zu diesem Gesetzestext ja rückblendend im Jahr 2003 beginnen, weil die Wurzel für dieses Gesetz bereits im Jahr 2003, nämlich durch Ihre Mitwirkung, durch ein falsches Gesetz, das für das Unternehmen ÖBB extrem schädigend war, gelegt wurde.
Herr Kollege Maier, Ihren Hinweis, das sei eine Weiterentwicklung, würde ich gerne einmal in einem Vier-Augen-Gespräch mit Ihnen diskutieren (Abg. Dr. Ferdinand Maier: Gerne!), denn ich glaube, das ist im Jahr 2003 ein Schritt zu weit gewesen und es ist jetzt der richtige Schritt, um die Infrastruktur wieder dorthin zu bringen, wohin sie gehört, denn durch diese Trennung im Infrastrukturbereich hat es ungeheure Schnittstellenprobleme und damit auch Reibungsverluste gegeben. Und diese werden jetzt mit diesem Gesetz wieder beseitigt.
Aber gleichzeitig – und da stimme ich Ihnen zu – eröffnet dieses Gesetz auch die Möglichkeit einer sinnvollen Weiterentwicklung, weil die Formulierung im Gesetzestext relativ flexibel ist und doch viel Verantwortung in den Händen des Managements liegt. Und ich meine, dorthin gehört die Verantwortung auch. Es darf durch die neue Struktur nur nicht zu einer Fesselung im operativen Bereich kommen.
Eine Bemerkung noch zum Abschluss: Herr Kollege Maier, ich lehne es vehement ab, Dienstrecht und Kollektivvertragsfragen in diesem Hause zu diskutieren und zu ent-
scheiden – die gehören auf die Sozialpartnerebene. (Beifall bei der SPÖ. – Zwischenruf des Abg. Dr. Bartenstein.)
Im Übrigen darf ich mich, Frau Bundesministerin Bures, sehr herzlich bedanken. Mit diesem Gesetz ist etwas gelungen, wonach das Unternehmen ÖBB sechs Jahre unter Schmerzen gelechzt hat, wenn ich das so nennen darf. Ich bedanke mich dafür, und ich hoffe, dieses Gesetz erfüllt unsere Erwartungen. (Beifall bei der SPÖ.)
19.41
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Zu einer Stellungnahme hat sich Frau Bundesminister Bures zu Wort gemeldet. – Bitte.
19.41
Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie Doris Bures: Herr Präsident! Hohes Haus! Trotz der späten Stunde und drei langen Plenartagen, wie ich weiß, möchte ich ganz kurz zur Strukturreform Stellung nehmen.
Ich glaube, es steht außer Zweifel, dass die Österreichischen Bundesbahnen eines der bedeutendsten österreichischen Unternehmen sind – und wir sollten das so sehen –, nämlich aus vielerlei Hinsicht. Die ÖBB sind ganz bedeutend für den Wirtschaftsstandort. Sie sind von ganz wesentlicher Bedeutung dafür, wie es uns gelingt, ein ökologisches Verkehrsmittel auch im Sinne des Klimaschutzes zu stärken. Und das Ganze hat – das ist für mich auch wichtig – sehr große sozialpolitische Bedeutung, nämlich ob Mobilität für die Menschen leistbar ist. Es geht um die Frage: Stützen wir mit Förderungen Tarife, damit Pendlerinnen und Pendler die Möglichkeit haben, kostengünstig, ökologisch sparsam von ihrem Wohnort zum Arbeitsplatz zu kommen?
Die Bedeutung dieses Unternehmens ÖBB ist natürlich auch noch aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Situation, in der wir uns befinden, gestiegen. Es ist also kein Zufall, dass das größte Paket der Konjunkturmaßnahmen, das das Parlament geschnürt hat, die Österreichischen Bundesbahnen betrifft und wir Rekordinvestitionen, Konjunkturpakete mit diesem Unternehmen umsetzen. Es ist mir wichtig, das zu sagen, weil das heute nicht budgetwirksam ist, weil das aus dem Unternehmen selbst einmal finanziert werden muss, dass wir aber erstmals eine Finanzierungsbasis haben, bei der im Finanzministerium ganz klar widergespiegelt wird, wie diese Investitionen über Annuitäten über 30 Jahre an das Unternehmen zu refinanzieren sind.
Ich möchte in diesem Zusammenhang Professor Felderer zitieren, nicht nur für das IHS zuständig, sondern auch Vorsitzender des Staatsschuldenausschusses. Professor Felderer hat davon gesprochen, dass wir noch nie so viele Investitionen in den Infrastrukturbereich, in die Schieneninfrastruktur hatten, dass sie sich auf Rekordniveau befinden. Er sagt, dass wir dieses Niveau auch halten werden, und zwar deshalb, weil wir erstmals einen klaren Finanzierungsplan haben, der sich im Finanzministerium widerspiegelt. Ein Zitat von Felderer: Das sieht gut aus!
Gleichzeitig mit diesen Investitionen für eine neue moderne Bahn, für eine Hochleistungsstrecke, die wir hier tätigen, war es mir wichtig, das Unternehmen so aufzustellen, dass es das so effizient, so wirtschaftlich, so rasch wie möglich auch wirklich umsetzen kann.
Wir haben gesehen, dass es in der Struktur der ÖBB zu viele Doppelgleisigkeiten, zu viele Schnittstellenprobleme gibt. Ich bin daher sehr froh darüber, dass dieses Hohe Haus vor dem Sommer mit einem der letzten Tagesordnungspunkte dem Unternehmen ÖBB die Chance gibt, mit einer neuen effizienten Struktur die Doppelgleisigkeiten zu beseitigen, sodass man im Unternehmen flexibel auf diese neuen Herausforderungen eingehen kann. Das Unternehmen bekommt mit dieser Strukturreform die Chance, wie gesagt, das Unternehmen effizient und wirtschaftlich aufzustellen.
Ich möchte, dass wir eine gesunde, eine wettbewerbsfähige österreichische Bundesbahn haben. Das ist für die 42 000 Menschen, die dort tagtäglich hart arbeiten, wichtig, aber das ist vor allem auch für die Kundinnen und Kunden, für den Wirtschaftsstandort und für die Umwelt wichtig. – Herzlichen Dank. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.)
19.45
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Rädler. Eingestellte Redezeit: 3 Minuten. – Bitte.
19.45
Abgeordneter Johann Rädler (ÖVP): Herr Präsident! Frau Bundesminister! Ich halte mich an die Vorgaben unseres Verkehrssprechers. – Es wäre viel zur Bundesbahn zu sagen. Die Frau Bundesminister hat von der Wettbewerbsfähigkeit und der Verantwortung gegenüber den 42 000 Mitarbeitern gesprochen. Herr Kollege Haberzettel, die Schienen waren bereits 2003 in diese Richtung gelegt mit der klaren Trennung. Sie haben damals keine Freude gehabt, aber Sie müssen zugeben, dass die Effizienzsteigerung damals mit der Aufgliederung eingesetzt hat; mit der Aufgliederung in den Absatzbereich und in den Infrastrukturbereich.
Es ist folglich eine Weiterentwicklung, wenn wir jetzt mit dieser Novelle – und das ist Ihnen ja, glaube ich, sehr recht – auch die Finanzierung für die nächsten sechs Jahre mit dem Rahmenplan absichern. Vielleicht ist es Ihnen nicht so recht, dass es eine Berichtspflicht geben wird, dass es im gesamten Bereich der Holding wahrscheinlich mehr Verantwortung im Finanzbereich geben wird, aber dies ist eine Weiterentwicklung im Sinne der Bundesbahn, und Sie sollten diese so wie wir begrüßen. – Danke. (Beifall bei der ÖVP.)
19.46
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Mag. Josef Auer. Eingestellte Redezeit: 2 Minuten. – Bitte.
19.47
Abgeordneter Mag. Josef Auer (SPÖ): Herr Präsident! Geschätzte Frau Ministerin! Herr Abgeordneter Redl hat jetzt gerade gesagt (Rufe bei der ÖVP: Rädler!), er hält sich an das, was der Herr Verkehrssprecher gesagt hat. – Ich möchte sagen, ich halte mich an Fakten!
Deshalb möchte ich zu den Ausführungen der Frau Abgeordneten Hakl zum Führerscheingesetz noch ganz kurz etwas sagen, weil ich zu dem Thema nicht sprechen konnte. Die Frau Abgeordnete soll die Geschwindigkeit nicht unterschätzen. Ich habe mir das mit den 10 km/h ausgerechnet. Wenn man die Geschwindigkeit von 30 km/h auf 40 km/h erhöht, dann steigt die Energie um fast 80 Prozent. Das ist also nicht zu unterschätzen. Eine andere Begründung haben ja auch Sie, Frau Ministerin, schon gegeben.
Aber zurück zum Thema. Diese Regierungsvorlage zeigt, ob es allen passt oder nicht, eine starke sozialdemokratische Handschrift. Der wesentlichste Punkt sind schlankere Strukturen und natürlich gewaltige Einsparungen: 100 Overhead-Posten, die eingespart werden können, und pro Jahr in der Endausbaustufe bis zu 200 Millionen €.
2003 wurden elf Gesellschaften gemacht, jetzt sind es nur mehr fünf. Ich würde sagen, es steht sozusagen 5 : 11 für uns, für die Sozialdemokratie. Die derzeitigen Zuordnungen innerhalb der Gesellschaft und die Strukturen verhindern mögliche Einsparungen und Synergien.
Noch einmal zurückkommend zur Freiheitlichen Partei und zum BZÖ: Sie sind ja Meister darin, dass Sie eben uns, der Sozialdemokratie, das vorwerfen wollen, was Sie vor
ein paar Jahren mitgetragen haben; nur das Stichwort: Polizei. (Abg. Neubauer: Schauen Sie in die Zukunft! Die Zukunft ist wichtig!)
Herr Kickl hat sogar gemeint, es sollte eine Abwrackprämie für die ÖVP geben, weil sie uns sozialdemokratisch abwrackt. Ich möchte sagen, Sie haben versucht, die ÖBB abzuwracken, nur ist es Ihnen nicht gelungen. (Abg. Dr. Haimbuchner: Geh!) Und wir werden jetzt schauen, dass die ÖBB mit roter Politik wieder mehr in schwarze Zahlen kommen. (Abg. Dr. Haimbuchner: Das wird wahrscheinlich eine schwarze Politik und rote Zahlen!)
Die Frau Ministerin hat es auch schon gesagt: Wir werden den Zug auf zwei Gleisen lassen, aber wir werden die sonstigen Zweigleisigkeiten oder sogar Mehrgleisigkeiten abstellen. Wir werden gemeinsam mit der Frau Ministerin eine gute Politik machen. Ich glaube, das haben Sie auch schon registriert. – Danke. (Beifall bei der SPÖ.)
19.49
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als vorläufig letzter Redner dazu zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Hell. Eingestellte Redezeit: 2 Minuten. – Bitte.
19.50
Abgeordneter Johann Hell (SPÖ): Herr Präsident! Frau Bundesministerin! Als letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt und als einer, der seit 37 Jahren mit diesem Unternehmen in den verschiedensten Tätigkeiten sehr eng verbunden ist, möchte ich wirklich noch einmal auf die Notwendigkeit hinweisen, die diese Gesetzesänderung mit sich bringt. Mit dieser Novelle muss es gelingen, den ÖBB jene strukturellen Rahmenbedingungen wiederzugeben, die es dem Unternehmen ermöglichen, rasch auf geänderte Verhältnisse zu reagieren und sich wettbewerbsmäßig aufzustellen.
Die bisherigen Strukturen haben von Anfang an zu Problemen geführt, weil es wegen der Aufteilung zu enormen Reibungsverlusten gekommen ist. Ich könnte Ihnen aus eigener Erfahrung berichten, was es bedeutet, wenn für das Anspannen eines Zuges vier Firmen benötigt werden und es bei einem Oberbauschaden oder einer -störung sechs Firmen bedarf, um diesen Fehler oder diese Störung zu beheben.
Meine Damen und Herren! Im § 34 ist vorgesehen, dass der Teilbetrieb Verschub der ÖBB-Infrastruktur AG oder zumindest Teile desselben im Sinne einer fortlaufenden Restrukturierung in die ÖBB-Produktion GmbH zu übertragen ist. Das bedeutet, dass dieser Teil vom Infrastruktur- in den Absatzbereich wandert. Hier können mit der Verringerung von Schnittstellenproblemen im Einsatz von Triebfahrzeugen und Personal weitere Synergien geschaffen und Einsparungen erzielt werden. Damit sind erstmalig Triebfahrzeugführer, Triebfahrzeuge, Service, technischer Wagendienst und die Mitarbeiter des Verschubes in einer Firma zusammengefasst.
Wesentlich erscheint mir dabei aber auch, dass künftig der Bund für die gemeinwirtschaftlichen Leistungen aufkommen muss. Letztendlich wird diese Gesetzesänderung auch konsumentenschutzpolitische Auswirkungen haben, und zwar durch klare und transparente Abläufe sowie verbesserte Infrastrukturangebote und Mobilitätsangebote für alle Personengruppen, die die ÖBB benützen.
Meine Damen und Herren, die aktuelle Herausforderung für das Unternehmen ist gewaltig. Zum einen haben die ÖBB Altlasten aufgrund von Spekulationsgeschäften des früheren Managements zu tragen, zum anderen wirft die Wirtschaftskrise auch die Eisenbahnen spürbar zurück. Insbesondere im Güterverkehr kämpft das Unternehmen, wie der gesamte Transportbereich, mit Einbrüchen. Aber auch die weitere Liberalisierung bringt neue Herausforderungen mit sich.
Geben Sie mit Ihrer Zustimmung zu dieser Novelle dem Unternehmen die Chance, sich in einem grenzenlosen Europa zu behaupten! – Danke. (Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordneten der ÖVP.)
19.52
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
Wünscht der Herr Berichterstatter ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 299 der Beilagen.
Ich ersuche jene Damen und Herren, die für diesen Gesetzentwurf sind, um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist die Mehrheit und somit angenommen.
Wir kommen sogleich zur dritten Lesung.
Ich bitte jene Damen und Herren, die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, um ein diesbezügliches Zeichen. – Auch das ist die Mehrheit. Der Gesetzentwurf ist somit in dritter Lesung angenommen.
Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Kunasek, Kolleginnen und Kollegen betreffend Erhaltung der Gesäusebahn.
Ich bitte jene Damen und Herren, die für den Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist die Minderheit und somit abgelehnt.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Dr. Moser, Kolleginnen und Kollegen betreffend Aufrechterhaltung des Schienen-Personenverkehrs durch das Gesäuse.
Ich bitte jene Damen und Herren, die für den Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist die Minderheit und abgelehnt.
Bericht des Rechnungshofausschusses betreffend den Bericht des Rechnungshofes, Reihe Bund 2009/1; Band 5 – WIEDERVORLAGE (III-20/266 d.B.)
27. Punkt
Bericht des Rechnungshofausschusses betreffend den Bericht des Rechnungshofes, Reihe Bund 2008/12 (III-11/267 d.B.)
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Wir gelangen zu den Punkten 26 und 27 der Tagesordnung, über welche die Debatte unter einem durchgeführt wird.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Zu Wort gemeldet hat sich Herr Abgeordneter Dr. Haimbuchner. Freiwillige Redezeitbeschränkung: 3 Minuten. – Bitte.
19.55
Abgeordneter Mag. Dr. Manfred Haimbuchner (FPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Präsident des Rechnungshofes! Ich werde mich in meinem Redebeitrag auf die Vergleichsverhandlungen und auf den abgeschlossenen Vergleich hinsichtlich der Eurofighter stürzen. Dieser Vergleich ist auch im wahrsten Sinne des Wortes abgestürzt; das zeigt der vorliegende Rechnungshofbericht.
Vor allem zeigt dieser Rechnungshofbericht eines: Das kommt heraus, wenn man vor einer Wahl den Mund zu voll nimmt, wenn man Versprechungen macht! Wenn man dann in die Zwickmühle gerät und die Versprechungen nicht einhalten kann, wird das Steuergeld verschleudert. Das zeigt dieser Bericht eindeutig. Einen derart vernichtenden Bericht habe ich in meiner Karriere als Abgeordneter noch nie gelesen. Man kann es nur immer wieder betonen: Herr Bundesminister Darabos ist rücktrittsreif! (Beifall bei der FPÖ. – Oh-Rufe bei der SPÖ.)
Wenn man sich die Verfehlungen einmal anschaut: keine Dokumentation der Vergleichsverhandlungen; ein Verzicht auf eine Vertragsstrafe (Ruf bei der SPÖ: Wer hat es denn bestellt?); eine Verteuerung des Stückzahlpreises.
Jetzt kommt wieder das Argument: Wer hat es denn beschafft? – Das ist das sogenannte Gegenargument. (Zwischenrufe bei der SPÖ.) Um Gottes willen, liebe Kollegen von der Sozialdemokratie: Aus einem schlechten Vertrag einen noch schlechteren Vertrag, einen noch schlechteren Vergleich zu machen, das haben Sie zustande gebracht! Das haben Sie zu verantworten. (Beifall bei der FPÖ.)
Erinnern wir uns doch daran, was Sie alles versprochen haben: Es wird keinen Eurofighter geben, es wird kein Eurofighter landen. – Aber die Eurofighter, die jetzt landen, sind teurer als jene, die man vorher bestellt hatte! Das haben wiederum Sie zu verantworten, meine sehr verehrten Damen und Herren von der SPÖ. (Beifall bei der FPÖ.)
Ich weiß schon, da werden Sie immer furchtbar nervös – aber lesen Sie doch einfach den Rechnungshofbericht durch! Da steht nichts von der Vorgängerregierung drin, von der schwarz-blauen oder schwarz-orangen Regierung – außerdem müsste ich auch die nicht verteidigen –, sondern da wird die Vorgangsweise der vorigen Regierung, der schwarz-roten Regierung, kritisiert. Also lesen Sie das, bitte, einmal ganz genau durch! Die Kurzfassung genügt für Sie, die ist katastrophal genug, meine sehr verehrten Damen und Herren. (Beifall bei der FPÖ.)
Die Liste der Verfehlungen ist sehr lang. Es werden kurzfristig sogenannte Einsparungen erzielt, die aber dann keine Einsparungen sind. Die 57 Millionen an Stornokosten hätte man, so glaube ich, auch anders verwenden können. Es kommt zu einer Stückzahlpreiserhöhung von 109 Millionen auf 114 Millionen. Es wird auf die moderne Tranche 2 verzichtet.
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich kann Ihnen nur eines sagen: Das ist ein vernichtender Bericht! Da sieht man wieder, was herauskommt, wenn man derartige Versprechungen liefert, aber diese Versprechungen nicht einhalten kann.
Da nützt leider Gottes auch die präventive Sache nichts, die Rechnungshofberichte an und für sich bewirken sollten. Das ist sehr traurig: Wir kontrollieren immer im Nachhinein, was alles schief gelaufen ist, auch das ist leider Gottes eine traurige Erkenntnis. Wir müssen dort hinkommen, dass wir in Zukunft eine begleitende Kontrolle haben, damit wir dann nicht nur im Nachhinein kritisieren können, was alles schief gelaufen ist, denn da ist das Steuergeld leider Gottes schon vernichtet worden. (Beifall bei der FPÖ.)
19.59
Präsident Mag. Dr. Martin Graf: Als nächster Redner zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Prähauser. Freiwillige Redezeitbeschränkung: 3 Minuten. – Bitte.
19.59
Abgeordneter Stefan Prähauser (SPÖ): Herr Präsident! Herr Präsident des Rechnungshofes! Hohes Haus! Kollege Haimbuchner, das war ein wunderschöner Redebeitrag, eben genau so ausgedrückt, wie es die Opposition gerne hört. Aber die Realität ist eine andere!
Letztendlich ist als einzige Kritik bei den Fliegern übrig geblieben, dass es eine politische und keine militärische Entscheidung war. Die politische Entscheidung hat letztendlich auf 15 Flieger gelautet – wie wir wissen, ist das für das Bundesheer finanziell fast nicht tragbar –, die militärische wollte 30 Flieger. Dann konnten wir auf 24, 21, 18 heruntergehen, ihr kennt ja alle die Geschichte. Letztendlich haben wir 15 Flieger, mit denen wir in der Lage sind, den Luftraum zu überwachen. (Präsident Neugebauer übernimmt den Vorsitz.)
Ich bin froh darüber, dass es eine politische Entscheidung war, denn 30 Flieger – gute Nacht, Bundesheer, mit den heutigen Budgetmöglichkeiten und dem Rahmen, den wir haben!
Ein weiterer Punkt betrifft Röntgen-Scanner für Eisenbahnfahrzeuge – ein Erlebnis der besonderen Art! Vizekanzler Gorbach war mit einer Truppe in China, hat sich einen solchen Scanner angeschaut und hat gesagt: Das ist super – was ich auch verstehe, es ist ja etwas Gutes –, so etwas brauchen wir in Österreich. Er hat einen wasserdichten Vertrag ausgehandelt, aus dem er letztendlich, als man in Österreich draufkam, dass man für diese Scanner eigentlich keinen Platz hat und dass das nicht möglich ist, nicht mehr aussteigen konnte. Wir haben also ein Gerät angekauft, von dem wir nicht wussten, was damit zu machen sei!
Letztendlich ist man auf die gute Idee verfallen, den Scanner dem Innenministerium zukommen zu lassen, weil man mit der Erzeugerfirma eine Vereinbarung treffen konnte, ihn umzubauen, aber, da er auch mobil für die Eisenbahn nicht brauchbar war, zu einem Lkw-Scanner. Das Innenministerium hat ihn dankenswerterweise angenommen, aber nichts dafür bezahlt. Die Kosten haben letztendlich die Eisenbahnen getragen.
Das Dritte, was der Rechnungshof in diesem Band auch bemängelt, sind die Vorkommnisse um den Jagdpanzer Jaguar. Da war die Stellungnahme des Rechnungshofes einfach folgende: Verwenden oder verwerten! Wir wissen, dass wir für Panzer dieser Art keine Verwendung haben, daher haben wir damit begonnen, sie zu verwerten.
Herr Verteidigungsminister Darabos hat uns in der letzten Ausschusssitzung berichtet, dass von den ursprünglich 75 Millionen €, die diese Panzer gekostet haben, bisher 6,3 Millionen € durch Veräußerungen von Lenkflugkörpern, also von Bewaffnung, erzielt werden konnten. Das ist weniger als 10 Prozent! Im Nachhinein ist natürlich leicht reden, das ist keine Frage, aber die verbliebenen 70 Millionen €, die in den Sand gesetzt wurden, würden dem Bundesheer heute auch aus der Misere heraushelfen.
Was sollten wir daraus lernen? – In Zukunft bei solchen Geschäften gemeinsam nachzudenken und dafür zu sorgen, dass solche Berichte nicht mehr zustande kommen! (Beifall bei der SPÖ.)
20.02
Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Gahr. – Bitte.
20.02
Abgeordneter Hermann Gahr (ÖVP): Sehr geehrter Präsident! Sehr geehrter Präsident des Rechnungshofes! Ja, dieser Rechnungshofbericht, der eigentlich eine Kette vom Jahr 2003 bis zum Jahr 2007 abschließt, ist schon ein Bericht, der uns zu denken geben sollte. Ich glaube, der Bericht spricht für sich selbst. Er ist wirklich ein Kompromiss, und man sieht ganz einfach, dass über viele Jahre die politische Verantwortung gewechselt hat. Man sieht es an den Ministerien, aber auch an den Personen.
Zum Schluss gibt es natürlich unterschiedliche Positionen. Es hat diesen Vergleich gegeben, und dieser Vergleich hinkt eben, weil er wiedergibt, dass wir hier eigentlich ein schlechtes Geschäft oder ein Kompromissgeschäft gemacht haben. Es gibt gebrauchte
Flieger statt neue, ein guter Vertrag wurde aufgeschnürt – das schreibt der Rechnungshof –, es bestand keine Transparenz bei den Entscheidungen. Da muss ich ganz offen sagen, was mich selbst fast am meisten stört, ist, dass man die Finanzprokuratur in diesen ganzen Vergleich nicht oder zu wenig eingebunden hat. (Beifall bei der ÖVP.)
Ich glaube weiters, man kann zu den Gegengeschäften stehen, wie man will, aber es ist auch zu einer Reduktion der Gegengeschäfte um 500 Millionen € gekommen. Ich persönlich habe mich in dieser Sache, bei den Gegengeschäften, wirklich auch bemüht, und das hat viele Betriebe betroffen. Wir wissen – und Herr Bundesminister Bartenstein ist ja heute auch anwesend –, dass wir hier vielen Firmen die Tür geöffnet haben. Diese Gegengeschäfte wurden zwar in der öffentlichen Darstellung sehr oft schlecht- und miesgemacht, aber in Wirklichkeit sind da eigentlich viele wirtschaftliche Entwicklungen und wirtschaftliche Geschäfte entstanden. Das sollte man hier auch klar zum Ausdruck bringen.
Was bringt die Zukunft? – Nach diesem Bericht (Zwischenruf des Abg. Dr. Haimbuchner), Kollege Haimbuchner, war es auch so, dass wir im Ausschuss eines eingefordert haben: Wir brauchen in dieser Frage Rechtssicherheit! Da hat der Herr Bundesminister durchaus Antworten gegeben, mit denen man, glaube ich, umgehen kann und mit denen man zufrieden sein kann. Aber die Rechtfertigung zu diesem ganzen Bericht ist schon eine, die man sehr subjektiv wahrnehmen kann.
Insgesamt wünschte ich mir in dieser Sache eines. Die Eurofighter sind im Land, die Eurofighter fliegen. Recht lustig ist Folgendes: Wenn es irgendwo eine öffentliche Show gibt und man die Luftfahrt präsentiert, dann kommen Zigtausende Leute; aber wenn wir über das Thema Luftraumsicherheit reden, dann sind sie alle dagegen, weil sie sich nicht dazu bekennen wollen. Darüber sollten wir, glaube ich, auch einmal nachdenken. (Beifall bei der ÖVP.)
Ich habe hier einen Bericht vom 15. Juni 2009, darin heißt es: In der ORF-Sendung „Report“ wurde der Eurofighter nur negativ dargestellt, und diese verzerrte Kampagne glich einer österreichischen Schmierenkomödie auf unterstem Niveau. Das Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport müsste daher eine Klarstellung herausgeben und eine Untersuchung einleiten. Statt sachlich zu informieren, gab es im „Report“ nur Desinformation auf niedrigem Niveau. – Da heißt es weiter: Wirklicher Höhepunkt war dann der Auftritt von Peter Pilz. – Da sind also viele selbst ernannte Experten beieinander!
Eines ist klar: Unser Luftraum muss gesichert werden. Dieser Kompromiss trägt dazu bei, unseren Luftraum zu sichern. Wir sollten nicht immer zurückschauen, sondern in die Zukunft schauen. Ich hoffe, dass diese Geräte möglichst lange ihren Dienst versehen und somit auch die Kosten überschaubar bleiben. – Vielen Dank. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Dr. Haimbuchner: Dann brauchen wir die Luftraumüberwachung ...!)
20.06
Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter List. – Bitte.
20.06
Abgeordneter Kurt List (BZÖ): Geschätzter Herr Präsident! Geschätzter Herr Präsident des Rechnungshofes! Werte Damen und Herren hier im Hohen Haus! Alle drei Kollegen haben recht, Kollege Gahr, Kollege Haimbuchner und auch der Kollege von den Roten, von der Sozialdemokratie. (Ruf bei der SPÖ: Er hat einen Namen!) Er hat einen Verteidigungsminister, der ein besonderes Feindbild hat, und zwar den Eurofighter Typhoon. Bekanntlich hat der Minister ein „Solo für Norbert“ durchgeführt und einen politischen Alleingang gewagt.
Der Eurofighter-Kauf und die Probleme dabei sind ohnehin hinlänglich bekannt. Hier bin ich wieder beim Kollegen Haimbuchner: Es ging nur darum, ein Wahlzuckerl der SPÖ zu erfüllen. Unter Gusenbauer hatte man damals versucht, einen Ausstieg aus dem Eurofighter-Vertrag durchzubringen. Das ist nicht gelungen, man hat nur eine Reduzierung auf 15 Stück geschafft. Durch diesen dubiosen Vergleich, geschätzte Damen und Herren, sind es jetzt drei Stück Eurofighter weniger! Drei Stück Eurofighter weniger, die den österreichischen Luftraum überwachen und sichern können; die Jets wurden insgesamt teurer, und das Einsatzspektrum der Flieger wurde durch diesen Vergleich wesentlich reduziert.
Minister Darabos und sein Freund – ich denke einmal, dass es der aus der Pension rekrutierte Generalmajor Jeloschek war, der ihn dabei falsch beraten hat. Er hat ihn zum Nachteil Österreichs falsch beraten! Sie beide haben nämlich in den Verhandlungen auf die Infrarotausstattung und die Selbstschutzausrüstung beim Flugzeug verzichtet, und sie haben bewusst Mängel in Kauf genommen. Durch die Abbestellung der Selbstschutz- und elektronischen Zielerfassungssysteme – das hat der Rechnungshof festgestellt – wurden Muss-Kriterien freiwillig aufgegeben. Diese Muss-Kriterien wurden freiwillig aufgegeben, und das bemängelt der Rechnungshof sehr, sehr massiv in seinem Bericht. Man muss sich hier die Frage stellen: Wie ist das möglich – die Selbstschutzausrüstung für diesen Flieger, der einer der modernsten in Europa und auf der Welt ist?
Damit kann man nur sagen: Dieser Vergleich, dieser ausgehandelte Eurofighter-Vergleich, ist ein Rückfall in die Steinzeit und in die Anfänge der Drakenfliegerei. Man hat auf das DASS verzichtet, das Defensive Aids Sub System; darauf hat man verzichtet. (Beifall beim BZÖ.)
Man geht bei anderen Dingen ganz anders an die Sache heran. Jeder Soldat hat die beste Schutzausrüstung, und man versucht, die beste Mannesausrüstung für jeden zu beschaffen. Der Soldat bekommt alles für den Selbstschutz – nur beim Eurofighter hat man das nicht gemacht! Man hat es nicht gemacht und hat beim teuersten österreichischen Soldaten, nämlich demjenigen, der ein Gerät fliegt, ein Flugzeug, das rund 80 Millionen € wert ist, auf die Selbstschutzausrüstung verzichtet! Diese Selbstschutzausrüstung wurde im Vergleich preisgegeben. Ich vermute, dass hier doch das eine oder andere hintenherum gelaufen ist.
Geschätzte Damen und Herren, was mich jetzt besonders ärgert, ist, dass Eurofighter-Flugstunden mit dem Jahresgehalt eines Soldaten verglichen werden. Da bin ich beim Kollegen Prähauser und beim Kollegen Faul. Sie beide sind es, die vor allem in den Ausschüssen oder auch in der Öffentlichkeit immer wieder versucht haben, die Waffengattungen gegeneinander auszuspielen. Diese Vergleiche: Eurofighter-Flugstunde, 30 000 € gegen ein Jahresgehalt eines Soldaten sind für das Bundesheer schädlich. Ihre Aussagen, die Sie getätigt haben, sind auch der Luftraumüberwachung nicht dienlich.
Geschätzte Damen und Herren, ich sage Ihnen, das Eurofighter-Team, die Piloten und die Techniker, die Betriebsdienste sind jetzt bereit für die LRÜ, sie sind voll motiviert. Die Umbauten im Fliegerhorst Hinterstoisser gehen ihrem Ende zu, sie sind im Finale. Die Umbauten der Piste, Turm, Feuerwehr und Tankanlagen und alle Betriebsstätten waren notwendig, weil sie über 60 Jahre alt und somit veraltet waren.
Ich frage jetzt den Präsidenten des Rechnungshofes, da der Herr Bundesminister nicht da ist. Es gibt insgesamt 22 Punkte, die der Rechnungshof in seinem Follow-Up aufzeigt, 22 Punkte, die Mängel, Kritiken und Ähnliches beim Eurofighter-Vergleich aufzeigen. Für uns wäre jetzt interessant, was von diesen Punkten noch ausständig ist, ob Probleme beim Betrieb des Eurofighters, bei der Einführung des Eurofighters, die jetzt
erfolgt, zu erwarten sind oder ob die Eurofighter-Einführung und die Inbetriebnahme der Eurofighter ohne diese 22 Punkte, die hier angeführt wurden, bereits möglich sind.
Geschätzte Damen und Herren, Österreich braucht eine Luftraumüberwachung. Österreich hat diesen Vergleich nicht gebraucht, aber da wir den Vergleich jetzt haben, müssen wir ihn auch zur Kenntnis nehmen und Maßnahmen setzen. Ich würde das den Damen und Herren der Sozialdemokratie und auch den Grünen vorschlagen. Ich hoffe, dass wir mit dem besten Flugzeug Europas auch Erfolge erzielen werden. (Beifall beim BZÖ.)
20.12
Präsident Fritz Neugebauer: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Schittenhelm. – Bitte.
20.12
Abgeordnete Dorothea Schittenhelm (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Präsident des Rechnungshofes! Geschätzte Damen und Herren! Hier wurde schon ausführlich über die Vertragsänderung bezüglich des Eurofighters gesprochen. Wenn man die vor zwei Wochen stattgefundene AirPower-Show in Zeltweg gesehen, mitverfolgt hat, weiß man, wozu das österreichische Bundesheer, seine Offiziere, seine Frauen und Männer in der Lage sind: 170 Flugzeuge aus 19 Nationen und 250 000 Bürgerinnen und Bürger, die begeistert dem Können der Piloten gefolgt sind und sich auch von der Leistungsschau der österreichischen, ja europäischen Luft- und Raumfahrtindustrie und der Forschung überzeugen konnten. (Beifall bei der ÖVP.)
Meine Damen und Herren! Alle, die sich ein wenig mit Sicherheit und dem österreichischen Bundesheer beschäftigen, wissen, dass ein wesentliches Element dieser Flugshow die Darstellung von Aufgaben aus dem Bereich der Luftraumüberwachung und der Lufttransporte ist.
Meine geschätzten Damen und Herren! Luftraumüberwachung, Luftraumunterstützung sind ja die Kernkompetenz des österreichischen Bundesheeres. Und jetzt bin ich beim Thema Eurofighter. Es wurde schon ausgeführt: Wir haben statt 18 neuen bestausgestatteten Kampfjets, nicht Geräten – unter Geräte fällt ein Kühlschrank, eine Mikrowelle, wir haben Kampfjets bestellt – 15 gebrauchte, sechs gebrauchte und sieben mit gebrauchten Teilen, die bereits von der deutschen Luftwaffe für Testflüge in Verwendung waren. Das haben wir heute, und – Kollege List hat das sehr ausführlich dargestellt – wir haben auch nicht die entsprechende Ausstattung, sodass unsere Flugzeuge, unsere Kampfjets bei Einbruch der Dunkelheit und bei schlechtem Wetter nicht mehr aufsteigen können, weil die Sicherheit der Piloten, aber auch der Bevölkerung nicht mehr gegeben ist. Das heißt, ab 20 Uhr ist der österreichische Luftraum frei für alle und jeden. Ab 20 Uhr ist es auch so, dass wir keine Sicherheit im österreichischen Luftraum haben.
Wir dürfen nicht vergessen, dass die Draken, die wir außer Betrieb gestellt haben, diese Einrichtungen hatten und dass auch die F-5, die Schweizer Leihjets, diese Ausstattung hatten – nur zur Erinnerung.
Meine geschätzten Damen und Herren, ich hoffe sehr, dass Minister Darabos im Nachhinein – und das ist auch im Rechnungshofbericht vermerkt – diese Ausstattung sehr wohl noch realisieren wird, weil sonst auch das Training der Piloten im Nacht- und Unwettereinsatz nicht möglich ist. Das heißt, keine Luftraumüberwachung, keine Luftsicherheit für das österreichische Volk. (Beifall bei der ÖVP.)
Meine Damen und Herren, ich möchte aber noch einige Sätze zum Bauprogramm der ASFINAG sagen. Sie wissen, dass die ASFINAG für die hochrangigen Straßen Österreichs verantwortlich zeichnet, zuständig ist. Es werden so im Jahr an die 1 000 Pro-
jekte realisiert. Nur eines können wir nicht, wir können unsere Bauprojekte und Straßen nicht umfunktionieren, damit ein Gigaliner hier auch fahren kann. Das wollen wir auch gar nicht. Wir lehnen das ab.
Daher bringe ich folgenden Antrag ein:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Heinzl, Dr. Maier, Prähauser, Schittenhelm, Kolleginnen und Kollegen betreffend Einsatz gegen die Zulassung von „Gigalinern“ auf europäischer Ebene
eingebracht im Zuge der Debatte zu TOP 26.) Bericht des Rechnungshofausschusses betreffend den Bericht des Rechnungshofes, Reihe Bund 2009/1; Band 5 – WIEDERVORLAGE (III-20/266 d.B.)
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher nachstehenden
Entschließungsantrag:
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie wird ersucht, sich auf europäischer Ebene, insbesondere durch ihren Einfluss auf die EU-Kommission und im Rat, im Gleichklang mit anderen europäischen Staaten nachhaltig und entschieden gegen eine Änderung der Richtlinie 96/53/EG im Sinne einer für Österreich verpflichtenden Einführung von Gigalinern einzusetzen und sich statt dessen für eine prononcierte Stärkung von Europas Bahnen einzusetzen, insbesondere durch europäische Initiativen zur Förderung von Anschlussbahnen, konventionellen Wagenverkehr und kombinierten Verkehr, der Erneuerung des rollenden Materials und Infrastruktur.“
*****
Ich ersuche um Ihre Zustimmung. – Danke. (Beifall bei der ÖVP.)
20.17
Präsident Fritz Neugebauer: Der verlesene Antrag ist ordnungsgemäß eingebracht und steht mit in Verhandlung.
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Heinzl, Dr. Maier, Prähauser, Schittenhelm, Kolleginnen und Kollegen betreffend Einsatz gegen die Zulassung von „Gigalinern“ auf europäischer Ebene
eingebracht im Zuge der Debatte zu Top 26.) Bericht des Rechnungshofausschusses betreffend den Bericht des Rechnungshofes, Reihe Bund 2009/1; Band 5 – WIEDERVORLAGE (III-20/266 d.B.)
Seit einiger Zeit laufen auf europäischer Ebene Lobbying-Aktivitäten zur Einführung einer neuen Generation von Lkw: überschwere (bis zu 60 Tonnen) und überlange (bis zu 25,25 Meter) Lastkraftwagen sollen – so die Befürworter – die Kosten im Straßenverkehr um bis zu einem Drittel senken, die Straßen entlasten und gleichzeitig den Schadstoffausstoß um ein Viertel senken. Selbst wenn Österreich diese nicht zulassen würde, könnten wir verpflichtet werden, im Ausland zugelassenen Fahrzeugen die Benützung Österreichs Straßen zu gestatten.
Das heimische, wie der Großteil des europäischen Straßennetzes, ist auf die heute üblichen Lkw-Dimensionen ausgelegt. Kurvenradien, Pannenbuchten, Leitschienen, Brücken, Tunnels, Abstellplätze entsprechen nicht den Anforderungen der Gigaliner und müssten um teures Geld adaptiert werden bzw. sind Änderungen baulich gar nicht möglich.
Für Pkw-Lenker bedeuten diese Fahrzeuge Sichtbeeinträchtigungen und längere Überholwege, das kann daher zu einem Sicherheitsrisiko führen. Im Falle eines Unfalles ist eine erhöhte Unfallschwere möglich. Abseits der Autobahnen (Freiland, städtischer Bereich) ist ein Betrieb dieser Fahrzeuge nur eingeschränkt möglich und erzwingt Umladevorgänge und einen Aufbau der hierfür nötigen Infrastruktur.
Ist andererseits der Einsatz in erster Linie für Hauptverkehrsachsen gedacht, so ist einer Verlagerung auf andere Verkehrsträger der Vorzug zu geben.
Studien gehen auch davon aus, dass es durch die Einführung von Gigalinern nicht oder kaum zu Reduktionen bei den CO2-Emissionen kommen wird. Im Gegenteil, der Rückverlagerungseffekt zieht einen erhöhten CO2 Ausstoß mit sich. Dies widerspricht eindeutig nicht nur dem verkehrspolitischen Ziel einer Verlagerung, sondern auch dem Kyoto-Ziel.
Wie bereits erwähnt, ist auch die Straßeninfrastruktur in Österreich für Gigaliner nicht eingerichtet: Auf Autobahnen sind Brücken, Kurvenradien, Autobahnrastplätze, Auf- und Abfahrten sowie Autobahnkreuze generell nicht auf eine Gesamtlänge von 25,25 Meter und 60 Tonnen Gewicht ausgelegt. Abseits der Autobahnen sind Abbiegespuren, Kreisverkehre und Kurvenradien teils unüberwindliche Hindernisse. Österreichs hochrangiges Straßennetz besteht auf Grund seiner Topographie zu knapp 15% aus Kunstbauten (Tunnel, Brücken). Ausbau und Straßenerhalt würden sich erheblich verteuern.
Für Österreich besteht dringender Handlungsbedarf: Zwar könnte es sein, dass ohne die Zustimmung Österreichs eine Einführung von Gigalinern auf dem österreichischen Straßennetz nicht möglich ist. Wenn die Nachbarländer Gigaliner zulassen, könnte es in Österreich zu einer Zunahme des Straßenverkehres kommen, da mit der Anwendung des sogenannten „modularen Konzepts“ Gigaliner an Österreichs Grenze geteilt werden müssten und von mehreren Lkw getrennt weitergeführt werden.
Eine nachhaltige Senkung der Stau-, Lärm- und Umweltbelastung und eine nachhaltige Stärkung von Europas Bahnen ist nur möglich, wenn entsprechende Initiativen zur Qualitäts- und Angebotsverbesserung im Bahnbereich auf Initiative der EU hin europaweit gefördert werden. Diese europäischen Initiativen sollten, insbesondere im Bereich der Anschlussbahnen, konventionellen Wagenverkehr und kombinierten Verkehr, der Erneuerung des rollenden Materials und der Beseitigung der „Flaschenhälse“ der Bahn-Infrastruktur angesiedelt sein.
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher nachstehenden
Entschließungsantrag:
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie wird ersucht, sich auf europäischer Ebene, insbesondere durch ihren Einfluss auf die EU-Kommission und im Rat, im Gleichklang mit anderen europäischen Staaten nachhaltig und entschieden gegen eine Änderung der Richtlinie 96/53/EG im Sinne einer für Österreich verpflichtenden Einführung von Gigalinern einzusetzen und sich statt dessen für eine prononcierte Stärkung von Europas Bahnen einzusetzen, insbesondere durch europäische
Initiativen zur Förderung von Anschlussbahnen, konventionellen Wagenverkehr und kombinierten Verkehr, der Erneuerung des rollenden Materials und der Infrastruktur.“
*****
Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Steindl. – Bitte.
20.17
Abgeordneter Konrad Steindl (ÖVP): Herr Präsident! Herr Präsident des Rechnungshofes! Meine Damen und Herren! Ich habe mich auch mit dem Kapitel Vergleich der Eurofighter-Beschaffung beschäftigt und festgestellt, dass ein Käufer, wenn er nachträglich einseitig rechtsgültige Verträge auflöst, meistens irgendwelche Lasten in Kauf nehmen muss. Diese Lasten haben wir in Kauf genommen. Wir haben statt neuen Eurofightern jetzt teilweise gebrauchte Eurofighter. Wir haben statt Tranche 2 jetzt die Tranche 1. Das ist so, wie wenn man einen Golf I mit einem Golf V vergleicht. Wir haben – leider Gottes für die Wirtschaft ganz bedauerlich – Gegengeschäfte im Wert von 500 Millionen € reduzieren müssen, was meiner Meinung nach einen entsprechenden Schaden gerade für die österreichischen Firmen darstellt.
Im Wesentlichen wurde alles schon ausgeführt, besonders eindrucksvoll von meiner Kollegin Schittenhelm. Ich meine, es ist einfach schwierig, wenn ein Beschaffungsvorgang der Republik Österreich von Anfang an von maßlosem Populismus begleitet wird und auch nach dem Vertragsabschluss von maßlosem Populismus begleitet ist. Da kann leider nichts Besseres dabei herauskommen. – Schade für Österreich. (Beifall bei der ÖVP.)
20.19
Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Windholz. – Bitte.
20.20
Abgeordneter Ernest Windholz (BZÖ): Meine geschätzten Herren Präsidenten! Hohes Haus! Die Debatte führt uns eigentlich zu einem Thema des Wahlkampfes zurück, und da sieht man einmal mehr: Es gibt auch den Tag nach der Wahl! Ich kann mich noch daran erinnern, als damals versprochen worden ist, wenn die SPÖ gewählt wird, gibt es keinen Eurofighter. Wenn Sie sagen, das war ein ausgesprochen schlechtes Geschäft, dann muss ich sagen, es gibt auch noch ein schlechteres! Das muss Ihnen hier zum Vorwurf gemacht werden: Diese Stückreduktion ergab ein noch schlechteres Geschäft, das Sie und vor allem Minister Darabos zu verantworten haben. (Abg. Dr. Haimbuchner: ... schlechter Vergleich, heißt das!)
Es werden auch immer wieder die Gegengeschäfte angesprochen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als viele gesagt haben, diese Gegengeschäfte haben Jobs in Österreich gesichert und geschaffen. Leider ist es nicht zur Gänze so ausgegangen, denn mit der Stückreduktion haben Sie auch einen Negativbeitrag geleistet.
Grundsätzlich muss man festhalten: Die Neutralität haben wir nicht nur am Boden, die gibt es auch in der Luft. Die Frage der Typenwahl war heiß umkämpft, und man kann dem Rechnungshof insgesamt dazu gratulieren, dass jetzt in einer so schwierigen Materie, die auch politisch so heftig umkämpft wurde, ein Bericht vorliegt, der absolut nachvollziehbar ist und der so manches Licht ins Dunkel gebracht hat. Ruhmesblatt für Herrn Minister Darabos, so darf festgehalten werden, ist das jedenfalls keines gewesen.
Dann darf ich noch auf Frau Kollegin Schittenhelm eingehen, die versucht hat, eine Abstimmungspanne zu reparieren. Der Rechnungshofpräsident wird sich sehr gewundert haben, dass er jetzt auch noch mit den Gigalinern konfrontiert wird. Ja, wir wissen es
schon, wir finden sicher etwas in dem Antrag, das ihn thematisch gerade noch rechtfertigt. Es darf aber festgehalten werden, dass die beiden Regierungsparteien jetzt schon Schwierigkeiten bei ihren eigenen Anträgen haben. Ich hoffe, das wird sich bessern, denn sonst werden wir wirklich noch zu einer Lachnummer. (Beifall beim BZÖ.)
20.22
Ankündigung von Anträgen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses
Präsident Fritz Neugebauer: Bevor ich dem nächsten Redner das Wort erteile, darf ich Folgendes bekannt geben:
Die Abgeordneten Strache, Kolleginnen und Kollegen haben gemäß § 33 Abs. 1 der Geschäftsordnung beantragt, einen Untersuchungsausschuss „zur näheren Untersuchung der politischen und rechtlichen Verantwortung im Zusammenhang mit dem Ausspionieren von Abgeordneten und deren Mitarbeitern oder politischen Funktionären durch Angehörige des Bundesministeriums für Inneres, des Bundesministeriums für Justiz und des Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport“ einzusetzen.
Ferner liegt das Verlangen von fünf Abgeordneten gemäß § 33 Abs. 2 der Geschäftsordnung vor, eine Debatte über diesen Antrag durchzuführen.
Weiters haben die Abgeordneten Dr. Cap, Kopf, Bucher, Dr. Pilz, Kolleginnen und Kollegen gemäß § 33 Abs. 1 der Geschäftsordnung beantragt, einen Untersuchungsausschuss „zur Untersuchung von Abhör- und Beeinflussungsmaßnahmen im Bereich des Parlaments“ einzusetzen.
Es liegt auch hier das Verlangen von fünf Abgeordneten vor, eine Debatte über diesen Antrag durchzuführen.
Ich werde, da der Gegenstand bei beiden eingebrachten Anträgen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses ähnlich gelagert ist, im Einvernehmen mit den Antragstellern im Sinne einer in diesen Fällen geübten Praxis vorgehen, nämlich dass zunächst beide Anträge begründet werden und die Debatte hierüber unter einem durchgeführt wird.
Gemäß § 33 Abs. 2 der Geschäftsordnung finden Debatte und Abstimmungen nach Erledigung der Tagesordnung statt.
*****
Zur weiteren Behandlung der Tagesordnungspunkte 26 und 27 gelangt nun Herr Abgeordneter Mag. Kogler zu Wort.
20.24
Abgeordneter Mag. Werner Kogler (Grüne): Herr Präsident! Herr Rechnungshofpräsident! Die Causa Eurofighter hat uns ja lange genug beschäftigt, aber weil ein paar Reizworte gefallen sind, muss ich schon Folgendes festhalten: Hinsichtlich dieser Gegengeschäfte wäre es schon sehr hilfreich, wenn Sie glaubwürdigere Beweise antreten würden, anstatt irgendwelche Geschichten nachzupredigen, die sich nicht einmal mehr das Wirtschaftsministerium zu erzählen traut.
Die Geschichte war am Anfang ganz groß, ganz transparent, alles auf einer Homepage, aber mittlerweile ist das zu gar nichts mehr zusammengeschrumpft. Früher standen wenigstens ein paar Daten auf der Homepage, als wir draufgekommen sind, die können nicht zusammenstimmen, sind es weniger geworden, und jetzt sind sie ganz verschwunden. Das ist auch logisch, denn Gegengeschäfte in dem Sinne, dass sie genau deshalb und nur deshalb stattfinden, weil die Republik Rüstungsgerät kauft – in
diesem Fall Eurofighter –, gibt es in der Form nicht. Mag sein, dass das bei einem einzelnen Zulieferer direkt zur Rüstungsfirma zutrifft, aber doch nicht in dem aufgeblasenen Ausmaß, wie Sie das hier dauernd darstellen.
Sie wissen das ganz genau, also hören Sie auf damit, sonst werden wir Sie einmal mit ein paar Kettenbriefen von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern versorgen, die alle fragen, wo in ihrer Region denn diese Firmen Aufträge vergeben und vor allem die Arbeitsplätze geschaffen wurden, von denen Sie dauernd reden. Das ist doch jetzt schon überflüssig, wo es gar nicht mehr darum geht, dass man das Opium für die SteuerzahlerInnen braucht. – Das war vielleicht notwendig, bevor man die sauteuren Rüstungsbeschaffungen gemacht hat, aber jetzt könnten Sie den Opium-Nebel doch ein bisschen einschränken; das geht den meisten doch nur mehr auf die Nerven und schadet Ihrer eigenen Glaubwürdigkeit.
Aber wir können ja beim Herrn Bundesminister Mitterlehner nachfragen, was jetzt tatsächlich an Gegengeschäften bestätigt ist, und dann gehen wir einmal nachschauen, ob die auch wirklich so stattgefunden haben. – Das ist doch alles ein Zinnober!
Wenn Sie sich daran erinnern, es sind doch Gegengeschäfte eingereicht und dann sogar noch bestätigt worden, als die Eurofighter Jagdflugzeug GmbH selbst eine Werbetour zu Gegengeschäften veranstaltet hat. Da sind auch ein paar Millionen angerechnet worden, also so funktioniert das. Das ist dann wirklich Voodoo-Ökonomie, dass sich nämlich die Wirtschaftskammer quasi als Messeplattform für die Anbahnung von Gegengeschäften zur Verfügung gestellt hat.
Da kommen dann halt ein paar Messevertreter von Eurofighter, dem Ganzen wird ein realer Aufwand von über einer Million oder so zugeschrieben, denn ein bisschen etwas wird es schon gekostet haben, was die Damen und Herren verjausnet haben, und dann hat man noch quasi einen Technologiehebel angelegt, das Ganze mit drei multipliziert – andere Dinge mit mehr –, und auf einmal sind es 3 oder 4 Millionen € an Gegengeschäften, wenn irgendwelche Manager herumfahren, die behaupten, dass sie auf der Suche nach Gegengeschäften sind.
Wissen Sie, wenn man das ad infinitum fortspielt, müssten die Gegengeschäfte ja einen unendlichen Wert haben, denn wenn diejenigen, denen eingeredet worden ist, dass sie vielleicht ein Gegengeschäft machen könnten, auch noch wo herumfahren, vielleicht auch noch wo ein Bier trinken, und wenn sie dann noch einen technologischen Bierhebel unterlegen, dann kommen wir auf eine Summe, die letztlich unendlich ist. Das ist eine relativ simple mathematische Übung. Genau das ist die inhärente ökonomische Logik dieser Gegengeschäfte. Also hören Sie doch endlich auf mit dem Unsinn, das hält ja hier herinnen niemand mehr aus! (Beifall bei den Grünen.)
Wie gesagt, Sie brauchen das ja gar nicht mehr, denn die Eurofighter sind ohnehin da – dass sie nicht oder kaum fliegen, ist eine andere Sache, aber das ist auch gut so, weil die Betriebsstunden viel zu teuer sind. Sie wissen ganz genau, die Betriebskostenexplosion ist enorm. Bald sind die Betriebskosten doppelt so hoch wie ursprünglich angenommen, und das sind genau die Zahlen, die Herr Abgeordneter Pilz Ihnen im Untersuchungsausschuss vorgerechnet hat. Genau so ist es gekommen, und jetzt knabbern Ihnen die Eurofighter die Haare von Ihrem Bundesheerbudget. Aber bitte, schauen Sie weiter, wie Sie damit zurechtkommen! Ein „klasser“ Erfolg, ein „super“ Erfolg! (Abg. Dr. Haimbuchner: Die ÖVP ist froh, dass sie die AirPower ...!)
Im Übrigen haben die Aufklärungsarbeiten in diesem Bereich sehr viel zutage gebracht. Ich darf an etliche Prozesse erinnern, die in diesem Zusammenhang angestrengt wurden. So sauber, wie Sie immer tun, ist der Deal nicht abgelaufen, sonst hätte nicht das Höchstgericht meinen Aussagen insofern endgültig recht gegeben, als
Klagen zurückgewiesen worden sind und ich zivilrechtlich unverfolgbar behaupten darf, dass allein durch die Anbahnung und im Vorfeld und rund um das Eurofighter-Geschäft 100 Millionen Schilling ins politische System eingeschleust wurden. Das darf man jetzt einfach behaupten, weil das so im Kontext für Recht befunden wurde!
Und von diesen 100 Millionen ist für zwei Drittel der Nachweis nicht da, das heißt, das Geld ist irgendwo oder bei einer bestimmten Werbeagentur verblieben. Eine „super“ Rendite! Vielleicht ist es ja auch woanders – das wissen wir eben nicht –, aber der Nachweis, dass 100 Millionen eingeschleust worden sind und zwei Drittel davon – also zirka 65 Millionen – gar keinen Verwendungsnachweis finden können, der bleibt aufrecht. Und das Drittel dieser Gelder, das nachgewiesen werden konnte, ist über fingierte Rechnungen nachgewiesen worden, weil eine Pressekonferenz um 100 000 €, das ist doch wohl nicht Ihr Ernst! Also das ist keine saubere Sache gewesen, das darf man auch so behaupten, und behaupten Sie ja nicht mehr das Gegenteil!
Jetzt zum eigentlichen Anlass des Berichts. Da wurde untersucht – der Herr Rechnungshofpräsident wird ja dazu selbst Stellung nehmen –, dass diese Vergleichsverhandlungen ein Bemühen waren, noch zu retten, was zu retten ist. Ich habe es aufgegeben, Herrn Minister Darabos da großartige Vorwürfe zu machen. Das hätte man vielleicht auch anders machen können, aber das werden Sie besser erläutern, als wenn ich da jetzt Energien hineinstecke.
Aber Folgendes muss man schon festhalten: Diese ganze Beschaffungscausa hat ihr Grundübel woanders gehabt. Das war ein Beschaffungs- und Vergabeschwindel – von Anfang an. Dann hat Herr Minister Darabos noch probiert, etwas zu verhandeln, was vielleicht auch nicht das Glücklichste war, aber das Unglück, das Herr Minister Darabos verursacht hat, war ein ganz anderes – nämlich dass er die Arbeiten des Untersuchungsausschusses nicht dazu herangezogen hat, um viel stärker auf einen vollständigen Ausstieg aus dem Ankauf dieses Produkts hinzuarbeiten. Das war die eigentliche Geschichte! Dazu gibt es unterschiedliche Einschätzungen, das ist klar, aber unsere ist und bleibt: Die Sünde des Minister Darabos war viel eher, das eben Erwähnte unterlassen zu haben, und vielleicht weniger das, was Sie jetzt vorbringen werden. (Beifall bei den Grünen.)
20.30
Präsident Fritz Neugebauer: Als Nächster gelangt Herr Abgeordneter Mag. Widmann zu Wort. – Bitte.
20.30
Abgeordneter Mag. Rainer Widmann (BZÖ): Herr Präsident! Hohes Haus! Ich als Milizoffizier würde mir wünschen, dass man die Debatte über die Landesverteidigung Österreichs weniger emotional und ideologisch, sondern mehr sachbezogen auf der Basis von Fakten, Zahlen und Daten führen würde, und nicht wieder eine Debatte fortsetzt, die Österreich in der Luftraumüberwachung auf das Abstellgleis Europas führt.
Wenn die SPÖ das Neutralitätsgesetz ernst nehmen würde, dann wüsste sie auch, dass das bedeutet, sich zur umfassenden Landesverteidigung zu bekennen. – Das heißt auch Luftraumüberwachung. Ich darf schon daran erinnern, dass es noch die SPÖ – gemeinsam mit der ÖVP – war, die den Grundsatzbeschluss zur Nachfolge der Draken gefasst hat. Dann sollten wir jetzt über die Typenauswahl und über die Geschäfte reden. Aber was dann passiert ist, dass man aufgrund der Aussagen von Experten, die den Typ ausgesucht haben, die Zahl der Abfangjägern reduziert, das ist der falsche Weg. Wenn wir den Typ komplett abmontieren, dann ist das eigentlich kein Abfangjäger mehr, sondern nur noch ein Leiterwagerl, das im Blindflug über Österreich hinwegfegt, aber letztlich sauteuer ist, weil es die Leistung nicht erbringen kann.
Wenn Sie ehrlich gewesen wären, hätten Sie nämlich sagen müssen: Schaffen wir das Neutralitätsgesetz ab, dann brauchen wir keine Abfangjäger! Wenn die SPÖ und die Grünen sagen: Wir sind neutral!, dann brauchen wir auch eine Luftraumüberwachung. Ich sage Ihnen, mit roten und grünen Luftballons wird das nicht gelingen. Das heißt, in dieser Debatte fehlen mir die Ehrlichkeit und die Konsequenz (Abg. Dr. Matznetter: Na geh! Was sagt der Scheibner jetzt?), Herr Kollege Matznetter, zur Landesverteidigung und auch zur Luftraumüberwachung zu stehen und dafür auch konkrete, faire und richtige Wege aufzuzeigen. Das haben Sie verabsäumt! (Abg. Dr. Matznetter: Der Scheibner ... 24 Stück! – Abg. Scheibner: 36! Ich wollte 36! Immer 36!) – Danke schön. (Beifall beim BZÖ.)
20.32
Präsident Fritz Neugebauer: Ich erteile nun dem Herrn Präsidenten des Rechnungshofes Dr. Moser das Wort. – Bitte.
20.32
Präsident des Rechnungshofes Dr. Josef Moser: Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Ich darf in Erinnerung rufen, dass der heute auf der Tagesordnung stehende Bericht betreffend die Nachbeschaffung des Luftraumüberwachungsflugzeuges Draken der fünfte in einer langen Kette von Prüfberichten des Rechnungshofes ist.
Ich möchte kurz daran erinnern, dass sich der erste Bericht mit der Vorbereitung der Nachfolgebeschaffung befasst hat, der nächste betraf die Typenentscheidung, der dritte die Unterzeichnung der Kaufverträge, der Folgebericht war die Bewertung und Dokumentation der Gegengeschäfte, und der heute auf der Tagesordnung stehende Bericht befasst sich mit der Bewertung des abgeschlossenen Vergleiches sowie mit der nachfolgenden Vertragsänderung mit der Eurofighter GmbH.
Ich möchte in diesem Zusammenhang erwähnen, dass die Grundlagen dieser Prüfungen für den Rechnungshof die verfassungsrechtlichen und einfachgesetzlichen Vorgaben, die Vorgaben aus den Beschlüssen des Nationalrates sowie militärische Konzepte waren. Diese Vorgaben hatte der Rechnungshof als Maßgabe für seine Gebarungsüberprüfung heranzuziehen und zur Kenntnis zu nehmen. Er hatte zu prüfen, ob und inwieweit die rechtlichen und militärischen Vorgaben sparsam, wirtschaftlich und zweckmäßig beziehungsweise möglichst steuerschonend erreicht worden sind. Dieser Maßstab war auch Gegenstand dieser Prüfung den Vergleich betreffend.
Die Prüfung hat auch gezeigt, dass durch den Vergleich eine Kostenreduktion von 267 Millionen € – durch die Abbestellung von drei Luftraumüberwachungsflugzeugen beziehungsweise von Einsatzausrüstung – bewirkt beziehungsweise erreicht werden konnte. Aus der Sicht des Rechnungshofes ist es notwendig, dass nunmehr aber die in Aussicht gestellten möglichen Entgeltreduktionen sichergestellt werden, dass der ausstehende Investitionsbedarf konkretisiert wird und dass die militärischen Planungsgrundlagen harmonisiert und vervollständigt werden. In dem Zusammenhang ist auch auf den Beschaffungsvorgang betreffend das Waffensystem Jaguar hinzuweisen, durch welchen – das wurde heute im Rahmen der Debatte schon erwähnt – ein verlorener Aufwand in Millionenhöhe verursacht wurde.
Gerade dieser Beschaffungsvorgang hat gezeigt, was das Grundproblem bei den Beschaffungen im Bundesministerium für Landesverteidigung war beziehungsweise ist. Es ist nämlich so, dass bei den Realisierungsmaßnahmen konkrete Planungsaufträge, inhaltliche Vorgaben, Planungsverantwortung und Projektstrukturen sowie umfassende Kostenermittlungen – sowohl für die Beschaffung als auch für die laufenden Betriebskosten – gefehlt haben. Es wurden Bedarfsermittlungen nicht durchgeführt, Prioritätenreihung und konkrete Realisierungszeiträume nicht beachtet und keine Abstimmungen zwischen Investitionsmaßnahmen der beteiligten Bereiche vorgenommen.
Diese Probleme treten beziehungsweise traten immer wieder auf. Das hat auch dazu geführt, dass die Beschaffungsvorgänge gestoppt und rückgängig gemacht beziehungsweise rückabgewickelt werden mussten. Generell ist auch zu vermerken, dass das Kostenbewusstsein – insbesondere bei der Planung – im Bundesministerium für Landesverteidigung nicht gerade sehr ausgeprägt ist. Der Rechnungshof weist daher darauf hin, dass diese Empfehlungen und Mängel so rasch wie möglich abgestellt werden müssen, weil es wichtig ist, dass der Truppe tatsächlich die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt werden können.
Das ist aber nicht nur ein Problem des Bundesministeriums für Landesverteidigung; die Prüfung bei den ÖBB – betreffend den Röntgen-Scanner – hat gezeigt, dass dort die gleichen Probleme vorliegen. Eine Beschaffung ohne Bedarfserhebung, ohne Berücksichtigung der Begleit- und Folgekosten, ohne Einsatzszenarien und ohne Einbindung der maßgeblichen Betroffenen führt zu einem erheblichen Schaden, in diesem Fall von 3,8 Millionen €. (Abg. Mag. Gaßner: So was gibt’s in den Gemeinden nicht! – Abg. Mag. Kogler: Wenn genug zusammenkommen!)
Der Rechnungshof möchte daher ausdrücklich darauf hinweisen, dass es notwendig ist, gerade die heute auf der Tagesordnung stehenden Empfehlungen tatsächlich umzusetzen. Ich ersuche Sie daher auch, dabei mitzuwirken, diese Empfehlungen in die Tat umzusetzen. Nur so können Geldmittel gespart werden, die wir dringend benötigen, um die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen.
Ich bedanke mich abschließend nochmals für die gute Zusammenarbeit und wünsche Ihnen schöne Urlaubstage. – Ich danke Ihnen. (Allgemeiner Beifall.)
20.37
Präsident Fritz Neugebauer: Danke, Herr Präsident Dr. Moser.
Es ist dazu niemand mehr zu Wort gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
Wir kommen zu den Abstimmungen.
Zunächst kommen wir zur Abstimmung über den Antrag des Rechnungshofausschusses, den vorliegenden Bericht des Rechnungshofes, Reihe Bund 2009/1; Band 5 – WIEDERVORLAGE (III-20/266 der Beilagen) zur Kenntnis zu nehmen.
Ich bitte jene Kolleginnen und Kollegen, die für dessen Kenntnisnahme eintreten, um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist angenommen.
Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag des Rechnungshofausschusses, den vorliegenden Bericht des Rechnungshofes, Reihe Bund 2008/12 (III-11/267 der Beilagen) zur Kenntnis zu nehmen.
Wer für dessen Kenntnisnahme eintritt, den bitte ich um ein zustimmendes Zeichen. – Das ist angenommen.
Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Heinzl, Dr. Maier, Kolleginnen und Kollegen betreffend Einsatz gegen die Zulassung von „Gigalinern“ auf europäischer Ebene.
Wer dem zustimmt, den bitte ich um ein Zeichen. – Das ist einstimmig angenommen. (Demonstrativer Beifall und Bravorufe bei Abgeordneten der ÖVP.) (E 44.)
Bericht des Immunitätsausschusses über das Ersuchen des Landesgerichtes für Strafsachen Wien (GZ 111 Hv 52/09v) um Zustimmung zur behördlichen Verfolgung der Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Eva Glawischnig-Piesczek (314 d.B.)
Präsident Fritz Neugebauer: Wir kommen nun zum 28. Punkt der Tagesordnung.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Es liegt mir hiezu keine Wortmeldung vor.
Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag des Immunitätsausschusses in 314 der Beilagen, Folgendes zu beschließen:
In Behandlung des Ersuchens des Landesgerichtes für Strafsachen Wien um Zustimmung zur behördlichen Verfolgung der Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Eva Glawischnig-Piesczek wird im Sinne des Artikel 57 Abs. 3 Bundes-Verfassungsgesetz festgestellt, dass ein Zusammenhang zwischen den vom Privatankläger behaupteten strafbaren Handlungen und der politischen Tätigkeit der Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Eva Glawischnig-Piesczek besteht. Daher wird einer behördlichen Verfolgung der Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Eva Glawischnig-Piesczek nicht zugestimmt.
Ich bitte jene Damen und Herren, die sich diesem Antrag anschließen, um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist angenommen.
Bericht des Immunitätsausschusses über das Ersuchen des Landesgerichtes für Strafsachen Wien (GZ 095 Hv 20/09w) um Zustimmung zur behördlichen Verfolgung des Abgeordneten zum Nationalrat Karl Öllinger (315 d.B.)
Präsident Fritz Neugebauer: Wir gelangen nun zum 29. Punkt der Tagesordnung.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Mag. Stefan. – Bitte.
20.40
Abgeordneter Mag. Harald Stefan (FPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Im Ausschuss haben wir zugestimmt, den politischen Zusammenhang herzustellen und daher der Auslieferung nicht zuzustimmen, weil das die Usance in diesem Haus ist, obwohl es hier um die Klage eines Mitarbeiters von Martin Graf gegen Kollegen Öllinger geht, unter anderem wegen Weitergabe einer dem Datenschutz unterliegenden Bestellliste und des üblichen Vorwurfs, ein Neonazi oder ein Nationalsozialist zu sein.
Jetzt haben wir allerdings Kenntnis davon erlangt, wie Herr Kollege Öllinger vorgeht, wie er zu seinen Informationen kommt. Wir haben erfahren, dass er zumindest mit einem Kriminalbeamten in unmittelbarem Zusammenhang Bespitzelungen vornimmt, sich diese Informationen illegal beschafft und dabei auch Bespitzelungen von Kollegen in diesem Haus durchführt, unter anderem Anfragen mit dem Kriminalbeamten abklärt, sich Fotos schicken lässt, Fotos auswerten lässt und so weiter, und so weiter.
Wir sind der festen Überzeugung, dass es weder Sinn noch Intention dieses Gesetzes war, dass ein Kollege, der andere bespitzelt, von denselben Kollegen dann davor geschützt werden soll, ausgeliefert zu werden.
Wir ändern daher unser Abstimmungsverhalten und werden gegen den Antrag des Ausschusses stimmen. (Beifall bei der FPÖ.)
20.42
Präsident Fritz Neugebauer: Weitere Wortmeldungen hiezu liegen nicht mehr vor. Die Debatte ist geschlossen.
Ich komme zur Abstimmung über den Antrag des Immunitätsausschusses in 315 der Beilagen, Folgendes zu beschließen:
Im Behandlung des Ersuchens des Landesgerichtes für Strafsachen Wien um Zustimmung zur behördlichen Verfolgung des Abgeordneten zum Nationalrat Karl Öllinger wird im Sinne des Artikel 57 Abs. 3 Bundes-Verfassungsgesetz festgestellt, dass ein Zusammenhang zwischen den vom Privatankläger behaupteten strafbaren Handlungen und der politischen Tätigkeit des Abgeordneten zum Nationalrat Karl Öllinger besteht. Daher wird einer behördlichen Verfolgung des Abgeordneten zum Nationalrat Karl Öllinger nicht zugestimmt.
Ich bitte jene Damen und Herren, die sich diesem Antrag anschließen, um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist angenommen.
Erste Lesung: Antrag der Abgeordneten Josef Bucher, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), BGBl. Nr. 1/1930 idgF, geändert wird (657/A)
Präsident Fritz Neugebauer: Wir kommen zum 30. Punkt der Tagesordnung.
Wir gehen in die Debatte ein.
Das Wort erhält zunächst der Antragsteller, Herr Abgeordneter Bucher. – Bitte.
20.43
Abgeordneter Josef Bucher (BZÖ): Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Idee, dass auch der Nationalrat das ganze Jahr über seinen Betrieb aufrechterhält, ist eine, die wir schon seit vielen Jahren diskutieren. Letztendlich hat ja auch die geschätzte Frau Präsidentin den Vorschlag gemacht, die Sommerferien auf vier Wochen zu beschränken. Diesem Vorschlag kommen wir selbstverständlich gerne nach, wenngleich wir als Oppositionspartei es gerne sehen würden, dass der Nationalrat gerade auch in Anbetracht der Wirtschaftskrise, in Anbetracht der großen Herausforderungen, vor denen wir alle stehen – nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die politischen Entscheidungsträger des Landes –, den Sommer für Beratungen nützt, auch dazu, Anträge und auch Anfragen einzubringen, eben den parlamentarischen Betrieb aufrechtzuerhalten.
Wir vom BZÖ legen großen Wert auf die Feststellung, dass es selbstverständlich ist, dass jeder Politiker/jede Politikerin des Landes Anspruch hat, Urlaub zu machen nach den sehr aufregenden Monaten des Jahres, in denen wir in Hochbetrieb sehr viel zu tun haben, und dass es selbstverständlich ist, dass jeder auch einen Sommerurlaub macht. Es wäre unser Vorschlag gewesen, dass wir den parlamentarischen Betrieb zumindest so weit aufrechterhalten, dass wir eben Anfragen stellen können, Anträge stellen können, das Interpellationsrecht, das für die Opposition sehr wichtig ist, ausnützen können.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, das bedeutet auch keine Einschränkung, was die Freizeit und die Urlaubszeit der Mitarbeiter anlangt. Wir wissen und schätzen auch, dass die Mitarbeiter des Hohen Hauses eine hervorragende Arbeit leisten – im Dienste der Abgeordneten des Hauses. Dieser unser Vorschlag soll auch keine Einschränkung darstellen für die Leistungsfähigkeit der Abgeordneten des Hauses. Wir wissen, dass auch während der Sommermonate jeder Einzelne von uns selbstverständlich auch in seinem Wahlkreis einer Beschäftigung und Tätigkeit nachgeht, was auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, was wichtig ist, um den Wählerkontakt aufrechtzuerhalten.
In diesem Sinne ist dieser unser Antrag zu verstehen. – Ich wünsche allen Kolleginnen und Kollegen einen schönen Sommerurlaub. (Beifall beim BZÖ.)
20.46
Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Mag. Gaßner. – Bitte.
20.46
Abgeordneter Mag. Kurt Gaßner (SPÖ): Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Abgeordneter Bucher, der Vergleich Ihrer Rede mit dem Segen „urbi et orbi“ ist vielleicht etwas weit hergeholt, aber man könnte schon sagen, es war so schmeichelweich; „ach bitte“, „doch“, „vielleicht“ und so weiter.
Ich verstehe eines nicht: Für mich bedeutet Sitzungsende beziehungsweise Tagungsende nicht gleich Arbeitsende. Wir arbeiten alle weiter! (Abg. Bucher: Das habe ich gesagt!) Ich bin jetzt schon einige Zeit hier, und ich habe mich noch in jedem Sommer wirklich bemühen müssen, um eine Woche, maximal 14 Tage lang einen gemeinsamen Urlaub mit meiner Familie verbringen zu können. Das aber ist, glaube ich, doch auch unser Recht. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.)
Sie werden doch nicht im Ernst glauben, dass Sie dadurch auch nur eine Stimme gewinnen, wenn ein paar Zeitungen schreiben, dass wir Abgeordneten zwei Monate Urlaub haben! Was soll denn das? Ich kenne keine Berufsgruppe, die solch einen Antrag stellen würde. (Abg. Grosz: Der Faul hat 10 Monate Urlaub!) Ich glaube, wir sind ganz normale „Arbeiter“ für Österreich, und daher haben wir auch das Recht, einen vierzehntägigen Urlaub zu verbringen. (Demonstrativer Beifall bei Abgeordneten der ÖVP.)
Sie sagen, Herr Kollege Bucher, Anfragen sollten eingebracht werden können. – Da stimme ich Ihnen zu, aber es wird eine GOG-Novelle geben, und dort kann das geregelt werden, das ist durchaus okay. Deswegen brauchen wir aber nicht auf unseren Urlaub zu verzichten.
Außerdem – wie schon gesagt – arbeiten wir ja weiter. Ich habe vorhin meinen Kalender angesehen und kann nur sagen: Es geht weiter! Es geht in der Bezirksarbeit weiter, denn es gibt viele, die wünschen, dass wir an Festen und sonstigen Veranstaltungen teilnehmen. Vielleicht werden Sie (in Richtung BZÖ) nicht überall hin eingeladen – bei uns ist die Arbeit genug. – Danke schön. (Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordneten der ÖVP. – Abg. Scheibner: Das mit den Einladungen ist wirklich interessant! Wir werden nicht überall eingeladen!)
20.48
Präsident Fritz Neugebauer: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Dr. Karl. – Bitte.
20.48
Abgeordnete Mag. Dr. Beatrix Karl (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Wenn man Kollegem Bucher vorhin zugehört hat, hat man den Eindruck gewonnen, dass es mit diesem Antrag ohnehin nicht ganz so ernst gemeint ist. (Beifall bei Abgeordneten der ÖVP.)
Wenn man den Wortlaut des Antrages liest, klingt das doch etwas anders. Hier heißt es etwa:
„Inmitten der Wirtschaftskrise weiterhin eine parlamentarische Sommerpause einzulegen, die volle zwei Monate dauert, legt das Parlament aus Sicht der unterzeichnenden Abgeordneten völlig lahm.“
Es ist von einer völligen Lahmlegung des Parlaments die Rede, dabei wird aber Wesentliches übersehen. Zum einen wird dabei übersehen, dass das österreichische Par-
lament aus zwei Organen besteht, und dass der Bundesrat seine letzte Sitzung erst in zwei Wochen abhält. Außerdem wird auch übersehen, dass sehr wohl die Möglichkeit besteht, Sondersitzungen einzuberufen, und dass auch die Möglichkeit besteht, Ausschüsse für permanent zu erklären, wie wir das heute ja auch tun werden.
Das heißt also, es ist reiner Populismus, in diesem Antrag so zu tun, als wäre das Parlament während der sitzungsfreien Zeit völlig handlungs- und entscheidungsunfähig. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
Es ist auch reiner Populismus, so zu tun, als würden die Abgeordneten zwei Monate lang Urlaub machen, nur weil sitzungsfreie Zeit ist. So zu tun, als ließe sich die Arbeit der Abgeordneten an der Zahl der Sitzungen festmachen und würde nicht auch außerhalb des Parlaments stattfinden, ist einfach schlichtweg unseriös! (Beifall bei ÖVP und SPÖ. – Zwischenrufe des Abg. Grosz.)
Zudem geht es bei der Abschaffung der sitzungsfreien Zeit nicht nur um uns, sondern sehr wohl auch um die Bediensteten des Parlaments, Herr Kollege Bucher. Ihre Arbeit wird von uns immer wieder gelobt und zu Recht gelobt; Sie haben deren Arbeit gelobt. – Wollen wir sie damit „belohnen“, dass wir ihre Urlaubsmöglichkeiten einschränken?
Sie müssen nämlich eines berücksichtigen: Ein Urlaub dient dem Erholungszweck, und das bedeutet unter anderem auch, dass diese Bediensteten die Möglichkeit haben müssen, den Urlaub innerhalb des Urlaubsjahres, in dem er entstanden ist, zu verbrauchen, und dass sie den Urlaub auch in einem möglichst langen Zeitraum verbrauchen können. Diese Möglichkeiten werden sehr wohl eingeschränkt, wenn man die sitzungsfreie Zeit abschafft.
Außerdem wundert mich schon eines angesichts Ihres Antrages, Herr Kollege Bucher: Wieso setzen Sie sich hier im Parlament so sehr dafür ein, dass die sitzungsfreie Zeit abgeschafft wird? Im Kärntner Landtag spielt das für Sie offensichtlich überhaupt keine Rolle. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) Im Kärntner Landtag hat gestern die letzte Sitzung stattgefunden – und bis 1. Oktober findet keine weitere Sitzung statt! (Oh-Rufe bei ÖVP und SPÖ.)
Ich würde Ihnen raten, dass Sie sich einmal dieses Problems in Kärnten annehmen, bevor Sie hier im Parlament die sitzungsfreie Zeit abschaffen wollen. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Für eine rein populistische Maßnahme, die noch dazu für die Bediensteten sehr wohl von Nachteil ist, sind wir nicht zu haben! – Danke. (Beifall und Bravorufe bei ÖVP und SPÖ.)
20.52
Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Lausch. – Bitte.
20.52
Abgeordneter Christian Lausch (FPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Meine geschätzten Damen und Herren! Ich kann es ebenfalls kurz machen, denn ich kann mich im Großen und Ganzen den Ausführungen meiner Vorrednerin, zumindest in ihrer Einleitung, anschließen. Geschätzter Herr Klubobmann Bucher! Es ist wirklich so, irgendwie hatte man den Eindruck, Sie entschuldigen sich jetzt für Ihren eigenen Antrag. Ihr Statement jetzt hat ganz anders geklungen als das, was im Antrag steht.
„Es wird daher vorgeschlagen“ –
nur den einen Satz lese ich vor, alles andere hat Kollegin Karl eigentlich gesagt –,
„die Sommerpause zur Gänze entfallen zu lassen.“
Diesen Eindruck hatte man jetzt nicht mehr, als Sie hier heraußen gestanden sind. Sie haben von „einschränken“ gesprochen, davon, die Sommerpause etwas zu verkürzen, aber „zur Gänze entfallen zu lassen“ hat man jetzt nicht mehr gehört.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir Freiheitlichen können diesem Antrag des BZÖ wenig abgewinnen. Wir begründen das mit vier Punkten.
Erstens – wenn Sie die heutige „ÖSTERREICH“-Ausgabe gelesen haben, wissen Sie es –: Wir freiheitlichen Abgeordneten stellen die fleißigsten acht Abgeordneten unter den ersten 15. (Beifall bei der FPÖ.) Das muss man einfach erwähnen. Kein einziger unserer Abgeordneten ist bei den Faulsten dabei, kein einziger unter den ersten 15 Faulsten. Kein einziger!
Ich muss sagen, die Oppositionsparteien haben in diesem Ranking generell sehr gut abgeschnitten; anders die Mitglieder der Regierungsfraktionen. (Zwischenrufe bei SPÖ und ÖVP.) Das muss man auch einmal erwähnen. Ich weiß, jetzt ist die Aufregung groß, aber ich hoffe, Sie lesen Zeitung.
Zweitens: Bei uns gehen die meisten Abgeordneten, trotz fleißiger Tätigkeit – fleißiger, wie „ÖSTERREICH“ heute schreibt; und auch erwiesen – im Nationalrat noch ihren ursprünglichen Zivilberufen nach. Deshalb können wir Ihrem Antrag ebenfalls nichts abgewinnen. (Beifall bei der FPÖ.)
Drittens: Wir Freiheitlichen kümmern uns in der sogenannten Sommerpause intensiv um Bürgerkontakte im Wahlkreis – dafür ist die Sommerpause, glaube ich, auch da – und machen sicherlich nicht zwei Monate blau. (Beifall bei der FPÖ.)
Viertens: Letztlich bezeichnen wir den Antrag als ein wenig populistisch – um das jetzt etwas einzuschränken, weil sich, wie gesagt, der Kommentar des Herrn Klubobmannes Bucher jetzt anders angehört hat. (Abg. Steibl: Redezeit! – Weitere Rufe bei der ÖVP: Das ist schon viel zu lange!) Ich glaube, dass das BZÖ jetzt ein wenig Einsehen hat.
Wir stehen grundsätzlich konstruktiven Ideen, konstruktiven Vorschlägen natürlich positiv gegenüber, wie immer, aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, können wir diesem Antrag leider nichts abgewinnen. – Danke. (Beifall bei der FPÖ.)
20.55
Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Brosz. – Bitte.
20.55
Abgeordneter Dieter Brosz (Grüne): Herr Präsident! Anmerkungen zur Differenz zwischen dem Text und der Rede sind ja schon hinlänglich gemacht worden, wobei: Nachdem ich Sie jetzt habe reden hören, Herr Kollege Bucher, kann ich Ihnen in weiten Teilen zustimmen. Dass nämlich das Parlament im Sommer der Kontrollrechte beschnitten wird und zwei Monate lang kein Anfragerecht besteht, das ist wirklich absurd. Wenn Kollege Gaßner Ihren Vorschlag dahin gehend unterstützt, dann hoffe ich, dass das auch die Position der SPÖ im Geschäftsordnungskomitee ist; darüber hat Kollegin Karl nämlich nichts gesagt.
Also vielleicht einigen wir uns darauf, dass diese Kontrollmöglichkeiten, die ja nicht die Sitzungen betreffen, auch über den Sommer bestehen bleiben. Das wäre schon einmal ein wesentlicher Schritt, um die Rechte im Parlament auszuweiten. Vielleicht hat also Ihr Antrag dazu geführt, dass zumindest hier ein Schritt in die richtige Richtung gegangen wird.
Die Art, in der wir den Sitzungsplan machen, verleitet natürlich schon dazu, dass wir manchmal ordentlich eine „auf den Schädel kriegen“. – Es geht ja nicht nur um die Sommerfrage. Wenn man sich ansieht, dass vor Weihnachten die letzte Sitzung, wie
ich glaube, am 6. Dezember ist und die nächste dann am 23. Jänner, dann kann man schon fragen, ob das eine besonders intelligente Anordnung ist. Sechs Wochen Pause macht nämlich niemand!
Es gibt das Argument, dass die Gesetze mit 1. Jänner in Kraft treten können müssen – deshalb verzichten wir wochenlang auf Sitzungen? Es gäbe schon Möglichkeiten, das anders zu gestalten, aber auch darüber haben wir in der Präsidiale schon gesprochen. Vielleicht kommen wir auch da einen Schritt weiter.
Letzte Anmerkung zum Kollegen Lausch: Wir Grünen sind ja bei diesen skurrilen Reihungen über den Fleiß der Abgeordneten in der Regel relativ gut weggekommen, aber ein viel unsinnigeres Kriterium, als Reden, Anfragen und Ausschüsse zusammenzuzählen und dann eine Reihung von Faulen und Fleißigen zu machen, fällt mir nicht ein. Wenn Sie Kollegem Bucher wegen der Sommerpause Populismus vorwerfen und sich dann beweihräuchern, weil Sie zum Teil Serienanfragen an die Ministerien produzieren und glauben, damit Ihren Fleiß ausdrücken zu können, dann sind Sie ganz schön auf dem Holzweg! (Beifall bei Grünen, SPÖ, ÖVP und BZÖ.)
20.57
Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Grosz. – Bitte.
20.57
Abgeordneter Gerald Grosz (BZÖ): Sehr geehrte Damen und Herren! Hohes Haus! Eigentlich wollte ich mich heute nicht mehr zu Wort melden (demonstrativer Beifall und Bravorufe bei SPÖ und ÖVP), aber dass sich der österreichische Nationalrat und so viele Mitglieder verschiedener Fraktionen hier in diesem Haus 20 Minuten lang damit beschäftigen, der Öffentlichkeit zu erklären, warum sie drei Monate Urlaub brauchen und warum das alles eigentlich so schön ist, hat mich schon dazu veranlasst, noch einmal hierher ans Rednerpult zu treten. (Abg. Strache: Der Kärntner Landtag macht drei Monate Urlaub!)
Sehr geehrte Damen und Herren, in diesem Land gibt es 300 000 Mitbürgerinnen und Mitbürger, die einen Arbeitsplatz suchen, die arbeiten wollen, aber keine Arbeit finden. – Sehr geehrte Damen und Herren! Hohes Haus! Vielleicht können Sie das Schicksal jener Mitmenschen in unserer Nachbarschaft, in unseren Gemeinden, in unseren Wahlkreisen nachvollziehen, die von Arbeitslosigkeit gepeinigt werden.
Vielleicht können Sie nachvollziehen, dass sich der/die, der/die im Haus gegenüber oder in der Wohnung gegenüber von Ihnen wohnt, auch in diesem Sommer Gedanken machen wird, wie die zwei Kinder ernährt werden sollen, wie die Leasingrate für das Auto und die Miete bezahlt werden soll. Vielleicht können Sie es nachvollziehen, dass sich diese Menschen von Ihnen als Abgeordnete der Republik erwarten, dass Sie den Sommer dazu nutzen, die Zukunft so zu gestalten, dass die Menschen in diesem Land wieder Arbeit haben, zumindest jene, die auch arbeiten wollen. (Beifall beim BZÖ.)
Sehr geehrte Damen und Herren, es steht Ihnen nicht schlecht an, bei einem Gehalt von 8 300 € brutto im Monat, 14 Mal im Jahr – 8 300 € im Vergleich zum Durchschnittsgehalt von ein wenig mehr als 1 000 € für Herrn und Frau Österreicher –, es steht Ihnen nicht schlecht an, anstatt sich hierher zu stellen und mit Zähnen und Klauen drei Monate Urlaub zu verteidigen, auch darüber nachzudenken, wie man Österreich in der größten Wirtschaftskrise in der Geschichte der Zweiten Republik nach vorwärts entwickeln kann, wie man Arbeitslosigkeit verhindern kann, sehr geehrte Damen und Herren! (Beifall beim BZÖ.)
Diese Diskussion hätte ich mir gewünscht! Selbstverständlich gebe ich Ihnen recht, dass viele Abgeordnete dieses Hauses, die ihre Aufgabe und ihre Arbeit ernst nehmen, den Sommer nicht ungenutzt verstreichen lassen.
Ich selbst besuche bis zum 10. September 180 Brauchtumsveranstaltungen in der Steiermark. (Ironische Heiterkeit bei der SPÖ.) Da gebe ich Ihnen recht, das mag zwar jetzt nicht sehr sinnvoll sein. Ich absolviere Sprechtage und versuche, den Menschen in meinem Heimatbundesland zu helfen. (Anhaltende Zwischenrufe.)
Ich werde mein Büro besetzen, werde Veranstaltungen besuchen und werde mit den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes in Kontakt treten, so, wie es von uns verlangt ist. (Unruhe im Saal.)
Aber wissen Sie, wen ich die letzten neun Monate bei diesen unzähligen Wahlkreisveranstaltungen, von denen Sie heute alle gesprochen haben, zumindest in der Steiermark, in meinem Wahlkreis, an Kolleginnen und Kollegen aus diesem Haus getroffen habe? Niemanden! Niemanden!
Doch! Entschuldigung! Den Herrn Faul im VIP-Zelt bei der „AirPower“-Veranstaltung. Das war der einzige Abgeordnete, der mir die letzten neun Monate bei Veranstaltungen in der Steiermark begegnet ist. (Abg. Strache: Da waren Sie auch im VIP-Zelt!)
Sehr geehrte Damen und Herren, ich würde mir daher wünschen, dass Sie unserem Antrag nachkommen, dass in Zukunft das Parlament auch im Sommer mit gutem Beispiel vorangeht und Leistung für Österreich erbringt. Ich ersuche um Ihre Zustimmung. (Beifall beim BZÖ.)
21.01
Präsident Fritz Neugebauer: Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Ich darf uns alle an etwas erinnern, dass die nun zu Ende gehende Debatte nach drei langen Plenartagen nicht der Vorgriff auf eine Brauchtumsveranstaltung ist. (Heiterkeit.) Wir sollten bitte bei allem Respekt die nächsten Tagesordnungspunkte abhandeln. (Beifall bei SPÖ, ÖVP, FPÖ und Grünen.)
Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
Ich weise den Antrag 657/A dem Verfassungsausschuss zu.
*****
Die Tagesordnung ist erschöpft. (Rufe: Wir auch!)
Kurze Debatte über Anträge auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses
Präsident Fritz Neugebauer: Wir gelangen nun zur Verhandlung über den Antrag der Abgeordneten Strache, Kolleginnen und Kollegen betreffend die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses gemäß § 33 GOG-NR zur näheren Untersuchung der politischen und rechtlichen Verantwortung im Zusammenhang mit dem Ausspionieren von Abgeordneten und deren Mitarbeitern oder politischen Funktionären durch Angehörige des Bundesministeriums für Inneres, des Bundesministeriums für Justiz und des Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport sowie über den
Antrag der Abgeordneten Dr. Cap, Kopf, Bucher, Dr. Pilz, Kolleginnen und Kollegen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Untersuchung von Abhör- und Beeinflussungsmaßnahmen im Bereich des Parlaments.
Wie bereits angekündigt, werden zunächst die Antragsteller die beiden Anträge begründen. Die daran anschließende Debatte wird unter einem durchgeführt. Beide Anträge wurden inzwischen an alle Abgeordneten verteilt.
Die beiden Anträge haben folgenden Gesamtwortlaut:
Antrag
der Abgeordneten Dr. Cap, Kopf, Bucher, Dr. Pilz, Kolleginnen und Kollegen gemäß § 33 GOG-NR auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Untersuchung von Abhör- und Beeinflussungsmaßnahmen im Bereich des Parlaments.
Die unterfertigten Abgeordneten stellen den Antrag, einen Untersuchungsausschuss im Verhältnis S : V: F : B : G = 5 : 5 : 3 :2 : 2 einzusetzen.
Gegenstand der Untersuchung:
1. Aufklärung, ob politische Mandatare in der XXIII. Und XXIV. GP gesetzwidrig überwacht wurden
2. Untersuchung des in der Sitzung des Nationalrates am 10. 7. 2009 erhobenen Vorwurfs der Anstiftung zur Bespitzelung von Personen im politischen Umfeld des Parlaments sowie der tatsächlichen Bespitzelung dieses Personenkreises durch Organe der Republik auf Grund von Ersuchen von Mandataren
und
3. Aufklärung darüber, welche Erkenntnisse die Sicherheitsbehörden über versuchte Einflussnahmen ausländischer Geheimdienste in der XXIII. und XXIV. GP auf aktive und ehemalige Mitglieder des Nationalrates besitzen
Untersuchungsauftrag:
Der Untersuchungsausschuss soll durch die Anwendung aller in der VO-UA vorgesehenen Instrumente zum Untersuchungsgegenstand, insbesondere durch die Vorlage von Akten der Bundesministerien für Inneres und Justiz sowie von Akten der Justizbehörden sowie durch die Anhörung von Auskunftspersonen, die den Gegenstand der Untersuchung bildenden Umstände ermitteln.
Gemäß § 33 verlangen die unterfertigten Abgeordneten die Durchführung einer Debatte.
*****
Antrag
der Abgeordneten Strache, Vilimsky und weiterer Abgeordneter
betreffend die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses gemäß § 33 GOG-NR zur näheren Untersuchung der politischen und rechtlichen Verantwortung im Zusammenhang mit dem Ausspionieren von Abgeordneten und deren Mitarbeitern oder politischen Funktionären durch Angehörige des Bundesministeriums für Inneres, des Bundesministeriums für Justiz und des Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport
Die unterzeichneten Abgeordneten stellen den Antrag, einen Untersuchungsausschuss im Verhältnis SPÖ: 5, ÖVP: 5, FPÖ: 3, BZÖ: 2, GRÜNE: 2 einzusetzen.
Gegenstand der Untersuchung:
Untersuchung der politischen und rechtlichen Verantwortung der Bundesministerin für Inneres, der Bundesministerin für Justiz und des Bundesministers für Landesverteidi-
gung und Sport im Zusammenhang damit, ob Angehörige des Bundesministeriums für Inneres, des Bundesministeriums für Justiz und des Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport Abgeordnete und deren Mitarbeiter oder politische Funktionäre ausspioniert haben und es dadurch zu Rechtsverletzungen, insbesondere zu Grundrechtsverletzungen von Abgeordneten und deren Mitarbeitern oder politischen Funktionären gekommen ist seit dem Jahr 2004 sowie der Grüne Spitzel- und Datenmissbrauchsskandal.
Dabei sind insbesondere folgende Punkte zu behandeln:
1. Aufklärung, ob und zu welchem Zweck Abgeordnete, Mitarbeiter oder politische Funktionäre im Rahmen der Tätigkeit des BIA oder anderer Bundeseinrichtungen ausspioniert worden sind;
2. Aufklärung, welche Abgeordneten im Rahmen der Tätigkeit des BIA oder anderer Bundeseinrichtungen, zur Umgehung der Rechtsvorschriften über die Immunität, als Zeuge geführt wurden und so überwacht worden sind;
3. Aufklärung, ob es in den letzten Jahren politisch motivierte widerrechtliche Untersuchungen unter Umgehung des Immunitätsrechts gegeben hat;
4. Aufklärung, ob es im Rahmen der Tätigkeit des BIA oder anderer Bundeseinrichtungen zu gesetzlich nicht gedeckten Überwachungsmaßnahmen insbesondere gegen Abgeordnete, Mitarbeiter oder politische Funktionäre gekommen ist;
5. Aufklärung, ob das Büro für Interne Angelegenheiten (BIA) oder andere Bundeseinrichtungen für parteipolitische Zwecke missbraucht worden sind;
6. Aufklärung, ob es im Rahmen der staatsanwaltschaftlichen Aufträge an die Sicherheitsbehörden – insbesondere das BIA – und der dazugehörigen Vorgänge innerhalb des Justizressorts zu unsachlichen Differenzierungen je nach Betroffenem in der Vorgangsweise kam;
7. Aufklärung, ob Angehörige des BMI, des BMJ und des BMLVS gegen Abgeordnete, Mitarbeiter oder politische Funktionäre amtsmissbräuchlich tätig geworden sind;
8. Aufklärung, ob sich mehrere Angehörige eines oder mehrerer Bundesministerien sich politisch motiviert zu einer Gruppe zusammengeschlossen haben, um Abgeordnete, Mitarbeiter oder politische Funktionäre ausspionieren zu können;
9. Aufklärung, ob und von wem Angehörige des BMI, des BMJ und des BMLVS zum Amtsmissbrauch angestiftet wurden;
10. Aufklärung, ob und zu welchem Zweck Abgeordnete, Mitarbeiter oder politische Funktionäre von Angehörigen des BMI, des BMJ und des BMLVS ausspioniert worden sind;
11. Aufklärung, ob und zu welchem Zweck Angehörige des BMI, des BMJ und des BMLVS durch Missbrauch der Infrastruktur und Logistik einer öffentlichen Dienststelle gegen Abgeordnete, Mitarbeiter oder politische Funktionäre Recherchen durchgeführt haben;
12. Aufklärung, ob und zu welchem Zweck Angehörige des BMI, des BMJ und des BMLVS von wem Gegenleistungen für die Überwachung oder Recherche erhalten haben;
13. Aufklärung, in wie weit politische Funktionäre und deren Mitarbeiter im Kabinett des Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport von Angehörigen des BMI, des BMJ und des BMLVS ausspioniert worden sind;
14. Untersuchung der rechtlichen und politischen Verantwortlichkeit im Zusammenhang mit den genannten Sachverhalten.
Untersuchungsauftrag:
Der Untersuchungsausschuss soll durch die Anwendung aller in der VO-UA vorgesehenen Instrumente zum Untersuchungsgegenstand und durch Einsicht in sämtliche Akten, und sonstige Unterlagen des Bundesministeriums für Inneres, des Bundesministeriums für Justiz und des Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport im Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegenstand sämtliche Sachverhalte auf rechtliche und politische Verantwortlichkeiten prüfen.
Begründung:
Die Überwachung und Bespitzelung von Politikern und ihrem Umfeld war schon einmal Thema im Hohen Haus und führte unter anderem zum Untersuchungsausschuss betreffend die Vertuschung von Polizeiaffären und des Missbrauchs der politischen Macht insbesondere im Bundesministerium für Inneres, aber auch in den Bundesministerien für Justiz, für Finanzen und für europäische und internationale Angelegenheiten, welcher aber im Herbst des Vorjahres auf Grund der Beendigung der Gesetzgebungsperiode noch vor Prüfung der wesentlichsten Untersuchungsgegenstände auslief.
Da es nun wieder zu mehreren skandalösen Vorfällen kam, ist die Aufklärung dieser Sachverhalte unumgänglich.
Fall 1:
Den folgenden Briefen ist zu entnehmen, dass Nationalratsabgeordneter Ing. Peter Westenthaler im Zuge einer Einvernahme als Zeuge durch das Büro für Interne Angelegenheiten feststellen musste, dass hinsichtlich seines Telefonanschlusses seitens der Staatsanwaltschaft Wien eine Rufdatenrückerfassung veranlasst wurde. Alle Gespräche an dem genannten Tag wurden somit von dieser Rufdatenrückerfassung aufgezeichnet und zwar ohne sein Wissen und unter Umgehung der Immunität, die er als Abgeordneter zum Nationalrat inne hat.
Dieser Fall ist durch Schreiben vom 9. Februar 2009 an die Staatsanwaltschaft Wien und durch Schreiben vom 9. Juli 2009 von Nationalratspräsidentin Mag. Prammer dokumentiert.
Der Nationalrat wurde in diesem Zusammenhang weder informiert noch sonst irgendwie befasst.
„Der Standard" vom 10.07.2009 berichtete unter der Überschrift „Politiker-Handys nicht immun – Dass Justiz und Polizei auf Westenthalers Daten zugreifen durften, macht Sorgen“ unter anderem folgendes:
„() Das Büro für interne Angelegenheiten bestätigte den Vorgang, sieht aber kein Fehlverhalten bezüglich der Überprüfung der Telefon-Ein- und Ausgänge Westenthalers. BIA-Chef Martin Kreutner erklärte, man habe lediglich im Auftrag der Staatsanwaltschaft gehandelt und diese habe auf Nachfrage zugesichert, dass das zulässig sei. ()“
Die Überwachung des Nationalratsabgeordneten Peter Westenthaler stellt einen Demokratieskandal ersten Ranges dar und erschüttert den Rechtsstaat in seinen Grundfesten. Vor diesem Hintergrund ist die Aussage und das Verhalten des Leiters des Büros für Interne Angelegenheiten mehr als alarmierend.
Fall 2:
Der angeführte Mail-Verkehr des Abgeordneten Öllinger mit Herrn Uwe Sailer, seines Zeichens Kriminalbeamter, ehemaliger Gruppenführer der IT-Gruppe im Landeskriminalamt Oberösterreich und Gerichtssachverständiger für das Fachgebiet forensische Datensicherung, spiegelt die Versuche Nationalratsabgeordnete der FPÖ, wie zum Beispiel die Nationalratsabgeordneten Strache und Fichtenbauer, und deren Mitarbeiter sowie politische Funktionäre der FPÖ zu bespitzeln und auszuspionieren wider.
Der Verdacht liegt nahe, dass hiebei Angehörige des Bundesministeriums für Inneres, eben Herr Sailer, amtsmissbräuchlich gegen Abgeordnete des Nationalrates sowie gegen weitere Personen der Freiheitlichen Partei tätig geworden sind.
Wenn man einen Blick auf das Beschlussprotokoll der Klubleitung der Grünen vom 7. Jänner 2009 wirft, ist die dort vorgegebene Linie ganz klar ersichtlich. So sind auch die Kampagnen der Grünen gegen den ehemaligen Bundesminister Platter und auch gegen die Bundesministerin für Inneres Fekter nach diesem System abgeführt worden.
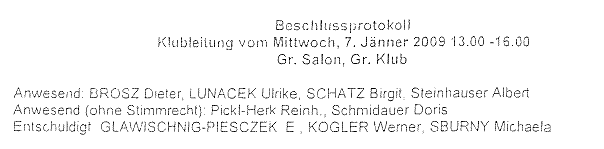
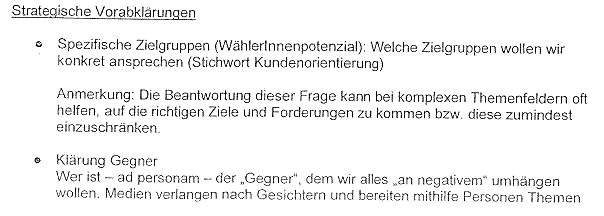
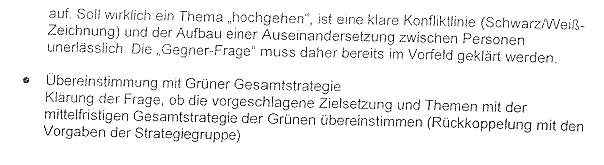
Unter anderem wurden dem Freiheitlichen Parlamentsklub folgende Dokumente zugespielt:
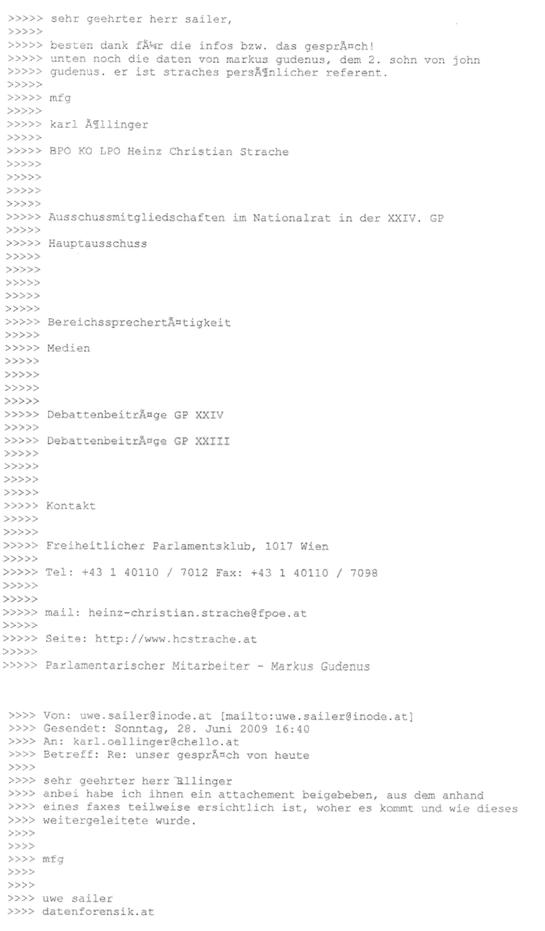
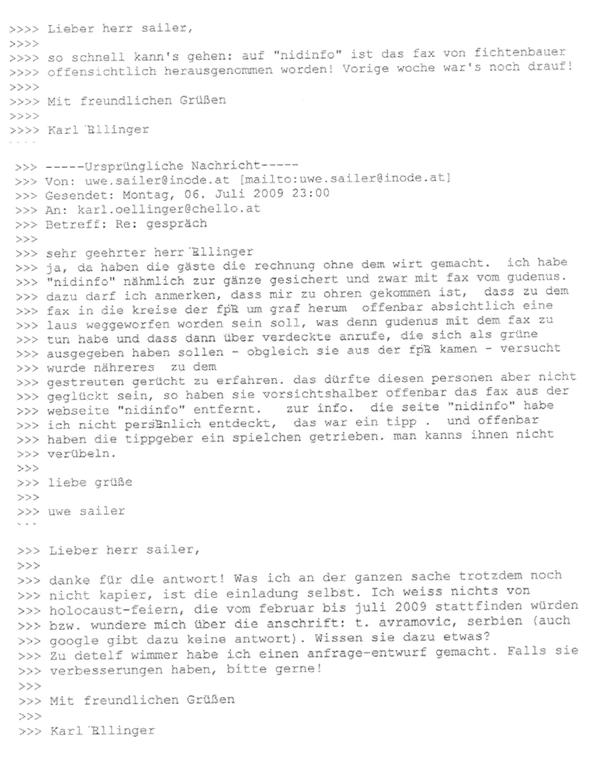
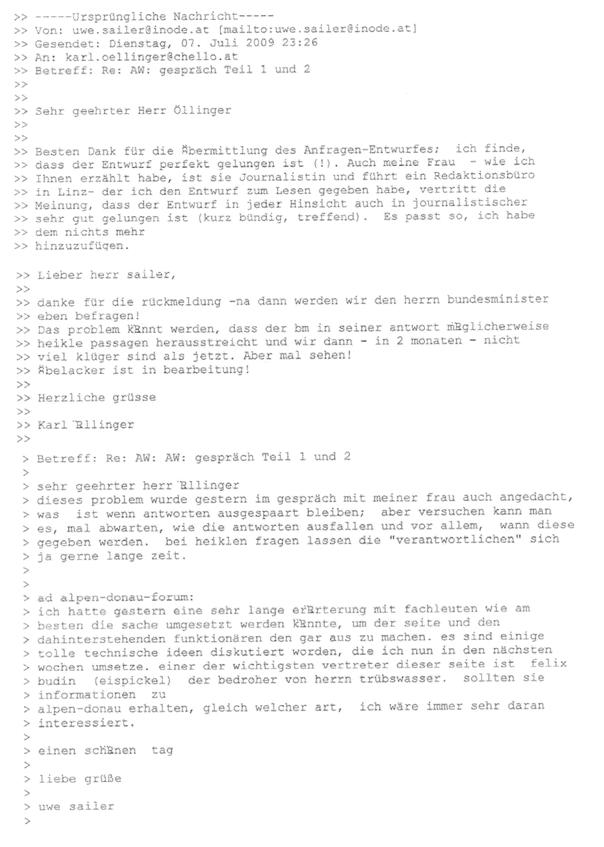
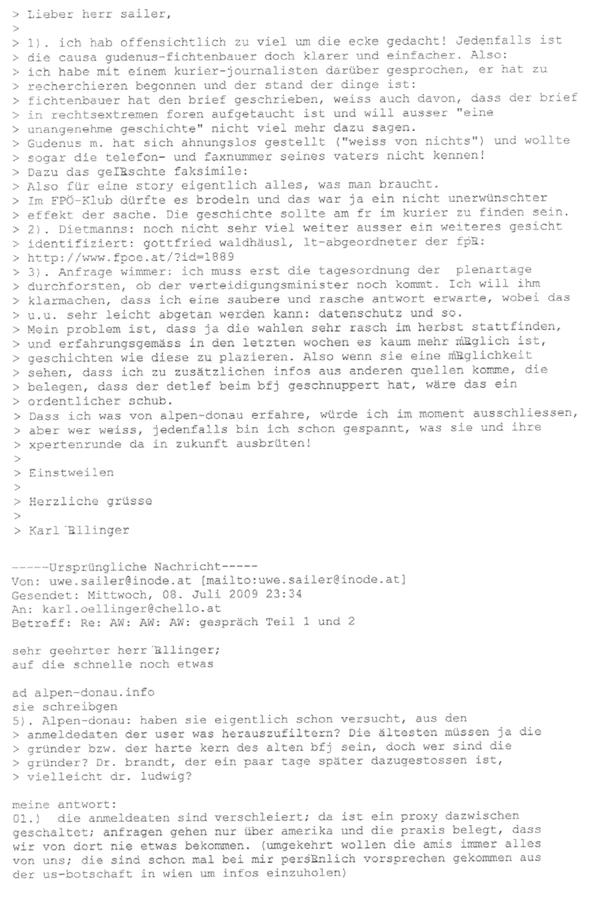
Diese Dokumente beweisen, dass es zu einer systematischen Ausspionierung von Politikern gekommen ist und zwar im Auftrag von Grün-Abgeordneten Öllinger.
Dabei wurde der staatliche Apparat offenkundig missbraucht.
Dieser Sachverhalt wird auch durch eine Pressemeldung (APA218) vom 10. Juli 2009 bestätigt:
„() Der Grüne Peter Pilz meinte auf die Vorwürfe Straches sarkastisch, er "danke" diesem, dass er zeige, dass das Innenministerium "ein Instrument der Grünen ist". Die FPÖ werde nun Gelegenheit haben, dies auch darzulegen. Zu den FPÖ-Vorwürfe gegen Öllinger merkte Pilz an, dass der Grüne Sozialsprecher lediglich einer privaten Forensik-Firma von Uwe S. einen Auftrag erteilt habe. Öllinger selbst war für eine Stellungnahme gegenüber der APA vorerst nicht erreichbar. ()“
Über Herrn Sailer steht in der Zeitschrift „kriminalpolizei“ Ausgabe 4/2006 folgendes zu lesen:
„() Der EDV-Spezialist
Nun, jeder Kenner der Vorgänge in der Alpenrepublik weiß, dass dies nicht die ganze Wahrheit ist. Wie der Fall eines Linzer Kriminalbeamten zeigt: Uwe Sailer, Jahrgang 1956, war bei der Bundespolizeidirektion Linz, Gruppe Betrug und Wirtschaftsdelikte, tätig. Im Jahr 1996 wurde klar, dass man Spezialisten für das Auswerten von Computerdaten bei der Kripo braucht. Uwe Sailer interessierte sich für die Thematik und begann eine umfangreiche Ausbildung zum Datensicherer. Er belegte Kurse für Computerforensik beim BMI sowie bei zahlreichen Privatunternehmen, die auf Datensicherung spezialisiert sind. Besonders im nördlichen Europa gibt es langjähriges Know-how über das professionelle Finden und Aufbereiten von Computerdaten für Gerichtsverfahren. Teile der Kurse wurden im Ausland durchgeführt. Als Abrundung seiner Ausbildung studierte Sailer einige Semester Jus und Informatik.
Sailer im Gespräch mit der „Kriminalpolizei“: „Man muss diesen Job lieben, um erfolgreich zu sein. Permanente Weiterbildung ist auch selbstverständlich, da sich die Computertechnologie rasend schnell entwickelt. Wichtig ist vor allem, unter der Unmenge an gespeicherten Daten, die für das Gerichtsverfahren wesentlichen Daten zu sichern und klar verständlich auszuwerten.“
Sachverständiger für Datenforensik
Sailer war seit 1997 ausschließlich als Datensicherer tätig und konnte bei zahlreichen Straftaten wesentlich bei der Aufklärung mithelfen. Außer den klassischen IT-Delikten wie Betrug und Wirtschaftskriminalität, wurde Sailer auch bei OK-Fällen und sogar bei Suchtgiftfällen beigezogen. Sailer wurde 2001 zum Gruppenführer bestellt. Seine professionelle Arbeit führte dazu, dass er immer öfter von den Gerichten als Sachverständiger zugezogen wurde. 2003 wurde er schließlich zum ersten gerichtlich beeideten Sachverständigen für Datenforensik bestellt.
Doch dann kam der 1. Juli 2005. Und die Polizeireform. Die Leitungsfunktion der IT-Gruppe im Landeskriminalamt Oberösterreich war zu besetzen. Aber: kein einziger Datensicherer aus einer Polizeidirektion wurde für fähig befunden, der neuen Truppe anzugehören. Es kamen ausschließlich Ex-Gendarmen zum Zug.
Uwe Sailer dazu: „Zuerst wurde mir mitgeteilt, dass ich zu intelligent sei, danach wurde mir vorgeworfen, nicht teamfähig zu sein.“
Waren die Kriminalisten der Gendarmerie alle „fachlich besser“? Ein Personalvertreter der ehemaligen BPD-Linz berichtet, dass es bei den Verhandlungen ein sehr gutes Einvernehmen zwischen dem schwarzen Gendarmeriegewerkschafter Kepic und der
ebenfalls ÖVP-nahen Führungsspitze, General Josef Holzinger (Ex-Gendarm) und dessen Stellvertreter Generalmajor Pilsl gegeben hat. Für den Nicht-Gendarmen und parteilosen Uwe Sailer keine guten Voraussetzungen auf einen adäquaten Posten. So hat es auch von der Personalvertretung keinen Einspruch gegen die Besetzung der IT-Gruppe gegeben.
Sailer arbeitet nun bei der Gruppe Fahndung und Assistenzleistung des SPK-Linz. Wo seine jahrelange und kostspielige Ausbildung nutzlos ist! Er verlor seine Bewertung als Gruppenführer und ist als einfacher Sachbearbeiter eingestuft. Der Dienstgeber ist am Fachwissen von Uwe Sailer offenbar nicht interessiert, die Gerichte sind es umso mehr. Uwe Sailer ist immer noch der einzige Gerichtssachverständige für Datenforensik in Österreich. Und fertigt in dieser Funktion Gutachten über die Arbeit seiner Nachfolger im Landeskriminalamt an.
Uwe Sailer ist, wie man hört, bei weitem nicht der einzige Polizist, der durch den großen Rost gefallen ist. Ähnliche unschöne Vorgänge gab es quer durch Österreich. Es wird noch eine Weile dauern, bis die „Patchworkfamilie Polizei“ ihre internen Machtkämpfe überstanden hat und endlich wieder die Arbeit im Mittelpunkt steht.“
Des Weiteren findet sich Herr Sailer auch in der Liste der Gerichtssachverständigen:
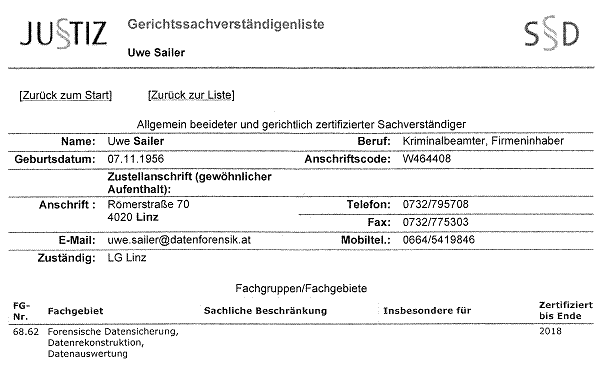
Fall 3:
Im Mai 2008 wurde durch das Abwehramt im Kabinett von Verteidigungsminister Darabos die Manipulation eines Telefonapparats entdeckt. Im "Profil" vom 23. März 2009 wurde der Verdacht geäußert, dass andere Mitarbeiter des Abwehramts den Telefonapparat des Kabinettsmitarbeiters, es handelte sich um den Pressesprecher des Ministers, Answer Lang, manipuliert haben.
„Die Presse" vom 26. März 2009 berichtete, dass der Telefonapparat derart manipuliert worden war, dass es sich höchstwahrscheinlich um interne Spionage gehandelt hat. Im Falle eines Anrufs bei Answer Lang schaltete sich bei ihm die Freisprechanlage ein,
ohne dass es Lang sehen konnte. Wenn Lang einen wichtigen Termin hatte musste ihn der „Spion“ lediglich anrufen und durfte nach dem Gespräch nicht auflegen. Man konnte das Gespräch im Raum mithören.
Fall 4:
Am 30. Juni 2009 berichtete die Zeitung „Heute“ von einem Einbruch im so genannten „Haus des Sports“ in der Prinz Eugen Strasse 12. Dort hat Verteidigungsminister Darabos nun sein Büro. Auch im Büro des Ministers wurde eingebrochen. Es soll sich um Profis gehandelt haben. Das Büro im „Haus des Sports“ ist nicht nach denselben Sicherheitsvorschriften gesichert wie das Verteidigungsministerium selbst. Da sich Verteidigungsminister Darabos die meiste Zeit im Haus des Sports aufhält, ist laut „Heute“ zu befürchten, dass Spione versucht haben könnten dort an militärische Geheimnisse gelangen zu können.
Fall 5:
OTS0265 5 II 0329 PWR0001 Do, 09.Jul 2009
„Wiener Zeitung: Unterbergers Tagebuch: "Vorsicht Staatsanwalt"
Und jetzt werden auch noch die Telefonate von Abgeordneten überwacht. Weil ein Polizist mit einem oppositionellen Volksvertreter über Polizeieinsätze geredet haben soll. Wenn so etwas schon bei Abgeordneten möglich ist, sollte sich niemand wundern, was insgeheim so alles bei Anwälten, Priestern oder Journalisten überwacht wird.
Die Staatsanwälte im Raum Wien sind zur Gefahr für den Rechtsstaat geworden - auch wenn das aus Angst vor ihrer seit der Strafprozessreform vermehrten Macht nur wenige auszusprechen wagen. Dies zeigt neben den kontrollierten Telefonaten des (in anderen Zusammenhängen zweifellos unerquicklichen) Peter Westenthaler auch die Strafverfolgung gegen einen weiteren Oppositionspolitiker, nämlich (den in anderen Zusammenhängen ebenfalls unerquicklichen) Martin Graf. Anlass war ein banaler arbeitsrechtlicher Konflikt mit parteipolitischem Hintergrund. Graf hatte sich gegen seine Entlassung in Seibersdorf gewehrt und im darauf folgenden Vergleich eine Entschädigung erhalten. Etwas, was tausende Male passiert, worin aber die rund um Wien stramm rot geführte Staatsanwaltschaft - bisher als einzige - ein Strafdelikt sieht.
Dass deren seltsame Aktionen besonders oppositionelle Gruppen treffen, konnte man auch in Wiener Neustadt beobachten. Dort wurde mit sehr aggressiven Methoden gegen radikale Tierschützer (gewiss eine ebenfalls ungustiöse Gruppe) vorgegangen - doch bisher ohne brauchbares Ergebnis.
In dieses Sündenregister der StA gehört weiters der (erst später vom Gericht gestoppte) Gutachter in der Causa Meinl, der bestellt worden war, obwohl er schon vorher seine höchst einseitige Meinung zu Meinl publiziert hatte. Und der auch keineswegs ein Experte in der Sache war.
Überaus bereitwillig eingestellt haben die dem Justizministerium unterstellten Staatsanwälte hingegen das Verfahren gegen einen der früheren Justizministerin nahestehenden Mann, der Urkunden manipuliert haben dürfte. Obwohl die Anzeige von einer Richterin gekommen war. Von Amtswegen!
Ein Jahr lang verhindert haben die Wiener Staatsanwälte schließlich alle Erhebungen gegen weitere Täter im Fall Kampusch, obwohl eine hochrangige Kommission (mit immerhin zwei früheren Präsidenten von Höchstgerichten) dies dringend empfohlen hat. Wer hütet den Rechtsstaat vor seinen Hütern?“
Auf Grund des Auftretens von mehreren Fällen der Bespitzelung in der letzten Zeit und auf Grund der hier angeführten Informationen ist ein Untersuchungsausschuss, wel-
cher die Aufgabe hat, Vorgänge im Bereich der Vollziehung zu untersuchen, zur Überprüfung der damit im Raum stehenden Ausspionierungen, Überwachungen und Bespitzelungen von Abgeordneten, Mitarbeitern und anderen politischen Funktionären unumgänglich, da nur so wieder ein Vertrauen in die Demokratie und den Parlamentarismus in diesem Land hergestellt werden kann.
Nach Aufklärung dieser bedenklichen Umstände ist es unabdingbar, den vollständigen Schutz von Abgeordneten vor jeglicher Umgehung der Immunität und sonstiger Überwachung, durch geeignete gesetzliche Maßnahmen im Hohen Haus umzusetzen. Des Weiteren sind auch amtsmissbräuchliche willkürliche Überwachungen und Bespitzelungen von Mitarbeitern und politischen Funktionären durch Angehörige von Bundesbehörden auf parlamentarischer Ebene strenger zu regeln.
In formeller Hinsicht verlangen die unterfertigten Abgeordneten gem. § 33 Abs.1 GOG, über diesen Antrag eine kurze Debatte durchzuführen.
*****
Präsident Fritz Neugebauer: Wir gehen in die Debatte ein.
Im Sinne des § 57a Abs. 1 der Geschäftsordnung beträgt die Redezeit in dieser Debatte 5 Minuten, wobei die Erstredner zur Begründung jeweils über eine Redezeit von 10 Minuten verfügen.
Zum Antrag der Abgeordneten Strache, Kolleginnen und Kollegen erhält zunächst Herr Klubobmann Strache das Wort. – Bitte.
21.04
Abgeordneter Heinz-Christian Strache (FPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrte Damen und Herren! Es ist gut, wenn sich dieses Hohe Haus mit Entwicklungen auseinandersetzt, die heute schon Behandlung gefunden haben.
Wir erleben in den letzten Wochen und Monaten Entwicklungen, wo wir von Spitzelskandalen in Österreich sprechen müssen: die Causa Westenthaler auf der einen Seite, aber es gibt auch Unterlagen und Dokumente, die uns übermittelt worden sind, die ein Beleg für einen Spitzenskandal sind, der auch in den grünen Reihen seinen Ausgang genommen hat mit Abgeordnetem Öllinger, wo heute Abgeordneter Peter Pilz hier im Plenum – auch mittels Protokoll belegbar – zugegeben hat, dass es konkrete Aufträge von Abgeordnetem Öllinger an den Kripo-Beamten Uwe Sailer gegeben hat und damit auch die Bestätigung heute an diesem Podium heraußen – auch von Peter Pilz – diesbezüglich gegeben wurde. (Präsidentin Mag. Prammer übernimmt den Vorsitz.)
Ich finde es schön, dass offenbar Personen und Persönlichkeiten im grünen Klub mit dieser Vorgangsweise nichts zu tun haben wollen und auch nicht damit leben können, dass Grund- und Freiheitsrechte mit Füßen getreten werden und daher offenbar auch bei diesem Spiel nicht mehr mitmachen. (Beifall bei der FPÖ.)
Mit diesen, von uns heute veröffentlichten Unterlagen wird dokumentiert, dass die Grünen in dem Fall Beamte des Innenministeriums kontaktiert haben, auch beauftragt haben, gegen politische Mitbewerber zu recherchieren, Anfragen zu redigieren, Informationen weiterzuleiten und offensichtlich auch sensible Daten zu sammeln und zu übermitteln. Und da ist ganz klar und deutlich im Raum stehend, dass es sich hier um einen Amtsmissbrauch, Datenmissbrauch, Datenklau und auch Anstiftung dazu handeln dürfte. (Abg. Öllinger: Ja, Datenmissbrauch!)
Die grüne Unverfrorenheit, die heute noch erlebt werden konnte, war jene, das Ganze als einen harmlosen privaten Auftrag an einen zufälligen Beamten des Innenministeriums zu richten, den man privat beauftragt hat, der ja eigentlich nur beeideter Gerichtssachverständiger für Forensik sei, und das Ganze sozusagen herunterzuspielen. Das ist mehr als lächerlich, peinlich und absurd.
Der Kripo-Beamte Uwe Sailer ist in seinem Hauptberuf Beamter des Innenministeriums, war bis vergangenes Jahr auch im Bereich des Verfassungsschutzes tätig, hat da auch, wie gesagt, eine Unvereinbarkeit gelebt, die ganz klar dokumentiert ist.
Natürlich wird man das alles zu überprüfen haben. Diese gesamte Entwicklung wird hoffentlich überprüft. Wir haben einen Antrag für einen Untersuchungsausschuss formuliert, der von uns eingebracht wird.
Wir wollen diesen grünen Spitzenskandal auch voll und ganz aufgedeckt wissen. Ich schließe heute auch nicht mehr aus, dass es da Netzwerke vonseiten der Grünen gibt, die viel tiefer gehen als das, was bis dato vorliegt.
Ich schließe nicht aus, dass es nicht nur einzelne Beamte im Bereich der Exekutive, der Kripo geben kann, sondern dass eventuell auch bis in den Bereich des BIA hinein einzelne Beamte mitwirken, bis hinein auch in den Bereich von Persönlichkeiten in der Staatsanwaltschaft.
Ich denke, dass wir all das beleuchten sollten, wenn ich mir die letzten Monate vergegenwärtige, von gestohlenen Laptops von Ministeriumsbeamten, was der Fall war, bis hin, dass Einbrüche in einem Ministerbüro stattgefunden haben, eine Verwanzung eines Ministerbüros stattgefunden hat, bis hin, dass eine Handtasche der Innenministerin gestohlen wurde, bis hin, dass es politisch motivierte Einbrüche in Büros von Abgeordneten und politischen Parteien gegeben hat (Abg. Öllinger – aufzeigend –: Hier!), bis hin, dass bei der Wochenzeitung „Zur Zeit“ eingebrochen wurde, um offenbar Daten zu erhalten. (Abg. Brosz: .... hat in sein eigenes Büro eingebrochen!)
So glaube ich bei all diesen politisch motivierten Handlungen, die hier doch zu vermuten sind, nicht mehr ganz an einen Zufall, bis hin, dass auch Strasser-E-Mails aus einem Netz gestohlen wurden und dann zufälligerweise bei Peter Pilz auftauchen und plötzlich der Öffentlichkeit übermittelt werden können.
Bis hin, dass ein EDV- und IT-Experte, der jetzt Kripo-Beamter ist, eben auch wahrscheinlich eventuell einen Zugriff auf EKIS-Daten und andere sensible Daten haben könnte, wo man gar nicht weiß, inwieweit es hier eine Rückverfolgungsmöglichkeit gibt. (Abg. Mag. Kogler: EKIS und FPÖ – das passt!)
Das alles wird aber zu untersuchen sein. Das alles sind Ansammlungen von Vorfällen, die einen politischen Hintergrund haben und wo man nicht an Zufall glauben kann, dass das alles so zufällig in dieser Republik passiert.
Es ist daher notwendig – da gibt es Handlungsbedarf in unserem Land –, dass wir nicht zu einer Bananenrepublik verkommen, wo vielleicht einige wenige Beamte in unterschiedlichsten Bereichen im Justiz- und Sicherheitsapparat eventuell aus parteipolitisch motivierten Gründen abseits des Rechtsstaates agieren und Handlungen setzen.
So etwas hat verhindert zu werden, so etwas hat ausfindig gemacht zu werden und so etwas hat abgestellt zu werden in unserem Land! Das ist auch die Intention. Ich gehe auch davon aus, dass dieses Wollen in diesem Haus da ist, auch in den Ressorts – ich sage bewusst, in den Ressorts des Justizministeriums, des Innenministeriums bis hinein ins Verteidigungsministerium – dem nachzugehen und solche Entwicklungen abzustellen, damit so etwas in Zukunft nicht mehr vorkommen kann. (Beifall bei der FPÖ.)
Wir haben in dieser Causa jetzt auch eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschat wegen Amts- und Datenmissbrauch übermittelt. Ich denke auch, dass da durchaus das neue Anti-Korruptionsgesetz Anwendung finden kann.
Wenn das, was Peter Pilz heute bestätigt hat, stimmt, nämlich ein Auftrag erteilt worden ist, vielleicht noch privat, und durch diesen Auftrag auch noch Geld an den Beamten geflossen sein dürfte, dann ist dies durchaus etwas, was auch das Anti-Korruptionsgesetz berühren kann und berühren wird. (Abg. Mag. Kogler: Ist das ein politisch motivierter Hörfehler? Wie soll man das behandeln?)
Einen grünen Privatauftrag gegenüber einem Mitarbeiter des Innenministeriums, um Informationen für Bespitzelung und allfällig geschützte Daten über politische Mitbewerber in Erfahrung zu bringen, als private harmlose Angelegenheit darzustellen, ist wirklich besonders kühn.
Ich denke, dass diese Punkte, die wir heute auch der Öffentlichkeit präsentiert haben, bis zum Fall Peter Westenthaler, durchaus mehr als dazu geeignet sind, den Eindruck zu vermitteln, dass es sich dabei nur um die Spitze eines Eisbergs handeln könnte. Wir wollen hier völlige Aufklärung. Es kann nicht angehen, dass Freiheits- und Grundrechte mit Füßen getreten werden. Es kann nicht angehen, dass Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Es kann nicht angehen, dass sich vielleicht innerhalb des Sicherheitsapparats ein paar wenige Personen verselbständigen und hier aus politischen Motiven abseits des Rechtsstaates tätig werden. Da braucht es volle Aufklärung, da kann und darf man auch keinen Bereich ausnehmen. Da ist maximale Aufklärung das Gebot der Stunde, das Gebot unseres Rechtsstaates, wenn es darum geht, dass die Demokratie zu schützen ist und auch der Rechtsstaat zu schützen ist. (Beifall bei der FPÖ.)
Ein bisschen hat man schon den Eindruck, dass der Herr Öllinger der Erich Mielke des österreichischen Parlaments mit diesen Stasi-Methoden sein könnte, die er da zum Besten gegeben hat. (Beifall bei der FPÖ.)
Aber wir haben daher auch einen Antrag für einen Untersuchungsausschuss formuliert, der genau den Anforderungen entsprochen hat, die eigentlich Klubobmann Karlheinz Kopf vorgegeben hat, nämlich sehr dezidiert auch Punkte herauszuarbeiten, die man überprüfen sollte.
Ich bin daher verwundert, dass man jetzt von diesem Vorschlag abgekommen ist, wenn ich mir den Antrag der Koalitionsparteien ansehe, der eigentlich nicht dezidiert formuliert ist, sondern sehr weitflächig formuliert ist und alles möglich macht. Das ist interessant, wir sind sehr gespannt darauf, wie dann auch das Abstimmungsverhalten ausgehen wird.
Ich hoffe auf eine tiefgreifende Untersuchung, damit all diese Dinge aufgedeckt werden können. Im Übrigen ist ja auch in diesen Dokumenten, die uns übermittelt wurden, eine Passage vorhanden, wo unter anderem vom Herrn Sailer an den Herrn Öllinger mitgeteilt wird, dass es üblich ist, dass wir alle Informationen an die amerikanischen Dienste richten, aber das umgekehrt leider Gottes nicht der Fall ist.
Das ist auch der Bezug, den wir heute aufgrund dieser Unterlagen und Dokumente über die APA mitgeteilt und dokumentiert haben, nicht irgendwelche anderen künstlich kreierten Darstellungen, die heute Herr Dieter Brosz der Öffentlichkeit mitgeteilt hat.
Für uns steht eines fest: Hier ist einfach Gefahr in Verzug. Hier hat völlige Aufklärung stattzufinden. Ich denke, dass damit auch das Verhalten der Grünen aufgedeckt ist – genau Ihr Strategiepapier, das Sie vor wenigen Monaten in Ihrem Klub besprochen haben, wo dokumentiert wird, wie Sie vorzugehen gedenken. Die Schwarzweißmalerei, die Sie in diesem Strategiepapier vorgenommen haben, wo Sie gesagt haben, Sie müssen die politischen Gegner definieren und anpatzen, so nach dem Prinzip, es wird
schon irgendetwas hängen bleiben! Das sind genau diese Methodiken, die Sie seit Monaten leben. (Abg. Krainer: Das steht im FPÖ-Papier!)
Ich denke, da sind Sie weit darüber hinausgegangen. Sie haben nicht nur Denunzierung und Diffamierung und Manipulation gelebt, sondern Sie haben einen Spitzelskandal zu verantworten, der seinesgleichen in der Zweiten Republik sucht. Ich kenne keinen Nationalratsabgeordneten, der jemals so gehandelt hätte wie Sie, Herr Öllinger. Sie sind rücktrittsreif! Sie sollten hier Verantwortung auch leben – aber ich bin es gewohnt von Ihrer Seite, dass Sie das alles in Abrede stellen und herunterzuspielen versuchen. (Beifall bei der FPÖ. – Präsidentin Mag. Prammer gibt das Glockenzeichen.)
Ich komme daher zum Schluss. Ich ersuche Sie, heute unserem Antrag für diesen Untersuchungsausschuss auch die Zustimmung zu erteilen, damit wir weitflächig und auch wirklich in allen Bereichen eine Aufklärung herbeiführen und eben nicht – ich sage jetzt – so einen breitgefächerten Antrag der Regierungsparteien unterstützen, der in Wirklichkeit einiges ausnehmen wird. (Beifall bei der FPÖ.)
21.14
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zu Wort gemeldet ist nun als Begründer des zweiten Antrages Herr Klubobmann Dr. Cap. Ich stelle die Uhr wunschgemäß freiwillig auf 5 Minuten. – Bitte.
21.14
Abgeordneter Dr. Josef Cap (SPÖ): Ich möchte einmal vorausschicken, dass das eine Chance für das ganze Parlament ist, ein Beweis aber auch dafür, dass es ein sehr lebendiges Parlament ist, dass es rasch reagieren kann, dass man im Stande ist, hier einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, dafür eine große Mehrheit, vielleicht sogar Einstimmigkeit zu erreichen und dass dann, wenn man diesen Ausschuss so konzipiert, dass er wirklich schnell, präzise seine Arbeit verrichtet, meiner Meinung nach auch wir beweisen können, dass wir handlungsfähig sind, dass uns Grundrechte ein ganz entscheidendes Anliegen sind und dass wir damit auch der Bevölkerung signalisieren sollten, dass es hier nicht nur um uns geht, sondern dass es eigentlich um die ganze Bevölkerung geht, denn es kann ja jedem passieren. Es kann sich hier nicht nur auf Abgeordnete beschränken, im Endeffekt kann das jeden betreffen.
Man muss daher auch in Zukunft sehr sorgfältig damit umgehen, wenn man hier im Haus über Instrumentarien diskutiert, die die Möglichkeiten zur Bekämpfung von bestimmter Kriminalität und von bestimmten Formen des Verbrechens erweitern. Da muss man immer auf die Grundrechte und Menschenrechte ganz sorgfältig Rücksicht nehmen. Das ist einmal ein ganz wesentlicher Punkt. (Beifall bei der SPÖ.)
Ein zweiter wesentlicher Punkt dabei ist das, worum es letztlich gegangen ist. Man darf nicht über einen Umweg gehen, denn wenn jemand beschuldigt wird, der der Immunität als Abgeordneter unterliegt, dann muss man ein gewisses Verfahren in Gang setzen. Wenn man plötzlich eine anonyme Anzeige vorliegen hat, dann über den Weg einer Zeugeneinvernahme Telefonverbindungen überwacht, in den Erhebungen an diese Kontakte herankommen will, dann ist das eine Vorgangsweise, die nachdenklich macht.
Wenn nämlich zugleich dieser Abgeordnete zum Beispiel in einem Untersuchungsausschuss ist und man möchte herausfinden, welche Kontakte er hat – und auf diese Art und Weise kann man das möglicherweise herausfinden, so wie es anscheinend der Fall war –, dann muss ich sagen, ist das natürlich auch eine Attacke gegen das Parlament, seine Kontrollrechte und die Möglichkeit, hier in einem Untersuchungsausschuss ordentlich zu arbeiten.
Da finde ich, das ist wirklich noch allemal ein Grund, das im Rahmen eines Untersuchungsausschusses genau zu untersuchen, genauestens zu untersuchen, auch dann allfällige gesetzliche Änderungen durchzuführen. Außerdem muss man auch herausfinden, ob das ein Einzelfall war. War das ein Einzelfall oder ist es System? Gibt es mehrere Abgeordnete, die davon betroffen waren – wo auch immer? Da ist hier ein breites Feld – und deswegen haben wir das auch so formuliert, Herr Klubobmann Strache –, um diese Untersuchungen auch durchzuführen. Ich meine, es wird auch ein Reifezeichen sein, wenn man hier erfolgreich zu einem Ergebnis kommt.
Ein weiterer Punkt in diesem Antrag ist: Eine Fraktion wirft einer anderen Fraktion vor, dass man einen Beamten aufgefordert hat, ein Mitglied einer anderen Fraktion oder mehrere Mitglieder einer anderen Fraktion zu bespitzeln, letztendlich ein Bespitzelungssystem aufzubauen. Das ist ein schwerwiegender Vorwurf und ist daher auch ein Grund dafür, dass dieser Untersuchungsausschuss zu Recht eingesetzt wird, denn auch dieser Punkt ist sehr genau zu untersuchen. Daher bin ich sehr, sehr froh darüber, dass dieser Punkt ebenfalls in diesem Antrag enthalten ist.
Der dritte Punkt betrifft Hinweise – vermutete Hinweise –, dass ausländische Geheimdienste auf Abgeordnete eingewirkt haben, gewisse Anfragen einzubringen. Im Wesentlichen ist das genauso eine wesentliche Sache, denn hier geht es auch um das Interpellationsrecht. Ich finde, das ist ein ganz wesentliches Recht, das wir hier im Hause haben, das es zu schützen gilt. Zugleich ist aber wichtig, dass das, wenn es diese Vorwürfe gibt, hier ebenfalls untersucht wird. Daher wird das erst im dritten Punkt ebenfalls aufgearbeitet.
Ich glaube, das Hohe Haus hat hier eine Aufgabe zu erfüllen. Der Ausschuss, der permanent erklärt wird, hat hier eine Aufgabe zu erfüllen, die sehr, sehr wichtig ist, die aber etwas über unseren Kreis hinaus signalisieren sollte. Es soll nicht so ausschauen, als ob wir uns das richten, wenn wir betroffen sind, aber wenn es die Bürgerinnen und Bürger betrifft, dann reagieren wir nicht so schnell. Das soll dann dazu führen, dass, wenn hier unsere Arbeit erfolgreich beendet ist, entsprechende Konsequenzen folgen – sei es gesetzlicher Natur oder entsprechende Sensibilitäten, die auch künftige Instrumentarien für die Exekutive, für die Justiz oder sonst wo betreffen.
Das ist ganz entscheidend: Es geht um die Grundrechte der Republik und die haben wir im höchsten Maße zu respektieren! (Beifall bei SPÖ, ÖVP, BZÖ und Grünen.)
21.19
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Die Redezeit der nunmehr zu Wort gemeldeten Abgeordneten beträgt jeweils 5 Minuten. Herr Klubobmann Kopf gelangt nun zu Wort. – Bitte.
21.20
Abgeordneter Karlheinz Kopf (ÖVP): Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Hohes Haus! Wir haben als Repräsentanten des Volkes hier besondere Aufgaben zu erfüllen, Gesetzgebung, Kontrolle auszuüben. Wir haben das unabhängig und unbeeinflusst zu tun; dazu genießen wir unter anderem Immunität – zu Recht.
Und jetzt stehen Vorwürfe im Raum, dass einerseits im Rahmen von Erhebungen gegen Dritte auch Überwachungen von Abgeordneten durchgeführt worden seien. Es ist schon darauf verwiesen worden und auch heute in der Präsidiale darüber diskutiert worden, dass es hier möglicherweise einen Bereich der Rechtsunsicherheit oder sogar eine Lücke im Gesetz gibt. Dazu haben wir einvernehmlich auch einen Ausschuss oder eine Kommission eingesetzt, die das besprechen und allenfalls auch Gesetzesänderungen vorschlagen soll.
Es steht ein zweiter Vorwurf im Raum: jener der Einflussnahme ausländischer Geheimdienste – keine Kleinigkeit! – auf Abgeordnete dieses Hauses.
Und es steht ein dritter Vorwurf im Raum, nämlich der Vorwurf der Bespitzelung von Abgeordneten durch Abgeordnete.
Ganz abgesehen davon, dass meines Erachtens mit Sicherheit, nachdem das Ganze unter Zuhilfenahme eines hochrangigen Beamten im Kriminaldienst geschehen sein soll, disziplinäre Maßnahmen anstehen, rufen all diese drei Vorwürfe dringend nach einer Untersuchung, weil wir einerseits aufgrund unserer besonderen Stellung und aufgrund unserer besonderen Aufgabenstellung diese Unabhängigkeit, die für die Ausführung unserer Aufgaben notwendig ist, auch in besonderem Maße schützen müssen. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
Und ein Zweites, meine Damen und Herren: Als Repräsentanten des Volkes, die wir mit einer Sonderstellung ausgestattet sind, haben wir auch eine besondere Verantwortung, nämlich eine Verantwortung, unsere Glaubwürdigkeit zu schützen und unsere Glaubwürdigkeit zu pflegen. Und seien wir alle miteinander ehrlich: Wir tun doch viel zu oft auch Dinge, die unserer Glaubwürdigkeit nicht besonders gut tun. Ich meine nicht nur Debatten über Sommerpausen und Ähnliches – das sind ja noch die gelinderen Dinge, auch wenn sie unsinnig sind –, aber so manche Aktionen, die wir setzen, so manche Äußerungen, die wir machen, sind nicht dazu angetan, die Glaubwürdigkeit dieses Hauses zu gewährleisten und der Bedeutung der Aufgabe, die wir hier erfüllen, auch wirklich gerecht zu werden.
Darum haben wir uns selbstverständlich darum bemüht, diesen Untersuchungsausschuss zustande zu bringen, weil es darum geht, uns einerseits in unserer Unabhängigkeit zu schützen, und andererseits auch die Glaubwürdigkeit von uns allen zu schützen oder notfalls wieder herzustellen.
Ich kann Ihnen abschließend aus einer kurzen OTS unserer Innenministerin Maria Fekter zitieren: „Aus tiefem Respekt vor dem Rechtsstaat und dem österreichischen Parlament wollen wir gemeinsam für Transparenz und Klarheit arbeiten.“
Das ist unser Auftrag mit diesem Untersuchungsausschuss. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der SPÖ.)
21.24
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Nun gelangt Herr Abgeordneter Vilimsky für 5 Minuten zu Wort. – Bitte.
21.24
Abgeordneter Harald Vilimsky (FPÖ): Frau Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Seit heute Vormittag steht aufgrund einer Äußerung des Abgeordneten Pilz fest, dass der Abgeordnete Öllinger einen Datenforensiker beauftragt hat – ich stelle es nochmals fest: beauftragt hat! –, Materialien über die Freiheitliche Partei und ihre Mandatare zu sammeln.
Um uns allen einmal bewusst zu machen, was Datenforensik ist, bringe ich Ihnen Folgendes zur Kenntnis:
Digitale Forensik behandelt die Untersuchung von verdächtigen Vorfällen im Zusammenhang mit IT-Systemen unter Feststellung des Datenbestandes und der Täter durch Erfassung, Analyse und Auswertung digitaler Spuren in Computersystemen. Mittlerweile ist die Untersuchung von Computersystem auch im Zusammenhang mit herkömmlichen Verbrechen, aber auch für Zwecke der Steuerfahndung etabliert.
Herr Öllinger, so jemanden haben Sie beauftragt! Jemanden mit einer Firma, die datenforensik.at heißt, jemanden, der bis vor Kurzem ein Spezialist des Verfassungs-
schutzes für Datenforensik war, und jemanden, der jetzt immer noch Kriminalpolizist ist.
Wenn der Herr Abgeordnete Pilz sagt, dass der Abgeordnete Öllinger beauftragt hat, Materialien zu sammeln, und das eine gewerbliche Firma ist, heißt es, dass Geld geflossen ist. Und ist Geld geflossen, sind wir bei der Anstiftung zum Amtsmissbrauch. Und genau das werden wir untersuchen, Herr Öllinger!
Wenn man Österreicher ist und hört, dass heute ein Spionageausschuss im Parlament beschlossen wird: Ich weiß nicht, was man sich da denkt als Frau oder Herr Österreicher. Dass da vielleicht irgendeine James Bond-Geschichte im Hohen Haus läuft. Normalerweise, in den klassischen James Bond-Filmen, gibt es den Blofeld; das ist der Bösewicht. Der hat seit heute ein Gesicht und einen Namen: Das ist der Herr Öllinger. Aber ich weiß nicht, ob Ihnen nicht vielleicht „Der Spion, der aus der Kälte kam“ sympathischer wäre. Das ist politisch aus Ihrer Sicht vielleicht auch korrekter als der von mir zuvor gewählte Vergleich.
Erinnern wir uns an die Untersuchungsausschüsse der vergangenen Legislaturperiode, wo von einer Fraktion immer auch viel Enthusiasmus an der Sache dabei war: Das waren Sie, das war die SPÖ. Sie haben gesagt: Untersuchen wir im Bereich der Eurofighter, untersuchen wir im Bereich des Bankenwesens! Am Anfang gab es wirklich eine tolle und gute Untersuchung, und der Herr Finanzstaatssekretär a.D. Matznetter hat da wertvolle Arbeit geleistet.
Nur kam plötzlich irgendwo zutage, in beiden Bereichen hängt die SPÖ tief drinnen, sowohl in der Eurofighter-Sache (Widerspruch bei der SPÖ) – ich sage nur Rapid und die Zahlung, die da geflossen ist – als auch im Bankwesen, und auf einmal wird das Ganze abgedreht! Da gibt es entweder Neuwahlen oder die ganze Geschichte wird abgedreht.
Und einer Sache werden wir auch noch auf die Spur zu gehen haben. Herr Abgeordneter Cap, den ich an sich sehr schätze, weil er jemand ist, der das Gespräch sucht, hält heute hier fest, dass ein Untersuchungsgegenstand jener sein wird, dass nachrichtendienstliche Aktivitäten in ihrem Einfluss auf Mandatare zu untersuchen sein werden; da geht es um Anfragen und da geht es um Einflussnahmen. Was ich nicht verraten darf: dass es Überlegungen und Gespräche dieser Art vielleicht gegeben hat, das aber alles strikteste Verschlusssache war. Das heißt, irgendjemand von den roten Mitgliedern muss da geplaudert haben. – Und ich sage nur am Rande: An sich steht Haft auf das Plaudern aus einem solchen Gremium. Aber es wird auch das zu klären sein.
Es wird sehr viel zu klären sein. Wenn wir bei Spionage sind, können wir bis hin zum Zilk gehen, obwohl mir das nicht gefällt. Wir können bis zu den Grünen gehen und einmal schauen, wer in der Jugend den Status eines informellen Mitarbeiters des DDR-Systems hatte, weil Sie alle in Ihrer Jugend tiefrote marxistische und kommunistische Wurzeln hatten, und das immer noch in Ihrem Handeln und in Ihrem Denken zutage kommt. (Beifall bei der FPÖ.)
Worüber wir sicher auch nicht die Decke des Schweigens breiten dürfen und können, ist die Sache des Herrn Abgeordneten Westenthaler, wo ich wirklich meine, dass da die Grundfesten der Zweiten Republik, unseres Verfassungsgefüges erschüttert wurden, wenn ein Mandatar im Schutz der Immunität mit einem Trick in eine Zeugenrolle manövriert wird und dann plötzlich im Visier von Abhöraktivitäten ist. Bis heute schulden uns das Innenministerium und der Herr Kräuter die Liste jener Politiker, gegen die ermittelt wurde, die Liste jener Politiker, gegen die möglicherweise auch abgehört wurde.
Das alles wird zu untersuchen sein. Und bei den Nachrichtendiensten, Herr Klubobmann Cap und auch in Richtung ÖVP, wird zu untersuchen sein, wie eigentlich die Behörden mögliche Informationspflichten gegenüber diesem Hohen Haus und den Mandataren verletzt haben. (Beifall bei der FPÖ. – Präsidentin Mag. Prammer gibt das Glockenzeichen.)
Sie haben die Gelegenheit, mit unserem Antrag wirklich Licht in die Sache zu bringen. Stimmen Sie ihm zu! – Danke. (Beifall bei der FPÖ.)
21.29
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Abgeordneter Vilimsky! Ich möchte nur, dass eine Sache nicht im Raum stehen bleibt. Nur so viel: Das, was in Punkt 3 dieses Antrages steht, habe ich offiziell von der Frau Innenministerin erfahren, und ich habe mit der Frau Innenministerin vereinbart, dass ich darüber auch die Mitglieder der Präsidialkonferenz informiere. Hier gab es keine Indiskretionen. Das wollte ich nur klarstellen. (Abg. Vilimsky: Das kann ja nicht sein, dass Sie informell das jetzt bekannt geben! Sie können sich jetzt nicht zusammensetzen mit der Frau Innenminister und ...!)
Herr Abgeordneter, Informationen der Frau Innenministerin sind keine informellen Informationen!
Als Nächster zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Mag. Stadler.
21.30
Abgeordneter Mag. Ewald Stadler (BZÖ): Frau Präsidentin! Hohes Haus! Zunächst zu den Fakten.
Frau Präsidentin Prammer hat der Frau Bundesminister für Justiz und der Innenministerin einen Brief geschrieben, hat Aufklärung verlangt. Diese Briefe sind heute eingelangt, und diese Briefe sind für mich ein weiterer Beleg für die Notwendigkeit dieses Ausschusses.
Zunächst zum Brief der Frau Dr. Fekter. – Frau Dr. Fekter berichtet, am 13. November 2008 hätte es einen Anfallsbericht des BIA an die Staatsanwaltschaft Wien gegeben im Zusammenhang mit der beabsichtigten Überwachung des Handys des Kollegen Westenthaler.
Am 17. November, also vier Tage später, datiert eine Anfragebeantwortung an die sozialdemokratische Fraktion, wo die Frau Innenministerin sagt, es ist überhaupt kein Mitglied des Untersuchungsausschusses, der damals getagt hat – und der damalige Klubobmann Westenthaler hat diesem Untersuchungsausschuss angehört –, irgendeiner Telefonüberwachung unterzogen worden.
Das heißt, das BIA wusste, dass es Westenthalers Handy überwacht, nämlich Rufdatenerfassung betreibt, aber die Frau Innenministerin erfährt davon gar nichts. (Ruf beim BZÖ: Oder doch!) Oder sie erfährt es, aber dann hätte sie die Sozialdemokraten und damit das Hohe Haus falsch informiert. Ich nehme das Erste an. Ich nehme das Erste an, weil ich weiß, wie in diesem Apparat gearbeitet wird.
Erster Punkt, warum hier eine Untersuchung erforderlich ist: Wie ist es möglich, dass eine so sensible Abteilung des Innenministeriums die eigene Ministerin falsch oder gar nicht informiert? – Das ist der erste Punkt.
Zweiter Punkt: Wir haben aus der brieflichen Beantwortung der Frau Innenministerin erfahren, dass dieses Handy gar nicht auf den Kollegen Westenthaler zugelassen war, sondern auf den BZÖ-Parlamentsklub, weil er Klubobmann war.
Nun ist aber dem Herrn Staatsanwalt bis dorthin immer noch nicht aufgefallen, dass das einen politischen Zusammenhang haben könnte, wenn ein Bundesparteiobmann,
ein Klubobmann, ein Abgeordneter zum Nationalrat mit einem Handy einer Parlamentsfraktion überwacht werden soll! (Abg. Dr. Schüssel: Dann fällt der Vorwurf in sich zusammen!) – Nein, der fällt nicht in sich zusammen, denn die Staatsanwaltschaft hätte in dem Moment sofort alle Ermittlungsschritte einstellen und sofort den Immunitätsausschuss des Parlaments anrufen müssen, meine Damen und Herren! – Hat sie aber nicht gemacht! (Beifall bei BZÖ und Grünen. – Abg. Dr. Schüssel: Dann ist das kein Vorwurf!)
Selbstverständlich ist das ein Vorwurf! (Abg. Dr. Schüssel: Da gilt Ihr Vorwurf ja gar nicht!) Die Staatsanwaltschaft hat in diesem Land gemeinsam mit ihrem Spitzel BIA ein Eigenleben entwickelt, und dieses Eigenleben gilt es zu untersuchen. Auffällig ist, dass dieses Eigenleben immer gegen Oppositionsabgeordnete entwickelt wird, dann aber, wenn es um Regierungsabgeordnete oder um regierungsnahe Vertreter geht, plötzlich eine „Totenstarre“ eintritt. Das ist das Problem, das dahintersteht, meine Damen und Herren. (Beifall beim BZÖ.)
Die Frau Justizminister hat mitgeteilt, dass aufgrund des Umstandes, dass der Kollege Westenthaler am 9. Februar die Staatsanwaltschaft anschreibt und sagt: Ich möchte Auskunft darüber, welche Überwachungsmaßnahmen auf meinem Handy stattgefunden haben! – das hat er nämlich erst an dem Tag erfahren ... (Abg. Dr. Schüssel: Das war ja gar nicht sein Handy!) – Das von ihm benutzte Handy! Sie haben völlig recht, Herr Bundeskanzler außer Dienst. (Heiterkeit.) Na, das ist ja großartig! Ich bin dafür, dass der Herr Bundeskanzler außer Dienst die Staatsanwaltschaft und das BIA übernimmt, denn er ist wirklich präzise. Er ist der Einzige in diesem Haus, meine Damen und Herren, der die Präzision erfunden hat. Ich werde mich bemühen, besonders präzise zu sein.
Also: Bei dem vom Kollegen Westenthaler benutzten Handy, das auf den BZÖ-Parlamentsklub zugelassen war, wurde eine Rufdatenerfassung gemacht. Er verlangt Auskunft von der Staatsanwaltschaft, und die Staatsanwaltschaft antwortet nicht einmal, obwohl sie nach dem Auskunftspflichtgesetz verpflichtet gewesen wäre, innerhalb von acht Wochen zu antworten, und nach der Strafprozessordnung hätte sie nach Beendigung der Überwachungsmaßnahmen den Betreiber dieses Handys, nämlich den BZÖ-Parlamentsklub und damit den Klubobmann Westenthaler, informieren müssen. – Ist aber nicht geschehen.
Dann sagt die Frau Justizministerin, dass die Überwachungsmaßnahmen gegen eine andere Person, nämlich gegen eine verdächtige Person, gerichtet gewesen seien und der Kollege Westenthaler somit keinen Anspruch auf Immunitätsschutz hätte. – Das ist objektiv unrichtig. Die Überwachungsmaßnahme hat sich nicht gegen den Verdächtigen gerichtet, sondern gegen den Zeugen, meine Damen und Herren. Und man benutzt die Zeugenstellung, um gegen den betreffenden Abgeordneten vorzugehen, um ihn am Schluss zum Beschuldigten zu machen. Das ist der Hintergrund dieses Vorganges, meine Damen und Herren! (Beifall beim BZÖ.)
Letzter Punkt: Die Frau Präsidentin verlangt von der Frau Justizministerin Auskunft darüber, ob gegen weitere Abgeordnete des Parlaments entsprechende vergleichbare Maßnahmen durchgeführt wurden. Wissen Sie, was die Frau Justizministerin zurückschreibt? – Ich will gar nicht sagen, dass sie den Brief entworfen hat. Den hat man ihr hingehalten, aber sie hat ihn leider unterschrieben.
Es wird geantwortet, dass in dem konkreten Ermittlungsverfahren 503 UT 1/09 z – Herr Kollege Schüssel, zum Mitschreiben! – der einzige Abgeordnete Peter Westenthaler gewesen sei. Über alle anderen potenziellen Überwachungsmaßnahmen, nach denen die Frau Präsidentin auch gefragt hat, ist keine Silbe verloren worden.
Die Frau Präsidentin wurde heute von der Präsidialkonferenz ersucht, einen neuerlichen Brief dort hinzuschreiben, um endlich das zu erfahren, was sie schon im ersten Brief haben wollte, meine Damen und Herren. Für wie dumm hält man eigentlich im Justizministerium die Vertreter dieses Hauses, meine Damen und Herren? (Beifall bei BZÖ, Grünen und FPÖ. – Präsidentin Mag. Prammer gibt das Glockenzeichen.) Das sind alles Dinge, die nach einem Untersuchungsausschuss schreien!
Frau Präsidentin! Gestatten Sie mir noch einen Schlusssatz.
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Abgeordneter, ich habe Ihnen jetzt wirklich viel Überzeit gegeben. Ich kann Ihnen diese Sekunde nicht mehr geben, weil Sie bereits eine Minute drüber sind.
Abgeordneter Mag. Ewald Stadler (fortsetzend): Die Reaktion des Staatsanwaltes Jarosch heute lautet, dass er dem Kollegen Westenthaler eine Freundin unterstellt, meine Damen und Herren. Und das einem verheirateten Familienvater! Das ist ein ungeheuerlicher Vorwurf! Das ist ungeheuerlich! (Beifall beim BZÖ. – Hö-Rufe bei der SPÖ.)
21.36
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Dr. Pilz. 5 Minuten Redezeit. – Bitte.
21.36
Abgeordneter Dr. Peter Pilz (Grüne): Meine Damen und Herren! Bevor ich zu Vorfällen im freiheitlichen Klub komme, die am heutigen Tag stattgefunden haben, noch einige grundsätzliche Bemerkungen.
Ich bin froh, dass dieser Untersuchungsausschuss mit großer Mehrheit in diesem Haus eingesetzt wird, weil wir damit signalisieren, dass wir ein gemeinsames Problem des Parlaments auch gemeinsam lösen wollen.
Wichtig an diesem Untersuchungsausschuss ist zweierlei: zum Ersten die penible Untersuchung der Vorwürfe, und zum Zweiten – wahrscheinlich wichtiger als bei anderen Untersuchungsausschüssen – die Empfehlungen, eine klare Antwort auf die Frage: Wie kann das Vertrauen von Menschen, die sich an Abgeordnete wenden und davon ausgehen, dass ihr Vertrauen geschützt ist, wie kann dieses Vertrauen durch die Präzisierung von Gesetzen, die wir beschließen können – und das sind nicht nur Gesetze über die Immunität –, wieder hergestellt und gestärkt werden?
Es geht ja nicht primär um den Schutz von Abgeordneten – Abgeordnete sind im Grunde nicht so schlecht geschützt –, es geht um den Schutz des Vertrauens der Bevölkerung, die sich – und das sind nicht nur Beamte und Beamtinnen, und nicht nur zur Bekämpfung von Machtmissbrauch und Missständen – an die Abgeordneten dieses Hauses wendet. Diese Menschen dürfen nicht den Eindruck haben, dass sie in eine Abhörfalle tappen, weil ein Staatsanwalt dieses Vertrauen für ein Leck in der Verwaltung hält, das es zu stopfen gilt. Das ist der erste wichtige Punkt. Und deswegen erwarte ich mir sehr, sehr klare Empfehlungen eines sehr zügig – und ich sage gleich dazu: auch über den Sommer – arbeitenden Untersuchungsausschusses.
Zweitens: Zu den Ermittlungen von – nennen wir es einmal „00Vilimsky – im Auftrag Ihrer Strachität“. (Heiterkeit. – Abg. Dr. Graf: Sie wissen, wer Namensverunglimpfung gemacht hat? 70 Jahre her, die Zeit!) Ich entnehme einer OTS der Freiheitlichen Partei, es sollen Kontakte mit fremden Diensten zur Informationsbeschaffung gegen freiheitliche Politiker aufgeklärt werden. Das soll aufgeklärt werden.
Herr Kollege Vilimsky, Sie wissen es genauso gut wie ich: Das Einzige, was hier nicht stimmt, ist das Wort „gegen“. Nicht gegen freiheitliche Politiker, sondern durch freiheit-
liche Politiker. (Abg. Strache: Das ist wieder typisch!) Darum geht es. Und das beschäftigt Sie schon den ganzen Tag, ja einige Tage. Und Sie wissen, dass Sie nicht verhindern können, dass das im Untersuchungsausschuss jetzt sehr genau besprochen wird. (Abg. Vilimsky: Auf das freue ich mich aber!) Und wir freuen uns gemeinsam, Herr Kollege Vilimsky, auf die Aufklärung dieses sehr heiklen Punktes (Abg. Dr. Graf: Das schauen wir uns an!), weil es keine Kleinigkeit ist, wenn der Vorwurf – jetzt einmal nur von der FPÖ – im Raum steht, Abgeordnete dieses Hauses hätten im Interesse ausländischer Nachrichtendienste und direkt für ausländische Nachrichtendienste gearbeitet, und zwar als Abgeordnete in diesem Haus. (Abg. Strache: „Gearbeitet“?!)
Das wollen wir untersuchen, weil uns die Freiheitliche Partei mit ihrer Presseaussendung heute auf diese heiße Spur gebracht hat. (Abg. Strache: Das ist ja alles nur mehr lächerlich! Haben Sie sich eingeraucht vorher, oder was?)
Und jetzt, Herr Strache, habe ich noch eine letzte Frage an Sie: Sie haben eine Mitarbeiterin in Ihrem Klub, Frau Michaela Gruber; sie ist EDV-Koordinatorin. Wir haben überprüft: Sie hatte gestern und heute keinen Termin im grünen Klub. Mitarbeiter haben bei uns im Klub, hier im Haus, ihre Zutrittsberechtigung gefunden. (Ruf bei der FPÖ: Wahrscheinlich haben sie sie gestohlen!) – Was hat in dem Zeitraum, in dem wir uns die Frage stellen, wie die E-Mails aus dem grünen Klub zu Ihnen gekommen sind (Abg. Strache: Geh bitte! Geh bitte!), Ihre Mitarbeiterin im grünen Klub getan? Klären Sie das auf, Herr Abgeordneter Strache! (Abg. Strache: Das ist ja lächerlich! Haben Sie sie der Frau Gruber gestohlen?)
Unsere Mitarbeiter gehen nur in den freiheitlichen Klub, wenn sie dort einen Termin haben, sonst nicht. Klären Sie das auf! Sie werden das sicherlich auf eine vernünftige Art und Weise aufklären können. Ihre Mitarbeiterin hat mit dieser Erklärung jederzeit die Möglichkeit, während der Dienststunden ihre Zutrittsberechtigung bei unserem Klubdirektor abzuholen.
Wenn etwas aufzuklären ist, dann sind es genau solche Fragen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch diese Frage behandeln. Aber wichtiger ist, dass wir die gemeinsame Frage klären: Gibt es einen Schutz der Abgeordneten dieses Hauses vor Bespitzelung? – Und ich bin mir sicher, der Untersuchungsausschuss wird diese Frage beantworten können. – Danke sehr. (Beifall bei den Grünen. – Abg. Strache: Das ist eine schwache Nummer! Eine wirklich peinliche Nummer!)
21.42
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. (Abg. Dr. Graf: Den Ausweis kann er aber schon zurückgeben! Den kann er nicht vorenthalten!)
Was die Frage des Ausweises betrifft, so ist das eine Angelegenheit der Sicherheitsstellen in unserem Haus. (Abg. Strache: Zur Geschäftsordnung, bitte!)
Herr Abgeordneter Strache zur Geschäftsbehandlung. – Bitte.
21.42
Abgeordneter Heinz-Christian Strache (FPÖ) (zur Geschäftsbehandlung): Frau Präsidentin! Also bitte, bei aller Wertschätzung: Mit einer freiheitlichen Mitarbeiter-Klubkarte kann man nicht in den grünen Klub hineingehen – erstens.
Zweitens: Umgekehrt ist es, wenn der Herr Peter Pilz die Karte nicht aushändigt, sehr wohl möglich, mit dieser Karte die Räumlichkeiten des Freiheitlichen Parlamentsklubs aufzusuchen.
Ich bitte daher sehr wohl, diese Karte abzugeben, wo immer sie gefunden wurde. Das ist der korrekte Weg. – Ich danke. (Beifall bei der FPÖ.)
21.43
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Da sich die Karte bereits hier bei mir am Pult befindet, wird es auch nicht notwendig sein, dass unsere Sicherheitsstellen im Haus dazu eingeschaltet werden.
Die Debatte ist geschlossen.
Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Abgeordneten Strache, Kolleginnen und Kollegen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses.
Ich bitte jene Damen und Herren, die dazu ihre Zustimmung geben, um ein diesbezügliches Zeichen. – Das ist die Minderheit und damit abgelehnt.
*****
Ferner lasse ich über den Antrag der Abgeordneten Dr. Cap, Kopf, Bucher, Dr. Pilz, Kolleginnen und Kollegen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses abstimmen.
Ich ersuche jene Damen und Herren, die sich dafür aussprechen, um ein Zeichen. – Das ist einstimmig angenommen.
Beschluss auf Beendigung der ordentlichen Tagung 2008/2009
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Es liegt mir folgender Antrag der Abgeordneten Dr. Cap, Kopf, Weinzinger, Brosz, Kolleginnen und Kollegen vor:
„Der Herr Bundespräsident wird ersucht, die ordentliche Tagung 2008/2009 der XXIV. Gesetzgebungsperiode des Nationalrates mit Ablauf des 13. Juli 2009 für beendet zu erklären.“
Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem Antrag ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes Zeichen. – Das ist mehrheitlich angenommen.
Anträge auf Permanenterklärung von Ausschüssen
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Gemäß § 46 Abs. 4 der Geschäftsordnung wurde von den Abgeordneten Dr. Cap, Kopf, Mag. Stefan, Bucher und Mag. Musiol ein schriftlicher Antrag sowie vor Eingang in die Tagesordnung vom Abgeordneten Scheibner ein mündlicher Antrag eingebracht.
Beide Anträge beinhalten den Auftrag an den Verfassungsausschuss, seine Arbeiten während der tagungsfreien Zeit hinsichtlich folgender Vorlagen fortzusetzen:
Antrag der Abgeordneten Dr. Peter Wittmann, Mag. Wilhelm Molterer, Dr. Walter Rosenkranz, Herbert Scheibner, Mag. Daniela Musiol, Kolleginnen und Kollegen betreffend Unterausschuss des Verfassungsausschusses „Verwaltungsreform“ (700/A)(E),
Antrag der Abgeordneten Mag. Dr. Manfred Haimbuchner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz geändert wird (286/A),
Antrag der Abgeordneten Josef Bucher, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz und das Rechnungshofgesetz geändert werden (460/A),
Antrag der Abgeordneten Josef Bucher, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz und das Rechnungshofgesetz geändert werden (461/A),
Antrag der Abgeordneten Mag. Daniela Musiol, Kolleginnen und Kollegen betreffend Erweiterung der Zuständigkeiten des Rechnungshofes (599/A)(E),
Antrag der Abgeordneten Mag. Daniela Musiol, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz geändert wird (677/A).
Ich lasse sogleich abstimmen.
Ich bitte jene Damen und Herren, die sich dafür aussprechen, dass der Verfassungsausschuss hinsichtlich der genannten Vorlagen seine Arbeit während der tagungsfreien Zeit fortsetzt, um ein entsprechendes Zeichen. – Das ist einstimmig angenommen.
*****
Ferner liegt ein Antrag der Abgeordneten Kopf, Dr. Cap, Strache, Bucher und Mag. Kogler vor, den Finanzausschuss gemäß § 46 Abs. 4 der Geschäftsordnung zu beauftragen, seine Arbeiten während der tagungsfreien Zeit fortzusetzen.
Ich lasse sogleich abstimmen.
Ich bitte jene Mitglieder, die sich dafür aussprechen, dass der Finanzausschuss seine Arbeit während der tagungsfreien Zeit fortsetzt, um ein Zeichen. – Das ist ebenfalls einstimmig angenommen.
*****
Schließlich liegt ein Antrag der Abgeordneten Kopf, Dr. Cap vor, den Untersuchungsausschuss zur Untersuchung von Abhör- und Beeinflussungsmaßnahmen im Bereich des Parlaments zu beauftragen, seine Arbeiten während der tagungsfreien Zeit fortzusetzen.
Ich lasse auch darüber sogleich abstimmen.
Ich bitte jene Damen und Herren, die sich dafür aussprechen, um ein entsprechendes Zeichen. – Das ist einstimmig angenommen.
Verlesung eines Teiles des Amtlichen Protokolls
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Es liegt mir das schriftliche Verlangen von 20 Abgeordneten vor, das Amtliche Protokoll hinsichtlich des Beschlusses auf Beendigung der ordentlichen Tagung 2008/2009 der XXIV. Gesetzgebungsperiode zu verlesen, damit dieser Teil mit Ende der Sitzung als genehmigt gilt:
„Die Abgeordneten Dr. Cap, Kopf, Brosz, Lutz Weinzinger, Kolleginnen und Kollegen legen folgenden Antrag (Beilage F) vor:
,Der Herr Bundespräsident wird ersucht, die ordentliche Tagung 2008/2009 der XXIV. Gesetzgebungsperiode des Nationalrates mit Ablauf des 13. Juli 2009 für beendet zu erklären.‘
Dieser Antrag Beilage F wird mehrstimmig (dafür: S, V, F, G) angenommen.
Es liegt ein Verlangen gemäß § 51 Abs. 6 GOG auf Verlesung des Teiles des Amtlichen Protokolls hinsichtlich des Beschlusses auf Beendigung der ordentlichen Tagung 2008/2009 vor (Beilage E).“
*****
Erheben sich Einwendungen gegen die Fassung oder den Inhalt? – Das ist nicht der Fall.
Dieser Teil des Amtlichen Protokolls gilt daher gemäß § 51 Abs. 6 der Geschäftsordnung mit Schluss der Sitzung als genehmigt.
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Ich gebe noch bekannt, dass in der heutigen Sitzung die Selbständigen Anträge 728/A bis 742/A eingebracht wurden.
Ferner sind die Anfragen 2734/J bis 2832/J eingelangt.
Schließlich ist eine Anfrage der Abgeordneten Öllinger, Kolleginnen und Kollegen, 25/JPR, an die Präsidentin des Nationalrates eingebracht worden.
Schlussansprache der Präsidentin
21.48
Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Meine Damen und Herren! Es ist so üblich, dass zu Tagungsende die Präsidentin einige Worte an Sie richtet. Sie können versichert sein, ich werde es sehr, sehr kurz halten.
Ich wollte mich an dieser Stelle nur dort einklinken, worüber gerade auch in den letzten Minuten oder in der letzten Stunde diskutiert wurde: Wir können uns ruhigen Gewissens vor unsere Wählerinnen- und Wählerschaft stellen. Der österreichische Nationalrat arbeitet fleißig!
Ich möchte das auch mit Zahlen belegen: Wir haben in dieser Tagung 89 Gesetze, davon vier Bundesverfassungsgesetze, und 22 Staatsverträge, neben vielen, vielen Entschließungsanträgen, beschlossen. Der heutige Tag ist in diesen Zahlen nicht mitgerechnet, meine Damen und Herren – ich wollte mit der Statistik dem Ausgang der heutigen Entscheidungen nicht vorgreifen.
Immerhin waren 47,2 Prozent all dieser Beschlüsse einstimmig und demgegenüber 52,8 Prozent mehrstimmig. Auch das ist ein Zeichen für das Haus, dass im Plenum und in den Ausschüssen gut gearbeitet wird.
Es gab immerhin fast 3 000 schriftliche Anfragen in dieser einen Tagung, und es hat auch 130 Ausschusssitzungen sowie 32 Unterausschusssitzungen gegeben.
Ich denke, mit dieser Statistik können wir gute Bilanz ziehen, und ich möchte das ganz besonders hervorheben, weil wir uns hier nicht selber das Leben schwer machen sollten, sondern unsere Arbeit auch transparent der Öffentlichkeit präsentieren.
Ich sehe meine Aufgabe genau darin, das zu ermöglichen, als Präsidentin Rahmenbedingungen zu schaffen – soweit es eben natürlich geht und nicht auch mir Grenzen gesetzt werden –, Ihnen das Arbeiten zu erleichtern, den Menschen den Zugang zu erleichtern, die Transparenz zu erleichtern, das Sichtbarmachen zu erleichtern. Ich glaube, die österreichische Demokratie braucht das.
Erst vor wenigen Wochen ist die sogenannte Wertestudie veröffentlicht worden. Ich habe ja Sie alle zur Präsentation dieser Wertestudie eingeladen. Einige unter Ihnen sind auch gekommen. Eines hat mich besonders erschüttert – und das war auch die Motivation, Sie einzuladen –, nämlich dass das Ansehen des Parlaments in den letzten zehn Jahren stark gesunken ist, und daran sollten wir arbeiten.
Und ich denke, da ist jede und jeder Einzelne von uns gefordert. Wir können alle unseren Beitrag leisten, besonders in unserer Streitkultur. Ich werde sehr oft von Besucherinnen und Besuchern gefragt, ich werde natürlich auch sehr oft angeschrieben, per E-Mail oder per Brief: Warum ist es denn im Plenum des Hauses so, wie es ist? – Ich versuche immer wieder darzustellen: Das ist der Parlamentarismus, das ist die Demokratie – der Streit um die besseren Argumente und das Finden von Kompromissen.
Dort, wo man keine Argumente mehr hat, ist man angelangt, wenn es eine Auseinandersetzung unter der Gürtellinie ist. Und das liegt in unserer Hand, dass wir hier nicht unter der Gürtellinie sozusagen den Austausch pflegen, sondern mit vielen, vielen guten Argumenten die besseren Argumente durchdringen lassen und gute Lösungen für die Menschen, für die Bevölkerung zustande bringen. (Allgemeiner Beifall.)
Ich möchte abschließend sehr herzlich – das gehört natürlich ganz besonders erwähnt – den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Parlamentsdirektion danken. (Allgemeiner Beifall.) Sie haben gute Arbeit, tolle Arbeit geleistet: für den Nationalrat, für den Bundesrat, aber es finden vor allen Dingen auch viele Veranstaltungen, viele Aktivitäten statt. Wir haben heuer bereits bis jetzt, bis Mitte des Jahres, mehr als 100 000 Besucherinnen und Besucher in diesem Haus begrüßt. Voriges Jahr waren es mit Jahresende 109 000. Wir werden also dieses Jahr auf eine unglaubliche Zahl kommen, und auch hier gebührt der Dank den Beschäftigten, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Ich bedanke mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Klubs (allgemeiner Beifall) und natürlich bei den parlamentarischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – das darf man auch nicht vergessen; die werden oft vergessen (allgemeiner Beifall) – sowie bei Ihnen allen, und vor allem – das habe ich mir zum Schluss aufgehoben – bei den Mitgliedern der Präsidiale. Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit. Es ist oft intensiv, aber die Arbeit macht mir Freude – hoffentlich macht sie Ihnen auch Freude. Ich werde mich jedenfalls auch in Zukunft sehr dafür einsetzen, Ihnen eine akzeptable, gute Präsidentin zu sein.
Ich wünsche Ihnen schöne Ferien! (Allgemeiner Beifall.)
21.54
*****
Die Sitzung ist geschlossen.
Schluss der Sitzung: 21.54 Uhr
|
Impressum: Parlamentsdirektion 1017 Wien |