
Stenographisches Protokoll

819. Sitzung des Bundesrates der Republik Österreich
Freitag, 5. April 2013

Stenographisches Protokoll

819. Sitzung des Bundesrates der Republik Österreich
Freitag, 5. April 2013
819. Sitzung des Bundesrates der Republik Österreich
Freitag, 5. April 2013
Dauer der Sitzung
Freitag, 5. April 2013: 9.01 – 20.08 Uhr
*****
Tagesordnung
1. Punkt: Wahl der/s ersten Schriftführerin/s für den Rest des 1. Halbjahres 2013
2. Punkt: Erklärung des Bundesministers für Landesverteidigung und Sport gemäß § 37 Abs. 4 GO-BR betreffend „Aktuelle Themen im Bereich Landesverteidigung und Sport“
3. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Wahl des Nationalrates (Nationalrats-Wahlordnung 1992 – NRWO) geändert wird
4. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das BFA-Einrichtungsgesetz, das BFA-Verfahrensgesetz, das Asylgesetz 2005, das Fremdenpolizeigesetz 2005, das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz und das Grenzkontrollgesetz sowie das Grundversorgungsgesetz – Bund 2005 geändert werden (FNG-Anpassungsgesetz)
5. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das EU-Polizeikooperationsgesetz (EU-PolKG) und das Bundesgesetz über die Einrichtung und Organisation des Bundesamts zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung geändert werden
6. Punkt: Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Republik Moldau über die gegenseitige Hilfeleistung bei Naturkatastrophen oder technischen Katastrophen und die Zusammenarbeit bei deren Prävention
7. Punkt: Bericht der Bundesministerin für Inneres an das österreichische Parlament zum Legislativ- und Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für 2013; Achtzehnmonatsprogramm des irischen, litauischen und griechischen Vorsitzes des Rates der Europäischen Union
8. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Datenschutzgesetz 2000 geändert wird (DSG-Novelle 2013)
9. Punkt: Bericht des Bundeskanzlers und der Bundesministerin für Frauen und öffentlichen Dienst an das Parlament zum Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für 2013 und zum 18-Monatsprogramm des Rates für 2013/14 gemäß Art. 23f Abs. 2 B-VG iVm § 7 EU-InfoG
10. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das Bankwesengesetz, das Börsegesetz 1989, das E-Geldgesetz 2010, das Zahlungsdienstegesetz, das Investmentfondsgesetz 2011, das Immobilien-Investmentfondsge-
setz, das Wertpapieraufsichtsgesetz 2007, das Kapitalmarktgesetz, das Ratingagenturenvollzugsgesetz, das Zentrale Gegenparteien-Vollzugsgesetz, das Pensionskassengesetz, das Versicherungsaufsichtsgesetz, das Punzierungsgesetz 2000, das Gebührengesetz 1957, das Glücksspielgesetz, die Bundesabgabenordnung, das Finanzstrafgesetz, das EU-Finanzstrafvollstreckungsgesetz, das Bundesfinanzgerichtsgesetz, das Bundespensionsamtübertragungs-Gesetz und das Rundfunkgebührengesetz geändert werden (Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz – Bundesministerium für Finanzen)
11. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Konsulargebührengesetz 1992, das Sanktionengesetz 2010, das Devisengesetz 2004 und das Nationalbankgesetz 1984 geändert werden
12. Punkt: Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein über die Zusammenarbeit im Bereich der Steuern samt Schlussakte einschließlich der dieser beigefügten Erklärungen
13. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Stiftungseingangssteuergesetz geändert wird
14. Punkt: Protokoll zur Abänderung des am 5. November 1969 in Vaduz unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen
15. Punkt: Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Chile zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und der Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt Protokoll
16. Punkt: Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik San Marino zur Abänderung des Zusatzprotokolls zum am 18. September 2009 unterzeichneten Protokoll zur Abänderung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik San Marino auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt Protokoll
17. Punkt: Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Republik Kosovo über Zusammenarbeit und gegenseitige Amtshilfe in Zollsachen samt Anhang
18. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Umsatzsteuergesetz 1994 und das Bewertungsgesetz 1955 geändert werden
19. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Verbrechensopfergesetz geändert wird
20. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz, das Opferfürsorgegesetz, das Verbrechensopfergesetz, das Impfschadengesetz und die 11. Opferfürsorgegesetz-Novelle geändert werden
21. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, das Betriebliche Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz, das Landarbeitsgesetz 1984, das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, das Arbeitsmarktservicegesetz, das Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Arbeitsverfassungsgesetz und das Betriebspensionsgesetz geändert werden (Sozialrechts-Änderungsgesetz 2013 – SRÄG 2013)
22. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Ausländerbeschäftigungsgesetz und das Behinderteneinstellungsgesetz geändert werden
23. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Behinderteneinstellungsgesetz, das Bundesbehindertengesetz, das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, das Opferfürsorgegesetz, das Heeresversorgungsgesetz, das Impfschadengesetz, das Verbrechensopfergesetz,
das Bundespflegegeldgesetz, das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, das Arbeitsmarktservicegesetz, das Arbeitsmarktförderungsgesetz, das IEF-Service-GmbH-Gesetz, das Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz 1991, das Arbeitsruhegesetz, das Arbeitszeitgesetz, das Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz 1987, das Landarbeitsgesetz 1984, das Mutterschutzgesetz 1979, das Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz, das Gleichbehandlungsgesetz, das Arbeitsverfassungsgesetz, das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, das Arbeitsinspektionsgesetz 1993 und das Produktsicherheitsgesetz 2004 geändert werden und das Bundesberufungskommissionsgesetz aufgehoben wird (Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz – Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz)
24. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, das Notarversicherungsgesetz 1972 und das Nachtschwerarbeitsgesetz geändert werden (Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz – Sozialversicherung)
25. Punkt: Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein über soziale Sicherheit
26. Punkt: Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Vorbereitenden Kommission für die Organisation des Vertrages über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen über soziale Sicherheit
27. Punkt: Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Indien über soziale Sicherheit
28. Punkt: Jahresbericht 2013 gemäß Art. 23f Abs. 2 B-VG des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz auf der Grundlage des Legislativ- und Arbeitsprogramms der Europäischen Kommission für 2013 sowie des Achtzehnmonatsprogramms des irischen, litauischen und griechischen Ratsvorsitzes
29. Punkt: Bundesgesetz über die Grundsätze
für Hilfen für Familien und Erziehungshilfen für Kinder und
Jugendliche (Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013 –
B-KJHG 2013)
30. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert wird
31. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Familienberatungsförderungsgesetz geändert wird
*****
Inhalt
Bundesrat
Schreiben des Präsidenten des Kärntner Landtages betreffend Wahl von Mitgliedern und Ersatzmitgliedern in den Bundesrat ................................................................................................................ 14
Angelobung der Bundesräte Ana Blatnik, Gerhard Dörfler, Günther Novak und Christian Poglitsch ............................................................................................................................... 15
Erklärung des Präsidenten des Ausschusses der Regionen Ramón Luis Valcárcel Siso zum Thema „Die Rolle der Regionen in einem sich schnell wandelnden Europa“ gemäß § 38a GO-BR – Bekanntgabe ............................................................................................................................... 34
Präsident Ramón Luis Valcárcel Siso ....................................................................... 35
Durchführung einer Debatte gemäß § 38a GO-BR ....................................................... 41
Redner/Rednerinnen:
Stefan Schennach ........................................................................................................ 41
Gottfried Kneifel ........................................................................................................... 44
Gerhard Dörfler ............................................................................................................ 46
Elisabeth Kerschbaum ................................................................................................ 49
Marco Schreuder .......................................................................................................... 52
Präsident Ramón Luis Valcárcel Siso ....................................................................... 53
Schreiben des Bundeskanzlers gemäß Artikel 23c Abs. 5 Bundes-Verfassungsgesetz betreffend Nominierung eines Mitgliedes des Verwaltungsrates der Europäischen Investitionsbank 58
Schreiben der Bundesministerin für Finanzen gemäß Artikel 50 Abs. 5 Bundes-Verfassungsgesetz betreffend Erteilung der Vollmacht zur Aufnahme von Verhandlungen mit Belize zum Abschluss eines Protokolls zur Abänderung des am 8. Mai 2002 unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik Österreich und Belize auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, BGBl. III Nr. 132/2003, durch den Herrn Bundespräsidenten ........................................................................................................ 60
1. Punkt: Wahl
der/s ersten Schriftführerin/s für den Rest des 1. Halbjah-
res 2013 .......................................................................................................................... 62
Personalien
Verhinderungen .............................................................................................................. 13
Aktuelle Stunde (21.)
Thema: „Initiative für Religionsfreiheit und gegen Christenverfolgung“ .......... 16
Redner/Rednerinnen:
Mag. Harald Himmer .................................................................................................... 17
Mag. Susanne Kurz ...................................................................................................... 18
Monika Mühlwerth ....................................................................................................... 22
Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger ................................................................ 24, 34
Efgani Dönmez, PMM .................................................................................................. 27
Günther Köberl ............................................................................................................. 29
Ing. Maurice Androsch ................................................................................................ 31
Cornelia Michalke ......................................................................................................... 32
Bundesregierung
Schreiben des Bundeskanzleramtes betreffend Aufenthalt eines Mitgliedes der Bundesregierung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union .............................................................. 61
Vertretungsschreiben ..................................................................................................... 62
Nationalrat
Beschlüsse und Gesetzesbeschlüsse .......................................................................... 62
Ausschüsse
Zuweisungen .................................................................................................................. 62
Verhandlungen
2. Punkt: Erklärung des Bundesministers für Landesverteidigung und Sport gemäß § 37 Abs. 4 GO-BR betreffend „Aktuelle Themen im Bereich Landesverteidigung und Sport“ ..................... 63
Bundesminister Mag. Gerald Klug ............................................................................ 63
Verlangen auf Durchführung einer Debatte gemäß § 37 Abs. 5 GO-BR ....................... 63
Debatte:
Wolfgang Beer .............................................................................................................. 69
Franz Perhab ................................................................................................................. 71
Monika Mühlwerth ....................................................................................................... 73
Marco Schreuder .......................................................................................................... 75
Christian Füller ............................................................................................................. 77
Bundesminister Mag. Gerald Klug ............................................................................ 79
3. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Wahl des Nationalrates (Nationalrats-Wahlordnung 1992 – NRWO) geändert wird (2178/A und 2213 d.B. sowie 8916/BR d.B.) ................................................................. 82
Berichterstatter: Günther Köberl .................................................................................. 82
Redner/Rednerinnen:
Mag. Bettina Rausch .................................................................................................... 82
Reinhard Todt ............................................................................................................... 84
Elisabeth Kerschbaum ................................................................................................ 85
Josef Saller ................................................................................................................... 87
Elisabeth Grimling ....................................................................................................... 88
Staatssekretär Sebastian Kurz ................................................................................... 89
Inge Posch-Gruska ....................................................................................................... 90
Annahme des Antrages des Berichterstatters, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben .................................................................................................... 90
4. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das BFA-Einrichtungsgesetz, das BFA-Verfahrensgesetz, das Asylgesetz 2005, das Fremdenpolizeigesetz 2005, das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz und das Grenzkontrollgesetz sowie das Grundversorgungsgesetz – Bund 2005 geändert werden (FNG-Anpassungsgesetz) (2144 d.B. und 2215 d.B. sowie 8914/BR d.B. und 8917/BR d.B.) ................................................................................................................. 91
Berichterstatter: Günther Köberl .................................................................................. 91
Redner/Rednerinnen:
Gerd Krusche ............................................................................................................... 91
Franz Perhab ................................................................................................................. 93
Efgani Dönmez, PMM .................................................................................................. 93
Elisabeth Reich ............................................................................................................. 94
Annahme des Antrages des Berichterstatters, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben .................................................................................................... 96
5. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das EU-Polizeikooperationsgesetz (EU-PolKG) und das Bundesgesetz über die Einrichtung und Organisation des Bundesamts zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung geändert werden (2143 d.B. und 2214 d.B. sowie 8918/BR d.B.) ...................................................................................... 96
Berichterstatter: Walter Temmel .................................................................................. 96
Redner/Rednerinnen:
Elisabeth Kerschbaum ................................................................................................ 96
Mag. Klaus Fürlinger ................................................................................................... 97
Johann Schweigkofler ................................................................................................. 97
Annahme des Antrages des Berichterstatters, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben .................................................................................................... 98
6. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Republik Moldau über die gegenseitige Hilfeleistung bei Naturkatastrophen oder technischen Katastrophen und die Zusammenarbeit bei deren Prävention (2135 d.B. und 2216 d.B. sowie 8919/BR d.B.) ............................................................................... 98
Berichterstatter: Walter Temmel .................................................................................. 98
Redner/Rednerinnen:
Günther Köberl ............................................................................................................. 99
Stefan Schennach ...................................................................................................... 100
Annahme des Antrages des Berichterstatters, 1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben und 2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen ......................................... 102
7. Punkt:
Bericht der Bundesministerin für Inneres an das österreichische Parlament
zum Legislativ- und Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission
für 2013; Achtzehnmonatsprogramm des irischen, litauischen und
griechischen Vorsitzes des Rates der Europäischen Union
(III-480-BR/2013 d.B. sowie 8920/BR d.B.) ................................ 102
Berichterstatter: Walter Temmel ................................................................................ 102
Redner/Rednerinnen:
Gerd Krusche ............................................................................................................. 102
Dr. Angelika Winzig .................................................................................................... 104
Stefan Schennach ...................................................................................................... 105
Elisabeth Kerschbaum .............................................................................................. 106
Annahme des Antrages des Berichterstatters, den Bericht III-480-BR/2013 d.B. zur Kenntnis zu nehmen ............................................................................................................................. 109
8. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Datenschutzgesetz 2000 geändert wird (DSG-Novelle 2013) (2131 d.B. und 2245 d.B. sowie 8940/BR d.B.) ............................................................................................................................. 109
Berichterstatter: Josef Saller ...................................................................................... 109
Redner/Rednerinnen:
Marco Schreuder ........................................................................................................ 109
Adelheid Ebner ........................................................................................................... 111
Georg Keuschnigg ..................................................................................................... 111
Hermann Brückl ......................................................................................................... 112
Staatssekretär Dr. Josef Ostermayer ...................................................................... 113
Annahme des Antrages des Berichterstatters, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben .................................................................................................. 115
9. Punkt: Bericht des Bundeskanzlers und der Bundesministerin für Frauen und öffentlichen Dienst an das Parlament zum Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für 2013 und zum 18-Monatsprogramm des Rates für 2013/14 gemäß Art. 23f Abs. 2 B-VG iVm § 7 EU-InfoG (III-483-BR/2013 d.B. sowie 8941/BR d.B.) ............................................................................................................................. 115
Berichterstatter: Josef Saller ...................................................................................... 115
Redner/Rednerinnen:
Hermann Brückl ......................................................................................................... 115
Ana Blatnik .................................................................................................................. 118
Franz Wenger .............................................................................................................. 120
Marco Schreuder ........................................................................................................ 121
Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek .......................................................... 123
Staatssekretär Dr. Josef Ostermayer ...................................................................... 126
Mag. Harald Himmer .................................................................................................. 128
Annahme des Antrages des Berichterstatters, den Bericht III-483-BR/2013 d.B. zur Kenntnis zu nehmen ............................................................................................................................. 129
Gemeinsame Beratung über
10. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das Bankwesengesetz, das Börsegesetz 1989, das E-Geldgesetz 2010, das Zahlungsdienstegesetz, das Investmentfondsgesetz 2011, das Immobilien-Investmentfondsgesetz, das Wertpapieraufsichtsgesetz 2007, das Kapitalmarktgesetz, das Ratingagenturenvollzugsgesetz, das Zentrale Gegenparteien-Vollzugsgesetz, das Pensionskassengesetz, das Versicherungsaufsichtsgesetz, das Punzierungsgesetz 2000, das Gebührengesetz 1957, das Glücksspielgesetz, die Bundesabgabenordnung, das Finanzstrafgesetz, das EU-Finanzstrafvollstreckungsgesetz, das Bundesfinanzgerichtsgesetz, das Bundespensionsamtübertragungs-Gesetz und das Rundfunkgebührengesetz geändert werden (Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz – Bundesministerium für Finanzen) (2196 d.B. und 2233 d.B. sowie 8921/BR d.B.) ............................................................................................................................. 129
Berichterstatter: Robert Zehentner ............................................................................ 130
11. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Konsulargebührengesetz 1992, das Sanktionengesetz 2010, das Devisengesetz 2004 und das Nationalbankgesetz 1984 geändert werden (2234 d.B. sowie 8922/BR d.B.) ............. 130
Berichterstatter: Robert Zehentner ............................................................................ 130
Redner/Rednerinnen:
Marco Schreuder ........................................................................................................ 130
Michael Lampel .......................................................................................................... 131
Mag. Reinhard Pisec, BA ................................................................................. 132, 135
Staatssekretär Mag. Andreas Schieder ................................................................... 134
Sonja Zwazl ........................................................................................................ 135, 136
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 10, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................ 137
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 11, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................ 137
Gemeinsame Beratung über
12. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein über die Zusammenarbeit im Bereich der Steuern samt Schlussakte einschließlich der dieser beigefügten Erklärungen (2151 d.B. und 2235 d.B. sowie 8923/BR d.B.) 137
Berichterstatter: Robert Zehentner ............................................................................ 137
13. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Stiftungseingangssteuergesetz geändert wird (2236 d.B. sowie 8924/BR d.B.) ........ 137
Berichterstatter: Robert Zehentner ............................................................................ 137
14. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend Protokoll zur Abänderung des am 5. November 1969 in Vaduz unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (2145 d.B. und 2237 d.B. sowie 8925/BR d.B.) .................. 137
Berichterstatter: Robert Zehentner ............................................................................ 137
Redner/Rednerinnen:
Mag. Reinhard Pisec, BA .......................................................................................... 138
Dr. Angelika Winzig .................................................................................................... 139
Efgani Dönmez, PMM ................................................................................................ 140
Michael Lampel .......................................................................................................... 142
Staatssekretär Mag. Andreas Schieder ................................................................... 143
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 12, 1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben und 2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen .............. 146
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 13, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................ 146
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 14, 1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben und 2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen .............. 146
Gemeinsame Beratung über
15. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Chile zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und der Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt Protokoll (2134 d.B. und 2238 d.B. sowie 8926/BR d.B.) ........................................................... 147
Berichterstatter: Michael Lampel ............................................................................... 147
16. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik San Marino zur Abänderung des Zusatzprotokolls zum am 18. September 2009 unterzeichneten Protokoll zur Abänderung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik San Marino auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt Protokoll (2136 d.B. und 2239 d.B. sowie 8927/BR d.B.) ........................................................... 147
Berichterstatter: Michael Lampel ............................................................................... 147
17. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Republik Kosovo über Zusammenarbeit und gegenseitige Amtshilfe in Zollsachen samt Anhang (2152 d.B. und 2240 d.B. sowie 8928/BR d.B.) 147
Berichterstatter: Michael Lampel ............................................................................... 147
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 15, 1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben und 2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen .............. 148
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 16, 1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben und 2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen .............. 149
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 17, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................ 149
18. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Umsatzsteuergesetz 1994 und das Bewertungsgesetz 1955 geändert werden (2234/A und 2241 d.B. sowie 8929/BR d.B.) ............................................................................................................... 149
Berichterstatter: Michael Lampel ............................................................................... 149
Annahme des Antrages des Berichterstatters, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben .................................................................................................. 149
Gemeinsame Beratung über
19. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Verbrechensopfergesetz geändert wird (2137 d.B. und 2218 d.B. sowie 8930/BR d.B.) 150
Berichterstatter: Reinhard Todt .................................................................................. 150
20. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz, das Opferfürsorgegesetz, das Verbrechensopfergesetz, das Impfschadengesetz und die 11. Opferfürsorgegesetz-Novelle geändert werden (2162 d.B. und 2219 d.B. sowie 8931/BR d.B.) 150
Berichterstatter: Reinhard Todt .................................................................................. 150
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 19, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................ 150
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 20, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................ 151
21. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, das Betriebliche Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz, das Landarbeitsgesetz 1984, das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, das Arbeitsmarktservicegesetz, das Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Arbeitsverfassungsgesetz und das Betriebspensionsgesetz geändert werden (Sozialrechts-Änderungsgesetz 2013 – SRÄG 2013) (2150 d.B. und 2220 d.B. sowie 8932/BR d.B.) 151
Berichterstatter: Richard Wilhelm .............................................................................. 151
Redner/Rednerinnen:
Monika Kemperle ....................................................................................................... 151
Josef Saller ................................................................................................................. 152
Efgani Dönmez, PMM ................................................................................................ 153
Klaus Konrad .............................................................................................................. 153
Martina Diesner-Wais ................................................................................................ 154
Bundesminister Rudolf Hundstorfer ....................................................................... 156
Annahme des Antrages des Berichterstatters, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben .................................................................................................. 156
22. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Ausländerbeschäftigungsgesetz und das Behinderteneinstellungsgesetz geändert werden (2163 d.B. und 2225 d.B. sowie 8933/BR d.B.) 156
Berichterstatter: Reinhard Todt .................................................................................. 156
Redner/Rednerinnen:
Gerd Krusche ............................................................................................................. 156
Richard Wilhelm ......................................................................................................... 158
Efgani Dönmez, PMM ................................................................................................ 158
Sonja Zwazl ................................................................................................................. 160
Bundesminister Rudolf Hundstorfer ....................................................................... 162
Monika Mühlwerth ..................................................................................................... 163
Franz Perhab ............................................................................................................... 164
Annahme des Antrages des Berichterstatters, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben .................................................................................................. 164
Gemeinsame Beratung über
23. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Behinderteneinstellungsgesetz, das Bundesbehindertengesetz, das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, das Opferfürsorgegesetz, das Heeresversorgungsgesetz, das Impfschadengesetz, das Verbrechensopfergesetz, das Bundespflegegeldgesetz, das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, das Arbeitsmarktservicegesetz, das Arbeitsmarktförderungsgesetz, das IEF-Service-GmbH-Gesetz, das Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz 1991, das Arbeitsruhegesetz, das Arbeitszeitgesetz, das Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz 1987, das Landarbeitsgesetz 1984, das Mutterschutzgesetz 1979, das Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz, das Gleichbehandlungsgesetz, das Arbeitsverfassungsgesetz, das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, das Arbeitsinspektionsgesetz 1993 und das Produktsicherheitsgesetz 2004 geändert werden und das Bundesberufungskommissionsgesetz aufgehoben wird (Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz – Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz) (2193 d.B. und 2226 d.B. sowie 8934/BR d.B.) ............................................................................................................... 165
Berichterstatter: Reinhard Todt .................................................................................. 165
24. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, das Notarversicherungsgesetz 1972 und das Nachtschwerarbeitsgesetz geändert werden (Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz – Sozialversicherung) (2195 d.B. und 2227 d.B. sowie 8915/BR d.B. und 8935/BR d.B.) ................................................................................. 165
Berichterstatter: Reinhard Todt .................................................................................. 165
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 23, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................ 166
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 24, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................ 166
Gemeinsame Beratung über
25. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein über soziale Sicherheit (2138 d.B. und 2229 d.B. sowie 8936/BR d.B.) ............................................................................................................... 166
Berichterstatter: Richard Wilhelm .............................................................................. 166
26. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Vorbereitenden Kommission für die Organisation des Vertrages über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen über soziale Sicherheit (2139 d.B. und 2230 d.B. sowie 8937/BR d.B.) ............................................................................................................................. 166
Berichterstatter: Richard Wilhelm .............................................................................. 166
27. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Indien über soziale Sicherheit (2159 d.B. und 2231 d.B. sowie 8938/BR d.B.) ............................................................................................................................. 166
Berichterstatter: Richard Wilhelm .............................................................................. 166
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 25, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................ 167
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 26, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................ 167
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 27, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................ 168
28. Punkt: Jahresbericht 2013 gemäß Art. 23f Abs. 2 B-VG des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz auf der Grundlage des Legislativ- und Arbeitsprogramms der Europäischen Kommission für 2013 sowie des Achtzehnmonatsprogramms des irischen, litauischen und griechischen Ratsvorsitzes (III-484-BR/2013 d.B. sowie 8939/BR d.B.) ...................................................................... 168
Berichterstatter: Richard Wilhelm .............................................................................. 168
Redner/Rednerinnen:
Monika Mühlwerth ..................................................................................................... 168
Monika Kemperle ....................................................................................................... 170
Franz Wenger .............................................................................................................. 172
Annahme des Antrages des Berichterstatters, den Bericht III-484-BR/2013 d.B. zur Kenntnis zu nehmen ............................................................................................................................. 173
29. Punkt: Beschluss
des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz
über die Grundsätze für Hilfen für Familien und
Erziehungshilfen
für Kinder und Jugendliche (Bundes-Kinder- und
Jugendhilfegesetz 2013 –
B-KJHG 2013) (2191 d.B. und 2202 d.B. sowie 8942/BR d.B.) ................................... 173
Berichterstatterin: Elisabeth Greiderer ...................................................................... 173
Redner/Rednerinnen:
Monika Mühlwerth ..................................................................................................... 173
Friedrich Reisinger .................................................................................................... 174
Efgani Dönmez, PMM ................................................................................................ 175
Inge Posch-Gruska ..................................................................................................... 177
Bundesminister Dr. Reinhold Mitterlehner ............................................................. 178
Annahme des Antrages der Berichterstatterin, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben .................................................................................................. 179
30. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert wird (2192 d.B. und 2207 d.B. sowie 8943/BR d.B.) ............................................................................................................................. 179
Berichterstatterin: Martina Diesner-Wais ................................................................... 179
Redner/Rednerinnen:
Mag. Bettina Rausch .................................................................................................. 180
Friedrich Hensler ........................................................................................................ 182
Annahme des Antrages der Berichterstatterin, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben .................................................................................................. 183
31. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Familienberatungsförderungsgesetz geändert wird (2190 d.B. und 2209 d.B. sowie 8944/BR d.B.) ............................................................................................................................. 183
Berichterstatterin: Martina Diesner-Wais ................................................................... 183
Redner/Rednerinnen:
Inge Posch-Gruska ..................................................................................................... 184
Bundesminister Dr. Reinhold Mitterlehner ............................................................. 185
Annahme des Antrages der Berichterstatterin, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben .................................................................................................. 186
Eingebracht wurden
Anfragen der Bundesräte
Hermann Brückl, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend Schuldenregulierungsverfahren im Jahr 2012 (2943/J-BR/2013)
Hermann Brückl, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend Schuldenregulierungsverfahren im Jahr 2011 (2944/J-BR/2013)
Anfragebeantwortung
der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Bundesräte Mag. Bettina Rausch, Kolleginnen und Kollegen betreffend die Einführung eines österreichweiten Studenten-Tickets für die öffentlichen Verkehrsmittel (2722/AB-BR/2013 zu 2937/J-BR/2013)
Beginn der Sitzung: 9.01 Uhr
Präsident Edgar Mayer: Ich eröffne die 819. Sitzung des Bundesrates.
Einen schönen guten Morgen! Herzlich willkommen im Bundesrat! Wir freuen uns über das große mediale Interesse; es könnte immer so sein. Zur Abwechslung würden sich die Bundesräte auch über eine sehr positive Berichterstattung freuen. Ich bedanke mich im Vorhinein. (Heiterkeit und allgemeiner Beifall.)
Das Amtliche Protokoll der 818. Sitzung des Bundesrates vom 14. März 2013 ist aufgelegen, unbeanstandet geblieben und gilt daher als genehmigt.
Als verhindert gemeldet sind die Mitglieder des Bundesrates Anneliese Junker, Hans-Jörg Jenewein, Christoph Kainz, Juliane Lugsteiner, Kurt Strohmayer-Dangl, Josef Steinkogler, Mag. Josef Taucher.
Präsident Edgar Mayer: Eingelangt ist ein Schreiben des Kärntner Landtages betreffend Wahl von Mitgliedern und Ersatzmitgliedern des Bundesrates.
Hinsichtlich des Wortlautes dieses Schreibens verweise ich auf die im Sitzungssaal verteilten Mitteilungen gemäß § 41 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Bundesrates, die dem Stenographischen Protokoll dieser Sitzung angeschlossen werden.
Die schriftliche Mitteilung hat folgenden Wortlaut:
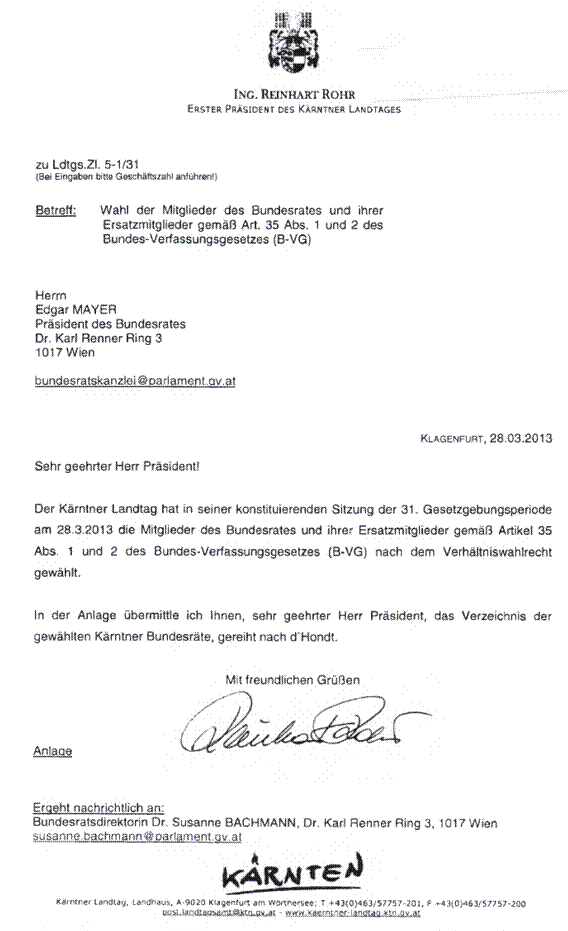
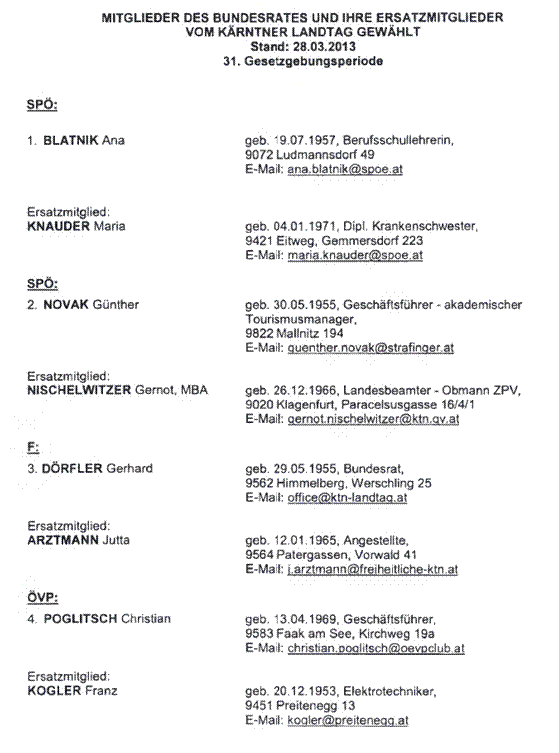
*****
Präsident Edgar Mayer: Die neuen Mitglieder beziehungsweise das wiedergewählte Mitglied des Bundesrates sind bereits im Hause anwesend. Ich werde daher sogleich die Angelobung vornehmen. (Bundesrat Dörfler schüttelt Vizekanzler Dr. Spindelegger die Hand.) – Das ist jetzt noch nicht die Angelobung. (Heiterkeit.)
Nach Verlesung der Gelöbnisformel durch die Schriftführung wird die Angelobung mit den Worten „Ich gelobe“ zu leisten sein.
Ich ersuche nun die Schriftführung um Verlesung der Gelöbnisformel.
Schriftführer Josef Saller: „Sie werden geloben unverbrüchliche Treue der Republik Österreich, stete und volle Beobachtung der Verfassungsgesetze und aller anderen Gesetze sowie gewissenhafte Erfüllung Ihrer Pflichten.“
*****
Über Namensaufruf durch den Schriftführer leisten die Bundesräte Ana Blatnik (SPÖ, Kärnten), Gerhard Dörfler (FPÖ, Kärnten), Günther Novak (SPÖ, Kärnten) und Christian Poglitsch (ÖVP, Kärnten) ihre Angelobung mit den Worten „Ich gelobe“.
*****
Präsident Edgar Mayer: Ich begrüße die neuen Mitglieder beziehungsweise das wiedergewählte Mitglied des Bundesrates sehr herzlich in unserer Mitte. (Allgemeiner Beifall.)
Ich wünsche allen viel Erfolg und freue mich auf eine sehr gute Zusammenarbeit. (Die neu angelobten Mitglieder des Bundesrates werden zahlreich von ihren Kolleginnen und Kollegen beglückwünscht.)
Sehr verehrte Damen und Herren, ich darf Sie bitten, wieder Platz zu nehmen. Wir haben eine umfassende Tagesordnung, ich möchte deshalb auch speditiv die Sitzung fortsetzen.
Ich darf vorweg noch einen besonderen Ehrengast begrüßen. Wir haben ja in diesen Tagen im Bundesrat ein Schwerpunktthema: Europa ... (Unruhe im Sitzungssaal. – Präsident Mayer gibt das Glockenzeichen.) – Ich hoffe, die große Euphorie, die eingekehrt ist, möge den ganzen Tag so anhalten. – Danke schön. (Heiterkeit.)
Wir haben seitens des Bundesrates in diesen Tagen, also gestern in den Ausschusssitzungen und auch heute, das Schwerpunktthema „Europa und internationale Angelegenheiten“, gestern im EU-Ausschuss mit Staatssekretär Lopatka und den Ausschussvorsitzenden der Länder und heute im Plenum mit Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger, den ich hiermit auch herzlich begrüßen möchte. Guten Morgen, Herr Vizekanzler! (Allgemeiner Beifall.)
Im Anschluss an die Aktuelle Stunde werden wir den Präsidenten des Ausschusses der Regionen Ramón Luis Valcárcel Siso begrüßen können, der ebenfalls eine Erklärung abgeben wird.
Ich darf auch noch besonders die Präsidentin des Vorarlberger Landtages Dr. Gabriele Nußbaumer begrüßen. – Herzlich willkommen! (Allgemeiner Beifall.)
Präsident Edgar Mayer: Wir gelangen nun zur Aktuellen Stunde zum Thema
„Initiative für Religionsfreiheit und gegen Christenverfolgung“
mit dem Herrn Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger.
In der Präsidialkonferenz wurde Einvernehmen über folgenden Ablauf erzielt:
Zunächst kommt je eine Rednerin/ein Redner pro Fraktion mit einer Redezeit von 10 Minuten zu Wort. Sodann folgt die Stellungnahme des Herrn Bundesministers, die ebenfalls 10 Minuten nicht überschreiten soll. Danach folgt eine Rednerin/ein Redner der Bundesräte ohne Fraktion und dann je eine Rednerin/ein Redner der Fraktionen mit einer jeweils fünfminütigen Redezeit. Zuletzt kann noch eine abschließende Stellungnahme des Herrn Bundesministers erfolgen, die nach Möglichkeit 5 Minuten nicht überschreiten soll.
Als Erster zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat Mag. Himmer. – Bitte.
9.07
Bundesrat Mag. Harald Himmer (ÖVP, Wien): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Hohes Haus! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Religionsfreiheit ist in mehr als 60 Ländern dieser Erde, wo mehr als zwei Drittel der Menschheit wohnen, stark eingeschränkt beziehungsweise überhaupt nicht existent. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Menschen wegen ihres Glaubens diskriminiert werden – egal, ob das Christen, ob das Juden, ob das Angehörige anderer Konfessionen sind –, dass sie ihre Arbeitsplätze verlieren, dass sie ihre Wohnungen verlieren, dass sie inhaftiert werden, dass sie gefoltert und ihrer existenziellsten Menschenrechte beraubt werden.
Ich glaube tatsächlich, dass dieses Thema von der Bedeutung her ein sehr, sehr wichtiges ist und auch von der politischen Gewichtung her fast noch spannender ist, als wochenlang darüber nachzudenken, wer ein Landtagsmandat annimmt oder nicht, auch wenn das die Medien bis zur Minute immer noch nachhaltiger interessiert. (Beifall bei der ÖVP, bei Bundesräten der SPÖ sowie des Bundesrates Dönmez.)
Die Religionsfreiheit ist ein zentrales Menschenrecht, und ich weiß nicht, ob Ihnen allen bewusst ist, dass weltweit über 100 Millionen Christen verfolgt und diskriminiert werden. Wenn wir von Christenverfolgung sprechen, dann denken wir üblicherweise an die Christenverfolgung, die einmal im Römischen Reich stattgefunden hat, weil das in der Geschichte des Christentums der Abschnitt ist, den man am meisten mit dem Thema Christenverfolgung verbindet. Aber in der Tat ist es so, dass sich das fortgesetzt hat über die Spätantike, über das Mittelalter, über die frühe Neuzeit, über die Neuzeit – und insbesondere in der Neuzeit auch unter dem Nationalsozialismus, aber auch in China; in den Ostblockstaaten gab es viele Probleme in Bezug auf Christenverfolgung: in der Tschechoslowakei, in der DDR, in der Sowjetunion, auch wenn nicht immer darüber berichtet wurde.
In der Gegenwart gibt es eine Vielzahl von Krisenherden, wo auch heute in unserer modernen Welt immer noch Hunderte Millionen Menschen verfolgt und diskriminiert werden. Das findet statt in Ägypten, das findet statt in Afghanistan. Da gibt es Probleme im Irak, im Iran, in Pakistan, in Saudi-Arabien, aber auch in Ländern wie der Türkei. Das hört aber dort nicht auf: Es gibt Christenverfolgung in Nordafrika, es gibt Probleme in Nigeria. Denken Sie an Syrien: In Syrien sind auch die Christen zwischen die Fronten geraten. Und wenn wir etwa nach Ägypten blicken, dann ist es schon tragisch zu sehen, dass im Zusammenhang mit dem demokratischen Frühling, den die Bevölkerung dort zum Teil erlebt hat oder zum Teil geglaubt hat zu erleben, fürs Erste eigentlich die Situation für die Christen dort schlechter geworden ist.
Ich möchte hier auch ausdrücklich betonen, wenn Länder, wie bereits angesprochen auch die Türkei, Absichten haben, sich der europäischen Wertegemeinschaft, sich an die Europäische Union anzunähern, manche wollen sogar beitreten, dass das dann natürlich auch bedingt, anzuerkennen, dass wir als Europäer auch eine Wertegemeinschaft zu bilden haben, die auf festen humanistischen Grundsätzen zu fußen hat. Und
einer dieser festen humanistischen Grundsätze ist mit ganz großer Sicherheit die Religionsfreiheit.
Es gibt unterschiedliche Institutionen und Menschenrechtler, die versuchen, zu erfassen, wie sich eigentlich die Situation der Religionsfreiheit und der Christenverfolgung weltweit darstellt, weil das ja nicht alles irgendwo zentral dokumentiert wird. Da gibt es auch Versuche, so eine Art Weltverfolgungsindex zu definieren und das auch nach diesen Kriterien zu bewerten, von Open Doors. Die machen das entlang folgender Kriterien: Wie schaut der rechtliche und offizielle Status der Christen in diesen Ländern aus? Wie ist die tatsächliche Situation in dem Land? Wie schaut es mit den Reglementierungen des Staates aus? Und: Was gibt es sonst noch für lokale Faktoren, die die Freiheiten einschränken?
Jetzt sind natürlich solche Statistiken, wo unterschiedliche Faktoren von Personen gewertet werden, keine präzise Wissenschaft, also was dabei herauskommt, aber trotzdem eine interessante Erfassung und ein sehr wichtiges Bemühen, die Realitäten abzubilden und zu Papier zu bringen.
Bei diesem Index ist als trauriger Spitzenreiter Nordkorea herausgekommen. Nordkorea, das uns gegenwärtig nicht nur in dieser Thematik wirklich große Sorgen bereitet. Aber ich möchte hier schon sagen, damit man es weiß, dass in Nordkorea bereits der Besitz einer Bibel damit verbunden ist, dass man die Todesstrafe an sich erleben kann – „erleben kann“ ist ein sehr blöder Ausdruck in dem Zusammenhang (Heiterkeit) –, dass die Todesstrafe über einen verhängt wird beziehungsweise dass die ganze Familie ins Arbeitslager kommt. Und das sind einfach Dinge, die uns als österreichischen, als europäischen Politikern nicht gleichgültig sein können.
Ich wundere mich immer wieder darüber, dass man bei diesem Thema manchmal den Eindruck bekommt, dass es nur interessant ist für jene, für die der Glauben im Leben eine besondere Rolle spielt. Man sagt: Ja, das Thema Christenverfolgung ist halt ein Thema für die Christen und für die, die der Glaube mehr interessiert, ich bin eigentlich nicht so gläubig, mich interessiert das nicht so narrisch, was mit den Christen passiert. – Das kann ich eigentlich nicht nachvollziehen, denn das Verfolgen jedweder Religion, selbstverständlich auch anderer Glaubensrichtungen, ist prinzipiell auf das Schärfste abzulehnen. Das Ausüben der Religionsfreiheit, egal welcher Religion, ist ein fundamentales Menschenrecht.
Was aber das Allerwesentlichste an dem Thema ist, ist, dass man doch nicht wegschauen kann, wie Hunderte Millionen Menschen in Unfreiheit leben, ihnen die Wohnungen weggenommen werden, sie inhaftiert werden, sie gefoltert werden. Das ist die blutige Realität, die sich darstellt. Und daher bin ich sehr froh, dass wir mit dem österreichischen Außenminister jemanden haben, der selber eine lange außenpolitische Erfahrung hat, auch im Europarat war, gelernt hat, für Menschenrechte einzutreten, der in seiner Funktion immer wieder vielfach Koalitionen schmiedet, damit die Europäische Union, aber auch die Weltöffentlichkeit von dieser Problematik immer wieder erfahren, immer wieder das Licht und das Vergrößerungsglas darauf gehalten werden, damit wir alle gemeinsam als Humanisten einen Beitrag zu einer gerechteren Welt leisten. (Beifall bei der ÖVP sowie bei Bundesräten der SPÖ.)
9.16
Präsident Edgar Mayer: Als Nächste zu Wort gelangt Frau Bundesrätin Mag. Kurz. – Bitte, Frau Kollegin.
9.16
Bundesrätin Mag. Susanne Kurz (SPÖ, Salzburg): Sehr geehrter Herr Vizekanzler! Sehr geehrter Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Werte Zuseherinnen und Zu-
seher! Bevor ich mich dem von Vizekanzler und Außenminister Spindelegger gewählten Thema „Initiative für Religionsfreiheit und gegen Christenverfolgung“ zuwende, schicke ich zwei Bemerkungen voraus.
Erstens: Ich war und bin nach wie vor über die Wahl des Themas erstaunt, denn meiner Meinung nach gibt es eine ganze Reihe europäischer – und wir haben heute einen Europatag hier im Bundesrat –, aber auch globaler Themen, die von extrem wichtiger Bedeutung sind und die aktives Handeln von Österreich erfordern.
Angesichts der Finanzkrisen, die Auswirkungen auf alle europäischen Staaten haben und die nicht nur Angelegenheit der Finanzministerinnen und Finanzminister sind, erscheint es mir eigentlich wichtiger zu klären, was das Außenministerium, was der Vizekanzler unternimmt, um die inakzeptablen hohen Arbeitslosenraten, insbesondere die der jungen Menschen, die eine Tragödie für Europa sind, zu vermindern. Im Februar waren in der EU-27 mehr als 5,5 Millionen Menschen im Alter von unter 25 Jahren arbeitslos.
Was sind die Konzepte, die wir haben, um Armut in Europa zu bekämpfen, um Menschenhandel zu unterbinden, insbesondere was die illegale Prostitution betrifft, die nicht nur in Salzburg ein Problem darstellt? Warum gelingt es nicht, sozialen Ausgleich zwischen den europäischen Staaten voranzutreiben? Es ist ein Armutszeugnis für Europa, dass seine BewohnerInnen in großer Zahl zum Beispiel auch zu uns nach Österreich kommen, um hier als Bettler ihr Leben zu fristen. Im Übrigen hat die ÖVP eine Initiative in Salzburg abgelehnt, die darauf abzielt, in Südosteuropa Armut zu bekämpfen. (Ruf bei der ÖVP: Sie haben die falsche Rede mit! – Weitere Zwischenrufe bei der ÖVP.) – Ich bin immer noch bei meinen Vorbemerkungen, zum eigentlichen Thema komme ich noch.
Die Themen Landwirtschaft, Umwelt, Verkehr sind brennende Themen in Europa, genauso wie steigender Antisemitismus und Islamophobie. Die Rechte von Frauen und Kindern weltweit zu sichern und Minderheitenrechte überall zu stärken sind dringende Anliegen großer Bevölkerungsgruppen. Und vergessen wir nicht: Europa hat den Friedensnobelpreis bekommen! Das ist Anerkennung, aber auch Auftrag für die Zukunft. – Was machen wir hier, in Österreich?
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht, aber Menschenrechte sind auch das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard, einschließlich Nahrung und Wohnung, das Recht auf soziale Sicherheit, Gesundheit und Bildung. (Beifall bei der SPÖ.)
Das betrifft auch die Entwicklungszusammenarbeit, für die der Herr Vizekanzler auch zuständig ist, denn ein menschenrechtsbasierter Ansatz zielt darauf ab, die Förderung der Menschenrechte und entwicklungspolitische Ziele in Einklang zu bringen. Auch dieses Thema bietet vielfältige Diskussionsmöglichkeiten.
Wie gesagt, viele Themen stehen an. Religionsfreiheit ist, global gesehen, sicherlich ein wichtiges Thema, betrifft aber nur einen der 30 Grundartikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und kann sicher nicht isoliert gesehen werden.
Zweite Vorbemerkung: Ich selbst bin Mitglied der katholischen Kirche.
Werte Kolleginnen und Kollegen! Religion gehört zweifelsohne zu den stärksten Kräften, die Menschen zum Guten wie zum Bösen beeinflussen und auch prägen können. Religionen setzen Werte, vermitteln Orientierung und Identifikationsmöglichkeiten. Religion wird aber auch immer wieder dazu missbraucht, gröbste Verstöße gegen die Menschenrechte unter Verweis auf die sogenannten höheren Ziele zu beschönigen und zu rechtfertigen. Was es hier braucht, ist Toleranz. Das bedeutet, dass jede Person das Recht hat, ihre Religion frei zu wählen und auszuüben, solange sie dadurch die Rechte
anderer Personen nicht beeinträchtigt. In keinem Fall kann Religion dazu missbraucht werden, Übergriffe gegen Leib und Leben zu rechtfertigen.
Leider ist das auch in Europa weit weniger selbstverständlich, als man annehmen möchte. Nicht nur kleine Sekten geraten immer wieder in die Schlagzeilen, weil die Sektenführer Mitglieder zu sexuellen Handlungen nötigen oder in den Selbstmord treiben. Auch jahrhundertealte, religiös begründete Traditionen wie etwa die Beschneidung von Mädchen stellen nicht akzeptable Verletzungen des Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit dar und können sich keinesfalls auf Religionsfreiheit berufen. Mit der verstärkten Einwanderung aus Afrika ist die Genitalverstümmelung auch in Europa zum Problem geworden.
Eine gewisse Kontrolle religiöser Aktivitäten durch einen demokratischen Staat ist also nötig, um Religionsfreiheit der Einzelperson zu garantieren. Denken wir dabei auch an die katholische Kirche und an die vielen Fälle von sexuellem Missbrauch, die von kirchlichen Vorgesetzten gedeckt und vertuscht worden sind.
Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte beginnt mit den bekannten Worten: „Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit“. – Die Realität sieht jedoch besonders für die Angehörigen religiöser Minderheiten in vielen Ländern dieser Erde anders aus.
Grundsätzlich gilt es, für die Anhänger aller Religionsgemeinschaften einzutreten, weil Religionsfreiheit eine Sache der Menschenwürde ist. Nicht nur Staaten, sondern Teile der Gesellschaft wie Religionsgemeinschaften, Warlords, Terrorgruppen treten als Täter auf. Macht und Kontrollbestrebungen, Korruption, Angst oder Hass treiben diese dazu, die Freiheit von AnhängerInnen anderer Religionen oder Konfessionen sowie Religionskritikern zu beschneiden. Die Mittel dabei reichen von Hetze in der Öffentlichkeit und Indoktrination über bürokratische Schikanen und einschränkende Strafrechtsbestimmungen bis hin zu körperlichen Angriffen und Mord.
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Zweifelsohne sind viele Christen in aller Welt von Verletzungen der Religionsfreiheit massiv betroffen. Mein Vorredner hat bereits einige Staaten aufgezählt, auch Staaten wie Nigeria, Iran, Irak, Ägypten, China oder Eritrea gehören dazu. Die Gründe für die Verfolgung sind so unterschiedlich wie die Länder, in denen sie stattfinden, aber wo Christen bedrängt werden, werden typischerweise auch andere Religionsgruppen bedrängt.
Im Irak stehen nicht nur Christen, sondern beispielsweise auch Jesiden massiv unter Druck. In Ägypten denken wir zu Recht an die Diskriminierung der Kopten. Vergessen wir aber nicht, dass dort beispielsweise die Bahai ebenfalls einen sehr schweren Stand haben. Erst recht gilt das für den Iran. Dort sind die Bahai wohl die am meisten verfolgte Gruppe. In Usbekistan sind es die Zeugen Jehovas, aber auch viele Christen, insbesondere Konvertiten, werden dort diskriminiert und verfolgt. Dabei ist es sinnvoll, innerhalb der Christen zu differenzieren. Es trifft oft besonders stark protestantische Gruppen, weil diese im Nahen Osten als westliche Missionskirche gelten und oft mit dem verhassten Amerika assoziiert werden.
Das heißt, ein Schlagwort wie „Christenverfolgung“ steht für ein sehr komplexes Phänomen. Wir sollten grundsätzlich von der Perspektive der Menschenrechte ausgehen, Solidarität verdienen alle verfolgten Menschen.
Tatsächlich zeigen sich heute in vielen islamischen Staaten in Sachen Religionsfreiheit schwere Defizite. Allerdings sollte man daraus nicht falsche Schlussfolgerungen ziehen und das Thema Religionsfreiheit in einen „Kampf zwischen Kulturen“ umdeuten, wonach Christen grundsätzlich Opfer und Muslime die Verfolger sind. Das führt in die Irre. In islamisch geprägten Gesellschaften werden auch viele Muslime wegen ihrer Reli-
gionsausübung verfolgt, so beispielsweise im Iran. In den Gefängnissen sitzen nicht nur Bahais und Christen, sondern auch viele kritische Muslime.
Es gibt natürlich auch Politiker, die mit Angst spielen, weil Ressentiments und Paranoia Mittel der politischen Mobilisierung sind. In Staaten mit schwachen öffentlichen Institutionen wird ein Spiel getrieben, das auf Kosten der Religionsfreiheit geht. Autoritäre Regime haben immer Angst, dass sich soziale Gruppen, die jenseits ihrer Kontrolle sind, selbständig organisieren.
In Europa verkehren sich scheinbar die Rollen. Hier fühlen sich die Muslime oft unterdrückt und verfolgt, die Berufung auf das Christentum, die man bei islamophoben Bewegungen in Europa gelegentlich findet, bleibt meist extrem oberflächlich. Die Skepsis gegenüber dem Islam, die zu Islamophobie führen kann, verläuft heute primär nach dem Muster: Wir sind modern, die anderen sind Modernitätsverweigerer! Es geht mittlerweile nicht mehr so sehr nach dem alten Muster: Abendland versus Morgenland, sondern: moderne versus vormoderne Aufklärung versus Aufklärungsverweigerung.
Das erkennt man übrigens auch daran, dass diese Frage sehr stark an der Frauenthematik exemplifiziert wird. Wie hält man es mit dem Kopftuch? Wie hält man es mit der Burka, mit der Zwangsverheiratung? Beim Gender-Thema bilden wir in Europa uns ein, dass wir auf dem Stand der Postaufklärung angelangt sind, während die anderen angeblich auf ewig in der Phase der Präaufklärung verharren. Ob das so ist, lasse ich dahingestellt.
Religionsfreiheit gehört zum Kernbestandteil jeder Zivilgesellschaft, doch auch diese Tradition wird brüchig. Das in Wien beheimatete Dokumentationsarchiv der Intoleranz gegen Christen schreibt im Jahresbericht 2011, in Europa seien 85 Prozent aller Hassdelikte gegen Christen gerichtet. Der ehemalige EU-Kommissar Lord Chris Patten hält es für „bemerkenswert“ – ich zitiere –, „wie intolerant sich die Atheisten gegenüber Gläubigen verhalten“. Also auch die Christophobie schreitet voran in unseren Ländern.
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Bloßes Dulden anderer Religionen und Kulturen reicht für einen Dialog nicht aus. (Präsident Mayer gibt das Glockenzeichen.) Es braucht viel mehr die Einsicht in den bereichernden Wert von Vielfalt und die Wertschätzung religiöser wie kultureller Diversität. Religion ist eben immer auch eine öffentliche Angelegenheit, eine zivile Gesellschaft darf den Glauben oder auch den Unglauben ihrer Bürger nicht ins stille Kämmerlein verbannen. Christen, Juden, Moslems, Buddhisten, Atheisten, Agnostiker, sie alle müssen dasselbe unteilbare Recht haben, sich zu ihrer jeweiligen Weltanschauung friedlich zu bekennen. Nur so leisten sie der Freiheit einen Dienst auf der ganzen Welt.
Präsident Edgar Mayer: Frau Vizepräsidentin, ich darf Sie um einen Schlusssatz ersuchen.
Bundesrätin Mag. Susanne Kurz (fortsetzend): Ich komme gleich zum Schluss, Herr Präsident, ich denke, das ist ein wichtiges Thema und 1 Minute Überzeit wird mit Sicherheit möglich sein.
Die Frage der Religionsfreiheit darf nicht losgelöst von anderen Rechten wie den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten betrachtet werden. Eine Verbesserung der Situation von Minderheiten kann nur mit der Verbesserung aller Menschenrechte der Betroffenen einhergehen. Dabei kann die EU und somit auch Österreich unterstützend wirken und Perspektiven eröffnen, zum Beispiel in konkreten Bereichen wie der Bildung oder der Zusammenarbeit mit den NGOs. Wichtig ist zum Beispiel auch, den Jugendaustausch zu forcieren. Die EU soll sich darauf konzentrieren, einen Beitrag zur Verbesserung der tatsächlichen Lebensbedingungen der Menschen zu leisten, denn Bildung und Wohlstand sind Grundvoraussetzungen für ein friedliches Zusammenleben verschiedener Weltanschauungen.
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss. – Eine Verbesserung der Lage der Christen allein ist weder möglich noch wünschenswert, sondern es geht um alle Menschen einer Region, die oft von einer hohen Analphabetisierungsrate und einer schwierigen sozialen Situation der Bevölkerung geprägt ist; Statistiken diesbezüglich wurden bereits erwähnt. Denken wir nur an die 38 islamischen Staaten, die der Verfolgungsindex aufzählt. Diese aggressive Intoleranz, die gegenüber allen Religionsgemeinschaften herrscht, die in der Minderheit sind, ist nicht zu akzeptieren. Aber, Kolleginnen und Kollegen, wie weit ist die oft nicht zu leugnende Toleranz der westlichen Welt, wo wirtschaftliche Interessen und geopolitische Macht oft wichtiger sind als Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit? – Danke. (Beifall bei SPÖ und Grünen.)
9.29
Präsident Edgar Mayer: Als Nächste zu Wort gemeldet hat sich Frau Kollegin Mühlwerth. – Bitte, Frau Kollegin.
9.29
Bundesrätin Monika Mühlwerth (FPÖ, Wien): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Außenminister und Vizekanzler! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren hier im Saal und zu Hause vor den Bildschirmen! Im Gegensatz zu meiner Vorrednerin halte ich das für ein sehr gut gewähltes Thema, es wundert mich allerdings, dass es so spät kommt. Diese Verfolgungen finden nicht erst seit gestern statt, aber man hat bislang nur sehr wenig bis gar nichts gehört – sowohl von Österreich als auch von der EU.
Zu diesem Thema muss ich schon Folgendes sagen, Frau Vizepräsidentin: Die Verfolgung, über die wir sprechen, die überwiegend an Christen stattfindet, findet hauptsächlich in muslimischen Ländern statt. Wir haben eine Vielzahl von muslimischen Einwanderern hier bei uns in Österreich, von denen – wenn man verschiedene Studien liest – eine Mehrheit immer wieder sagt beziehungsweise der Meinung ist, dass auch die Scharia in Österreich eingeführt werden sollte beziehungsweise Teile davon im Gesetz verankert werden sollten. Spätestens das sollte Anlass dafür sein, dass wir uns über die Eingliederungswilligkeit muslimischer Zuwanderer sehr wohl unterhalten. (Zwischenruf des Bundesrates Schreuder.) Es gibt verschiedene Studien, Herr Kollege Schreuder, die belegen, dass eine Vielzahl sagt, Teile der Scharia sollten durchaus auch in österreichischen Gesetzen ihren Niederschlag finden. (Bundesrätin Mag. Kurz: Das ist eine ganz kleine radikale Minderheit!)
Der Islam ist aber nicht nur eine Religion, er ist auch ein Gesellschaftssystem und ein Rechtssystem, und somit können wir nicht mehr sagen, das betrifft uns nicht, das findet anderswo statt, jeder, der das anspricht, ist – wie das ja unterschwellig angeklungen ist – einer, der hetzt. – Das tun wir nicht. (Beifall bei der FPÖ.)
Es geht aber im Zusammenhang mit Religionsfreiheit nicht nur um Christen, sondern es geht auch – und das ist die andere Seite – um Nichtreligiöse, auch um Atheisten. Die werden ja ihrerseits genauso unter Druck gesetzt, wie sie es vielleicht mit Christen machen. Es gibt darüber auch eine Studie, die als Protest am Tag der Menschenrechte präsentiert worden ist. Die Internationale Humanistische und Ethische Union sagt in ihrem Bericht, dass in vielen Ländern auch die Atheisten oder die Nichtgläubigen oder die humanistisch Ausgerichteten verfolgt werden.
Ich zitiere aus dieser Studie, die sagt, andere Gesetze verbauen Nicht-Religiösen „den Zugang zu öffentlichen Schulen und Universitäten, zu Stellen im öffentlichen Sektor und kriminalisieren Kritik an der Religion“.
„In sieben Ländern – Afghanistan, Iran, den Malediven, Mauretanien, Pakistan, Saudi-Arabien und Sudan – droht Atheisten und Konvertiten“ – das ist schon erwähnt worden – „die Hinrichtung.“
Die Atheisten werden auch dazu gezwungen, irgendein Religionsbekenntnis anzugeben, weil sie oft genug keinen Pass bekommen, und ohne Pass haben sie wiederum zum Beispiel keinen Zugang zu einer Gesundheitsvorsorge.
In den USA ist es leider auch so. Auch dazu ein Zitat aus der Studie, die sagt: „In den USA wiederum ist das Recht auf freie Religionsausübung und auf Meinungsäußerungsfreiheit durch die Verfassung geschützt.“ – So weit, so gut. – „Dennoch werden in mindestens sieben US-Staaten Atheisten per Verfassung vom öffentlichen Dienst ausgeschlossen. In einem Bundesstaat, Arkansas, werden Atheisten gar per Gesetz als Zeugen von Prozessen ausgeschlossen.“
Ich denke, auch das ist ein Kapitel, das, wenn wir über Religionsfreiheit sprechen, durchaus auch Beachtung finden sollte.
Aber natürlich sehr schlecht, das wissen wir, geht es den Christen. Weltweit werden 250 Millionen Christen verfolgt, in mehr als 50 Staaten werden sie als religiöse Minderheit mit dem Tod bedroht. In vielen islamischen, aber auch kommunistischen Staaten – Nordkorea ist schon erwähnt worden, aber auch China ist da mit dabei – und religiös nationalistischen Staaten – es ist ja leider auch Indien schon mit auf dieser Liste, in dem Fall ist es das buddhistische Bhutan – gelten Christen als Freiwild.
Die weltweit größte Gefahr herrscht für Gläubige in Nordkorea – das ist auch schon erwähnt worden –, besagt der sogenannte Weltverfolgungsindex der US-Hilfsorganisation Open Doors. 220 000 Christen in Nordkorea dürfen sich nicht zu ihrem Glauben bekennen, auf sie warten Haft, Folter und immer öfter auch Mord.
Auf Platz zwei der traurigen Liste der Christenverfolgung liegt Saudi-Arabien, was uns jetzt aber nicht wundert. Es folgt der Iran, aber auch im Irak ist es ganz schlimm, auch das haben wir heute schon gehört. Es ist gar nicht so lange her, dass 2 400 Familien fliehen mussten – sie sind ins Kurdengebiet geflohen –, weil sie aufgrund ihres Glaubens verfolgt und mit Gewalt bedroht worden sind.
Es sind nicht immer die Staaten selbst, die diese Verfolgung vornehmen, sondern es gibt die sogenannten Warlords, staatlich geduldete und unterstützte religiöse Fanatiker – das wird einfach hingenommen und eben auch unterstützt –, die sich dann an den Christen austoben.
In Nigeria etwa – auch nicht so lange her – sind bezeichnenderweise am Christtag mehrere christliche Kirchen angegriffen und 40 Menschen getötet worden.
In Pakistan – und das haben Gott sei Dank schon die Medien einmal aufgegriffen – gibt es Blasphemiegesetze, die zur Anwendung kommen und vor allem – nicht nur, aber vor allem – überproportional gegen Christen eingesetzt werden.
In Indien gab es in den Jahren 2007 und 2008 große Pogrome – was wir leider auch aus unserer leidvollen europäischen Geschichte kennen – gegen Christen im Bundesstaat Orissa durch radikale Hindu.
In Saudi-Arabien – das haben wir schon öfter behandelt, ist jetzt nicht ganz neu – sind zum Beispiel im Jahr 2011 42 äthiopische Christen verhaftet worden. Das waren Christen, die nicht in einer Kirche gebetet, sondern in einem Privathaus einen Gottesdienst abgehalten haben. Die saudische Polizei ist dafür bekannt, dass sie Privathäuser stürmt und Christen verhaftet. Übrigens weiß man nicht, wohin diese 42 äthiopischen Christen gebracht worden sind. Deren Aufenthalt ist nach wie vor nicht bekannt. Ausländer dürfen in Saudi-Arabien ihren Glauben ohnehin nicht ausüben, Juden dürfen nicht einreisen, Konvertiten werden zum Tod verurteilt.
Außer zu Nigeria, worüber sich nach diesem großen Anschlag auf die christlichen Kirchen zumindest nach meinem Wissen erstmals die EU entsetzt gezeigt hat, wird sehr
wenig zu diesem Thema gesagt. Das ist auch eine Verletzung der Menschenrechte. Bei allem anderen sind gleich immer alle zur Stelle, wenn es um religiöse Verfolgungen geht, herrscht großes Schweigen – auch in Österreich, muss ich sagen.
Was haben wir stattdessen gemacht? – Sie, Herr Außenminister, haben auf das interreligiöse Zentrum gesetzt, das vor nicht allzu langer Zeit erst eröffnet worden ist, das wir auch hier im Bundesrat diskutiert haben, das wir damals abgelehnt haben und das wir heute ablehnen, weil wir es nicht als das geeignete Instrument sehen, den Saudis irgendeine uns wichtige westliche Komponente der Menschenrechte, der Frauenrechte et cetera nahezubringen. (Beifall bei FPÖ und Grünen.)
Ganz im Gegenteil: Wir sehen es nach wie vor als Mittel für Saudi-Arabien, den Fuß nach Mitteleuropa zu setzen, vor allem am Balkan. Wir erleben ja schon seit Jahren, wie in Bosnien mit saudi-arabischen Geldern gewisse Ziele verfolgt werden, wie Saudi-Arabien dort bestimmt, was passiert. Die westlichen Demokratiewerte werden wir dem saudi-arabischen Regime ganz sicher nicht nahebringen. In Saudi-Arabien werden auch nicht nur Christen verfolgt, sondern alles, was islamisch ist und nicht dem wahhabitischen Glauben angehört, wird genauso verfolgt, seien es die Aleviten oder wer auch immer.
Daher halten wir dieses interreligiöse Zentrum nach wie vor für untauglich – es ist mit österreichischem Steuergeld finanziert (Vizekanzler Dr. Spindelegger: Das ist aber ein völliger ! – Rufe bei der ÖVP: Blödsinn!), die Politpensionistin Bandion-Ortner, die bei Ihnen in Ungnade gefallen ist, hat einen Posten bekommen –, der Zweck heiligt weiß Gott nicht die Mittel. Wir finden es schändlich, dass man dieses Zentrum errichtet hat und uns vorgaukelt, dadurch würde sich in einem so radikal islamischen Staat wie Saudi-Arabien irgendetwas ändern. (Beifall bei der FPÖ.) Über Religionsfreiheit zu sprechen und gleichzeitig diesen Schritt zu setzen – das, glauben wir, ist wirklich eine Verhöhnung. (Beifall bei der FPÖ sowie des Bundesrates Dönmez.)
9.39
Präsident Edgar Mayer: Zu einer einleitenden Stellungnahme zu Wort gemeldet hat sich Herr Vizekanzler Dr. Spindelegger. Ich erteile es ihm.
9.40
Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger: Herr Präsident! Sehr geschätzte Damen und Herren! Geschätzte Bundesrätinnen und Bundesräte! Warum ist dieses Thema, das heute hier gewählt wurde – nicht von mir, sondern von den Fraktionen –, ein wichtiges Thema? – Wir sehen in den letzten Jahren einen weltweiten Trend zur Verfolgung von Menschen, die eine bestimmte Überzeugung haben. Gewissens- und Religionsfreiheit ist ein umfassendes Menschenrecht, das vielfach mit Füßen getreten wird, und dagegen muss Österreich, dagegen muss der österreichische Außenminister auftreten – selbstverständlich! –, auch eine Gemeinschaft, die sich zu Werten bekennt, ob die Europäische Union insgesamt oder Österreich. Das ist meine tiefe Überzeugung. (Beifall bei der ÖVP sowie der Bundesrätin Ebner.)
Wenn Sie sich die Konflikte diesbezüglich ansehen und die Folgen, die es durch Verfolgte gibt, die – egal, aus welcher Religion sie kommen – genau deshalb, weil sie diese Religion hochhalten, verfolgt werden, sehen Sie, dass das weltweit zu immer mehr Radikalität führt, die zu Vertreibung führt. Aus verschiedenen Regionen verlassen viele Menschen aufgrund dieser Zustände das Land. Das führt dazu, dass dort Intoleranz vorherrscht, und zwar Intoleranz in jeder Hinsicht, und dazu, dass blutige Konflikte ausbrechen.
Meine Damen und Herren, das können wir doch
nicht hinnehmen! Da müssen wir
als internationale Wertegemeinschaft dagegen auftreten. Darum ist das ein
wichtiges Thema.
Weil Frau Bundesrätin Mag. Kurz darauf hingewiesen hat, dass es auch viele andere Themen gibt: Selbstverständlich, aber wenn Sie mich fragen, was ich gegen die Arbeitslosigkeit in Europa tue, dann sage ich Ihnen: Ich stehe natürlich auf dem Boden der österreichischen Bundesverfassung und der Europäischen Verträge, und dort ist ganz klar geregelt, dass Sozialpolitik eine Angelegenheit der Mitgliedsländer ist. Ich stehe dazu, und ich möchte das auch nicht ändern. Ich möchte das nicht nach Brüssel delegieren, und in Österreich haben wir eine Zuständigkeit dafür. Der Arbeits- und Sozialminister ist dafür zuständig. Wenn Sie mir die Kompetenzen übertragen wollen, gerne, selbstverständlich, ich bin sofort gesprächsbereit; dann schaut es vielleicht ein bisschen anders aus. (Beifall bei der ÖVP.)
Lassen Sie mich zum Ernst des Themas zurückkehren. Warum sind Christen ganz besonders im Zentrum dieser Verfolgung? – Ja, das belegen uns die Experten: 70 Prozent der wegen ihrer Religion weltweit Verfolgten sind heute Christen. Darum ist das auch der Schwerpunkt und der Grund, dass wir uns damit auseinanderzusetzen und diesbezüglich Maßnahmen zu setzen haben.
Welche Maßnahmen sind das, meine Damen und Herren? – Ich beschäftige mich als Außenminister nicht erst heute mit diesem Thema – Kollegin Mühlwerth, sehr nett, was Sie sagen, nämlich dass Sie zum ersten Mal davon hören, aber das liegt an Ihnen. (Bundesrätin Mühlwerth: Wenig bis gar nichts!) – Wenig bis gar nichts. Ich kann Ihnen nur empfehlen, lesen Sie internationale Zeitungen oder schauen Sie auf die außenpolitischen Seiten auch österreichischer Tageszeitungen! Das würde ich Ihnen empfehlen, denn dann würden Sie sehen, dass das nicht erst heute, sondern schon seit Jahren ein Thema ist.
Für Österreich ist es seit zwei Jahren ein Thema, weil wir seit zwei Jahren im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen vertreten sind und dort einen Schwerpunkt in Richtung Religionsfreiheit gesetzt haben – zu Recht –, mit vielen Initiativen. Und ich danke allen österreichischen Beamten, die dort tagtäglich dafür sorgen, dass dieses Thema auch behandelt wird. Das ist gut und richtig. (Beifall bei der ÖVP.)
Ich möchte Ihnen aber auch sagen, was ich persönlich tue. Ich habe bei allen meinen Reisen, die ich in muslimische Länder, die ich in Länder wie China, in Länder im Fernen Osten unternommen habe, immer auch dieses Thema, bei jedem Gespräch, und zwar in harten Gesprächen, auf der Tagesordnung gehabt. Das ist notwendig, denn es muss klar sein: Von einem österreichischen Außenminister, der zu den Menschenrechten steht – und da geht es nicht nur um Christen, sondern generell um die Fragen Religionsfreiheit, Gewissensfreiheit, weil das ein ganz zentrales Menschenrecht ist –, muss das angesprochen werden. Und das ist nicht einfach.
Es ist nicht so, dass in China ein Außenminister gerne diesen Dialog aufgreift, ganz im Gegenteil, dort wird hart darum gerungen, diesen Punkt überhaupt von der Tagesordnung zu nehmen.
Es herrscht auch in Saudi-Arabien keine große Freude, wenn man über Rechte anderer Religionen spricht, aber es ist notwendig, selbstverständlich.
Ich mache das auch in Nigeria. Auf dem afrikanischen Kontinent erleben wir derzeit die größte Verfolgung. Insbesondere in jenen Ländern, in denen es muslimische und christliche Bevölkerung gibt, gibt es einen unglaublichen Konflikt zwischen beiden Gruppen. Das kann und darf nicht so enden, dass dort Anschläge auf Christen, die die Kirche verlassen, verübt werden, dass es jeden Sonntag blutige Auseinandersetzungen gibt, egal, ob in Ägypten, in Nigeria, mit Boko Haram oder all den anderen Terrororganisationen. Dagegen müssen wir auftreten! Das ist notwendig! Und ich hoffe, dass alle österreichischen Parlamentarier für eine solche österreichische Außenpolitik sind. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
Wir haben aber auch, meine Damen und Herren, im Rahmen der Europäischen Union unsere Spuren hinterlassen, denn es ist notwendig, dass wir in der Europäischen Union dort, wo wir einen neuen auswärtigen Dienst schaffen, auch diesem auswärtigen Dienst den Auftrag geben, auf Fragen der Verfolgung von religiösen Minderheiten besonderen Wert zu legen.
Das war keine einfache Aufgabe, weil es so wie in der SPÖ oder bei den Grünen bei uns natürlich auch in der Europäischen Union viele gibt, die dieses Thema gerne hintanstellen wollen – und das ist nicht richtig. Wir haben uns durchgesetzt, und wir haben heute einen Europäischen Auswärtigen Dienst, in dessen Leitlinien aufgenommen wurde, dass jedes Jahr genau über dieses Thema in all diesen Ländern, in denen es Probleme gibt, Berichte zu legen sind und ein Frühwarnmechanismus zu entwickeln ist, nämlich wo sich abzeichnet, dass das ein blutiger Konflikt wird, wo Vertreibung einsetzt, wo Menschen verfolgt werden, dass wir genau dort reagieren, nämlich auch mit den Hebeln, die wir haben – und die haben wir.
Entwicklungszusammenarbeit wird weltweit am meisten von der Europäischen Union gefördert. Und wenn es kein Geld gibt, meine Damen und Herren, sind alle Regierungen gesprächsbereit. Aber das müssen wir einsetzen, und dazu müssen wir uns gemeinsam bekennen. Heute haben wir Leitlinien in der Europäischen Union, die dem auswärtigen Dienst diesen Auftrag mitgeben, und das war eine österreichische Initiative, auf die ich stolz bin. (Beifall bei der ÖVP.)
Wir haben aber auch im Bereich der UNO – ich habe schon gesagt, seit zwei Jahren sind wir Mitglied im Menschenrechtsrat – genau dieses Thema zu einem Schwerpunktthema gemacht, mit vielen Veranstaltungen in Genf, mit vielen Initiativen, die wir dort bei den Behandlungen der einzelnen Länder, wenn es um Menschenrechte geht, mit auf die Tagesordnung genommen haben. Wir haben dafür auch sehr viel Unterstützung von anderen bekommen. Wir als Österreich haben in der UNO insgesamt, glaube ich, einen Stellenwert, gerade was die Fragen von Menschenrechtsverletzungen betrifft, um den uns andere beneiden. Und diesen Weg werden wir fortsetzen.
Ich plane für Ende Juni dieses Jahres, 20 Jahre nach der großen Wiener Menschenrechtskonferenz, die damals Menschenrechte auf die universelle Ebene gehoben hat, wieder eine Konferenz zu veranstalten, bei der wir dieses Thema besonders ins Zentrum stellen.
Ich habe die Allianz der Zivilisationen nach Wien eingeladen. Ende Februar gab es hier in Österreich eine große Konferenz dazu. Ein Thema war die Frage der Religionsfreiheit. Es ist eben für viele Länder, insbesondere arabische Länder, nicht angenehm, sich Kritik gefallen lassen zu müssen, aber es ist notwendig, auch dort den Finger in die Wunde zu legen – das tun wir, und das werden wir auch in Zukunft tun.
Lassen Sie mich noch ein Letztes erwähnen, weil es mir besonders wichtig erscheint: Wer einmal Menschenrechte verletzt, sei es die Religionsfreiheit oder andere, der wird sich nicht scheuen, das fortgesetzt wieder zu tun. Und wenn wir jetzt in dieser Hinsicht erleben, dass Menschenrechte mit Füßen getreten werden, dass man die Person und die Würde des Menschen damit verletzt, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass insgesamt Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und die Hochhaltung der persönlichen Werte und Rechte eines Menschen auch mit Füßen getreten werden. Das dürfen wir einfach nicht zulassen. Das ist meine tiefste und feste Überzeugung. Und Länder wie Österreich, wo wir in dieser Hinsicht nicht wirklich mit wahren Problemen zu kämpfen haben, müssen sich dafür besonders stark machen. Das ist ein Auftrag an uns, an unsere Werte in diesem Land. (Beifall bei ÖVP, SPÖ und Grünen.)
Meine Damen und Herren! Ich bedanke mich daher dafür, dass dieses Thema gewählt wurde. Wir werden das mit aller Konsequenz vom Außenministerium aus verfolgen,
aber ich bitte auch alle Parlamentarier, die im Europarat tätig sind, die auch zu internationalen Konferenzen fahren, dieses Thema immer wieder auch dort anzusprechen, wo es so viele Probleme gibt. Wir sehen zunehmend diesen Trend, der natürlich auch uns mit belastet.
Wir brauchen uns nichts vorzumachen: Wenn es auf dem afrikanischen Kontinent Konflikte gibt in die Richtung, dass Minderheiten vertrieben werden, wenn die Kopten – 20 Millionen in Ägypten – vor solch fundamentale Probleme gestellt werden und beginnen, das Land zu verlassen, dann werden wir Europäer ganz automatisch auch davon betroffen sein. Auch das ist eine Folge, die wir uns immer wieder bewusst machen müssen.
Darum war es, glaube ich, richtig, heute dieses Thema zu wählen, und ich bedanke mich bei allen, die engagiert an dieser Diskussion teilnehmen und sich zu dieser gemeinsamen Zielsetzung bekennen. – Vielen Dank. (Beifall bei der ÖVP und bei Bundesräten der SPÖ.)
9.49
Präsident Edgar Mayer: Ich danke dem Herrn Vizekanzler.
Ich darf darauf aufmerksam machen, dass die Redezeit aller weiteren Teilnehmer an der Aktuellen Stunde nach Beratung in der Präsidialkonferenz 5 Minuten nicht übersteigen darf.
Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat Dönmez. – Bitte, Herr Kollege.
9.49
Bundesrat Efgani Dönmez, PMM (Grüne, Oberösterreich): Sehr geehrter Herr Vizekanzler! Hohes Präsidium! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Werte ZuseherInnen zu Hause! „Initiative für Religionsfreiheit und gegen Christenverfolgung“ ist das Thema dieser Aktuellen Stunde. Unter der politischen Federführung der ÖVP und durch finanzielle Unterstützung von Saudi-Arabien wurde unter dem Deckmantel des interreligiösen Dialoges ein King-Abdullah-Zentrum in Wien installiert. Ein Land, in dem Christen und Angehörige anderer Religionen Verfolgungen ausgesetzt sind, finanziert nicht nur ein interreligiöses Dialogzentrum in Österreich, sondern auch bestimmte terroristische Gruppierungen.
Das doppelbödige Spiel der ÖVP ist genau an dieser Themensetzung der Aktuellen Stunde erkennbar: auf der einen Seite sich gegen Christenverfolgung einzusetzen und auf der anderen Seite jene salonfähig zu machen und zu hofieren, die im eigenen Land Christen und Angehörige anderer Religionen verfolgen. Das ist ein Spiel, welches in Österreich mit politischer Unterstützung der Regierungsparteien an Kabarettreife kaum zu übertreffen ist.
Eine einzige Abgeordnete in dieser Kammer – bis auf die Kolleginnen und Kollegen der freiheitlichen Fraktion – hat dagegen gestimmt, nämlich Kollegin Anneliese Junker von der ÖVP, die da Standhaftigkeit bewiesen hat.
Ihre Weltanschauung und ihre gesellschaftliche Einstellung gegenüber Frauen, ethnischen Minderheiten, religiös Andersgläubigen und ihre wirre Interpretation des Islams sind allzu bekannt. Und mit Leuten aus diesem Dunstkreis suchen Sie den Dialog, das sind Ihre Ansprechpartner für die Lösung der Probleme.
Wissen Sie, was wirklich ein Lösungsansatz wäre? – Wenn man erkennt, dass der Osten seine Schätze hat, die religiösen Techniken, und der Westen seine Schätze hat, die wissenschaftlichen Techniken. Und wenn sich diese treffen könnten, könnte diese Welt zum Paradies werden. Dann wäre es nicht mehr notwendig, sich nach einer anderen Welt zu sehnen. Wir sind zum ersten Mal in der Lage, hier auf dieser Erde das
Paradies zu schaffen, und wenn wir es nicht tun, dann liegt das nur an uns, kein anderer ist dafür verantwortlich!
Ich bin für eine Welt, eine Menschheit und letztlich eine Wissenschaft, die beides umfassen, die Verbindung von Religion und Wissenschaft, eine Wissenschaft, die sich sowohl um die äußere als auch um die innere Welt kümmert. Angehörige einer Religion, welche Angehörige einer anderen Religion oder Atheisten verfolgen, erniedrigen, ihnen Rechte vorenthalten, sie sogar ermorden, haben den Kern, welcher allen Religionen zugrunde liegt, nicht verstanden.
Wir dürfen einander nicht als Fremde betrachten. Wir sind die Früchte eines Baumes und die Blätter eines Zweiges. Und ich bin der tiefsten Überzeugung, dass keiner das Recht hat – keiner! –, sich über den anderen zu erheben. (Bundesrat Kneifel: Jetzt wird es lyrisch!) Blindheit und Hass haben seit Jahrtausenden die Menschheit an den Abgrund geführt, zumeist geführt von zwei Kräften: der Politik und einer instrumentalisierten Religion. Wahre Religion bedarf keiner politischen Instrumentalisierung. Wahre Religion kommt aus dem Inneren des Menschen, so wie das Haci Bektas Veli bereits im 13. Jahrhundert gesagt hat: Was immer du auch suchst, suche es in dir!
Die Trennung von Staat und Religion bedeutet für mich nicht, Religionen zu verbieten oder Gläubige als Staatsbürger zweiter Klasse zu behandeln. Als Beispiel möchte ich hier die Türkei anführen. Was ist passiert? – Die ehemals säkular-kemalistische Elite des Landes hat genau durch diese Verhaltensweisen bewirkt, dass jetzt eine islamisch-islamistische Elite diese abgelöst hat. Die Situation der religiösen Minderheiten wie etwa der Christen oder der Aleviten in der Türkei sorgt nach wie vor für Diskussionsstoff, insbesondere das Kloster Mor Gabriel oder auch die Nichtanerkennung des Alevitentums als eigenständige Religion in der Türkei, wo die meisten Aleviten und Alevitinnen leben.
Österreich hat da eine Vorreiterrolle eingenommen, und darauf können wir alle stolz sein. Österreich hat die 60 000 Aleviten und Alevitinnen, die in Österreich leben, als eigenständige Religionsgemeinschaft anerkannt. Damit haben sie natürlich Rechte erhalten, die ihnen bis vor Kurzem noch vorenthalten wurden.
Die Situation der religiösen Minderheiten in anderen Ländern steht ebenfalls unter internationaler Beobachtung, seien es Verfolgungen gegenüber den Bahai im Iran oder den christlichen Minderheiten in den arabischen Ländern, den Zeugen Jehovas in Russland oder in der Ukraine oder auch in der Türkei und in Aserbaidschan wegen der Wehrdienstverweigerung. Aber auch Angehörige des jüdischen Glaubens werden seit Tausenden von Jahren verfolgt, und ihnen wird von manchen Gruppen und Bewegungen jegliche Existenzberechtigung abgesprochen.
Angehörige dieser Religionen sind nach wie vor mehr oder weniger Gewalt ausgesetzt, und an der Spirale der Gewalt wird im Zuge der Umbrüche in der arabischen Welt mit unüberschaubarer Geschwindigkeit gedreht, die Gewalt nimmt dramatisch zu. Da spielen eine doppelbödige Politik und auch eine falsch interpretierte und instrumentalisierte Religion eine wesentliche Rolle.
Sehen wir uns die Situation etwas genauer an: Was erkennen wir? Wer verfolgt wen? Wer bekommt von wem Unterstützung? Wer finanziert Waffen? Welche Allianzen – innerislamisch und seitens der westlichen Mächte – werden eingegangen? Welche Rolle spielen die Machteinflüsse des Westens im Kampf um Absicherung und Zugang zu den Ressourcen?
Wir befinden uns im Krieg! Wir befinden uns im Krieg um die verbleibenden und knapper werdenden Ressourcen. Die Religion wird dabei missbraucht, um die Massen zu mobilisieren. Wer würde schon in den Krieg ziehen, damit wir genügend Treibstoff für unsere Tanks bekommen? Durch eine falsch verstandene und instrumentalisierte Reli-
gion gepaart mit politischen Interessen werden Angehörige zuerst diffamiert, ausgegrenzt und dann verfolgt. Diese Systematik ist ja nichts Unbekanntes und tritt seit Menschengedenken in unterschiedlichen Schattierungen zutage. (Präsident Mayer gibt das Glockenzeichen.)
Deswegen ist es meiner Meinung nach extrem wichtig, dass wir in der Politik, aber auch in den Religionen Menschen haben, die das Gemeinsame in den Vordergrund stellen und nicht das Trennende heranziehen – ohne alles gleichzumachen. Wir sind nicht alle gleich, und die Gesellschaft lebt von Vielfalt. Dazu gehören religiöse Menschen und Atheisten. Keiner hat das Recht, sich über den anderen zu stellen, und jeder hat die Pflicht, hinzusehen, wo Unrecht geschieht – egal, von wem wem gegenüber.
Ein Nebensatz sei mir noch erlaubt: Wenn sich die Kollegin von der FPÖ hier gegen die Verfolgung von religiösen Minderheiten in unterschiedlichen Ländern stark macht, dann werden ihre Aussagen meiner Meinung nach dann authentisch und glaubhaft, wenn die FPÖ auch gegenüber Asylsuchenden, Asylwerbern nicht mehr diese ablehnende Haltung zeigt (Zwischenruf der Bundesrätin Mühlwerth), wie das bis dato der Fall ist. (Bundesrat Kneifel: Wann und wo?) Letztendlich zählen nicht die Worte, sondern die Taten, die wir setzen. – Danke. (Beifall bei Grünen und SPÖ.)
9.57
Präsident Edgar Mayer: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Kollege Köberl. – Bitte.
9.57
Bundesrat Günther Köberl (ÖVP, Steiermark): Geschätzter Herr Präsident! Geschätzter Herr Vizekanzler! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zuseherinnen und Zuseher zu Hause an den Fernsehgeräten! Lassen Sie mich mit einem Zitat beziehungsweise mit Ausführungen von Papst Benedikt XVI. in seiner Botschaft zum Weltfriedenstag 2011 beginnen:
„Die Christen sind gegenwärtig die Religionsgruppe, welche die meisten Verfolgungen aufgrund ihres Glaubens erleidet. Viele erfahren tagtäglich Beleidigungen und leben oft in Angst wegen ihrer Suche nach der Wahrheit, wegen ihres Glaubens an Jesus Christus und wegen ihres offenen Aufrufs zur Anerkennung der Religionsfreiheit.“
Ich darf mich dafür bedanken, dass es möglich war, das Thema „Initiative für Religionsfreiheit und gegen Christenverfolgung“ heute zum Thema der Aktuellen Stunde zu machen.
Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass bei diesem Thema in diesem Haus nicht mehr Einigkeit herrscht, und ich darf eingehend auf meine Vorredner drei Vorbemerkungen machen.
Frau Vizepräsidentin Kurz, mich hat gefreut, dass du dann doch den Hauptteil deiner Rede einem wichtigen Thema und nicht der Eingangsbemerkung gewidmet hast. Das hat mich ein bisschen an das Gleichnis von der „verlorenen Tochter“ erinnert, weil dir das ja anscheinend doch sehr wichtig war.
Frau Kollegin Mühlwerth hat gesagt, dass sie dazu bisher nichts gehört hat. – Ich darf dir, Frau Kollegin, anschließend eine Liste mit den österreichischen Aktivitäten, vor allem den Aktivitäten unseres Vizekanzlers und Außenministers übergeben. Das sind nur die Aktivitäten der letzten zwei Jahre. Der Herr Vizekanzler hat es auch in seiner Rede klargestellt: Das ist ihm ein persönliches Anliegen. Und in diesem Zusammenhang wurde von österreichischer Seite – einem im internationalen Vergleich kleinen Land – viel erreicht.
Kollege Dönmez hat auch gesagt, der Dialog ist wichtig, das Miteinander ist wichtig, obwohl er sich gegen den Dialog ausgesprochen hat; die Darstellung des Paradieses
wäre eine eigene Diskussion, die wir führen könnten. Letzten Endes bemühen wir alle uns darum.
Ich möchte mich bei dir, Herr Vizekanzler, für deinen persönlichen Einsatz bedanken. Wir haben schon einige Dinge gehört. Vor allem der Europäische Auswärtige Dienst, dass dieses Instrumentarium geschaffen wurde, ist dein persönliches Verdienst, und das ist auch ein Verdienst der Bemühungen Österreichs.
Es geht letzten Endes um die weltweite Durchsetzung der Religionsfreiheit als elementares Grund- und Menschenrecht. Kollegin Kurz hat den Artikel 18 angesprochen. Ich möchte das hier auch noch einmal festhalten. Wie wir wissen und schon gehört haben, hat die Diskriminierung und Verfolgung religiöser Minderheiten beziehungsweise von Menschen aufgrund ihres Glaubens in den letzten Jahren in vielen Staaten ein besorgniserregendes Ausmaß angenommen. Die Religionsfreiheit ist in mehr als 60 Ländern der Erde – das muss man sich vorstellen! –, in denen zusammen rund 70 Prozent der Weltbevölkerung leben, sehr stark eingeschränkt oder gar nicht vorhanden.
Religiöse Minderheiten sind dort vielfach von Gewalt und gesetzlichen Einschränkungen betroffen. Menschen werden wegen ihres Glaubens nicht nur diskriminiert, sie verlieren auch ihre Arbeit – was das bedeutet, kann sich jeder vorstellen – und ihre Wohnung. Sie werden inhaftiert, entführt, verstümmelt und ermordet. Und, wie wir gehört haben, Kirchen und religiöse Einrichtungen werden niedergebrannt und die Häuser zerstört.
Eine dramatische Entwicklung erleben Christen derzeit in manchen Ländern des Nahen und Mittleren Ostens, in Afrika und in Asien. Lassen Sie mich dem ein paar kurze Beispiele hinzufügen.
Lebten vor 100 Jahren noch etwa 20 Prozent Christen auf dem Gebiet der heutigen Türkei, so beträgt ihr Anteil heute nur noch 0,1 Prozent. Ich wiederhole: 0,1 Prozent! Im Irak lebten vor dem Krieg rund 1,4 Millionen Christen, derzeit sind es nur noch rund 700 000, also die Hälfte.
Der jährliche Weltverfolgungsindex wurde angesprochen. Nummer eins: Nordkorea; Nummer zwei: Saudi-Arabien; aber, was viele nicht gewusst haben, auf Platz 6 befinden sich die Malediven, die wir sonst nur als Urlaubsparadies kennen.
Es sei mir gestattet, abschließend noch ein paar Bemerkungen zu Nordkorea zu machen, weil wir dieses Land und die Führung dieses Landes in den letzten Tagen besonders erlebt haben. Es stellt sich die Frage, wie berechenbar oder wie zurechnungsfähig die Führung dieses Landes ist.
Noch vor 100 Jahren galt Nordkoreas Hauptstadt mit etwa 100 Kirchen als das Jerusalem des Ostens. Unter Präsident Kim Jong-il verschwanden jedoch innerhalb kurzer Zeit über 2 000 Gemeinden. Das Land ist tief geprägt von einem traditionellen stalinistischen Personenkult, durch den der verstorbene Diktator Kim Jong-il quasi zum Gott erhoben wird. Die derzeitige Führung unter Kim Jong-un setzt den Weg der Verehrung weiter fort. (Präsident Mayer gibt das Glockenzeichen.)
Ich komme schon zum Schluss. Ich glaube, es liegt letzten Endes an uns allen, dass wir dieses Thema bei allen Gelegenheiten, die sich uns bieten, auch als Mandatare bei Tagungen, bei Sitzungen oder bei anderen Besprechungen zum Thema machen. Das Motto heißt nämlich nicht nur: Wir dürfen nicht wegschauen, wir sollen hinschauen!, sondern auch: Wir sollen auch handeln!
Und du bist ein Beweis dafür, Herr Vizekanzler, dass es gelingen kann, wenn man sich bemüht und stetig an diesem Thema arbeitet. Dafür möchte ich mich sehr herzlich bedanken. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
10.04
Präsident Edgar Mayer: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Bundesrat Ing. Androsch. – Bitte, Herr Kollege.
10.04
Bundesrat Ing. Maurice Androsch (SPÖ, Niederösterreich): Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Vizekanzler! Werte Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Herren an den Fernsehgeräten! Wir haben es schon gehört, die Zahlen sind schon mehrmals genannt worden: Mehr als 150 Millionen Menschen, in manchen Medien wird von 250 Millionen Menschen gesprochen, Christen, werden weltweit verfolgt. Das ist bekannt. Das sind 70 bis 75 Prozent. In der Diskussion ist aber auch deutlich herausgekommen, dass auch 25 bis 30 Prozent aller anderen Religionsangehörigen verfolgt werden. Ich begrüße prinzipiell diese heutige Initiative, die gestartet worden ist, wenngleich ich auch der Meinung bin, dass es auch noch viele andere wichtige europäische Themen gäbe. Trotzdem begrüße ich diese Initiative, dass hier darüber diskutiert wird, welchen Ansatz wir finden müssen, damit die Verfolgung religiös tätiger Menschen hintangehalten werden kann.
Diese Verfolgung richtet sich hauptsächlich gegen Christen, daher ist das auch ein wichtiges Schwerpunktthema. Aber eines haben wir gelernt, eines haben wir diskutiert, und ich habe das auch aus den verschiedensten Redebeiträgen mitgenommen: Das Wichtigste in der ganzen Aufarbeitung dieser Dinge, dieser Vorkommnisse, die in der Vergangenheit passiert sind, ist letzten Endes der Dialog zwischen den und die Akzeptanz anderer Kulturen.
Auch das Haus Europa hat hier viele Aufgaben zu erfüllen, denn Diskriminierung, Verfolgung finden ja nicht nur im Falle der Gefährdung von Leib und Leben oder des tragischen Vorfalls, wenn jemand zu Tode kommt oder wenn Massen an Menschen durch terroristische Vorgangweisen getötet werden, statt, sondern auch in verschiedenen einzelnen Fällen, am Arbeitsplatz, in den Familien, im Privatleben, im sozialen Umgang miteinander, zwischen den Geschlechtern; also in vielen Facetten. Meine Vorrednerin hat es angesprochen, das gilt auch für die Verstümmelung von Frauen in verschiedensten Religionen. Das sind inakzeptable Vorgangsweisen, die wir als westliches Land, als demokratisches Land nicht akzeptieren können.
Daher sind wir auch gezwungen, uns damit auseinanderzusetzen, ob der Weg, den wir bisher gegangen sind, der richtige war, wenn ich von profunden Kennern auch der christlichen Kirchen höre, dass wir zurzeit eine Christenverfolgung erleben, die ständig im Steigen begriffen ist. Wenn die Christenverfolgung ständig steigt, müssen wir uns fragen, was wir dagegen getan haben und was wir auch in Zukunft tun müssen. Daher begrüße ich jede Initiative, die letzten Endes zu einem Dialog führt, um zwischen den einzelnen Religionen, egal, in welchen Bereichen wir sind, den Dialog voranzutreiben.
Ich halte nichts davon, wenn wir mit Ausgrenzung beginnen oder gar in Richtung von Einreiseproblematiken gehen. Das müssen wir natürlich tun, wenn es darum geht, die terroristischen Kräfte herauszufinden. Wir müssen aber auch schauen, dass wir da in Europa unsere Aufgaben erfüllen, um keinen Nährboden dafür zu schaffen, dass es hier extremistische Bewegungen geben kann. Das ist besonders wichtig.
Wenn wir uns die Länder ansehen, in denen in den letzten Jahren – wie auch im Bericht 2013 von Open Doors zu sehen ist – die Verfolgung wieder deutlich gestiegen ist, dann sehen wir, dass das immer unter den Rahmenbedingungen eines sozial schwachen Arbeitsmarktes in problematischen Gegenden geschieht. Das ist ein Nährboden. Da müssen wir sehr vorsichtig sein, und daher müssen wir gute Ansätze in Europa finden. Ich denke, dass das vereinte Europa ein Haus ist, das ein Vorzeigebeispiel für die ganze Welt sein kann.
Ich habe in der Vergangenheit gerade in Afrika verschiedenste Länder besucht, wo dieser Dialog vorangetrieben worden ist. Ich bin bekennender Christ, auch ausübender
Katholik, und ich war bei diesen Dialogen dabei, zum Beispiel auch in Tansania, einem Land, das erst kürzlich neu auf die Liste von Open Doors im Ranking der Länder, wo Christen verfolgt werden, wo Angehörige anderer Religionen verfolgt werden, hinzugekommen ist; wohlgemerkt schwerpunktmäßig auf Sansibar, aber doch. Und daher glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, in diesen Dialog einzutreten und vieles neu zu überdenken, was zu tun ist.
Herr Präsident, erlauben Sie mir, da das heute meine letzte Plenarsitzung ist, mich noch eine Minute lang von diesem Hause zu verabschieden. (Präsident Mayer: Du bist in der Zeit, Herr Kollege!) – Danke schön. Ich habe das Licht blinken gesehen; war ein bisschen voreilig. Aber da meine Vorrednerin ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen hat, spare ich wieder Zeit ein.
Ich möchte mich hier an dieser Stelle sehr, sehr herzlich bei Ihnen bedanken. Ich bin seit einigen Monaten in diesem Haus tätig und habe hier sehr viel Toleranz untereinander und sehr interessante Diskussionen und Vielfältigkeit erlebt. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ich bin hier herinnen kein Urgestein geworden, weil ich in Zukunft Aufgaben in der niederösterreichischen Landesregierung übernehmen werde, und ich darf sagen, ich bin einer, der zuerst hier in den Bundesrat gekommen ist und das Haus von innen kennengelernt hat. Ich bin sehr stolz darauf, hier Bundesrat gewesen zu sein, und ich bin sehr stolz darauf, mit Ihnen zusammengearbeitet zu haben und zusammenarbeiten zu dürfen. Ich würde mir wünschen, dass wir diesen Dialog in dieser Breite weiterhin aufrechterhalten.
Ich danke Ihnen für die Aufnahme in diesem Haus und wünsche Ihnen alles Gute. Sie haben in mir auch in Zukunft einen Verfechter dieser Kammer. – Ich danke Ihnen. (Allgemeiner Beifall.)
10.09
Präsident Edgar Mayer: Herzlichen Dank, lieber Kollege Maurice Androsch! Wir freuen uns über die lobenden Worte, die du für den Bundesrat gefunden hast. Du wirst in Niederösterreich ein flammender Verfechter dieser Länderkammer sein. Darauf sind wir auch besonders stolz. Dir alles Gute und viel Erfolg. (Allgemeiner Beifall.)
Als Nächste zu Wort gelangt Frau Bundesrätin Michalke. – Bitte, Frau Kollegin.
10.10
Bundesrätin Cornelia Michalke (FPÖ, Vorarlberg): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Minister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer! Hurra, der Wahlkampf ist gestartet! Spätestens nach deiner Rede, geschätzte Frau Vizepräsidentin – jetzt ist sie leider gerade nicht im Saal –, ist mir klar, dass das Thema, das heute gewählt wurde, eigentlich noch wichtiger ist, als ich ursprünglich angenommen hatte. Diese Wertediskussion erst jetzt zu führen, das finde ich schon fast ein bisschen zu spät. Und ich bin stolz darauf, als Vertreterin einer politischen Partei sagen zu können, dass wir schon vor Jahren darauf aufmerksam gemacht haben, dass wir stolz auf unsere Tradition und stolz auf unsere Werte sein dürfen, sein müssen und das auch öffentlich deklarieren müssen und nicht nur in Toleranz und Ergebenheit alles erdulden müssen, was von anderen Seiten auf uns zukommt.
Zu Ihrem Redebeitrag, Herr Minister, möchte ich sagen: Selbstverständlich ist es sehr lobenswert, wenn Sie sich auf außenpolitischer Bühne für dieses Thema starkmachen, aber es ist natürlich auch Ihre Pflicht, das zu tun. Sie haben die Werte der österreichischen Gesellschaft entsprechend zu vertreten, und wenn Sie das tun, dann ist das lobenswert, aber auch Ihre Pflicht.
Zu den Werten, die heute angesprochen wurden. Die Aussage unserer Kollegin Kurz hat mich sehr verwundert, da doch von der Seite der Linken normalerweise Minder-
heiten als Opfer dargestellt werden, die immer schützenswert sind, egal, ob es sich um eine Einzelperson oder um eine kleine Gruppe handelt. Aber speziell in diesem Fall, in dem es ja um die Christen geht, also weltweit gesehen auch eine Minderheit, gibt es das jetzt nicht mehr. Das hat mich ein bisschen verwundert. Wie das geht, kann man auch im Buch „Unter Linken“ von Jan Fleischhauer nachlesen. Er hat das sehr schön aufgelistet; und man weiß, wie das funktionieren würde.
Noch einmal zum Thema: Leider Gottes wird dieses Wertethema von aktuellen und brisanten Themen, wie Frau Kollegin Kurz es angesprochen hat, überdeckt. Leider ist nicht in den Köpfen aller, dass tatsächlich über 200 Millionen Christen aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden. 200 Millionen bis 400 Millionen Christen – das sind schon Zahlen, die man sich noch einmal ins Gedächtnis rufen muss – werden wegen ihres Glaubens diskriminiert. Und Jahr für Jahr werden bis zu 175 000 Christen wegen ihres Glaubens ermordet!
Die Länder, in denen diese Dinge passieren, muss ich nicht noch einmal aufzählen. Aber auch in Deutschland und selbstverständlich gerade auch bei uns in Europa findet das tagtäglich statt. Es findet auch bei Menschen statt, die zum Beispiel vom islamischen zum christlichen Glauben konvertiert sind. Diese Menschen haben Angst, teilen dies zum Teil gar nicht mit, bekennen sich gar nicht offiziell dazu, weil sie diskriminiert werden, in Bedrängnis gebracht werden, verfolgt werden und manchmal auch wegen einer Konversion zu einem anderen Glauben zu Tode kommen. Und diese verfolgten, bedrängten und diskriminierten Christen sind auf unsere Solidarität angewiesen.
Aber gerade in Europa, gerade hier bei uns wird auf diese Christen nach wie vor allzu oft vergessen. Und im christlich-islamischen Dialog, den wir heute ja auch schon angesprochen haben, gelten sie hauptsächlich als Dialogverhinderer, und es muss schon fast ein drohendes Todesurteil im Raum stehen, damit sich etwa die offizielle Meinung positiv zur Religionsfreiheit äußert.
Es gibt einige Menschenrechtsorganisationen, die sich für verfolgte Christen einsetzen. Es wäre wünschenswert, wenn sich viele Christen diesen Hilfswerken und ihrer wichtigen Arbeit für verfolgte und bedrängte Christen zuwenden würden und diese unterstützen würden. Aber zumeist gilt die Arbeit dieser Organisationen als politisch nicht korrekt. Vor allem wenn es um Christenverfolgung in Ländern islamischen oder auch kommunistischen Hintergrundes geht, ist diese politisch nicht korrekte Art ein Thema.
Es ist wichtig, diese ideologische Barriere zu durchbrechen und die Auseinandersetzung mit der Christenverfolgung auf die politische Agenda zu setzen. Wir müssen uns viel, viel häufiger damit beschäftigen.
Nun ein kleiner Exkurs in meine private Geschichte, ich möchte einfach noch zeigen, wie weit solch ein Fanatismus gehen kann. Wie Sie alle wissen, war ich viele Jahre in Algerien wohnhaft und wollte gerne ein algerisches Kind aus einem Waisenhaus adoptieren. (Präsident Mayer gibt das Glockenzeichen.) – Das erzähle ich jetzt noch fertig. (Präsident Mayer: Ich bitte um eine kurze Geschichte! – Heiterkeit.)
Ich habe versucht, ein Kind von dort zu adoptieren, und habe mit der Unterstützung von hoher Ebene, von Ärzten versucht, diesen Weg zu beschreiten. Und wie ein Menschenrecht dort tatsächlich gesehen wird, hat sich gezeigt: Ich durfte kein Kind adoptieren, weil ich keine Muslima war und natürlich auch nicht konvertiert bin. Also es ist wichtiger, einen bestimmten Glauben zu haben, als einem Kind eine Zukunft bieten zu können, die vielleicht eine bessere gewesen wäre. (Beifall bei FPÖ und ÖVP.)
10.16
Präsident Edgar Mayer: Zu einer abschließenden Stellungnahme hat sich noch einmal Herr Vizekanzler Dr. Spindelegger zu Wort gemeldet. – Bitte.
10.16
Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger: Herr Präsident! Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Zunächst möchte ich mich herzlich für die Diskussion bedanken. Sie zeigt, wie wichtig dieses Thema ist, auch wenn die Emotionen da und dort hochgehen. Das macht nichts, wir müssen nur dranbleiben. Und das ist meine wesentliche Auftragssituation, die ich als Außenminister auch von dieser Diskussion mitnehme.
Lassen Sie mich noch zwei Bemerkungen zu Aussagen machen, die im Laufe der Diskussion gefallen sind! Ja, ich weiß schon, manche haben betreffend dieses Dialogzentrum, das wir in Österreich gemeinsam mit anderen Ländern gegründet haben, alle möglichen Befürchtungen. Ich kann Sie beruhigen: Es geht um den Dialog, und wer den Dialog will, der baut der Gewalt vor. Darum sind wir für diesen Dialog – auch in Österreich –, und das sollten wir immer ins Zentrum rücken. (Beifall bei der ÖVP.)
Ich darf auch Herrn Kollegen Dönmez noch einmal in Erinnerung rufen: Was glauben Sie, warum der Generalsekretär der Vereinten Nationen Ban Ki-moon an der Eröffnungsfeier teilgenommen hat, warum Kardinal Tauran als persönlicher Vertreter von Papst Benedikt teilgenommen hat (Bundesrat Dönmez: Weil die eine Strategie verfolgen!), warum der griechisch-orthodoxe Ökumenische Patriarch von Konstantinopel Bartholomäus teilgenommen hat, warum der Oberrabbiner David Rosen teilgenommen hat? – Deswegen, weil das ein wahhabitisches Zentrum ist, wohl nicht. Sie werden mir schon gestatten, dass ich das sicher immer in Abrede stelle. Es geht um den Dialog, der ist gut und richtig.
Lassen Sie mich mit einem schließen – das hat mich wirklich innerlich getroffen, was Sie gesagt haben –: Die wahre Religion kommt aus dem Inneren.
Wissen Sie, warum mich das trifft? – Das sind genau die Worte, die mir immer in all den arabischen Ländern entgegenkommen: Die wahre Religion kommt aus dem Inneren. Und unausgesprochen der zweite Satz: Und dort muss sie auch bleiben.
Nein, meine Damen und Herren! Es ist ein Menschenrecht, dass ich meine Religion auch nach außen bekennen darf, ohne dass ich verfolgt werde, ohne dass ich vertrieben werde. Das ist nämlich der Unterschied, meine Damen und Herren. (Beifall bei der ÖVP sowie bei Bundesräten von SPÖ und FPÖ.)
Darum bitte ich Sie wirklich: Hören Sie auf mit solchen Sätzen, die uns gerade die islamischen Vertreter immer wieder entgegenhalten! Nein, das ist falsch! (Zwischenruf des Bundesrates Dönmez.) Es ist ein Menschenrecht, dass man Religions- und Gewissensfreiheit in aller Öffentlichkeit betreiben kann, und dafür werden wir von der österreichischen Außenpolitik uns weiter einsetzen. – Vielen Dank. (Beifall bei ÖVP und SPÖ sowie bei Bundesräten der FPÖ.)
10.19
Präsident Edgar Mayer: Herzlichen Dank, Herr Vizekanzler und Außenminister Dr. Spindelegger.
Die Aktuelle Stunde ist beendet.
Ankündigung einer Erklärung des Präsidenten des
Ausschusses der Regionen gemäß § 38a GO-BR
Präsident Edgar Mayer: Ich gebe bekannt, dass der Präsident des Ausschusses der Regionen Ramón Luis Valcárcel Siso seine Absicht bekundet hat, eine Erklärung gemäß § 38a der Geschäftsordnung des Bundesrates zum Thema „Die Rolle der Regionen in einem sich schnell wandelnden Europa“ abgeben zu wollen.
Zum geplanten Ablauf teile ich mit, dass der Herr Präsident beabsichtigt, seine Rede in spanischer Sprache zu halten, weshalb für eine Simultanübersetzung Vorsorge getroffen wurde. Ich darf daher bitten, die vorbereiteten Kopfhörer auf den Pulten zu verwenden, damit die Erklärung auf Deutsch beziehungsweise auf Spanisch mitverfolgt werden kann.
Bevor ich nun dem Herrn Präsidenten das Wort erteile, gebe ich darüber hinaus bekannt, dass gemäß § 38a der Geschäftsordnung des Bundesrates im Anschluss an diese Erklärung eine Debatte stattfinden wird.
Es wurde in der Präsidialkonferenz Einvernehmen darüber erzielt, dass pro Fraktion je ein Redner/eine Rednerin der Bundesräte, auch jener ohne Fraktion, zu Wort kommt. Die Redezeit ist mit 10 Minuten beschränkt. Bei Einhaltung der Redezeit möge man sich ein Beispiel am Vizekanzler und Außenminister nehmen. Danke im Vorhinein.
Ich darf sehr herzlich in unserer Mitte den Präsidenten des Ausschusses der Regionen, Herrn Ramón Luis Valcárcel Siso, begrüßen. (Allgemeiner Beifall.)
Erklärung
des Präsidenten des Ausschusses der Regionen zum Thema
„Die Rolle der Regionen in einem sich schnell wandelnden Europa“
Präsident Edgar Mayer (in Übersetzung aus dem Spanischen): Guten Morgen, Herr Präsident! Wir möchten Sie im Bundesrat herzlich willkommen heißen. Wir freuen uns, und wir fühlen uns sehr geehrt, dass Sie zu uns zum Thema „Die Rolle der Regionen in einem sich schnell wandelnden Europa“ sprechen und dass Sie uns anschließend auch die Möglichkeit zu einer Diskussion bieten. (Allgemeiner Beifall.)
Herr Präsident, ich erteile Ihnen das Wort.
10.21
Ramón Luis Valcárcel Siso (Präsident des Ausschusses der Regionen) (in Übersetzung aus dem Spanischen): Vielen herzlichen Dank, Herr Präsident! Ich möchte mich zunächst einmal sehr herzlich bedanken für die Freundlichkeit, die Sie uns mit dieser Begrüßung in einem geradezu wunderbaren Spanisch erwiesen haben. Ich kann Ihnen da leider nichts Entsprechendes bieten, mein Österreichisch ist sehr begrenzt. Aber ich kann sagen: Herr Edgar Mayer ist ein großartiger Präsident, und ich werde mich bemühen, in seine großen Fußstapfen zu treten.
Sehr verehrte Mitglieder des Bundesrates! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Freundinnen und Freunde! Gestatten Sie, dass ich Ihnen zunächst einmal danke – Ihnen allen, und ganz konkret dem Präsidenten des Bundesrates, dem sehr verehrten Herrn Mayer – für diese Einladung, die an mich ergangen ist in meiner Funktion als Präsident des Ausschusses der Regionen.
Ich darf Ihnen heute einiges zur Rolle der Regionen in einem Europa im Wandel sagen. Das ist ein Thema, für das Sie hier wirklich auch Vorbildwirkung zeigen, unter dem Vorsitz von Präsident Mayer, der ja auch bei der Europäischen Union die österreichischen Bundesländer vertritt. Er ist ein aktiver und engagierter Europäer, der sich für dieses faszinierende und manchmal komplexe Projekt der Europäischen Union persönlich einsetzt.
Ich darf Ihnen sagen, dass es für mich eine große Ehre ist, heute in diesem Parlament zu Ihnen sprechen zu dürfen, das Zeuge einiger der wichtigsten Momente der europäischen Demokratie war. Einige der Grundpfeiler, auf denen das Europa von heute ruht, haben in diesem Saal begonnen, Gestalt anzunehmen. Das Parlament des österreichisch-ungarischen Imperiums, das 1867 eingerichtet wurde, war das erste multinationale Parlament der Welt, in dem Abgeordnete aus 17 unterschiedlichen Territorien und
acht verschiedenen Nationen der österreichisch-ungarischen Monarchie zusammenarbeiteten.
Österreich war bald ein wunderbares Beispiel dafür, wie ein demokratisches und auch friedliches Europa aussehen kann. Dieses Parlament leistete auch Pionierarbeit bei der Anerkennung der politischen Rechte der Frau, denn hier wurde zum ersten Mal in der modernen Geschichte eine Frau zur Präsidentin gewählt. Ich spreche da – und das wissen Sie alle sehr gut – von Olga Rudel-Zeynek, die dem Bundesrat im Jahr 1927 vorgesessen ist.
Nach dem ersten Weltkrieg war es ein österreichischer Politiker und Schriftsteller, Graf Coudenhove-Kalergi, der zum allerersten Mal die Vision eines geeinten Europa in seinem Buch „Pan-Europa“ darlegte – einem Buch, das dann auch zur Inspirationsquelle für viele überzeugte Europäer wurde.
Ich spreche heute zu Ihnen als Vertreter der Europäischen Union, was zeigt, dass Europa nach den Kriegen und Katastrophen der letzten Jahrhunderte endlich den Weg geschaffen hat, der es möglich macht, dass die Menschen auf diesem Kontinent in Frieden, Stabilität und Freiheit zusammenleben.
Der Bundesrat und seine Mitglieder spielen eine sehr wichtige Rolle, sowohl hier in Österreich als auch bei wichtigen Fragen im Zusammenhang mit der europäischen politischen Agenda. Deshalb bin ich ganz besonders dankbar, dass ich heute hier in diesem historischen Gebäude zu Ihnen sprechen darf.
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren Bundesräte! In den letzten Jahren hat die Europäische Union eine der schlimmsten Krisen seit Beginn des europäischen Einigungswerkes durchgemacht, und diese Krise führte dazu, dass unser Projekt der europäischen Einigung von unseren eigenen Bürgerinnen und Bürgern, aber auch von unseren Partnern in der ganzen Welt infrage gestellt wird.
Die Hauptursache für die gegenwärtige Situation ist wirtschaftlicher Natur, und deshalb wird auch unsere Priorität darin bestehen, die wirtschaftlichen Probleme zu lösen, bevor wir uns anderen Herausforderungen widmen. Wir müssen zunächst das Grundlegende in Ordnung bringen, und dafür brauchen wir eine stabile und nachhaltige Erholung auf soliden Grundlagen, um weiterzugehen auf dem Weg zu einem intelligenten, nachhaltigen und integrierenden Wachstum.
Die Europäische Union muss ihre soziale Marktwirtschaft weiter modernisieren und die Bemühungen fortsetzen, um eine Haushaltskonsolidierung zu erwirken, die wachstumsfördernd ist, wirtschaftliche Reformen und selektive Investitionen begünstigt. Auch wenn jetzt schon einige Defizite sinken und die Spannungen auf den Finanzmärkten zurückgehen, so braucht die Europäische Union doch noch mehr Reformen und auch stärkere Reformen. Diese Reformen sind politisch schwierig und haben oft auch schwerwiegende soziale Auswirkungen. In einigen Teilen Europas steigen die Arbeitslosenzahlen – vor allem auch unter der jungen Bevölkerung – auf geradezu dramatische Höhen an.
In meinem Land, in Spanien, ist die Jugendarbeitslosigkeit schon bei über 50 Prozent angelangt, und das führt, wie Sie sicherlich verstehen können, zu einer sozial und wirtschaftlich sehr besorgniserregenden Situation – zu einer Situation, die so einfach nicht bleiben kann!
Diese Herausforderungen haben uns noch deutlicher gezeigt, wie wichtig es ist, näher am Bürger zu arbeiten, bürgernahe Politiken durchzuführen, damit die Menschen spüren, dass die politisch Verantwortlichen an ihrer Seite stehen und dafür kämpfen, den Wohlfahrtsstaat und die sozialen Politiken aufrechtzuerhalten, denn darum geht es! Wir sprechen von Bildung, vom Gesundheitswesen, von der Ausbildung, wir sprechen von
den Politiken, die im Alltag den Bürger betreffen und für die wir als Vertreter der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften auch die wichtigsten Zuständigen sind.
Das ist der Grund, weshalb ich in meinem Beitrag versuchen werde, Ihnen konkrete Beispiele vorzutragen, wie lokale und regionale Körperschaften ihre Rolle spielen können bei der Anwendung und bei der Verbesserung der europäischen Politiken, in einem sehr breiten Bereich, wie etwa der Good Governance, der Wirtschaft, der Innovation, der Forschung, bis hin zum Klimawandel und zur Außenpolitik.
Für mich ist klar, dass der österreichische Bundesrat ein geradezu offensichtlicher Kanal ist, über den die österreichischen Landtage ihre Stimme auch in Europa hörbar machen, vor allem auch im institutionellen Mehrebenenkontext, der durch den Vertrag von Lissabon eingerichtet wurde. Ich möchte die grundlegende Rolle betonen, die auch die Regionen mit Gesetzgebungskompetenz spielen können, wenn es darum geht, die europäische Gesetzgebung zu beeinflussen, insbesondere wenn es um Fragen wie Wachstum und Beschäftigung in allen Gebieten Europas geht. Regionen mit gesetzgeberischer Zuständigkeit können da eine Vorreiterrolle spielen, auf allen Ebenen der Governance: im Bundesrat, im Ausschuss der Regionen, bis hin zum Ministerrat der Europäischen Union.
In diesem Sinne haben die österreichischen Regionen bei der Verabschiedung der Verordnung zum Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit eine Vorreiterrolle gespielt. Es war dank Ihrer Arbeit möglich, dass diese Verordnung unter österreichischem Vorsitz im Jahr 2006 verabschiedet werden konnte. Damit wurde eine Verhandlungsplattform im Bundesrat geschaffen. Es wurde ein ausgezeichneter Berichterstatter für den Ausschuss der Regionen bestellt, Herr Niessl. Und Sie haben auch einen wichtigen Beitrag im Team des österreichischen Vorsitzes geleistet, damit diese Verordnung die Mehrheit der Mitgliedstaaten bekommen konnte, obwohl man da anfangs auf relativ großen Widerstand gestoßen war.
Sie haben damit auch eine grenzüberschreitende Allianz der Regionen geschaffen, um dieses Thema im europäischen Raum entsprechend zu verankern. Ich möchte daher heute dem Bundesrat für diesen Erfolg herzlich danken, und ich darf Sie einladen, dieses Modell der Multi-Level Governance auch weiter anzuwenden, für die nächsten Herausforderungen, die wir nur gemeinsam bewältigen können.
Meine Anerkennung gilt auch Ihrer aktiven Nutzung der Bestimmungen des Vertrags im Zusammenhang mit der Subsidiaritätskontrolle. In den letzten drei Jahren hat der österreichische Bundesrat intensiv und systematisch die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips durch die gesetzgeberischen Vorschläge der Europäischen Union überprüft. Er hat sehr rasch Prüfverfahren hier in dieser Kammer eingerichtet, die auch die Partizipation der Landtage begünstigen.
Anerkennen möchte ich auch die wichtige Rolle, die die österreichischen Mitglieder im Ausschuss der Regionen, in unserer Institution spielen. Sie sind aktive Mitglieder, kreative Mitglieder, die auch Mut bewiesen haben, wenn es darum ging, die Rolle der nationalen, der regionalen Körperschaften in Europa zu verteidigen.
Ich glaube, dass die Regionen alle Verfahren und Mittel nützen müssten, um sich in dieses europäische Verfahren, in das System der Multi-Level Governance einzubringen. Diese Partizipation ist nicht nur eine Frage der demokratischen Theorie, sie ist auch und vor allem eine Schlüsselfrage, wenn es darum geht, Qualität und Wirksamkeit der getroffenen Entscheidungen zu garantieren und sicherzustellen, dass die Legitimität dieser Entscheidungen für die Bürgerinnen und Bürger Europas sichtbarer wird.
Gestatten Sie, dass ich in weiterer Folge darüber spreche, wie die europäischen Regionen dazu beitragen können, die Wirtschaftslage in Europa zu verbessern.
Der Ausschuss der Regionen ist der Ansicht, dass eine Stärkung der Wirtschafts- und Währungsunion in jedem Fall einen Schlüsselfaktor zur Förderung des nachhaltigen Wachstums, des sozialen Fortschritts und der besseren politischen Integration der Europäischen Union darstellt. Das ist aber nur dann möglich, wenn auch die demokratische Legitimität des Prozesses sichergestellt ist, das heißt, wenn alle Schlüsselakteure eingebunden sind. Dazu gehören das Europäische Parlament, die nationalen Parlamente und über die Partizipation der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften auch die Regionen, und da ganz besonders jene mit gesetzgeberischen Befugnissen.
Wir glauben außerdem, dass zur Sicherstellung der Anwendung der Strukturreformen der Mitgliedstaaten sogenannte Verträge zwischen den Mitgliedstaaten und den Institutionen der Europäischen Union unterzeichnet werden sollten. Diese Vereinbarungen müssten von Fall zu Fall geschlossen werden sowie Hand in Hand gehen mit einer vorübergehenden und selektiven finanziellen Unterstützung, und sie müssten ganz allgemein die Partizipation der lokalen und regionalen Körperschaften sicherstellen sowie auch die demokratische Kontrolle gewährleisten.
Was den sehr fragilen Bankensektor betrifft, so hat der Ausschuss der Regionen das Abkommen über einen einheitlichen Überwachungsmechanismus begrüßt und betont, wie wichtig es ist, die Verhältnismäßigkeit der Informationspflichten zu gewährleisten, um die Aufgabe der regionalen Banken zu erhalten, den kleinen und mittleren Unternehmen und den Projekten öffentlicher Investitionen entsprechendes Kapital zur Verfügung zu stellen.
Wir haben auch darauf hingewiesen, dass die Wirtschafts- und Währungsunion Hand in Hand gehen muss mit entsprechenden Haushaltsnormen. Und wir fordern die schnelle Verabschiedung des Legislativpakets über die Haushaltskontrolle, des sogenannten Two-Pack. Es ist aber auch da wichtig, große Sorgfalt an den Tag zu legen, um sicherzustellen, dass sich diese Normen nicht negativ auf die Finanzautonomie und die Haushaltsautonomie der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften auswirken.
Wie ich bereits erwähnt habe, ist der Ausschuss der Regionen davon überzeugt, dass, sobald die wirtschaftlichen Grundlagen ausgeglichen sind, die Wirtschaftspolitiken darauf abzielen müssen, ein starkes, nachhaltiges und integrierendes Wirtschaftswachstum zu fördern. Sie müssen darauf abzielen, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und Beschäftigung zu schaffen, damit Europa weiterhin eine soziale Marktwirtschaft sein kann, die hoch attraktiv ist und die auch das europäische Sozialmodell hochhalten kann. Wir haben da ein Instrument, das aus unserer Sicht am besten dafür geeignet ist, dieses Ziel zu erreichen, und zwar die Strategie Europa 2020.
Die Strategie Europa 2020 verfügt über das Potenzial, die Begrenzungen der Strategie von Lissabon zu sprengen. Europa 2020 zeigt einen sehr ausgewogenen Ansatz, der sich auf drei Säulen stützt: auf intelligentes Wachstum, nachhaltiges Wachstum und integrierendes Wachstum. Sie trägt auch realistischer der Notwendigkeit Rechnung, dass Ziele auf der Grundlage der real bestehenden Unterschiede zwischen den verschiedenen Mitgliedsländern flexibler gestaltet werden müssen.
Wir möchten aber auch darauf hinweisen, dass die Strategie Europa 2020 nur dann Ergebnisse zeitigen kann, wenn sie auch eine wirkliche territoriale Dimension erhält, in Anerkennung der regionalen Unterschiede und der Notwendigkeit eines sozialen, wirtschaftlichen und territorialen Zusammenhalts, die sich daraus ergibt. Eine Grundvoraussetzung für den Erfolg der Strategie Europa 2020 ist der Ansatz der sogenannten Multi-Level Governance.
Die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, die wir repräsentieren, tätigen einen großen Teil der öffentlichen Investitionen, die für das Wachstum der Union verantwortlich sind. Ich darf Ihnen gestehen, dass wir besorgt sind – sehr besorgt sind! – ange-
sichts der Art und Weise, wie die Strategie Europa 2020 zur Anwendung kommt. Als Beweis dafür dient uns die jüngste jährliche Wachstumsumfrage zur Strategie Europa 2020, wo es heißt, dass diese Strategie in Verzug ist. Auch die Europäische Kommission hat betont, dass dieser Rückstand nicht nur auf die gegenwärtige Wirtschaftskrise zurückzuführen ist.
Die lokalen und regionalen Körperschaften nehmen nicht aktiv teil an der Ausarbeitung, Entwicklung und Anwendung der nationalen Reformprogramme. Und die Institutionen der Union sind offensichtlich nicht so überzeugend, wie sie sein sollten, wenn es darum geht, die Mitgliedsländer einzuladen, einen wirklich assoziativen Ansatz zu wählen. Es besteht also etwas, was wir angemessen ein Governance-Defizit, ein Regierungsdefizit nennen könnten. Wenn sich die lokalen und regionalen Körperschaften an der Ausarbeitung und Anwendung nationaler Reformprogramme nicht beteiligen, so wird, glauben wir, die Strategie Europa 2020 die gleichen Fehler begehen wie ihre Vorgängerstrategie, die Strategie von Lissabon.
Diese Sorge haben wir bereits dem Präsidenten des Europäischen Rates Van Rompuy mitgeteilt, auch dem Präsidenten der Europäischen Kommission Manuel Durão Barroso, und nächste Woche werde ich noch die Gelegenheit haben, den Präsidenten des Europäischen Parlaments zu treffen, Herrn Martin Schulz, und ich werde auch ihm unsere tiefe Sorge mitteilen.
Zum Zweiten sollten die lokalen und regionalen Körperschaften sich an der Vorbereitung und Ausarbeitung dieser Assoziierungsverträge beteiligen, die im neuen Gemeinsamen Strategischen Rahmen der Strukturfonds für den Zeitraum 2014 bis 2020 vorgesehen sind. Angesichts der Tatsache, dass diese Fonds zur Erreichung der Ziele von Europa 2020 beitragen sollen, neben ihrer Kohäsionsaufgabe, müsste dies als eine Chance gesehen werden, um wirklich um einen Tisch eine möglichst breite Palette verfügbarer Finanzinstrumente entsprechend zu koordinieren.
Wir im Ausschuss der Regionen fördern die territoriale Dimension der Strategie Europa 2020 und auch die des Europäischen Semesters zur Ausgestaltung einer europäischen Wirtschaftsgovernance. Wir haben eine Europa-2020-Monitoringplattform eingerichtet, an der rund 170 Städte, Regionen und andere Körperschaften aller Mitgliedstaaten mitarbeiten, die uns auf freiwilliger Basis ihre Beiträge darüber liefern, wie die Strategie Europa 2020 vor Ort angewandt wird und wie nützlich sie sich für die lokalen und regionalen Körperschaften erweist.
Auf dem Wege des territorialen Dialogs setzen wir uns auch mit politisch Verantwortlichen der Institutionen der Europäischen Union zusammen, und zwar jährlich vor dem Frühlingsgipfel der Europäischen Union zur Halbzeit des Europäischen Semesters. Gegenwärtig findet eine Reihe von Konferenzen statt, die sich der Evaluierung einer der wichtigsten Initiativen der Strategie Europa 2020 widmen. Im März 2014 wird dann eine vollständige Evaluierung der Strategie Europa 2020 stattfinden, und zwar beim Europäischen Gipfel der Regionen und Städte, der in Athen stattfinden wird. Bei diesem Gipfel werden wir auch den Beitrag des Ausschusses der Regionen der Öffentlichkeit vorstellen, angesichts der Mittelfristrevision der Strategie, die für das nächste Jahr vorgesehen ist, und zwar parallel zu den Arbeiten des Europäischen Rates.
Meine Damen und Herren! Herr Präsident! Sehr geehrte Mitglieder des Bundesrates! Abschließend möchte ich noch auf einige andere Themen eingehen, bei denen der Ausschuss der Regionen einen aktiven Beitrag zur Diskussion leistet.
Was den Binnenmarkt betrifft, so sind wir der Ansicht, dass der Grundsatz des Zunächst-im-kleinen-Maßstab-Denkens die Bedeutung der lokalen Aktivitäten zeigt und zeigt, wie wichtig es ist, dass auf lokaler Ebene die Unternehmen entsprechende Bedingungen vorfinden, auch wenn der Rahmen auf europäischer Ebene abgesteckt wird.
Denn: Wirtschaftliche Aktivitäten finden nur auf lokaler Ebene statt. Und das gilt es zu berücksichtigen, wenn die Gesetzgebung zum Binnenmarkt entwickelt wird, denn das ist die einzige Möglichkeit, wie man das Konzept des Lokalen mit dem einer paneuropäischen Wirtschaft in Einklang bringen kann.
Es gibt ein Thema, über das ich heute mit besonderem Stolz hier zu Ihnen spreche, und zwar spreche ich da von der Jugendgarantie. Das war eines der positivsten Ergebnisse des Europäischen Rates vom 8. Februar. Es wird allen Jugendlichen ein Arbeitsangebot, eine qualitative Ausbildung oder die Möglichkeit von Praktika geboten, um so zu vermeiden und zu verhindern, dass hier eine verlorene Generation heranwächst. Dieser Vorschlag, das System der Jugendgarantie auf die ganze Europäische Union auszuweiten, inspiriert sich, soviel ich weiß, zum Teil auch am österreichischen Modell. Und das ist gerade der Vorteil der Europäischen Union: dass man von den bewährten Praktiken unserer Mitglieder lernen kann, die, wie in diesem Fall Österreich, in einem bestimmten Bereich Vorreiter sind. Ich bin voll und ganz davon überzeugt, dass das ein effizientes Instrument sein wird, um die Jugendbeschäftigung voranzubringen und damit auch das Wachstum in Schwung zu bringen.
In Spanien führen wir gegenwärtig eine Revision unseres Modells zur Schaffung von Jugendarbeitsplätzen durch, und zwar auf der Grundlage der Leitlinien der Europäischen Union. Und wir sind davon überzeugt, dass der Erfolg dieses Planes im großen Maße von der Partizipation der Städte und Regionen abhängen wird, denn sie sind am besten dazu in der Lage, die lokalen Arbeitsmärkte zu evaluieren und entsprechende auf die Jugendlichen abgestimmte Programme zu entwickeln.
Was die Globalisierung und Wettbewerbsfähigkeit betrifft, so sind wir auch davon überzeugt, dass es dringlich ist, Strukturreformen im unternehmerischen Umfeld vorzunehmen. Wir brauchen ein neues Wettbewerbsmodell, das den Aufschwung der Schwellenländer berücksichtigt, die neuen Technologien, vor allem im Bereich von Information und Kommunikation, sowie auch den Übergang hin zu einer Wirtschaft, die sich auch der Reduktion von CO2-Emissionen verschrieben hat.
Es ist daher ganz besonders wichtig, dass lokale und regionale Körperschaften und unsere Industrien sich auch anpassen an diesen neuen Kontext des internationalen Wettbewerbs, der ja per definitionem ein Kontext ist, der sich ständig verändert. Die Globalisierung ist eine Herausforderung, die sich der ganzen Gesellschaft stellt und nicht nur den Unternehmen, deshalb müssen auch lokale und regionale Körperschaften dazu beitragen, sicherzustellen, dass europäische Unternehmer sich wirklich dieser Internationalisierung verpflichtet fühlen und auf internationaler Ebene wettbewerbsfähig sind.
Vor diesem Hintergrund wird der Ausschuss der Regionen weiterhin betonen, wie wichtig es ist, mittel- und langfristige Investitionen in lokale und regionale Projekte im Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien zu unterstützen, vor allem auch im Einklang mit dem Klimapakt der Bürgermeister, denn diese Bemühungen tragen zur Erreichung der Ziele von Europa 2020 im Bereich CO2-Reduktion bei.
Wie Sie aus meinen Worten bisher unschwer erkennen können, ist der Ausschuss der Regionen sehr aktiv in vielen, eigentlich in fast allen Politikbereichen der Europäischen Union. Europa ist aber natürlich auch mitbetroffen durch die Geschehnisse in den Nachbarländern, und sowohl in den Nachbarländern des Ostens wie auch in jenen des Südens finden gerade tiefgreifende Umwälzungen statt. Um die Grundlagen für eine nachhaltige Demokratie zu schaffen, die ja das Hauptziel der neuen Nachbarschaftspolitik der Europäischen Union darstellt, wurde auch die wichtige Rolle anerkannt, die hier den lokalen und regionalen Körperschaften bei der Förderung der Kultur einer politischen Partizipation zukommt.
Für die Versammlung der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften Europa-Mittelmeer, ARLEM, ein territoriales Governance-Organ der Union für das Mittelmeer, ge-
schaffen auch vom Ausschuss der Regionen, ist die Grundlage der Demokratie vor allem auf lokaler und regionaler Ebene angesiedelt.
Was unsere Nachbarn im Osten betrifft, so hat der Ausschuss der Regionen die Konferenz der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften der Östlichen Partnerschaft, CORLEAP, eingerichtet, und zwar im Jahr 2011, mit dem Ziel, dieser Östlichen Partnerschaft auch eine lokale und regionale Dimension zu verleihen.
Unser Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen den lokalen und regionalen Körperschaften der Europäischen Union und den entsprechenden Körperschaften in Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Moldau und der Ukraine zu ermöglichen und zu verstärken, mit dem Ziel, effiziente Governance-Systeme auf lokaler Ebene einzurichten, Good Governance zu fördern, Transparenz und lokale Demokratie voranzubringen und natürlich auch entsprechende öffentliche Dienstleistungen für alle Bürger zu gewährleisten.
Jetzt komme ich wirklich zum Ende. – Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich hoffe, dass ich es in meinem Beitrag geschafft habe, Ihnen eine klarere Vorstellung von der Arbeit des Ausschusses der Regionen zu vermitteln, und dass ich Ihnen auch zeigen konnte, wie wir angesichts der Rolle der regionalen und lokalen Körperschaften in Europa dazu beitragen können, die großen Herausforderungen zu lösen, vor denen wir gegenwärtig stehen.
Ein in Vielfalt geeintes Europa ist heute mehr denn je eine einzigartige und wunderbare Idee. Um diese Idee Wirklichkeit werden zu lassen und sie vor allem auch in die Herzen unserer Bürger zu tragen, müssen wir Körperschaften in ganz Europa auf allen Ebenen zusammenarbeiten, und zwar noch wesentlich mehr, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Das ist unsere Verpflichtung, das ist unser Ziel, und ich darf Ihnen auch sagen, das ist unsere Berufung. – Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. (Allgemeiner Beifall.)
10.49
Präsident Edgar Mayer (teilweise in Übersetzung aus dem Spanischen): Herzlichen Dank, Herr Präsident, für Ihre inspirierenden Worte.
Sehr verehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es war also nicht nur eine Premiere für den Bundesrat, sondern auch für Herrn Valcárcel Siso als Präsidenten, weil er das erste Mal zu einer nationalen Kammer in Europa gesprochen hat. Er wird sich im Sommer dann noch im Deutschen Bundestag zu Wort melden. Man sieht, wie sich das auch steigern kann, aber man beginnt mit dem Bundesrat.
Wir gehen nun in die Debatte ein, ebenfalls mit Simultandolmetschung.
Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat Schennach. – Bitte, Herr Kollege.
10.51
Bundesrat Stefan Schennach (SPÖ, Wien): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Präsident des Ausschusses der Regionen! Als erster Teilnehmer an der Debatte zu Ihrer Erklärung darf ich Sie, glaube ich, im Namen auch aller Kolleginnen und Kollegen noch einmal herzlich begrüßen und Ihnen vor allem danken für Ihre geradezu leidenschaftlichen europäischen Ausführungen. Sie haben recht: Zu Europa gibt es keine Alternative, zu einem vereinten Europa gibt es keine Alternative, und zu einem vertieften Europa gibt es keine Alternativen. Und Europa wird sich weiterentwickeln, und da ist Ihre Rolle, unsere Rolle von ganz besonderer Bedeutung.
Denn: Die Rolle der nationalen Staaten wird schmelzen, wird weniger werden. Die Bedeutung des Europäischen Rats wird geringer werden, und Europa wird stärker werden. Und Europa kann nur stärker werden, wenn dies im Kontext mit den Regionen ge-
schieht. Denn das ist unsere Identität: Wir sind Europäer und Europäerinnen, aber letztlich sind wir zu Hause in der Region Kastilien, in der Region Tirol, in der Region Lombardei. Das ist aber auch die unglaubliche Stärke, die Europa hat: dass seine Regionen so einen starken Charakter haben und eine starke Identität haben – und sich gleichzeitig zu Europa bekennen, so wie Sie es heute als Präsident des Ausschusses der Regionen getan haben.
Sie sind als Ausschuss der Regionen ein Kind des Maastricht-Vertrages, und Sie haben durch den Vertrag von Lissabon neue Aufgaben bekommen. – Wir in Österreich sind ein Kind der Republiksgründung, und wir haben viele, viele Jahrzehnte mit Reformdiskussionen des Bundesrates verbracht. Der Lissabon-Vertrag hat uns verändert, nachhaltig und substanziell. Wir können sicher sagen, dass wir heute auch eine Europakammer sind, gerade in dieser gemeinsamen Vernetzung und Vertretung von gemeinsamen europäischen Idealen und Zielen, aber vor allem auch in der Beteiligung und Schaffung europäischer Politik und in der Mitwirkung und Gestaltung dieser Politik.
Herr Präsident, Sie können sicher sein, von diesem Rednerpult wurde nicht nur einmal darüber gesprochen, welche Bedeutung Städte, Gemeinden und Regionen haben bei der Gestaltung von Wirtschaft und Arbeitsplätzen. Denn: Die tatsächlichen Innovationen, die tatsächliche Gestaltung von Arbeitsplätzen findet in den Regionen, in den Städten und Gemeinden statt. Und das wird letztlich für uns auch der Schlüssel dafür sein, wie wir die europäische Krise bewältigen können. Und deshalb ist diese Verbindung so wichtig, und auch wir als Bundesrat, vor allem bei unserer Tätigkeit im Rahmen des EU-Ausschusses, haben uns ja auch innerösterreichisch zum Beispiel mit den Städten sehr stark vernetzt, so wie Sie es mit den europäischen Hauptstädten erst kürzlich auch gemacht haben.
Vor wenigen Tagen fand ja das Treffen der europäischen Hauptstädte statt, und auch hier hat zum Beispiel der Wiener Bürgermeister gesagt, zur Überwindung der Krise braucht Europa seine Städte, und die Zukunft Europas entscheidet sich in unseren Städten – in unseren Städten und Regionen. Und das ist, glaube ich, etwas von ganz eminenter Bedeutung.
Ich möchte aber nun auf die Haushaltssanierungen, Budgetsanierungen zu sprechen kommen und dabei auch an Ihre Ausführungen anschließen: Wir haben in den letzten Jahren zu sehr auf die Bankensanierung und die Haushaltssanierung und die Budgetsanierung geschaut und dabei völlig übersehen – selbstkritisch müssen wir das anmerken; nicht alle haben es übersehen, wir haben es zum Beispiel hier im österreichischen Bundesrat mehrfach debattiert –, dass wir das nicht auf Kosten der Jugend machen können. Und wenn wir das eingestehen, so müssen wir sagen, Europa hat in den letzten Jahren auf Kosten seiner Jugend saniert. Aber was passiert? – Wir verlieren unsere Jugend!
Der Euro ist stark, Europa ist stark, rechtsnationalistische, populistische Strömungen können Europa nicht in die Krise bringen, aber wenn wir die Jugend verlieren, wenn die Jugend in eine Sackgasse des europäischen Gedankens gerät, dann verliert Europa, nämlich durch eine Jugendarbeitslosigkeit, die derzeit bei 8 Millionen liegt.
Sie haben recht: Die Jugendgarantie der Europäischen Union, vor wenigen Wochen ausgesprochen, ist ein erster Schritt. Hier sitzt zum Beispiel eine Präsidentin der Wirtschaftskammer – einer der Sozialpartner –, die kann Ihnen auch sagen, wie wichtig dieses österreichische duale Ausbildungssystem – Sie haben es angesprochen –, Lehre und Arbeit, ist. Und wir kämpfen sowohl auf Ebene des Europäischen Parlaments als auch auf jener des Europarates dafür, dass wir es zustande bringen, dieses System – und Sie haben dazu im Ausschuss der Regionen eine Fachkommission, nämlich für Jugend, Bildung und Forschung – zu einem einheitlichen System in Europa zu machen, damit wir auch austauschen können, damit unsere Bildungssysteme in Europa
zu einem werden und damit wir vor allem das Problem der Jugendarbeitslosigkeit einer Lösung zuführen.
Wir in Österreich sind glücklich, wir haben die geringste Jugendarbeitslosigkeit in Europa, aber glauben Sie nicht, dass den Kollegen und Kolleginnen in unserem Land die Jugendarbeitslosigkeit von 54 Prozent in Spanien, von 40 Prozent in Italien, von fast 40 Prozent in Frankreich und von über 50 Prozent in Griechenland nicht genauso viele Sorgen macht. Das ist unsere Jugend, auch unsere österreichische Jugend! Wenn wir zum Beispiel die Situation derzeit in Italien sehen, so wissen wir, dass diese natürlich auch Rückwirkungen auf unsere unmittelbare Wirtschaft hat. Und deshalb muss die Jugend unser gemeinsames Anliegen sein, denn von ihr hängt es ab, dass Europa nicht scheitert, und das ist wichtig.
Darf ich ganz kurz auch ein paar andere Punkte anreißen. – Wir haben gemeinsame Themen. Der EU-Ausschuss des Bundesrates hat vor wenigen Wochen zum Beispiel den Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten von Armut betroffenen Menschen behandelt. Sie behandeln diesen nächste Woche. Das zeigt, dass wir an gemeinsamen Themen arbeiten, nämlich insofern, als die Städte und Gemeinden historisch für die soziale Wohlfahrt zuständig sind und die Europäische Union bisher nicht. Und plötzlich, in der Krise, kommt diese soziale Dimension langsam zum Bewusstsein.
Das ist ja dieser „Schmerzfleck“ an der Konstruktion der Europäischen Union, dass wir keine Sozialunion sind. Und jetzt, aus verschiedenen Ansätzen heraus – Jugendarbeitslosigkeit, schwere Betroffenheit von sozialer Armut –, entsteht eine europäische Verantwortung, die, gemeinsam von den nationalen Parlamenten und auch vom Ausschuss der Regionen getragen, nun zur Schaffung der Säule der sozialen Union führen muss. Dass Sie in selbiger Weise diese Themen behandeln, finde ich großartig, und ich möchte Ihnen auch vonseiten des Bundesrates dafür danken.
Sie haben hier auch – und das sieht man auch an der Tätigkeit des Ausschusses der Regionen – ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Die Veränderungen in der dritten industriellen Revolution: Nachhaltigkeit, erneuerbare Energie, Energieeinsparung, Energieeffizienz, Ökologisierung in der Wirtschaft sind ganz wichtige Themen. Das sind neue Jobs, das ist Forschung, das ist Innovation, und auch hier ist der Ausschuss der Regionen sehr aktiv – und auch dafür ein großes Dankeschön.
Aber jetzt, Herr Präsident, komme ich zu einem ganz speziellen Thema, das uns hier seit Monaten begleitet und das auch zu entsprechenden Reaktionen führt. Der Ausschuss der Regionen stellt in seinem letzten Memorandum klar: Es muss garantiert sein, dass die Kommunen und die Regionen die sozialen Dienstleistungen und die Infrastruktur für ihre Bürger und Bürgerinnen garantieren. Das ist etwas, was wir hier in einem wahren Kampf mit der Europäischen Kommission auch sagen: Schluss mit der Neoliberalisierung in diesem Bereich, Schluss mit dem Versuch der Destabilisierung unserer Kommunen und unserer Städte, was die kommunale Daseinsvorsorge betrifft, und man muss aufhören mit dem ständigen Versuch, hier Verunsicherung zu schüren! (Beifall bei SPÖ, ÖVP und Grünen.)
Sie erklären das ebenso ausdrücklich, und deshalb sind wir Ihnen auch sehr dankbar, dass wir hier eine Partnerschaft haben. Ich finde, dass Ihr Hiersein heute zu dieser Erklärung der Beginn einer solchen Partnerschaft sein sollte, und ich glaube, das ist ein ganz großes Signal.
Aber jetzt sage ich Ihnen, auch ich habe eine Geschichte. Jeder von uns hat eine Geschichte in seinem Leben, meine Geschichte kommt aus der Entwicklungszusammenarbeit. Ich bin auch sehr tief davon beeindruckt, dass Sie einen ganz besonderen Fokus darauf legen und dass Sie jetzt – mitten in der Krise – erklären, an der Entwicklungszusammenarbeit Europas mit verarmten oder benachteiligten Regionen führt kein
Weg vorbei, und dass Sie
herausstreichen, dass 85 Prozent der Europäer und Europäerinnen
trotz der Krise für die Durchführung und Einhaltung der
Entwicklungszusammenarbeit sind. – Das sagt der Ausschuss der
Regionen. Das ist toll, und dafür möchten wir Ihnen herzlich danken. (Beifall
bei SPÖ und ÖVP sowie des Bundesra-
tes Posch.)
11.02
Präsident Edgar Mayer: Als Nächster ist Kollege Kneifel zu Wort gemeldet. – Bitte, Herr Kollege.
11.02
Bundesrat Gottfried Kneifel (ÖVP, Oberösterreich): Señor Presidente, bienvenido! Hoy Viena es la capital de las regiones de Europa. Heute ist Wien die Hauptstadt der europäischen Regionen. Das hat Ihre Erklärung heute ganz klar bewiesen, und wir freuen uns sehr, dass Sie zu uns in den österreichischen Bundesrat gekommen sind.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch vor den Bildschirmen! Ich gratuliere Ihnen, dass Sie heute die Geduld und die Energie aufbringen, dieser Debatte zu folgen. Ich gratuliere Ihnen auch dazu, dass Sie heute einen der erfolgreichsten Spartensender Europas eingeschaltet haben. Wir haben erst gestern davon erfahren, dass kein anderer Spartensender Europas in so kurzer Zeit so viele Zuseherinnen und Zuseher gewinnen konnte – und ich sage das deshalb, weil dieser Sender sich in der Europa-Berichterstattung ganz besonders auszeichnet. Europamagazine von Raimund Löw wie „inside BRÜSSEL“ und all diese Programme sind empfehlenswert, und das sollte auch einmal in dieser Debatte gesagt werden. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
Man darf nicht nur die Entscheidungen in Europa begleiten, sondern es ist unsere Herausforderung, diese Entscheidungen auch immer wieder zu erklären, zu definieren, entsprechend zu interpretieren und die Leute, die Menschen im europäischen Prozess mitzunehmen. Das ist auch eine Leistung der Medien, die immer besser und immer wirkungsvoller bewältigt wird.
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Präsident, ich danke Ihnen, dass Sie nicht nur auf die positiven Seiten der europäischen Zusammenarbeit durch die Regionen hingewiesen haben, sondern auch viele Problemfelder angesprochen haben, vor denen wir stehen und die uns in unserer praktischen politischen Arbeit, in unseren Kontakten mit der Bevölkerung auch immer wieder begleiten.
Ich danke Ihnen auch, dass Sie auf die große österreichische parlamentarische Tradition hingewiesen haben, dass sich hier in diesem Haus eigentlich das erste große Parlament der europäischen Zusammenarbeit und der europäischen Verständigung gebildet hat, wenn dieses System auch am übertriebenen Nationalismus zerbrochen ist. Das muss auch gesagt werden, wenn wir von der Vergangenheit reden: Es ist eigentlich am Konzept des Nationalismus zerbrochen, und dieser ist schuld am Zusammenbruch dieses Systems. Aber wir haben aus der Geschichte gelernt – und 68 Jahre Frieden in Europa sind ein Beweis, dass wir aus der Geschichte gelernt haben, obwohl immer wieder gesagt wird: Die lernen sowieso nichts aus der Geschichte! Wir in Europa haben aus unserer Geschichte gelernt!
Ich danke Ihnen für diesen Hinweis, denn es gibt immer mehr Generationen, jüngere Europäerinnen und Europäer, die nicht mehr diese Phasen – diese schwierigen Phasen – der europäischen Entwicklung miterlebt haben und denen das Friedensprojekt Europäische Union nicht mehr so geläufig ist wie jenen, die es noch am eigenen Leib verspürt haben.
Herr Präsident Siso, Sie haben auch darauf hingewiesen, dass wir in einem Europa leben, das derzeit von Krisen geschüttelt wird, dass wir eine Krise nach der anderen
durchwandern und uns da durchhanteln müssen, dass diese Krisen manchmal sogar dazu geeignet sind, das Vertrauen in und den Glauben an das europäische Konzept zu erschüttern. Wenn man die Entwicklungen der Spekulationsgeschäfte und der internationalen Spekulationswirtschaft beobachtet, dann kommen einem manchmal Zweifel an den Gesetzen der sozialen Marktwirtschaft. Deshalb müssen wir alles tun, um auch für die soziale Marktwirtschaft und für die soziale und solidarische Zusammenarbeit in unserer Gesellschaft zu werben und entsprechend dafür zu arbeiten. – Ich danke Ihnen auch für diesen Hinweis.
Europa reift aber an den Problemen, die es meistern muss, und ich glaube, dass das Rezept des Regionalismus und das Konzept des Föderalismus nicht Probleme sind, sondern die Lösung mancher europäischen Probleme; Sie haben eindrucksvoll auch darauf hingewiesen.
Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Wir leben auch in einer Zeit der Legitimationskrise Europas, und wir tun gut daran, möglichst viele lokale und regionale Körperschaften dafür zu gewinnen, für den europäischen Gedanken und für die gemeinsame europäische Arbeit zu werben.
Sie haben auch auf die Probleme bei der Haushaltskontrolle hingewiesen. Ich glaube, es führt kein Weg an der Haushaltsdisziplin vorbei: Sparen, aber wachsen – aber wachsen! Vor allem muss die Beschäftigungsquote bei der Jugend wachsen, auch mein Vorredner hat darauf hingewiesen. Ich kann dieses Konzept der dualen Ausbildung, die wir in Österreich seit vielen Jahrzehnten haben, als Rezept, als europäisches Modell anderen Regionen und anderen Staaten nur empfehlen, weil wir auch ganz klar den Nachweis erbringen können, dass das duale Ausbildungssystem, man könnte fast sagen, eine Garantie gegen Jugendarbeitslosigkeit ist, weil die Staaten, die dieses System haben, bei der Jugendarbeitslosigkeit am besten abschneiden. (Beifall bei ÖVP und SPÖ sowie des Bundesrates Posch.)
Ein Problem sehe ich auch – und es hat keinen Sinn, etwas zu beschönigen – in der Regulierungswut der europäischen Behörden. Die Regulierungswut feiert fröhliche Urständ, wie man bei uns in Österreich sagt. Mein Kollege hat schon auf die Verhandlungen im Europaausschuss dieses Hauses verwiesen, wo wir immer wieder auch darauf hinweisen, dass Regulierungswut, übertriebene Bürokratie schaden. Gerade im letzten EU-Ausschuss haben wir das am Beispiel der Tabakprodukterichtlinie bemängelt, die zwar mit der Subsidiarität konform geht, die aber ein Überschießen der Regulierung und der bürokratischen Festlegungen darstellt. Ich glaube – und das ist ein Beispiel von vielen –, hier sollen wir auch den Finger erheben und sagen: Nicht so viel Regulierung in diesem gemeinsamen Europa!
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Meiner festen Überzeugung nach helfen die Regionen, die Demokratie in Europa zu stärken. Aufgewertete Regionen und Regionen, die in Europa und im europäischen Kontext ernst genommen werden, sind ein Rezept gegen Nationalismus und gegen übertriebene nationalistische Strömungen. Mit dieser Debatte in der österreichischen Länderkammer wollen wir auch ein Zeichen setzen, und ich bedanke mich bei Präsidenten Mayer sehr herzlich für diese Initiative.
Wir sehen den Bundesrat auch als eine Brücke: Wir sehen den Bundesrat als eine Brücke zwischen den Regionen und der Europäischen Kommission und den Brüsseler Dienststellen. Das ist eine wichtige Aufgabe, die wir erst seit wenigen Jahren hier in dieser Kammer wahrnehmen. Und ich danke Ihnen, dass Sie als Präsident der Regionen dieser Arbeit auch Respekt und Anerkennung gezollt haben. (Beifall bei ÖVP und SPÖ sowie des Bundesrates Posch.)
Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Wir wollen die Regionen stärken, weil wir glauben, dass sie ein geeignetes Konzept und die richtige Antwort auf den in manchen
Staaten aufkeimenden Nationalismus sind. Die Region kann Grenzen überwinden, die Region kann flexibel, bürgernah, unmittelbar, eigenverantwortlich Probleme lösen. Diese guten Eigenschaften sollten wir uns erhalten. Musterbeispiele dafür sind beispielsweise grenzüberschreitende Projekte vieler Regionen und Bundesländer.
Ich denke dabei nur an mein Heimatbundesland Oberösterreich. Es gibt derzeit ein gemeinsames kulturelles Projekt mit der Tschechischen Republik, mit Tschechien, nämlich eine grenzüberschreitende Ausstellung mit dem Titel „Alte Spuren. Neue Wege“ zwischen dem Land Oberösterreich und Südböhmen, die in wenigen Tagen eröffnet wird. Ich lade auch alle ein, zu dieser Ausstellung zu kommen, weil es ein Musterbeispiel dafür ist, wie man Grenzen überwinden kann. Aber Sie alle können aus Ihren Ländern, wo Sie ebensolche Projekte haben, die grenzüberschreitend sind, genügend Beispiele bringen. Das ist eine Leistung der Regionen in dieser Republik, die ganz, ganz wichtig ist! (Beifall bei der ÖVP.)
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Präsident, ich komme zum Schluss: Sie haben auch klare Aufträge an uns als Abgeordnete und Mandatare dieser Kammer übermittelt. Wir stellen uns dieser Herausforderung, und wir nehmen diesen Auftrag ernst. Ich glaube, wir haben heute nicht nur über Forderungen an die Europäische Union zu reden, an den Ausschuss der Regionen oder an die Kommission oder an wen immer, sondern wir haben auch über Forderungen an uns selbst als Abgeordnete zu reden.
Ich denke, wir sollten – erstens – mit dem Beispiel der vitalen Regionen die Demokratie in Europa stärken.
Zweitens: der Grundsatz der Subsidiarität. – „Subsidiarität“ ist ein schwieriges Wort; ich sage immer, wir prüfen die entsprechenden Richtlinien der Europäischen Union auf Bevölkerungstauglichkeit, inwieweit sie dazu taugen, die Probleme der Regionen und der Menschen in diesen Regionen zu lösen. Wir sollten den Grundsatz der Subsidiarität in der Gesetzgebungspraxis der EU pflegen und weiterentwickeln und auch unsere MitbürgerInnen laufend in Gesprächen mit Informationen versorgen.
Als dritten und letzten Punkt sollten wir die Vielfalt der Traditionen, der Sprachen, der Geschichte, der Landschaften und der Kulturen der Regionen nicht als Problem betrachten, sondern als Vorteil in den europäischen Einigungsprozess einbringen.
Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Wenn wir heute feststellen, dass das europäische Projekt trotz aller Probleme, die wir haben, letztlich doch ein europäisches Erfolgsprojekt geworden ist und ein Projekt erster Qualität und erster Güte, so haben die Regionen Europas einen wesentlichen Anteil daran. – Danke. (Beifall bei ÖVP und SPÖ sowie des Bundesrates Posch.)
11.15
Präsident Edgar Mayer: Danke, Herr Kollege Kneifel. – Man würde nicht glauben, wie viele spanische Talente sich im Bundesrat finden. (Heiterkeit.)
Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Kollege Dörfler. – Bitte, Herr Kollege.
11.15
Bundesrat Gerhard Dörfler (FPÖ, Kärnten): Geschätzter Herr Präsident Siso! Ich freue mich ganz besonders, Sie heute in Österreich, in Wien begrüßen zu dürfen. Herr Präsident des Bundesrates! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Bevor ich auf ein besonderes Erfolgsprojekt aus südösterreichischer Sicht eingehen darf, möchte ich, Herr Präsident Siso, vielleicht ein Geständnis ablegen: Ich bin Katalane. – Ich liebe den FC Barcelona, ich bin, wenn es um Kulinarik, Wein und Tourismus geht, Spanier. Ich werde demnächst mit meiner Gattin als Reiseleiterin – sie hat ja den Jakobsweg absolviert – zumindest einen Teil des Jakobswegs zurücklegen, um damit Ihr Land noch besser kennenlernen zu können.
Ja, vitale Regionen – und starke Nationalstaaten, das möchte ich schon auch betonen – sind für mich die unverzichtbare Basis für ein soziales und vitales Europa, und daher stehe ich für ein föderales und nicht für ein zentrales Europa.
Vorhin wurden die Zentralisierungswut und auch die Bürokratie angesprochen. Bürokratie und Zentralismus entstehen dort, wo der Föderalismus und letztendlich die Wünsche der Menschen in den Regionen, in den Städten, sozusagen draußen auf dem Land nicht mehr verstanden werden. Und deshalb meine ich, dass wir ganz klar festhalten müssen: Ja zu Europa, aber Ja zu einem bunten, vitalen Europa der Menschen! Die Menschen verstehen Europa teilweise nicht mehr. – Herr Präsident Siso! Ich kann stark unterstreichen, dass die Aufgaben der Regionen da ganz wichtige Bindeglied-Aufgaben zu den Menschen Europas auch sind.
Das Hauptthema, das sich derzeit für mich stellt, ist Arbeit und Soziales. Wir müssen die Deindustrialisierung in Europa stoppen. Wir brauchen ein Comeback der Industrie, eine Reindustrialisierung Europas. Wenn wir das nicht schaffen, dann können wir zwar schöne Versprechungen abgeben, aber letztendlich ist für mich die wichtigste Sozialleistung ein Arbeitsplatz. Arbeit schafft Würde, Arbeit schafft soziale Unabhängigkeit und Arbeit ist letztendlich eine Grundverpflichtung, die wir in Europa haben.
Nun möchte ich auf ein sehr erfolgreiches Projekt – es ist vielleicht das erfolgreichste Projekt der Regionen in Österreich – speziell eingehen.
Herr Präsident Siso! Wir haben im Rahmen der EVTZ-Möglichkeiten mit der Region Veneto, mit dem Land Kärnten und mit Friaul-Julisch Venezien die Euregio Senza Confini gegründet. Das ist in Wahrheit ein später Erfolg einer Olympiabewerbung – Kärnten hat sich ja mit Italien und Slowenien für die Olympischen Winterspiele 2006 beworben. Die Marke Senza Confini wurde damals geboren. Uns war es aber wichtig, diese Marke als Zukunftsaufgabe zu verstehen.
Die Olympia-Bewerbung hat man damals nicht verstanden – Slowenien, Oberitalien und Kärnten, und damit Österreich, wäre eine grenzüberschreitende Vision der Regionen gewesen –, aber wir dürfen darauf aufbauen, dass es uns gelungen ist, mit unseren italienischen und erfreulicherweise nach der Lösung der Kärntner Ortstafelfrage im Jahr 2011 auch mit den slowenischen Nachbarn ein neues Leben der Regionen zu entdecken. Und letztendlich ist das auch ein Zeichen dafür, dass es da um ein Projekt geht, das auf das Verständnis, in diesem Fall auf die Brückenbaufunktion des Sports aufbaut, der uns sozusagen eine Hinterlassenschaft der Marke Senza Confini auf den Weg mitgegeben hat, auf die wir aufbauen konnten.
Wir dürfen heute sagen, dass diese drei Gründungsmitglieder der Euregio Senza Confini, dass also Veneto, Friaul und Kärnten immerhin 6,5 Millionen Menschen vertreten. Dimitrij Rupel als Generalkonsul Sloweniens war dabei, wie auch Ivan Jakovcić, der Präsident der Region Istrien, bei dieser feierlichen Inthronisierung dieses Projektes mit dabei war, und der damalige Regierungschef Sloweniens Janez Janša hat erklärt, dass Slowenien als nächstes Mitglied und zwei Regionen Kroatiens mit dabei sein werden.
Das heißt, wir haben da ein starkes Europa dreier Sprachen, dreier Kulturen – die slawische, die romanische und die deutsche –, die sich dort treffen, die sich nach einer äußerst schwierigen Geschichte finden, wenn wir davon ausgehen, dass wir nächstes Jahr, also im Jahr 2014, 100 Jahre auf das Attentat in Sarajewo zurückblicken, bei dem der österreichische Thronfolger ermordet wurde und mit dem Ersten Weltkrieg eine Krise Europas begonnen hat, die sich – zumindest in Kärnten – bis zum Jahr 2011 fortgesetzt hat.
Das heißt, wir werden in der Endausbaustufe mit dem Nachbarn Slowenien, mit Istrien und mit einer zweiten Region in Kroatien 9 Millionen Menschen dreier Kultur- und
Sprachräume vertreten dürfen, und das ist für mich, Herr Präsident Siso, eine sehr faszinierende Aufgabe: dass Nachbarn und Freunde Brücken bauen, die letztendlich europäische Dimensionen erreichen können.
Unser großes Ziel war es, eine Verkehrs-Bahn-Achse von Danzig bis Bologna durchzusetzen, und es ist uns schließlich gelungen, nach jahrelangen Verhandlungen zuerst mit den italienischen Nachbarn, dann mit Salzburg und der Steiermark und letztendlich mit über 15 Regionen, dieses Projekt im Rahmen der neuen TEN-T-Leitlinien durchzusetzen.
Das heißt, das kleine Bundesland Kärnten hat gemeinsam mit seinen Nachbarregionen eine Idee geboren, und es ist uns gelungen, mit einem EU-Projekt, das sich BATCo genannt hat, dafür Sorge zu tragen, dieses Projekt schließlich ans Ziel zu bringen. Wir verbinden damit über 16 Regionen Europas, von Danzig in Pommern bis zur Emilia-Romagna, sprich bis Bologna.
Was will ich damit sagen? – Dass letztendlich die kraftvolle Idee, Regionen zu verbinden, europäische Großdimensionen erreichen kann. Wir werden diese Umfahrung des Güterverkehrs um Europa abkürzen, um sechs bis sieben Tage pro Schiffsreise. Das heißt, wir werden natürlich den oberitalienischen, aber auch den slowenischen und den kroatischen Hafenwirtschaftsraum wesentlich aufwerten können. Wir werden auch den Standort Österreich, besonders Südösterreich, wesentlich aufwerten können, aber wenn wir gerade an Danzig, Solidarność und die Entwicklung Polens denken, dann ist das eine europäische Dimension, die letztendlich ohne kraftvolle Zusammenarbeit der Regionen nicht möglich gewesen wäre, Herr Präsident.
Ich bin politischer Praktiker und kein Zentralist, und deshalb freut es mich umso mehr, dass wir beweisbar herzeigen können, dass derartige Projekte, wenn wir sie gemeinsam tragen, erfolgreich durchgeführt werden können.
Wir haben aber in den letzten Jahren auch ein zweites Projekt entwickelt. Religion und Integration sind heute schon kurz Thema gewesen. In Kärnten leben zirka 11 000 Menschen aus Bosnien-Herzegowina, darunter viele Muslime. Wir haben eine Gemeinschaft gefunden, die sich äußerst positiv entwickelt hat. 4 000 dieser in der Krise, die es 1991 in Ex-Jugoslawien gegeben hat, nach Kärnten zugewanderten Menschen leben in Kärnten perfekt integriert, möchte ich einmal festhalten.
Deshalb ist es für mich auch faszinierend, ein Projekt der Regionen zwischen dem Kanton Sarajevo und dem Bundesland Kärnten entwickelt zu haben. Die Kärntner Landesregierung sowie die Kantonsregierung und der Landtag in Sarajevo haben beschlossen, dass wir auch in Zukunft ein Gemeinschaftsregionsprojekt, sozusagen außerhalb der EU, mit einer Region zustande bringen, das letztendlich auch zeigt, dass es möglich ist, zukünftige Brücken nach Europa zu bauen und zur Zusammenarbeit einzuladen, letztendlich aufbauend auf die Geschichte der Republik Österreich. – Das ist ja das, was so faszinierend daran ist.
Ganz kurz noch zum Thema Religionsfreiheit, weil wir darüber heute auch gesprochen haben. Es ist schon faszinierend, wenn du Samstag Abend in einer Moschee bist und der Iman dich zu einem Tee einlädt und du am nächsten Tag aus Kärnten nach Sarajevo ein E-Mail bekommst, in dem sich der Iman in Kärnten für diesen Besuch der Moschee bedankt. Es ist faszinierend, am Sonntag die katholische Messe zu besuchen. Es ist faszinierend, danach eine orthodoxe Messe zu besuchen und zum Abschluss ein jüdisches Museum.
Was will ich damit sagen? – Religionsfreiheit ist kein Anspruch, der einseitig gestellt werden kann, sondern das ist ein Anspruch auf Toleranz, die man gewähren muss. Ich würde einfach nur um dieses Verständnis bitten. Vielleicht kann man einmal eine Art religiöse Schulungsreise nach Sarajevo machen, denn dort hat es ja bis zu dem gro-
ßen Konflikt perfekt funktioniert. Es sind aber jetzt neue Wunden entstanden, die zeigen, dass Religionen, wenn sie sich feindlich gegenüberstehen, Menschen letztendlich trennen und auseinanderdividieren.
Es hat sich aber über Jahrhunderte gezeigt, dass gerade Sarajevo – das „Jerusalem“ in Südosteuropa – es geschafft hat, Menschen über Religionsbrücken zusammenzuführen. Ich würde dem Bundesrat einmal empfehlen, nach Sarajevo zu reisen. Ich bin sechs Mal in Sarajevo gewesen. Es ist einfach spannend, faszinierend und bedrückend zugleich, was sich in dieser Stadt abgespielt hat. Wenn Sie das Thema Religionsfreiheit einmal genauer analysieren möchten, dann würde ich Sie gerne dazu einladen, nach Sarajevo zu reisen. Ich habe dort viele Kontakte.
Abschließend darf ich sagen, dass mir dieses große Erfolgsprojekt der Euregio Senza Confini ganz wichtig ist, mit diesen 9 Millionen Menschen in drei Sprachräumen, aufbauend auf der schwierigen Geschichte dieses Lebensraumes. Das Islamgesetz in Österreich, das voriges Jahr sein hundertjähriges Jubiläum feierte, ist ja letztendlich eine Folge des Ersten Weltkrieges. Die so geschätzten Soldaten aus Bosnien-Herzegowina, die an der Plöckenfront für die Monarchie gekämpft haben, sind ja letztendlich die Grundlage für die Islamgesetzgebung in Österreich; das muss man ja auch wissen.
Daher ist es interessant, Herr Präsident, dass auch hinsichtlich des Themas, das vorhin besprochen wurde, Regionen, Nationalstaaten, Menschen, Städte, aber auch Religionen und Kulturen ein Substrat sind, das nicht immer ganz einfach ist, aber das letztendlich unserem Europa ein sehr vitales, buntes Erscheinungsbild gibt. So wie eben das „Weiße Ballett“ in Madrid und mein Lieblingsfußballklub Barcelona zwei Welten darstellen, die ein gesamtes positives Spanien sind, so ist es auch in Österreich so, dass Steirer, Salzburger, Vorarlberger, Kärntner, Wiener und alle anderen letztendlich auch ein buntes, vitales Österreich ergeben. Für mich ist also klar, dass starke Kooperationen der Regionen ein erfolgreicher Weg für Europa sein können.
Ich bedanke mich dafür, dass Sie hier in Wien sind, Herr Präsident! Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Ihnen, gemeinsam mit unseren Nachbarn, auch einmal sehr speziell die Euregio Senza Confini vorstellen dürfte. – Danke schön. (Beifall bei der FPÖ sowie bei Bundesräten der ÖVP.)
11.26
Präsident Edgar Mayer: Als Nächste zu Wort gelangt Frau Bundesrätin Kerschbaum. – Bitte.
11.26
Bundesrätin Elisabeth Kerschbaum (Grüne, Niederösterreich): Sehr geehrter Herr Präsident des Bundesrates! Sehr geehrter Herr Präsident Siso! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich denke, wir sind uns einig: Europa ist nicht Brüssel, sondern Europa besteht aus vielen Menschen – verschiedenen Menschen – in einer Vielzahl von Regionen, und genau diese Vielfalt ist es, die Europa ausmacht. Die europäische Einigung gibt es zwar schon seit einigen Jahren, aber es ist eine gewachsene Geschichte, und gerade diese kulturelle Vielfalt ist das Spannende an Europa.
Gleichzeitig müssen wir aber schon auch akzeptieren, dass es globale beziehungsweise zumindest europäische Probleme gibt, die wir auf regionaler Ebene einfach nicht lösen können. Da braucht es Zusammenarbeit – und dafür gibt es die Europäische Union. Das ist prinzipiell gut so, aber ich habe da immer ein Problem mit so Ausdrücken wie den „Zentralisten“ und den „Bürokraten“ in Brüssel, die da angeblich hantieren und etwas machen, das uns alle nichts angeht, wie wir es vorhin gehört haben. Damit habe ich ein Problem, weil ich denke, es gibt eben Dinge, die können wir auf lokaler Ebene nicht lösen, die müssen wir global oder zumindest europäisch angehen.
Ein Thema, mit dem wir seit 2008 regelmäßig beschäftigt sind, ist die Finanzmarktkrise – Probleme mit Banken, Immobilienblasen et cetera. Das fordert Solidarität, keine Frage, und diese Solidarität gibt es in Europa und wird es auch weiterhin geben. Was mir aber persönlich fehlt und was meiner Meinung nach zu langsam geht, ist die Prävention, sprich, wir müssen vorher schon Maßnahmen setzen, dass Spekulationen in diesem Ausmaß, wie sie erfolgt sind, die in die Krise geführt haben, nicht mehr vorkommen können, dass künftig nicht mehr Gewinne privatisiert und Verluste verstaatlicht werden, wie es auch ein Teil der Grundlage dieser Krise war. Das geht auch auf großer europäischer Ebene – nennen wir es Brüssel – meiner Meinung nach zu langsam.
Wir haben gestern im EU-Ausschuss auch über die Finanztransaktionssteuer gesprochen. Das ist eine Maßnahme, die wichtig wäre, um eben auch Spekulationen vorzubeugen. Es hat mich ein bisschen irritiert, dass vonseiten der FPÖ Bedenken gekommen sind, das würde die Wirtschaft zu sehr belasten.
Es ist auch schade, dass es nur elf von 27 EU-Staaten sind, die sich jetzt an diesem Projekt beteiligen werden, aber es ist ein wichtiger erster Schritt. Wie gesagt, es hätte auch schneller gehen können, aber es geschieht jetzt immerhin etwas.
Ein zweites Thema, das seit Kurzem wieder sehr aktuell geworden ist, sind Steuerhinterziehungen – also es geht ums Geld. Um in Europa Dinge umzusetzen, brauchen wir Geld. Wenn auf der einen Seite massiv Steuern hinterzogen werden, wenn wir es nicht schaffen, dem Einhalt zu gebieten, dass einfach Millionen und Milliarden und sogar Billiarden ins Ausland verschoben werden, dort steuerfrei oder steuerarm untergebracht werden und man das mit Rechnungen et cetera ausgleichen kann, wenn es sich jeder richten will und Steuern immer die anderen zahlen sollen, dann haben wir auf der anderen Seite einfach das Problem, dass wir nicht wissen, wo dann das Geld herkommen soll, um die Probleme, die wir europaweit haben, lösen zu können.
Dieses Geld brauchen wir einerseits in Brüssel, aber natürlich auch in den Regionen. Es sind heute schon einige Probleme angesprochen worden. Das vordringlichste ist derzeit auf jeden Fall die Arbeitslosigkeit. Wenn wir hören, dass in Spanien 55 Prozent der Jugendlichen arbeitslos sind, dann kann uns das nicht egal sein. Wenn der Herr Außenminister heute gesagt hat, Sozialpolitik ist Politik der Mitgliedstaaten und die Arbeitslosigkeit ist kein europäisches Problem, dann hat mich das schon etwas ... (Bundesrat Tiefnig: Das hat er überhaupt nicht gesagt! Das ist ein Blödsinn! – Anhaltende Zwischenrufe bei der ÖVP.) – Na dann stellt es dann richtig! Es war jedenfalls die Frage, was er denn zur Arbeitslosigkeit sagt, und er hat gesagt, Sozialpolitik ist eine Aufgabe der Mitgliedstaaten. So habe ich es verstanden. Vielleicht erklärt ihr es mir dann später.
Meiner Meinung nach wäre es sehr wohl erstrebenswert, in der Europäischen Union zumindest Sozialstandards zu schaffen, denn auch Länder und Gemeinden kämpfen damit, wenn die Sozialstandards in der Europäischen Union derartig unterschiedlich sind und wenn dann möglicherweise Menschen aus Rumänien plötzlich in Deutschland in größeren Ansiedelungen unterkommen wollen. Das ist ein Problem, mit dem die Gemeinden nicht zurechtkommen. Dieser soziale Ausgleich kann also nicht nur ein Problem der Mitgliedstaaten sein, sondern wenn wir sagen, die EU ist ein Friedensprojekt, dann ist es ein dringendes Erfordernis, dass sich die EU auch mit sozialen Belangen befasst und diesen sozialen Ausgleich schafft. (Beifall bei den Grünen.)
Wir wissen, dass wir künftig Probleme mit der Ressourcenknappheit haben werden. Wir haben Energieprobleme – so wie jetzt können wir nicht weitermachen –, und es gibt massive Umweltprobleme, auch wenn man sie vielleicht nicht mehr so sieht, wie in den siebziger Jahren, wo noch über den sauren Regen diskutiert worden ist. Humusabbau und andere Probleme bestehen nach wie vor, und diese Probleme werden frü-
her oder später virulent werden. Wichtig wäre auch hier Prävention, und auch dafür brauchen wir Geld – in den Regionen und in Brüssel, und zwar rechtzeitig und nicht dann, wenn die Krise da ist.
Wir haben noch ein Problem – es wurde heute auch schon kurz angesprochen –, und zwar die Politikverdrossenheit, die zu einem massiven Rechtsruck führt – teilweise, nicht in allen Mitgliedstaaten, aber Ungarn ist einfach ein besorgniserregendes Problem, das man sich auch europaweit genau anschauen muss. Man muss Vorkehrungen treffen, dass solche Dinge nicht geschehen, etwa dass einfach Verfassungen und Rechte ausgehebelt werden. Das geht so nicht, und es ist eine Gefahr für die Demokratie. Diese Politikverdrossenheit ist eine Gefahr für die Demokratie. (Beifall bei den Grünen. – Zwischenruf des Bundesrates Perhab.) – Nein, er ist schon gewählt worden. Das ist ja das Problem! In diesem Gremium bekommt eine Partei einen Sitz, die sich Partei nennt und dann nicht einmal dieses Mandat besetzt, denn man hat es ja nicht notwendig, Politik zu machen, denn Politik ist ja „pfui gack“!
Das ist die Ebene des Bundesrates. Ich denke mir, Wirtschaft und Politik auseinanderzuhalten wäre wichtig. Vor allem ist auch Politik wichtig. Politik darf nicht immer von allen als „pfui gack“ bezeichnet werden. Wenn man sich wählen lässt und dann nicht kommt, weil man sich in dieses Gremium nicht hineinsetzt, dann muss ich sagen: Das finde ich einfach bedenklich. Das betrifft jetzt nicht euch (in Richtung FPÖ), sondern das betrifft das Team Stronach. (Bundesrat Brückl: Aber du schaust uns an!) – Ich habe nur in diese Richtung geschaut, weil ich glaube, da hinten irgendwo wäre sein Platz.
Also diese Politikverdrossenheit und dieses Abwerten von Politik im Vergleich zu allen anderen Bereichen ist problematisch. Wenn es um Politik und Wirtschaft geht, hat immer die Politik den schlechteren Ruf, und die Wirtschaft, das sind immer die Braven, die Experten et cetera.
Aber zurück zum eigentlichen Thema. Diese Probleme, die ich gerade angesprochen habe, einerseits Ressourcenknappheit, Arbeitslosigkeit, aber auch Demokratieverdrossenheit, bekommen wir in den Regionen zu spüren, und die Lösungsansätze werden teilweise auch aus den Regionen kommen.
Wichtig ist es deshalb natürlich, dass die Regionalpolitik, die ja wirklich nahe am Menschen ist, auch auf EU-Ebene gehört wird. Deshalb ist auch der Ausschuss der Regionen eine wichtige Einrichtung, weil man sich natürlich nicht zentral in alle Bereiche hineindenken kann, und je mehr Leute mitdenken, je mehr Regionen Gedanken beisteuern, umso besser ist es.
Der Ausschuss der Regionen ist auch ein sehr eifriges Gremium. Ich habe gestern noch geschaut, wie viele Stellungnahmen von ihm abgegeben worden sind. Es ist nur so ähnlich wie beim Bundesrat, dass diese Stellungnahmen nicht unbedingt etwas mit regionalen Themen zu tun haben, sondern natürlich auch politisch geprägt sind. Aber man kann dem Ausschuss der Regionen nicht absprechen, dass er ein aktiver Ausschuss ist.
Was ich sehr schade finde und was mir fehlt: Vom Ausschuss der Regionen hört man nicht wirklich etwas, zumindest bei uns in Niederösterreich. Ich habe erst gestern versucht, über Google herauszufinden, wie oft unser Herr Landeshauptmann sich über den Ausschuss der Regionen geäußert hat. Die einzige Meldung, die ich gefunden habe, war aus 2011.
Es könnte funktionieren, wenn es einen breiten Ausschuss gäbe und alle so wie Sie – das hat mir wirklich super gefallen, als Sie gesagt haben: Ich spreche zu Ihnen als Vertreter der Europäischen Union! – hinausgehen und sagen würden: Ich bin Vertreter der Europäischen Union, ich sage euch, was funktioniert, ich sage euch, worum es
geht, und wir diskutieren darüber! Das würde ich mir wirklich wünschen, und nicht, dass alle nur meckern über das, was „da oben“ passiert, und betonen, dass man alles regional braucht und dass die anderen die Zentralisten sind. (Bundesrat Schennach: Das ist ein niederösterreichisches Problem! – Bundesrätin Mag. Kurz: Das ist auch ein Salzburger Problem! – Bundesrat Schennach: Elisabeth, das ist nicht in jedem Bundesland so!) – Das habe ich jetzt auch aus Kärnten gehört. (Bundesrat Schennach: Ich sage es ja nur, es ist nicht in jedem Bundesland so! ... das ist eher Niederösterreich!) – Und Kärnten, wie gesagt. (Bundesrat Schennach: Nein, es ist schon wahr!)
Jedenfalls würde ich mir solche Aussagen wie vom Herrn Präsidenten Siso auch von österreichischen Mitgliedern des Ausschusses der Regionen wünschen, weil es einerseits wichtig ist, dass die Regionen in der Europäischen Union mitwirken, aber andererseits eben auch, dass die Vertreter der Regionen die Entscheidungen der EU mittragen und nach außen tragen.
Es geht so ein bisschen um dieses alte Thema „Global denken – lokal handeln“. Ich würde mir wünschen, dass wir Sie zum Vorbild nehmen und das künftig auch von unseren Vertretern in den Regionen und in der Europäischen Union hören. (Beifall bei den Grünen und bei Bundesräten der SPÖ.)
11.36
Präsident Edgar Mayer: Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Bitte, Herr Kollege Schreuder.
11.36
Bundesrat Marco Schreuder (Grüne, Wien): Herr Präsident des Bundesrates! Herr Präsident Siso! Ich wollte noch einen Aspekt einbringen, weil ich vor nicht allzu langer Zeit im deutschen Fernsehen eine sehr interessante Debatte verfolgt habe. In der Europäischen Union gibt es durch die Beitritte auch ärmerer Länder – was wir ja prinzipiell gutheißen –, also beispielsweise von Rumänien oder Bulgarien, natürlich mittlerweile auch große Einkommensunterschiede.
Dies hat natürlich auch Folgen. In der Sendung ging es vor allem um deutsche Kommunen – sofern ich mich richtig erinnere, ging es in diesem Fall vor allem um Berlin und um Marburg, es kann aber auch Duisburg gewesen sein – und darum, dass sehr viele sehr arme Menschen aus ländlichen Regionen, aus sehr kleinen Dörfern, die es nicht gewohnt sind, in einem urbanen westeuropäischen Umfeld zu leben, dorthin ziehen, und zwar nicht einzelne Personen, sondern ganze Dörfer.
Die Verzweiflung der Bürgermeister und der Bürgermeisterinnen in diesen betroffenen Städten ist unfassbar groß. Sie wissen teilweise nicht, wie sie diese Menschen überhaupt in dieses urbane westeuropäische Leben integrieren können, denn die kommen aus wirklich sehr ländlichen Regionen – ich kenne das selbst, ich habe ja persönlich nach Rumänien hineingeheiratet, ich kenne diese Dörfer – und sind dort wirklich verloren und ausgeliefert, wohnen in Wohnungen, in Häusern, die reine Spekulationsobjekte sind, müssen unfassbar hohe Mieten bezahlen, also die werden wirklich ausgebeutet.
Die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, die mit diesem Problem konfrontiert sind, appellieren verzweifelt an die Europäische Union und rufen: Helft uns! – Immerhin war es doch eine gesamteuropäische Entscheidungen aller Staaten – eine Entscheidung, die ich vollkommen unterstütze! –, dass diese Staaten beitreten. Die Konsequenzen daraus, die Folgen dieser Einkommensunterschiede, dieser sozialen Unterschiede, diese Integrationsfragen, Zuwanderungsfragen und Ausbildungsfragen – ganz wichtige Fragen, denn diese jungen Leute können keine Sprache und gehen zum Großteil gar nicht in die Schule – sind gesamteuropäische Probleme, aber die Europäische Union tut für diese Gemeinden, für diese Kommunen nichts, und das ist ein Fehler.
Ich wollte das jetzt doch ansprechen, deswegen habe ich mich spontan zu Wort gemeldet, weil das natürlich auch für Wien ein Thema ist, aber vermutlich auch für andere österreichische Städte. Gerade in diesem Zusammenhang wünsche ich mir vom Ausschuss der Regionen eine ganz klare, aber auch harte Politik gegenüber der Europäischen Union. Helft den Kommunen bei diesem Problem! – Danke schön. (Beifall bei Grünen und SPÖ.)
11.39
Präsident Edgar Mayer: Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall.
Zur Abgabe eines Schlusswortes hat sich nochmals der Herr Präsident der Regionen zu Wort gemeldet. Ich erteile es ihm.
11.40
Ramón Luis Valcárcel Siso (Präsident des Ausschusses der Regionen) (in Übersetzung aus dem Spanischen): Herr Präsident! Ich möchte mich zunächst bei Ihnen allen für Ihre sehr interessanten Überlegungen, Ihre sehr interessanten Beiträge bedanken, die sicherlich den Diskurs bereichern, auch den Diskurs des Ausschusses der Regionen.
Wenn Sie es gestatten, möchte ich versuchen, eher allgemein zu reagieren, in unterschiedlichen Abschnitten.
Ich habe hier durchaus einen gemeinsamen Nenner eines Diskurses erkennen können, der in seiner Vielfalt auch aufzeigt, dass es doch bei vielen Fragen eine gewisse Übereinstimmung gibt – eine Übereinstimmung, der ich mich durchaus anschließen kann: dass Regionen nie als Problem verstanden werden dürfen, wenn es darum geht, die Europäische Union voranzubringen. Die Regionen sind nicht das Problem bei der Bewältigung der Krise, sondern ganz im Gegenteil, sie sind die Lösung, sie sind der Weg aus der Krise. Und das ist auch ganz einfach zu begründen.
Die Städte, die Regionen, die lokalen und regionalen Körperschaften, wir sind diejenigen, die wirklich eine Politik der Bürgernähe leben. Wir sind nah dran an den Menschen. Wir wissen, wo man am besten diesen Euro investiert. Und da soll niemand von irgendwo sonst herkommen und uns erklären, wo wir dieses Geld investieren sollen, das dann wirklich dazu beiträgt, uns aus dieser Krise zu führen.
Wir Regionen wissen ganz genau, die Bürgermeister wissen das in ihren Städten, wo diese Armutsnischen sind, wo man konkrete politische Maßnahmen setzen kann, um Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist ein weiteres Anliegen, wo wir Politiker, die wir die Verantwortung haben, wirklich ganz nah am Bürger zu agieren, uns mit den Menschen identifizieren müssen, auch die Probleme dieser Menschen zu unseren eigenen Problemen machen müssen. Und ich möchte hier wirklich nicht in eine romantische Anschauung verfallen, aber ich glaube, wir sollten auch die Träume dieser Menschen mitträumen. Wir haben die Pflicht, an der Seite dieser Menschen unseren Weg zu gehen. (Allgemeiner Beifall.)
Das ist eine der ersten Fragen, die für uns ein wichtiges Element ist und wo ich auch glaube, dass wir alle einer Meinung sind.
Aber es gibt auch noch einen Reformbedarf, einen großen Reformbedarf. Die Europäische Union kann und darf nicht ein politischer Raum der verschiedenen Geschwindigkeiten sein. Es stimmt natürlich, dass es Nationen gibt – und dazu gehört auch meine, und ich bin stolz darauf, Spanier zu sein, aber auch Spanien muss sich viel, viel mehr bemühen –, die ihre Hausaufgaben machen müssen. Wir müssen uns mehr auf diese gemeinsame Politik konzentrieren, eine Politik, die nicht kurzfristig auf das politische Kleingeld, auf den kurzfristigen Nutzen des Unternehmers ausgerichtet sein darf, sondern die langfristig agieren muss – im Sinne der Wirtschaft, im Sinne der Menschen.
Ich sage es ganz offen: Hier, in Spanien, in meiner Region und überall sonst sind Neid, Geiz und mangelnde Visionen in der Politik, in der politischen Klasse, zu der auch ich gehöre, der Grund dafür, dass es uns nicht gelungen ist, ein Problem wahrzunehmen, das jetzt wirklich grundlegend geworden ist: schnelles Geld zu machen, Spekulationen im Immobiliensektor. All diese Dinge haben uns in eine sehr schwierige Lage gebracht. Es wurde hier aber auch eines gesagt, was ich voll und ganz unterstütze: Die Geschichte ist dazu da, dass man aus ihr lernt; und wir haben unsere Lektion gelernt. Wir wissen, was wir nicht mehr tun sollten. Das ist wichtig! Das ist die Schlussfolgerung!
Man muss gemeinsam Politik machen, Reformen auf dem Arbeitsmarkt durchführen, die uns alle dazu verpflichten, eine Politik zu machen, für die die Schaffung von Arbeitsplätzen das zentrale Ziel ist. Das wurde hier gesagt. Es wurde zu Recht gesagt: Die beste Sozialpolitik ist die Sozialpolitik, die Arbeitsplätze schafft, denn wenn Arbeitsplätze geschaffen werden, dann gibt es Würde. Dann sind die Menschen in der Lage, in der Früh aufzustehen, weil sie wissen, was sie an diesem Tag zu tun haben. Damit wird gleichzeitig auch Reichtum geschaffen, und dann steigt die Produktivität. (Allgemeiner Beifall.)
Wir müssen uns auch das gesamte Steuersystem ansehen, ein Finanzsystem, das auch die Vielfalt der verschiedenen Mitgliedstaaten mit berücksichtigt und dennoch einen gemeinsamen Kern hat, eine Komponente, die dazu führt, dass wir einander ähnlicher werden, damit wir nicht ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten schaffen, damit diese Kluft zwischen den reichen Regionen, den reichen Mitgliedstaaten und den armen Regionen, in diesem konkreten Fall denen des Südens, nicht noch weiter aufgeht. Das dürfen wir nicht zulassen! Wir müssen den Stier bei den Hörnern packen, wie wir das auch in Spanien sagen. Wir müssen mutig sein. Wir müssen Entscheidungen treffen, und wir müssen alle an einem Strang ziehen.
Dieses Finanzsystem ist reformbedürftig. Es kann nicht sein, dass wir zum Beispiel ein Unternehmen in einem Land haben, ein kleines oder mittleres Unternehmen oder auch eine öffentliche Körperschaft, die einen Kredit braucht und dafür doppelt so viele Zinsen zahlen muss wie eine andere Region oder ein anderer Mitgliedstaat in Europa. Auch da müssen wir in die gleiche Richtung gehen, damit wir letztendlich dieses gemeinsame Europa haben, das wirklich eine Gemeinschaft aller Bürgerinnen und Bürger ist. Das ist schwierig, aber es ist nicht unmöglich. Wir haben die Kapazitäten dazu. Wir haben auch das Engagement. Und die Geschichte zeigt, dass das der Weg zur Erreichung unserer Ziele ist.
Der dritte gemeinsame Nenner, meine Damen und Herren, ist die Vielfalt. Die Vielfalt ist es, die Europa groß macht: die sprachliche Vielfalt, die kulturelle Vielfalt, die religiöse Vielfalt. Und es ist doch wunderbar, Worte zu hören wie die, die wir auch hier gehört haben, wo religiöse Gemeinschaften gut zusammenleben. Ich spreche zu Ihnen als jemand, der aus einer Region in Spanien kommt, im Mittelmeerraum, die Murcia heißt. Ich bin Präsident der autonomen Region Murcia, niemand weiß, wo das ist (Vizepräsident Mag. Himmer hebt die Hand), aber ich kann es Ihnen erklären. Es liegt nördlich von Andalusien und südlich von Valencia. Es gibt also vielleicht doch einige, die wissen, wo das liegt, und offensichtlich weiß es auch der Herr Präsident.
Diese Region ist durch eine wirklich eigene Identität gekennzeichnet und durch ein Identitätsmerkmal, das Toleranz ist – Toleranz, Verständnis, Zusammenleben. Denn drei Kulturen sind dort im Laufe der Jahrhunderte zusammengewachsen: Griechen, Phönizier, Römer, zu unterschiedlichen Zeiten. Später kamen dann auch noch die Moslems und natürlich die Christen und die Juden. Und wir haben aus dieser Wirklichkeit unsere Wirklichkeit gemacht. Die drei Kulturen haben zusammengelebt, und dazu braucht es Toleranz, dazu braucht es gegenseitige Achtung. Das ist etwas, was
man leben muss. Dieser Respekt, den man sich auch für sich selbst wünscht, muss auch den anderen entgegengebracht werden.
Das ist auch ein großer gemeinsamer Nenner dieses Europas, ein gemeinsamer Nenner, der uns groß macht, der uns großartig macht, der es uns ermöglicht, wirklich ganz optimistisch in die Zukunft zu schauen – auch mit großer Freude, trotz aller Schwierigkeiten; denn das sind die Instrumente, die uns stärken und die diese unglaubliche Realität der Europäischen Union so besonders machen.
Dieser erste Block der gemeinsamen Nenner hat einen sehr positiven Unterton, aber es gibt auch Probleme. Ich bin nicht davor zurückgeschreckt, sie anzusprechen. Sie haben in Ihren wunderbaren Redebeiträgen auch dazu beigetragen, diese Wirklichkeit Europas zu bereichern.
Es gibt Probleme: Arbeitslosigkeit, vor allem die Jugendarbeitslosigkeit. Und ich möchte es noch einmal sagen: Die beste Sozialpolitik ist die Schaffung von Arbeitsplätzen. Junge Menschen brauchen Arbeit, denn sonst hat dieses Europa keine Zukunft. Die Jugend ist unsere Zukunft. Ich möchte auch nicht auf Menschen vergessen, die schon 40 Jahre alt sind, ihre Arbeit verloren haben und möglicherweise große Schwierigkeiten haben, wieder Arbeit zu finden. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen! Alles andere ist wunderbar. – Ja, das muss auch getan werden. Dem muss man sich stellen.
Wir dürfen diese Vielfalt, diese Komplexität des Lebens natürlich nicht über Gebühr simplifizieren, aber es gibt dennoch Bereiche, die wichtiger sind als andere – und dieser Bereich ist unverzichtbar, grundlegend. Das ist es, wo wir die Zukunft aufs Spiel setzen, wenn wir nicht handeln. Das ist ein Spiel, das wir gewinnen müssen!
Das ist eines der großen Probleme, aber es gibt noch einige andere. Es wurde über die Aufnahme neuer Länder in die Europäische Union gesprochen. Es sind Länder der Europäischen Union zu einem Zeitpunkt beigetreten, zu dem man sich vielleicht noch nicht einmal vorstellen konnte, welch verheerende Auswirkungen diese Wirtschaftskrise einmal haben würde. Wir haben alle mit bester Absicht und mit bestem Willen gehandelt. Und wir haben gesagt: Europa muss wachsen, nicht nur wirtschaftlich!
Europa ist aber nicht nur ein Wirtschaftskonzept, Europa ist ein Werteprojekt, ein Projekt demokratischer Werte. Das geht weit über die Wirtschaft hinaus, so wichtig die Wirtschaft auch ist. Aber wir haben eben entschieden, gemeinsam voranzuschreiten. Und dann kam die Krise und mit der Krise die Ausgrenzung, die Armut, das Elend und auch der Hunger. Auch das gibt es in Europa.
Europa muss die Lösung für das Problem sein. Europa hat die nötigen Muskeln dazu. Europa hat mehr als genug Kraft und Macht, um diese Situation zu überwinden. Und da, genau da greift der Mechanismus der Solidarität, denn wenn es diesen nicht gibt, was soll dann das alles, wozu dann die schönen Worte?
Ich bin seit 18 Jahren im Ausschuss der Regionen tätig. Ich gehöre also zu den dienstältesten Mitgliedern – ich bin noch nicht der Älteste an Lebensjahren, auch wenn ich nicht mehr der Jüngste bin. Dort wurde immer von den zwei großen Säulen gesprochen, die diese Idee der Europäischen Union tragen – wunderbare Worte, keine Frage –: Solidarität, Subsidiarität, Engagement. Aber all das muss sich auch materialisieren, das dürfen nicht leere Worte bleiben. Solidarität ist eine Ressource. Solidarität ist eine Verpflichtung, ist eine Lebensweise. Und ich möchte noch etwas sagen: Die Solidarität ist das Identitätsmerkmal dieser Europäischen Union. Das ist Europa! Und das ist der Weg, den wir gehen müssen, um die Probleme zu vermeiden, vor denen wir heute stehen. (Allgemeiner Beifall.)
Und damit, meine Damen und Herren – ich komme schon zum Schluss –, komme ich auch noch zu anderen Problemen, die vielleicht schwieriger zu quantifizieren sind, viel-
leicht in gewisser Weise universeller sind, eher in den Bereich des Abstrakten fallen, die aber dennoch Probleme sind und bleiben. Große Sorge bereitet mir – und ich weiß, dass das auch bei Ihnen der Fall ist, das habe ich auch heute Morgen hier gehört – die Tatsache, dass der Euro in der Krise steckt.
Der Euro ist eine Währung, die es zu retten gilt, keine Frage. Der Euro hat Stärke gezeigt, auch wenn man hier sagen kann, mit gewissen Vorbehalten, denn die jüngsten Entwicklungen haben doch dazu geführt, dass die Grundlagen der Europäischen Union überall dort ins Wanken geraten sind, wo es um die europäische Währung gegangen ist. Und ich spreche hier von Zypern; man soll die Dinge ja nicht beim Namen nennen. Natürlich wird der Euro gerettet werden, kein Zweifel, der Euro wird gerettet werden. Das Problem ist, ob es uns gelingt, den Euro zu retten und gleichzeitig auch viele Menschen zu retten. Da gilt es genau hinzuschauen.
Europa hat eine starke Währung, aber Europa hat vor allem eine Gesellschaft, die aus Menschen besteht: Europäerinnen und Europäer, die mit immer größerer Sorge und – ich sage es noch klarer – mit einer gewissen Skepsis diese Europäische Union beäugen. Und das muss uns Sorgen bereiten! Sorgen bereiten muss uns auch die Tatsache, dass da politische Ideen, populistische Parteien entstehen. Und wir alle wissen, welche Gefahr der politische Populismus in sich birgt.
Die Geschichte ist gepflastert mit allzu vielen Anlässen, die uns fürchten lassen, dass politische Parteien entstehen, die nur von Populismus genährt werden, von der Euroskepsis leben, denn wir wissen, was geschehen wird: Wir werden die Krise überwinden. Sie haben sie schon überwunden, und wir möchten von Ihnen lernen, möchten in Ihre Fußstapfen treten und die Krise auch überwinden. Europa wird diese Situation überwinden, und dann wird es keine Krise mehr geben. Aber diese Parteien, die dann im Schatten des Populismus entstanden sind, werden die auch mit der Krise verschwinden, oder bleiben uns diese dann erhalten?
Das ist die große Gefahr, das ist das Risiko! Und dieses Risiko müssen wir ansehen, dem müssen wir uns stellen. Wenn wir es nicht tun, dann werden wir ein Europa vorfinden, das wir eigentlich nicht wollten. Das ist ein anderes Problem, dieser eher abstraktere Bereich. Ja, natürlich, das ist abstrakter, aber es ist ein Problem – nichtsdestotrotz.
Noch etwas in diesem Zusammenhang: Wir dürfen niemals und bei keinem Anlass auf unsere politische Verpflichtung vergessen, nämlich dass es gilt, den Wohlfahrtsstaat weiterhin zu garantieren. Die Krise darf nicht von den Ärmsten bezahlt werden. Ich glaube, dass es gilt, alle Bemühungen in Richtung dieser Politik der Sparsamkeit, der Austeritätspolitik zu lenken, dass es gilt, die öffentlichen Haushalte in Ordnung zu bringen, die öffentlichen Defizite zu kontrollieren, denn diese Kontrolle ist die Grundlage für die Politik des Wohlfahrtsstaates. Aber wir dürfen uns da auch nicht festbeißen und anderes aus den Augen verlieren. Es gilt, den goldenen Mittelweg zu finden – und das ist sehr, sehr schwierig, das ist mir wohl bewusst, aber es ist auch nicht unmöglich –, den goldenen Mittelweg zwischen der Defizitkontrolle, einer guten Führung der öffentlichen Konten einerseits mit der Garantie des Wohlfahrtsstaates auf der anderen Seite.
Jetzt komme ich wirklich zum Schluss, Herr Präsident. Ich darf Ihnen etwas erzählen, was in meiner Region geschieht. Ich hätte das öffentliche Defizit auf der Grundlage von Verpflichtungen, die wir mit der spanischen Regierung eingegangen sind, kontrollieren müssen. Die spanische Regierung, das wissen Sie, wird von einer politischen Partei geführt, die sich Partido Popular – Volkspartei – nennt, der auch ich angehöre. Ich hätte da meine Defizitvorgaben einhalten müssen. Aber ich sage Ihnen hier: Ganz offen und ganz bewusst habe ich entschieden, diese Defizitvorgaben nicht einzuhalten, denn das hätte bedeutet, dass wir Krankenhäuser hätten sperren müssen, dass wir den Bürgern ihre Rechte hätten beschneiden müssen. Es hätte bedeutet, bei der Qua-
lität der Bildung einzusparen und sozialpolitische Maßnahmen massiv zu kürzen. Ich habe es nicht getan, ganz bewusst nicht, aber man hätte es tun müssen. (Beifall bei SPÖ und Grünen.)
Ich sage Ihnen das jetzt wirklich nicht mit Selbstzufriedenheit. Es wäre mir lieber gewesen, wenn ich meine Haushaltsverpflichtungen erfüllt hätte. Aber ich fordere von der spanischen Regierung – und ich sage das auch vor der Europäischen Union –, dass wir die realen Kosten der Dienstleistungen endlich einmal auf den Tisch legen. Wir müssen wissen, was die Dinge kosten, und dann können wir entscheiden, was wir mit supranationalen, regionalen, nationalen, lokalen Politiken subventionieren wollen, damit wir die realen Kosten finanzieren können. Dann gibt es keine Entschuldigungen mehr, keine Ausreden mehr für die Nichteinhaltung von Defizitvorgaben.
Wir Politiker müssen auch mit dem Herzen handeln. In einer Zeit, in der die Gesellschaft leidet, braucht es noch mehr Herz in der Politik. Wir Politiker sind keine Bürokraten, wir sind keine Verwalter der öffentlichen Gelder. Wir Politiker müssen mit jenen Hand in Hand gehen, die am meisten zu leiden haben. – Vielen Dank. (Allgemeiner Beifall.)
12.00
Präsident Edgar Mayer: Muchas gracias, señor Presidente! Ich bedanke mich sehr herzlich auch für die emotionalen Ausführungen, die sehr beeindruckend waren, und nochmals herzlichen Dank für Ihren Besuch!
Einen Dank möchte ich auch anschließen an alle, die im Internationalen Dienst hier mitgearbeitet haben. Stellvertretend für alle möchte ich mich bei Dr. Brigitte Brenner und ihrem Team bedanken. Bedanken möchte ich mich auch beim Landtagspräsidenten Herwig van Staa, dem Vizepräsidenten des AdR. Er hat uns hier wirklich sehr dabei unterstützt, dass dieser Besuch zustande gekommen ist.
Ich wünsche Ihnen, Herr Präsident Siso, alles Gute, und bedanke mich nochmals. Gute Heimreise! (Allgemeiner Beifall. – Präsident Siso verlässt den Sitzungssaal.)
*****
Ich darf jetzt ganz besonders herzlich eine Gruppe aus Nickelsdorf, die heute zu Besuch ist, begrüßen. Ihnen wird einiges spanisch vorgekommen sein. (Heiterkeit.) Es ist nicht immer so bei uns.
Bevor ich den Vorsitz an Frau Vizepräsidentin Kurz übergebe, möchte ich noch den Herrn Altbundesrat und neuen Minister Mag. Gerald Klug in unserer Mitte herzlich begrüßen. (Allgemeiner Beifall.)
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz (den Vorsitz übernehmend): Kolleginnen und Kollegen, auch ich darf mit besonderer Freude unseren neuen Bundesminister für Landesverteidigung und Sport Gerald Klug, unseren ehemaligen Kollegen, bei uns im Bundesrat begrüßen. Ich darf dich sehr herzlich willkommen heißen! Schön, dass du da bist! (Allgemeiner Beifall.)
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz: Hinsichtlich der eingelangten, vervielfältigten und verteilten Anfragebeantwortung 2722/AB
beziehungsweise jenes Schreibens des Bundeskanzlers gemäß Artikel 23c Abs. 5 Bundes-Verfassungsgesetz, Herrn Mag. Wolfgang Nitsche als Mitglied des Verwaltungsrates der Europäischen Investitionsbank zu benennen,
sowie jenes Schreibens der Bundesministerin für Finanzen gemäß Artikel 50 Abs. 5 Bundes-Verfassungsgesetz betreffend die Aufnahme von Verhandlungen mit Belize zum Abschluss eines Protokolls zur Abänderung eines Abkommens auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und Vermögen
und jenes Schreibens des Ministerratsdienstes des Bundeskanzleramtes betreffend den Aufenthalt der Bundesministerin für Finanzen Dr. Maria Fekter am 5. April 2013 in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union
verweise ich auf die im Sitzungssaal verteilten Mitteilungen gemäß § 41 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Bundesrates, die dem Stenographischen Protokoll dieser Sitzung angeschlossen werden.
Die schriftlichen Mitteilungen haben folgenden Wortlaut:
Anfragebeantwortung (siehe S. 12)
*****
Schreiben des Bundeskanzlers betreffend Beschluss gemäß Art. 23c Abs. 5 B-VG:
„WERNER FAYMANN
BUNDESKANZLER
Herrn Präsident des Bundesrates
Parlament
Dr. Karl-Renner-Ring 3
1017 Wien Wien, am 20. März 2013
Sehr geehrter Herr Präsident!
Entsprechend Art. 23c Abs. 5 B-VG darf ich Ihnen mitteilen, dass der Ministerrat im Sinne der diesbezüglich gemäß Art. 23c Abs. 2 B-VG stattgefundenen Konsultationen mit den im Hauptausschuss des Nationalrates vertretenen Parteien in seiner 179. Sitzung am 12. März 2013 beschlossen hat – die Herstellung des Einvernehmens mit dem Hauptausschuss des Nationalrates vorausgesetzt, Herrn Mag. Wolfgang Nitsche als Mitglied des Verwaltungsrates der Europäischen Investitionsbank zu benennen.
Mit freundlichen Grüßen
2 Beilagen
Lebenslauf wird nicht veröffentlicht“
„BESCHLUSSPROTOKOLL Nr. 179
über die Sitzung des Ministerrates am 12. März 2013
12. Bericht des Bundeskanzlers, ZI. 405.828/0017-IV/5/13, betr. Nominierung von Mag. Wolfgang NITSCHE als Mitglied im Verwaltungsrat der Europäischen Investitionsbank.
Der Ministerrat beschließt im Sinne des Antrages.
15. Bericht des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten, ZI. AT.2.07.47/0003-ll.8b/13, betr. Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und des Einsatzes chemischer Waffen und über die Vernichtung solcher Waffen; Entsendung einer österreichischen Delegation zur Dritten Überprüfungskonferenz vom 8. bis 19. April 2013 in Den Haag, Niederlande.
Der Ministerrat beschließt im Sinne des Antrages.
16. Bericht des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten, ZI. AT.8.19.11/0044-1.7b/13, betr. Nationaler Aktionsplan zur Umsetzung von Resolution 1325 (2000) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen; Vierter Umsetzungsbericht.
Der Ministerrat beschließt im Sinne des Antrages.
17. Bericht des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, ZI. 434.001/0062-VI/A/6/13, betr. Arbeitsmarktlage im Monat Februar 2013.
Der Ministerrat beschließt im Sinne des Antrages.
18. Bericht der Bundesministerin für Finanzen, ZI. 010.221/0021-IV/4/13, betr. Erteilung der Verhandlungsvollmacht über ein Protokoll zur Abänderung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Islamischen Republik Pakistan zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen samt Protokoll.
Der Ministerrat beschließt im Sinne des Antrages.
19. Bericht der Bundesministerin für Finanzen, ZI. 010.221 /0022-IV/4/13, betr. Erteilung der Verhandlungsvollmacht über ein Protokoll zur Abänderung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik der Philippinen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen.
Der Ministerrat beschließt im Sinne des Antrages.
20. Bericht der Bundesministerin für Finanzen, ZI. 010.221 /0023-IV/4/13, betr. Erteilung der Verhandlungsvollmacht über ein Protokoll zur Abänderung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik Tunesien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen.
Der Ministerrat beschließt im Sinne des Antrages.
21. Bericht der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur, ZI. 12.940/0004-111/2/13, betr. Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Schulunterrichtsgesetz, die Schulunterrichtsgesetz-Novelle BGBl. I Nr.9/2012, die Schulunterrichtsgesetz-Novelle BGBl. I Nr. 52/2010, das Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige, Kollegs und Vorbereitungslehrgänge, das Bundesgesetz über die Berufsreifeprüfung, das Pflichtschulabschluss-Prüfungs-Gesetz, das Schulpflichtgesetz 1985, das Schülerbeihilfengesetz 1983, das Privatschulgesetz, das Bundes-Schulaufsichtsgesetz, das Schülervertretungengesetz, das Schulorganisationsgesetz, das Schulzeitgesetz 1985, das Land- und forstwirtschaftliche Bundesschulgesetz, das Bundesgesetz über die Rechtspersönlichkeit von religiösen Bekenntnisgemeinschaften und das Bundesgesetz über die Regelung des Instanzenzuges bei Erlassung von Bescheiden in Angelegenheiten der staatlichen Kultusverwaltung geändert werden (Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz für den Schul- und Kultusbereich).
Der Ministerrat beschließt im Sinne des Antrages.
22. Bericht der Bundesministerin für Inneres, ZI. LR1300/0021-111/1/13, betr. Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das Bundes-Gemeindeaufsichtsgesetz, das Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz, das EU-Polizeikooperationsgesetz, das Kriegsmaterialgesetz, das Luftfahrtsicherheitsgesetz 2011, das Meldegesetz 1991, das Namensänderungsgesetz, das Passgesetz 1992, das Personenstandsgesetz 2013, das Polizeibefugnis-Entschädigungsgesetz, das Polizeikooperationsgesetz, das Pyrotechnikgesetz 2010, das Sicherheitspoli-
zeigesetz, das Sprengmittelgesetz 2010, das Staatsgrenzgesetz, das Strafregistergesetz 1968, das Vereinsgesetz 2002, das Versammlungsgesetz 1953, das Waffengesetz 1996, das Wappengesetz und das Zivildienstgesetz 1986 geändert werden (Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz – Bundesministerium für Inneres).
Der Ministerrat beschließt im Sinne des Antrages.“
*****
Schreiben der Bundesministerin für Finanzen gemäß Art. 50 Abs. 5 B-VG:
„DR. MARIA FEKTER BMF
FINANZMINISTERIN BUNDESMINISTERIUM
FÜR FINANZEN
Herr Präsident
des Bundesrats
Edgar Mayer Wien, am 25. März 2013
Parlament
1017 Wien GZ: BMF-010221/0019-IV/4/2013
Sehr geehrter Herr Präsident!
Gemäß Artikel 50 Abs. 5 B-VG beehre ich mich Sie davon zu informieren, dass gemäß dem Ministerratsbeschluss der 178. Sitzung des Ministerrates am 5. März 2013 der Herr Bundespräsident am 18. März 2013 die Vollmacht zur Aufnahme von Verhandlungen mit Belize zum Abschluss eines Protokolls zur Abänderung des am 8. Mai 2002 unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik Österreich und Belize auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, BGBl. III Nr. 132/2003, erteilt hat. Die Aufnahme dieser Verhandlungen wird ehestmöglich erfolgen.
Aufgrund der internationalen Entwicklungen im Bereich der steuerlichen Transparenz und Amtshilfebereitschaft hat sich eine Revision des Abkommens zur Anpassung an den neuen OECD-Standard hinsichtlich des steuerlichen Informationsaustauschs von Bankauskünften als erforderlich herausgestellt.
Zur näheren Information lege ich eine Kopie des Vortrages an den Ministerrat bei.
Beilage
Mit freundlichen Grüßen“
„BMF
BUNDESMINISTERIUM
FÜR FINANZEN
GZ. 010221/0019-IV/4/2013
178/13
VORTRAG AN DEN MINISTERRAT
betreffend die Erteilung der Verhandlungsvollmacht über ein Protokoll zur Abänderung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und Belize auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen
Im Verhältnis zu Belize wird der Eintritt einer internationalen Doppelbesteuerung durch das Abkommen zwischen der Republik Österreich und Belize auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, BGBl. III Nr. 132/2003, vermieden. Auf-
grund der internationalen Entwicklungen im Bereich der steuerlichen Transparenz und Amtshilfebereitschaft hat sich eine Revision des Abkommens zur Anpassung an den neuen OECD-Standard hinsichtlich des steuerlichen Informationsaustauschs durch ein Protokoll zur Abänderung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und Belize auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen als erforderlich herausgestellt.
Das geplante Protokoll wird gesetzändernd bzw. gesetzesergänzend sein und daher der Genehmigung durch den Nationalrat gemäß Art. 50 B-VG bedürfen. Der Nationalrat und der Bundesrat werden gemäß Art. 50 Abs. 5 B-VG von der Aufnahme der Verhandlungen unverzüglich unterrichtet werden.
Negative finanzielle Auswirkungen des Protokolls auf den Bundeshaushalt sowie auf andere Gebietskörperschaften sind nicht zu erwarten. Das Protokoll hat keine Auswirkungen auf die Planstellen des Bundes.
Ich stelle daher im Einvernehmen mit dem Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten den
Antrag,
die Bundesregierung wolle dem Herrn Bundespräsidenten vorschlagen, Dr. Wolfgang NOLZ, Sektionschef im Bundesministerium für Finanzen und im Falle seiner Verhinderung Dr. Heinz JIROUSEK, Abteilungsleiter im Bundesministerium für Finanzen, zur Leitung der Verhandlungen über ein Protokoll zur Abänderung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und Belize auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen zu bevollmächtigen.
27. Februar 2013
Die Bundesministerin:
Fekter“
*****
Schreiben des Bundeskanzleramtes betreffend Aufenthalt eines Mitgliedes der Bundesregierung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union:
„BUNDESKANZLERAMT ÖSTERREICH
Mag. Stephan LEITNER
MINISTERRATSDIENST
An den
Präsidenten des Bundesrates Sachbearbeiterin: Gabriele MUNSCH
Parlament Pers. eMail: gabriele.munsch@bka.gv.at
1017 Wien Telefon: 01/531 15 20/2217
Datum: 3. April 2013
Sehr geehrter Herr Präsident!
Der Ministerratsdienst des Bundeskanzleramtes teilt mit, dass sich die Bundesministerin für Finanzen Dr. Maria FEKTER am 5. April 2013 in Brüssel aufhalten wird.
Für den Bundeskanzler:
LEITNER“
*****
Vertretung von Mitgliedern der Bundesregierung
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz: Darüber hinaus gebe ich bekannt, dass das Schreiben des Ministerratsdienstes des Bundeskanzleramtes betreffend den Aufenthalt der Bundesministerin für Justiz Mag. Dr. Beatrix Karl vom 1. bis 7. April 2013 in Israel bei gleichzeitiger Beauftragung des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung Univ.-Prof. Dr. Karlheinz Töchterle mit ihrer Vertretung eingelangt ist.
*****
Eingelangt ist der ORF-Jahresbericht 2012 gemäß § 7 ORF-Gesetz, der dem Ausschuss für Verfassung und Föderalismus zur Vorberatung zugewiesen wurde.
Darüber hinaus ist der Bericht der Bundesanstalt für Verkehr über technische Unterwegskontrollen im Jahr 2012 eingelangt, der dem Ausschuss für Verkehr, Innovation und Technologie zur Vorberatung zugewiesen wurde.
Eingelangt sind und den zuständigen Ausschüssen zugewiesen wurden jene Beschlüsse des Nationalrates beziehungsweise jene Berichte, die jeweils Gegenstand der heutigen Tagesordnung sind. Die Ausschüsse haben ihre Vorberatungen abgeschlossen und schriftliche Ausschussberichte erstattet.
Ich habe die zuvor genannten Verhandlungsgegenstände sowie die Wahl der ersten Schriftführerin/des ersten Schriftführers für den Rest des 1. Halbjahres 2013 beziehungsweise die Erklärung des Bundesministers für Landesverteidigung und Sport gemäß § 37 Abs. 4 Geschäftsordnung des Bundesrates betreffend „Aktuelle Themen im Bereich Landesverteidigung und Sport“ auf die Tagesordnung der heutigen Sitzung gestellt.
Wird zur Tagesordnung das Wort gewünscht? – Das ist nicht der Fall.
Behandlung der Tagesordnung
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz: Aufgrund eines mir zugekommenen Vorschlages beabsichtige ich, die Debatte über die Tagesordnungspunkte 10 und 11, 12 bis 14, 15 bis 17, 19 und 20, 23 und 24 sowie 25 bis 27 jeweils unter einem durchzuführen.
Wird dagegen eine Einwendung erhoben? – Das ist nicht der Fall. Wir werden daher so vorgehen.
Wahl der/s ersten Schriftführerin/s für den Rest des 1. Halbjahres 2013
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz: Wir gehen in die Tagesordnung ein und kommen zum 1. Punkt der Tagesordnung: Es ist dies die Wahl der/s ersten Schriftführerin/s für den Rest des 1. Halbjahres 2013. Diese Wahl ist durch die vom neu konstituierten Landtag Kärnten durchgeführten Neuwahlen in den Bundesrat notwendig geworden.
Wir gehen nunmehr in den Wahlvorgang ein.
Es liegt mir der Vorschlag vor, Frau Bundesrätin Ana Blatnik zur Schriftführerin des Bundesrates für den Rest des 1. Halbjahres 2013 zu wählen.
Ich bitte nun jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Wahlvorschlag ihre Zustimmung geben, um ein Handzeichen. – Es ist dies Stimmeneinhelligkeit. Der Wahlvorschlag ist somit angenommen.
Ich gehe davon aus, dass die Gewählte die Wahl annimmt. (Bundesrat Todt: Die Gewählte nimmt die Wahl an!) – Danke.
Erklärung des Bundesministers für Landesverteidigung und Sport gemäß § 37 Abs. 4 GO-BR betreffend „Aktuelle Themen im Bereich Landesverteidigung und Sport“
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz: Wir gelangen nun zum 2. Punkt der Tagesordnung.
Ich begrüße dazu Herrn Bundesminister Mag. Klug noch einmal recht herzlich. (Allgemeiner Beifall.)
Bevor ich dem Herrn Bundesminister das Wort erteile, gebe ich bekannt, dass mir ein schriftliches Verlangen von fünf Mitgliedern des Bundesrates im Sinne des § 37 Abs. 5 der Geschäftsordnung des Bundesrates vorliegt, im Anschluss an die abgegebene Erklärung eine Debatte durchzuführen. Da dieses Verlangen genügend unterstützt ist, werde ich ihm ohne Weiteres stattgeben.
Ich erteile nun dem Herrn Bundesminister zur Abgabe seiner Erklärung das Wort. – Bitte, Herr Bundeminister.
12.08
Bundesminister für Landesverteidigung und Sport Mag. Gerald Klug: Geschätzte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen! Geschätzte Besucherinnen und Besucher aus Micheldorf! Bei meiner heutigen Antrittsrede möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen, etwas nachzuholen, das mir unsere an sich sehr flexible Geschäftsordnung aus dem Bundesrat nicht mehr ermöglicht hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein kleiner Ausflug in die Vergangenheit sei mir gestattet.
Ich habe seit dem Jahr 2005 gerne die Aufgabe eines Bundesrates im österreichischen Parlament aktiv wahrgenommen und habe in dieser Zeit viele Kolleginnen und Kollegen hier im Saal kennen und schätzen gelernt. Wichtig ist natürlich bei dieser Gelegenheit, dass man nie im Detail dazusagt, wie weitläufig und dass das auch über Parteigrenzen hinweg möglich war. Noch wichtiger ist in der Politik, dass man bei dieser Gelegenheit keinesfalls einzelne Namen ausdrücklich nennt, aber die hier im Saal Anwesenden wissen genau, wen ich meine. Ich habe diese Kollegialität sehr schätzen gelernt, auch wenn sich meine konkrete Aufgabenstellung im Laufe der Zeit geändert hat.
Es liegt in der Natur der Sache – modern: job description –, dass die Aufgabenstellung eines Mitglieds einer Fraktion zu Beginn eine andere ist, als es dann die Aufgabe eines Fraktionsvorsitzenden ist. Ich habe mich natürlich bemüht – auch aufgrund dieser exponierten Stellung hier im Saal –, einerseits die Interessen meiner Fraktion im Idealfall gut über die Bühne und auch durchzubringen. Darüber hinaus war es mir immer wichtig, einen kollegialen und fairen persönlichen Umgang zu pflegen. Das ist über weite Strecken sehr gut gelungen.
Ich habe versucht, das Meinige dazu beizutragen, und ich glaube, dass es uns hier im Bundesrat gemeinsam gelungen ist, einen politischen und zum Teil sehr persönlichen Dialog zu führen, der von der österreichischen Bevölkerung auch wertgeschätzt wird. Von der einen Seite wird das Klima als familiär beschrieben, von der anderen Seite kommen immer wieder Reflexionen von den Zuseherinnen und Zusehern zu Hause, die dem österreichischen Bundesrat, sofern sie die Übertragungen unmittelbar im Fernsehen sehen, eine sehr hohe Sachkompetenz in den einzelnen Tagesordnungspunk-
ten und in den einzelnen Materien zusprechen. Und darüber freue ich mich natürlich auch im Nachhinein.
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, damit spanne ich jetzt doch ein wenig die Brücke zu dieser im Moment noch etwas neuen Situation hier auf dieser sogenannten Regierungsbank. Aber Sie alle wissen, dass mir als gelerntem Parlamentarier, als der ich in Wien in die Politik eingestiegen bin, auch in meiner zukünftigen Aufgabenstellung die Zusammenarbeit mit dem Parlament eine sehr wichtige sein wird. Es ist auch von gewissem politischem Vorteil, wenn man weiß, was ein Landesverteidigungsausschuss ist, was ein Sportausschuss ist und was in diesen Bereichen so gemeinsam diskutiert wird. Dadurch hat man dann auch in der eigenen politischen Arbeit einen anderen Zugang, was die Zusammenarbeit mit dem Parlament betrifft.
Ihnen allen, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, im Allgemeinen und dem Bundesrat im Besonderen wünsche ich eine gute Zukunft. Es hat mich sehr gefreut, diese Kollegialität auch miterleben und mitgestalten zu dürfen. Und ich ergreife die Gelegenheit, mich heute – halb außer Protokoll – in dieser Form von Ihnen als Altbundesrat und auch als Fraktionsvorsitzender zu verabschieden. (Allgemeiner Beifall.)
Kolleginnen und Kollegen, nun zur Arbeit. Vor fast vier Wochen wurde ich als Bundesminister für Landesverteidigung und Sport angelobt. Es ist mir eine besondere Ehre, aber auch eine große Freude, diese Aufgabe übernehmen zu dürfen und heute in unserem Bundesrat bei Ihnen meine Antrittsrede halten zu dürfen.
Ich kann Ihnen versichern, dass ich diese Aufgabe verantwortungsvoll, mit großem Engagement, aber auch mit der gebotenen Demut ausüben werde und dass ich mich als Bundesminister für Landesverteidigung und Sport auch diesem Haus sehr verpflichtet fühle.
Insofern hoffe ich und werde ich auch alles dazu beitragen, dass ich vor allem der Opposition in meiner konkreten Amtsausübung nur wenig Veranlassung biete, eine Dringliche zu stellen, sodass ich die Geschäftsordnung nicht zur Gänze vergesse. (Heiterkeit.)
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich habe diese Aufgabe mit dem Bewusstsein übernommen, dass mir die österreichische Bevölkerung einen klaren Auftrag mitgegeben hat. Die Entscheidung am 20. Jänner war eindeutig, daher ist mein Auftrag auch klar: Ich werde mich bemühen, die Attraktivierung des Grundwehrdienstes in dieser Form voranzutreiben. Lassen Sie mich daher auch zu diesem Zeitpunkt mit aller Deutlichkeit sagen: Die Attraktivierung des Grundwehrdienstes ist jetzt im Bereich der Landesverteidigung mein primäres politisches Ziel.
Es ist klar, und das Maßgebliche bei dieser Zielsetzung besteht für mich darin, dass wir uns darum bemühen müssen, jenen jungen Burschen – im Herbst sind es wieder 7 000, alljährlich 22 000 –, die zu uns kommen, das Gefühl zu vermitteln und zu signalisieren: Ich hätte gerne, wenn ihr bei uns seid, dass ihr auch möglichst viel für euer weiteres Leben mitnehmt. An diesem Ziel arbeite ich. Der Grundwehrdienst muss attraktiver werden, und es müssen auch, wenn vorhanden, Leerläufe vermieden werden. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.)
Werte Kolleginnen und Kollegen, da bin ich sehr zuversichtlich. Die österreichische Bundesregierung hat in diesem Zusammenhang einen äußerst professionellen Plan auf die Reise geschickt. Der Prozess ist perfekt vorbereitet. Es gibt eine Expertenarbeitsgruppe, es gibt eine politische Arbeitsgruppe auf der Ebene der Koalition und es gibt eine klare Zeiteinteilung, in welchem Zeitabschnitt wir welches Thema primär bearbeiten werden.
Ich habe unserem Koalitionspartner vorgeschlagen, dass wir in jenen Bereichen, in denen es sinnvoll ist, der Öffentlichkeit auch Zwischenergebnisse präsentieren werden.
Ich freue mich, dass das für die ÖVP-Kolleginnen und -Kollegen auch annehmbar war. Wir werden dort, wo es sinnvoll ist, Zwischenergebnisse präsentieren und wir werden dann – davon bin ich felsenfest überzeugt –, Ende Juni, ein Maßnahmenpaket und einen Endbericht vorlegen, von dem ich heute schon einschätzen kann, dass viele Punkte beinhaltet sein werden, bei denen die österreichische Bevölkerung und im Konkreten die jungen Burschen, die potenziellen Rekruten das Gefühl bekommen und die Einschätzung haben: Der Grundwehrdienst wird attraktiver, da ist auch etwas für mich dabei, das schaut gut aus. Darin besteht mein konkretes Ziel.
Ich bin mir auch völlig dessen bewusst – und ich habe kein Problem damit, das direkt anzusprechen –, dass eine maßgebliche Bewertung meiner ersten Amtszeit auch darin bestehen wird, ob dies gut gelingt oder nicht. Ich bin sehr optimistisch, wenngleich ich in diesem Zusammenhang dazusage, dass der Prozess so professionell aufgestellt ist, dass bereits die ersten Ideen für meine zweite Amtszeit zu mir kommen. Und darüber freue ich mich natürlich auch. (Heiterkeit und allgemeiner Beifall.)
Werte Kolleginnen und Kollegen, mir war aber auch wichtig, bei diesem Prozess auch jene zu Wort kommen zu lassen, die jetzt unmittelbar bei uns sind. Daher habe ich auch eine Befragung der Grundwehrdiener in Auftrag gegeben, weil ich von diesen 11 000 Burschen, die jetzt bei mir sind, wissen will: Was erlebt ihr unmittelbar? Wo drückt der Schuh im wahrsten Sinne des Wortes? Daher wurde im Zuge dieser Grundwehrdienerbefragung eine einfache Frage gestellt: Was könnt ihr euch zur Attraktivierung des Grundwehrdienstes vorstellen?
Die Beteiligung war perfekt, ich möchte fast sagen überwältigend. Und es sind bereits die ersten Ergebnisse sichtbar. In einem Bereich wünschen sich die jungen Burschen eine deutliche Stärkung der sportlichen Aktivitäten. Wir machen vieles – ich möchte jetzt den Spitzensportbereich mit rund 400 Heeressportlerinnen und -sportlern gar nicht ansprechen, aber wir machen schon viel im sportlichen Bereich. Aber die jungen Burschen hätten diesen sportlichen Bereich gerne breiter aufgestellt, bis hin zum Wettbewerb. Ich freue mich natürlich über diese Eindrücke. Das ist so ein erstes Signal aus dieser noch nicht fertig ausgewerteten Befragung.
Als Zweites – und das ist nicht weniger wichtig – erwarten sich die jungen Burschen von der Attraktivierung des Grundwehrdienstes mehr militärische Grundausbildung, also eine vertiefte militärische Ausbildung in den Bereichen der Kernkompetenzen. Das sind einmal diese zwei wesentlichen Aspekte: Verbreiterung des Sports und eine Vertiefung in der militärischen Kernausbildung.
Das sind erste Eindrücke aus dieser Grundwehrdienerbefragung. Und ich bin mir auch sicher und werde mich auch dafür einsetzen, dass, wenn dann alle Ergebnisse vorliegen und ausgewertet sind, die besten Ergebnisse in die Reform des Grundwehrdienstes im Hinblick auf eine Attraktivierung einfließen werden.
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, zu einer zukunftsorientierten Verteidigungspolitik, Militärpolitik, gehören natürlich auch die Umsetzung und die politische Einigung auf diese Sicherheitsstrategie als maßgeblicher Baustein. Ich freue mich, dass in den letzten Tagen viele Gespräche intensiviert werden konnten. Die Sicherheitsstrategie ist ja auf der Ebene der Bundesregierung im Ministerrat positiv abgearbeitet. Sie liegt jetzt im Parlament. Nach meinen letzten Informationen freue ich mich auch, dass die Wehrsprecher in den letzten Tagen bereits einen intensiven Dialog auf dieser Ebene initiiert haben und in den nächsten Tagen initiieren werden.
Zweifelsohne handelt es sich dabei um die maßgeblichen Eckpunkte, auf Basis welcher die Weiterentwicklung des österreichischen Bundesheeres und der österreichischen Sicherheitspolitik geschehen soll. Zweifelsohne bedeutet das auch, dass wir zentrale Elemente im Bereich des Neutralitätsgedanken niemals außer Acht lassen dürfen.
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, es ist mir besonders wichtig, heute auch darauf hinzuweisen, dass unsere Soldatinnen und Soldaten permanent ein Ziel verfolgen, nämlich die Sicherheit und den Schutz der österreichischen Bevölkerung. Ich glaube, dass es besonders wichtig ist, das noch einmal in den Vordergrund zu rücken, weil es viel zu wenig Beachtung erfahren hat. Insofern möchte ich auch meinen Respekt und meine Anerkennung dafür aussprechen.
Im Bereich Inlandseinsätze erfüllt das österreichische Bundesheer nicht nur maßgebliche Sicherungsaufgaben, sondern ist auch ein starker Partner im Bereich des Katastrophenschutzes, der Katastrophenhilfe. Auch bei den sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsätzen wurde Maßgebliches geleistet.
In diesem Zusammenhang möchte ich besonders hervorheben, dass es natürlich gerade in der Länderkammer nicht unbeachtet bleiben soll, dass die einzelnen Militärkommandanten in allen Bundesländern für das österreichische Bundesheer ein maßgeblicher Partner sind und bleiben werden.
Ich freue mich natürlich auch – das möchte ich nicht verhehlen –, dass das österreichische Bundesheer im internationalen Umfeld – und da sind jetzt konkret die Auslandseinsätze angesprochen – einen hervorragenden Ruf hat. Wir haben im Moment rund 1 300 Soldatinnen und Soldaten in rund 13 Auslandsmissionen im Einsatz. Der Ruf ist hervorragend, das spricht für das österreichische Bundesheer. Wir sind höchst professionell aufgestellt, wir sind ein sicherer Partner im internationalen Umfeld. Es ist natürlich klar, dass wir sicherheitspolitisch nie außer Acht lassen dürfen, dass die Sicherheit im Inland wichtig ist. Wir sollen aber auch dafür sorgen, dass wir dort, wo ein konkretes Bedrohungsszenario im Ausland entsteht, bereits vor Ort dementsprechend als Partner zur Verfügung stehen. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.)
Kolleginnen und Kollegen! Sie haben sicher damit gerechnet, dass ich mich an einem Kommentar zur aktuellen Entwicklung am Golan nicht nur nicht vorbeischwindeln will, sondern das auch konkret ansprechen will, weil mir das wichtig ist. Wir beobachten die aktuellen Entwicklungen laufend, mittlerweile – das darf ich sagen – stündlich. Die Situation vor Ort ist angespannt, aber sie ist beherrschbar. Sie ist angespannt, aber sie ist beherrschbar!
Unsere Soldatinnen und Soldaten erfüllen dieses Mandat und diesen Einsatz seit 1974 und leisten damit auch einen maßgeblichen Beitrag für den Frieden in der Welt. Ich glaube, dass wir auch diesen Gedanken nicht außer Acht lassen sollten. (Demonstrativer Beifall des Bundesrates Schreuder.)
Lassen Sie mich etwas sagen: Das österreichische Bundesheer bleibt ein verlässlicher Truppensteller. Das österreichische Bundesheer hat nicht nur eine hohe Reputation und ein hohes Ansehen in diesen Auslandseinsätzen, sondern wir sind auch höchst professionell aufgestellt. Die Entwicklung der letzten Tage untermauert diese Einschätzung. Das heißt im Konkreten: Österreich wurde stellvertretend der Force Commander angeboten. Wir haben eine gute, sehr überlegte Vorentscheidung getroffen. Ich warte auf die Bestätigung, aber ich bin mir sicher, dass wir mit diesem stellvertretenden Kommandanten vor Ort noch mehr Einfluss in jener Mission bekommen, in der wir auch der stärkste Truppensteller sind.
Ich sage daher in aller Deutlichkeit: Wir bleiben ein verlässlicher Partner, wir sind ein verlässlicher Truppensteller. Österreich leistet im Verhältnis zur Größe des Landes mehr, als von uns erwartet werden kann. Aber ich sage auch deutlich: Wir machen das nicht um jeden Preis. Die Sicherheit der österreichischen Soldatinnen und Soldaten steht für mich im Vordergrund. (Allgemeiner Beifall.)
Ich bin in diesem Zusammenhang auch in engstem Kontakt mit unserem Vizekanzler und Außenminister und in engstem Kontakt mit dem Bundeskanzler. Sie haben das si-
cher verfolgt. Es geht auch um die Debatte um das Stichwort „Waffenembargoaufhebung“ – ja oder nein? Hier gibt es einen engen Schulterschluss auf österreichischer Ebene, und die Ansage ist vollkommen klar: Wir sind dagegen. (Allgemeiner Beifall.)
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Mehr Waffenlieferungen in ein Krisengebiet können kein Signal für mehr Sicherheit sein. Wir können nie einschätzen, in welche Hände diese Waffen geraten. Ich freue mich, dass es hier einen engen Schulterschluss gibt, und wir werden auch auf europäischer Ebene alles daran setzen, diese Position weiter stark zu verteidigen.
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich bin als Teamspieler in die österreichische Bundesregierung eingetreten. Daher ist für mich auch vollkommen klar, dass jene Vereinbarungen, die vor meinem Amtsantritt getroffen wurden, auch von mir eingehalten und umgesetzt werden. Ich sage daher in aller Deutlichkeit: Ich halte mich an den Budgetfahrplan 2017 – um nicht direkt zu sagen: Das Budget „pickt“.
Wir werden daher auch in meinem Bereich mit unseren finanziellen Mitteln im Interesse des Steuerzahlers und der Steuerzahlerin sehr sorgsam umgehen. Wir werden gut haushalten. Ich bin schon oft gefragt worden: Naja, Ihr wichtigstes Ziel, nämlich die Attraktivierung des Grundwehrdienstes, wird das nicht vielleicht auch etwas kosten? Es ist politisch verlockend zu sagen: Naja, da lässt man sich einmal vorsichtig ein.
Aber da ist mein Zugang ganz eindeutig: Zum einen versuche ich, finanzielle Mittel durch Einsparungen freizumachen. Darüber hinaus versuche ich, im Ressort umzuschichten, und zu guter Letzt habe ich noch immer die Möglichkeit, Rücklagen aufzulösen. Wenn dieser Mix zu dem Ergebnis käme, dass die Mittel noch immer nicht reichen sollten, dann bin ich in enger Abstimmung und einer Meinung mit dem Bundeskanzler und unserem Außenminister. Daher ist die Sachlage auch klar: Von der einen oder anderen Million wird ein neuer attraktiver Grundwehrdienst nicht abhängig gemacht werden. (Beifall bei SPÖ und ÖVP sowie der Bundesräte Dönmez und Schreuder.)
Kolleginnen und Kollegen! Meine Ressortverantwortung liegt nicht nur im Bereich der Verteidigungspolitik, sondern betrifft auch den Sport. Insofern stehe ich im Moment noch unter den tollen Eindrücken der Sportgala in Salzburg gestern Abend. Ich möchte die Gelegenheit auch nützen, um mit Ihnen gemeinsam einige sportpolitische Zielsetzungen zu diskutieren.
Priorität A im Bereich des Sports hat für mich die Finalisierung des Bundes-Sportförderungsgesetzes. Das steht völlig außer Streit. Mein Vorgänger Sportminister Norbert Darabos hat das professionell vorbereitet.
Es war ein langer, intensiver Prozess. Es sind alle eingebunden gewesen, es war ein konsensualer Prozess. Viele Anliegen der Verbände, der Vereine, der Dachverbände, der Sportlerinnen und Sportler, der Funktionärinnen und Funktionäre sind eingeflossen.
Es ist auf Ministerratsebene beschlossen. Das Gesetz wurde dem Parlament zugeführt. Ich freue mich, dass es mit intensiven Telefonaten auch gelungen ist, bereits mit 18. April einen Sportausschusstermin im Nationalrat festzusetzen. Es wird im Zuge dieser Behandlung auf parlamentarischer Ebene eine intensive Debatte geführt werden. Es wird ein Hearing geben. Das ist meines Erachtens eine tolle Gelegenheit, diese Materie noch intensiver zu diskutieren. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es bei positiver Einstellung aller Player und Akteure gelingen mag, das Bundes-Sportförderungsgesetz noch im Mai-, spätestens im Juniplenum zu beschließen und in diesem Zusammenhang auch auf neue Beine zu stellen.
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Werte Bundesräte! Eines ist mir natürlich wichtig: Mit diesem neuen Bundes-Sportförderungsgesetz gehen wir auch in eine neue moderne Zeit. Wir gehen weg von dem Gießkannenprinzip und hin zur konkreten Pro-
jektförderung. Wir schaffen mehr Transparenz, und wir schaffen mehr Kontrolle im Bereich der Verwendung öffentlicher Mittel. Es kommt auch zu einer klaren Trennung zwischen dem Breiten- und Spitzensport.
Ich bin der Meinung, dass dies eine moderne Sportpolitik mit öffentlichen Mitteln ist. Ich freue mich, dass das erste Feedback, das ich vergangene Woche bekommen habe, als ich alle 60 Fachverbände und Dachverbände zu mir ins Haus des Sports eingeladen habe, ein so positives ist. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die professionelle Vorbereitung dieses neuen Gesetzes in absehbarer Zeit die parlamentarische Beschlussfassung ermöglichen wird.
Werte Kolleginnen und Kollegen! Der Spitzensport steht zweifelsohne – je nach Jahreszeit und Großveranstaltung – immer wieder im Blickwinkel der sportpolitischen Auseinandersetzung. Ich möchte aber in diesem Zusammenhang Folgendes sagen: Klar ist, dass unsere Sportlerinnen und Sportler Höchstleistungen erbringen, hart trainieren. Als Hobbysportler kann ich maximal erahnen, was es bedeutet, wenn man de facto sein ganzes Leben danach ausrichtet, um Höchst- und Spitzenleistungen im Bereich des Sports zu erbringen. Ich kann maximal erahnen, was es bedeutet, viel auf Privatleben, viel auf Familienleben zu verzichten, den Tages- und Wochenablauf nach dem Sportprogramm auszurichten. Ich habe höchsten Respekt vor diesen Leistungen, vor dieser Lebensgestaltung und davor, was unsere Sportlerinnen und Sportler in diesem Zusammenhang alles schaffen. (Allgemeiner Beifall.)
Werte Kolleginnen und Kollegen! Geschätzte Bundesräte! Wenn da oder dort strukturelle Defizite festgestellt werden, dann ist es auch meine Aufgabe als Sportminister, meine Beiträge dahin gehend, wie wir diese strukturellen Defizite auf Zeit beseitigen können, durchzudenken und einzubringen.
Ich habe mich daher bemüht, auch finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen – nicht nur für Rio. Alles ist gut aufgestellt, es wird in Summe gelingen, 5 Millionen € zusätzlich pro Jahr aufzubringen, also 20 Millionen €.
Geld alleine ist es aber nicht. Bei den Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern geht es auch darum, dass sie optimale und jederzeit verfügbare Trainingsmöglichkeiten haben. Spitzensportlerinnen und Spitzensportler brauchen optimale Trainingsbedingungen. Mein zweites Ziel neben dem Bundes-Sportförderungsgesetz ist es daher, zu einem Spitzensport-Masterplan, einem Trainingsstätten-Masterplan zu kommen. Dies soll auf der einen Seite aus der Sicht des Bundes geschehen, aber auf der anderen Seite natürlich – nicht, weil ich jetzt in der Länderkammer bin – in engster Abstimmung mit den Landessportreferenten und den Landesverantwortlichen, weil es in verschiedenen Bundesländern zu unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen kommen wird. Da versuche ich, eine sehr konstruktive Zusammenarbeit zu erreichen. Wenn ich das vielleicht etwas lockerer formulieren darf: Bundesländerübergreifende Zusammenarbeit ist mir ja auch aus der Zeit im Bundesrat nicht fern. Ich bin sehr optimistisch, dass wir da zu schönen und guten Ergebnissen im Interesse des Sports kommen werden.
Lassen Sie mich abschließend noch etwas ansprechen, das ich natürlich gerne unterstützt habe: Die politische Idee, das politische Modell, die politische Forderung der täglichen Turnstunde ist ein Projekt, das im Kern nicht nur richtig, sondern auch zukunftsträchtig ist. Warum? – Es ist besonders wichtig, bereits junge Menschen, Kinder, für den Sport zu begeistern.
Natürlich wirkt das in Kombination mit Vorbildern. Botschafter für das Land, wie es Spitzensportlerinnen und Spitzensportler sind, sollen sie durch ihre Begeisterung mitreißen. Diese Verantwortung, die Spitzensportler auch haben, nehmen diese ganz toll wahr. Wenn bereits die Kinder möglichst früh tolle Vorbilder haben und gleichzeitig die Voraussetzung für mehr Bewegung bekommen, ist dies nicht nur ein Projekt, das
politisch toll ist, sondern ein Projekt, das ich auch gerne unterstütze. (Allgemeiner Beifall.)
Mir ist natürlich bewusst, dass das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur die Federführung in diesem Bereich hat, aber ich versuche, mich auch als Sportminister positiv in diesem Zusammenhang einzubringen.
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich habe die Gelegenheit gerne wahrgenommen, einige aktuelle Themen aus dem Bereich der Verteidigungspolitik, aus meinem politischen Programm und auch aus dem Bereich des Sports kurz darzulegen. Ich hoffe, dass vieles dabei war, das auch Sie begeistern kann. Mir ist natürlich an einer Gemeinsamkeit und an einer möglichst guten und konstruktiven gemeinsamen Arbeit sehr gelegen.
Insofern freue ich mich, wenn es möglich ist, für meine Ressorts, für die Verteidigungspolitik und für den Sport, hier immer auch Partner zu finden und die Zusammenarbeit mit dem Bundesrat zu pflegen. In diesem Sinne bin ich sehr optimistisch, dass meine Ziele für die ersten sieben Monate gemeinsam gut erreichbar sind. Da es schon gute Ideen für eine zweite Amtszeit gibt, freue ich mich auch auf eine gute Zusammenarbeit in der Zukunft. – Danke schön. (Allgemeiner Beifall.)
12.38
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz: Ich danke dem Herrn Bundesminister für seine Ausführungen.
Wir gehen nun in die Debatte ein.
Als Erster ist Herr Bundesrat Beer zu Wort gemeldet. – Bitte.
12.38
Bundesrat Wolfgang Beer (SPÖ, Wien): Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Was sagt man nach einem Bundesminister, der seine Antrittsrede im Bundesrat hält? –Fürs Erste einmal: Viel Erfolg! Ich glaube, der Erfolg, den du haben wirst, wird auch unser Erfolg sein. Es wird nicht nur unser Erfolg sein, sondern auch ein Erfolg für die Grundwehrdiener, für das österreichische Bundesheer und für die Bevölkerung im Allgemeinen.
Wir haben von dir gehört: Mehr Sport! Das ist wirklich eine sehr sinnvolle Maßnahme, mit der man aber schon in der Schule ansetzen sollte. Wir haben ja immerhin drei Ausbildungsphasen beim österreichischen Bundesheer. Wenn die Jugendlichen schon ein bisschen durchtrainiert, ein bisschen mehr auf Kondition getrimmt zum Bundesheer kommen, dann hat man wieder mehr Zeit, andere Dinge durchzuführen.
Wenn sich die Jungmänner, die Grundwehrdiener eine bessere Ausbildung wünschen, dann kann das, glaube ich, auch in unser aller Sinne sein, denn eine bessere Ausbildung, vor allem auch der Teil dieser Ausbildung für das zivile Leben bringt unserer Gesellschaft nur Vorteile.
Die Ausbildung, wie schon von mir angesprochen, ist in drei Bereiche unterteilt. Diese drei Bereiche sind in der jetzigen Zeit eigentlich nicht ganz unwichtig. Man spricht hier von Basisausbildung 1, Basisausbildung 2 und Basisausbildung 3. Die Basisausbildung 1 ist eigentlich für jeden Soldaten gleich. Hier lernt man grundsätzliche Dinge im Umgang mit der Waffe. Es wird versucht, die körperliche Fitness zu steigern. Es wird eigentlich in erster Linie, wenn ich mich noch an meine Grundwehrdienstzeit erinnere, einmal das Gemeinschaftsgefühl verstärkt, gefördert.
Im zweiten Schritt, bei der Basisausbildung 2 – man könnte das auch schon fast eine Spezialisierung oder Spezialausbildung nennen –, werden die Grundwehrdiener ihren spezifischen Aufgabenbereichen zugeteilt und geschult. Das ist also zum Beispiel Panzerfahrer, Funker, Scharfschütze, was auch immer.
Im dritten Teil – und das ist ein wichtiger Beitrag für unser soziales Gefüge und auch für die Arbeitswelt – wird der Teamgeist gefördert. Hier wird eigentlich den Jungmännern gelernt und gelehrt, wie man sich in einer Gruppe, in einem Team zu verhalten hat, weil man beim österreichischen Bundesheer als Einzelspieler eigentlich nicht wirklich etwas verloren hat, weil es in einem Ernstfall oder in einem Bedrohungsszenarium die anderen gefährdet, wenn man sich nur als Einzelindividuum sieht und nicht als Teil der Gruppe.
Was ich mir auch wünschen würde, ist, dass man die jungen Menschen schon ein bisschen mehr darüber aufklärt, wie es beim österreichischen Bundesheer eigentlich weitergehen könnte, dass es hier in diesen Bereichen auch mehrere Möglichkeiten gibt. Es gibt nicht nur den Grundwehrdienst alleine. Man hat ja zum Beispiel die Möglichkeit, Einjährig-Freiwilliger zu werden. Das wird wenigen vermittelt. Weiters hat man bei der Miliz auch wieder die Möglichkeit, einen Offizierstitel zu tragen und weitere Ausbildungen zu machen.
Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass das Bundesheer ja nicht nur aus dem Grundwehrdienst besteht. Das Bundesheer hat ja noch andere Aufgaben, zum Beispiel die militärische Landesverteidigung. Die militärische Landesverteidigung wird eigentlich immer nur so gesehen, dass man hier die Kernkompetenz bei den Land- und Luftstreitkräften sieht. Wir haben andere Bedrohungsszenarien und wir müssen uns schön langsam – und das ist ja auch schon geschehen – von der Panzerschlacht im Marchfeld verabschieden. Wir haben da einige andere Angriffsszenarien zu erwarten, die eher im elektronischen Bereich angesiedelt sind und die die Infrastruktur der gesamten österreichischen Bevölkerung lahmlegen könnten. Das Bundesheer hat also auch noch den Schutz von Einwohnern und Einrichtungen zu gewährleisten, aber nie selbständig, immer nur auf Aufforderung des Innenministeriums. Das ist aber ein nicht unwesentlicher Teil.
Was in der Bevölkerung am meisten wahrgenommen wird, ist natürlich die Hilfe bei Naturkatastrophen. Das sieht man auch im Fernsehsehen. Hier wird gezeigt, wie das österreichische Bundesheer bei Überschwemmungen, Lawinenkatastrophen und Windschäden Hilfe leistet, aber das ist nicht allein unser Bundesheer.
Wie auch schon von unserem Minister vorgebracht, genießen wir ein sehr hohes Ansehen bei den Auslandseinsätzen, und dazu ist zu sagen, dass wir bei den Auslandseinsätzen immer nur friedenssichernde Maßnahmen oder Katastrophenhilfe leisten. Das ist auch gut so. Das schützt und wahrt auch unsere Neutralität und bringt uns wirklich Ansehen im Ausland.
Die Sicherheitsstrategie ist ganz wichtig, um hier die Veränderungen des Grundwehrdienstes zu einem Ende zu bringen. Ich bin sehr froh, dass die Sicherheitsstrategie die Verteidigungsdoktrin von 2001 ersetzt hat, denn da ist immerhin noch eine NATO-Beitrittsoption – das wurde unter Schwarz-Blau beschlossen – drinnen gestanden. Das gefällt mir als Österreicher, der für die Neutralität ist, nicht sehr gut. Noch dazu kostet es auch sehr viel Geld, weil die NATO gewisse Standards verlangt. (Zwischenruf des Bundesrates Kneifel.) – Ich sage jetzt nichts zu den Eurofightern, denn ich glaube, es weiß ohnehin jeder, wie meine Einstellung zu den Eurofightern ist. Ich glaube, das müssen wir nicht weiter vertiefen. (Bundesrat Todt: Die Vorarbeit habt ihr schon dazu geleistet!)
Ein weiteres Aufgabengebiet wird es auch sein, bei den Liegenschaften eine Erneuerung herbeizuführen. Viele Liegenschaften wurden in der Kaiserzeit erbaut, sind wahrscheinlich wunderschön anzusehen, aber meinen Grundwehrdienst würde ich gerne in einem moderneren Bau absolvieren. Ich werde nicht mehr in die Lage kommen, aber wenn da so ein junger Mensch kommt, dann ist es für diesen sicherlich angenehmer,
ein neues, schönes Gebäude zu haben und sich dort auch mit den Sanitäreinrichtungen anfreunden zu können.
Was mich persönlich noch freuen würde, ist, wenn es ganz einfach ein österreichisches Bundesheer gäbe, auf das auch die Bundesheerangehörigen stolz sein könnten. Ich kann mich erinnern, in meiner Jugend gab es wesentlich mehr Uniformierte auf den Straßen, Bundesheerler, die im Bundesheeruniform gegangen sind. Es fuhr auch die Militärstreife. Ich weiß überhaupt nicht, wann ich die letzte Militärstreife gesehen habe. Es ist schon sehr lange her, dass ich Grundwehrdiener in Uniform gesehen habe, Offiziere schon gar nicht, außer wenn sie auf einen Ball in der Ausgehuniform sind. Ich glaube, es ist auch mit eine Aufgabe, das österreichische Bundesheer in der Öffentlichkeit zu präsentieren, um zu zeigen: Wir sind das österreichische Bundesheer, wir brauchen uns nicht zu genieren! (Beifall bei SPÖ und ÖVP.)
12.47
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Bundesrat Perhab. – Bitte.
12.47
Bundesrat Franz Perhab (ÖVP, Steiermark): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Minister! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Kollege Beer, es gab meines Wissens – ich bin 1973 in Klagenfurt eingerückt – bis zum Jahre 1971 Uniformpflicht beim Ausgang. Das war wahrscheinlich mit ein Grund, warum man früher mehr Uniformen in der Öffentlichkeit gesehen hat (Bundesrat Beer: Auch! Ja!), aber ich glaube, es hat damals auch noch sogenannte Sperrbezirke gegeben, auch in den Großstädten. Also in diesen Vierteln durften wir als Einjährig-Freiwillige nicht einrücken, zum Beispiel. Das sei nur nebenbei gesagt. (Bundesrat Stadler: Das hat wohl seinen Grund gehabt!)
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Minister Klug, vorerst sage ich dir persönlich als steirischer Landsmann: Herzliche Glückwünsche! Ich denke, es ist berechtigt, dass ein Steirer dieses Ressort führt, weil die Steiermark per se das heeresintensivste Bundesland, Flächenbundesland ist. Bei allen Rankings, die sowohl die Auslandseinsätze betreffen als auch die Grundwehrdiener, ist die Steiermark meistens an der Spitze. Das spricht für die positive Einstellung unserer Jugend, und wir sprechen hier immerhin von 25 000 jungen Österreichern, die Jahr für Jahr für sechs Monate ihre kostbare Zeit in den Dienst des Staates, unserer Republik und damit im Dienste unserer Werte Demokratie und Freiheit stellen.
Ich akzeptiere und bedanke mich herzlich bei dir, Herr Minister, dass du eindeutig festgestellt hast, dass du das Votum der österreichischen Bevölkerung vom 20. Jänner in dieser Form ohne Punkt und Beistrich umsetzen musst. Das gehört zur Demokratie dazu. Ich bedanke mich für deine Einstellung, die ich mir oft auch bei den Grünen wünschen würde, weil die tun manchmal so, als ob die Minderheit die Mehrheit bestimmt. (Zwischenruf des Bundesrates Schreuder.) Das kann nicht sein! Es ist so, dass die Mehrheit die Mehrheit ist, die man irgendwann einmal demokratisch legitimiert anerkennen muss. Das ist einmal ein Punkt.
Herr Kollege Beer hat schon erwähnt, dass das bisherige Modell des Grundwehrdienstes auch strukturiert ist, eigentlich sehr logisch strukturiert ist, und er hat auch die Inhalte erwähnt.
Das große Problem, das wir beim Heer haben, ist der System-Erhalter, der ja, wie es der Name schon sagt, dazu verwendet wird, dass er mit Routinetätigkeiten, die zur Aufrechterhaltung gewisser Dienste notwendig sind, betraut wird. Da, glaube ich, besteht auch seitens des Ministeriums Handlungsbedarf.
Die Befragung hat ja auch ergeben, dass die Grundwehrdiener sich nicht wünschen, dass sie den ganzen Tag nichts zu tun haben, sondern dass sie gefordert, gefördert und ausgebildet werden. Einer meiner Söhne rückt im Juni in die Kaserne in Aigen ein, leider als Systemerhalter, aber aus Termingründen ist es nicht anders gegangen. Ich habe mich schon an den Kommandanten gewendet und habe gesagt, ich würde mir als Vater sehr wünschen, nachdem ich langjähriger Milizoffizier war, dass er dort sinnvoll verwendet wird und nicht nach acht Stunden Dienst nach Hause kommt und sagt: Heute war wieder nichts los! Ich hoffe, dass dieser Bitte auch nachgegangen wird. Als Vater würde ich mir das zumindest sehr wünschen.
Ich möchte noch auf die sportliche Ertüchtigung hinweisen. Wir haben ja in den Stellungskommissionen Daten, die beweisen, dass die österreichischen 18-Jährigen eigentlich nicht in der körperlichen Grundverfassung sind, die wir uns wünschen. Es gibt hier Wertungsziffern und jeder ist nur nach dieser Wertungsziffer in bestimmten Funktionen einsetzbar. Daher fängt man im Basismodul 1 mit einer grundkörperlichen Ausbildung an, zum Beispiel 4 000 Meter gehen. Damit fangt man in der ersten Woche an. Viele lachen darüber, wenn man weiß, dass in anderen Bevölkerungsgruppen manche freiwillig Städtemarathons laufen, und wir beim Bundesheer beginnen mit 4000 Meter gehen in der ersten Woche. Das wird immer schneller, bis man dann 4 000 Meter in einer gewissen Zeit bewältigen kann. Ich denke daran, dass es die täglichen körperlichen Übungen gibt in dieser Phase, und die Möglichkeit besteht, hier auch noch zusätzlich selbst etwas zu tun. Es gibt viele Kasernen, wo viele Sporteinrichtungen bereit stehen, die aber in der Freizeit, nach dem Dienst nicht mehr benützt werden, weil die Freizeit einfach einen größeren Stellenwert hat.
Damit komme ich schon zu den Aufgaben unserer Streitkräfte, die ja auf dem Wehrgesetz basieren und inzwischen durch unsere Mitgliedschaft in der Europäischen Union und in der Partnerschaft für den Frieden erweitert wurden. Militärische Landesverteidigung, Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit im eigenen Land, Katastrophenhilfe und die Auslandsmissionen wurden schon erwähnt, wobei wir hier auch bedenken müssen, dass wir einen Großteil unserer Soldaten im Ausland sicher aus der Miliz rekrutieren. Hier bin ich bei einem Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Wir haben 21 000 Bundesheerbedienstete und 24 000 Angehörige der Miliz, also zusammen eine Mobilitätsstärke von 45 000. (Bundesrat Beer: 55 000!) Wenn man alles zusammenrechnet und noch das Verwaltungspersonal in den Kommanden einbezieht, dann kommt man vielleicht auf 50 000 bis 55 000, aber das wäre nur im Falle einer Mobilmachung überhaupt möglich. Daher: Die Miliz ist nach wie vor auch von der Rekrutierung her eine tragende Säule. Wir sollten meiner Meinung nach die Miliz in einer gewissen Stärke auch in Zukunft erhalten.
Damit bin ich schon bei der nächsten Frage, nämlich bei den Standorten. Die Steiermark hat zum Beispiel 15 Standorte militärischer Einrichtungen, davon sind sieben in Graz. Jetzt sage ich einmal, es gibt auch auf Landesebene einen Zentralismus. Ich denke, per se gehören Kasernen in den ländlichen Raum. Strategisch-taktisch, regionalpolitisch, wirtschaftlich und auch vom Übungsbetrieb her ist das ja leicht verständlich, dass man in einem urbanen Zentrum eine Kaserne nicht voll betreiben kann mit Übungen und so weiter. Daher gilt es darüber nachzudenken. Mein Herz spricht auch für meine Kaserne im Ennstal, die Hubschrauberkaserne in Aigen, die ja europaweit Anerkennung findet in der Ausbildung der Alpinpiloten. Leider ist unser Modell Alouette III in nächster Zeit, bis 2020 glaube ich, nicht mehr einsatzfähig, und wir werden überlegen müssen, ob es hier ein Nachfolgemodell beziehungsweise eine Standortsicherung geben kann. Eine sehr harte Entscheidung steht hier bevor.
Aber ich denke, es wird für das Heer nie mehr möglich sein, bei der heutigen Raumordnung in Österreich einen adäquaten Raum, also einen Platz mit Flugfeld und so weiter, mitten im Zentralraum zu finden. Es ist fast undenkbar, in Zukunft solche Standorte neu
zu installieren. Also meine Bitte ist, hier bei der Standortauswahl wirklich aufzupassen. Das ist für mich natürlich auch eine Herzensangelegenheit, weil ich auch jahrzehntelang Kommandant einer Milizkompanie in St. Michael gewesen bin.
Damit wünsche ich dir, Herr Minister Klug, alles Gute, auch in Sachen des Sportes. Ich denke, du wirst viel mehr Fortune haben als dein Vorgänger. Ich möchte hier nicht Schnee von gestern aufrühren, aber es war für mich schon demoralisierend, dass dein Vorgänger meinem Gefühl nach zum Beispiel nie mit Herz bei dieser Sache war und sich sogar am Beispiel des Burgenlandes, wo das Heer jahrzehntelang einen Assistenzeinsatz an der Grenze geleistet hat, nicht bereit war, diese Aufgabe selbst zu leisten. Im Gegenteil: Dein Vorgänger hat auch da keine positive Einstellung zu seinem eigenen Ressort gehabt. Ich wünsche dir alles Gute im Sinne der Republik Österreich und im Sinne der österreichischen Landesverteidigung. (Beifall bei ÖVP, SPÖ und FPÖ.)
12.55
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz: Als Nächste zu Wort gelangt Frau Bundesrätin Mühlwerth. – Bitte.
12.55
Bundesrätin Monika Mühlwerth (FPÖ, Wien): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Minister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Nachdem keiner meiner Vorredner darauf eingegangen ist, mache ich es jetzt: Ja, Herr Minister, du warst ein guter Kollege, überfraktionell! Das kann ich bestätigen. Ich glaube auch – und das möchte ich einmal mehr hier anmerken –, es ist schon ein Spezifikum des Bundesrates, dass es uns auch dann, wenn bei uns Debatten mit hoher Emotion geführt werden, weil das Weltanschauliche und das Inhaltliche sehr weit auseinandergehen (Heiterkeit bei der SPÖ) – und du hast dich an diesen Debatten immer sehr lustvoll beteiligt –, gelingt, diese Debatten nicht so weit entgleisen zu lassen, dass es uns am Ende einer Sitzung nicht gelingt, einander in die Augen zu schauen und zu sagen: Komm gut heim! (Allgemeiner Beifall.)
Ich habe jetzt meinen Vorrednern zugehört und habe mir dann noch einmal die Rednerliste angeschaut und habe festgestellt, ich bin die einzige Frau, zumindest jetzt einmal auf der Rednerliste, die zum Landesverteidigungsminister und Sportminister spricht. Ich muss feststellen, deinen Amtsvorgänger und mich verbindet eines: Wir haben beide nicht gedient! Ich habe das nicht gekonnt, weil das natürlich damals aufgrund meiner Jahre einfach nicht möglich war, selbst wenn ich es gewollt hätte. Aber da endet dann auch schon die Gemeinsamkeit, denn im Gegensatz zum Vorgänger, Minister Darabos, war mein Herz für das Bundesheer immer ein sehr großes, was man dem ausgeschiedenen Bundesminister nicht gerade unterstellen kann. Ganz im Gegenteil: Da hatten wir eher den Eindruck, die Demoralisierung der Truppe und die Demontage des Bundesheeres seien sein Ziel und nicht ein schlagkräftiges, starkes Bundesheer.
Ich gratuliere dir, Herr Minister Klug, zu deinem Einstieg. Du hast ja keine Schonfrist gehabt. Das hast du – Respekt! – gut gemeistert. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch dafür, dass du den Akt gesetzt hast, dass der scheidende Generalstabschef in Würde ausscheiden konnte, dass also sein Abschied würdevoll gestaltet worden ist. Das heißt, man kann sagen, du hast eine gute Vorstellung gegeben.
Natürlich gibt es dann immer ein Wunschkonzert. Bei einem neuen Minister gibt es alte und neue Wunschkonzerte. Du hast schon die Attraktivierung des Grundwehrdienstes angesprochen. Ja, das ist auch von uns ein Anliegen wie einiges andere auch, das heute schon genannt worden ist. Das wird ganz wesentlich sein, da den jungen Soldaten – ich finde, man kann sie ruhig Soldaten nennen, man muss sie nicht Burschen
nennen, das sind Soldaten – hier wirklich einen Sinn zu geben. Wenn ich jetzt sage, das Handwerk der Landesverteidigung zu erlernen, klingt das ein wenig komisch, aber wir müssen ihnen hier wirklich auch einen Sinn geben, den sie darin sehen, für das Vaterland tätig zu werden.
Ich habe ja nie zu denen gehört, die gesagt haben, das ist verlorene Zeit. Ganz im Gegenteil: Ich finde, dass es für junge Männer und Frauen – es sind ja auch Mädchen dabei – durchaus eine Zeit geben kann, wo sie sagen: Ich stelle mich jetzt voll in den Dienst des Vaterlandes! – Ich halte das für richtig. Ich habe das immer für richtig gehalten und tue das auch heute noch. (Beifall bei der FPÖ.)
Aber es hat wenig Sinn, wenn die dann dort sitzen und geistig oder tatsächlich Däumchen drehen und das Gefühl haben, das alles bringt ihnen nichts. Daher werden wir jetzt schauen, was dann auch wirklich herauskommt dabei und was tatsächlich geschieht, denn wir haben ja schon oft erlebt, dass die Überschriften da waren und dann das weniger mit Leben erfüllt wurde und die Überschriften stehengeblieben sind. Also jetzt gibt es noch Vorschusslorbeeren von unserer Seite. Wir hoffen, dass das tatsächlich mit Leben erfüllt wird.
Wenn man Reformen umsetzen will – du hast gesagt, du wirst einsparen und umschichten, und Vizekanzler und Bundeskanzler haben gesagt, dass es dabei auf 1 Million € nicht ankommen soll –, hat die Frau Finanzminister das letzte Wort, ob sie den Betrag dann auch freigibt. Es ist auch die Frage, ob das überhaupt genügen würde. Wenn wir ein gutes Bundesheer haben wollen, muss man sich irgendwann nach 2017 auch ganz ernsthaft darüber unterhalten, ob nicht eine generelle Budgeterhöhung richtig und wichtig wäre. In diesem Zusammenhang wünsche ich wirklich viel Erfolg.
Wir werden auch als Opposition dort immer dabei sein, wo es uns richtig und sinnvoll erscheint. Wir werden dort Kritik üben, wo wir sehen, dass es nicht so gut läuft, aber das ist ja nichts Unbekanntes. Herr Minister Klug kennt das Haus, kennt uns, weiß also, wie es läuft.
Ich möchte jetzt noch zwei, drei Dinge zum Sport sagen, weil das Ressort ja dazugehört. Wir können auf unsere Sportler stolz sein, und ja, höchsten Respekt vor ihren Leistungen. Nehmen wir jetzt einmal das Skifahren als Beispiel. Wenn da zwischen dem Ersten und dem Dritten ein paar Tausendstelsekunden Unterschied ist, kann man nicht sagen, dass der Erste gut ist und der Dritte schlecht. Das stimmt einfach nicht. Es ist aber im Sport eben so, dass es einen Ersten, einen Zweiten, einen Dritten und weiter Folgende gibt. Trotzdem hat der Dritte genauso Respekt verdient wie der Erste, und irgendwann einmal wird dann auch der Dritte der Erste sein. (Bundesrat Schreuder: Der Letzte hat auch Respekt verdient!) – Auch der Letzte hat selbstverständlich Respekt verdient, aber normalerweise werten wir immer nur die ersten Drei. So kommt es dann auch zu Meldungen, und das war jetzt in meinem Hinterkopf, dass wir keine Medaille gemacht haben, und die werden nun einmal an die ersten Drei vergeben.
Was uns jedoch auch fehlt, was uns bei aller Sportförderung leider über die Jahrzehnte abhandengekommen ist, denn das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, sind Freiräume für Kinder. Als ich ein Kind war, gab es in Wien noch Baulücken, die man Gstätten genannt hat, wo wir uns austoben konnten, Mädchen wie Burschen. Die sind völlig verschwunden, und wir behüten auch unsere Kinder so sehr, dass sie, selbst wenn es diese Gstätten noch gäbe, dort gar nicht mehr spielen dürften, weil wir ja vor Angst und Sorge sterben würden, dass sie sich dort die Knie aufschürfen könnten. Und es gibt auch nicht mehr diese wenig befahrenen Nebenstraßen, in denen die Buben Fußball gespielt haben. In vielen Ländern ist es ja auch heute noch so, dass man auf der Straße die Talente unter den Kindern entdeckt. Das fehlt uns ja alles.
Ich habe auch kein Patentrezept, wie wir da wieder hinkommen könnten, aber wir sollten zumindest immer im Hinterkopf behalten, dass wir wieder mehr Freiräume schaffen
sollten, damit wir dem Sport insgesamt einen Impuls so richtig aus der Bevölkerung heraus geben können und nicht nur beschränkt auf jene, die ihre Kinder in einem Sportverein anmelden, der dann entsprechend gefördert wird.
In diesem Sinne, Herr Minister, wünsche ich dir für beide Bereiche namens meiner Fraktion viel Erfolg und alles Gute. Du wirst uns, wie gesagt, dort als Partner haben, wo wir die Dinge ebenso sehen wie du, aber dort, wo wir es anders sehen als du, auch als Kritiker, und es ist bei allen Bemühungen natürlich auch nicht auszuschließen, dass es trotzdem die eine oder andere Dringliche geben wird. (Heiterkeit und allgemeiner Beifall.)
13.03
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz: Nächster Redner: Herr Bundesrat Schreuder. – Bitte.
13.03
Bundesrat Marco Schreuder (Grüne, Wien): Frau Präsidentin! Herr Minister Klug, es ist nicht nur für Sie ungewohnt, dort zu sitzen, für uns ist es auch noch ein bisschen ungewohnt, dass Sie dort sitzen, aber wir werden uns daran gewöhnen.
Ich wollte mich gleich zu Beginn zumindest in einem Punkt als ein bisschen altmodisch outen, aber ich habe bemerkt, dass man es allgemein so hält, und das finde ich auch gut so und es freut mich. Nämlich: Man sollte jemandem, der ein Amt neu übernimmt, die Zeit und die Ruhe geben – und das gibt es in der Politik vielleicht viel zu wenig –, sich einmal einzuarbeiten, und jemand danach bewerten, was er getan hat, statt einfach so drauflos zu kritisieren, weil gerade ein Wahlkampf bevorsteht. Ich werde das also nicht tun. Ich habe festgestellt, dass auch die anderen das nicht tun, und das freut mich in diesem Fall tatsächlich besonders.
Daher schlicht und ergreifend – im Interesse der Republik – im Namen der grünen BundesrätInnen: Alles Gute und viel Erfolg! Das sei einmal zu Beginn gesagt. (Allgemeiner Beifall.)
Was man aber natürlich machen kann, wenn Sie schon kommen – und das ist ja wahrscheinlich auch Sinn und Zweck der Übung hier –, ist, dass man Botschaften und Gedanken mitgeben kann. Da wird es natürlich nach wie vor auch unterschiedliche Konzepte und Ideen geben, und das ist ja das Schöne und das Gute an einer Demokratie.
Was sind die Aufgaben eines modernen Bundesheeres? – Die Panzerschlacht im Marchfeld ist es wohl nicht mehr. Das ist ja auch schon gesagt worden, aber das ist eben so das klassische Bild, das man im Kopf hat. Es reicht in Wahrheit noch wesentlich tiefer. Wir wissen alle, dass Konflikte, wie sie derzeit global auch unter Einsatz von Waffengewalt stattfinden, völlig anders, mit völlig anderen Kämpfen ablaufen, als wir sie bisher kannten. Wenn man Krieg als Geschehen definiert, in dem zwei oder mehrere Staaten gegeneinander kämpfen, dann muss man sagen: Wir haben vorher noch nie in einer Zeit gelebt, in der es so wenig Kriege gab. Das wird meistens so gar nicht wahrgenommen. Das persönliche und subjektive Empfinden ist ein ganz anderes. – Was? Nein! Es ist eine konfliktreiche, blutige Zeit, es ist alles ganz schrecklich, es ist alles ganz furchtbar. Wenn man es historisch betrachtet, ist dem jedoch nicht so.
Warum wird es anders wahrgenommen? – Anders wahrgenommen wird es einfach deswegen, weil Konflikte eben anders ablaufen. Sie haben Syrien schon erwähnt. Syrien ist ein ganz gutes Beispiel: auf der einen Seite ein unerträgliches Regime mit einem Diktator, der, wild geworden, auf seine eigenen Leute schießen lässt; auf der anderen Seite eine Koalition, bei der man überhaupt nicht mehr abschätzen kann, welche Kräfte, wer jetzt eigentlich mit wem zusammenarbeitet oder welche Konflikte danach kommen werden, wer dann gegen wen kämpfen wird.
So gesehen ist es natürlich eine sehr schwierige Sache geworden, und Friedenspolitik und Sicherheitspolitik in einem globalen Kontext – und das ist schlussendlich Verteidigungspolitik heute, im 21. Jahrhundert – sind genau mit solchen Schwierigkeiten konfrontiert. Teilweise werden sogenannte Kriege überhaupt nicht mehr mit Waffen ausgetragen. Es sterben auch keine Menschen. Das kann man natürlich als Fortschritt sehen, und es ist das vermutlich auch einer für den einzelnen Menschen. Im elektronischen Bereich geht es dennoch – und das wurde auch schon erwähnt – ganz massiv um Sicherheit. Es stehen enorme Wirtschaftsinteressen und Ressourceninteressen dahinter. Das Netz ist wahrscheinlich der momentan umkämpfteste Ort der Welt. Ich finde das sehr interessant, und das ist eine der Botschaften, die ich Ihnen mitgeben möchte.
Ich weiß, dass sich zum Beispiel das US-Militär auf dem Gebiet betätigt. Die veranstalten sogar Hackerwettbewerbe. Da dürfen Hacker Systeme knacken, und die Besten werden sofort gut bezahlt und haben einen Superjob. Man sollte da wirklich vermehrt, vielleicht auch auf gesamteuropäischer Ebene, überlegen, ob nicht solche Bereiche für eine moderne Sicherheitspolitik besser und wichtiger sind, als dass man beispielsweise einen Panzer fahren kann. Ganz ehrlich!
Wir von den Grünen haben immer – und das ist allgemein bekannt – internationale Friedensmissionen unterstützt. Wir haben diese internationale Solidarität Österreichs immer begrüßt. Dazu stehen wir auch. Es gibt einfach sinnvolle polizeiliche Aufgaben, die dazu beitragen, vor Ort etwas aufzubauen, um Staaten, die in Konflikte und Kriege geraten sind und nicht mehr auf eigenen Füßen stehen können, zu helfen, damit sie wieder auf eigenen Füßen stehen können. Das halten wir nach wie vor für vollkommen richtig.
Nichtsdestotrotz – ich habe ohnehin schon versucht, es Ihnen zu erklären – werden wir in Zukunft auch in Österreich in einem wachsenden Europa – und Sie haben das in Interviews auch schon gesagt – darüber diskutieren müssen, inwieweit Sicherheitspolitik/ Verteidigungspolitik eine nationale oder eine europäische Aufgabe ist. Da sind vermutlich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten große Veränderungen zu erwarten, wenn es tatsächlich einmal in Richtung Vereinigte Staaten von Europa gehen soll.
Gleichzeitig bedeutet so eine Entwicklung natürlich auch, dass Österreich noch einmal über seine Identität nachdenken muss. Neutralität ist durchaus ein Wort, das wir gerne verwenden, das eine hohe Wertschätzung genießt, das aber auch im Jahre 2013, im Jahre 2014, im Jahre 2020 und darüber hinaus mit Inhalten gefüllt werden muss. Neutralität als Wort, vielleicht auch als Mythos, bringt uns nicht weiter. Wir müssen uns überlegen: Was ist Neutralität, was ist aktive Neutralitätspolitik, aktive Politik in einem globalen Ganzen?
Genau in diesem gesamteuropäischen Zusammenhang werden sich sicherlich vollkommen neue Fragen stellen und Debatten entwickeln, die ich in der Wehrdienstdebatte aus Anlass der Volksbefragung im Jänner schmerzlich vermisst habe. Es war aus meiner Sicht nur oberflächliche Desinformation zu bemerken, und die Menschen wurden meiner Meinung nach nicht ausreichend mit diesen Fragen konfrontiert. Es gab dafür vielleicht auch zu wenig Zeit, zu wenig Luft und zu wenig Information.
Eine Frage ist sicherlich die Effizienz des Heeres. Ich weiß schon, dass sich da vieles geändert hat. Die meisten Menschen denken ja an das Bundesheer, das sie damals erlebt haben, und das ist ja nicht das Bundesheer, das es jetzt ist. Das ist vollkommen klar. Vielleicht laden Sie uns alle ja einmal ein, damit wir das auch kennenlernen. Es wäre einmal nett, so einen Ausflug zu machen, um auch einmal hautnah zu erleben, wie das Bundesheer heutzutage funktioniert. Vom Wiener Landtag aus haben wir das einmal gemacht. Das war sehr interessant.
Man tut ja jetzt gerade so, als ob Österreich kein Berufsheer hätte. Wir wissen, dass Österreich selbstverständlich ein Berufsheer hat: 21 000 Menschen arbeiten beim
Heer. Bei 21 000 Menschen, die das als Beruf haben, kann man schon sagen, dass das ein Berufsheer ist, zumal das Verhältnis von denjenigen, die das beruflich machen, zu den Grundwehrdienern fifty-fifty ist. Es sind ein bissel mehr Grundwehrdiener, tausend mehr, aber das Verhältnis ist ungefähr fifty-fifty.
Wie dieser doch sehr große Verwaltungsapparat effizient, in Zeiten wie diesen wahrscheinlich auch sparsam gestaltet werden kann, ist sicherlich eine interessante Frage. Interessant ist auch, wie die Ausbildung für die Grundwehrdiener in Zukunft gestaltet werden wird.
Herr Perhab, wir werden natürlich nach wie vor für ein Berufsheer werben und gegen die Wehrpflicht Stellung nehmen. Es ist ja in einer Demokratie statthaft, eine andere Position zu bewerben. Dass der Zug jetzt nach der Volksbefragung einmal abgefahren ist, das ist mir schon klar. So deppert bin ich auch nicht!
Natürlich ist die Attraktivierung des Präsenzdienstes, wie Sie das genannt haben, sehr wichtig. Selbstverständlich ist blinder Gehorsam keine Haltung des 21. Jahrhunderts mehr. Stattdessen geht es darum, wofür man eigentlich einsteht, was Demokratie bedeutet und auch was die Menschenrechte bedeuten. Diese Werte müssten meiner Meinung nach ganz stark vermittelt werden.
Zum Thema Effizienz. Der Tsunami ist schon eine Weile her, aber es gibt da dieses berühmte Beispiel: Sowohl das Österreichische Rote Kreuz als auch das Bundesheer bauten in Sri Lanka eine Wasseraufbereitungsanlage. Das Österreichische Rote Kreuz brauchte in derselben Zeit drei Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, das Bundesheer 90. Da stellen sich natürlich gewisse Effizienzfragen, aber das ist, wie gesagt, ja auch schon ein paar Jahre her.
Zum Sport noch ganz kurz – ich weiß, die Lampe leuchtet schon; ich komme bald zum Schluss –: Wir blicken alle gerne auf den Medaillenspiegel, aber Sport muss natürlich – Sie haben das auch angekündigt, und das finde ich auch richtig – in Zusammenhang mit dem Breitensport, mit den Schulen gesehen werden. Mehrere Ressorts müssen da übergreifend zusammenarbeiten.
Selbstverständlich ist traurig, dass es auch für Sportarten, in denen Österreich traditionell immer gut war – ich nenne zum Beispiel das Kajakfahren –, keine Trainingsmöglichkeiten mehr in unserem Land gibt. Das bedauere ich sehr. Ich hätte noch viel mehr zum Sport vorbereitet. Das geht sich aber nicht mehr aus.
Zum Schluss noch ein Wunsch als Kulturpolitiker: Bitte, helfen Sie dem Heeresgeschichtlichen Museum! Das ist ein bisschen ein Stiefkind der Wiener Kulturpolitik und bislang auch im Verteidigungsministerium, fürchte ich. 1945 hört dort die Geschichte auf, und es ist immer noch eher eine repräsentative Habsburgerschau. Gerade diese neuen Konflikte, die im Computer, im Internet stattfinden – „Cyberwar“, wie man so schön sagt –, könnten für Schulen, für Schüler und Schülerinnen, für diejenigen, die auf Wienwoche nach Wien kommen, eine ungeheuer spannende Sache sein.
Das Heeresgeschichtliche Museum sollte meiner Meinung nach aufgewertet werden. – Vielen Dank. (Beifall bei Grünen und SPÖ sowie der Bundesrätin Zwazl.)
13.15
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz: Nächster Redner: Herr Bundesrat Füller. – Bitte.
13.15
Bundesrat Christian Füller (SPÖ, Steiermark): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Geschätzter Herr Bundesminister! Herr Staatssekretär! Werte Kolleginnen und Kollegen! Mit Veränderungen im Bereich der Sportpolitik verhält es sich oft so, dass erzielte Er-
folge in der Öffentlichkeit nicht immer so wahrgenommen werden, wie es zum Beispiel in den Bereichen Soziales, Infrastruktur, Wirtschaft oder eben auch im Bereich der Landesverteidigung der Fall ist. Meine Vorredner haben ja schon sehr viel über Landesverteidigungsthemen gesprochen, daher werde ich mich eher auf den Bereich Sport konzentrieren.
Mit den Auswirkungen der Sportpolitik beschäftigen sich sehr stark die Sportfunktionärinnen und -funktionäre in den Verbänden, in den Vereinen, aber auch die Sportlerinnen und Sportler selbst. Es gibt auch ein eher geringeres Interesse der Medien, darüber zu berichten. Der Fokus wird viel mehr auf Erfolge, gegebenenfalls auch auf Misserfolge oder Skandale im Sport gelegt.
Es freut mich ganz besonders, dass du als unser neuer Verteidigungs- und Sportminister die Umsetzung des von deinem Vorgänger Norbert Darabos initiierten Sportförderungsgesetzes ganz oben auf deiner Prioritätenliste hast und das auch vorantreiben möchtest. Dieses Sportförderungsgesetz, das bereits – und das wurde auch bereits angesprochen – vorbereitet ist und dem auf parlamentarischer Ebene nur noch die Beschlussfassung fehlt, ist ein wichtiger Schritt. Im Breitensport soll für die Grundförderung der Dachverbände in Zukunft eine Mindestquote festgeschrieben werden, die für die Förderung der Vereine verwendet werden muss.
Im Spitzensport soll als Beurteilungskriterium eine leistungsorientierte Reihung der Fachverbände eingeführt werden. Diese inhaltliche Planung der Förderschwerpunkte obliegt einem Gremium, das mehrheitlich vom organisierten Sport beschickt werden soll.
Zwei fachliche Beiräte mit unabhängigen Expertinnen und Experten für den Breiten- und den Spitzensport werden sicherstellen, dass die Förderungen auch zielorientiert eingesetzt werden. Damit ist eine langjährige Forderung des Sports realisiert, möglichst alle Verbandsförderungen an einer Stelle beantragen zu können. Und für die Transparenz nach außen wird eine Förderdatenbank sorgen.
Letztendlich muss man sich auch die Frage stellen, welche Konsequenzen wir zum Beispiel aus den Olympia-Teilnahmen – ich denke da an London 2012, wo es keine einzige Medaille für Österreich gab – ziehen sollen. Eine Konsequenz – das wurde heute schon angesprochen – ist die finanzielle Sicherung für Rio 2016 in der Größenordnung von 20 Millionen €. Eine weitere muss nicht finanzieller, sondern durchaus inhaltlicher Natur sein: Mit dem Sportförderungsgesetz würde eine deutliche Trennung zwischen Breiten- und Spitzensport erfolgen, ein klares Abgehen von der „Gießkannen“-Förderung hin zu einer konkreten Projektförderung und ein neues Maß an Transparenz und guter Kontrolle der Mittelverwendung.
Auch die Umsetzung des in der Planungsphase befindlichen Masterplans zum Sportstättenbau unter Einbindung der SportlandesrätInnen, wie du das heute bereits angeführt hast, ist ein wesentlicher Beitrag zu einer besseren Kontrolle des Mitteleinsatzes und könnte in Zukunft auch eher schwächer repräsentierten und von weniger Menschen betriebenen Sportarten erlauben, vielleicht neue Akzente zu setzen.
Mich freut besonders das Bekenntnis von dir, Herr Minister Klug, als zuständigem Sportminister, einen Beitrag dazu leisten zu wollen, aus der klassischen Wintersport-Nation Österreich auch eine Sommersport-Nation zu machen.
Eine weitere Unterstützung für den Sport, die heute auch wieder ausgesprochen wurde, wäre die täglichen Turnstunde in der Schule. Die Bundessportorganisation hat dafür über 150 000 Unterstützungsunterschriften gesammelt. Diese Forderung wird von allen Parlamentsparteien unterstützt und auch von dir, geschätzter Herr Minister, getragen. Unabhängig davon, wie das in der Umsetzung letztendlich aussehen wird,
möchte ich festhalten, dass Bewegung und Sport – je mehr Menschen wir erreichen können und umso jünger sie sind, desto besser – auch eine Entlastung bei Kosten und Folgekosten im Gesundheitsbereich bringen könnten.
Ich bin seit zwölf Jahren im Gemeinderat meiner Heimatgemeinde Judenburg tätig und merke, dass immer wieder, wenn es um Subventionen und Förderungen für Sportvereine geht, die Diskussion seitens der Opposition aufkommt, ob das in dieser Höhe erfolgen muss und wir als Mehrheitsfraktion nicht das Gefühl haben, dass wir die Sportvereine mit Geld zuschütten. Ich möchte hier in aller Klarheit feststellen und betonen, dass diese Förderungen für Sportvereine letztendlich auch eine Art von Wirtschaftsförderung darstellen, denn große Teile dieser Mittel werden für Anschaffungen der Infrastruktur in den Vereinen eingesetzt und kommen auch der regionalen Wertschöpfung und den Betrieben und Arbeitsplätzen vor Ort zugute.
Abschließend möchte ich festhalten: Wir als sozialdemokratische Bundesratsfraktion unterstützen diese geplanten Projekte und auch die anstehenden Umsetzungsschritte vollinhaltlich und wünschen dir, geschätzter Herr Bundesminister, lieber Gerald, dabei viel Erfolg. Auch was die zweite Amtszeit anbelangt, kannst du auf unsere Unterstützung zählen. – Vielen Dank. (Beifall bei der SPÖ.)
13.21
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz: Zu Wort gelangt nun Herr Bundesminister Mag. Klug. – Bitte.
13.21
Bundesminister für Landesverteidigung und Sport Mag. Gerald Klug: Geschätzte Frau Präsidentin! Geschätzte Kolleginnen! Geschätzte Kollegen! Wenn ich jetzt sozusagen von vorne beginnen darf, freue ich mich natürlich, dass viele meiner politischen Schwerpunkte im Bereich der Verteidigungspolitik, aber auch im Bereich der Sportpolitik von den Abgeordneten und von den Mitgliedern des Bundesrates gleich eingeschätzt werden.
Daher freue ich mich natürlich auch, dass unser Kollege Wolfgang Beer deutlich angesprochen hat, dass im Bereich der Attraktivierung des Präsensdienstes eine klare Differenzierung und eine klare Herausarbeitung der unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen einen Erfolg für ein Endprojekt bedeuten.
Wir versuchen natürlich, bei den jungen Burschen – in diesem Fall sind es noch junge Burschen – zum frühestmöglichen Zeitpunkt, bei der Erstuntersuchung oder bei den Einrückungsterminen auch eine Stärke- und Schwächenanalyse durchzuführen, um sie möglichst auch dort abzuholen, wo sie stehen, und um ein erstes realistisches Bild zu erhalten. Darüber hinaus ist ein weiterer Bereich natürlich eine konzentrierte Stärke- und Schwächenanalyse: Wo gibt es positive Erfahrungen, wo gibt es nicht so positive Erfahrungen?
Der dritte Bereich wird eine Schwerpunktsetzung – es ist mehrfach angesprochen worden – im Milizbereich sein. Dem werden wir uns besonders widmen, aber auch dem gesamten Ausbildungsbereich. Ich habe in diesem Zusammenhang schon in der Vergangenheit nie aus meinem Herzen eine Mördergrube gemacht. Auch mein Ziel besteht darin, zu versuchen, diesen Grundwehrdienst nicht nur zu attraktivieren, sondern auch, sollten sie vorhanden sein, Leerläufe zu vermeiden und Inhalte attraktiver zu gestalten.
Ich bin sehr zuversichtlich, dass es gelingen wird, innerhalb des vorgesehenen Zeitplans, bis Ende Juni ein sehr attraktives Gesamtkonzept und einen Gesamtbericht vorlegen zu können.
Im Bereich der Liegenschaften, den du auch angesprochen hast, sind wir de facto in einem langjährig aufgestellten Prozess, ausgehend von der Bundesheerreformkommis-
sion und dem Ministerratsbeschluss 2008. Im Wesentlichen sind die meisten Liegenschaftsveräußerungen abgeschlossen. Ich freue mich natürlich, dass ich jetzt auch einmal feststellen kann, dass wir bisher rund 230 Millionen € aus diesen Verkaufserlösen lukrieren konnten. Ich freue mich auch außerordentlich, dass klargestellt ist, dass diese Veräußerungserlöse ausschließlich dem österreichischen Bundesheer zufließen und dem österreichischen Bundesheer auch zur Verfügung stehen. Wir haben in diesem Zusammenhang für das Jahr 2013 30 Millionen € bereitgestellt und für das Jahr 2014 weitere 40 Millionen €. Mir ist das natürlich als Verteidigungsminister deshalb so wichtig, weil dadurch auch finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, um in ein modernes österreichisches Bundesheer zu reinvestieren.
Ich sage in der gebotenen Kürze, dass mir natürlich die Unterkünfte ein großes Anliegen sind. Ob das jetzt – kurz in die steirische Richtung geblickt – die Unterkünfte beim Jägerbataillon in Strass sind, die wir modernisieren, ob das die Unterkünfte in der Garde in Wien sind. Ich sage klar und deutlich: Das sind die Arbeitsplätze unserer Soldatinnen und Soldaten, und die müssen anständig aufgestellt und ordnungsgemäß annehmbar sein.
Aber auch bei den Investitionen in die Modernisierung des österreichischen Bundesheeres möchte ich noch einmal besonders betonen, falls das sozusagen noch nicht ausreichend das Licht der Öffentlichkeit erreicht hat: Wir bauen im Moment im Burgenland die europaweit modernste Kaserne. Insofern ist es mir natürlich wichtig, dass diese Erlöse aus den Liegenschaftsveräußerungen auch dem österreichischen Bundesheer unmittelbar zufließen.
Geschätzter Franz Perhab, ich danke dir außerordentlich für die steirischen Glückwünsche. Für mich brachte – und das habe ich mittlerweile schon sehr deutlich zum Ausdruck gebracht – der 20. Jänner 2013 ein eindeutiges Ergebnis, und dieses Ergebnis ist 1 : 1 umzusetzen. Das ist jetzt auch mein primäres politisches Ziel in der Verteidigungspolitik, und daran arbeite ich. Ich bin nicht nur guter Hoffnung, sondern sehr zuversichtlich, dass das erfolgreich abgearbeitet und Ende Juni auch der Öffentlichkeit präsentiert werden kann.
Du, Kollege Perhab, hast die Problematik der Systemerhalter angesprochen. Ich sage ganz offen, die Systemerhalter sind im Sinne eines modernen, zukunftsorientierten österreichischen Bundesheeres – mit Blickwinkel auf die Rekruten – auch mir ein Dorn im Auge. Der Prozentsatz ist eindeutig zu hoch. Und wir arbeiten jetzt hinsichtlich der Reduktion der Zahl der Systemerhalter einen besonderen Schwerpunkt heraus. In diesem Zusammenhang bringe ich immer ein Beispiel. Es mag auf den ersten Anschein ein sehr einfaches Beispiel sein, aber es ist ein durchaus guter Treffer: Wir haben am Truppenübungsplatz Seethaler Alpen ein durchaus interessantes Projekt. Jenen Bereich an der Grenze, der ursprünglich von hundert Soldaten gesichert wurde, sichert jetzt ein elektronischer Zaun. – Es ist nicht immer eine Frage der Kosten. Das mag einfach und banal klingen, aber es gibt viele inhaltlich gute Ansätze, und auch in diesem Bereich werden wir einen deutlichen Schwerpunkt herausarbeiten.
Den sportlichen Ansatz und Schladming hast du sicherlich ausdrücklich ansprechen wollen. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir waren ja damals mit einer sehr interessanten kleinen Delegation des Bundesrates in Schladming. Insofern ist es ja auch schön, jetzt sozusagen in meiner neuen Rolle erleben zu dürfen, dass wir in Wahrheit ja genau zum richtigen Zeitpunkt nach Schladming gefahren sind. Genau zum richtigen Zeitpunkt! (Bundesrat Dr. Brunner: Du bist ja dann auch Minister geworden! – Allgemeine Heiterkeit.) – Ganz genau, und das sage ich ja auch ganz offen: Wir sind dann oben beim Teamwettbewerb auf der Tribüne gestanden, haben die Daumen gedrückt, haben spannende Momente erlebt, und als dann der Marcel Hirscher hinuntergefahren
ist, war nicht nur für uns die Welt in Ordnung. Und gestern habe ich die Gelegenheit gehabt, in Salzburg auch für diese spannenden Momente danke sagen zu dürfen.
Insofern ist es jetzt auch angenehm, nicht nur Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern danke zu sagen und ihnen Respekt für ihre Leistungen zu zollen, sondern auch zu versuchen, als Sportminister gute Beiträge zu leisten, damit österreichische Sportlerinnen und Sportler in die Lage versetzt werden, ihre Rahmenbedingungen so vorzufinden, dass auch in Zukunft Spitzensportleistungen möglich sein werden.
Geschätzte Kollegin Mühlwerth, ich bedanke mich ausdrücklich für die freundliche Aufnahme. Es ist von dir vieles angesprochen worden, was in meiner politischen Agenda ganz oben steht. Ich habe es hier auch ausdrücklich angesprochen. Es ist nicht nur die Attraktivierung des Präsenzdienstes, der mir natürlich wichtig ist, sondern auch der respektvolle Umgang innerhalb des österreichischen Bundesheeres.
Ich freue mich, dass ich – wenn auch nicht als Einstandsgeschenk für meine neue Aufgabe – vor rund einer Woche einen Bericht der Parlamentarischen Bundesheerkommission übergeben bekommen habe, der eine Reduktion der Zahl der Beschwerden um 20 Prozent zeigt. Das ist doch eine deutlich positive Tendenz. Ich freue mich natürlich auch, dass nur ein sehr geringer Anteil dieser knapp über 400 aufgelisteten Beschwerden im Bereich der Grundwehrdiener und auch ein geringer Anteil im Bereich der Ausbildung – beides sehr sensible Bereiche – festgestellt werden. Ich freue mich natürlich ausdrücklich über diese positive Entwicklung.
Kollege Schreuder hat auch die Frage unserer internationalen Missionen angesprochen und gemeint, dass es auch eine zentrale Aufgabe des österreichischen Bundesheeres sein muss, Konfliktherde und Bedrohungsszenarien möglichst frühzeitig zu erkennen. Dort, wo Österreich einen Beitrag leisten kann, leisten wir ihn auch gerne. Das Schlagwort lautet zum Teil auch „Hilfe zur Selbsthilfe“. In diesem Zusammenhang möchte ich ausdrücklich ansprechen, dass unsere Mission in Mali genau in diesem Bereich erste Schritte setzt und positive Beiträge leistet.
Für den Hinweis betreffend Sport bin ich dankbar. Auch mein politisches Programm beginnt klarerweise mit dem Grundbaustein „Keine Spitze ohne Breite“, und ich freue mich daher auch, dass es hier einen grundsätzlichen Konsens gibt.
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Lieber Christian Füller! Die sportlichen Schwerpunktsetzungen versuche ich auch in meiner täglichen Arbeit als Sportminister umzusetzen. Ich habe das in meinem Eingangsstatement ganz kurz angesprochen. Es wird auch ein Teil meiner Arbeit darauf fokussiert sein, bewusst die Brücke zwischen dem österreichischen Bundesheer und dem Sport zu verstärken, und zwar nicht nur deshalb, weil ich jetzt sagen könnte, dass das österreichische Bundesheer eigentlich der größte Arbeitgeber im Bereich des Sports ist – wir haben rund 400 Spitzensportlerinnen und Spitzensportler bei uns –, sondern auch deswegen, weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dass es hier eine gute, tolle Brückenfunktion zwischen dem Sport und dem österreichischen Bundesheer geben kann.
Darüber hinaus: Ja, mit aller Kraft unterstütze ich das politische Projekt der täglichen Bewegungseinheit. Für mich selbst – und das sage ich aber auch – ist es keine Fahnenfrage hinsichtlich der Begrifflichkeit, ob das jetzt explizit „tägliche Turnstunde“ oder „tägliche Bewegungseinheit“ heißt. Mir geht es um den Kern des Projekts. Auch ich will unsere Kinder wieder fitter machen. Das ist aus meiner Sicht der Kern des Projekts, und diesen unterstütze ich selbstverständlich auch sehr gerne.
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Im guten Sinne des Wortes könnte ich heute sagen: Man trifft sich im Leben immer zweimal, auch wenn die Rollenverteilung dann eine andere ist! Ich bedanke mich ausdrücklich für die freundliche Aufnahme – auch
hier im Bundesrat – in meiner neuen Rolle. Ich bedanke mich jetzt aber abschließend auch für all die wohlwollenden Vorschusslorbeeren – wie ich sie heute in der Früh wieder von einem Journalisten gehört habe – und für die Statements, die von einzelnen Kollegen im Zuge meiner Amtsübernahme auch in der Öffentlichkeit abgegeben wurden. Und ich kann in diesem Zusammenhang nur mein Angebot wiederholen, das ich in der Vergangenheit auch immer gerne ausgesprochen habe: Ich bin ein Mann des Dialogs!
Ich hoffe auf eine konstruktive Zusammenarbeit. – Vielen herzlichen Dank und Ihnen allen alles Gute! (Allgemeiner Beifall.)
13.34
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz: Die Debatte ist geschlossen.
Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, Herr Minister, und wünsche dir viel Erfolg für deine weitere Tätigkeit! Danke fürs Kommen!
Vor der Debatte über den nächsten Tagesordnungspunkt begrüße ich Herrn Staatssekretär Sebastian Kurz ganz herzlich hier bei uns! Herzlich willkommen im Bundesrat! (Allgemeiner Beifall.)
Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Wahl des Nationalrates (Nationalrats-Wahlordnung 1992 – NRWO) geändert wird (2178/A und 2213 d.B. sowie 8916/BR d.B.)
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz: Wir kommen damit zum 3. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatter ist Herr Bundesrat Köberl. Bitte um den Bericht.
Berichterstatter Günther Köberl: Geschätzte Frau Vizepräsidentin! Geschätzter Herr Vizepräsident! Herr Staatssekretär! Ich bringe den Bericht des Ausschusses für innere Angelegenheiten über den Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Wahl des Nationalrates, kurz Nationalrats-Wahlordnung 1992, geändert wird.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor; ich komme daher gleich zum Antrag.
Der Ausschuss für innere Angelegenheiten stellt nach Beratung der Vorlage am 3. April 2013 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsident Mag. Harald Himmer (den Vorsitz übernehmend): Danke für die Berichterstattung.
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Mag. Rausch. – Bitte, Frau Kollegin.
13.36
Bundesrätin Mag. Bettina Rausch (ÖVP, Niederösterreich): Sehr geehrte Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Werte Damen und Herren zu Hause! Sehr geehrter Herr Staatssekretär, lieber Sebastian! Ich freue mich besonders, dass du heute da bist, wenn wir diesen Beschluss treffen können, weil – das wissen jetzt wahrscheinlich nur wir zwei – es ziemlich genau ein Jahr her ist, dass wir in der Jungen ÖVP bei einer Tagung in Graz beisammengesessen sind und ein Bündel an Maßnahmen diskutiert und dann beschlossen haben. Dem sind auch intensive Diskussionen
mit Expertinnen und Experten innerhalb und außerhalb der institutionellen Demokratie vorangegangen.
Beschlossen haben wir ein Maßnahmenbündel für eine „Demokratie.Neu“, ein Maßnahmenbündel, das wir dann auch gemeinsam in die öffentliche Diskussion, in unsere eigene Partei und letztlich auch hier ins Hohe Haus getragen haben. Ein Maßnahmenbündel für eine neue Demokratie, das auf dem Wissen oder vielleicht viel eher noch auf dem Gefühl und dem Gespür gründet – das wir haben und das viele mit uns auch teilen –,wenn sich die Welt rund um uns verändert und weiterdreht, dass sich dann auch das politische, das parlamentarische System, die Instrumente der Demokratie verändern müssen, sich den neuen Herausforderungen, den Erwartungen, Anforderungen und Wünschen anpassen müssen, die auf uns treffen, die wir jeden Tag mitbekommen, hören, sehen und spüren.
Die Instrumente der Demokratie müssen nämlich deswegen auch verändert werden, damit sie weiterhin – sagen wir – stabilisierende, aber auch gestaltende Elemente in unserem Land bleiben können, damit sie weiterhin von Bürgerinnen und Bürgern, für die sie ja da sind, genutzt, geschätzt, respektiert werden, damit unsere Demokratie weiterhin so funktioniert, wie wir uns das wünschen. Das ist auch heute schon im europäischen Kontext mehrmals angesprochen worden.
Dieses Maßnahmenbündel, das wir vorgeschlagen haben und das auch immer wieder in Diskussion steht, hat drei Schwerpunkte gehabt. Zum einen haben wir vorgeschlagen, dass es echte Transparenz geben muss. Und da sei mir ein Wort gestattet, auch wenn ich mir die Berichterstattung von heute anschaue. Transparenz besteht nicht darin, darauf zu achten oder Politikerinnen, Politiker im Parlament zu filmen und darüber zu berichten, ob sie sich während einer Sitzung die Nase putzen oder Zeitung lesen. Vielleicht ist das für manche Menschen interessant. Aber das hat nichts mit Transparenz zu tun. Uns muss es darum gehen, das ernst zu meinen, wenn wir sagen: Wir wollen einen gläsernen Staat, statt gläserne Bürger, wir wollen überall dort, wo Steuergeld verwendet wird, darauf schauen, dass es auch sinnvoll und den Gesetzen entsprechend verwendet wird.
Es sind zwei Maßnahmen in Verhandlung, die auch dazu beitragen können, dass Transparenz ernst gemeint, dass echte Transparenz möglich wird. Ich denke zum einen daran, dass die Finanzministerin auf diese Initiative hin auch die Steuergeldverwendung offenlegt, die Bürgerinnen und Bürger, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler informiert, was mit ihrem Steuergeld passiert. Das hat sich der Mensch, der Steuern zahlt, auch verdient. Um zum anderen denke ich daran – das wurde in den letzten Wochen auch sehr intensiv diskutiert –, das Amtsgeheimnis auf die Bereiche zurückzudrängen, wo es zwingend notwendig ist, und gleichzeitig mehr Bürgerinnen- und Bürgerinformation möglich zu machen. Da danke ich auch dem Herrn Staatssekretär für seine Initiative und auch dem Koalitionspartner für die sehr fruchtbaren Verhandlungen.
Zweiter Schwerpunkt war, mehr Bürgerbeteiligung möglich zu machen – nicht nur dort, wo Politikerinnen und Politiker das brauchen, verlangen oder es vielleicht den Bürgern sozusagen fast erlauben – so kommt es ja manchmal hinüber –, sondern dort, wo Bürgerinnen und Bürger auch wirklich mitentscheiden wollen. Deswegen steht als erster Schritt eine parlamentarische Bürgeranfrage in Verhandlung, um den Parlamentarismus auch um dieses Instrument der Bürgerbeteiligung und den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern zu erweitern.
Ich persönlich kann mir vorstellen, dass wir hier im Long Run auch noch weiter gehen, dass es Volksentscheide gibt, die eine befriedigendere Situation bei der Bürgerbeteiligung möglich machen, als wir heute haben, Volksentscheide mit geringeren Hürden
bei der Beteiligung, mit klareren Konsequenzen und einer objektiveren Information, als wir es heute erleben.
Der dritte Bereich – und das ist auch der, um den es heute geht – ist ein modernes, neues Wahlrecht, dass die Personen, um die es geht, die kandidieren, stärker in den Mittelpunkt rückt. Wir hatten in Niederösterreich vor Kurzem Landtagswahlen. Bei uns gilt bei der Landtagswahl mittlerweile ein Wahlrecht, bei dem die Person vor der Partei steht. Es gilt in meiner eigenen Partei ein Vorzugsstimmensystem, mit dem wir – das sage ich auch ganz offen – erst leben lernen mussten, aber gut leben gelernt haben, und bei dem die Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stimme entscheiden, wie sich der Landtag aufseiten der Volkspartei zusammensetzt, das heißt, wer die Mandate bekommt.
Heute machen wir mehr Bürgerbeteiligung und mehr Mitwirkung der Wählerinnen und Wähler auch bei der Zusammensetzung des Nationalrates möglich. Wir werden, wenn wir heute zustimmen – und für meine Fraktion kann ich das auch schon ankündigen –, die bestehenden Hürden senken. Letztlich werden wir auch die Anforderungen senken, die bestehen, wenn man einen Kandidaten, eine Kandidatin auf der Wahlkreisliste vorreihen will, also die Liste einer Partei umreihen will. In Zukunft werden 14 Prozent der Parteistimmen an Vorzugsstimmen reichen, damit die betreffende Person auf der Liste vorgereiht wird. Die Hürden waren wesentlich höher, und dadurch war keine echte Mitwirkung der Wählerinnen und Wähler möglich.
Ich freue mich sehr darüber, dass sich das ändern wird, dass nicht mehr nur Parteien, sondern die Wählerinnen und Wähler in Zukunft sowohl im Regionalwahlkreis, als auch im Landeswahlkreis und neuerdings – das ist entscheidend – auch auf der Bundesliste viel stärker mitentscheiden können, wie sich die Parlamente personell zusammensetzen. Ich werde heute mit meiner Fraktion zustimmen, und ich kann Ihnen auch versprechen, ich werde weiterhin – wenn auch nicht hier, sondern ab Ende April in einer neuen Funktion – mit voller Kraft und Leidenschaft an der Modernisierung unserer Demokratie arbeiten, weil ich davon überzeugt bin, dass wir ein neues Miteinander zwischen dem politischen System, der Politik und den Bürgerinnen und Bürgern, für die diese Politik da ist, brauchen.
Das hat sich unser Land verdient, das haben sich die Menschen in unserem Land verdient. Sie haben sich unser aller Einsatz über Parteigrenzen, über Wahlkreisgrenzen – wenn man so will –, über Legislaturperioden und auch über persönliche Amtszeiten hinweg verdient. Darum bitte ich Sie alle, und ich freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit im Sinne unserer Demokratie. (Beifall bei der ÖVP sowie bei Bundesräten der SPÖ.)
13.42
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Als Nächster ist Herr Bundesrat Todt zu Wort gemeldet. – Bitte, Herr Kollege.
13.42
Bundesrat Reinhard Todt (SPÖ, Wien): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Staatssekretär! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir stimmen heute über einen sehr bedeutsamen Entwurf ab, und zwar einen, der vorsieht, dass mehr Persönlichkeitselemente in die Nationalratswahlordnung aufgenommen werden, dass es eine Reihe von Möglichkeiten gibt, Vorzugsstimmen abzugeben. Meine Vorrednerin hat dankenswerterweise schon auf diese Punkte hingewiesen, ich kann mir daher diese Erklärung sparen.
Ich möchte darauf hinweisen – und das ist mir ganz wichtig –, dass zu dieser Vorzugsstimmenfrage bei der nächsten Nationalratswahl auch eine entsprechende Informa-
tionskampagne, das heißt eine Aufklärungskampagne gemacht wird. Diese Kampagne über die Änderung der Nationalratswahlordnung kann aus meiner Sicht nur vonseiten des Innenministeriums gemacht werden.
Bisher war es ja so, dass man das immer als Kandidat erklären musste. Der Kandidat musste erklären, wie das ist, wann er gewählt ist und vieles andere mehr. Ich denke mir, es gehört eigentlich dazu, dass der Staat da aufklärt.
Eine weitere Geschichte, die mir auch sehr wichtig ist, ist, dass speziell die AuslandsösterreicherInnen über die geschaffenen Möglichkeiten zur Abgabe der Vorzugsstimme informiert werden und auch dazu animiert werden. Schließlich gibt es jetzt auch die Möglichkeit, Vorzugsstimmen auch auf der Bundesliste abzugeben. Das hat es bisher nicht gegeben. Diese Neuerungen müssen den Wählerinnen und Wählern bekanntgegeben werden.
Herr Staatssekretär, ich bitte Sie, das mitzunehmen, denn es ist Aufgabe des Innenministeriums, über diese Wahlen zu informieren.
Im Übrigen ist diese Novelle zur Nationalrats-Wahlordnung ja auch von Ihren Beamten sehr, sehr gut vorbereitet worden und zeugt im Prinzip von der hohen Qualität unserer Wahlordnung.
Ich möchte die Gelegenheit aber auch dazu nützen, darauf hinzuweisen, wie es um die Wahl des Bundesrates steht, das heißt der Bundesrätinnen und Bundesräte. Es ist jedem bekannt, dass nach den Artikeln 34 und 35 der Bundesverfassung die Mitglieder des Bundesrates von den Landtagen für die Dauer der Gesetzgebungsperiode der Landtage gewählt werden.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, da stellt sich schon die Frage, ob es für den Bundesrat, aber insbesondere für die Bundesrätinnen und Bundesräte nicht vorteilhafter wäre, wenn diese direkt von den jeweiligen Landesbürgern bei den Landtagswahlen gewählt werden könnten, statt wie bisher bloß mittelbar über die Landtage, und damit eine größere Legitimation bekämen. Natürlich sollte diese Wahl der Bundesrätinnen und Bundesräte im Rahmen der jeweiligen Landtagswahlen erfolgen, und alles andere könnte so bleiben, wie es ist. Ich würde aber vorschlagen, dass diese Wahl auf einem eigenen Stimmzettel – so wie das auch bei anderen Kandidaten geschieht – vorgenommen wird und dass es auch die Möglichkeit einer Reihung gibt, wie bei Nationalratswahlen oder bei Landtagswahlen.
Kandidatinnen und Kandidaten können dadurch eine Vorzugsstimme erhalten, die Politik des Kandidaten wäre damit präsenter und er müsste sich auch im Wahlkampf mehr einbringen, als er das bisher tun musste. Das würde für uns alle eine Aufwertung unserer Bundesratsfunktion bedeuten. Es gibt sicherlich eine Menge Details, die man klären müsste, man müsste sich die Wahlordnungen im Detail anschauen, und das bedeutet sicher auch sehr viel Arbeit, aber es wäre eine Möglichkeit, die sicher auch zur Optimierung des Bundesrates beitragen würde. Ich werde diesen Vorschlag gerne auch bei künftigen Verhandlungen über die Optimierung des Bundesrates mit einbringen.
Ich bitte Sie einfach, über diesen Vorschlag, dass Bundesrätinnen und Bundesräte bei Landtagswahlen auf einem eigenen Stimmzettel direkt gewählt werden können, nachzudenken! (Beifall bei der SPÖ.)
13.48
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Als Nächste ist Frau Bundesrätin Kerschbaum zu Wort gemeldet. – Bitte, Frau Kollegin.
13.49
Bundesrätin Elisabeth Kerschbaum (Grüne, Niederösterreich): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Staatssekretär! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!
Ich bin als Pro-Rednerin gemeldet, weil es prinzipiell auch mir ein wichtiges Anliegen ist, dass man die Personalisierung der Politik durch die Erleichterung der Vergabe von Vorzugsstimmen vorantreibt. Ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass wir uns alle gemeinsam dafür einsetzen.
Bettina, es ist schön, wenn ihr zwei zusammengesessen seid. Ich habe das damals sogar mitgekriegt, weil es in der Zeitung gestanden ist. Ich habe nur die Sache mit dieser Bürgeranfrage lustig gefunden, weil ich mir gedacht habe, wenn die Antworten auf die Bürgeranfragen so sind, wie die Antworten auf die parlamentarischen Anfragen, dann ist das kein Fortschritt.
Aber es gibt sicherlich einiges zu diskutieren, und da wäre es wirklich schön, wenn man einmal Gesamtdiskussionen führen könnte. Ich glaube nämlich, dass wir im Prinzip ja schon viele gleiche Interessen haben und dass es ganz, ganz wichtig ist, die Mittel, die wir haben, ein bisschen anzupassen, denn sowohl die Wahlordnungen, als auch unsere Mittel der direkten Demokratie – ich glaube, da sind wir uns offensichtlich zu einem Großteil einig – ein bisschen zahnlos sind. Insbesondere die Mittel der direkten Demokratie sind eindeutig verbesserungswürdig. Dazu haben wir ja nächsten Mittwoch auch eine Enquete.
Warum ich aber dem Gesetzentwurf beziehungsweise dem Gesetzestext letztlich nicht zustimmen kann, obwohl mir diese Personalisierung schon sehr wichtig ist, hat zwei Gründe.
Ich halte diese Wahlbroschüre an und für sich für eine sehr gute Idee. Prinzipiell ist eine neutrale Vorstellung aller Kandidaten und Kandidatinnen, damit sich die BürgerInnen, Wählerinnen und Wähler ein gutes Bild machen können, eine super Geschichte. Nur kriegen das, wie wir dann im Ausschuss gehört haben, nur die AuslandsösterreicherInnen und die, die mit Wahlkarten wählen, zugeschickt. Da denke ich mir, das ist auch nicht okay. Warum ist es nicht möglich, acht Millionen Exemplare zu drucken und jedem oder jeder mitzuschicken, der oder die zu einer Wahl geht? Diese Kostenfrage beziehungsweise warum man das weggelassen hat, ist für mich nicht nachvollziehbar. Prinzipiell muss es uns ja ein Anliegen sein, dass sich die Leute informieren und ein Bild darüber machen, wer kandidiert und wen man wählen kann.
Der zweite Punkt ist das Genderthema. Wir als Grüne haben das Problem ja in erster Linie, weil wir unsere Listen nach Männlein und Weiblein geordnet haben. Ich habe mir gedacht, dieses Genderproblem könnte man in einer Extrarunde einmal konkret ansprechen und sich parteiübergreifend Gedanken machen, wie man es lösen kann. Letztendlich glaube ich nämlich schon, dass zumindest ein großer Teil der hier Anwesenden meine Meinung teilt, dass es mehr Frauen im Parlament braucht. Es geht nicht darum, dass frauenspezifische Themen nur von Frauen gebracht werden können. Es geht eher darum, dass es einfach Unterschiede zwischen Männlein und Weiblein gibt, dass es oft auch unterschiedliche Ansichten gibt und dass es wichtig ist, dass beide Ansichten oder beide Seiten ausreichend vertreten sind und gleichen Zugang haben. Es geht also nicht um eine Gleichmacherei, sondern um eine Gleichstellung.
Nachdem es Bettina Rausch angesprochen hat: In Niederösterreich waren ja die letzte Landtagswahl und besonders die Gemeinderatswahl, bei der es ja auch bei der ÖVP dieses Vorzugsstimmensystem gegeben hat, besonders interessant. An und für sich ist das eine super Geschichte, nur ist dabei meines Wissens keine einzige Frau hineingekommen. Es ist leider so wie in der Wirtschaft: Da wissen wir auch, dass es sehr viele begnadete Frauen gibt, die trotzdem nicht weiterkommen. (Bundesrätin Mag. Rausch: Es sind sogar welche Bürgermeisterin geworden! In meinem Bezirk gibt es fünf Bürgermeisterinnen!) – Die sind durch das Vorzugsstimmensystem hineingekommen? (Bundesrätin Mag. Rausch: Deswegen ist es ja eigens beschlossen worden!)
Ich weiß nur, dass bei uns, in meinem Bezirk, keine einzige Frau durch die Vorzugsstimme hineingekommen ist. Die, die dann doch hineingekommen sind, das war wieder ein anderes System. Mach einmal eine Statistik und schau dir die Sache an!
Prinzipiell denke ich, dass dieses radikale Vorzugsstimmensystem leider dazu führt, dass eher weniger Frauen in den Parlamenten oder Gemeinderäten oder Landtagen sitzen würden als bisher, und das ist nicht förderlich. Das wird sich auch nicht von alleine ändern.
Wir sehen das auch in der Wirtschaft. Da gibt es auch Bemühungen, damit mehr Frauen in höhere und entscheidende Posten kommen, aber letztendlich wirkt das alles wenig. (Bundesrat Tiefnig: Wir haben eine Nationalratspräsidentin!) Es stimmt, wir haben eine Präsidentin. Wir haben ja nicht keine Frauen. Es stimmt ja nicht, dass wir keine Frauen haben, hier herinnen sitzen auch 30 Prozent Frauen. Aber es werden nicht von alleine mehr werden. In der Bevölkerung haben wir mehr als 50 Prozent Frauen. (Bundesrätin Zwazl: Die Unternehmen werden jetzt schon großteils von Frauen geführt, und bei den Neuanmeldungen haben wir 49 Prozent Frauen!) – Ja, in der Wirtschaft, aber bei den Posten in den Aufsichtsräten, in den Vorständen, sind wir uns, glaube ich, schon einig, dass Frauen nicht in dem Ausmaß vertreten sind, wie wir das gerne hätten.
Mir geht es nicht darum, dass eine Frau nur deshalb gefördert wird, weil sie eine Frau ist, sondern mir geht es um die verschiedenen Zugänge und die verschiedenen Arbeitsweisen. Ich glaube, das ist sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik wichtig. Deshalb finde ich unser System, mindestens so viele Frauen wie Männer in der Politik zu haben, eine super Geschichte. In Bundesrat ist es uns leider nicht so gelungen, weil wir leider genau in den Bundesländern, in denen wir die Frauen gestellt haben, Mandate verloren haben. Aber im Prinzip finde ich, sind unsere Listen eine super Geschichte, und ich denke, das sollten auch andere überdenken.
Kurzum: Da das Vorzugsstimmensystem zwar jetzt verbessert wird, aber die Genderproblematik in Wirklichkeit keinesfalls angegangen wird und auch im Ausschuss gesagt worden ist, das ist keine politische Entscheidung, das ist eben so in der Gesellschaft, denke ich mir, wenn nicht der Wille da ist, auch darüber nachzudenken, kann ich leider nicht zustimmen.
Wie gesagt, ich hätte gerne zugestimmt, aber das fehlt mir, ebenso wie ich finde, dass diese Broschüre, die informativ sein sollte und sicher gut wäre, jeder Wählerin und jedem Wähler zugutekommen sollte und nicht nur denen, die AuslandsösterreicherInnen oder BriefwählerInnen sind.
Ansonsten hoffe ich, dass wir vielleicht die direkte Demokratie und die Demokratiedebatte und die Wahlordnungsdebatte doch noch irgendwann einmal fortführen und dass vielleicht auch neue Aspekte einfließen. Heute können wir leider nicht zustimmen. (Beifall bei den Grünen.)
13.55
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Als Nächster gelangt Herr Bundesrat Saller zu Wort. – Bitte, Herr Kollege.
13.55
Bundesrat Josef Saller (ÖVP, Salzburg): Herr Präsident! Herr Staatssekretär! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Eine im Herbst durchgeführte Studie zeigt, dass 80 Prozent der Befragten mehr direkte Demokratie wollen. Das heißt, die Österreicher wollen einfach mehr mitentscheiden.
Es gibt einen klaren Unterschied zwischen der Politikverdrossenheit und der Politikerverdrossenheit. Ich möchte die zwei klar trennen, weil wir derzeit eher mit Zweiterem befasst sind.
Vertrauen kann man nicht kaufen, Vertrauen muss man sich erwerben und erarbeiten. Entscheidend ist, das Vertrauen der Wähler zu gewinnen. Wer ist näher am Bürger als der gewählte Mandatar, ob das nun bei Veranstaltungen, Stammtischen oder sonst irgendwo ist? Es muss eine neue Chance geben, jene abzustrafen, die nichts tun, die nicht arbeiten, die Scheingefechte führen, und dafür jene in gesetzgebende Körperschaften zu hieven und zu bringen, die fleißig sind, die die Sorgen der Menschen erkennen und sie auch vertreten. Natürlich wird es immer wieder sogenannte Platzhirsche geben. Aber aufgrund der neuen Möglichkeiten für Vorzugsstimmen kommt natürlich auch da allerhand in Bewegung.
Jugend und Senioren müssen den richtigen Platz haben. Junge Menschen wählen vielleicht jüngere Kandidaten, ältere wählen Seniorenvertreter. – Warum auch nicht? Jeder muss die Chance bekommen. Das ist so.
In Salzburg hat sich unser Landeshauptmann-Stellvertreter Haslauer bereits seit Herbst 2011 besonders bemüht, mehr direkte Demokratie einfließen zu lassen. Es geht darum, die Legitimation der Abgeordneten als direkte Vertreter der Bevölkerung weiter zu stärken und auszubauen. Der Kontakt zwischen Politikern und Wählern ist dauerhaft zu intensivieren.
Es wird nicht mehr reichen, vor Wahlen einen Wahltross zusammenzustellen und durch die Lande zu touren. Was wir brauchen, meine Damen und Herren, ist eine stetige und unermüdliche Betreuung der Bürgerinnen und Bürger.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist ja von meiner Vorrednerin Kollegin Rausch schon angesprochen worden, nämlich die Erhöhung der Verbindlichkeiten der direkten Demokratie. Die Bevölkerung sollte für die Politik verbindliche Volksabstimmungen einleiten können.
Es gibt noch viele Möglichkeiten, die direkte Demokratie auszubauen, wir müssen es nur wollen und umsetzen und nicht immer nur davon reden. Heute sind wir hier auf einem guten Weg. – Danke. (Beifall bei der ÖVP.)
13.58
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Als Nächste gelangt Frau Bundesrätin Grimling zu Wort. – Bitte, Frau Kollegin.
13.59
Bundesrätin Elisabeth Grimling (SPÖ, Wien): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Staatssekretär! Werte Kolleginnen und Kollegen! Es ist schon sehr viel gesagt worden, ich möchte es noch einmal wiederholen, und zwar das, was die Vorzugsstimmen betrifft.
Kernpunkt des vorliegenden Gesetzentwurfs zur Änderung der Nationalratswahlordnung ist die Möglichkeit, künftig auch auf Bundesebene Vorzugsstimmen zu vergeben und damit eine entsprechende Umreihung der Kandidaten und Kandidatinnen auf der Bundesparteiliste zu bewirken, was bisher nur bei den Regionalparteilisten und den Landesparteilisten möglich war.
Erhält ein Kandidat/eine Kandidatin in der Bundesparteiliste 7 Prozent der gültigen Parteistimmen, muss er beziehungsweise sie vorgereiht werden.
Auch auf Regional- und Landesebene wird es für Wahlwerberinnen und Wahlwerber leichter, vorzurücken. Für Regionalwahlkreise wurde der Vorzugsstimmenschwellenwert auf 14 Prozent der jeweiligen Parteistimmen herabgesetzt. Im Landeswahlkreis sind es 10 Prozent. Die Wahlzahl des Bundeslandes muss nicht mehr zwingend erreicht werden. Durch die höhere Gewichtung von Vorzugsstimmen soll die Wahl attraktiver werden.
Darüber hinaus sind Änderungen bei den für Nationalratswahlen geltenden Fristen vorgesehen.
Um eine Ausgabe der Stimmzettel am 30. Tag vor der Wahl zu gewährleisten und AuslandsösterreicherInnen damit eine rechtzeitige Stimmenabgabe zu ermöglichen, muss der vom Hauptausschuss des Nationalrates festzulegende Stichtag in Hinkunft auf den 82. Tag vor der Wahl fallen. Bisher war es der 68. Tag. Das wirkt sich auch auf andere Fristen aus, etwa auf den letztmöglichen Zeitpunkt für die Einbringung von Landes- und Bundeswahlvorschlägen.
Die Novellierung enthält weiters die entsprechenden legistischen Anpassungen wie die Änderung der Rechenregeln in den Ermittlungsverfahren und die Neugestaltung der amtlichen Stimmzettel.
Meine Fraktion wird, wie ja schon angekündigt, dem vorliegenden Gesetzentwurf zustimmen. – Danke. (Beifall bei der SPÖ sowie bei Bundesräten der ÖVP.)
14.02
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Staatssekretär Kurz. – Bitte, Herr Staatssekretär.
14.02
Staatssekretär im Bundesministerium für Inneres Sebastian Kurz: Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzte Bundesrätinnen und Bundesräte! Es ist schon viel gesagt worden zum vorliegenden Gesetzesvorschlag. Bettina Rausch hat angesprochen, wir haben uns vor einem Jahr als Junge ÖVP Gedanken gemacht, wie kann man die Demokratie ein Stück weit weiterentwickeln, wie kann man vielleicht auch den Bürger ein Stück weit näher an die Politik heranbringen und ihm eine stärkere Möglichkeit der Selbstwirksamkeit und eine stärkere Möglichkeit zur Mitbestimmung einräumen.
Da gibt es viele Vorschläge. Ich freue mich, dass heute ein zentraler dieser Vorschläge ein Stück weit umgesetzt werden kann, nämlich die Aufwertung der Vorzugsstimme. Ich gebe zu, es wäre schön gewesen, wenn noch mehr möglich gewesen wäre, es wäre schön gewesen, wenn Vorzugsstimmen noch mehr Gewicht bekommen, aber ich glaube, dass es doch ein richtiger Schritt in die richtige Richtung ist.
Was ändert sich? – Ganz konkret sind es zwei Punkte. Erstens: Vorzugsstimmen bekommen mehr Gewicht, das heißt, es ist in Zukunft leichter möglich, durch Vorzugsstimmen vorgereiht zu werden. Und das Zweite ist, man kann nun auch auf Bundesebene eine Vorzugsstimme abgeben. Das heißt, dass bei der nächsten Nationalratswahl der Wähler oder die Wählerin im Wahlkreis einen Kandidaten ankreuzen kann, auf der Landesliste einen Kandidaten hinschreiben kann und auch auf der Bundesliste einen weiteren Kandidaten hinschreiben kann.
Es können somit drei Vorzugsstimmen vergeben werden, und die Wählerin und der Wähler haben eine stärkere Möglichkeit, nicht nur Parteien entscheiden zu lassen, sondern selbst mitzuentscheiden, welche Persönlichkeiten in die jeweilige gesetzliche Vertretungskörperschaft einziehen können sollen.
Zu den angesprochenen Themen darf ich noch ganz kurz Stellung beziehen. Frau Bundesrätin Kerschbaum von den Grünen hat angesprochen, dass es keine Gendergerechtigkeit gibt. Ich bin da eigentlich der Meinung, dass, wenn Vorzugsstimmen vergeben werden können, die Macht beim Wähler ist, und so soll es in einer Demokratie auch sein. Der Wähler hat die Möglichkeit, einer Frau die Vorzugsstimme zu geben, der Wähler hat die Möglichkeit, einem Mann die Vorzugsstimme zu geben, und es entspricht eigentlich nicht meinem Weltbild, Frauen einmal grundsätzlich zu unterstellen, dass sie beim Wähler nicht so gut ankommen und keine Möglichkeit haben, entsprechend viele Vorzugsstimmen einzufahren.
Wenn ich mir die letzten Vorzugsstimmenergebnisse anschaue, zum Beispiel in Niederösterreich, dann sehe ich, dass Bettina Rausch eines der besten Vorzugsstimmenergebnisse im ganzen Bundesland eingefahren hat, und das vollkommen problemlos, obwohl oder gerade weil sie eine Frau ist. (Beifall und Bravorufe bei der ÖVP. – Zwischenruf der Bundesrätin Kerschbaum.)
Herr Bundesrat Todt hat angesprochen, dass es wichtig ist, die Bevölkerung zu informieren, und dass es sinnvoll ist, auch darauf hinzuweisen, dass überhaupt die Möglichkeit besteht, Vorzugsstimmen zu vergeben. Diesen Auftrag nehmen wir gerne an und werden als Innenministerium auch alles tun, um diesem Auftrag gerecht zu werden. Wir werden darüber informieren, dass es diese Möglichkeiten gibt, nicht nur durch die Broschüren, die übrigens nicht nur die Auslandsösterreicher bekommen, sondern alle Wahlkartenwähler, sondern natürlich auch durch eine breit angelegte Informationskampagne, weil natürlich, um demokratisch mitgestalten zu können, auch Wissen vorhanden sein muss, und diese Wissensvermittlung ist nicht nur eine Hol-, sondern vor allem auch eine Bringschuld seitens der Politik.
Ich darf allen Fraktionen, die diesen Schritt in Richtung mehr Demokratie unterstützen, vorab danken und hoffe auch, dass es nicht der letzte gewesen ist, sondern dass wir noch viele kleine Schritte machen können, um unsere Demokratie weiterzuentwickeln. – Vielen Dank. (Beifall bei der ÖVP.)
14.06
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Als Nächste zu Wort gelangt Frau Bundesrätin Posch-Gruska. – Bitte, Frau Kollegin.
14.06
Bundesrätin Inge Posch-Gruska (SPÖ, Burgenland): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Staatssekretär! Ich muss mich sozusagen außertourlich zu Wort melden, weil ich davon überzeugt bin, dass dieses Polemisieren, das gerade stattgefunden hat, dass der Wähler entscheidet, nicht so im Bundesrat stehen bleiben darf.
Erstens einmal hat nicht nur der Wähler, sondern auch die Wählerin das Recht zu entscheiden (demonstrativer Beifall der Bundesrätin Kerschbaum), und dieses Weltbild, das wir hier vertreten, müssen wir, glaube ich, sehr wohl gemeinsam diskutieren.
Dass diese neue Wahlordnung nicht dazu beiträgt, dass sie wirklich gendergerecht ist, das wissen wir. Und zu dem müssen wir auch stehen. Auch wir als SPÖ stimmen dafür, weil wir wissen, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist nicht gendergerecht. Und ich glaube nicht, dass wir das hier mit einer Wahl – ich bin sehr froh und gratuliere dir, Bettina, auch zu deinem Wahlergebnis – einfach so runtermachen können. Ein gendergerechtes Ergebnis ist diese Wahlordnung ganz sicher nicht! (Beifall bei der SPÖ sowie der Bundesrätin Kerschbaum. – Bundesrat Perhab: Das war ein peinlicher Auftritt!)
14.07
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Weitere Wortmeldungen dazu liegen mir jetzt nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Wenn das nicht der Fall ist, gelangen wir zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit, der Antrag ist somit angenommen. (Bundesrätin Kerschbaum: Entschuldigung, Herr Präsident! Haben Sie gesagt „einstimmig“?) Ich korrigiere: Der Antrag ist mehrheitlich angenommen.
4. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das BFA-Einrichtungsgesetz, das BFA-Verfahrensgesetz, das Asylgesetz 2005, das Fremdenpolizeigesetz 2005, das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz und das Grenzkontrollgesetz sowie das Grundversorgungsgesetz – Bund 2005 geändert werden (FNG-Anpassungsgesetz) (2144 d.B. und 2215 d.B. sowie 8914/BR d.B. und 8917/BR d.B.)
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Wir gelangen zum 4. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatter ist Herr Bundesrat Köberl. – Bitte um den Bericht.
Berichterstatter Günther Köberl: Herr Vizepräsident! Herr Staatssekretär! Ich bringe den Bericht des Ausschusses für innere Angelegenheiten über den Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das BFA-Einrichtungsgesetz, das BFA-Verfahrensgesetz, das Asylgesetz 2005, das Fremdenpolizeigesetz 2005, das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz und das Grenzkontrollgesetz sowie das Grundversorgungsgesetz – Bund 2005 geändert werden, kurz: FNG-Anpassungsgesetz.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor; ich komme daher gleich zur Antragstellung.
Der Ausschuss für innere Angelegenheiten stellt nach Beratung der Vorlage am 3. April 2013 mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Danke für die Berichterstattung.
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Krusche. – Bitte, Herr Kollege.
14.09
Bundesrat Gerd Krusche (FPÖ, Steiermark): Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Staatssekretär! Meine Damen und Herren! Werte Zuseher zu Hause! Wenn ich richtig gezählt habe, sind insgesamt sieben Gesetze von dieser vorliegenden Novelle betroffen. Es geht dabei um eine Anpassung an die neue Novelle zur Verwaltungsgerichtsbarkeit. Es geht um Rechtsgrundlagen für den Übergang der Verfahren nach dem 1. Jänner 2014. Es geht um die Verwendungsmöglichkeit für Landesbedienstete und Bedienstete der Gemeinde Wien, um die Anpassung an die Judikatur vom Verwaltungs- und Verfassungsgerichtshof und um die Umsetzung, wie eigentlich fast immer, von irgendwelchen EU-Richtlinien und -Verordnungen.
Also vordergründig handelt es sich dabei sicherlich nicht um fundamentale Änderungen im Asyl- und Fremdenrecht. Trotzdem werden wir aber dieser Materie unsere Zustimmung nicht erteilen, und zwar so lange nicht, solange Meldungen wie die folgenden zur täglichen Berichterstattung gehören.
Ich zitiere aus der „Kleinen Zeitung“ vom 9. März des heurigen Jahres:
„Nach einem Trinkgelage im Grazer Metahofpark waren () vier Unbekannte über eine Friseurin () hergefallen. Die Männer vergewaltigten und verletzten die Frau schwer.“ DNA-Spuren führten „zu einem Pakistani. Der 30-Jährige sitzt bereits wegen Mordversuch in Untersuchungshaft. Er soll drei Wochen nach der Vergewaltigung in einem Asylantenhaus in der Grazer Mariengasse einen Landsmann wegen Differenzen bei Drogengeschäften niedergestochen haben. Im Zuge der umfangreichen Erhebungen () wurden schließlich auch noch zwei Inder () und ein 23-jähriger Türke als Mittäter ausgeforscht und verhaftet.“
Oder acht Tage vorher war unter der Schlagzeile „Zehn Dealer verhaftet, größere Mengen an Suchtgift und Drogengeld sichergestellt. Bande versorgte die Szene in Graz und in Kärnten“ Folgendes zu lesen:
„Die jetzt Verhafteten waren der Polizei keine Unbekannten mehr – viele von ihnen sind einschlägig vorbestraft. Die Männer () stammen aus Marokko, Ägypten, Tunesien, Afghanistan und Saudi-Arabien und lebten als Asylwerber oder mittels geschlossener Scheinehen seit Längerem in Österreich.“
Dass solche Vorkommnisse, die hier beispielhaft an zwei steirischen Beispielen aus dem vergangenen Monat aufgezeigt worden sind, keine Einzelfälle sind, das beweisen die Zahlen aus Ihrem Ministerium, Herr Staatssekretär: Das sind einmal 8 500 bis 10 000 straffällige Asylwerber pro Jahr oder über 40 000 tatverdächtige Asylwerber in den letzten fünf Jahren. Im Jahre 2012 sind 2 625 im Verfahren befindliche Personen einfach untergetaucht, und mit Stichtag 31. Dezember des letzten Jahres befinden sich über 3 000 Personen mit negativ abgeschlossenem Asylverfahren in der Grundversorgung.
Wir Freiheitlichen, meine Damen und Herren, werden keinerlei Gesetzen zustimmen, die sich rund um die Thematik Asyl bewegen, wenn sich die Faktenlage in Österreich nicht ändert, die nämlich so ausschaut, dass die Anerkennung von Asylwerbern in Österreich über dem europäischen Durchschnitt liegt, dass wir bei den Asylwerbern eine Steigerungsrate von über 20 Prozent haben, dass 90 Prozent dieser Asylwerber aus sicheren Drittstaaten kommen.
Ich fordere Sie auf, Herr Staatssekretär: Legen Sie endlich ein Gesetz vor, das gewährleistet, dass wirklich nur jene Asyl und Aufenthalt in Österreich bekommen, die schutzbedürftig sind, nämlich Schutz vor Verfolgung bedürfen!
Herr Kollege Dönmez hat heute im Rahmen einer Debatte in unsere Richtung, in Richtung FPÖ angemerkt, dass wir nicht so richtig glaubhaft wären, solange wir den Verfolgten keinen Schutz geben – es ist da um die Religion gegangen. Herr Dönmez, ich kann Ihnen versichern: Jeder, der aus religiösen Gründen verfolgt wird, verdient nach unserer Auffassung in Österreich Asyl, aber nicht all jene Wirtschaftsflüchtlinge, für die Österreich einen Anziehungspunkt darstellt!
Vor allem fordere ich, dass straffällige Asylwerber umgehend abgeschoben werden, nämlich genau diese Herren beispielsweise, die in diesen Zeitungsberichten angesprochen waren. Und in erster Linie müssen Gewaltverbrecher und Drogendealer möglichst rasch abgeschoben werden.
Natürlich wäre auch ein Nebeneffekt, dass die Kosten für das Asyl- und Fremdenwesen in Österreich etwas eingebremst werden können. Ich möchte nur an den jüngsten Rechnungshofbericht erinnern, der hier große Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern aufdeckt. Ich weiß, dass allein in der Steiermark im Jahr 2011 35,4 Millionen € dafür ausgegeben wurden. Vielleicht könnte ja die große Koalition ein neues Lieblingsthema aufgreifen und schauen, dass wir da etwas einsparen und dafür leistbares Wohnen ermöglichen können.
Also abschließend noch einmal: Solange solche Dinge bei uns passieren und sich immer wieder wiederholen, werden wir keinen Novellierungen des Fremden- und des Asylgesetzes, die nur Flickwerk sind und an den harten Fakten nichts ändern, zustimmen. (Beifall bei der FPÖ.)
14.16
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Bundesrat Perhab. – Bitte.
14.16
Bundesrat Franz Perhab (ÖVP, Steiermark): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Staatssekretär! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich glaube, wir können es jetzt nach einer intensiven Diskussion im Innenausschuss relativ kurz halten, weil die Problematik in der Debatte hier im Plenum bei diesen Tagesordnungspunkten oder bei diesen Inhalten immer dieselbe ist: Wir, die Regierungskoalition, befinden uns hier immer in der Mitte.
Das ist eine sehr gesunde Mitte, wie ich meine, denn auf der linken Seite sind die Grünen, die alles öffnen wollen, die sich gegen jede, wenn auch nur millimeterweise Verschärfung des Fremdenrechts wehren; so wie jetzt zum Beispiel wieder: Protest gegen den Fingerabdruck bei der Grenzkontrolle. Also ich frage mich wirklich, in welcher Welt ihr Grünen lebt. Reisen Sie nach Amerika ein, da haben Sie den Fingerprint sofort schon bei der „Immigration“ oder sonst wo! Das ist heute State of the Art. Und ihr seid wieder dagegen! – Auf der anderen Seite haben wir die FPÖ, der alles zu wenig ist. Jetzt sind wir natürlich in der Mitte, und ich glaube, wir haben in vielen Dingen recht, denn das Glas kann man als halb voll oder als halb leer bezeichnen.
Aber durchaus kritisch eingestellt bin ich gegenüber dem, was auch Ihre Redner erwähnt haben: Wenn es tatsächlich in Italien so ist, wie es geschildert wird und in einigen Medien wiedergegeben wurde, dass die italienische Regierung, die Verwaltung jedem Flüchtling und jedem Asylwerber 500 € in die Hand drückt und ein Dokument ausstellt, mit dem er im gesamten Schengenraum mehr oder minder unbefristet, über die 90 Tage unkontrollierbar herumreisen kann, dann muss das zu einer EU-Beschwerde führen, aber mit Bomben und Granaten.
Ich meine, das kann doch kein EU-Mitgliedstaat so handhaben! Das ist doch keine Verwaltung mehr, das ist doch eine Auflösung der Verwaltung. Das ist das Gegenteil von legaler Verwaltung. Ich denke, da ist auch von unseren Regierungsvertretern und vor allem von den EU-Vertretern Handlungsbedarf gegeben. Hier muss die EU einmal tätig werden. Ich habe noch keine Beweise, dass das so ist, aber wenn es so ist, gehört das sofort abgeschafft. Da bin ich durchaus einer Meinung mit ein paar Vorrednern.
Das Zweite ist diese Sache mit den Minderjährigen. Aus Polizeiberichten geht hervor, dass immer mehr Minderjährige alleine über die Grenze kommen, um um Asyl anzusuchen, wo vermutet wird, dass da gewisse Schlepper dahinterstehen, weil sie damit kalkulieren, dass diese leichter Asyl bekommen und dadurch auch leichter der Familiennachzug möglich ist beziehungsweise dass diese andere Möglichkeiten haben, hier in Österreich – unter Anführungszeichen – „legal“ Asyl zu bekommen.
Letzten Endes ist diese Novelle nichts anderes als eine Anpassung, verursacht durch die Neuorganisation der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Das ist eine trockene legistische Materie, die wir aber unseren Instanzen, unseren Behörden schuldig sind, damit sie effizient handeln können – genau das, was die FPÖ will, genau das, was die Regierung verspricht und wir auch durchsetzen wollen – auch gegen den Willen der Grünen. Wir werden dem zustimmen. – Vielen Dank. (Beifall bei der ÖVP.)
14.19
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Bundesrat Dönmez. – Bitte, Herr Kollege.
14.20
Bundesrat Efgani Dönmez, PMM (Grüne, Oberösterreich): Sehr geehrter Herr Staatssekretär! Hohes Präsidium! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Auch wir werden nicht zustimmen (Bundesrat Krusche: Wie es der Franz gesagt hat!), das aber mit anderen Argumenten begründen als die FPÖ. Ich verstehe, Kollege Krusche, dass Sie hier, wenn es um diese Thematik geht, keine Gelegenheit auslassen, Asylwerber gene-
rell in ein kriminelles Licht zu rücken. (Bundesrätin Mühlwerth: Nein, das stimmt nicht!) Es gibt überall schwarze Schafe, mit denen wir alle nicht glücklich sind, aber wir haben in Österreich auch eine Gewaltenteilung. Für Leute, die straffällig geworden sind, sind nach wie vor die Polizei und die Exekutive zuständig. Auch das Fremdengesetz sieht entsprechende Maßnahmen vor, von Asyl-Aberkennung bis hin zu Abschiebung, aber das erwähnen Sie immer ganz bewusst nicht.
Unser Kritikpunkt in aller Kürze: Es handelt sich um eine Richtlinie der EU, die in nationales Recht umzusetzen ist. Was haben SPÖ und ÖVP gemacht? – Sie haben diese Gelegenheit wieder dazu genutzt, Verschärfungen hineinzureklamieren, Verschärfungen zum Beispiel dahin gehend, dass man für Asylwerber, wenn sie Berufung einlegen, wenn sie in die Berufungsinstanz gehen, die Beschwerdefrist von vier Wochen, die für alle anderen gilt, auf zwei Wochen reduziert hat.
Es soll auch eine neue Mitwirkungspflicht für UMF, für unbegleitete minderjährige Fremde, geben. Ich verstehe hier die Intention nicht – vielleicht kann mir diese noch jemand erklären –, warum man explizit eine Mitwirkungspflicht für UMF vorsieht, wenngleich nach dem Asylgesetz bei Asylverfahren ohnehin schon eine Mitwirkungspflicht besteht.
Zu dem, Kollege Perhab, was du angesprochen hast, was du nicht verstehst, möchte ich sagen: Ich glaube, die datenschutzrechtlichen Bedenken so lapidar mit einem Satz, wie du es getan hast, vom Tisch zu wischen, das geht nicht. Es geht darum, dass Fingerabdrücke im EURODAC-System eingespeist werden. Das kritisieren wir auch nicht, natürlich braucht es eine Kontrolle, braucht es eine Überprüfung, wer wo einen Asylantrag gestellt hat. Das, was wir kritisieren, ist, dass diese Fingerabdrücke, die, wie vorgesehen, in das EURODAC-System eingespeist werden sollen, mittlerweile auch mit anderen Datenbanken, wo Fingerabdrücke abgespeichert werden, verglichen werden sollen, ohne dass ein konkretes Verdachtsmoment vorliegt. Das ist aus datenschutzrechtlicher Perspektive doch eine bedenkliche Entwicklung. Was wir Grüne noch verhindern konnten, ist, dass – wie es ja vorgesehen war – DNA-Daten auch mit hineingenommen werden.
Das sind in aller Kürze die Gründe dafür, dass wir diesem Gesetz unsere Zustimmung nicht erteilen werden, und das sind, wie gesagt, andere Argumente, als die FPÖ vorgebracht hat. – Danke. (Beifall bei den Grünen.)
14.23
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Als Nächste gelangt Frau Bundesrätin Reich zu Wort. – Bitte, Frau Kollegin.
14.23
Bundesrätin Elisabeth Reich (SPÖ, Oberösterreich): Geschätztes Präsidium! Herr Staatssekretär! Werte Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat! Mit dem Fremdenbehördenneustrukturierungsgesetz werden nun unter anderem EU-Vorgaben umgesetzt, Entscheidungen des Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshofes bei den gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt und im Hinblick auf die bevorstehende Einrichtung von Verwaltungsgerichten neue Regeln für fremdenrechtliche Beschwerdeverfahren festgelegt.
Unter anderem wird es laut FNG-Anpassungsgesetz für Drittstaatsangehörige künftig möglich sein, eine kombinierte Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis zu beantragen. Außerdem erhalten Familienangehörige aus Drittstaaten rascher einen unbeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt. Auch für anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte gibt es verschiedene bürokratische Erleichterungen.
Neu ist darüber hinaus, dass künftig alle Antragsteller, deren Visa-Antrag von österreichischen Vertretungsbehörden abgelehnt wurde, die Entscheidung beim Bundesver-
waltungsgericht anfechten können. Bisher war das für Drittstaatsangehörige nicht möglich.
Die Änderung des Grenzkontrollgesetzes gibt zwar Sicherheitsorganen in Hinkunft die Befugnis, bei Grenzkontrollen Fingerabdrücke von Reisenden abzunehmen und diese mit den im Reisepass oder in Datenbanken gespeicherten Fingerabdrücken zu vergleichen, aber dieses Gesetz ist durch einen Abänderungsantrag entschärft worden, der noch einmal deutlich unterstreicht, dass diese Maßnahme nur bei begründeten Zweifeln an der Identität des Reisenden zulässig ist und der erlaubte Abgleich biometrischer Daten nicht für die DNA gilt.
Klargestellt wird mit dem Abänderungsantrag weiters, dass die künftig vorgesehene verpflichtende Mitwirkung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge bei der Suche ihrer Eltern nur mehr für mündige Minderjährige, also für Über-14-Jährige gilt. Bei Unter-14-Jährigen wird diese Mitwirkungspflicht nicht schlagend. Außerdem wird auch nochmals verdeutlicht, dass die Mitwirkungspflicht dann nicht besteht, wenn die Suche nach den Familienangehörigen nicht im Interesse des Kindeswohls gelegen ist.
Diese Mitwirkungsrechte der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge waren ein Diskussionsthema, werden vielleicht auch noch ein Diskussionsthema bleiben. Sie wurden aber nach intensiven Beratungen in den Ausschüssen des Nationalrates und auch in unseren Ausschüssen und nach Gesprächen mit der Frau Ministerin noch abgeändert – danke dafür –, und zwar, sehr geehrte Damen und Herren, wie ich glaube, zum Wohl der schutzbedürftigen Kinder. Unbegleitete unmündige Minderjährige sind nun auf deren Ersuchen von der Behörde bei der Suche nach deren Familienangehörigen zu unterstützen.
So wie in den EU-Richtlinien vorgeschrieben, wurde die Pflicht nun auf das Recht auf die Suche nach den Eltern mit der vollen Unterstützung des Bundesamtes abgeändert. Es ist nun auch im Gesetz festgeschrieben, dass die Jugendwohlfahrt der Länder beizuziehen ist und somit das Kindeswohl im Vordergrund steht. Es ist mir aber auch bewusst, dass der Begriff „Kindeswohl“ ein breites Spektrum zur Auslegung beinhaltet, dass es natürlich unterschiedliche Jugendliche gibt, dass verschiedenste Gründe für deren Aufenthalt vorliegen und dass es auch bei den Eltern nicht nur gute, um das Wohl ihres Kindes besorgte gibt, weshalb die verpflichtende Suche nach ihnen manchmal sogar bedenklich für das Kind sein kann.
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Was wir uns selbstverständlich wünschen, sind europaweit gemeinsame Regelungen, damit man so rasch wie möglich reagieren kann und so menschlich wie möglich reagieren soll, damit Menschen in Not geholfen werden kann. Trotz allem, geschätzter Bundesrat, denke ich, ist diese Anpassung ein Schritt in eine fairere, in eine menschlichere Richtung. Es ist und wird für meine Fraktion immer wichtig sein, gerade bei dieser sehr sensiblen Thematik gute Lösungen zu finden. Daher werden wir diesem Anpassungsgesetz zustimmen. (Beifall bei der SPÖ.)
14.28
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Ich darf den Pensionistenverband aus Kirchberg in Tirol sehr herzlich bei uns willkommen heißen. Herzlich willkommen! (Allgemeiner Beifall.)
Mir liegen zu diesem Tagesordnungspunkt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall.
Bevor wir zur Abstimmung kommen, möchte ich Ihnen, Frau Kollegin Kerschbaum, sagen: Man kann sich natürlich als Pro-Redner zu Wort melden und dann trotzdem dagegen stimmen, aber es ist natürlich für den Vorsitzenden nicht immer leicht, das dann korrekt zu beobachten. Also ich empfehle jenen, die sich als Pro-Redner zu Wort mel-
den und während der Rede ihre Meinung ändern, das besonders deutlich zu machen, dann funktioniert das Vorwarnsystem beim Vorsitzenden besser. (Heiterkeit bei ÖVP und SPÖ.)
Wir gelangen nun zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist eindeutig die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das EU-Polizeikooperationsgesetz (EU-PolKG) und das Bundesgesetz über die Einrichtung und Organisation des Bundesamts zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung geändert werden (2143 d.B. und 2214 d.B. sowie 8918/BR d.B.)
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Wir gelangen zum 5. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatter ist Herr Bundesrat Temmel. – Bitte um den Bericht.
Berichterstatter Walter Temmel: Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzter Herr Staatssekretär! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich bringe den Bericht des Ausschusses für innere Angelegenheiten über den Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das EU-Polizeikooperationsgesetz (EU-PolKG) und das Bundesgesetz über die Einrichtung und Organisation des Bundesamts zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung geändert werden.
Der Bericht liegt in schriftlicher Form vor; ich komme daher gleich zur Antragstellung.
Der Ausschuss für innere Angelegenheiten stellt nach
Beratung der Vorlage am 3. Ap-
ril 2013 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den
vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Danke für die Berichterstattung.
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Kerschbaum. – Bitte. (Rufe bei der ÖVP: Pro oder Kontra?) – Kontra, ja.
14.30
Bundesrätin Elisabeth Kerschbaum (Grüne, Niederösterreich): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Staatssekretär! Herr Präsident, ich habe es in meiner Rede kurz erwähnt: Ich habe es mir nicht während der Rede überlegt, sondern in Wirklichkeit im Ausschuss.
Bei der vorliegenden Gesetzesänderung stimmen wir nicht deshalb dagegen, weil diese technischen Änderungen prinzipiell das Problem wären, sondern weil das Gesetz an und für sich das Problem ist. Das Schengener Informationsabkommen ist das Problem. Um nicht Gefahr zu laufen, dass, wenn wir jetzt bei einer technischen Änderung zustimmen, dann irgendjemand sagt, die Grünen seien immer dafür gewesen, um also zu verhindern, dass da irgendetwas falsch aufgefasst werden könnte, stimmen wir dieser Novelle nicht zu. – Danke. (Beifall des Bundesrates Schreuder.)
14.31
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Mag. Fürlinger. – Bitte, Herr Kollege.
14.31
Bundesrat Mag. Klaus Fürlinger (ÖVP, Oberösterreich): Hohes Präsidium! Herr Staatssekretär! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Worum es geht, hat der Antrag schon deutlich gemacht.
Zum einen kommt die Politik dem Auftrag nach, verstärkt gegen das Unwesen der Korruption vorzugehen, die Gesetze gegen Korruption zu verschärfen, die Kompetenzen einzelner Behörden im Kampf gegen die Korruption entsprechend zu gestalten und auch zu modernisieren. – Das ist der eine Teil.
Das Zweite ist: Wenn man A zu Schengen sagt, dann muss man auch B zu Schengen sagen, dann kommt Schengen II. Es ist ja nicht so, dass Computersysteme, dass technische Umstellungen nicht einer permanenten Veränderung und Verbesserung bedürfen.
Ich verstehe die Argumentation der Grünen bis zu jenem Punkt, Frau Kollegin, wo Sie sagen: Wir waren immer gegen Schengen, deshalb sind wir auch weiterhin gegen Schengen. Ich verstehe es allerdings nicht ganz, wenn ich an die Worte des Chefermittlers Pilz im Nationalrat denke, der sich aller möglichen Ermittlungsmethoden bedient, ob legal oder nicht legal, um seine politische Agenda durchzusetzen, um andere sozusagen vor ihn selbst, den selbst ernannten Kadi, zu zerren. Da scheint jedes Mittel recht zu sein, es wird keine Unterscheidung gemacht, ob irgendetwas dem Datenschutz unterliegt; mit diesem Argument wird ja immer sehr viel gefuhrwerkt.
Der Herr Chefermittler Pilz sagt: Ich bin zwar Chefermittler, aber ich will keine Ermittlungsmethoden haben. – Das ist an und für sich nicht logisch. Ich weiß auch nicht, wovor sich Herr Pilz und die Grünen fürchten, wenn man im Schengenraum Internationalität haben will. Das ist ja etwas, das sich die Grünen auch auf ihre Fahnen heften. Sie reden von international, multikulturell, davon, dass sie Reisefreiheit haben wollen. Das Problem ist nur, es sind nicht nur die Guten, die reisen, sondern es reisen auch die Bösen, und wenn die Bösen dann reisen, dürften wir sie nicht aufhalten. Wir müssen das aber und können das nur auf diese Art und Weise. (Zwischenruf der Bundesrätin Kerschbaum.) – Frau Kollegin, Sie dürfen sich gerne nach mir noch einmal zu Wort melden, dann werde ich noch einmal sprechen, hin und her, dann werden wir ein bisschen Replik machen, ist ja auch schön. Ich biete Ihnen aber an, dass wir das in einem gepflegten Diskurs zu zweit regeln, wenn Sie das wollen.
Es bleibt nicht logisch, denn die Kriminalität bedient sich all dieser technischen Möglichkeiten, um den Staat und die Ordnungsmacht auszutricksen, daher müssen wir auf dieser Ebene entgegentreten. Wir sind dazu gezwungen, wir haben nicht die freie Wahl der Waffen, wir können nicht nach wie vor mit dem Walkie-Talkie und dem Wählscheibentelefon versuchen, ein paar internationale Verbrecher aufzuhalten. So werden wir keine Chance haben.
Daher, Frau Kollegin, finde ich Ihr Verhalten nicht logisch, denn auch die Grünen sollten meiner Meinung nach – und das hat nichts mit Überwachungsstaat oder Überwachungssystem zu tun – dafür sein, dass internationalem Verbrechen das Handwerk gelegt wird. Das ist etwas, das wir uns wünschen würden, daher laden wir Sie höflich ein, Ihre Kontra-Position noch zu überdenken, und bitten um Annahme des Antrages. (Beifall bei ÖVP und SPÖ sowie des Bundesrates Brückl.)
14.34
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Schweigkofler. – Bitte, Herr Kollege.
14.34
Bundesrat Johann Schweigkofler (SPÖ, Tirol): Herr Präsident! Herr Staatssekretär! Herr Präsident, besten Dank dafür, dass Sie die Gruppe aus Kirchberg in Tirol begrüßt
haben, ich darf sie auch von hier aus noch einmal begrüßen und werde versuchen, keine lange Rede zu halten, um die Pensionisten aus Kirchberg dann durch das Haus führen zu können.
Es wurde schon vorgebracht, was in der Novelle dieses Gesetzes steht. Eine verstärkte Korruptionsbekämpfung wünschen sich nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch wir Politiker, um unseren Ruf wieder um einiges zu verbessern.
Der Straftatbestand Verletzung des Amtsgeheimnisses wird jetzt eine Sache des .BAK, des Bundesamtes zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung.
Im zweiten Teil ist das Schengen-II-Abkommen enthalten. Es werden die Rahmenbedingungen dafür gesetzt, dass das Schengen-II-Abkommen, das SIS II, auch in Österreich umgesetzt werden kann.
Wir Sozialdemokraten stehen dem sehr positiv gegenüber. Auch wenn man mit der Ausarbeitung dieses Gesetzes schon im Jahr 2007 begonnen hat und es zu einer Verteuerung von 20 Millionen auf, wie man liest, 143 Millionen € geführt hat – man fragt sich schon, was so teuer gewesen ist, wenn man vorher nur 20 Millionen € annimmt –, dieses Gesetz ist notwendig, und daher wird die SPÖ zustimmen. – Danke schön. (Beifall bei der SPÖ sowie bei Bundesräten der ÖVP.)
14.36
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Weitere Wortmeldungen dazu liegen mir nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Ich sehe, das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir gelangen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Republik Moldau über die gegenseitige Hilfeleistung bei Naturkatastrophen oder technischen Katastrophen und die Zusammenarbeit bei deren Prävention (2135 d.B. und 2216 d.B. sowie 8919/BR d.B.)
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Wir gelangen zum 6. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatter ist Herr Bundesrat Temmel. – Bitte um den Bericht.
Berichterstatter Walter Temmel: Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzter Herr Staatssekretär! Werte Kolleginnen und Kollegen! Ich bringe den Bericht des Ausschusses für innere Angelegenheiten über den Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Republik Moldau über die gegenseitige Hilfeleistung bei Naturkatastrophen oder technischen Katastrophen und die Zusammenarbeit bei deren Prävention.
Der Bericht liegt in schriftlicher Form vor; ich komme daher gleich zur Antragstellung.
Der Ausschuss für innere Angelegenheiten stellt nach
Beratung der Vorlage am 3. Ap-
ril 2013 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag,
1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben,
2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Ich danke für die Berichterstattung.
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Köberl. – Bitte, Herr Kollege.
14.38
Bundesrat Günther Köberl (ÖVP, Steiermark): Geschätzter Herr Vizepräsident! Herr Staatssekretär! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Werte Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem Land Tirol! Liebe Gäste zu Hause vor den Fernsehgeräten! Mit diesem Abkommen, das unter dem Tagesordnungspunkt 6 die Zusammenarbeit zwischen der Republik Österreich und der Republik Moldau regelt, kommen wir in eine Region Europas, die es wahrlich nicht leicht hat.
Lassen Sie mich zuerst kurz auf das Abkommen selbst eingehen; ich bin überzeugt davon, dass mein Kollege Stefan Schennach noch genauere Details aus der Republik Moldau vorbringen wird!
Worum geht es? – Im Bereich der internationalen Katastrophenhilfe hat Österreich in den letzten Jahren bereits mehrmals Unterstützung für Moldau geleistet. Dies geschah auf dem Weg des Gemeinschaftsverfahrens für den Katastrophenschutz beziehungsweise im Rahmen der NATO-Partnerschaft für den Frieden. Österreich hat mit nahezu allen Nachbarländern, interessanterweise ausgenommen Italien, Abkommen über gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen und schweren Unglücksfällen abgeschlossen. Diese Abkommen haben sich auch in der Vergangenheit schon sehr gut bewährt.
Daher liegt der Abschluss eines derartigen Abkommens auch mit der Republik Moldau im Interesse Österreichs. Das Abkommen regelt im Detail die Zusammenarbeit und freiwilligen Hilfeleistungen bei Naturkatastrophen und technischen Katastrophen, insbesondere durch die Festlegung der Ansprechstellen, weiters die Erleichterung des Grenzübertritts von Personen im Dienste der Katastrophenbekämpfung und die Ein- und Ausfuhr von Hilfsgütern und Ausrüstungsgegenständen.
Konkret heißt das, dass es eine Befreiung vom Erfordernis des Sichtvermerkes oder einer Aufenthaltsgenehmigung während des Einsatzes für betroffene Personen gibt. Es geht um die Regelung von Schadensfällen, den grundsätzlichen Verzicht auf gegenseitige Kostenerstattung sowie die Verstärkung des einschlägigen wissenschaftlichen Informationsaustausches und die Durchführung gemeinsamer Übungen zur Vorbereitung auf den Ernstfall. Es geht weiters um die Festlegung von zuständigen Behörden für die Stellung und die Entgegennahme von Hilfeersuchen, einvernehmliche Festlegung von Art und Umfang der Hilfeleistung, die Koordination der Gesamtleistung der Rettungs- und Hilfsmaßnahmen durch die Behörden des hilfesuchenden Landes und die Regelung der Einsatzkosten.
Eines ist auch wesentlich festgehalten: Das Abkommen legt im Artikel 1 klar, dass Hilfeleistungen beziehungsweise Einsätze im Fall einer Naturkatastrophe seitens österreichischer Kräfte grundsätzlich freiwillig erfolgen. Das bedeutet im Einzelfall, dass das Bundesministerium für Inneres einem Hilfeansuchen der Republik Moldau nur dann entsprechen kann, wenn seitens maßgeblicher Trägerorganisationen – wie zum Beispiel Feuerwehren und deren Verbände, Österreichisches Rotes Kreuz, Arbeiter-Samariter-Bund, Rettungsflugorganisationen oder ähnliche – und der hierfür politisch und rechtlich Verantwortlichen die Bereitschaft zur Erbringung von Hilfeleistungen besteht.
Zweck des Abkommens ist es, wie gesagt, rasch und unbürokratisch Hilfeleistung zu ermöglichen. Einsätze in den Partnerstaaten sollen nicht durch langwierige gegenseitige Abrechnungen nach ihrem Abschluss erschwert beziehungsweise überschattet
werden. Wesentlich im Sinne des Föderalismus ist auch: Für Österreichs staatliche Stellen besteht somit keine rechtliche Möglichkeit, unmittelbar aufgrund dieses Vertrages andere Rechtsträger zur Teilnahme an Hilfseinsätzen zu verpflichten. Dies gilt insbesondere für die Beziehung des Bundes zu den Ländern.
Moldawien, ein kleines Land, das es wahrlich nicht leicht hat – das habe ich schon gesagt. Die österreichischen Exporte in dieses Land betragen rund 33 Millionen, die Importe aus Moldawien rund 20 Millionen €. Wenn man sich die Eckzahlen des Landes anschaut – mit einer Fläche von rund 33 000 Quadratkilometern, rund 3,5 Millionen Einwohnern – und dann ein bisschen hinter die Kulissen schaut, weiß man, dass dieses Land, das am 27. August 1991 von der Sowjetunion unabhängig wurde, in allen Bereichen im hinteren Drittel der sogenannten Ranglisten liegt. Das betrifft das Bruttoinlandsprodukt, das betrifft aber auch den sogenannten Human Development Index.
Im Jahre 2011 hat die Europäische Kommission angekündigt, ein umfangreiches Freihandelsabkommen mit Moldawien abzuschließen. Entsprechende Verhandlungen wurden als Teil des geplanten Assoziierungsabkommens aufgenommen. Die Freihandelsräume sollen der langfristigen politischen Stabilisierung des Landes dienen. Derzeit gilt für Moldawien ein bevorzugter Zugang zum europäischen Markt, wobei natürlich auch die EU der Haupthandelspartner ist.
Moldawien lebt vor allem von der Landwirtschaft sowie von der damit verbundenen Industrie. Früher war es der Wein, der ist es auch heute noch, darüber hinaus werden Obst, Gemüse und kleinere Bereiche von Elektroartikeln exportiert. Die Entwicklung in den letzten Jahren ist aber eine erschreckende. Es war dies eine der wohlhabendsten Regionen der Sowjetrepubliken; seither hat sich wegen des ungelösten Transnistrien-Konflikts – er stammt aus dem Jahr 1992 – die wirtschaftliche Lage drastisch verschlechtert.
2002 betrug das Bruttoinlandsprodukt 1,5 Milliarden €. Der durchschnittliche Monatslohn – und diese Zahlen muss man sich vergegenwärtigen – stieg von 2003 mit 30 € bis zum Jahre 2006 auf 102 € an. Pensionisten bekommen rund 12 € im Monat; man weiß, dass man, um die wichtigsten Lebenshaltungskosten abzudecken, rund 100 € pro Monat benötigt. Moldawien ist eine der ärmsten Regionen Europas. Ein Viertel der Bevölkerung ist in den letzten Jahren abgewandert. Diese Menschen überweisen Geld in ihre Heimat, und diese Summe macht mehr als das jährliche Bruttoinlandsprodukt des Staates aus.
Wenn wir mit diesem Abkommen ein Stück dazu beitragen, dass man diesem Land und seinen Menschen ein Stück weiter auf dem Weg nach Europa hilft, dann lade ich Sie alle zu Ihrer Zustimmung ein. – Danke. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
14.45
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Als Nächster gelangt Herr Bundesrat Schennach zu Wort. – Bitte, Herr Kollege.
14.46
Bundesrat Stefan Schennach (SPÖ, Wien): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geschätzter Herr Staatssekretär! Moldawien ist jetzt in einem ganz netten Rhythmus hier bei uns im Bundesrat. Ich glaube, es ist heute das dritte Mal, dass wir über Moldawien sprechen.
Das ist ein gegenseitiges Abkommen über Naturkatastrophen; in Wirklichkeit ist die Katastrophe in Moldawien Tag für Tag. Moldawien ist das Armenhaus in Europa. 12 Prozent der Kinder haben keine Eltern, weil die Eltern aufgrund der Armut gezwungen sind, das Land wie auch immer zu verlassen. Deshalb haben wir eine ganz besonders hohe Rate an Kindesmissbrauch, an Kinderhandel – erst jüngst ein Bericht über Or-
ganhandel, das heißt, wo man Kinder als lebende Schlachtbanken nimmt –, Vernachlässigung, und natürlich sind Kinder, die keine Eltern haben, die auf der Straße leben – diese Straßen sind nicht geteert und asphaltiert –, Opfer der organisierten Kriminalität.
Insofern ist es zu Recht, dass Österreich einen seiner zwei Sozialattachés, die das Land ausgesandt hat, nach Moldawien geschickt hat. Moldawien ist das letzte verbliebene Land innerhalb Europas, wo Österreich Entwicklungszusammenarbeit leistet, und das ist richtig!
Wenn heute in Moldawien 32 Prozent der Kinder zwischen 5 und 14 Jahren arbeiten, aber nicht ein bisschen mitarbeiten, sondern arbeiten full, kommt jetzt die nächste Zahl, die mich immer wieder erschüttert – und ich kenne das Land wirklich sehr gut –: Fast 20 Prozent der Kinder sind verheiratet worden! Es geht hier um Mädchen, nicht um Knaben. Erst jüngst hat man rund um den Besuch der Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel erhoben, dass zum Beispiel 25 Prozent der Kinder aufgrund dieses Gewaltpotenzials, das in der Gesellschaft aufgrund von Armut und Verwahrlosung vorhanden ist, es völlig in Ordnung finden, dass Männer in der Ehe mit Gewalt gegenüber Frauen und Kindern regieren.
In diesem Zusammenhang finde ich es auch richtig, dass Österreich im Rahmen der Donauraumstrategie der EU entschieden hat, die Human Capacity, das Humankapital in Moldawien zu stärken. Auch EU-Kommissionspräsident Barroso war jetzt dort. Es ist nicht das Ende Europas, sondern wenn wir nichts tun, dann hat Europa dort ein Ende gefunden. Die Verschärfung kam natürlich – Kollege Köberl hat es gesagt: es ist ein relativer Wohlstand gewesen in Zeiten der Sowjetunion, ein stolzes Fürstentum, das auch in der Sowjetunion eine klare Zuordnung hatte – mit dem EU-Beitritt der Rumänen, da ist alles zugegangen an Grenzen. Und die, die sich als wirkliche Rumänen empfinden, sind dort quasi die Südtiroler, das sind die christlichen Türken, genannt Gagausen, die nahezu einen Südtirol-Status an Autonomie und Unabhängigkeit haben.
Ansonsten ist in einer Gesellschaft, in der es auch tatsächliche Flutkatastrophen gibt – daran möchte ich schon erinnern, dass es zum Beispiel im Jahre 2010 ganz extreme Überschwemmungen gab –, durch diese Überschwemmungen kaum Trinkwasser da.
Es gibt einen Österreicher, den ich in dem Zusammenhang natürlich auch hervorheben möchte – Sie kennen den Namen alle –: Pater Sporschill, der versucht, diese Kinder, diese marodierenden Kinder – die dazu ja gezwungen werden – eben irgendwie in Kinderzentren unterzubringen, was aber sehr schwer ist. Aber da wiederum der Dank an den Sozialattaché, der die Hälfte seiner Zeit nicht im Büro verbringt, sondern hier wirklich mitarbeitet!
Ein Dank geht jetzt aber auch zum Beispiel an das SMZ-Ost, das Wiener Spital. Das SMZ-Ost übergab vor Kurzem Betten für eine Intensivstation – denn dort gibt es nicht Betten, sondern es liegt nur Stroh auf dem Boden –, es gab Untersuchungsliegen, Inkubatoren für Babys, Ultraschallgerät, Bekleidung für medizinisches Personal. Aber jetzt kommt es: Wenn einmal ein Mediziner in Moldawien war, dann wird er einen Eindruck nicht mehr los, nämlich den, dass die medizinische Wäsche, das Verbandszeug irgendwie in einem Pott außen gewaschen wird. Das SMZ-Ost übergab eine industrielle Waschanlage! Es ist nicht notwendig für ein Wiener Spital, das zu tun, aber es zeigt, dass das etwas ist, was von unermesslichem Wert ist.
Deshalb sage ich nur: ja, für Naturkatastrophen – wir hoffen, dass Moldawien lange keine Naturkatastrophe hat –, aber die Katastrophe ist täglich in diesem Land, und es ist gut, dass wir das unterzeichnen und dass wir Moldawien im europäischen Einigungsprozess nicht vergessen. – Danke. (Beifall bei SPÖ, ÖVP und Grünen.)
14.51
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Weitere Wortmeldungen dazu liegen mir nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Ich sehe, das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir gelangen zur Abstimmung.
Da der gegenständliche Beschluss Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbereiches der Länder regelt, bedarf dieser der Zustimmung des Bundesrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz.
Wir gelangen daher zunächst zur Abstimmung darüber, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist somit angenommen.
Ich lasse nun über den Antrag abstimmen, dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
Ich ersuche abermals jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, um ein Handzeichen. – Das ist wieder die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit angenommen.
Bericht der Bundesministerin für Inneres an das österreichische Parlament zum Legislativ- und Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für 2013; Achtzehnmonatsprogramm des irischen, litauischen und griechischen Vorsitzes des Rates der Europäischen Union (III-480-BR/2013 d.B. sowie 8920/BR d.B.)
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Wir gelangen zum 7. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatter ist Herr Bundesrat Temmel. Bitte um den Bericht.
Berichterstatter Walter Temmel: Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzter Herr Staatssekretär! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich bringe Ihnen den Bericht des Ausschusses für innere Angelegenheiten über den Bericht der Bundesministerin für Inneres an das österreichische Parlament zum Legislativ- und Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für 2013; Achtzehnmonatsprogramm des irischen, litauischen und griechischen Vorsitzes des Rates der Europäischen Union.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor; ich komme deshalb gleich zur Antragstellung.
Der Ausschuss für innere Angelegenheiten stellt nach Beratung der Vorlage am 3. April 2013 den Antrag, den Bericht der Bundesministerin für Inneres an das österreichische Parlament zum Legislativ- und Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für 2013; Achtzehnmonatsprogramm des irischen, litauischen und griechischen Vorsitzes des Rates der Europäischen Union zur Kenntnis zu nehmen.
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Krusche. – Bitte, Herr Kollege.
14.54
Bundesrat Gerd Krusche (FPÖ, Steiermark): Herr Präsident! Herr Staatssekretär! Meine Damen und Herren! Werte Zuseher! Dieses Programm hat durchaus positive
Ansätze, beispielsweise die Reduzierung der Schusswaffenkriminalität, das Schengen-Informationssystem – das wir sehr wohl unterstützen und wofür wir ja heute bereits die gesetzlichen Voraussetzungen beschlossen haben –, Drogenstrategie, Kampf gegen Cyber-Kriminalität, gegen Menschenhandel. Das alles sind durchaus begrüßenswerte Vorhaben.
Kritischer sehen wir gewisse andere Punkte wie beispielsweise Visa-Erleichterungen und -Liberalisierungen, vor allem, weil davon auch Staaten wie Russland und Georgien betroffen sind, die ja doch nicht als unproblematisch anzusehen sind, was illegale Zuwanderung und auch organisierte Kriminalität betrifft. Auch die Frage der gemeinsamen Integrationspolitik ist grundsätzlich ob ihrer Sinnhaftigkeit zu hinterfragen: ob es nicht doch klüger ist, Integrationspolitik auf nationaler Ebene zu betreiben, und ob hier eine gesamteuropäische Integrationspolitik wirklich die regionalen bevölkerungspolitischen, sozialpolitischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten entsprechend berücksichtigen kann.
Auch die Frage des gemeinsamen Asylrechtes ist zwar ein großes Vorhaben, aber auch da ist Vorsicht geboten. Führt es schlussendlich zu einer gerechteren Verteilung und damit auch zu einer Entlastung Österreichs – was ich ja heute bereits einmal angesprochen habe –, wäre es zu befürworten. Sollte es aber eine generelle Aufweichung zur Folge haben, dann stehen wir dem natürlich schon kritischer gegenüber.
Allerdings gibt es hier auch Punkte, die ich eigentlich mehr oder weniger als blanken Hohn empfinde, und zwar auch den Punkt betreffend Solidarität zwischen den EU-Mitgliedstaaten im Asylbereich, sogenannte Intra-EU-Solidarität. Hier steht wörtlich im Vorhabensbericht: „Ziel ist es, die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten der EU im Asylbereich zu stärken und gleichzeitig sicherzustellen, dass Menschen, die auf Schutz angewiesen sind, diesen auch tatsächlich erhalten.“
So weit, so gut; dagegen wäre ja nichts einzuwenden. Aber Präsident Siso hat es heute bereits erwähnt: Die Solidarität innerhalb der EU-Länder ist eine ganz, ganz wesentliche Säule, aber in Wirklichkeit sieht es im Konkreten ganz anders aus, wenn sich nämlich einzelne Staaten ihrer Verantwortung einfach entledigen. Kollege Perhab hat es vor drei Tagesordnungspunkten bereits angesprochen, am Beispiel Italiens, das seit 1. März nur noch unbegleitete Minderjährige, Behinderte, Senioren, alleinstehende Schwangere und Elternteile, Folteropfer und Opfer von Gewalt in den Betreuungszentren behält.
Was heißt das? – Das heißt, dass alle Übrigen einen Fremdenpass ausgehändigt oder einen Schengen-wirksamen Aufenthaltstitel bekommen, plus 500 € bar auf die Hand, und dann heißt es: Jetzt macht ihr, was ihr wollt! Es werden meistens nicht einmal Fingerabdrücke von diesen Personen genommen. Diese kommen dann eben zu einem Gutteil auch nach Österreich, nach Deutschland. Nicht umsonst haben wir ja wegen dieser Italienroute das bekannte Marokkaner-Problem in Innsbruck, und durch solche Maßnahmen wird das mit Sicherheit nicht verbessert werden.
Meine Damen und Herren! Wir verstehen unter Solidarität etwas anderes, nämlich Maßnahmen gegen solche Staaten, die eben überhaupt nicht solidarisch sind, sondern einfach die Verantwortung planlos auf andere überwälzen. Hier wäre es wahrscheinlich gut, wenn in diesem Papier etwas darüber stünde: Was macht man mit solchen Staaten, die sich nicht solidarisch verhalten?
Auch ein anderer Punkt ist noch zu erwähnen: das viel zitierte Dublin-II-Abkommen, das auch in diesem Papier wieder zitiert wird. Da fehlt es auch an konkreten Maßnahmen zu einer konsequenten Umsetzung.
Ich habe bereits einmal gesagt, 90 Prozent der österreichischen Asylwerber kommen laut dem sozusagen Chef von Traiskirchen aus sicheren Drittstaaten. Aber wenn sich
Länder wie beispielsweise Griechenland, das bekannterweise ein Mitverfasser dieses Papiers ist, so verhalten, dass Asylwerber, die über Griechenland in die Europäische Union einreisen, gemäß Dublin-II-Abkommen nicht nach Griechenland zurückgeschickt werden können, weil Griechenland keine menschenwürdigen Unterkünfte zur Verfügung stellt, so ist das auch ein ganz klarer Mangel an Solidarität und ein Abwälzen von Verantwortung.
Wir würden uns daher bei solchen Vorhabensberichten und Programmen mehr konkrete Maßnahmen und konsequente Umsetzung und weniger hohle Phrasen, leere Worthülsen und groß angekündigte Projekte wünschen.
Wir werden daher diesem Bericht unsere Zustimmung verweigern. (Beifall bei der FPÖ.)
15.00
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Als Nächste zu Wort gelangt Frau Bundesrätin Dr. Winzig. – Bitte, Frau Kollegin.
15.01
Bundesrätin Dr. Angelika Winzig (ÖVP, Oberösterreich): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Staatssekretär! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Im Gegensatz zum Kollegen Krusche finde ich, dass es sich hier um ein sehr ambitioniertes Arbeitsprogramm der Kommission und des Rates handelt. (Bundesrat Krusche: Ambitioniert schon!) Sie sprechen von Worthülsen und leeren Phrasen. Das finde ich nicht. Sie haben allerdings in die Vorlagen, die in diesem Jahr erst vorgelegt werden und die Sie noch gar nicht kennen, schon Ihre negative Interpretation hineingebracht.
Das Programm ist umfangreich. Es geht um den Schutz der Außengrenzen, die Steuerung der legalen Migration, Asyl, Bekämpfung der illegalen Migration, die innere Sicherheit, Cyber-Kriminalität, Drogenkriminalität, die Sie angesprochen haben, die organisierte Kriminalität, Terrorismusbekämpfung und Zivilschutzmaßnahmen.
Einige Richtlinien sind uns ja aus dem EU-Ausschuss bekannt. Wir haben ja gegen einige Vorlagen schon eine Mitteilung verfasst beziehungsweise eine Rüge weitergeleitet.
Ich möchte nur eine Maßnahme aus diesem Arbeitsprogramm erwähnen, weil Kollege Schreuder heute schon darüber gesprochen hat, im Bereich Sicherheit moderner zu werden. Ich glaube, die Smart-Borders-Initiative ist ein modernes Grenzmanagement, man muss ja bedenken, dass jährlich 700 Millionen Europäer und Drittstaatenangehörige die Außengrenzen überschreiten und dass sich diese Zahl in Zukunft laut EUROCONTROL wahrscheinlich verdoppeln wird.
Im Jahr 2009 hatten wir 400 Millionen Grenzübertritte auf europäischen Flughäfen, und man rechnet damit, dass es 720 Millionen sein werden.
Diese Initiative umfasst einerseits die Registrierung der Daten bei der Ein- und Ausreise von Drittstaatenangehörigen, andererseits wird es aber auch Erleichterungen geben, wenn sich die Reisenden beim Grenzübertritt registrieren lassen. Dieses Instrument wird für die Bekämpfung der illegalen Aufenthalte sicherlich nützlich sein.
Ich möchte aus aktuellem Anlass noch ganz kurz eine nicht-legislative Maßnahme anschneiden, weil ich selber schockiert war, dass es Menschenhandel auch bei uns noch vor der Haustür gibt; wir haben das im Innviertel mit dem Bordellfall gesehen. Die Bekämpfung von Menschenhandel ist auch eine Priorität der Triopräsidentschaft. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Es ist natürlich auch eine Priorität des Bundesministerium für Inneres.
Dank der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in diesem Fall konnten die Täter gefasst werden. Ich denke, es ist wichtig, gerade in diesem Bereich auf europäischer Ebene zusammenzuarbeiten.
Österreich ist eines der sichersten Länder der Welt, und wir haben auch den Anspruch, dass dieses hohe Niveau auch auf europäischer Ebene umgesetzt wird. Und ich bin der Meinung, dass das Bundesministerium für Inneres ein Garant dafür ist. (Beifall bei der ÖVP und bei Bundesräten der SPÖ.)
15.04
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Bundesrat Schennach. – Bitte, Herr Kollege.
15.04
Bundesrat Stefan Schennach (SPÖ, Wien): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geschätzter Herr Staatssekretär! Liebe Kollegen und Kolleginnen! Es ist ein ambitioniertes Programm im Bereich des Inneren, was ja keine an sich delegierte Rechtsakte ist, sondern in Form der intensiven Zusammenarbeit erfolgt. Das ist gut so.
Wir haben ja aus datenschutzrechtlichen Gründen und aus den bürgerlichen Grundrechten heraus immer davor gewarnt, und die Fluggastdaten werden auf Vorschlag der Kommission zurückgezogen. Das ist ein wichtiger Punkt, den man hier ganz besonders hervorheben muss.
Etwas ist ganz wichtig, Frau Kollegin Dr. Winzig hat das auch gesagt: Wir brauchen die Mobilität. Wir brauchen sie kulturell, wir brauchen sie im Rahmen der Wissenschaft und Forschung und nicht zuletzt auch im Rahmen des wirtschaftlichen Austauschprozesses. Im Jahr 2011 haben Reisende in Europa 271 Milliarden € ausgegeben. Das ist ja unglaublich. Und wir nehmen jetzt an, dass es aufgrund der Maßnahmen, die die Europäische Union da mit Visa-Erleichterungen und so weiter vorsieht, zu einer Verdoppelung kommen wird. Das ist doch etwas Erfreuliches. In Europa leben heißt auch, in Europa in Bewegung zu sein.
Etwas, was zu überprüfen ist, Herr Staatssekretär – das haben wir auch gestern im EU-Ausschuss sehr ausführlich besprochen –, ist das Smart-Borders-System. Das schaffen nicht einmal die USA, wenn Sie in New York einreisen, sich zwei Monate in den USA aufhalten und dann über San Francisco ausreisen. Ich würde sagen, das ist kein hundertprozentiges System, dass die wissen, wo Sie sind.
In den drei Monaten der Gültigkeit des Visums zu beobachten, wo sich ein Schengen-Visum-Tourist oder -Wirtschaftstreibender bewegt und wieder ausreist, dazu muss ich sagen, im Augenblick schaut das nach unheimlichen Kosten aus. Die richtige Balance scheint mir nicht gegeben zu sein.
Ja, wir brauchen natürlich ein effizientes Grenzsystem, aber ich habe im Ausschuss auch erzählt, dass ein Konzernchef aus der Türkei, der in Österreich einen Firmenstandort eröffnen möchte und viel Geld bringt, sechs Wochen auf ein Visum warten muss. Das ist absurd. Eine international anerkannte Persönlichkeit! – Durch die Registrierung könnte man da, wie Frau Winzig auch gesagt hat, einiges erleichtern.
Verbesserungen im Asylrecht – jetzt komme ich ganz kurz zur Vorrede zurück –: Griechenland wird vorgeworfen, mangelnde Solidarität zu zeigen. Wissen Sie, wie viele Asylsuchende sich derzeit in Griechenland aufhalten? – Über 50 000! Wie viele haben wir? (Präsident Mayer übernimmt wieder den Vorsitz.)
Wissen Sie, dass das Sozialsystem, das Behördensystem in Griechenland zusammengebrochen ist? Wissen Sie, dass diese Menschen hausen und von rechtsradikalen Organisationen pogromartig verfolgt und sogar zum Teil erschlagen werden? Dass es
mittlerweile ein Massengrab für anonyme, unbekannte Asylsuchende in Griechenland gibt, von rechtsradikalen Schlägerbanden Ermordete?
Nicht das Dublin-II-Abkommen besagt, die dürfen nicht nach Griechenland, sondern der Europäische Menschenrechtsgerichtshof hat gesagt, bei jedem Asylsuchenden, der in das Drittland Griechenland zurückkommt, macht sich der Staat schuldig, der ihn zurückschickt. Er hat auch Österreich gesagt, ihr macht euch schuldig – und deshalb tun wir es nicht. (Beifall bei der SPÖ.)
Griechenland braucht unsere Solidarität. Griechenland braucht unsere europäische Solidarität, um diesen unglaublichen Flüchtlingsansturm zu bewältigen, so wie wir gegenüber Spanien solidarisch waren, wie wir gegenüber Italien im Fall Lampedusa auf europäischer Ebene solidarisch waren.
Wenn hier gesagt wird, dass die Griechen unfair sind, weil sie Asylsuchende nicht zurücknehmen, muss ich sagen: Es ist jedem europäischen Staat verboten, Asylsuchende nach Griechenland zurückzuschicken. Das ist die Realität. (Bundesrat Krusche: Habe ich eh gesagt!)
Nun noch zu dem Inhalt, den Sie ablehnen – Sie lehnen ja die Vorschau ab. Es geht um die effiziente Bekämpfung des Menschenhandels. Es geht um die Bekämpfung des Terrorismus. Es geht um Kriminalprävention. – Hey, Leute, die FPÖ lehnt all das ab! Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. (Bundesrat Krusche: Sie haben nicht zugehört!) Sie lehnt das einfach ab. (Bundesrat Krusche: Es war einiges positiv, aber es ist nicht alles positiv!)
Ich habe mich ja heute über diese christliche Debatte gewundert und darüber, dass die FPÖ fast eine Ministranten-Partei geworden ist, und dann wird hier gesagt: Georgien ist etwas Verdächtiges! Bei Georgien müssen wir aufpassen! – Das sind die zwei letzten christlichen Länder in dieser Region. Aber okay, ist etwas Verdächtiges.
Es geht um Erleichterungen auch mit Moldawien (neuerlicher Zwischenruf des Bundesrates Krusche), Montenegro, Mazedonien, Georgien, Albanien – alles Nachbarn von uns, alle mit einer großen Beziehung zu Österreich, wie Bosnien, wie Serbien. Und es ist gut so, denn Europa ist nicht 27 und acht, sondern Europa ist ein bisschen größer. Und in Europa sollten wir es einfach den jungen Menschen ein bisschen mehr ermöglichen, zusammenzukommen.
Wir haben im Rahmen des EU-Ausschusses des Bundesrates die Saisonnier-Richtlinie abgelehnt, indem wir eine gelbe Karte gezeigt haben, eine begründete Mitteilung gemacht haben, und diese Richtlinie soll in diesem Jahr – und deshalb ist das wahrscheinlich auch für unseren EU-Ausschuss wichtig – adaptiert werden. Es gibt eine begründete Mitteilung des Bundesrates, deshalb werden wir darauf auch besonderes Augenmerk legen.
Ein weiterer Einspruch kam ja seitens des Bundesrates, was die Katastrophenschutzrichtlinie betrifft, im Sinne aller unserer Bundesländer. Dieser wurden zwar schon die Giftzähne gezogen – die Kommissarin war ja hier bei uns –, aber auch sie wird in diesem Jahr umgesetzt. Und auch darauf werden wir besonders schauen.
Aber es ist ein ambitioniertes und ein gutes Programm, das die Europäische Union da vorhat. – Danke. (Beifall bei SPÖ, ÖVP und Grünen.)
15.11
Präsident Edgar Mayer: Als Nächste zu Wort gelangt Frau Bundesrätin Kerschbaum. – Bitte.
15.11
Bundesrätin Elisabeth Kerschbaum (Grüne, Niederösterreich): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Staatssekretär! Sehr geehrte Damen und Herren! Wir werden den Be-
richt zur Kenntnis nehmen, auch wenn wir ihm nicht in allen Punkten zustimmen. Das ist unsere Auffassung. Ein Bericht, der vorgelegt wird, wird zuerst einmal überprüft, ob er vollständig ist. – Vollständig ist er. Dann nehmen wir ihn gerne zur Kenntnis. Dass wir inhaltlich nicht immer zustimmen können, ist klar und logisch, und es wäre eigentlich auch traurig, wenn wir uns inhaltlich in so vielen Punkten komplett einig wären.
Ich möchte nur auf ein paar Bereiche eingehen, sie wurden heute zum Teil schon angesprochen. Und weil ich vorhin das Match mit dem Kollegen Fürlinger nicht fertig ausgespielt habe, mache ich das zu diesem Zeitpunkt: Unser Problem mit dem Schengener Informationsabkommen ist, dass jeder Einreisende aus einem Drittstaat mehr oder weniger als Verbrecher vorverdächtigt wird. (Zwischenruf bei der ÖVP.) – Man kann es so ausdrücken.
Man muss einmal seine Fingerabdrücke abgeben, und dann muss regelmäßig verfolgbar sein, wo man sich aufhält. Und dass nachträglich noch bei irgendwelchen Tatorten aufgefundene Fingerabdrücke mit jenen der Einreisenden aus den Drittstaaten abgeglichen werden können, zeugt schon ein bisschen von diesem Vorverdacht. Und diesen finde ich nicht gerechtfertigt.
Verbrechen passieren im Schengen-Raum, keine Frage, aber die Täter sind nicht immer nur die Leute, die aus Drittstaaten hereinkommen. Es muss ja auch nicht jeder Österreicher und jeder Deutsche seine Fingerabdrücke abgeben, um dann, wenn irgendwo ein Verbrechen passiert, feststellen zu können, ob er das war, sondern es ist das eine Ausnahmeregelung. Verdächtig sind einmal diejenigen, die aus einem Drittstaat kommen.
Das ist unser Hauptproblem. Und dass es in diesem Zusammenhang auch Datenschutzprobleme gibt, ist, glaube ich, prinzipiell einsichtig – vielleicht auch für Sie.
Ein weiteres Problem, das wir mit dem Inhalt des Berichts haben, betrifft die Smart-Borders-Initiative. Wir haben das im EU-Ausschuss behandelt, und da waren wir uns ziemlich einig darin, dass das vielleicht doch etwas überschießend ist. Wenn wir wirklich jeden Einreisenden vorher erfassen und dann jeweils überprüfen müssen, wo er sich aufhält und wo er wie ausreist, kann und wird auch wieder zu Datenschutzproblemen führen. Auf der anderen Seite wird das auch teuer werden. Und ich denke, dass wir in der Europäischen Union sicher andere Probleme haben, als wissen zu müssen, wer einreist und wer wieder ausreist. Die Verhältnismäßigkeit ist da offensichtlich nicht gegeben, und ich denke, diesbezüglich wird es noch einige Diskussionen geben.
Ein weiteres Problem, das wir mit dem Inhalt des Berichts haben, betrifft Eurosur, eine Überwachung der EU-Außengrenze mit Kameras et cetera. Auch da stellt sich wieder die Frage nach der Verhältnismäßigkeit und ob der Datenschutz gewährleistet ist.
Es gibt in diesem Bericht überraschenderweise aber auch Punkte, die wir positiv hervorheben wollen, wo wir sehen, dass es schon sehr sinnvoll ist, dass man da weitermacht: Das eine ist die Zulassung von Drittstaatenangehörigen zu Forschung und Studium. Es gibt künftig eine Europäische Agenda für Integration. Ich hoffe, das ist dann nicht nur ein Schlagwort, sondern es wird auch wirklich um Integration gehen.
Positiv zu vermerken ist auch, dass auch unser Innenministerium die Fluggastdatenerfassung eher nicht so positiv sieht, sprich ablehnt. Denn prinzipiell sind auch wir der Meinung, dass das nicht notwendig ist.
Stefan Schennach hat schon sehr ausführlich berichtet, dass wir die Solidarität der Mitgliedstaaten untereinander stärken müssen, was das Asylwesen betrifft. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es sollte nicht so sein, dass es nur um Kosten geht, sondern auch um eine wirklich faire Aufteilung.
Nicht jeder Staat hat eine EU-Außengrenze, und deshalb kann ich es absolut nicht nachvollziehen, wenn man da jetzt Griechenland einen großen Vorwurf macht. Prinzipiell hat Griechenland viele, viele, viele Probleme, und wir können froh und glücklich sein, in Österreich zu wohnen und nicht in Griechenland. Wir wissen auch, dass Griechenland eine Außengrenze hat, über die sehr viele hereinkommen. Wir haben keine Außengrenze nicht mehr. (Bundesrätin Mühlwerth: Das ist ja nicht vom Himmel gefallen in Griechenland!)
Die Frage ist: Was bedeutet Solidarität? Ist dieses Abkommen, dass die Leute nur an der Außengrenze abgefangen werden und dort untergebracht werden müssen, solidarisch? – Meiner Meinung nach nicht. Darüber einmal nachzudenken, das wäre wirklich sinnvoll.
Begrüßenswert ist nicht zuletzt auch, dass die Bekämpfung des Menschenhandels als Schwerpunkt der Tätigkeit der Präsidentschaft gesehen wird.
Also prinzipiell gibt es Für und Wider, was den Inhalt dieses Berichts betrifft. Positiv hervorheben möchte ich, dass wirklich zu jedem Punkt eine österreichische Position vermerkt ist. Man kann über die Positionen streiten, aber es gibt sie, und das ist eigentlich das, was solch ein Bericht unserer Meinung nach bieten soll. Er soll eine Darstellung dessen sein, was geplant und was die österreichische Position dazu ist.
Da das jetzt wirklich meine letzte Rede hier im Bundesrat ist, möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken, insbesondere bei meinen Kollegen hier auf der rechten Seite, bei Efi und bei Marco, aber auch bei Stefan, der jetzt nicht im Saal ist, der mich viele, viele Jahre lang begleitet hat und neben mir gesessen ist. Ich möchte mich aber auch bei dir, Herr Präsident, bedanken und bei allen anderen Kolleginnen und Kollegen, denn es ist nicht so selbstverständlich, dass wir hier in diesem Gremium ein hohes Maß an Wertschätzung füreinander pflegen, dass wir respektvoll miteinander umgehen. Du hast es heute schon gesagt: Natürlich haben wir inhaltlich viele verschiedene Meinungen und tragen diese manchmal auch etwas bissiger aus, aber beim Hinausgehen können wir einander noch in die Augen schauen, einander grüßen und ein gutes Heimkommen wünschen. Und das habe ich an diesem Gremium wirklich sehr zu schätzen gelernt. (Allgemeiner Beifall.)
Ich schätze auch, dass wir uns in den letzten ein, zwei Jahren diese EU-Themen wirklich intensiver vornehmen – ich wiederhole das schon längere Zeit gebetsmühlenartig –, dass wir intensiv darüber diskutieren, dass wir auch über Themen wie Atomkraft – ich weiß, es sind nicht alle so wie ich an diesem Thema interessiert – und regionale Themen wie meine Wassergeschichte in Korneuburg und ähnliches diskutieren. Das ist nicht selbstverständlich. Ich weiß es zu schätzen, dass ihr das gemacht habt, und ich weiß auch zu schätzen, dass es in einem EU-Ausschuss bei uns offene Diskussionen gibt und dass man auch über Themen redet, die vielleicht von einer Minderheit eingebracht werden, die nicht wirklich das Recht hat, einen Vorschlag zu machen, aber trotzdem gehört wird.
Ich war zehn Jahre lang hier im Bundesrat. Ich habe es nicht vorgehabt und ich habe auch nicht die Welt verändert, und ich habe auch nicht den Bundesrat verändert, aber ich denke, dass ich doch ein steter Tropfen war, der manchen Stein nicht unbedingt gehöhlt, aber zumindest ein bisschen angegriffen und zum Nachdenken angeregt hat.
Ich werde die Politik sicher nicht ganz aufgeben, das schaffe ich sowieso nicht. Ich bin ein politischer Mensch und ich werde weiter darüber reden.
Ich danke euch! Ihr werdet mir fehlen! (Anhaltender allgemeiner Beifall.)
15.19
Präsident Edgar Mayer: Liebe Elisabeth Kerschbaum! Ich darf mich auch im Namen des Bundesrates recht herzlich für deinen Einsatz und für dein Engagement bedanken.
Du warst manchmal auch nicht einfach oder nett zu uns, sagen wir es einmal so. (Heiterkeit. – Bundesrätin Kerschbaum: Danke!) Die Diskussion hat auf jeden Fall immer gezeigt, dass du die grüne Idee mit allem, was du hattest, verteidigt hast und für sie eingetreten bist. Das ist, denke ich, auch das Wichtigste, was ein Bundesrat oder eine Bundesrätin zu machen hat.
Du warst auch im EU-Ausschuss eine wirklich sehr, sehr engagierte und fleißige Vertreterin der europäischen Idee. Dafür und insgesamt für deine großartige Dienstleistung einen herzlichen Dank und weiterhin alles Gute. Danke schön. (Allgemeiner Beifall.)
Weitere Wortmeldungen dazu liegen nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir kommen nun zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, den gegenständlichen Bericht zur Kenntnis zu nehmen, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Bevor wir nun zum 8. Punkt der Tagesordnung kommen, begrüße ich sehr herzlich Herrn Staatssekretär Dr. Josef Ostermayer. Herzlich willkommen im Bundesrat, Herr Staatssekretär! (Allgemeiner Beifall.)
Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Datenschutzgesetz 2000 geändert wird (DSG-Novelle 2013) (2131 d.B. und 2245 d.B. sowie 8940/BR d.B.)
Präsident Edgar Mayer: Wir kommen nun zum 8. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatter ist Herr Bundesrat Saller. Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatter Josef Saller: Herr Präsident! Herr Staatssekretär! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich bringe den Bericht des Ausschusses für Verfassung und Föderalismus über den Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Datenschutzgesetz 2000 geändert wird.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher gleich zur Antragsstellung.
Der Ausschuss für Verfassung und Föderalismus stellt nach Beratung der Vorlage am 3. April 2013 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Präsident Edgar Mayer: Ich danke für den Bericht.
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat Schreuder. – Bitte, Herr Kollege.
15.22
Bundesrat Marco Schreuder (Grüne, Wien): Herr Präsident! Jetzt hast du es mir echt schwer gemacht, Elisabeth. Ja, du bist nicht die Einzige mit Tränen in den Augen, aber ich werde jetzt trotzdem versuchen, über die Datenschutzgesetz-Novelle zu sprechen. Vielleicht nur einen Satz, weil du dich bedankt hast: Auch von unserer Seite her vielen, vielen lieben Dank.
Der Datenschutzgesetz-Novelle werden wir nicht zustimmen. Ich glaube, das ist allgemein bekannt und ist auch in vielen Ausschüssen und im Nationalrat bereits disku-
tiert worden. Die Basis dieser Novelle, der Datenschutzgesetz-Novelle, ist ja ein Urteil des EuGH, nach dem die Datenschutzkommission zu wenig unabhängig sei.
Das ist prinzipiell gut so, und prinzipiell ist es auch gut, wenn dafür gesorgt wird, dass die Datenschutzkommission weisungsfrei und unabhängig ist, also muss man das reparieren. Das liegt eben heute vor, allerdings hätte man das aus unserer Sicht nicht mit einem einfachen Gesetz machen können, sondern nur mit einer Änderung der Verfassung.
Warum sind wir dieser Auffassung? – Das Unterrichtungsrecht gegenüber unabhängigen Behörden, also in dem Fall seitens des Bundeskanzleramtes beziehungsweise des Herrn Bundeskanzlers, ist in der Verfassung geregelt. Und damals schon, als es 2007 ein Verfassungsgesetz wurde, haben wir nicht zugestimmt, weil wir natürlich auch damals schon das Spannungsverhältnis zwischen der Unabhängigkeit einer Behörde und der Informationspflicht gesehen haben. Das jetzt hier einfachgesetzlich zu regeln widerspricht aus unserer Sicht der damaligen Verfassungsbestimmung aus dem Jahr 2007. Wir halten daher dieses Gesetz für nicht verfassungskonform und würden eine saubere Lösung bevorzugen, das heißt, mittels Zweidrittelmehrheit.
Ich weiß schon, dass es da zwei unterschiedliche juristische Ansichten zwischen Ihrem Haus und uns gibt (Staatssekretär Dr. Ostermayer: Genau!), aber das ist nun einmal so, klären wird das möglicherweise am Ende der VfGH.
Schade nur, dass es nicht per Zweidrittelmehrheit verhandelt worden ist und wir auch eine Verfassungsänderung hätten machen können. Natürlich hätten wir da auch etwas verhandelt, das ist ja immer die Quintessenz von Zweidrittelmaterien; in dem Fall wäre aus unserer Sicht auch eine Verstärkung der Ressourcen der Datenschutzkommission mit zu klären gewesen, die ja immer knapp am Limit arbeiten muss.
Wie auch immer, es ist ja ohnehin nicht das letzte Mal, dass wir über den Datenschutz diskutieren werden, dieses Thema begleitet den Bundesrat ja schon seit Langem, aber allem voran kommt nun auch eine neue Datenschutzverordnung seitens der Europäischen Union – vermutlich eine Verordnung. Was wir momentan in Brüssel erleben, ist natürlich schon auch interessant. Also wie hat das Max Schrems in einem Gastkommentar geschrieben? – Es ist der Krieg der Lobbyisten, der da bezüglich der Datenschutzverordnung gerade in Brüssel ausgebrochen ist.
Man konzentriert sich natürlich immer, wenn man über den Datenschutz spricht, auf so Fragen wie: Welche Daten sammelt Google, welche Daten sammelt Facebook? Das ist auch eine berechtigte und richtige Diskussion, allerdings sind es ja nicht nur die großen Konzerne, die Daten sammeln. Persönlich habe ich selbst gerade Folgendes erlebt: Ich wurde gebeten, ob ich nicht Freunde für mein Fitnessstudio empfehlen möchte. Als ich mein Fitnessstudio gefragt habe, was sie denn mit den Daten der Freunde machen würden, konnten sie mir darauf keine Antwort geben und entschuldigten sich dann vielmals bei mir. Das war nirgendwo angegeben, auch nicht auf dem Online-Formular, was also absolut rechtswidrig ist.
Aber das ist leider bei kleinen Unternehmen gang und gäbe. Und tatsächlich – wir werden sehen, wie das im Europäischen Parlament schlussendlich ausgeht – gibt es jetzt Bestrebungen, kleine Unternehmungen nicht unter die Datenschutzverordnung der Europäischen Union zu stellen. In Österreich sind das 98,5 Prozent aller Betriebe, und das ist nicht ganz einleuchtend. Wir hoffen sehr, dass die Europäische Union nach wie vor der Weltstandard an persönlichem Datenschutz ist.
In diesem Sinne auch meine Botschaft an die Bundesregierung, bei den Verhandlungen oder bei etwaigen Gesprächen auf europäischer Ebene auch tatsächlich für einen
umfassenden Schutz von personenbezogenen Daten zu sorgen. – Danke schön. (Beifall bei den Grünen.)
15.27
Präsident Edgar Mayer: Als Nächste ist Frau Bundesrätin Ebner zu Wort gemeldet. – Bitte, Frau Kollegin.
15.27
Bundesrätin Adelheid Ebner (SPÖ, Niederösterreich): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Staatssekretär! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Im Gegensatz zu den Grünen werden wir von der SPÖ dieser Novelle zustimmen. Wir nehmen natürlich auch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes sehr ernst, das am 16. Oktober vorigen Jahres gefällt und in dem Österreich aufgefordert wurde, diese unionsrechtskonforme Rechtslage herzustellen, damit die Datenschutzkommission diesen Kriterien der Unabhängigkeit auch Genüge tut.
Aber was beinhaltet diese Änderung? – Erstens soll eben diese Datenschutzkommission als eigene Dienstbehörde und als Personalstelle ausgestaltet werden. Es wird damit auch dem Bundeskanzleramt das, was ihm bis jetzt zugeordnet worden ist, also ein Teilbereich abgezogen. Österreich wurde ja auch in diesem Bereich vorgeworfen, dass das geschäftsführende Mitglied der Kommission ein der Dienstaufsicht unterliegender Bundesbediensteter sei; dies wurde nun mit dieser Novelle geändert und dieses Problem gelöst.
Zweitens soll das Unterrichtungsrecht des Bundeskanzlers in unionsrechtskonformer Auslegung dahin gehend eingeschränkt werden, dass der Vorsitzende dieser Datenschutzkommission dem Unterrichtungsrecht nur insofern zu entsprechen hat, als dies nicht der völligen Unabhängigkeit unserer Kontrollstelle im Sinne von Art. 28 Abs. 1 der Datenschutzrichtlinie widerspricht. Diese Geschäftsstelle wurde nunmehr aus dem Bundeskanzleramt herausgenommen und letztendlich die Informationspflicht auch an unseren Herrn Bundeskanzler massivst eingeschränkt.
Drittens: Als weitere Garantie für die völlige Unabhängigkeit soll auch die Sicherstellung der notwendigen Sach- und Personalausstattung der Datenschutzkommission durch eine budgetorganisatorische Einrichtung, sei es jetzt eine Finanzstelle oder auch eine Kontrollstelle, gewährleistet werden.
Eine große Datenschutzreform wird wahrscheinlich noch bevorstehen, wir werden uns noch öfter hier im Parlament über verschiedenste Bestimmungen unterhalten müssen. Datenschutz ist etwas Wichtiges, Datenschutz betrifft unsere Bürgerinnen und Bürger, wir gehen damit auch sehr sorgfältig um.
Ich denke, diese Novellierung ist wieder ein kleiner Schritt dazu, die Sicherheit der persönlichen Daten in den verschiedensten Bereichen auch rechtskonform herzustellen. Unsere Fraktion stimmt dieser Novelle gerne zu. (Beifall bei der SPÖ.)
15.29
Präsident Edgar Mayer: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Bundesrat Keuschnigg. – Bitte, Herr Kollege.
15.30
Bundesrat Georg Keuschnigg (ÖVP, Tirol): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Staatssekretär! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben hier eine kleine Novelle zum Datenschutzgesetz 2000 zu behandeln. Es ist inhaltlich schon ausführlich gesagt worden, worum es geht. Es ist insofern wichtig, dass wir diese Novelle beschließen, da es um die Einstellung eines Vertragsverletzungsverfahrens geht, die wir damit erreichen wollen.
Und es ist – das sollte man vielleicht auch dazusagen – eine grundsätzliche Novellierung dieses Datenschutzgesetzes bereits auf dem Weg. Ich glaube, die Regierungsvorlage, Herr Staatssekretär, liegt bereits im Parlament. Der Termin für den Verfassungsausschuss des Nationalrates ist mit 16. April festgelegt, in diesem Rahmen wird die notwendige Grundsatzdiskussion – Stichwort „Verfassungsrechtmäßigkeit“ – geführt werden. Daher verstehe ich jetzt nicht ganz, dass die Grünen dieser kleinen, sozusagen fast technischen Novelle nicht zustimmen. (Bundesrat Schreuder: Weil sie nicht verfassungskonform ist!) Aber sei es, wie es sei, das wird nichts verändern. In wenigen Monaten haben wir wirklich die Gelegenheit, das sehr grundsätzlich zu diskutieren.
Wir wissen alle um die Bedeutung des Datenschutzes. Wir wissen aber auch alle, dass hier teilweise Gratwanderungen notwendig sind: Wie weit geht das Recht des Schutzes der Privatsphäre? Wo endet es? Wo beginnt das übergeordnete öffentliche Interesse im Hinblick auf Sicherheitsüberlegungen?
Betreffend Videoüberwachungen habe ich zum Beispiel vor einiger Zeit persönlich einen Fall betreut, wo ein benachbarter Betrieb eine Videokamera zur Hofüberwachung beziehungsweise auch zu Demonstrationszwecken montiert hat und im Schwenkbereich der Kamera in die Wohn- und Schlafräume des von uns geführten Schülerheimes hineingezoomt werden konnte. Es war dann, wenn man sich damit im Detail befasst hat, gar nicht so einfach, diese Kamera wegzubekommen.
Ich weise nur darauf hin, dass wir im Einzelfall natürlich auch einen hohen Aufwand für die Behörde erzeugen. Wir haben dort derzeit 28 Mitarbeiter sitzen, wir sollten in Summe einen Weg finden, dass die Verwaltung dieses Datenschutzes nicht überbordet, sondern dass wir in Zeiten der Konsolidierung den Aufwand in Grenzen halten.
Es ist dies ein wohlüberlegter Zwischenschritt, dessen Verfassungsmäßigkeit vom Verfassungsdienst eindeutig festgestellt worden ist, womit für uns eigentlich keine Zweifel bestehen. Um vor allem auch dieses Vertragsverletzungsverfahren zu vermeiden, stimmen wir der Novelle selbstverständlich zu. (Beifall bei der ÖVP und bei Bundesräten der SPÖ.)
15.33
Präsident Edgar Mayer: Als Nächster gelangt Herr Bundesrat Brückl zu Wort. – Bitte, Herr Kollege.
15.33
Bundesrat Hermann Brückl (FPÖ, Oberösterreich): Geschätzter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Staatssekretär! Werte Kolleginnen und Kollegen! Frei nach dem Motto: „Es ist schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem“, erlauben Sie mir auch ein paar Worte.
Wir halten diese Änderungen, die aufgrund der EU-Datenschutzrichtlinie, aufgrund dieses Urteils des Europäischen Gerichtshofes notwendig geworden sind, ebenfalls für positiv. Mit diesem Gesetz wird das Unterrichtungsrecht des Bundeskanzlers eingeschränkt. Die Datenschutzkommission befindet sich auf dem Weg zu einer unabhängigen, zu einer eigenständigen Dienstbehörde mit eigener Personalhoheit. Aber wir wissen natürlich auch, dass damit noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist, sondern es handelt sich hier tatsächlich erst einmal nur um einen Zwischenschritt.
Im Gegensatz zu den Grünen sehen wir dieses Gesetz – naturgemäß, sonst würden wir ja nicht zustimmen – durchaus der Verfassung entsprechend. Es hat auch einer Prüfung durch den Verfassungsdienst im Bundeskanzleramt standgehalten. Und dass diese Änderung jetzt notwendig geworden ist – ja wir müssen sie beschließen, um schlichtweg Strafzahlungen an die Europäische Union zu vermeiden –, daran führt kein Weg vorbei und wir werten das durchaus als positiv.
Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Gestatten Sie mir eine kritische Frage, Herr Staatssekretär: Warum hat man sich nicht schon früher mit dieser Thematik beschäftigt, sich mit einer Umsetzung auseinandergesetzt? – Denn dann könnten wir heute vielleicht sogar schon einen endgültigen, einen finalisierenden Beschluss darüber fassen, dass wir eine neue, unabhängige Datenschutzbehörde mit einem neuen, ausführlichen Datenschutzgesetz haben.
Aber nichtsdestotrotz stimmen wir hier zu. Wir sagen Ja zu einer unabhängigen, zu einer weisungsfreien und zu einer eigenständigen Datenschutzbehörde, auch mit eigener Personalhoheit. (Beifall bei der FPÖ.)
15.35
Präsident Edgar Mayer: Zu Wort gemeldet hat sich Herr Staatssekretär Dr. Ostermayer. – Bitte, Herr Staatssekretär.
15.35
Staatssekretär im Bundeskanzleramt Dr. Josef Ostermayer: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Bundesrätinnen und Bundesräte! Da doch noch nicht alles gesagt ist, habe ich mich zu Wort gemeldet. Ich beginne gleich mit der Frage des Herrn Bundesrates Brückl: Warum haben wir nicht früher eine umfassende Novelle gemacht?
Das ist relativ einfach erklärt. Die Novelle, die im Ministerrat beschlossen wurde, die jetzt im Parlament ist und am 16. April im Verfassungsausschuss behandelt werden soll, ist die einfachgesetzliche Umsetzung der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Diese ist 26 Jahre nicht zustande gekommen – so lange bin ich noch nicht im Amt. Obwohl viele der Meinung waren, dass wir das auch jetzt nicht schaffen werden, haben wir es geschafft, und zwar einstimmig auch hier im Bundesrat. Und als Ergebnis der Verfassungsbestimmung haben wir dann eine organisationsrechtliche und eine verfahrensrechtliche Novelle dazu gemacht.
Aufbauend auf diesen beiden Gesetzen haben wir jetzt in jedem einzelnen Ressort die materiellrechtlichen Änderungen umgesetzt. Das heißt, das musste Schritt für Schritt abgearbeitet werden. Daher haben wir diese Regierungsvorlage, ich glaube, im Februar im Ministerrat beschlossen, sie ist jetzt dem Parlament zugeleitet worden und soll am 16. April im Verfassungsausschuss behandelt werden. Es konnte sozusagen nicht der Schritt vier vor dem Schritt eins gemacht werden – um das zu erklären.
Dass das Verfahren beim Europäischen Gerichtshof eine bestimmte Zeit in Anspruch genommen hat, dass dazu auch entsprechende Stellungnahmen abgegeben wurden, muss ich nicht extra betonen – das ist selbstverständlich. Und als dann die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes vorgelegen ist, sind wir an die Umsetzung gegangen. Und es hat dies nicht nur, wie Sie dankenswerterweise gesagt haben, der Verfassungsdienst geprüft und für in Ordnung befunden, sondern der Verfassungsdienst ist auch die zuständige Sektion im Bundeskanzleramt, die diesen Entwurf gemacht hat. Sie hat diesen natürlich mit aller Sorgfalt gemacht, und wir sind felsenfest davon überzeugt, dass er verfassungskonform ist.
Herr Bundesrat Schreuder (den Namen Niederländisch aussprechend) – ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen (Bundesrat Schreuder: Sie sind der Einzige, der es kann!), danke! –, wir sind überzeugt davon, dass das verfassungskonform ist. Ich habe auch schon ausführlich im Plenum des Nationalrates erläutert, warum wir der Meinung sind, dass der Art. 20 Abs. 2 der Bundesverfassung in diesem Fall auch verfassungskonform umgesetzt wurde, und zwar steht dort, dass die näheren Bestimmungen durch Gesetz zu regeln sind. „Durch Gesetz“ heißt natürlich einfachgesetzlich. Und die einfachgesetzliche Umsetzung muss dann natürlich auch die unionsrechtlichen Vorgaben, in dem Fall auch die Entscheidung des EuGH, die wiederum auf Unionsrecht beruht, berücksichtigen. Wir sind überzeugt davon, dass wir das gemacht haben und dass das verfassungskonform umgesetzt wurde.
Es wird eigentlich so unterschwellig unterstellt, wir haben das deshalb einfachgesetzlich gemacht, weil wir nicht ein Verfassungsgesetz verhandeln wollten. Also ich halte das geradezu für absurd. Wir haben in dieser Legislaturperiode so viele Verfassungsbestimmungen vorgelegt, verhandelt und beschlossen – in den meisten Fällen sogar einstimmig beschlossen –, ich glaube, wir haben ausreichend bewiesen, dass wir fähig sind, mit Oppositionsparteien zu verhandeln und zu einem Konsens zu kommen – ob das die gerade erwähnte Verwaltungsgerichtsbarkeit ist, ob das das Volksgruppengesetz ist, nämlich die Ortstafellösung und Amtssprachenlösung, ob das die Umsetzung von OPCAT ist, wo es auch acht Jahre nicht funktioniert hat und wo wir dann eine Lösung geschafft haben, ob das das Parteiengesetz ist, wo wir mit Verfassungsmehrheit nach 40 Jahren, glaube ich, eine vollkommene Neuordnung beschlossen haben. Also ich glaube, diese Zweifel müssen Sie nicht haben.
Und im Übrigen: Die kommende, die dauerhafte Regelung, die sozusagen Ausfluss der Verwaltungsgerichtsbarkeit ist, wo wir dann eine monokratische Datenschutzbehörde schaffen wollen, ist auch mit Zweidrittelmehrheit zu beschließen. Auch die werden wir verhandeln, und ich hoffe, dass wir auch da zu einem Konsens kommen werden.
Was wir jetzt beschließen oder was Sie hoffentlich jetzt beschließen, hat den Sinn und ist, obwohl wir schon die große Novelle vorbereitet haben, deshalb jetzt noch durchzuführen, weil wir das Vertragsverletzungsverfahren beenden wollen. Da ist die Voraussetzung dafür, dass diese Umsetzung jetzt beschlossen wird.
Ich danke allen, die dem zustimmen, weil, wie ich glaube, Österreich überhaupt nichts davon hätte, wenn wir ein Vertragsverletzungsverfahren hätten. Wir wollen ja nicht zahlen, sondern wir wollen eine Lösung, und dazu ist es notwendig, dass wir jetzt diese kurzfristige Novelle machen.
Die Diskussion zum Thema Personal kenne ich natürlich auch. Wir haben halt Zielkonflikte, und bei Zielkonflikten muss man eben schauen, dass man eine Lösung findet.
Ein Zielkonflikt ist, dass natürlich auf der einen Seite der Wunsch besteht, dass mehr Personal in der künftigen Datenschutzbehörde vorhanden ist. Aber wir haben auf der anderen Seite ein Konsolidierungspaket geschnürt, wo wir beschlossen haben, dass wir kein zusätzliches Personal im Bundesdienst aufnehmen, dass wir, im Gegenteil, die Zahl der Beschäftigten reduzieren wollen, um auch über diesen Weg einen Beitrag zu soliden Staatsfinanzen zu leisten.
Dass wir da auf einem guten Weg sind, wurde vorige Woche bewiesen, als die Statistik Austria die neuen Zahlen veröffentlicht hat, wo sich zeigte, dass wir kein Defizit haben, dass über 3 Prozent liegt, sondern mit 2,5 Prozent deutlich besser als ursprünglich in der Prognose angesiedelt sind. Also wir sind da, wie gesagt, auf dem richtigen Weg.
Aber mir ist bewusst – haben Sie da keine Zweifel –, dass wir im Zuge der größeren Reform auch das Thema „Personal“ diskutieren müssen. Man kann das von zwei Seiten angehen. Wir haben eine andere Idee, und die ist, dass wir eine Datenschutz-Novelle machen, was wir schon in Form eines Gesetzentwurfes vorbereitet haben, wo wir bestimmte Dinge herausnehmen, die nicht mehr als wichtig oder als relevant erachtet werden, dass wir Datenschutzbeauftragte einsetzen, womit wir auch die Datenschutzbehörde entlasten könnten. Ich hoffe, dass wir auch da zu einem Ergebnis kommen werden. Dann ist die Problematik der Überlastung auf einem anderen Weg gelöst, ohne dass man zusätzliches Personal aufnehmen muss.
Ich danke Ihnen, wenn Sie diese Novelle jetzt beschließen, und bin guter Hoffnung, dass wir für die kommende Novelle konstruktive und hoffentlich auch zielführende Gespräche führen und dann noch in dieser Legislaturperiode die entsprechenden Beschlüsse fassen können. – Vielen Dank. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.)
15.43
Präsident Edgar Mayer: Danke, Herr Staatssekretär.
Weitere Wortmeldungen dazu liegen nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir gelangen nun zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Bericht des Bundeskanzlers und der Bundesministerin für Frauen und öffentlichen Dienst an das Parlament zum Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für 2013 und zum 18-Monatsprogramm des Rates für 2013/14 gemäß Art. 23f Abs. 2 B-VG iVm § 7 EU-InfoG (III-483-BR/2013 d.B. sowie 8941/BR d.B.)
Präsident Edgar Mayer: Wir gelangen nun zum 9. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatter ist Herr Bundesrat Saller. Bitte um den Bericht.
Berichterstatter Josef Saller: Herr Staatssekretär! Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich erstatte den Bericht des Ausschusses für Verfassung und Föderalismus über den Bericht des Bundeskanzlers und der Bundesministerin für Frauen und öffentlichen Dienst an das Parlament zum Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für 2013 und zum 18-Monatsprogramm des Rates für 2013/14.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor; ich komme daher sogleich zur Antragstellung.
Der Ausschuss für Verfassung und Föderalismus stellt nach Beratung am 3. April den Antrag, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen.
Präsident Edgar Mayer: Danke, Herr Kollege Saller.
Bevor wir in die Debatte eingehen, darf ich sehr herzlich unsere Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek begrüßen. Herzlich willkommen! (Beifall bei SPÖ und ÖVP.)
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gelangt als Erster Herr Bundesrat Brückl. – Bitte, Herr Kollege.
15.45
Bundesrat Hermann Brückl (FPÖ, Oberösterreich): Geschätzter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Minister! Sehr geehrter Herr Staatssekretär! Werte Kolleginnen und Kollegen! Der Bericht des Bundeskanzlers zum Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für 2013 und zum 18-Monatsprogramm des Rates für 2013/14 ist sehr umfangreich, ist sehr ausführlich.
Was die inhaltliche Bewertung betrifft, darf ich jedoch sagen, dass diese für uns überwiegend negativ ausfällt. Ich bitte Sie aber, das nicht als bösartige Kritik unsererseits zu werten, sondern sehen Sie das bitte als Vorschläge und Ideen von unserer Seite beziehungsweise nehmen Sie das als Bitte auf, diese Themen auch in der Richtung, so wie ich Sie jetzt vorbringe, entsprechend zu überdenken.
Im vorliegenden Bericht heißt es gleich nach wenigen Seiten unter anderem, dass der Europäische Rat möglichweise neuerlich auf den Schengen-Beitritt von Bulgarien und Rumänien zurückkommen wird. Wir wissen mittlerweile, dass die Konferenz der Innenminister Anfang März beschlossen hat, diese Frage, nämlich den Beitritt Rumäniens
und Bulgariens zum Schengen-Raum, auf Dezember zu verschieben. Tatsache ist aber, sehr geehrte Damen und Herren, dass beide Länder meilenweit davon entfernt sind, die Schengen-Kriterien zu erfüllen, insbesondere was die Korruption betrifft. Das ist etwas, was sogar die Europäische Kommission mittlerweile eingesteht. Es gäbe genug Beispiele dafür. Kollege Mag. Klaus Fürlinger hat heute gemeint, nicht nur die Guten würden reisen. Ich denke, auch das sollte man hier in diesem Zusammenhang auf jeden Fall berücksichtigen.
Eine weitere Kritik betrifft Punkt III: „Reform der Wirtschafts- und Währungsunion“. Da heißt es, die Wirtschaftspolitik müsse darauf ausgerichtet sein, unter anderem die Haushaltsdisziplin zu gewährleisten.
Ich darf dazu festhalten, dass man sich bislang in der Europäischen Union offensichtlich nur sehr, sehr spärlich um die Haushaltsdisziplin gekümmert hat. In diesem Zusammenhang darf ich auf einen Bericht des „Kurier“ aus der letzten Woche verweisen, wo die Überschrift lautet: „75 Verstöße gegen Maastricht-Kriterien“, und da findet sich eine Auflistung, wann und wie oft welche Kriterien verletzt wurden. Ich zitiere daraus.
„Das Maastricht-Kriterium von maximal 3,0 Prozent des Budgetdefizits wurde von 2009 bis 2012 in den 27 EU-Staaten insgesamt 75 Mal gebrochen.“ – Also es schert sich wirklich niemand darum.
Aufgelistet ist hier Irland mit dem höchsten Defizit im Jahr 2010 in der Höhe von 30,9 Prozent.
Als einziges Land, das einen Überschuss erzielt hat, ist Ungarn angeführt. Ungarn konnte offensichtlich aufgrund von Privatisierungen, die durchgeführt wurden, einen Überschuss erzielen.
Eingegangen wird hier in diesem Bericht auch auf die Staatsverschuldung, insbesondere auf jene Griechenlands. Griechenland hatte im Jahr 2011 eine Staatsverschuldung von 170 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Dann hat es für Griechenland ein Rettungspaket gegeben, woraufhin natürlich diese Quote gesunken ist, und zwar auf 161 Prozent. Aber für 2013 werden für Griechenland 175,6 Prozent Staatsverschuldung prognostiziert. Trotz des Rettungspakets wird die Staatsverschuldung in Griechenland weit über das Höchstmaß, das man 2011 erreicht hatte, steigen.
Was Zypern betrifft – wir kennen die Situation: Zypern-Krise –, war für 2012 eine Staatsverschuldung von 86,5 Prozent prognostiziert, die, glaube ich, in dieser Größenordnung auch erreicht wurde. Heuer hätte sie auf 93 Prozent ansteigen sollen. Jetzt gibt es ein Rettungspaket in der Größenordnung von 10 Milliarden. Die Staatsverschuldung steigt jetzt auf 150 Prozent, weil man natürlich die 10 Milliarden, die man nach Zypern schickt, auch als Schulden anrechnen muss, weil sie ja zurückzuzahlen wären.
Österreich ist in diesem Bericht ebenfalls angeführt. Die Staatsverschuldung Österreichs hat sich 2012 gegenüber der Winterprognose etwas verbessert. Wir liegen derzeit offiziell bei 73,4 Prozent. Ich sage deswegen „offiziell“, weil hier die ausgelagerten Unternehmungen, wie etwa ÖBB und ASFINAG, wo wir eben nicht wissen, ob uns das nicht tatsächlich irgendwann einmal zugerechnet werden würde, nicht eingerechnet sind. Dann würde nämlich die Staatsverschuldung tatsächlich auf 100 Prozent des Bruttoinlandproduktes steigen.
So viel zur Haushaltsdisziplin, die zu gewährleisten ist.
Ich möchte in diesem Zusammenhang jetzt auf noch etwas hinweisen. Herr Präsident des Ausschusses der Regionen Siso, der heute hier viele positive Dinge angesprochen und gesagt hat, hat auch von Solidarität gesprochen. Er hat gesagt, er habe finanzielle Vorgaben in seinem Verantwortungsbereich nicht erfüllt, weil er unter anderem Kran-
kenhäuser hätte schließen müssen. Genauso hat er es gesagt, ich habe es mir aufgeschrieben.
Kollege Gottfried Kneifel, wir Oberösterreicher wissen, dass tatsächlich – wir hatten im Vorjahr eine Spitalsreform in Oberösterreich – ganze Abteilungen in Krankenhäusern geschlossen wurden. Es waren dies massive Einschnitte, die da in Oberösterreich stattgefunden haben, insbesondere hat es das Innviertel betroffen. Also ich frage mich schon, was für eine Solidarität da angesprochen wurde. (Bundesrat Schreuder: Kennen Sie die Region in Spanien?) Herr Kollege, ich rede über Solidarität. Und wenn ich Solidarität einfordere, dann muss ich sie auch selbst leben. Von nichts anderem rede ich.
Ein weiterer Punkt, der im vorliegenden Bericht angesprochen wird, betrifft die Umverteilung der Sitze im Europäischen Parlament. Dazu findet sich leider Gottes keine österreichische Position. Wir wissen aus Berichten, dass es vermutlich so sein wird, dass Österreich im Europäischen Parlament einen Sitz verlieren wird. Es gab in der Vergangenheit einen gemeinsamen parteiübergreifenden Antrag, den man im Plenum des EU-Parlaments eingebracht hat, dass Österreich nach wie vor dieselbe Anzahl der Abgeordneten stellen soll, wird und darf. Dieser Antrag wurde niedergestimmt.
Man sollte da, denke ich, auch einmal gewisse Kriterien heranziehen. So soll der Platz, den wir verlieren, an Schweden gehen. Nur am Rande möchte ich dazu anmerken: Wenn man nach Kriterien sucht, könnte man auch einmal den Arbeitsbericht der Parlamentarier im EU-Parlament hier heranziehen. Wenn man sich das ansieht, dann kann man feststellen, dass die österreichischen Abgeordneten aller Parteien mit Abstand die fleißigsten im Europäischen Parlament sind, während Schweden an drittletzter Stelle liegt, also sozusagen eines der Schlusslichter bildet. Da wäre durchaus unsere Meinung angesagt in der Form, dass die österreichische Regierung ein Vetorecht zumindest einmal in den Raum stellt, weil nicht einzusehen ist, dass wir zugunsten Schwedens einen Platz verlieren.
Ein weiterer Punkt im vorliegenden Bericht betrifft die Vorbereitung der Wahl zum Europäischen Parlament. Diese Wahl soll zu Pfingsten 2014 stattfinden. Da darf ich der Regierung durchaus Wohlwollen entgegenbringen, weil sie dafür eintritt, dass dieser Termin auf jeden Fall verlegt wird. Ich möchte aber in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass Brüssel sehr wenig Rücksicht auf Feiertage – vor allem auf christliche Feiertage – nimmt. Heuer ist für Pfingstmontag – das ist, glaube ich, der 20. Mai – ein Plenumstag angesetzt. Ich sehe nicht ein, dass man immer an solchen Tagen, die in einer Vielzahl europäischer Länder christliche Feiertage sind, Arbeitstage oder sogar Wahlen ansetzt. Ich bitte auch hier, dass die Bundesregierung das entsprechend weiter betreibt.
Abschließend darf ich als letzten Punkt noch eines herausgreifen, und das betrifft die EU-Donauraumstrategie. Das ist ein positives Projekt, das, wie wir wissen, einer Idee der Kooperation zwischen Rumänien und Österreich entsprungen ist. Dieses Projekt – und das habe ich von dieser Stelle aus schon einmal gesagt – beschäftigt sich mit vielen Themen, insbesondere mit wirtschaftlichen Themen, geht aber nicht auf die Frage der Atomenergie ein. Ich meine, man sollte im Rahmen dieser Donauraumstrategie auch einmal die Frage aufwerfen, was mit Temelín, Mochovce und vielen anderen Atomkraftwerken, die wir nicht als sicher einstufen und die wir als österreichische Bevölkerung sowieso nicht wollen, in Zukunft geschehen wird.
Hohes Haus! Sehr geehrter Herr Staatssekretär! Sehr geehrte Frau Ministerin! Wir werden dieser Vorlage aufgrund der von mir beispielhaft aufgezählten Punkte nicht zustimmen. (Zwischenrufe bei der SPÖ.) – Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. (Beifall bei der FPÖ.)
15.54
Präsident Edgar Mayer: Als Nächste zu Wort gelangt Frau Bundesrätin Blatnik. – Bitte, Frau Kollegin.
15.54
Bundesrätin Ana Blatnik (SPÖ, Kärnten): Herr Präsident! Gospod president! Frau Bundesministerin! Gospa zvezna ministrica! Herr Staatssekretär! Gospod zvezni sekretar! Bevor ich auf den vorliegenden Bericht eingehe, möchte ich einfach sagen, dass ich auf den Bundesrat sehr stolz bin, auf das, was heute geschehen ist: Nicht nur die Ana Blatnik, die immer Zweisprachigkeit pflegt, hat heute erleben können und dürfen, dass Mehrsprachigkeit im Bundesrat wirklich stattfindet und gelebt wird. (Zwischenruf der Bundesrätin Mühlwerth.)
Lieber Herr Fraktionsvorsitzender, danke! Hvala lepa! Lieber Herr Präsident, danke! Hvala lepa! (Beifall bei SPÖ und ÖVP.)
Jetzt zum eigentlichen Bericht. – Es ist, wie mein Vorredner schon gesagt hat, ein gemeinsamer Bericht, ein umfassender Bericht, der 15 Schwerpunkte beinhaltet. Ich werde mich auf drei Schwerpunkte konzentrieren, und zwar: erstens auf Medienangelegenheiten, zweitens auf die Situation der Roma und drittens auf die Gleichstellung zwischen Frauen und Männern.
Wir haben heute miterleben dürfen, dass der Präsident des Ausschusses der Regionen über Europa gesprochen und das Gemeinsame Europa als eine einzige wunderbare Idee bezeichnet hat, wo Menschen in Frieden, Stabilität und Freiheit zusammenleben können. Und gerade das, liebe Kolleginnen und Kollegen, sollen wir über Europa vermitteln. Dieses positive Vermitteln von Europa geht uns alle etwas an. Wir sind dafür verantwortlich, dass dieses Gemeinsame Europa positiv vermittelt wird.
Der Herr Präsident des Ausschusses der Regionen hat auch gemeint, dass das Gemeinsame Europa ein Werteprojekt ist. Das Gemeinsame Europa ist wirklich ein Werteprojekt, wo Achtung, Respekt, Wertschätzung in den Vordergrund gestellt werden und Neid und Geiz keinen Platz haben sollten.
Der zweite Punkt, den ich ansprechen will, ist die Situation der Roma. Ziel der Europäischen Kommission ist es, eine Empfehlung für eine bessere Umsetzung der Nationalen Strategie zur Integration der Roma auszuarbeiten, vor allem in den Bereichen Bildung, Beschäftigung, Wohnen und Gesundheitsvorsorge. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Maßnahme, um die Situation der Roma im sozialen und im wirtschaftlichen Bereich zu verbessern.
Der dritte Punkt, zu dem ich Stellung nehmen möchte, weil es mir ein Hauptanliegen ist, ist die Gleichstellung zwischen Mann und Frau, die mir sehr am Herzen liegt. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir von der Europäischen Union Rückenwind bekommen, weil es vielleicht dadurch leichter geht oder leichter gehen wird, in puncto Gleichstellung etwas zu verändern.
Ich habe sehr lange geglaubt, dass Freiwilligkeit uns weiterbringen wird, musste aber leider erkennen, dass uns die Freiwilligkeit nicht viel weitergebracht hat. Man kann sagen, eine Quote ist zwar nicht so elegant – ich bin da anderer Meinung –, aber sie ist wirksam.
An dieser Stelle möchte ich ein Zitat von Viviane Reding bringen, die Folgendes sagt: Ich bin keine Frau von Quoten, aber ich mag die Ergebnisse, die Quoten bringen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist es! Ich glaube, wir müssen von Ausreden Abstand nehmen und zur Kenntnis nehmen: Es wird sich in der Gleichstellung zwischen Mann und Frau nur dann etwas ändern, wenn es eine verbindliche Quotenregelung gibt. Auch die österreichische Position in diesem Bericht sagt zum Thema „Gleichstel-
lung“ ganz klar, was Sache ist: dass Maßnahmen, die auf Freiwilligkeit basieren, nicht erfolgreich sind, sondern scheitern. Deshalb sind verbindliche Regelungen notwendig.
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Geschlechtergleichstellung ist ein fundamentaler Wert in der EU. Und zu diesem Kapitel steht Folgendes im Bericht – ich zitiere –:
„Die Präsidentschaften werden sich bemühen, die Verpflichtungen, die im Europäischen Pakt für die Gleichstellung der Geschlechter () und in der Strategie der Kommission für die Gleichstellung von Frauen und Männern () festgelegt wurden, zu erfüllen.“
Wir müssen erkennen, dass sich einiges getan hat, dass sich einiges verbessert hat. Und da muss ich unserer Frau Bundesministerin recht herzlichen Dank sagen: Danke für den Einkommensbericht! Danke für den Gehaltsrechner! Danke für das einkommensabhängige Kindergeld! Danke für jede Maßnahme und jede Unterstützung, die die Situation bezüglich Gleichstellung zwischen Mann und Frau verbessert. (Beifall bei der SPÖ.)
Ich muss aber auch betonen, dass vieles noch nicht in Ordnung ist. Fakt ist, dass im 21. Jahrhundert die Einkommensdifferenz noch immer besteht. Heute ist übrigens der Equal Pay Day, das ist jener Tag, ab dem Frauen unentgeltlich arbeiten – dies im Vergleich mit dem Einkommen von Männern in einem Jahr. Fakt ist auch, dass für Führungspositionen oft männliche Nominierungen erfolgen. Fakt ist auch, dass so viele Frauen erwerbstätig sind wie noch nie, aber leider fast jede zweite Frau in Teilzeit. Und Fakt ist auch, dass sich die Frauen zum Großteil noch immer für unbezahlte Arbeit verantwortlich fühlen und auch für deren Erledigung sorgen. Und Fakt ist leider auch, dass sich Frauen noch immer für typische Frauenberufe entscheiden, die schlechter bezahlt werden, die schlechter bewertet werden. (Bundesrat Perhab: Fakt ist auch, dass die Frauen früher in Pension gehen können!) – Und jetzt muss ich sagen: Solange nicht auch zum Beispiel du, Herr Kollege, für eine vollständige Gleichstellung zwischen Mann und Frau, auch was unbezahlte Arbeit und Doppelbelastung betrifft, kämpfst, so lange hat die Frau auch ein Anrecht darauf – und darüber diskutiere ich absolut nicht –, früher in Pension zu gehen! (Beifall bei Bundesräten der SPÖ.)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist genau der Punkt: Es wird über Gleichstellung sehr viel diskutiert, aber leider auch polarisiert. Und dagegen verwahre ich mich vehement. (Bundesrätin Mühlwerth: Das macht ja ihr genauso!) – Ich polarisiere, was Gleichstellung betrifft, nicht.
Wie gesagt, vieles ist noch zu machen, viele Probleme warten noch auf uns. Gehen wir es an!
(Die Rednerin setzt ihre Ausführungen in slowenischer Sprache fort.)
Danke. Hvala lepa. (Beifall bei der SPÖ sowie bei Bundesräten der ÖVP.)
16.03
Präsident Edgar Mayer: Danke, Frau Kollegin Blatnik.
Ich darf jetzt auf der Regierungsbank noch Herrn Staatssekretär Mag. Schieder begrüßen. Herzlich willkommen! (Allgemeiner Beifall.)
Die Regierungsbank füllt sich. Der Bundesrat fühlt sich geehrt, heute so viele Regierungsmitglieder hier anwesend zu haben.
Ich begrüße auch noch herzlich liebe Freunde aus Tirol bei uns, und zwar eine Gruppe aus der Gemeinde Aurach bei Kitzbühel samt Bürgermeister. Herzlich willkommen! (Allgemeiner Beifall.)
Als Nächster zu Wort gelangt Herr Bundesrat Wenger. – Bitte, Herr Kollege.
16.04
Bundesrat Franz Wenger (ÖVP, Salzburg): Sehr geehrte Frau Bundesministerin! Die Herren Staatssekretäre! Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Nachbarschaft aus dem Unterland, wenn ich das so sagen darf. Im vorliegenden Bericht finden sich die politischen Prioritäten der Europäischen Kommission und der in Österreich zuständigen Ministerien. Frau Kollegin Blatnik hat ja einige Themen bereits angeführt und diese auch detailliert erläutert. Dazu nun auch noch einige Ergänzungen von meiner Seite.
Wesentliche Ziele sind die Wirtschafts- und Finanzpolitik der EU, die Politik der Länder besser aufeinander abzustimmen, den Binnenmarkt weiter zu vertiefen, die Beschäftigung anzukurbeln oder auch die Wettbewerbsfähigkeit Europas zusätzlich zu stärken. Auf der Agenda stehen weiterhin auch die Dauerthemen wie Abbau von Verwaltungslasten, die EU-Erweiterung oder auch eine gemeinsame Außenpolitik – Themen, die schon seit Längerem auf der Agenda stehen.
Um die Politik der Euro-Länder besser aufeinander abstimmen und in Krisensituationen auch wesentlich rascher reagieren zu können, sind künftig regelmäßige Treffen der Staats- und Regierungschefs des Euroraumes informeller Art geplant. Die österreichische Regierung spricht sich in diesem Zusammenhang für eine transparente, strukturierte und ergebnisoffene Debatte aus. Maßgeblich für sie ist, dass eine Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion einen positiven Effekt auf Wachstum und Beschäftigung hat. Zudem fordert unsere Regierung, dass während des gesamten Prozesses eine angemessene Beteiligung der nationalen Parlamente und des Europäischen Parlaments stattfindet.
Den Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie betreffend informiert der Bericht unter anderem über Pläne der EU-Kommission, mit einer Cyber Security-Strategie gezielt gegen Cyberkriminalität vorzugehen. Weitere IKT-Themen sind die grenzüberschreitende Nutzung von Bürgerkarten, sichere elektronische Signaturen durch eine Vereinheitlichung der technischen Standards oder auch ein barrierefreier Zugang zu Websites öffentlicher Stellen und Online-Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung.
Geplant ist aber auch, das Mandat der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit zu überarbeiten und im Rahmen der Digitalen Agenda den Ausbau von Breitband-Festnetzen und Mobilfunk-Hochgeschwindigkeitsnetzen voranzutreiben. Die Digitale Agenda für Europa verfolgt insgesamt das Ziel, aus einem digitalen Binnenmarkt, der auf einem schnellen Internet und interoperablen Anwendungen beruht, einen nachhaltigen wirtschaftlichen und sozialen Nutzen zu ziehen.
Die Agenda ist eine der sieben Leitinitiativen der Strategie Europa 2020. Die Kommission hat bereits im Dezember 2012 eine Mitteilung zur Überprüfung der Digitalen Agenda vorgelegt. Neben einer Bestandsaufnahme der bisherigen Umsetzung setzt sie Prioritäten, insbesondere im Bereich der Breitband-Festnetze und Mobilfunk-Hochgeschwindigkeitsnetze. Weitere wichtige Themen sind verstärkte Maßnahmen im Bereich IKT-Ausbildung oder auch die Modernisierung des Urheberrechts.
Die Kommission hat zudem darauf verwiesen, dass die digitale Wirtschaft zwar sieben Mal so schnell wie die übrige Wirtschaft wächst, dass aber dieses Potenzial aufgrund des lückenhaften gesamteuropäischen politischen Rahmens nur mangelhaft ausgeschöpft wird. Bei völliger Umsetzung der aktualisierten Agenda könnte laut Kommission das BIP der EU in den kommenden acht Jahren um 5 Prozent gesteigert werden. Dazu bedarf es aber einer Erhöhung der IKT-Investitionen, einer Verbesserung der IKT-Kompetenzen der Arbeitskräfte, um Innovation im öffentlichen Sektor zu ermöglichen, und einer Reform der Rahmenbedingungen für die Internetwirtschaft.
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Thema Datenschutz findet sich in den Arbeitsprogrammen der Europäischen Kommission und der Ministerien immer wieder,
so auch im vorliegenden Bericht. Österreich begrüßt die Initiative der Kommission, die Rechtsinstrumente zum Datenschutz in Einklang zu bringen, mit dem Vertrag von Lissabon abzugleichen und zudem an die Anforderungen durch die neuen technologischen Entwicklungen anzupassen.
Österreich sieht dabei das in der nationalen Richtlinie vorgegebene Niveau des Datenschutzes grundsätzlich als Maßstab an. Kommt es also zu einem umfassenden Datenschutzrechtsinstrument, dann vertritt Österreich den Standpunkt, dass das nationale Niveau nicht unterboten werden darf.
Grundsätzlich soll es auch – ein wichtiger Bereich – zu datenschutzrelevanten Initiativen im Bereich der Zusammenarbeit zwischen Polizei und Justiz kommen. Und auch da ist es Österreich wichtig, dass das nationale Niveau gehalten wird.
Umfassendes Thema war heute schon jener große Bereich, der hier von unserem Präsidenten der Regionen dargestellt wurde, die Kohäsionspolitik beziehungsweise Regionalpolitik. Sie verfolgt grundsätzlich eine Politik zur Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts. Das ist, wie ich meine, eine der vornehmsten und wesentlichsten Aufgaben der Union.
Die Bedeutung dieser Politik sieht man daran, dass zirka ein Drittel der EU-Gesamtausgaben dafür vorgesehen sind. Dieser Bereich ist natürlich ganz eng mit den Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen verknüpft. Wesentliche Elemente sind die Förderung aller Regionen Europas, finanziell abgestuft und auch nach wirtschaftlichem Entwicklungsstand abgestimmt. Die künftigen Fördermittel sind auf die Ziele der Europa-2020-Strategie fokussiert und zielen auf ein nachhaltiges und integratives Wirtschaftswachstum ab.
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Insgesamt kann festgestellt werden, dass die für das Jahr 2013 seitens der Ministerien geplanten Vorhaben nicht nur umfangreich, sondern auch sehr ambitioniert sind. Im vorliegenden Bericht ist zu den einzelnen Themen die österreichische Position formuliert. Und in der Erwartung, dass die Umsetzung auch gelingt, stimmt die Fraktion der ÖVP dem vorliegenden Bericht zu. (Beifall bei der ÖVP sowie bei Bundesräten der SPÖ.)
16.12
Präsident Edgar Mayer: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Kollege Schreuder. (Der Präsident spricht den Namen auf Niederländisch, der Muttersprache des Redners, aus.)
16.12
Bundesrat Marco Schreuder (Grüne, Wien): Die Mehrsprachigkeit macht sich breit! (Heiterkeit.) Aber ich muss ehrlich sagen, nur der Herr Staatssekretär versteht es, meinen Namen in meiner Muttersprache auch wirklich korrekt auszusprechen. (Präsident Mayer: Darum ist er auch Staatssekretär!) Herr Präsident, sagen Sie einfach (der Redner bedient sich der deutschen Aussprache) „Schreuder“! Sie können das nicht! (Heiterkeit des Redners.)
Ich habe mich schon gefreut vor der ganzen Runde, weil sich jeder sozusagen Themen herausgepickt hatte, und ich habe mir gedacht, ich kann zur Digitalen Agenda reden. Aber der Herr Wenger hat sich gedacht: Ich muss das auch! – Aber das ist doch auch gut so. In diesem Bericht stehen ja viele, viele Bereiche drinnen, die geplant sind, die angegangen werden sollen, und da hat es ja keinen Sinn, wenn man das nur oberflächlich betrachtet. Und ich wollte auch ganz gezielt über die Digitale Agenda sprechen, weil ich auch glaube, dass dies gerade im Bundesrat, in der Länderkammer ein ganz, ganz wichtiges Thema ist.
Es haben ja jetzt die erfreulicherweise neue Kärntner Landesregierung und der neue Landeshauptmann in Kärnten – schade, der alte ist nicht da, jetzt hätte ich ihn gerne
gesehen – erfreulicherweise gesagt, eine der großen, großen Aufgaben auch für die Kärntner Landesregierung ist die Bekämpfung der Abwanderung. Und wenn wir über die Abwanderung und über das Ausdünnen des ländlichen Raumes sprechen – und es gab ja auch schon eine Bundesratsenquete zu diesem Thema –, dann müssen wir natürlich auch darüber sprechen, wie Arbeitsbedingungen im ländlichen Raum funktionieren und wie Menschen auch im globalen Netz irgendwo arbeiten können, auch wenn die Firmenzentrale woanders ist.
Das ist natürlich auch für Kommunen wie Wien wichtig, also für die großen Metropolen, denn die müssen ja erst einmal die Wohnungen bauen für all die Menschen, die zuziehen. Das ist eine Herausforderung für alle Bereiche, sowohl für die Bundesländer, die sozusagen ausgedünnt werden und Bevölkerung verlieren, als auch für die Metropolen, in denen so ein starker Zuwachs an Menschen zu verzeichnen ist. Und die Breitbandoffensive, sprich die Digitale Agenda, die ein Projekt für die Zeit bis 2020 sein soll, ist einer der ganz, ganz wesentlichen Beiträge zu diesem Thema. – Wieso sehe ich da jetzt nichts mehr? (Der Redner blickt auf den – nunmehr – schwarzen Bildschirm seines Tablets und hält dieses in die Höhe.) – Ich sehe es fast nicht mehr. Schade, denn da ist meine Rede drauf. Blöde Sache! – Aber vieles weiß ich auswendig.
Es sollen ja bis 2020 alle Haushalte in Europa mit mindestens 30 Megabit pro Sekunde ausgestattet werden – vom Breitbandanschluss her – und die Hälfte davon sogar mit über 100. Das ist für den ländlichen Raum natürlich eine Riesenherausforderung, und wir haben das hier auch schon öfter gehört. Ich kann mich erinnern, als Landeshauptmann Platter aus Tirol hier war, hat er auch gesagt, wie wichtig auch für die Tiroler Täler zum großen Teil diese Breitbandoffensive und die Digitale Agenda sind, damit Menschen dort modern, im Anschluss an die Welt, arbeiten können.
Jetzt haben wir in diesem Bericht auch ambitioniert die Digitale Agenda drinnen. Aber jetzt kommt die schlechte Nachricht: Jeder hat wahrscheinlich die Budgetverhandlungen der Staats- und Regierungschefs Europas erlebt, und das waren kein Ruhmesblatt und keine Sternstunde europäischer Politik – vom Britenrabatt angefangen, aber auch von österreichischen Regierungsmitgliedern gab es keine besonders erfreulichen Wortmeldungen, mit Vetokeulen-Drohungen und dergleichen –, mit dem Effekt, dass das Budget in der Europäischen Union zurückgehen wird. Und dieser Bericht wurde davor geschrieben.
Das Budget für die Digitale Agenda wurde nämlich gekürzt, und zwar nicht nur ein bisschen gekürzt, sondern es wurde um 90 Prozent gekürzt! In diesem Programm geht man bei der Digitalen Agenda noch immer davon aus, dass 9,2 Milliarden € zur Verfügung stehen werden. Die zuständige Kommissarin Neelie Kroes – ich bin wahrscheinlich der Einzige, der das richtig aussprechen kann (Staatssekretär Dr. Ostermayer: Falsch! Ich kann es auch!); ja, Sie natürlich; er (auf Präsident Mayer weisend) nicht – hat sich ja in ihrem Blog bitter beschwert über dieses Budgetdesaster, das da herausgekommen ist. Und ich meine, eine Kürzung von 90 Prozent, von 9,2 Milliarden € auf 1 Milliarde, das muss man ja auch erst einmal verkraften. Und ob die Digitale Agenda bis 2020 jetzt überhaupt noch in dieser Form umsetzbar sein wird, das schaue ich mir natürlich gerne an.
Es war immer klar, dass natürlich nicht
nur die europäischen Gelder dafür zur Verfügung stehen. Es
war immer eine Zusammenarbeit (Staatssekretär Dr. Ostermayer: Genau!)
von Public-private-Partnership – das sind die Firmen, die wollen
natürlich auch ausbauen, sie verdienen ja auch Geld damit (Staatssekretär
Dr. Ostermayer: Natio-
nal, !) –, national, regional und so weiter, keine Frage.
Aber nichtsdestotrotz, eine Kürzung um 90 Prozent – ich
schaue mir das jetzt an, wie das weitergeht. Ich habe da meine
Befürchtungen, so wie Neelie Kroes. Ich finde, ihre Besorgnis ist
berechtigt. Ich kann nur hoffen, dass sich dann trotzdem etwas tut, weil es
gerade für Österreich, aber
nicht nur für Österreich, sondern für Europa generell, wichtig ist. – (Der Redner weist auf sein Tablet.) Jetzt geht es wieder!
Es haben ja auch sehr intelligente, sehr gescheite Leute in der Kommission einmal ausgerechnet, welche Effekte die Digitale Agenda für die Wirtschaft in Europa haben würde. Und sie haben ausgerechnet, dass die Digitale Agenda nicht nur eine Steigerung des Bruttoinlandsproduktes um zirka 1,5 Prozent bringen würde, sondern 2 Millionen Arbeitsplätze – in Europa natürlich.
Und jetzt denke ich mir: Liebe Staats- und Regierungschefs, die ihr das EU-Budget verhandelt, die ihr ständig auch uns hier erzählt, wie wichtig jetzt alle Maßnahmen sind, um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen, die Krise zu bewältigen, ihr kürzt Budgets dort, wo Arbeitsplätze geschaffen werden können?! – Das sehe ich nicht ein. Und ich finde, das gehört kritisiert und dagegen muss man etwas unternehmen. (Beifall des Bundesrates Dönmez.)
Zur Datenschutz-Verordnung habe ich vorhin schon gesprochen, also lasse ich es jetzt gut sein.
Der Bericht kann natürlich gar nichts dafür, dass die Budgets gekürzt werden. Deswegen werden wir dem Bericht zustimmen. – Danke schön. (Beifall der Bundesräte Dönmez und Blatnik.)
16.19
Präsident Edgar Mayer: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesministerin Heinisch-Hosek. – Bitte, Frau Ministerin.
16.19
Bundesministerin für Frauen und öffentlichen Dienst Gabriele Heinisch-Hosek: Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich kurz mit dem öffentlichen Dienst beschäftigen und etwas länger mit dem Kapitel Gleichstellung, wie auch Kollegin Blatnik das schon getan hat, während andere Vorredner das zum Teil vielleicht ausgespart und Bemerkungen gemacht haben, die zwar ihre Berechtigung haben, die ich aber vielleicht entkräften kann. Ich weise darauf hin, dass wir jetzt in Österreich überhaupt noch nicht daran denken müssen und auch nicht daran denken sollten, das Frauenpensionsantrittsalter jetzt einfach anzuheben: weil sich die Europäische Kommission, der Rat, die Strategie EU 2020, viele, viele Bereiche dem Thema Gleichstellung ja schon lange widmen und der Bereich der Gleichstellung noch lange nicht abgeschlossen sein wird.
Aber ganz kurz zum öffentlichen Dienst: Diese eine Milliarde an von der Kommission geplanten Einsparungen in den nächsten Jahren, die Reform des Beamtenstatus, das geht den 17 Nettozahlerstaaten, darunter Österreich, zu wenig weit. Wenn wir bedenken, dass nationalstaatlich die öffentlichen Dienste in den verschiedensten Bereichen sehr große Einsparungen tätigen und auch große Reformen angestrebt haben und durchführen und auch beim Personal sehr einsparen, dann ist es so, dass uns die Position der Kommission natürlich zu wenig weit geht. Der Status quo ist, dass versucht wird, die Verhandlungspositionen zwischen Rat, Kommission und den Nettozahlern, die Ende 2011 eine eigene Position formuliert haben, weil sie der Meinung sind, dass da auch mehr drinnen wäre, auszuloten.
Ich darf nur kurz in Erinnerung rufen: Es geht unter anderem um die Anhebung des Pensionsantrittsalters – Regelpension, Frühpension – und viele, viele andere Bereiche, wobei es aber wichtig ist, dass wir uns damals, gerade in Zeiten der Krise, als hier sehr viel Aufregung geherrscht hat darüber, wie die Beamtengehälter der EU-Beamtinnen und -beamten angepasst wurden, anderes gewünscht haben und nicht mitgegangen sind. Diese Anpassungsautomatik ist ja Ende 2012 ausgelaufen, und wir wollen daher
jetzt eine gemeinsame neue Regelung finden. Das ist derzeit in Verhandlung, im sogenannten Trilog – nicht Dialog, sondern Trilog –, wie das am besten handhabbar ist. Daher ist hier auch momentan noch nicht mehr zu berichten.
Zum Thema Gleichstellung: Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Seit 1957 gibt es das Prinzip „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ – das hängt ja unmittelbar mit Gleichstellung zusammen – in der EU, und es ist bis jetzt noch immer nicht erfüllt. Es wurde auch schon gesagt, dass heute der Tag der Lohngleichheit ist. Nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen Ländern gibt es diese Unterschiede, die man zum großen Teil erklären kann. Aber bei einigen Prozentpunkten ist es immer noch so, dass wir fragen: Warum sind da jetzt die Frauen benachteiligt? – Das passiert nicht nur, weil sie in schlechter bezahlten Bereichen arbeiten, nicht nur, weil sie Teilzeit arbeiten.
Ich komme gerade an dieser Stelle auch zu den Zahlen in der Strategie „Europa 2020“, nämlich zu den Zahlen, was die Erwerbsquoten anlangt: Österreich liegt über der Durchschnittserwerbsquote der Europäischen Union. Wir in Österreich haben mittlerweile eine Beschäftigungsquote von 75,2 Prozent, aber der hohe, hohe Teilzeitanteil der Frauen macht diese hohe Quote aus. Wenn man das wegrechnet, schaut sie bei Weitem anders aus. Trotzdem wollen wir für die 20- bis 64-Jährigen in Österreich in der Strategie „Europa 2020“ auf 77 bis 78 Prozent Beschäftigungsziel – hier in Österreich als nationales Ziel festgeschrieben – kommen.
„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ ist also noch lange nicht erreicht. „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“, das macht man nicht als Selbstzweck oder nur aus gleichstellungspolitischen Gründen, sondern das wird ökonomisch immer wichtiger. Auch gestern gab es auf einem großen internationalen Kongress, wo ich gewesen bin, viele Interviews, wie üblich rund um den Tag der Lohngleichheit.
Es ist längst nicht mehr nur eine Frage, ob man die Frauen aus Gerechtigkeitsgründen gleich bezahlen soll. Ja, natürlich – ich sage das als Frauenpolitikerin –, aber es ist auch ein Business Case geworden. Wir brauchen die Talente, wir brauchen einfach die Arbeitskraft, die gute Ausbildung der Frauen, und das nicht nur national, sondern vor allem auch auf europäischer Ebene – und da ist noch einiges zu tun.
Unternehmen wurde zum Beispiel die Möglichkeit des Quick-Check angeboten, das ist eine Initiative auf der Homepage der Europäischen Kommission, wo Unternehmen ganz leicht nachschauen – sozusagen checken – können, wie es um die Gleichstellung in ihrem eigenen Unternehmen bestellt ist. Es gibt einige Bereiche, wo das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen schon Vorarbeiten geleistet hat, wo viele Angebote vorliegen, wie man diese wirtschaftlichen Gründe, warum es notwendig ist, die Gleichstellung endlich zu erreichen, auch einfach belegen kann.
Man muss sie auch belegen, denn es geht schließlich und endlich nicht nur um die Geschlechtergleichstellung, sondern es geht um Wachstum, es geht letztendlich um den sozialen Zusammenhalt, um den sozialen Frieden in einer Gesellschaft eines Nationalstaates, aber auch um den gesellschaftlichen und sozialen Frieden in der gesamten Europäischen Union.
Wenn wir das nächste Jahr hernehmen – es wird das Europäische Jahr der Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben sein –, so glaube ich, dass gerade wir in Österreich diesbezüglich schon viele Vorarbeiten geleistet und Weichen für eine entsprechende Vereinbarkeit gestellt haben. Der Bund unterstützt die Länder, damit Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderbetreuungseinrichtungen errichtet werden können. Diese Weichen sind gestellt, es muss aber weitergearbeitet werden. Denn in Vereinbarkeitsfragen sind uns schon einige Staaten in Europa weit, weit voraus, mit Rechtsansprüchen ab dem ersten Lebensjahr, mit Karenzzeiten, wo Väter im Umfang von zweistelligen Prozentzahlen in Karenz gehen – bei uns sind nicht einmal 5 Prozent der Männer in Karenz.
Das heißt, hier haben wir noch einigen Aufholbedarf. Was das anlangt, sind wir noch lange nicht Vorzeigeland.
Nächstes Jahr ist also das Europäische Jahr der Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben, und das darf nicht nur Frauensache sein. Wir wollen, dass auch Männer Familienzeit nehmen können. Wir wollen, dass Unternehmen auch Männer dazu ermutigen und ermuntern, obwohl es im Bereich der Klein- und Mittelunternehmen – das wissen wir (in Richtung von Bundesrätin Zwazl), Frau Präsidentin, das diskutieren wir auch sehr oft – sehr schwierig ist, Männer eine Zeitlang zu entbehren. Es sollte aber mit einer Kraftanstrengung möglich sein, zum Beispiel einen Papamonat anzudenken und es dann auch zu erreichen, dass Männer zumindest zwei bis drei Monate Auszeit nehmen. Klein- und Mittelbetriebe gibt es auch in anderen europäischen Staaten, und auch dort kann man sich, wenn es einmal Mainstream, wenn es einmal normal geworden ist, mit Ersatzlösungen sehr gut helfen. Also hier ist noch einiges zu tun.
Die irische Präsidentschaft, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, hat das Thema „Frauen und Medien“ als prioritäres Thema definiert, denn letztendlich ist es wichtig, dass wir auch im Bereich der Medien Frauen in Führungspositionen haben. Und da kann ich sehr stolz sagen, dass in Österreich der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit der Quotenregelung schon einiges auf den Weg bringen konnte, dass Frauen dort in Führungspositionen gekommen sind und dass sich die Auswirkungen davon auf alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses so großen Unternehmens als positiv herausgestellt haben. Wenn gemischte Führungsteams am Werk sind, werden Entscheidungen vielfältiger und bunter, und das tut jedem Unternehmen gut – auch unserem ORF.
Das heißt, „Frauen und Medien“ ist ein Thema, bei dem wir gut mitreden können, bei dem wir aber auch – und da gibt es gleichfalls noch einiges zu tun – die Darstellung von Frauen in den Medien hinterfragen müssen. Auch das gehört zu den Schwerpunkten, wenn man für die Präsidentschaft „Frauen und Medien“ als Thema definiert: dass die Darstellung von Frauen hinterfragt wird, die Sexismen, die tagtäglich damit verbunden sind, beispielsweise diese Zuschreibungen in der Werbung: Waschmittel ist Frau und Reparieren mit Bohrer und sonstigen Gerätschaften ist Mann. Das wird ein bisschen aufgebrochen, aber bei Weitem noch nicht so, wie es sich gehört.
Wir haben daher letztes Jahr bei den Medientagen auch einen Preis ausloben können, den Gender Award für gleichstellungsorientierte Werbung. Es haben sich einige Unternehmen beworben – es hätten mehr sein können, aber es war das erste Mal. Wir werden diesen Preis alle zwei Jahre ausloben, und ich glaube, dass sich auch da in den Köpfen schön langsam die typischen Zuschreibungen, was Frauen können oder nicht können und was Männer können oder nicht können, ändern werden.
Wenn die irische Präsidentschaft diese Rollenbilder prioritär behandelt, dann ist das sicherlich auch etwas, was nationalstaatlich hilft, eine nicht diskriminierende Darstellung von Frauen und Mädchen sowie Buben und Männern zu erreichen.
Ein wichtiger Vorstoß ist auch der Vorschlag der EU-Kommissarin hinsichtlich Quotenregelungen. Und ich sage es immer wieder – es wurde auch von Kollegin Blatnik schon gesagt –: In Österreich könnte es schneller gehen. Wir arbeiten mit der Freiwilligkeit seit vielen, vielen Jahren, aber es tut sich zu wenig! Und wenn die Arbeiterkammer jedes Jahr die 200 Topunternehmen anschaut, dann sieht man, dass sich dort etwas im Zehntelprozentbereich tut.
Wir in der Bundesregierung haben es aber geschafft, dass wir bei den staatsnahen Unternehmen ... (Zwischenruf des Bundesrates Perhab.) – Natürlich! Die bei der Arbeiterkammer haben einen Papamonat, Herr Kollege, da haben sehr viele Abteilungsleiterinnen ... (Bundesrat Perhab: ... in Führungsfunktion in der Arbeiterkammer!) – Ja, in der Landwirtschaftskammer kenne ich auch keine einzige Frau, die in einer Führungsposi-
tion ist – leider, leider, leider und so weiter und so fort. (Bundesrätin Zwazl: Wir haben eine Generalsekretärin!)
Ich glaube nicht, dass wir das aufrechnen müssen. Ich glaube, dass jede einzelne Bemühung – und wenn Sie mithelfen, wird wahrscheinlich noch schneller etwas weitergehen – da hilft, die Situation zu verändern. (Beifall bei der SPÖ. – Bundesrat Schennach: Die Landwirtschaftskammer ist zu 69 Prozent Männer!) – Männlich besetzt, richtig! (Bundesrätin Zwazl: Wir haben eine Generalsekretärin und zwei Präsidentinnen!)
Wenn ich das einfach zu Ende sagen darf: Die Bundesregierung hat es mit der Selbstverpflichtung, den Quoten in staatsnahen Unternehmen, geschafft, dass wir jetzt, nach der ersten Berichtslegung, schon über 30 Prozent Frauen in Aufsichtsratsfunktionen haben etablieren können und dass wir, denke ich, ganz locker, wenn ich das so salopp formulieren darf, das Ziel von 35 Prozent schon vor dem Jahr 2018 erreichen. Und es wird sich keine einzige schlecht qualifizierte Frau bewerben gegenüber vielen Männern, die aufgrund der vielen, vielen Funktionen, die sie oft in Aufsichtsräten wahrnehmen, vielleicht auch gar nicht jede einzelne so gut bewältigen können. (Vizepräsidentin Mag. Kurz übernimmt den Vorsitz.)
Ich darf noch zur litauischen Präsidentschaft kommen, sehr geehrte Damen und Herren. Zweites Halbjahr 2013: Was steht da am Programm? – Selbstverständlich wird auch da der Fokus auf die De-facto-Gleichstellung von Frauen und Männern und auch auf institutionelle Mechanismen für die Gleichstellung von Frauen und Männern gelegt, also darauf, wie man den Austausch, die Zusammenarbeit noch intensivieren kann, um wesentliche Grundlagen zu schaffen, damit Debatten wie diese: Frauen gehen ja früher in Pension, und Männer wollten ja gerne, dürfen aber nicht! in Zukunft weniger bis überflüssig werden. Erst wenn Männer sich in gleichem Ausmaß an der Familienarbeit beteiligen wie Frauen und Frauen in gleichem Ausmaß in beruflichen Führungspositionen vertreten sind wie Männer, erst dann, glaube ich, waren unsere gemeinsamen Anstrengungen erfolgreich. Aber die gesamte Europäische Kommission, der Rat, die Union, das Parlament arbeiten nicht erst seit gestern, sondern schon seit Langem daran, dass sich diese Situation ändert. Und wenn wir im Bundesrat auch mithelfen, dann wird es noch schneller gehen! (Beifall bei der SPÖ sowie des Bundesrates Schreuder.)
16.32
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz: Zu Wort gelangt Herr Staatssekretär Ostermayer. – Bitte.
16.32
Staatssekretär im Bundeskanzleramt Dr. Josef Ostermayer: Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Frau Bundesministerin! Sehr geehrte Damen und Herren Bundesräte! Ich muss jetzt noch einmal den Herrn Bundesrat Schreuder ansprechen, und zwar nicht, weil ich noch einmal den Versuch unternehmen will, seinen Namen korrekt auszusprechen – im Übrigen glaube ich auch nicht, dass es ein Monopol gibt, den Namen der Frau Kommissarin Kroes richtig auszusprechen (Bundesrat Schreuder: Das war ja ein Scherz!), ja, ja, sowieso! –, sondern Sie haben mich mit Ihrer, na ja, sagen wir, etwas undifferenzierten Kritik an den Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen herausgefordert.
Vielleicht hat das damit zu tun gehabt, dass Ihr iPad in den Sleep-Modus gewechselt ist – das weiß ich nicht –, ich möchte nur eines betonen: Der Bundeskanzler hat nie mit einer Vetokeule gedroht (Zwischenruf des Bundesrates Schreuder), der Bundeskanzler hat versucht, das zu tun, was logischerweise wegen der Konstruktion der Europäischen Union und des Europäischen Rates alle dort tun – oder hoffentlich alle tun –, nämlich einen Versuch zu unternehmen, einerseits die nationalen Interessen, andererseits die europäischen Interessen unter einen Hut zu kriegen.
Kommissar Hahn – immerhin ein Vertreter der Kommission – hat übrigens die Verhandlungen des Bundeskanzlers betreffend den mehrjährigen Finanzrahmen im Europäischen Rat als sehr intelligent bezeichnet.
Tatsächlich ist es so, dass dort 27 Regierungschefs versuchen, einen Kompromiss herbeizuführen. Das dauert manchmal lange, das ist manchmal mühsam, aber es ist eine hohe Qualität einerseits der Demokratie, dass man versucht, mit Argumenten zu Ergebnissen zu kommen, und eine hohe Qualität der Europäischen Union, dass man mit Worten und nicht mit Gewalt zu Ergebnissen kommt. (Bundesrat Schreuder: ... nicht kritisieren!) – Okay, das wollte ich hören. Ich danke Ihnen. (Heiterkeit des Redners.)
Natürlich ist es so, dass man dann, wenn man versucht, das zu tun, was auch in den Nationalstaaten getan wurde, getan werden musste, in manchen Ländern mit mehr, in manchen Ländern mit weniger Erfolg, nämlich nach der Finanzkrise auch eine Konsolidierung der Haushalte herbeizuführen, auf der europäischen Ebene nicht davon ausgehen kann, dass die Budgets dort sozusagen beliebig wachsen, sondern auch dort sehr genau geschaut wird, dass man sich sozusagen nach der Decke streckt. Dass das dazu führt, dass manche Projekte mehr Geld, manche Projekte weniger Geld bekommen, das liegt nun einmal in der Natur der Sache. Wir können – ich sage das jetzt aus österreichischer Sicht – froh sein, dass Infrastrukturprojekte insgesamt mehr Geld bekommen. Dass es auf der anderen Seite für die Digitale Agenda, die Sie erwähnt haben, weniger Geld gibt, ist nicht erfreulich, da bin ich ganz bei Ihnen.
Die Frage ist: Wie geht man damit um? – In Österreich hat die zuständige Bundesministerin Doris Bures insofern reagiert, als sie gesagt hat, dass das Geld, das durch die Ausschreibung der Frequenzen hereinkommt, in den Ausbau des Breitbandnetzes investiert werden soll, und zwar dort, wo es, wie Sie auch richtigerweise gesagt haben, die Industrie nicht von sich aus tut, die natürlich auch in einer nicht ganz einfachen Lage ist. – Nur so viel zum Finanzrahmen.
Ich mache es relativ kurz, ganz wenige Anmerkungen: Eines ist mir sehr wichtig, nämlich die Ziele, die im Arbeitsprogramm der Kommission und im Programm des Rates definiert wurden, und zwar dass man sehr genau darauf achtet, dass Wachstum und Beschäftigung weiterhin Hauptanliegen sind. Das halte ich, wie gesagt, für sehr wichtig. Dass bei den Konsolidierungsbemühungen einerseits Wachstum, andererseits soziale Fairness nicht außer Acht gelassen werden, halte ich auch für einen ganz wesentlichen Weg. Dieser deckt sich übrigens mit dem Weg, den wir, als wir etwa vor einem Jahr das Konsolidierungspaket geschnürt haben, auch als unsere Leitlinie betrachtet haben.
Wir haben damals auch nicht das Ziel gehabt, dass wir sozusagen auf Teufel komm raus überall auf der Ausgabenseite einsparen, sondern das Ziel war, dass wir einen Mix finden zwischen zusätzlichen Einnahmen und Sparmaßnahmen, Konsolidierungsmaßnahmen auf der Ausgabenseite, und das – ich habe das schon in meinem vorigen Redebeitrag gesagt –, wie jetzt das Ergebnis der Statistik Austria zeigt, mit sehr gutem Erfolg: einerseits, weil wir deutlich unter dem Budgetdefizit sind, das wir angenommen haben, und andererseits, weil wir auf der Seite der Beschäftigung, auf der Seite der Jugendbeschäftigung in Europa vorbildhaft sind.
Ich zitiere Kommissionspräsidenten Barroso, der gestern und vorgestern in Wien war. Barroso sagte in der Pressekonferenz Folgendes über Österreich:
„Es ist ein Vorzeigeland für Beschäftigung und die Job-Garantie für Jugendliche ist ein Modell für ganz Europa.“
Ich glaube, dem ist in diesem Punkt nichts hinzuzufügen.
Es gibt noch einige weitere Punkte, die ich kurz anschneide.
Das eine Stichwort lautet Bankenunion. Ziel ist es, dass man auch in diesem Punkt auf europäischer Ebene möglichst rasch zu einem Ergebnis kommt, und zwar einerseits betreffend die Bankenaufsicht, andererseits auch betreffend die Frage, was passiert, wenn Banken ins Straucheln kommen, also das Thema Bankensanierung, Bankenabwicklung. Da haben wir auch in Österreich gerade das Bankenrestrukturierungs- und -sanierungsgesetz in Vorbereitung. Also da zeigt natürlich die gesamte Entwicklung im Finanzsektor, dass da dringend Maßnahmen notwendig sind.
Einen letzten Punkt möchte ich noch anschneiden: Zypern. – Wir haben das alle miterlebt: Jean-Claude Juncker war, glaube ich, kurz nachdem es die erste Einigung zu Zypern gegeben hat, in Österreich im Bundeskanzleramt und hat dort die gleiche Meinung vertreten, die viele von uns vertreten haben, nämlich dass es ein schwerer Fehler war, an der Einlagensicherung zu rütteln, also auch Einlagen unter 100 000 € zur Sanierung des Landes, zur Sanierung der Banken heranzuziehen. Man hat das dann glücklicherweise korrigiert, und nun werden nur mehr Einlagen über 100 000 € herangezogen.
Unerfreulicherweise hat es dann in Österreich in den letzten Tagen auch eine Diskussion gegeben, wo manche Bankdirektoren die Meinung vertreten haben, es sollten auch Spareinlagen unter 100 000 € herangezogen werden. – Es hat, glaube ich, Herr Staatssekretär Schieder, aber auch die Frau Finanzministerin klargestellt, dass das in Österreich nicht in Frage kommt, dass jedenfalls Sparguthaben bis zu 100 000 € gesichert sind, und das sollte auch die europäische Linie sein.
Mehr möchte ich jetzt nicht mehr ausführen, nachdem die Frau Bundesministerin ausführlich Stellung genommen hat. – Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.)
16.39
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz: Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. (Zwischenruf des Bundesrates Mag. Himmer.) – Bitte, Herr Vizepräsident.
16.39
Bundesrat Mag. Harald Himmer (ÖVP, Wien): Sehr geehrte Frau Präsident! Frau Minister! Meine Herren Staatssekretäre! Ich wollte auch Bezug nehmen auf die Rede des Kollegen, ich sage immer noch „Schreuder“, da tue ich mir leichter. Wenn ich dann Holländisch gelernt habe, dann passe ich es gerne an.
Da nicht Herr Bundeskanzler Faymann, sondern vielleicht doch jemand anderer mit der Vetokeule gemeint war, wollte ich schon für ein bisschen mehr Unaufgeregtheit plädieren, weil Folgendes wohl ganz logisch ist: Wenn man die Aufgabe hat, bei Verhandlungen die Republik zu vertreten, nach Brüssel fährt und eigentlich Treuhänder für das Geld des Österreichers ist (Staatssekretär Dr. Ostermayer: Und der Österreicherin!), na selbstverständlich darf man dann im Rahmen von Verhandlungen sagen, dass man, wenn unsere Vorstellungen so nicht berücksichtigt werden, einmal im Ist-Zustand dagegen ist.
Ich glaube, jeder, der die Demokratie kennt – und natürlich auch jeder hier in diesem Hohen Haus –, kennt das Zauberwort Nein. Das kennen wir in der Koalition jeden Tag, solange wir uns noch nicht geeinigt haben, das kennen wir auch in diesem Parlament, wenn man eine oppositionelle Fraktion für eine Zweidrittelmehrheit braucht. Selbst die Grünen kennen da das Wort Nein. Wenn wir dann verhandelt haben, kennen sie auch wieder das Wort Ja.
In diesem Zusammenhang kann man auch bei Bundesminister Berlakovich ruhig unaufgeregt bleiben, zumal es um das Geld der Österreicher geht.
Ich wollte auch noch auf etwas anderes Bezug nehmen, was mir wirklich wichtig ist, nämlich auf die ganze Thematik um die Digitale Agenda und die Breitbandstrategie. Es ist hier richtig gesagt worden – und ich zweifle nicht an diesen Studien –, dass man bei der Umsetzung dieser Strategie – wie bei jeder früheren Umsetzung einer Breitbandstrategie in der Fläche – enorme Effekte für Beschäftigung und Wachstum hat. Daher ist das auch eine ganz, ganz wichtige Agenda, und man kann es sich ja auch am Beispiel Österreich sehr gut vorstellen.
Es ist einfach so: Wenn Betriebe im Waldviertel oder irgendwo in Tirol nicht oder nicht entsprechend breitbandig an das Internet angebunden sind, dann ist das ein Problem für die Unternehmungen dort. Es ist natürlich etwas, das logischerweise auch die Produktivität reduziert, und daher haben wir bei Investitionen in die Digitalisierung und ins Breitband nicht nur die unmittelbaren positiven Effekte in der Telekombranche zu verzeichnen, sondern natürlich auch Produktivitätssteigerungseffekte in anderen Branchen und damit natürlich auch eine steigende Standortqualität.
Warum ich das sage, ist Folgendes: Da darf man dann aber auch nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn es dazu keine europäische Einigung gibt, weil selbstverständlich jedes Land für sich die Möglichkeit hat, seine digitale Strategie, seine Breitbandstrategie vorzusehen. Das ist insbesondere eine Herausforderung für die Regionen – wir haben ja heute schon so viel über die Regionen gesprochen –, das ist kein städtisches Thema, sondern das ist ein Thema der benachteiligten Regionen. Da sind wir in Österreich konkret aufgerufen, für uns – in Österreich, in den Bundesländern und in den Regionen – Lösungen zu finden, und Selbiges gilt auch für andere Nationalstaaten.
Ich will das wirklich nicht zu lange ausführen, aber gerade was dieses Problem betrifft, sehe ich das jetzt wirklich sehr gelassen. Da dieses Thema in einen Zusammenhang mit den Budgetverhandlungen gerückt worden ist: Wir müssen nicht mehr Geld nach Brüssel zahlen, damit wir dann einen Bruchteil davon wieder für Dinge zurückbekommen, von denen wir ohnehin der Auffassung sind, dass wir sie machen wollen. Daher habe ich eigentlich die Art und Weise, wie die Verhandlungen von unserer Bundesregierung geführt worden sind, im Wesentlichen für eine kluge Strategie gehalten und wollte daher einfach festhalten, dass uns das nicht daran hindert, in den nationalen Entscheidungen das Richtige zu tun. (Beifall bei der ÖVP sowie bei Bundesräten der SPÖ.)
16.43
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir kommen nunmehr zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, den gegenständlichen Bericht zur Kenntnis zu nehmen, um ein Handzeichen. – Es ist dies die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das Bankwesengesetz, das Börsegesetz 1989, das E-Geldgesetz 2010, das Zahlungsdienstegesetz, das Investmentfondsgesetz 2011, das Immobilien-Investmentfondsgesetz, das Wertpapieraufsichtsgesetz 2007, das Kapitalmarktgesetz, das Ratingagenturenvollzugsgesetz, das Zentrale Gegenparteien-Vollzugsgesetz, das Pensionskassengesetz, das Versicherungsaufsichtsgesetz, das Punzierungsgesetz 2000, das Gebührengesetz 1957, das Glücksspielgesetz, die Bundesabgabenordnung, das Finanz-
strafgesetz, das EU-Finanzstrafvollstreckungsgesetz, das Bundesfinanzgerichtsgesetz, das Bundespensionsamtübertragungs-Gesetz und das Rundfunkgebührengesetz geändert werden (Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz – Bundesministerium für Finanzen) (2196 d.B. und 2233 d.B. sowie 8921/BR d.B.)
11. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Konsulargebührengesetz 1992, das Sanktionengesetz 2010, das Devisengesetz 2004 und das Nationalbankgesetz 1984 geändert werden (2234 d.B. sowie 8922/BR d.B.)
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz: Wir kommen nun zu den Punkten 10 und 11 der Tagesordnung, über welche die Debatte unter einem durchgeführt wird.
Berichterstatter zu den Punkten 10 und 11 ist Herr Bundesrat Zehentner. Ich bitte um die Berichte.
Berichterstatter Robert Zehentner: Geschätzte Frau Präsidentin! Geschätzter Herr Staatssekretär! Ich bringe den Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 20. März betreffend ein Bundesgesetz über den Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das Bankwesengesetz, das Börsegesetz 1989, das E-Geldgesetz 2010, das Zahlungsdienstegesetz, das Investmentfondsgesetz 2011, das Immobilien-Investmentfondsgesetz, das Wertpapieraufsichtsgesetz 2007, das Kapitalmarktgesetz, das Ratingagenturenvollzugsgesetz, das Zentrale Gegenparteien-Vollzugsgesetz, das Pensionskassengesetz, das Versicherungsaufsichtsgesetz, das Punzierungsgesetz 2000, das Gebührengesetz 1957, das Glücksspielgesetz, die Bundesabgabenordnung, das Finanzstrafgesetz, das EU-Finanzstrafvollstreckungsgesetz, das Bundesfinanzgerichtsgesetz, das Bundespensionsamtübertragungs-Gesetz und das Rundfunkgebührengesetz geändert werden (Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz – Bundesministerium für Finanzen).
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor; ich komme daher sogleich zur Antragstellung.
Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 3. April 2013 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Ich komme nun zum Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Konsulargebührengesetz 1992, das Sanktionengesetz 2010, das Devisengesetz 2004 und das Nationalbankgesetz 1984 geändert werden.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor; ich komme daher sogleich zur Antragstellung.
Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 3. April 2013 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz: Danke für die Berichte.
Wir gehen in die Debatte ein.
Als Erster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Schreuder. – Bitte.
16.46
Bundesrat Marco Schreuder (Grüne, Wien): Frau Präsidentin! Herr Staatssekretär! Ich mache es ganz kurz. Grundsätzlich ist es positiv, dass wir jetzt ein Bundesfinanz-
gericht erhalten. Das finden wir gut. Bisher war das ja anders. Bei Bescheiden der Finanzmarktaufsicht gab es ja keine Möglichkeit einer Beschwerde, außer man ging direkt zum Verwaltungsgerichtshof oder zum Verfassungsgerichtshof, um gegen einen Bescheid zu berufen. In der neuen Rechtslage gibt es eben diese neue Ebene des Bundesfinanzgerichts. Das ist prinzipiell richtig, denn das bedeutet gleichzeitig, dass Beschwerden zulässig sind, aber keine aufschiebende Wirkung haben.
Da kommen wir auch gleichzeitig zur Kritik: Dass Beschwerden keine aufschiebende Wirkung haben, finden wir ja sehr gut, zum Beispiel bei Kapitalanlagegesellschaften – das ist ein ganz gutes Beispiel. Diese Regelung geht uns dann aber doch zu weit, weil es nun einmal Fälle gibt, wo eine aufschiebende Wirkung einfach Sinn macht, zum Beispiel – um ein Beispiel zu nennen, das gerade aktuell auch immer wieder diskutiert worden ist – bei den Bürgerbeteiligungskraftwerken, Fall Staudinger. – Danke schön. (Beifall bei den Grünen.)
16.48
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Bundesrat Lampel. – Bitte.
16.48
Bundesrat Michael Lampel (SPÖ, Burgenland): Sehr geschätzte Frau Präsidentin! Geschätzter Herr Staatssekretär! Liebe Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat! Wir diskutieren heute das Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz des Bundesministeriums für Finanzen. Aufgrund der Verwaltungsgerichtsbarkeitsnovelle 2012 wird die Einführung einer zweistufigen Verwaltungsgerichtsbarkeit ab 1. Jänner des kommenden Jahres verfassungsrechtlich verankert. Das hat natürlich zur Folge, dass Anpassungen in den einfachen Materiengesetzen innerhalb der Ressortzuständigkeit des Bundesministeriums für Finanzen erforderlich sind.
Insgesamt werden durch das Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz 22 Gesetze geändert, wobei es einerseits um die Anpassung der gesetzlichen Regelungen an das System der Verwaltungsgerichtsbarkeit geht – in vielen Fällen werden die Verjährungsbestimmungen geändert, durch die Anhebung der Verjährung von 6 Monaten auf ein Jahr –,andererseits aber auch um die Schaffung eigener verfahrensrechtlicher Regelungen für den Bereich der Finanzmarktaufsicht, wozu ja mein Kollege vorher teilweise kritische Anmerkungen gemacht hat.
Dabei geht es vor allem auch darum, ein starkes und stabiles Finanzinstrument zu haben. Aufgrund der jüngsten Vergangenheit und Gegenwart, nämlich der Turbulenzen am Finanzmarkt, der zunehmenden europäischen Verflechtung der Finanzmärkte und der stetig steigenden Anforderungen an die Finanzmarktaufsicht ist es wichtig, dass Entscheidungen erforderlichenfalls rasch und effizient getroffen werden können.
Daher erhält die Finanzmarktaufsichtsbehörde auch ein eigenes Verfahrensrecht, das erlaubt, erforderlichenfalls Bescheide auch unverzüglich zu vollziehen. Trotzdem ist es auch aufgrund der rechtsstaatlichen Grundsätze besonders wichtig, dass gegen einen Bescheid der Finanzmarktaufsicht beim Bundesverwaltungsgericht berufen werden kann. Beschwerden gegen Bescheide der FMA haben ja grundsätzlich, wie vorher schon gesagt wurde, keine aufschiebende Wirkung. Eine solche kann aber das Bundesverwaltungsgericht im Einzelfall bei Beschwerden gegen Bescheide zuerkennen, wenn kein öffentliches Interesse dagegensteht und dem Beschwerdeführer anderenfalls ein unverhältnismäßiger Nachteil entstehen würde.
Im Bankwesen- und im Börsegesetz wird eine jeweils ähnliche Bestimmung zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angepasst. Soweit die Behörde angeordnet hat, dass verdächtige Transaktionen nicht durchgeführt werden, ist der
betroffene Kunde darüber zu verständigen, wobei der Hinweis erfolgt, dass ebenfalls eine Beschwerdemöglichkeit beim Bundesverwaltungsgericht besteht.
Des Weiteren gibt es durch das heute zu beschließende Gesetz die Möglichkeit, im Verordnungsweg Pauschalgebühren für die Beschwerden festzusetzen, was natürlich eine Verwaltungsvereinfachung mit sich bringt.
Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Zusammenfassend ist zu sagen, dass das heute zu beschließende Verwaltungsgerichtsbarkeit-Anpassungsgesetz Anpassungen in verschiedenen Gebieten des Finanzbereiches enthält, die aufgrund der bereits beschlossenen Verwaltungsgerichtsbarkeitsnovelle erforderlich und notwendig sind; diese sind aber auch ein weiterer Schritt zur Verwaltungsreform. Daher wird meine Fraktion diesem Gesetz auf jeden Fall zustimmen. (Beifall bei der SPÖ.)
16.52
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Bundesrat Pisec. – Bitte.
16.52
Bundesrat Mag. Reinhard Pisec, BA (FPÖ, Wien): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Staatssekretär! Sehr geehrte Damen und Herren! Herr Kollege Schreuder! Ich glaube, wir sind im Ausschuss nebeneinander gesessen, und da habe ich auch die Frage gestellt, bei welcher neu eingezogenen Instanz man nun gegen die Bescheide der FMA Beschwerde einlegen kann, und da war die Antwort, beim Bundesverwaltungsgericht – und nicht beim Bundesfinanzgericht, wie Sie gesagt haben. Ihre Argumentation wäre richtig, ich verstehe auch nicht, warum man nicht beim Bundesfinanzgericht beruft, sondern beim Bundesverwaltungsgericht, aber es ist eben so.
Kurz zum Gesetz: Das Wichtigste hat mein Vorredner, Herr Kollege Lampel, herausgestrichen. Die Institution, das Instrumentarium, das ist die Finanzmarktaufsicht. In der heutigen Zeit, wo man praktisch mit 200 km/h auf der Finanzautobahn fährt, ist es wichtig, dass dem Finanzmarkt, dem Kapitalmarkt Regeln vorgegeben werden – Ordnungen, Verordnungen, an die man sich halten muss, gerade vor dem Hintergrund der Liquiditätsschwemme der europäischen Zentralbank, die ja diese marode Staatsverschuldung letztlich refinanzieren muss. Damit hat das Ganze seinen ursächlichen, kausalen Zusammenhang.
Heute ist die Finanzmarktaufsicht das Instrumentarium, um die Banken, die Versicherungen, die Pensionskassen und den Wertpapierhandel an der Wiener Börse zu beaufsichtigen. Das Wichtigste sind dabei die Bankenaufsicht und die Wertpapieraufsicht.
Was sind die Ursprünge der Finanzmarktaufsicht? Wir reden
immer von der Krise,
aber die größte Krise, die bereits abgeschlossen ist, war die
Weltwirtschaftskrise im Jahr 1929. Aus dieser Situation ist das Instrumentarium
der Finanzmarktaufsicht entstanden, das jedes Land – von den
USA ausgehend bis nach Österreich – eingeführt hat. Die
zweite große Krise – 2007/2008 – ist in den USA und
in Asien bereits abgeschlossen, in Europa feiert sie hingegen fröhliche
Urständ, und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Daher sprechen alle
von der European Crisis – es ist eine lokale, auf den
europäischen Raum begrenzte Krise. Wie es da weitergeht, können wir
uns ja alle weiter anschauen.
Zu diesem Gesetz: Es ist sicherlich sinnvoll, wenn von Europa ausgehend ein harmonisiertes europäisches Verfahren eingeleitet wird, damit Vergehen auch einheitlich geahndet werden können, denn der Finanzmarkt braucht schnelle Entscheidungen, und nur in dieser Hinsicht, wenn eben die Verfahren beschleunigt werden, ist das Gesetz sinnvoll.
Wir Freiheitlichen stimmen also unter der Hypothese, unter der Annahme zu, dass es zu einem beschleunigten Verfahren kommt, zu schnelleren Entscheidungen am Fi-
nanzmarkt, damit die Regeln eingehalten werden. Unter dieser Prämisse stimmen wir zu, denn – das ist der Hintergedanke – wenn ich mir diese jahrelange Verfahrensdauer des Telekomprozesses ansehe, wo erst nach neun Jahren, also erst vor Kurzem, vor wenigen Wochen ein Urteil gesprochen worden ist, und das nur wegen einer Kronzeugenregelung, dann frage ich mich doch, ob die Finanzmarktaufsicht, ob die österreichische Gerichtsbarkeit da wirklich effektiv ist – denn die Finanzmarktaufsicht ist ja letztlich eine Effektivbehörde.
Zur Besetzung der Finanzmarktaufsicht: Wenn man sich anschaut, wie die österreichische Finanzmarktaufsicht besetzt ist, dann muss man einmal sehen, dass es zwei Verantwortliche gibt. Das ist international absolut ungewöhnlich, normalerweise wird ein Unternehmen von einer Person geführt. Einer trägt die Verantwortung, einer hat dafür zu haften, dass das Ganze richtig funktioniert. Bei uns sind es zwei. Ich nehme an – beziehungsweise ich nehme es nicht an, sondern man weiß es ja –, das ist politisch besetzt.
Zweitens: Der Aufsichtsrat besteht aus acht Personen, dem Vorsitzenden, dessen Stellvertreter und sechs Mitgliedern. Interessanterweise sind zwei von der Wirtschaftskammer dabei. Das verstehe ich auch nicht. Die Wirtschaftskammer vertritt ja eher Großkonzerne, während die Großkonzerne von der FMA ja kontrolliert werden sollen. Ob da die Wirtschaftskammer der richtige Ansprechpartner ist, wage ich zu bezweifeln. Abgesehen davon gehört die Wirtschaftskammer als ganzes Instrumentarium eigentlich reformiert und fit gemacht für das dritte Jahrtausend. Die Wirtschaftskammer sollte sich endlich um die Interessen der Klein- und Mittelbetriebe kümmern und nicht immer um das Großkapital und um die Großkonzerne. Hier in der Finanzmarktaufsicht hat sie definitiv nichts verloren. (Bundesrätin Zwazl: ... keine Ahnung! – Weitere Zwischenrufe bei der ÖVP.)
Zu den Compliance-Regeln: Was helfen die schönsten und besten Compliance-Regeln, wie sie hier in diesem Gesetz beschlossen worden sind, wenn sich der Staat als oberste Instanz nicht daran hält?! So gut und so sinnvoll dieses Gesetz ist, bringt das Ganze nichts, wie wir im Salzburg-Skandal sehen, wenn die oberste und letzte Instanz die Marktwirtschaft von selber aushöhlt. Da bringt das beste Gesetz nichts mehr. Nicht einmal eine ordentliche Buchhaltung wird in Salzburg eingehalten – nicht einmal das, und das ist die Basis jeder Volkswirtschaft, eine Basis für jedes Unternehmen!
Wenn ich mir kurz den Rechnungshofbericht anschaue – ohne jetzt hier darauf einzugehen –, was der da festgestellt hat, über 400 Konten, die da herumschwirren, dann frage ich mich doch, ob das alles überhaupt annähernd realwirtschaftlich zu messen ist. – Sicherlich nicht! (Bundesrätin Zwazl: Schau einmal nach Kärnten!)
Rechnungsführung, keine Spekulation und Konsequenzen ziehen: Das wäre die Aufgabe einer Staatswirtschaft, und das passiert nicht. (Weiterer Zwischenruf der Bundesrätin Zwazl.)
Ein Grundgedanke zuletzt, sehr geehrter Herr Staatssekretär, und zwar, ob nicht, wenn es jetzt zu einer harmonisierten europäischen Verordnung kommen sollte – vielleicht ist das ohnehin schon in diesem Sinne geschehen –, vorab schon eine Finanzmarktaufsicht tätig werden könnte, um so einen Fall wie Zypern zu verhindern. Wenn eine Bank 4 Prozent Zinsen auf Sparguthaben verspricht, ist es ein Schneeballsystem, und irgendwann muss es aus sein. Da wäre es vielleicht besser, wenn eine Aufsichtsbehörde vorher eingreift als im Nachhinein.
In diesem Sinne stimmen wir diesem Gesetzesbeschluss zu. Eine Stärkung der Finanzmarktaufsicht ist sicherlich sinnvoll. – Danke. (Beifall bei der FPÖ.)
16.58
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz: Zu Wort gelangt nun Herr Staatssekretär Mag. Schieder. – Bitte.
16.58
Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen Mag. Andreas Schieder: Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren des Bundesrats! Vielleicht zuerst zu den Fragen, die angerissen wurden, die aber mit dem Gesetz im engeren Sinn gar nicht so viel zu tun haben. Ein Hinweis: Ich würde mir ja wünschen, dass Sie recht hätten und die Krise überall anders schon vorbei ist und nur mehr in Europa bestünde. – Ich wünsche mir natürlich nicht, dass die Krise in Europa noch nicht vorbei ist, aber ich würde mir wünschen, dass es wenigstens stimmen würde, dass sie überall anders vorbei ist.
Leider ist die Krise aber auch in den USA nicht vorbei. Erinnern Sie sich doch an all die Fragen, die dort vor Weihnachten aufgetaucht sind, und zwar unter der Bezeichnung „fiscal cliff“, was ja das Bild vermittelt, fiskalisch droht die USA den Abgrund hinunterzustürzen, und zwar haushaltstechnisch und so weiter. Das sind nicht wirklich Indikatoren, die darauf schließen lassen, dass dort alles wieder in Ordnung und vorbei ist. Wenn man die Arbeitslosenzahlen vergleicht, würde ich sogar sagen, dass die Krise in den USA keineswegs vorbei ist, im Vergleich zum Beispiel zu österreichischen Arbeitslosenzahlen, die ja doch wesentlich niedriger sind; wir haben ja immerhin auch eine steigende Beschäftigung.
Aber auch in Österreich und in Europa ist es nicht so, dass man sagen kann, man kann die Hände in den Schoß legen, die Krise ist vorbei, sondern es gilt, jetzt an dem zu arbeiten, was die Spät- und Langzeitfolgen der Krise sind: hohe Arbeitslosigkeit, hohe Jugendarbeitslosigkeit, natürlich große Verunsicherung der Leute um ihren Job, um ihr Einkommen. Neben diesen Fragen geht es natürlich auch um Fragen, die mit dem europäischen Währungssystem zu tun haben.
Aber eines sei Ihnen auch gesagt: Es ist eine Finanzmarktaufsicht nie dafür zuständig, zu schauen, wie die Staaten beieinander sind. Das ist nicht Aufgabe der Finanzmarktaufsicht. Zu den Zinsen: Das gesamte Zinssystem ist eigentlich eines, das noch sehr stark an den Nationalstaaten hängt – ja auch eines der Probleme der Europäischen Union.
Darin liegt auch eine Antwort auf die Frage, warum die Berufungsinstanz von der FMA das Bundesverwaltungsgericht ist, nicht das Finanzgericht. Das ist ganz einfach deshalb so, weil das Bundesfinanzgericht quasi die Übertragung dessen ist, wofür der Unabhängige Finanzsenat zuständig war, und das sind die Angelegenheiten in Steuern- und Abgabenfragen. Nur weil „Finanz“ in beiden drinnen steckt, nämlich Finanzmarktaufsicht und Finanzministerium, sind es trotzdem zwei verschiedene Geschichten. Das Bundesfinanzgericht ist das, das dem Finanzministerium auf die Finger klopft oder wo Bürgerinnen und Bürger gegen Bescheide berufen können, wenn sie finden, sie sind nicht richtig, falsch beurteilt, was auch immer. Das ist ja auch Ausdruck der Rechtsstaatlichkeit.
Allgemein aber, muss man sagen, ist dieser Teil der aus der Finanz kommende Teil einer doch großen Reform in unserem Land, der auch die Länder sehr stark berührt, nämlich die Vereinheitlichung der gesamten Verwaltungsgerichte. Das ist ein wesentlicher gelebter und umgesetzter Beitrag zur Verwaltungsreform. Man muss doch sagen, mit dem neuen, zweistufigen Prinzip neun plus zwei, also jeweils neun Landesverwaltungsgerichte und dann eben die zwei Bundesgerichte, nämlich das Bundesverwaltungsgericht und das Bundesfinanzgericht, gibt es viel, viel weniger Einheiten als die ganze Fülle von Sonderbehörden, die wir zum Teil in Österreich hatten. Das waren bis zu 120.
Um die Qualität, auch die Expertise sicherzustellen, sind natürlich viele Leute, die in den Unabhängigen Verwaltungssenaten, Unabhängigen Finanzsenaten und anderen
Senaten tätig waren, größtenteils in die neuen Gerichte gewechselt. Das ist ja sinnvoll, denn die Leute, die es können, die sich auskennen und die Erfahrung haben, sollen natürlich auch in der neuen Struktur mitwirken können.
Zum nächsten Thema muss ich dem Kollegen Schreuder meine Verwunderung aussprechen, weil wir gerade von grüner Seite bis jetzt immer in der Forderungsrhetorik gewohnt waren, dass die aufschiebende Wirkung gerade bei Finanzmarktbescheiden als besonders kritisch gesehen worden ist, was ja auch der erste Teil der Aussage war. Ich verstehe nur nicht, warum man jetzt genau das als Grund heraussucht, dass man dem skeptisch gegenübersteht, denn es ist ja ein Fortschritt, weil genau in Finanzmarktfragen Zeit Geld ist. Und wenn wir keine aufschiebende Wirkung haben, dann werden zwar Dinge erkannt, aber nicht geändert, weil sie so weiterlaufen.
Wir haben ja auch in Österreich solche schmerzhaften Themen gehabt, ich sage nur AWD und wie sie alle heißen, und es ist auch internationaler Standard bei allen anderen Aufsichtsbehörden. Und wir haben zur Rechtssicherheit und für die spezifischen Fälle ja auch die Möglichkeit, dass aufschiebende Wirkung vom Bundesverwaltungsgericht in Einzelfällen – gemäß dem Prinzip: dort, wo es angebracht ist – auch zuerkannt werden kann.
Also es ist genau dieser Gedanke dabei, daher wollte ich jetzt zum Nachdenken mitgeben, dass eigentlich das, was hier moniert worden ist, in Wahrheit genau so richtigerweise auch in diesem Bereich umgesetzt ist.
Daher schließe ich nicht nur meinen Appell an die Bundesräte an – wie den Kollegen Lampel, der auch diesen Punkt konkret angesprochen hat –, die schon zum Ausdruck gebracht haben, dem Gesetz zuzustimmen, sondern ich appelliere insbesondere auch an die, die noch kritisch waren, genau eingedenk dieser Argumente vielleicht auch noch zuzustimmen! (Beifall bei SPÖ und ÖVP sowie bei Bundesräten der FPÖ.)
17.04
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz: Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Bitte, Frau Präsidentin Zwazl.
17.04
Bundesrätin Sonja Zwazl (ÖVP, Niederösterreich): Frau Präsidentin! Herr Staatssekretär! Du hast es herausgefordert, lieber Kollege Pisec: Sich herzustellen und vollmundig über eine Wirtschaftskammerorganisation zu schimpfen, wo man nicht einmal in der Lage ist, richtig zu wählen, denn die Wiener Wirtschaftskammer verdankt den Freiheitlichen, dass in 14 Fachgruppen die Wahl aufgehoben wird, weil ihr zwei einander (Bundesrätin Mühlwerth: Ja, weil falsch !) – Halt, halt, halt, Monique: weil ihr zwei sich nicht grün seiende freiheitliche Listen habt (Bundesrätin Mühlwerth: Das hat schon gestimmt!) und auf beiden Listen ein und dieselben Personen draufstehen habt! (Bundesrätin Mühlwerth: Na, na!) – Ich weiß schon, aber ich sage dir etwas: Ich lade dich ein, wir haben eine Funktionärsakademie, da lernt man, wie sich die Wirtschaftskammer zusammensetzt und welche Konzepte sie hat – kostenlos! (Heiterkeit und Beifall bei ÖVP und SPÖ sowie bei Bundesräten der Grünen.)
17.05
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz: Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. – Doch! Nächster Redner: Herr Kollege Pisec. (Zwischenrufe bei der SPÖ.)
17.05
Bundesrat Mag. Reinhard Pisec, BA (FPÖ, Wien): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Staatssekretär! Als Unternehmer brauche ich eine Vertretung (Bundesrätin Zwazl: Ja! Und die ist auch gut, die wir haben!), und Unternehmer leiden unter
zu hohen Steuersätzen und Abgabekosten. Das vertritt die Wirtschaftskammer nicht! (Weitere Zwischenrufe der Bundesrätin Zwazl.) Und deswegen wollen wir Freiheitliche eine eigene Fraktion in der Wirtschaftskammer haben und diese Zustände aufdecken. (Zwischenrufe bei ÖVP und SPÖ.)
Und ein zweites Problem ist: Ihr kriegt 1 Milliarde € Jahreseinnahmen, Zwangsabgaben, Zwangsgebühren. (Weitere Zwischenrufe bei ÖVP und SPÖ.) Zweimal im Jahr gibt es Sitzungen, zweimal im Jahr von 15 bis 18 Uhr. Ja darf denn das wahr sein? Ist das eine Arbeitsleistung? – Erstens. (Zwischenruf der Bundesrätin Zwazl.) – Ich bin noch nicht fertig! (Bundesrätin Zwazl: Ja, red!)
Zweitens: Was passiert mit den Anträgen? Was passiert mit den Anträgen? Gibt es da irgendeine Information, eine Stelle? (Bundesrätin Zwazl: Ja! Ja! – Weitere anhaltende Zwischenrufe bei ÖVP und SPÖ.)
Unsere Anträge waren: Senkung der Steuern, Senkung der Lohn- und Einkommensteuer, Senkung der Mineralölsteuer, Abschaffung der kalten Progression – mitgestimmt mit deinem Wirtschaftsbund. Was passiert? – Nichts. Aus diesem Grund gehört diese Wirtschaftskammer reformiert, um endlich die Interessen der Unternehmer zu vertreten. – Danke. (Beifall bei der FPÖ.)
17.06
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz: Zweite Wortmeldung: Frau Bundesrätin Zwazl. – Bitte.
17.06
Bundesrätin Sonja Zwazl (ÖVP, Niederösterreich): Es ist, glaube ich, fast gescheiter, wir gehen auf einen Kaffee mit einem Lautsprecher hierher, damit wir das hier heute nicht aufhalten. Aber noch einmal: Ich lasse nicht meine Wirtschaftskammerorganisation, die die Einzige ist, die wirklich erfolgreich die Unternehmerinnen und Unternehmer vertritt, und vor allem die Klein- und Mittelbetriebe, von jemandem kritisieren, der sich nicht die Mühe macht, die Organisation überhaupt kennenzulernen und zu wissen, wie sie funktioniert – denn sonst kann ich mich hier nicht herstellen und von zwei Veranstaltungen im Jahr sprechen. (Bundesrat Mag. Pisec: Zu gut kenne ich sie, zu gut!)
Es gibt die Fachgruppen, wo ganz gezielt Interessenvertretung gemacht wird, es gibt unsere Wirtschaftsparlamente. (Zwischenruf des Bundesrates Kneifel. – Bundesrat Mag. Pisec: Ihr lasst uns ja nicht reden!) – Dann schau dir das jetzt einmal an, ich bringe dir die Unterlagen mit!
Ihr wart diejenigen, die ganz einfach nicht in der Lage waren, richtig zu wählen, weil ihr euch viel zu wenig die Mühe macht, diese Organisation anzuschauen.
Und eines sage ich dir: Ich komme aus einem kleinen Unternehmen. Ich stehe hier als Präsidentin einer der größten Wirtschaftskammern Österreichs, und zwar deshalb, weil es keine bessere Vertretung gibt als die Wirtschaftskammerorganisation! (Beifall bei der ÖVP sowie des Bundesrates Beer. – Zwischenruf der Bundesrätin Mühlwerth.)
17.08
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz: Ich gehe davon aus, dass nun keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen. – Das ist der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Die Abstimmung über die gegenständlichen Beschlüsse des Nationalrates erfolgt getrennt.
Wir gelangen zunächst zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend ein Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz aus dem Bundesministerium für Finanzen.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Es ist dies die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Wir kommen nun zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Konsulargebührengesetz 1992 und weitere Gesetze geändert werden.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Es ist dies die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein über die Zusammenarbeit im Bereich der Steuern samt Schlussakte einschließlich der dieser beigefügten Erklärungen (2151 d.B. und 2235 d.B. sowie 8923/BR d.B.)
13. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Stiftungseingangssteuergesetz geändert wird (2236 d.B. sowie 8924/BR d.B.)
14. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend Protokoll zur Abänderung des am 5. November 1969 in Vaduz unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (2145 d.B. und 2237 d.B. sowie 8925/BR d.B.)
Vizepräsidentin
Mag. Susanne Kurz: Wir gelangen nunmehr
zu den Punkten 12
bis 14 der Tagesordnung, über welche die Debatte unter einem
durchgeführt wird.
Berichterstatter zu den Punkten 12 bis 14 ist Herr Bundesrat Zehentner. Ich bitte um die Berichte.
Berichterstatter Robert Zehentner: Geschätzte Frau Präsidentin! Geschätzter Herr Staatssekretär! Ich komme nun zum Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend ein Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein über die Zusammenarbeit im Bereich der Steuern samt Schlussakte einschließlich der dieser beigefügten Erklärungen.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor; ich komme daher sogleich zur Antragstellung.
Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 3. April 2013 mit Stimmenmehrheit den Antrag,
1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben,
2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
Ich komme nun zum Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Stiftungseingangssteuergesetz geändert wird.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor; ich komme daher zur Antragstellung.
Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 3. April 2013 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Ich komme nun zum Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend Protokoll zur Abänderung des am 5. November 1969 in Vaduz unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen.
Der Text liegt allen Abgeordneten vor; ich komme daher zur Antragstellung.
Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 3. April 2013 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag,
1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben,
2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz: Ich danke für die Berichte.
Wir gehen in die Debatte ein.
Als Erster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Pisec. – Bitte.
17.12
Bundesrat Mag. Reinhard Pisec, BA (FPÖ, Wien): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Staatssekretär! Ich erlaube mir, diese drei Gesetze zusammenzufassen: Bei Gesetz Nummer 1 und 3 sind wir dagegen, bei dem Gesetz in der Mitte sind wir dafür. (Ruf bei der SPÖ: Wie geht das?)
Liechtenstein hat 35 000 Einwohner, existiert in den heutigen Grenzen seit zirka 300 Jahren und hat alle Wirren der Geschichte bis heute unbeschadet überstanden. Regiert wird es von der Dynastie der Liechtensteins in der 10. Generation. Es ist nicht Mitglied der EU aber Teil – das ist das Interessante – des EWR-Raumes. Das heißt, der europäische Binnenmarkt gilt auch für Liechtenstein – im Unterschied zur Schweiz. Die Schweiz ist nicht Mitglied des EWR-Raumes und muss daher immer Assoziierungsabkommen abschließen, Liechtenstein nicht, das gilt automatisch.
Das wäre vielleicht damals, 1995, ein Modell für Österreich gewesen, um diesem ganzen Euro-Desaster zu entgehen – aber das ist jetzt sowieso schon Historie.
Liechtenstein war bis 1918 eng an die Habsburger-Monarchie angegliedert, Teil der österreichischen Zollunion, hatte auch die Krone bis zum Zerfall der Habsburger-Monarchie im Ersten Weltkrieg, hat sich dann an die Schweiz angelehnt, und heute ist die dortige Währung der Schweizer Franken, mit all seinen Vorzügen gegenüber dem Euro.
Aus dem Schmuddel-Image konnte sich Liechtenstein in den letzten Jahren befreien. Da gibt es diesen Financial Secrecy Index. Liechtenstein ist da auf die 35. Stelle abgerutscht. Das ist ein sogenannter Steueroasenindex. Liechtenstein wird heute international anerkannt, sowohl was die Wirtschaft, die Politik sowieso und den Finanzmarkt betrifft.
Liechtenstein weist etwas auf, worum es die Länder heutzutage alle beneiden, und das ist der Wettbewerbsvorteil schlechthin, deshalb brauchen sie dieses Steueroasenmo-
dell gar nicht mehr machen: Das ist das Vertrauen, das ist die Rechtssicherheit. Darum geht es nämlich heute im Zeitalter der Unsicherheit. Es geht um das Vertrauen, es geht um die Sicherheit. Da sind die Zinsen gar nicht mehr so wichtig. Man muss sich eher anschauen: Wer steht hinter den ganzen Zinsen? Wer steht hinter dem ganzen Komplex? Kann ich überhaupt jemals mein Geld wieder zurückbekommen? Also die Frage der Zahlungsunsicherheit und Zahlungssicherheit, die Frage der Solvenz wird wichtiger denn je.
Kurz zur Dynastie der Liechtensteins: Sie sind in Wien sehr repräsentativ. Sie haben zwei Palais, die sind wunderbar restauriert. Das ist das Gartenpalais im 9. Bezirk und das Stadtpalais, das soeben renoviert und eröffnet worden ist, unmittelbar vor dem Bundeskanzleramt. Es wurde historisch einwandfrei mit den Privatgeldern vom regierenden Fürsten Hans-Adam II renoviert und ist ein Beispiel für die österreichische Stadtkultur im Sinne der Erhaltung. (Staatssekretär Mag. Schieder: Und die Burg Liechtenstein!) – Und die Burg Liechtenstein, denn von dort kommt der Name, richtig. Der lichte Stein ohne e, der helle Stein, war ursprünglich der Sinn, deswegen heißt die Burg Liechtenstein so und heißt die Dynastie so, richtig.
Aber ich wollte jetzt auf die Kunstsammlung eingehen. Die Kunstsammlung ist zum Teil von Liechtenstein nach Wien transferiert worden. Eines der – in Klammer: wenigen – Highlights von Bürgermeister Häupl ist, dass er damals vor Ende des 20. Jahrhunderts gemeint hat: Ich gebe das Gartenpalais den Liechtensteins zurück, dafür müsst ihr die Kunstsammlung herbringen! Und in diesem Sinne steht es heute da, ein Juwel an österreichischer Revitalisierung.
Der Fürst hat auch ein interessantes Buch geschrieben, und zwar „Der Staat im dritten Jahrtausend“, das man jedem nur empfehlen kann zu lesen. Aber ich darf hier einiges zitieren:
Der Staat muss sich von einem ineffizienten Monopolbetrieb in ein effizientes Dienstleistungsunternehmen verwandeln. – Zitatende.
Oder: Die Finanzkrise ist nicht ein Marktversagen, sondern ein Versagen des Staates, seiner Gesetze, seiner Verordnungen und seiner Aufgaben. – Zitatende.
Und das Hauptproblem, das ich schon genannt habe, wird in Zukunft die Zahlungsunfähigkeit sein. – Ein Buch, das hochinteressant zu lesen ist, leicht geschrieben; und ich habe es, ehrlich gesagt, in einem halben Nachmittag ausgelesen.
Kurz zu dem Thema, das der Herr Staatssekretär Ostermayer angesprochen hat, zur Einlagensicherung: Der österreichische Staat garantiert jedem 100 000 € Einlagensicherung. Also die gesamte Summe dieser Einlagensicherung würde 150 Milliarden € in Österreich ausmachen; die soll der österreichische Staat garantieren? – vor dem Hintergrund von 240 Milliarden € Schulden, 170 Milliarden € an Haftungen. Und mit dem gesamten Euro-Desaster dazu garantiert er 150 Milliarden €. Ich, als Bürger, glaube das nie und nimmer.
Vielleicht wird es besser – warten wir ab. Aber Krisen können resistent sein, die sind nicht so leicht zu lösen, vor allem diese europäische Euro-Krise – und es geht da ja um die Euro-Krise. In diesem Sinne lehnen wir, wie gesagt, zwei Gesetze ab, einem stimmen wir zu. – Danke. (Beifall bei der FPÖ.)
17.18
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz: Als Nächste zu Wort gelangt Frau Bundesrätin Dr. Winzig. – Bitte.
17.18
Bundesrätin Dr. Angelika Winzig (ÖVP, Oberösterreich): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Staatssekretär! Ja, Herr Kollege, bei der Geschichte der
Liechtensteins kennen Sie sich entschieden besser aus als bei der Organisation der Wirtschaftskammer. Aber das kann man auch lernen, das ist auch nicht so schwierig – und da gibt es sicher auch ein verständliches Buch darüber. (Heiterkeit.)
Zum Thema: Unversteuertes Geld ins Ausland zu verschieben ist Betrug an der österreichischen Bevölkerung, kann aber leider trotz strenger Gesetze – wir haben ja die Verdoppelung der Strafen, auch die Schaffung der Finanzpolizei – nicht eliminiert werden, denn wir stoßen da im wahrsten Sinne an unsere Grenzen, nämlich an unsere geographischen Grenzen.
Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten: Entweder wir lassen das Geld dort, wo es ist, unversteuert, zur Freude der Steuerflüchtlinge und auch zur Freude der Steueroasen, so wie es eben der Wunsch der Opposition ist, oder wir beschließen ein bilaterales Abkommen, zu dem wir, das heißt das Finanzministerium, Liechtenstein überzeugen konnten – das war ja auch kein Sonntagsspaziergang –, und holen uns die Steuereinnahmen zurück.
Ich möchte noch betonen, das Abkommen spricht sich nicht gegen eine europäische Lösung aus. Wie so oft könnten wir auch in diesem Fall wieder Vorreiter sein.
Bei der Diskussion im Nationalrat war ja die Befürchtung, dass durch dieses Abkommen weniger Steuern hereinkommen und die Großen wieder geschützt und die Kleinen benachteiligt werden. Aber wenn Sie sehen, wie jetzt die Steuerberater zur Selbstanzeige auffordern – das bedeutet Transfer des Geldes nach Österreich und dortige normale Besteuerung –, dann liegt der Vorteil dieses Abkommens sicherlich nicht in der wesentlich geringeren Steuer, sondern der Anreiz – und man muss bei so einem Abkommen einen Anreiz schaffen – ist die Straffreiheit.
Herr Staatssekretär, ich gratuliere Ihnen, der Frau Finanzministerin und Ihrem Team zu diesem Abkommen. Man sieht hiermit, dass die Bundesregierung nicht in dem Stillstand verharrt, den sich die Opposition immer herbeiredet, sondern schnelle, unkonventionelle Lösungen herbeiführt, die zum Wohle der Österreicherinnen und Österreicher sind. (Beifall bei der ÖVP und bei Bundesräten der SPÖ.)
17.20
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Dönmez. – Bitte.
17.20
Bundesrat Efgani Dönmez, PMM (Grüne, Oberösterreich): Hohes Präsidium! Sehr geehrter Herr Staatssekretär! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Manchmal braucht man ja wirklich nicht viele Worte zu verlieren, sondern man kann einfach Bilder für sich sprechen lassen. Und ich werde den Kameramann vom ORF ersuchen, dieses Bild ein bisschen einzufangen für die ZuseherInnen zu Hause. (Der Redner zeigt ein Bild.)
Hier steht „Leistung“, darunter „ÖVP-Parlamentsklub“ und dahinter „unsere Verantwortung“. Das werdet ihr kennen, nehme ich einmal an. (Der Redner zeigt ein weiteres Bild.)
Und da haben wir von der SPÖ „Zeit für Gerechtigkeit! Faire Verteilung. Soziale Ausgewogenheit. Gleiche Chancen.“ – Dafür steht ihr, genau.
In diesem Land fühlen sich all jene ÖsterreicherInnen, die ehrlich Steuern bezahlen, so wie jetzt zu diesem Tagesordnungspunkt argumentiert worden ist, als die Volltrottel dieser Nation. Wenn Steuersünder begnadigt werden und nur die Hälfte jener Abgaben zu zahlen haben, die sie zu zahlen hätten, und wenn Sie sich dann hier herstellen,
geschätzte KollegInnen, und von Steuergerechtigkeit sprechen, dann muss ich sagen, das versteht keiner. (Beifall des Bundesrates Schreuder.)
Das versteht niemand, der ein Sparbuch hat und da 25 Prozent KESt abführen muss oder der sonstige Veranlagungen hat und seine Steuern abführt. Dies im Gegensatz zu jenen, die undurchsichtige Konstrukte wählen. Und diese Konstrukte sind ja nicht illegal, das muss man ja auch erwähnen, diese Konstrukte wurden von der internationalen Staatengemeinschaft teilweise verabschiedet, und auch in diesem Haus hat es ja Zustimmung zu dem einen oder anderen Konstrukt gegeben. Das sind legitime Formen, wie man steuerschonend sein Geld im Ausland veranlagen kann.
Und ich verstehe nicht, warum man von Steuerflüchtlingen spricht. Das sind keine Steuerflüchtlinge, die müssen nicht flüchten, die sind keiner Bedrohung ausgesetzt. Das, was die betreiben, ist Sozialbetrug, Sozialbetrug und nichts anderes, weil sie den Staat, die Nationalstaaten schwächen, weil sie Einnahmen, die dem Staat zustehen würden, die wir für die Bildung, für den Sozialbereich und so weiter brauchen, einfach nicht aufbringen. Das ist Sozialbetrug und nicht Steuerflucht. Und das wird teilweise Hand in Hand mit den Finanzinstituten und mit den Banken organisiert, verwaltet und auch erleichtert.
Dies ist ja nichts Neues, wir wissen ja schon seit Jahren, ja Jahrzehnten, dass es derartige Konstrukte gibt. Das Neue ist jetzt allerdings, dass durch diese Offshore-Leaks, die ja in den letzten zwei Tagen in den Zeitungen publik waren, jetzt ganz konkrete Namen genannt werden. (Zwischenruf des Bundesrates Günther Köberl.)
Es sind über 2,5 Millionen Dokumente gefunden worden, 130 000 Personen aufgeteilt auf über 180 Nationen. Diese wurden investigativen Journalisten zugespielt, und die sind einem Kodex verpflichtet – und das rechne ich ihnen ganz hoch an, dass sie die Quelle nicht preisgeben. Das ist die Aufgabe der Behörde, an diese Informationen heranzukommen. Die Journalisten, die das aufgedeckt haben, sind kooperationswillig, aber sie werden nicht die Quelle preisgeben, und das ist ihnen auch sehr hoch anzurechnen. (Zwischenruf der Bundesrätin Dr. Winzig.)
Kollegin Winzig hat völlig recht, es sind nicht alle Steuerbetrüger, das habe ich auch nicht gesagt, aber es sind Unsummen an Beträgen, wo die Herkunft doch sehr fraglich ist. Ich glaube, da sind wir uns schon einig. Ich kenne keinen Arbeiter, der zig Millionen auf die Seite legen kann, sondern das sind Gelder aus Drogengeschäften, aus Waffengeschäften, wo Steuerhinterziehung betrieben wird, von Spekulanten, und diese sind in den Steuerparadiesen steuerschonend gebunkert, mit Duldung der internationalen Staatengemeinschaft.
Das sind Gelder, die uns gerade in der Zeit der Krise abgehen, wo wir doch Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit setzen sollten. Wir haben doch heute am Vormittag diskutiert, wie wichtig es ist, dass wir gegen die Arbeitslosigkeit ankämpfen, dass die beste Sozialabsicherung ist, Arbeitsplätze zu schaffen. Gerade wenn man sich Spanien, Portugal, Griechenland und viele, viele andere Länder ansieht, wo die Jugendarbeitslosigkeit relativ hoch ist, ja fast bei 50 Prozent liegt, wenn nicht teilweise höher, und man sich dann ansieht, welche Beträge da herumliegen, vorbei an den Nationalstaaten, dann, muss ich sagen, ist doch eine massive Schieflage gegeben. Und das muss man auch ansprechen, dass mit Briefkastenfirmen, mit undurchsichtigen Veranlagungen, mit Offshore-Konten, mit Trusts Millionen steuerschonend an den Nationalstaaten vorbeigeschmuggelt werden.
Die Schätzung von Tax Justice Network aus dem Jahre 2012 belegt das auch. Es sind in etwa 21 bis 32 Billionen US-Dollar in Steueroasen veranlagt, und dadurch entgehen den Staaten 280 Milliarden € an Steuern. 280 Milliarden €! Das sind keine Peanuts, da kann man vieles bewegen. Und die Politik und die Politiker, die in den nationalen Par-
lamenten mitgestimmt haben, dass derartige Konstrukte entstehen können, sind für diese Situation mitverantwortlich.
Wir können uns jetzt nicht herstellen und sagen: Weiße Weste, wir haben nichts gewusst. Wir sind Teil des Problems, wir sind aber auch Teil der Lösung. Wenn die Politik wieder Glaubwürdigkeit zurückbekommen möchte, dann müssen wir das Zepter wieder in die Hand nehmen. Wir müssen wieder die Richtung vorgeben. Zurzeit haben wir längst das Zepter verloren. Die Politik ist in vielen Bereichen nicht mehr die richtungsweisende Kraft. Das sind die Finanzmärkte, das sind die Banken. Diese treiben uns vor sich her, die ziehen uns am Gängelband. Und wenn wir das ändern möchten, dann müssen wir schauen, dass wir derartige Lücken, die es gibt, so schnell wie möglich schließen, damit die Gelder, die uns, dem Staat, zur Verfügung stehen, auch in sinnvolle Projekte und Bereiche investiert werden.
Wir haben ja ehemals einen Finanzminister gehabt, Karl-Heinz Grasser. In vielen, vielen Reden wurden ja unter anderem der Nationalstaat und der Patriotismus immer wieder hervorgehoben. Wenn jemand zu diesem Land, zu Österreich, steht, warum hat er es notwendig, dass er seine Millionen im Ausland ins Trockene bringt? Warum veranlagt er als österreichischer Politiker diese Gelder nicht hier in Österreich? Wir müssen doch als Vorbild voranschreiten. Und genau solche Beispiele, die keine Einzelfälle sind, tragen dazu bei, dass die Politikerverdrossenheit nicht abnimmt, sondern zunimmt.
Ich kann nur innigst dafür plädieren, dass wir das Zepter wieder in die Hand nehmen und den entfesselten Kapitalismus und die Finanzmärkte in geordnete Bahnen lenken, denn sonst sind wir nach wie vor die Getriebenen und können nicht die Richtung vorgeben – und das möchte ich nicht.
Ich bin nicht in die Politik gegangen, damit andere mich vor sich hertreiben, sondern ich bin in die Politik gegangen, damit man auf gleicher Augenhöhe miteinander diskutiert und die Rahmenbedingungen gestaltet. Gegenwärtig gestalten wir nicht die Rahmenbedingungen, sondern wir sind Feuerlöscher. Wir haben allerdings keinen Feuerlöscher, sondern wir haben Eimerchen, und vor uns ist ein riesengroßer Brand. So werden wir den Brand sicher nicht eindämmen können, sondern da müssen wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen, wurscht, welche Partei, welche Fraktion, denn sonst spielen sie uns alle miteinander nationalstaatlich aus und tanzen uns weiterhin auf der Nase herum. – Danke. (Beifall des Bundesrates Schreuder und bei Bundesräten der SPÖ.)
17.29
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Bundesrat Lampel. – Bitte.
17.30
Bundesrat Michael Lampel (SPÖ, Burgenland): Sehr geschätzte Frau Präsidentin! Herr Staatssekretär! Liebe Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat! Es wurde über dieses Liechtensteiner Abkommen von meinen Vorrednern schon vieles an Positivem und Negativem geäußert. Nur eines muss uns bei den Abkommen schon klar sein: Das Abkommen mit Liechtenstein, wie auch das Abkommen mit der Schweiz – was aufgrund von vielen Selbstanzeigen und Geldrücküberweisungen nach Österreich bereits gezeigt wird – mindern deutlich die Anreize für Steuerflucht. Und es wird durch diese Abkommen immer unattraktiver, das Geld in die Schweiz oder hinkünftig auch nach Liechtenstein zu bringen.
Von welchen Summen reden wir da? – Aufgrund des Abkommens mit Liechtenstein kann Österreich mit Einnahmen aus der Einmalzahlung der liechtensteinischen Banken und Treuhänder von rund 500 Millionen € für 2014 rechnen. In weiterer Folge sollen ja
die Einnahmen aus der Besteuerung von Kapitalerträgen österreichischer Steuerpflichtiger in Liechtenstein jährlich 20 Millionen € betragen.
Dieses heute zu beschließende Abkommen mit Liechtenstein bringt nicht nur Einnahmen, sondern – und da widerspreche ich Ihnen, Efgani – ist auch ein kleiner, aber wichtiger Schritt in Richtung mehr Steuergerechtigkeit und zurzeit die einzige Möglichkeit, auch die reichen Österreicherinnen und Österreicher zur Mitfinanzierung unserer Gesellschaft zu zwingen.
Natürlich wäre eine europäische Lösung sehr wichtig, und man sollte auch intensiv daran arbeiten. Aber was wäre die Alternative zu diesem gegenständlichen Abkommen gewesen? – Gar kein Geld zu erhalten, weiter zu verhandeln und auf 500 Millionen € zu verzichten. Hätten wir das bei der Schweiz gemacht und jetzt bei Liechtenstein, dann würden wir, geschätzte Damen und Herren, auf 1,5 Milliarden verzichten.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor einem Jahr wurde der Vertrag mit der Schweiz unterzeichnet. Heute beschließen wir einen weiteren Vertrag, um den Steuerbetrugstourismus weiter einzudämmen.
Ich habe vorhin von 1,5 Milliarden € gesprochen. Man möge sich das vorstellen: 1 Milliarde € ist die Höhe des Budgets des Burgenlandes. Hier geht es um 1,5 Milliarden €, dieser Betrag ist also höher als das Budget des Burgenlandes. Auf diesen Betrag hätten wir verzichtet, hätten wir diese Steuerabkommen nicht abgeschlossen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich danke dem Verhandlungsteam für diesen Erfolg. Meine Partei wird diesem Abkommen mit Liechtenstein gerne zustimmen. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.)
17.32
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz: Zu Wort gelangt Herr Staatssekretär Mag. Schieder. – Bitte.
17.33
Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen Mag. Andreas Schieder: Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich kann voll unterstreichen, was mein Vorredner, Herr Bundesrat Lampel, zu diesem Thema gesagt und analysiert hat.
Es ist auch keine leichte Situation, denn es geht hier um Leute, die Umsatzsteuer, Einkommensteuer, andere Arten von Abgaben sehr oft nicht abgeliefert haben und ihr Geld in anderen Ländern – das letzte Jahr war das Thema die Schweiz, jetzt ist das Thema Liechtenstein, hier noch mit dem Zusatz, dass es nicht um Konten geht, sondern um Stiftungskonstruktionen – geparkt haben.
Natürlich ist man der Meinung, man muss diese Leute völlig erwischen, wie man so schön sagt, das heißt, den Strafen zuführen und sie somit quasi dazu bringen, dass sie nicht nur alles zurückzahlen, sondern auch die Strafe zahlen.
Das Problem ist nur: Es gibt eine Verjährungsfrist. Somit gibt es jedes Jahr eine große Zahl von Leuten, die Danke sagen, wenn es Leute gibt, die sagen: Bevor man nicht alles regeln kann, machen wir gar nichts! Die denken sich: Super, fordert weiterhin immer alles, denn in der Zwischenzeit zahle ich gar nichts!
Und das ist ein Deal, der so nicht weitergehen kann. Der Deal muss sein, dass Leute, die ihr Geld nach Liechtenstein verfrachtet haben, in Zukunft auch einen steuerlichen Beitrag zahlen, so wie sie ihn zahlen hätten sollen, wenn sie das Geld nicht weggeschafft hätten.
Dieses Abkommen sieht auch vor, dass Leute – es gibt ja auch Leute, die vielleicht ihr Geld gar nicht aus Gründen der Steuerhinterziehung dorthin gebracht haben – gegen-
über der Finanz offen sagen können: Schaut her, ich habe ursprünglich ohnehin alles versteuert, ich bin ein Kind von Liechtenstein und deswegen habe ich mein Geld dort geparkt, habe es deswegen auch dort hinterlegt. Die sollen das auch machen können, wenn sie alles belegen können.
Bei allen anderen, die weiterhin Anonymität haben wollen, wird über den Stiftungstreuhandgeber auch eine Abgabe abgeführt. Und diese ist nicht so knapp bemessen. Diese beläuft sich nämlich auf zwischen 15 und 38 Prozent des dort liegenden Geldes, abhängig davon, wie lange das Geld dort geparkt ist – also je länger desto höher beziehungsweise auch je höher die Summe desto mehr beziehungsweise auch gemessen an den Bewegungen, weil man davon ausgeht, wer lange viel dort liegen hat und herumjongliert, sprich bewegt, der hat höchstwahrscheinlich, wenn er es nicht deklarieren will, etwas nicht so Gutes im Schilde geführt und soll dann eine Abgabe von bis zu 38 Prozent zahlen.
Das bringt Einnahmen von einer halben Milliarde Euro, die wir sehr, sehr vorsichtig geschätzt haben. Ich sage das deshalb, weil das Finanzministerium gerade bei solchen Einnahmen, wo die Potenziale höher liegen, die Pflicht hat, immer am untersten Limit zu schätzen. Aber wir alle hoffen ja auch, dass sogar noch mehr von dort hereinkommt. Wir wissen aber zum Teil nicht einmal ganz genau, wie viel dort liegt.
Es kommt auch noch dazu, dass in Zukunft diese Leute dort für ihre Veranlagungserfolge die gleiche Steuer zahlen, wie wenn sie diese daheim haben würden. Das bringt jährliche Zusatzeinnahmen von mindestens 20 Millionen €. Das ist schon ein Unterschied: 20 Millionen € jährlich und eine halbe Milliarde einmalig.
Bisher hatten wir die Regel, dass man, wenn man sein Geld nach Liechtenstein verfrachtet, eine 25 prozentige Stiftungseingangssteuer für das Geld, das man in eine Liechtensteiner Stiftung gelegt hat, in Österreich zu zahlen hatte. Das ist ein sehr hoher Steuersatz. Die Idee war, dass man, wenn man schon sein Geld wegschafft, auch ordentlich dafür zahlt.
Hereingekommen sind allerdings nur 3 000 € im Jahr, weil es keiner deklariert hat, weil die Leute Wege gefunden haben, es an den Behörden vorbeizuschmuggeln. Daran sieht man auch, dass das Problem nicht in unserem Steuersystem liegt, sondern es liegt im Liechtensteiner Steuersystem. Dieses Abkommen, wo Liechtenstein und die Liechtensteiner Struktur mit den Treuhandgebern und all dem auch mit im Boot sind, führt dazu, dass von diesem hinterzogenen Geld endlich auch in Österreich etwas ankommt.
Der zweite Punkt ist: Ich gebe allen Rednern recht, die betont haben – und da bin ich froh darüber, dass das auch hier im Bundesrat alle betont haben –, dass Steuerhinterziehung nicht ein Kavaliersdelikt ist, auch nicht irgendeine Sache ist, die man auf die leichte Schulter nehmen kann, schon gar kein Gegenstand von toller Buchhaltung oder eines tollen Steuerberaters, sondern das ist ein Verbrechen, das ist Hinterziehung, das ist eine Schädigung des gesamten Staates Österreich.
Und deswegen haben wir ja auch schon vor einiger Zeit die Strafen verdoppelt und die Hürden für die Strafen herabgesetzt, sodass sie auch schon früher gelten, und auch mit der Finanzpolizei massiv kontrolliert. Wir haben übrigens auch die Finanzpolizei vom Aufnahmestopp des Bundes bewusst ausgenommen, weil ich gesagt habe: Diese Leute brauchen wir ganz dringend, es ist notwendig, dass sie kontrollieren gehen, denn da kommt mehr Geld rein, als wir einsparen, wenn wir keine Leute dort aufnehmen.
Aber es stimmt, trotz hoher Strafen, trotz strenger Kontrollen bei Finanzvergehen gibt es immer wieder Vorgänge, die uns alle erschüttern.
Wir wissen auch, Offshore-Leaks führt uns erschütternd vor Augen, was hier los ist. Es gibt 170 betroffene Staaten, eine unvorstellbar große Anzahl von Akten und vermute-
ten Hinterziehungen. Das zeigt aber auch eine zweite Sache: Es ist kein österreichisches Problem, es ist kein Problem Österreichs mit seinen Nachbarn, es ist kein europäisches Problem, sondern es ist ein globales Problem. Geld wird global versteckt und hinterzogen.
Früher sind die Verbrecher, die Diebe herumgezogen und haben versucht, sich von einem Land zum anderen durchzuschlagen und sich irgendwo zu verstecken. Heutzutage sitzen diese Verbrecher im besten Anzug im besten Restaurant der Stadt, und ihr Geld fließt um den ganzen Erdball und versteckt sich am Schluss irgendwo in einer Steueroase. Daher ist es unsere politische Aufgabe, diese Steueroasen überall nahtlos trockenzulegen. Das Trockenlegen von Steueroasen ist leicht gefordert, nur muss man auch Ideen entwickeln, wie man das umsetzen kann.
Das eine ist, innerhalb der OECD, der Organisation der Industriestaaten der Welt, Regeln zu schaffen, wie man Informationen austauscht, wie man Doppelbesteuerungsabkommen – auch heute auf der Agenda, Ihr nächster Tagesordnungspunkt – so gestaltet, dass es bessere Informationen gibt.
Wir haben da auch einiges verschärft. Wir sind voll im internationalen Trend und haben auch immer dazugesagt – das sage ich auch ganz offen –, dass das österreichische Bankgeheimnis eine Idee ist, die den kleinen Sparer betreffen soll, aber nie und nimmer Steuerhinterzieher schützen soll. Das heißt, wenn es darum geht, internationale Abkommen abzuschließen, die die Information verbessern, dann werden wir das machen, und wir machen das auch heute beim nächsten Tagesordnungspunkt und auch hier mit dem Abkommen und den Doppelbesteuerungsabkommen.
Es geht aber auch darum: Wir haben sofort reagiert. Wir haben im Finanzministerium gleich eine Sondereinheit innerhalb der Abgaben- und Steuerprüfung zusammengestellt, die sich ganz bewusst diese Vorgänge rund um Offshore-Leaks anschaut – aktiv und passiv. Das heißt, sie kann, wenn es Informationen gibt, gleich bereit sein und reagieren. Sie schaut aber natürlich auch nach, was im Internet publiziert wird: Finden sich auf den Listen Namen von Österreichern? Muss man dem nachgehen oder nicht? Somit verschlafen wir nicht irgendwelche Dinge, sondern machen ganz aktiv mit, da das natürlich eine ganz wichtige Sache ist.
Ich glaube auch, dass wir auf europäischer Ebene eine Task Force brauchen: Wie können wir auch die Steueroasen, die es auf europäischem Hoheitsgebiet gibt, schließen? Das kann doch nicht sein – Virgin Islands und andere Themen, über die wir immer wieder lesen. Auf diesen Inseln und eigenen Staatsgebieten, die zwar irgendwie auch zu Europa gehören, die von einzelnen Mitgliedstaaten abgedeckt werden, wird aber trotzdem Geld versteckt und es werden Steuern hinterzogen und, und, und.
Wir sind in einem Themenbereich, der von Geldwäsche bis hin zu Steuerhinterziehung reicht. Das ist ein recht breiter Bereich. Ich meine, wir haben für die Kreditinstitute bei Geldwäscheverdacht sehr strenge Regeln. Können wir uns dort nicht auch etwas abschauen, das für Steuerhinterziehung tragbar ist?
Ich glaube, dass all diese Themen jetzt sehr schnell in Österreich und in der Europäischen Union diskutiert werden können, sodass wir ein Punkteprogramm bekommen. Dann können wir den Bürgerinnen und Bürgern sagen: Dank der engagierten Arbeit der Journalisten sind jetzt auch Namen von Leuten, die keiner entschuldigen will, ans Tageslicht gekommen. Wir finden, dass diese Leute alle den ordentlichen Gerichts- oder Finanzstrafverfahren – was jeweils zutreffend ist – global zugeführt gehören. Wir brauchen aber auch Antworten, wie wir das global schließen. Das hier ist eine kleine Antwort in diesem Bereich, aber es ist eine Antwort. Weitere werden auch noch folgen und folgen müssen. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.)
17.41
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz: Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall.
Die Debatte ist geschlossen.
Die Abstimmung über die gegenständlichen Beschlüsse des Nationalrates erfolgt getrennt.
Wir kommen zunächst zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend ein Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein über die Zusammenarbeit im Bereich der Steuern samt Schlussakte einschließlich der dieser beigefügten Erklärungen.
Da der gegenständliche Beschluss Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbereiches der Länder regelt, bedarf dieser der Zustimmung des Bundesrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz.
Wir gelangen zunächst zur Abstimmung über den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, um ein Handzeichen. – Es ist dies die Stimmenmehrheit. Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist somit angenommen.
Nun lasse ich über den Antrag abstimmen, dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, um ein Handzeichen. – Es ist dies die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Nun gelangen wir zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Stiftungseingangssteuergesetz geändert wird.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Es ist dies die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit angenommen.
Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend Protokoll zur Abänderung des am 5. November 1969 in Vaduz unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen.
Da der gegenständliche Beschluss Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbereiches der Länder regelt, bedarf dieser der Zustimmung des Bundesrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz.
Wir gelangen zunächst zur Abstimmung über den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einwand zu erheben.
Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, um ein Handzeichen. – Es ist dies die Stimmenmehrheit. Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist somit angenommen.
Nun lasse ich über den Antrag abstimmen, dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, um ein Handzeichen. – Es ist dies die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
15. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Chile zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und der Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt Protokoll (2134 d.B. und 2238 d.B. sowie 8926/BR d.B.)
16. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik San Marino zur Abänderung des Zusatzprotokolls zum am 18. September 2009 unterzeichneten Protokoll zur Abänderung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik San Marino auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt Protokoll (2136 d.B. und 2239 d.B. sowie 8927/BR d.B.)
17. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Republik Kosovo über Zusammenarbeit und gegenseitige Amtshilfe in Zollsachen samt Anhang (2152 d.B. und 2240 d.B. sowie 8928/BR d.B.)
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz: Wir kommen nun zu den Punkten 15 bis 17 der Tagesordnung, über welche die Debatte unter einem durchgeführt wird.
Berichterstatter zu den Punkten 15 bis 17 ist Herr Bundesrat Lampel. Ich bitte um die Berichte.
Berichterstatter Michael Lampel: Frau Präsidentin! Herr Staatssekretär! Ich bringe den Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Chile zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und der Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt Protokoll.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher gleich zur Antragstellung.
Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 3. April 2013 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag,
1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben und
2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
Ich komme zum Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss
des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend Abkommen zwischen der
Republik Österreich und
der Republik San Marino zur Abänderung des Zusatzprotokolls zum am
18. Septem-
ber 2009 unterzeichneten Protokoll zur Abänderung des Abkommens zwischen
der Republik Österreich und der Republik San Marino auf dem Gebiete der
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt Protokoll.
Der Bericht liegt Ihnen ebenfalls in schriftlicher Form vor, ich komme daher auch gleich zur Antragstellung.
Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 3. April 2013 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag,
1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben und
2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
Ich komme zum dritten Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Republik Kosovo über Zusammenarbeit und gegenseitige Amtshilfe in Zollsachen samt Anhang.
Der Bericht liegt Ihnen ebenfalls schriftlich vor; ich komme daher gleich zur Antragstellung.
Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 3. April 2013 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz: Danke für die Berichte.
Wortmeldungen liegen nicht vor.
Wünscht jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall.
Die Abstimmung über die gegenständlichen Beschlüsse des Nationalrates erfolgt getrennt.
Wir kommen zunächst zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend das Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Chile zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und der Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt Protokoll.
Da der gegenständliche Beschluss Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbereiches der Länder regelt, bedarf dieser der Zustimmung des Bundesrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz.
Wir gelangen zunächst zur Abstimmung über den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, um ein Handzeichen. – Es ist dies die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist somit angenommen.
Nun lasse ich über den Antrag abstimmen, dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, um ein Handzeichen. – Es ist dies die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit angenommen.
Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über den Beschluss
des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend ein Abkommen zwischen
der Republik Österreich und der Republik San Marino zur Abänderung
des Zusatzprotokolls zum am 18. Septem-
ber 2009 unterzeichneten Protokoll zur Abänderung des Abkommens zwischen
der Republik Österreich und der Republik San Marino auf dem Gebiete
der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt Protokoll.
Da der gegenständliche Beschluss Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbereiches der Länder regelt, bedarf dieser der Zustimmung des Bundesrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz.
Wir gelangen zunächst zur Abstimmung über den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, um ein Handzeichen. – Es ist dies die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist somit angenommen.
Nun lasse ich über den Antrag abstimmen, dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, um ein Handzeichen. – Es ist dies die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit angenommen.
Nun gelangen wir zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend ein Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Republik Kosovo über Zusammenarbeit und gegenseitige Amtshilfe in Zollsachen samt Anhang.
Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Es ist dies die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Umsatzsteuergesetz 1994 und das Bewertungsgesetz 1955 geändert werden (2234/A und 2241 d.B. sowie 8929/BR d.B.)
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz: Wir gelangen nunmehr zum 18. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatter ist Herr Bundesrat Lampel. Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatter Michael Lampel: Frau Präsidentin! Herr Staatssekretär! Ich bringe den Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Umsatzsteuergesetz 1994 und das Bewertungsgesetz 1955 geändert werden.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor; ich komme daher zur Antragstellung.
Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 3. April 2013 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz: Danke für den Bericht.
Wortmeldungen liegen nicht vor.
Wünscht jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall.
Wir kommen gleich zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Es ist dies die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit angenommen.
19. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Verbrechensopfergesetz geändert wird (2137 d.B. und 2218 d.B. sowie 8930/BR d.B.)
20. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz, das Opferfürsorgegesetz, das Verbrechensopfergesetz, das Impfschadengesetz und die 11. Opferfürsorgegesetz-Novelle geändert werden (2162 d.B. und 2219 d.B. sowie 8931/BR d.B.)
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz: Wir kommen nun zu den Punkten 19 und 20 der Tagesordnung, über welche die Debatte unter einem durchgeführt wird.
Berichterstatter zu den Punkten 19 und 20 ist Herr Bundesrat Klubvorsitzender Todt. Ich bitte um die Berichte.
Berichterstatter Reinhard Todt: Ich bringe den Bericht über den Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Verbrechensopfergesetz geändert wird.
Der Bericht liegt Ihnen vor; ich komme zur Antragstellung.
Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz stellt nach Beratung der Vorlage am 3. April 2013 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Ich bringe weiters den Bericht über den Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz, das Opferfürsorgegesetz, das Verbrechensopfergesetz, das Impfschadengesetz und die 11. Opferfürsorgegesetz-Novelle geändert werden.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor; ich komme daher gleich zur Antragstellung.
Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz stellt nach Beratung der Vorlage am 3. April 2013 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz: Danke für die Berichte.
Ich begrüße Herrn Bundesminister Hundstorfer ganz herzlich hier bei uns im Bundesrat! (Allgemeiner Beifall.)
Wortmeldungen dazu liegen nicht vor.
Wünscht jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall.
Die Abstimmung über die gegenständlichen Beschlüsse des Nationalrates erfolgt getrennt.
Wir gelangen zunächst zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Verbrechensopfergesetz geändert wird.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Es ist dies die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit angenommen.
Wir kommen nun zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz sowie weitere Gesetze und die 11. Opferfürsorgegesetz-Novelle geändert werden.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Es ist dies die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, das Betriebliche Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz, das Landarbeitsgesetz 1984, das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, das Arbeitsmarktservicegesetz, das Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Arbeitsverfassungsgesetz und das Betriebspensionsgesetz geändert werden (Sozialrechts-Änderungsgesetz 2013 – SRÄG 2013) (2150 d.B. und 2220 d.B. sowie 8932/BR d.B.)
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz: Wir kommen nunmehr zum 21. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatter ist Herr Bundesrat Wilhelm. Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatter Richard Wilhelm: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Herr Minister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Bericht des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz über den Beschluss des Nationalrats vom 21. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, das Betriebliche Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz, das Landarbeitsgesetz 1984, das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, das Arbeitsmarktservicegesetz, das Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Arbeitsverfassungsgesetz und das Betriebspensionsgesetz geändert werden.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor; ich komme daher gleich zur Antragstellung.
Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz stellt nach Beratung der Vorlage am 3. April 2013 den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrats keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsidentin Mag. Susanne Kurz: Danke für den Bericht.
Wir gehen in die Debatte ein.
Als Erste ist Frau Bundesrätin Kemperle zu Wort gemeldet. – Bitte.
17.56
Bundesrätin Monika Kemperle (SPÖ, Wien): Geschätzter Herr Minister! Geschätztes Präsidium! Geschätzte Bundesräte und Bundesrätinnen! Das Gesetz, das wir heute beschließen werden, ist sicher ein weiterer Meilenstein für die Bildungspolitik in unserem Land.
Ich glaube, dass es ein sehr wohl bedachter Beschluss ist, vor allem, wenn ich mir den Bereich der Bildungsteilzeit in diesem Gesetz ansehe. Wir haben ja bereits die Bildungskarenz im Gesetz verankert. Allerdings stellt die Bildungskarenz eine Hemmschwelle dar, tatsächlich Beschäftigung und Bildung zu vereinen. Es gibt nur entweder das eine oder das andere für einen bestimmten Zeitraum. Ich glaube, dass dies gerade für geringer qualifizierte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen einen Nichtzugang zu einer höheren Qualifizierung dargestellt hat.
Die Bildungsteilzeit bietet nun die Möglichkeit, beides zu vereinen, also sowohl Bildung als auch Beschäftigung gleichzeitig auszuüben. Das bietet natürlich auch eine weitere Möglichkeit, finanziell besser abgesichert zu sein als bisher mit der Bildungskarenz. Ich glaube, dass diese Maßnahme insgesamt eine sehr wohlüberlegte war, sowohl was den wirtschaftlichen Bereich betrifft als auch was den bildungspolitischen Bereich betrifft.
Ein kleiner Wermutstropfen dabei ist natürlich, dass die Bildungsteilzeit ebenfalls eine Vereinbarungssache zwischen ArbeitgeberIn und ArbeitnehmerIn im Betrieb ist. Aber das war auch bisher mit der Bildungskarenz so. Wir mussten immer wieder feststellen, dass es bei der Bildungskarenz oft so ist, dass höher Qualifizierte diese in Anspruch nehmen konnten und eher weniger Qualifizierte an die Grenzen ihrer Möglichkeiten, sie zu nutzen, gestoßen sind. Ich glaube aber – wie schon vorher erwähnt –, dass die Bildungsteilzeit einen weiteren Schritt darstellt, um dem entgegenzutreten, und dass Arbeitgeber letztendlich eher daran denken, die Bildungsteilzeit in Anspruch nehmen zu lassen als die Bildungskarenz.
Ein weiterer Schritt ist natürlich das Fachkräftestipendium. Es stellt ebenfalls einen weiteren Schritt im Bereich lebensbegleitendes Lernen dar. Im Hinblick auf die duale Berufsausbildung wurde ein Schritt gesetzt, der letztendlich auch eine Weiterführung in der Qualifizierung und in den rahmenrechtlichen Bedingungen darstellt. Das bedeutet nicht, dass das Fachkräftestipendium die sogenannte Fachkräftemilliarde, die die Gewerkschaftsjugend immer wieder für den Ausbildungsbereich fordert, ersetzen soll. Das kann nur ein ergänzender Teil sein, um weitere Qualifizierungen in Anspruch nehmen zu können.
Ein positiver Effekt in diesem Gesetz ist auch, dass bereits jetzt im Gesetz festgelegt wird, dass eine Evaluierung vorgesehen ist, denn ich glaube, dass es gerade in diesen Bereichen der Bildung notwendig ist, ständig zu evaluieren und nachzuschauen, ob Maßnahmen auch tatsächlich greifen, weil es nichts Schlechteres gibt als Maßnahmen zu setzen, die – im Nachhinein gesehen – nichts bringen. (Vizepräsident Mag. Himmer übernimmt den Vorsitz.)
Ich glaube, gerade im Bereich der Bildung ist es notwendig, diese Schritte zu setzen und zu bewerten. Wir sind noch nicht am Ende, denn ich glaube, dass es notwendig ist, gerade was den bildungspolitischen Bereich betrifft, ständig Maßnahmen zu setzen.
Die vorliegende Regelung ist ein positiver Ansatz, weshalb wir ihr die Zustimmung erteilen werden. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.)
18.01
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Bundesrat Saller. – Bitte.
18.01
Bundesrat Josef Saller (ÖVP, Salzburg): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Sehr geehrte Damen und Herren! Berufsleben und Bildung sind untrennbar miteinander verbunden! Wir wünschen uns, dass die Österreicher länger arbeiten, jedenfalls bis zum Regelpensionsalter. Daher ist es notwendig, dass Neuregelungen bei Weiterbildungsangeboten keine Altersgrenzen vorsehen. Das heißt, es eröffnen sich vor allem für ältere Arbeitnehmer im Hinblick auf den Pensionsantritt neue Chancen: neue Wege im Beruf statt alte Wege in die Pension.
Unterbrochene Erwerbsbiographien mit vielen Arbeitsstellen in teilweise völlig unterschiedlichen Bereichen sind auch bei den über 50-Jährigen zur Regel geworden.
Bildung, sei es Fortbildung, Weiterbildung oder die Erweiterung des Wissens aus persönlichem Interesse, wird auch für die Generation 50plus immer wichtiger, um sich be-
ruflich und auch privat weiterzuentwickeln. In den letzten Jahren ist eine große Bandbreite an Bildungsangeboten für über 50-Jährige entstanden. Vor allem Ausbildungsangebote im Bereich der beruflichen Bildung, aber auch Kurse in den Bereichen Kunst, Musik, Gesundheit, Sport et cetera werden von den Junggebliebenen immer mehr nachgefragt.
Unser „50plus Center“ im Seniorenbund Salzburg ist seit 2009 eine Art Kammer der älteren Generation mit vielen Angeboten für Menschen ab 50 Jahren.
Bei vielen Firmen rückt die Generation 50plus immer mehr in das Zentrum der Aufmerksamkeit, und zwar sowohl als Mitarbeiter als auch als Konsument. Mit geeigneten Bildungsmaßnahmen kann der Mensch ab 50 aufgrund seiner Erfahrung insbesondere firmenintern einen wertvollen Beitrag leisten. Ausgerichtet an Gütern und Dienstleistungen umfasst dies ein jährliches Volumen von ungefähr 800 Milliarden Dollar.
Es ist Bundesminister Hundstorfer und Wirtschaftsminister Mitterlehner für die konstruktive Zusammenarbeit zu danken – und das in einer nicht einfachen Vorwahlzeit. Wir sind da auf alle Fälle auf dem richtigen Weg. – Danke. (Beifall bei ÖVP, SPÖ und Grünen.)
18.04
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Als Nächster gelangt Herr Bundesrat Dönmez zu Wort. – Bitte.
18.04
Bundesrat Efgani Dönmez, PMM (Grüne, Oberösterreich): Sehr geehrter Herr Staatssekretär! Hohes Präsidium! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich habe mich mit dieser Vorlage beschäftigt und dann die Kommentare dazu gelesen, und die waren nur positiv: super, toll, da habt ihr etwas Gescheites zusammengebracht, klasse Sache.
Es ist wirklich wichtig, dass wir in diesem Bereich die Rahmenbedingungen verbessern und so gestalten, dass Beruf und Ausbildung vereinbar sind, dass man sich nicht für das eine oder andere entscheiden muss. Ich selbst habe über den zweiten Bildungsweg meine gesamte tertiäre Ausbildung nachgeholt, und ich weiß, wie schwierig es ist, mit wie vielen Entbehrungen diese Zeit verbunden ist, aber ich kann den Österreicherinnen und Österreichern, insbesondere den jungen Menschen wirklich nur nahelegen: Macht es, ihr habt nichts zu verlieren, man kann nur dazugewinnen!
Mit diesem Gesetz werden jetzt sozusagen die Möglichkeiten geschaffen, dass man arbeiten und sich fort- und weiterbilden kann, insbesondere auch für jene, die keinen Hochschulabschluss haben und als Facharbeiter, Angestellte oder Arbeiter tätig sind. Daher steht auch meine Fraktion dieser Vorlage mit Wohlwollen gegenüber. – Herzlichen Dank. (Beifall bei Grünen, ÖVP und SPÖ.)
18.06
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Bundesrat Konrad. – Bitte.
18.06
Bundesrat Klaus Konrad (SPÖ, Steiermark): Sehr geehrtes Präsidium! Sehr geehrter Herr Minister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren zu Hause an den Bildschirmen! Die Sitzung dauert schon neun Stunden, daher werde ich mir erlauben, meine Ausführungen kurz zu halten.
Auch im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit bin ich mit den Themen Fortbildung und insbesondere auch Bildungskarenz und den Zugängen dazu konfrontiert, und ich weiß, es gibt Schwierigkeiten in diesem Bereich. Diese haben sich vor allem dadurch erge-
ben, dass das für Vollzeitkräfte zur Verfügung gestanden ist. Probleme gibt es aber auch dabei, tatsächlich eine Vereinbarung mit den Betrieben zustande zu bringen, nämlich dass seitens der Betriebe diese Bildungskarenz Zustimmung findet. Ich weiß, das wird auch in Zukunft ein Reibungspunkt sein, weil viele Betriebe klarerweise – durchaus verständlich in manchen Bereichen – Sorge haben, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach erfolgreicher Ausbildung anders orientieren. Das ist eine Tatsache, und dem kann man so auch nur zustimmen.
Der Punkt ist, sehr geehrte Damen und Herren – und das ist auch klar –, ohne entsprechende Fortbildung wird der Wirtschaftsstandort Österreich keine Zukunft haben. Das heißt, die Betriebe sind auch dann, wenn sie Gefahr laufen, gut gebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verlieren, besser dran, diese Fortbildung zu gewähren als sie zu streichen, denn letztlich ist dieser Braindrain, der zwischen den Betrieben stattfindet, gut, wenn er auf hohem Niveau stattfindet.
In diesem Sinne gratuliere ich dir, Herr Minister, zu diesem zustande gebrachten Werk, hoffe, dass das viele in Anspruch nehmen, und wünsche weiterhin Verbesserungen in diesem Bereich. Vielleicht gelingt es uns auch, einen gewissen Schutz für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die diese Ausbildung in Anspruch nehmen, zu erreichen, einen Kündigungsschutz für diese Zeit. – Danke. (Beifall bei SPÖ, ÖVP und Grünen.)
18.08
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Als Nächste zu Wort gelangt Frau Bundesrätin Diesner-Wais. – Bitte.
18.08
Bundesrätin Martina Diesner-Wais (ÖVP, Niederösterreich): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Minister! Meine Damen und Herren! Mit der Bildungsteilzeit und dem Fachkräftestipendium beschließen wir heute weitere Maßnahmen, damit lebenslanges Lernen nicht nur ein Schlagwort ist, sondern auch wirklich praktiziert werden kann. Damit setzen wir einen weiteren Schritt, dass unsere Betriebe auch die Fachkräfte, die sie brauchen, bekommen, sodass wir unseren Wirtschaftsstandort Österreich auch in Zukunft gut absichern können.
Ich persönlich freue mich daher sehr, dass wir dieses Gesetz heute beschließen, denn in meiner Tätigkeit als Bundesrätin merke ich sehr oft, dass bei den Menschen die Bereitschaft gegeben ist, sich weiterzubilden, und diese Bereitschaft immer größer wird.
In letzter Zeit waren mehrere Personen bei mir, die bereits acht oder zehn Jahre als Arbeitnehmer gearbeitet und jetzt wieder eine Schule begonnen haben, oft eine dreijährige Schule. Diese Menschen nehmen wirklich viel auf sich, und sie haben in dieser Zeit keine soziale Absicherung, denn sie haben ja nicht einmal einen Anspruch auf Mindestsicherung, weil sie ja dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen. Und ich denke, wenn jemand bereit ist, sich weiterzubilden, dann sollte er nicht im Stich gelassen werden, denn wir brauchen die Qualifikationen, und es ist ja in unserem Sinne, wenn neue Fachkräfte ausgebildet werden, da sie von unserer Wirtschaft gebraucht werden.
Wir schaffen mit diesem Gesetz wirklich verbesserte Bedingungen für die Weiterbildung und Aufschulung der Menschen, und mit dem Fachkräftestipendium wird die Möglichkeit geschaffen, dass sich Mitarbeiter im Bereich der Pflege und in Mangelberufen, wie im Metall-, Gesundheits-, Elektrotechnik- oder Holzbereich, auch weiterbilden. Sie bekommen den Ausgleichszulagenrichtsatz von 795 € pro Monat für maximal drei Jahre. Optimal ist, dass sie auch noch geringfügig dazuverdienen dürfen.
Weiters kann jetzt der Einzelne, das ist auch schon angesprochen worden, neben der Bildungskarenz in die Bildungsteilzeit gehen. Ich glaube, das ist etwas besonders Posi-
tives für den Arbeitnehmer, aber auch für den Arbeitgeber, denn damit ist die Verbindung zum Betrieb da. Es ist gut für den Mitarbeiter, dass er da den Kontakt hält, aber auch für den Unternehmer.
Wie schaut das aus? – Die wöchentliche Arbeitszeit wird um ein Viertel oder bis auf die Hälfte herabgesetzt, darf jedoch zehn Stunden pro Woche nicht unterschreiten. Die Bildungsteilzeit kann vier Monate bis zwei Jahre in Anspruch genommen werden, man kann sie auch in Teilen innerhalb von vier Jahren konsumieren.
Das sind wirklich wichtige Neuerungen, und es gilt, diese besonders gut zu bewerben, bei den ArbeitnehmerInnen, aber auch bei den Unternehmern, sodass diese Maßnahmen auch in Anspruch genommen werden, denn wir brauchen, wie ich schon gesagt habe, die Fachkräfte, damit wir unseren Wirtschaftsstandort absichern können und die Zahl der Facharbeiter in Österreich, das ist für Österreich sehr wichtig, erhöhen können.
Da das meine letzte Rede im Bundesrat ist, möchte ich mich auch noch von Ihnen allen verabschieden. Ich möchte mich recht herzlich dafür bedanken, dass ich zehn Jahre lang hier mitwirken durfte und zum Wohle unserer Bürger hier Gesetze mit beschließen konnte, damit Österreich noch lebenswerter wird. Ich habe mich bemüht, die Anliegen meiner Region, meines Waldviertels, meines Bundeslandes Niederösterreich hier mit einzubringen.
Ich möchte mich natürlich auch für die vielen Freundschaften, die ich hier im Bundesrat schließen konnte, bedanken.
Ich darf meine Ausführungen mit einer kleinen Geschichte beenden: Zwei Freunde haben eine Wanderung gemacht. Während dieser Wanderung ist es zu einem Streit gekommen, und der eine hat den anderen unabsichtlich ins Gesicht geschlagen. Der andere war still und hat am Abend in den Sand geschrieben: Heute hat mich mein Freund geschlagen! Sie sind dann weitergegangen, haben am nächsten Tag gemeinsam in einer Oase gebadet, und der, der den anderen geschlagen hat, hat diesen dann vor dem Ertrinken gerettet. Der Gerettete hat sofort einen Stein genommen und in den Stein geritzt: Heute hat mir mein Freund das Leben gerettet! Der Freund, der ihn geschlagen hatte, hat dann gefragt: Warum hast du das eine in den Sand geschrieben, als ich dich geschlagen habe, und das andere in den Stein geritzt? Darauf hat der gesagt: Wenn man gekränkt ist, soll man es in den Sand schreiben, damit der Wind des Verzeihens es wieder auslöschen kann, wenn man sich aber freut, dann soll man es in einen Stein ritzen, damit es für ewig bleibt.
So möchte ich auch meine Zeit hier im Bundesrat in Stein ritzen, und ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft, dass in dieser Länderkammer noch viel geschieht, und bedanke mich, dass ich die zehn Jahre hier sein durfte. Alles Gute! (Anhaltender allgemeiner Beifall.)
18.14
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Liebe Martina! Der Applaus zeigt auch dir, der gesamte Bundesrat dankt dir sehr herzlich für deine Arbeit in den letzten zehn Jahren, für deinen Einsatz für das Land, für dein Land Niederösterreich, für deine Region. Du warst eine überaus engagierte Bundesrätin, und wir wissen, du gehst ja der Politik nicht verloren. Als Stadträtin in Schrems, zuständig für Tourismus und Wirtschaftsangelegenheiten, hast du weiterhin viel Positives einzubringen. Dafür wünschen wir dir ganz herzlich das Allerbeste und viel Erfolg dabei. Einen schönen Gruß ins Waldviertel, nach Schrems, Steinbach und Umgebung. – Herzlichen Dank. (Allgemeiner Beifall.)
Als Nächster zu Wort gelangt Herr Bundesminister Hundstorfer. – Bitte, Herr Minister.
18.15
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz Rudolf Hundstorfer: Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich halte meine Ausführungen sehr kurz und möchte mich für die Einstimmigkeit bedanken. Ich bedanke mich dafür, dass Sie dieses Paket beschließen; der Inhalt wurde schon erwähnt, ich brauche ihn nicht zu wiederholen.
Ich glaube, wir sind da gemeinsam auf dem richtigen Weg, sowohl bei der Bildungsteilzeit als auch beim Fachkräftestipendium, worauf ich persönlich sehr viel Wert lege, da sich mit diesem Fachkräftestipendium viele Ausbildungsmöglichkeiten eröffnen. Es soll nicht nur die klassische Facharbeiterausbildung, sondern es sollen auch viele Ausbildungen im Sozial- und Gesundheitsbereich damit ermöglicht werden. In diesem Sinne ein herzliches Dankeschön.
Da ich nicht weiß, ob ich mich heute noch einmal zu Wort melden werde, sage auch ich ein herzliches Dankeschön all jenen, die heute das letzte Mal an einer Sitzung teilnehmen, es sind ja mehrere KollegInnen. Aber ich begrüße auch die neuen Bundesräte sehr herzlich. (Allgemeiner Beifall.)
18.16
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall.
Die Debatte ist geschlossen.
Wir gelangen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Es ist dies Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Ausländerbeschäftigungsgesetz und das Behinderteneinstellungsgesetz geändert werden (2163 d.B. und 2225 d.B. sowie 8933/BR d.B.)
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Wir gelangen zum 22. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatter ist Herr Bundesrat Todt. Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatter Reinhard Todt: Ich bringe den Bericht über den Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Ausländerbeschäftigungsgesetz und das Behinderteneinstellungsgesetz geändert werden.
Der schriftliche Ausschussbericht liegt Ihnen vor, ich komme daher sogleich zur Antragstellung.
Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz stellt nach Beratung der Vorlage am 3. April 2013 mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Ich danke für den Bericht.
Als Erster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Krusche. Ich erteile ihm das Wort.
18.17
Bundesrat Gerd Krusche (FPÖ, Steiermark): Herr Präsident! Herr Minister! Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrte Zuseher zu Hause! Wir haben schon bei der seinerzeitigen Beschlussfassung gesagt, dass dies ein Flop werden wird, und haben
damit recht behalten. Der erwartete Zuzug von Schlüsselarbeitskräften ist weitgehend ausgeblieben, aber auf der Gegenseite strömen schlechter qualifizierte Arbeitskräfte in unser Land.
Geradezu zynisch dabei ist auch die Argumentation, dass die Höchstzahl abgeschafft werden kann, weil durch die Öffnung des Arbeitsmarktes mit 1. Jänner kommenden Jahres für Bulgarien und Rumänien, die keinen ungebremsten Zuzug erwarten lässt, die Höchstzahl für die anderen Bereiche nicht mehr erforderlich ist.
Herr Bundesminister! Sie sollten sich eigentlich dieses Problems annehmen, denn Ihr vielgelobtes Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz ist, wie wir alle wissen und feststellen mussten, löchrig und ineffizient. Die Behauptung, dass ausländische Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer im Heimatland sozialversichert haben, wird ja nicht überprüft. Da gibt es sehr, sehr viele schwarze Schafe. Dazu befragen Sie am besten Ihren Parteikollegen, Nationalratsabgeordneten Muchitsch aus der Steiermark, der in diesem Zusammenhang ein ständiger Mahner ist. Ich bin auch schon gespannt darauf, was der mir folgende Redner zu diesem Tagesordnungspunkt, der ja ebenfalls aus der Gewerkschaftsbewegung kommt und aus der Steiermark ist, sogar aus meinem Bezirk ist, zu diesem Thema zu sagen hat.
Das alles ist angesichts der steigenden Arbeitslosigkeit besonders kritisch zu beurteilen. Ich kann das ständige Selbstlob, dieses Sich-selbst-auf-die-Schulter-Klopfen, dass wir die geringste Arbeitslosenquote in der EU haben, auch die USA eine höhere hätten und so weiter, nicht mehr hören und sehen. (Bundesrat Kneifel: Wir sollen also die Fakten nicht mehr anführen?!) Das stimmt zwar! (Ironische Heiterkeit bei ÖVP und SPÖ.) Das erinnert jedoch allzu sehr daran, dass unter den Blinden der Einäugige König ist. (Beifall bei der FPÖ. – Bundesrat Kneifel: Das ist also richtig!)
Wir dürfen nämlich nicht vergessen, dass wir die zweithöchste Arbeitslosenrate seit dem Zweiten Weltkrieg zu verzeichnen haben. (Bundesrat Kneifel: Es stimmt zwar, aber wir dürfen es nicht sagen!) Es wird nur Eigenlob unkritisch wiedergegeben, und das ist nicht das, was wir wollen.
Wir ziehen die AMS-Statistik heran, und das sind die Fakten. (Bundesrat Kneifel: Zahlen, Daten, Fakten!) – Genau! Danke. Und die sage ich dir jetzt, wenn du mir zuhörst!
Arbeitslosigkeit plus 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Es gibt einen massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit in den Bauberufen, nämlich plus 27,4 Prozent. Auch bei den Dienstleistungsberufen und bei den Technikern hatten wir Ende März am Stellenmarkt 26 520 offene Stellen. Das entspricht einem Minus von 11,9 Prozent. Auf dem Lehrstellenmarkt gibt es ebenfalls ein Minus von 9,6 Prozent, und die Zahl der Schulungsteilnehmer ist um 11,4 Prozent gestiegen. (Bundesrat Schennach: Ist das vielleicht schlecht?)
Es gibt auch noch andere Zahlen, die in dieser AMS-Statistik enthalten sind, nämlich eine Zunahme der Ausländerarbeitslosigkeit um 15,3 Prozent, während die Arbeitslosigkeit bei den Inländern nur um 8,5 Prozent zugenommen hat. (Bundesrätin Zwazl: Ja, es geht um die Qualifikation!) Besonders interessant habe ich gefunden, dass die Zunahme der Arbeitslosigkeit unter den Absolventen von Pflichtschulen 8,2 Prozent beträgt, bei solchen mit Lehrabschluss 12,6 Prozent und bei Akademikern 14,1 Prozent. Diese Tatsachen sind nicht mit dem schlechten Wetter im März zu erklären und widersprechen eigentlich der bisherigen Argumentation, dass die schlechter Qualifizierten viel weniger Chancen am Arbeitsmarkt haben. Es wäre sicherlich gut, wenn man diese Zahlen analysierte und entsprechende Gesetzentwürfe einbrächte, wie man hier gegensteuern will, statt den Arbeitsmarkt für ausländische Arbeitskräfte weiter unkritisch zu öffnen.
Deshalb werden wir diesem Entwurf nicht zustimmen. (Beifall bei der FPÖ.)
18.23
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Nächster Redner: Herr Bundesrat Wilhelm. – Bitte.
18.24
Bundesrat Richard Wilhelm (SPÖ, Steiermark): Werter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Geschätzte Kollegen und Kolleginnen! Das Bundesgesetz, mit dem das Ausländerbeschäftigungsgesetz und das Behinderteneinstellungsgesetz geändert werden, ist inhaltlich eine Bereinigung oder Vereinfachung von Bestimmungen in Bezug auf ausländische Arbeitskräfte. Außerdem wird mit dieser Beschlussfassung eine Rahmenrichtlinie der Europäischen Union umgesetzt, die 2013 ohnedies umgesetzt werden muss. Darüber hinaus beinhaltet diese Regierungsvorlage eine Steuerungsfunktion gegenüber ausländischen Arbeitskräften, deren Zahl bislang an eine Bundeshöchstzahl gekoppelt war.
Wir haben in Österreich im Vergleich mit anderen Ländern (in Richtung Bundesrat Krusche) – ich weiß schon, dass dir das nicht passt! – noch immer eine sehr positive Wirtschaftsentwicklung, wenn wir uns etwa die Zahlen im EU-Raum ansehen. Auch was die Beschäftigung betrifft, sind wir noch – das sage ich auch – gut aufgestellt. Trotzdem muss es natürlich unser aller Ziel sein, die Arbeitslosenquote zu senken. Das liegt sicherlich in unserem gemeinsamen Interesse.
Wir vom ÖGB sind da genauso gefordert. Wir müssen auch darauf schauen, dass es für die eigenen Arbeitskräfte Arbeit gibt. Ich denke da zum Beispiel an das Jahr, in dem die Krise am Höhepunkt war. Da mussten 300 Millionen Überstunden geleistet werden. Darüber müssten wir auch einmal diskutieren. (Beifall bei der SPÖ.)
Es ist auch richtig, dass die Politik bei mehr Wettbewerb gefragt ist, um die österreichische Wirtschaft und die Arbeitnehmer vor unfairem Wettbewerb zu schützen. Die Änderungen im Ausländerbeschäftigungsgesetz und im Behinderteneinstellungsgesetz bringen bürokratische Vereinfachungen für verschiedene Berufsfelder, und die sind auch notwendig für die Wirtschaft, die Betroffenen und auch jene ausländischen Arbeitskräfte, die eigentlich ohnehin schon ordnungsgemäß in Österreich arbeiten. Für uns wesentlich ist, das für bestimmte Gruppen, die verstärkt auf den Arbeitsmarkt drängen, wie Saisonniers oder Betriebsentsandte ohne Betriebsstätte in Österreich, die auf einen Arbeitsplatz zur Erfüllung eines Auftrags nach Österreich entsandt werden, trotzdem weiterhin Bewilligungen erforderlich sein werden. Die Erfahrung zeigt, dass diese Maßnahme wichtig und es im Zuge des Wettbewerbs auch notwendig ist, dass man die heimische Wirtschaft vor unfairem Wettbewerb schützt. Da sind wir einer Meinung.
Dazu bedarf es Initiativen seitens der Politik in Form von gesetzeskonformen öffentlichen Ausschreibungen. Dass die Politik mithilft, ist auch wichtig. Man hat das im Burgenland gesehen, wo eine entsprechende Initiative gestartet worden ist. Das Gleiche hat es auch in der Steiermark gegeben, wo es eine Winterbauoffensive gegeben hat. Aus Landesmitteln sind da einige Firmen gefördert worden, die Arbeit geschaffen und Arbeitskräfte aufgenommen haben.
Weiters möchte ich noch darauf hinweisen, dass sich Änderungen gemäß dieser Richtlinie auch im Behinderteneinstellungsgesetz finden und sich damit auch der Kreis der begünstigten Drittstaatsangehörigen erweitert. (Beifall bei der SPÖ.)
18.27
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Nächster Redner: Herr Bundesrat Dönmez. – Bitte.
18.27
Bundesrat Efgani Dönmez, PMM (Grüne, Oberösterreich): Hohes Präsidium! Sehr geehrter Herr Minister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte eine differen-
zierte Argumentation vorbringen, denn diese Richtlinie ist meines Erachtens insofern eine sinnvolle Regelung, als es bis dato ja so war, dass man zwar Aufenthaltsbewilligungen erteilt hat, die Leute jedoch meist keinen Zugang zum Arbeitsmarkt hatten. Das ist schon eine sehr komische Konstellation gewesen. Mit dieser Richtlinie wird jetzt in nationales Recht umgesetzt, dass der Aufenthalt mit dem Zugang zum Arbeitsmarkt verbunden und gleichzeitig ermöglicht wird. Damit fallen die Arbeitserlaubnis und der Befreiungsschein komplett weg, und es ist eben auch vorgesehen, dass dieser Personenkreis auf eine Rot-Weiß-Rot-Karte plus umsteigen kann. Das ist auch zu begrüßen.
Was jedoch nicht zu begrüßen ist, ist, dass wiederum eine doch nicht kleine Gruppe, über die wir auch in diesem Haus schon mehrmals diskutiert haben, nicht berücksichtigt wird, nämlich die Gruppe der Asylwerber. Es ist weder menschlich noch ökonomisch nachvollziehbar, warum man Menschen, die arbeitswillig und arbeitsfähig sind, vom Arbeitsmarkt fernhält, um sie stattdessen mit öffentlichen Geldern in der Grundversorgung zu belassen. Es gibt viele Menschen, die arbeiten möchten und sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen könnten. Wir hätten dadurch im Sozialbereich, in der Asyl- und Flüchtlingsbetreuung viel, viel weniger Probleme.
Es muss ja nicht so sein, dass man gleich am ersten Tag, an dem man zum Asylverfahren zugelassen worden ist, auch auf dem Arbeitsmarkt tätig wird, aber man könnte doch zumindest diese Bartenstein-Verordnung einmal aufheben. Ich weiß, sehr geehrter Herr Minister, dass Sie in diesem Punkt anderer Meinung sind. Ich teile Ihre Auffassung da nicht, nicht zuletzt deshalb, weil ich jahrelang in diesem Bereich tätig war. Ich habe gesehen, wie wichtig es ist, dass diese Leute eine Beschäftigung haben und ihr eigenes Geld verdienen können. Wir hätten in der Flüchtlingsbetreuung wirklich viel, viel weniger Probleme. Man braucht auch keine Angst zu haben, dass deswegen mehr Asylwerber nach Österreich kämen, denn Zugang zum Arbeitsmarkt bekämen ohnehin nur jene, die auch zum Asylverfahren zugelassen werden. Alle anderen werden ohnedies vorher schon durch das Zulassungsverfahren ausgesiebt.
Das ist der Grund, warum wir diesem Gesetzentwurf unsere Zustimmung nicht erteilen.
Ich würde Sie wirklich ersuchen, sehr geehrter Herr Minister, sich die diesbezügliche Argumentation der Volkshilfe, die ja der SPÖ nicht allzu fern steht, einmal anzusehen, denn dort kann man das alles im Detail nachlesen.
Kollege Krusche behauptet immer wieder, dass ausländische Arbeitnehmer österreichischen ArbeitnehmerInnen den Arbeitsplatz wegnehmen. Dem möchte ich Folgendes entgegenhalten: Gehen Sie doch einfach einmal ein paar Schritte weiter und schauen Sie in die Küche der Parlamentscafeteria! Sie werden sehen, dass dort fast nur ausländisches Personal beschäftigt ist. In Oberösterreich startet Soziallandesrat Ackerl eine Initiative, um mehr Pflegepersonal zu rekrutieren, und zwar aus der Slowakei. Ich kann Ihnen auch sagen, warum das so ist. – Weil nämlich um dieses Geld und unter diesen Rahmenbedingungen kein österreichischer Arbeitnehmer beschäftigt sein will.
Wenn also mehr österreichische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt sein sollen – da bin ich auch dafür: Man braucht keine Arbeitskräfte aus dem Ausland zu holen, da sollen unsere Leute arbeiten! –, dann bedeutet das für uns als Politiker, geschätzter Kollege, dass wir die Rahmenbedingungen für die Menschen, die in den unterschiedlichsten Bereichen arbeiten, attraktiver gestalten und ihnen vor allem auch ein Gehalt einräumen müssen, von dem sie leben können; dann hätten wir viele Nebeneffekte nicht. Gerade im Baubereich gibt es viele Handwerker, die pfuschen, und die machen das nicht aus Spaß, sondern weil sie mit dem Gehalt, das sie bekommen, nicht über die Runden kommen.
Auf diesem Weg könnte man viele Probleme, die ineinander greifen, lösen. Sündenböcke zu finden, ist allerdings immer leicht. Die Ausländer müssen da immer herhalten,
weil sie keine Lobby haben, weil sie Spielball der Politik sind. Das sind Argumentationen, die sich meines Erachtens doch sehr an der Oberfläche bewegen.
Wenn wir in der Politik Interesse daran haben, die Probleme tatsächlich zu lösen, dann muss man genau hinschauen und die Dinge beim Namen nennen. Man müsste das, was ich vorhin nur knapp skizziert habe, auch tatsächlich in die Wege leiten, dann – da bin ich vollkommen Ihrer Meinung – brauchen wir keine ausländischen Arbeitskräfte hereinzuholen, sondern könnten unsere eigenen Leute beschäftigen. Es ist aber eben nicht so, und daher muss man noch viel, viel Arbeit leisten. Ich hoffe, dass das auch für Sie nachvollziehbar ist, Kollege Krusche. – Danke. (Beifall bei den Grünen. – Bundesrat Krusche: Das ist die falsche Lösung!)
18.32
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Nächste Rednerin: Frau Bundesrätin Zwazl. – Bitte.
18.33
Bundesrätin Sonja Zwazl (ÖVP, Niederösterreich): Herr Präsident! Herr Minister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Wenn es um das Ausländerbeschäftigungsgesetz geht, vor allem dann, wenn es um die Rot-Weiß-Rot-Karte geht, werden regelmäßig, wie wir ja gehört haben, die Arbeitslosenzahlen als Gegenargument angeführt. Daher möchte ich mich zunächst einmal mit der Arbeitsmarktsituation auseinandersetzen.
Es ist richtig, es stimmt, dass wir derzeit eine relativ hohe Arbeitslosenquote haben; wir haben 7,7 Prozent nach dem AMS-System und 4,8 Prozent nach Eurostat. Wenn man sich das dann genauer anschaut, was Sie, Herr Kollege Krusche, gemacht haben, der Sie ein paar Zahlen herausgegriffen haben, dann weiß man auch, dass es die massiven Anstiege bei der Arbeitslosigkeit vor allem bei den Hilfsberufen gibt. Da gibt es einen Anstieg von 10 Prozent und bei den Bauberufen um 27 Prozent. Wenn man jedoch weiß, dass rund ein Viertel dieser Arbeitslosen aus Saisonberufen kommt, die wetterabhängig sind, dann wissen wir auch – wir haben ja alle gesehen, wie heuer das Wetter war –, warum es da diese Werte gibt.
Es geht auch darum, dass wir uns damit auseinandersetzen, wie unsere wirtschaftliche Lage generell aussieht. Sie ist aktuell nicht besonders rosig. Besonders bei der Industrie ist es jedoch so, dass es da schon positivere Aspekte gibt, die zeigen, dass die Entwicklung da wieder leicht ansteigt. Den Branchen jedoch, die auf den Inlandskonsum angewiesen sind, geht es noch nicht sehr gut. Sowohl der Handel als auch das Gewerbe zeigen derzeit eine rückläufige Entwicklung. Wir gehen auch insgesamt davon aus, dass sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt nur langsam entspannen wird.
Dennoch ist es nun einmal so, dass wir qualifizierte Arbeitskräfte brauchen, denn gerade die Qualifikation unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es, die uns einen entscheidenden Standortvorteil gewährt. Genau deshalb brauchen wir sie auch. Wir haben es mit einer strukturellen Arbeitslosigkeit zu tun, weil viele Menschen die Qualifikationen, die vom Markt verlangt werden, die der Markt braucht und nachfragt, ganz einfach nicht haben. Gott sei Dank haben wir sehr viel in Umschulungsprogramme investiert. Dafür möchte ich mich auch recht herzlich bedanken, denn da wird sehr, sehr viel gemacht.
Es ist jedoch kurzsichtig, wenn man glaubt, dass die Rot-Weiß-Rot-Karte die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt verschärft. Wir müssen trachten, die Qualifikation unserer Leute zu heben. Wir müssen sie dazu bringen, dass sie verstärkt in diese Ausbildungen gehen, und deshalb ist es wichtig, dass wir da Geld hineinstecken.
Auf Themen wie Bildungsreform und Erkennen von Potenzialen unserer Jugend gehe ich jetzt in diesem Rahmen gar nicht näher ein. Die Rot-Weiß-Rot-Karte ist für uns je-
doch ganz einfach wichtig, um die Qualifikationen in unser Land zu holen, die die Wirtschaft braucht. Die fehlen uns nämlich schlicht und einfach, so ist es nun einmal.
Die Rot-Weiß-Rot-Karte ist Mitte 2011 zur Anwerbung von Drittstaatsangehörigen eingeführt worden. Österreich nimmt auf diesem Gebiet in Europa eine Vorreiterrolle ein. Wir haben sowohl im Inland als auch im Ausland große Anerkennung für diese Maßnahme erfahren, und es ist durchaus nichts Negatives, wenn man für eine Initiative gelobt wird. Die SPÖ-Europaabgeordnete Evelyn Regner bezeichnete die Rot-Weiß-Rot-Karte als Glücksfall, und der bayrische Wirtschaftsminister Martin Zeil sagte: „Österreich hat im internationalen Wettbewerb um die besten Köpfe vorgelegt.“
Die Rot-Weiß-Rot-Karte ist ein Modell, das die Sozialpartner entwickelt und vorgeschlagen haben. Wir haben deswegen jetzt Interessenten aus Drittstaaten, die anhand objektiver Kriterien erkennen können, ob sie zuwandern können, und vor allem, unter welchen Voraussetzungen.
Welche Gruppen sprechen wir konkret an? – Wir brauchen besonders hoch qualifizierte Zuwanderer, Fachkräfte in Mangelberufen, sonstige Schlüsselkräfte, ausländische Studienabsolventen und selbständige Schlüsselkräfte – dies jeweils nach unterschiedlichen zusätzlichen Kriterien. Natürlich haben wir dabei auch Sportler und Künstler im Auge.
Wir sind bei der Einführung dieser Karte sehr behutsam vorgegangen, weil der Vorwurf eines unkontrollierten Zugangs naheliegend ist. Seit der Einführung konnte die Zahl der qualifizierten Zuwanderer im Vergleich zum alten System fast verdoppelt werden. 2012 haben wir in Österreich 1 500 Rot-Weiß-Rot-Karten verteilt. Im Vollausbau ab dem Jahr 2030 sollen es jährlich 8 000 Rot-Weiß-Rot-Karten sein. Das geht aus einer Studie der Donau-Universität Krems und des Instituts für Höhere Studien hervor. Neben der Umsetzung von Bildungsreformen in Österreich ist das ganz einfach ein wichtiger Beitrag zur Lösung des Fachkräftemangels, und einen solchen haben wir nun einmal.
Derzeit dominieren bei den Rot-Weiß-Rot-Karten Manager mit 673 Genehmigungen und Techniker mit 534. Auf Platz drei liegen bereits die Sportler. Aus Sicht der Wirtschaft ist neben einer entsprechenden Willkommenskultur in Österreich ein Gesamtkonzept für qualifizierte Zuwanderung notwendig. Eine Analyse der Außenwirtschaftsorganisation der Wirtschaftskammer hat gezeigt, dass vor allem in Serbien und Bosnien und Herzegowina besonders viele Menschen über eine gute, eine sehr gute Qualifikation in den MINT-Bereichen verfügen. Das sind Qualifikationen, die wir ganz besonders dringend brauchen.
Es sind natürlich zur Weiterentwicklung noch einige Schritte notwendig, aber es gibt auch jetzt schon Erleichterungen. So wird zum Beispiel bei einem Wechsel des Betriebsinhabers die für den alten Arbeitgeber gültige Arbeitserlaubnis auch für eine entsprechende Beschäftigung beim neuen Arbeitgeber gelten. Der räumliche Geltungsbereich der Bewilligung wird vom politischen Bezirk auf das ganze Bundesgebiet ausgeweitet. Entsprechend den Vorgaben der EU-Richtlinie müssen künftig alle Inhaber einer Niederlassungsbewilligung eine damit kombinierte Arbeits- und Aufenthaltsbewilligung, konkret eine Rot-Weiß-Rot-Karte plus erhalten, die ihnen einen unbeschränkten Arbeitsmarktzugang erlaubt.
Von den Richtlinien werden Saisonniers, Betriebsentsandte, Schüler, Studenten und Au-pair-Kräfte nicht erfasst, also viele jener Gruppen, die verstärkt auf den Arbeitsmarkt drängen.
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Als Wirtschaftsvertreterin bin ich weniger erfreut darüber, dass der Instanzenzug in diesen Fragen in Zukunft nach der regionalen Geschäftsstelle des AMS bei Berufungsentscheidungen nicht wie bisher über die Lan-
desstelle des AMS verläuft, sondern über das Bundesverwaltungsgericht. Das geht zulasten der Selbstverwaltung, was natürlich nicht nach meinem Sinn ist. Wir werden sehen, ob sich dieser Schritt bewährt.
Aber insgesamt ist diese Novelle eine notwendige Maßnahme. Wir von der Wirtschaft brauchen sie, und ich bitte Sie um Ihre Zustimmung. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
18.41
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesminister Hundstorfer. – Bitte, Herr Minister.
18.41
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz Rudolf Hundstorfer: Herr Präsident! Hoher Bundesrat! Ich musste mich noch einmal zu Wort melden – es muss sein. Meine Damen und Herren! Ich möchte Sie ersuchen, zur Kenntnis zu nehmen, dass wir in einem gemeinsamen Europa leben. Wenn Sie hier argumentieren, dass wir Menschen abhalten sollen, anderswo zu arbeiten, darf ich Sie einladen, Folgendes zu bedenken: 250 000 Österreicherinnen und Österreicher leben und arbeiten in Deutschland, sind aber weiterhin österreichische Staatsbürger. 50 000 österreichische Staatsbürger leben in der Schweiz. Und wenn ich Ihrer Argumentation folge, dann – das sage ich Ihnen ganz offen – gibt es in Wien ab morgen keine Arbeitslosigkeit mehr, weil alleine aus Niederösterreich pro Tag 140 000, aus dem Burgenland 18 000 und aus den restlichen Bundesländern 13 000 Menschen nach Wien pendeln. (Bundesrat Krusche: Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich!)
Ihr Problem ist nämlich Folgendes: Sie gehen mit Uraltvorstellungen an die Sache heran. Ich darf darauf hinweisen, dass 30 Prozent der Arbeitskräfte, die in den letzten drei Jahren in Österreich zugezogen sind, einen akademischen Abschluss oder einen FH-Abschluss haben. Im Durchschnitt hat die österreichische Bevölkerung nur zu 15 Prozent einen solchen Abschluss. Wir haben keinen unqualifizierten Zuzug, sondern wir haben in den letzten drei bis vier Jahren einen qualifizierten Zuzug. (Bundesrat Krusche: Vielleicht ist das der Grund für die steigende Akademikerarbeitslosigkeit!) – Schauen Sie, bei der Akademikerarbeitslosigkeit haben Sie ein Problem: Sie sollten den Anstieg eines Monats nicht mit den Gesamtarbeitslosenzahlen vergleichen, denn nicht umsonst haben wir bei den Akademikern über das ganze Jahr gesehen eine Arbeitslosenquote von nur 2,5 Prozent. Das ist die niedrigste Arbeitslosenquote der Gruppen von Menschen mit Bildung. (Zwischenruf des Bundesrates Krusche.) – Ja, jetzt gibt es eine Zunahme, aber das ist ein Monat! Wenn 100 Akademiker arbeitslos werden, sind wir bei 14 Prozent. Das ist ja ganz logisch, wenn ich von einer schmalen Basis ausgehe. – Das dazu.
Wenn Sie behaupten, dass das Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz nicht funktioniert, dann frage ich Sie auch ganz offen: Warum haben wir dann schon Firmen gesperrt? Warum haben wir ausländischen Firmen schon verboten, in Österreich zu arbeiten? – Das sind rechtskräftige Bescheide, das ist alles schon lange erledigt. Ich würde Sie dringend bitten, dass Sie sich zuerst erkundigen, und dann reden wir weiter. (Beifall bei SPÖ, ÖVP und Grünen.)
Es wurde auch vergessen zu sagen – das ist kein Vorwurf an die Vorredner –, dass wir den höchsten Beschäftigtenstand in der Zweiten Republik haben. Das sollten Sie auch nicht vergessen. (Bundesrat Schennach: Das versteht er nicht!)
Wir leben in einem sehr fluktuierenden Arbeitsmarkt. Ja, sehr viel ist in Veränderung! Ja, in diesen Zeiten ist Arbeitslosigkeit schwierig, aber ich kann eben auf Baustellen im Außenbereich nichts machen, wenn zwei Meter Schnee liegen. Ich war zu Ostern drei Tage in Niederösterreich im sogenannten Ötscherland. Dort haben die Baufirmen schon mehr oder weniger in den Startlöchern gescharrt. Und was ist passiert? – Noch
einmal 30 Zentimeter Schnee! Ja, was soll man da tun? Wir hoffen täglich, dass es besser wird. Alleine von 1. auf den 2. April hat sich die Arbeitslosigkeit um 12 000 verringert – das auch nur als statistische Anmerkung. 12 000 Österreicher haben allein von Ostermontag, den 1. April, auf Dienstag, den 2. April, wieder einen Job gehabt.
Wir haben eine angespannte Situation am Arbeitsmarkt, das ist gar keine Frage, aber einen sogenannten „closed shop“ – alles wird dichtgemacht – kann Österreich auf keinen Fall verkraften. Wenn wir die hohe Produktivität aufrechterhalten wollen, brauchen wir Arbeitskräfte, ob wir wollen oder nicht. Genauso wie Österreicher ins Ausland gehen, kommen eben Menschen aus Europa auch zu uns.
Die Rot-Weiß-Rot-Card ist zwischenzeitlich ein Erfolgsmodell. Warum? – Weil die Zahl derer, die mit Höchstqualifikationen kommen, monatlich steigt. Dass ganz am Anfang – die ersten drei Monate, nachdem die Rot-Weiß-Rot-Card eingeführt wurde –, die Sportler die größte Gruppe waren: Na klar, die waren ja alle schon da. Ich bin froh, dass es nun ordnungsgemäße Dienstverträge gibt, dass ordnungsgemäß die Basketballer und die Handballer, die Eishockeyspieler und diverseste Fußballspieler angemeldet sind, dass das alles passt. Aber die Gruppe der Sportler wird in der Zwischenzeit immer kleiner, während alle anderen im Ansteigen sind. Das ist eine ganz normale Entwicklung. Deshalb bin ich froh, dass wir saubere Dienstverhältnisse haben, dass es nichts mir Schwarzgeld gibt, was es ja in der Vergangenheit hie und da gegeben haben soll.
Lange Rede, kurzer Sinn: Ich weiß, dass Sie dem nicht zustimmen können – wir haben diese Debatte ja schon im Nationalrat gehabt –, aber nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir sehr vorsichtig mit dem österreichischen Arbeitsmarkt umgehen und dass vor allem das Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz keine tote Materie ist, sondern eine sehr lebendige. Denn wir haben schon ein paar Millionen Euro an Strafen rechtskräftig ausgeschickt, wir haben ein paar hundert weitere Verwaltungsstrafverfahren in der Pipeline und – was vor allem für uns ganz wichtig ist – es wird ordnungsgemäß kontrolliert, sowohl von den Gebietskrankenkassen als auch von der Finanzpolizei als auch von der BUAK – das heißt, von dieser eigenen Prüftruppe der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse.
Demzufolge glaube ich, dass das Gesetz wirkt, dass das Gesetz greift – und ich habe diesbezüglich keine Differenzen mit dem Kollegen Muchitsch, denn das alles haben wir schon lange ausdiskutiert. (Beifall bei SPÖ, ÖVP und Grünen.)
18.47
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Als nächste Rednerin zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Mühlwerth.
18.48
Bundesrätin Monika Mühlwerth (FPÖ, Wien): Sehr geehrter Präsident! Sehr geehrter Herr Minister! Ich habe es heute schon einmal gesagt: Jeder Greißler lobt seine Ware, und natürlich sagt auch jeder Bundesminister, dass das, was er macht, ganz toll und ganz wunderbar ist, um damit jede Kritik im Keim zu ersticken.
Wenn aber alles immer so toll ist, dann frage ich mich schon, warum wir uns eigentlich noch immer über die Höherqualifizierung von Arbeitskräften unterhalten müssen. Wir haben auf der einen Seite Lehrlinge, die bei der Lehrlingsolympiade absolut toll abschneiden – das ist die eine Seite der Medaille –, die andere Seite der Medaille ist, dass wir Lehrstellenbewerber haben, die nicht ausreichend lesen, schreiben, rechnen können und daher kaum eine Chance auf einen Arbeitsplatz oder Lehrplatz haben. Seit Jahren diskutieren wir das.
Jetzt haben wir endlich geschafft, was in einem der vorhergehenden Tagesordnungspunkte beschlossen wurde – was ich begrüße –, nämlich dieses Fachkräftestipendium,
wo Menschen die Möglichkeit haben, sich besser zu qualifizieren, dennoch ist das ein Problem – und das verfolge ich seit Jahren, ohne dass sich wirklich etwas grundlegend ändert.
Zu dem Glücksfall der Rot-Weiß-Rot-Karte, Frau Kollegin Zwazl, möchte ich schon sagen, dass die offiziellen Zahlen eine andere Sprache sprechen. Bei der Beschlussfassung hat der Herr Bundesminister gesagt, dass 8 000 qualifizierte Zuwanderer kommen werden, 100 000 sollten es bis 2030 sein.
Und wie schaut es wirklich aus? Anhand der offizielle Zahlen von 2012 kann man über ein ganzes Jahr beobachten, wie viele Qualifizierte tatsächlich gekommen sind: Es sind 1 931 Anträge gestellt worden, davon wurden 1 500 bewilligt; dazu kommen noch 1 210 über die Familienzusammenführung. – Also keine Rede davon, dass da so ein Boom ist – und die Hochqualifizierten und jene, die aus Mangelberufen kommen, die kommen eben nicht.
2011 gab es allerdings 43 000 Anträge aus Drittstaaten. Dazu schreibt die „Presse“ am 26. Februar 2013:
„Andere Formen der Zuwanderung wie Familienzusammenführungen oder Asyl“ – das haben wir heute auch schon öfter diskutiert – „spielen offenkundig eine größere Rolle als der geregelte Zuzug“ der Qualifizierten, die Sie ja haben wollten. – Das heißt, von einem Erfolgsmodell der Rot-Weiß-Rot-Karte ist hier wirklich nicht zu sprechen. (Beifall bei der FPÖ.)
18.50
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Bundesrat Perhab. – Bitte.
18.51
Bundesrat Franz Perhab (ÖVP, Steiermark): Sehr geehrter Herr Minister! Herr Präsident! Keine Angst, nur eine Minute, aber ich muss mich als Touristiker schon zu Wort melden. Der Herr Minister würde sonst etwas vermissen, und zwar mein Lieblingsthema Saisonniers.
Es sind in dieser Novelle, Gott sei Dank, die Übergangsfristen für Bulgarien und Rumänien zu Ende. Aber ab 1. Juni haben wir ein neues EU-Mitglied, Kroatien. Kroatien ist für uns Touristiker der Gegenpol zur Wintersaison in Österreich, und wir haben wieder eine siebenjährige Übergangsfrist, nicht zu unserer Freude. In der Praxis selbst hoffe ich auf die bewährte Methode: nach zwei Jahren wird evaluiert, nach drei Jahren wird wieder evaluiert und dann kommt endlich nach sieben Jahren die Öffnung.
Ich gestehe zu, dies ist abhängig von der Arbeitsmarktsituation in Österreich. Aber es geht auch darum, dass wir in Österreich als Erste die besseren Kräfte aus Kroatien rekrutieren können, und nicht unsere Mitbewerber. – Vielen Dank. (Beifall bei der ÖVP.)
18.52
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Mir liegen hiezu keine Wortmeldungen mehr vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall.
Die Debatte ist geschlossen.
Wir gelangen nun zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
23. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Behinderteneinstellungsgesetz, das Bundesbehindertengesetz, das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, das Opferfürsorgegesetz, das Heeresversorgungsgesetz, das Impfschadengesetz, das Verbrechensopfergesetz, das Bundespflegegeldgesetz, das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, das Arbeitsmarktservicegesetz, das Arbeitsmarktförderungsgesetz, das IEF-Service-GmbH-Gesetz, das Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz 1991, das Arbeitsruhegesetz, das Arbeitszeitgesetz, das Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz 1987, das Landarbeitsgesetz 1984, das Mutterschutzgesetz 1979, das Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz, das Gleichbehandlungsgesetz, das Arbeitsverfassungsgesetz, das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, das Arbeitsinspektionsgesetz 1993 und das Produktsicherheitsgesetz 2004 geändert werden und das Bundesberufungskommissionsgesetz aufgehoben wird (Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz – Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz) (2193 d.B. und 2226 d.B. sowie 8934/BR d.B.)
24. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, das Notarversicherungsgesetz 1972 und das Nachtschwerarbeitsgesetz geändert werden (Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz – Sozialversicherung) (2195 d.B. und 2227 d.B. sowie 8915/BR d.B. und 8935/BR d.B.)
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Wir gelangen nun zu den Punkten 23 und 24 der Tagesordnung, über welche die Debatte unter einem durchgeführt wird.
Berichterstatter ist Herr Bundesrat Todt. Bitte um die Berichte.
Berichterstatter Reinhard Todt: Meine Damen und Herren! Ich bringe zunächst den Bericht des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz über den Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend ein Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz – Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor; ich komme daher gleich zur Antragstellung.
Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz stellt nach Beratung der Vorlage am 3. April 2013 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Ich komme weiters zum Bericht des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz über den Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, das Notarversicherungsgesetz 1972 und das Nachtschwerarbeitsgesetz geändert werden (Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz – Sozialversicherung).
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor; ich komme daher gleich zur Antragstellung.
Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz stellt nach Beratung der Vorlage am 3. April 2013 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Danke für die Berichterstattung.
Wortmeldungen dazu liegen mir nicht vor.
Wünscht dazu jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall.
Die Debatte ist geschlossen.
Die Abstimmung über die gegenständlichen Beschlüsse des Nationalrates erfolgt getrennt.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend ein Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz – Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit angenommen.
Nun gelangen wir zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend ein Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz – Sozialversicherung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein über soziale Sicherheit (2138 d.B. und 2229 d.B. sowie 8936/BR d.B.)
26. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Vorbereitenden Kommission für die Organisation des Vertrages über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen über soziale Sicherheit (2139 d.B. und 2230 d.B. sowie 8937/BR d.B.)
27. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Indien über soziale Sicherheit (2159 d.B. und 2231 d.B. sowie 8938/BR d.B.)
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Wir gelangen zu den Punkten 25 bis 27 der Tagesordnung, über welche die Debatte unter einem durchgeführt wird.
Berichterstatter ist Herr Bundesrat Wilhelm. Bitte um die Berichte.
Berichterstatter Richard Wilhelm: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Minister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Ich bringe den Bericht des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz über den Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein über soziale Sicherheit.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor; ich komme daher gleich zur Antragstellung.
Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz stellt nach Beratung der Vorlage am 3. April 2013 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Ich bringe weiters den Bericht des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz über den Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Vorbereitenden Kommission für die Organisation des Vertrages über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen über soziale Sicherheit.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor; ich komme daher gleich zur Antragstellung.
Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz stellt nach Beratung der Vorlage am 3. April 2013 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Ich bringe außerdem den Bericht des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz über den Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Indien über soziale Sicherheit.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor; ich komme daher gleich zur Antragstellung.
Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz stellt nach Beratung der Vorlage am 3. April 2013 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Danke für die Berichterstattung.
Es liegen mir keine Wortmeldungen vor.
Wünscht dazu jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall.
Die Debatte ist geschlossen.
Die Abstimmung über die gegenständlichen Beschlüsse des Nationalrates erfolgt getrennt.
Wir kommen zunächst zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein über soziale Sicherheit.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist angenommen.
Wir gelangen nun zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Vorbereitenden Kommission für die Organisation des Vertrages über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen über soziale Sicherheit.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist ebenfalls Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist angenommen.
Wir gelangen nun zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Indien über soziale Sicherheit.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist angenommen.
Jahresbericht 2013 gemäß Art. 23f Abs. 2 B-VG des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz auf der Grundlage des Legislativ- und Arbeitsprogramms der Europäischen Kommission für 2013 sowie des Achtzehnmonatsprogramms des irischen, litauischen und griechischen Ratsvorsitzes (III-484-BR/2013 d.B. sowie 8939/BR d.B.)
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Wir gelangen nun zum 28. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatter ist wieder Herr Bundesrat Wilhelm. Ich bitte um die Berichterstattung.
Berichterstatter Richard Wilhelm: Ich bringe den Bericht des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz über den Jahresbericht 2013 gemäß Artikel 23f Abs. 2 B-VG des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz auf der Grundlage des Legislativ- und Arbeitsprogramms der Europäischen Kommission für 2013 sowie des Achtzehnmonatsprogramms des irischen, litauischen und griechischen Ratsvorsitzes.
Der Bericht liegt in schriftlicher Form vor, ich komme daher sogleich zur Antragstellung.
Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz stellt nach Beratung der Vorlage am 3. April 2013 den Antrag, den Jahresbericht 2013 gemäß Artikel 23f Abs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz auf der Grundlage des Legislativ- und Arbeitsprogramms der Europäischen Kommission für 2013 sowie des Achtzehnmonatsprogramms des irischen, litauischen und griechischen Ratsvorsitzes zur Kenntnis zu nehmen.
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Ich danke für die Berichterstattung.
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gelangt als Erste Frau Bundesrätin Mühlwerth. – Bitte, Frau Kollegin.
19.01
Bundesrätin Monika Mühlwerth (FPÖ, Wien): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Ich möchte einmal vorausschicken, dass so ein Arbeitsprogramm von seiner Konzeption und von seiner Aufstellung und Gliederung her natürlich durchaus in Ordnung ist. Warum wir diesen Bericht dennoch nicht zur Kenntnis nehmen, hat einfach mit den Inhalten zu tun, die grundsätzliche Inhalte sind, die die Europäische Union vorgibt und aufgrund derer sämtliche Arbeitsprogramme einander gleichen, auch wenn sie ressortmäßig natürlich unterschiedlich dargestellt und gegliedert sind und sich auch im Einzelnen unterscheiden. Die grundsätzlichen Maßnahmen ziehen sich aber wie ein roter Faden durch.
Um ein paar Punkte zu nennen: Selbstverständlich begrüßt jeder von uns Maßnahmen gegen Arbeitslosigkeit, gegen Armut, besonders gegen Jugendarbeitslosigkeit, weil wir ja europaweit schon von einer verlorenen Generation sprechen müssen. Es ist zwar für Österreich schön, wenn wir bei der Jugendarbeitslosigkeit auf einem sehr niedrigen Stand sind, wenn wir uns aber europaweit die Länder anschauen, die wir über den ESM mitfinanzieren, die eine Jugendarbeitslosenrate von 50 Prozent haben, dann müssen wir sagen, das ist eine Generation, die verloren zu sein scheint und die sich natürlich auch in Bewegung setzen wird. Man muss sich auch fragen: Woher kommt
denn diese hohe Jugendarbeitslosigkeit? Woher kommt hohe Arbeitslosigkeit überhaupt?
Wir haben einen globalisierten Markt. Wir haben immer mehr Dienstleistungsfirmen und immer weniger Produktionsfirmen, die aber eigentlich die Wertschöpfung ausmachen. Wir haben immer mehr Firmen, die an die Börse gehen, die börsennotierte Unternehmen sind. Der Sinn und das Ziel eines börsenorientierten Unternehmens sind aber, eine möglichst hohe Rendite zu machen, und nicht so sehr, darauf zu schauen, dass Arbeitsplätze geschaffen werden. Ganz im Gegenteil, in vielen Fällen ist es so, dass man sagt: Die Personalkosten sind hoch, und daher müssen wir sie möglichst wieder herunterschrauben!
Das heißt, es bleibt immer weniger für immer mehr Menschen über, die alle Arbeitsplätze bekommen wollen. Das heißt, die soziale Marktwirtschaft – zu der wir ja alle stehen – wird immer weiter zurückgedrängt und ist eigentlich längst einem mehr oder weniger finanzgesteuerten Kapitalmarkt gewichen, was wirklich bedauerlich ist.
Der zweite Punkt: der Mobilitätsgedanke. Der Mobilitätsgedanke ist grundsätzlich ein guter. Ich begrüße es, wenn Menschen sagen: Ich möchte einmal in einem anderen Staat arbeiten (Bundesrätin Zwazl: Rot-Weiß-Rot-Karte!), ich möchte schauen, wie es dort ist! – Wir reden ja von den Qualifizierten. (Bundesrätin Zwazl: Ja, davon rede ich ja auch!) Ich würde das zum Beispiel auch im Bereich der Lehrlinge durchaus begrüßen, so wie man früher auf die Walz gegangen ist. (Bundesrätin Zwazl: Monika, das gibt es ja, erkundige dich einmal!)
Dass man sich einmal woanders umschaut, finde ich gut, nur: Wir sind aber mittlerweile schon in der misslichen Lage, dass Leute nahezu gezwungen sind, in ein anderes Land auszuwandern, um überhaupt noch einen Arbeitsplatz zu finden. Man braucht nur nach Spanien oder nach Portugal zu schauen, wie sich dort Menschen in Bewegung setzen, nicht nur innerhalb Europas, sondern auch außerhalb Europas.
Das sind aber Menschen, die Bindungen haben, die Freunde haben, die eine Wohnung haben, ein Heim haben, die jedenfalls gesellschaftliche Kontakte haben. Da gefällt es mir wieder nicht, dass dieser Mobilitätsgedanke fast schon ein zwingender und nicht mehr ein freiwilliger ist.
Mein dritter Punkt ist heute schon einmal behandelt worden – nicht mit Ihnen, sondern mit Ihrer Kollegin, Frauenministerin Heinisch-Hosek –: die Gleichbehandlung. –Ja, Gleichbehandlung an sich ist in Ordnung, aber auch hier hat die EU eine Strategie, zu sagen, die Gleichbehandlung darf nicht mehr nur im Berufs- und Arbeitsumfeld sein, sondern geht bis in den privaten Bereich hinein. Und da sage ich: Das geht mir zu weit! (Bundesrätin Mag. Kurz: Halbe-halbe ist die Devise! Papamonat!) Es geht mir zu weit, denn ich muss mir schon auch aussuchen können, wen ich mag und wen ich nicht mag. (Bundesrätin Zwazl: So ist das aber nicht wahr!) – Das steht aber im Arbeitsprogramm, ich habe es mir angeschaut. Das ist genau so drinnen. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist.
Der letzte Punkt, den ich im Zuge der Gleichbehandlung ansprechen möchte, ist die Quotenverpflichtung für Frauen in den Aufsichtsräten. Ich muss wirklich sagen – Kollegin Blatnik, mit Ihnen matche ich mich da am meisten –: Ich lehne das wirklich ab! Ich will nicht, dass Frauen unter einen Quargelsturz gesetzt werden! (Bundesrätin Mag. Kurz: Das ist ja nicht der Fall!) Wir sind alle irgendwo in einem Wettbewerb, auch die Männer. (Bundesrätin Mag. Kurz: Warum sind denn dann überall nur Männer?)
Es nützt uns gar nichts! Ich bin kein Freund der Quote, und ich glaube auch nicht, dass sie wirklich etwas nützt. Ich möchte auch nicht in einen Aufsichtsrat kommen, nur weil ich eine Frau bin, auch wenn ich qualifiziert bin. (Bundesrätin Mag. Kurz: Wirst du eh nicht!) Ich lehne auch ab, was zum Beispiel bei den Medizintests gemacht worden ist.
Ich glaube, 20 Prozent der Frauen waren es, die beim Medizintest nicht durchgekommen sind, und deshalb hat man den Test einfach anders bewertet. Es kann doch nicht im Sinne der Frauen, in unserem Sinn sein, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird!
Diese Aufsichtsratsquotenregelung, damit gleich viele Männer und Frauen vertreten sind, lehne ich ab. Außerdem möchte ich anmerken: Im umgekehrten Fall geschieht das nämlich nicht! Dort nämlich, wo die Frauen schon fast 100 Prozent haben, zum Beispiel bei den Direktoren im Wiener Volksschulbereich, könnt Ihr euch anschauen, was geschieht, wenn man versucht, das Gleichbehandlungsgesetz zur Anwendung zu bringen. Ich habe das einmal versucht, in einem Fall, in dem ein Mann und eine Frau ziemlich gleich qualifiziert waren – da hätte man würfeln können. Da habe ich gesagt, das Gleichbehandlungsgesetz muss sehr wohl für beide gelten. (Bundesrätin Mag. Kurz: Es gilt ja auch für beide!) Mehr habe ich nicht gebraucht, schon sind sämtliche Frauen über mich hergefallen und haben gesagt, es darf ja wohl nicht wahr sein, dass ich fordere, dass da jetzt ein Mann zum Zug kommt und nicht eine Frau. (Bundesrätin Blatnik: Ich bin absolut für mehr Männer in Sozialberufen! Ich hätte auch gern mehr Pädagogen und Volksschullehrer!) Es ist ja schön, dass wir uns einmal irgendwo einig sind. Ich freue mich ja.
Mein allerletzter Punkt – ganz kurz noch – ist die Akademikerquote, denn die ist ja auch ein Ziel der Strategie 2020. Auch mit dieser Forderung nach einer höheren Akademikerquote habe ich ein gewisses Problem, denn ich glaube, es nützt uns gar nichts, wenn wir jetzt auch Berufe, für die wir ausgebildete Fachkräfte haben, unbedingt einem akademischen Abschluss zuführen müssen und dann glauben, die sind jetzt besser. Die leisten ja deswegen keine bessere Arbeit, die leisten ja jetzt schon gute Arbeit! (Bundesrätin Blatnik: Darum geht es ja gar nicht!) Ich bin aber ein wirklicher Anhänger davon – wir reden ja immer davon, dass wir einen Fachkräftemangel haben –, dass wir jene Jugendlichen, die aus den Schulen herauskommen, über den Weg einer Lehre oder einer sonstigen Zusatzausbildung zu qualifizierten Fachkräften machen. Ich habe da auch kein Problem mit der Lehre mit Matura. Ich glaube aber, wir dürfen nicht wie das Kaninchen vor der Schlange nur auf die Akademikerquote schauen, sondern müssen uns für qualifizierte Abschlüsse in verschiedenen Bereichen aussprechen, stark machen und das auch durchsetzen. (Beifall bei der FPÖ, bei Bundesräten der ÖVP sowie des Bundesrates Dönmez.)
19.09
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Als Nächste gelangt Frau Bundesrätin Kemperle zu Wort. – Bitte, Frau Kollegin.
19.09
Bundesrätin Monika Kemperle (SPÖ, Wien): Herr Minister! Geschätztes Präsidium! Werte Kolleginnen und Kollegen des Bundesrates! Ich glaube, dass das Arbeitsprogramm letztendlich ein sehr ambitioniertes ist und es wert ist, auch inhaltlich weiter verfolgt zu werden. Das Arbeitsprogramm stellt sich den Herausforderungen, vor denen wir alle miteinander stehen. Das heißt, es stellt sich den Herausforderungen der Wirtschaftskrise und es versucht, Nachhaltigkeit und Stabilität zu erreichen.
Es steht, glaube ich, außer Streit, dass wir, was die verschiedenen zu verwendenden Mittel betrifft, unter Umständen politisch gesehen unterschiedlicher Auffassung sind.
Nicht außer Streit steht allerdings, dass es sehr wohl mancher Maßnahmen bedarf, die dazu führen, dass es positive Effekte gibt. Ein Effekt – und hier haben Sie mich wirklich herausgefordert – ist natürlich jener hinsichtlich Frauen, Frauenbeschäftigung und Frauen in höheren Positionen.
Ich bin dafür, dass Maßnahmen getroffen werden, die es allen ermöglichen, die richtigen Rahmenbedingungen vorzufinden, damit diese auch in ihren Bereichen zur Umsetzung gelangen und damit alle die Möglichkeiten der Wahl haben.
Tatsache ist aber, dass es ohne die Quote keine Wahlmöglichkeit gegeben hätte. Nur mit Einführung der Quote wurde die Möglichkeit geschaffen, dass Frauen in höhere Positionen kommen und dass sie letztendlich auch den Weg dorthin finden.
Ich stehe nicht an, letztendlich auch für mich in Anspruch zu nehmen – und das können andere für sich auch –, selbst eine Quotenfrau zu sein, wenn ich nach deinen Argumenten gehe. (Bundesrätin Mühlwerth: Ich bin keine Quotenfrau!)
Ich sehr wohl, weil die Quote beschlossen wurde, weil es Maßnahmen gegeben hat. Ich sage nicht, dass ich schlechter qualifiziert bin, nicht qualifiziert bin oder nichtwissend bin. (Beifall bei der SPÖ.)
Ich bestehe darauf, dass Frauen, auch wenn sie als sogenannte Quotenfrauen bezeichnet werden, wenn sie die notwendigen Voraussetzungen und Qualifikationen haben, um die entsprechenden Positionen auszufüllen, die Möglichkeit erhalten, in diese Positionen zu kommen. (Beifall bei der SPÖ.)
Ich glaube, dass es hier sehr vieler Maßnahmen bedarf, damit es diese Möglichkeiten auch gibt. Eine dieser Maßnahmen und eine dieser Voraussetzungen wird in diesem Arbeitsprogramm beschrieben und gefordert und, ich hoffe, letztendlich mit Vehemenz vertreten, damit diese Maßnahmen zur Durchsetzung gelangen.
Der nächste Bereich ist einer, der – gerade was das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz betrifft – den ArbeitnehmerInnenschutz betrifft. Ich glaube, dass hier die Notwendigkeiten gegeben sind, tatsächlich darauf zu schauen.
Hier sind einige Richtlinien festgelegt, die zur Veränderung anstehen. Wenn ich mir nämlich anschaue, mit welchen Maßnahmen oder Voraussetzungen in manchen Bereichen noch gearbeitet wird, dann glaube ich, dass hier ein großer Schritt getan werden muss, auch hier Vorkehrungen zu treffen.
Wenn ich sehe, dass zum Beispiel das Chemikalienrecht im ArbeitnehmerInnenschutz auch im Programm steht, dann muss ich sagen, dass das ein guter Schritt ist, dass aber nicht nur für den europäischen Bereich – und ich habe sehr viel mit internationaler Arbeit zu tun –, sondern auch für den internationalen Bereich Vorkehrungen zu treffen sind.
Es nützt nämlich nichts, wenn ich Biobaumwolle anbaue, Biobaumwolle habe und diese letztendlich mit Chemikalien einfärbe, die hautunverträglich sind, die Allergien auslösen et cetera, und wenn diese Produkte dann in die Europäischen Union eingeführt werden, sodass wir letztendlich wieder vor der Tatsache stehen, dass unzureichende Vorkehrungen getroffen wurden.
Die Jugendarbeitslosigkeit ist heute schon angesprochen worden. Auch hier ist es mehr als notwendig, Maßnahmen zu treffen, und ich glaube, dass die Europäische Union und die Kommission letztendlich einen richtigen Schritt getan haben, indem sie sich auch das österreichische Modell angesehen haben.
Wir hier haben leider Gottes immer wieder die Tendenz, dass wir unsere eigenen Maßnahmen, unsere eigenen positiven Effekte schlechtreden und diese als nicht ausreichend und als unzulänglich bewerten. Letztendlich haben wir aber in der Krise gesehen, dass gerade unsere Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in dieser Situation genau die richtigen Maßnahmen waren. Ich glaube, dass diese letztendlich auch in der Europäischen Union zu positiven Effekten führen werden.
Was den Konsumentenschutz betrifft, glaube ich, sind auch dafür im Arbeitsprogramm Vorkehrungen getroffen. Ich möchte dazu nur ein Beispiel anführen, weil ja jeder von uns irgendwann einmal eine Flugreise macht. In letzter Zeit gab es immer wieder Zeitungsberichte über Überbuchungen et cetera, und ich glaube, dass es hier notwendig ist, im Bereich des Konsumentenschutzes Vorkehrungen zu treffen.
Wenn ich mir das Arbeitsprogramm anschauen, dann meine ich, es wird insgesamt sehr viele positive Effekte geben. Ich hoffe, dass all diese Effekte letztendlich auch zum Tragen kommen und die Maßnahmen umgesetzt werden.
Wir werden diesen Bericht jedenfalls positiv zur Kenntnis nehmen. – Danke. (Beifall bei der SPÖ sowie des Bundesrates Dönmez.)
19.16
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Als Nächster gelangt Herr Bundesrat Wenger zu Wort. – Bitte, Herr Kollege.
19.16
Bundesrat Franz Wenger (ÖVP, Salzburg): Sehr geehrte Herren Bundesminister! Geschätzter Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Wesentliche Inhalte des vorliegenden Berichtes wurden ja im Verlauf des Tages, im Rahmen der heutigen Sitzung schon umfassend erläutert. Ich kann daher auf Wiederholungen verzichten.
Ich möchte dennoch einige Bemerkungen anbringen, denn es ist schon erstaunlich, wie Österreich als kleiner Mitgliedstaat der Europäischen Union mit der Entwicklung der Krise von 2008 umgeht und diese wie kaum ein anderes Land innerhalb der EU bewältigt.
Dieses Krisenmanagement gibt es natürlich nicht zum Nulltarif. Die in Österreich gelebte Form der Sozialpartnerschaft hat sich wieder einmal mehr als bewährt. Eine Sozialpartnerschaft, die zwar auf harten Verhandlungen, die auf der Ebene der Interessensvertretungen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber geführt werden, beruht, die aber letztendlich in gemeinsamer Verantwortung zu positiven Ergebnissen führt.
Österreich kann innerhalb Europas in vielen Bereichen auf Best-Practice-Beispiele verweisen. Exemplarisch dafür seien die Jugendbeschäftigung, die niedrigste Arbeitslosenrate insgesamt, die duale Berufsausbildung, die überbetrieblichen Lehrwerkstätten, die Bereiche Konsumentenschutz, Wachstumsförderung und Arbeitsplatzschaffung sowie vieles andere mehr erwähnt.
Speziell die Frage der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, im Speziellen der Jugendarbeitslosigkeit, ist ja nicht nur in Österreich ein Thema, sondern ein zentrales europäisches Thema. In diesem Zusammenhang möchte ich doch auf die Diskussion rund um das EU-Budget Bezug nehmen. Für Maßnahmen in diesem Bereich sind grundsätzlich 6 Milliarden € vorgesehen.
Sehr geehrter Herr Bundesminister, ich hoffe, dass nicht nur dieser Budgetposten hält, sondern auch jene Ansätze im EU-Budget, die unbedingt erforderlich sind, um die im vorliegenden Bericht geplanten sozialpolitischen Verbesserungen auch umsetzen zu können.
Wir haben nun einmal innerhalb der EU unterschiedliche Sozialstandards, und es wird nicht nur Zeit, sondern auch vieler gemeinsamer Anstrengungen bedürfen, um diese Unterschiede abzubauen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Da bereits die elfte Sitzungsstunde angebrochen ist, möchte ich meine Ausführungen natürlich kurz halten. Ich möchte mich aber bei jenen bedanken, die an der Erstellung dieses Berichtes mitgewirkt haben.
Insgesamt kann festgestellt werden, dass die für das Jahr 2013 seitens des Ministeriums geplanten Vorhaben nicht nur umfangreich, sondern auch sehr ambitioniert sind.
Im vorliegenden Bericht ist zu den einzelnen Themen die österreichische Position sehr klar formuliert, und in der Erwartung, dass die Umsetzung auch gelingt, nimmt die ÖVP-Fraktion den vorliegenden Bericht zur Kenntnis. (Beifall bei der ÖVP und bei Bundesräten der SPÖ.)
19.20
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall.
Die Debatte ist geschlossen.
Wir gelangen nun zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, den gegenständlichen Bericht zur Kenntnis zu nehmen, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz über die Grundsätze für Hilfen für Familien und Erziehungshilfen für Kinder und Jugendliche (Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013 – B-KJHG 2013) (2191 d.B. und 2202 d.B. sowie 8942/BR d.B.)
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Wir gelangen nun zum 29. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatterin ist Frau Bundesrätin Greiderer. Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatterin Elisabeth Greiderer: Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzter Minister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich erstatte den Bericht des Ausschusses für Familie und Jugend über den Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz über die Grundsätze für Hilfen für Familien und Erziehungshilfen für Kinder und Jugendliche (Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013).
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher sogleich zur Antragstellung.
Der Ausschuss für Familie und Jugend stellt nach Beratung der Vorlage am 3. April 2013 mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Ich danke für die Berichterstattung.
Ich darf zur Debatte über diesen Tagesordnungspunkt sehr herzlich Herrn Bundesminister Dr. Mitterlehner begrüßen. (Allgemeiner Beifall.)
Als Erste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Mühlwerth. – Bitte, Frau Kollegin.
19.21
Bundesrätin Monika Mühlwerth (FPÖ, Wien): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Minister! Dieser Regierungsvorlage sind ja sehr lange Verhandlungen vorausgegangen, und ich glaube, es ist jetzt der vierte Entwurf, über den wir heute abstimmen.
Ich möchte Ihnen ausdrücklich meine Anerkennung ausdrücken, Herr Minister, dass Sie sich hier wirklich bemüht haben, einen Konsens zu finden, was nicht immer ganz
einfach ist, und dass Ihnen auch durchaus gute Schritte gelungen sind. Zum Beispiel: die Professionalisierung der Fachkräfte, auch bei den privaten Vereinen; einheitliche Standards für alle Einrichtungen, halte ich für ganz wesentlich; Qualitätskriterien für Adoptiv- und Pflegeeltern, auch bis jetzt nicht gewesen, auch ein wichtiger Teil; Aufgabenbeschreibung der Kinder- und Jugendanwaltschaft – und, und das ist, glaube ich, immer das Schwierigste in solchen Verhandlungen, dass alle Bundesländer an Bord sind. Denn: Wir erleben ja immer wieder, dass dann einige ihre eigene Suppe kochen, und dann schaut es zuerst einmal nach einem Konsens aus, doch dann springen wieder ein paar ab. Also hier ist es Ihnen gelungen, doch alle Länder an Bord zu bekommen.
Aber warum wir trotzdem nicht zustimmen können, war und ist – und das hat ja schon meine Kollegin im Nationalrat gesagt –, weil uns dieses Vier-Augen-Prinzip so wichtig ist. Ich weiß, Sie haben das auch in der Nationalratssitzung gesagt, das steht ja drinnen, erforderlichenfalls kann man eine weitere Meinung einholen, und Sie vertrauen den Fachkräften, dass sie durchaus in der Lage sind, zu beurteilen, ob sie das alleine können oder ob es doch besser ist, noch jemanden hinzuzuziehen.
Bei allem Respekt vor den Fachkräften, wir haben aber leider schon öfter erlebt, dass die Fachkräfte eine Situation völlig falsch eingeschätzt haben. Ich erinnere da zum Beispiel, da es mir gerade einfällt, an den Pöstlingberg. Das gab es auch eine völlig falsche Einschätzung der Situation, wo die Dinge anders gelaufen wären, wenn man die Situation richtiger eingeschätzt hätte, wenn sich die Leute abgesprochen hätten und sich nicht der eine auf den Datenschutz berufen hätte und der andere den Datenschutz nicht auf seine Weise interpretiert hätte.
Daher sagen wir, vier Augen sehen mehr als zwei. Das sollte für uns der Normalfall sein. Und daher können wir dem bedauerlicherweise nicht zustimmen. (Beifall bei der FPÖ.)
19.24
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Bundesrat Reisinger. – Bitte, Herr Kollege.
19.24
Bundesrat Friedrich Reisinger (ÖVP, Steiermark): Hohes Präsidium! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Geschätzte Damen und Herren! Frau Kollegin Mühlwerth, ich gebe Ihnen in vielen Punkten recht, aber ich habe auch volles Verständnis dafür, dass man in der Rolle der Opposition immer versucht, nach Argumenten zu suchen, welche eine Ablehnung rechtfertigen. (Bundesrätin Mühlwerth: Aber wir stimmen auch oft zu, gell?) Das liegt in der Natur der Sache, aber ich muss Ihnen schon auch sagen, es geht bei diesem Gesetz um das Wohl der Kinder und Jugendlichen, und ich glaube, hier sollte man nicht unbedingt politische Spielchen machen.
Dieses Gesetz wurde sehr verantwortungsvoll und auch sehr gründlich und – ja, das ist durchaus kritisch anzumerken – auch sehr lange verhandelt. Aber es ist nun einmal so, wenn man etwas nicht auf die leichte Schulter nimmt und etwas ordentlich machen möchte, dann braucht es eben auch seine Zeit, bis man alles unter einem Hut hat. Wie Sie wissen, haben wir diesbezüglich die schwierige Situation, dass der Bund für den Rahmen und die Länder für die Vollziehung und im Wesentlichen auch für die Finanzierung zuständig sind. Die Berücksichtigung der Länderinteressen war daher ein ganz entscheidender Aspekt bei diesen Verhandlungen. Damit dieser Konsens mit den Ländern überhaupt zustande gekommen ist, war nicht zuletzt auch die Zusage der Mitfinanzierung des Bundes ein wesentlicher Punkt.
Nun obliegt es den Ländern, die entsprechenden Ausführungsbestimmungen zu regeln, und ich bin auch da überzeugt, dass die Bundesländer ihre Verpflichtung und Verantwortung entsprechend wahrnehmen werden.
Dieses Gesetz ist fertig ausverhandelt, es liegt auf dem Tisch, und es ist gut so, wie es ist. Und das sage nicht nur ich, und das sagt nicht nur der Herr Bundesminister, das sagen mir auch viele Menschen, die mit der Materie Jugendwohlfahrt sehr intensiv und auch täglich befasst sind.
Ich möchte in diesem Zusammenhang all jenen Menschen in unserem Lande, welche mit hoher Professionalität und mit höchster Professionalität im Bereich der Kinder- und Jugendwohlfahrt arbeiten, ein großes Lob aussprechen und ein großes Danke sagen.
Dieses Gesetz bringt eindeutige Verbesserungen, was den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gewalt in der Familie, aber auch vor anderen Gefährdungen betrifft. Es sind die Gefährdungsabklärung und die Hilfeplanung neu geregelt. Es gibt klare Regeln und Vorgaben, was die Mitteilungspflicht und die Dokumentation betrifft. Und es sind auch Fragen des Datenschutzes zeitgemäß geregelt.
Ich bin sehr froh darüber, dass dieses Gesetz auf Schiene ist, da es ein wichtiger Baustein in einer Reihe wichtiger familienpolitischer Eckpfeiler ist, in einer Reihe an Eckpfeilern, welche in letzter Zeit sehr erfolgreich realisiert und umgesetzt wurden. Ich nenne nur die Neuregelung in der Frage der Obsorge, wo es darum geht, dass beide Elternteile ihre Rechte und Pflichten gleichwertig wahrnehmen sollen und auch dürfen, oder das Gratis-Kindergartenjahr, wo der Bund in den kommenden zwei Jahren die Kindergartenfinanzierung mit weiteren 140 Millionen € unterstützt, oder den Ausbau der Kinderbetreuungsplätze, wo die Bundesregierung 55 Millionen für eine Ausbauoffensive zur Verfügung stellt, da es enorm wichtig ist, dass Familie und Beruf vereinbar sind.
Es gäbe noch eine Reihe weiterer Punkte aufzuzählen, so zum Beispiel die Neuregelung bei der Familienbeihilfe und dergleichen mehr. Aber dazu gibt es ohnehin noch zwei weitere Gesetzesvorlagen unter den nächsten Tagesordnungspunkten.
Ich denke, dass wir insgesamt familienpolitisch sehr vorbildhaft unterwegs sind. Und das ist auch gut so und wichtig, da es gerade die Familien mit ihren Kindern und Jugendlichen sind, welche die Stütze und die Träger einer funktionierenden Gesellschaft sind. Und ich sage es noch einmal: Dieses Gesetz ist ein wesentlicher Schritt in die richtige Richtung, und ich gratuliere vor allem dir, Herr Bundesminister, dass es gelungen ist, dieses Gesetz in dieser Form zu finalisieren. (Beifall bei der ÖVP.)
Ein letzter Satz noch, meine Damen und Herren von der Opposition: Mit Ihrer heute angekündigten Nicht-Zustimmung zu diesem Gesetz stimmen Sie auch wesentlichen Verbesserungen im Bereich der Kinder- und Jugendwohlfahrt nicht zu, und ich finde, das ist wirklich sehr schade. – Danke. (Beifall bei der ÖVP und bei Bundesräten der SPÖ.)
19.29
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Bundesrat Dönmez. – Bitte, Herr Kollege.
19.29
Bundesrat Efgani Dönmez, PMM (Grüne, Oberösterreich): Hohes Präsidium! Sehr geehrter Herr Minister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Dass es in der Jugendwohlfahrt massiven Handlungsbedarf gibt und gegeben hat, ist, glaube ich, allen Involvierten vollkommen klar. Und da hat der Herr Minister, wie meine Vorrednerinnen und Vorredner schon angemerkt haben, massive Anstrengungen unternommen, um hier einheitliche Qualitätsstandards in die Wege zu leiten. Dass das nicht immer ganz einfach war und ist, wissen wir. Diesbezüglich einen recht herzlichen Dank meinerseits.
Es gibt aber dennoch einige Kritikpunkte, die ich auch gerade als Sozialarbeiter anmerken möchte. Den Kritikpunkt mit dem Vier-Augen-Prinzip hat die Kollegin Mühlwerth schon angesprochen. Ich habe das auch im Ausschuss in der Diskussion mit den ExpertInnen kurz andiskutiert. Für mich macht es schon einen Unterschied, ob ich mich im Helfersystem mit Sozialarbeitern, Sozialpädagogen oder Psychologen oder einem weiteren Helfer austausche oder ob ich gewisse Informationen gleich an die Exekutive oder an die Sicherheitsbehörde weiterleite, denn dann kommt ein massiver Stein ins Rollen, und das hat massivste Auswirkungen auf die Involvierten – sei es in der Familie oder auch in der Einrichtung, wo sie untergebracht sind.
Ich weiß, welch großem Druck die Berater und Beraterinnen, die Pädagogen und Sozialarbeiter, die in diesem Bereich tätig sind, ausgesetzt sind. Es ist wirklich keine leichte Entscheidung. Und daher ist es umso wichtiger, dass hier disziplinübergreifend unterschiedliche Professionalisten im Teamwork für das Kindeswohl und für das Wohl der Jugendlichen zusammenarbeiten. – Das ist der eine Punkt.
Der zweite Punkt, der mir fehlt – und das habe ich auch im Ausschuss angesprochen –, ist die Verankerung von Hilfen für junge Erwachsene. Ich weiß, da gibt es dann die Diskussionen: Soll man das am Alter festmachen oder an den Bedürfnissen? Wie lange kann man jemandem eine Unterstützung zukommen lassen? Und es kostet letztendlich auch viel Geld. Ich habe wirklich in meiner beruflichen Praxis als Sozialarbeiter, aber auch in meiner politischen Tätigkeit einige Fälle gehabt, wo junge Menschen weiterhin Hilfe und Unterstützung benötigt haben, weil sie einfach noch nicht so weit waren in ihrer Persönlichkeitsentwicklung oder dass sie am Arbeitsmarkt, sei es am primären oder am sekundären Arbeitsmarkt, Fuß fassen konnten.
Da aber mit dem Argument fehlender Geldmittel diesen jungen Menschen eine Unterstützung nicht zukommen zu lassen, das kostet uns als Steuerzahler im Endeffekt viel mehr, weil das die Leute sind, die dann mit großer Wahrscheinlichkeit in der Arbeitslosen oder in der Sozialhilfe sind.
Wir haben halt ein Pensionssystem, das vorsieht, insbesondere für die heute Jungen, dass man bis 65 im Berufsleben stehen soll. Wenn man aber gerade in einer wichtigen Phase nicht zusätzliches Geld in die Hand nimmt, um diese Jugendlichen zu stabilisieren, kostet uns das als Steuerzahler letztendlich viel mehr, als wenn man sie über das 18. Lebensjahr hinaus, wo ja dann die Volljährigkeit erreicht ist und meistens auch die Zuständigkeit der Jugendwohlfahrt endet, sozusagen noch weiter begleiten könnte. Und da gibt es nicht wenige Jugendliche, Jugendliche, die Beeinträchtigungen haben, Jugendliche, die auf Grund von Entwicklungsdefiziten noch zusätzlichen Bedarf benötigen, und die fallen wirklich de facto fast überall durch: und das ist meiner Meinung nach schon ein großes Problem.
Was ich auch als Problem sehe, aber das kann man sicher optimieren, das ist meines Erachtens eine technische Adaptierung, das ist das Fehlen einer einheitlichen Dokumentation. Das macht es dann schwierig, wenn unterschiedliche Einrichtungen unterschiedliche Dokumentationen verwenden, letztendlich auch für die Behörde, weil sich die immer wieder auf neue Dokumentationssysteme einstellen, einlesen muss und so weiter. Wenn es da für bestimmte Bereiche ein einheitliches Dokumentationssystem gäbe, würde man sich als Sozialarbeiter oder als Helfender leichter tun, denn wenn ich den Job wechsle, zum Beispiel von der Caritas zur Volkshilfe oder zur Jugendwohlfahrt oder in die Bezirkshauptmannschaft wechsle, dann habe ich nach wie vor ein gleiches, vertrautes Dokumentationsmodell.
Aber jetzt ist es so, dass jede Einrichtung unterschiedliche Dokumentationsmodelle hat. Das macht es für diejenigen, die im System arbeiten, schwierig, aber auch für die Behörden, wenn es um die Abrechnung, um die Finanzierungen, darum, ob das Geld sinnvoll eingesetzt worden ist, geht.
Ich hoffe, dass diese Kritikpunkte, die ich jetzt angeführt habe, vielleicht in eine sechste Novellierung miteinfließen könnten. Ich habe jetzt versucht, die positiven Teile zu betonen, aber letztendlich gibt es aus unserer Sicht und auch aus Sicht der Freiheitlichen doch massive Bereiche, die nicht berücksichtigt worden sind. Und deswegen werden wir dieser Vorlage unsere Zustimmung leider nicht erteilen können. – Danke. (Beifall bei den Grünen.)
19.35
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Posch-Gruska. – Bitte, Frau Kollegin.
19.35
Bundesrätin Inge Posch-Gruska (SPÖ, Burgenland): Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Minister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Es wurde schon gesagt, es ist nicht die einzige schwierige Materie, die Sie haben, aber auch das war eine sehr schwierige Materie in den Verhandlungen. Die Grundsatzgesetzgebung passiert durch den Bund, die Ausführungsgesetzgebung passiert durch die Länder. Daher war es notwendig und wichtig, hier lange Verhandlungen zu führen, die sicherlich nicht einfach waren. Die Materie ist auch keine einfache, es wurden sehr viele Experten, Expertinnen befragt, die auch alle eingeladen wurden, und mit denen im Arbeitskreis auch diskutiert wurde. Daher bin ich überzeugt davon, dass dieses Gesetz ein Schritt in die richtige Richtung ist.
Ich gebe meinem Vorredner sehr wohl recht, dass es Verbesserungen gibt, dass es aber auch noch Wünsche gibt, die wir ins Gesetz hineinnehmen könnten. Ich denke, wenn Sie, Herr Minister, Wünsche äußern könnten, würden diese vielleicht auch noch in diesem Gesetz Berücksichtigung finden, aber da die Verhandlungen mit Bund und Ländern geführt wurden, ist es nicht einfach, in einer Situation, wo man Kompromisse machen muss, wirklich alles hineinzunehmen.
Ich glaube, dass wir, wenn wir diesen Schritt jetzt nicht für unsere Kinder, für unsere Familien im Land gehen, sehr, sehr viel versäumen, denn wir können unsere Kinder mit diesem Schritt in Zukunft mehr schützen und wirklich das Kindeswohl in den Vordergrund stellen.
Ich möchte auch an dieser Stelle allen Personen, die in der Jugendwohlfahrt arbeiten, meine Anerkennung, meinen Dank aussprechen, weil es sicherlich eine sehr, sehr schwere Aufgabe ist. Und auch wenn Kritik an diesem Gesetz geübt wird, glaube ich trotzdem, dass wir ihnen mit diesem Gesetz eine kleine Erleichterung ihrer Arbeit schaffen und einen ersten Schritt in die richtige Richtung setzen.
Das Gesetz kommt auch den Veränderungen, die wir eigentlich in unserer Gesellschaft schon seit 20 Jahren haben, nach. Dieses Gesetz wird jetzt dem gerecht, was wir eigentlich schon 20 Jahre lang leben. Seit fünf Jahren ist es bereits in Verhandlung gewesen, zwei Minister und zwei Staatssekretäre haben dieses Gesetz mit überlebt oder dieses Gesetz hat diese Personen überlebt. (Heiterkeit.) Also ich glaube, da steckt schon sehr, sehr viel dahinter.
Ich möchte auch ein Danke sagen, denn es wäre nicht möglich gewesen, dieses Gesetz umzusetzen, wenn nicht vom Herrn Minister auch eine finanzielle Unterstützung an die Länder gekommen wäre, 3,9 Millionen € für die Länder, damit hier auch wirklich gearbeitet werden kann.
Ich habe schon gesagt, auch von unserer Seite gibt es Kritikpunkte, jeder hat sie wahrscheinlich bei diesem Gesetz, es ist aber wirklich ein Gesetz in die richtige Richtung. Ich glaube, dass wir, wenn dieses Gesetz in Kraft tritt, einfach die Ärmel hochkrempeln müssen. Es hat im Nationalrat einen Antrag gegeben, mit dem die Evaluierung vorver-
legt wurde, das heißt, im Jahr 2016 wird die Evaluierung stattfinden. Da werden wir uns das ganz genau anschauen, sicherlich alle gemeinsam, um wirklich einen Schritt für unsere Kinder zu gehen. Ich denke, wir haben eine gute Ausgangsbasis. Gehen wir es an! Arbeiten wir gemeinsam für unsere Kinder, für das Wohl der Kinder, und wenn es notwendig ist, evaluieren wir im Jahr 2016 wieder gemeinsam! – Danke schön. (Beifall bei SPÖ, ÖVP und Grünen.)
19.39
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesminister Dr. Mitterlehner. – Bitte.
19.39
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend Dr. Reinhold Mitterlehner: Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es haben alle Vorrednerinnen und Vorredner zu dem Thema aus meiner Sicht durchaus etwas Richtiges dargestellt, auch wenn ich es in der Nuancierung etwas anders sehe. Natürlich ist es kein perfektes Gesetz, aber es ist zum Status quo nicht eine kleine Verbesserung, sondern schon eine wesentliche Verbesserung.
Es ist schon dargestellt und beschrieben worden: Es ist nicht die fünfte Novelle, sondern es ist der fünfte Begutachtungsentwurf, der jetzt zu einem Gesetz führt. Damit wird auch einigermaßen unterstrichen, dass das eben eine mühsame Angelegenheit war. Das Mühsame daran war nicht unbedingt die Frage des Inhaltes, sondern das Mühsame war die Frage der Finanzierung.
Beim Erstentwurf, der nicht viel anders war als der jetzige, haben neun Länder den Konsultationsmechanismus in Kraft gesetzt. Das heißt, es gab keine Chance, hier etwas zu bewegen. Es ist schon erwähnt worden, wenn die Grundsatzgesetzgebung beim Bund und die Ausführung bei den Ländern liegt, haben die Kosten im Endeffekt die Länder zu tragen, die in Zeiten von Budgetsanierungen natürlich keine Freude damit haben, die entsprechenden Mitarbeiter anzustellen.
Wir haben erst dadurch Bewegung in die Angelegenheit gebracht, dass mit jenen Ländern – der Verfassungsdienst hat mir bestätigt, dass ich das tun könnte –, die mittun wollen, eine 15a-Vereinbarung getroffen wird. Sie kennen die Bundesländer, sie gönnen sich viel, aber nicht unbedingt das Geld, das sie sich selbst vorgestellt haben, den anderen. Der Bund finanziert bis zum Jahr 2014 diese neuen Planstellen, die notwendig sind, und Frau Ministerin Fekter hat auch eine darüber hinausgehende Finanzierung im Finanzausgleich zugesichert. Mit dieser drohenden – „drohenden“ kann man gar nicht sagen –, möglichen Regelung einer 15a-Vereinbarung ist Bewegung in die Sache gekommen, die Regelung war möglich, und somit haben wir jetzt diese Inhalte.
Diese Inhalte betreffend gebe ich Ihnen in einem Punkt nicht recht, was das erforderlichenfalls ist. Sie müssen sich vorstellen, wir haben das entwickelt, wie von den Experten vorgeschlagen, und das war auch im Erstentwurf so enthalten. Im Endeffekt würde ein Vier-Augen-Prinzip bedeuten, dass man bei allen Aktivitäten, die die Fachleute setzen, mit zwei Personen antreten muss. Es gibt aber Routinefälle, und da ist im Unterschied zu früher, wie Sie erwähnt haben, genau standardisiert, was vom jeweiligen Sachbearbeiter zu beachten ist. Es ist eine eindeutige Sachverhaltsabklärung möglich, wenn beispielsweise eine Meldung vorliegt, dass ein Kind offensichtlich allein ist, beide Elternteile nicht anwesend sind, dann ist der Sachverhalt klar. Sagt aber der eine das, der andere etwas anderes, dann wird es nach den Standards, die jetzt erarbeitet worden sind, notwendig sein, sofort vom Vier-Augen-Prinzip Gebrauch zu machen. Es gibt also im Unterschied zu früher ganz klare Regelungen, wie und in welchem Fall das anzuwenden ist.
Im Klartext: Mit dieser neuen Regelung würden bestimmte Fälle wie Cain und auch andere möglicherweise – wirklich wissen kann man das nicht – nicht mehr passieren. Die Gefährdungsabklärung und die Hilfsplanung ist wesentlich besser geregelt.
Einige Probleme haben wir natürlich einerseits mit den Meldeverpflichtungen und andererseits auch mit der Verschwiegenheitspflicht. Wir haben das seriös geregelt, glauben aber, dass natürlich immer ein Spannungsfeld einerseits zwischen den Interessen der Kinder und andererseits zwischen Datenschutz und Verschwiegenheitspflicht gegeben ist. Ich denke aber doch, dass wir einen durchaus gängigen und gangbaren Mittelweg gefunden haben, der auch eine Verbesserung darstellen sollte. Es hat einige Einwendungen – nicht heute von Ihnen oder von Fachleuten auf dieser Ebene – gegeben, die wir entsprechend prüfen wollen, weswegen wir die Evaluierung vorgezogen haben. Wir werden diese schon im Jahr 2016 vornehmen.
Alles in allem – die Zeit ist vorgeschritten –: Sie sollten anerkennen, und haben das, glaube ich, auch getan, es ist damit ein langjähriger Prozess mit einem Gesetz zum Abschluss gekommen, das eine konkrete Verbesserung für die Kinder und Jugendlichen darstellt. Das wird sich meiner Meinung nach auch bei der Evaluierung so darstellen. Wenn es Notwendigkeiten gibt, das Gesetz noch weiter auszuweiten oder zu vertiefen, werden wir das auch tun. – Vielen Dank. (Allgemeiner Beifall.)
19.43
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Weitere Wortmeldungen liegen nicht mehr vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall.
Die Debatte ist geschlossen.
Wir gelangen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert wird (2192 d.B. und 2207 d.B. sowie 8943/BR d.B.)
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Wir gelangen zum 30. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatterin ist Frau Bundesrätin Diesner-Wais. Bitte um den Bericht.
Berichterstatterin Martina Diesner-Wais: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Liebe Bundesräte! Ich bringe den Bericht des Ausschusses für Familie und Jugend über den Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert wird.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor; ich komme daher gleich zur Antragstellung.
Der Ausschuss für Familie und Jugend stellt nach Beratung der Vorlage am 3. April 2013 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Danke für die Berichterstattung.
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Mag. Rausch. – Bitte, Frau Kollegin.
19.45
Bundesrätin Mag. Bettina Rausch (ÖVP, Niederösterreich): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bundesminister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Wir haben heute über einen Beschluss des Nationalrates zu befinden, bei dem es darum geht, dass jungen Menschen, volljährigen Kindern nach den Buchstaben des Gesetzes die Leistungen der Familienbeihilfe direkt ausbezahlt werden können. Ich finde das gut, denn es bildet sozusagen eine Wirklichkeit ab. Wenn man an volljährige Kinder denkt, die außer Haus leben und Anspruch auf diese Leistung haben, dann sind das zumeist auch Studierende, die in gewisser Weise selbständig sind beziehungsweise sein sollten und somit auch die Möglichkeit haben, über ihre Einnahmen und Ausgaben selbst besser zu verfügen. (Bundesrat Dönmez: Wenn die Eltern zustimmen!) – Wenn die Eltern zustimmen, das ist ein gutes Stichwort, Herr Kollege Dönmez!
Wir haben das im Ausschuss diskutiert, und es gab natürlich auch Vorschläge, Bestrebungen, Ideen, Wünsche, einen direkten Anspruch der volljährigen Kinder im Sinne des Gesetzes zu erwirken. Wir würden dabei über andere Leistungen reden wie zum Beispiel über die Studienförderung, darauf Anspruch haben ja nicht die Eltern, sondern die Studierenden, das macht auch Sinn, wir reden aber nach wie vor über eine Unterstützungsleistung für die Familien, bei der es darum geht, Familien in der Erziehungs- und Unterhaltsleistung zu unterstützen.
Würden wir – das möchte ich erklären – einen direkten Anspruch der jungen Menschen begründen, so würden wir von der Systematik her dieses Leistungsangebot völlig verändern. (Bundesrat Dörfler steht neben der Regierungsbank und spricht mit Bundesminister Dr. Mitterlehner.) – Interessant. (Bundesrätin Kerschbaum – ihre Aufforderung durch Beifallskundgebung untermauernd –: Reden! Weiterreden!) Sollen wir warten? (Zahlreiche Rufe: Nein! Reden! – Bundesrat Dörfler verabschiedet sich per Handschlag von Bundesminister Dr. Mitterlehner und verlässt den Sitzungssaal. – Bundesrat Stadler: Hat ihm noch niemand gesagt, dass die Sitzung noch nicht aus ist?) Genau, die Sitzung ist noch nicht geschlossen, aber wurscht. (Bundesrätin Grimling: Eigentlich ist man bis zum Schluss da! Ein Benehmen hat der!) Kein Problem, ich nehme mir schon die Zeit. (Weiterer Ruf bei der SPÖ: Das ist unkollegial!)
Ich war selbst lange dafür, dass das möglich ist, weil ich es für ein Symbol und ein Signal halte, für die jungen Menschen die direkte Auszahlung möglich zu machen. – So viel zu diesem Beschluss.
Ich freue mich, dass gerade in dieser heutigen Sitzung des Bundesrates – die letzte, an der ich teilnehmen darf – einige Beschlüsse aus – unter Anführungszeichen – „meinem“ Ausschuss, also jenem Ausschuss, dem ich in den letzten Jahren vorsitzen durfte, gefasst werden, aber nicht nur diese drei Beschlüsse freuen mich, sondern auch die Tatsache, dass im Bereich Jugend und Familie in den letzten fünf Jahren doch einiges geschehen ist. Ich denke dabei an zahlreiche Anpassungen im Bereich des Familienlastenausgleichsgesetzes, unter anderem an eine Anpassung bei der Geschwisterstaffel.
Es freut mich, dass es in den letzten fünf Jahren auch gelungen ist – ich danke dem Herrn Minister, auch seiner Vorgängerin für die Unterstützung –, den Familienlastenausgleichsfonds so weit finanziell zu stabilisieren, dass wir jetzt so weit Spielraum haben, über andere Veränderungen nachzudenken. Der Herr Minister hat auch schon Vorschläge gemacht, wie man die Familienförderung neu ordnen kann.
Ich freue mich, dass im Kinderbetreuungsgeldgesetz einige Neuerungen erfolgt sind. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben, ein verpflichtendes kostenloses Kindergartenjahr einzuführen und auch fortzuführen. Das wird eine Tradition in den nächsten Jahren werden, davon gehe ich aus.
Es freut mich besonders, dass wir in den letzten Sitzungen auch die Grundlage für ein Top-Jugendticket geschaffen haben. Die Ostregion war Vorreiter, und andere Bundesländer ziehen jetzt nach. Die öffentliche Diskussion darüber findet allerorten statt, wie wir alle wissen.
Und es freut mich, dass ich darüber hinaus in den letzten Jahren auch bei vielen anderen Themen mitgestalten durfte, etwa im Bereich Bildung, Wissenschaft, Außenpolitik oder Demokratiereform.
Abschließend möchte ich noch sagen – weil ich darauf angesprochen wurde –, ich freue mich, dass ich mit Ende April im Niederösterreichischen Landtag an einigen dieser Themen weiterarbeiten kann. Es gibt im Bereich Jugend, Familie, Bildung, Gesundheit, Demokratiereform an allen Ecken und Enden viel zu tun, wenn man sich so wie ich wünscht, dass Österreich in Zukunft nicht nur für seine Kultur, für seine Musik, für seinen Tourismus – zweifelsohne schön, dass es so ist – oder für das eine oder andere Exportprodukt, von der „Manner“-Schnitte über Seilbahnen bis hin zu Red Bull, berühmt ist, sondern dass wir auch bekannt werden als ein Land in der Mitte Europas, in dem Familien- und Jugendfreundlichkeit weiterhin großgeschrieben wird, dass wir in diesem Bereich auch Vorreiter werden können. Das würde ich mir wünschen, daran werde ich auch weiterarbeiten.
Ich freue mich auf die neue Aufgabe – gleichzeitig wird mir der Bundesrat, werden mir die Themen hier, die Sitzungen, die Kolleginnen und Kollegen natürlich fehlen. Ich will mich von Herzen bedanken für die letzten fünf Jahre, die, wenn ich heute zurückschaue, irrsinnig schnell vergangen sind. Man merkt es daran, wenn man die Sesselreihen nach vorne wandert, dass Jahre vergangen sein müssen, aber diese Jahre sind irrsinnig schnell vergangen.
Sie waren sehr ereignisreich, manchmal überraschend, man erlebt das eine oder andere, das man sich aus der Ferne nicht so über den Bundesrat denkt, viel Positives. Diese Jahre waren auch herausfordernd, Jahre, in denen ich viele Erfahrungen sammeln konnte, zu einzelnen Themen auf der einen Seite, über die Politik im Allgemeinen, Jahre, in denen ich viel lernen konnte über das Leben an sich und vielleicht auch über mich selbst.
Ich will mich – diese kurze Zeit sei mir noch gegönnt – bedanken bei jenen, von denen ich in den letzten Jahren lernen durfte, die mich so herzlich aufgenommen haben und die mich sozusagen bei meiner politischen Tätigkeit begleitet haben. Ich war ja noch ein ziemliches Greenhorn, als ich vor fünf Jahren hierhergekommen bin.
Bedanken möchte ich mich des Weiteren – sie sind ja ursächlich auch dafür verantwortlich, dass ich hier sein durfte, dass ich dieses Mandat bekleiden durfte – bei meinen Mitstreitern in Niederösterreich, bei der Jungen Volkspartei, bei meinen Mitarbeitern im Büro, bei meinen Kolleginnen und Kollegen, die ehrenamtlich so viel Zeit investiert haben, dass ich vieles auch hierhertragen konnte, bei meiner Familie, bei meinem Freund, die mich in den letzten fünf Jahren über viele Höhen und Tiefen in der neuen Situation begleitet haben.
Aber vor allem will ich mich bedanken bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier im Parlament, unter anderem und vor allem bei jenen des Bundesratsdienstes, an der Spitze Frau Direktor Bachmann und Frau Vizedirektor Alsch-Harant. Ich will mich bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen auch im Nationalrat, mit denen wir immer wieder viel diskutiert und zusammengearbeitet haben, und bei den Kolleginnen und Kollegen in der Bundesregierung und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die uns immer mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Ich möchte mich bedanken bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fraktion, insbesondere bei Isolde Thornton, Inge Cseh, Alfred Obermüller und Karl Ganneshofer,
die uns unbemerkt im Hintergrund sehr, sehr viel Arbeit abnehmen, die wir sonst nicht bewältigen könnten.
Ich will mich bei den Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat bedanken, fraktionsübergreifend – es sind viele Bekanntschaften entstanden, die hoffentlich nicht alle mit dem heutigen Tag enden –, und vor allem natürlich bei meiner Fraktion, in der ich mich sehr wohl und daheim gefühlt habe – Kontakte werden ja ohnedies über viele andere Berührungspunkte bestehen bleiben, hoffe ich –, an der Spitze bei Gottfried, unserem Fraktionsobmann, bei Georg, seinem Stellvertreter, bei den Präsidenten Edgar Mayer und Harald Himmer.
Es war eine tolle Zeit, ich freue mich, dass ich dabei sein durfte, viel lernen konnte, und ich freue mich, wenn wir noch an vielen Themen auch in den neuen Rollenaufteilungen weiter zusammenarbeiten können. Alles Gute Ihnen/euch allen und dem Bundesrat. (Anhaltender allgemeiner Beifall.)
19.52
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Liebe Bettina, der Applaus will sagen, auch wir wollen uns sehr herzlich bei dir bedanken. Du warst von Anfang an bis heute eine engagierte Bundesrätin, die ihre Anliegen auch sehr pointiert vorgebracht hat. Ich sehe das sehr positiv, dass uns die einen Mitglieder in Richtung Bundesregierung, andere in Richtung Landtage verlassen, weil das sozusagen den Level erhöht. Es ist im gesamten politischen System bekannt, wie wir hier arbeiten, und das kann die Zusammenarbeit nur besser machen.
Von deiner kritischen Gesinnung wärst du sicher auch eine frische Oppositionspolitikerin, aber ich denke, mit einer absoluten Mehrheit kann es auch ganz lustig sein. (Heiterkeit bei der ÖVP.) Ich wünsche dir für deine Zeit im Niederösterreichischen Landtag alles Gute. (Allgemeiner Beifall.)
Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Hensler. – Bitte.
19.53
Bundesrat Friedrich Hensler (ÖVP, Niederösterreich): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bundesminister! Meine sehr geehrten Damen und Herren des Bundesrates! Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer! Es ist heute für mich ein bewegender, aber auch ein dankbarer Tag! Erlauben Sie mir, dass ich heute ein paar persönliche Worte sage. Es ist so im politischen Leben, Sie wissen es alle, Generationen gehen, andere Generationen kommen. Ich habe mich entschieden, nicht mehr für den Bundesrat zu kandidieren, und ich stehe das letzte Mal hier am Rednerpult des Bundesrates.
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn ich so zurückdenke, kann ich sagen, ich bin seit nahezu 40 Jahren im Gemeinderat der Marktgemeinde Rohrau tätig, habe im bäuerlichen Bereich durch meine Aufgaben für den Maschinenring Niederösterreich viel Verantwortung getragen, 16 Jahre lang als Hauptverantwortlicher, war zehn Jahre lang Mitglied im Bundesrat und fünf Jahre im Landtag. Eine schöne Zeit, meine sehr geehrten Damen und Herren, eine Zeit, in der man über viele Dinge des Lebens nachdenkt, aber gleichzeitig auch sehr viele Erfahrungen sammelt.
Erlauben Sie – und ich habe mir absichtlich kein Wort aufgeschrieben, weil ich glaube, beim Abschied soll man Worte, die aus dem Herzen kommen, sagen – zur Wertigkeit der Politik in der Öffentlichkeit ein offenes und ehrliches Wort von Fritz Hensler: Ich habe sehr viel Erfahrung sammeln dürfen, und diese Erfahrung dokumentiert sich dahin gehend – die Elisabeth hat es heute schon sehr treffend gesagt –, dass ich meine Aufgabe im Bundesrat darin gesehen habe, den Menschen zu dienen. Aber nicht nur ich habe das so gesehen, Sie alle, meine sehr geehrten Damen und Herren, tragen dazu bei, dass die Kultur in der Politik ein positives Ansehen in der Öffentlichkeit hat.
Das ist keine dahingesagte Floskel oder eine Höflichkeitsaussage, nein, das ist Realität, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Ich sage Ihnen ganz offen und ehrlich, was mich bewegt. Ich bin wirklich sehr glücklich und froh, dass ich zehn Jahre lang in diesem Haus aktiv mitarbeiten durfte – wirklich, es war so –, und ich bin froh, dass ich Sie alle kennenlernen durfte, denn eines ist unbestritten: Ein Mensch, der auf eine Erfahrung zurückblicken kann, hält sehr viel davon, wenn er ein bisschen Intelligenz in sich trägt, was seine Freunde, was seine Organisation und was ganz einfach die Kammer dazu beigetragen haben. So gesehen, meine sehr geehrten Damen und Herren, bedanke ich mich nochmals recht herzlich bei jedem Einzelnen!
Ich bedanke mich bei allen Fraktionen, ich bedanke mich bei meiner Fraktion, bei meinem Klubobmann und bei den Klubobleuten der anderen Fraktionen. Mein Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dem Klub der Österreichischen Volkspartei und ganz besonders Herrn Alfred Obermüller.
Sie alle sind ein Team, wir alle sind der Bundesrat. Ich wünsche Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, für die Zukunft alles erdenklich Gute und Gottes Segen! Ich bin überzeugt davon: Der Bundesrat wird auch in Zukunft die Prioritäten in unserer Gesellschaft für unser Heimatland Österreich setzen. – Recht herzlichen Dank. (Anhaltender allgemeiner Beifall.)
19.58
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Lieber Fritz, ich darf dir im Namen von uns allen unseren Dank für deine bewegenden Worte aussprechen. Du hast auch deine ganze Routine zum Einsatz gebracht, denn eigentlich wollte ich dir erst beim nächsten Tagesordnungspunkt das Wort erteilen, aber ich war meiner Zeit voraus. Du warst spontan in der Lage, diese Rede zu halten, dafür herzlichen Dank.
Herzlichen Dank auch für dein Engagement und für deine Freundschaft in den vergangenen Jahren. Ich wünsche dir persönlich im Namen von uns allen das Allerbeste für deine Zukunft. Herzlichen Dank. (Allgemeiner Beifall.)
Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Wenn das nicht der Fall ist, dann ist die Debatte geschlossen.
Wir gelangen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Ich stelle Stimmeneinhelligkeit fest. Der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Familienberatungsförderungsgesetz geändert wird (2190 d.B. und 2209 d.B. sowie 8944/BR d.B.)
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Wir gelangen zum 31. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatterin ist Frau Bundesrätin Diesner-Wais. Bitte um die Berichterstattung.
Berichterstatterin Martina Diesner-Wais: Werter Herr Präsident! Herr Bundesminister! Meine Damen und Herren des Bundesrates! Ich bringe den Bericht des Ausschusses für Familie und Jugend über den Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2013
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Familienberatungsförderungsgesetz geändert wird.
Der Bericht liegt Ihnen allen in schriftlicher Form vor; daher komme ich auch schon zur Antragstellung.
Der Ausschuss für Familie und Jugend stellt nach Beratung der Vorlage am 3. April 2013 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Danke für die Berichterstattung.
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Posch-Gruska. – Bitte, Frau Kollegin.
20.00
Bundesrätin Inge Posch-Gruska (SPÖ, Burgenland): Bevor ich zum Thema komme, möchte ich vor allem für die Zuseherinnen und Zuseher zu Hause sagen, dass es im Bundesrat eigentlich nicht üblich ist, dass man während einer Bundesratssitzung den Bundesrat verlässt, auch wenn der neue Kollege glaubt, dass man das tun kann. Wir Bundesrätinnen und Bundesräte bleiben eigentlich bis zum letzten Tagesordnungspunkt und arbeiten auch bis zum letzten Tagesordnungspunkt. (Beifall bei SPÖ, ÖVP und Grünen. – Zwischenrufe bei der FPÖ.) Wir alle sind Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker. Wir haben alle auch eine andere Funktion und teilen uns unsere Zeit auch ein.
Zum jetzigen Punkt aber, zu den Familienberatungsstellen, möchte ich an dieser Stelle sagen, dass von den 450 Familienberatungsstellen, die wir in ganz Österreich haben, zirka 200 noch nicht barrierefrei sind. Im Jahr 2006 wurde das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz beschlossen. In diesem Gesetz ist festgehalten worden, dass wir bis 2015 alle Familienberatungsstellen barrierefrei haben sollten, überhaupt der Zugang für alles barrierefrei sein sollte.
Mit den Familienberatungsstellen wird jetzt ein wichtiger und richtiger Schritt gesetzt. Hier war es möglich, dies auch seitens des Familienministeriums finanziell zu unterstützen. Es wird in den Jahren 2013, 2014 und 2015 je 1 Million € für diese Umgestaltung geben, um diese Barrierefreiheit zu ermöglichen. Manche Familienberatungsstellen werden auch die Situation haben, dass sie ausziehen müssen, weil sie in den Gebäuden, in denen sie sind, einfach nicht mehr bleiben können.
Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es wirklich wichtig sein wird, die Familienberatungsstellen insoweit zu unterstützen, dass wir keine Einzige verlieren. Es ist sowohl für die Eltern als auch für die Großeltern und für die Kinder wichtig, dass sie überall einen barrierefreien Zugang haben. Die Familienberatungsstellen leisten wichtige und wertvolle Arbeit und helfen unseren Familien vor Ort.
In diesem Sinne ein herzliches Danke für diese Unterstützung! Wir werden auch hier mit Freude zustimmen. – Danke. (Beifall bei SPÖ, ÖVP und Grünen.)
20.02
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Was den Kollegen Dörfler betrifft, möchte ich nur zur historischen Wahrheit festhalten, dass er nicht der erste Bundesrat dieser Republik ist, der die Sitzung etwas früher verlassen hat. (Zwischenrufe bei SPÖ und ÖVP.) Was die Usancen betrifft, ist er noch nicht so geübt. Aber er ist ja noch ein junger Bundesrat.
Weiters zu Wort gemeldet ist der Herr Bundesminister. – Bitte, Herr Minister.
20.03
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend Dr. Reinhold Mitterlehner: Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Was den Kollegen Dörfler anbelangt: Er wollte eigentlich nur höflich sein, indem er mich – ich kenne ihn auch schon länger – da begrüßt hat, das möchte ich schon sagen, und wollte sicher keine schlechte Absicht damit verbinden. Ich muss auch sagen, wenn hier jemand 10 Minuten vorher weggeht, dann ist das jetzt nicht die Unterstellung ... (Bundesrätin Grimling: Aber nicht, wenn wer spricht! – Rufe und Gegenrufe zwischen SPÖ und FPÖ.)
Meine Damen und Herren! Nachdem ich mich beim letzten Tagesordnungspunkt nicht gemeldet habe – ich wollte nicht unbedingt diese Stimmung stören –, möchte ich beiden – nämlich der Bettina, da hat man einfach die Kraft der Jugend und eigentlich auch die Einstellung bemerkt, und beim Fritz die Routine und das Wissen, und ich glaube, beides kommt eigentlich gut rüber – wirklich alles Gute für die Zukunft wünschen!
Zum Thema darf mich trotzdem noch mit zwei, drei Sätzen melden, weil es zwei wichtige Themen sind. Das eine Thema, was die Direktauszahlung der Familienbeihilfen anbelangt, ist einfach ein Thema, wo dem jungen Menschen entgegengekommen wird, dass er für sein späteres Leben mit Transparenz und mit einer bestimmten Eigenverantwortung ausgestattet ist, weil er dann auch über das Geld selber verfügt.
Die Frage, die wir auch im Nationalrat erörtert haben, war: Sollte nicht eine Art automatisches Antragsrecht für den jeweiligen Betroffenen da sein, oder die Möglichkeit, dass eben kein Widerruf gewährt werden kann? – Und da sage ich Ihnen: Im Endeffekt haben wir gesehen, da gibt es mögliche Verwicklungen, was das Unterhaltsrecht und vor allem das Steuerrecht anbelangt; das ist die eine Seite. Das Zweite ist aber, was vor allem das Widerrufsrecht anbelangt: Wenn wir diese eine Komponente noch haben und das Widerrufsrecht nicht gegeben wäre, dann würden sich wahrscheinlich alle Eltern überlegen, so etwas überhaupt durchzuführen und eine Unterschrift zu leisten.
Deswegen glaube ich, dass die vorliegende Variante in den meisten Fällen die Regel sein wird und dass da auch eine konkrete Verbesserung eintreten kann, die vielleicht der erste Schritt ist – wenn Sie anschauen, was Schweden anbelangt, auch im Stipendienbereich –, hier vielleicht insgesamt einmal eine Änderung ins Auge zu fassen. Dafür ist eine langwierige Diskussion notwendig, das ist mir klar.
Das zweite Thema ist eher eine Formalangelegenheit, trifft aber genau das, was wir das erste Mal schon erwähnt haben. Nämlich: Der Bund beschließt irgendetwas, andere sind die Betroffenen und haben die Finanzierungsmittel nicht. So schön es ist, Barrierefreiheit zu beschließen, so schwierig ist es dann für Einrichtungen wie Familienberatungsstellen, das zu finanzieren! Denn die Unterstützung des Bundes war nur auf Personalkosten ausgerichtet, und deswegen war diese Gesetzesänderung notwendig.
Wir stellen da de facto dreimal 1 Million, also insgesamt 3 Millionen, zur Verfügung. Wir haben uns ausgerechnet, nach dem, was es in anderen Bereichen gibt, werden wir auch die Erledigung mit ziemlicher Sicherheit gewährleisten können, und damit auch einige organisatorische Verbesserungen, wobei Barrierefreiheit umfassend zu verstehen ist. Also auch, wenn jemand schlecht hört oder sieht, sollte in der Form eine entsprechende Berücksichtigung bei der Umsetzung gefunden werden.
In diesem Sinn haben Sie heute, wenn Sie das auch beschließen, wichtige Dinge für die Betroffenen beschlossen, und ich danke Ihnen dafür. (Allgemeiner Beifall.)
20.06
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte geschlossen.
Wir gelangen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit angenommen.
Die Tagesordnung ist so weit erschöpft.
Da wir in den letzten Minuten mehrere Kollegen verabschiedet haben, möchte ich nur erwähnen, dass, auch wenn uns in dem Moment ein bisschen Wehmut überkommt, alle nur die Funktion und niemand davon das Leben verlässt und wir in dem Sinn eigentlich jeden Grund haben, fröhlich zu bleiben. (Heiterkeit bei der ÖVP.)
Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Ich gebe noch bekannt, dass seit der letzten beziehungsweise in der heutigen Sitzung insgesamt zwei Anfragen, 2943/J-BR und 2944/J-BR, eingebracht wurden.
*****
Die Einberufung der nächsten Sitzung des Bundesrates wird auf schriftlichem Weg erfolgen. Als Sitzungstermin ist Mittwoch, der 8. Mai 2013, 9 Uhr, in Aussicht gestellt.
Für die Tagesordnung dieser Sitzung kommen wie immer jene Beschlüsse in Betracht, die der Nationalrat bis dahin verabschiedet haben wird, soweit diese dem Einspruchsrecht beziehungsweise dem Zustimmungsrecht des Bundesrates unterliegen. Die Ausschussvorberatungen sind für Dienstag, 7. Mai 2013, ab 14 Uhr, vorgesehen.
Diese Sitzung ist geschlossen.
Schluss der Sitzung: 20.08 Uhr
|
Impressum: Parlamentsdirektion 1017 Wien |