
Stenographisches Protokoll

863. Sitzung des Bundesrates der Republik Österreich
Mittwoch, 21. Dezember 2016

Stenographisches Protokoll

863. Sitzung des Bundesrates der Republik Österreich
Mittwoch, 21. Dezember 2016
863. Sitzung des Bundesrates der Republik Österreich
Mittwoch, 21. Dezember 2016
Dauer der Sitzung
Mittwoch, 21. Dezember 2016: 9.04 – 20.08 Uhr
*****
Tagesordnung
1. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz 1997 geändert wird
2. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Umweltförderungsgesetz geändert und das Bundesgesetz, mit dem zusätzliche Mittel für Energieeffizienz bereitgestellt werden, aufgehoben wird
3. Punkt: Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG Zielsteuerung-Gesundheit
4. Punkt: Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens
5. Punkt: Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz zur partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit (Gesundheits-Zielsteuerungsgesetz – G-ZG) erlassen wird sowie das Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, das Ärztegesetz 1998, das Bundesgesetz über die Gesundheit Österreich GmbH und das Bundesgesetz über die Dokumentation im Gesundheitswesen geändert werden (Vereinbarungsumsetzungsgesetz 2017 – VUG 2017)
6. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Ärztegesetz 1998 geändert wird
7. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Gentechnikgesetz und das Versicherungsvertragsgesetz geändert werden
8. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Elektrotechnikgesetz 1992 (ETG 1992) geändert wird
9. Punkt: Bundesgesetz, mit dem ein Innovationsstiftung-Bildung-Gesetz erlassen und das Einkommensteuergesetz 1988 und das Körperschaftsteuergesetz 1988 geändert werden (Innovationsstiftungsgesetz – ISG)
10. Punkt: Bundesgesetz, mit dem ein Finanzausgleichsgesetz 2017 erlassen wird sowie das Finanzausgleichsgesetz 1997, das Finanzausgleichsgesetz 2001, das Finanzausgleichsgesetz 2005, das Finanzausgleichsgesetz 2008, das Umweltförderungsgesetz, das Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfengesetz und das Bundespflegegeldgesetz geändert werden und das Bedarfszuweisungsgesetz aufgehoben wird
11. Punkt: Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern, mit der Regelungen zu Haftungsobergrenzen vereinheitlicht werden – HOG-Vereinbarung
12. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988, das Umgründungssteuergesetz, das Umsatzsteuergesetz 1994, das Glücksspielgesetz, das Kommunalsteuergesetz 1993, das Verrechnungspreisdokumentationsgesetz, die Bundesabgabenordnung, das Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz 2010, das Bundesfinanzgerichtsgesetz, die Abgabenexekutionsordnung, das Mineralölsteuergesetz 1995, das Tabakmonopolgesetz 1996, das Transparenzdatenbankgesetz 2012, das Stabilitätsabgabegesetz und das Versicherungssteuergesetz 1953 geändert werden (Abgabenänderungsgesetz 2016 – AbgÄG 2016)
13. Punkt: Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz zur Verhinderung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzmarkt (Finanzmarkt-Geldwäschegesetz – FM-GwG) erlassen wird und das Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz, das Bankwesengesetz, das Bausparkassengesetz, das Betriebliche Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz, das Börsegesetz 1989, das Bundesfinanzierungsgesetz, das Bundesgesetz zur Schaffung einer Abbaueinheit, das Bundeskriminalamt-Gesetz, das Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz, das E-Geldgesetz 2010, das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz, das Glücksspielgesetz, das Investmentfondsgesetz 2011, das Kontenregister- und Konteneinschaugesetz, das Rechnungslegungs-Kontrollgesetz, das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, das Sparkassengesetz, das Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, das Verbraucherzahlungskontogesetz, das Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 und das Zahlungsdienstegesetz geändert werden
14. Punkt: Protokoll zur Abänderung des am 5. November 1969 in Vaduz unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen in der Fassung des am 29. Jänner 2013 in Vaduz unterzeichneten Protokolls
15. Punkt: Protokoll zur Abänderung des am 29. Jänner 2013 in Vaduz unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein über die Zusammenarbeit im Bereich der Steuern
16. Punkt: Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Aufhebung des Abkommens vom 13. April 2012 zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt
17. Punkt: Abkommen zwischen der Republik Österreich und Island zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt Protokoll
18. Punkt: Bundesgesetz über die Enteignung der Liegenschaft Salzburger Vorstadt Nr. 15, Braunau am Inn
19. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz 2015, das Meldegesetz 1991, das Namensänderungsgesetz, das Personenstandsgesetz 2013, das Sprengmittelgesetz 2010 und das Waffengesetz 1996 geändert werden (Deregulierungs- und Anpassungsgesetz 2016 – Inneres)
20. Punkt: Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG zwischen dem Bund und dem Land Tirol über Hubschrauberdienste für den Zivil- und Katastrophenschutz im Land Tirol
21. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Richter- und Staatsan-
waltschaftsdienstgesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Landesvertragslehrpersonengesetz 1966, das Bundes-Personalvertretungsgesetz, das Rechtspraktikantengesetz und das Auslandszulagen- und ‑hilfeleistungsgesetz geändert sowie ein Bundesgesetz zur Änderung der Personalstellenverordnung und ein Bundesgesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/54/EU über Maßnahmen zur Erleichterung der Ausübung der Rechte, die Arbeitnehmern im Rahmen der Freizügigkeit zustehen (UmsetzungsG-RL 2014/54/EU), erlassen werden
22. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz, das Bundesverwaltungsgerichtsgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953 geändert werden
23. Punkt: Bundesgesetz über den weiteren Ausbau ganztägiger Schulformen (Bildungsinvestitionsgesetz)
24. Punkt: Nationaler Bildungsbericht Österreich 2015
25. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Sanierung des Parlamentsgebäudes (Parlamentsgebäudesanierungsgesetz, PGSG) geändert wird
26. Punkt: Erstattung eines Vorschlages des Bundesrates für die Ernennung eines Ersatzmitgliedes des Verfassungsgerichtshofes
27. Punkt: Wahl der beiden Vizepräsidenten/innen, der Schriftführer/innen und der Ordner/innen für das 1. Halbjahr 2017
*****
Inhalt
Bundesrat
Schlussansprache des Präsidenten Mario Lindner .................................................. 13
Schreiben des Generalsekretärs für auswärtige Angelegenheiten gemäß Artikel 50 Abs. 5 Bundes-Verfassungsgesetz betreffend Erteilung der Vollmacht zur Aufnahme von Verhandlungen über ein Abkommen zur Beendigung des Abkommens – in Form eines Briefwechsels – über die Besteuerung von Zinserträgen und die vorläufige Anwendung dieses Abkommens zwischen der Republik Österreich und Guernsey durch das gemäß Artikel 64 Abs. 1 B-VG die Funktionen des Bundespräsidenten ausübende Präsidium des Nationalrates ........................................................................................... 39
Schreiben des Generalsekretärs für auswärtige Angelegenheiten gemäß Artikel 50 Abs. 5 Bundes-Verfassungsgesetz betreffend Erteilung der Vollmacht zur Aufnahme von Verhandlungen über ein Abkommen zur Beendigung des Abkommens – in Form eines Briefwechsels – über die Besteuerung von Zinserträgen und die vorläufige Anwendung dieses Abkommens zwischen der Republik Österreich und Jersey durch das gemäß Artikel 64 Abs. 1 B-VG die Funktionen des Bundespräsidenten ausübende Präsidium des Nationalrates ........................................................................................... 42
Schreiben des Generalsekretärs für auswärtige Angelegenheiten gemäß Artikel 50 Abs. 5 Bundes-Verfassungsgesetz betreffend Erteilung der Vollmacht zur Aufnahme von Verhandlungen über ein Abkommen zur Beendigung des Abkommens – in Form eines Briefwechsels – über die Besteuerung von Zinserträgen und die vorläufige Anwendung dieses Abkommens zwischen der Republik Österreich und Isle of Man durch das gemäß Artikel 64 Abs. 1 B-VG die Funktionen des Bundespräsidenten ausübende Präsidium des Nationalrates ............................................................................................................ 45
Wortmeldungen zur Geschäftsbehandlung:
Monika Mühlwerth ...................................................................................................... 156
David Stögmüller ........................................................................................................ 157
Unterbrechung der Sitzung ........................................................................................ 181
27. Punkt: Wahl der beiden Vizepräsidenten/innen, der Schriftführer/innen und der Ordner/innen für das 1. Halbjahr 2017 ........................................................................................................... 182
Verlesung der vorgesehenen Fassung eines Teiles des Amtlichen Protokolls dieser Sitzung durch Vizepräsidenten Mag. Ernst Gödl ............................................................................ 183
Genehmigung des verlesenen Teiles des Amtlichen Protokolls ................................ 188
Schlussworte des Präsidenten Mario Lindner ........................................................ 188
Personalien
Verhinderung .................................................................................................................. 13
Aktuelle Stunde (48.)
Thema: „Umsetzung Klimavertrag: auf dem Weg in eine fossilfreie Zukunft“ 17
Redner/Rednerinnen:
Ing. Andreas Pum ......................................................................................................... 17
Mag. Michael Lindner ................................................................................................... 19
Gerhard Dörfler ............................................................................................................ 22
Mag. Nicole Schreyer ................................................................................................... 24
Bundesminister Dipl.-Ing. Andrä Rupprechter .................................................. 26, 36
Ing. Eduard Köck .......................................................................................................... 29
Stefan Schennach ........................................................................................................ 31
Gerd Krusche ............................................................................................................... 32
Dr. Heidelinde Reiter .................................................................................................... 33
Mag. Gerald Zelina ....................................................................................................... 35
Bundesregierung
Vertretungsschreiben ..................................................................................................... 47
Nationalrat
Beschlüsse und Gesetzesbeschlüsse ............................................................................ 48
Verfassungsgerichtshof
26. Punkt: Erstattung eines Vorschlages des Bundesrates für die Ernennung eines Ersatzmitgliedes des Verfassungsgerichtshofes ............................................................................................ 178
Verlangen auf Durchführung einer Debatte gemäß § 57 Abs. 2 GO-BR .................... 178
Redner/Rednerinnen:
Mag. Dr. Ewa Dziedzic ............................................................................................... 178
Edgar Mayer ................................................................................................................ 179
Reinhard Todt ............................................................................................................. 180
Mag. Michael Raml ..................................................................................................... 180
Ergebnis: Ersatzmitglied: Mag. Werner Suppan
Ausschüsse
Zuweisungen ......................................................................................................... 38, 188
Verhandlungen
1. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz 1997 geändert wird (1263 d.B. und 1413 d.B. sowie 9666/BR d.B. und 9716/BR d.B.) ................................................................................................................. 48
Berichterstatter: Ing. Andreas Pum .............................................................................. 48
Redner/Rednerinnen:
Christoph Längle .......................................................................................................... 48
Martin Preineder ........................................................................................................... 50
Adelheid Ebner ............................................................................................................. 51
Mag. Nicole Schreyer ................................................................................................... 52
Bundesminister Dipl.-Ing. Andrä Rupprechter ......................................................... 52
Annahme des Antrages des Berichterstatters, 1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben und 2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 44 Abs. 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen ........................................................... 53
2. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Umweltförderungsgesetz geändert und das Bundesgesetz, mit dem zusätzliche Mittel für Energieeffizienz bereitgestellt werden, aufgehoben wird (1361 d.B. und 1417 d.B. sowie 9712/BR d.B.) 54
Berichterstatterin: Adelheid Ebner ............................................................................... 54
Redner/Rednerinnen:
Christoph Längle .......................................................................................................... 54
Dr. Magnus Brunner, LL.M .......................................................................................... 55
Günther Novak ............................................................................................................. 56
Mag. Nicole Schreyer ................................................................................................... 58
Peter Heger ................................................................................................................... 59
Bundesminister Dipl.-Ing. Andrä Rupprechter ......................................................... 60
Annahme des Antrages der Berichterstatterin, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ..................................................................................................... 61
Gemeinsame Beratung über
3. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG Zielsteuerung-Gesundheit (1339 d.B. und 1371 d.B. sowie 9702/BR d.B.) ............ 61
Berichterstatterin: Inge Posch-Gruska ......................................................................... 62
4. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens (1340 d.B. und 1372 d.B. sowie 9703/BR d.B.) ................................................................................................................. 62
Berichterstatterin: Inge Posch-Gruska ......................................................................... 62
5. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz zur partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit (Gesundheits-Zielsteuerungsgesetz – G-ZG) erlassen wird sowie das Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten, das Allgemeine Sozial-
versicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, das Ärztegesetz 1998, das Bundesgesetz über die Gesundheit Österreich GmbH und das Bundesgesetz über die Dokumentation im Gesundheitswesen geändert werden (Vereinbarungsumsetzungsgesetz 2017 – VUG 2017) (1333 d.B. und 1373 d.B. sowie 9665/BR d.B. und 9704/BR d.B.) ................................................................................... 62
Berichterstatterin: Adelheid Ebner ............................................................................... 62
6. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Ärztegesetz 1998 geändert wird (1357 d.B. und 1377 d.B. sowie 9705/BR d.B.) ......... 62
Berichterstatterin: Adelheid Ebner ............................................................................... 62
Redner/Rednerinnen:
Gerd Krusche ............................................................................................................... 63
Mag. Daniela Gruber-Pruner ....................................................................................... 65
Hans-Jörg Jenewein, MA ............................................................................................ 67
Ferdinand Tiefnig ......................................................................................................... 68
Dr. Heidelinde Reiter .................................................................................................... 70
Bundesministerin Dr. Sabine Oberhauser, MAS ...................................................... 71
Annahme des Antrages der Berichterstatterin zu Punkt 3, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................... 73
Annahme des Antrages der Berichterstatterin zu Punkt 4, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................... 73
Annahme des Antrages der Berichterstatterin zu Punkt 5, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................... 73
Annahme des Antrages der Berichterstatterin zu Punkt 6, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................... 73
7. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Gentechnikgesetz und das Versicherungsvertragsgesetz geändert werden (1336 d.B. und 1378 d.B. sowie 9706/BR d.B.) ................................................................................................................. 74
Berichterstatterin: Mag. Daniela Gruber-Pruner ......................................................... 74
Redner/Rednerinnen:
Adelheid Ebner ............................................................................................................. 74
Martin Preineder ........................................................................................................... 74
Dr. Heidelinde Reiter .................................................................................................... 75
Bundesministerin Dr. Sabine Oberhauser, MAS ...................................................... 76
Annahme des Antrages der Berichterstatterin, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ............................................................................................... ..... 77
8. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Elektrotechnikgesetz 1992 (ETG 1992) geändert wird (1326 d.B. und 1402 d.B. sowie 9718/BR d.B.) ............................................................................................................................... 77
Berichterstatterin: Marianne Hackl ................................................................................ 77
Redner/Rednerinnen:
Dr. Heidelinde Reiter .................................................................................................... 77
Ing. Andreas Pum ......................................................................................................... 78
Rene Pfister .................................................................................................................. 79
Peter Samt ..................................................................................................................... 79
Staatssekretär Mag. Dr. Harald Mahrer ..................................................................... 81
Annahme des Antrages der Berichterstatterin, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ..................................................................................................... 81
9. Punkt: Beschluss
des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem
ein Innovationsstiftung-Bildung-Gesetz erlassen und das Einkommensteuergesetz 1988 und das Körperschaftsteuergesetz 1988
geän-
dert werden (Innovationsstiftungsgesetz – ISG)
(1350 d.B. und 1383 d.B. sowie 9717/BR d.B.) 82
Berichterstatterin: Elisabeth Grimling .......................................................................... 82
Redner/Rednerinnen:
Mag. Reinhard Pisec, BA ............................................................................................. 82
Renate Anderl ............................................................................................................... 85
Robert Seeber ............................................................................................................... 86
David Stögmüller .......................................................................................................... 88
Staatssekretär Mag. Dr. Harald Mahrer ..................................................................... 88
Annahme des Antrages der Berichterstatterin, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ..................................................................................................... 90
Gemeinsame Beratung über
10. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein Finanzausgleichsgesetz 2017 erlassen wird sowie das Finanzausgleichsgesetz 1997, das Finanzausgleichsgesetz 2001, das Finanzausgleichsgesetz 2005, das Finanzausgleichsgesetz 2008, das Umweltförderungsgesetz, das Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfengesetz und das Bundespflegegeldgesetz geändert werden und das Bedarfszuweisungsgesetz aufgehoben wird (1332 d.B. und 1393 d.B. sowie 9669/BR d.B. und 9687/BR d.B.) ................................................................... ..... 90
Berichterstatter: Mag. Michael Lindner ........................................................................ 91
11. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern, mit der Regelungen zu Haftungsobergrenzen vereinheitlicht werden – HOG-Vereinbarung (1364 d.B. und 1394 d.B. sowie 9688/BR d.B.) ............. 91
Berichterstatter: Mag. Michael Lindner ........................................................................ 91
12. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988, das Umgründungssteuergesetz, das Umsatzsteuergesetz 1994, das Glücksspielgesetz, das Kommunalsteuergesetz 1993, das Verrechnungspreisdokumentationsgesetz, die Bundesabgabenordnung, das Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz 2010, das Bundesfinanzgerichtsgesetz, die Abgabenexekutionsordnung, das Mineralölsteuergesetz 1995, das Tabakmonopolgesetz 1996, das Transparenzdatenbankgesetz 2012, das Stabilitätsabgabegesetz und das Versicherungssteuergesetz 1953 geändert werden (Abgabenänderungsgesetz 2016 – AbgÄG 2016) (1352 d.B. und 1392 d.B. sowie 9670/BR d.B. und 9689/BR d.B.) 91
Berichterstatter: Mag. Michael Lindner ........................................................................ 91
Redner/Rednerinnen:
Mag. Reinhard Pisec, BA ............................................................................................. 92
Edgar Mayer .................................................................................................................. 94
Dr. Heidelinde Reiter .................................................................................................... 96
Ewald Lindinger ........................................................................................................... 99
Mag. Gerald Zelina ..................................................................................................... 101
Ing. Eduard Köck ........................................................................................................ 103
Gerd Krusche ............................................................................................................. 103
Peter Heger ................................................................................................................. 104
Bundesminister Dr. Johann Georg Schelling ......................................................... 106
Monika Mühlwerth ...................................................................................................... 112
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 10, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................. 112
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 11, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................. 112
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 12, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................. 113
13. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz zur Verhinderung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzmarkt (Finanzmarkt-Geldwäschegesetz – FM-GwG) erlassen wird und das Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz, das Bankwesengesetz, das Bausparkassengesetz, das Betriebliche Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz, das Börsegesetz 1989, das Bundesfinanzierungsgesetz, das Bundesgesetz zur Schaffung einer Abbaueinheit, das Bundeskriminalamt-Gesetz, das Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz, das E-Geldgesetz 2010, das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz, das Glücksspielgesetz, das Investmentfondsgesetz 2011, das Kontenregister- und Konteneinschaugesetz, das Rechnungslegungs-Kontrollgesetz, das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, das Sparkassengesetz, das Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, das Verbraucherzahlungskontogesetz, das Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 und das Zahlungsdienstegesetz geändert werden (1335 d.B. und 1391 d.B. sowie 9671/BR d.B. und 9690/BR d.B.) 113
Berichterstatter: Peter Heger ...................................................................................... 113
Redner/Rednerinnen:
Mag. Reinhard Pisec, BA ........................................................................................... 114
Christian Poglitsch .................................................................................................... 115
Dr. Heidelinde Reiter .................................................................................................. 116
Ewald Lindinger ......................................................................................................... 117
Bundesminister Dr. Johann Georg Schelling ......................................................... 118
Annahme des Antrages des Berichterstatters, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................................................... 119
Gemeinsame Beratung über
14. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend Protokoll zur Abänderung des am 5. November 1969 in Vaduz unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen in der Fassung des am 29. Jänner 2013 in Vaduz unterzeichneten Protokolls (1323 d.B. und 1396 d.B. sowie 9691/BR d.B.) ........................................................... 119
Berichterstatter: Peter Heger ...................................................................................... 120
15. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend Protokoll zur Abänderung des am 29. Jänner 2013 in Vaduz unterzeichneten Abkom-
mens zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein über die Zusammenarbeit im Bereich der Steuern (1324 d.B. und 1397 d.B. sowie 9692/BR d.B.) ............................................................................................................... 119
Berichterstatter: Peter Heger ...................................................................................... 120
16. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Aufhebung des Abkommens vom 13. April 2012 zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt (1327 d.B. und 1398 d.B. sowie 9693/BR d.B.) ............................................................................................................................. 119
Berichterstatter: Peter Heger ...................................................................................... 120
17. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und Island zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt Protokoll (1252 d.B. und 1399 d.B. sowie 9694/BR d.B.) ........................................................... 120
Berichterstatter: Peter Heger ...................................................................................... 120
Redner/Rednerinnen:
Dr. Heidelinde Reiter .................................................................................................. 121
Ing. Eduard Köck ........................................................................................................ 122
Stefan Schennach ...................................................................................................... 123
Christoph Längle ........................................................................................................ 124
Bundesminister Dr. Johann Georg Schelling ......................................................... 125
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 14, 1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben und 2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen ............. 127
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 15, 1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben und 2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen ............. 127
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 16, 1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben und 2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen ............. 127
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 17, 1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben und 2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen ............. 128
18. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz über die Enteignung der Liegenschaft Salzburger Vorstadt Nr. 15, Braunau am Inn (1250 d.B. und 1389 d.B. sowie 9713/BR d.B.) ............................................................................................................... 128
Berichterstatterin: Sandra Kern .................................................................................. 128
Redner/Rednerinnen:
Gerhard Schödinger .................................................................................................. 129
Mag. Michael Lindner ................................................................................................. 129
Monika Mühlwerth ...................................................................................................... 130
David Stögmüller ........................................................................................................ 131
Bundesminister Mag. Wolfgang Sobotka ................................................................ 133
Annahme des Antrages der Berichterstatterin, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................................................... 133
Gemeinsame Beratung über
19. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz 2015, das Meldegesetz 1991, das Namensänderungsgesetz, das Personenstandsgesetz 2013, das Sprengmittelgesetz 2010 und das Waffengesetz 1996 geändert werden (Deregulierungs- und Anpassungsgesetz 2016 – Inneres) (1345 d.B. und 1388 d.B. sowie 9714/BR d.B.) ............................................................................................................................. 134
Berichterstatter: Gregor Hammerl .............................................................................. 134
20. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG zwischen dem Bund und dem Land Tirol über Hubschrauberdienste für den Zivil- und Katastrophenschutz im Land Tirol (1366 d.B. und 1390 d.B. sowie 9715/BR d.B.) .... 134
Berichterstatter: Gregor Hammerl .............................................................................. 134
Redner/Rednerinnen:
Werner Herbert ........................................................................................................... 134
Anneliese Junker ........................................................................................................ 136
Mag. Dr. Ewa Dziedzic ............................................................................................... 137
Martin Weber ............................................................................................................... 139
Ana Blatnik .................................................................................................................. 140
Bundesminister Mag. Wolfgang Sobotka ................................................................ 141
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 19, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................. 142
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 20, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................. 142
21. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Landesvertragslehrpersonengesetz 1966, das Bundes-Personalvertretungsgesetz, das Rechtspraktikantengesetz und das Auslandszulagen- und ‑hilfeleistungsgesetz geändert sowie ein Bundesgesetz zur Änderung der Personalstellenverordnung und ein Bundesgesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/54/EU über Maßnahmen zur Erleichterung der Ausübung der Rechte, die Arbeitnehmern im Rahmen der Freizügigkeit zustehen (UmsetzungsG-RL 2014/54/EU), erlassen werden (2. Dienstrechts-Novelle 2016) (1348 d.B. und 1368 d.B. sowie 9673/BR d.B. und 9722/BR d.B.) ............................................................................................................................. 142
Berichterstatter: Dr. Andreas Köll .............................................................................. 142
Redner/Rednerinnen:
Elisabeth Grimling ..................................................................................................... 143
Peter Oberlehner ........................................................................................................ 144
Werner Herbert ........................................................................................................... 145
Dr. Heidelinde Reiter .................................................................................................. 147
Staatssekretärin Mag. Muna Duzdar ........................................................................ 147
Annahme des Antrages des Berichterstatters, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................................................... 149
22. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz, das Bundesverwaltungsgerichtsgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953 geändert werden (1255 d.B. und 1369 d.B. sowie 9723/BR d.B.) ............................................................................. 149
Berichterstatter: Edgar Mayer ..................................................................................... 149
Redner/Rednerinnen:
Wolfgang Beer ............................................................................................................ 149
Bundesminister Mag. Thomas Drozda .................................................................... 150
Annahme des Antrages des Berichterstatters, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................................................... 150
23. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz über den weiteren Ausbau ganztägiger Schulformen (Bildungsinvestitionsgesetz) (1360 d.B. und 1408 d.B. sowie 9720/BR d.B.) ............................................................................................................... 151
Berichterstatterin: Mag. Daniela Gruber-Pruner ....................................................... 151
Redner/Rednerinnen:
Rosa Ecker .................................................................................................................. 151
Elisabeth Grimling ..................................................................................................... 153
Josef Saller ................................................................................................................. 154
David Stögmüller ........................................................................................................ 156
Ana Blatnik .................................................................................................................. 157
Angela Stöckl-Wolkerstorfer .................................................................................... 159
Bundesministerin Mag. Dr. Sonja Hammerschmid ....................................... 160, 164
Monika Mühlwerth ...................................................................................................... 163
Annahme des Antrages der Berichterstatterin, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................................................... 165
24. Punkt: Nationaler Bildungsbericht Österreich 2015 (III-592-BR/2016 d.B. sowie 9721/BR d.B.) ............................................................................................................................. 165
Berichterstatterin: Ana Blatnik .................................................................................... 165
Redner/Rednerinnen:
Monika Mühlwerth ...................................................................................................... 166
Mag. Daniela Gruber-Pruner ..................................................................................... 168
Marianne Hackl ........................................................................................................... 171
David Stögmüller ........................................................................................................ 172
Bundesministerin Mag. Dr. Sonja Hammerschmid ................................................ 173
Annahme des Antrages der Berichterstatterin, den Bericht III-592-BR/2016 d.B. zur Kenntnis zu nehmen ............................................................................................................................. 177
25. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Sanierung des Parlamentsgebäudes (Parlamentsgebäudesanierungsgesetz, PGSG) geändert wird (1906/A und 1401 d.B. sowie 9719/BR d.B.) ........................................ 177
Berichterstatter: Christian Poglitsch .......................................................................... 177
Annahme des Antrages des Berichterstatters, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................................................... 178
Eingebracht wurden
Antrag der Bundesräte
Reinhard Todt, Edgar Mayer, Mag. Nicole Schreyer, Kolleginnen und Kollegen betreffend wirkungsvolle Maßnahmen gegen Hasskriminalität im Internet (223/A(E)-BR/2016)
Anfrage der Bundesräte
Gerd Krusche, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Flüchtlingsgroßquartier in der ehemaligen Baumax-Halle in Leoben (3197/J-BR/2016)
Beginn der Sitzung: 9.04 Uhr
Präsident Mario Lindner: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich eröffne die 863. Sitzung des Bundesrates.
Als verhindert
gemeldet ist für die heutige Sitzung das Mitglied des Bundesrates
Arnd Meißl.
Besonders bei uns begrüßen darf ich unseren Herrn Bundesminister Dipl.-Ing. Andrä Rupprechter. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Minister! (Allgemeiner Beifall.)
9.04
Präsident Mario Lindner: Sehr geehrter Herr Bundesminister! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu – ein Jahr, das für uns alle eine ganze Reihe an Überraschungen bereitgehalten hat. International genauso wie in Österreich können wir auf bewegte zwölf Monate zurückblicken, und gerade die letzten Tage haben uns auf schmerzhafte Art gezeigt, wie viele Menschen auch noch im Jahr 2016 unter Gewalt, Terror und Hass leiden mussten. Berlin und Aleppo stehen stellvertretend für furchtbare Anschläge auf unsere Demokratie und als Aufruf an jede und jeden von uns, sich niemals der Angst zu beugen. Unsere Antwort auf Gewalt muss Tag für Tag mehr Demokratie, mehr Menschlichkeit sein. (Allgemeiner Beifall.)
Für mich persönlich geht damit aber auch ein Jahr zu Ende, mit dem ich so nicht gerechnet habe. Als mich eine Kollegin aus unserer Bundesratskanzlei, unsere Susi, vor einem Jahr mehr beiläufig als gezielt gefragt hat, ob ich mich schon darauf freue, heuer als Bundesratspräsident arbeiten zu dürfen, war das, wie viele von euch wissen, eine echte Überraschung – eine Aufgabe, mit der ich auf diese Art in meinem Leben nicht gerechnet habe, aber auch eine ganz besondere Ehre. Jetzt, wenn diese Präsidentschaft zu Ende geht, kann ich wohl guten Gewissens sagen, dass auch die letzten fünfeinhalb Monate völlig anders waren, als ich sie mir jemals vorgestellt habe: von unzähligen Kirtagen, Festen und Veranstaltungen im Sommer bis zu einem wirklich intensiven politischen Herbst; von vielen beeindruckenden Begegnungen mit Menschen im ganzen Land über Tausende Kilometer, die ich quer durch Österreich reisen durfte, bis zu einer unfassbaren Anzahl – lieber Wolfgang, ich muss das jetzt sagen – an Grillhendln, Würsteln und Koteletts bei jedem erdenklichen Anlass.
Dabei ist mir persönlich eines völlig klar: Eine gelungene Präsidentschaft im Bundesrat ist ganz sicher nicht die Leistung eines Einzelnen. – Ganz im Gegenteil! Sie ist Teamwork im besten Sinne des Wortes.
Genau deswegen möchte ich diesen Moment auch nutzen, um all den Frauen und Männern zu danken, die mich in den letzten Monaten unterstützt haben. In diesem Haus arbeiten so viele beeindruckende Menschen, deren Arbeit leider nicht immer im Scheinwerferlicht steht, die aber das Funktionieren unserer Demokratie überhaupt erst möglich machen: von der Sicherheitsabteilung bis zum Büro unserer Nationalratspräsidentin, von den Hausarbeiterinnen und Hausarbeitern bis zum Internationalen Dienst, von der Veranstaltungsabteilung über die Demokratiewerkstatt bis zu unserer Bundesratskanzlei, von den MitarbeiterInnen und ReferentInnen unserer Klubs bis zu meinem persönlichen Team. Von all diesen Personen habe ich in den letzten sechs Monaten eine Form der Unterstützung erhalten, ohne die keines unserer Projekte überhaupt möglich gewesen wäre – und dafür möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken. (Allgemeiner Beifall.)
Danke sagen möchte ich auch euch allen, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Die Art, wie wir hier im Bundesrat über alle politischen Differenzen hinweg einen ehrlichen und aufrichtigen Umgang miteinander pflegen, ist eine der herausragendsten Eigenschaften unserer Kammer. Ich möchte deshalb allen Fraktionen und ganz besonders meinem Vizepräsidenten und meiner Vizepräsidentin, unseren Fraktionsvorsitzenden sowie den Bundesministerinnen und Bundesministern für die Zusammenarbeit aufrichtig danken. (Allgemeiner Beifall.)
Normalerweise müsste ich mich heute bei weit mehr als hundert Menschen namentlich bedanken; stellvertretend für sie alle darf ich mich bei Monika Schweitzer-Wünsch, Claudia Peska, Sebastian Pay, Wolfgang Magyar und Susanne Janatsch bedanken. Auf Steirisch würde ich sagen: Ihr seids echt super! (Allgemeiner Beifall.)
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Digitale Courage war unser Schwerpunkt im vergangenen Halbjahr, und das zu Recht, denn mit unserer Arbeit hier im Bundesrat haben wir definitiv einen Nerv der Zeit getroffen. Es kommt leider nicht oft vor, dass unsere Kammer auf die Art und Weise in den Medien präsent ist wie in den letzten sechs Monaten. Hass im Netz ist ein Thema, in Österreich genauso wie in ganz Europa, und die Frage, wie wir mit diesem Phänomen umgehen sollen, hat das Jahr 2016 politisch so geprägt wie kaum eine andere. NGOs und Institutionen, Medien und Parteien, wir alle sehen dieses riesige Problem, und wir alle stehen vor der Herausforderung, Lösungen für eine Entwicklung zu finden, die sich mit den herkömmlichen politischen Mitteln so gut wie gar nicht regulieren lässt.
Ich bin stolz darauf, dass wir hier im Bundesrat einen wichtigen, einen zentralen Beitrag dazu leisten konnten, echte Lösungen für dieses Problem zu finden. (Beifall bei SPÖ und Grünen sowie bei Bundesräten der ÖVP.)
Eines ist klar: In einer Zeit, in der sich immer mehr Menschen zurückgelassen und vergessen fühlen, greift Verunsicherung um sich, und zwar in einem bisher kaum gekannten Maß. Viel zu viele unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger fühlen sich an den Rand gedrängt, ausgeschlossen. Sie misstrauen den politischen Institutionen, sie misstrauen uns, und Tag für Tag erleben wir, dass aus diesem Misstrauen, aus dieser Verunsicherung geballte Wut werden kann, eine Wut, die sich ganz besonders im Internet und in den sozialen Medien Luft verschafft, oft mit furchtbaren Auswirkungen auf die Betroffenen – und das können, das wollen und das werden wir nicht akzeptieren. (Beifall bei SPÖ und Grünen sowie bei Bundesräten von ÖVP und FPÖ.)
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Bei der Enquete des Bundesrates vor etwas mehr als einem Monat haben wir die Folgen, die Hass im Netz für eine Betroffene haben kann, aus erster Hand erlebt, und ich bin mir sicher, dass nicht nur ich entsetzt war, als damals eine mutige, couragierte Frau hier im Saal ihre furchtbare Geschichte erzählt hat. Sie hat uns vor Augen geführt, wie wichtig es ist, dass wir für dieses Problem eine Lösung finden, und zwar besser heute als morgen. (Beifall bei SPÖ und Grünen sowie bei Bundesräten der ÖVP.)
In den vergangenen Monaten habe ich erlebt, dass es in Österreich inzwischen ein unglaubliches Problembewusstsein hinsichtlich dieser Frage gibt. Unzählige Organisationen und Institutionen beschäftigen sich mit Hass im Netz, starten Kampagnen, liefern Expertise. Was es aber nicht gibt, das sind eine richtige Vernetzung und echte Lösungsansätze. Wir diskutieren über Hass im Netz und wissen dabei oft selbst nicht, wie dieses Problem abseits rechtlicher Nachschärfungen wirkungsvoll bekämpft werden kann. Gerade deshalb bin ich stolz darauf, dass wir, der Bundesrat, es geschafft haben, dieses Thema auf die überparteiliche, parlamentarische Ebene zu heben, und dass es hier neu definiert wurde.
Mein Ziel war es immer, dieser Frage eine neue Perspektive zu geben, eine neue Richtung, und ich bin nach diesem Halbjahr überzeugter denn je, dass die Lösung in ge-
lebter digitaler Zivilcourage liegt. (Beifall bei SPÖ und Grünen sowie bei Bundesräten der ÖVP.)
Wir müssen die Mehrheit unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger davon überzeugen, selbst couragiert gegen Hass und Diskriminierung im Netz aufzutreten. Wir müssen sie dabei unterstützen, sie fördern und auch selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Das Feedback, das wir für diesen Lösungsansatz bekommen haben, war überwältigend. Unsere Enquete zur digitalen Courage hat es geschafft, die Arbeit der Länderkammer in eine wirklich breite Öffentlichkeit zu bringen. Zeitungen haben berichtet, der ORF brachte einen Themenschwerpunkt, in Onlineforen und sozialen Medien wurde fleißig diskutiert; digitale Courage war sogar auf Twitter das österreichweite Thema Nummer eins.
Mit unserer Enquete und den vielen Veranstaltungen und Treffen dazu haben wir nicht nur tollen Expertinnen und Experten eine Plattform gegeben, wir haben auch den vielen Institutionen und Organisationen die Möglichkeit zur Vernetzung geboten, die sie so dringend einfordern. Und mit unserem Grünbuch zur digitalen Courage haben wir in diesem Bereich den ersten wissenschaftlich fundierten Katalog mit Vorschlägen an die Politik geschaffen. All das wird weit über diese Bundesratspräsidentschaft hinaus wirksam sein, wenn wir das wollen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen! So stolz ich auch auf die Arbeit bin, die wir in den vergangenen Monaten zum Thema digitale Courage geleistet haben, so überzeugt bin ich davon, dass es dabei nicht um einen abgeschlossenen Prozess geht. Dieses Thema soll und darf für den Bundesrat mit dem 31. Dezember nicht abgehakt sein. Nutzen wir die Chance, bleiben wir an diesem Thema dran, machen wir den Bundesrat wirklich zur Kammer der Zivilcourage in unserem Land (Beifall bei SPÖ und Grünen, bei Bundesräten der ÖVP sowie des Bundesrates Schererbauer), nicht nur, weil es für das Ansehen unserer Kammer wichtig ist, sondern ganz besonders, weil es moralisch und politisch richtig ist! (Beifall bei SPÖ und Grünen.)
Wenn also 2016 das Jahr des Problems, das Jahr von Hass im Netz war, dann machen wir 2017 gemeinsam zum Jahr der Lösung, zum Jahr der digitalen Courage!
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Ihnen und euch allen noch einen Gedanken mit auf den Weg geben, der sich durch meine Zeit als Bundesratspräsident gezogen hat wie kaum ein anderer.
Ein Kollege aus dieser Kammer hat Ende Juni zu mir gesagt: Ein guter Präsident bist du, wenn in deiner Amtszeit niemand die Abschaffung des Bundesrates fordert! (Heiterkeit bei Bundesräten der SPÖ.) Nach dieser Definition bin ich – genauso wie die meisten meiner Vorgänger – kein guter Präsident. Aber ganz im Ernst: Diese Aussage hat mich nachdenklich gemacht. Ich kann gar nicht mehr zählen, in wie vielen Interviews und Gesprächen ich seit Juli gefragt wurde, warum wir eigentlich einen Bundesrat brauchen. Ich glaube, wir alle kennen diese Situation, deswegen sage ich: Wir müssen uns diese Frage nicht nur gefallen lassen, sondern sie auch ernsthaft beantworten können.
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin der Überzeugung, dass es in der Politik nur ganz selten einfache Lösungen gibt. Auf die wenigsten Fragen kann man mit einem klaren Ja oder Nein antworten; Hass im Netz ist das beste Beispiel dafür. Gute Politik wird in den Graubereichen gemacht, ohne Verkürzungen und nach langen, intensiven Diskussionen – und genau da liegt meiner Meinung nach die unglaubliche Stärke des Bundesrates.
Wir stehen als Länderkammer nicht im unmittelbaren Zentrum der Tagespolitik, aber genau deswegen haben wir die Chance, auch eine gänzlich andere Form der Politik zu machen – eine Politik, die für unsere hektische Mediendemokratie vielleicht nicht immer sexy genug ist, eine Politik, die weniger aufgeregt ist, die aber wirkt. Wir können
langfristige Projekte anstoßen und über Legislaturperioden hinaus Schwerpunkte setzen, so wie wir es in der Frage des digitalen Wandels vor einem Jahr getan haben oder heuer mit dem Schwerpunkt zur digitalen Courage. Wir sind die Kammer der Kinderrechte, wir haben den Zukunftsausschuss, und wir stehen zu Recht im Zentrum der österreichischen Europapolitik. (Beifall bei SPÖ und ÖVP sowie der Bundesräte Schererbauer und Stögmüller.)
Das allein reicht aber nicht, wir müssen auch selbstkritisch fragen, wie wir als Bundesrat wahrgenommen werden und was wir besser machen können. Ich will einfach nicht akzeptieren, dass wir uns als Länderkammer permanent für unsere Arbeit rechtfertigen müssen; und ich glaube, da stimmt ihr mir alle zu. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) Was ich in meiner Zeit hier im Bundesrat gelernt habe, ist, dass in unserer Kammer beeindruckende Arbeit passiert, dass wir Bundesrätinnen und Bundesräte aber auch viel zu oft in Selbstzweifel verfallen, dass wir manchmal nur auf Kritik reagieren, statt selbst zu agieren.
Demokratie – davon bin ich überzeugt – braucht den permanenten Willen, besser zu werden, sich weiterzuentwickeln. Nehmen wir uns das zu Herzen! Der Bundesrat bietet uns heute schon so viele Möglichkeiten, die wir aber noch nicht bis zum Ende ausreizen. Allein der Zukunftsausschuss ist eine Errungenschaft, die wir noch viel aktiver einsetzen könnten. Da geht es nicht um Partei- oder Regierungspolitik, sondern darum, dass wir als Mitglieder dieser Kammer ein neues Selbstverständnis sowie den Mut brauchen, unseren Bundesrat auch weiterzuentwickeln.
Ja, natürlich brauchen wir mehr Kompetenzen, denn schließlich ist der Bundesrat laut Verfassung das einzige Organ des Föderalismus in unserem Land. Ich bin aber überzeugt davon, dass wir auch die Spielräume ausreizen müssen, die wir schon heute haben. Trauen wir uns mehr zu, seien wir mutiger!
Ich meine es ernst, wenn ich sage, dass ich zutiefst daran glaube, dass Österreich einen starken, aktiven und präsenten Bundesrat braucht. (Allgemeiner Beifall.)
Ich hoffe, dass ich mit meiner Präsidentschaft einen Beitrag zur Stärkung unserer Kammer leisten konnte.
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Österreicherinnen! Liebe Österreicher! Lassen Sie mich abschließend noch folgenden Gedanken formulieren: Wir alle erfahren aus den Medien leider viel zu oft von furchtbaren Gewalt- und Terrorakten auf der ganzen Welt. Das sind Entwicklungen, vor denen wir niemals die Augen verschließen dürfen. Wir dürfen aber auch nicht auf jene Akte von Gewalt und Ausgrenzung vergessen, die Tag für Tag vor unseren Augen passieren.
Wenn Anfang November ein junges Mädchen in Wien von gleichaltrigen Burschen brutal zusammengeschlagen und dabei gefilmt wurde und diese Tat auf Facebook mehr als 2,8 Millionen Menschen erreichte, wenn fast zur selben Zeit eine junge Frau in Berlin von einem Mann die Treppe hinuntergetreten wurde, wenn in der Nacht von 2. auf 3. Dezember zwei junge Männer geschlagen wurden, nur weil sie sich auf offener Straße geküsst haben, und wenn nur wenige Tage darauf zwei Jungs brutal angegriffen wurden, nur weil sie Händchen hielten, dann hört sich für mich jeder Spaß auf. (Beifall bei SPÖ, ÖVP und Grünen.)
Niemand – absolut niemand! – hat das Recht, Gewalt gegenüber Kindern, Frauen oder Männern auszuüben. Absolut niemand hat dieses Recht! (Beifall bei SPÖ, ÖVP und Grünen sowie bei Bundesräten der FPÖ.)
Ich wünsche mir vom Jahr 2017, dass kein Mensch – kein Kind, keine Frau, kein Mann – aufgrund seines Geschlechts, seines Alters, seiner Herkunft, seiner Religion, seiner sexuellen Orientierung oder einer Behinderung (Bundesrätin Mühlwerth: Oder der politi-
schen Einstellung!) jemals wieder Mobbing, Ausgrenzung oder – ganz besonders – Gewalt erfahren muss.
In meiner Zeit im Bundesrat habe ich immer wieder gesagt – und ich werde es auch sagen, wenn ich in wenigen Tagen nicht mehr Präsident dieser Kammer bin –: Ich werde nicht aufhören, meine Stimme zu erheben, wenn Menschen diskriminiert werden. Die Europäische Menschenrechtskonvention ist einzuhalten. – Punkt! (Beifall bei SPÖ, ÖVP und Grünen sowie bei Bundesräten der FPÖ.)
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich danke euch und Ihnen allen für die tolle Zusammenarbeit und für all die Unterstützung in den letzten Monaten, und ich wünsche unserer künftigen Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann alles erdenklich Gute für ihre Präsidentschaft. (Allgemeiner Beifall.)
Es lebe der österreichische Bundesrat, es lebe die Republik Österreich, es lebe ein friedliches, demokratisches Europa! (Allgemeiner Beifall.)
9.25
Präsident Mario Lindner: Wir gelangen nun zur Aktuellen Stunde zum Thema
„Umsetzung Klimavertrag: auf dem Weg in eine fossilfreie Zukunft“
mit dem Herrn Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Dipl.-Ing. Andrä Rupprechter, den ich noch einmal herzlich willkommen heißen darf. (Allgemeiner Beifall.)
Zunächst kommt je eine Rednerin/ein Redner pro Fraktion mit einer Redezeit von 10 Minuten zu Wort. Sodann folgt die Stellungnahme des Herrn Bundesministers, die ebenfalls 10 Minuten nicht überschreiten soll. Danach folgt wiederum je eine Rednerin/ein Redner pro Fraktion sowie anschließend ein Redner der Bundesräte ohne Fraktionszugehörigkeit mit einer jeweils 5-minütigen Redezeit. Zuletzt kann noch eine abschließende Stellungnahme des Herrn Bundesministers erfolgen, die nach Möglichkeit 5 Minuten nicht überschreiten soll.
Als Erster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Ing. Pum. – Bitte, Herr Bundesrat.
9.26
Bundesrat Ing. Andreas Pum (ÖVP, Niederösterreich): Geschätzter Herr Präsident! Werter Herr Umweltminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen des Bundesrates! Liebe Damen und Herren vor den Fernsehgeräten! Ein spannendes Thema wird uns heute Vormittag begleiten. Es ist einer der wesentlichsten Bereiche, den wir heute diskutieren, denn ab jetzt wird es spannend – spannend für alle Nationalstaaten, denn es geht darum, über Klima und dessen Auswirkungen zu diskutieren. Ich behaupte, das Thema ist mit Aldous Huxleys „Brave New World“ gleichzusetzen, also mit einer neuen Lebenswelt, nicht zuletzt auch mit neuen Ideen, neuen Denkansätzen, die aber wieder sehr klar zutage bringen: Mit dem ersten Tag dieser Diskussion werden die Mühen des Alltags spürbar.
Es geht ganz einfach darum, auch international Klimapolitik zu betreiben, und um das gemeinsame Ziel, die Erderwärmung mit 2 Grad Celsius zu begrenzen und die Treibhausgasemissionen auf null zu reduzieren. Das Ziel ist sehr einfach formuliert. Der Vertrag wurde am 4. November in Kraft gesetzt, und 115 von 195 Staaten haben ihn bereits ratifiziert. Es ist eine Reise von Cancún bis Paris, die im Vorfeld viele Menschen bewegt und viele Diskussionen ausgelöst hat und die viele Wissenschaftler aufgerufen hat, ganz einfach für dieses Thema zu sensibilisieren. Von Helga Kromp-Kolb
bis Heinz Kopetz sind es viele namhafte Persönlichkeiten gewesen – und sind es nach wie vor –, die dieses Thema in den Köpfen der Bevölkerung enorm stark wachrufen.
Wenn wir die Diskussion heute durch die erst vor wenigen Wochen erfolgte Wahl von Trump in den USA mit einem gewissen Unsicherheitsfaktor führen und die Frage stellen: Bleibt all das aufrecht, was in der Vergangenheit diskutiert wurde?, dann sage ich Ihnen heute schon sehr klar: Der Überlebenstrieb wird stärker sein als die Lobby, die über wirtschaftliche Entwicklungen und über Profit bestimmt, und es wird spätestens dann, wenn im gesamten Kalifornien wegen der Trockenheit alles versiegt, der Ruf nach Veränderung lauter, und das wird Realität werden, denn letztendlich kennt Klimaveränderung keine nationalen Grenzen, und es zeigt sich immer wieder, dass uns die Veränderungen ganz einfach einholen werden.
China bringt es aktuell auf den Punkt: Wer in den letzten Tagen die Medienberichte verfolgt hat, weiß, es werden in China derzeit so viele Staubmasken wie noch nie ausgegeben, es gibt Autopickerl zur Fahrerlaubnis an geraden und ungeraden Tagen und andere Maßnahmen zur Einschränkung der Emissionen.
Was ist der Grund dafür? – Eine riesige Smogwolke, eine riesige Staubwolke hüllt Peking ein, und es gibt nur ein Fazit aus dieser gesamten Entwicklung: Das ist der Preis für enormes Wirtschaftswachstum, der Preis dafür, dass wir in den vergangenen Jahren ganz einfach überdurchschnittlich hohe Entwicklungszahlen erreicht haben.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind aber schon lange auf diesen Zug der modernen Energiepolitik des 21. Jahrhunderts aufgesprungen. Minister Rupprechter hat dieses Thema in der Vergangenheit ja bereits leidenschaftlich diskutiert und auch mit Maßnahmen begleitet; ich sage nur: Maßnahmen im Bereich der Energieerzeugung, Maßnahmen im Bereich der Mobilität bis hin zu Wohnbaumaßnahmen. In all diesen Bereichen wird ein Beitrag geleistet, um auch in Zukunft Maßnahmen zu setzen, um eine Begrenzung der Emissionen zu erreichen.
Was sind unsere Ressourcen? – Ich sage sehr klar dazu: Wir haben genug dieser Ressourcen, um eine nachhaltige, umweltfreundliche, ökologische Energiepolitik umzusetzen. Wind, Wasser, Sonne, Biomasse – all das umgibt uns, ist ganz einfach frei nutzbar und steht uns nicht zuletzt auch über Jahrhunderte zur Verfügung.
Wenn wir im Detail schauen, wo die großen Einsparungsmaßnahmen liegen, dann darf ich als Erstes den Wohnbau anführen. Der Wohnbau birgt eines der größten Einsparungspotenziale, und da gibt es auch eine sehr klare Zielformulierung: Ausstieg aus der Energieerzeugung aus Erdöl, Erdgas – aus fossiler Energie, sage ich dazu, denn reden wir von Biogas, reden wir von Biotreibstoffen, dann sollten diese auch zukünftig Ausnahmen darstellen.
Gerade diese Formulierung klingt sehr einfach, das ist in der Umsetzung aber schwierig. Im niederösterreichischen Landtag wurde das bereits diskutiert – ein Verbot des Einbaus von Ölheizungen in neuen Wohnungen im Wohnbau ab jetzt –, und es wurde auch ein klares Ja seitens der zuständigen Behörden gegeben. Es wird auf europäischer Ebene geprüft und dann letztlich zur Umsetzung kommen, weil es der richtige Weg ist. Jenen, die da einen Geschäftsverlust sehen, die da eine Entwicklung im Sinne von Handelsbeschränkungen erkennen, wird sehr klar gesagt: Die Chance liegt ganz einfach in den zukünftigen Entwicklungen, in der Wertschöpfung im eigenen Land, in Preissicherheit und nicht zuletzt auch in Unabhängigkeit. Ich denke, das sind die Rahmenbedingungen, die da geschaffen werden müssen.
Ich sage auch sehr deutlich, dass es notwendig ist, alle Kräfte zu bündeln, die eine positive Entwicklung in dieser Frage umsetzen. Es geht ganz einfach darum, jenen Pessimisten, die ständig das Vergangene bewahren wollen, zu sagen, dass sie diesen Weg
so nicht gehen können, dass sie das so zukünftig nicht umsetzen können. (Beifall bei der ÖVP und bei Bundesräten der SPÖ.)
Ich darf auch aktuelle Diskussionen erwähnen: Denken Sie an die VW-Abgas-Diskussion, im Rahmen derer gezeigt wurde, dass da enorme Summen bezahlt werden müssen, um dieses Schadensausmaß zu bewältigen. Würden wir dieses Geld in moderne Technologien, in nachhaltige Energien investieren, hätten wir, so glaube ich, in dieser Hinsicht heute schon wesentlich größere Potenziale.
Das zeigt auch einmal mehr, dass der Verkehr eine große Herausforderung ist. Wir wissen, dass allein in Österreich der Verkehr rund 45 Prozent der Treibhausgasemissionen verursacht und dass die Verkehrsinfrastruktur zu 93 Prozent von Erdöl abhängig ist. Das zeigt schon, dass es notwendig ist, da Schritte zu setzen; Mobilitätswende ist das Stichwort und nicht zuletzt auch die Zukunftsfrage in der neuen Ausrichtung. Mit der Mobilitätswende ist unumgänglich auch ein weiteres Thema verbunden: E-Mobilität, ein Thema, das uns in Zukunft mehr denn je beschäftigen wird. Ein Vergleich zeigt, dass Österreich hinsichtlich E-Mobilität laut einer Patentanalyse innerhalb der EU an erster Stelle liegt.
Anreizförderungen, Impulssetzungen, Stärkung neuer Technologien – das Thema ist sehr umfangreich. Elektroautos sind das Thema der Zukunft, und die 15-prozentige Erhöhung der Fördermittel beziehungsweise besser gesagt die Anreizförderung – 4 000 € in Niederösterreich plus ein 1 000-€-Gutschein, der seitens des Landes daraufgelegt wird – zeigt, dass dieser Weg auch zukunftsträchtig ist. Wenn wir das auf fossile Energien umlegen: Bei der Nutzung von erneuerbaren Energieträgern, Pellets, Holz und vielem mehr gibt es eine Erhöhung der Fördermittel um 15 Prozent. Wir sehen, dass da alleine 2014 28 Millionen Tonnen CO2 eingespart wurden. Das ist zukunftsträchtig.
Wenn ich es nochmals mit Zahlen belegen darf: Die österreichische Umwelttechnikindustrie erwirtschaftete im Jahr 2015 mit rund 31 000 Beschäftigten – das sind 5 Prozent der Sachgüterindustrie – einen Umsatz von knapp 10 Milliarden €. Diese Zahlen bestätigen: Wir sind auf dem richtigen Weg, und Emissionshandel ist nicht die Antwort der Zukunft.
Abschließend möchte ich zum Schwerpunktthema Lebensmittelproduktion kommen. Dazu darf ich nur eines sehr klar sagen: Wenn wir von Energie sprechen, dann sprechen wir gleichzeitig von Lebensmittelproduktion. Wir wissen – und gerade das Thema Fair Trade, das heute hier im Hause präsent ist, zeigt es –, dass die Lebensmittelproduktion vor großen Herausforderungen steht, vor globalen Herausforderungen, die letztendlich aber in regionale Lösungen münden. Die Fragen des Bodenverbrauchs, des Humuserhalts und der CO2-Speicherung werden uns beschäftigen und vor allem die Landwirtschaft vor neue Herausforderungen stellen. Eines sei klar gesagt: Der Konsument, wir alle werden die Richtung vorgeben und die diesbezüglichen Entscheidungen treffen.
Abschließend kann ich nur sagen: Folgen wir diesem Kurs weiter, und schaffen wir kommenden Generation ein lebenswertes Klima! – Danke. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
9.37
Präsident Mario Lindner: Als nächster Redner zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Mag. Lindner. – Bitte, Herr Bundesrat.
9.37
Bundesrat Mag. Michael Lindner (SPÖ, Oberösterreich): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Vor einem Jahr wurde er weltweit bejubelt, mittlerweile ist er in Kraft getreten: der Weltklimavertrag von Paris. In weniger als einem Jahr wurde das Abkommen von der notwendigen Mehrheit der Staaten ratifiziert; offensichtlich nehmen es viele jetzt ernster.
Nur zum Vergleich: Beim Kyoto-Protokoll, das eigentlich viel weniger weitreichend war, dauerte dieser Prozess sieben Jahre. Das zeigt meiner Meinung nach schon, dass es dieses Mal um mehr geht als um eine Alibiaktion zur Gewissensberuhigung. Es geht um den Ausstieg aus fossiler Energie und die Begrenzung der Erderwärmung mit dem 2-Grad-Ziel. Es geht in Wirklichkeit – und das ist schon angesprochen worden – um eine große Transformation. Es geht um die Transformation unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft und unserer Lebensweise. Es geht meiner Meinung nach auch darum, mit diesem Weltklimavertrag einen Gesamtansatz zu finden, anstatt Einzelstrategien zu verfolgen.
Klimaschutz kann meiner Meinung nach nicht aufgezwungen werden, sondern muss gewollt werden, und ich glaube, wir müssen auch die soziale Frage mit dem Klimaschutz verbinden. Ein bisschen überspitzt gesagt: Was nützt uns die energieeffizienteste Wohnung, wenn sich diese niemand leisten kann? Nur ein für die Menschen leistbarer Klimaschutz ist auch ein nachhaltiger Klimaschutz. Lassen Sie mich daher vier Punkte formulieren:
Punkt eins: Wir sitzen alle im selben Boot, und niemand kann aussteigen. Viel zu oft wurde auch in Diskussionen hier im Bundesrat schon gesagt, es sollen einmal die Chinesen, die Asiaten und die Amerikaner ihre Hausaufgaben machen. Dass dies eine Lösung darstellt, möchte ich anhand einer Studie widerlegen: Der österreichische Sachstandsbericht 2014 hat relativ eindrucksvoll gezeigt, dass sich unser Warenverbrauch und unser Konsum hier in Österreich ganz massiv auf den CO2-Ausstoß in anderen Weltregionen auswirkt. Die CO2-Emissionen, die bei der Produktion von Gütern im Ausland, die dann in der Folge nach Österreich importiert werden, anfallen, werden auch graue Emissionen genannt. Diese CO2-Mengen, diese grauen Emissionen, sind mit 62 Millionen Tonnen fast genauso hoch wie jene CO2-Mengen, die wir hier in Österreich direkt ausstoßen. Wir importieren zum Beispiel durch unseren Warenverbrauch 12 Millionen Tonnen CO2 aus Asien, während wir nur 2 Millionen Tonnen nach Asien exportieren; ähnlich sind die Verhältnisse hinsichtlich Nordamerika und Russland.
Schon im Regierungsprogramm ist deshalb richtigerweise angeführt, dass der Klimaschutz auch in internationalen Handelsabkommen verankert und berücksichtigt werden muss. Das ist bei CETA, muss man offen sagen, nicht wirklich gelungen. Da muss bei TTIP und Co wesentlich mehr drin sein, denn wir sitzen letztendlich alle im selben Boot.
Punkt zwei: Klimaschutz vertreibt niemanden und ist wirtschaftlich vertretbar. Eine deutsche Studie unter 16 000 UnternehmerInnen hat gezeigt, dass es nicht CO2-Zertifikate sind, die Unternehmen zur Abwanderung bringen. Die wichtigsten genannten Gründe waren Arbeitskosten und Erschließung neuer Märkte, also das Ausnutzen von niedrigen Lohnstandards und schlechten Arbeitsbedingungen für ArbeitnehmerInnen und neue Expansionsgebiete.
Auch eine Studie der Europäischen Kommission hat gezeigt, dass das sogenannte Carbon Leakage, also die Produktionsverlagerung aufgrund von CO2-Kosten, auf andere Faktoren zurückzuführen ist: Verlagerung der Nachfrage, Arbeitskosten und Energiepreise.
Und noch wichtiger: Erneuerbare Energien sind wettbewerbsfähig und keine geschützte Werkstätte. Bloomberg New Energy Finance hat einen empirischen Befund geliefert, dass die Kosten für fossile Kraftwerke schon seit Jahren stabil sind, während sie für erneuerbare Energien deutlich sinken, für PV-Anlagen in den letzten sechs Jahren um 24 Prozent, für Batteriespeichersysteme um ganze 65 Prozent. Also erneuerbare Energien müssen nicht nur klimapolitisch gefördert werden, sondern tragen sich auch wirtschaftlich hervorragend.
Punkt drei: In Österreich, glaube ich, müssen wir es jetzt rasch angehen und rasch vorwärtskommen. Wir sind gefordert, unser Ziel, 36 Prozent Reduktion der Emissionen,
bis 2030 zu erreichen. Stichwort Gebäudesanierung – das ist schon angesprochen worden –: Da haben wir unsere Emissionen bereits um 42 Prozent senken können. Die Sanierung von Altbauten hat, glaube ich, das größte Potenzial. Bei den Neubauten oder bei den Privaten müssen wir, glaube ich, fast schon aufpassen, dass wir an den Regulierungsschrauben bei der Wohnbauförderung nicht zu weit drehen, weil wir zumindest in Oberösterreich schon beinahe eine Flucht aus der Wohnbauförderung haben und parallel dazu das Faktum, dass die Häuslbauer diese Beratungsangebote für Energieeffizienz kaum mehr nutzen.
Traurig ist, dass sich im selben Zeitraum, nämlich von 1990 bis 2014, der Emissionsausstoß im Bereich Verkehr um über 56 Prozent gesteigert hat, bei der doppelten Zahl an zugelassenen Kraftfahrzeugen. Das liegt aber auch an einer Raumordnungspolitik, die wir uns, wie ich meine, sehr genau anschauen müssen; es braucht eine bundesweite strategische Raumplanung mit Einbindung der Bundesländer, um auch die Zersiedelung in den Griff zu bekommen.
Die E-Mobilität ist schon angesprochen worden. Ich glaube, dass wir unser derzeitiges Mobilitätsverhalten nicht eins zu eins auf E-Mobilität werden übertragen können, weil auch der Strom letztendlich irgendwo produziert werden muss. Es braucht, wie ich meine, weiterhin einen starken Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Dieses Förderungspaket für E-Mobilität im Ausmaß von 72 Millionen € ist aber eine ganz, ganz wichtige Impulsförderung, gerade auch für den privaten Bereich.
Der vierte Punkt: Ich glaube, wir brauchen auch mehr Geld für lokale und regionale Initiativen. Als Mandatar aus dem Bezirk Freistadt möchte ich noch einmal ein Projekt aus unserem Bezirk kurz skizzieren. Wir haben vor zehn Jahren den Energiebezirk Freistadt gegründet, einen gemeindeübergreifenden Verein, der Bewusstseinsarbeit für Klima- und Energiepolitik betreibt. Eine lokale Energiegemeindegruppe betreibt Energieberatung. Diesem Verein ist es mit der Helios GmbH in den letzten Jahren gelungen, das größte virtuelle Sonnenstromkraftwerk in Österreich zu errichten, über 250 Einzelfotovoltaikanlagen auf einer Gesamtfläche von 40 000 Quadratmetern Kollektorfläche. Das entspricht einer Energieleistung, mit der wir ungefähr 1 500 Haushalte im Bezirk mit Strom versorgen können. Das sind Initiativen, die vor Ort gemeinsam mit den Menschen entwickelt worden sind, die auch im Bewusstsein der Bevölkerung stark verankert sind.
In diesem Herbst haben wir in 20 von 26 Gemeinden Doppel-E-Ladestellen errichten können. In zehn Gemeinden wird mittlerweile ein E-Auto in Form von Car-Sharing-Projekten genutzt, über 150 Menschen haben sich bereits eingetragen.
Mit viel Engagement, kreativen Projekten und unterschiedlichen Fördertöpfen ist es gelungen, da viel auf die Beine zu stellen. Wenn es aber um die großen Fördersummen geht, dann haben lokale Initiativen leider sehr oft das Nachsehen. Wir haben gemeinsam mit der Region Großschönau im Waldviertel versucht, ein Projekt für die Vorzeigeregion Energie einzureichen. Inhaltlich hat man uns bestätigt, und wir wurden bestens ausgewiesen, nur Geld haben wir keines bekommen. Zum Zug gekommen sind die großen Energieversorger.
Ich denke, dass es diese lokalen und regionalen Initiativen sind, die direkt sichtbar für die Menschen in den Gemeinden vor Ort jeden Tag einen Transformationsprozess mit einleiten, und deswegen, glaube ich, sollten diese kleinen Projekte gegenüber großen Projekten nicht benachteiligt werden. (Beifall bei SPÖ, ÖVP und Grünen.)
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zum Abschluss: Es gibt zum Glück nur mehr wenige Zweifler am Klimawandel, nur mehr wenige Ansagen wie die von Donald Trump, dass China den Klimawandel erfunden hat, um die Wettbewerbsfähigkeit der amerikanischen Industrie zu schwächen, oder jene des oberösterreichischen Landeshauptmann-
Stellvertreters Manfred Haimbuchner, der sagt, der menschliche Anteil am Klimawandel sei nicht nachweisbar. Das sind zum Glück Einzelmeinungen. Es ist jetzt an der Zeit, rasch ins Umsetzen und ins Arbeiten zu kommen, denn für alles andere ist einfach keine Zeit mehr. – Herzlichen Dank. (Beifall bei SPÖ, ÖVP und Grünen.)
9.45
Präsident Mario Lindner: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Dörfler. – Bitte.
9.45
Bundesrat Gerhard Dörfler (FPÖ, Kärnten): Geschätzter Herr Präsident! Herr Bundesminister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn wir heute Österreich beobachten, wenn wir wieder einmal nicht weiße Weihnachten haben, dann wissen wir, dass wir ständig mit dem Klimawandel konfrontiert sind und dass es größten Handlungsbedarf gibt.
Wie ist die Situation? – Wenn 70 000 Tonnen Müll aus Rom kommend über 1 100 Kilometer nach Wien transportiert werden, um da verbrannt zu werden, dann muss man sich fragen, welche Umweltpolitik Europa oder unser Nachbar Italien macht. Wenn wir wissen, dass ein Zehntel Chinas von einer Smogglocke überdeckt ist, wenn im Bereich der amerikanischen Botschaft in Peking laut ORF-Teletext eine Feinstaubbelastung von 200 Mikrogramm Feinstaub gemessen wurde – das ist das Achtfache des WHO-Richtwerts – oder wenn in einer chinesischen Hafenstadt 400 Mikrogramm Feinstaubbelastung gemessen werden, dann, muss ich sagen, ist das ein dramatisches Zeichen.
Natürlich sind auch die wirtschaftliche Verlagerung, die Deindustrialisierung Europas und anderer Regionen dieser Welt an diesem Prozess beteiligt. Wir brauchen mehr Regionalität der Wirtschaft, wir brauchen mehr europäische Wirtschaft und weniger Giganten, die zulasten der Umwelt und damit zulasten der Lebensqualität der Menschen und der Zukunft der Mutter Erde ihre Wirtschafts- und Standortpolitik machen.
Aktuelles Beispiel: Wo investiert die voestalpine? – In den USA! Natürlich sind die Standortkosten dort wesentlich niedriger, natürlich sind die Umweltauflagen wesentlich geringer, auch die Energiekosten. Auch Lenzing hat angekündigt, es werde nicht in Österreich investieren, sondern dort, wo die Umweltstandards niedriger sind, die Löhne geringer sind, die Sozialleistungen schlechter sind als in Österreich oder im übrigen Europa. Daher ist schon klar, dass eine Regionalisierung der Wirtschaft ein wichtiger Teil und auch notwendig ist, damit wir da den richtigen Weg in die Zukunft finden. Es sollte nicht so wie in China sein, wo der Wirtschaftsmotor vorwiegend die Kohleproduktion ist und das Europa mit seinen Konsumartikeln überschwemmt.
Gehen Sie einmal auf einen Wiener Weihnachtsmarkt! Ich habe für meinen Enkelsohn Simon ein Spielzeug gekauft, einen VW Doka-Pritsche – die Älteren unter uns kennen ihn noch, ein legendäres Fahrzeug. Ich habe versucht, ein Auto zu finden, das nicht aus China kommt. – Ich habe keines gefunden. Es ist traurig, dass wir nicht in der Lage sind, unsere Weihnachtsgeschenke in Europa selbst zu produzieren.
Da möchte ich schon auch aufrufen, dass wir alle zum Thema Klimaschutz etwas beitragen sollten und dass wir versuchen sollten, dass die Weihnachtsgeschenke vielleicht wieder europäischer oder österreichischer werden. Das wäre schon auch ein dringendes Anliegen, dass wir versuchen, das Zusammenspiel von Klima und Auswirkungen der Produktion sowie des gigantischen Transitverkehrs zu durchleuchten und da einen Umkehrschub zu schaffen.
Schauen wir uns die aktuelle Dieselaffäre an: Das ist ein Betrug auf höchster Ebene. Schauen wir uns einmal die Automobilhersteller insgesamt an: Das, was sie uns an Treibstoffverbrauch im Prospekt versprechen, ist in der Praxis überhaupt nicht erreichbar, außer wenn man 70 Kilometer statt 100 Kilometer fährt. Dann wird man diesen
Treibstoffverbrauch haben, den einem die Automobilhersteller in ihren Prospekten unterjubeln.
Dann vielleicht noch zu einem Thema, das ich für sehr wichtig halte, nämlich zum Thema Mobilität insgesamt: Herr Umweltminister, es ist äußerst erfreulich, dass in den letzten Jahren die ÖBB den Standort Österreich massiv aufgewertet haben. Wie wurde die Südachse bekämpft! Erwin Pröll wollte keinen Semmering-Basistunnel, den Koralmtunnel wollte man verhindern. Genau das ist eine der großen Verkehrsinvestitionen in die Zukunft, dass die Bundeshauptstadt Wien mit Graz, mit Klagenfurt verbunden ist – und Danzig mit Bologna. Das heißt, die ganze baltisch-adriatische Achse wird tatsächlich eine massive Verbesserung des Transitverkehrs zulasten der Straße und zugunsten der Schiene und der Menschen bringen. Abgesehen davon wird auch die Vernetzung zwischen Arbeit und Leben in Österreich wesentlich attraktiver und umweltfreundlicher sein.
Ich muss auch festhalten, dass die ASFINAG zum Beispiel mit jedem Tunnelprojekt dazu beigetragen hat, dass die Staubbelastung und damit auch die Umweltbelastung, die sinnlos war, geringer wurden. Ich denke nur an Kärnten, an den Gräberntunnel auf der A2, den Katschberg- und Tauerntunnel. Da haben wir im Sommer 30, 40 Kilometer Staus gehabt, die gibt es nicht mehr. Und jetzt kommt noch der Karawankentunnel dran. Das heißt, den Verkehr, den es gibt, muss man auch entsprechend verflüssigen.
Eine Riesenchance ist die Elektromobilität, Herr Bundesminister. Es ist wirklich erfreulich, dass es da eine Offensive gibt. Wir in Kärnten haben sie vor Jahren gestartet. Wie du weißt, waren wir die einzige österreichische Region, die per Vertrag mit Mercedes eine Entwicklungspartnerschaft über vier Jahre abgeschlossen hat. Das heißt, wir haben da Pionierarbeit geleistet.
Gestern habe ich mit dem Verkehrsminister gesprochen; Leichtfried hat mir zugesagt, dass es im Jänner dazu ein Gespräch geben wird, weil ich meine, dass wir auch grenzüberschreitend Elektromobilität ausbauen sollten: Graz–Marburg als einen Schwerpunkt, Klagenfurt–Laibach als einen Schwerpunkt, Villach–Udine als einen Schwerpunkt. Das heißt, Österreich könnte da auch eine internationale Pionierrolle spielen, indem es die Elektromobilität grenzüberschreitend entwickelt, und da auch eine europäische Vorbildwirkung haben. (Allgemeiner Beifall.)
Es wäre auch notwendig, dass wir die Haustankstelle forcieren. Ich verstehe die Diskussion nicht, wenn man glaubt, es muss jedes Auto öffentlich betankt werden. Wenn man 15 bis 20 Quadratmeter Fotovoltaikanlage auf dem Dach eines Einfamilienhauses hat, dann kann man pro Jahr den Strom produzieren, den ein Elektroauto für 15 000 Kilometer braucht. Das heißt, in Wirklichkeit muss es ein Gesamtkonzept geben, das vor allem die Menschen im ländlichen Raum durch entsprechende Projektfördermaßnahmen und Projektkonzeptionen in die Lage versetzt, dafür Sorge zu tragen, dass der Mobilitätsstrom, der Treibstoff der Zukunft wirklich vom eigenen Haus kommt. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die zum Teil zu sehr in den öffentlichen Raum verlagert wird. Wo steht das Auto am längsten? – In der Nacht vor dem Haus oder in der Garage, und dort muss ich auch die Stromproduktion entsprechend forcieren.
Mit dem Thema, dass Europa am fossilen Tropf hängt, beschäftigt sich auch eine Fachzeitschrift. Wie schaut die Situation derzeit aus? – 99,4 Prozent der Energieimporte der EU-28 stellten 2014 noch immer auf fossile Energieträger ab. Das heißt, Europa ist nach wie vor massiv von fossiler Energie abhängig.
Wenn man sich zum Beispiel die Pelletsproduktion anschaut, dann sieht man, in Europa werden derzeit 20,3 Millionen Tonnen Pellets verbraucht. Davon werden 14,1 Millionen Tonnen in Europa produziert. Hauptproduzent ist Deutschland mit 2 Millionen Tonnen. Immerhin 6,2 Millionen Tonnen oder 30 Prozent – ganz genau 30,5 Prozent – wer-
den hauptsächlich aus den USA importiert. Also dass das der Klimaschutz der Zukunft ist, wage ich zu bezweifeln. In Kärnten wächst eine Million Festmeter Holz zu, das ist auch zu nützen. Ein Appell an die Grünen: Dazu braucht man auch eine Motorsäge; den Baum zu küssen wird nicht reichen, wir müssen auch den Baum ernten, um Biomasse zu haben. (Beifall bei der FPÖ und bei Bundesräten der ÖVP.)
Das ist immer die Diskussion. Wir müssen schon auch klarmachen, dass eine Waldbewirtschaftung für die Biomasse notwendig ist. Ich weiß, wovon ich rede, Frau Kollegin Dziedzic; ich habe in Klagenfurt einmal 44 Bäume gefällt, da haben die Grünen eine Protestaktion gestartet. Ich habe aber über hundert wieder gepflanzt, das haben sie vergessen. Das heißt, man muss schon auch ein ehrliches Bekenntnis zur Biomasse abgeben. Es ist eine Riesenchance. Österreich ist auf gutem Wege.
Noch eines: Eines der Hauptprobleme ist der Alpentransit, wir haben ja sozusagen eine Art importierten Umweltbelastungsfaktor Transit. Der Semmering-Basistunnel, die Südachse und andere Projekte werden dazu beitragen, diese Belastung zu verringern. Wichtig wäre es auch, wenn es uns gelänge, die Wirtschaft wieder zu regionalisieren und damit auch Verkehre wieder regional zu verkürzen. Wir haben ja auch in Österreich so etwas wie eine nationale Globalisierung, dass die Arbeitsplätze in Zentren abwandern, dass die Angebote in Zentren abwandern, dass die Menschen sehr oft vom ländlichen Raum ins Zentrum fahren müssen und aufgrund des nicht funktionierenden öffentlichen Verkehrs auf das Auto angewiesen sind. Daher muss es, Herr Minister, auch eine Regionalisierung nicht nur der Lebensmittelproduktion geben, sondern vor allem auch eine Regionalisierung der Wirtschaft in Österreich, damit draußen auf dem Land die Menschen dort Arbeit haben, wo sie wohnen; damit verhindern wir ein größeres Verkehrsaufkommen und schützen die Umwelt.
In diesem Sinne hoffe ich, dass Österreich eine Vorreiterrolle beim Klimaschutz einnehmen wird. (Beifall bei der FPÖ und bei Bundesräten der ÖVP.)
9.54
Präsident Mario Lindner: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Mag. Schreyer. – Bitte sehr, Frau Bundesrätin.
9.54
Bundesrätin Mag. Nicole Schreyer (Grüne, Tirol): Hohes Haus! Sehr geehrter Herr Minister! Sehr geehrte ZuseherInnen hier und zu Hause! Ja, der Titel der heutigen Aktuellen Stunde lautet: „Umsetzung Klimavertrag: auf dem Weg in eine fossilfreie Zukunft“ – und das möchten wir natürlich auch.
Wir Grüne möchten in Österreich wirklich jede Unterstützung zusichern, gemeinsam an so einer fossilfreien Zukunft zu arbeiten, denn jetzt den Weg in Richtung einer fossilfreien Zukunft einzuschlagen, das ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit, und je eher wir damit anfangen, desto leichter ist es zu erreichen und desto billiger wird es auch für uns. Egal, wie viel auch immer wir jetzt in die Bekämpfung des Klimawandels reinstecken, es wird auf alle Fälle viel, viel billiger als die Folgekosten, die durch den Klimawandel auf uns zukommen. Mit jedem Zehntelgrad, das wir nicht einsparen, gehen die Folgekosten einfach exponentiell in die Höhe.
Das große Problem ist nur, ich sehe einfach nicht, wir sehen einfach nicht, wie Österreich das schaffen soll. Alles, was Österreich derzeit macht, ist eine Beibehaltung des Status quo.
Ich gehe jetzt aber noch einmal einen Schritt zurück und hole da ein bisschen aus: Also vor ungefähr einem Jahr, fast zeitgleich mit dem Beschluss des Klimavertrags von Paris, sind im Budget für das laufende Jahr 2016 sämtliche Klimaschutzmaßnahmen, sämtliche Klimaschutzinstrumente des Bundes empfindlich gekürzt worden. Die Förderung der thermischen Sanierung ist fast halbiert worden. Die Mittel für den Klima- und
Energiefonds sind um 30 Millionen € auf 84 Millionen € gekürzt worden. Die Umweltförderungen im Inland sind ebenfalls um 16 Millionen € gekürzt worden, also ungefähr um ein Viertel.
Für das kommende Jahr 2017 sind die Kürzungen jetzt nicht mehr so drastisch, aber es gibt immer noch in allen Bereichen Kürzungen, und wir gehen jetzt eben auch von einem viel geringeren Niveau aus als in den Vorjahren, weil eben von 2015 auf 2016 so massiv gekürzt worden ist, und der Finanzrahmenplan bis 2020 sieht vor, dass diese Kürzungen fortgesetzt werden. Kumuliert bedeuten diese Kürzungen für die fünf Jahre von 2016 bis 2020 ein Minus von über 200 Millionen € im Vergleich zum Jahr 2015 – und das sind nicht Ausgaben, die wir uns sparen, das wäre jetzt einfach zu kurz gesehen, es sind auch massive Einnahmeneinbußen, die wir da hinnehmen müssen.
Das ist jetzt keine Behauptung der Grünen. Wir sind ja keine Baumumarmerfraktion, wie gerade eben noch behauptet worden ist. (Zwischenruf des Bundesrates Mayer.) Auf der Homepage des Landwirtschaftsministeriums gibt es eine Studie zum Download, aus der hervorgeht, dass durch die Sanierungsoffensive 2014 knapp 8 000 Vollzeitarbeitsplätze geschaffen worden sind, bei einer Fördersumme von knapp 90 Millionen € sind fast 600 Millionen € an Investitionen ausgelöst worden, und es hat eine Wertschöpfung von über 430 Millionen € gegeben. Ungefähr die gleichen Zahlen ergeben sich auch für die Umweltförderung im gleichen Zeitraum.
Die gesamte Budgetpolitik steht im Moment also in direktem Widerspruch zu dem, was wir eigentlich jetzt brauchen würden: mehr Anstrengung und mehr Investitionen beim Klimaschutz.
Bei der Klimaschutzkonferenz im vergangenen Monat in Marrakesch ist eine Deklaration verabschiedet worden, wonach die Anstrengungen im Klimaschutz unbedingt verstärkt werden müssen, weil sonst die Ziele von Paris nicht eingehalten werden können. Wenn alle Länder der Welt bei den Zielen, die sie sich jetzt im Moment gesetzt haben, bleiben und diese umsetzen, dann steuern wir auf eine Erwärmung von über 3 Grad weltweit zu, und das würde den totalen Klimakollaps bedeuten. Es braucht einfach deutlich ambitioniertere Ziele, um die 1,5 Grad, die in Paris beschlossen worden sind, zu erreichen oder zumindest deutlich unter 2 Grad zu bleiben.
Österreich hat laut aktuellem Plan aber nicht vor, die Emissionen bis 2020 wesentlich zu senken, sondern eben nur die Stabilisierung der Emissionen auf dem Niveau von circa 1990 zu erreichen. Das nimmt uns eben auch ganz, ganz viele Chancen weg. Auf EU-Ebene – und das ist auch die Begründung dafür, dass wir im Moment nicht mehr machen – sind nur die 2020-Ziele vereinbart worden, und zwar mit dem Referenzjahr 2005. Das war ein Jahr mit sehr hohen Emissionen, daher sind einfach die Anstrengungen, um diese einzuhalten, nicht so besonders groß, und die 2030-Ziele sind EU-weit noch nicht vorgegeben. Wir wissen aber, wo es ungefähr hingehen wird. Es geht in Richtung eines Minus von 40 Prozent an Emissionen im Vergleich zu 1990, plus, minus ein bisschen; und da auf die Strategie zu warten und nichts zu tun, wie Österreich das derzeit vorhat, ist einfach nicht zu vertreten.
In Richtung 2050 müssen wir auf 85 bis 90 Prozent der Emissionen von 1990 kommen. Warum fangen wir also nicht jetzt an? – Alle Zeit, die wir jetzt abwarten und nicht sofort nützen, ist vergeudete Zeit, die uns später teurer kommt. Anfangs sind die Kosten noch viel geringer. Je später Klimaschutzmaßnahmen gesetzt werden, also je näher wir an die 1,5 oder knapp 2 Grad globale Erwärmung hinkommen, desto teurer wird es. Es geht da einfach nur ums Anfangen.
Ich bringe ganz selten und sehr ungern Deutschland als Vorbild, aber Deutschland macht das im Moment. Deutschland hat sich Sektorziele bis 2030 gesetzt. (Bundesrat Dörfler: … mehr Kohle!) Diese Ziele sind unserer Meinung nach zwar auch nicht ausreichend, aber Deutschland macht schon etwas und wartet nicht einfach nur ab. Damit
das nicht gleich als Gegenargument kommt: Der Ausstieg aus Kohle ist in Deutschland nicht explizit in die Sektorziele hineingeschrieben, aber aus den Emissionszielen ist herauszulesen, dass es ohne den Kohlestopp nicht geht. (Zwischenbemerkung von Bundesminister Rupprechter. – Zwischenruf des Bundesrates Mayer.) Natürlich muss es einen Kohleausstieg geben, aber was ich damit sagen will, ist: Deutschland als unser nördlicher Nachbar hat sich zumindest Ziele gesetzt und wartet nicht ab und macht einfach einmal nichts, bis irgendwann einmal die ganz fixen Vorschriften kommen. Wir müssen da in diese Richtung steuern!
Mit der integrierten Energie- und Klimastrategie, die es gemeinsam von Landwirtschafts-, Verkehrs-, Wirtschafts- und Sozialministerium geben wird – was ja ein sehr guter Prozess ist – soll es eine Lösung für die Ziele für 2030 geben; diese Ziele sollen da erarbeitet werden. Ein Zeithorizont für die Erstellung ist aber leider auch nicht angegeben.
Ein weiterer Punkt, bei dem Österreich immer noch säumig ist, ist die internationale Klimafinanzierung, durch die die reichen Länder die ärmsten Länder der Welt dabei unterstützen, Maßnahmen gegen den Klimawandel zu setzen. Es gibt von Österreich bis jetzt überhaupt keine Zusage für künftige Mittel, und bisher liegen wir auch weit unter dem Durchschnitt vergleichbarer Staaten. Da müssen wirklich Mittel freigemacht werden, damit Österreich als eines der finanziell am besten dastehenden Länder dieser Erde seinen Beitrag leistet.
Es muss sich in der österreichischen Klimapolitik einiges verbessern. Österreich soll bitte bei der nächsten Klimakonferenz 2017 in Bonn nicht schon wieder die Ehre zuteilwerden, den „Fossil of the Day“-Award – also Fossil des Tages – zu erhalten.
Ja, wir wollen eine fossilfreie Zukunft. Österreich soll Teil der Energiewende werden und auch von den unglaublichen wirtschaftlichen Chancen dabei profitieren. Dafür braucht es einfach sehr viel Engagement. Wir müssen die Klimaziele bis 2020 anheben, wir müssen das umsetzen, und dazu wird es ein Budget brauchen, Herr Minister. Es wurden 100 Millionen € versprochen, ich sehe sie aber nicht. Das ist auch weniger als die Kürzungen, die im derzeitigen Finanzfahrplan bis 2020 vorgesehen sind. Wir brauchen schnellstmöglich die integrierte Energie- und Klimastrategie mit Zielen und Maßnahmen für 2030 und mit einem Dekarbonisierungsfahrplan bis 2050.
Es wird auch notwendig sein, gezielt auf Gesetzesebene nachzuschärfen. Vorher ist zum Beispiel schon die Artikel-15a-Vereinbarung zum Klimaschutz im Gebäudesektor erwähnt worden – Stichwort Ölheizungsverbot. Da muss der Bund im Rahmen der Artikel-15a-Vereinbarung mit den Ländern noch nachschärfen, damit die Länder da auf alle Fälle auch mitziehen. (Bundesrat Mayer: Aber zwingen können wir sie nicht!)
Die Streichung klimaschädlicher Subventionen ist notwendig. Ebenso braucht es, wie von uns schon lange gefordert, eine generelle Ökologisierung des Steuersystems und natürlich eine Novellierung des Ökostromgesetzes. Darauf geht meine Kollegin später noch ein.
Ich bin mir sicher, dass wir es vereint schaffen können, Österreich klimafit zu machen. Wir müssen nur damit anfangen! – Danke schön. (Beifall bei den Grünen und bei Bundesräten der SPÖ.)
10.03
Präsident Mario Lindner: Zu einer ersten Stellungnahme hat sich Herr Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Dipl.-Ing. Rupprechter zu Wort gemeldet. Auch seine Redezeit soll 10 Minuten nicht überschreiten. – Bitte, Herr Bundesminister.
10.03
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Dipl.-Ing. Andrä Rupprechter: Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Die Untertitel für
meinen Redebeitrag zu dieser Aktuellen Stunde lauten: Großes Lob für die freiheitliche Fraktion. Und an die Grünen: Leider alles falsch, tut mir sehr leid.
Sehr geehrter Herr Präsident, lassen Sie mich Ihnen auch, bevor ich auf die Inhalte eingehe, zu Ihrem Eingangsstatement gratulieren. Ich gratuliere auch zur sehr beherzten, umsichtigen Vorsitzführung und zur Schwerpunktsetzung des steirischen Vorsitzes. Gratulation! Ich denke, Sie haben damit wirklich sehr zur Relevanz dieser hohen Kammer beigetragen.
Ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit mit der nächsten Vorsitzenden, Sonja Ledl-Rossmann – sie ist jetzt, glaube ich, gerade hinausgegangen. Gerade für das kommende Jahr habe ich in meinem Ressort gemeinsam mit der Landeshauptleutekonferenz und dem Gemeindebund ganz bewusst einen Schwerpunkt auf den ländlichen Raum, auf die regionale Zusammenarbeit gesetzt. Ich hoffe, dass wir auch hier im Hohen Haus eine diesbezügliche Schwerpunktsetzung haben werden, und vielleicht können wir auch eine Enquete im Bundesrat zur Thematik Masterplan für den ländlichen Raum abhalten. Ich denke, dass das auch sehr zur Relevanz dieser Kammer beitragen kann.
Nun zur Aktuellen Stunde, ich werde mich möglichst kurz fassen: Auch in diesem Zusammenhang gratuliere ich dem Bundesrat zur Schwerpunktsetzung. Sie haben der Debatte über den Klimaschutz sehr viel Raum gegeben und damit auch zur raschen Ratifizierung des Abkommens von Paris beigetragen. Ich durfte im letzten Jahr vom erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen in Paris berichten, und wir haben es geschafft, in Österreich die Ratifikation in weniger als einem halben Jahr über die Bühne zu bringen. Wir waren damit auch einer der drei ersten Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die den Weltklimavertrag in so kurzer Zeit ratifiziert haben.
Damit haben wir auch dazu beigetragen, dass die Europäische Union im September dieses Jahres mit einem Ratsbeschluss ein Schnellverfahren zur Ratifizierung durch die Europäische Union beschlossen hat. Die Mitgliedstaaten und die Europäische Union konnten dazu beitragen, dass der Weltklimavertrag bereits am 4. November dieses Jahres in Kraft getreten ist.
So war es möglich, dass wir bereits bei der ersten Vertragsstaatenkonferenz zum Abkommen von Paris in Marrakesch, der COP 22, als aktive Verhandlungspartei, wie auch die Europäische Union, am Verhandlungstisch gesessen sind.
Ich denke, wir können schon ein bisschen stolz darauf sein, dass wir da wirklich Vorreiter waren. Herr Bundesrat Dörfler, wir sind Vorreiter im Klimaschutz, und ich werde selbstverständlich noch auf eine Reihe von Punkten eingehen.
Der Weltklimavertrag ist nun in Kraft. Mehr als 115 Staaten der Welt haben das Abkommen bereits ratifiziert und in Kraft gesetzt. Mehr als 80 Prozent der Treibhausgase sind von diesem Abkommen umfasst, das heißt: Es ist erstmals wirklich gelungen, ein globales, umfassendes Abkommen in Kraft zu setzen. Ich denke, das war enorm wichtig, gerade auch vor dem Hintergrund der befürchteten Effekte von Carbon Leakage, die in mehreren Debattenbeiträgen angesprochen worden sind.
Ich denke, dass das ein wirklich historisches Abkommen ist. Auch eine derartige Raschheit des Inkrafttretens hat es noch nie gegeben. Nur als Beispiel: Beim Kyoto-Vertrag hat es vom Ausverhandeln bis zum Inkrafttreten mehr als 5 Jahre gedauert. Auch so gesehen ist dieses Abkommen ein historisches Abkommen.
Es geht – und das ist das Thema der Aktuellen Stunde – jetzt um die Umsetzung. Auch das ist in Marrakesch klar geworden. Das war eine Arbeits-COP, wir haben den Arbeitsplan bis 2018, bis zur COP 24 in Warschau, festgelegt. Es wurde festgelegt, was bis dahin erreicht sein muss, damit wir tatsächlich auf Zielpfad bis 2030 und bis 2050 sind, um das Ziel der Entkarbonisierung unserer Energiesysteme, vor allem auch un-
serer Mobilitätssysteme, zu erreichen. Das sind genau die Ansatzpunkte, um die es geht, das wurde auch richtig in den Debattenbeiträgen angesprochen.
Es geht vor allem um eine Energiewende. Klimaschutzpolitik ist vor allem Energiepolitik mit einem ganz klaren Schwerpunkt auf die Forcierung der erneuerbaren Energieträger. Wir sind in diesem Bereich in Österreich gut aufgestellt, wir haben bereits einen Anteil erneuerbarer Energiequellen an der Gesamtenergieversorgung von fast 34 Prozent. Unser Ziel ist es, bis 2030 den Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen zu erzeugen. Bundesländer wie Niederösterreich oder das Burgenland zeigen uns, dass das jetzt schon möglich ist. Das soll uns Antrieb geben, dass wir dieses Ziel bis 2030 wirklich auch festschreiben und den Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen erzeugen.
Insgesamt ist die Größenordnung noch so, dass wir in der Gesamtenergieversorgung, vor allem im Bereich der Mobilität, natürlich stark fossilabhängig sind. Bundesrat Pum hat es richtig gesagt: 93 Prozent kommen noch aus Erdöl. Wir müssen einen Schwerpunkt in Richtung E-Mobilität setzen, das ist völlig richtig. Es zeigt sich auch, dass wir in dem Bereich tatsächlich gewaltige Innovationsschübe haben, die wir auch forcieren können.
Wir sind in Österreich auch bei der E-Mobilität ganz gut aufgestellt. Wir haben in der Zwischenzeit Deutschland bei den Neuzulassungen überholt, dazu hat vor allem auch die Steuerreform ihren Beitrag geleistet. Das wollen wir jetzt forcieren. Wir haben gemeinsam mit Bundesminister Leichtfried und dem Automobilhandel für die nächsten zwei Jahre ein E-Mobilitätspaket geschnürt. Dafür nehmen wir 75 Millionen € in die Hand, aufgeteilt auf zwei Jahre, um tatsächlich eine massive Anschubförderung bei Neuzulassungen zu geben und noch mehr zu erreichen. Vor allem auch der Ausbau der Infrastruktur – Herr Bundesrat Dörfler, auch die Heimladestationen – muss forciert werden. Da haben wir viel vor uns. Auch die Schaffung von Schnellladeinfrastruktur entlang der großen Autorouten ist ein Ziel dieses 75-Millionen-€-Paketes. Ich möchte zuversichtlich sagen, dass wir, wenn wir die Mittel hochrechnen, die die Bundesländer in die Hand nehmen, auf die 100 Millionen € in diesen zwei Jahren kommen, die wir in die E-Mobilität investieren.
Wir haben in der Umsetzungsphase jetzt zwei Ebenen: einerseits die EU-Ebene, wo wir an der Reform des ETS-Systems arbeiten. Da müssen wir natürlich unsere Zielsetzungen – minus 40 Prozent Treibhausgase gegenüber 2005 – auf die Mitgliedstaaten herunterbrechen; wir sind da in den Verhandlungen. Ich war diese Woche beim EU-Umweltministerrat in Brüssel, wo wir die diesbezüglichen Vorschläge der Kommission beraten haben. Wir hoffen, dass wir im Laufe des nächsten Jahres tatsächlich zu einem Abschluss kommen können. Wir müssen damit rechnen, dass unser Beitrag in der Größenordnung von minus 36 Prozent außerhalb des ETS-Bereichs liegt, und es ist klar, wo die Anknüpfungspunkte sein müssen.
Wir müssen dann natürlich auch das Klimaschutzgesetz entsprechend anpassen, die Zielpfade neu definieren, um die 36 Prozent bis 2030 zu erreichen. Es ist richtig, wie gesagt wurde, dass wir die Anstrengungen forcieren müssen, aber es ist falsch, dass wir nicht die notwendigen Mittel in die Hand nehmen. Es ist einfach nicht richtig, dass wir weniger in die thermische Sanierung oder in die Energiewende investieren, sondern das Gegenteil ist richtig. Ich habe Ihnen bereits wiederholt auch im Hohen Haus darüber berichtet, dass wir für die kommenden zwei Jahre eine Klimaschutzoffensive der österreichischen Bundesregierung mit 100 Millionen € an zusätzlichen Mitteln aus der Auflösung von Rücklagen starten werden – für den Bereich der erneuerbaren Energieträger, für den Bereich der thermischen Sanierung und, wie ich schon angesprochen habe, für den Bereich der forcierten E-Mobilität. Ich denke, dass wir das selbstverständlich auch im Bundesfinanzrahmengesetz niederschreiben müssen. Das muss na-
türlich auch widergespiegelt sein. Wir sind dazu in sehr positiven, sehr guten Gesprächen mit dem Finanzminister.
Eines lassen Sie mich zum Abschluss noch sagen, das aus meiner Sicht enorm wichtig ist: Klimaschutz schafft Arbeitsplätze. Es ist heute nicht mehr so, dass durch Klimaschutzmaßnahmen Arbeitsplätze verloren gehen; im Gegenteil, es werden mehr Arbeitsplätze, grüne Arbeitsplätze – nicht im politischen Sinn – geschaffen. Die Voest plant, das ist bereits angesprochen worden, in Kapfenberg das weltweit modernste Stromstahlwerk zu bauen, dort zu investieren. Das wird auch von der Bundesregierung mit Nachdruck unterstützt. Da sehen wir, dass wirklich zukunftsweisende Arbeitsplätze geschaffen werden.
Ich möchte abschließend etwas ansprechen, das auch Teil meiner Umweltpolitik ist: Sehr wichtig ist es, dass wir Rahmenbedingungen, internationale Verpflichtungen, EU-Richtlinien, nationale Gesetze und Verordnungen haben; diese brauchen wir auch. Ganz besonders wichtig ist aber, dass wir auch auf Eigenverantwortung setzen, denn mit Eigenverantwortung, mit der persönlichen Verantwortung jedes Einzelnen, können wir tatsächlich am meisten weiterbringen. Es ist mir auch wichtig, diese Eigenverantwortung zu stärken und zu motivieren. – In diesem Sinne: Danke. (Beifall bei ÖVP und SPÖ, bei Bundesräten der FPÖ sowie der Bundesrätin Schreyer.)
10.15
Präsident Mario Lindner: Ich mache darauf aufmerksam, dass die Redezeit aller weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Aktuellen Stunde gemäß den Beratungen der Präsidialkonferenz 5 Minuten nicht übersteigen darf.
Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Ing. Köck. – Bitte, Herr Bundesrat.
10.15
Bundesrat Ing. Eduard Köck (ÖVP, Niederösterreich): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Minister! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Gäste! Der Weltklimavertrag von Paris ist ein Meilenstein für unsere Erde. Er ist ein Meilenstein in Richtung des Ziels, dass unsere Erde in Zukunft von außen auch so toll aussehen wird, wie sie uns jetzt immer auf Bildern gezeigt wird. Ich denke, man soll das nicht kleinreden.
Die Grünen stellen sich hierher und sagen: Man müsste tun, man müsste tun, man müsste tun! – Da muss ich Ihnen sagen: Zwischen Reden und Tun liegt das Meer. Tun Sie etwas und reden Sie nicht nur! Das ist es nämlich, was mir bei den Grünen nicht gefällt: Sie meinen, sie wissen alles besser, aber sie setzen nichts um. Schauen wir uns an, wer bei den vielen Ökoenergieprojekten vorne steht: Da steht fast nirgends ein Grüner vorne, da stehen fast immer ÖVPler vorne. Wir sind die Macher, wir sind die Umsetzer. (Beifall bei der ÖVP.) Und viele sagen, wir waren schon grün, da waren andere noch farblos.
Zur Umsetzung des Klimavertrages in Österreich gibt es doch einige Dinge, die wir beachten sollen und die das Ganze offensichtlich nicht so leicht machen. In den letzten Tagen sind mir einige Mails zugestellt worden, zum Beispiel vom Fachverband der Mineralölindustrie. Der schreibt:
Der Weg zur Reduzierung der Treibhausgase kann nur gemeinsam mit dem Verbrennungsmotor gelingen. Das bedeutet, dass der Verbrennungsmotor ein Teil der Lösung ist, denn im Antrieb mit fossilen Brennstoffen liegt noch enormes Potenzial. – Zitatende.
Oder zum Beispiel Gas Connect schreibt:
„In guten Händen – Verantwortung gegenüber der Natur. Fairness gegenüber den Menschen. Mit Weitblick in die Zukunft. Diese drei Werte bestimmen unser Handeln. Gas Connect Austria stellt ein modernes und leistungsfähiges Pipelinesystem bereit, über
das schnell, sauber und umweltschonend Erdgas innerhalb Österreichs und nach Europa transportiert wird.“
Wir sehen also: Die eingefahrenen Wege der Energielobbyisten der Vergangenheit werden hier noch etwas vertieft. Auch sie wollen sich ökologisch präsentieren, damit sie ihre Energiesysteme noch länger aufrechterhalten können. Deshalb wird es wohl nicht so einfach sein, diese Umsetzung zügigst fortzusetzen, was wir sicher gerne wollen.
Wir haben im Energiesektor drei große Bereiche: Wirtschaft, Wärme und Verkehr. Auch ich möchte mich beim Verkehr der Elektromobilität widmen. Es gibt sehr viele gute Ansätze in den neuen Förderrichtlinien, aber es gibt auch noch viel zu tun. Die E-Mobilität wurde immer als eine Mobilitätsform der Stadt proklamiert. Ich wundere mich aber, wenn ich dann lese, dass es in Ottakring, einem Stadtbezirk, kein Elektroauto gibt, dass aber Waidhofen an der Thaya, der Bezirk, aus dem ich komme, der Bezirk mit den meisten Elektroautos pro Kopf ist. Das heißt, wenn ich den vielstrapazierten Begriff Smart City darauf umlege, dann gibt es die Smart City nicht, aber es gibt ein Smart County, einen Smart Bezirk Waidhofen an der Thaya. (Zwischenruf des Bundesrates Mayer.)
Ich denke, da gibt es noch viel zu tun, vor allem in der Bewusstseinsbildung in den Städten. Wir haben eine Klima- und Energie-Modellregion, die den Europäischen Klimaschutzpreis 2016 gewonnen hat. Das zeigt schon, dass dort einiges geschehen ist. Wir haben eine eigene Firma gegründet, die TRE Thayaland GmbH, die auf Bürgerbeteiligung basiert und laufend Ökoenergieprojekte umsetzt. Wir haben auch ein E-Carsharing. Es gibt also auch in den Städten noch sehr viel zu tun, und ich denke, gerade dort muss es auch angegangen werden.
Wir müssen aber auch den Bereich der Stromproduktion betrachten, denn wenn wir jetzt wirklich alle auf Elektromobilität umsteigen, dann muss der Strom ja auch produziert werden, und er sollte auf ökologische Art und Weise produziert werden. Da haben wir gerade ein wenig Stillstand bei den Tarifen.
Es geht darum, dass 100 bäuerliche Betriebe noch immer keinen weiterführenden Tarif bei den Biogasanlagen haben. Sie stehen vor dem Ruin, sie stehen vor dem Konkurs! – Ich verstehe nicht, dass hier immer wieder mit dem Argument gemauert wird, dass das zu teuer sei. Klar ist nämlich: Der Strompreis ist in den letzten zehn Jahren von 8,5 Cent auf unter 4 Cent gefallen, und Ursache dafür sind nur die Ökoenergieprojekte. Das würde für die österreichischen Haushalte eigentlich eine Verbilligung und eine Ersparnis von 500 Millionen €, im Durchschnitt 200 € pro Haushalt, bedeuten, leider können sie es nicht lukrieren, weil sich die Energieversorger zum großen Teil entsprechend organisiert haben, und da muss man, denke ich, ansetzen.
Die Wirtschaft konnte diese Strompreisreduktion lukrieren, und wir sehen: Ökoenergieprojekte sind wichtig. Sie senken die Preise. Sie sind wichtig für die Innovation in Österreich. Wir haben europaweit die meisten Patente in diesem Bereich. Ökoenergie schafft Arbeitsplätze und Wertschöpfung. Wir haben tolle Firmen, die das europa- und weltweit zeigen. (Präsident Lindner gibt das Glockenzeichen.)
Der nächste Schub muss meiner Meinung nach auch eine Förderung der Speichertechnik sein. Wir sollten uns da nicht von Tesla mit dem Hausspeicher den Rang ablaufen lassen, denn auch wir haben gute Betriebe, die das machen können.
Bis jetzt, denke ich, ist die Umsetzung gut. Viel Glück und Energie für die Zukunft, damit wir diesen Weg gut weitergehen können! – Danke, Herr Minister. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
10.21
Präsident Mario Lindner: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Schennach. – Bitte, Herr Bundesrat.
10.21
Bundesrat Stefan Schennach (SPÖ, Wien): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geschätzter Herr Umweltminister! Mein Vorredner hat recht, wenn er sagt: Der Pariser Klimaschutzvertrag ist einzigartig und von besonderer Bedeutung. Aber das war’s jetzt, denn ein Vertrag beziehungsweise ein Abkommen muss erst belebt und umgesetzt werden. Es muss ganz klare Pläne der Umsetzung geben, denn wir haben bis 2020, bis 2030 und bis 2050 Ziele zu erfüllen, und dazu braucht man eine Roadmap, Herr Minister! Wann kommt die Roadmap? Auf diese warten wir.
Als Koalitionspartner haben Sie es mit uns nicht schwer – Sie haben ja selber gesagt, wir haben das E-Mobilitätspaket bereits gemeinsam mit dem Verkehrsminister vorgelegt –, aber schwierig wird es, wenn Sie mit dem Landwirtschaftsminister debattieren müssen. (Bundesrat Mayer: Anders geht es nicht!) Das ist halt ein Selbstgespräch, aber diese Diskussion ist nicht minder schwierig, denn manchmal gewinnt die eine Seite dieses Ministeriums. Außerdem müssen Sie auch mit dem Wirtschaftsminister diskutieren. – Wir meinen aber, dass wir in diesem Bereich gemeinsam die gleichen Ziele haben, nämlich dass wir es bis 2030 schaffen und schaffen wollen, dass die Elektrizität zu 100 Prozent aus erneuerbarer Energie kommt.
Kollege Dörfler! Sie haben ein Beispiel verwendet, dass Sie, wie ich glaube, halb illegal eine Baumallee abholzen ließen und selbst Hand angelegt haben, und das haben Sie nicht für Pelletsheizungen gemacht, sondern um eine Straße zu erweitern und den Verkehr zu fördern, aber … (Zwischenruf des Bundesrates Dörfler.) Das ist die behübschende nachträgliche Aussage. (Zwischenruf des Bundesrates Samt.)
Liebe FPÖ! Wir können ja hier gleich noch einhaken, denn ich glaube, mein Vorredner aus Oberösterreich hat ja schon diesen genialen Landeshauptmann-Stellvertreter von Oberösterreich, Herrn Haimbuchner, erwähnt. – Wenn heutzutage ein Landesrat beabsichtigt, die Förderprogramme für alternative Heizsysteme, etwa für Solarthermieanlagen, für Wärmepumpen, für Fern- und Nahwärmenetze, zu streichen, so ist das ein ökologischer Geisterfahrer, und das noch dazu in der Funktion eines Landeshauptmann-Stellvertreters! (Beifall bei der SPÖ.)
Genau diese positiven Programme haben nämlich zum Beispiel dazu geführt, dass eine steirische Firma mit solar cooling, also mit der Herstellung von Systemen, die mittels Sonnenenergie kühlen, weltweit führend ist. Die Universität von Singapur wird von der steirischen Firma komplett mit solar cooling ausgestattet, und etwa bei Kühlsystemen gibt es eben hohen Energieverbrauch.
Herr Bundesminister, werfen wir nun aber einen Blick darauf, was das Energiepaket der EU vorsieht, nämlich genau ein solches Kühlsystem mit Elektrizität zu betreiben und damit auf Atomenergie zu setzen: Damit gehen wir einen falschen Weg, und diesbezüglich müssen Sie mit dem Wirtschaftsminister in ein Streitgespräch kommen!
Wir haben all diese Möglichkeiten, und wir müssen zum Beispiel – jetzt wird wieder der Landwirtschaftsminister widersprechen – von der Förderung von Diesel wegkommen, und wir müssen auch den Kohlekraftwerken spätestens mit 2020 ein Ende vorgeben. Wir sehen heute, dass – und in dieser Hinsicht unterstreiche ich das, was Sie, Herr Bundesminister, gesagt haben, voll und ganz – jegliche Investition in die Bekämpfung des Klimawandels und in den Energieumbau neue, nachhaltige, zukunftsträchtige Arbeitsplätze bedeutet. Das sind die Arbeitsplätze der Zukunft, und wir haben auch gesehen, dass die Arbeitsplätze gerade in diesem Bereich und in dieser Branche in Zeiten der Krise nicht gefährdet werden. (Präsident Lindner gibt das Glockenzeichen.)
Lassen Sie mich noch ganz zum Schluss sagen, dass wir an Sie dringend das Ersuchen richten: Wir brauchen klare und auch für uns alle überprüfbare Ausstiegsszenarien, und daher brauchen wir diese Roadmap für Österreich betreffend Klimaschutz-
ziele im Zusammenhang mit dem internationalen Klimaübereinkommen. Wir brauchen nämlich eine Handhabe gegen Geisterfahrer in Landesratsfunktionen! (Heiterkeit und Beifall bei der SPÖ sowie Beifall bei Bundesräten der ÖVP.)
10.27
Präsident Mario Lindner: Ich begrüße ganz herzlich die Schülerinnen und Schüler der 7. Klasse BRG Baden Biondekgasse. – Herzlich willkommen im österreichischen Bundesrat! (Allgemeiner Beifall.)
Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Krusche. – Bitte, Herr Bundesrat.
10.27
Bundesrat Gerd Krusche (FPÖ, Steiermark): Hohes Präsidium! Herr Bundesminister! Meine Damen und Herren! Meine Damen und Herren Zuseher zu Hause! Herr Bundesminister, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob Sie in Ihren abschließenden Ausführungen auch noch die Freiheitlichen loben werden, aber schauen wir einmal! (Bundesrat Mayer: Bei dir wird es schwierig!)
Für mich, der ich mit einer gewissen Affinität zu den Geowissenschaften behaftet bin, ist natürlich der vor allem von den Grünen viel zitierte Teil des Titels dieser Aktuellen Stunde „fossilfreie Zukunft“ schon ein bisschen problematisch, denn ich frage: Was kann die Paläontologie, was können die Ammoniten und was kann der Archaeopteryx für die Klimaerwärmung? – Aber mit ein bisschen gutem Willen weiß man, was mit diesem Titel gemeint ist.
Es wurde heute ständig der Weltklimavertrag angesprochen. Dieses 2-Grad-Mantra steht eigentlich schon seit 20 Jahren im Raum, und die Wurzeln liegen schon 40 Jahre zurück. Dieses 2-Grad-Mantra ist ja eine politische und keine wissenschaftliche Richtmarke, und zwar basierend auf drei Hoffnungen hinsichtlich des Gelingens der Umsetzung.
Die erste dieser Hoffnungen ist, dass das Klima nicht besonders empfindlich ist. Auch der Weltklimarat sagt, dass es bei einer Verdoppelung des CO2-Ausstoßes, gerechnet ab der vorindustriellen Zeit, zu einer Klimaerwärmung zwischen 1,5 und 4,5 Grad kommen kann. Das ist alles gleich wahrscheinlich. (Vizepräsident Gödl übernimmt den Vorsitz.)
Die zweite Hoffnung basiert darauf, dass der Menschheit – sprich der Wissenschaft – Großes gelingt und dass Lösungen gefunden werden. Es gibt ja teilweise abenteuerliche Ideen, beispielsweise Bäume zu pflanzen, die das CO2 aufnehmen, die Bäume dann zu verbrennen, das CO2 herauszufiltern und unterirdisch zu speichern. Damit das Ganze wirksam wird, würde man ungefähr einen Flächenbedarf von 1,5 Mal der Fläche Indiens benötigen!
Die dritte Hoffnung ist, dass die Erwärmung nicht so schlimm ist: Man sagt ja auch, dass es mehr Kälteopfer als Wärmeopfer gibt.
Ich habe diese Beispiele jetzt nur genannt, um diese ganze Diskussion über die 2 Grad etwas zu relativieren. (Bundesrat Schennach: Das ist ein bisschen peinlich, Herr Kollege!)
Wir reden hier immer nur vom CO2-Ausstoß und kaum von Methan, das ja auch ein klimaschädliches Gas ist, und schon gar nicht reden wir von dem, was am klimaschädlichsten ist, nämlich vom Wasserdampf: Das sind unsere Wolken, und genau darin liegt ein großes Problem, weil man nämlich über die Auswirkung des CO2-Anstiegs in Verbindung mit der Entwicklung der Wolken und des Wasserdampfes vor allem in den erdnahen Schichten überhaupt noch viel zu wenig weiß.
Worum geht es also? – Man hat sich auf diese 2 Grad geeinigt, weil das Risiko groß ist und man wissenschaftlich eben noch so wenig weiß und dieses Risiko minimieren will. Leider gibt es in diesem Zusammenhang aber auch immer etwas abenteuerliche Berichte. Jedes Mal vor der Klimakonferenz wird dieser Weltklimaschutzindex veröffentlicht, der auf nicht nachvollziehbaren Daten beruht. Nach diesem Index wäre, glaube ich, Frankreich an führender Stelle und Österreich auf Platz 41. – Es muss also klarerweise – das wollen wir auch nicht in Abrede stellen – etwas geschehen, und es sind hier bereits einige gute Ansätze gebracht worden.
Es ist klar: Ölheizungen müssen der Vergangenheit angehören und die E-Mobilität muss gestärkt werden, aber alles mit Maß und Ziel. Ich war beim letzten Städtetag bei einem diesbezüglichen Arbeitsausschuss, und wenn man dort dann hören muss, dass es in fünf Jahren keine Verbrennungsmotoren mehr geben wird, dann sage ich: Das sind einfach unrealistische Ansagen!
Tatsächlich geht es darum, die E-Mobilität gezielt dort zu fördern, wo sie Sinn macht, etwa im Bereich der Pendler, im Bereich der Zweitfahrzeuge und im Bereich des ländlichen Raumes. Die Abgasnormen, auch für Pkw, müssen realistisch angesetzt werden und nicht unrealistisch, denn Letzteres führt genau zu dem, was VW gemacht hat, nämlich zu Schummeleien.
Abschließend sage ich: Schlussendlich müssen wir immer Augenmaß bewahren, um nicht die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft und unserer Industrie ernsthaft zu gefährden. Leider gibt es nämlich auch Beispiele, wo das mit CO2-Zertifikaten geschehen ist: Ich darf nur an die Pelletieranlage am Erzberg erinnern, deren Betrieb eben wegen des CO2-Handels abgesagt wurde.
Wenn wir alles vernünftig und mit Maß und Ziel betreiben, dann werden wir es schaffen, dass wir in Europa nicht selber zu Fossilien werden. (Beifall bei der FPÖ und bei Bundesräten der ÖVP.)
10.33
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Dr. Reiter. – Bitte, Frau Bundesrätin, Sie sind am Wort.
10.34
Bundesrätin Dr. Heidelinde Reiter (Grüne, Salzburg): Herr Präsident! Herr Minister! Werte Kollegen und Kolleginnen! Werte Zuseher und Zuseherinnen! Dass wir zu Fossilien werden, ist nicht auszuschließen. Das ist nämlich unser aller natürlicher Prozess, das droht uns allen, wie auch immer das ausgeht. (Heiterkeit bei der SPÖ. – Zwischenruf des Bundesrates Krusche.)
Kollege Köck! Herr Minister! Diese gesamte Diskussion ist ja nicht vom Himmel gefallen und auch nicht erst seit Paris akut, sondern es ist schon seit vielen Jahrzehnten klar, dass der Ausstieg aus dem fossilen Bereich notwendig ist und dass es zu einer Umstrukturierung im Energiebereich und so weiter kommen muss.
Ich habe eigentlich nie, wenn ich im Ökoenergiesektor unterwegs bin – und das bin ich schon länger –, nach einem Parteibuch gefragt, wenn ich mit jemandem in diesem Bereich kooperiert habe. Das war nie mein Ansinnen, und ich meine, das sollte auch so bleiben.
Trotzdem möchte ich am Anfang eine kleine Schnurre erzählen: Ich habe mir 2004 ein Elektroauto zugelegt und bin mit diesem Elektroauto, um dieses einmal auszuprobieren, auch in den Landtag in Salzburg, in den Chiemseehof, gefahren und habe es dort angesteckt, damit ich auch wieder nach Hause komme. Dort geht es nämlich bergauf, und das war damals ziemlich problematisch mit dem Fahrzeug. – Die Freiheitlichen haben mich deswegen aber vor den Kadi gezerrt und haben gemeint, dass ich damit dem Steuerzahler Strom stehle.
Ich habe gesagt, dass ich bereit bin, das Tanken jedes Mal zu vergüten, aber es hat dann geheißen, dass das ohne entsprechenden Umbau und entsprechende Elektrouhr nicht geht. Ich habe auch gesagt, dass ich am Abend früher heimgehe, weil dann das Licht bei mir im Büro nicht so lange brennt und ich den Computer nicht brauche, aber auch das war nicht möglich. (Heiterkeit.) Ich durfte mein Elektroauto beim Landtagsgebäude nicht mehr mit Strom auftanken. Diesbezüglich hat also schon ein Bewusstseinswandel stattgefunden, aber seit 2004 ist auch schon ziemlich viel Zeit vergangen.
Ich bin es eigentlich auch müde, mich immer wieder zu schämen, wenn Österreich in diversen Rankings betreffend das Erreichen von Zielen, sei es das Kyoto-Ziel, das Toronto-Ziel und so weiter, immer Schlusslicht ist beziehungsweise knapp davor herumkrebst oder wenn Österreich wie in Marrakesch aufgrund dessen sozusagen gerügt und an den Pranger gestellt wird. (Zwischenbemerkung von Bundesminister Rupprechter.) – Nein, das waren nicht die Grünen! Das sind internationale Statistiken, das sind OECD-Statistiken beziehungsweise EU-Statistiken, und das finde ich traurig. (Bundesminister Rupprechter: Das sind keine EU-Statistiken!) – Ja, natürlich. (Bundesminister Rupprechter: Heute enttäuschen mich die Grünen das erste Mal!)
Vor allem in einem Bereich gibt es meiner Meinung nach in Österreich wirklich dringenden Handlungsbedarf. Wir geben im Jahr laut einer Wifo-Studie – das ist keine Studie eines grünen Instituts, sondern eine Wifo-Studie! – nach wie vor 4 Milliarden € für klimaschädliche Subventionen aus. Das ist viel Geld! Das heißt, wenn es gelingt, dieses Geld sozusagen in die richtige Richtung zu lenken, dann haben wir Geld gewonnen und einen wichtigen Schritt getan. Aber warum geschieht das nicht? Unter diesen genannten Subventionen sind zum Beispiel Steuererleichterungen für Kohlestrom und ähnliche Dinge mehr. Wir zahlen 13 Milliarden € für Importe fossiler Brennstoffe. Wir haben weiterhin steigende Stromimporte aus dem EU-Raum unbekannter beziehungsweise allgemeiner Herkunft. Da besteht also tatsächlich großer Handlungsbedarf, der sich ganz klar auch in Zahlen messen lässt.
Ich möchte jetzt noch kurz auf das Ökostromgesetz eingehen: Das Ökostromgesetz 2012 harrt dringendst der Novellierung. Seit zwei Jahren wurde das versprochen, aber nicht beschlossen; das wurde für Sommer 2016 angekündigt. Die Situation in der Ökostrombranche wird allerdings immer prekärer und immer schwieriger. Das heißt, es gelingt nicht nur nicht, da neue Strukturen aufzubauen, sondern wir fahren Bestehendes an die Wand! Das ist im Biogassektor so. Das ist im Bereich der Kleinwasserkraft so. Das ist im Bereich Wind so. Wenn man jetzt ein Projekt einreicht, dann ist man in der Förderschiene 2022 an der Reihe. Nach drei Jahren kann man das Projekt aber zusammenpacken und schreddern.
Wir haben in diesem ganzen Bereich keine verlässlichen Investitionsbedingungen, die wir aber brauchen, wenn Leute Projekte machen sollen und wenn solche Projekte verwirklicht werden sollen. Das haben wir aber nicht!
Wir brauchen das zum Beispiel für Bürgerkraftwerke im PV-Bereich. Wenn man aber den Leuten nicht sagen kann, welcher Art das Projekt ist, wie viel man zahlt, was die Erträge sind und ob das verlässlich ist, sondern ihnen sagen muss, dass man das nicht weiß und das Projekt letztlich vielleicht eingestampft wird, weil man nicht in die Förderschiene hineinkommt, dann meine ich: So kann das nicht funktionieren!
In diesem Bereich gibt es also nicht nur keinen New Deal, sondern wir haben No Deal. Somit besteht da dringender Handlungsbedarf, und daher rufe ich Sie, Herr Minister, und auch die Regierungsparteien wirklich auf: Schaffen Sie entsprechende Rahmenbedingungen, die es den Initiativen und all den Menschen, die sich diesbezüglich engagieren wollen, tatsächlich ermöglichen, hier zu investieren, damit hier etwas weitergeht. Daher also die Aufforderung: Wir brauchen ganz dringend ein neues Ökostromgesetz!
Es fehlt mir leider die Zeit, um die genaueren Details auszuführen, aber ich hoffe, dass wir das bald bekommen. – Danke. (Beifall bei den Grünen.)
10.40
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Mag. Zelina. – Bitte, Herr Bundesrat.
10.40
Bundesrat Mag. Gerald Zelina (STRONACH, Niederösterreich): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Umweltminister! Liebe Zuschauer vor den Fernsehgeräten! Bei drei Punkten müssen wir bei der Umsetzung des Weltklimavertrages ansetzen: Erstens gehören alle Förderungen und steuerlichen Begünstigungen für Öl und Gas gestoppt. Zweitens gehören sämtliche Neuinvestitionen in fossile Energieträger beendet. Drittens müssen wir massiv in emissionsfreie erneuerbare Energietechnologien investieren.
Angesichts der klimatischen Bedrohung für unser Ökosystem gibt es keinen vernünftigen Grund, zusätzliche Neuinvestitionen in Öl, Gas und Kohle zu tätigen. Auch alle Neuinvestitionen in Fracking und Ölsand gehören beendet.
Vergessen wir nicht, wir haben keinen zweiten Planeten Erde! We don’t have a planet B, hat auch der US-Präsident gesagt. (Bundesrat Mayer: … Englisch! – Zwischenruf des Bundesrates Stögmüller.) Wenn wir Menschen in blinder Profitgier unseren Planeten und unsere Umwelt zerstören, zerstören wir uns letzten Endes selbst. – Und das sage ich, obwohl ich hier eine Wirtschaftspartei vertrete. (Ruf bei der ÖVP: Welche? – Heiterkeit bei der ÖVP.) Ohne Gesundheit ist alles nichts, und ohne intakte Umwelt ist auch alles nichts. Da kann uns auch eine noch so gute Wirtschaft nicht mehr retten.
Bei den fossilen Investitionsstopps gibt es bereits einige Vorbilder: Die Allianz Versicherung und der Staatliche Pensionsfonds Norwegens – und das sind europäische Großinvestoren – haben sich bereits aus allen Kohleinvestments zurückgezogen. Selbst die US-amerikanische Rockefeller-Stiftung ist dabei, sich von ihren Investments in fossile Brennstoffe, zum Beispiel vom Ölriesen ExxonMobil, zurückzuziehen.
Ölheizungen gehören wie in Niederösterreich in allen Bundesländern verboten. Für Neubauten gehören auch Gasheizungen verboten, und sie gehören auf emissionsfreie Heizungssysteme aus erneuerbaren Energiequellen umgestellt. Investitionen in thermische Haussanierungen zur CO2-Emissionsreduktion und Heizkostenreduktion sind weiterhin zu forcieren.
Wir müssen auch massiv in emissionsfreie Elektroautotechnologien investieren und unseren Verkehr auf Elektroautos, auf Elektro-Lkws und auch auf Elektro-Busse umstellen. Elektroautos sind emissionsfrei und produzieren keine schädlichen Abgase wie Benzin- und Dieselverbrennungsmotoren. Ab 2025 sollte in Österreich ein Verkaufsverbot für Benzin- und Dieselautos gelten. In Norwegen, in den Niederlanden und auch in Indien ist das bereits beschlossen. Österreich soll ein Land ohne Benzin- und Dieselautos werden!
Abschließend noch zu den klimaschädlichen Förderungen, die gestoppt werden müssen: Fünfmal so hoch sind die Förderungen für fossile Energien im Vergleich zu jenen für erneuerbare Energien. Allein Österreich subventioniert fossile Energien jährlich mit 4 Milliarden € – das sind 4 Milliarden € an klimaschädlichen Subventionen pro Jahr! Förderungen und steuerliche Begünstigungen für Öl und Gas gehören beendet und dürfen Förderungen für erneuerbare Energien nicht mehr übersteigen!
Folgende Förderungen gehören konkret eingestellt:
Die steuerliche Begünstigung von Diesel gehört beendet. Da bewegen wir uns in einer Größenordnung von über einer halben Milliarde Euro.
Die Befreiung des Kerosins von der Mineralölsteuer gehört beendet. Da liegen wir auch fast bei einer halben Milliarde Euro.
Auch über die Pendlerförderungen, die Pendlerpauschale bei der Nutzung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren müssen wir reden. Die liegt auch bei einem Betrag von über einer halben Milliarde Euro.
Weiters gehört die Energieabgabenvergütung für die energieintensive Industrie beendet. Das beträgt auch eine halbe Milliarde Euro.
Und auch über das Herstellerprivileg für Produzenten von Energieerzeugnissen müssen wir diskutieren. Da liegen wir auch bei über einer halben Milliarde Euro.
In Summe lässt sich zur Umsetzung des Weltklimavertrages sagen: Österreich soll ein Vorzeigeland bei der Nutzung erneuerbarer Energieressourcen sein und eine wirtschaftliche Vorreiterrolle in der Umwelttechnologie bei Wasser, Wind, Sonne und Erdwärme einnehmen. – Danke schön. (Beifall bei den Grünen und bei Bundesräten von ÖVP und SPÖ.)
10.45
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Zur Abgabe einer abschließenden Stellungnahme hat sich nochmals der Herr Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Rupprechter zu Wort gemeldet. Ich erteile es ihm und darf ihn bitten, die Redezeit von 5 Minuten nach Möglichkeit einzuhalten. – Bitte, Herr Bundesminister.
10.45
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Dipl.-Ing. Andrä Rupprechter: Herr Präsident! Hohes Haus! Abschließend möchte ich noch eine ganz kurze Stellungnahme abgeben. Auch ich darf die Schülerinnen und Schüler ganz herzlich begrüßen. Ich glaube, parlamentarische Streitkultur auf hoher Ebene kann man in dieser Hohen Kammer wirklich lernen. Trotz der Schärfe der Debatte bleibt man immer wertschätzend – auch gegenüber dem politischen Gegner. Darauf freue ich mich immer, wenn ich in diese Kammer kommen darf. Ich glaube, das ist wirklich ein gutes Beispiel, dass man hier auch lernen kann. (Allgemeiner Beifall.)
Leider muss ich jetzt einiges relativieren, Herr Bundesrat Dörfler, nachdem Bundesrat Krusche alle meine Illusionen zerstört hat, dass es bei den Freiheitlichen tatsächlich zu einem großen Umdenkprozess und zum Licht der Erkenntnis in der Klimaschutzpolitik gekommen ist. Nach deinen Ausführungen, Bundesrat Dörfler, hatte ich gewisse Hoffnungen, aber die sind zerstört worden. Sie haben sich da leider wirklich auf die Seite der Finsternis (allgemeine Heiterkeit), leider auf die Seite von Trump und leider auf die Seite von ExxonMobil gestellt. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
Frau Bundesrätin Reiter, Sie haben mir nicht gut zugehört; Sie haben mir nicht ausreichend Argumente geliefert, dass ich die Grünen jetzt in dieser zweiten Runde tatsächlich loben könnte. Das tut mir aufrichtig leid. (Bundesrat Stögmüller: Wir loben Sie ja auch nicht!) Als Grüner der ersten Stunde, der sich politisch weiterentwickelt hat, hätte ich gewisse Hoffnungen in diese Richtung gehabt. (Heiterkeit bei ÖVP und SPÖ.)
Nun lassen Sie mich in aller Kürze ausführen: Bundesrat Dörfler, du hast völlig recht, die Land- und Forstwirtschaft ist nicht das Problem im Klimaschutz, sondern das Gegenteil ist der Fall. Und das ist gerade in Marrakesch sehr deutlich zum Ausdruck gekommen: Die Land- und Forstwirtschaft ist ein Teil der Lösung. Gerade die feste Biomasse muss in der Energiepolitik der Zukunft ein ganz maßgeblicher Bestandteil sein. Die feste Biomasse ist genau das, was wir in der Zukunft mehr brauchen, wenn wir die Energiewende schaffen wollen. Da brauchen wir gerade auch die feste Biomasse. Da hast du absolut recht.
Herr Bundesrat Schennach, zur Roadmap, die eingefordert worden ist: Wir haben diese auf den Weg gebracht. Gemeinsam mit Bundesminister Leichtfried, gemeinsam mit Vizekanzler Mitterlehner und Bundesminister Stöger haben wir das Grünbuch im Frühjahr aufgelegt. Wir haben damit den Prozess für die Erarbeitung einer integrierten Klima- und Energiestrategie gestartet. Es gibt noch kein anderes Mitgliedsland der EU, das da schon so weit ist. Wir haben den Bericht über die Konsultationen; es gab mehr als 10 000 Stellungnahmen. Nach der großen Enquete im Hohen Haus, die im September übrigens sehr positiv verlaufen ist, haben wir Stellungnahmen, die einzuarbeiten sind. Wir werden sie in diesen Tagen, noch vor Weihnachten, präsentieren können. Ich bin guten Mutes, dass wir im nächsten Jahr, spätestens zur Sommerpause, hier auch über die integrierte Klima- und Energiestrategie, über das konkrete Maßnahmenprogramm sprechen können.
Bundesrat Schennach, es ist richtig: Eine gewisse Sorge habe ich schon bezüglich des Winterpakets, das die Kommission jetzt vorgelegt hat. Ich glaube, da haben schon einige Kommissare sehr stark auf die fossile Lobby und vor allem – und das muss ich leider auch sagen – auf die Nuklearlobby gehört. Dass es bei den Einspeistarifen keine Vorrangigkeit bei neuen Anlagen für erneuerbare Energie mehr geben soll, ist zum Beispiel ein solches Problem, aber auch das Zurückfahren von Biotreibstoffen ist ein solcher Problembereich. Ich habe das letzte Woche beim Agrarministerrat und diese Woche beim Umweltministerrat angesprochen. Das ist kein Gegensatz – im Gegenteil, ich kann Ihnen versichern, das ist ein sehr positives Modell, dass der Landwirtschaftsminister sich mit dem Umweltminister auf kurzem Weg unterhalten kann. 14 Mitgliedstaaten der EU haben dieses Erfolgsmodell des Lebensministeriums in der Zwischenzeit auch umgesetzt.
Liebe Bundesrätin Schreyer – das tut mir jetzt wirklich leid, weil es eine Tiroler Grüne ist –, Deutschland als Musterbeispiel zu erwähnen, diesen Fehler macht schon die Vorsitzende des Umweltausschusses im Nationalrat. Bitte fangen Sie nicht auch damit an! Deutschland hat gerade die Kohleverstromung bis 2045 festgeschrieben. Und das soll jetzt unser Vorbild sein? (Bundesrätin Schreyer: Das Vorbild ist, dass etwas gemacht wird!) Also das ist wirklich fast peinlich.
Peinlich ist auch, uns dauernd Schweden als Vorbild vor die Nase zu halten. Schweden, die grün-rote Regierung in Schweden hat gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels beschlossen, fünf neue Atomkraftwerke zu bauen. Ist das unser Beispiel, das wir haben wollen? – Also ich will das nicht; und ich hoffe, viele von Ihnen auch nicht. (Beifall bei ÖVP und SPÖ sowie der Bundesräte Dörfler und Samt. – Zwischenruf des Bundesrates Stögmüller.)
Da heute wiederholt der Index von Germanwatch gebracht worden ist: Da wird ein Index verwendet, bei dem man, wenn man von einem Anteil von 75 Prozent erneuerbarer Energieträger beim Strom auf 80 Prozent geht, dann ein Plus von 7 Prozent oder 5 Prozentpunkten hat. Wenn man von einem Anteil von 1 Prozent auf 2 Prozent geht, dann hat man ein Plus von 100 Prozent – und das ist dann dieser Germanwatch-Index. Also da ist mir schon eine faire, sachliche Berichterstattung lieber als so halbseidene Germanwatch-Berichte, die wirklich gar nichts über einen Fortschritt und über eine Klimaambition aussagen. Lassen Sie sich das ins Stammbuch schreiben! (Beifall bei der ÖVP sowie des Bundesrates Todt. – Zwischenruf des Bundesrates Stögmüller.)
Das möchte ich auch einmal sagen: Wir haben ein Gutachten in Auftrag gegeben – das liegt allen Bundesländern vor –, das besagt, dass das Verbot der Ölheizungen schon jetzt möglich ist. Niederösterreich hat es umgesetzt. Das ist sehr vorbildlich, sehr positiv. Bitte machen Sie sich bei Ihren Klimaschutzreferentinnen in Salzburg und in Tirol – die sind beide Landeshauptmann-Stellvertreterinnen (Zwischenrufe der Bundesräte Schreyer und Stögmüller) – stark dafür, dass sie das auch umsetzen! Bitte, dort haben Sie
die Möglichkeit. Tun Sie das! (Rufe und Gegenrufe zwischen Bundesräten von Grünen und ÖVP.)
Das größte – auch da haben Bundesrat Dörfler und auch Bundesrat Schennach wirklich recht – E-Mobilitätspaket, das wir geschaffen haben (Bundesrat Stögmüller: Aber Oberösterreich ist ja …!), sind die großen Tunnelprojekte für die Österreichischen Bundesbahnen wie zum Beispiel der Brenner Basistunnel. Das ist das größte Umweltschutzinvestitionsprojekt. Da wird schon sehr viel in Richtung E-Mobilität getan.
Abschließend: Es ist richtig, Bundesrat Schennach hat das ebenso wie Bundesrat Köck angesprochen, wir sind in diesem Bereich wirklich Innovationsleader, beispielsweise im Bereich der Speichertechnologie. Die besten Automobilspeicher werden heute im Mühlviertel gebaut. Alle E-Mobilitätshersteller kommen ins Mühlviertel zu den Brüdern Kreisel. Das sind drei Brüder, die da weltweit führend sind. Das ist Best of Austria, genauso wie die angesprochene Firma mit innovativer Solartechnologie weltweit spitze ist. Wir sind da Best of Austria, wirklich gut unterwegs; das schafft Arbeitsplätze, das schafft grüne Arbeitsplätze. – Vielen Dank. (Beifall bei ÖVP und SPÖ sowie des Bundesrates Zelina.)
10.53
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Eingelangt sind Schreiben des Generalsekretärs für auswärtige Angelegenheiten, die dem Stenographischen Protokoll dieser Sitzung angeschlossen werden.
Die schriftlichen Mitteilungen haben folgenden Wortlaut:
Schreiben des Generalsekretärs für auswärtige Angelegenheiten gemäß Art. 50 Abs. 5 B-VG:
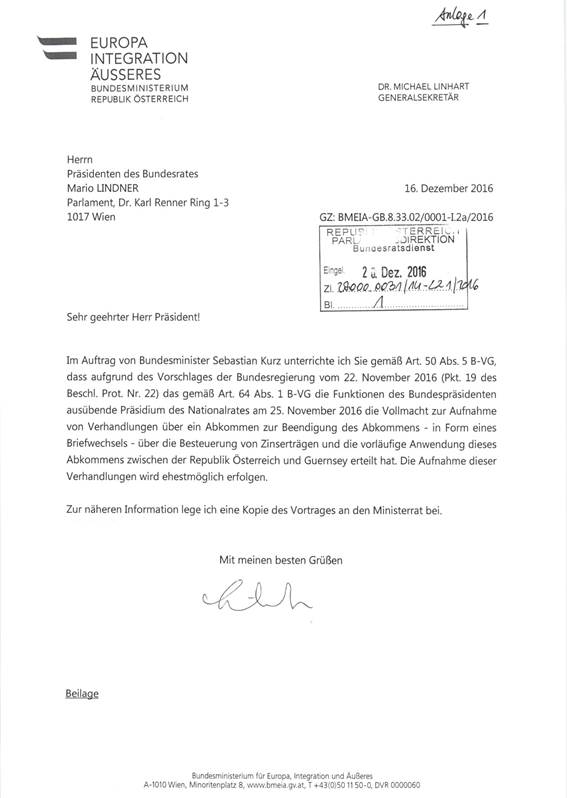
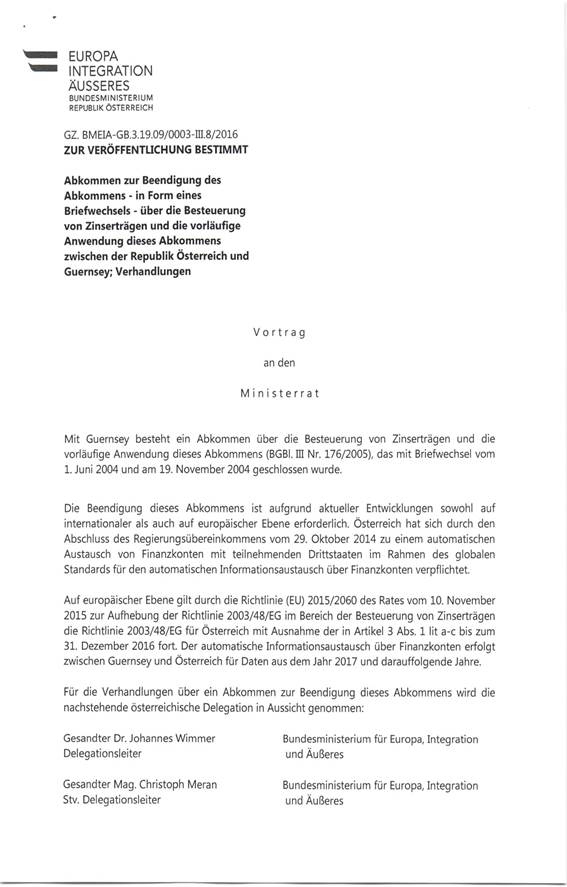
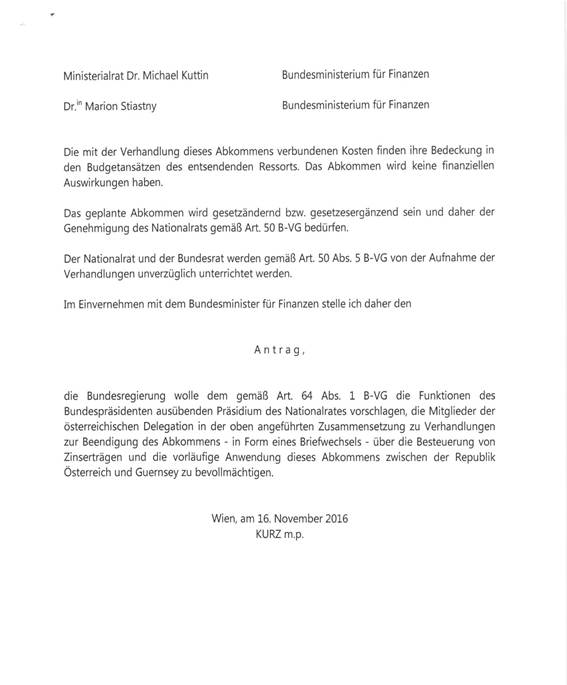
*****
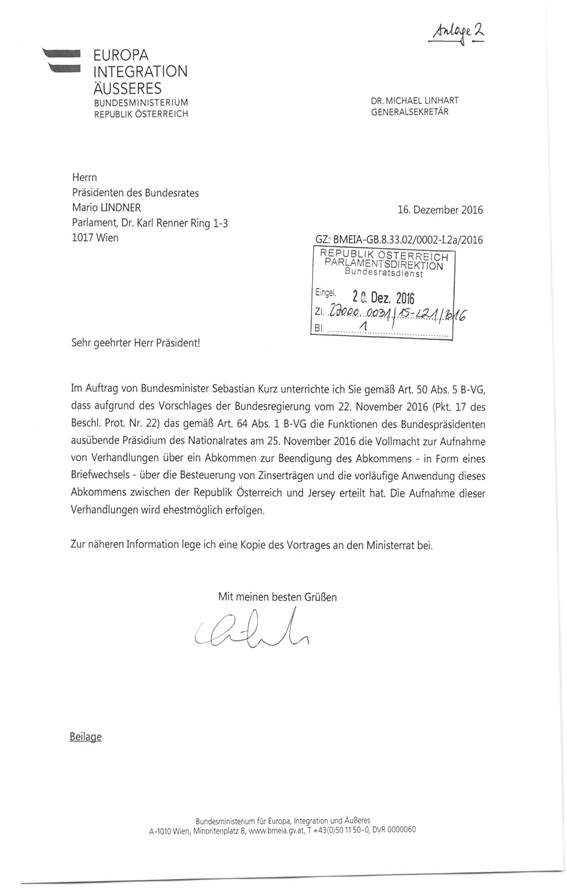
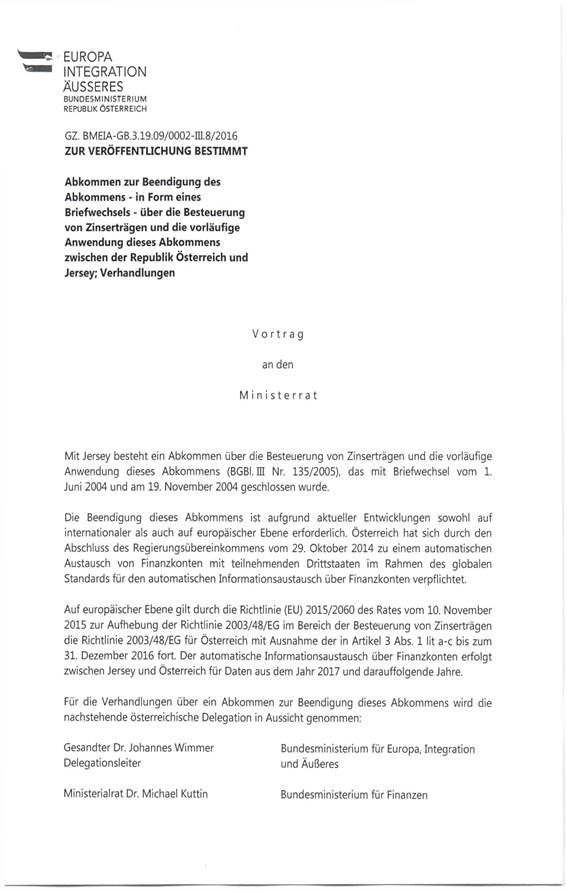
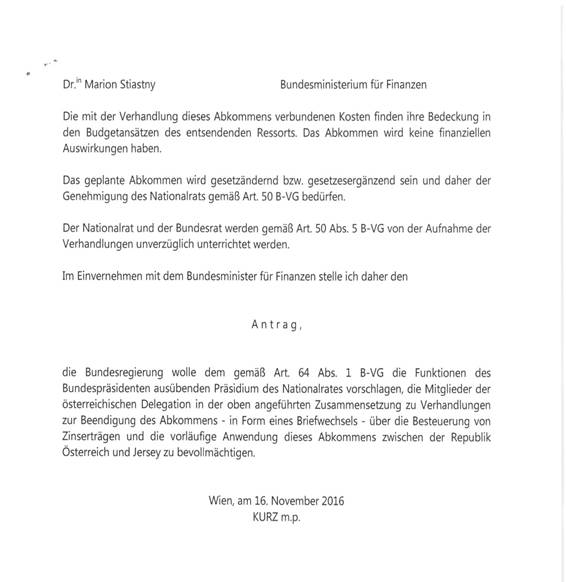
*****
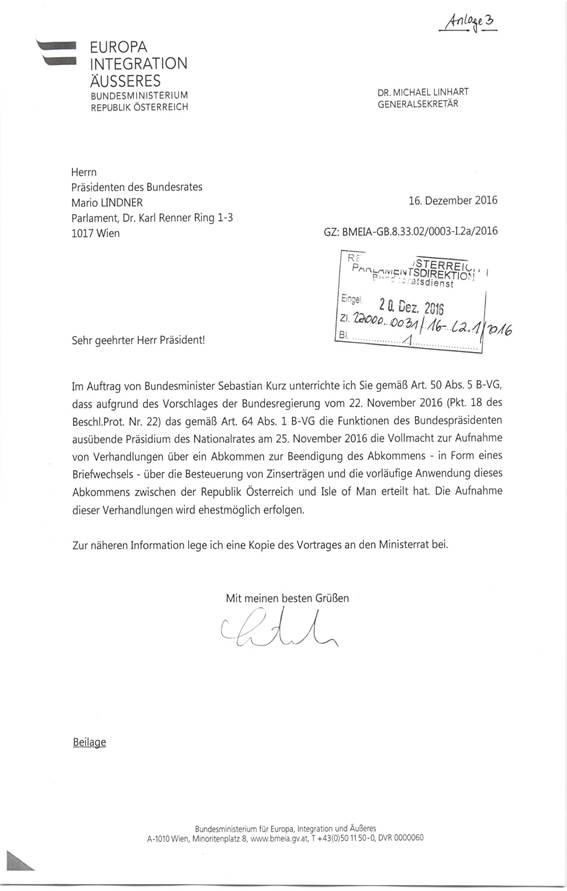
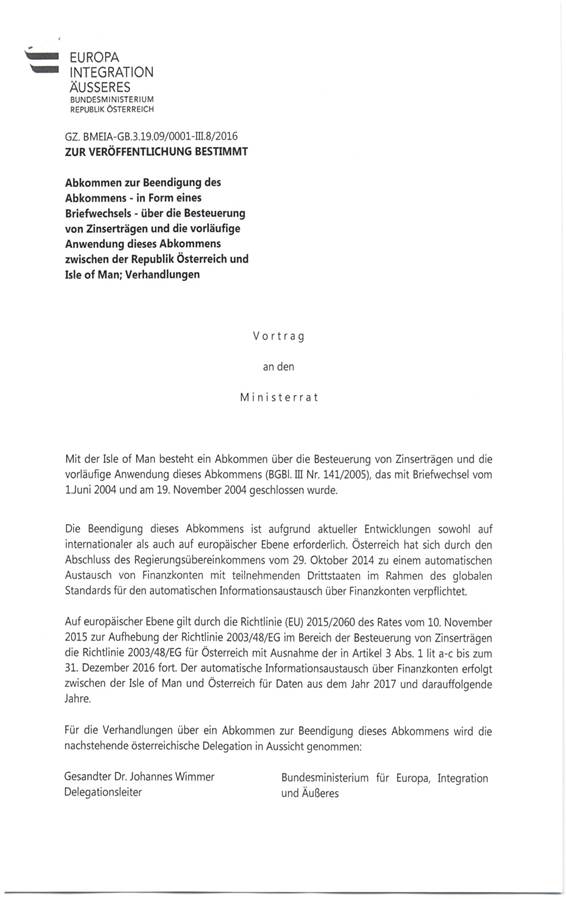
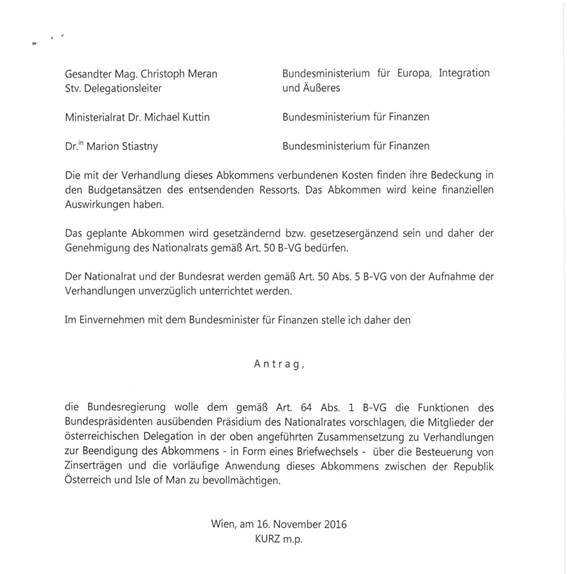
*****
Vertretung von Mitgliedern der Bundesregierung
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Eingelangt sind Schreiben des Ministerratsdienstes des Bundeskanzleramtes
betreffend den Aufenthalt des Bundesministers für Landesverteidigung und Sport Mag. Hans Peter Doskozil am 21. Dezember im Kosovo, bei gleichzeitiger Beauftragung von Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz Alois Stöger mit seiner Vertretung, sowie
betreffend den Aufenthalt der Bundesministerin für Familien und Jugend, Dr. Sophie Karmasin-Schaller, vom 20. Dezember 2016 bis 1. Jänner 2017 in Südafrika, bei gleichzeitiger Beauftragung für den Zeitraum vom 21. Dezember bis 1. Jänner 2017 von Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Dipl.-Ing. Andrä Rupprechter mit ihrer Vertretung.
*****
Eingelangt sind und den zuständigen Ausschüssen zugewiesen wurden jene Beschlüsse des Nationalrates sowie jener Bericht, die beziehungsweise der jeweils Gegenstand der heutigen Tagesordnung sind beziehungsweise ist.
Die Ausschüsse haben ihre Vorberatungen abgeschlossen und schriftliche Ausschussberichte erstattet.
Ich habe die zuvor genannten Verhandlungsgegenstände sowie die Erstattung eines Vorschlages des Bundesrates für die Ernennung eines Ersatzmitgliedes des Verfassungsgerichtshofes beziehungsweise die Wahl der beiden Vizepräsidenten, der Schriftführerinnen und Schriftführer und der Ordnerinnen und Ordner für das erste Halbjahr 2017 auf die Tagesordnung der heutigen Sitzung gestellt.
Wird zur Tagesordnung das Wort gewünscht? – Das ist nicht der Fall.
Behandlung der Tagesordnung
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Aufgrund eines mir zugekommenen Vorschlages beabsichtige ich, die Debatte über die Tagesordnungspunkte 3 bis 6, 10 bis 12, 14 bis 17 sowie 19 und 20 jeweils unter einem durchzuführen.
Erhebt sich dagegen ein Einwand? – Das ist nicht der Fall.
Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz 1997 geändert wird (1263 d.B. und 1413 d.B. sowie 9666/BR d.B. und 9716/BR d.B.)
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Wir gelangen somit zu Punkt 1 der Tagesordnung.
Berichterstatter ist Herr Bundesrat Ing. Pum. Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatter Ing. Andreas Pum: Geschätzter Herr Präsident! Herr Minister! Kolleginnen und Kollegen des Bundesrates! Ich erstatte den Bericht des Ausschusses für Land-, Forst- und Wasserwirtschaft über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz 1997 geändert wird.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor; ich komme daher sogleich zur Antragstellung.
Der Ausschuss für Land-, Forst- und Wasserwirtschaft stellt nach Beratung der Vorlage am 19. Dezember 2016 mit Stimmenmehrheit den Antrag,
1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben,
2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 44 Abs. 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Danke für den Bericht.
Wir gehen in die Debatte ein.
Als Erster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Längle. – Bitte, Herr Bundesrat.
10.56
Bundesrat Christoph Längle (FPÖ, Vorarlberg): Sehr geehrter Herr Vizepräsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Minister! Zur Debatte steht das Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz. Worum geht es dabei? – Zum einen werden wir mit dieser Gesetzesänderung eine zehnjährige Verlängerung herbeiführen, um da für die Zu-
kunft gerüstet zu sein. Und zum anderen geht es darum, dass wir sogenannte Wirtschaftslenkungen haben, die Österreich im Falle einer Krise darauf vorbereiten, bei Lebensmittelknappheit gerüstet zu sein. Ich hoffe, dass das nie der Fall sein wird, denn Krisen, die derartige Notmaßnahmen nötig machen, sind selbstverständlich nie gut; und gerade der Fall eines Krieges, einer außerordentlichen Krise wäre natürlich sehr, sehr schlecht für uns, und ich hoffe eben nicht, dass das eintritt.
Von unserer Seite, vonseiten der Freiheitlichen gibt es jetzt aber schon etwas Kritik, und zwar bezüglich der Vorgehensweise. Dazu sage ich auch, dass es nicht sein kann, dass man knapp vor Sitzungsbeginn mit den entsprechenden Anträgen daherkommt, das dann gleich beschließen lässt und wir mehr oder minder überhaupt keine Möglichkeit haben, auf dieses Gesetz einzugehen beziehungsweise dieses Gesetz einmal genau zu begutachten. Ich finde es nicht ganz in Ordnung, sich vor allem vonseiten der ÖVP-Fraktion eine Zweidrittelmehrheit zu beschaffen, ohne alle Fraktionen, die im Parlament vertreten sind, einzubinden. Das ist sicherlich auch nicht im Sinne einer Demokratie und schon gar nicht im Sinne eines ordentlichen Parlamentarismus. (Beifall bei der FPÖ.)
Bezüglich der AMA-Marketing ist hier auch einiges zu sagen, und zwar gibt es da sehr, sehr viele Vorschläge des Rechnungshofs, insgesamt 55; und diese sind überhaupt nicht angenommen beziehungsweise umgesetzt worden – Stichwort Auftragsvergaben und Intransparenz. Was mich auch besonders stört, ist, dass da das sogenannte Interpellationsrecht fehlt; und es kann eigentlich nicht so sein, dass wir als Parlamentarier nicht einmal das Recht haben, dort Anfragen zu stellen, um gewisse Informationen auch über die AMA-Marketing zu erlangen. Es wäre wünschenswert, dass das auch einmal geändert wird und dass auch dem Artikel 52 B-VG Genüge getan wird, also eben auch dieses Anfragerecht eingeräumt wird.
Eine kleine Krise hat es in den letzten Tagen schon gegeben, und zwar in meinem Heimatland Vorarlberg. Das ist als Schweineskandal in Vorarlberg auch medial recht breitgetreten worden. Was ist da passiert? – Da ist Folgendes passiert: Da wurde Fleisch verkauft, und dieses Fleisch wurde ganz klar gekennzeichnet, dass es aus Österreich kommt. Das war aber nicht richtig, sondern dieses Fleisch ist aus dem Ausland gekommen. Noch schlimmer ist, dass in der Information für den Konsumenten angegeben wurde, dass dieses Fleisch nur circa drei bis vier Stunden unterwegs war. Das hat man geprüft und dabei herausgefunden, dass das eben nicht stimmt, sondern dass dieses Fleisch rund acht bis zehn Stunden unterwegs war. Davon gibt es auch Bilder und Videoaufnahmen, die zeigen, dass diese armen Tiere mitten in der Nacht – in einer sogenannten Nacht- und Nebelaktion – von einem Lkw auf den anderen umgeladen worden sind.
Der zuständige Präsident der Landwirtschaftskammer Vorarlberg, Herr Moosbrugger, hat angekündigt, dass gesetzliche Regelungen herbeigeführt werden sollten beziehungsweise es eine klare, eindeutige Kennzeichnungspflicht geben muss. Das möchte ich unterstreichen, es kann nämlich nicht sein, dass die Konsumenten derart in die Irre geführt werden.
Jetzt sind ja Sie da, Herr Minister: Mich würde schon interessieren, welche Maßnahmen Ihr Parteikollege vorhat und wie das in Zukunft gesetzlich ausschaut. Ich hoffe selbstverständlich auch, dass es in diesem Fall, bei diesem tatsächlichen Skandal endlich zu einer lückenlosen Aufklärung kommt, denn das kann es wirklich nicht sein.
Abschließend halte ich fest, dass wir Freiheitliche dieser Gesetzesvorlage nicht zustimmen werden, insbesondere eben wegen der Vorgehensweise. Es wäre nett, wenn Sie uns da auch einmal einbinden würden, dann könnten wir vielleicht darüber reden. Vor allem wäre es auch für die Zukunft sehr sinnvoll, dass wir diese 55 Vorschläge des Rechnungshofes endlich einmal umsetzen. (Beifall bei der FPÖ.)
11.01
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Als Nächster gelangt Herr Bundesrat Preineder zu Wort. – Bitte, Herr Bundesrat.
11.01
Bundesrat Martin Preineder (ÖVP, Niederösterreich): Geschätzter Herr Vorsitzender! Herr Bundesminister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Schülerinnen und Schüler! Wir diskutieren das Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz 1997, das verlängert werden soll. Kollege Längle hat schon darauf hingewiesen, dass es dazu dient, den Herrn Bundesminister in Krisenfällen zu ermächtigen, im Bereich der Energie- und Lebensmittelversorgung lenkend einzugreifen.
Lieber Kollege Längle, du hast gemeint, eure Fraktion kann diesem Gesetz, dieser Verlängerung, und damit auch der Verlängerung der Sicherheit im Lebensmittel- und Energiebereich in Österreich, nicht zustimmen. Die Grünen haben gemeinsam mit meiner Partei und der sozialistischen Fraktion (Ruf bei der SPÖ: Sozialdemokratisch!) dazu einen Abänderungsantrag im Nationalrat eingebracht. Das ist ein ganz normales, parlamentarisches Verfahren. Wir hatten in der Ausschusssitzung hier im Bundesrat eine Diskussion darüber, da hat es von eurer Seite keine Wortmeldung gegeben. Da diese Verlängerung eigentlich mehr Demokratie, mehr Mitsprache der Fraktionen in einem Lenkungsgremium, bringt, würde ich bitten, sich zu überlegen, doch mitzustimmen. (Bundesrat Längle: Hättet ihr uns die Anträge früher gegeben!)
Geschätzte Damen und Herren, wir alle freuen uns auf die Festtage. Wir hoffen, dass wir die Feiertage mit gutem Essen in geheizten Wohnzimmern verbringen können, und darum ist es gut, dass wir in guten Zeiten an die Krisenvorsorge denken. Darum, denke ich, ist es auch gut, dass wir heute dieser Vorlage zustimmen und dieses Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz für weitere zehn Jahre verlängern, um im Krisenfall entsprechend gerüstet zu sein.
Ich kann mich noch an die Krise von Tschernobyl 1986 erinnern – ich war ein Jugendlicher –, als wir alle nicht mehr wussten, welche Lebensmittel wir essen dürfen und welche Lebensmittel verstrahlt sind. Es ist durchaus notwendig, rechtzeitig Vorsorge zu treffen. Es gilt einfach auch, eine flächendeckende Produktion der Landwirtschaft sicherzustellen, um nicht von ausländischen Märkten abhängig zu sein.
Geschätzte Damen und Herren, die Landwirtschaft zu sichern, steht hier auch im Zentrum, und damit kann man einen Bogen zum vorherigen Tagesordnungspunkt spannen, zum Ausstieg aus der fossilen Energie. Mit heimischer Produktion wird die Landschaft und damit auch der Fremdenverkehr gestärkt. Es bedeutet, dass Produkte umweltgerecht und tierschutzgerecht produziert werden. Da schwingt auch der Aspekt der Sicherheit mit, weil uns eine heimische Produktion unabhängiger von Importen, unabhängiger von ausländischen Zulieferungen macht und damit im Krisenfall Eigenständigkeit ermöglicht. Das sollten wir auch immer wieder mitschwingen lassen.
Wir sollten uns auch bewusst sein, dass dazu spezielle Maßnahmen notwendig sind. Ich verweise zum Beispiel auf die Saatgutproduktion. Ich weiß nicht, ob es allerorts bekannt ist, dass ein Großteil der Saatgutproduktion in den Händen internationaler Konzerne ist und dass es teilweise Hybridsaatgut gibt, das nicht weiterverwendet werden darf. Daher ist es auch notwendig, eine eigenständige österreichische Saatgutwirtschaft aufrechtzuerhalten.
Wenn wir den Ausstieg aus der fossilen Produktion planen und das ernst nehmen, dann hat auch da die Landwirtschaft durchaus eine wichtige Rolle im Bereich der Wärmeproduktion und der Verwendung von modernen Holzheizungen. Da ist, glaube ich, auch zu erwähnen – der Herr Bundesminister hat darauf hingewiesen –, dass wir den Bereich der Treibstoffe aus der Landwirtschaft vernachlässigen, ob das jetzt Biodiesel oder Ethanol ist. Da bestünden Chancen, für einen Teil der Energieproduktion, die wir für
den Verkehr benötigen – gerade dort gibt es die wenigsten Möglichkeiten, umzulenken –, erneuerbare Energieformen wie Biodiesel oder Bioethanol zu verwenden. Auch das ist ein Beitrag zur Ernährungssicherheit, weil die Gefäße kommunizierend sind, das heißt, es ist jederzeit möglich, Pflanzen, die wir für die Treibstoffproduktion verwenden, das nächste Mal für die Lebensmittelproduktion zu verwenden. Wichtig ist, dass die Flächen bewirtschaftet sind und dass diese Möglichkeiten geschaffen werden.
Das gilt genauso für die Stromproduktion. Ich darf hier in dieselbe Kerbe wie die Vorrednerinnen und Vorredner schlagen: Es ist einfach notwendig, das Ökostromgesetz im Bereich Biogas wieder neu zu gestalten, um den Bereich der Biogasproduktion weiter zu erhalten und nach Möglichkeit auch auszubauen, weil das eine Möglichkeit heimischer Stromversorgung ist, die man, wenn es notwendig ist, auch für den Treibstoff einsetzen kann.
Geschätzte Damen und Herren! Sicherheit zum Nulltarif wird es nicht geben, das sollte uns bewusst sein. Das müssen wir auch immer wieder den Konsumenten, den Bürgerinnen und Bürgern erklären.
Es freut mich, dass heute die Kollegen von Fair Trade draußen stehen und darauf hinweisen, dass es mehrere Zusammenhänge gibt, dass es breite Zusammenhänge gibt, wie und unter welchen sozialen und ökologischen Gesichtspunkten Lebensmittel, Nahrungsmittel und andere Produkte letztlich entstehen. Wenn wir den Gesichtspunkt der Sicherheit der heimischen Lebensmittel, der heimischen Agrarprodukte dazuhängen, dann ist das, glaube ich, wichtig und wertvoll.
Wir werden dieser Vorlage zustimmen. In diesem Sinne alles Gute! (Beifall bei ÖVP und SPÖ sowie der Bundesrätin Schreyer.)
11.07
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Ebner. – Bitte, Frau Bundesrätin.
11.07
Bundesrätin Adelheid Ebner (SPÖ, Niederösterreich): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bundesminister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Schülerinnen und Schüler! Die Nahrungsmittelversorgung und die Sicherheit dieser Nahrungsmittel ist wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen unseres Jahrhunderts. Die Verfügbarkeit der Grundnahrungsmittel aus Getreide muss gerade in Zeiten des Klimawandels für alle Menschen gewährleistet sein und bleiben. Das Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz, das heute vorliegt, soll, wie Kollege Preineder schon erwähnt hat, um zehn Jahre verlängert werden. Das ist eine Zeitspanne, wie gesagt, bis 2026, innerhalb derer wir uns auch sicher sein können, ausreichend mit guten Lebensmitteln versorgt zu werden.
Es soll auch die rechtliche Grundlage zur Setzung von Maßnahmen in den unterschiedlichsten Krisensituationen geschaffen werden. Der zuständige Bundesminister ist berechtigt, die Agrarmarkt Austria, die AMA, in der Situation einer drohenden oder bereits eingetretenen Störung mit der Behebung dieser zu beauftragen. Die Auseinandersetzung mit den Agrarmärkten, insbesondere die Erhebung, Aufarbeitung und Veröffentlichung von Daten – zum Beispiel von Mengen und Preisen –, bietet die Grundlage für den Informationsaustausch, der auch sehr wichtig ist und eine frühzeitige Krisenprävention mit dem Ziel der Ernährungssicherheit mit sich bringt.
Krisenlager können zum Beispiel ein Element der Vorsorge sein, werden aber nicht alleine die Versorgungsicherheit gewährleisten können. Kollege Preineder hat schon erwähnt, wie wichtig es ist, dass auch die heimische Landwirtschaft mit ihren Produkten gesichert wird und wir auf österreichische Produkte zurückgreifen können. Da ist jedenfalls der Konsument gefragt, nicht unbedingt immer die billigsten Produkte zu nehmen,
sondern qualitativ hochwertige Produkte zu kaufen, damit der Lebensmittelerzeuger dadurch auch sein Auskommen findet.
Ein ausreichendes Angebot erfüllt noch nicht die erstrebte Versorgungssicherheit. Die zur Verfügung stehenden Nahrungsmittel müssen unbelastet, gesund, nahrhaft und ernährungsphysiologisch angemessen sein. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Beitrag der Landwirtschaft. Herausforderungen beziehungsweise Gefahren wie Klimawandel, Energieknappheit, Rohstoffknappheit, Bodenverluste, Wasserknappheit sowie Bevölkerungsexplosion und Veränderungen der Konsumgewohnheiten sind wichtige Rahmenbedingungen.
Zur Bewältigung dieser Probleme müssen die größtmöglichen Anstrengungen unternommen werden. Der Staat muss auf jede Krisensituation vorbereitet sein, auch auf eventuelle Naturkatastrophen. Wir hören immer wieder von Naturkatastrophen im asiatischen Raum – seien es Hurrikans, Seuchen oder extreme Regenfälle. Auch in solchen Situationen muss der Staat den Menschen Sicherheit bieten können, damit sie ausreichend mit guten Lebensmitteln versorgt werden.
Lebensmittel sind die Grundlage unseres Lebens. Wir stimmen dieser Gesetzesvorlage natürlich sehr gerne zu. (Beifall bei SPÖ und ÖVP sowie der Bundesrätin Schreyer.)
11.11
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Mag. Schreyer. – Bitte, Frau Bundesrätin.
11.11
Bundesrätin Mag. Nicole Schreyer (Grüne, Tirol): Hohes Haus! Sehr geehrter Herr Minister! Sehr geehrte ZuseherInnen hier und zu Hause! Wir haben es schon von meinen VorrednerInnen gehört: Das Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz ist eine Krisengesetzgebung, die im Falle von Verknappungserscheinungen bei der Lebensmittelversorgung der österreichischen Bevölkerung – die aus Krisen resultieren und nicht mit marktwirtschaftlichen Maßnahmen behoben werden können – zum Tragen kommt, um die Bevölkerung mit Lebensmitteln zu versorgen.
Das Gesetz wird, das haben wir eh schon gehört, jetzt einfach wieder um zehn Jahre verlängert. Aus unserer Sicht gibt es aber zwei wesentliche Verbesserungen, nämlich mehr Informationen und mehr Transparenz, und das nicht nur im Krisenfall, sondern insgesamt. Der Lenkungsausschuss wird – weg von einem Krisengremium – aufgewertet. Er wird mit mehr Aufgaben betraut, nämlich mit der Beobachtung der langfristigen Entwicklung der Produktion und der Märkte und der Überwachung der Ernährungssouveränität. Es werden verschiedene Instrumentarien und Statistiken herangezogen, zum Beispiel ein jährlicher Bericht der Agrarmarkt Austria zur Markt- und Preisentwicklung. Der Grüne Bericht wird dazu verwendet, auch sonstige Markt- und Preisdaten, Erzeuger- und Produktionskosten, inklusive eben auch der biologischen Landwirtschaft und der gentechnikfreien Produktion, werden als Grundlage dazu dienen.
Was für uns auch sehr wichtig ist: Es gibt eine Aufstockung der Mitglieder im Lenkungsausschuss. Künftig werden alle im Nationalrat vertretenen Parteien im Lenkungsausschuss vertreten sein und auch in Zeiten, in denen es keine Krise gibt, das Gremium mitlenken. Daher stimmen wir hier sehr gerne zu. – Danke schön. (Beifall bei den Grünen und bei Bundesräten von ÖVP und SPÖ.)
11.13
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Als vorläufig letzter Redner zu Wort gemeldet ist Herr Bundesminister Dipl.-Ing. Rupprechter. – Bitte, Herr Minister.
11.13
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Dipl.-Ing. Andrä Rupprechter: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Hohes Haus! Ich glaube,
ich brauche die Debatte nicht zu ergänzen. Ich freue mich darüber, dass dieses Instrumentarium nicht nur verlängert wird, sondern – wie gerade auch ausgeführt wurde – in verbesserter Version verlängert wird. Es wird uns für die nächsten zehn Jahre ein Instrumentarium an die Hand gegeben, mit dem wir wirklich auch Prävention und Vorsorge im Sinne der Lebensmittelbewirtschaftung schaffen können.
Ich denke, das ist eine sehr gute Vorlage, die in der parlamentarischen Debatte im Nationalrat die notwendige Verfassungsmehrheit gefunden hat und sie auch hier im Bundesrat finden wird. Es ist damit ein Instrument geschaffen worden, das wir hoffentlich nie brauchen werden, mit dem wir für die Krise Vorsorge treffen, für einen Fall, der hoffentlich nie eintreten wird. In diesem Sinne bedanke ich mich ausdrücklich für die konstruktive Debatte.
Herr Bundesrat Längle, die von Ihnen angesprochene Thematik des AMA-Marketings wurde sehr ausführlich im Landwirtschaftsausschuss des Nationalrates diskutiert, es wurden alle Fragen von Geschäftsführer Michael Blass erschöpfend beantwortet, das ist auch gewürdigt worden, selbst in der Nationalratsdebatte.
Von den 55 Empfehlungen des Rechnungshofes betreffen drei mein Haus, diese sind umgesetzt worden, und wie gesagt, alle Fragen, die von den Oppositionsführern vorgebracht wurden, wurden zur vollen Zufriedenheit, auch der Oppositionsfraktionen, beantwortet; deswegen sind da wirklich keine Fragen offengeblieben.
Zur von Ihnen angesprochene Thematik im Ländle, was die Schweinekennzeichnung anbelangt: Da ist die Zuständigkeit bei den Veterinärbehörden, bei der Bundesministerin für Gesundheit und Frauen gelegen. Nach den Informationen, die mir vorliegen, sind alle Bestimmungen der Schweinekennzeichnung eingehalten worden. Es gibt nach meinen Informationen keine Notwendigkeit einer legislativen Änderung, und es gibt auch, soweit ich weiß, keine unrechtmäßigen Handlungsweisen, die da getätigt worden sind. – Vielen Dank. (Beifall bei ÖVP und SPÖ sowie der Bundesrätin Schreyer.)
11.15
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Dieser Beschluss des Nationalrates ist ein Fall gemäß Artikel 44 Abs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz und bedarf daher der Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder und einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen zur Erteilung der Zustimmung des Bundesrates.
Ich stelle zunächst die für die Abstimmung erforderliche Anwesenheit der Mitglieder des Bundesrates fest.
Wir gelangen zunächst zur Abstimmung, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Nunmehr lasse ich über den Antrag abstimmen, dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 44 Abs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, dem gegenständlichen Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 44 Abs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
2. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Umweltförderungsgesetz geändert und das Bundesgesetz, mit dem zusätzliche Mittel für Energieeffizienz bereitgestellt werden, aufgehoben wird (1361 d.B. und 1417 d.B. sowie 9712/BR d.B.)
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Wir gelangen nun zum 2. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatterin ist Frau Bundesrätin Ebner. Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatterin Adelheid Ebner: Herr Präsident! Herr Bundesminister! Ich bringe den Bericht über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Umweltförderungsgesetz geändert und das Bundesgesetz, mit dem zusätzliche Mittel für Energieeffizienz bereitgestellt werden, aufgehoben wird.
Der Bericht liegt in schriftlicher Form vor, ich komme daher zur Antragstellung:
Der Umweltausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 19. Dezember 2016 mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Danke für den Bericht.
Wir gehen in die Debatte ein.
Als Erster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Längle. – Bitte, Herr Bundesrat.
11.18
Bundesrat Christoph Längle (FPÖ, Vorarlberg): Herr Vizepräsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Minister! Danke für Ihre Ausführungen vorhin, es ist aber, denke ich, immer gut, wenn man nachfragt. Es geht ja doch um viele wichtige Dinge, und man sollte Rechnungshofberichte nicht schubladisieren, sondern diese auch konkret behandeln. Das haben wir auch gemacht, und wir haben darüber gesprochen, damit das nicht in Vergessenheit gerät und diese guten Vorschläge eben dann auch umgesetzt werden.
Bezüglich des Umweltförderungsgesetzes gibt es meiner Meinung nach Licht und Schatten – Licht auf jeden Fall insofern, als zusätzliche Mittel für die Energiebereitstellung, Energieeffizienz zur Verfügung gestellt werden und natürlich auch insofern, als die erneuerbare Energie in den Mittelpunkt rückt. Wir haben heute auch schon von vielen Seiten gehört, dass wir in Zukunft darauf schauen müssen, dass wir vermehrt und verstärkt erneuerbare Energien nutzen, denn, wie auch schon gesagt wurde, wir haben nur einen Planeten und diesen gilt es eben zu schützen.
Bezüglich der Vorgehensweise: Mit diesem Gesetz sind wir schon etwas spät dran, in der Debatte im Nationalrat wurde auch erwähnt, dass diese Novellierung eigentlich schon vor zwei Jahren auf den Tisch gehört hätte. Was ich persönlich als Bundesrat hier anmerken muss, ist, dass dieses Gesetz innerhalb von acht Tagen quasi durchgedrückt wurde.
Acht Tage sind, wenn man sich die Hülle und Fülle dieses Gesetzes anschaut, doch eine etwas kurze Zeit. Ich greife da die Stellungnahme des Tiroler Landtages beziehungsweise der Tiroler Landesregierung auf, die auch klar und deutlich besagt, dass eine umfassende Prüfung innerhalb von acht Tagen nicht möglich ist. Es gab aber auch eine ähnliche Stellungnahme der Wirtschaftskammer Österreich, die das ebenfalls kritisiert hat, und eben auch die Landesregierung in Vorarlberg hat das aufgegriffen und gesagt, dass acht Tage eine sehr kurze Zeit dafür sind.
Mich interessiert konkret die Schaffung einer neuen Kommission: Müssen wir da mit zusätzlichen Kosten rechnen, die auf uns zukommen, oder kann das kompensiert werden, indem bereits involvierte Personen teilnehmen und es zu keiner Kostenentwicklung von Verwaltungsseite her kommt?
Inhaltlich könnte man auch den Bereich Hochwasserschutz etwas verstärken. Wir alle wissen, in Österreich gibt es immer wieder Hochwässer, und wenn Hochwässer da sind, wird sehr vieles zerstört, und im Nachhinein ist das viel, viel teurer, als wenn man das im Vorhinein schützen würde. Vorbeugen ist besser als Heilen.
Zur Thematik sauberes Wasser: Wir alle wissen, Wasser ist das Lebenselixier schlechthin, und die vorgesehenen Gelder könnte man durchaus etwas erhöhen. Ich denke, rund 150 Millionen € für die nächsten vier Jahre wären angebracht.
Was mir auch sehr wichtig ist, ist, von freiheitlicher Seite her ganz klar zu betonen, dass wir Freiheitliche sehr für Umweltschutz, sehr für saubere Luft und auch sehr für saubere Gewässer sind. Ich meine, in Österreich will niemand, dass es schlechte Luft gibt, dass es schlechtes Wasser gibt und dergleichen. Das will sicherlich niemand, und das wollen auch wir nicht. Ich denke, wie vorhin erwähnt, dass es sehr wichtig ist, dass wir unsere Umwelt schützen.
Der Gesetzesvorlage werden wir allerdings nicht zustimmen, weil wir eben meinen, dass diese Begutachtungsfrist zu kurz war – das muss anders geregelt werden – und dass es teilweise, wie angesprochen, inhaltlich zu wenig weit geht. – Danke. (Beifall bei der FPÖ.)
11.22
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Als Nächster ist Herr Bundesrat Dr. Brunner zu Wort gemeldet. – Bitte, Herr Bundesrat.
11.22
Bundesrat Dr. Magnus Brunner, LL.M (ÖVP, Vorarlberg): Hohes Präsidium! Herr Bundesminister! Dieses Umweltförderungsgesetz bringt wichtige Neuerungen zu vier Förderschienen, um das kurz noch einmal darzulegen. Diese vier Förderschienen sind eigentlich die Grundlage für eine erfolgreiche Förderpolitik im Bereich der Klima- und Energieförderung auf der einen Seite und im Bereich der Wasserwirtschaft auf der anderen Seite.
Das ist zum Ersten die Verlängerung des Zusagerahmens für die Gewässerökologie bis 2017. Von den 140 Millionen €, die für gewässerökologische Maßnahmen bereitgestellt worden sind, wurde ein Teil nicht abgeholt, und um diesen Zusagerahmen vollständig auszuschöpfen, wird jetzt eine Verlängerung um zwei Jahre beschlossen.
Der zweite Punkt ist eine Erleichterung der Sanierungsförderung in der Siedlungswasserwirtschaft. Da gibt es immer mehr Bedarf für die Sanierung von alten Anlagen. In der Vergangenheit hat es ein fixes Datum gegeben, vor diesem Datum hat eine Anlage in Betrieb gehen müssen. Das wird jetzt flexibler gestaltet, und es wird in Zukunft auf ein Alter von mindestens 40 Jahren für solche Anlagen abgestellt.
Der dritte Punkt ist die thermische Sanierung, diese soll weiterhin ermöglicht werden. Durch diese Novelle wird eben die Fortsetzung des Förderprogramms für 2017 und 2018 ermöglicht. Insgesamt reden wir für beide Ministerien, also Lebensministerium und Wirtschaftsministerium, von gemeinsam 60 Millionen €, die vorgesehen sind.
Der vierte Punkt ist die Eingliederung des Energieeffizienzförderungsprogramms in die Umweltförderung. Das ist eher eine administrative Angelegenheit, dazu hat es bereits im Juli 2014 einen Entschließungsantrag des Nationalrates gegeben. Es ist also nicht so, dass man das von heute auf morgen einfach eingliedert, sondern das wurde eigent-
lich schon vor zwei Jahren festgelegt. Die ursprüngliche gesetzliche Regelung wird natürlich – no na – hiermit aufgehoben.
Lassen Sie mich, weil ich bei der Aktuellen Stunde nicht die Gelegenheit hatte, in diesem Zusammenhang doch noch drei Sätze zur Novellierung des Ökostromgesetzes sagen und auch appellieren: Wir brauchen diese Novellierung wirklich dringend! Und dieser Appell ergeht jetzt weniger an die Grünen, die hier konstruktiv mitarbeiten, sondern mehr an die SPÖ und an die FPÖ. Ich hatte heute bei Redebeiträgen das Gefühl, dass hier im Bundesrat der Ausbau der erneuerbaren Energie von beiden Fraktionen sehr positiv gesehen wird. Ich habe auch bei den Reden der Kollegen Lindner, Schennach und Dörfler genau zugehört, die wirklich wichtige und richtige Punkte angesprochen haben: das eigene Kraftwerk im Haus, ein ganz wichtiger Punkt, aber auch die kleinen regionalen Projekte, die Kollege Lindner angesprochen hat.
Genau diese Themen, diese Punkte wären in dieser kleinen Ökostromgesetz-Novelle drinnen, darum geht es ja. Wir reden nicht nur von Biogasrettung und solchen Dingen, die auch wichtig sind. Es geht auch um andere Punkte, um Bürgerbeteiligungsanlagen, um Fotovoltaikanlagen in großen Wohnanlagen beispielsweise, die bisher nicht möglich waren. Da geht es um andere Punkte, da geht es um Verbesserungen im Fördersystem insgesamt und nicht nur um die eine oder andere Gruppe, die hier eventuell bevorzugt werden sollte – nein, im Gegenteil!
Ich war vor Kurzem mit Kollegin Brunner von den Grünen in Bratislava bei einem parlamentarischen Treffen zum Thema erneuerbare Energien, und es war erschreckend, wie in Europa die Zugänge zu diesem Thema sind. Ich bin froh, dass wir in Österreich einen anderen Weg gehen und da Vorreiter sind. Diese Vorreiterrolle könnten wir mit dieser Ökostromgesetz-Novelle weiter fortführen. Ich appelliere also wirklich dringend, weil es sowohl in der FPÖ als auch in der SPÖ massive Stimmen dagegen und massive Vorbehalte gibt: Bitte macht euch in euren Parteien stark für so eine Novelle, wir brauchen sie dringend! – Danke. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
11.26
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Novak. – Bitte, Herr Bundesrat.
11.27
Bundesrat Günther Novak (SPÖ, Kärnten): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben schon gehört, dass mit der Novelle dieses Umweltförderungsgesetzes jetzt auch die Förderung der Energieeffizienz Bestandteil dieses Gesetzes wird. Ich denke, dass das der richtige Weg und eine Vereinfachung ist, und das ist gut so. Das ist nicht nur deshalb gut, weil Synergieeffekte genutzt werden, sondern auch, weil die Energieeffizienz ein wesentlicher Faktor im Bereich des Umweltschutzes ist. Das haben wir auch in der Aktuellen Stunde und jetzt wieder ausführlich von Dr. Magnus Brunner gehört. Das hat übrigens auch die EU-Kommission erkannt und daher das Energieeffizienzziel bis 2030 auf 30 Prozent erhöht. Dazu – das muss man auch sagen, wenn manche gegen die EU sind – werden zusätzlich 900 000 Arbeitsplätze geschaffen.
Österreich war im Bereich der Energieeffizienz schon bisher nicht tatenlos, vielmehr wurde die Energieeffizienz als ganz wichtige Zielsetzung der Umweltförderung im Inland erkannt. Ich darf in diesem Zusammenhang auf das Erfolgsmodell der thermischen Sanierung hinweisen; das wurde heute auch schon mehrmals genannt. Erfreulich ist in diesem Zusammenhang nunmehr, dass dieses Modell für zumindest zwei Jahre weiterläuft.
Schaut man sich die Energieeffizienz auf EU-Ebene und auf Ebene der Kommission an, dann wäre eigentlich darüber nachzudenken, ob diese Förderungen im Inland nicht
eine dauerhafte Einrichtung für die Zukunft sein sollten, denn das beste Energieforum ist das Energiesparen, und dabei hilft nun einmal die thermische Sanierung sehr. Wir sanieren im Jahr 60 000 Wohnungen. Im Vergleich zur BRD hat Österreich einen um ein Drittel niedrigeren CO2-Ausstoß – das wurde heute schon erwähnt. Ich denke, dass es vielleicht bei den Einfamilienhäusern Probleme geben könnte, denn wenn wir uns das Förderprogramm anschauen und die Wohnbauförderung auf Landesebene betrachten, die an sehr strenge umweltpolitische Standards gebunden ist, dann zeigt sich, dass die Sanierungen dort rückläufig sind. Wir haben außerdem noch die Wohnbauinvestitionsbank, wir haben den Sanierungsscheck; die Mittel sind – wenn ich das richtig gelesen habe – rückläufig gewesen, wobei die Mittel aber in weiterer Folge nicht ausgeschöpft wurden.
Es wird auch über die finanzielle Ausstattung der Ministerien gesprochen, und ich denke doch, dass Wirtschaftsministerium und Umweltministerium gemeinsam mit 45 Millionen € und den weiteren 100 Millionen €, die – wie der Herr Bundesminister heute schon gesagt hat – mit dem neuen Finanzrahmengesetz nach Verhandlungen mit dem Finanzministerium auf dem Weg sind, sehr gut für die Zukunft aufgestellt sind.
Ich komme noch einmal auf die Einfamilienhäuser zurück, mit denen ich begonnen habe: Mit diesen 60 Millionen €, die zur Verfügung stehen, können wir 1 000 Einfamilienhäuser fördern, und das ist auch gut so. Angesichts dessen, dass sich die erdölexportierenden Länder wieder gefunden haben, der Ölpreis wieder steigt, insofern die Förderquote gesenkt wird und dadurch die Energiekosten steigen, gehen diese Anreize genau in die richtige Richtung.
Im Zusammenhang mit dieser Novelle des Umweltförderungsgesetzes ausdrücklich zu begrüßen – das hat Dr. Brunner auch schon gesagt – sind die Maßnahmen zur Erneuerung beziehungsweise Sanierung der Wasserversorgungsanlagen, der Abwasserentsorgungsanlagen, der Schlammbehandlungsanlagen, und zwar jener, deren Baubeginn vor 40 Jahren war. Damals hat es noch keine Förderung dafür gegeben, und erst jetzt hat es die Siedlungswasserwirtschaft erfreulicherweise geschafft, dass das in Zukunft anders sein wird. Das Ganze muss man als Erfolgsprojekt betrachten, denn seit 1959 wurden dort 58 Milliarden € investiert.
Jetzt sagt aber eine Studie, dass in Zukunft von uns Gemeinden 5 Milliarden € im Bereich der Trinkwasseranlagen und 9 Milliarden € im Bereich der Abwasseranlagen bis 2021 investiert werden müssen, also insgesamt 14 Milliarden €. Jeder weiß – ich komme aus dem Mölltal, das von der Abwanderung der Bevölkerung sehr hart betroffen ist –, bei uns in Kärnten müssen letztendlich die Gemeinden und die Kommunen das alles bereitstellen und finanzieren und sind natürlich auf die Unterstützung des Bundes angewiesen, keine Frage. Was passiert, ist, dass wir bei den Sitzungen – leider Gottes immer zu Weihnachten – die Gebühren erhöhen müssen – wie auch bei uns –, und das kommt bei den Menschen nicht gut an, denn die wenigen Menschen, die noch auf dem Land leben, müssen diesen Kanal – das sage ich jetzt einmal unter Anführungszeichen – „bezahlen“.
Ich möchte deswegen als Bürgermeister einer Nationalparkgemeinde etwas aufgreifen, das Sie, Herr Bundesminister, gesagt haben, nämlich dass es möglich wäre, auch Ministerien oder Teilbereiche von Ministerien auf das Land abzusiedeln. Wir haben bei uns – jetzt nenne ich speziell unsere Gemeinde – ein Nationalparkzentrum, in dem zwei Drittel des Hauses leer stehen, und eine kleine Abteilung des Umweltministeriums unterzubringen würden wir schon schaffen. Vielleicht sollten wir einmal darüber nachdenken, ob wirklich alles in Wien oder in den Landeshauptstädten angesiedelt sein muss. – So viel zum Thema ländlicher Raum; eine Schnellzugstation hätten wir auch noch dazu.
Es ist schade, Kollege Längle, dass die Freiheitlichen wegen der acht Tage Begutachtungsfrist nicht mitstimmen; Sie stimmen nur deswegen nicht mit, weil das Gesetz als
solches in der Administration nicht so gemacht wurde, wie Sie sich das vorstellen; der Inhalt ist aber vorhanden. Schlussendlich werden Sie, die Freiheitlichen, als diejenigen übrig bleiben, die gegen die Umweltförderung, gegen die Klimaschutzpolitik und gegen ein lebenswertes Österreich gestimmt haben. (Beifall bei der SPÖ und bei Bundesräten von ÖVP und Grünen.)
11.34
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Mag. Schreyer. – Bitte, Frau Bundesrätin.
11.34
Bundesrätin Mag. Nicole Schreyer (Grüne, Tirol): Hohes Haus! Sehr geehrter Herr Minister! Sehr geehrte ZuseherInnen hier und zu Hause! Eingangs nur ganz kurz: Wir teilen die Kritik der Freiheitlichen an der kurzen Begutachtungsfrist – das sollte die Ausnahme sein, auf keinen Fall zur Regel werden –, aber wir werden zustimmen, weil wir die Inhalte gut finden, wenn auch nicht weitreichend genug. Es ist schon noch genug Luft nach oben, aber es geht in die richtige Richtung, und von daher stimmen wir sehr gern zu.
Wir haben es von den Vorrednern schon gehört: Die vorliegende Regierungsvorlage enthält im Wesentlichen vier Punkte. Es sind Maßnahmen aus dem Energieeffizienzgesetz, es ist die Verlängerung der gesetzlichen Grundlage für die thermische Sanierungsoffensive bis ins Jahr 2018. Es wird aber eben nicht die Höhe der Mittel preisgegeben, sondern es ist nur eine formale Anpassung, dass es auch im kommenden Jahr generell Maßnahmen zur thermischen Sanierung geben kann. Bei der Höhe, wie viel das im Endeffekt dann werden wird, sind wir uns selbst noch nicht ganz sicher.
Der dritte Punkt sind kleine Anpassungen in der Siedlungswasserwirtschaft, und der vierte Punkt, auf den ich hauptsächlich eingehen möchte, sind Maßnahmen zur Verbesserung des ökologischen Zustands der Gewässer in Österreich im Zuge der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Ziel dabei ist es, die Gewässer in Teilschritten – bis 2015, 2021, 2027 – dem guten oder sehr guten Zustand beziehungsweise dem guten oder sehr guten Potenzial zuzuführen. Für die Verbesserung des ökologischen Zustands der Gewässer im Rahmen der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie sind von 2007 bis 2015 insgesamt 140 Millionen € an Fördermitteln bereitgestellt worden.
Für 2016 hat es vom Bund keine Fördermittel gegeben, und auch für den Rest der zweiten Planungsperiode bis 2021 gibt es bis dato noch nichts. Wie die Maßnahmen zur Verbesserung der hydromorphologischen Situation der Fließgewässer bis 2021 beziehungsweise dann bis 2027 finanziert werden sollen, ist also noch völlig ungeklärt. Im Rahmen des Umweltförderungsgesetzes beschließen wir hier, wie Kollege Brunner bereits erklärt hat, dass die liegen gebliebenen Mittel der ersten Förderperiode komplett ausgeschöpft werden sollen, und das sollen sie natürlich auch. Ich glaube, das sind wahrscheinlich 2 bis 4 Millionen €, die von den 140 Millionen € übrig geblieben sind. Angesichts der Herausforderungen, die noch vor uns liegen, ist das nicht einmal ein Tropfen auf den heißen Stein.
Im Entwurf des Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplans sind die derzeitigen Fakten und die Aufschlüsselung der Evaluierung, was sich von 2009 bis 2015 getan hat, enthalten, und da ist enorm viel Aufholbedarf gegeben. Nur 39,5 Prozent, also nicht einmal 40 Prozent der Fließgewässer in Österreich sind in gutem oder sehr gutem ökologischen Zustand.
Wir werden, wie gesagt, zustimmen, damit die Ausschöpfung der Mittel, die übrig geblieben sind, möglich wird, aber es ist einfach wirklich dringend notwendig, die Mittel auch fortzuschreiben. Wir haben im Nationalrat dazu einen Antrag eingebracht, der leider abgelehnt worden ist. Ich möchte daher dringend an Sie appellieren, da etwas zu
tun, und Sie wissen ganz genau, da braucht es etwas, das passiert nicht von alleine. Das ist einfach irrsinnig wichtig, nicht nur mir.
Ich bin Gewässerbiologin, mir ist der ökologische Zustand wirklich sehr wichtig, mir ist es wichtig, dass unsere Flüsse und Bäche nicht komplett verbaut sind, dass sie nicht als begradigter Schlauch durch die Landschaft schneiden, aber – und da sind wir wieder beim Klimathema – ich sage jedem, dem der ökologische Zustand prinzipiell eher egal ist: Die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie vor allem in der Hydromorphologie – die Hydromorphologie ist alles, was Begradigungen, Verbauung, Querbauwerke betrifft – ist ein riesiger Faktor im Hochwasserschutz, und genau diesen ökologischen Hochwasserschutz brauchen wir dringend, um eben Klimawandelfolgen abzufedern. Die Hochwässer in den letzten Jahren haben uns schon einen kleinen Vorgeschmack darauf geboten, was da auf uns zukommen wird.
Es ist eine Win-win-Situation im Interesse von Mensch und Natur, wir werden da sehr gern zustimmen. Abschließend möchte ich ganz kurz noch einmal für mehr Mittel plädieren. – Danke schön. (Beifall bei Grünen, ÖVP und SPÖ.)
11.38
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Heger. – Bitte, Herr Bundesrat.
11.38
Bundesrat Peter Heger (SPÖ, Burgenland): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Minister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat! Werte Zuseher! Die Änderung des Umweltförderungsgesetzes und die Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln für Energieeffizienz – so kurz und so prägnant liest sich dieser Tagesordnungspunkt; dahinter steht aber sehr viel.
Das oberste Ziel dieser Gesetzesänderung ist es, Synergien zu nutzen. Ich weiß, Sie alle, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wissen, dass Energie und Umwelt in einem direkten, in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen. Damit wird aber auch deutlich, dass beide Begriffe im selben Atemzug zu nennen sind, es sind absolut gleichberechtigte Begriffe. Deshalb sehe ich es auch als überaus positiv an, dass die Energieeffizienzförderung in den Bereich des Umweltförderungsgesetzes aufgenommen wurde.
Mir ist aber auch vollkommen klar, dass es immer wieder Kritikpunkte geben wird – das hat sich ja auch im Ausschuss und bei den Vorrednern gezeigt –, insbesondere was das Thema der Begutachtungsfrist und deren Länge, aber auch was einzelne inhaltliche Punkte der vorliegenden Gesetzesänderungen betrifft.
Ich nehme für meine Fraktion zur Kenntnis, dass die Begutachtungsfrist eine kurze war. Wir begrüßen diese Gesetzesänderung aber dennoch ausdrücklich, weil sie Verbesserungen im Bereich der Umweltförderungen im Inland mit sich bringen wird. Es ist wichtig, dieser Gesetzesänderung im Sinne eines ressourcenschonenden und energieeffizienten Arbeitens eine möglichst breite Zustimmung zu erteilen. Es wird damit nämlich weiterhin möglich sein, innovative Projekte zu fördern – innovative Projekte, die uns Schritt für Schritt weg von der fossilen Energie hin zur erneuerbaren Energie führen; und jeder Schritt, auch wenn er noch so klein ist, ist ein wichtiger und ein wertvoller.
Eines ist aber auch klar: Es liegt an uns selbst, ressourcenschonend mit Energie umzugehen. Es sind immer die kleinen Dinge des Lebens, die in der Summe eine große Auswirkung haben, denn eigentlich ist die beste und billigste Energie die, die man gar nicht erst verbraucht. Die heutige Gesetzesänderung ist für mich deshalb auch ein Zeichen von großem Weitblick, damit auch die nächsten Generationen eine realistischere Aussicht auf eine lebenswerte Umwelt vorfinden. Daran sollten wir auch beim Abstimmen denken.
Meine Fraktion wird der Änderung des Umweltförderungsgesetzes zustimmen, denn wir beschließen heute auch, dass die Umweltförderung in verschiedensten Bereichen erhöht wird. Es betrifft dies etwa die Bereiche der thermischen Sanierung und der Siedlungswasserwirtschaft. Ich möchte speziell den Bereich der Siedlungswasserwirtschaft ansprechen, weil dies ein Erfolgsprojekt seit 1959 ist, in das bereits 58 Milliarden € investiert wurden, um die Bevölkerung mit Trinkwasser zu versorgen und die Abwässer entsprechend entsorgen zu können.
Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung haben einen großen Gesamtinvestitionsbedarf. Im Bereich der Abwasserbeseitigung werden es bis 2021 – das haben wir schon gehört – rund 9 Milliarden € sein, die die Gemeinden werden aufbringen müssen, damit sie auch die derzeit gegebenen hohen Versorgungsstandards gewährleisten können. Als Obmann eines Abwasserverbands möchte ich auch festhalten, dass es immer, auch wenn es um Verbandsstrukturen geht, die Gemeinden sind, die für die Infrastruktur in den Gemeinden zuständig und verantwortlich sind und daher auch immer als Kommune die finanzielle Last zu tragen haben.
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte zum Schluss noch auf einen Punkt hinweisen, mit dem wir uns in den nächsten Jahren ebenfalls beschäftigen werden: Es geht nicht nur um die Fördermittel für die Kommunen, denn wenn die Fördermittel nicht ausgezahlt werden, müssen die Bürger dementsprechend mit Gebühren belastet werden, sondern es geht auch um die ländliche Entwicklung und um die Aufrechterhaltung der Infrastruktur, da es noch immer Gemeinden mit Abwanderungstendenzen gibt. Darüber hinaus wird uns in den nächsten Jahren auch noch die Verordnung zur EU-Wasserrahmenrichtlinie beschäftigen, und sie wird uns anhalten, Umweltförderungen entsprechend zu adaptieren.
Sehr geehrte Damen und Herren! Stimmen Sie heute für eine Verbesserung der Umweltförderung, stimmen Sie für eine Verbesserung im Bereich der Klimaschutzpolitik, und stimmen Sie damit für lebenswerte Gemeinden in Österreich! – Danke. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.)
11.44
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Nun gelangt Herr Bundesminister Dipl.-Ing. Rupprechter zu Wort. – Bitte.
11.44
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Dipl.-Ing. Andrä Rupprechter: Sehr geehrter Herr Präsident! Hoher Bundesrat! Ich darf beim Vorredner anknüpfen: Ich freue mich, dass der Begriff des lebenswerten Österreich heute sehr oft benutzt wurde, vor allem auch vom Koalitionspartner sehr intensiv benutzt wurde. Auch das Schlusswort, das wir jetzt soeben gehört haben, war wirklich ein sehr gutes. Vielen herzlichen Dank! Sie haben mir, Herr Bundesrat Heger, da wirklich aus dem Herzen gesprochen.
Die beste Energie – das ist ein Zitat von Ihnen, Herr Bundesrat Heger – ist die, die wir nicht verbrauchen. Ich möchte das noch ergänzen: und die, die wir selber produzieren, und vor allem die, die wir effizient nützen und einsetzen. Wenn wir jährlich immer noch um 12 Milliarden € Energie vor allem aus fossilen Energieträgern zukaufen müssen, diese Energie aber selbst erzeugen könnten, dann ist klar, in welche Richtung wir gehen müssen. Es sind die beiden Bundesländer Niederösterreich und das Burgenland, die uns als Best-Practice-Modelle vorzeigen, in welche Richtung es gehen muss. Ich denke, daran können wir uns wirklich orientieren.
Sie haben, Herr Bundesrat Heger, auch richtig gesagt, dass es sehr oft die Gemeinden sind, die im Bereich des Klimaschutzes und der Umweltförderung Vorreiter sind und wirklich sehr viel weitergebracht haben.
Zur Regierungsvorlage brauche ich nichts mehr ergänzend zu sagen, denn es wurde in der Debatte sehr gut dargestellt, worum es dabei geht, nämlich darum, die Grundlage für die Klimaschutzoffensive der Bundesregierung, die ich schon in der Debatte im Rahmen der Aktuellen Stunde angesprochen habe, zu schaffen
Frau Bundesrätin Schreyer, Sie verlangen mehr Mittel. – Selbstverständlich brauchen wir mehr Mittel im Rahmen der Gewässerökologie. Wir schaffen jetzt den Zusagerahmen, die Verlängerung, und auch die Voraussetzung dafür, dass bereits am Beginn der Periode Mittel zur Verfügung stehen. Wir sind in dieser Sache in sehr guten Verhandlungen mit dem Finanzminister, wobei es auch darum geht, durch Rücklagenauflösung tatsächlich mehr Mittel in diesem Bereich einsetzen zu können.
Wenn Sie sich den Bundesvoranschlag und den Budgeterfolg der letzten drei Jahre anschauen, werden Sie sehen, dass wir beim Erfolg in der Umweltförderung im Inland immer deutlich über dem Haushaltsvoranschlag gelegen sind.
Herr Bundesrat Novak, Sie haben völlig richtig gesagt, dass der Ölpreis – das haben noch nicht viele bemerkt – in diesem Jahr um fast 50 Prozent angestiegen ist. Er wird wahrscheinlich bis zum Jahresende über 60 US-Dollar pro Barrel liegen. Ich glaube, das betrifft die Marke Brent, die auch die Leitmarke ist. Wir werden wieder mit steigenden Ölpreisen konfrontiert sein, und deswegen macht es auch Sinn, in die erneuerbaren Energien zu investieren.
Ich glaube, es wurden jetzt von mir alle Themen angesprochen. Ich bedanke mich noch für die große Mehrheit, die diese Regierungsvorlage gefunden hat, und freue mich über die breite Unterstützung hier in dieser Kammer.
Lassen Sie mich zum Abschluss, weil dies vor Weihnachten mein letztes Treffen mit Ihnen hier im Bundesrat sein wird, Ihnen ganz herzlich eine frohe Weihnacht wünschen, auch Zeit für Besinnlichkeit, Ruhe und Einkehr. Ich wünsche Ihnen beste Gesundheit und viel Erfolg im neuen Jahr – dann unter Tiroler Vorsitz; auch darauf freue ich mich aus besonderen Gründen. – Vielen herzlichen Dank und alles Gute! (Allgemeiner Beifall.)
11.47
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir kommen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Ich darf die Weihnachtswünsche erwidern, darf auch Ihnen, Herr Minister, alles Gute wünschen, eine friedvolle Zeit und einen guten Start ins neue Jahr.
Gleichzeitig darf ich unsere Frau Bundesministerin für Gesundheit und Frauen Dr. Oberhauser sehr herzlich in unserer Mitte begrüßen. Ich danke für Ihr Kommen, Frau Minister. (Allgemeiner Beifall.)
Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG Zielsteuerung-Gesundheit (1339 d.B. und 1371 d.B. sowie 9702/BR d.B.)
4. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens (1340 d.B. und 1372 d.B. sowie 9703/BR d.B.)
5. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz zur partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit (Gesundheits-Zielsteuerungsgesetz – G-ZG) erlassen wird sowie das Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, das Ärztegesetz 1998, das Bundesgesetz über die Gesundheit Österreich GmbH und das Bundesgesetz über die Dokumentation im Gesundheitswesen geändert werden (Vereinbarungsumsetzungsgesetz 2017 – VUG 2017) (1333 d.B. und 1373 d.B. sowie 9665/BR d.B. und 9704/BR d.B.)
6. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Ärztegesetz 1998 geändert wird (1357 d.B. und 1377 d.B. sowie 9705/BR d.B.)
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Wir gelangen nun zu den Punkten 3 bis 6 der Tagesordnung, über welche die Debatte unter einem durchgeführt wird.
Berichterstatterin zu den Punkten 3 und 4 ist Frau Bundesrätin Posch-Gruska. Ich bitte um die Berichterstattung.
Berichterstatterin Inge Posch-Gruska: Ich erstatte den Bericht des Gesundheitsausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG Zielsteuerung-Gesundheit.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher sogleich zur Antragstellung:
Der Gesundheitsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 19. Dezember 2016 mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Ich erstatte des Weiteren den Bericht des Gesundheitsausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens.
Auch dieser Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher sogleich zur Antragstellung:
Der Gesundheitsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 19. Dezember 2016 mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Berichterstatterin zu den Punkten 5 und 6 ist Frau Bundesrätin Ebner. Ich bitte um die beiden Berichte.
Berichterstatterin Adelheid Ebner: Herr Präsident! Frau Bundesministerin! Ich erstatte den Bericht über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betref-
fend ein Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz zur partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit (Gesundheits-Zielsteuerungsgesetz – G-ZG) erlassen wird sowie das Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, das Ärztegesetz 1998, das Bundesgesetz über die Gesundheit Österreich GmbH und das Bundesgesetz über die Dokumentation im Gesundheitswesen geändert werden (Vereinbarungsumsetzungsgesetz 2017 – VUG 2017)
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher sogleich zur Antragsstellung:
Der Gesundheitsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 19. Dezember 2016 mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Des Weiteren erstatte ich den Bericht über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Ärztegesetz 1998 geändert wird.
Dieser Bericht liegt Ihnen ebenfalls in schriftlicher Form vor, ich komme daher sogleich zur Antragsstellung.
Der Gesundheitsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 19. Dezember 2016 mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Ich danke für die Berichterstattung.
Wir gehen in die Debatte ein.
Als Erster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Krusche. – Bitte, Herr Bundesrat.
11.52
Bundesrat Gerd Krusche (FPÖ, Steiermark): Hohes Präsidium! Sehr geehrte Frau Gesundheitsminister! Es freut mich besonders, Sie heute hier persönlich begrüßen zu dürfen. Ich darf Ihnen für Ihre persönliche Gesundheit das Beste wünschen. (Allgemeiner Beifall. – Bundesministerin Oberhauser: Danke schön!)
Meine Damen und Herren! Wir von der freiheitlichen Fraktion werden den vorliegenden Gesetzentwürfen nicht zustimmen. Ich werde mich in meinem Redebeitrag nun auf zwei wesentliche Kritikpunkte, die wir in Zusammenhang damit anzubringen haben, konzentrieren.
Es ist die Verknüpfung der Gesundheitskosten mit dem BIP-Wachstum für uns Freiheitliche nicht nachvollziehbar, denn die Gesundheitskosten orientieren sich an anderen Faktoren, beispielsweise an der demografischen Entwicklung, aber auch an der Wissenschaft, an der Medizintechnik – wenn man nur bedenkt, dass eine Strahlentherapiestation heutzutage so viel kostet wie vor einigen Jahren noch ein ganzes Krankenhaus – und vor allem an den Notwendigkeiten der Bevölkerung und an den Bedürfnissen der Patienten – aber nicht am Wirtschaftswachstum! Aus diesen Gründen ist das für uns nicht nachvollziehbar.
Ein weiterer, ganz wesentlicher Kritikpunkt von uns Freiheitlichen betrifft die Primärversorgungszentren, die ja aufs Erste ganz gut klingen, wenn man sich anhört, welche Vorteile sie bieten sollen: eine bessere interdisziplinäre Betreuung der Patienten, längere und benutzerfreundlichere Öffnungszeiten, attraktivere Arbeitszeiten für die dort beschäftigten Ärzte. (Bundesrat Mayer: Das ist die Zukunft!) Wir von der FPÖ machen uns aber Sorgen um den niedergelassenen Bereich, dass diesem dadurch Nachteile er-
wachsen werden – entgegen den ständigen Beteuerungen, dass dieser nicht geschwächt werden soll.
Wo liegen aber die aktuellen Probleme, die in der Gesundheitsversorgung im niedergelassenen Bereich bestehen? – Schon jetzt können viele Planstellen – vor allem in ländlichen Raum – nicht mehr nachbesetzt werden, weil man keine Ärzte findet, die diese Aufgabe übernehmen. Auf der anderen Seite haben wir mit überfüllten Ambulanzen zu kämpfen. (Bundesrat Stögmüller: Das widerspricht sich …!) Mediziner flüchten ins Ausland, denn wir haben in Österreich unattraktive Kassenverträge – vieles ist eine Folge der unattraktiven Kassenverträge –, außerdem sind die Ärzte mit einer überbordenden Bürokratie konfrontiert. Und zu allem Überfluss werden sie noch dem generellen Missbrauchsverdacht ausgesetzt und mit Mystery Shoppern konfrontiert, um vermeintliche Verdachtsmomente nachweisen zu können.
Worin liegen unsere Bedenken an diesen Primärversorgungszentren? – Erstens stellen sie keine Lösung für die Probleme im ländlichen Raum dar, denn sie werden hauptsächlich in Ballungsräumen angesiedelt werden (Bundesrat Mayer: Nein!), und damit werden die Wege für die Patienten dann wieder länger statt kürzer. Außerdem wird die freie Arztwahl dadurch untergraben, denn im Primärversorgungszentrum steht halt jener Arzt zur Verfügung, der gerade Dienst hat, und damit wird es unmöglich sein, die so wichtige Vertrauensbeziehung zwischen dem Arzt und dem Patienten aufzubauen; und wir wissen ja, dass der Hausarzt seinen Patienten am besten kennt.
Die Frage ist auch: Wer wird denn diese Primärversorgungszentren betreiben? – Wahrscheinlich einerseits die Sozialversicherungsträger und andererseits private und gewinnorientierte Unternehmen; und wenn der Arzt Angestellter ist, der in einem solchen Zentrum eigentlich keine Karrieremöglichkeiten vorfindet, der ein fixes Gehalt bezieht, dann wird seine Motivation nicht gerade die beste sein. (Bundesministerin Oberhauser: So wie in Spitälern! Ist die Motivation der Spitalsärzte schlecht?)
Dieses ganze Modell erinnert halt fatal an die alten DDR-Zeiten. Dort hat das Ganze Poliklinik geheißen. Die Polikliniken haben genau diese Merkmale gehabt, nämlich: Die Ärzte waren staatliche Angestellte, und unterstützt wurden sie von Krankenschwestern und Hilfspersonal. Die Polikliniken waren Ausdruck des Zentralismus im DDR-Gesundheitssystem. Als Folge davon hat die Zahl der niedergelassenen Ärzte in der DDR ständig abgenommen. (Bundesministerin Oberhauser: Absurd!) Sie waren nicht Bindeglied zwischen Hausarzt und Klinik, sondern Ersatz des Hausarztes.
Diese Politik hat ja bereits vor Jahren eine Ihrer Vorgängerinnen in Deutschland, und zwar Ulla Schmidt, vehement gefordert: eine Rückwendung beziehungsweise eine Rückkehr in DDR-Zeiten. (Bundesrat Mayer: Geh, hör auf!) Ich will Ihnen jetzt ersparen, sich Erfahrungsberichte aus solchen Polikliniken anhören zu müssen. (Bundesrat Mayer: Bitte!) Dass aber die Stoßrichtung, vor allem bei der SPÖ, in diese Richtung geht, erscheint klar. Nicht umsonst hat der gesundheitspolitische Sprecher der SPÖ bereits gefordert, die Wahlärzte überhaupt einzusparen. (Bundesrat Todt: Wir reden über ein modernes Gesundheitssystem, aber nicht …!) Und das Ganze läuft natürlich unter dem Motto: Kostendämpfungspfad – sprich: Sparmaßnahmen.
Wir von der FPÖ haben andere Rezepte, und die Umsetzung dieser Rezepte gibt es auch schon. (Bundesrat Mayer: Russische Rezepte!) Das sind die Gruppenpraxen, die vor allem in Ballungsräumen – in Wien gibt es bereits 103 solche Praxen – erfolgreich arbeiten, und das ist sehr wohl etwas anderes als Primärversorgungszentren. Polikliniken oder Primärversorgungszentren sind nicht das Gleiche wie Gruppenpraxen (Bundesministerin Oberhauser: Man kann eine PHC als Gruppenpraxis machen!), denn in einer Gruppenpraxis hat man eine individuelle Arzt-Patienten-Beziehung. Diese wird dort nicht durch ein Angestelltenverhältnis verunmöglicht, und außerdem bergen gerade diese Pri-
märversorgungszentren zusätzlich noch das Gefahrenpotenzial einer erhöhten Personalfluktuation. (Vizepräsidentin Winkler übernimmt den Vorsitz.)
Für den ländlichen Raum gibt es ja auch bereits in der Steiermark das Erfolgsmodell styriamed.net, bei dem sich in den Regionen die Ärzte sehr gut miteinander vernetzt haben, Synergien nützen und zu einer verbesserten strukturellen Versorgung beitragen (Bundesrat Mayer: Genau das ist es!), und das ist eben genau nicht dasselbe. (Zwischenruf des Bundesrates Mayer.)
Und ich muss schon sagen: Wir befinden uns hinsichtlich der Kritik ja nicht, wie gesagt wird, in Gesellschaft von irgendwelchen Ewiggestrigen, sondern in diesem Falle teilen wir die Ansicht der Ärztekammer (Bundesministerin Oberhauser: Die wird auch ewiggestrig sein!), die sich da zu Recht Sorgen macht. Wir fordern deshalb eine Attraktivierung des niedergelassenen Bereichs durch attraktivere Kassenverträge, entsprechende Förderungen (Zwischenruf des Bundesrates Stögmüller) von Gruppenpraxen und Vernetzungen. Das wäre das Zukunftsmodell, und nicht die Polikliniken nach DDR-Vorbild. (Beifall bei der FPÖ.)
12.01
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Mag. Gruber-Pruner. – Bitte, Frau Kollegin.
12.01
Bundesrätin Mag. Daniela Gruber-Pruner (SPÖ, Wien): Hohes Präsidium! Liebe Frau Ministerin! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren vor den Bildschirmen! Mein Vorredner Bundesrat Krusche hat ja die Vorteile der neuen Maßnahmen sehr gut benannt, nur leider reicht das offensichtlich nicht, um die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und die richtigen Maßnahmen gutzuheißen. Darum möchte ich jetzt noch einmal versuchen, die vorgeschlagenen Maßnahmen in diesen vier Vereinbarungen und Vorlagen, die zur Debatte stehen, zu begründen.
Den ersten Fokus möchte ich auf die Patientinnen und Patienten legen, um die es dabei ja im Kern gehen soll. Patientinnen und Patienten müssen nämlich immer im Fokus von Gesundheitsmaßnahmen und Veränderungen im Gesundheitssystem stehen. Was will ein kranker Mensch? – Ein kranker Mensch will zuerst einmal natürlich schnell gesund werden. Und damit er das kann, braucht er ein gutes, qualitativ hochwertiges System, er braucht kompetente Ärztinnen und Ärzte, Betreuungspersonen, Pflegepersonen, die in der Nähe und gut erreichbar sind. Lange Anfahrtswege und kurze Öffnungszeiten sind natürlich genau das Gegenteil davon.
Offen gesagt haben wir in Wien da gewisse Vorteile, im Ballungsraum sind wir etwas verwöhnt. Da gibt es sicher ein gewisses Stadt-Land-Gefälle, an dem man arbeiten muss.
Der zweite Bereich betrifft die Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten. Auch sie brauchen beste Rahmenbedingungen, um ihre wertvolle und notwendige Arbeit sehr gut erfüllen zu können. Auch da geht es um Gesundheitsförderung: Diese Rahmenbedingungen müssen gesundheitsförderlich sein, und dabei, denke ich, ist es auch ein Faktor, ob eine Person als Einzelkämpferin arbeiten muss oder in einem Team arbeiten darf und dadurch die Verantwortung teilen kann und die Entlastung gewährleistet ist. Ich denke, diese Aufwertung der Gesundheitsberufe – aller Gesundheitsberufe, auch die der medizinisch-technischen Dienste – ist notwendig und wichtig.
Ein drittes Argument, das für die Maßnahmen, die vorliegen, spricht, ist natürlich, dass das Gesundheitssystem einen nicht unwesentlichen Budgetposten darstellt. Aus meiner Sicht ist es ein Zeichen verantwortungsvoller Politik, wenn in einem übergreifenden Management, wie es diese Zielsteuerung-Gesundheit vorsieht, auf Qualität, aber auch auf den effizienten Einsatz der vorhandenen Ressourcen geachtet wird. Ich denke, es
ist ein Gebot der Stunde, über die vorgeschlagenen Maßnahmen nachzudenken und sie gutzuheißen.
Ein Kern ist das Konzept der Primärversorgung. Dabei geht es einerseits darum, den sehr teuren Bereich der stationären Behandlung zu entlasten, aber das – und das ist der Kern – bei gleichzeitigem Ausbau der niedergelassenen Versorgung. Das steht auch überall so geschrieben, das kann man auch nicht wegreden, weil es natürlich darum geht, Hausärzte und Hausärztinnen nachhaltig und langfristig zu sichern. Das gelingt eben dann, wenn man dieses Einzelkämpfertum, wie es bisher verortet ist, mit multiprofessionellen Teams ergänzt und damit verschiedene Vorteile schafft.
Welche Vorteile sind das? – Hausärztinnen und Hausärzte sind natürlich eine tragende Säule im Gesundheitswesen, denn sie genießen das Vertrauen der PatientInnen, sie kennen PatientInnen oft über Jahrzehnte. Dieser Erfahrungsschatz und diese Vertrauensbasis dürfen natürlich nicht geschmälert werden, aber Medizin und Gesundheit sind sehr komplexe Angelegenheiten. Die ÄrztInnen zu vernetzen und Interdisziplinarität herzustellen kann für die Patientinnen und für die Patienten nur zu einem Qualitätsgewinn führen, kann die einzelnen Ärztinnen und Ärzte vor Ort entlasten und eine bessere Qualität der Arbeitsbedingungen schaffen. Ob das in der gemeinsamen Nutzung von Räumlichkeiten besteht oder ob das im ländlichen Raum über das Kooperieren in einer Region stattfindet – da wird es verschiedene Modelle geben können. Man gewinnt dadurch größere Flexibilität für die einzelnen Ärzte und Ärztinnen, für das Personal, man gewinnt Qualität durch die Vernetzung, man schafft dadurch bessere, längere und klientenfreundlichere Öffnungszeiten, und das alles spricht dafür, diese Primärversorgungszentren in Anspruch zu nehmen und nicht als Erstes in die Ambulanz zu fahren.
Schlussendlich sind die Zielsteuerung-Gesundheit und die Einführung von Primärversorgungszentren bedarfsgerechter, näher bei den Patientinnen und Patienten und beinhalten auch für die Personen, die dort arbeiten, Qualität.
Was natürlich auch nicht unwesentlich ist, ist die Kostenthematik im Gesundheitswesen. Im Unterschied zu dem, was mein Vorredner gesagt hat, geht es dabei um einen Ausgabendämpfungspfad, weil es wichtig ist, die Ausgaben – und es geht um Mehrausgaben, die jedes Jahr getätigt werden – mit Maß und Ziel vorzunehmen. Und dieser Ausgabendämpfungspfad – es ist ja nicht der erste, es hat schon 2011 einen Ausgabendämpfungspfad gegeben – bedeutet, dass wir, jetzt mit Mehrausgaben bei 3,6 Prozent des BIPs beginnend, bis 2021 diese Mehrausgaben schrittweise auf 3,2 Prozent reduzieren. Also man sieht, es geht nicht um Einsparungen, es geht um Mehrausgaben, die insgesamt bis 2021 4,6 Milliarden € ausmachen werden, und diese kann man nicht wegreden.
Auf lokaler beziehungsweise regionaler Ebene bedeutet das Einrichten dieser 75 Primärversorgungszentren österreichweit – so viele sind angedacht – 200 Millionen € Mehrausgaben, die in die regionale Versorgung investiert werden. Darauf haben sich Bund, Länder, Gemeinden und die Sozialversicherungen geeinigt.
Was ich zum Schluss noch einbringen will, weil es mich sehr freut, auch als Vertreterin einer Familienorganisation, wobei ich wirklich nicht verstehen kann, warum die FPÖ im Nationalrat da nicht mitgestimmt hat, weil es nämlich eine Entlastung für Familien und sozusagen ein Weihnachtsgeschenk an alle Familien in Österreich ist (Bundesrat Mayer: Ja!): Wir können hoffentlich mit dem heutigen Tag den Selbstbehalt für Kinder und Jugendliche in Spitälern streichen. Das ist eine enorme Entlastung gerade für jene Familien, die mit kranken Kindern sowieso belastet sind, sowieso permanent einen Mehraufwand zu leisten haben. (Beifall bei SPÖ und ÖVP sowie des Bundesrates Stögmüller.)
Diese Entlastung gilt auch für Lehrlinge, gilt auch für Menschen, die die Waisenpension beziehen. Es ist ein schönes Weihnachtsgeschenk, für das ich mich sehr herzlich im
Namen aller Familien bedanken möchte. – Danke schön. (Beifall bei SPÖ und ÖVP sowie des Bundesrates Stögmüller.)
12.09
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Bevor wir in der Debatte weitergehen, erlauben Sie mir, das Team des Abfallwirtschaftsverbandes Graz-Umgebung unter der Leitung von Bürgermeister Ing. Markus Windisch bei uns im Bundesrat herzlich zu begrüßen. – Herzlich willkommen! (Allgemeiner Beifall.)
In der Debatte fortschreitend darf ich Herrn Bundesrat Jenewein um seine Ausführungen bitten.
12.10
Bundesrat Hans-Jörg Jenewein, MA (FPÖ, Wien): Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau Bundesministerin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Um gleich auf meine Vorrednerin Bezug zu nehmen: Wir haben im Nationalrat in der zweiten Lesung selbstverständlich für dieses Gesetz gestimmt, weil eben die Selbstbehalte weggefallen sind. Das ist eine langjährige Forderung, und wir begrüßen das auch ausdrücklich. Daher auch die Zustimmung in der zweiten Lesung. Das sei hier der Form halber erwähnt.
Insgesamt überwiegen jedoch die Nachteile. Was die von meiner Vorrednerin immer wieder erwähnten Vorteile durch diese primärmedizinischen Einrichtungen betrifft, möchte ich einen kurzen Ausflug in die Bundeshauptstadt machen. Kollege Todt verlässt gerade den Saal (Bundesrat Todt begibt sich zurück zu seinem Sitzplatz) – nein, jetzt kommt er wieder zurück. (Heiterkeit des Redners sowie der Bundesräte Todt und Mayer.) Wenn wir über Wien reden, musst du schon dableiben, bitte.
Es ist nicht uninteressant, wenn man zum Beispiel weiß, dass es in Wien eines dieser Medizinzentren gibt, es wurde mit 200 000 € subventioniert. Für das zweite, in unmittelbarer Nähe des Donauspitals, findet man seit einer Ewigkeit, trotz mehrmaliger Ausschreibung, keinen Betreiber; es wurde auf Eis gelegt. Das heißt, so eine großartige Einrichtung kann das dann wohl nicht sein.
Auf der anderen Seite, wenn wir uns schon auf Wiener Ebene befinden, gibt es dann die Alarmrufe, gerade von der Gewerkschaft – Sie, Frau Bundesministerin, kommen ja auch aus der Gewerkschaft, und es sind ja einige Gewerkschaftsvertreter hier –, dass in Wien die Gefahr besteht, dass der Krankenanstaltenverbund privatisiert wird. Das muss man also schon immer im Kontext sehen. Wir sind hier die Länderkammer, und hier sollte man auch darüber sprechen.
Da stelle ich mir schon die Frage: In welche Richtung geht denn die Gesundheitspolitik, wenn wir auf der einen Seite den niedergelassenen Arzt unter Druck setzen – ich rede jetzt gar nicht einmal so sehr von dessen Abschaffung, ich sage, unter Druck setzen; man installiert mit diesen medizinischen Einrichtungen, mit diesen PHC-Zentren, quasi ein Konkurrenzunternehmen, man könnte auch, wenn man so will, sagen, ein Kleinkrankenhaus ohne diesen großen Verwaltungsapparat –, und auf der anderen Seite gibt es dann die ernsthafte Debatte darüber, ob nicht der Krankenanstaltenverbund verkauft wird, ausgegliedert wird, was auch immer damit passieren wird?
Es kann natürlich auch sein, dass die Gewerkschaft da übertreibt und – ich weiß nicht – Panikmache betreibt. Ich will das aber niemandem unterstellen. Die Gefahr, die ich da sehe, ist vor allem unter dem Blickwinkel einer Meldung zu betrachten, die wir gestern bekommen haben: Die Privatklinik Döbling eröffnet jetzt für Privatpatienten eine Notaufnahme. – Meine sehr geehrten Damen und Herren, da sprechen wir nicht mehr von der Zweiklassenmedizin, da sprechen wir mittlerweile von der Dreiklassenmedizin. Das sind dann nämlich diejenigen, die es sich überhaupt mit Privatversicherung leisten können, in einem Privatspital in die Notaufnahme zu gehen. Das kann doch nicht der Weis-
heit letzter Schluss sein. (Beifall bei der FPÖ. – Zwischenbemerkung von Bundesministerin Oberhauser.)
Man muss aber … (Bundesrat Mayer: Da kann die Frau Ministerin nichts dazu!) – Ich habe auch nicht gesagt, dass die Frau Ministerin etwas dazu kann, überhaupt nicht, nein, nein, nein, Herr Kollege, überhaupt nicht! – Ich mache mir ernsthaft Sorgen, dass wir uns bei der Neuorganisation, bei der Überlegung, wie wir das Gesundheitssystem auch im 21. Jahrhundert organisieren, vergaloppieren, und es sagt ja auch ein geflügeltes Wort: Das Gegenteil von gut ist gut gemeint.
Ich sehe da schon Entwicklungen, die uns alle sehr, sehr, sehr vorsichtig sein lassen sollten, wenn wir bei der Gesundheitsversorgung anfangen, da ein bisschen zu reformieren und da ein bisschen etwas zu machen. Da haben wir dann die Ärztekammer, über die man natürlich sagen kann: Na ja, gut, das ist eine Interessenvertretung, die nur ihre eigenen Interessen vertritt, und das ist mir eigentlich als Politiker nicht ganz so wichtig, denn ich habe meine eigenen Vorstellungen. – Ja, ja, natürlich! Natürlich soll das Primat der Politik immer noch so weit vorherrschend sein, dass man sagt: Die Grundvoraussetzungen, was wir wollen und wie wir es wollen, geben schon wir vor.
Auf der anderen Seite kann man sich leider Gottes auch oftmals des Eindrucks nicht erwehren, dass da immer ein bisschen eine Neiddebatte mitschwingt, so nach dem Motto: Na ja, die verdienen ohnehin so gut, machen wir es doch lieber so, dann sind die in diesen PHC-Zentren angestellt, und damit kann man auch die Einkommenssituation ein bisschen besser kontrollieren.
Ich denke, das ist nicht der richtige Weg. Ich glaube vielmehr, dass es gerade im Bereich der niedergelassenen Ärzte dazu kommen muss, dass es auch wieder interessant sein muss und dass man sich bemüht, einen Kassenvertrag zu bekommen.
Ich gebe Ihnen ein drastisches Beispiel. Es betrifft meinen persönlichen Zahnarzt im zehnten Bezirk – in einem dicht besiedelten Gebiet, für all jene, die es nicht kennen –: Ein Krankenkassenzahnarzt findet keinen Nachfolger mehr. Theoretisch muss man annehmen: Ein Zahnarzt sucht einen Nachfolger, hat alle Kassenverträge, das muss doch eine Fingerübung sein, einen Nachfolger zu finden. – Nein, mitnichten ist das so! (Bundesrat Beer: Vielleicht haben wir in Favoriten so viele Zahnärzte!) Da müsste man sich dann vielleicht auch überlegen, ob an der Tarifschraube wirklich alle Feinjustierungen so gedreht sind, das man sagt: Das ist auch wieder attraktiv. – Und wenn es attraktiv ist, dann funktioniert es auch.
Das wollte ich zusätzlich vonseiten der freiheitlichen Fraktion in diese Debatte einbringen. Kollege Krusche hat vorhin ohnehin das meiste abgedeckt.
Ihnen, Frau Bundesministerin, wünsche ich für das Jahr 2017 alles erdenklich Gute und Gesundheit. – Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. (Beifall bei der FPÖ sowie des Bundesrates Schmittner. – Bundesministerin Oberhauser: Danke!)
12.16
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Tiefnig. – Bitte.
12.16
Bundesrat Ferdinand Tiefnig (ÖVP, Oberösterreich): Liebe Präsidentin! Geschätzte Frau Bundesminister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Geschätzte Damen und Herren vor den Bildschirmen! Vor allem: Liebe Ärzte!, denn ihr habt im vergangenen Jahr über 68 Millionen Kontakte mit Patientinnen und Patienten gehabt; das zeigt die e-card-Auswertung. Ein herzliches Dankeschön für Ihre Arbeit!
Jetzt aber zum Thema des Tages; ich glaube, das ist wirklich das Thema Primary Health Care, das Ärztezentrum. 2009 war ich in Kopenhagen und in Malmö. Ich konnte
mir dort diese Systeme anschauen. Der Grund meiner Reise war der, dass ein Arzt in meiner Nähe gesagt hat: Wir werden in Zukunft ein Riesenversorgungsproblem bei den Hausärzten haben.
Das zweite Thema betrifft die Tatsache, dass viele Ärzte nach Deutschland, nach England abwandern. Wir müssen schauen, wie wir in Zukunft die ärztliche Versorgung sicherstellen können.
Wie die Systeme in den skandinavischen Ländern abgewickelt werden, war für mich eigentlich sehr beeindruckend. Bei einem Gespräch habe ich dann auch Leute in Österreich kennengelernt, die diesen Weg verfolgen. Ich muss sagen, dieser Weg war der richtige, denn es ist nicht so, wie es in Skandinavien ist, dass Ärztezentren so wie kleine Krankenhäuser entstehen, in denen Krankenschwestern beschäftigt sind, in denen dann auch Physiotherapeuten, Heilpraktiker zusammenarbeiten, sondern bei uns besteht die Möglichkeit der Freiwilligkeit, und das ist das Ausschlaggebende. Dafür danke ich Ihnen, Frau Minister, denn dieser Punkt der Freiwilligkeit ist der wichtigste, der auch den Ärzten überlassen bleibt.
Es ist auch heute schon der Fall, dass sich die Ärzte – jetzt besonders – bei Wochenenddiensten, bei Feiertagsdiensten untereinander vernetzen, und diese Vernetzung wird mit der Primärversorgung noch vertieft.
Ein weiterer Punkt ist: Ein Arzt kann einen Arzt beschäftigen, ein Arzt kann eine Krankenschwester beschäftigen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für die Zukunft, denn wenn es wirklich eintreten sollte, dass die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum in Zukunft immer schwieriger wird, dass es immer schwieriger wird, Ärzte in den ländlichen Raum zu bekommen – was wird in Zukunft mit den älteren Menschen sein? Wie werden diese betreut werden? Müssen wir zusätzliche Heime errichten, die sehr viel kosten? – Auf der anderen Seite wollen die älteren Menschen zu Hause bleiben, und mit der Primärversorgung können wir auch diese Pflege zu Hause für längere Zeit sicherstellen. Das ist ein wichtiger Schritt. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
Ein weiterer Punkt betrifft das Thema der Zielsteuerung. Die Zielsteuerung schreibt vor, dass nur eine gewisse Steigerung vorherrschen darf. Auf der anderen Seite wird aber jetzt über den Finanzausgleich geregelt, dass wieder besonders im Bereich der Gesundheit die Mittel in die Länder kommen. Die Länder haben sich freiwillig dazu bereit erklärt, diese Mittel in die Gesundheit zu investieren. Sie können diese Mittel auch zum Ausgleich des Abgangs des Budgets verwenden. Ich hoffe nicht, dass die Landeshauptleute dann den Budgetabgang decken und die Gesundheitsversorgung im Stich lassen.
Ein wichtiger Schritt war bei uns in Oberösterreich die Errichtung der Medizin-Universität, die Tatsache, dass wir jetzt in Oberösterreich auch eine Ausbildungsstätte haben, eine Medizin-Uni, um Ärzte im Land, in Österreich zu halten.
Die Frage wird in Zukunft sicherlich auch sein: Wie kann man den Beruf des praktischen Arztes attraktiver machen und die Ausbildung zum Diagnostiker noch verbessern?, ist es doch auch sehr wichtig, dass ein Arzt ein guter Diagnostiker ist. Somit wird es wichtig sein, die Vernetzung der Gesundheitsberufe voranzutreiben.
Ich danke Ihnen, Frau Minister, für all das, was Sie in diesem Jahr trotz Ihrer schweren Krankheit auf den Weg gebracht haben. Ich wünsche Ihnen für das kommende Jahr eine Steigerung Ihres Gesundheitsbefindens – alles Gute! Wir freuen uns, dass Sie wieder bei uns im Bundesrat sind, und stimmen diesen Gesetzentwürfen natürlich zu. – Danke schön. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
12.20
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Dr. Reiter. – Bitte.
12.20
Bundesrätin Dr. Heidelinde Reiter (Grüne, Salzburg): Hohes Präsidium! Werte Frau Minister! Werte Kollegen und Kolleginnen! Ja, alles im Bereich Gesundheit, Organisation, Steuerung, Finanzierung ist sehr kompliziert und sehr komplex. Die hier zusammengefassten Tagesordnungspunkte in der gebotenen Kürze nicht nur zu erläutern, sondern auch fundiert dazu Stellung zu nehmen, das ist wahrscheinlich eine unlösbare Aufgabe – ebenso unlösbar wie die Aufgabe, die Probleme im Gesundheitswesen politisch radikaler zu lösen – und dabei meine ich das im Wortsinne: an der Wurzel zu lösen –, ohne massiven Widerstand, massive Ängste, Konflikte auszulösen, die politisch nicht zu gewinnen sind.
Ich gebe zu, ich war über die Ergebnisse des Finanzausgleiches im Bereich Gesundheit sehr enttäuscht, und trotzdem werden wir die beiden Artikel-15a-Vereinbarungen – ich halte Artikel-15a-Vereinbarungen für undemokratisch, intransparent und so weiter – und das Vereinbarungsumsetzungsgesetz und die Novelle zum Ärztegesetz mittragen. Ich halte es für ein Gewurschtel, aber eine Alternative gäbe es nur mit einem wirklichen Kraftakt der Landeshauptleute, der Bürgermeister, also der Gemeinden, der Kammern, der Sozialpartner und der Versicherungen. Da müsste das Ganze von einem großen Vertrauen und einer Unterordnung unter ein größeres Ziel getragen werden, das nicht nur Machterhalt und Erhalt von mehr Geld bedeutet. (Beifall bei den Grünen.)
Um das ein bisschen konkreter zu machen, was es an Problemen gibt: Ich bin aufgrund einer Witwenpension und einer eigenen Pension – alles im unteren dreistelligen Bereich (Heiterkeit) – und meiner Tätigkeit hier dreifach versichert: bei der Gebietskrankenkasse, bei der SVA und bei der BVA. (Bundesrat Jenewein: Jetzt gibt es eh den Hunderter!) Vor einem Arztbesuch müsste ich mir eigentlich genau ausrechnen, welche Versicherung ich in Anspruch nehme, denn: Es gibt Selbstbehalte, keine Selbstbehalte, viele Ärzte haben nur kleine Kassen, manche gar keine, dann sind die Refundierungen unterschiedlich. Das geht so weit, dass ein MRI zum Beispiel bei der BVA nicht chefärztlich bewilligt werden muss, aber bei den anderen Krankenkassen schon. Rational ist das nicht begründbar, aber trotzdem denkt sich das ja irgendjemand aus, macht die entsprechenden Verträge, das muss administriert werden, muss kontrolliert werden. Es ist aber offensichtlich nicht möglich, dieses im Endeffekt natürlich auch wahnsinnig kostspielige Tohuwabohu zu beenden oder zu klären.
Oder die Hausarztproblematik: Ich kenne sehr engagierte, fantastische Hausärzte. Mein Hausarzt ist zum Beispiel so einer, aber, ehrlich, verheiratet möchte ich mit ihm nicht sein und auch keine Kinder mit ihm großziehen. Er kann mit seiner Frau nur einigermaßen Kontakt halten, wenn er sie nach altbewährtem Modell als Sprechstundenhilfe in der Praxis hat. (Heiterkeit.) Viele junge Ärzte werden Wahlärzte, weil sie einerseits mehr Zeit für die Patienten zur Verfügung haben wollen und andererseits auch eine andere Lebensführung anstreben. So manche frisst das System, trotzdem!
Seit ich politisch tätig bin, höre ich als eines der großen Rezepte im Gesundheitswesen: Stärkung des extramuralen Bereichs, also weg vom Krankenhaus, weg von der teuren Akutversorgung. Allein, es ist in all diesen Jahren nichts gelungen, die Entwicklung geht sogar eher ins Gegenteil.
Jetzt gibt es also diesen Vorstoß für Primärversorgungszentren mit hoffentlich viel Flexibilität in der konkreten Umsetzung. Um es wieder als Patient zu sagen: Ich wünsche mir eine Anlaufstelle, wo immer jemand da ist und ich vieles gleich erledigen kann, wenn ich dorthin komme, und für die im Gesundheitsbereich Arbeitenden wünsche ich mir, dass sie sich permanent austauschen können und nicht irgendwo allein in einer Praxis sitzen. Ich wünsche mir, dass es hier zu einem ständigen Austausch kommen kann, dass die Menschen auch Freiräume für ihre Lebensgestaltung haben, also auch guten Gewissens auf Urlaub gehen können, weil sie die Patienten gut versorgt wissen.
Ich glaube, ebenso wie das Bild der Zweikindfamilie, mit Papa und Mama unter dem Weihnachtsbaum Lieder singend und fröhlich feiernd, ist unser Hausarztbild etwas überarbeitungsbedürftig. Beides trifft wahrscheinlich eher nur selten zu.
Ich wünsche natürlich trotzdem allen, in welchen Konstellationen auch immer, eine schöne Weihnachtszeit, und ich glaube, dass es auch vielen Menschen gelingen wird, eine solche zu verbringen; ich hoffe das. Uns und besonders auch Ihnen, Frau Minister, wünsche ich, dass es in wenigen Jahren Primärversorgungszentren gibt, in denen sich Kranke gut aufgehoben fühlen und die Beschäftigten gerne und mit Engagement arbeiten. Ich wünsche uns auch, dass es gelingt, unser Gesundheitssystem auch weiterhin zu finanzieren, denn das ist nicht trivial und weiterhin eine große Herausforderung für die Zukunft. Deshalb werden wir diesem Gesetz auch zustimmen. – Danke. (Beifall bei Grünen und SPÖ sowie bei Bundesräten der ÖVP.)
12.26
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Zu Wort gemeldet ist Frau Bundesministerin Dr. Oberhauser. – Bitte.
12.26
Bundesministerin für Gesundheit und Frauen Dr. Sabine Oberhauser, MAS: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Erstens einmal vielen Dank für die zuletzt von Ihnen, Kollegin Reiter, gemalten Bilder zu der Frage: Wie schaut die Realität des Hausarztes, der Hausärztin aus und wo wollen wir hin? Ich werde versuchen, anhand der aufgeworfenen Fragen, die von Ihnen am Anfang gekommen sind, ein bisschen zu erklären, dass wir offensichtlich von unterschiedlichen Bildern sprechen.
Sie haben beide das Zentrum, das Haus im Fokus Ihres Bildes. Das ist auch das, was die Ärztekammer und Gegner des PHC, die es sich nicht vorstellen wollen, dass es anders auch sein kann, versuchen, in den Fokus zu stellen – nämlich das Haus, in das Menschen anonym hineingehen und anonym wieder hinausgehen, dort nicht auf behandelnde Ärztinnen und Ärzte, sondern am besten noch auf Roboter treffen und keine Chance haben, eine freie Arztwahl zu treffen.
Mein Bild ist ein ganz anderes. Stellen Sie sich einen See vor, und rund um diesen See sind mehrere Ortschaften, und in jeder Ortschaft sitzt derzeit ein Hausarzt! Wir wünschen uns, dass rund um diesen See nicht alle zum Beispiel am Montag in der Früh keine Ordination haben, sondern am Montag zumindest einer erreichbar ist, der auch weiß, wie der Patientenstock der anderen ist, dass alle drei in ihren Ordinationen sitzen bleiben, sich aber verbindlich besser vernetzen, sodass es ganz klar ist, wann ich wen finde – ELGA wird zu diesem Zeitpunkt dann auch schon in der weiteren Ausrollung sein –, und dass der diensthabende Arzt auf die Daten der Patientinnen und Patienten seiner Kollegen zugreifen kann.
Das hat erstens den Vorteil, dass man als Patient nicht fragen muss: Nehmen Sie mich überhaupt an, denn mein Hausarzt ist nicht da? – Das erleben wir jetzt immer wieder, und zwar auch in Ballungszentren: Mir schreiben Leute und sagen, es nimmt mich kein Arzt mehr, weil die sagen, sie haben schon genug Patientinnen und Patienten. In dem Fall hätten das die drei, vier oder wie viel Ärzte auch immer, ganz verbindlich geregelt: Wenn ich nicht da bin, nimmst du den Patienten!
Im Idealfall treffen sich diese drei mit der Gesundheits- und Krankenpflegerin, mit einer Hebamme, mit wem auch immer, einmal, zweimal im Monat und sprechen über Risikopatienten oder, wenn sie auf Urlaub gehen, auf welche Patienten man besonders schauen muss, weil diese auch mit Hausbesuchen abzudecken sind, et cetera.
Das ist eines der Bilder, die ich von Primärversorgung im Kopf habe, dass man das auch regional steuert und regional festlegt.
Das zweite steirische Beispiel neben Styriamed: In Mariazell ist es ein Haus, in dem mehrere Ärztinnen und Ärzte da sind, um dort die Versorgung der ansässigen Bevölkerung und Touristen zu gewährleisten. Dazu wird auch noch ein Internist kommen, ein Kinderarzt und auch ein Orthopäde, die an gewissen Tagen dort Ordination machen. Ich stelle mir vor, das ist das, was sich Patientinnen und Patienten sowohl im städtischen als auch im ländlichen Bereich wünschen.
Was Ärztinnen und Ärzte sich wünschen, ist unterschiedlich. Das eine ist die Freiberuflichkeit. Die nehmen wir ihnen nicht, weil es ein Gruppenpraxismodell ist, das wir in der PHC-Versorgung planen, und das Gesetz beschließen wir ja noch lange nicht, das beginnen wir ja erst zu diskutieren. Wir beschließen jetzt nur einmal den Finanzausgleich. Es geht hier darum, dass sich drei freiberufliche Ärzte zusammenschließen, als Gruppenpraxis, als Verein, als GesmbH, als was auch immer. Wir möchten möglichst große Freiheiten lassen, weil die Freiberuflichkeit sicherlich etwas ist, was vielen Ärztinnen und Ärzten wichtig ist.
Was sich aber viele der jungen Ärztinnen und Ärzte nicht trauen, ist, gleich in die Freiberuflichkeit zu gehen. Und es ist die Frage, ob man sich nicht dort einmal mit, ich weiß nicht, 20 Stunden anstellen lässt – eine Möglichkeit für Anstellung soll es geben – und sich das einfach einmal anschaut, mit der Option, vielleicht einmal einen dieser Verträge zu übernehmen. Also es ist da ein langsames Hineinwachsen möglich.
Da wir das nicht – es ist ja gesagt worden – mit Zwang, sondern freiwillig machen, werden wir natürlich schauen müssen, dass die Verträge attraktiv sind. Nur, bei der Frage von neuen attraktiven Kassenverträgen muss man schon die Kirche im Dorf lassen, denn: Wer verhandelt die Kassenverträge? – Die Ärztekammer mit der Sozialversicherung! Und zumindest nach meiner Erinnerung als Kammerfunktionärin war es immer noch so, dass die niedergelassenen Fachärzte in den Vertragsverhandlungen mit den Sozialversicherungen sehr dominant waren. Und es ist kein Geheimnis, dass die Honorare der Allgemeinmediziner um 40 Prozent niedriger sind als die der Fachärzte, zumindest wenn man sich den Durchschnitt anschaut.
Das heißt, es wird auch ein Augenmerk darauf gelegt werden müssen, dass die Hausarztmedizin besser und adäquater honoriert wird, vielleicht mit einer Pauschale, dass man für einen Patienten eine Pauschale und Einzelleistungen bekommt. Es muss uns aber klar sein, es muss attraktiv sein, sonst geht uns dort niemand hinein. – So viel zu diesen Fragen.
Zu der Frage dieses Notfallzentrums der UNIQA: Das wird eine allgemeinmedizinische Ambulanz ohne Wartezeiten für Zusatzversicherte sein. Die Frage ist ja heute in der Zeitung auch schon gestellt worden: Was ist, wenn ich mit einem Schlaganfall dorthin fahre? – Dann wird das ein Umweg sein, denn dort wird man mir sagen: Nicht bei uns, fahren Sie zum Nächsten!
In Wirklichkeit richten sich dort einige den Allgemeinmediziner ohne Wartezeit. Gefallen tut es mir nicht, das ist klar, allerdings, wie gesagt, wenn die Auswahlmöglichkeiten immer geringer werden, ist es klar, dass Ärzte, Versicherungen in so etwas einsteigen. Das kann nämlich lukrativ sein. Ein PHC auf der grünen Wiese ist für die UNIQA wahrscheinlich nicht attraktiv, denn das PHC hat auch ein großes Charakteristikum: Sie können Ihre Geldbörse zulassen, weil es ein Sachleistungszentrum sein soll, und das ist nicht gewinnbringend. Das heißt, die UNIQA wird sich wahrscheinlich mit so etwas nicht auf die grüne Wiese stellen.
Was ich an der Kritik teile, das ist die überbordende Bürokratie. Das betrifft Spitäler wie Ärzte im niedergelassenen Bereich. Ich glaube, dass man ganz dringend darauf schauen muss, dass man versucht, Computerprogramme möglichst benutzerfreundlich zu ma-
chen und die Dokumentationen auf ein Mindestmaß herunterzuschrauben. All diese Dinge muss man einerseits im Rahmen des PHC-Gesetzes machen, zu schauen, wie man da zu Verbesserungen kommt, aber andererseits müssen wir auch danach trachten, bei den Berufsbildern, bei den Berufsrechten zu einer Reduktion zu kommen.
Abschließend noch zur Frage des Kostendämpfungspfades: Wir geben 4,6 Milliarden € mehr aus. Wir haben den Pfad, den wir von 2012 bis jetzt gehabt haben, geschafft, auch mit den sehr großen Herausforderungen, die auf die Spitäler zugekommen sind, mit den doch sehr großen Erhöhungen der Ärztegehälter im Rahmen des Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetzes. Wir haben diesen Pfad mit 3,6 Prozent eingehalten. Ich kann Ihnen versprechen, dass mein Haus den Kostendämpfungspfad sehr genau und sehr detailliert berechnet hat und wir mit dieser Treppung – und die Forderungen, mit denen wir konfrontiert waren, waren ganz andere, was den Ausgabendämpfungspfad betroffen hat – von 3,6 auf 3,2 Prozent nicht ins Sparen kommen, sondern immer in den Mehrausgaben bleiben werden. Wenn sich die Kosten ganz exorbitant entwickeln würden, dann wird weiter diskutiert werden müssen. Ich glaube, es werden uns BürgermeisterInnen oder auch Landeshauptleute nicht auslassen, wenn sie bemerken, dass die Gesundheitsversorgung in ihrem eigenen Umfeld in Schwierigkeiten kommt.
In diesem Sinne danke ich für die Zustimmung und danke auch für die Diskussion. – Das war es. (Allgemeiner Beifall.)
12.34
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Es ist dies nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Die Abstimmung erfolgt getrennt.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG Zielsteuerung-Gesundheit.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist angenommen.
Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist angenommen.
Weiters gelangen wir zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Vereinbarungsumsetzungsgesetz 2017.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist angenommen.
Wir gelangen nun zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Ärztegesetz 1998 geändert wird.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist angenommen.
7. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Gentechnikgesetz und das Versicherungsvertragsgesetz geändert werden (1336 d.B. und 1378 d.B. sowie 9706/BR d.B.)
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Nun gelangen wir zu Punkt 7 der Tagesordnung.
Berichterstatterin ist Frau Bundesrätin Mag. Gruber-Pruner. Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatterin Mag. Daniela Gruber-Pruner: Hohes Haus! Frau Ministerin! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich bringe den Bericht des Gesundheitsausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Gentechnikgesetz und das Versicherungsvertragsgesetz geändert werden.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, daher komme ich sogleich zur Antragstellung.
Der Gesundheitsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 19. Dezember 2016 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Ebner. – Bitte, Frau Kollegin.
12.38
Bundesrätin Adelheid Ebner (SPÖ, Niederösterreich): Geschätzte Frau Präsidentin! Frau Bundesministerin! Ich kann das sehr kurz machen. Es geht nur um eine kleine Korrektur des Gentechnikgesetzes, und zwar hat der Verfassungsgerichtshof in seinem Erkenntnis vom 8. Oktober 2015 den § 67 des Gentechnikgesetzes mit der Begründung aufgehoben, dass die Weitergabe von Daten aus gentechnischen Analysen nicht verfassungskonform geregelt ist.
Es geht hier um Typ 1. Typ 1, das sind keine vererbbaren Merkmale, zum Beispiel Tumorerkrankungen. Diese Daten können in Zukunft sowohl den Arbeitgebern als auch den Versicherern weitergegeben werden. Typ 2, das sind die manifesten, die erkennbaren Krankheiten. Typ 3 und 4, da weiß der Patient eigentlich noch gar nicht, ob er diese Krankheit hat. Die müssen weiterhin im Verbot bleiben und genießen auch den Datenschutz.
Aus diesem Grunde wird das Gesetz dahin gehend abgeändert, die Novelle tritt mit 1. Jänner 2017 in Kraft. Unsere Fraktion stimmt dieser Abänderung auf alle Fälle zu. (Beifall bei der SPÖ.)
12.39
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Preineder. – Bitte, Herr Bundesrat.
12.40
Bundesrat Martin Preineder (ÖVP, Niederösterreich): Frau Präsidentin! Frau Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Werte Damen und Herren! Ich darf ebenfalls zum Bundesgesetz, mit dem das Gentechnikgesetz und das Versicherungsvertragsgesetz geändert werden, Stellung nehmen. Wie gesagt, es geht um ein Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes, das darauf abzielt, dass etwas differenzierter, vernünftiger, verfassungskonformer mit den Daten umgegangen wird, weil die bisherige Regelung einfach zu wenig differenzierend war.
Es war grundsätzlich verboten, Daten, die aus gentechnisch generierten Analysen entstanden sind, weiterzugeben. Nun geht es darum, dass jene Daten – Frau Kollegin Eb-
ner hat schon darauf hingewiesen –, die in vergleichbarer Form auch mit konventionellen Messmethoden herstellbar sind, ab 1. Jänner wieder weitergegeben werden dürfen, allerdings keine Rohdaten, damit nicht Mutmaßungen oder Spekulationen Tür und Tor geöffnet wird.
Geschätzte Damen und Herren, wir werden diesem Gesetz zustimmen. Vielleicht ein Ansatz zum Thema Datenschutz, weil wir in einer Zeit leben, in der sehr viele Daten gespeichert, verarbeitet und generiert werden: Es ist immer ein Unterschied, ob es um die Frage geht, wie die öffentliche Hand mit Daten umgeht, oder um die Frage, wie der private Bereich mit Daten umgeht, seien es solche aus Befragungen, sei es all das, was wir im Netz von uns preisgeben.
Ich glaube, wichtig ist, dass wir uns persönlich auch immer wieder entscheiden, welche Daten wir von uns preisgeben, denn beim Datenschutz lautet das Motto nicht: alles oder nichts – oder: die öffentliche Hand darf nicht, aber der Private schon –, sondern ich glaube, beim Datenschutz geht es auch um eine Balance dahin gehend, dass jene Daten, die wir von uns hergeben, auch im öffentlichen Bereich verwendet werden.
Geschätzte Damen und Herren, wir werden dieser Vorlage zustimmen. (Beifall bei der ÖVP und bei Bundesräten der SPÖ.)
12.41
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Dr. Reiter. – Bitte schön.
12.42
Bundesrätin Dr. Heidelinde Reiter (Grüne, Salzburg): Kollege Preineder, ich glaube, dass auch der bisherige Umgang beziehungsweise das bisherige Gesetz grundvernünftig waren. Und das vorliegende Gesetz spiegelt eben die Problematik wider, dass die Versicherungen mehr Daten aus diesen Analysen wollten, deshalb geklagt haben und erreicht haben, dass sie an mehr Daten kommen. Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich die Entwicklung ist, die wir haben wollen.
Die moderne Analytik erlaubt uns ja, immer mehr Informationen über einen Menschen zu gewinnen. Es ist heute kein Problem mehr, ihn zu kartieren, und wir greifen ja auf diese Analytik in den Vaterschaftstests, in der Kriminalistik und so weiter immer intensiver zu. Man kann sich auch privat schon entsprechende Analysen machen lassen. Ganz spannend ist zum Beispiel, was die Paläogenetik da macht, dass man aufgrund einer Genanalyse feststellen kann, woher man kommt, und das seit Jahrhunderten, also wo man seine genetischen Wurzeln hat. Da erlebt so mancher seine Überraschungen, was die Einwanderungs- und Wanderungsgeschichte betrifft.
Immer genauer werden aber natürlich auch Aussagen zu Dispositionen für bestimmte Erkrankungen. Und das hat eben vielfältige und durchaus nicht immer wünschenswerte Konsequenzen. Denken wir an Angelina Jolie und die Amputation ihrer Brüste: Sie hat sich eben, weil sie genetisch eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, an Brustkrebs zu erkranken, für diesen Eingriff entschieden. Da stellt sich eben schon die Frage, inwieweit – und wann – auch Patienten darüber aufgeklärt werden sollten, dass sie zum Beispiel Träger einer schrecklichen Erbkrankheit sind, die ihr Leben radikal verändern, ja zerstören kann, auch wenn sie derzeit sozusagen noch ganz gesund sind.
Und es gibt natürlich auch Interessen von Versicherungen und vermutlich auch von Arbeitgebern, entsprechende Daten zu erhalten: Gibt es Dispositionen für Depression, für Zuckerkrankheit? – Und viele andere Dinge sind hier denkbar.
Ergebnisse aus genetischen Analysen durften bisher nicht weitergegeben werden, aber dieses Verbot wurde eben als zu wenig differenziert aufgehoben und dadurch die vorliegende Reparatur notwendig. Es bleibt aber Gott sei Dank im Wesentlichen bei dem
Verbot, und die Versicherungen dürfen nur Daten bekommen, die auch mit konventionellen Methoden erhebbar wären – das heißt, bei bestehenden Erkrankungen, wenn diese Untersuchungen zur Vorbereitung oder Kontrolle einer Therapie gemacht wurden, also in einem sehr eingeschränkten Bereich.
Wenn aus diesen Daten Rückschlüsse auf Keimbahnmutationen, Prädispositionen und Ähnliches gezogen werden könnten, bleibt die Weitergabe weiterhin verboten.
Wir stimmen dem Gesetz zu. Ich fürchte aber, dass es nicht das letzte Mal ist, dass uns dieser Bereich beschäftigt, und ich bin auch der Überzeugung, dass diese Fragen der modernen Medizin – noch dazu, wenn wir an CRISPR denken, wo es möglich ist, ganz gezielt zum Beispiel auch in die Gene einzugreifen, und Ähnliches – breit gesellschaftlich diskutiert werden sollten und müssten, und eben auch die Frage: Wie gehen wir mit diesen Daten und mit diesen Informationen entsprechend um?
Ich glaube, dass solche Debatten dringend notwendig sind, weil sich daraus sehr viele ethische und dann auch politisch zu lösende Fragen ergeben. – Danke. (Beifall bei den Grünen und bei Bundesräten von ÖVP und SPÖ.)
12.46
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Ich bitte nun die Frau Bundesminister um ihre Ausführungen.
12.46
Bundesministerin für Gesundheit und Frauen Dr. Sabine Oberhauser, MAS: Danke für die sichtlich einstimmige Zustimmung zu diesem Gesetz. Ich kann Ihnen nur berichten: Ich bin als junge Medizinstudentin unter einer – damals noch – Oberärztin Elisabeth Pittermann, wo ich meine Ferialjobs gemacht habe, groß geworden. Das ist schon relativ lange her, und die Liesl hat eines immer gepredigt, sie hat gesagt: Gentechnische Analysen gehören nicht in die Krankengeschichte! Gentechnische Analysen gehören nicht an Versicherungen weitergegeben! Ja da nie nachgeben!
Mit dem bin ich groß geworden, und ich kann Ihnen garantieren, dass ich zumindest darauf immer ein Auge haben werde. Und ich weiß, dass mit Gerhard Aigner, meinem Sektionschef, jemand hier sitzt, der das ganz genauso sieht, wie ich das sehe, nämlich dass persönliche Daten, gentechnische Daten einem extremen Schutz unterliegen.
Und ja, es stimmt, es war die Versicherungswirtschaft, die geklagt hat, die einfach wollte, so sich jemand testen lässt, ob er zum Beispiel ein erhöhtes Brustkrebsrisiko hat, dass sie diese Daten bekommt – und damit natürlich den Versicherungsschutz ausschließt.
So viel sei auch all jenen gesagt, die von einer Pflichtversicherung nichts wissen wollen, sondern von der Versicherungspflicht reden, nämlich dass jeder sich seine Versicherung aussuchen muss. Wenn solche Dinge fortschreiten, dann kann man sich schon vorstellen, wie schwer es sein wird, wenn es irgendeine Erkrankung in der Familie gibt, eine Versicherung zu finden.
Also in diesem Sinne: Vielen, vielen herzlichen Dank für die Zustimmung!
Was ich aber noch sagen möchte, ist: Ich möchte Ihnen allen und Ihren Familien frohe Weihnachten wünschen, einen guten Rutsch in ein gesundes neues Jahr. Ich kann Ihnen von meiner Seite sagen, ich genieße die Debatten im Bundesrat immer sehr. Sie sind sehr unmittelbar, sehr direkt, sie sind immer sehr fair, wir können gut miteinander reden. Ich freue mich immer, wenn ich hier sein kann. Ich hoffe, wir sehen uns gesund und munter wieder, mit vielen neuen, guten Ideen für die Menschen, für die wir hier herinnen sitzen, und können viele gute Dinge beschließen. In diesem Sinne: Genießen Sie hoffentlich Ruhe über die Feiertage! (Anhaltender allgemeiner Beifall.)
12.48
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Sehr verehrte Frau Bundesminister! Ich denke, dieser Applaus hat dir gezeigt, wie sehr wir dich schätzen. Wir wünschen dir ein paar ruhige Weihnachtsfeiertage, und wir wünschen dir alle – jeder Einzelne in diesem Raum – viel Kraft und alles Gute für 2017! (Allgemeiner Beifall.)
Weitere Wortmeldungen liegen zu diesem Tagesordnungspunkt nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Es ist dies nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir kommen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit, der Antrag ist angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Elektrotechnikgesetz 1992 (ETG 1992) geändert wird (1326 d.B. und 1402 d.B. sowie 9718/BR d.B.)
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Wir gelangen nun zu Punkt 8 der Tagesordnung.
Berichterstatterin ist Frau Bundesrätin Hackl. – Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatterin Marianne Hackl: Geschätztes Präsidium! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bringe den Bericht des Wirtschaftsausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Elektrotechnikgesetz 1992 geändert wird.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, daher komme ich gleich zur Antragstellung.
Der Wirtschaftsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 19. Dezember 2016 mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Bevor wir in die Debatte eingehen, darf ich in unserer Mitte Herrn Staatssekretär Mag. Dr. Mahrer begrüßen. Herzlich willkommen! (Allgemeiner Beifall.)
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Dr. Reiter. – Bitte, Frau Kollegin.
12.51
Bundesrätin Dr. Heidelinde Reiter (Grüne, Salzburg): Hohes Präsidium! Herr Staatssekretär! Werte Kollegen und Kolleginnen! Werte Zuhörer und Zuseher! Das Normungswesen soll auf festere institutionelle und kontrollierbare Beine gestellt werden, so das Ansinnen des Ministeriums – so weit, so gut. Dazu gibt es ein großes Normengesetz, das im letzten Jahr beschlossen wurde, und jetzt die Novelle des Elektrotechnikgesetzes, das sich mit den Normen in diesem Bereich befasst, der also nicht vom großen Normengesetz umfasst ist.
Die Bundesregierung hat zwar ein großes Deregulierungs- und Verwaltungsreformpaket vorgestellt, aber diese Vorgangsweise, nämlich wie überall normiert wird, welch unterschiedliche Gremien dafür geschaffen werden, damit ja alle dabei sind und so weiter, ist davon offensichtlich nicht betroffen. Im Normengesetz gibt es das ASI, hier im elektrotechnischen Bereich das OEK, das Österreichische Elektrotechnische Komitee,
innerhalb des OVE, des Österreichischen Verbands für Elektrotechnik, der natürlich auch oder vielleicht – und das ist nämlich ein kritischer Punkt – vor allem die Interessen seiner Mitglieder vertritt, nämlich die Interessen der Elektroindustrie.
Die Transparenz des Erstellungsprozesses dieser Normen ist mäßig – wer bei einer Norm mitgearbeitet hat oder wie viel Kritik es daran gibt, ist also nicht ersichtlich –, und die kostenlose Zurverfügungstellung von Normen ist da leider genauso schwammig formuliert wie im großen Normengesetz. Es gibt aber natürlich einen entsprechenden Normungsbeirat, der sehr umfangreich besetzt ist – 23 Mitglieder und Ersatzmitglieder, darunter Landwirtschaftskammer, Verteidigungsministerium und natürlich alle neun Bundesländer –, aber einen Vertreter von Umweltagenden braucht man nicht, also diese Vertretung fehlt in diesem Gremium.
Natürlich kann man das Ganze jetzt historisch würdigen: Kelvin war einer der Gründerväter des OVE im Jahr 1906, während das ASI, das im großen Normengesetz diese Aufgaben übernimmt, erst 1920 das Licht der Welt erblickte. Wir schreiben aber das Jahr 2016, und warum das kleine Österreich – mit einer allerdings, und Gott sei Dank, international verflochtenen Wirtschaft – zwei solche Apparate braucht und nicht mit einer schlanken Organisation auskommt, in der transparent und effektiv Normen erstellt werden, die effektiv und zu möglichst niedrigen Kosten zur Verfügung gestellt werden, ist für mich nicht verständlich. Und diese Institution sollte natürlich auch intensiv auf europäischer Ebene an europäischen Normen mitarbeiten, denn dort muss man ja eigentlich hin.
Das bleibt zumindest für uns weiterhin das Ziel, und wir geben uns deshalb mit dem vorliegenden Gesetz nicht zufrieden, sondern lehnen es ab. We could do better, werte Kollegen und Kolleginnen. – Danke. (Beifall der Bundesrätin Schreyer.)
12.54
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Ing. Pum. – Bitte, Herr Kollege.
12.54
Bundesrat Ing. Andreas Pum (ÖVP, Niederösterreich): Geschätzte Frau Präsidentin! Herr Staatssekretär! Werte Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat! Elektrotechnik ist eine Thematik, die vielleicht im ersten Moment ein wenig sperrig klingt, aber bei genauer Betrachtung wird klar, dass sie in vielen Bereichen unseres Lebens beinhaltet ist. So stellen wir wahrscheinlich sehr schnell fest, dass dieses Thema uns im alltäglichen Leben tagein, tagaus begleitet. Betrachten wir Handy, Computer, Zahnbürsten, Fernsehkameras und vieles mehr, dann wissen wir, es gibt unzählige Geräte, die uns in der Vielfalt ihrer technischen Ausführungen immer wieder begleiten und die manches Mal auch schon Ärger hervorgerufen haben: Denken wir nur an den Urlaub im Ausland, wo unterschiedliche technische Normen den Einsatz und Gebrauch erschweren.
Die Wiederaufnahme normierter Angaben bei Elektrizität, Elektrotechnik, Elektronik in die Verordnung ist ein wichtiger und notwendiger Schritt, und daher glaube ich, dass diese Gesetzesänderung natürlich eine wesentliche Verbesserung bringt.
Es ist hier die Einbindung verschiedenster Stellen notwendig. Es ist ein Bereich, der gerade die KMUs, die Klein- und Mittelunternehmer betrifft, aber auch die Gebietskörperschaften, die Sozialpartnerschaft, Behörden, Verbraucher, Arbeitnehmerschutz, Gesundheits-, Umweltschutz, Behindertenorganisationen, nicht zuletzt auch die NGOs, die hier auch immer wieder ihren Beitrag leisten. In Summe gesehen sind es viele, viele Organisationen, die da mitreden und eine Vereinfachung herbeiführen sollen.
Unsere Zustimmung zu diesem Gesetz soll Kosten senken und vor allem das Leben erleichtern. Wir sagen ein sehr klares Ja zu dieser Gesetzesänderung. (Beifall bei der ÖVP.)
12.57
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Pfister. – Bitte, Herr Kollege.
12.57
Bundesrat Rene Pfister (SPÖ, Niederösterreich): Frau Präsidentin! Herr Staatssekretär! Mein Vorredner hat es ja auch schon ausgeführt, die Bedeutung der elektrotechnischen Normung für den internationalen Wettbewerb und auch für die weltweit vernetzte österreichische Volkswirtschaft wird natürlich zunehmend größer.
Elektrotechnik ist mittlerweile aus unserem Leben gar nicht mehr wegzudenken, wenn ich nur daran denke, welche Unterstützungsmöglichkeiten es nicht nur mit dem Handy, sondern auch in vielen anderen Lebensbereichen gibt, wie etwa elektronische Fensteröffnungen, Belüftungssysteme, Verdunkelungs- oder Beschattungsanlagen und so weiter und so fort.
Gleichzeitig ist die Normung in diesem Bereich inzwischen weitgehend ein Ergebnis aus europäischen und internationalen Prozessen, vor denen wir natürlich auch nicht die Augen verschließen können. Der Umfang der elektrotechnischen Normen, die einen rein österreichischen Ursprung haben, liegt nur mehr bei etwa 10 Prozent. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben im Ausschuss am Montag auch die Information bekommen, dass hier in Österreich pro Jahr über 500 Normierungen dazukommen und auch entwickelt werden. Und wenn es um Entwicklung und Weiterentwicklung geht, dann heißt das für uns nicht nur das, was wir hier eingangs in der Aktuellen Stunde diskutiert haben, sondern dass es auch um Bildung, Ausbildung und um Forschung geht, und dann geht es um Arbeitsplätze und dann geht es auch um Fortschritt.
Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit diesem Gesetz bringen wir das auch auf die Reise, dass wir diesen Forschungsschwerpunkt voranbringen, wenn ich nur noch einmal das Beispiel mit der Solartechnik in der Steiermark hervorheben darf, das ebenfalls da darunterfällt, bei dem Klein- und Mittelbetriebe Erfindungen, Entdeckungen oder auch Normierungen vorlegen, durch die der Wirtschaftsstandort Österreich gestärkt und vor allem auch Arbeitsplätze geschaffen werden.
Diese Anwendungsbereiche sind wichtig und, lieber Herr Staatssekretär, ich würde mir auch wünschen, dass es bei den Normungen oder bei den Vorgaben, die erfolgen, mehr einheitliche Lösungen gibt, sodass der Konsument/die Konsumentin zum Beispiel auch einheitliche Ladesysteme verwenden kann, ob das mit den Telefonen zusammenhängt oder mit vielen anderen mittlerweile akkubetriebenen Geräten wie etwa dem Laptop oder dem Tablet.
Daher stimmen wir diesem Gesetzesvorschlag sehr, sehr gerne zu und hoffen, dass bei den Normungen in Österreich nicht nur eine Weiterentwicklung passiert, sondern dass das auch einen Antrieb für die Wirtschaft bedeutet. Natürlich hoffen wir auch, dass Sie als Wirtschaftsstaatssekretär Druck machen, damit es auch für Konsumentinnen und Konsumenten brauchbare und zukunftsträchtige Lösungen gibt. (Beifall bei der SPÖ und bei Bundesräten der ÖVP.)
13.00
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Samt. – Bitte, Herr Kollege.
13.00
Bundesrat Peter Samt (FPÖ, Steiermark): Frau Präsident! Herr Staatssekretär! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Geschätzte Zuhörer vor den Fernsehgeräten! Der vorliegende Entwurf zur Änderung des Elektrotechnikgesetzes stellt ja in Wirklichkeit einen logischen zweiten Schritt im Bereich des österreichischen Rechts für das Normenwesen dar, da wir – wie meine Vorrednerin auch schon gesagt hat – vor einigen Mo-
naten das Normengesetz auf den Weg gebracht haben, dem wir auch die Zustimmung gegeben haben.
Bei diesem Normengesetz allerdings waren explizit sämtliche Regelungen für die elektrotechnischen Normen ausgenommen, das heißt, man hat bereits zu diesem Zeitpunkt gewusst, dass es da eine eigene Gesetzesvorlage geben wird. Frau Kollegin von den Grünen, natürlich gebe ich Ihnen recht. Man könnte jetzt, wenn man das oberflächlich betrachtet, fragen: Wofür brauche ich ein paralleles Normenwesen für die Elektrotechnik? Wofür brauche ich zwei getrennte Datenbanken? Wofür brauche ich zwei eigene Geschäftsordnungen, eine zweite Schlichtungsstelle für diesen Bereich, natürlich auch die Normungsbeiräte?
Auch ich habe mir das mit den Normungsbeiräten sehr genau angeschaut. Natürlich stellt sich die Frage, ob aus den diversen Bereichen tatsächlich – so, wie es jetzt im Vorwort zu diesen Erklärungen dargestellt ist – auch Fachleute der Elektrotechnik entsandt werden. Das ist aber keine neue Erfindung. Zu bemerken ist auch, dass es im Vergleich zum bestehenden Beirat natürlich nicht weniger Beiräte geworden sind. Es stellt sich auch für mich die Frage, warum zwei Universitäten vertreten sein müssen – die TU Graz und die TU Wien können jeweils einen eigenen Beirat stellen.
All das sollte man aber auch unter realistischen Bedingungen betrachten. Meine Vorredner haben es schon ein bisschen angedeutet: Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass die Elektrotechnik einen Großteil unseres Lebens bestimmt. Dazu zähle ich jetzt noch gar nicht das Handy, weil das ja abgesehen von der Tatsache, dass eine Batterie drinnen ist, nicht wirklich mit Elektrotechnik zu tun hat; es fällt eher unter die Kommunikationstechnik.
Was wir aber übersehen und was wir nicht mehr spüren, sind sämtliche Sicherheitseinrichtungen, die wir tagtäglich benutzen, indem wir heute Elektrogeräte bedienen, die Schutzspannungsverkleidungen haben, die Schutzklasse 2 entsprechen, die schutzisoliert sind, bei denen wir davon ausgehen, dass uns nichts mehr passieren kann. Man kann heute die Schwiegermutter nicht mehr um die Ecke bringen, indem man den Föhn in die Badewanne wirft. Das funktioniert nicht, weil die Sicherheitseinrichtungen, die wir seit vielen, vielen Jahren haben – und auf die können wir in Österreich auch stolz sein – das auch tatsächlich verhindern, nämlich der FI-Schutzschalter. (Zwischenruf bei der ÖVP. – Zwischenruf des Bundesrates Novak.) – Na ja, da hat es ja ganze Kriminalfälle gegeben.
Faktum ist, dass das Bereiche sind, die in Österreich nicht nur über das normale Normenwesen geregelt sind, geschätzte Damen und Herren, sondern die Gesetzeslage sind. Das heißt, jedes Elektrounternehmen, das heute eine Hausinstallation durchführt, richtet sich nicht nur nach Normen und Richtlinien, so wie im Maschinenbau, sondern nach sicherheitstechnischen Vorgaben, für deren Einhaltung es haftet. Wenn es die nicht einhält, steht es im Kriminal. Da gibt es dann kein Zivilverfahren, sondern da wird der Staatsanwalt eingeschaltet und man wird wegen Fahrlässigkeit verknackt.
Das bedeutet, dass wir in Österreich mit dieser Normengesetzgebung, die wir in diesem Bereich haben, trotz aller EU-Harmonisierungsbedürfnisse, die es gibt – das möchte ich dazusagen –, wie in vielen anderen Bereichen seit vielen Jahrzehnten richtungsweisend sind. Die Normen sind eben tatsächlich Sicherheitseinrichtungen, damit wir ruhig leben, damit wir einen Straßenlaternenmasten angreifen können, ohne Angst haben zu müssen, dass wir tot umfallen, und sonstige Dinge machen können, die wir heute ja gar nicht mehr so zur Kenntnis nehmen.
Das bedeutet für uns: Wir haben seit vielen, vielen Jahren Sicherheitsstandards eingerichtet, die wir über das Elektrotechnikgesetz auch zum Gesetz erhoben haben, in vielen Bereichen durch die Normierung unterstützt. Diese muss mit allen Dingen, die von außen kommen, natürlich harmonisiert werden, ist aber trotz dieser im ersten Augenblick vielleicht überbordenden Verwaltung eine, die man gutheißen soll und kann.
Verschlanken, geschätzte Damen und Herren, kann man immer, aber an dem Gesetz beziehungsweise an der Normungsgebung innerhalb des Elektrotechnikgesetzes können und dürfen wir nicht rütteln. – Danke schön. (Beifall bei der FPÖ sowie bei Bundesräten von SPÖ und ÖVP.)
13.05
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Ich darf nun den Herrn Staatssekretär um seinen Redebeitrag ersuchen. – Bitte.
13.05
Staatssekretär im Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft Mag. Dr. Harald Mahrer: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Abgeordnete! Ich möchte ganz kurz darauf hinweisen, dass ich hoffe, dass in Österreich die ganz große Mehrzahl der Elektrogeräte nicht zweckentfremdet verwendet wird, wie es von Herrn Kollegen Samt angesprochen wurde. (Allgemeine Heiterkeit.) Ich möchte jetzt nicht im Detail auf die Anregungen eingehen, aber in der Vorweihnachtszeit mutet eine derartige Form etwas eigenartig an. Ich hoffe, dass die Normung ihren notwendigen Beitrag dazu leistet, das zu verhindern.
Nun zum von Frau Dr. Reiter angesprochenen Punkt, zum Thema Internationalisierung: Ich habe das bereits im Nationalrat gesagt, möchte das aber hier noch einmal wiederholen, damit klar ist, warum es eine zweiteilige Struktur gibt: Wir haben eben den gesamten Bereich das Normungswesen betreffend auf europäischer Ebene im CEN, also im Europäischen Komitee für Normung, und auch dort ist der gesamte Bereich Elektronik und Elektrotechnik ausgenommen; dafür gibt es das CENELEC. Genau deswegen haben wir das auch spiegelgleich so gemacht. Ansonsten würden alle anderen Argumente natürlich zutreffen, und wir könnten fragen, warum wir das nicht schon mit dem Normengesetz in einem Aufwaschen vernünftig erledigt haben. Das ist so, weil es dazu eben einen eigenen internationalen und europäischen Strang gibt.
Das ist der Grund dafür, dass es diesbezüglich eine Zweiteilung gibt und das so vorgenommen wurde, daher lässt sich das auch sachlich argumentativ gar nicht anders darstellen. Wir sind eben genau dem Beispiel gefolgt, das Sie eigentlich eingefordert haben, nämlich eine internationale, eine europäische Orientierung. Das ist die Faktenlage, und an der können wir nicht rütteln. Alles andere haben die Bundesräte ohnehin schon angeführt.
Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit noch einmal bei Dipl.-Ing. Mag. Dittler aus dem Ministerium bedanken – langjähriger Abteilungsleiter –, der jetzt in den Ruhestand tritt. Es ist sein letztes Gesetz, und da möchte man auch einmal Danke sagen. Er hat für den gesamten Bereich der Elektrotechnik, der elektronischen Sicherheit in den letzten Jahrzehnten mit seinem Team immer darauf geschaut, dass alles perfekt funktioniert. Ich weiß, da war die Zusammenarbeit mit dem Hohen Haus und den Ausschüssen auch immer gut, ich möchte daher vonseiten der Regierung noch einmal Danke sagen, und ich möchte auch Ihnen danken, dass Sie die Umsetzung hier durchsetzen. – Danke. (Allgemeiner Beifall.)
13.07
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Es ist dies nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir kommen nun zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
9. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein Innovationsstiftung-Bildung-Gesetz erlassen und das Einkommensteuergesetz 1988 und das Körperschaftsteuergesetz 1988 geändert werden (Innovationsstiftungsgesetz – ISG) (1350 d.B. und 1383 d.B. sowie 9717/BR d.B.)
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Wir gelangen nun zu Punkt 9 der Tagesordnung.
Berichterstatterin ist Frau Bundesrätin Grimling. – Ich ersuche um den Bericht.
Berichterstatterin Elisabeth Grimling: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Staatssekretär! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der gegenständliche Bericht des Ausschusses für Innovation, Technologie und Zukunft über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein Innovationsstiftung-Bildung-Gesetz erlassen und das Einkommensteuergesetz 1988 und das Körperschaftsteuergesetz 1988 geändert werden, liegt Ihnen in schriftlicher Form vor; daher komme ich gleich zur Antragstellung:
Der Ausschuss für Innovation, Technologie und Zukunft stellt nach Beratung der Vorlage am 19. Dezember 2016 mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Mag. Pisec. Bitte verzeih mir, Herr Kollege, ich werde deinen Nachnamen nie richtig aussprechen. Ich bitte um Nachsicht. – Bitte. (Bundesrat Pisec – auf dem Weg zum Rednerpult –: … Vertrauen in deine Präsidentschaft! – Bundesrat Schennach: Aber diese Kontrarede folgt jetzt nicht dem Verlauf …!)
13.10
Bundesrat Mag. Reinhard Pisec, BA (FPÖ, Wien): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Staatssekretär! Sehr geehrte Damen und Herren! Dieses Gesetz ist das Innovationsstiftung-Bildung-Gesetz und wurde dotiert mit 50 Millionen € für die nächsten zwei Jahre aus der Stabilitätsabgabe, besser bekannt als Bankenabgabe – diese Abschlagszahlung, die die Banken jetzt leisten mussten. Das ist aber dann der nächste Tagesordnungspunkt, zu dem werde ich jetzt nicht sprechen.
Sehr geehrter Herr Staatssekretär, ich schätze Ihre hehre Absicht sehr, allein mir fehlt der Glaube; das möchte ich vorweg sagen. Sie rufen hier – ich beziehe mich auf „studium.at“, ich nehme an, dass das richtig wiedergegeben worden ist –, wenn man das jetzt so nachvollzieht, gleichsam eine neue Galaxie für Österreich aus, gleichsam das Internet 10.0. Wir fahren alle ab und entwickeln ein Unternehmen mit einem Wert von 1 Milliarde US-Dollar, und das ist unter den Top 10 weltweit. (Bundesrat Schennach: Aber im Ausschuss waren Sie doch sehr beeindruckt!) Also ich glaube, es geht um 1 Milliarde US-Dollar, aber wir sind mit diesen österreichischen Rahmenbedingungen noch eine Milliarde Kilometer davon entfernt, solche Sachen umzusetzen; das muss ich ganz offen sagen.
Sie sprechen viel über Digitalität, und das ist ja das Wichtigste, Digitalität ist die Modernität, ist Internet 4.0. Das ist das, womit sich die Wirtschaft, womit sich die Industrie auseinandersetzen muss und sollte; deswegen brauchen wir Nachwuchskräfte, innovative Kräfte, die mit diesem Programm ausgebildet und an die Forschung, an die Entwicklung herangeführt werden sollten, die letztlich diese innovativen Kräfte befeuern und entstehen lassen sollen. Das Wort Digitalität im Sinne Ihrer Education Technology finde ich im Gesetz nicht.
Die Beilagen, die das Parlament da angeführt hat, sind ja sehr ehrlich. Da gibt es einen Bericht von der Europäischen Kommission, der ganz nüchterne Zahlen über die Inno-
vationskraft Österreichs zeigt, und zwar, dass wir in Österreich im Jahr 2009 noch circa 10 Prozent über dem EU-Durchschnitt lagen, aber im Jahr 2014 nur mehr 5 Prozent über dem EU-Durchschnitt. Ich zitiere: „In den Jahren 2014 und 2015 büßte Österreich weiter an Innovationskraft ein.“ Dort werden auch gleich die Ursachen festgestellt, warum dies der Fall ist.
Punkt 1: Schwäche im Venture-Capital-Bereich. Das heißt, wir haben keinen Kapitalmarkt, keinen Finanzmarkt; das kommt dann beim nächsten Tagesordnungspunkt. – No na, wenn man den Finanzmarkt in Österreich mehr oder minder zusammengehaut hat, dann darf man sich nicht wundern, wenn man keine Finanzierung zusammenbringt, denn mit 50 Millionen €, unter uns gesagt, werden Sie keine Milliardenunternehmen heranzüchten können. Allein die Cash-Kassa von Apple ist so groß wie das BIP Österreichs, nämlich 350 Milliarden €, circa 370 Milliarden Dollar.
Punkt 2: Es gibt nur eine geringe Anzahl von Doktoranden aus Drittstaaten; das ist der Grund dafür, dass in Österreich keine Innovationskraft entsteht. Das heißt, es kommen keine ausländischen Wissenschaftler und Forscher nach Österreich. – Auch no na: Wenn Sie einen ausländischen Wissenschaftler, einen Forscher, mit dem Nettogehalt eines Wissenschaftlers, das an österreichischen Universitäten vergeben wird, locken, sehr geehrter Herr Staatssekretär, haben Sie keine Chance, ausländische Wissenschaftler, Forscher und Doktoranden anzuwerben, außer Sie machen Sonderverträge. Das ist ein anderes Kapitel. Offensichtlich ist das aber nicht der Fall.
Drittens – und das freut mich ganz besonders, denn das habe ich im Bundesrat vor zwei, drei Jahren schon einmal erwähnt; es ist immer schön, wenn man die Bestätigung bekommt –: die geringen Erträge aus Lizenzen und Patenten aus dem Ausland. Das ist ja das Wichtigste, und das hat die Schweiz festgestellt, die die Unternehmenssteuerreform Nummer drei gemacht hat, die vor wenigen Monaten abgeschlossen worden ist. In England hat das David Cameron gemacht. Das ist eine wirklich konservative Partei in England, die kümmert sich um die Wirtschaft. Die ÖVP ist ja – ich muss es noch einmal sagen – so eine Verwaltungspartei, das ist unglaublich, das ist bar jeder Realität. (Beifall bei der FPÖ. – Bundesrat Mayer: Aber wir sind noch in der EU!) Das ist der Beweis, warum das nicht funktioniert. (In Richtung des Bundesrates Mayer:) Du liegst sehr nahe an der Schweiz. Schau ein bisschen über deinen Tellerrand hinaus!
Die Schweiz ist gescheit, die hat Lizenzen eingeführt, und zwar mit einer Besteuerung von 10 Prozent, denn dort hat man nämlich gewusst: Mit diesen Lizenzgebühren und Patenten aus dem Ausland bekommt man die Wissenschaftler, bekommt man Erfindungen. Wenn du über deinen Tellerrand auch einmal nach Deutschland blickst, siehst du, dort hat sich – denn Innovation ist praktisch die Summe aus Erfindungen und aus Umsetzung, dazu komme ich später – 2014 bis 2015 die Innovationskraft der privaten Unternehmensleistungen verdoppelt. Bei uns hinken wir hinterher, weil die Rahmenbedingungen nicht und nicht stimmen.
Wie gesagt, Herr Staatssekretär, ich schätze Ihre hehre Absicht, die aus dem Interview deutlich wird, aber ich muss der Realität im Gesetz nachgehen, und die schaut leider ein bisschen anders aus.
Damit komme ich auch zu einem, der sich mit dem Innovationsbegriff sehr intensiv und als Erster auseinandergesetzt hat. Das war Joseph Schumpeter in seinem Werk „Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung“. Was ist Innovation? – Wie schon erwähnt: Das ist die Erfindung und die Umsetzung im Rahmen der Unternehmenslandschaft; dort wird die Innovation realisiert.
Wenn ich mich jetzt dem Gesetz widme: Dieses Gesetz ist auch zu weit gefasst, das sieht man einfach. Es fehlt mir die geradlinige Zielorientierung. Es geht von Unis, Universitäten, den Bologna-Zielen – das ist ja sehr löblich –, Fachhochschulen, Schulen bis
zu gemeinnützigen Einrichtungen. Wir haben ja im Ausschuss gehört, es ist auch die Feuerwehr dabei. Natürlich ist die Feuerwehr etwas sehr Löbliches, aber sie ist kein Milliardenunternehmen. Das hat mit Digitalität nicht zwingend etwas zu tun.
Was wir, was Forscher und Wissenschaftler, sehr geehrter Herr Staatssekretär, definitiv ablehnen, ist die Unterwerfung unter das politische Parteiensystem in Österreich. Das wollen wir definitiv nicht. Warum? – Hier steht drinnen, die Entscheidung über Forschungsanträge im Rahmen dieser Stiftung wird von sechs Personen gefasst – über die Ausbildung, die diese sechs Personen vorweisen müssen, steht nichts drinnen (Bundesrat Schennach: Ja, den Portier schicken sie nicht hin!) –: drei aus Ihrem Wirtschafts- und Wissenschaftsministerium, das sind die Schwarzen, und drei aus dem Bildungsministerium, das sind die Roten – eine typische rot-schwarze Verteilungsgeschichte.
Ich darf der gesamten Bundesregierung sagen, und darauf legt die Wissenschaft Wert: „Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei.“ Das ist Artikel 17 des Staatsgrundgesetzes von 1867. (Bundesrat Mayer: Das stellt ja niemand infrage!) Die Wissenschaft lässt sich niemals durch parteipolitische Geschichten instrumentalisieren, wie in diesem Gesetz vorgesehen; daher passt das nicht.
Wir von der FPÖ suchen die Bedürfnisse und den Nutzen für die Bevölkerung. Es geht um Förderungen. Ich muss mich aber auf die Aussagen des Herrn Staatssekretärs beziehen, der die digitale Welt neu erfinden möchte. Das klappt mit diesem Gesetz nicht. (Bundesrat Stögmüller: Ja, aber es ist ein wichtiger Schritt …!) – Das wird so nicht klappen. Da steht etwas anderes drin. Ich muss mich an das Gesetz halten. Sicher kann man sagen, Papier ist geduldig, wir machen es anders, aber das ist das Gesetz. Es ist so, tut mir leid. Die Verzahnung von Wissenschaft und Wirtschaft ist ja das Wichtigste. Die Idee, dass die Wissenschaft in die Wirtschaft kommt oder die Wirtschaft in die Bildung, dass junge Menschen praktisch herangeführt werden – das habe ich ja schon gesagt – ist ja sehr hehr, ist ja sehr löblich, aber das steht da nicht drinnen.
Ganz kurz noch ein Wort zur Forschung: Die Digitalisierung, das Scannen von Büchern, das Uploaden in das Internet bedeuten Produktivitätsfortschritt schlechthin. Das hat die Arbeitszeit für Forscher locker, aber das unterschätze ich jetzt, um das Dreifache reduziert und die Effizienz damit um das Dreifache erhöht, weil die Bücher online, virtuell im Internet gelesen werden können. Da ist Österreich – das habe ich beim Wirtschaftsparlamentsempfang schon einmal erwähnt – sehr, sehr weit hinten. Dazu kommt, dass die Bildungssprecherin der ÖVP allen Ernstes gesagt hat, junge Menschen lesen nicht mehr. (Zwischenruf des Bundesrates Stögmüller.) – Liest du nicht mehr? (Neuerlicher Zwischenruf des Bundesrates Stögmüller.) – Siehst du, du liest, eben!
Junge Menschen lesen. Die Bibliothek wurde aber 2012 demontiert, die gibt es nicht mehr. (Bundesrat Stögmüller: Das ist schade!) In der Wirtschaftskammer Wien, am Stubenring, wurde die Bibliothek 2012, obwohl denkmalgeschützt, obwohl Präsenzbibliothek, demontiert, ohne dass eine virtuelle Onlinebibliothek, wie es in Amerika üblich ist, wie es in Großbritannien üblich ist, wie es mittlerweile auch in Deutschland und sogar in Slowenien üblich ist, auch in Tel Aviv, eingerichtet wurde. Die Bibliothek wurde abgerissen, die gibt es nicht mehr. Die Bücher verstauben wahrscheinlich, der Bücherwurm frisst sie. Das wollen wir nicht. Wo finde ich aber das Buch von Schumpeter auf Deutsch? – In amerikanischen Bibliotheken, in britischen Bibliotheken finde ich es, aber in Österreich nirgends.
Wir wollen die Innovationskraft der Unternehmen stärken, so wie in Deutschland. Mit einer Forschungsprämie von 10 bis 12 Prozent werden Sie nichts zusammenbringen, sehr geehrter Herr Staatssekretär. Da werden Sie Unternehmen, Innovationskräfte nicht hinter dem Ofen hervorholen können. Sie müssen die auf 25, 30 Prozent erhöhen. Der Investitionsfreibetrag muss auch auf 30 Prozent erhöht werden, oder es muss – noch
besser – einen Gewinnfreibetrag für Investitionen geben, denn Innovationen werden ja zu Investitionen.
Ausländische Forscher bekommen Sie mit diesem Nettogehalt nicht, das ist Faktum. Da gibt es andere, bessere Standorte. In einer globalisierten Welt zählt der Wettbewerb. Das gilt auch für die Forschung, das gilt auch für junge Unternehmen, und deswegen wandern junge Unternehmen auch reihenweise ab.
Ganz zum Schluss noch: Schumpeter habe ich auch deswegen ausgesucht, weil er damals in den Dreißigerjahren von der Rockefeller Foundation – mittlerweile eine Universität in New York, sie heißt Rockefeller University – abgeworben wurde. Die Rockefeller Foundation warb gezielt Köpfe aus Europa ab; in den Dreißigerjahren war das so, Schumpeter war einer davon. Er hat eine riesige, gigantische Karriere an der Harvard University gemacht.
Man sollte sich das einmal anschauen und nicht das Rad neu erfinden, denn solche Stiftungen gibt es in den USA schon überall, und das ist mit diesem Gesetz einfach nicht stringent zu leisten. (Vizepräsidentin Winkler gibt das Glockenzeichen.) – Ich bin schon am Schluss. – Dazu fehlt auch der Breitbandausbau für ein leistungsstarkes Internet, das in Österreich leider, leider noch nicht flächendeckend vorhanden ist. Daher wird auch die Industrie 4.0 nicht so umgesetzt werden können wie geplant.
Wie gesagt: keine Kritik an Ihnen ad personam, denn ich schätze Sie und Ihre hehren Absichten sehr; es steht aber nicht so im Gesetz. – Danke. (Beifall bei der FPÖ.)
13.20
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Anderl. – Bitte, Frau Kollegin.
13.20
Bundesrätin Renate Anderl (SPÖ, Wien): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Staatssekretär! Werte Kolleginnen, werte Kollegen! Liebe Zuseherinnen und Zuseher vor den Bildschirmen! Ich kann jetzt leider nicht direkt auf Bundesrat Pisec eingehen, das hat den Grund, dass ich ihn auf der Seite, auf der ich gesessen bin, sehr, sehr schlecht verstehen konnte. Was ich aber schon verstanden habe, ist, dass wir es immer wieder schaffen, hier alles schlechtzureden. Natürlich wird im Bereich Technologie noch ganz, ganz viel zu machen sein, noch ganz viel vor uns liegen.
Ich denke aber, wir haben heute hier über etwas zu diskutieren, das auch mit der Bildung zusammenhängt. Wir sind ständig bemüht, Bildung zu reformieren. Wir sprechen immer wieder darüber, wie wichtig Bildung ist, und meiner Meinung nach wird mit der Innovationsstiftung für Bildung ein weiterer wesentlicher Schritt zur Förderung von Bildung getan.
Die Innovationsstiftung bringt die kontinuierliche Anhebung des Bildungsniveaus und der Innovationskompetenz aller Altersgruppen in Österreich, und das ist es, was wir als Vorteil sehen. Bildung, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, beginnt nicht erst, wenn man die erste Klasse Volksschule besucht, sondern Bildung beginnt bereits im Kleinstkindalter, im Kindergarten. Als GewerkschafterInnen haben wir uns dazu entschlossen, wenn wir über Kindergärten sprechen, dass wir Kinderbildungseinrichtungen meinen, weil wir davon überzeugt sind, dass unsere Kinder schon im Rahmen der Elementarpädagogik, in der Kinderkrippe durch unsere sehr gut qualifizierten und vor allem bestens ausgebildeten PädagogInnen die erste Bildung konsumieren.
Elementarbildung findet einerseits in der Familie statt, andererseits in institutionellen Einrichtungen wie der Kinderkrippe, altersweiten Kleingruppen, dem Kindergarten und der Vorschule. Damit endet Bildung aber nicht, sie endet auch nicht mit dem Ende der Schulpflicht, und sie endet auch nicht mit einer Lehrausbildung, sondern Bildung be-
gleitet uns ein ganzes Leben lang. Daher versuchen wir heute, mit der Innovationsstiftung für Bildung einen neuen Weg zu beschreiten.
Mir ist schon bewusst, dass es immer, wenn wir neue Wege gehen, etwas Neues machen, Skepsis gibt. Wir versuchen damit, ein neues Instrument zu schaffen, das bei Kinderbildungseinrichtungen ansetzt, in Schulen, in Forschungseinrichtungen, aber auch in den Betrieben. Erwähnenswert ist dabei vor allem, dass bei diesem Zukunftsthema vier Agenturen, nämlich AWS, OeAD, FWF und FFG zusammenarbeiten. Wir wollen ganz unbürokratisch – das ist ein wesentlicher Aspekt – die Menschen, die Projekte entwickeln, direkt dort abholen. Genau das werden wir in Zukunft auch dringend benötigen, denn durch Digitalisierung, Industrie 4.0 werden die Arbeitsplätze von heute sicher nicht die Arbeitsplätze von morgen sein.
Wenn wir von Industrie 4.0 sprechen, dann reicht es nicht, wenn wir von einer Bildung 1.0 sprechen. Auch dort müssen wir dringend ansetzen. Die ersten engagierten Schritte hat ja die vorige Bildungsministerin Gabi Heinisch-Hosek schon gesetzt, und unsere jetzige Bildungsministerin Sonja Hammerschmid setzt gemeinsam mit Herrn Staatssekretär Mahrer den gleichen Weg fort. Und ja, dieser Weg ist der richtige, denn, wie schon erwähnt, wir leben in einer sich sehr rasch verändernden Arbeitswelt und wir müssen jetzt und heute Menschen auf zukünftige Arbeitsplätze vorbereiten, für zukünftige Arbeitsplätze ausbilden, die wir unter Umständen noch gar nicht kennen.
Daher setzen wir mit dieser Maßnahme nicht nur einen ganz wichtigen Schritt im Bereich Bildung, sondern wir öffnen uns auch neuen, kreativen Ideen. Einen neuen Weg zu beschreiten, geht immer mit einer gewissen Unsicherheit einher, aber wir sollten jenen Menschen, die sich tagtäglich mit Bildung auseinandersetzen, unser Vertrauen schenken, darauf vertrauen, dass sie uns mit ihrem Know-how auf das eine oder andere hinweisen.
Zum Schluss noch ein Ausspruch von Michael Jackson: Niemand kann dir besser beibringen, wie man es richtig macht, als jemand, der schon dort gewesen ist, wo du jetzt bist, und weiß, was in dir vorgeht.
Das Motto sollte also stets lauten: Lernen wir doch einfach von den Besten, gehen wir es an!, denn Innovation und Bildung sind zentrale Zukunftsthemen. Es geht um Beschäftigung, es geht um den Wohlstand, und es geht vor allem auch um die Zukunftschancen unserer Jugend. Geben wir unserer Jugend eine Chance! – Danke schön. (Beifall bei der SPÖ.)
13.26
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Seeber. – Bitte, Herr Kollege.
13.26
Bundesrat Robert Seeber (ÖVP, Oberösterreich): Hohes Präsidium! Sehr geehrter Herr Staatssekretär! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe vor circa drei Wochen meine Antrittsrede hier im Bundesrat gehalten und habe als einen der Teilaspekte in meiner Rede auch die Digitalisierung angesprochen, einen Bereich, der uns alle in der Bevölkerung betrifft. Mit „alle“ meine ich alle, von Jung bis Alt.
Ich sage das deswegen, weil das untrennbar mit dem Thema meines heutigen Redebeitrags verbunden ist, nämlich dem Innovationsstiftungsgesetz. Dieses Gesetz, meine Damen und Herren, soll letztendlich das Bildungsniveau in unserem Lande anheben und unterstützen.
Sie wissen, ich komme aus dem Land Oberösterreich. Oberösterreich ist das Exportland Nummer eins. Sie wissen auch: Ich stehe hier als Wirtschaftler, als Unternehmer. Und ich weiß, dass wir, das Exportland Oberösterreich, wesentlich zum Erfolg Öster-
reichs beitragen, denn der Export ist der Wachstumstreiber schlechthin. Ich sage das im Zusammenhang mit diesem Gesetz, weil es indirekt auch damit verbunden ist, denn: Was brauchen wir in Zukunft, meine Damen und Herren? – Wir brauchen in Zukunft innovative Technik, innovative Produktionen und bestens ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – und dieses Gesetz, welches hier beschlossen wird, ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Wir als Politiker, als Politik insgesamt sind gefordert, für diese Forschungs- und Bildungslandschaft einen wesentlichen Beitrag zu leisten. Ich sage immer dazu: Eine ausreichend geförderte Innovationspolitik ist auch die beste Sozialpolitik für morgen, das darf man nie vergessen. Abgesehen von diesem Innovationsstiftungsgesetz spreche ich mich generell dezidiert für eine breite öffentliche Förderungspolitik für alle Bereiche, die Innovation und Forschung betreffen, aus. Wir wissen heute alle, meine Damen und Herren, dass Forschung und Innovation die Wachstumstreiber unserer Gesellschaft sind und letztendlich auch in Zukunft genügend entsprechend gesicherte Arbeitsplätze bieten werden, daher kann man diesem Aspekt gar nicht genug Bedeutung beimessen.
Wir wollen Österreich zum Vorreiter in der Bildungstechnologie machen. Mit diesem Gesetz werden auch Start-up-Unternehmen gefördert. Wir haben es heute schon von einem Vorredner gehört: Mit 50 Millionen € vom Finanzministerium ist das dotiert. Ich sage dazu: Das ist eine moderne Politik, da gibt es kein Gießkannenprinzip, das wird zielgerichtet ausgeschüttet.
Ich sage an dieser Stelle auch Folgendes: Es wird einen externen Beirat geben, externe Experten sind dabei. Sie wissen, ich bin auch in der Sozialpartnerschaft als Interessenvertreter tätig, aber bei diesem Gesetz gibt es keine Sozialpartner, das könnte man auch einmal erwähnen. Meiner Meinung nach ist das eine moderne Art der Förderung, denn es arbeiten alle vier Bundesagenturen zusammen. Es gibt keine Förderlücke, das muss man einmal sagen, das ist einzigartig in Österreich.
Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich die hervorragende Vorarbeit und Ausgestaltung von Bundesministerin Sonja Hammerschmid und unseres Staatssekretärs Harald Mahrer hervorheben, denn das ist wirklich ein Schritt in die richtige Richtung, und ich bedanke mich ausdrücklich. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
Meine Damen und Herren, um zum Schluss zu kommen: Förderung von Innovation und Forschung ist das, was die Zukunftsfähigkeit unseres Landes letztendlich sichert, und das ist mir ein echtes Anliegen.
Ein kleiner Wermutstropfen für mich ist Folgendes: Ich hätte mir natürlich eine Allparteienregelung beziehungsweise eine Zustimmung aller gewünscht. Mir ist schon klar, dass wir hier im Bundesrat mehrere gesellschaftspolitische Parteien sind, und ich bin überzeugt davon, dass Bildung jedem ein Anliegen ist, aber aus gesellschaftspolitischen Gründen hat halt jeder einen anderen Ansatz. Das ist in der Demokratie legitim, aber bei diesem Gesetz überwiegt das Positive, das wiederhole ich noch einmal.
Ich würde mir wünschen, dass die FPÖ, die jetzt nicht zustimmt, vielleicht bei den späteren Evaluierungen zustimmt (Bundesrätin Mühlwerth: Na, macht halt einmal ein gescheites Gesetz, dann stimmen wir eh zu!) – wir sind schon auf dem richtigen Weg –, das würde mich auf jeden Fall freuen.
Ich bedanke mich an dieser Stelle für diesen Vorschlag. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich ersuche Sie auch im Sinne der Zukunftsfähigkeit Österreichs, das zu unterstützen, und darf abschließend auch noch schöne Feiertage wünschen. – Danke. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
13.32
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Stögmüller. – Bitte, Herr Bundesrat.
13.32
Bundesrat David Stögmüller (Grüne, Oberösterreich): Sehr geehrtes Präsidium! Sehr geehrter Herr Staatssekretär! Sehr geehrte Damen und Herren! Mein oberösterreichischer Kollege hat schon einiges ausgeführt, da kann ich vieles unterstreichen, auch unterstützen. Ich denke, Bildung ist ein Bereich, der finanziell sehr aufwendig ist, und da kann dieses Innovationsstiftungsgesetz sehr wohl einen positiven Beitrag leisten. Positiv ist zum Beispiel, dass alle Bildungsbereiche davon betroffen sind, das bringt auch wieder Vernetzung. Vernetzung ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich, gerade in der Bildung, und das finde ich auch sehr positiv.
Was will diese Stiftung erreichen? – Zum einen soll auf guten forschungs-, bildungs- und innovationspolitischen Strategien und Programmen aufgebaut werden. Es soll eine Anhebung der Innovationskompetenzen und allgemein eine Anhebung des Bildungsniveaus erfolgen. Ein Punkt ist dabei, den ich sehr spannend finde: die Umsetzung von systemisch ausgerichteten Pionier- und Modellregionen, die Investitionsimpulse im österreichischen Bildungssystem setzen sollen.
Ich glaube, die Schaffung dieses Gesetzes ist ein ganz neuer und guter Weg, um Bildung, Forschung und Wissenschaft allgemein besser zu vernetzen und in Österreich ausbauen zu können. Bei der Schaffung der Stiftung ist allgemein aufgefallen, dass es sich um eine sehr schlanke Führungsstruktur handelt, zum Beispiel arbeiten alle Stiftungsräte und -rätinnen ehrenamtlich. Natürlich ist das wieder proporzmäßig besetzt; das ist ein österreichisches Problem, da kann ich mich auch Ihrer Kritik anschließen, aber das ist eine andere Sache.
Die Sparsamkeit und die Zweckmäßigkeit werden aber vom Rechnungshof überprüft, das ist auch sehr gut so, obwohl – und das ist, glaube ich, auch im Nationalrat als Kritik angekommen – dieser zur Begutachtung dieses Gesetzes nur vier Tage Zeit gehabt hat; das nur als kleine Kritik am Rande.
Die Idee, eine Stiftung zu gründen – da muss man auch ein bisschen die Hintergründe anschauen –, entstand ja auch aufgrund des Problems, dass im Bildungsressort 191 Millionen € an Budget fehlen und dann natürlich die 50 Millionen € für etwas Dringenderes benötigt oder zumindest sofort aufgesaugt werden. Dafür hat man diese Stiftung auch gegründet, und natürlich auch, das finde ich auch interessant, um private Mittel für Innovationsstiftungen einzutreiben. Das finde ich persönlich spannend, weil es die Möglichkeit schafft, Substiftungen zu gründen, die dann mit einem eigenen Namen bei privaten Investoren um private Förderungen ansuchen können. Diese werden aber auch vom Rechnungshof überprüft, soweit ich es verstanden habe; das finde ich auch sehr gut und wichtig.
In einem Jahr bekommen wir dann einen Jahresbericht vorgelegt, und dann haben wir auch Zeit, zu evaluieren. Ich bin gespannt und gratuliere Ihnen, Herr Staatssekretär, auch im Namen unserer Bundesratsfraktion, zu einem Beinahe-Allparteienantrag, zumindest im Nationalrat, und im Bundesrat zumindest von jenen Parteien, denen Bildungszukunft wichtig ist. (Ironische Heiterkeit bei der FPÖ. – Bundesrat Krusche: Ein Scherzkeks!)
Das soll aber, und dafür plädiere ich schon noch einmal, nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Bildungsressort eine Unterfinanzierung in Höhe von 191 Millionen € besteht. Dies als Anmerkung und als Appell zum Schluss. – Vielen Dank. (Beifall bei den Grünen sowie des Bundesrates Schennach.)
13.35
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Zu Wort gemeldet ist Herr Staatssekretär Dr. Mahrer. – Bitte, Herr Staatssekretär.
13.35
Staatssekretär im Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft Mag. Dr. Harald Mahrer: Meine Damen und Herren! Die zentralen Punkte dieses Ge-
setzes sind, glaube ich, angesprochen worden: Es ist extrem schlank gemacht worden, es ist damit ein richtungsweisendes Gesetz. Zum ersten Mal arbeiten alle Förderagenturen des Bundes zusammen. Sie sind dadurch gezwungen, ihre Prozesse so zu strukturieren, dass sie das im Sinne eines One-Stop-Shop-Verfahrens – ich begrüße den Herrn Finanzminister, der dieses Thema ja immer vonseiten des Finanzministeriums vorantreibt – so umsetzen, wie wir uns das als Bürgerinnen und Bürger wünschen, nämlich effizient, effektiv und sparsam im Sinne der Steuerzahler und Steuerzahlerinnen, was Sie vonseiten der Freiheitlichen Partei auch immer einfordern. Sie müssen dann schon die Kirche im Dorf lassen; ich habe das mit Kollegen Deimek im Nationalrat auch schon besprochen.
Die Kritik geht natürlich ins Leere, wenn das Gesetz schlank gemacht ist und die Sozialpartner draußen sind. Und es geht nicht um eine Proporzbesetzung, sondern natürlich nominieren die Fachministerien die externen Experten. Wer soll sie sonst nominieren, irgendeine externe dritte Behörde? Es ist auch sonst üblich im Universitäts- und Wissenschaftsbereich, dass für die jeweiligen Tickets Experten nominiert werden, das halten wir beim Rat für Forschung und Technologieentwicklung so, beim Wissenschaftsrat. Das sind alles ausgezeichnete Persönlichkeiten mit internationalem Ruf, die mit ihrer Expertise auch immer genau das kritisieren, was sie kritisieren sollen, oder die Expertise zweckdienlich einbringen. Da kann man einmal bei dem Gesetz überhaupt nichts hinterfragen.
Dieses Gesetz ist auch so transparent entstanden wie noch kein anderes. Für die Vorinformation möchte ich mich explizit bei Herrn Ministerialrat Dr. Smoliner und seinem Team bedanken, die allen Interessierten im Vorfeld ganz offen und transparent zugänglich gemacht haben, was wir da intendieren.
Es ist eine neue Herangehensweise, ja, sie birgt ein gewisses Risiko in sich, aber das hat dieses Projekt nun einmal an sich. Wir wollen ja Neues, Unbekanntes mit diesem Projekt fördern, und zwar bottom-up und nicht top-down, also von unten herauf, genau diejenigen kreativen Kräfte, die diese Mittel sonst möglicherweise nicht bekommen. Wir wollen sie nicht mit der Gießkanne bedienen, sondern genau die Innovation fördern, die wir im Bildungsbereich brauchen, mit dem starken Fokus auf Digitalisierung, auch auf Begabtenförderung und natürlich auf neue Modelle im Bereich der Pädagogik und Didaktik.
Es geht nicht nur um die Kinder – die Zielgruppe ist breiter, das ist richtig –, sondern vor dem angesprochenen Hintergrund der Digitalisierung wollen wir auch innovative Projekte fördern, die dann möglicherweise mit Partnern aus der Industrie – darum das Konzept der Substiftung – für die Requalifizierung der Arbeitnehmerschaft in Anspruch genommen werden sollen.
Ich glaube, viel mehr und viel besser kann man ein Modell, das es in ganz Europa nicht gibt, nicht machen, und ich hätte mich sehr gefreut, wenn die freiheitliche Fraktion das mitgetragen hätte, wie sie das bei der Open-Innovation-Strategie getan hat, denn alle sachlichen Kritikpunkte sind ausräumbar.
Ich kenne die Vorbehalte der freiheitlichen Fraktion, dass dann da irgendwelche Projekte von irgendwelchen NGOs finanziert werden würden. – Keine Sorge, es ist recht klar definiert, was da passieren soll, mit dem notwendigen Spielraum, die jeweiligen Programme auch anzupassen! Also eine sachliche Infragestellung dieses Instruments gibt es nicht, es soll evaluiert werden, der Rechnungshof schaut hinein. Bei allen Dingen, die in der Republik mit Finanzen zu tun haben, schaut auch der Finanzminister mit seinem Team drauf.
Es ist eine gute Sache, eine richtige Sache, sie passiert zum richtigen Zeitpunkt, und sie wird unsere Ambitionen, die Republik Österreich zurück an die Spitze, in Richtung
Innovationsführerschaft zu führen, entscheidend mitbeeinflussen. – Vielen herzlichen Dank dafür.
Zu den anderen Punkten, die von dir angesprochen wurden, Reinhard, was unsere Innovationstätigkeit betrifft – das muss in diesem Rahmen auch gesagt werden –: In der Analyse von vor ein paar Jahren mag das stimmen, aber was all die angesprochenen Punkte betrifft – den Wissenstransfer, das Ausgründen aus Universitäten und Forschungseinrichtungen hinaus –: Da sind in den letzten eineinhalb Jahren so viele Akzente gesetzt worden wie zuvor jahrzehntelang nicht. Es ist uns gelungen, über eigene Ausgründungs-Fellowships, sogenannte Spin-off-Fellowships bei den Universitäten die notwendigen Mittel dafür zur Verfügung zu stellen, und einen eigenen Fonds, der diese Projekte, wenn sie erfolgreich ausgegründet haben, finanzieren soll. Wir haben vor eineinhalb Jahren in Österreich vier Wissenstransferzentren errichtet, die sich ausschließlich diesem Thema widmen.
Ja, das braucht ein bisschen Zeit, das wirkt nicht von einem Monat auf den anderen, aber das wird sich in den nächsten Jahren auswirken. Das sind genau die Dinge, die man vielleicht jahrzehntelang in der Republik vernachlässigt hat, die aber genau jetzt passieren.
Das heißt, es ist unredlich, zu sagen, es passiert dort nichts. Es mag die Diagnose aus der Vergangenheit stimmen, aber redlich und sachlich ist, wenn man sich auch wirklich mit den Dingen, die die Bundesregierung macht, auseinandersetzt und feststellt, dass in den letzten Monaten und eineinhalb Jahren sehr viel passiert ist. Diese Dinge kann man erst ex post in zwölf, 18, 24 Monaten evaluieren. An den Taten muss man sich messen lassen und nicht, so wie bei euch, an den Worten.
Ich wünsche trotzdem, weil das unsere letzte Zusammenkunft vor Weihnachten ist, allen Bundesräten und dem Präsidium ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und eine gedeihliche Zusammenarbeit im Sinne der Republik im Jahr 2017. – Herzlichen Dank. (Allgemeiner Beifall.)
13.40
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Sehr geehrter Herr Staatssekretär! Ich darf im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen diese Glückwünsche erwidern: Auch Ihnen ein paar ruhige Stunden zu Weihnachten und ein gutes neues Jahr!
Mir liegen nun zu Tagesordnungspunkt 9 keine weiteren Wortmeldungen vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir kommen nun zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein Finanzausgleichsgesetz 2017 erlassen wird sowie das Finanzausgleichsgesetz 1997, das Finanzausgleichsgesetz 2001, das Finanzausgleichsgesetz 2005, das Finanzausgleichsgesetz 2008, das Umweltförderungsgesetz, das Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfengesetz und das Bundespflegegeldgesetz geändert werden und das Bedarfszuweisungsgesetz aufgehoben wird (1332 d.B. und 1393 d.B. sowie 9669/BR d.B. und 9687/BR d.B.)
11. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern, mit der Regelungen zu Haftungsobergrenzen vereinheitlicht werden – HOG-Vereinbarung (1364 d.B. und 1394 d.B. sowie 9688/BR d.B.)
12. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988, das Umgründungssteuergesetz, das Umsatzsteuergesetz 1994, das Glücksspielgesetz, das Kommunalsteuergesetz 1993, das Verrechnungspreisdokumentationsgesetz, die Bundesabgabenordnung, das Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz 2010, das Bundesfinanzgerichtsgesetz, die Abgabenexekutionsordnung, das Mineralölsteuergesetz 1995, das Tabakmonopolgesetz 1996, das Transparenzdatenbankgesetz 2012, das Stabilitätsabgabegesetz und das Versicherungssteuergesetz 1953 geändert werden (Abgabenänderungsgesetz 2016 – AbgÄG 2016) (1352 d.B. und 1392 d.B. sowie 9670/BR d.B. und 9689/BR d.B.)
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Wir kommen zu den Punkten 10 bis 12 der Tagesordnung, und ich darf in unserer Mitte unseren Finanzminister Dr. Schelling begrüßen. (Allgemeiner Beifall.)
Berichterstatter zu diesen Tagesordnungspunkten ist Herr Bundesrat Mag. Lindner. Ich bitte um die Berichte.
Berichterstatter Mag. Michael Lindner: Sehr geehrte KollegInnen! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Sehr geehrtes Präsidium! Ich berichte zu Tagesordnungspunkt 10: Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein Finanzausgleichsgesetz 2017 erlassen wird sowie das Finanzausgleichsgesetz 1997, das Finanzausgleichsgesetz 2001, das Finanzausgleichsgesetz 2005, das Finanzausgleichsgesetz 2008, das Umweltförderungsgesetz, das Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfengesetz und das Bundespflegegeldgesetz geändert werden und das Bedarfszuweisungsgesetz aufgehoben wird.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor; ich komme daher gleich zur Antragstellung:
Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 19. Dezember 2016 mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Zu Tagesordnungspunkt 11: Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern, mit der Regelungen zu Haftungsobergrenzen vereinheitlicht werden – HOG-Vereinbarung.
Der Bericht liegt Ihnen ebenfalls in schriftlicher Form vor; ich komme daher gleich zur Antragstellung:
Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 19. Dezember 2016 mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Zu Tagesordnungspunkt 12: Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend das Abgabenänderungsgesetz 2016.
Der Bericht liegt Ihnen ebenfalls in schriftlicher Form vor; ich komme daher gleich zur Antragstellung:
Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 19. Dezember 2016 mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Ich danke für die Berichterstattung.
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Mag. Pisec. – Bitte.
13.45
Bundesrat Mag. Reinhard Pisec, BA (FPÖ, Wien): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Finanzminister! Sehr geehrte Damen und Herren! In dieser Debatte sind drei Tagesordnungspunkte zusammengefasst, über die ich in gestürzter Reihenfolge sprechen möchte. Ich beginne mit dem Thema Bankenabgabe, setze mit dem Thema Haftungsobergrenze fort und komme dann, soweit es noch geht, noch zum Thema Finanzausgleich, das mein Kollege Krusche fortsetzen wird.
Zur Bankenabgabe: Offiziell, im Gesetz, heißt sie Stabilitätsabgabe, im Volksmund heißt sie aber Bankengabe. Es sollte dem Gesetzgeber zu denken geben, wenn er mit seinen Begrifflichkeiten in der Öffentlichkeit nicht durchkommt. Es ist nun einmal keine Stabilitätsabgabe, denn sie hat zur Destabilisierung des Wirtschafts- und vor allem des Finanzstandortes Österreich, in erster Linie natürlich Wien als Residenzstadt, beigetragen.
Die Bankenabgabe kommt aus der Immobilienkrise alias Finanzkrise. Sie wurde 2011 eingeführt, und zwar limitiert bis 2017. Sie ist jetzt praktisch ein Jahr früher obsolet geworden und stark reduziert worden. Nun sollen die Banken von ihrem Obolus, von ihren Tributzahlungen – denn das ist ja eigentlich keine Steuer, es sind Tributzahlungen – befreit werden, soweit wie möglich. Die Abgabe verschwindet ja nicht, wie oft fälschlich in den Medien gesagt worden ist, sie wird nur reduziert.
Die Bemessungsgrundlage ist eine andere. 2011 hat die Bundesregierung nämlich allen Ernstes den Banken aufgetragen, per Gesetz wurde ihnen das aufgetragen, von der Bilanzsumme, vom Umsatz ihren Tribut, ihren Obolus zu entrichten, unabhängig von der Ertragslage, unabhängig davon, ob sie überhaupt einen Gewinn erwirtschaftet haben. Das bringt jedes Unternehmen früher oder später um, das hält auf die Dauer keiner aus. Unabhängig vom Gewinn eine Abgabe zu verlangen ist ja ein Novum, das hat es in der Geschichte Österreichs und Europas noch nicht gegeben.
Was damit bezweckt worden ist, ist nicht bekannt, aber das Ergebnis ist bekannt: Die Wirtschaft – in erster Linie die KMUs, denn die hängen ja von Bankkrediten ab, die brauchen ja die Außenfinanzierung – wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Warum? – Weil sie die notwendigen Bankkredite, die man für das Working Capital braucht, nicht erhalten hat. Umsätze ohne Außenfinanzierung sind fast nicht möglich, so viel Eigenkapital hat praktisch kein Unternehmer. (Präsident Lindner übernimmt den Vorsitz.)
Was haben die Banken gemacht? – Die Banken haben sich mit Basel III – Basel IV steht vor der Tür – und mit dieser Bankenabgabe auseinandersetzen müssen und haben ihre Bilanzsumme, ihre Umsätze reduziert. Dadurch sind auch die Kredite reduziert worden. Österreich hat sich also zusätzlich zu Basel III und Basel IV und zusätzlich zu all diesen Bankenabgaben in Europa, die es seit 2014 gibt, und in den Einlagen von Österreich noch einmal geschädigt, hat den eigenen Finanzplatz noch einmal geschädigt – bei einem nicht ausgeprägten Finanzmarkt.
Der Herr Staatssekretär hat ja verlauten lassen – nicht jetzt hier im Plenum, sondern bei einem Interview –, er möchte 1 Milliarde US-Dollar akquirieren. – Ja von wo denn? Bei diesen Banken, die durch die Bankenabgabe praktisch zerpflückt worden sind, und bei einem Finanzmarkt, den die österreichische Bundesregierung in den letzten zehn
Jahren stark zu reduzieren geschafft hat, sodass er, was schade ist, sich nicht mehr mit den osteuropäischen Börsenplätzen messen kann!?
Wir werden sehen, wie es weitergeht; aber es hat noch einen weiteren Effekt gehabt, man denke an die Bank Austria. Da sind zwei traditionelle Industrie- beziehungsweise Geschäftsbanken verschwunden, nämlich die 100 Jahre alte Länderbank und der fast 150 Jahre alte Creditanstalt-Bankverein, als sie von der Bank Austria übernommen wurden; und die Bank Austria wurde dann – unter Anführungszeichen – „intelligenterweise“ über Deutschland nach Italien verkauft.
Solche Globalisierungswellen muss man voraussehen, gerade in der Politik; und wenn man das nicht schafft, ist die Politik eigentlich falsch besetzt, muss man ganz einfach sagen. Die Politik soll nicht immer reagieren, sie muss agil sein. Da hat man den Bankplatz Österreich extrem geschädigt.
Zurück zur UniCredit. Warum? – Die bauen, wie wir alle wissen, 3 000 Mitarbeiter ab. Das Osteuropageschäft ist von Wien nach Mailand abgewandert. Ein Grund, nicht der einzige, war die Bankenabgabe in Österreich. – Klar, wenn sie den gleichen Umsatz in Mailand machen können, warum müssen sie dann in Österreich, in Wien sitzen, wo sie diese riesige Bankenabgabe bezahlen müssen? Da schädigt man sich ja selbst! – So viel zur Bankenabgabe.
Wir hätten uns gewünscht, sie würde überhaupt verschwinden beziehungsweise hätte überhaupt nie existiert. Es hätte damals in den Zeiten dieser Finanzkrise andere Finanzierungsmöglichkeiten gegeben, nämlich wie es die USA gemacht haben: Beteiligungen als tatsächlicher Stakeholder, an den Gesellschaften. Die USA haben ja, wie wir alle wissen, Profit aus dieser Finanzkrise erzielt, weil die Bankenaktien dann extrem gestiegen sind. Österreich hat sich anders entschieden. Das Ergebnis ist dieser zerpflückte, stark reduzierte Finanzplatz, und vor allem wurden die KMUs, und das betrifft uns von den KMUs sehr, sehr stark beeinträchtigt.
Zweiter Punkt: die Haftungsobergrenze – dem stimmen wir Freiheitlichen zu. Das macht Sinn, ist vernünftig; ich gebe nur zu bedenken: Es geht da um die Haftungsobergrenze für Bund und Land von 175 Prozent der Nettoeinnahmen, für Städte und Gemeinden von 75 Prozent.
Wenn man sich das im Zusammenhang mit unseren Staatsschulden ausrechnet: Die Staatsschulden betragen schon fast 250 Milliarden € oder 260 Milliarden €, die Schuldenquote liegt bei 80 Prozent bis 85 Prozent, je nachdem, wie man es rechnet (Bundesrat Mayer: Ohne die Bankenabgabe hätten wir noch mehr Schulden!) – du kommst nachher dran, du kannst es gern referieren –, plus die 200 Milliarden € Haftungen, da bin ich bei 500 Milliarden € an Verbindlichkeiten! Glaubst du allen Ernstes, dass Österreich das jemals zurückzahlen wird? (Bundesrat Mayer: Was Haftungen anlangt, habe ich von eurer Partei die Nase voll!) – Niemals!, das sage ich dir hier von diesem Pult aus.
Erinnere dich an meine Rede: Niemals, niemals wird Österreich das zurückzahlen können! Wenn du den Gläubigern sagst, dass wir das jemals zurückzahlen werden, dann wünsche ich dir viel Glück, dass dir das jemand glaubt. Wir Freiheitlichen glauben es dir nicht. (Beifall bei der FPÖ. – Bundesrat Mayer: Wir glauben euch auch nichts!)
Zum Finanzausgleich: Ich anerkenne Ihr Ziel, sehr geehrter Herr Finanzminister, dass Sie einen großen Wurf machen wollten, der nicht gelungen ist, das muss man einfach Revue passieren lassen. Damit wird Ihre Ankündigung im Ministerium zum Mysterium, das muss ich auch einmal sagen.
Diese Ankündigung aus dem Finanzministerium verfolge ich seit Jahren. Nicht umsonst wird im Jänner 2017 ein Symposium stattfinden, und zwar unter dem Titel: „FAG 2017 –
Nach der Reform ist vor der Reform?“ Offensichtlich haben die Entscheidungsträger selbst festgestellt oder die Erkenntnis gewonnen, dass das nichts war. Ein Punkt dabei ist: Wie Aufgabenorientierung, Finanzausgleich aussehen sollten … – mit drei Punkten, Konjunktiv. Offensichtlich gibt es da keine Aufgabenorientierung, das wäre aber notwendig.
Es gibt auch keine Zweckorientierung. Steuermittel sollen zweckorientiert eingesetzt werden, damit endlich dieses Füllhorn, dieses Ausschütten, wer immer das bekommt, aufhört, damit das praxisorientiert gemacht wird – man weiß nicht, wer das Geld bekommt.
Was dazukommt: 300 Millionen € jährlich mehr. Da schaffen Sie, sehr geehrter Herr Finanzminister, keine Spielräume für Einsparungen, wenn Sie immer sagen, wir haben ein Ausgaben- und kein Einnahmenproblem. Wo gibt es denn da Spielräume? Da ist man für die nächsten fünf Jahre – so lange geht der Finanzausgleich – festgezurrt. In Deutschland hat Finanzminister Schäuble sehr wohl erkannt, dass Einsparungen die Voraussetzung für Steuersenkungen sind.
Also zusammengefasst: Wir Unternehmer können uns darauf einstellen, dass es in den nächsten fünf Jahren keine Steuersenkungen gibt. – Na viel Spaß für den Finanz- und Wirtschaftsstandort Wien und Österreich!
Sie haben auch beim Wirtschaftsparlament – ist auch schon wieder ein Jahr her – gesagt, Sie schaffen die kalte Progression ab, und auch das ist nicht vollzogen. Die Abschaffung der kalten Progression bedeutet die Inflationsabgeltung auf die Bemessungsgrundlage, sodass man nicht jedes Jahr mit den Gehaltserhöhungen in eine höhere Steuerklasse gelangt. (Bundesrat Mayer: Gebt einen Vorschlag!) – Vorschlag: Steuersenkungen, Abgabensenkungen, Steuerfreiheit für den nicht entnommenen Gewinn (Bundesrat Mayer: Steuerreform nicht vergessen!), Investitionszuschüsse im Sinne von Senkungen und Investitionsfreibeträge, wie ich in der vorhergegangenen Rede erzählt habe, und vor allem Einsparungen, aber nicht mehr!
Wie gesagt, sehr geehrter Herr Finanzminister, Sie hatten vielleicht die hehre Absicht, aber es ist nicht geschehen.
Das Spekulationsverbot habe ich jetzt nicht erwähnt, das ist sich in der Rede nicht ausgegangen; nur ganz kurz: Das Spekulationsverbot ist sehr gut, ich schätze es sehr, die Frage ist nur, ob Sie es durchsetzen können. Da meine ich vor allem Wien, Stadträtin Brauner, die ja praktisch der Spielsucht verfallen ist (allgemeine Heiterkeit) und Milliarden an Schulden angehäuft hat, nämlich vor allem in Schweizer-Franken-Krediten, vor allem im Swapgeschäft, der Wien Holding – und da ist noch lange kein Ende in Sicht. – Danke. (Beifall bei der FPÖ.)
13.54
Präsident Mario Lindner: Als Nächster ist Herr Bundesrat Mayer zu Wort gemeldet. – Bitte, Herr Bundesrat.
13.54
Bundesrat Edgar Mayer (ÖVP, Vorarlberg): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Finanzminister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege Pisec! Ich rede jetzt zum Finanzausgleich, weil mir als Föderalismussprecher meiner Partei das sehr wichtig ist und als Ländervertreter in besonderem Maße. Deine Ausführungen, was Bankenplatz und Bankengesetz anlangt, reichen für mich unter dem Strich nicht für einen Job im Schattenkabinett von H.C. Strache. Da müsste schon noch Essenzielles kommen. (Bundesrätin Mühlwerth: Das entscheidest aber Gott sei Dank nicht du!) – Es kann ja für andere auch eine Bewertung geben, und wenn man sich hier so über etwas ausfließen lässt, sozusagen, dann ist das für mich sehr, sehr bescheiden.
Es ist schade, dass ich nicht nach Kollegen Krusche reden kann, denn ich kenne Kollegen Krusche. Er wird den Finanzausgleich natürlich verdammen bis zum Gehtnichtmehr, obwohl es ein zukunftsweisendes Projekt ist, das möchte ich schon anmerken. (Bundesrätin Mühlwerth: Das sagt ihr immer, bei allem!)
Der Herr Finanzminister hat da nämlich ganz klare Parameter dafür geschaffen, dass wir sozusagen einen Einstieg in den Umstieg schaffen. Das ist der erste Finanzausgleich, der mit Ländern und Gemeinden verhandelt wurde, der ganz klare Aufgabenbereiche definiert, der sich auch im Wege von Pilotprojekten in Szene setzen wird. Als Einstieg in eine Aufgabenorientierung wird die Verteilung der Ertragsanteile der Gemeinden teilweise durch eine aufgabenorientierte Verteilung, wie etwa die Finanzierung der Elementarbildung, ersetzt. Da gibt es also sehr viele gestalterische Elemente; ich komme dann noch zu einigen Punkten.
Unter dem Strich bekommen die Gemeinden und Länder mehr. Wenn ein Verhandler wie der Bürgermeister außer Dienst Mödlhammer, den wir alle als nicht unbedingt regierungsfreundlich kennen, wenn es ums Geld geht, im Zusammenhang mit dem Finanzausgleich 2017 bis 2021 von einem Wunder spricht, dann darf man hier schon anmerken, dass das eine besondere Art und Weise ist, mit den Ländern und Gemeinden umzugehen. (Beifall bei der ÖVP und bei Bundesräten der SPÖ.)
Auch für die Länder wird es unter dem Strich mehr Geld geben, wesentlich mehr Geld. Es kommen nämlich mit diesem Finanzausgleich mehr als 300 Millionen € mehr zu den Ländern und Gemeinden. Es wird auch für die Finanzierung des Flüchtlingsproblems Geld geben. (Bundesrätin Mühlwerth: Das wir gar nicht haben!) Da gibt es zusätzlich 125 Millionen €. Das ist schon auch ein besonderer Zugang, wenn es darum geht, die Finanzprobleme, die die Länder und Gemeinden dadurch haben, zu lösen.
Herr Finanzminister, das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Punkt, Länder und vor allem Gemeinden zu motivieren, einen stärkeren Zugang hinsichtlich Flüchtlingsarbeit zu haben, um da bessere Integrationsmöglichkeiten anzubieten. Das ist ein ganz wichtiger gestalterischer Punkt in diesem Finanzausgleich.
Wie gesagt, keine Gemeinde wird Geld verlieren, kein Land wird Geld verlieren, und es gibt viele gestalterische Elemente. Auch in den Bereichen Gesundheit und Pflege gibt es da ganz klare Vorgaben. Es gibt auch Kostenbremsen im Bereich Gesundheit, aber auch im Bereich der Pflege einen Dämpfungspfad von 4,6 Prozent; wobei man trotzdem sagen muss, dass der Pflegefonds bis 2021 gesichert ist, was auch ganz wichtig ist. Man muss sich darüber unterhalten, was wir in der Zukunft machen, wie wir die Pflege finanzieren. Dieser Bereich wird nämlich ein immer größeres Problem in Österreich darstellen, denn die Menschen werden immer älter und haben immer mehr Pflegebedarf.
Ich darf hier anmerken, dass Frau Ledl-Rossmann sich ab 1. Jänner 2017 als Präsidentin sehr intensiv um die Pflege bemühen wird und schon beim Finanzminister angeklopft hat, dass man gemeinsam ein Projekt seitens des Bundesrates aufsetzt, um Möglichkeiten zu schaffen, das auf Dauer und richtig zu finanzieren.
Auch für den Gesundheitsbereich gibt es jetzt vorderhand mehr Geld, aber auch eine Kostenbremse, indem man sagt: Die Gesundheits-, Sozial- und Pflegekosten können nicht ewig überbordend steigen, sondern wir müssen Möglichkeiten schaffen, wie wir das Ganze entsprechend finanzieren können.
Es gibt auch Möglichkeiten der Verwaltungsvereinfachung, diese wurden auch bereits angesprochen, zum Beispiel hinsichtlich Dokumentationspflichten in den Spitälern. Auch ein wichtiger Punkt – er wurde heute schon beim Gesundheitsbereich angesprochen; das darf man nicht vergessen –: Der Spitalskostenbeitrag für Kinder und Jugendliche wird abgeschafft. Das ist ein wesentlicher Punkt, um Familien finanziell besser zu un-
terstützen. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) – Da darf man ganz kräftig applaudieren, jawohl.
Die Haftungsgrenzen wurden schon angesprochen. In diesem Finanzausgleich ist nicht nur ein Spekulationsverbot verankert, sondern auch Haftungsobergrenzen. Ein Spekulationsverbot gibt es ja bereits in sieben Ländern, jetzt sind, man höre und staune, Kärnten und das Burgenland dazugekommen. Es gibt also jetzt ein Spekulationsverbot für alle Bundesländer – das ist wichtig und auch in die Zukunft gerichtet –, und auch die Haftungsobergrenzen werden ganz klar normiert. Das ist gut.
Bei der Wohnbauförderung gibt es entsprechende Ansätze, bei denen die Länder dann die Wohnbauleistungen, Wohnbauprogramme umsetzen würden; auch das ist in die Zukunft gerichtet.
Ich möchte jetzt auch noch die Transparenzdatenbank besonders erwähnen (Bundesrätin Mühlwerth: Wow!): Seit Jahren diskutieren wir über die Transparenzdatenbank. Vor Jahren wurde sie beschlossen, einige Länder sind säumig, einige Länder machen das. In diesen Finanzausgleich hat der Herr Finanzminister hineinschreiben lassen, dass die Bereiche Umwelt und Energie vollständig erfasst werden. Das ist der erste richtige Schritt, um diese Transparenzdatenbank umfassend und in allen Bereichen zu füllen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. (Bundesrätin Mühlwerth: Das ist gut!)
Ich komme jetzt zum Schluss, weil wir noch eine lange Tagesordnung haben. Der Finanzausgleich würde sich als Tagesordnungspunkt anbieten, den man einen Tag lang diskutierten kann. Man könnte sich als Ländervertreter, als Vertreter der Gemeinden einen ganzen Tag lang bedanken und freuen.
Herr Finanzminister, das ist wirklich ein Finanzausgleich, der in die Zukunft weist und Schritt für Schritt für eine gerechtere und fairere Finanzierung der Länder und Gemeinden sorgt. Das hat es in dieser konkreten Form noch nie gegeben. Mir als verantwortungsbewusstem Ländervertreter ist das ein besonderes Anliegen, und ich darf mich sehr herzlich im Namen meiner Fraktion bedanken, Herr Finanzminister! (Beifall bei ÖVP und SPÖ sowie Bravorufe bei der ÖVP.)
14.01
Präsident Mario Lindner: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Dr. Reiter. – Bitte, Frau Kollegin.
14.02
Bundesrätin Dr. Heidelinde Reiter (Grüne, Salzburg): Herr Präsident! Herr Minister! Werte Kollegen und Kolleginnen! Es wundert mich nicht, dass Präsident Mödlhammer von einem Wunder redet. Ich meine, die haben 500 Millionen gekriegt, ohne dafür irgendetwas hergeben zu müssen oder sich auf irgendetwas festlegen zu müssen. Ich halte das auch für ein Wunder. (Ruf: Es stimmt halt nur nicht!)
Finanzausgleich, das klingt so trocken und so technisch, aber im Grunde genommen ist er ganz essenziell, denn er setzt unser Miteinander um. Wir haben ja in Österreich – für die Zuhörer – einen extremen Einnahmenzentralismus, das meiste Geld, über 95 Prozent, wird in Wien vom Bund eingenommen (Bundesrat Mayer: Das wollte er ändern!) – ja, das habt ihr von den Ländern verhindert (Bundesrat Mayer: Wir Vorarlberger nicht!) –, und das wird dann in einem sehr komplizierten, gewachsenen Mechanismus an die Länder und Gemeinden verteilt. Wir haben einen sehr ausgeprägten Ausgabenföderalismus.
Der Finanzausgleich selbst ist ja schon sehr komplex, und dazu kommen dann noch eine Fülle von Artikel-15a-Vereinbarungen, die Einzelbereiche regeln. Alles in allem sind es also 250 000 Transferzahlungen, die da horizontal, vertikal und so weiter abgewickelt und verwaltet werden müssen. Dass das System intransparent ist, Aufgaben- und
Ausgabenverantwortung oft nicht oder praktisch nie zusammenfallen, dass dieses System nicht in irgendeiner Form steuerbar ist, dass entsprechende Motivationen fehlen, dass es sehr teuer ist, ist bekannt.
Vor 40 Jahren ist unter der Leitung von Professor Egon Matzner ein erstes Expertenpapier mit entsprechenden Reformvorschlägen dazu verfasst worden, ein Finanzausgleichsgutachten. Seither gibt es Stillstand. Es gibt immer wieder Reformversprechen – auch Kollege Kneifel meinte, das ist etwas für die Zukunft – und Bemühungen. Herr Finanzminister, auch Sie haben sich wahrscheinlich etwas anderes vorgestellt als das, was der Finanzausgleich jetzt tatsächlich „dahoben“ hat, zumindest folgere ich das aus Ihren Ankündigungen davor.
Was hat er „dahoben“? – Im Bereich der Elementarbildung und Pflichtschulen – ein Jahr später – erfolgt der Einstieg in den Umstieg zur Aufgabenorientierung, aber wenn man hinschaut, sind alle wesentlichen Details dazu völlig offen. (Bundesminister Schelling: Das können Sie nicht wissen!) – Das weiß ich schon, weil wir in Salzburg gerade ein Kinderbetreuungsgesetz machen und sehr interessiert an der Information wären, unter welchen Bedingungen diese Gelder dann tatsächlich fließen. (Bundesminister Schelling: Das steht drinnen, ganz sicher!) – Das steht nicht drinnen! (Bundesminister Schelling: Dann haben Sie es nicht gelesen!) – Doch. (Bundesminister Schelling: Ganz sicher nicht!)
Es ist auch nicht klar, welche Transfers von Ländern in Richtung Gemeinden hier in diesem Bereich ausgenommen oder nicht betroffen sind. Es könnte auch passieren, dass die Unterschiede im Versorgungsniveau bei den Ländern noch verschärft werden. Laut Erläuterungen wird in Aussicht genommen, von 2020 bis 2021 weitere Aufgabenbereiche aufgabenorientiert zu gestalten, also es weist in die Zukunft – in die etwas fernere. Seien Sie mir nicht böse, aber diese Suppe ist ziemlich dünn!
Das nächste große Kapitel ist die Abgabenautonomie. Darin findet sich der Wohnbauförderungsbeitrag, der ab 2018 eine reine Landesabgabe wird. Es wird eine Arbeitsgruppe geben, die sich über zukünftige Abgabenautonomie auch in anderen Bereichen den Kopf zerbricht. Das ist ein kleiner Schritt, das macht 6 Prozent der gesamten Ertragsanteile aus, und das wurde von den Landeshauptleuten eigentlich auch gleich unterlaufen, weil die gesagt haben, wir machen das nur miteinander, also nicht jedes Land extra, sondern nur nach einheitlichen Standards, wir gehen also im Gleichklang vor. Es stimmt: Die bisherige Struktur wurde teils vereinfacht, aber eben nicht grundsätzlich verändert.
Der Bereich Klimaschutz bildet sich im Finanzausgleich nach wie vor in keiner Weise ab. Es wurde ein Klimaschutzkoordinations- und Verantwortlichkeitsmechanismus ins Leben gerufen. Im Finanzausgleich steht das so drinnen, aber das ist ein Wortungetüm, hinter dem sich konkret eigentlich gar nichts verbirgt.
Transparenz – das Thema ist auch schon angesprochen worden –: Es wird Benchmarking und Spending Reviews geben. Die haben wir ja eigentlich schon lange, das hat man früher Aufgabenkritik genannt, ein deutsches Wort. Es ist ja eigentlich ganz klar, dass uns für ein wirkliches Benchmarking die Daten fehlen. Das kann frühestens eingeführt werden, wenn es 2019 tatsächlich ein vereinheitlichtes Rechnungswesen geben wird. Allerdings sollen laut § 24 Finanzausgleichsgesetz 300 Millionen nur dann ausbezahlt werden, wenn es ein Benchmarking gibt.
Die Transparenzdatenbank und die Transparenz bei den Transferströmen werden ja von den Ländern immer wieder sehr erfolgreich blockiert. Jetzt hat man sich in zwei Bereichen darauf geeinigt. Warum es diese Transparenzdatenbank und Transparenz nicht tatsächlich in allen Bereichen und auch bezüglich der Transferströme gibt, erschließt sich uns nicht.
Haftungsobergrenzen: Gut, dass es eine einheitliche Berechnung geben wird, aber das Ganze wird dann auch erst im Rahmen einer Artikel-15a-Vereinbarung ab 1. Jänner 2019 umgesetzt. Hoffentlich hat man aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. An dieser Artikel-15a-Vereinbarung gibt es ja massive Kritik des Rechnungshofes. Da sehen wir, dass das auch in eine ganz falsche Richtung gehen kann und eine solche Vereinbarung eine bundesweit einheitliche Regelung nur sehr bedingt ersetzt. Es gibt leider keinen klaren und verbindlichen Pfad zu einem eventuell notwendigen Haftungsabbau.
Bundesstaatsreform: Das Ganze verweist auch da in die Zukunft. Unter Berücksichtigung der Arbeit des Österreich-Konvents soll bis Ende 2018 von Bund, Ländern und Gemeinden eine entsprechende Reform vorbereitet werden. Aufgrund der Erfahrungen, die es bisher mit solchen Gremien und Verweisen gibt, kann man das eigentlich nicht ernst nehmen. Es wäre dringend geraten oder sogar heilsam, sich an der Schweiz zu orientieren. Die Schweiz hat 15 Jahre gebraucht, um zu einer Bundesstaatsreform zu kommen, aber sie ist dorthin gekommen, während bei uns, wie gesagt, seit 40 Jahren Stillstand herrscht.
Es gibt vor allem zusätzliche finanzielle Mittel des Bundes: einmalig 125 Millionen € für Integration und Migration, das ist sicher wichtig – wie die Verteilung dann wirklich erfolgt, wird sich auch erst weisen –, und auch 300 Millionen € jährlich für Gesundheit, Pflege und Soziales, die sind sicher notwendig, aber auch da schließen Länder und Gemeinden erst entsprechende Vereinbarungen über die Aufteilung.
Die 350 Millionen € für die Weiterführung des Pflegefonds sind wichtig, aber all diese Extrazahlungen verkomplizieren wieder das System als Ganzes. Es fehlt wirklich ein übersichtliches und damit auch steuerbares System dahinter. Es haben sich die Länder und die Landesfürsten wirklich wunderbar durchgesetzt. (Bundesrat Mayer: Das waren Verhandlungen!) Die Umsetzungschancen für an Arbeitsgruppen ausgelagerte Projekte sind aufgrund vergangener Erfolge als eher gering einzuschätzen. (Zwischenbemerkung von Bundesminister Schelling.) – Ja, aber es ist klar, dass Doppel- und Mehrfachförderungen zum Beispiel nur in Teilbereichen angegangen werden, da das auch für uns oder die Allgemeinheit nicht zugänglich ist und damit auch nicht gesteuert werden kann.
Was bräuchte es? – Es bräuchte natürlich ein Wegkommen von der Verteidigung der Besitzstände am gesamten Steuerkuchen. Es bräuchte eine Umorientierung von einem ausschließlichen Mittelausgleich, es müssten auch andere Ziele definiert werden (Ruf: Welche?), zum Beispiel eine entsprechende Wirtschaftsentwicklung, entsprechende Umweltstandards und Entwicklungen in diesen Bereichen. Hier dominiert die Bevölkerungszahl wirklich alles. Ökologische Nachhaltigkeit kann auf diese Art und Weise sicherlich nicht sichergestellt werden.
Es kann ein neuer Finanzausgleich, der diesen Namen auch verdient – mit Schritten zu einem konstruktiven Föderalismus –, nur gelingen, wenn das tiefe Misstrauen zwischen den Finanzausgleichspartnern überwunden und der Dissens zwischen Bund und Ländern aufgelöst wird. Das Gemeinsame muss nicht nur in Sonntagsreden vor das Trennende gestellt werden. Das Besitzstandsdenken an mehr Ertragsteile bringt uns nicht weiter. Der Finanzausgleich ist nicht nur eine riesige Umverteilungsmaschinerie, sondern sollte ein wichtiges Instrument zum Erreichen von Wirtschafts- und Klimazielen, von umweltpolitischen Zielen und von einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum sein. Dazu muss man diese Ziele auch definieren und formulieren.
Wie gesagt, in der Schweiz haben fünf Finanzwissenschaftler eine Basis geschaffen, dann gab es fünf Jahre Debatten darüber im Parlament, begleitet von Ökonomen und entsprechenden Wissenschaftlern. (Präsident Lindner gibt das Glockenzeichen.) – Ich bin gleich fertig. (Bundesrat Mayer: Aha! – Bundesrat Stögmüller: Sei nicht so streng!) –
Es gab eine Volksabstimmung darüber, und 64,4 Prozent waren dafür, obwohl zehn Länder etwas verloren haben. Eine Ansage wie jene von Landeshauptmann Wallner – unter dem Strich zählt einfach, wie viel Geld von Wien nach Vorarlberg fließt, oder: Vorarlberg will einfach das zurück, was es einbezahlt hat – ist dafür einfach zu wenig, das greift zu kurz. – Danke. (Beifall bei den Grünen. – Bundesrat Mayer: Das hat er nicht behauptet!)
14.13
Präsident Mario Lindner: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Lindinger. – Bitte, Herr Bundesrat.
14.13
Bundesrat Ewald Lindinger (SPÖ, Oberösterreich): Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Geschätzte Damen und Herren vor den Fernsehgeräten zu Hause! Ich bin jetzt seit 25 Jahren Bürgermeister, und ich warte immer noch auf das Füllhorn, das über die Gemeinden ausgeschüttet wird. Ich habe schon sehr viele Finanzausgleichsverhandlungen abgewartet und dann das jeweilige Ergebnis bekommen.
Wir haben vorgestern im Ausschuss den Bericht zum Finanzausgleich, der sich in verschiedene Teile gliedert, diskutiert: Reform des Finanzausgleichs, Aufgabenorientierung, Abgabenautonomie, Vereinfachung des Finanzausgleichsgesetzes, Reform der Verteilung der Ertragsanteile der Gemeinden – das wäre einer der wichtigsten Teile, davon leben die Gemeinden –, Neuordnung der Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel – wir wissen, bei großen Projekten geht es ohne Bedarfszuweisungsmittel überhaupt nicht – und Klimaschutzkoordinations- und Verantwortlichkeitsmechanismus. Das ist also ein umfassender Finanzausgleich, ein umfassendes Gesetz, das heute hier beschlossen wird und dem wir auch die Zustimmung geben. Das setze ich einmal voraus.
Geschätzter Herr Finanzminister, Sie haben sehr gut verhandelt, sehr gut für den Bund, die Länder haben auch das Ihre getan, nur die Gemeinden sind wieder einmal durchgefallen. (Bundesminister Schelling: Nein!) Ich weiß das aus meiner eigenen Gemeinde; ich bin Bürgermeister einer mittelgroßen Gemeinde mit 6 000 Einwohnern. Die Mittel meiner Gemeinde haben beim Finanzausgleich nicht zugenommen, sondern leicht abgenommen, sie werden weniger, aber vielleicht wird sich noch Genaueres weisen, denn die Gemeinden können eine Vielfalt an Mitteln bekommen oder lukrieren, beispielsweise aus dem Bereich der Siedlungswasserwirtschaft, wenn etwas getilgt wird, und, und, und. (Bundesrat Mayer: Da musst du nur ein Formular ausfüllen!) Das ist ja auch im Finanzausgleich drinnen, das sieht man erst am Ende des Tages und nicht, wenn das Mail von der Landesregierung mit dem sogenannten Voranschlagserlass kommt, nach dem man dann den Voranschlag erstellt. Daran arbeiten zu Hause die Mitarbeiter der Finanzabteilung, damit wir noch schöne Weihnachten haben – oder auch nicht. Es kann ja auch sein, dass eine rote Zahl dahinter steht, das wäre das erste Mal in den letzten Jahren. Wir haben immer gut gewirtschaftet.
Die Aufgabenorientierung ist noch nicht ganz gelungen, aber das liegt nicht am Finanzminister, geschätzte Damen und Herren, das liegt an den Ländern. Die Tiroler sagen, wir müssen die Gemeinden, die über 800 Meter liegen, berücksichtigen; die Niederösterreicher sagen, wir haben ein so großes Wegenetz und so viele Güterwege; die Oberösterreicher sagen das vielleicht auch über die Güterwege – die kommen noch vom Landeshauptmannstellvertreter, der schon seit einem Jahr im Ruhestand ist –; und die Wiener sagen, wir haben eine hohe Anzahl an Pendlerinnen und Pendlern und die Einrichtungen des Bundes. (Bundesrat Mayer: Und die Heurigen!) – Das ist vielleicht im Burgenland, Kollege.
Jedes Bundesland hat seine Extrawürste bei den Finanzausgleichsverhandlungen, und darum ist dieser – wie man in den Medien gehört hat – große Wurf noch nicht gelun-
gen, aber man hat bei der Bildung begonnen. Es ist ein wichtiger Schritt, dass man bei der Bildung mit der Aufgabenorientierung, mit der Verteilung der Finanzmittel bei der Elementarbildung – bei den bis zu Sechsjährigen – begonnen hat und da nach quantitativen und qualitativen Parametern verteilt. Das heißt, man wird in Zukunft als Gemeinde direkt zugreifen können, die Verteilung der Ertragsanteile wird bemessen und auf die Qualität und die Quantität der Kinderbetreuung abgestimmt werden.
Ich hoffe doch, dass das Datum des 1. Jänners 2018 hält. Sie wissen, Herr Finanzminister, die Kinderbetreuung ist eine Maßnahme, für die die Gemeinden das Geld morgen brauchen, nicht übermorgen. Wir haben voriges Jahr einen Kindergarten errichtet – mit den Mitteln, die wir genehmigt bekommen haben –, und heuer wissen wir, dass wir nächstes Jahr schon wieder eine Gruppe dazubauen müssen. Insbesondere im Bereich der Krabbelstuben steigt der Bedarf, weil Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger ins Berufsleben dieses Angebot benötigen und auch gerne annehmen. Das sind Maßnahmen, bei denen wir als Gemeinden gefordert sind, und da ist es auch wichtig, dass wir verstärkt Mittel bekommen.
Der Wohnbauförderungsbeitrag soll als Landesabgabe in die volle Autonomie der Länder kommen. In Oberösterreich habe ich ein wenig Angst, wenn die Wohnbauförderung als Landesmittel in die Hände des Wohnbaureferenten gelangt. Ich habe Angst, dass in Oberösterreich die Mittel falsch verwendet werden, denn man kann sich das Wohnen nicht mehr leisten.
Vor 14 Tagen war eine Pensionistin in meiner Sprechstunde, die mir auf einem Zettel gezeigt hat, um wie viel ihre Wohnungsmiete gestiegen ist und dass ihr die Wohnbeihilfe gestrichen wurde. Das heißt, die Wohnbeihilfe steigt nicht in dem Ausmaß, in dem die Wohnungsmieten steigen. Man müsste den Einstieg zur Wohnbeihilfe erleichtern und auch das Einkommen anheben, damit man das kompensieren kann – erhöhte Mittel durch das Steigen der Mieten.
Der Wohnbaureferent bei uns in Oberösterreich hebt das nicht an. Draufzahler in diesem Bereich sind Alleinerzieherinnen und Alleinerzieher, Pensionistinnen und Pensionisten. Gerade deshalb habe ich Angst, wenn diese Mittel direkt zufließen. Ich hoffe doch, dass sie über den Finanzreferenten dann gut zugeteilt werden und der Wohnbauförderungsbeitrag in den Ländern richtig verteilt wird – und nicht nach Gutdünken des Wohnbaureferenten.
Geschätzte Damen und Herren, der Gemeindebund hat natürlich wieder verhandelt und ist nicht unbedingt als Sieger hervorgegangen – so sehe ich das. Die nächsten Jahre werden es zeigen. Es sind ja einige Vorhaben in diesem Finanzausgleich in Arbeitsgruppen ausgelagert worden, in denen man darüber verhandelt, dass sich auch in Zukunft einiges verändern soll. Der Startschuss zur Aufgabenorientierung ist jetzt im November erfolgt – sie ist eineinhalb Jahre von einer Expertengruppe verhandelt worden.
Was mich besonders gefreut hat, ist, dass der Versuch der Erhöhung der Landesumlage durch den Landesfinanzreferenten und den Landeshauptmann in Oberösterreich beim Budgetlandtag vorige Woche gescheitert ist. Die SPÖ hat sich quergelegt und gesagt: Wir stimmen dem Landesbudget nicht zu, wenn die Landesumlage erhöht wird. Während des Budgetlandtages ist dann noch verhandelt worden, und die Landesumlage wurde schließlich nicht angehoben. Somit ist eine Belastung für die Gemeinden natürlich aufgeschoben, aber, ich glaube, nicht aufgehoben worden. Es könnte sein, dass diese Idee vielleicht wiederkommt.
Es gibt auch Bundesländer, die überhaupt keine Landesumlage haben. Das wäre natürlich für uns Oberösterreicher gut. Dann müsste ich auch in meinem Voranschlagsentwurf nicht so viel streichen, aber, geschätzter Herr Finanzminister, ich habe es schon erwähnt: Siedlungswasserwirtschaft – es tut uns gut, dass da wieder 80 Millionen € als Mittel für die Gemeinden vorgesehen sind.
Viele Gemeinden, die keine Eisenbahn haben, wissen nicht – und einige wissen wahrscheinlich gar nicht, dass es eine Eisenbahnkreuzungsverordnung 2012 gibt, weil sie keine Eisenbahn haben –, welche Belastung durch die Eisenbahnkreuzungsverordnung auf sie zukommen kann. Ich habe in meiner Gemeinde sieben Eisenbahnkreuzungen und derzeit eine Rechnung des Verkehrsministeriums mit 430 000 € als Teilbeitrag der Gemeinde liegen. Dann habe ich noch drei Unterführungen und vor zwei Jahren über 200 000 € als einen kleinen Beitrag für die Kosten der Sanierung bezahlt.
Herr Finanzminister, es freut mich, dass dieser Fonds jetzt mit Zuschüssen auf Landesebene gegründet wurde und man aus diesem Fonds Mittel lukrieren kann. Ich habe auch mit der zuständigen Landesrätin vorige Woche noch ein Gespräch gehabt. Sie hat gesagt: Wenn wir alles aus den Bedarfszuweisungsmitteln decken müssten, dann könnten wir keine Schulen, keine Bäder mehr erhalten und in vielen Bereichen nichts mehr erledigen. Das frisst einen Großteil der Bedarfszuweisungsmittel auf. Ich glaube doch, dass es eine gelungene Idee ist, dass dieser Fonds gegründet wird.
Bei diesen Finanzausgleichsverhandlungen wurde auch vereinbart, dass es zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit in Zukunft Mittel gibt, dass die Zusammenarbeit der Gemeindeverbände gefördert wird und die strukturschwachen Städte unterstützt werden, unter anderem durch die Förderung des Breitbandausbaus, der wichtig ist. Bei Industrieansiedlungen wird gefragt: Gibt es Breitband? Gibt es einen Breitbandanschluss? Wann kommt dieser? – Also am besten morgen und nicht übermorgen.
Wir wissen, dass auch Gemeindezusammenlegungen nicht mehr hinter vorgehaltener Hand diskutiert werden, sondern sehr offen, und kennen das auch in Oberösterreich schon. Wir haben aber auch die Erfahrungen in der Steiermark aus der Ferne beobachtet und das Gute auch mit nach Hause genommen. Die schlimmen Sachen, die es gegeben hat, werden wir diskutieren.
Geschätzte Damen und Herren, der Finanzausgleich ist hoffentlich unterm Strich – das werden wir erst 2017 und 2018 feststellen – ein Erfolg für die Gemeinden. Ich bedanke mich, dass Städte- und Gemeindebund gemeinsam so gut verhandelt haben, dass wir nicht durch den Rost gefallen sind. Herr Finanzminister, Sie haben gut verhandelt. Wir stimmen dem Finanzausgleich zu. (Beifall bei der SPÖ sowie des Bundesrates Mayer.)
14.26
Präsident Mario Lindner: Nächster Redner ist Herr Bundesrat Mag. Zelina. – Bitte, Herr Bundesrat.
14.26
Bundesrat Mag. Gerald Zelina (STRONACH, Niederösterreich): Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Finanzminister! Liebe Zuschauer vor den Fernsehgeräten! Der österreichische Finanzausgleich und die Finanzierung unserer Bundesländer und Gemeinden gehören total reformiert und völlig neu aufgesetzt.
Wir brauchen einen Steuerwettbewerb zwischen den Bundesländern, mit Steueraufschlägen und Steuerabschlägen bis hinunter auf die Gemeindeebene wie in der Schweiz. Die Schweiz ist als Staat nur halb so hoch verschuldet wie Österreich, das Steuerniveau ist deutlich niedriger und der Wohlstand höher als in Österreich.
Wettbewerb in der Privatwirtschaft bringt qualitativ bessere und günstigere Produkte. Wettbewerb im öffentlichen Sektor bringt niedrigere Steuersätze und eine qualitativ bessere Staatsverwaltung. Derzeit beobachten wir bei den Ländern leider einen Ausgabenwettbewerb. Dieser Ausgabenwettbewerb der Bundesländer nach oben braucht unbedingt einen Steuerwettbewerb nach unten.
Unsere Bundesländer und Gemeinden sollen Steuereinhebungsrechte bekommen, um für ihre Ausgaben auch auf der Einnahmenseite selbst die Verantwortung zu tragen.
Landeshauptleute und Bürgermeister sollen ihre Ausgaben vor ihren Bürgern rechtfertigen müssen. Wenn das Land Niederösterreich 27 Spitäler bauen will, dann kann es das gerne tun. Vorher sind aber die Bürger zu befragen, ob sie das überhaupt wollen, da die Finanzierung der Spitäler in diesem Fall nur mit lokalen Steueraufschlägen durchführbar ist.
Ein Landeshauptmann oder auch ein Bürgermeister, der Steuern für seine Ausgabenentscheidungen selbst einheben muss, geht auf jeden Fall sorgfältiger mit den Steuern seiner Bürger um. Das Bundesland, das die schlankeste Verwaltung und damit die geringsten Verwaltungskosten hat, kann seinen Bürgern und Unternehmen auch die niedrigsten Steuersätze anbieten und damit Betriebe anlocken und zusätzliche Arbeitsplätze, Wohnsitze und Wohlstand für seine Gemeinden schaffen.
Empirische Studien zeigen eindeutig, dass mehr Steuerwettbewerb zu schlankeren Staatsverwaltungsstrukturen führt. Ein Bundesland oder eine Stadt, die ihren Bürgern eine Eins-a-Infrastruktur und ein Top-Kundenservice anbietet, kann gerechtfertigterweise höhere Steuersätze verlangen. Städtische Ballungszentren haben mehr zentralörtliche Aufgaben zu erledigen als ländliche Regionen und können daher auch aus guten Gründen höhere Steuersätze verrechnen. Ländliche Regionen wiederum könnten durch niedrigere Steuersätze Unternehmen anlocken, die sich sonst nicht dort niederlassen würden.
Für den Steuerwettbewerb eignen sich am besten die Einkommensteuer oder die Körperschaftsteuer. Ich nenne ein Beispiel: Bei den derzeitigen 25 Prozent Körperschaftsteuer könnten 15 Prozentpunkte den Ländern übergeben werden. Das heißt: Die Länder hätten dann einen eigenen KÖSt-Länderaufschlag zwischen 0 Prozent und 15 Prozent und könnten selbst entscheiden, in welcher Höhe sie diesen Aufschlag gestalten. Würde der Länderaufschlag zum Beispiel in Vorarlberg 10 Prozent und im Burgenland 0 Prozent betragen, würde das bedeuten, dass ein Unternehmen in Vorarlberg in Summe 20 Prozent Körperschaftsteuer zahlt und im Burgenland in Summe nur 10 Prozent. Mit 10 Prozent Körperschaftsteuer wären wir in Europa absolute Spitze, da könnten wir mithalten! Da gibt es auch keine Flucht mehr in Steueroasen, und auch die Gewinnverschiebungen hören auf.
Die Körperschaftsteuer hat derzeit ein Volumen von 6 Milliarden €. Davon drei Fünftel vom Bund den Ländern zu überlassen bedeutet, den Ländern 3,6 Milliarden € Körperschaftsteuereinnahmen zur freien Verfügung zu übertragen. (Bundesrat Mayer: Und wo sparen wir es ein?) Die Länder werden durch eigene Ländersteuern beweglicher, und der Föderalismus wird gestärkt.
Die Steuereinnahmen gehören in Summe eher direkt den Gemeinden und Bürgermeistern und weniger den Ländern übertragen. Die Gemeinden sind unsere größten Infrastrukturinvestoren. Unsere Gemeinden gehören zu größeren Gebietsgemeinden zusammengefasst und kräftig aufgewertet. Die Bürgermeistergehälter gehören auch erhöht, sie sind im Verhältnis zur Verantwortung viel zu gering. Das gilt auch für das Gehalt des Herrn Finanzministers, da fehlt bei der Verantwortung für die ganze Republik auch eine Null, wenn ich mir anschaue, was unsere Bankenvorstände verdienen. (Heiterkeit und Beifall bei der ÖVP.) – Das ist so! Gute Leute bekommt man nur mit wettbewerbsfähigen Gehältern.
Zusammengefasst: Steuerwettbewerb zwischen den Ländern bis hinunter auf die Gemeindeebene führt zu niedrigeren Steuersätzen, Steuerwettbewerb führt zu schlankeren Landesverwaltungen, und Steuerwettbewerb führt zu attraktiveren Standorten für Unternehmen. – Danke.
14.31
Präsident Mario Lindner: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Ing. Köck. – Bitte, Herr Bundesrat.
14.32
Bundesrat Ing. Eduard Köck (ÖVP, Niederösterreich): Sehr geehrter Herr Minister! Sehr geehrter Herr Präsident! – Mit fortschreitendem Alter muss man auf sehr vieles schauen, das man mitnehmen muss (seine Lesebrille in die Höhe haltend), damit alles klappt. (Allgemeine Heiterkeit.) – Brillen und Kugelschreiber meine ich!
Ich möchte mich vor allem zum Finanzausgleich äußern. Wir haben ja schon einige Redebeiträge gehört, manche waren sehr gut und sehr erläuternd, so wie der von Kollegen Lindinger – er hat sicherlich schon alles angesprochen –, manche waren sehr kreativ, was man nicht alles tun, besser tun und hineinverpacken könnte, wie Kollegin Dr. Reiter bemerkte.
Natürlich hätten wir auch jeder unsere eigenen Vorstellungen, was man bei diesem Finanzausgleich nicht alles machen könnte. Gerade als Bürgermeister einer Region, in der die Entwicklung nicht so gut ist, würden wir uns vieles ganz anders vorstellen.
Ich denke aber: Wenn wir die Medienmeldungen gehört haben, dass sich die Gemeinden 500 Millionen € mehr wünschen, die Länder 500 Millionen € mehr wünschen, und dann hat auch noch der Herr Finanzminister gesagt, er wünsche sich auch 500 Millionen € mehr, spätestens dann muss man wissen, dass es wirklich nicht leicht ist, einen derartigen Ausgleich in Österreich zu schaffen. Letzen Endes, so meine ich, ist hier doch etwas Großartiges gelungen, anders als bei den letzten Ausgleichsverhandlungen, wo dies eigentlich nicht der Fall war.
Wir sehen, dass es vor diesem Ausgleich bei den Ertragsanteilen doch sehr, sehr große Unterschiede gegeben hat. Die kleineren Gemeinden würden demnach nur 780 € pro Kopf und Gemeinden über 20 000 Einwohner 1 200 € pro Kopf bekommen. Das ist natürlich eine Ungerechtigkeit, die wir ändern wollten und zu der auch eine ARGE gerechter Finanzausgleich mit 600 Unterschriften von Gemeinden gegründet wurde. Wir hätten uns natürlich mehr erwartet, aber sehen auch die Realität. Die meisten Vertreter kommen aus Ballungszentren und würden bei so einer größeren Verschiebung offensichtlich nicht mittun. Deshalb ist es auch ein Ausgleich geworden, bei dem es letzten Endes viele Sieger und keine Verlierer gibt.
Es gibt jetzt für strukturschwache Gemeinden einen eigenen Fonds. Es sind 60 Millionen € im Jahr, die in diese Gemeinden verteilt werden, und ich habe selbst schon für meine Gemeinde gesehen, wie das aussieht. Es ist durchaus ein respektabler Betrag, den wir in die Zukunft investieren und mit dem wir auch Wertschöpfung für unsere Firmen generieren können, was, glaube ich, das Wichtigste ist.
Wir müssen im internen Länderausgleich noch darauf achten, dass der Finanzkraftausgleich nicht wieder einiges wegrationalisiert. Das aber wird erst die nächste Hürde sein. Insgesamt sehe ich den Finanzausgleich als eine großartige Leistung, gut gelungen und für die nächste Zeit durchaus praktikabel. Deshalb, denke ich, müssen wir zusehen, dass wir ihn so gut wie möglich umsetzen. – Danke. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
14.35
Präsident Mario Lindner: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Krusche. – Bitte, Herr Bundesrat.
14.36
Bundesrat Gerd Krusche (FPÖ, Steiermark): Hohes Präsidium! Herr Bundesminister! Kolleginnen und Kollegen! – Kollege Mayer kann es ja fast gar nicht mehr erwarten, bis ich zu Wort komme, er hat ja eigentlich schon meine Rede halten wollen! Zum Finanzausgleich ist ja schon sehr viel gesagt worden, ich kann mich daher auf eine kurze Zusammenfassung beschränken.
Vor knapp einem Jahr, Herr Finanzminister, haben wir uns hier mit Ihnen im Rahmen einer Aktuellen Stunde über den Finanzausgleich unterhalten und ausführlich diskutiert. Vergleicht man das, was damals von Ihnen gesagt wurde – die Ambitionen, die Sie damals geäußert haben –, mit dem, was uns hier heute als Realität vorliegt, so müsste man eigentlich zu dem Urteil kommen, dass Sie mit den Ambitionen, die Sie damals beschrieben haben, grandios gescheitert sind.
Von der Aufgabenorientierung ist nur mehr ein Tropfen auf dem heißen Stein übrig geblieben – es wurde ja bereits erwähnt: ab 2018 im Bereich der Elementarbildung und ab 2019 im Pflichtschulbereich. Bei der Steuerautonomie beschränkt man sich auf den Wohnbauförderungsbeitrag, aber die Zweckbindung gibt es noch immer nicht, und auch sonst ist nichts Neues in diesem Punkt.
Im Transferdschungel ist eigentlich alles so geblieben, wie es war. Das Beispiel Landesumlage wurde ja bereits erwähnt: dermaßen sinnlose Geldflüsse, die es da gibt – von den Ländern an die Gemeinden und dann wieder zurück von den Gemeinden an die Länder! Was da alleine Geld übrig bleiben würde, wenn man sich den bürokratischen Aufwand für die Bewältigung dieser Transferleistungen sparte, möchte ich hier gar nicht erwähnen.
Vom zitierten Einstieg in den Umstieg ist in Wahrheit nicht viel übrig geblieben. Es ist den Mehrleistungen für Länder und Gemeinden zu verdanken, dass der Finanzausgleich überhaupt zustande gekommen ist und nicht wieder, wie schon in der Vergangenheit, immer wieder verlängert und fortgeschrieben worden ist. Wir haben es ja schon gehört: 300 Millionen € zweckgebunden für Soziales, Gesundheit und Pflege, 125 Millionen € Einmalbetrag zur Abdeckung der Zusatzkosten durch Migration. Man wird sehen, ob das reicht. Die Eisenbahnkreuzungen wurden auch bereits erwähnt, und wenn Kollege Mödlhammer mit dem Finanzausgleich zufrieden ist, dann ist eigentlich allein diese Tatsache schon der Beweis dafür, dass Sie mit Ihren Ideen in die Knie gegangen sind. (Bundesminister Schelling: Abenteuerlich, wirklich abenteuerlich! – Zwischenrufe bei der ÖVP.) – So ist es leider, und Sie haben ja noch Gelegenheit, Sie werden ja die Gelegenheit haben, mir noch ausführlich zu widersprechen. (Bundesminister Schelling: Genau! Ich werde die Gelegenheit wahrnehmen!) – Ja, ich bitte darum.
Ich möchte zu dem, was Kollege Lindinger zum Wohnbau in Oberösterreich gesagt hat, nur noch eines erwähnen: Er hat dabei zu erwähnen vergessen, dass der jetzige Wohnbaulandesrat Haimbuchner, der das Ressort 2009 von der SPÖ übernommen hat (Bundesrat Schennach: Geisterfahrer!), einen Schuldenberg von 130 Millionen € übernommen und es geschafft hat, über Landesdarlehen innerhalb kürzester Zeit wieder ein Volumen von 684 Millionen € aufzubauen. Wenn man schon von der Wahrheit redet, dann soll man die ganze Wahrheit sagen.
Ich bin jetzt schon gespannt, wie Sie den Einstieg in den Umstieg dann noch weiter begründen werden. – Danke. (Beifall bei der FPÖ.)
14.40
Präsident Mario Lindner: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Heger. – Bitte, Herr Bundesrat.
14.40
Bundesrat Peter Heger (SPÖ, Burgenland): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Minister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen des Bundesrates! Werte Zuseher! Geschätzter Herr Kollege Zelina! Sie haben in Ihrem Debattenbeitrag soeben den Bürgermeistern unterstellt, mit Steuergeldern nicht ordnungsgemäß und nicht fürsorglich genug umzugehen. Das möchte ich auf das Schärfste zurückweisen! (Beifall bei der SPÖ und bei Bundesräten der ÖVP.)
Gerade für uns als Landesvertreter und für mich als Bürgermeister ist das Finanzausgleichsgesetz 2017 etwas ganz besonders Wichtiges. Vieles ist schon gesagt worden, aber gerade der Finanzausgleich und die begleitenden Maßnahmen sind derart wichtig, dass ich die aus meiner Sicht wichtigsten Punkte nochmals zusammenfassen möchte.
Die Einschätzungen der Gemeinden und der verantwortlichen Kommunalpolitiker, was das Finanzausgleichsgesetz 2017 betrifft, sind äußerst unterschiedlich. Das merkt man heute auch an den unterschiedlichen Zugängen in der Debatte. Einige meinen, es hätte im Finanzausgleich schon mehr drinnen sein können, die anderen wiederum sagen, die Gemeinden steigen gar nicht so schlecht aus, und eigentlich haben beide irgendwie recht. Eines ist jedoch schon sicher: Der Finanzbedarf der Kommunen bleibt mit Sicherheit auch in Zukunft sehr hoch – das vor allem auch deshalb, weil die Gemeinden in den nächsten Jahren durch Zuteilung von Aufgaben mehr Geld ausgeben müssen, als sie eigentlich zur Verfügung haben.
Die Gemeinden sind der bedeutendste öffentliche Investor, und diese Aussage ist kein Stehsatz, sondern auch durch viele Studien belegt. Kanal- und Straßenbau, Kinderbetreuung, egal ob im Kindergarten oder in der Pflichtschule, dies auch verbunden mit ganztätigen Schulformen, Altenbetreuung, oft auch in Form von Sozialprojekten: das alles ist sehr kostenintensiv! Und dazu kommen noch verschiedenste Erhaltungsmaßnahmen für öffentliche Gebäude.
Ich möchte jetzt ein Beispiel aus meiner Gemeinde bringen, denn in der wird beispielsweise die Neue Mittelschule saniert, umgebaut, barrierefrei gestaltet und mit einem neuen Unterrichtskonzept versehen, und diese Investition in der Höhe von insgesamt 3,3 Millionen € ist für die Gewerbebetriebe in der Gemeinde und in der Region ein wichtiger Wirtschaftsimpuls.
Die Altenbetreuung erfolgt in verschiedensten Formen, auch in Form eines Sozialprojektes wie in meiner Gemeinde mit dem Projekt Nachbarschaftshilfe, das ich kurz beschreiben möchte. Bereits vor drei Jahren haben sich in meinem Heimatbezirk insgesamt sechs Gemeinden zusammengetan und haben das Projekt Nachbarschaftshilfe Plus gegründet und installiert. Im Wesentlichen schenken freiwillige Helfer den älteren Gemeindebewohnern Zeit. Sie fahren mit ihnen zum Arzt, kaufen für sie ein, erledigen ihre Amtswege und stehen auch für einen Besuchsdienst, also für ein Tratscherl, zur Verfügung. Koordiniert werden die Einsätze der freiwilligen Helfer durch hauptamtliche KoordinatorInnen, die in den Gemeindeämtern als AnsprechpartnerInnen für die Ortsbevölkerung zur Verfügung stehen. Damit helfen wir denen, die diese Hilfe brauchen, und haben zusätzlich insgesamt vier Arbeitsplätze geschaffen, da im vergangenen Jahr noch weitere drei Gemeinden dem Projekt beigetreten sind. Zudem bleiben die älteren MitbürgerInnen mobil und können so am Dorfleben weiter teilnehmen und auch zum Arzt, zur Post beziehungsweise zum Postpartner oder zur Bank kommen.
Die Gemeinden sind also – und darüber besteht, so denke ich, kein Zweifel – für die Wirtschaftsentwicklung das Zugpferd Nummer eins. Sie werden diese wichtige Rolle mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren ausfüllen und auch bravourös lösen, auch dann, wenn sich die Bereiche Soziales, Gesundheit, Bildung und die Flüchtlingsbetreuung, wie das meine Vorredner schon angesprochen haben, sehr auf das Budget schlagen werden.
Dass mit dem Finanzausgleich die Aufgabenorientierung bereits in einem ersten Schritt wirklich gelungen ist, war ein besonders wichtiger Punkt. Mit dem Pilotprojekt Kinderbetreuung sind die Weichen grundlegend in die richtige Richtung gestellt worden. Dieser Einstieg in die Aufgabenorientierung wird für die Elementarbildung von 0 bis 6 Jahren als Pilotprojekt vorbereitet und ab 1. Jänner 2018 mit dem Ziel umgesetzt, ab 1. Jänner 2019 den Bereich Pflichtschulen von 6 bis 15 Jahren mit einzubeziehen.
Es ist wichtig, dass die Kommunen die Mittel bekommen, die sie brauchen. Wie erreichen wir das? – Die Gemeinden, deren Ertragsanteile sich gegenüber dem Vorjahr, also dem Jahr 2016, unterhalb des Mindestniveaus entwickelt haben, bekommen eine Aufstockung. Das ist nicht nur sehr positiv, sondern aus meiner Sicht überaus wichtig. Besonders wesentlich ist aber – und auch das wurde heute schon erwähnt – der Strukturfonds. Das betrifft dessen Schaffung an sich und die Tatsache, dass die Einwohnerentwicklung berücksichtigt wird. Für die Anteile aus dem Strukturfonds werden Bevölkerungsentwicklung, Abhängigenquote und Finanzkraft herangezogen. Wesentlich dabei ist, dass eine Gesamtbetrachtung dieser Parameter angestellt wird.
In der interkommunalen Zusammenarbeit werden die bisherigen Ländermittel um die Gemeindebedarfszuweisungen aus dem Finanzkraftausgleich ausgeweitet. Gefördert werden sollen die interkommunale Zusammenarbeit, die Gemeindeverbünde, die Unterstützung strukturschwacher Gemeinden und Gemeindezusammenlegungen, wobei ab 2017 zumindest 15 Prozent und ab 2020 20 Prozent der Gemeindebedarfszuweisungsmittel für die interkommunale Zusammenarbeit und die Unterstützung strukturschwacher Gemeinden beziehungsweise Gemeindezusammenlegungen verwendet werden.
Besonders wichtig ist auch, dass durch die Artikel-15a-Vereinbarung über die Zielsteuerung-Gesundheit ein Kostendämpfungspfad für die kommenden Jahre vereinbart wird. Der Spitalskostenbeitrag für Kinder und Jugendliche wird abgeschafft, und es wird eine sektorübergreifende Medikamentenbewirtschaftung angestrebt. Das Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfengesetz wird um zwei Jahre verlängert, um eine EU-rechtskonforme Lösung zu finden. Es werden also Voraussetzungen für eine finanzielle Stabilisierung der Gemeinden und Städte geschaffen. Es gibt mehr Geld für Gesundheit, es gibt mehr Geld für Pflege, und es gibt mehr Geld für Soziales. Ich meine, die Suppe ist doch nicht so dünn, wie manche behaupten.
Zu den Haftungsobergrenzen gibt es eine eigene Artikel-15a-Vereinbarung. Ziel ist die einheitliche Berechnung auf Gebietskörperschaftsebene und ein einheitliches Spekulationsverbot für Bund, Länder und Gemeinden ab 1.Jänner .2019. Die Haftungen werden dann im Rechnungsabschluss ausgewiesen und die Obergrenzen nach einem eigenen Schlüssel errechnet. Für Banken, Wohnbaudarlehen und Wirtschaftshaftungen sind eigene Haftungsgruppen zu bilden.
Aus all den genannten Gründen wird meine Fraktion daher nicht nur dem Finanzausgleichsgesetz 2017, sondern auch den Beschlussvorlagen der Tagesordnungspunkte 11 und 12 zustimmen. – Danke. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.)
14.49
Präsident Mario Lindner: Als Nächster zu Wort gemeldet ist unser Herr Finanzminister. – Bitte, Herr Bundesminister.
14.49
Bundesminister für Finanzen Dr. Johann Georg Schelling: Hohes Präsidium! Geschätzte Bundesrätinnen und Bundesräte! Eine kurze Vorbemerkung zur Bankenabgabe: Herr Bundesrat Pisec, wenn Sie sich zur Bankenabgabe äußern und damit dann den Verkauf der Creditanstalt in Zusammenhang bringen, darf ich daran erinnern, dass es da keinen gab. Wenn Sie sich daran erinnern, dass Ursache und Wirkung auseinanderzuhalten sind, so war die Bankenabgabe eine Folge dessen, was der Bund an Leistungen für den Finanzsektor übernommen hat – und nicht umgekehrt. Der Bund hat die Mittel zur Verfügung gestellt. Man könnte darüber diskutieren, ob es richtig war, dass die Länder davon Anteile bekommen haben, aber das ist Ihre Aufgabe. Sie sind ja Ländervertreter, zumindest hatte ich bis vor dieser Debatte diesen Eindruck. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
Die Motivation, die hinter diesen Maßnahmen zur Bankenabgabe steht, war ja gerade, nach Überwindung der Probleme auf dem Finanzmarkt die Banken zu entlasten und ih-
nen die Möglichkeit zu geben, am Finanzsektor wieder aktiver zu werden. Ich möchte dazusagen, dass wir auch zu berücksichtigen hatten, dass es in der Zwischenzeit europäische Fonds für Einlagensicherung und für Bankenabwicklung gibt, die ebenfalls von den Banken zu speisen sind, und diese Belastung wäre sicherlich untragbar gewesen, denn das hätte die Bankenabgabe noch einmal deutlich erhöht. Wenn Sie sich vor Augen halten, dass Tranche 2 der Bankenabgabe befristet war und mit Jahresende ausgelaufen wäre, dann sehen Sie, dass da eine gute Lösung gefunden wurde. Ihre Kritik, dass das an der Bilanzsumme hängt, teile ich, sie hängt aber nicht mehr daran, denn die neue Bankenabgabe hängt nämlich am Gewinn. Es war der ausdrückliche Wunsch in der Diskussion mit den Bankenvertretern, dass wir ein System wählen, das die Banken konkurrenzfähig macht. Daher hat man dasselbe System gewählt, das auch in anderen Ländern im Einsatz ist, und es daher vom Gewinn abhängig gemacht und nicht mehr an die Bilanzsumme gehängt.
Was die Haftungsobergrenzen anbelangt, so möchte ich dazu einiges klarstellen. Erstens: Sie werden als Vertreter der Bundesländer wissen, dass jedes Bundesland 100 Prozent der Haftungen aufzulisten hat, und zwar zu den Werten, die die Haftungen ausmachen. Der Begriff Haftungsobergrenze ist etwas verwirrend, denn in Wirklichkeit sind die Haftungsobergrenzen so etwas wie eine Bewertung, was schlagend werden könnte, um das einmal sehr vereinfacht darzustellen.
Wir haben natürlich nicht die Diskussion, dass Haftungen schlagend werden. Wir haben allerdings solche Fälle. Einen löse ich gerade, der betrifft Kärnten, dort sind die Haftungen schlagend geworden. Wenn Sie jedoch einmal ein typisches Beispiel für Haftungen, die Sie kritisiert haben, mit durchdenken wollen, möchte ich Ihnen das kurz erläutern: Der Bund garantiert haftungsmäßig für 50 Milliarden € in der Kontrollbank, und die Kontrollbank hat den Zweck, die starke österreichische Wirtschaft international zu begleiten und für den Export Garantien und Finanzierungen bereitzustellen.
Diese Haftungen werden zurzeit mit 23 Milliarden € ausgenützt, also nicht einmal zur Hälfte. Wenn Sie sich die Statistik ganz genau anschauen, dann sehen Sie, dass diejenigen, die so eine Haftung und Garantie bekommen, ein Haftungsentgelt dafür bezahlen. Bisher war dieses Haftungsentgelt immer höher als die möglichen Ausfälle. Ich halte es für mehr als sinnvoll, dass der Bund solche Haftungen übernimmt, um die österreichische Wirtschaft im internationalen Geschäft zu unterstützen. Man kann aber nicht unterstellen, dass diese Haftungen schlagend werden. Und da bitte ich Sie auch, die zu hohe Staatsverschuldung – da stimme ich Ihnen zu – und diese Haftungen auseinanderzuhalten.
Was uns jetzt gelungen ist, ist mit den Haftungsobergrenzen eine Grenze festzusetzen, und ich kann Ihnen versichern, dass ab dem Jahr 2019 alle Bundesländer diese Grenze unterschreiten werden. Ich kann Ihnen auch ganz kurz erklären, warum. Es gibt einzelne Bundesländer, die noch Haftungen für ihre Banken haben, und die reifen mit 2017 ab, und dann fahren wir das systematisch herunter. Ich halte das für richtig und auch für zweckmäßig, dass man diesen Schritt gesetzt hat.
Nur ein kleiner Hinweis noch, weil Sie meinen, dass man den Ländern und den Gemeinden Geld gegeben hat und wir nichts dafür bekommen haben – ich werde es Ihnen dann noch erläutern, was damit alles erreicht wurde –: Vor Kurzem war ein Artikel im „Kurier“, der ja nicht übertrieben regierungsfreundlich berichtet, und zwar über den Finanzausgleich, der die Überschrift hatte: Viel mehr erreicht, als man erwartet hat. Wir befinden uns da in einer komischen Diskussion. Die einen kritisieren, dass wir für spezielle Themen – Gesundheit, Pflege, Integration – mehr Geld bereitstellen, und gleichzeitig behaupten die anderen, sie bekommen weniger. Also jetzt frage ich Sie: Wer hat denn diese Mittel jetzt eigentlich? – Ich habe sie jedenfalls nicht, also müssen sie bei den Ländern und bei den Gemeinden ankommen, und das soll auch so sein.
Daher glaube ich schon, dass dieser Einstieg in den Umstieg gelungen ist. Man kann da zwei Wege beschreiten, da haben Sie schon recht, Frau Bundesrat. Man kann den Weg der Schweiz beschreiten, 15 Jahre verhandeln und dann sagen: Es ist so!, oder man kann den Einstieg in den Umstieg planen und diesen systematisch weiterentwickeln.
Ich werde Ihnen kurz ein paar Punkte erläutern, die darin enthalten sind, um einmal zu verdeutlichen, was alles gemacht wurde.
Wir haben die Transparenzdatenbank, das war ein jahrelanges Kampfthema, und jetzt kommt sie. Warum wollen wir denn diese Daten haben? – Diese Daten will ich ja nicht haben, um irgendjemanden zu beobachten oder was auch immer. Bei den Förderungen im Bereich Energie und Umwelt zum Beispiel möchte ich am Ende des Tages gerne wissen, ob ein Bundesland, das eine Solarzelle höher fördert als ein anderes Bundesland, auch wirklich mehr Solarzellen installiert hat oder nicht. Das muss doch das Ergebnis dieser Transparenzdatenbank sein, um mit den Fördermitteln steuern zu können.
Es gibt Beispiele: Das Land Oberösterreich liefert zu 100 Prozent, die unterscheiden nicht mehr zwischen Energie und Umwelt, die liefern alles. Da hat der Herr Landeshauptmann gesagt: Ich bin es leid, dauernd vom Herrn Finanzminister irgendwie eigenartig angeschaut zu werden, wir liefern. Sie als Bundesrätinnen und Bundesräte können das gerne von ihren jeweiligen Landesregierungen einfordern. Tun Sie das! Sie sitzen ja zum Teil in den Landesregierungen, auch die Grünen. Sie können diesen Antrag jederzeit einmal in Ihrer eigenen Regierung einbringen; dann werden wir sehen, wie weit Sie im Verhältnis zu dem, was wir hier erreicht haben, kommen.
Wenn Herr Bundesrat Lindinger sagt, dass der Finanzminister für den Bund sehr gut verhandelt hätte, dann nehme ich das Lob natürlich dankend zur Kenntnis. Ich möchte aber darauf aufmerksam machen: Das ist mein Job, denn ich vertrete hier ja die Interessen des Bundes, und daher muss ich ja für den Bund gut verhandelt haben, und so möchte ich es auch gerne verstanden wissen. (Beifall bei der ÖVP.)
Was andere Anregungen anbelangt: Ja, deshalb haben wir ja gesagt, wir wollen das weiterentwickeln. Ich komme noch auf ein paar Punkte zurück. Ich möchte nur kurz dazusagen: Die KöSt war so ein Thema, das wir intensiv diskutiert haben. Man erkennt dann aber, dass man dazu auch Zeit braucht, denn die Komplexität ist enorm. Nehmen Sie nur ein ganz einfaches Beispiel, das jeder sofort verstehen kann: Ein Unternehmen hat in einem Bundesland seine Firmenzentrale, zahlt dort die KöSt und hat in allen neun Bundesländern Filialen. Wie macht man dann den Ausgleich der KöSt? Sie können es nicht dem Unternehmen aufhalsen, dass es eine KöSt-Berechnung pro Bundesland erstellt. Das wäre einfach ein bürokratischer Aufwand, der unnötig ist. Daher: Wie lösen wir das und wo kommen wir dann hin? – Wir kommen dann dahin, dass das Bundesland mit den anderen Bundesländern einen Finanzausgleich machen muss. Ich kann Ihnen nur viel Freude damit wünschen, zumindest was meine Erfahrung damit anbelangt.
Herr Krusche, ich meine – ehrlich –, politisches Kleingeld mit dem Finanzausgleich zu machen, ist das eine, aber als Ländervertreter, als der Sie hier sitzen, müssten Sie eigentlich sagen: Bei dem Finanzausgleich bleibt mir nichts mehr anderes übrig, ich muss zurücktreten. Also Sie machen nicht den Einstieg in den Umstieg, sondern Sie würden eigentlich den Ausstieg machen. Zum einen höre ich hier von Ländervertretern, dass wir ein passables Ergebnis erreicht haben, und von den anderen höre ich, dass alles ganz furchtbar ist. Irgendwann werden wir uns einigen müssen, wo denn da die Wahrheit liegt.
Jetzt komme ich zu etwas, das ich angekündigt habe, und was wir in jedem einzelnen Punkt zumindest teilweise erfüllen konnten. Ich sage es jetzt noch einmal: Der Einstieg
in den Umstieg heißt ja nicht, dass wir damit fertig sind. Ich komme auch noch auf die Frage der Kriterien zurück. Ich habe gesagt, wir stellen auf Aufgabenorientierung um. Von mehreren Rednern ist erwähnt worden, die Aufgabenorientierung für zwei Projekte ist erreicht, mehrere werden noch kommen.
Ich darf Ihnen dazu sagen, wir haben zwölf Projekte dazu vorgelegt. Wir haben auch errechnet, wie sich die finanzielle Struktur verwerfen würde oder nicht verwerfen würde. Natürlich brauchen die Bundesländer jetzt Zeit, diese Projekte nachzurechnen, aber es wird den nächsten Schritt geben. (Bundesrat Krusche: Wir reden ja nur von dem, was kommt, und nicht von dem, was kommen wird!) – Also Sie beschließen schon einmal gar nichts! (Heiterkeit und Beifall bei ÖVP und SPÖ.) Es sei denn, Sie sind nach Ende meiner Rede vom Saulus zum Paulus geworden, was aber eher unwahrscheinlich ist. (Bundesrat Herbert: Stimmrecht haben wir aber schon!)
Abgabenautonomie: Wir steigen einmal mit der Wohnbauförderung ein, weil es da völlig unterschiedliche Voraussetzungen gibt. Ich möchte bei dieser Gelegenheit kurz erwähnen, was da sozusagen dahintersteckt. Erstens: In Zukunft soll es vereinfachte Standards für den Wohnbau geben. Wir sind überkompliziert, und dadurch steigen, wie Bundesrat Lindinger sagt, die Mieten. Wir regeln viel zu intensiv, wir brauchen alle möglichen Vorschriften, von Schutzräumen bis hin zu allem Möglichen. Das soll vereinfacht werden. Die technische Bauordnung wird bundeseinheitlich geregelt werden, und was die Wohnbauförderung anbelangt, wird für die neuen Mittel festgelegt, dass die Bundesländer ein Zwei-Jahres-Fixprogramm für die Wohnbautätigkeit vorzulegen haben.
Das ist das Resultat davon, dass wir gesagt haben: Wenn man schon die Zweckbindung nicht erreichen kann, vor allem bei den Rückflussmitteln, denn die sind ja zum Teil schon gar nicht mehr existent, denn die sind ja zum Teil veranlagt, dann wollen wir zumindest dieses Wohnbauprogramm fixiert haben, um so auch für die Bauwirtschaft Planungssicherheit zu bekommen, sodass dieser Wohnbau auch stattfindet.
Die Frage der weiteren Vorgangsweise ist so vereinbart. Dazu sage ich, dass es da ziemlich genau eine Drei-Drei-Drei-Teilung in der Frage der Abgabenautonomie gibt: Da gibt es drei Bundesländer, die sind strikt dagegen, drei Bundesländer, die sind strikt dafür, und drei Bundesländer sagen: Schauen wir einmal, was kommt, und dann reden wir weiter!
Das ist eine besonders spannende Situation für die Verhandlungen, wenn einige sagen, dass das für sie überhaupt nicht infrage kommt. Dass wir den Bereich Abgabenautonomie zumindest in diesem einen Punkt geschafft haben, ist also durchaus das, was auch angekündigt wurde.
Bei den Vereinfachungen komme ich im Detail noch zu den Themen Pflege, Gesundheit, Spitalskostenbeitrag, Palliativmedizin. Dazu darf ich sagen, Frau Bundesrätin Reiter, dass da die Länder jetzt mitzahlen, das war bisher nicht so. Das konnten wir also auch erledigen.
Wir haben entsprechende sonstige Maßnahmen gesetzt, und ich möchte einige davon beispielhaft erläutern:
Es gibt diesen neudeutschen Begriff Spending Review. Auf Basis der Ergebnisse der Spending Reviews wird ab sofort auf allen Ebenen, übrigens auch auf der Bundesebene, zu untersuchen sein, ob wir aus den historisch gewachsenen Strukturen herausmüssen. In vielen Bereichen wird das so sein, daher werden wir untersuchen, was noch zweckmäßig ist, was zeitgemäß ist, was vor allem das Ergebnis der Maßnahmen ist. Wir haben die Denkweise, dass mehr Geld bessere Lösungen bringt – das stimmt bei Weitem nicht, das wissen wir alle. Wir sollten untersuchen, was herauskommt.
Das Benchmark-System, zu dem sich die Länder und die Gemeinden verpflichtet haben, ist viel einfacher, als die meisten glauben. Unter anderem werden wir anhand von
Daten der Statistik Austria untersuchen, was die Kosten pro Einwohner für die Bezirksverwaltung sind, was die Kosten pro Einwohner für ein Amt der Landesregierung sind. Diese Zahlen sind da, und diese Zahlen nehmen wir als Benchmarking, um auch eine Bewegung auf der Länderebene im Bereich der eigenen Verwaltungsverantwortlichkeit zu erreichen. Das halte ich für sehr zweckmäßig, damit jeder einmal sieht, warum man da kritisiert. Die Zahlen gehen ja teilweise sehr weit auseinander: Wenn es Bereiche gibt, in denen das eine Bundesland Kosten in Höhe von 80 € pro Kopf und das andere Kosten in Höhe von 50 € pro Kopf hat, dann wird man darüber diskutieren müssen, warum das so ist. Dieses Benchmark-System ist erstmalig im Finanzausgleich verankert worden.
Wir haben das Thema Steuerung und Planung des Gesundheitssystems auf die Bundesebene geholt, das heißt, jede weitere Planung im stationären Bereich ist in der Bundeszielsteuerungskommission abzustimmen und nicht mehr auf der Länderebene.
Was Ihre Kritik an den 27 Krankenhäusern betrifft: Glauben Sie mir, als ehemaliger Vorsitzender des Verbandsvorstandes im Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger kenne ich die Kostenstruktur jedes einzelnen Krankenhauses, und da ist manche Kritik durchaus angebracht. Warum aber steuern wir jetzt in der Bundeszielsteuerungskommission? – Damit wir den niedergelassenen und den stationären Bereich gemeinsam planen können. Das ist ein wesentlicher Fortschritt, den man uns bisher nicht zugetraut hat.
Der Kostendämpfungspfad für Gesundheit und Pflege muss dazu führen, dass wir darüber nachdenken, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Nur wenn dieser Kostendämpfungspfad kommt – der übrigens nichts Neues ist, den gibt es schon seit einigen Jahren, und er wird auch eingehalten –, können wir garantieren, dass es da zu einer Entwicklung kommt, die die Ausgaben nicht mehr expansiv nach oben treibt. Dass die Kosten weiter steigen werden, ist jedem bewusst, und das ist klar – aber die Frage ist, mit welcher Dynamik das geschieht.
Zu den weiteren Punkten, die angesprochen wurden: Glauben Sie, dass es einfach war, eine Regelung dafür zu finden, dass bestimmte Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel für die interkommunale Zusammenarbeit reserviert werden? Es waren nämlich nicht alle erfreut darüber, dass wir das forcieren wollen. Auch dies ist ein Schritt in die Richtung: Was wir gemeinsam tun können, sollten wir gemeinsam tun. Dafür sollte es Anreize geben, dafür sind Mittel reserviert worden, und ich halte das für einen wesentlichen Fortschritt.
Das Spekulationsverbot ist erwähnt worden.
Die Frage, die am Schluss noch aufgetaucht ist, betrifft das Thema der Bundesstaatsreform. Jetzt sage ich Ihnen etwas: Hier sitzen die Bundesländervertreter, und wir können uns gerne einmal über die Bundesstaatsreform nach dem Beispiel des Konvents unterhalten. Da bin ich gespannt, wie weit wir kommen werden!
Jeder, der jedoch meint, dass der Finanzausgleich ein Ersatz für eine Bundesstaatsreform ist, der irrt einfach. Wir greifen bei jeder Maßnahme des Finanzausgleichs entweder in die Bundesverfassung oder in die Bundesfinanzverfassung ein – da bin ich ja dann gespannt, ob wir hier im Bundesrat eine Zweidrittelmehrheit dafür zustande bringen. Auf diese Diskussion freue ich mich schon, und ich werde sie auch aktiv führen. Ich habe in Bezug auf die Bundesstaatsreform bereits eine Arbeitsgruppe bei mir im Haus installiert, die auf Basis der Ergebnisse des Konvents einen Vorschlag unterbreiten wird, und diesen sollten wir dann diskutieren.
Was ich noch ergänzen möchte, betrifft den Strukturfonds in Höhe von 60 Millionen € pro Jahr; er ist kurz erwähnt worden. Dieser ist, wie ich meine, eine gute Sache, um strukturschwachen Gemeinden zu helfen, strukturstärker zu werden. Was noch in einer
anderen Gesetzesmaterie vorhanden ist: Wir haben für die Gemeinden über zwei Jahre ein Investitionspaket mit je 87,5 Millionen € pro Jahr an zusätzlichen Mitteln für Investitionen zur Verfügung gestellt, um der Tatsache – was Sie alle argumentiert haben –, dass die Gemeinde der wichtigste Investor ist, Rechnung zu tragen.
Wir werden auch ein neues Modell für die Finanzierungen vorstellen, das zum Teil bekannt ist. Wir müssen natürlich im Zusammenhang damit beachten, dass die Ausgaben der Gemeinden im Sinne von Investitionen nicht im Maastricht-Ergebnis des Bundes ankommen, denn dafür werde ich dann geprügelt.
Ein Projekt, das ebenso initiiert wurde, betrifft die Frage des Transfers. Ich stimme Ihnen da völlig zu, dass der Einstieg in den Umstieg, ohne darüber nachzudenken, welche Transfers aus der Vergangenheit da sind, nie gelingen würde. Wir haben eine Untersuchung durch das Finanzministerium vorgelegt, wer eigentlich am meisten von diesen Transfers profitiert. Das Interessante dabei ist: Es sind die kleinsten Gemeinden!
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass das richtig ist, aber die Frage ist, ob wir dafür diese Transferleistungen brauchen, die extrem komplex sind. Brauchen wir Maßnahmen, die bewirken, dass Mittel vom Bund an die Länder und von den Ländern an die Gemeinden zugewiesen werden und die Länder dieses Geld dann wiederum von den Gemeinden abholen? Soll man nicht einfach einen anderen Weg beschreiten und sagen: Diese Aufgabe erledigen die Länder, das machen ausschließlich sie, und da ist keine Kommunalfinanzierung im Sinne der Rückfinanzierung mehr dabei!? Diese Aufgabenstellung müssen wir in Angriff nehmen.
Daher: Ja, wir haben die ersten Schritte geschafft. Ich wollte nicht 15 Jahre warten, bis mir Experten erklären, wie das geht – ich meine, wir haben auch so genug Expertenmeinungen gehabt, um diese Maßnahmen umzusetzen.
In Anbetracht dessen, dass Sie Vertreter der österreichischen Bundesländer sind, die ja bekanntlich die Republik gegründet haben (Bundesrat Mayer: Richtig!) – ja, zumindest wird das so behauptet, aber lassen wir es einmal so stehen –, appelliere ich an Sie, Ihre Zustimmung zu diesem Gesetz zu geben und sich die weiteren Maßnahmen anzusehen.
Letzter Punkt: Wir haben in der Frage der Elementarbildung eine Punktation aufgesetzt, aber solange die nicht mit allen akkordiert ist, können wir sie auch nicht ins Gesetz schreiben. Da geht es um die Fragen: Wie groß sind die Gruppen? Wie viele Gruppen gibt es? Wie groß ist der Anteil von besonders förderungswürdigen jungen Menschen? Wie sind die Öffnungszeiten? Welche Sonderleistungen werden sonst erbracht? Anhand dieses Kriterienkatalogs erfolgt dann die Mittelzuweisung und nicht mehr nur nach den Kriterien, wie groß die Gemeinde oder die Stadt ist.
Jetzt sind wir übereingekommen, dass wir im ersten Halbjahr des nächsten Jahres diesen Kriterienkatalog fixieren und per Verordnung festlegen. Die Länder sind dann mit dieser Verordnung daran gebunden, den Gemeinden anhand dieser Kriterien die Zuweisungen zu geben. Ich halte das für einen gangbaren Weg.
Die Eckpunkte sind fixiert, aber sie können natürlich nicht im Gesetz verankert werden, solange ich mit den Bundesländern die Eckpunkte nicht im Detail abgehandelt habe. Im Rahmen der Finanzausgleichsverhandlungen wissen jedoch alle, dass das die Eckpunkte sind, plus weitere Punkte, die noch eingebracht werden.
Wir sind also eigentlich gut ausgerüstet dafür, dass wir die Terminpläne mit den Stichtagen 1. Jänner 2018 und 1. Jänner 2019 für den Einstieg in die Aufgabenorientierung einhalten werden können. – Vielen Dank. (Beifall bei ÖVP und SPÖ sowie des Bundesrates Schererbauer.)
15.08
Präsident Mario Lindner: Bevor ich Frau Bundesrätin Mühlwerth das Wort erteile, erlauben Sie mir noch eine Bemerkung: Ich möchte mich als Präsident des Bundesrates ganz herzlich beim ORF, insbesondere bei jenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im Jahr 2016 für die Liveübertragungen verantwortlich waren und sind, ganz herzlich bedanken. (Allgemeiner Beifall.)
Da es kurz vor Weihnachten ist, darf ich mir auch noch etwas wünschen: Ich wünsche mir, dass zukünftig alle Sitzungen des österreichischen Bundesrates live im ORF übertragen werden. (Allgemeiner Beifall. – Bravoruf bei der ÖVP.)
Zu Wort gemeldet ist nun Frau Bundesrätin Mühlwerth. – Bitte. (Bundesrat Mayer: Jetzt kommt das Christkind! – Bundesrätin Mühlwerth – auf dem Weg zum Rednerpult –: Oder auch nicht!)
15.09
Bundesrätin Monika Mühlwerth (FPÖ, Wien): Herr Präsident! Herr Minister Schelling! Ihrem Wunsch, Herr Präsident, schließe ich mich gerne an: Wir reden ja schon seit Längerem in der Präsidiale darüber, dass wir gern jede Sitzung übertragen hätten.
Herr Finanzminister, es wird ja selbst Ihnen nicht entgangen sein, dass eine Sache immer von mehreren Seiten betrachtet werden kann. Es ist in einer Demokratie so, dass die Sicht der Regierung oft – nicht immer, aber oft – eine andere ist als jene der Opposition. (Vizepräsident Gödl übernimmt den Vorsitz.)
Auch im ganz normalen Leben, abseits der Politik, kann man eine Sache von der einen und von der anderen Seite sehen – und je nachdem, von welcher Seite man sie betrachtet, kann man zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen kommen, das ist nun einmal so. (Zwischenbemerkung von Bundesminister Schelling.) Ich würde bitten, dass Sie respektieren, dass Oppositionsparteien die Dinge ein wenig anders sehen. Bei allem Respekt, Herr Minister, nur, weil Sie etwas sagen, heißt das nicht, dass das der Weisheit letzter Schluss ist. Es haben auch schon Minister geirrt, auch das haben wir schon erlebt. (Neuerliche Zwischenbemerkung von Bundesminister Schelling. – Zwischenruf des Bundesrates Mayer.)
Ich wünsche mir jetzt – nicht vom Christkind, sondern von Ihnen –, dass Sie da ein bisschen mehr auf Augenhöhe mit jenen kommunizieren, die die Dinge etwas anders als Sie sehen und eine andere Meinung vertreten. (Beifall bei der FPÖ.)
15.11
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Die Abstimmung erfolgt getrennt.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein Finanzausgleichsgesetz 2017 erlassen wird sowie das Finanzausgleichsgesetz 1997 und weitere Gesetze geändert werden und das Bedarfszuweisungsgesetz aufgehoben wird.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend Vereinbarung gemäß Artikel 15a Bundes-Verfassungsgesetz zwischen dem Bund und den Ländern, mit der Regelungen zu Haftungsobergrenzen vereinheitlicht werden – HOG-Vereinbarung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Wir gelangen nun zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend ein Abgabenänderungsgesetz 2016.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz zur Verhinderung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzmarkt (Finanzmarkt-Geldwäschegesetz – FM-GwG) erlassen wird und das Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz, das Bankwesengesetz, das Bausparkassengesetz, das Betriebliche Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz, das Börsegesetz 1989, das Bundesfinanzierungsgesetz, das Bundesgesetz zur Schaffung einer Abbaueinheit, das Bundeskriminalamt-Gesetz, das Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz, das E-Geldgesetz 2010, das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz, das Glücksspielgesetz, das Investmentfondsgesetz 2011, das Kontenregister- und Konteneinschaugesetz, das Rechnungslegungs-Kontrollgesetz, das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, das Sparkassengesetz, das Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, das Verbraucherzahlungskontogesetz, das Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 und das Zahlungsdienstegesetz geändert werden (1335 d.B. und 1391 d.B. sowie 9671/BR d.B. und 9690/BR d.B.)
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Wir gelangen nun zu Punkt 13 der Tagesordnung.
Berichterstatter ist Herr Bundesrat Heger. Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatter Peter Heger: Herr Präsident! Herr Minister Schelling! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen Bundesräte! Ich bringe den Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz zur Verhinderung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung – Finanzmarkt-Geldwäschegesetz – erlassen wird.
Der gegenständliche Beschluss des Nationalrates umfasst zudem die Änderung folgender Gesetze: das Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz, das Bankwesengesetz, das Bausparkassengesetz, das Betriebliche Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz, das Börsegesetz 1989, das Bundesfinanzierungsgesetz, das Bundesgesetz zur Schaffung einer Abbaueinheit, das Bundeskriminalamt-Gesetz, das Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz, das E-Geldgesetz 2010, das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz, das Glücksspielgesetz, das Investmentfondsgesetz 2011, das Kontenregister- und Konteneinschaugesetz, das Rechnungslegungs-Kontrollgesetz, das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, das Sparkassengesetz, das Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, das Verbraucherzahlungskontogesetz, das Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 und das Zahlungsdienstegesetz.
Der Bericht liegt in schriftlicher Form vor.
Nach Beratung der Vorlage am 19. Dezember 2016 stellt der Finanzausschuss mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Ich danke für den Bericht.
Wir gehen in die Debatte ein.
Als Erster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Mag. Pisec. – Bitte.
15.15
Bundesrat Mag. Reinhard Pisec, BA (FPÖ, Wien): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Finanzminister Schelling! Sehr geehrte Damen und Herren! Wir stimmen diesem Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfungsgesetz zu, wenn die Einwände des Nationalrates – die ich jetzt nicht wiederholen möchte, weil sie alle schon plakativ in der Korrespondenz enthalten sind – angenommen werden.
Ich darf noch einen zweiten Punkt ergänzen, auf den ich kurz eingehen möchte. Das betrifft nämlich auch den Finanzplatz Österreich – das ist praktisch ein Kollateralschaden, wenn man so will; ich möchte die Kontinuität wahren –, denn offensichtlich hat ja auch das Wissenschafts- und Wirtschaftsministerium erkannt, dass in Österreich einiges nicht stimmt.
Herr Vizekanzler Mitterlehner – oder war es Staatssekretär Mahrer, was ich eher vermute – hat im Jahr 2016 eine interessante Studie über die „KMU-Börsen in Europa“ mit 118 Seiten in Auftrag gegeben. Da stehen interessante Sachen drin: dass es eben mit dem Finanzmarkt Österreich so nicht funktioniert und dass die gesamte Wirtschaft – ist ja egal, ob man jetzt Kleinst-, Klein-, Mittel- oder Großbetriebe dazunimmt – darunter leidet.
Dieses Geldwäschegesetz strahlt deswegen auf den Finanzmarkt aus, weil der Dritte Markt – und das sind die KMUs – dort Eigenkapital sucht. Das finden die Betriebe nur auf dem Dritten Markt, weil sie aufgrund der Vorschriften für KMUs nur dort gelistet werden können.
Auf dem Dritten Markt – wie in Deutschland oder in anderen Ländern, das steht alles in der Studie drin, aber die Schlussfolgerung daraus steht nicht drin, und die darf ich jetzt erläutern – gibt es Inhaberaktien. Das ist ganz wichtig, weil Investoren Inhaberaktien kaufen. Mit diesem Gesetz sind diese Inhaberaktien dann nur mehr Namensaktien – weil es wieder ein Gold-Plating-Gesetz ist, Österreich also praktisch über das hinausgeht, was die Europäische Kommission uns vorschreibt, die Financial Action Task Force. In Deutschland gibt es das gleiche Gesetz. Das wird zu einem weiteren Delisting österreichischer KMUs führen.
In Deutschland ist das nicht der Fall, dort gibt es nach wie vor die Inhaberaktien, obwohl das gleiche Gesetz, dieses Geldwäschegesetz – und das ist ja schon Nummer 4 –, weiterhin Gültigkeit hat.
In Österreich, das steht in diesem Bericht drin, gibt es gerade einmal zehn Unternehmen auf diesem Dritten Markt – in Warschau sind es 431, an der Deutschen Börse 175 Unternehmen, die auf dem Dritten Markt gelistet sind und Eigenkapital thesaurieren können, weil sie eben auf dem Dritten Markt emittieren.
Ich weiß, dass es dem Wirtschaftsministerium ein Anliegen ist, den Dritten Markt auszubauen – und der Wiener Börse sowieso, mit dem guten neuen deutschen Präsidenten, Herrn Boschan, der die Problematik auch erkannt hat. Er kommt ja aus Deutschland, von der Stuttgarter Börse, er weiß, was die Wirtschaft braucht. Er weiß, dass all die Unternehmen, egal, welche Größe sie haben, Eigenkapital benötigen. Das gibt es nur an der Börse, denn Kredite sind immer Fremdkapital; das darf ich erwähnen.
Ich möchte noch eine weitere Problematik erwähnen. Auf dem Ersten Markt wurde jetzt neben RHI – im Frühjahr war das – Austria Email delistet, und Lenzing hat den Standort in die USA verlagert. Der primäre Grund war aber nicht die Energie – das war mit
ein Grund, aber der primäre Grund, das ist ganz interessant, war die Balance der Währungen.
Das ist ein Effekt des neuen US-Präsidenten Donald Trump, der ganz klar der Wirtschaft neue Prioritäten einräumt, ganz klar Richtlinien vorgegeben hat – nur rhetorisch, ohne dass er ein einziges Gesetz geändert hat. Da ist ein unheimlicher Wirtschaftsboom zu erwarten, der natürlich auch auf Europa ausstrahlt, und Österreich kann da vermutlich mitnaschen.
Das ist zu bedenken: dass die Währung, der US-Dollar, offenbar auch ein Grund ist – dass man aufgrund der Abwertung des Euros Österreich verlässt. – Danke. (Beifall bei der FPÖ.)
15.19
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Poglitsch. – Bitte.
15.19
Bundesrat Christian Poglitsch (ÖVP, Kärnten): Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Geschätzter Herr Finanzminister! Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Kollege Pisec, stimmt ihr dem Geldwäschegesetz heute zu, oder? (Bundesrat Pisec: Wenn …!) – Wenn was? (Bundesrat Pisec: Die Sache, die ich erläutert habe! Es ist nicht vollständig!) Ich nehme einmal an, dass es um die politisch exponierten Personen geht, oder? Es hat im Nationalrat eine heftige Diskussion dazu gegeben.
Ich sage ganz offen: Dieses Gesetz, das heute hier zur Beschlussfassung vorliegt, ist ein extrem wichtiges Gesetz, denn Geldwäsche schadet nicht nur der Republik, sondern Geldwäsche schadet auch der Wirtschaft. Die Korruption und an sich auch die Steuerhinterziehung schaden den klein- und mittelständischen Unternehmen in diesem Land, gerade jenen Betrieben, die tagtäglich an der Wirtschaft aktiv mitwirken und brav Steuern abliefern. Dieses Gesetz ist wichtig, und wir sollten das heute auch einstimmig beschließen, um nach außen ein deutliches Signal zu senden: Es darf keine Geldwäsche in Österreich geben!
Es gibt auch einen Bericht – und das wisst ihr (in Richtung FPÖ) ganz genau – der Financial Action Task Force, die an uns scharfe Kritik übt und feststellt, dass wir in Österreich einiges ändern müssen.
Nun kommt der Herr Bundesfinanzminister her und bringt uns eine Richtlinie, die von der Europäischen Union vorgeschrieben wird, zur Beschlussfassung, und jetzt passt euch das auch wieder nicht. Das können wir so nicht verstehen! (Bundesrat Pisec: Die Börse leidet, das Geld nicht! Das ist ein No-Go!) Ihr wisst ganz genau, dass Geldwäsche auch zur Finanzierung von Terrorismus verwendet wird. Betrachten wir das so, dann seid ihr gegen ein Gesetz, das auch den Terrorismus verhindert. Und deswegen verstehe ich euch hierbei absolut und überhaupt nicht. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
Davon betroffen sind natürlich viele Banken, viele Versicherungsunternehmen, aber auch Anwälte und Notare, das wissen wir. An dieser Stelle möchte ich auch einmal in die Bresche springen und sagen: Das bedeutet natürlich einen größeren Aufwand, gar keine Frage. Vielleicht sollten wir es auch einmal dabei belassen, wo wir gegenwärtig sind, damit es keinen zusätzlichen Aufwand für die Banken gibt und dann unter Umständen die Kredite verteuert werden oder es bei den Anwälten aufgrund der großen Aufwendungen zu Verteuerungen kommt.
Trotzdem möchte ich ein paar Punkte herausstreichen: Es ist natürlich auch für viele politisch exponierte Personen problematisch, die in Vereinen oder in sonstigen Institutionen tätig sind, wenn sie unter besonderer Kontrolle stehen – das ist gar keine Frage. Deswegen bin ich auch froh, dass es im Nationalrat eine Änderung in der Beschluss-
fassung gegeben hat, dass Personen, vor allem auch Landtagsabgeordnete, die ja gerade im ländlichen Raum in vielen Vereinen unterwegs sind, herausgenommen werden, denn wenn sie schon ehrenamtlich tätig sind, dann sollen sie nicht unter Beobachtung stehen.
Ich bin aber schon dafür, dass Landesräte, die politisch exponierte Personen sind – und wir wissen vom Beispiel in Kärnten ganz genau, was in einer Landesregierung durch Korruption und Geldwäsche angerichtet worden ist –, mit involviert sind und unter besonderer Beobachtung stehen.
Von unserer Seite ist dieses Gesetz für den Finanzplatz Österreich, die Wirtschaft, aber auch für unseren Rechtsstaat absolut notwendig, und von uns gibt es hierzu natürlich auch eine dementsprechende Zustimmung. – Danke schön. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
15.23
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Als Nächste gelangt Frau Bundesrätin Dr. Reiter zu Wort. – Bitte.
15.23
Bundesrätin Dr. Heidelinde Reiter (Grüne, Salzburg): Herr Minister! Herr Präsident! Werte Zuseher und Zuseherinnen! Ja, das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz ist wichtig, und es ist ein erster und auch wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Es ist positiv anzumerken, dass Österreich beim Aufbau einer Financial Intelligence Unit erste Schritte setzt. Ob diese erfolgreich sein werden, bleibt abzuwarten, aber es ist von entscheidender Bedeutung, dass noch weitere gesetzliche Maßnahmen folgen, zum Beispiel hinsichtlich Aufbau eines Registers der wirtschaftlichen Eigentümer. Es fehlen noch wichtige Adressaten aus der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, die von diesem Gesetz nicht erfasst sind, wie zum Beispiel Abschlussprüfer, Notare, sonstige Dienstleister für Gesellschaften und Trusts, Immobilienmakler und so weiter. Also da müssen sicher noch weitere Schritte gesetzt werden, um diese Richtlinie der EU auch im vollen Umfang umzusetzen.
Für unglücklich gelöst halten wir den Bereich Glücksspielgesetz im Geldwäschegesetz. Da erfolgt eine weitgehende Anwendung, aber das Gesetz ist unlesbar. Es enthält viele Regelungen, die bisher direkt im Glücksspielgesetz enthalten waren. Diese Regelungen sind nun eben in diesem Gesetz enthalten, und da kommt es dann immer wieder zu verschiedensten Verweisen. Wesentliche Regelungsinhalte sind damit im Glücksspielgesetz nicht mehr erkennbar, und die Anwendung wird wirklich zur juristischen Fleißaufgabe mit teils drei- bis vierstufigen Verweisen. Das könnte man ja noch stehen lassen, aber es ist eine Tatsache, dass eine solche Regelungstechnik problematisch ist und laut VfGH-Judikatur im Extremfall auch dem Legalitätsprinzip widerspricht.
Es gibt auch ein Problem mit der Anwendbarkeit auf das kleine Glücksspiel, also auf die Landesausspielungen, denn auch im kleinen Glücksspiel müssen wesentliche Teile der Geldwäschebestimmungen eingehalten werden, was aber nur erfolgt, wenn es die entsprechende Landesgesetzgebung dazu gibt. Derzeit läuft das unter einer Ausnahme vom Glücksspielmonopol des Bundes. Bei einem Inkrafttreten am 1. Jänner 2017 gibt es sicherlich noch keine Landesgesetze.
Eine Frage stellt sich auch, was die Landeskonzessionäre betrifft, welche ja von den Landesbehörden zu kontrollieren sind. Die Kontrolle der Einhaltung des Geldwäschegesetzes in diesem Bereich obliegt aber der Finanzmarktaufsicht, und da stellt sich die Frage, ob es notwendig ist, dass die Länder parallel dazu eigene Kontrollstrukturen aufbauen – das kann sicherlich nicht sinnvoll sein. Das konnte nicht entsprechend geklärt werden. Was die Vergabe von Konzessionen bei Anteilsübertragungen betrifft, ist es so, dass sich unter Umständen eine Lücke auftut. Das heißt, dass entsprechende Kon-
zessionäre das Glücksspielgesetz ruhig brechen dürfen, solange die Anteilsübertragung rechtzeitig gemeldet wird.
Es gibt auch noch kleinere Probleme im Glücksspielgesetz, was die Identität der Besucher betrifft: Diese muss nach den neuen Bestimmungen des vorliegenden Geldwäschegesetzes auch überprüft werden, aber die Daten müssen nicht mehr – wie bisher – aufgehoben werden. Also diese Aufbewahrungsfrist fällt, und das finden wir auch nachteilig.
Wie gesagt, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber hinsichtlich des Aufbaus des Registers, welches öffentlich zugänglich sein soll, gibt es noch Handlungsbedarf, um die entsprechende EU-Richtlinie im vollen Umfang umzusetzen. Wir glauben, das hätte wirklich alles in einem entsprechend erledigt werden können. In diesem Sinne ist es nicht zukunftsweisend, und wir hoffen, dass das tatsächlich noch passiert. – Danke. (Beifall bei den Grünen.)
15.28
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, darf ich Herrn Professor Herbert Schambeck begrüßen, ein langjähriges Mitglied dieses Hauses, nämlich 28 Jahre Mitglied als Bundesrat, davon 22 Jahre Vizepräsident und drei Mal Präsident des Hauses. Ich hoffe, ich habe es richtig eingeordnet. – Herzlich willkommen, Herr Professor Schambeck! (Allgemeiner Beifall.)
Als Nächster gelangt nun Herr Bundesrat Lindinger zu Wort. – Bitte.
15.29
Bundesrat Ewald Lindinger (SPÖ, Oberösterreich): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen! Mit Freude habe ich in den einleitenden Worten des Kollegen Pisec entnommen, dass Sie zustimmen.
Ich dachte mir: Ja, heute findet der Tag doch noch ein schönes Ende. Wir sind gemeinsam gegen Geldwäsche, gemeinsam gegen Terrorismusfinanzierung. Und auf einmal macht er eine Kehrtwende und sagt: Ja, aber … – Es gibt da aber kein: Ja, aber …, es gibt nur ein Ja zur Terrorbekämpfung und zur Bekämpfung der Geldwäsche.
Uns entgeht in Europa sehr viel Geld, wenn dieses auf die bekannten Inseln verschoben wird und die Steuern hinterzogen werden. Schätzungen ergeben, dass 1 Billion € verschoben und damit der Steuer entzogen wird.
Geschätzte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben in Europa kein Problem mit Flüchtlingen, bei denen zu Hause, in den Hauptstädten, Bomben hochgehen oder die in ihren Heimatländern fast verhungern. Wir haben ein Problem mit Steuerflüchtlingen. Das ist das Problem Europas. (Beifall bei SPÖ und Grünen.)
Wir haben ein Problem mit Steuerflüchtlingen, und um dem einen Riegel vorzuschieben, hat man für die Umsetzung dieser EU-Richtlinie sehr rasch ein Gesetz formuliert. Wir haben 21 Gesetze zu ändern. Wir haben es beim Bericht des Berichterstatters gehört: Es handelt sich um eine Reihe von Gesetzen.
Geschätzte Damen und Herren! Auch wenn das Gesetz auf im Inland politisch exponierte Personen anzuwenden ist, ist das richtig. Im Inland politisch exponierte Personen haben ja meistens eine reine Weste – bis auf ein paar schwarze Schafe, und die sollen auch verfolgt und verurteilt werden können. Dazu ist es auch notwendig, dass man das in Zukunft vermeiden und verhindern kann. Ich habe vorhin beim letzten Tagesordnungspunkt die Redezeit ein wenig überschritten, darum würde ich im Sinne der Zeitökonomie sagen: Wir werden auch jetzt zustimmen.
Ich bedanke mich und wünsche Ihnen, Herr Finanzminister, dass in Österreich keine Geldwäsche stattfindet, dass wir gemeinsam in Europa gegen die Terrorfinanzierung an-
kämpfen, und wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg. – Danke. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.)
15.32
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Als Nächster zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesminister Schelling. – Bitte.
15.32
Bundesminister für Finanzen Dr. Johann Georg Schelling: Hohes Präsidium! Lieber Professor Schambeck! Ich habe ja eine ganz besondere Beziehung zu dir, du warst einer meiner akademischen Lehrer – da sieht man, was daraus wird –, und daher freut es mich, dass du heute auch hier bist.
Ganz kurz zu der Vierten Geldwäscherichtlinie – das ist eine Umsetzung einer europäischen Richtlinie –: Die zum Teil angesprochenen Probleme treten auf, weil es dazu auf europäischer Ebene eine Novelle geben wird. Da war die Überlegung der Kommission, die Mitgliedstaaten zu bitten, dass möglichst alle mit 1. Jänner 2017 diesen Teil der Richtlinie in Kraft treten lassen, wissend, dass eine Novelle kommt, denn ursprünglich war geplant, dass das Inkrafttreten der Vierten Geldwäscherichtlinie erst mit Juni 2017 erfolgt. Aus den bekannten Gründen hat man das vorgezogen, daher liegt der Gesetzesvorschlag vor. Im Wesentlichen ist natürlich klar, dass wir – Sie, ich – nun alle davon betroffen sind.
Es gab die Überlegung, dass das einen besonderen Verwaltungsaufwand bedeutet. Das wird aber keinen wesentlichen Verwaltungsaufwand bedeuten, da für die politisch exponierten Personen nicht österreichischer Provenienz diese Register schon existieren. Das bedeutet, die Banken haben schon solche Register, sie müssen sie nach internationalem Standard schon führen. Wir alle kommen nun zu diesem Register hinzu, daher haben wir mit dem Fachverband der Banken und Versicherungen sehr detailliert besprochen, wie diese Abwicklungen erfolgen sollen.
Was im Zuge der Begutachtung auch wichtig war, war die Präzisierung der Sorgfaltspflichten: wo es eine verstärkte und wo es eine vereinfachte Sorgfaltspflicht gibt. Das ist in der Zwischenzeit in der entsprechenden Vorlage des Gesetzes geregelt.
Nun zur weiteren Vorgangsweise: Die heute vorliegende Vierte Geldwäscherichtlinie wurde entsprechend eingebracht und behandelt. Zur Frage, die aufgetaucht ist: Das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz wird noch heuer fertig werden und in Begutachtung geschickt. Ich hoffe nur, dass sich am Ende des Tages alle daran halten werden, denn wir wissen aus vielen Untersuchungen und Studien – auch der Europäischen Kommission –, dass die Nichtsichtbarmachung der sogenannten Trusts, die vor allem im amerikanischen und angloamerikanischen Raum stattfindet, eben verhindert, dass wir nachvollziehen können, wie die Geldflüsse sind.
In Österreich hat man ein Firmenbuch, da weiß man, wer die Gesellschafter, die Eigentümer und die Geschäftsführer sind. Man kann bei den Stiftungen die Stifter sehen, man kann als Finanzverwaltung auch die Begünstigten sehen, sodass man das nachvollziehen kann. Wenn es aber nicht gelingt, dass es einen internationalen Standard für diese sogenannten Trustregister gibt, dann wird das weiterhin ein Riesenproblem sein, das übrigens auch im Zusammenhang mit dem bereits im Parlament beschlossenen automatischen Informationsaustausch auftreten wird, da es uns nicht allzu viel nützen wird, wenn wir die Information bekommen, aber nicht wissen, auf wen wir zugreifen können. Das bedeutet, dass ein Schwerpunkt darauf gelegt wird. Wir gehen davon aus, dass dieses Register entsprechend aufbereitet wird.
Die angesprochene Novelle zur Geldwäscherichtlinie soll heute oder morgen von der Kommission präsentiert werden. Geplant ist, dass diese Novellierung noch unter slo-
wakischem Vorsitz kommt. Wir werden die nationale Umsetzung, sobald sie als Textfassung vorliegt, unmittelbar in Begutachtung senden. Geplant ist, dass wir diesen Teil, der nachträglich dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz, das heute zu beschließen ist, folgt, im Juni 2017 beschließen können. Damit ist ein Paket abgeschlossen, und ich glaube, es ist im Interesse aller, dass die Staatengemeinschaft, nicht nur einzelne Länder, alle Kraft darauf konzentriert, diesen Geldwäscheprozessen möglichst enge Spielräume zu lassen und sie unmöglich zu machen.
Was auch von den Vorrednerinnen und -rednern bereits angesprochen wurde, ein ganz zentrales Thema, gerade nach den furchtbaren Ereignissen der letzten Tage: Die Terrorismusfinanzierung damit zu bekämpfen, das ist, glaube ich, eine wesentliche Entscheidung, das wird mit dieser Gesetzesvorlage auch ermöglicht. Ich glaube, dass das in Zukunft noch verschärft werden muss, da die Kanäle für die Terrorismusfinanzierung immer noch nicht versiegt sind. Gerade die Länder, die am meisten davon betroffen sind, legen natürlich großen Wert darauf, dass wir mit der nächsten Novelle auch diese Lücke schließen.
Ich ersuche daher um Zustimmung. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
15.37
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Weitere Wortmeldungen dazu liegen nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir kommen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Mehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend Protokoll zur Abänderung des am 5. November 1969 in Vaduz unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen in der Fassung des am 29. Jänner 2013 in Vaduz unterzeichneten Protokolls (1323 d.B. und 1396 d.B. sowie 9691/BR d.B.)
15. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend Protokoll zur Abänderung des am 29. Jänner 2013 in Vaduz unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein über die Zusammenarbeit im Bereich der Steuern (1324 d.B. und 1397 d.B. sowie 9692/BR d.B.)
16. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Aufhebung des Abkommens vom 13. April 2012 zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt (1327 d.B. und 1398 d.B. sowie 9693/BR d.B.)
17. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und Island zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt Protokoll (1252 d.B. und 1399 d.B. sowie 9694/BR d.B.)
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Nun gelangen wir zu den Tagesordnungspunkten 14 bis 17.
Berichterstatter zu diesen Punkten ist Herr Bundesrat Heger. Ich bitte um die Berichte.
Berichterstatter Peter Heger: Herr Präsident! Herr Minister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich bringe nun die Berichte des Finanzausschusses zu den Tagesordnungspunkten 14, 15, 16 und 17.
Zuerst bringe ich den Bericht zu Tagesordnungspunkt 14: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend Protokoll zur Abänderung des am 5. November 1969 in Vaduz unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen in der Fassung des am 29. Jänner 2013 in Vaduz unterzeichneten Protokolls.
Der Finanzausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 19. Dezember 2016 in Verhandlung genommen.
Der Bericht liegt in schriftlicher Form vor, ich komme daher gleich zur Antragstellung.
Nach Beratung der Vorlage am 19. Dezember 2016 stellt der Finanzausschuss mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag,
1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben,
2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
Zu Tagesordnungspunkt 15: Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend Protokoll zur Abänderung des am 29. Jänner 2013 in Vaduz unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein über die Zusammenarbeit im Bereich der Steuern.
Auch dieser Bericht liegt schriftlich vor; ich komme daher gleich zur Antragstellung.
Der Finanzausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 19. Dezember 2016 in Verhandlung genommen und stellt nach Beratung der Vorlage mit Stimmenmehrheit bzw. Stimmeneinhelligkeit den Antrag,
1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben,
2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
Zu Tagesordnungspunkt 16: Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Aufhebung des Abkommens vom 13. April 2012 zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt.
Auch dieser Bericht liegt schriftlich vor; ich komme daher gleich zur Antragstellung.
Der Finanzausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 19. Dezember 2016 in Verhandlung genommen und stellt nach Beratung der Vorlage mit Stimmenmehrheit den Antrag,
1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben,
2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
Zu Tagesordnungspunkt 17: Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und Island zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt Protokoll.
Auch dieser Bericht liegt schriftlich vor; ich komme daher gleich zur Antragstellung.
Der Finanzausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 19. Dezember 2016 in Verhandlung genommen und stellt nach Beratung der Vorlage mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag,
1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben,
2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Ich danke für die Berichte.
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gelangt als Erste Frau Bundesrätin Dr. Reiter. – Bitte.
15.43
Bundesrätin Dr. Heidelinde Reiter (Grüne, Salzburg): Herr Präsident! Herr Minister Schelling! Werte Kollegen und Kolleginnen! Es sind vier Abkommen, und unsere Haltung dazu ist eine differenzierte, weshalb ich sie jetzt einfach schrittweise durchgehe.
Das erste Abkommen ist jenes zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen. Die Änderung in diesem Abkommen betrifft zwei Abschnitte, das heißt, es soll ausgeschlossen werden, dass es durch das Abkommen zur doppelten Nichtbesteuerung kommt, das heißt zum Treaty Shopping. Wenn es mehrere Auslegungsmöglichkeiten des Textes gibt, so gilt eben jene, die die Steuerumgehung ausschließt. – Wir befürworten das.
Eine Änderung des Doppelbesteuerungsabkommens durch Frau Ministerin Fekter im Jahr 2013 durch Verordnung ist vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben worden und wird jetzt durch eine neue Formulierung saniert. Das betrifft die Besteuerung von öffentlich Bediensteten im jeweils anderen Land. – Diesem ersten Vertrag stimmen wir zu.
Das zweite Abkommen ist jenes zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der Republik Österreich vom 29. Jänner 2013 über die Zusammenarbeit im Bereich der Steuern. Österreich und Liechtenstein verständigen sich darüber, dass das Abkommen zwischen der EU und Liechtenstein – das ist das Abkommen, das einen ersten Datenaustausch ab September 2018 vorsieht – für am 31. Dezember 2016 bestehende Vermögensstrukturen nicht angewendet wird, da die bestehende, die anonyme Pauschalbesteuerung eine „gleichwertige, administrativ bewährte und missbrauchsresistente Maßnahme“ darstelle.
Damit wird eine Übergangslösung zur Dauerlösung. Die geringe Pauschalbesteuerung von Guthaben in Liechtenstein und damit die Ungleichbehandlung von in Österreich Steu-
erpflichtigen soll weiter bestehen. Ich erwähne dazu, dass Deutschland im Jahr 2013 ein solches Abkommen schon abgelehnt hat. Das heißt, es ist nicht angedacht, die Praxis abzustellen, dass Gelder steuervermeidend in Liechtenstein geparkt werden können. – Wir lehnen das ab und stimmen deshalb diesem Abkommen nicht zu.
Zum nächsten Abkommen, jenem zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt: Da wird das Abkommen des Jahres 2013 aufgehoben, und die Bestimmungen regeln, wie mit den restlichen eingehobenen Abgeltungssteuern umgegangen werden soll. Die wesentliche Bestimmung ist, dass über alle im Abkommen als vertraulich bezeichneten Sachverhalte auch weiterhin Stillschweigen bewahrt wird und dass alle Rechtsverhältnisse, die durch das Abkommen entstanden sind, auch weiterhin Gültigkeit haben.
Da das Abkommen aber im Wesentlichen geregelt hat, dass durch die Bezahlung der Abgeltungssteuer eine Endbesteuerung stattgefunden hat und dass die für die Bezahlung der Abgeltungssteuer von der schweizerischen Zahlstelle ausgestellten Bestätigungen jederzeit vor einem österreichischen Finanzamt als Beleg verwendet werden können, ist diese Bestimmung wohl dazu gedacht, eine nachträgliche Besteuerung der Steuerflüchtlinge zu verhindern. – Auch das lehnen wir ab, und deshalb gibt es für diesen Vertrag keine Zustimmung.
Dem vierten Abkommen, jenem mit Island zur Vermeidung der Doppelbesteuerung, stimmen wir vollinhaltlich zu. – Danke. (Beifall bei den Grünen.)
15.48
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Ing. Köck. – Bitte.
15.48
Bundesrat Ing. Eduard Köck (ÖVP, Niederösterreich): Sehr geehrter Minister! Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Gäste! Wir stimmen hier über vier Vereinbarungen – mit verschiedenen Ländern – ab, die die Steuerflucht vermeiden sollen. Ich denke, dass das sehr, sehr wichtige Abkommen sind, weil das die sogenannten einfachen Bürger auch von uns verlangen.
Man sieht immer wieder im Fernsehen, wie sich die großen Konzerne um die Steuerlast drücken, man liest, dass zum Beispiel Apple – wie auch diverse andere Konzerne – offensichtlich Milliarden an Steuern hinterzogen hat, welche jetzt zurückgefordert werden sollen. Das ist für sehr viele unverständlich, denn unsere Klein- und Mittelunternehmer unterliegen, wie auch die Arbeitnehmer in unserem Land, doch einem sehr strengen Regime bei den Steuerleistungen und können sich nicht so leicht mit ihren Gewinnen davonmachen.
Dass die Freiheitlichen vorhin beim Geldwäschegesetz nicht mitgemacht haben, hat mich nicht sonderlich gewundert, denn ich habe mich wieder einmal an die Firma Euro-Consult des ehemaligen freiheitlichen Nationalratsabgeordneten Schreiner erinnert. Er propagiert ein Erfolgsmodell, dass man in Zypern eine Firma gründet und die Gewinne dann zwischen den Tochterfirmen in Österreich und Zypern hin- und herschiebt und so die Steuerzahlungen in Österreich umgehen kann.
In den Medien war ja schon von sehr vielen Mandataren die Rede, von Schellenbacher, Kickl, Rumpold und Waldhäusl, welche da fleißig mittun. Man wird also doch einiges mitgemacht haben, und daher möchte man solche Gesetze vielleicht nicht unterstützen.
Ich denke, dass es wichtig ist, diese vier Abkommen zu unterstützen. Das wird auf OECD-Standard gehoben, und es sind sehr gute bilaterale Abkommen dabei, die die
Handhabe verstärken, um die Steuerflucht einzudämmen. Deshalb werden wir von unserer Fraktion diesem Gesetz zustimmen. – Danke. (Beifall bei der ÖVP und bei Bundesräten der SPÖ.)
15.50
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Schennach. – Bitte.
15.50
Bundesrat Stefan Schennach (SPÖ, Wien): Sehr geehrter Präsident! Sehr geehrter Herr Finanzminister! Liebe Kollegen und Kolleginnen! Diese vier Abkommen bieten die Chance, das gesamte System, das dahinter liegt – Kollege Köck hat es bereits angesprochen – ein bisschen anzupacken. In einem dieser Abkommen steht das nahezu behübschende Wort Steuerumgehung drinnen. Steuerumgehung heißt eigentlich: nichts zahlen – nämlich dort und dort nichts zahlen! Schaut man dann in den Topf hinein, aus dem das Wort Steuerumgehung kommt, dann sieht man, darin liegen auch Wörter wie Steuerflucht, Steuerhinterziehung, Steuerschlupflöcher, Steuervermeidung, Steuerparadiese. – Das ist ein und dasselbe.
Im Europarat bin ich Berichterstatter für die Panama Papers und die Bahamas Papers, und Herr Kollege Köck weiß, dass der Bericht mit nur vier Gegenstimmen zur Kenntnis genommen wurde. Ich habe dort etwas gesagt, das ich auch hier wiederholen möchte: Mir ist es egal, ob das Geld legal von Konzernen oder Superreichen oder illegal aus Geldwäsche oder anderen Machinationen in sogenannte Steuerparadiese kommt – Steuerumgehung, Steuerhinterziehung –: Es ist illegal, und es gehört bekämpft. (Beifall bei der SPÖ und bei Bundesräten der ÖVP.)
Es kippt etwas in unserer Gesellschaft, nämlich, dass Josef und Anna, Maria und Georg, wo immer sie arbeiten, Steuern zu zahlen haben. Normale werktätige Menschen haben Steuern zu zahlen, und andere können es sich richten, wenn sie eine entsprechende Größe haben.
Nehmen wir den Fall einer österreichischen Spedition her: Im Jahre 2015 hat eine Spedition aus Österreich mit einem wahren Konstrukt aus Briefkasten- und Scheinfirmen, bei denen die Fahrer angemeldet wurden, 82 Millionen € an Sozialabgaben hinterzogen. Das schafft dieses System, und dieses System bedeutet letztlich für Europa, dass den Staaten jährlich Milliarden an Steuern entgehen. Gleichzeitig soll aber der Staat in der Bereitstellung der Infrastruktur, in der Bereitstellung der Gesundheitsversorgung, in der Bereitstellung des Bildungswesens funktionieren. All das soll funktionieren, aber manche richten es sich und zahlen nichts.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch sagen, dass die Menschen unter Steuergerechtigkeit ebenfalls verstehen, dass irgendwann auch die Banken normalen Steuersätzen unterliegen. Die Banken haben genug Geld für Boni, aber sie haben kein Geld, um dem Staat entsprechende Steuern zu bezahlen.
Blickt man auf die großen Konzerne, so muss man sagen, dass es richtig war, dass von Apple 13 Milliarden € nachgefordert werden. So sieht man klar, dass in dem Land, in dem eine Tätigkeit entwickelt wird, in dem Umsätze generiert werden, in dem Gewinne erwirtschaftet werden, auch die Steuern bezahlt gehören und sie nicht durch irgendwelche Konstrukte, die sich nur wenige leisten können, herumgeschoben werden dürfen. Das gilt auch für Google, Amazon, Starbucks oder Apple.
Es gibt da aber auch britische Inseln, wie British Virgin Islands, Cayman Islands, Insel Jersey, Isle of Man und so weiter, wie sie alle heißen, wo ganz viel Geld geparkt ist. Dazu gehören dann aber noch einige europäische Staaten, und mit einem dieser Staaten, der Schweiz, erfolgt dieses Abkommen, und das ist wichtig.
Die Schweiz ist so wie Luxemburg, Malta und Zypern im Schattenfinanzindex immer wieder ganz oben. Wir alle, die Öffentlichkeit und die normalen Steuerzahler, können uns beim Tax Justice Network bedanken, das das immer wieder klar und deutlich sichtbar macht. Nur, wenn die Öffentlichkeit da Druck macht, kommt es langsam zur Steuergerechtigkeit, dass die, die etwas haben, endlich auch ihre Steuern bezahlen. (Beifall bei der SPÖ, bei Bundesräten der ÖVP sowie des Bundesrates Stögmüller.)
Natürlich verstehe ich das mit Liechtenstein. Ich verstehe die Kritik, aber ich verstehe nicht, dass man deswegen dagegen stimmt. Natürlich ist das Abkommen mit der Schweiz besser. Da gibt es auch gleich die Abgeltungssteuer, diese Einlagen aus Österreich in den Schweizer Banken werden zugunsten Österreichs versteuert.
Natürlich ist es auch so, dass der automatische Datenausgleich mit der Schweiz sofort und schneller funktioniert als mit Liechtenstein, aber dass wir diesen Schritt setzen – mit Island übrigens auch –, ist gut. By the way: Mit Schweden hatten wir das Problem auch. Durch sogenannte Steuervermeidung und nicht vorhandene Doppelbesteuerungsabkommen haben Menschen, die sehr geschickt hantiert haben, weder in Schweden noch in Österreich Steuern gezahlt.
Noch ein letztes Wort zu jenen, die uns immer Basel II und Basel III aufgedrückt haben, den USA: Man muss sich einmal vor Augen halten, wie doppelbödig die USA agieren. Allein in Delaware sind 1 Million Firmen registriert, darunter 60 Prozent der 500 größten! Da frage ich mich: Hallo? – Da stimmt doch etwas nicht an dem, was wir glauben, was Gerechtigkeit ist!
Wenn wir im Pensionsbereich einen Generationenvertrag haben und im Staatsaufbau einen Vertrag darüber haben, dass wir alle Steuern zahlen, dann sage ich mir: Da stimmt etwas nicht! Ein paar zahlen Steuern, und manche zahlen, wenn sie eine kleine Gehaltserhöhung bekommen, durch die kalte Progression gleich mehr Steuern als das, was sie dazubekommen, und andere jonglieren durch die ganze Welt. – Das kann es nicht sein, und deshalb stimmen wir diesen vier Abkommen zu.
Wir sagen aber gleich dazu: Es darf in Europa keinen Steuerwettbewerb geben. Das ist das Minimum, dass man den Steuerwettbewerb zwischen Mitgliedstaaten ausschaltet. Wir haben ihn aber derzeit, und deshalb passiert auch so viel. Was noch mehr zu befürchten ist: Durch den Brexit öffnen sich ganz neue Tore in diesem Karussell des Steuerwettbewerbs. Dabei geht es nur um Dumping, da geht es nur um das Nichtbezahlen von Steuern, da geht es um Verschleiern und – wenn nicht das Schlimmste – auch um Geldwäsche.
Da müssen wir alle Schritte setzen, denn ein Staat funktioniert nur, wenn jeder und jede – und dazu gehören auch Konzerne und Superreiche – seine und ihre Steuern zahlt. – Danke. (Beifall bei der SPÖ.)
15.58
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Längle. – Bitte.
15.58
Bundesrat Christoph Längle (FPÖ, Vorarlberg): Herr Vizepräsident! Sehr geehrter Herr Finanzminister! Sehr geehrter Herr Innenminister! Geschätzte Damen und Herren! Bezüglich dieses Abkommens mit der Schweiz, mit Liechtenstein und mit Island wurde zwar inhaltlich schon sehr viel gesagt, von freiheitlicher Seite betone ich aber, dass eine Doppelbesteuerung generell negativ ist, weil sie einfach ungerecht ist.
Ebenso sollte es gerade für Österreich – grundsätzlich aber für jeden Staat auf dieser Welt – irgendwie schon sinnvoll erscheinen, dass man mit seinen Nachbarländern gute Beziehungen hat. Für Österreich ist es schon sehr vorteilhaft, mit der Schweiz und mit
Liechtenstein – das sind ja auch Nachbarländer von uns – gute Beziehungen zu haben. In einem weiteren Kontext, in einem europäischen Kontext, betrifft das selbstverständlich auch die Beziehungen mit Island, und daher sind alle vier Abkommen zu unterstützen.
Ebenso sollte man Verfassungsgerichtshofurteile ernst nehmen. Wir haben jetzt ja die Thematik, dass wir darauf eingehen und dass auch repariert wird, der Artikel 19 ist da zu nennen. Ebenso ist es gut, dass wir eine Revision haben und die Umsetzung von OECD-Standards im Bereich der Gewinnverlagerung erreichen. Das ist grundsätzlich sehr positiv zu unterstreichen.
Was ich auch sagen möchte, ist, dass es in Vorarlberg, meinem Heimatland, sehr viele fleißige Vorarlbergerinnen und Vorarlberger gibt, die tagtäglich in die Schweiz und nach Liechtenstein fahren, um dort zu arbeiten, und dann in Österreich quartalsmäßig ihre Steuern entrichten. Ich meine, dass mir der Herr Finanzminister sicherlich recht gibt, dass gerade von diesen vielen Tausenden Personen eine sehr große Steuerleistung erbracht wird, die ja auch uns allen zugutekommt. Daher: ein großes Lob an diese vielen und fleißigen Menschen.
Was mir auch wichtig ist, sind ein paar Worte zu den Ausführungen von Herrn Kollegen Lindinger: Sie haben vorhin gesagt, dass wir Freiheitliche für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind. Ich möchte hier ganz klar festhalten, dass wir das selbstverständlich nicht sind. Nur weil wir vielleicht einen anderen Zugang zu dem einen oder anderen Tagesordnungspunkt haben, heißt das nicht, dass wir für Geldwäsche oder dergleichen sind. Das ist strikt abzulehnen!
Zu den Ausführungen des Herrn Kollegen Köck sage ich auch ein paar Worte. Wenn Sie schon negativ auf die Freiheitlichen schielen und glauben, uns Freiheitliche hier beschimpfen zu können, dann sage ich Ihnen das ganz klar und in aller Deutlichkeit: Zum Beispiel Herr Martinz von der ÖVP wurde wegen Hinterziehung von 12 Millionen € verurteilt und sitzt im Gefängnis, und auch der ehemalige ÖVP-Innenminister Strasser – der dürfte auch kein Unbekannter sein – wurde wegen Bestechung und unerlaubter Geschenkannahme verurteilt. Das sage ich Ihnen auch: Man soll nicht mit Steinen werfen, wenn man selbst im Glashaus sitzt. (Beifall bei der FPÖ.)
Kommen wir aber zurück zur Tagesordnung! (Ruf bei der ÖVP: Grad ihr müsst reden! – Weitere Zwischenrufe bei der ÖVP. – Bundesrat Herbert: Das sagt der Richtige!) – Ja, genau, es scheint, dass wir eure Gemüter geweckt haben, aber die Wahrheit gehört eben auch einmal gesagt, auch wenn es euch vielleicht wehtut, aber ihr habt immerhin mit diesen Geschichten hier angefangen.
Zurück zur Tagesordnung: Wie eingangs erwähnt halten wir diese vier Abkommen beziehungsweise die Protokolle für positiv und werden daher allen Abkommen unsere Zustimmung erteilen. (Beifall bei der FPÖ.)
16.02
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Nun hat sich unser Herr Finanzminister Schelling zu Wort gemeldet. – Bitte, Herr Minister.
16.02
Bundesminister für Finanzen Dr. Johann Georg Schelling: Wertes Präsidium! Zum einen: Ich mache Herrn Bundesrat Köck darauf aufmerksam, dass es nicht richtig ist, zu sagen, Apple hätte Steuern hinterzogen. Ich stehe nicht unter Immunität, daher muss ich mich anders ausdrücken. Es gibt ein Verfahren der Kommission in Bezug auf ungerechtfertigte Beihilfen, die aufgrund von Steuerkonstrukten der Republik Irland mit Apple seit Jahrzehnten vereinbart sind. Übrigens geht das jetzt nicht mehr, da die OECD dem einen Riegel vorgeschoben hat, aber das ist ein klassisches Problem, das im Zuge solcher Doppelbesteuerungsabkommen immer wieder auftritt.
Man sollte nicht mit den Fingern auf Panama oder irgendwohin zeigen, das passiert auch mitten in Europa. Wenn man sich die aktuelle Steueroasenliste ansieht, findet man dort auch mitteleuropäische Länder. Österreich ist Gott sei Dank nicht dabei.
Was das Abkommen mit Liechtenstein anbelangt, so möchte ich zwei Anmerkungen machen. Erstens: Im Gegensatz zur Schweiz – da geht es hauptsächlich um Konten – geht es in Liechtenstein um Stiftungen. Da haben wir die Regelung gefunden, dass wir gemeinsame Prüfkommissionen einsetzen, um die Transparenz der Stiftungen sicherzustellen beziehungsweise Intransparenz aufzuzeigen.
Die zweite Bemerkung zu Liechtenstein: Liechtenstein muss das bei der Kommission durchbringen. Das liegt nicht an uns. Wenn Liechtenstein, das einen Antrag bei der Kommission gestellt hat, nicht damit durchkommt und dieses Abkommen nicht als rechtskonform gilt, dann tritt mit Liechtenstein automatisch das Abkommen über den automatischen Informationsaustausch in Kraft. Betrachtet man das rein pragmatisch, so scheint die Lösung, die wir jetzt gefunden haben, so etwas wie eine maßgeschneiderte Möglichkeit zu sein, überhaupt an diese Mittel heranzukommen, was beim automatischen Informationsaustausch – wie ich vorher schon kurz erwähnt habe – nicht sichergestellt ist.
Dann darf ich – für diejenigen Rednerinnen und Redner, die von Steuervermeidung und all dem gesprochen haben – noch kurz in Erinnerung rufen: Wir haben im Nationalrat und auf europäischer Ebene ein riesiges Paket mit PEPs, mit allem, was mit Steuervermeidung zu tun hat, Country-by-Country-Reporting, Verrechnungspreisdokumentation, verabschiedet.
Wir sind also alle redlich bemüht, diese möglichen Gestaltungsspielräume einzuengen oder abzuschaffen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass in den meisten bisher bekannten Fällen alles völlig legal gelaufen ist, weil eben nationalstaatliches Recht das zugelassen hat. Österreich ist ein Land, wo es ganz, ganz wenige Ausnahmebestimmungen gibt, aber es gibt natürlich Länder, die mit ihren sogenannten Tax Rulings Vereinbarungen mit den jeweiligen Ortsansässigen getroffen haben, die halt jetzt aufschlagen. Man versucht mit PEPs, aber auch mit Country-by-Country-Reporting, diese Lücken zu schließen. Sie können sich gerne schlau machen: Ich bin auf europäischer Ebene einer der vehementesten Kämpfer in dieser Sache, damit das geschieht.
Schlussendlich zur Aussage des Herrn Bundesrates Schennach: Stimmen Sie meinem Vorschlag zur Abschaffung der kalten Progression zu und schon ist sie abgeschafft! (Beifall bei der ÖVP.) Das ist überhaupt kein Problem. Wenn es ein progressives Steuersystem gibt, in dem die, die mehr verdienen, mehr bezahlen, dann werden auch entsprechend der kalten Progression alle entlastet.
Ich denke, es ist ein guter Vorschlag, ein einfacher und transparenter Vorschlag. Es spricht nichts dagegen, dem zuzustimmen. Ich hoffe, dass wir mit den Verhandlungen weiterkommen.
Schlussendlich darf ich mich bei Ihnen allen bedanken und darf Ihnen ein frohes, hoffentlich friedliches Weihnachtsfest und ein paar ruhige Tage wünschen. Für uns Politiker gilt ja nicht: Ein besinnliches Weihnachtsfest!, sondern für uns gilt: Das Weihnachtsfest als Zeit der Besinnung! (Allgemeine Heiterkeit.) Dem schließe ich mich natürlich vollinhaltlich an und hoffe, dass wir nach diesen Besinnungstagen im nächsten Jahr erfolgreich gemeinsam für dieses Land weiterarbeiten. – Ich wünsche Ihnen alles Gute! (Allgemeiner Beifall.)
16.07
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir kommen zur Abstimmung, die ich über jeden Antrag getrennt vornehme.
Wir gelangen zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 14: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend Protokoll zur Abänderung des am 5. November 1969 in Vaduz unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen in der Fassung des am 29. Jänner 2013 in Vaduz unterzeichneten Protokolls.
Da der gegenständliche Beschluss Angelegenheiten der selbständigen Wirkungsbereiche der Länder regelt, bedarf dieser der Zustimmung des Bundesrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz.
Wir gelangen zunächst zur Abstimmung, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit angenommen.
Nun lasse ich über den Antrag abstimmen, dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, um ein Handzeichen. – Das ist wiederum die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit angenommen.
Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 15: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend Protokoll zur Abänderung des am 29. Jänner 2013 in Vaduz unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein über die Zusammenarbeit im Bereich der Steuern.
Da der gegenständliche Beschluss Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbereiches der Länder regelt, bedarf dieser der Zustimmung des Bundesrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz.
Wir gelangen zunächst zur Abstimmung, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Dies ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Nun lasse ich über den Antrag abstimmen, dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, um ein Handzeichen. – Das ist wiederum die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Weiters gelangen wir zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 16: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Aufhebung des Abkommens vom 13. April 2012 zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt.
Da der gegenständliche Beschluss Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbereiches der Länder regelt, bedarf dieser der Zustimmung des Bundesrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz.
Wir gelangen zunächst zur Abstimmung, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Nun lasse ich über den Antrag abstimmen, dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, um ein Handzeichen. – Das ist wiederum die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Weiters gelangen wir zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 17: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und Island zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt Protokoll.
Da der gegenständliche Beschluss Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbereiches der Länder regelt, bedarf dieser der Zustimmung des Bundesrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz.
Wir gelangen zunächst zur Abstimmung, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Dies ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit angenommen.
Nun lasse ich über den Antrag abstimmen, dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, um ein Handzeichen. Dies ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit angenommen.
Bevor wir zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen, darf ich auch unserem Bundesminister ein für Politiker friedvolles Weihnachtsfest wünschen, alles Gute und viel Kraft und Erfolg auch für das nächste Jahr! – Danke, Herr Minister Schelling. (Allgemeiner Beifall.)
Ich darf im gleichen Atemzug den Bundesminister für Inneres, Herrn Sobotka, bei uns begrüßen. – Danke für Ihr Kommen, Herr Bundesminister. (Allgemeiner Beifall.)
Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz über die Enteignung der Liegenschaft Salzburger Vorstadt Nr. 15, Braunau am Inn (1250 d.B. und 1389 d.B. sowie 9713/BR d.B.)
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Wir gelangen nun zum 18. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatterin ist Frau Bundesrätin Kern. – Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatterin Sandra Kern: Hohes Haus! Sehr geehrter Herr Minister! Ich erstatte den Bericht des Ausschusses für innere Angelegenheiten des Bundesrates über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz über die Enteignung der Liegenschaft Salzburger Vorstadt Nr. 15 in Braunau am Inn.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich darf deshalb sogleich zur Antragstellung kommen.
Der Ausschuss für innere Angelegenheiten des Bundesrates stellt nach Beratung der Vorlage am 19. Dezember 2016 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Danke für den Bericht.
Wir gehen in die Debatte ein.
Als Erster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Schödinger. – Bitte.
16.12
Bundesrat Gerhard Schödinger (ÖVP, Niederösterreich): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Minister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Salzburger Vorstadt Nr. 15, Braunau am Inn: Diese Adresse war mir – bis wir diesen Punkt behandelt haben – eigentlich nicht geläufig und bekannt. Mittlerweile ist klar, worum es dabei geht.
Ich will mich jetzt nicht allzu sehr über die Vergangenheit verbreiten, nur so viel dazu: Unsere Innenminister haben mit ihren Teams 15 Jahre mit der Besitzerin darüber verhandelt, dieses Haus gewissen Zwecken zuzuführen, was eigentlich bis dato nicht erreicht werden konnte. Deswegen war nicht anders vorzugehen, als eine gesetzmäßige Enteignung durchzuführen und diesem Haus – und so, wie es aussieht, läuft es auch in die richtige Richtung – einen Zweck zu geben, der unserer Gesellschaft wichtig ist: einen sozialen Zweck. Wir haben keinerlei Ambitionen in Richtung irgendwelcher Mahnmale und dergleichen, denn Mahnmale, die uns an diese schreckliche Zeit erinnern, haben wir genug. Wir haben das große Mahnmal Mauthausen und noch viele kleine Gedenkstätten, die wir pflegen sollten, was wir auch tun. (Bundesrat Lindinger: Das hat’s ja nicht gegeben, haben ein paar gesagt! – Heiterkeit des Redners.) Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Ich glaube, dass wir hier in diesem Plenum doch einer Meinung sind, wie diese Zeit abgelaufen ist und was wir von dieser Zeit zu halten haben.
Für mich – und, ich glaube, auch für die Kolleginnen und Kollegen hier – ist es ein ganz wichtiger Punkt, dem nicht allzu viel Bedeutung beizumessen, weil wir der Meinung sind, dass diese schreckliche Zeit nie wiederkehren darf und dass diese schreckliche Zeit auch in unserem Erinnerungsvermögen nicht ausgelöscht werden darf. (Beifall des Bundesrates Koller.)
Deswegen war es auch die beste Entscheidung des Innenministeriums, dieses Haus zu enteignen und sozialen Zwecken zuzuführen. Es ist daher auch für uns eine klare Sache: Wir werden dem Antrag zustimmen, und das mit vollster Überzeugung. – Danke. (Beifall bei der ÖVP.)
16.15
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Bundesrat Mag. Lindner. – Bitte, Herr Bundesrat.
16.15
Bundesrat Mag. Michael Lindner (SPÖ, Oberösterreich): Sehr geehrter Herr Bundesminister! Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Enteignung einer privaten Liegenschaft ist natürlich immer eine sehr heikle Sache, das öffentliche Interesse daran muss natürlich gut und weitreichend begründet sein.
Wir haben mit dem Staatsvertrag 1955 eine große Verpflichtung übernommen, nämlich alle nationalsozialistischen Spuren aus dem politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben zu beseitigen und ein Wiederaufleben des Nazismus zu bekämpfen. Das ist, wenn wir ehrlich sind, eine fortwährende Aufgabe, die auch mehr als 70 Jahre nach En-
de des Zweiten Weltkrieges noch immer nicht vollendet ist, vor allem, wenn man sich die rasant ansteigende Zahl der rechtsextremen Straftaten ansieht.
Ich glaube, in Österreich haben wir mit unseren Gedenkstätten grundsätzlich eine sehr gute Erinnerungskultur aufgebaut, die auch gerade für die nachfolgenden Generationen wichtig ist. Braunau als Geburtsstadt von Adolf Hitler, aber auch als Grenzstadt zwischen Österreich und Deutschland ist in diesem Zusammenhang natürlich immer sehr stark im Fokus gestanden, und man war sich seiner Bedeutung immer bewusst. Gerade der Altbürgermeister Gerhard Skiba hat immer sehr aktive Gedenk- und Erinnerungsarbeit geleistet und dadurch große Verdienste erworben.
Braunau selbst hat eigentlich in der Geschichte keine große NSDAP-Vergangenheit. Während in anderen Regionen oder Städten die NSDAP in den 30er-Jahren schon Wahlergebnisse um die 20, 30, 40 Prozent hatte, waren es in Braunau weniger als 10 Prozent. (Zwischenruf bei der SPÖ.)
Unabhängig davon, wie häufig und intensiv dieses Haus Vorstadt 15 von rechtsextremen Kreisen oder von Neonazis als Pilgerstätte besucht wird, muss es in Zukunft darum gehen, dass man dieses Haus entmystifiziert und es sinnvoll nutzt. Dass das notwendig ist, hat erst gestern die Verurteilung eines 27-jährigen Innviertlers gezeigt, der wegen einer rechtsextremen Straftat im Umfeld dieses Hauses zu 15 Monaten bedingter Haftstrafe verurteilt worden ist.
Uns muss klar sein, dass diese Enteignung und auch eine neue Nutzung des Hauses die Probleme mit rechtsextremen Netzwerken im Innviertel, im restlichen Oberösterreich oder auch grenzüberschreitend in Bayern nicht lösen wird. Gegen diese Umtriebe braucht es ein konsequentes Vorgehen und eine scharfe Linie der Strafbehörden.
Ich glaube, diese Enteignung ist ein wichtiger symbolischer Schritt, durch den wir dann als öffentliche Hand Gestaltungshoheit haben. Mein Vorredner hat es schon angesprochen: Jahrelang wurde mit der Besitzerin intensiv über andere Möglichkeiten verhandelt. Die Besitzerin wollte aber aus dem Besitz dieser Liegenschaft – weil öffentliches Interesse daran besteht – auch noch Kapital schlagen und hohe Preise oder Mieten verlangen. Das war und ist nicht mehr länger vertretbar.
Mit der vorgesehenen Enteignung haben wir jetzt die Möglichkeit, die Liegenschaft positiv zu nutzen und einen Kontrapunkt zur historischen Bedeutung zu setzen. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, bei der Nachnutzung die handelnden Personen vor Ort, die Stadt Braunau, die Sozialorganisationen und die gesamte Region und die Bevölkerung breit und gut einzubinden, denn letztlich muss diese positive Nutzung auch vor Ort breit getragen sein. – Wir stimmen dieser Enteignung natürlich zu. (Beifall bei SPÖ, ÖVP und Grünen.)
16.18
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Als Nächste zu Wort gelangt Frau Bundesrätin Mühlwerth. – Bitte.
16.18
Bundesrätin Monika Mühlwerth (FPÖ, Wien): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Minister! Meine beiden Vorredner haben ja schon ausführlich erläutert, worum es geht und warum hier eine allgemeine Zustimmung erfolgt.
Ich gebe zu, die FPÖ hat mit der Enteignung gewisse Probleme gehabt, aus dem einfachen Grund, weil wir als Freiheitliche Partei generell gegen Enteignungen und für Privateigentum sind. Soweit ich weiß, hat sich aber auch Kollege Rosenkranz aus dem Nationalrat den Akt genau angesehen, hat auch versucht, mit der Dame Kontakt aufzunehmen, die aber war für niemanden erreichbar. Es ist daher nicht so – der Vorwurf stand im Raum –, dass das Innenministerium da zu wenig getan hätte, sondern ganz
im Gegenteil: Nach Aktenlage hat sich das Innenministerium wirklich bis zum Schluss bemüht und versucht, dass es zu einer ordentlichen Lösung kommt, aber es gibt halt Menschen, die nicht genug bekommen, die glauben, sie können das immer noch ein wenig in die Höhe schrauben.
Wir sind daher entgegen unserer sonstigen Intention in diesem Ausnahmefall für dieses Enteignungsgesetz, weil die Dame der Politik in dem Fall keine andere Möglichkeit gelassen hat. – Wir werden diesem Gesetz daher selbstverständlich auch zustimmen. (Beifall bei FPÖ, ÖVP und SPÖ.)
16.19
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Nun darf ich das Wort Herrn Bundesrat Stögmüller erteilen. – Bitte.
16.20
Bundesrat David Stögmüller (Grüne, Oberösterreich): Sehr geehrtes Präsidium! Sehr geehrter Herr Minister! Sehr geehrte Damen und Herren! Ja, eine jahrelange Diskussion um die Nutzung des Hitler-Geburtshauses scheint nun mit Beschluss dieses Gesetzes in die entscheidende Phase zu kommen.
Seit 2011 steht dieses Geburtshaus in der Salzburger Vorstadt leer und verrottet mehr oder weniger mitten in der Stadt dahin. Warum? – Es diente, wie Kollegen schon gesagt haben, vor 2011 verschiedenen Nutzungszwecken. Eine Expositur der HTL und eine Stadtbücherei waren darin untergebracht. Zuletzt war eine Einrichtung der Lebenshilfe Oberösterreich in diesem Gebäude. Die haben dort eine Tagesheimstätte und auch eine Werkstätte betrieben.
Das Problem dabei war, dass die Vermieterin, also die Besitzerin, es leider verweigerte, dieses Gebäude barrierefrei umzubauen. Das war ein ganz großes Problem für uns, weil die Lebenshilfe natürlich auch körperlich eingeschränkte Personen beschäftigte und diese dann nicht in das Haus hineinkommen und die Einrichtung betreiben konnten. Die Besitzerin erhielt weiterhin 5 000 € Miete. 2 500 € Miete haben wir als Stadtgemeinde an die Bundesrepublik als Untermiete überwiesen. Vielleicht einmal so viel als Überblick, damit man weiß – weil ja nicht alle so in der Thematik drinnen sind –, worum es geht. Ich bin selber Gemeinderat in der Stadt Braunau und bin natürlich auch etwas intensiver und emotionaler in diese Thematik eingebunden als andere Kolleginnen und Kollegen hier im Parlament.
Vielleicht vorweg etwas Kritik an der Vorgehensweise – das muss ich auch auf diesem Weg anbringen, Herr Minister –: Wir von der Opposition im Parlament und auch der Gemeinderat in der Stadt Braunau haben die Gesetzesinitiative für das Enteignungsverfahren eigentlich nur aus den Zeitungen mitgeteilt bekommen. Auch die restlichen Pläne des Ministers wurden uns fast ausschließlich über die Medien mitgeteilt, egal, ob es um die Enteignung ging, ob es um das Schleifen des Hauses oder jetzt um die Nachnutzungspläne ging. Sie sind ja noch letzte Woche mit dem Bürgermeister der Stadt Braunau beieinandergesessen. Während dieser heimfuhr, ist schon die Presseaussendung nach außen gegangen. Wir haben da eigentlich wenige bis gar keine Informationen bekommen. – Das nur als Kritik am Rande.
Aber genau das, diese ewige Diskussion und dabei das Gefühl, dass über die Köpfe der Braunauer Bevölkerung hinweg entschieden wird, was mit dem Hitler-Geburtshaus geschehen soll, ärgert viele und bringt auch gleichzeitig viel nationale und internationale Presse nach Braunau. Es ist aber nicht nur ärgerlich, sondern schon fast eine Belastung für die Braunauerinnen und Braunauer, was sie mit dieser ewigen Diskussion und Spekulation darüber, was mit dem Geburtshaus passieren soll, erleben.
Uns Grünen war es von Anfang an wichtig, dass diese Entscheidung breit getragen wird, mit Einbindung des Gemeinderates, des Bürgermeisters und natürlich von Exper-
tinnen und Experten aus den Kommissionen. Dass das leider nicht so ganz funktioniert hat, sollten Sie als Kritik mitnehmen, Herr Minister.
Aber es ist nicht nur die Diskussion eine Belastung für die Bevölkerung, sondern auch die ständige Assoziierung der Stadt mit dem Geburtshaus von Adolf Hitler ist natürlich ein Stigma für uns Braunauer und Braunauerinnen. Als Braunauer ist man es auch gewöhnt, dass sofort, wenn man gefragt wird, woher man kommt, und man sagt, aus Braunau am Inn, die erste Frage, gerade angesichts der aktuellen Zeitungsberichte, immer ist: Was passiert denn mit dem Hitler-Haus? Das ist immer die erste Frage. Oder man hört sofort: Ah, dort ist das Geburtshaus von Adolf Hitler. Daher ist es auch gut, dass da endlich eine Lösung gefunden wird.
Ein Aspekt, auf den ich auch in diesem Rahmen gerne eingehen möchte, ist der sogenannte Nazi-Tourismus. Dies wurde im Nationalrat von den Kolleginnen und Kollegen ein bisschen breiter diskutiert als hier. Ich möchte da vielleicht etwas korrigieren, weil es oft so dargestellt wird, als ob da täglich Busse voller Nazis nach Braunau kommen würden, die dann vor dem Hitler-Haus stehen und abgelichtet werden oder Hitlergrüße machen: Das ist natürlich nicht der Fall.
Es gibt aber schon immer eine latente Anzahl an Menschen, die sich dort mit einschlägigen T-Shirts, Handzeichen und so weiter ablichten lassen. Es gibt manche, die den Putz vom Hitler-Haus herunterschlagen und als Erinnerung, als Souvenir mitnehmen. Es gibt immer wieder Vorfälle, dass der Stein, der vor dem Haus steht und als Mahnmal gegen Krieg und Faschismus aufgestellt worden ist, mit Farbe beschmiert wird. Es gibt rechtsextreme Gruppen, die ganz bewusst das Haus besuchen, zum Beispiel erst vor Kurzem Blood & Honour aus Ungarn. Auch bei der Gedenkveranstaltung vor dem Hitler-Haus gibt es immer wieder Vorfälle, dass Neonazis vorbeischauen und ganz bewusst auch provozieren wollen. Gerade um den 20. April gibt es immer wieder Neonazis und Rechtsextreme, die zum leer stehenden Haus pilgern, um sich dort an diesem Ort an diesem Tag ablichten zu lassen.
Wie Sie also sehen, sehr geehrte Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, ist es nicht unbegründet: Das Haus ist ein Anziehungspunkt für Ewiggestrige. Ich bin wirklich froh darüber, dass wir da eine Lösung gefunden haben und auch alle Parteien hier im Bundesrat diese mittragen können. Das freut mich wirklich ganz besonders! Ich danke euch allen dafür, dass hier alle Parteien zugunsten der Stadt Braunau, der Braunauer Bevölkerung mitgehen.
Es wurde in letzter Zeit auch viel über die Nachnutzung spekuliert. Mein Vorschlag dazu war immer ein Mix aus verschiedenen Einrichtungen, zum Beispiel eine Ausstiegsstelle für Rechtsextremisten, ein Roma-Sinti-Verein, weil Braunau auch einen der letzten beziehungsweise einen der wenigen Roma- und Sinti-Durchreiseplätze hat, und auch die Lebenshilfe möchte ich wieder in das Gebäude bringen. Genau diesen Punkt haben Sie jetzt auch als mögliche Nachnutzung geplant. Ich finde diese Entscheidung wirklich sehr gut, Herr Minister, dass die Lebenshilfe mit beeinträchtigten Menschen wieder in dieses Gebäude kommt. Das ist auch ein klares Zeichen, weil genau diese Menschen von den Nazis verfolgt und umgebracht wurden.
Ich möchte aber auch zu bedenken geben, dass das Haus durch eine bloße Umbenennung und eine Institution, die einzieht, nicht entmystifiziert wird. Es braucht hier also auch eine nachhaltige Maßnahme, um diesem Gebäude wirklich die Anziehung für Rechtsextreme zu nehmen. Wir müssen auch weiterhin vehement gegen diese ewiggestrigen Besucherinnen und Besucher vorgehen und sicherstellen, dass es nicht mehr zu solchen rechtsextremen Besuchen in Braunau kommt, denn Nazis und Rechtsextreme haben in Braunau wirklich nichts zu suchen.
Ich möchte auf diesem Weg aber auch erwähnen, dass sich die Stadt und der Bezirk Braunau ihrer Verantwortung sehr wohl bewusst sind. Wir haben mit den Braunauer
Zeitgeschichte-Tagen jedes Jahr eine internationale Veranstaltung, die kritisch aktuelle und besonders historische Ereignisse hinterfragt, aufbereitet und präsentiert. Wenn jemand von Ihnen, werte Kolleginnen und Kollegen, interessiert ist: Sie sind herzlich willkommen! Die Braunauer Zeitgeschichte-Tage sind es wirklich wert, dass Sie vorbeischauen.
Also, Herr Minister, ich bin froh darüber, dass wir nun einen sinnvollen Plan haben, was mit dem Haus geschieht. Jetzt hoffe ich nur, dass es keine drei Jahre dauert, bis mit der Umsetzung des Plans begonnen werden kann, wobei ich weiß, dass wir beide, wir alle hier in diesem Haus das nicht wirklich beeinflussen können, denn unklar ist noch, wie lange das Entschädigungsverfahren dauern wird.
Ich sage danke, auch im Namen meiner Gemeinderatsfraktion, denn die Stadt Braunau hat definitiv mehr zu bieten als dieses Geburtshaus. – Vielen Dank. (Beifall bei Grünen und SPÖ.)
16.28
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Als vorläufig Letztem zu dieser Thematik darf ich dem Herrn Bundesminister das Wort erteilen.
16.28
Bundesminister für Inneres Mag. Wolfgang Sobotka: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Werte Mitglieder des Bundesrates! Ich darf mich recht herzlich für die Diskussion und vor allem für das einheitliche Votum bedanken. Dieses Haus ist in der Tat schon lange ein ganz großer Stachel im Fleisch des Innenministeriums, weil wir mit allen Bemühungen letzten Endes gescheitert sind. So ist die Enteignung die Ultima Ratio gewesen.
Die Nachnutzung wird im Einvernehmen mit der Stadt Braunau und dem Land Oberösterreich festgelegt, wobei sich beide Partner für eine soziale Einrichtung ausgesprochen haben. Es wäre unser ausdrücklicher Wunsch, auch als Symbol, die Lebenshilfe wieder dafür zu gewinnen, dieses Haus quasi in Besitz zu nehmen. Es bleibt im Besitz des Ministeriums und wird langfristig und dauerhaft vermietet, sodass auch die Umbauarbeiten so gestaltet werden können, dass auf der einen Seite jene Nutzungen möglich sind, die die Lebenshilfe braucht, und dass es auf der anderen Seite nach außen hin kein bekennendes Bejahen mehr gibt und dieses Denkmal für alle Zeiten als solches der Öffentlichkeit entzogen wird.
Wir wissen ganz genau, dass insbesondere der Geburtsmythos in dieser Zeit etwas ist, das die Menschen immer wieder motiviert hat, solche Orte aufzusuchen. Wer jemals am Obersalzberg gewesen ist und dort die Anstrengungen sieht, trotz aller Bemühungen der öffentlichen Stellen um eine in einer sehr demokratischen Struktur empfundene Geschichtsaufklärung, die das Wiederaufflackern des Nationalsozialismus und das Bekennen dazu verhindern sollen, wer sieht, dass tageweise entsprechende Materialien weggeschafft werden, der wird verstehen, warum wir in Österreich diesen Vorschlag gemacht haben.
Ich darf mich dafür bedanken, dass beide Kammern dem in so großer Mehrheit – der Bundesrat sogar einstimmig – gefolgt sind. – Herzlichen Dank. (Allgemeiner Beifall.)
16.30
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir kommen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit angenommen.
19. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz 2015, das Meldegesetz 1991, das Namensänderungsgesetz, das Personenstandsgesetz 2013, das Sprengmittelgesetz 2010 und das Waffengesetz 1996 geändert werden (Deregulierungs- und Anpassungsgesetz 2016 – Inneres) (1345 d.B. und 1388 d.B. sowie 9714/BR d.B.)
20. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG zwischen dem Bund und dem Land Tirol über Hubschrauberdienste für den Zivil- und Katastrophenschutz im Land Tirol (1366 d.B. und 1390 d.B. sowie 9715/BR d.B.)
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Nun gelangen wir zu den Punkten 19 und 20 der Tagesordnung.
Berichterstatter zu beiden Punkten ist Herr Bundesrat Hammerl. Ich bitte um die Berichte.
Berichterstatter Gregor Hammerl: Sehr geehrter Herr Bundesminister! Zu Tagesordnungspunkt 19 bringe ich den Bericht des Ausschusses für innere Angelegenheiten über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz 2015, das Meldegesetz 1991, das Namensänderungsgesetz, das Personenstandsgesetz 2013, das Sprengmittelgesetz 2010 und das Waffengesetz 1996 geändert werden (Deregulierungs- und Anpassungsgesetz 2016 – Inneres).
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, daher komme ich gleich zur Antragstellung.
Der Ausschuss für innere Angelegenheiten stellt nach Beratung der Vorlage am 19. Dezember 2016 mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. (Vizepräsidentin Winkler übernimmt den Vorsitz.)
Zu Tagesordnungspunkt 20 bringe ich den Bericht des Ausschusses für innere Angelegenheiten über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG zwischen dem Bund und dem Land Tirol über Hubschrauberdienste für den Zivil- und Katastrophenschutz im Land Tirol.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, daher komme ich gleich zur Antragstellung.
Der Ausschuss für innere Angelegenheiten stellt nach Beratung der Vorlage am 19. Dezember 2016 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Herbert. – Bitte.
16.32
Bundesrat Werner Herbert (FPÖ, Niederösterreich): Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich habe im Ausschuss versucht zu ergründen, warum es möglich ist, dass man in einem einzigen Gesetz so viele verschiedene und völlig unzusammenhängende, nämlich nicht miteinander korrespondierende, Gesetzesmaterien verbunden hat. So richtig konnte mir der Vertreter des BMI – sosehr
ich ihn auch persönlich schätze, weil ich ihn sehr gut und auch schon sehr lange kenne – eigentlich keine Antwort darauf geben. Seine Antwort war: Na, es geht halt um die Deregulierung, also Entlastung von administrativen Dingen.
Wenn man sich das aber genauer anschaut, dann liegt, glaube ich, der Grund dafür, dass man hier all diese unterschiedlichen Gesetzesmaterien verpackt hat, wohl darin, dass man aus politisch-strategischen Überlegungen die Absicht hatte, den politischen Mitbewerber – in dem Sinn die Opposition – ein bisschen in die Pflicht zu nehmen. So hätte man neben dem durchaus positiven Aspekt, den zum Beispiel die Frage der Klärung der Eintragungsmöglichkeit für Sternenkinder mit sich bringt, was ja durchaus zu begrüßen ist, auch die positiven Ergänzungen im Zentralmeldeamt, im Personenstandsgesetz oder auch im Waffengesetz – nämlich den Ansatz, dass man Asylwerbern und Drittstaatsangehörigen den Besitz, den Erwerb und das Führen von Waffen und Munition per se verbietet –, also durchaus positive Aspekte, mitnehmen können und auch das Wohlwollen unserer Fraktion gehabt, wenn da nicht das kalkulierte Minus dabei gewesen wäre.
Daher glaube ich, dass man da wohl bewusst die Bestimmungen über die Schließung von Homo-Ehen am Standesamt hineingepackt hat, um uns als Opposition wohl ein bisschen in die Pflicht zu nehmen und den kalkulierten Widerstand in uns zu erwecken. Sie haben mit Ihrer Erwartungshaltung recht bekommen: Sie haben diesen Widerstand erweckt, und ich darf Ihnen mitteilen, dass ich Sie auch nicht enttäuschen werde. Wir werden dieser Gesetzesvorlage unsere Zustimmung nicht geben, was mich insofern doch ein bisschen wehmütig stimmt, weil es gute Ansätze gibt, denen ich schon gerne zugestimmt hätte. Einige habe ich schon erwähnt.
Ich hätte auch ganz gern dieser Waffengesetzbestimmung zugestimmt, dass man Polizisten das Führen von privaten Schusswaffen zugesteht, und zwar außerhalb des Umstandes, dass ein besonderer Bedarf vorliegen muss. Aber auch da habe ich schon im Vorfeld stets angemerkt, dass diese Beschränkungsklausel auf 9-Millimeter-Kaliber eigentlich eine recht deutliche Geringschätzung des Ministeriums – oder nicht des Ministeriums direkt, sondern der Bundesregierung – gegenüber den Polizistinnen und Polizisten in unserem Land darstellt. Jenen Polizisten, denen man zutraut, im Rahmen ihrer Dienstausübung jederzeit über Zwangsmaßnahmen, von Eingriffen in die Freiheit bis zu Personsdurchsuchungen, Hausdurchsuchungen, Sicherstellungen jeglicher Art, zu entscheiden, traut man nämlich nicht zu, dass sie privat die gleiche Umsicht an den Tag legen, und beschränkt das Vertrauen in jene fachliche Qualität, die sie tagtäglich im Umgang und im Führen ihrer Dienstwaffen mitbringen, in ihrer privaten Zeit dahin gehend, dass man sagt: Na ja, du bist jetzt vielleicht doch nicht so der gute Polizist, wie wir es vordergründig immer meinen! – Also man zeigt hier recht deutlich die Geringschätzung des Ministeriums den Polizisten gegenüber.
So ist das, so wird das aufgenommen, so wird das auch von den Kolleginnen und Kollegen draußen auf der Straße gesehen. Ich glaube nicht, dass sich diese Bundesregierung – und auch nicht Sie, Herr Bundesminister – damit einen guten Dienst erwiesen hat. So gesehen nehmen wir das so zur Kenntnis, wie es da steht, und ich darf, wie schon gesagt, mitteilen, dass wir diesem Gesetzesvorschlag, nämlich dem Deregulierungs- und Anpassungsgesetz, unsere Zustimmung verweigern werden.
Wozu wir allerdings die Zustimmung geben werden, das ist zur Artikel-15a-Vereinbarung einen Hubschrauber für das Land Tirol betreffend. Da ist es doch so, dass man den besonderen regionalen Bedürfnissen – einerseits den sicherheitspolizeilichen Einsätzen, aber andererseits auch den Problemen bei schwerwiegenden Naturkatastrophen insbesondere angesichts der dortigen regionalen Gegebenheiten – Rechnung tragen muss. Es hat sich ja auch die finanzielle Komponente, die da am Anfang ein biss-
chen die Problematik war, zwischen dem BMI und dem Land Niederösterreich positiv gelöst, und daher geben wir diesem Gesetz gerne unsere Zustimmung.
Wie gesagt, zum Anpassungs- und Deregulierungsgesetz muss ich Ihre Erwartungshaltung in negativer Weise leider bestätigen. – Danke schön. (Beifall bei der FPÖ.)
16.38
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Bevor wir in der Debatte fortfahren, darf ich recht herzlich Frau Staatssekretärin Mag. Duzdar bei uns im Bundesrat begrüßen. Herzlich willkommen! (Beifall bei SPÖ und ÖVP.)
Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Junker. – Bitte, Frau Kollegin.
16.39
Bundesrätin Anneliese Junker (ÖVP, Tirol): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Geschätzte Frau Staatssekretär! Geschätzter Herr Bundesminister! Ich darf zu vier Punkten Stellung nehmen.
Erstens einmal zum Meldegesetz: Da sehe ich als Obfrau von „Frauen helfen Frauen“, aus der Perspektive von Frauen, die sich in Opferschutzeinrichtungen und in sogenannten Notwohnungen befinden, dass es im Sinne des Opferschutzes zu begrüßen ist, dass die Auskunftssperre für Meldeadressen von jetzt zwei Jahren auf fünf Jahre angehoben wird. Bis jetzt musste das ja alle zwei Jahre verlängert werden. Da denke ich doch, dass das einen Schutz vor allem für die betroffenen Personen darstellt und daher zu begrüßen ist.
Der zweite Punkt betrifft das Personenstandsgesetz. Die neue Regelung über die sogenannten Sternenkinder – das betrifft Fehlgeburten mit einem Geburtsgewicht unter 500 Gramm – halte ich für einen sehr wichtigen und vor allem auch menschlichen Schritt. Durch die Eintragung ins Personenstandsregister ermöglicht man den Eltern, ihrem Kind einen Namen zu geben, sich von ihm zu verabschieden und es zu beerdigen, was bis jetzt nicht der Fall war.
Wenn eine Frau bisher ein Kind geboren hat mit einem Geburtsgewicht unter 500 Gramm und das dann verstorben ist, dann war das Sondermüll. Ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, wie sich eine Frau fühlt, die ein Kind zur Welt bringt und sich nicht von ihrem Kind verabschieden darf. Mit dieser Regelung wird es jedenfalls gestattet, dass das Kind einen Namen bekommt und beerdigt wird. Ich glaube, man kann den Eltern nicht ihren Schmerz nehmen, aber man kann ihnen mit diesem Schritt helfen, diesen zu bewältigen, und das finde ich einfach großartig. (Beifall bei der ÖVP sowie bei Bundesräten von SPÖ und Grünen.)
Das Dritte betrifft die Schützen in Tirol. Wir haben in Tirol 15 000 Schützen. Die sind in 235 Kompanien organisiert und haben circa 11 600 Gewehre. Die Differenz zwischen den 15 000 und 11 600 hat folgenden Grund: Die Offiziere tragen Stiefel und haben keine Gewehre, und auch die Jungschützen und Marketenderinnen haben keine Gewehre.
Das Waffenregister zu führen war für die Schützenkompanien eine brutale Herausforderung. Das wird jetzt vereinfacht. Die Schützenhauptmänner führen das Waffenregister, und damit sind auf Knopfdruck alle Informationen da. Die Registrierung als Vereinswaffen wurde jetzt neu eingeführt. Die Meldung der Änderungen halbjährlich sowie der schnelle Zugang für die Behörden, sollte etwas nicht passen, sind gute Regelungen.
Mit dem neuen Gesetz wird eine praktikable Lösung für die Schützen gefunden. Die Registrierung der Waffen bringt Rechtssicherheit für alle ehrenamtlich tätigen Funktionäre und vor allem für die Waffenmeister. Wir werden in Wien ja im nächsten Halbjahr zweimal in den Genuss einer Ehrensalve kommen: einmal, wenn der Bundespräsident angelobt wird, und das zweite Mal, wenn unsere Sonja Ledl-Rossmann die Präsident-
schaft im Bundesrat übernimmt. Da gehe ich davon aus, dass die Außerferner Schützen in Wien auftreten. (Bundesrätin Kurz: Da freuen wir uns darauf!)
Das Vierte ist die Artikel-15a-Vereinbarung, die ja schon seit 2014 mit dem Innenministerium verhandelt wird – damals noch unter Mikl-Leitner – und jetzt zum Abschluss kommt. Die Artikel-15a-Vereinbarung zwischen dem Bund und dem Land Tirol wird mit dem heutigen Beschluss im Bundesrat Realität, und so nimmt der Ankauf eines Hubschraubers für den Zivil- und Katastrophenschutz in Tirol immer konkretere Formen an. Die Waldbrände der jüngsten Vergangenheit in Absam, die Murenereignisse im Sellraintal, das Hochwasser in Kössen und die Lawinenkatastrophe in Galtür haben uns gezeigt, dass wir rasch Einsatz und Hilfe brauchen, dass aber die Hubschrauber von außerhalb wetterbedingt nicht immer schnell zum Einsatz kommen können.
Deswegen ist das Land Tirol zur Ansicht gekommen, dass versucht werden soll, einen eigenen Hubschrauber für den Katastrophen- und Zivilschutz zu bekommen, was jetzt mit der Artikel-15a-Vereinbarung mit dem Innenministerium, das heißt mit dem Bund, zu einem glücklichen Ende gekommen ist. Die Dienstpläne halten sich nämlich nicht an das Wetter, und so gibt es nunmehr folgende Lösung: Ab Anfang 2018 ist der Hubschrauber an 365 Tagen und in Extremsituationen auch 24 Stunden einsatzbereit, und durch die abgestimmten Einsatzpläne wird der Hubschrauber durch den des Verteidigungsministeriums bestens ergänzt.
Ich bitte Sie alle, diese Artikel-15a-Vereinbarung zu unterstützen und Ihre Zustimmung zu geben. – Danke. (Beifall bei der ÖVP und bei Bundesräten von SPÖ und Grünen.)
16.45
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Mag. Dr. Dziedzic. – Bitte.
16.45
Bundesrätin Mag. Dr. Ewa Dziedzic (Grüne, Wien): Sehr geehrter Herr Minister! Frau Präsidentin! Wertes Präsidium! Werte Kollegen und Kolleginnen! Der Artikel-15a-Vereinbarung zwischen dem Bund und dem Land Tirol über Hubschrauberdienste für den Zivil- und Katastrophenschutz in Tirol werden wir zustimmen. Da gibt es auch unsererseits nicht unbedingt Diskussionsbedarf.
Beim Deregulierungs- und Anpassungsgesetz wurden ja in der Regierungsvorlage unterschiedliche Themen durcheinandergewürfelt, und da sind für uns somit natürlich positive wie negative Punkte dabei. Da es hier nicht möglich ist, wie im Nationalrat eine getrennte Abstimmung zu verlangen, wird sich das einfach in unserem Abstimmungsverhalten beziehungsweise im Protokoll widerspiegeln.
Ich greife jeweils zwei Punkte auf, und das verhält sich, vielleicht wenig überraschend, diametral zu dem, was von der FPÖ vorher dazu festgehalten worden ist. Der eine Punkt betrifft das Waffengesetz. Für alle Polizisten und Polizistinnen wird das private Führen von Schusswaffen jetzt möglich gemacht. Das führt zu mehr Waffen im privaten Bereich, aber wir sind der Meinung, wir brauchen in Österreich nicht mehr, sondern weniger Waffen. Mehr Waffen bedeutet für uns nämlich nicht mehr Sicherheit, sondern weniger Sicherheit für all jene, die unfreiwillig einer Gefahr ausgesetzt werden.
Dabei geht es keinesfalls darum, dass Polizisten und Polizistinnen selbst diese Gefahr wären, auch wenn wir Einzelfälle kennen, sondern in erster Linie darum, dass, wenn Polizeibeamte und -beamtinnen diesen erleichterten Zugang im Privatbereich wahrnehmen können, andere zu Recht fragen können, wieso sie nicht – zum Beispiel Justizbeamte und -beamtinnen oder Wachbeamte und Bundesheerbedienstete. Ich denke, diese Frage werden wir hier nicht klären. Vielleicht kann ja der Minister später noch kurz darauf eingehen.
Ein zweiter Punkt, den wir sehr negativ beurteilen, ist, dass Drittstaatsangehörigen der Besitz von Schusswaffen pauschal verboten wird, bis sie einen Daueraufenthaltstitel in der EU erhalten. Das stellt eine Diskriminierung einer bestimmten Gruppe dar. Da gibt es, glaube ich, nichts zu beschönigen, weil hierbei einfach die Herkunft zum Anlass genommen wird.
Jetzt zu den positiven Punkten: Das sind die Änderungen im Namensänderungsgesetz und im Personenstandsgesetz. Die Sternenkinder wurden schon erwähnt. Auch das halten wir für eine sehr wichtige Änderung. Es geht aber natürlich auch um das Namensrecht bei eingetragenen Partnerschaften, das jetzt jenem der Ehe angeglichen wird, und auch um die bisherige Diskriminierung, dass Verpartnerungen bisher nicht am Standesamt durchgeführt werden durften.
Das heißt, ab 1. April 2017 werden eingetragene Partnerschaften genauso wie Zivilehen auf den Standesämtern geschlossen, und eingetragene gleichgeschlechtliche Paare dürfen tatsächlich einen Familiennamen haben. Bisher gab es – falls Sie das nicht so genau wissen – eine eigene Namenskategorie, die mit dem Partnerschaftsgesetz 2010 eingeführt worden ist und die diese Paare gekennzeichnet hat. Ich sage bewusst „gekennzeichnet“, weil sozusagen allein schon die Verpartnerung per se einem Outing gleichkam, da eben unterschieden worden ist.
Es gab vom Justizministerium im Zuge der Stellungnahme zu diesem Deregulierungs- und Anpassungsgesetz auch Folgendes zu lesen, ich zitiere:
„Der Entwurf möge zum Anlass genommen werden, bestehende Ungleichbehandlungen zwischen Ehe und eingetragener Partnerschaft auch in den Justizgesetzen zu beseitigen. Das Bundesministerium für Inneres darf gebeten werden, folgenden Änderungen in den Entwurf einfließen zu lassen (…)“. Dort wurden dann ganz präzise alle Änderungen, die notwendig wären, vorgeschlagen, wie zum Beispiel in Bezug auf die Möglichkeit des Verlöbnisses.
Da ist also jedenfalls noch viel Luft nach oben. Viele von Ihnen werden ja wissen, dass die eingetragene Partnerschaft seit 2010 in Österreich möglich ist. Ursprünglich waren es über 70 Ungleichbehandlungen gegenüber der Ehe, die garantieren sollten, dass es ja nicht zu Verwechslungen kommt oder dass sich eben die Paare – das war tatsächlich eine Begründung beziehungsweise ist es nach wie vor – nicht am Standesamt begegnen können. Diese Liste ist mittlerweile auf 30 geschrumpft. Ich habe das hier (ein Blatt Papier mit einer Liste in die Höhe haltend) aufgezeichnet, falls Sie sich einmal genauer anschauen wollen, was seit 2010 Schritt für Schritt meistens durch Gerichtsurteile beseitigt worden ist.
Es gibt aber auch eine zweite Liste mit 30 Ungleichbehandlungen, die wir jetzt weiter bekämpfen werden. Es wird natürlich weitere Gerichtsurteile und Klagen geben, anstatt dass wir uns durchringen, diese Ungleichbehandlungen ein für alle Mal zu beseitigen. Das sind vor allem keine gravierenden Punkte, wo man behaupten könnte, diese Unterscheidbarkeit zur Ehe wäre eine, an der man festhalten müsste. Zum Beispiel geht es bei Punkt 3 darum, dass es bei einer unrichtigen Todeserklärung keine Regelung zur Wiederverheiratung gibt oder dass es bei der Partnerschaftswohnung keine gerichtliche Übertragung des Mietverhältnisses gibt. Ich denke, das sind alles keine Dinge, die unsere Gesellschaft grundsätzlich bedrohen.
Alles in allem: Österreich gewährt gleichgeschlechtlichen Paaren genau die gleichen Familiengründungsrechte wie verschiedengeschlechtlichen Paaren, zum Beispiel Stiefkindadoption, Fremdkindadoption, medizinisch unterstützte Fortpflanzung, automatische gemeinsame Elternschaft bei eingetragenen lesbischen Paaren, Mutterschaftsanerkennung bei nicht eingetragenen lesbischen Paaren analog zur Vaterschaftsanerkennung bei unehelichen Kindern – dennoch müssen die Kinder in diesen Partnerschaften zwangs-
weise unehelich sein. Vielleicht ist das ein Argument für einige: Österreich ist tatsächlich das einzige Land weltweit mit solch einer Rechtslage. Das heißt, alle anderen Länder der Welt, die homosexuellen Paaren volle Adoptionsrechte gewähren, lassen die Eltern dieser Kinder auch heiraten.
Zum Schluss etwas Grundsätzliches: Die Eheöffnung für Lesben und Schwule wird sehr oft als etwas Revolutionäres betrachtet, obwohl es das überhaupt nicht ist. Es wäre sogar ein sehr christlicher Schritt in der Geschichte der Ehe, weil nämlich die Liebesehe die eigentlich revolutionäre Idee war. Wir wissen, dass die Liebe lange Zeit als eine Art geistige Verwirrung gegolten hat oder es im alten Griechenland als töricht galt, dass man seine eigene Frau liebt.
Im Alten Testament gibt es zum Beispiel auch eine Geschichte: Jakob heiratet Lea und später dann ihre Schwester Rachel dazu, und diese wiederum stellt Jakob ihre Magd zur Verfügung, weil sie selbst keine Kinder bekommen kann. Das klingt recht verrucht, auch im 21. Jahrhundert. In China sah man lange Zeit übermäßige Liebe zwischen den Eheleuten als bedrohlich für die Solidarität mit der Großfamilie an.
Ehe als etwas Religiöses, das wissen auch nicht viele, ist tatsächlich eine sehr, sehr späte Entwicklung in Europa. Im Mittelalter beispielsweise wurden viele Ehen einfach im Wirtshaus oder gleich im Bett geschlossen. Allein durch den Beischlaf war man so zum Beispiel verheiratet, nach dem Motto: Ist das Bett beschritten, ist das Recht erstritten. In Bauernehen war der Kuss verboten. Und ein vielleicht nicht rühmliches, aber doch aktuelleres Beispiel aus den USA: Bis in die 1960er-Jahre war es in vielen Staaten verboten, „gemischtrassige Ehen“ – unter Anführungszeichen – einzugehen. Wir alle kennen die Begründung.
Alles in allem habe ich eine Bitte an Sie: Wenn wir während der Weihnachtsfeiertage unsere Familien treffen, dann können wir diesmal vielleicht genauer hinschauen. Ich glaube, es gibt keine Familie, auch nicht bei ÖVP- und auch nicht bei FPÖ-Mandataren, in der es nicht einen schwulen Cousin oder eine lesbische Tante gibt. (Bundesrat Krusche: Was sind das für Unterstellungen?!) Bitte, reden Sie einmal mit ihnen, und vielleicht reden wir dann im neuen Jahr darüber, wie wir es schaffen, diese rechtliche Segregation, die auf Ideologie basiert, einfach abzuschaffen. Ich glaube, gerade für die Gegner und Gegnerinnen der sogenannten Homoehe kann es nicht von Interesse sein (Vizepräsidentin Winkler gibt das Glockenzeichen), dass wir uns im Nationalrat, aber auch im Bundesrat alle zwei Monate mit dem Thema beschäftigen. – Vielen Dank. (Beifall bei den Grünen sowie bei Bundesräten von ÖVP und SPÖ.)
16.55
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Weber. – Bitte, Herr Kollege.
16.55
Bundesrat Martin Weber (SPÖ, Steiermark): Liebe Frau Präsidentin! Werte Mitglieder der Bundesregierung! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit diesen zwei Tagesordnungspunkten ändern wir – zugegeben – mehrere Gesetze. An meinen Kollegen Herbert gerichtet: Ja, natürlich nehmen wir die Opposition sehr gerne in die Pflicht. Das ist ja gar nichts Negatives. Leider schafft es die Opposition dann aber nicht, über ihren Schatten zu springen, der – zugegeben – ein bisschen begrenzt ist.
Unter anderem ändern wir mit diesen zwei Tagesordnungspunkten, wir haben es schon gehört, das Personenstandsgesetz. Seit rund 15 Jahren bin ich ehrenamtlich als Standesbeamter in meiner Heimatgemeinde Tieschen tätig. Ich schätze, so ungefähr 100 standesamtliche Eheschließungen habe ich in dieser Zeit schon durchführen dürfen. Viele davon halten bis heute. Ich denke, dass ich – oder meine Kollegin – im kommenden Jahr
die erste Verpartnerung von gleichgeschlechtlichen Menschen am Standesamt durchführen werde, und ich meine, das ist auch gut so.
Dass es endlich die Möglichkeit gibt, dass gleichgeschlechtliche Paare auch am Standesamt heiraten dürfen, ist ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Gleichbehandlung. Die Öffnung des Standesamts war längst überfällig. Statt eines gemeinsamen Nachnamens wird künftig auch ein gemeinsamer Familienname möglich sein, was nicht mehr stigmatisiert.
Begrüßenswert und ebenso wichtig sind die Verschärfungen im Sprengmittelgesetz sowie teils auch im Waffengesetz. Zum Sprengmittelgesetz: Der Erwerb und Besitz von Schießmitteln ist derzeit grundsätzlich an eine behördliche Bewilligung gebunden. Schießmittel in einer Menge bis zu zehn Kilogramm sind dabei bisher von einer Bewilligungspflicht ausgenommen. Vor dem Hintergrund der Gefährlichkeit sollen in Zukunft der Erwerb und der Besitz von jeglichen Mengen an Schießmitteln an eine behördliche Bewilligung geknüpft werden.
Aufgrund der gleich hohen Gefährlichkeit von Spreng- und Schießmitteln und der Tatsache, dass Schießmittel im Vergleich zu Sprengmitteln auch leichter umsetzbar sind, sollen die bisherigen Ausnahmebestimmungen von der Bewilligungspflicht entfallen. Derzeit gelten Ausnahmen für Inhaber eines Waffenpasses, einer Waffenbesitzkarte, Inhaber einer Jagdkarte und so weiter; diese werden weiterhin Bestand haben.
Wir schaffen mit diesen Gesetzesänderungen also nicht nur raschere Abläufe, sondern auch ein Mehr an Sicherheit, auch beim Waffengesetz. Da führen wir ja zum Teil ebenfalls Verschärfungen durch. Es geht dabei zum Beispiel auch um das Schusswaffenverbot für Asylwerber im Zeitraum von bis zu fünf Jahren. Ebenso erhöhen wir in diesem Zusammenhang auch den Strafrahmen.
Ein zweiter Punkt in diesem Zusammenhang ist eine wichtige Nachjustierung bei der Polizei. Künftig gibt es einen Rechtsanspruch für Polizistinnen und Polizisten, einen Waffenpass zu bekommen. Sie haben ja die Möglichkeit, ja sogar die Pflicht, sich in den Dienst zu stellen; für alle anderen Berufsgruppen gilt das ja nicht. Deswegen ist dieses Sonderrecht für die Polizei vorgesehen. Die Begrenzung ist bis zum Kaliber von maximal 9 Millimetern gegeben.
Wir schaffen also mit diesem Deregulierungs- und Anpassungsgesetz raschere Abläufe – eine Forderung zum Beispiel auch der Hotellerie ist die einfachere Führung von Gästeblättern – und vor allem auch ein Mehr an Sicherheit für unsere Bevölkerung und für unsere Polizeikräfte.
Aus aktuellem Anlass möchte ich in diesem Zusammenhang auch all jenen Kräften herzlich danken, die an diesen Festtagen zu Weihnachten nicht bei ihren Familien sein können, sondern für die Sicherheit aller Österreicherinnen und Österreicher im Inland sowie im Ausland – etwa unsere Blauhelme – im Einsatz sind. Das gilt natürlich auch für alle anderen Berufsgruppen wie die Pflege, den Gesundheitsbereich und so weiter.
Schöne Festtage! – Danke. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.)
17.00
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Blatnik. – Bitte.
17.00
Bundesrätin Ana Blatnik (SPÖ, Kärnten): Frau Präsidentin! Gospa president! Frau Staatssekretärin! Gospa zvezna sekretarka! Herr Bundesminister! Gospod zvezni minister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Drage kolegice in kolegi! Ich möchte zu zwei Punkten Stellung beziehen. Der erste Punkt ist das, was mein Vorredner auch schon befürwor-
tet hat, was die Vorrednerin ganz genau erklärt hat, und zwar geht es darum, dass mit diesem Gesetz die Möglichkeit geschaffen wird, dass gleichgeschlechtliche Paare am Standesamt heiraten können. Das ist etwas ganz Wichtiges, etwas ganz Positives. Meiner Meinung nach müsste das im 21. Jahrhundert etwas ganz Selbstverständliches sein.
Unser Herr Bundesratspräsident hat heute über die Kammer der Zivilcourage gesprochen. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Gerade da könnte der Bundesrat viele Zeichen setzen, um mehr Gleichbehandlung, mehr Gleichberechtigung für die Gesellschaft im 21. Jahrhundert zu erreichen. (Beifall bei SPÖ, ÖVP und Grünen.)
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mehr Mut, mehr Zivilcourage! Wo ein Wille, da auch ein Weg – gehen wir es an! Wir sind für die Gleichbehandlung und wir sind für die Gleichberechtigung nicht nur in Worten, sondern auch in Taten.
Der zweite Punkt ist mir ein ganz großes Anliegen, und das ist das Thema Sternenkinder. Sternenkinder sind Kinder, die unter 500 Gramm wiegen und vor, während oder nach der Geburt sterben. Bis heute waren diese Kinder im Gesetz – entschuldigt den Ausdruck – gar nicht existent. Ab heute werden sie in das Personenstandsregister eingetragen, und sie haben eine Existenz. Du, liebe Kollegin Junker, hast es wunderschön formuliert: Diese Kinder sind kein Sondermüll, diese Kinder müssen begraben werden, damit die Eltern eine Stätte haben, wo sie trauern können. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Man kann diesen Eltern, im Speziellen diesen Müttern, sicherlich nicht das Leid nehmen, aber ihnen wenigstens ein Stück Würde zurückgeben.
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich bei allen Parteien bedanken, denn es hat einen Entschließungsantrag im Nationalrat gegeben, der einstimmig angenommen worden ist. Ich möchte mich beim Nationalratsabgeordneten Hermann Lipitsch, der dieses Thema ins Rollen gebracht hat, bedanken und ich möchte mich auch bei einer Frau bedanken, nämlich bei Anita Ogris, die Trauerbegleiterin für solche Eltern ist, die Leid und Trauer mit ihnen teilt. Sie ist im Vorstand der SPÖ-Frauen Kärnten. Liebe Anita, deine Beharrlichkeit, deine Konsequenz, dein Mut wurden heute belohnt – dafür recht herzlichen Dank!
(Die Rednerin setzt ihre Ausführungen in slowenischer Sprache fort.)
Danke. Hvala lepa. (Beifall bei SPÖ, ÖVP und Grünen.)
17.04
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Ich darf den Herrn Bundesminister um seinen Redebeitrag ersuchen.
17.04
Bundesminister für Inneres Mag. Wolfgang Sobotka: Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren des Bundesrates! Liebe Gäste! Ich möchte nichts Inhaltliches mehr beitragen; ich bedanke mich für die Debatte, nicht nur für die heutige, sondern auch für die in allen anderen Bundesratssitzungen, für die Aufnahme, für das faire Umgehen miteinander, für die aus unterschiedlichen Gesichtspunkten eingebrachten Beiträge, die für uns auch in Zukunft wesentlich sein werden, wenn wir weiter die Gesetze gestalten, verändern und diesen dynamischen Prozess auch beibehalten. – Herzlichen Dank.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. So Sie christlichen Glaubens sind, wünsche ich Ihnen, dass Sie das als Hoffnung, als Perspektive ansehen und auch Mut schöpfen, um den Herausforderungen des neuen Jahres aus diesem Glauben heraus zu begegnen, und so Sie es als Familienfest sehen, viel Freude mit Ihren Kindern, mit Ihren Eltern, mit Ihren Partnern, mit Ihren Freunden, sodass Sie sich auch ein wenig aus dieser Alltäglichkeit herausnehmen können, wieder Kraft für die nächsten Wochen und Monate daraus gewinnen. – Alles Gute. (Allgemeiner Beifall.)
17.05
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Sehr geehrter Herr Bundesminister! Ich darf Ihnen im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen und auch in meinem Namen schöne Weihnachten und ein paar ruhige Stunden wünschen.
Mir liegen zu diesem Tagesordnungspunkt keine weiteren Wortmeldungen vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Die Abstimmung erfolgt getrennt.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Deregulierungs- und Anpassungsgesetz 2016 – Inneres.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit, der Antrag ist somit angenommen.
Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend Vereinbarung gemäß Artikel 15a Bundes-Verfassungsgesetz zwischen dem Bund und dem Land Tirol über Hubschrauberdienste für den Zivil- und Katastrophenschutz im Land Tirol.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit, der Antrag ist angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Landesvertragslehrpersonengesetz 1966, das Bundes-Personalvertretungsgesetz, das Rechtspraktikantengesetz und das Auslandszulagen- und ‑hilfeleistungsgesetz geändert sowie ein Bundesgesetz zur Änderung der Personalstellenverordnung und ein Bundesgesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/54/EU über Maßnahmen zur Erleichterung der Ausübung der Rechte, die Arbeitnehmern im Rahmen der Freizügigkeit zustehen (UmsetzungsG-RL 2014/54/EU), erlassen werden (2. Dienstrechts-Novelle 2016) (1348 d.B. und 1368 d.B. sowie 9673/BR d.B. und 9722/BR d.B.)
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Wir gelangen nun zum 21. Tagesordnungspunkt.
Berichterstatter ist Herr Bundesrat Dr. Köll. Ich bitte um die Berichterstattung.
Berichterstatter Dr. Andreas Köll: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Frau Staatssekretärin! Geschätzte Damen und Herren! Ich erstatte den Bericht des Ausschusses für Verfassung und Föderalismus zu Tagesordnungspunkt 21 über den Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Landesvertragslehrpersonengesetz 1966, das Bundes-Personalvertretungsgesetz, das Rechtspraktikantengesetz und das Auslandszulagen- und -hilfeleistungsgesetz geändert sowie ein Bundesgesetz zur Änderung der Personalstellenverordnung und ein Bundesgesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/54/EU über Maßnahmen zur Erleichterung der Ausübung der Rechte, die Arbeitnehmern im Rahmen der Freizügigkeit zustehen (UmsetzungsG-RL 2014/54/EU), erlassen werden (2. Dienstrechts-Novelle 2016), sowie den Bericht zu Tagesordnungspunkt 22 über den
Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz, das Bundesverwaltungsgerichtsgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953 geändert werden (1255 d.B. und 1369 d.B. sowie 9723/BR d.B.)Die Berichte liegen Ihnen in schriftlicher Form vor, weshalb auf eine Verlesung verzichtet werden darf. Ich komme daher sogleich zur Antragstellung.
Zu TOP 21:
Der Ausschuss für Verfassung und Föderalismus stellt nach Beratung der Vorlage am 19. Dezember 2016 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Ich danke für die Berichterstattung.
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Grimling. – Bitte, Frau Kollegin.
17.09
Bundesrätin Elisabeth Grimling (SPÖ, Wien): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau Staatssekretärin! Werte Kolleginnen und Kollegen des Bundesrates! Der Überbegriff Bundesdienstrecht umfasst alle Regelungen zur Sicherung der Funktionsfähigkeit des Bundesdienstes. Es bildet daher den rechtlichen Rahmen für die Tätigkeit beim Bund.
Den Besonderheiten der öffentlichen Verwaltung Rechnung tragend kommt eine ganze Reihe von Gesetzen zur Anwendung. Notwendige Anpassungen und Ergänzungen müssen daher oftmals durch die Novellierung einschlägiger Einzelgesetze getroffen werden. So wurde heuer bereits einmal ein derartiges Gesetzeswerk mit Abänderungen von 17 Bundesgesetzen unter der Bezeichnung Dienstrechts-Novelle 2016 verabschiedet.
Dass nach so kurzer Zeit eine neuerliche Ergänzung durch den vorliegenden Entwurf einer 2. Dienstrechts-Novelle 2016 erforderlich ist, ergibt sich aus der zwingenden Berücksichtigung der über das nationale Recht hinausgehenden Judikatur des Europäischen Gerichtshofes beziehungsweise der Umsetzung von verbindlichen EU-Richtlinien. Die Novellierung wird daher auch zum Anlass genommen, eine Reihe von Klarstellungen und Anpassungen vorzunehmen.
Die ursprüngliche Regierungsvorlage zur 2. Dienstrechts-Novelle 2016 enthält im Wesentlichen die Anpassung der Bestimmungen über die Urlaubsersatzleistung von Beamtinnen und Beamten an die Judikatur des EuGH, die Schaffung einer eindeutigen Rechtsgrundlage für die Einholung von Strafregisterauskünften sowohl bei Rechtspraktikantinnen und Rechtspraktikanten als auch im Zuge der Aufnahme in den richterlichen Vorbereitungsdienst und die Behebung einer durch das Auslaufen des Unterrichtspraktikumsgesetzes für bestimmte Lehramts-Studierende entstandenen Rechtslücke sowie die Einreihungsmöglichkeit in die Entlohnungsgruppe l 2a 2 – für den Bachelor – beziehungsweise Entlohnungsgruppe l 1 – für den Master – für bestimmte Vertragslehrpersonen und die Ausweitung der Möglichkeit einer audiovisuellen Vernehmung aller Zeuginnen und Zeugen im Disziplinarverfahren.
Gegenüber dieser ursprünglichen Regierungsvorlage wurden im Nationalrat mittels Abänderungsantrag schließlich noch die aufgrund des zwischen der Regierung und der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst vereinbarten Gehaltsabschlusses neu erstellten Gehaltstabellen in diese Novelle eingefügt. Die Gehälter der Beamten und Beamtinnen sowie der Vertragsbediensteten werden im kommenden Jahr um 1,3 Prozent steigen. Zu diesem Gehaltsabschluss für den öffentlichen Dienst treten auch noch begleitende gesetzliche Bestimmungen zur Zusammenführung zweier Verwendungsgruppen beim
Militär. Hinzugefügt wurden schließlich Regelungen über eine erweiterte Verfahrenshilfe vor dem Bundesverwaltungsgericht und den Landesverwaltungsgerichten.
Die Endfassung ist daher leider sehr umfangreich geworden und damit sowohl für die mit der Vollziehung Beschäftigten als auch für die rechtsuchenden Betroffenen schwer lesbar. Eine Wiederverlautbarung oder eventuelle Neufassung einzelner durch diese Novelle geänderten Gesetze wäre daher mehr als wünschenswert.
Im Hinblick auf die inhaltliche Bedeutung und ihre sinnvollen Auswirkungen wird meine Fraktion der 2. Dienstrechts-Novelle 2016 zustimmen. – Danke. (Beifall bei der SPÖ und bei Bundesräten der ÖVP.)
17.14
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Oberlehner. – Bitte, Herr Bundesrat.
17.14
Bundesrat Peter Oberlehner (ÖVP, Oberösterreich): Sehr geehrte Frau Präsident! Hohes Präsidium! Liebe Frau Staatssekretärin! Liebe Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat! Meine Vorrednerin, Kollegin Grimling, hat schon sehr ausführlich über die Dienstrechts-Novelle gesprochen. Wie eben schon die 1. Dienstrechts-Novelle im Jahr 2016 ist nun auch die hier jetzt vorliegende 2. Dienstrechts-Novelle ein, wie ich meine, gutes und gelungenes Paket von einer ganzen Reihe von Einzelmaßnahmen für den öffentlichen Dienst in Österreich.
Der Kern und das meiner Meinung nach Wichtigste in dieser Novelle ist aber der Gehaltsabschluss für 2017, der darin auch verpackt ist und der für den öffentlichen Dienst eine Erhöhung von 1,3 Prozent im kommenden Jahr bringen wird. Ich darf dazu später noch ein bisschen etwas sagen.
Bei den Einzelmaßnahmen möchte ich vor allem die Modernisierung des Disziplinarrechts hervorheben. Eine räumlich getrennte audiovisuelle Vernehmung wird demnach in Zukunft für alle Zeuginnen und Zeugen möglich sein und nicht mehr nur für die minderjährigen Zeugen. Das halte ich doch für eine sehr wesentliche und wichtige Verbesserung.
Eine wichtige Änderung betrifft aber auch die Richter und Staatsanwälte, wo nun im Rechtspraktikantengesetz für die Zulassung als Bedingung aufgenommen wurde, dass weder eine Verurteilung zu einer drei Monate übersteigenden Freiheitsstrafe noch ein wegen eines Verbrechens eingeleitetes Strafverfahren vorliegen dürfen. Bisher fehlte eine derartige Regelung im Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz. Ich denke, dass das auch im Sinne der Integrität dieses Berufsstandes eine sehr wichtige Ergänzung ist, die auch eine wesentliche Veränderung darstellt.
Einige weitere wichtige Änderungen sind grundsätzlich Umsetzungen von EuGH-Judikaturen und EU-Richtlinien. Das betrifft zum Beispiel auch die Urlaubsersatzleistung von Beamtinnen und Beamten. Anspruch auf Urlaubsersatzleistung gibt es demnach hinkünftig vor allem auch dann, wenn die Beamtin oder der Beamte im Einzelfall wegen einer Dienstverhinderung durch Krankheit, durch Unfall, durch ein sonstiges Gebrechen nicht in der Lage war, den Urlaub als Erholungsurlaub zu verbringen. Wichtig ist auch, dass klargestellt wurde, dass Urlaubsverbrauch grundsätzlich immer Vorrang hat vor finanziellen Abgeltungen, weil eben die Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst genauso wie überall in den Betrieben den Urlaub auch brauchen, weil es ja Erholungsurlaub heißt und er letztlich auch zur Erholung dienen soll.
Noch ein paar Worte zum schon angesprochenen Gehaltsabschluss für das Jahr 2017 für den öffentlichen Dienst: Als Bürgermeister und Gemeindebündler, also als Dienstgeber beziehungsweise auch als GÖD-Funktionär und damit als Dienstnehmervertre-
ter, finde ich, dass dieser Abschluss ein wirklich sehr, sehr gelungener und sehr, sehr guter ist. Ich gratuliere allen, die dort am Verhandlungstisch gesessen sind, egal auf welcher Seite, und denke, es war auch eine gewisse Nagel- und Feuerprobe, denn sowohl Frau Staatssekretärin Duzdar als auch der neue GÖD-Vorsitzende Norbert Schnedl waren ja das erste Mal in dieser Rolle tätig, und daher war es natürlich für beide Seiten eine besondere Herausforderung. Ich glaube, es ist wirklich lobenswert und anerkennenswert, dass der Abschluss in dieser Form gelungen ist. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
Es war für mich vor allem auch sehr schön, wie getragen von gegenseitiger Wertschätzung und ohne irgendwelche unnötige Begleitmusik mit irgendwelchen Drohgebärden oder was immer da manchmal dazugehört, auf sehr sachlicher Ebene diskutiert und in gegenseitiger Wertschätzung auch Ergebnisse erzielt wurden, die, glaube ich, für beide Seiten sehr gute sind, die sehr gut mitgetragen werden können. 1,3 Prozent sind auf der Dienstgeberseite leistbar und vertretbar, sind aber auch für die Dienstnehmerseite ein gutes Ergebnis. Ich glaube, dass den öffentlich Bediensteten das ihnen Zustehende vom Wirtschaftswachstum und von der Entwicklung generell zukommt und dass hier also für beide Seiten ein guter Abschluss gelungen ist.
Was mich als Vorsitzenden der GÖD-Landesverwaltung noch besonders freut, ist, dass alle Länder oder fast alle Länder den Abschluss fast 1 : 1 übernommen haben und dass damit in allen Ländern, in allen Gemeinden und beim Bund eine gemeinsame Entwicklung garantiert wird, was auch eine sehr wichtige Botschaft für den öffentlichen Dienst in Österreich ist.
Ich bedanke mich also bei allen Beteiligten für dieses, wie ich meine, wirklich gute Ergebnis und möchte diese Gelegenheit nutzen, mich am Ende des Jahres und eben auch dazupassend zum Gehaltsabschluss auch bei allen öffentlich Bediensteten in Österreich – vor allem aber auch bei den Kolleginnen und Kollegen hier im Parlament, aber insgesamt bei allen öffentlich Bediensteten – herzlich für die wieder einmal hervorragende Arbeit zu bedanken. Eine geordnete und gut funktionierende Verwaltung auf allen Ebenen – in den Gemeinden, Ländern und im Bund – ist letztlich ein Garant für ein gutes Funktionieren unseres gesamten Staatsgefüges, und die Verwaltung ist immer ein Stabilitätsfaktor im System und in der Republik. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ich bedanke mich für diese hervorragende Arbeit, die hier geleistet wird, und wünsche auch für das Jahr 2017 alles Gute, verbunden mit der Bitte, wiederum so gute Arbeit im Sinne der Republik Österreich zu leisten.
Dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates wird meine Fraktion natürlich die Zustimmung erteilen.
Wie das heute alle schon gemacht haben, darf auch ich am Ende meiner Rede allen frohe Weihnachten wünschen und mich für die gute und ausgezeichnete Zusammenarbeit im ganzen Jahr bedanken und ebenso alles Gute für ein erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2017 wünschen. – Danke schön. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
17.19
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Herbert. – Bitte.
17.20
Bundesrat Werner Herbert (FPÖ, Niederösterreich): Frau Staatssekretärin! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Von einem guten und gelungenen Paket würde ich da nicht unbedingt sprechen. Es ist kein schlechtes Paket, das möchte ich nicht sagen – aber ein gutes und gelungenes Paket? – Also die Gehaltsabschlüsse sind in Ordnung, sage ich einmal, und das ist auch überwiegend der Grund dafür, dass wir zustimmen werden.
Es gibt ein paar inhaltlich akzeptable Adaptierungen im positiven Sinne, was ich aber schon im Ausschuss zu ergründen versucht habe, mir aufgrund des fehlenden zuständigen, informierten Vertreters aus dem Bundeskanzleramt jedoch leider nicht gelungen ist, ist: Warum schreibt man die Bestimmungen des § 42o und § 42p – also Otto und Paula – zur Fortführung der Dienststellenausschüsse einerseits beim aufgelösten Bezirk Wien-Umgebung, andererseits beim Bezirkspolizeikommando Eferding fort, obwohl es eine eindeutige, klare Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes gibt, dass das gesetzwidrig ist?
Es hat mich einigermaßen irritiert, dass man das trotz erwiesener Rechtswidrigkeit in das Gesetz aufnimmt, zumal das auch bereits im Begutachtungsverfahren angemerkt wurde. Trotzdem hat man diese Bestimmung 1 : 1 übernommen. Also im Begutachtungsverfahren war ja nur Wien-Umgebung angeführt, erst im Erweiterungsantrag sind das Bezirkspolizeikommando Eferding beziehungsweise die weiterführenden Dienststellenausschüsse dazugekommen.
Zum besseren Verständnis: Es gab im Jahr 2004 bei der Zusammenlegung von Polizei und Gendarmerie in Wien die große Polizeireform, bei der es eine genau gleiche Bestimmung gab – also die Zusammenlegung war 2002 –, und diese wurde vor dem Verfassungsgerichtshof angefochten. Mit Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes, Geschäftszahl G 365/02 vom 23. Juni 2003, wurde die Rechtswidrigkeit anerkannt, und trotzdem findet sich das wieder. Das lässt sich leider nicht ganz erklären.
Wie dem auch sei, wir werden das einmal mehr vor dem Höchstgericht klären, und dann – davon bin ich überzeugt – werden wir einmal mehr mit unserer Rechtseinschätzung recht bekommen; so wie bei den anderen Dienstrechts-Novellen bei den Vorrückungsstichtagen, bei den Besoldungsdienstrechtsänderungen, wo wir auch recht bekommen haben.
Zur Ergänzung, liebe Kolleginnen und Kollegen (ein Schriftstück in die Höhe haltend): Das ist das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes zur Aufhebung des Feststellungsbescheides über die Nichtanerkennung meiner Vordienstzeiten. Das habe ich dieser Tage bekommen. So schaut es aus! Obwohl ich hier von diesem Pult aus darauf hingewiesen habe, wurden die Bestimmungen trotz der Bedenken des EuGH, trotz der Bedenken des Verfassungsgerichtshofs in dieser Vorrückungsstichtagsfrage abermals fortgeschrieben. Eine schon anerkannte Unrechtsbestimmung wurde mit einer neuen rechtswidrigen Auslegung der alten Unrechtsbestimmung im Gesetz festgeschrieben.
Ich verstehe irgendwie nicht ganz, warum das Bundeskanzleramt zum wiederholten Mal so vorgeht. Ich lasse mir schon einreden, dass die Legisten einmal etwas übersehen, aber schön langsam glaube ich, dass das eigentlich ein Vorgehen in bewusster Art und Weise ist, um dem öffentlichen Dienst einfach die Gleichgültigkeit oder vielleicht auch – wie ich es zuerst schon gesagt habe – die Geringschätzung zu zeigen.
Ich kann mir beim besten Willen nicht erklären, warum man das als Gesetzgeber, als zuständiges Ministerium macht, ich verstehe das einfach nicht. Obwohl man wiederholt die eigene legistische Unfähigkeit vom Höchstgericht um die Ohren gefetzt bekommen hat, macht man das immer wieder und ignoriert selbst wohlmeinende Hinweise im Begutachtungsverfahren. Trotz allem – wie in diesem Fall mit der Weiterführung der Dienststellenausschüsse trotz fehlender Geschäfts- und Rechtsgrundlage der aufgelösten Behörden – macht man das.
Wir werden das einmal mehr klären, jetzt aber nicht zuletzt, wie ich schon gesagt habe, wegen der Gehaltsabschlüsse und einiger weiterer inhaltlich guter Ergänzungen zustimmen. Die Frage der Weiterführung der Dienststellenausschüsse werden wir einmal mehr vor dem Verfassungsgerichtshof klären, und ich werde Ihnen dann hier an dieser Stelle wieder berichten und Ihnen einmal mehr den Aufhebungsbescheid vorführen.
In diesem Sinne sage ich und auch namens meiner Fraktion Danke an alle Bediensteten im öffentlichen Dienst, Danke für die gute, umfassende, aufwendige Arbeit, die sie, nämlich die Beamtinnen und Beamten, die Vertragsbediensteten, männlich und weiblich, für die Republik und die Bevölkerung geleistet haben. In Zeiten fehlender sachlicher Ressourcen, fehlender finanzieller Mittel und ebenso fehlender Personalressourcen ist das keine leichte Aufgabe, aber ich hätte fast gesagt: Man hat mit der Zeit gelernt, auch bei mäßig vorhandener Struktur das Beste herauszuholen.
In diesem Sinne noch einmal herzlichen Dank an den öffentlichen Dienst, an alle Kolleginnen und Kollegen und Ihnen, geschätzte Damen und Herren des Bundesrates, frohe Festtage, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. – Danke schön. (Beifall bei der FPÖ und bei Bundesräten der ÖVP.)
17.26
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Bevor wir die Debatte fortsetzen, darf ich ganz herzlich in unserer Mitte Bundesminister Mag. Drozda begrüßen. – Herzlich willkommen! (Allgemeiner Beifall.)
Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Dr. Reiter. – Bitte, Frau Kollegin.
17.27
Bundesrätin Dr. Heidelinde Reiter (Grüne, Salzburg): Frau Präsidentin! Hohes Präsidium! Werte Minister! Werte Kollegen und Kolleginnen! Ganz kurz: Wir werden dieser Novelle zustimmen; insbesondere – das ist eigentlich noch nicht erwähnt worden – schätzen wir die Ausweitung des Zeugenschutzes für Disziplinarverfahren wegen sexueller Belästigung. Wir würden uns auch weitergehende Regelungen zur Unterstützung der Opfer wünschen, die allerdings noch offen sind.
Da ich zum nächsten Tagesordnungspunkt nicht sprechen werde – dem werden wir auch zustimmen –, möchte ich jetzt diese Gelegenheit nutzen, allen ein frohes und schönes Weihnachtsfest, Gesundheit und viel Freude und Motivation für die Arbeit für das nächste Jahr zu wünschen. Ich möchte mich bei Ihnen allen für Ihre Kollegialität und für die Form der Zusammenarbeit ganz herzlich bedanken. (Beifall bei den Grünen und bei Bundesräten von ÖVP und SPÖ.)
17.28
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Staatssekretärin Mag. Duzdar. – Bitte.
17.28
Staatssekretärin im Bundeskanzleramt Mag. Muna Duzdar: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Mitglieder des Bundesrates! Es ist von den BundesrätInnen schon viel gesagt worden über die vorliegende 2. Dienstrechts-Novelle 2016, die wir sozialpartnerschaftlich verhandelt haben.
Zum einen geht es darin um technische Anpassungen an unionsrechtliche Richtlinien, zum anderen geht es natürlich auch um die Gehaltsanpassung der Zigtausenden Bundesbediensteten. Da ist es uns gelungen, gemeinsam mit der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst einen Gehaltsabschluss zu erzielen, der sich, glaube ich, sehr gut sehen lassen kann.
Es ist eine Gehaltserhöhung von 1,3 Prozent, und ich denke, das ist ein gutes Ergebnis gewesen, vor allem vor dem Hintergrund, dass diese 1,3 Prozent um 0,55 Prozent höher liegen als die Inflationsrate, die im Zeitraum Oktober 2015 bis September 2016 0,75 Prozent ausgemacht hat. Diese Gehaltserhöhung kostet den Bund 168 Millionen €, und diese 1,3 Prozent liegen auch in der Bandbreite der Ergebnisse der Kollektivvertragsverhandlungen für 2017.
Wenn wir das runterbrechen, bedeutet das real, dass beispielsweise eine junge Polizistin nach der Ausbildung im Jahr 2017 380 € mehr und beispielsweise ein Pflichtschullehrer mit Berufserfahrung 650 € im Jahr 2017 mehr verdienen werden.
Das ist ein fairer und gerechter Abschluss sowohl für die Bundesbediensteten, nämlich einerseits für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des öffentlichen Dienstes, andererseits auch für die Bürger und Bürgerinnen. Ich glaube, der Spagat zwischen den budgetären Vorgaben, die wir natürlich haben, und der Anerkennung, nämlich für die Leistung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im öffentlichen Dienst, ist uns sehr gut gelungen. Mit diesem Abschluss stärken wir natürlich die Kaufkraft der circa 204 000 unmittelbar betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und auch deren Engagement und Leistung werden, wie gesagt, anerkannt.
Ich möchte noch einige Aspekte der Dienstrechts-Novelle herausgreifen. Es ist schon gesagt worden, dass wir beispielsweise den Opferschutz im Disziplinarverfahren im öffentlichen Dienst ausgebaut und ausgeweitet haben. Wir hatten ja bereits bei der Dienstrechts-Novelle im Juni 2016 einen ersten richtigen Schritt gesetzt. Damals haben wir das Gesetz dahin gehend novelliert, dass Zeugen und Zeuginnen im Disziplinarverfahren Vertrauenspersonen beiziehen konnten. Jetzt ist es erstmals so, dass, wenn Personen, beispielsweise Frauen, im öffentlichen Dienst sexueller Belästigung ausgesetzt sind, sie in den Disziplinarverfahren nicht ihren Peinigern gegenübertreten müssen, sondern eine audiovisuelle Vernehmung in Anspruch nehmen können. Das ist ein guter und wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Das ist auch eine sehr gute Anregung, die auch vonseiten der Grünen damals im Juni kam, gewesen, und die haben wir aufgenommen und schlagen jetzt auch als Gesetz dem Bundesrat vor. (Beifall bei der SPÖ und bei Bundesräten der ÖVP.)
Dann gibt es noch zwei Maßnahmen, die ich nennen möchte, die eine Anpassung ans Unionsrecht vorsehen. Zum einen geht es dabei um die Urlaubsersatzleistung von Beamten, die den öffentlichen Dienst verlassen. Es wurde erstmals klargestellt, dass Urlaubszeiten ausbezahlt werden, wenn sie nachweisen können, dass sie sie unverschuldet nicht verbrauchen konnten.
Zum anderen gibt es eine Anpassung an eine Richtlinie, die die Arbeitnehmerfreizügigkeit betrifft. Es ist in der Vergangenheit oftmals beklagt worden, dass die Arbeitnehmerfreizügigkeit im öffentlichen Dienst sehr eingeschränkt gehandhabt wird. Aus diesem Grund haben wir jetzt eine Freizügigkeitskoordinierung geschaffen und verankern explizit ein Benachteiligungsverbot für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger.
Werte Mitglieder des Bundesrates! Im Nationalrat wurde diese Dienstrechts-Novelle in zweiter Lesung einstimmig beschlossen. Das ist ein gutes Zeichen für die Ausgewogenheit dieses Paketes. Ich ersuche auch Sie um Zustimmung, damit die Gehaltserhöhung für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im öffentlichen Dienst mit 1. Jänner 2017 wirksam werden kann.
Ich möchte diese Gelegenheit aber auch nutzen, Ihnen allen frohe Weihnachten, erholsame Feiertage zu wünschen. Nehmen Sie sich Zeit! Ich denke, wir alle brauchen ein paar Tage Auszeit, um gestärkt und motiviert ins neue Jahr zurückzukehren. – Vielen herzlichen Dank. (Allgemeiner Beifall.)
17.33
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Auch dir, liebe Frau Staatssekretärin, wünsche ich in unser aller Namen ein paar ruhige Stunden und viel Kraft und Erfolg für 2017.
Weitere Wortmeldungen würden nicht vorliegen.
Wünscht noch jemand das Wort? – Es ist dies nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir kommen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz, das Bundesverwaltungsgerichtsgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953 geändert werden (1255 d.B. und 1369 d.B. sowie 9723/BR d.B.)
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Wir gelangen nun zu Punkt 22 der Tagesordnung.
Berichterstatter ist wieder Herr Bundesrat Dr. Köll. Bitte um den Bericht. – Er ist nicht im Saal. Dann darf ich den Vorsitzenden des Ausschusses für Verfassung und Föderalismus, Herrn Bundesrat Dr. Brunner, um die Berichterstattung ersuchen. – Er ist auch nicht da.
Der Herr Fraktionsvorsitzende wird diese Aufgabe übernehmen. – Bitte. (Allgemeine Heiterkeit und Beifall.)
Berichterstatter Edgar Mayer: Ich danke für den Beifall im Vorhinein.
Ich bringe den Bericht des Ausschusses für Verfassung und Föderalismus über den Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz, das Bundesverwaltungsgerichtsgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953 – im Übrigen ein guter Jahrgang – geändert werden.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor; ich komme daher gleich zur Antragstellung.
Der Ausschuss für Verfassung und Föderalismus stellt nach Beratung der Vorlage am 19. Dezember 2016 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. (Allgemeiner Beifall.)
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Beer. – Bitte.
17.36
Bundesrat Wolfgang Beer (SPÖ, Wien): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Kurz zur Verfahrenshilfe: Bis jetzt beziehungsweise bis 31. Dezember 2016 wird Verfahrenshilfe nur in Verwaltungsstrafverfahren gewährt. Der Verfassungsgerichtshof hat diese Bestimmung beziehungsweise § 40 des Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetzes aufgehoben. Aufgrund der Menschenrechtskonvention und eines Erkenntnisses des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte wurde entschieden, dass sowohl für Zivilverfahren als auch für Strafverfahren sowie im Verwaltungsverfahren ein Verfahrenshelfer beigestellt werden muss.
Nun wird dieses Gesetz geändert und auch im Verwaltungsverfahren ein Verfahrenshelfer beigestellt. Diese Verfahrenshilfe muss beantragt werden. Die Verfahrenspartei muss außerstande sein, die Verfahrenskosten zu tragen, respektive muss also kein aussichtsloser Fall vorliegen oder es sich um ein Verfahren handeln, welches aus Justament angestrebt wird.
Dies ist ein Gesetz für Menschen ohne großartigen finanziellen Hintergrund, die so die Möglichkeit haben, zu ihrem Recht zu kommen. Sehr geehrte Damen und Herren, für
mich bedeutet dieses Gesetz eine Weiterentwicklung unseres Rechtssystems! (Beifall bei der SPÖ sowie bei Bundesräten von ÖVP und Grünen.)
17.38
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächster ist Herr Bundesrat Oberlehner zu Wort gemeldet. – Er verzichtet auf den Redebeitrag.
Dann darf ich gleich den Herrn Bundesminister um seinen Redebeitrag ersuchen. – Bitte, Herr Bundesminister.
17.39
Bundesminister für Kunst und Kultur, Verfassung und Medien Mag. Thomas Drozda: Ich kann das sehr kurz machen, weil ich mich den Ausführungen meines Vorredners uneingeschränkt anschließen kann. Es ist eine maßgebliche Weiterentwicklung des Rechtsstaates, nicht nur im Verfahren von Strafsachen, sondern auch bei zivilrechtlichen Verfahren diese Form der Unterstützung und der Rechtshilfe zu bieten. Insofern bin ich sehr stolz auf diesen Entwurf. Wir haben ihn in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe gründlich akkordiert.
Nebenbei gibt es noch weitere Inhalte, die vielleicht noch interessant wären und Ihre geschätzte Aufmerksamkeit verdienten; ich referiere sie dennoch: Weitere Inhalte sind der Entfall der mündlichen Verhandlung, wenn das Verwaltungsgericht durch Rechtspfleger entscheidet, die Möglichkeit der Vernehmung über Videokonferenz, gekürzte Erkenntnisausfertigungen, wenn das Erkenntnis mündlich verkündet wurde, und Aufnahme von Regelungen betreffend die Sicherheit in Amtsgebäuden. Ich glaube, wir haben da ein gutes Paket vorgelegt und vorgetragen, und ich hoffe, dass dieses zustimmungsfähig ist.
Ansonsten nütze ich die Gelegenheit, mich nach meinen ersten sieben Monaten im Amt für die gute Zusammenarbeit zu bedanken. Ich habe das Gefühl, im Bundesrat interessante Debatten verfolgt zu haben, und habe mich mit dem einen oder anderen von Ihnen auch abseits der Sitzungen ausgetauscht. Ich habe diesen Austausch sehr genossen und möchte mir das auch für das nächste Jahr vornehmen.
Abschließend bleibt mir wirklich nur noch, Ihnen allen schöne Feiertage, etwas Ruhe und einen guten Start ins neue Jahr zu wünschen. Da ich, wie wahrscheinlich alle von uns, unter dem Eindruck der Ereignisse in Berlin stehe, wollte ich auch noch einmal zum Ausdruck bringen, dass es abseits allen politischen Dissenses Ereignisse wie die in Berlin sind, die einem noch einmal klarmachen, was im Leben wirklich wichtig ist.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir die nächsten Tage reflektieren können, was das eigentlich ist, worauf es tatsächlich ankommt, um dann mit den Ergebnissen der Reflexion an die Arbeit des nächsten Jahres zu gehen. – Vielen Dank. (Allgemeiner Beifall.)
17.42
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Sehr geehrter Herr Bundesminister, ich darf die Glückwünsche im Namen aller Bundesrätinnen und Bundesräte erwidern – auch Ihnen schöne und vielleicht ein paar ruhige Stunden zu Weihnachten! Alles Gute für 2017!
Mir liegen zu diesem Tagesordnungspunkt keine weiteren Wortmeldungen vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir kommen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist angenommen.
23. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz über den weiteren Ausbau ganztägiger Schulformen (Bildungsinvestitionsgesetz) (1360 d.B. und 1408 d.B. sowie 9720/BR d.B.)
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Wir gelangen nun zu Punkt 23 der Tagesordnung.
Berichterstatterin ist Frau Bundesrätin Mag. Gruber-Pruner. Bitte um den Bericht.
Berichterstatterin Mag. Daniela Gruber-Pruner: Hohes Haus! Herr Minister! Frau Ministerin! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich bringe den Bericht des Ausschusses für Unterricht, Kunst und Kultur über den Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz über den weiteren Ausbau ganztägiger Schulformen (Bildungsinvestitionsgesetz).
Der Bericht liegt in schriftlicher Form vor; ich komme daher gleich zu Antragstellung.
Der Ausschuss für Unterricht, Kunst und Kultur stellt nach Beratung der Vorlage am 19. Dezember 2016 mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Sehr geehrte Frau Bundesministerin Dr. Hammerschmid, herzlich willkommen in unserer Mitte! (Allgemeiner Beifall.)
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Ecker. – Bitte.
17.44
Bundesrätin Rosa Ecker (FPÖ, Oberösterreich): Sehr geehrtes Präsidium! Sehr geehrte Frau Minister! Geschätzte Damen und Herren! Alle drei Jahre gibt es Ergebnisse des PISA-Tests, und wir hören, dass die Absolventen der Pflichtschulen nur durchschnittliche Leistungen erzielen und, ganz schlimm, die Leseleistung unter dem OECD-Schnitt liegt.
Heute steht das Bildungsinvestitionsgesetz auf der Tagesordnung. Wenn ich das übersetze und es ganz minimalistisch auf den Punkt bringen darf, dann heißt das, Investition in Bildung, es heißt, die Kinder können dann mehr als jetzt. Dafür sind in den nächsten Jahren 750 Millionen € eingeplant, aber für 2017 – im nächsten Jahr besteht, wenn wir die Ergebnisse des PISA-Tests hernehmen, dringender Handlungsbedarf – sind nur 20 Millionen € eingeplant. (Bundesrat Stögmüller: Weil die FPÖ in Oberösterreich eingespart hat!) Abgesehen davon, dass die Mittel nicht reichen werden, sind sie auch noch in erster Linie für die verschränkte Form der Ganztagsschule vorgesehen. Was werden die Kinder dazu sagen? Wie schaut denn das aus mit einem verschränkten Stundenplan, am Nachmittag Freizeitaktivitäten? (Rufe und Gegenrufe zwischen Bundesräten von FPÖ und Grünen.)
Unsere Schulen sind infrastrukturmäßig darauf nicht vorbereitet und dafür nicht gerüstet. Es gibt in den einzelnen Schulen keine Rückzugsgebiete. Manche Kinder haben jetzt mit Investitionen aus der Artikel-15a-Vereinbarung ein grünes Klassenzimmer bekommen. In einer Schule gibt es vielleicht hundert Kinder, es gibt einen Stundenplan, und wir alle wissen, dass Kinder, auch im Volksschulalter, einen Nachmittag brauchen, um sich zu erholen, um sich auszutoben. Ein Stundenplan, der dafür eine Stunde vorsieht – zwar vielleicht zwei- oder dreimal am Tag –, reicht bei Weitem nicht aus. Warum lassen wir die Kinder nicht zumindest am Nachmittag Kinder sein? Wir pressen die 6- bis 10-Jährigen in einen Belastungsmarathon und wundern uns dann, wenn sie manches nicht mehr schaffen und zum Teil auch nicht mehr wollen.
Ich habe auch im Ausschuss davon berichtet: Mit der Freiwilligkeit ist das so eine Sache. Wir haben auch bei uns eine Schule, eine Schwerpunkthauptschule für Musik, die
mit der Begründung auf Ganztagsschule umgestellt wurde, dass dort die Hausübungen erledigt werden, dass man keine Nachhilfe mehr braucht und dass besonders gefördert wird. Tatsächlich ist es aber eine Ganztagsschule an einem Tag pro Klasse, dafür wurde der quasi freiwillig mögliche Unterricht in Informatik und Maschineschreiben pro Klasse an einen Tag verschoben.
Das heißt, jede Klasse hat an einem Nachmittag dieses Drei-Säulen-Modell: Freizeitstunde, sprich Mittagspause, Lernstunde in der Schule und zwei Stunden Informatik. Die zweite, dritte und vierte Klasse hat das an einem Tag, und die erste Klasse hat statt Informatik Maschineschreiben. Jetzt frage ich mich, was das für eine qualitätsvolle Nachmittagsbetreuung in einer Ganztagsschule ist. Die Kinder haben kein zusätzliches Angebot. Wenn ich als Elternteil auf Nachmittagsbetreuung angewiesen bin – und das ist ja ein Umstand, den viele berufstätige Eltern haben –, möchte ich qualitätsvolle Nachmittagsbetreuung, bekomme aber an anderen Tagen kein Angebot, weil es keines gibt.
Das ist das, was ich mit „freiwillig“ meine. Wenn ich meinem Kind ermöglichen möchte, Informatikwissen zu erwerben, heißt das, ich muss es in die Ganztagsschule schicken. Wenn ich es nicht mache, kann es an diesem Unterricht nicht teilnehmen. – Das ist meiner Meinung nach nicht mehr freiwillig.
Frau Minister – Sie kommen ja aus einer meiner Nachbargemeinden –, ich habe einmal gelesen, Sie haben festgestellt, am Mittagessen wird es nicht scheitern. Wir mussten diese Gruppenförderungen, die es gegeben hat, in eine Schulküche investieren, da sich aus der Wirtelandschaft kein Anbieter mehr gefunden hat, der das übernommen hätte. Wir als Schulerhalter einer Ganztagsschule sind dazu verpflichtet, Mittagessen zur Verfügung zu stellen und anzubieten.
Jetzt muss man schon sagen: Natürlich, die Kosten für die Errichtung wurden im Zuge der GTS-Förderung durch eine Artikel-15a-Vereinbarung übernommen, aber als Gemeinde – wir haben heute auch vom Finanzausgleich gesprochen – sind wir für diese öffentlichen Einrichtungen auch in Zukunft zuständig, sprich für Sanierung, sprich für Personalkosten. Wir bekommen vom Land den wohlmeinenden Ratschlag, abgangsdeckend zu kalkulieren – das wird jede Gemeinde so kennen –, haben jetzt den Preis für das Mittagessen der Schulkinder um 50 Cent erhöhen müssen und sind bei Weitem noch nicht abgangsdeckend, aber die Personalkosten auch den Eltern zuzumuten, das ist etwas, das man in einer Wohnsitzgemeinde nicht machen kann. Das heißt, die Kosten bleiben an der Gemeinde hängen. (Bundesrat Lindinger: Schulküche? – Bundesrätin Kurz: Das hat nichts mit dem Thema zu tun!)
Wir haben uns auch bemüht, im Zusammenhang mit den qualitätsverbessernden Maßnahmen Möglichkeiten zu schaffen, diese müssen aber auch im Vorhinein von den Gemeinden übernommen werden und werden nach einem Jahr abgerechnet. Es gibt jetzt unterschiedliche Öffnungszeiten: Es ist nicht möglich, im Vorhinein zu eruieren, welche Kosten bis zu welcher Höhe tatsächlich übernommen werden, wenn man nur bis 16 Uhr offen hat und vielleicht am Freitag nicht. Das ist für Gemeinden, die umstellen, nicht zumutbar, weil Abgangsgemeinden abgangsdeckend kalkulieren sollen. Das heißt, darüber, wie viel wir dort investieren und auch gerne investieren würden, weil es für die Qualität der Nachmittagsbetreuung gut ist, ist schwierig zu entscheiden, wenn wir nicht wissen, was wir tatsächlich zurückbekommen, und das auch eben erst wieder ein Jahr später.
Frau Minister, ich habe es schon gesagt, Sie kommen aus einer meiner Nachbargemeinden. (Bundesministerin Hammerschmid: Wo sind Sie her?) – Aus Saxen. Wir haben quasi dasselbe Schulsystem durchlaufen, damals gab es noch A- und B-Zug, es war keine Rede von Ganztagsschule, keine Rede von Nachmittagsbetreuung, und es gab sehr, sehr wenig Nachhilfeunterricht in dieser Zeit. Die meisten Herrschaften hier haben genau so ihr Schulwissen erworben.
Die neuen Methoden sind sicher auch anerkannt, aber ganz so schlecht dürfte manches Element aus diesen damaligen Unterrichtszeiten nicht gewesen sein, da wir all die Grundlagen – sprich das ABC, sinnerfassend zu lesen und zu schreiben, einige Teile aus dem Sachunterricht, die man braucht, damit man in die Hauptschule kommt, Umformungen und Flächenberechnungen – in der Volksschule gelernt haben. (Bundesrätin Mühlwerth: Das kleine Einmaleins! – Zwischenruf des Bundesrates Stögmüller.) Das ist das Minimum, das man in der Volksschule lernen soll.
Wir haben im Ausschuss gehört, dass es heute offensichtlich schwieriger ist, dieses Wissen zu erwerben, weil die Stundenpläne, die Schulpläne, die Lehrpläne quasi permanent irgendwie evaluiert werden. Das lasse ich mir vielleicht in einer höheren Schule noch einreden, aber in der Volksschule eigentlich nicht, denn das Grundwissen, das man in der Volksschule über vier Jahre erwerben sollte, ist noch immer dasselbe wie vor 20 Jahren. Das sind diese Grundbausteine, auf die man aufbaut, wenn man später in eine weiterführende Schule geht. Das ist für mich jetzt nicht die Erklärung. (Beifall bei der FPÖ.)
Eine andere Erklärung findet man vielleicht, wenn man nachliest: Das Max-Planck-Institut hat sich vor einigen Jahren sehr intensiv mit der Thematik beschäftigt. Der Schlüssel liegt in der Förderung der Kinder vor dem Schuleintritt. Also: Ganztagsschule in verschränkter Form ist nicht die ganze Lösung, sondern das Ansetzen in der frühkindlichen Förderung, in der emotionalen Bindung zwischen Kind und Mutter. Für die Etablierung der Gehirnsynapsen sind einfach der Körperkontakt und ein niedriger Stresshormonspiegel ganz wichtig.
Ich traue mich das hier auch zu sagen – das lassen allein diese Fakten erahnen –, dass eine außerhäusliche Betreuung und Erziehung das nicht abdecken können. Da sprechen wir davon, dass sehr viele Kinder im Alter zwischen einem und drei Jahren seit vielen Jahren in der Krabbelstube und im Vorkindergarten sind, obwohl genau in diesem Alter diese Dinge sehr wichtig sind und eben außerhäuslich nicht vermittelt werden können.
Im Nationalrat wurde der Abänderungsantrag der FPÖ, für alle Schultypen Geld zur Verfügung zu stellen – egal, in welcher Form der Nachmittagsbetreuung, nicht nur ganz besonders für die verschränkte Form der GTS –, leider abgelehnt. Ich appelliere an die Menschen in der Politik, sich an den Bedürfnissen unserer Kinder zu orientieren, und ich wiederhole hier zum Schluss das Statement von Walter Rosenkranz, das er im Nationalrat abgegeben hat:
„Deshalb Ja zu einer qualitätsvollen Betreuung außerhalb der Unterrichtszeit für jene, die sich freiwillig dafür entscheiden, aber Nein zur zwangsverpflichtenden täglichen Anwesenheit von 8 bis 16 Uhr ab dem ersten Schuljahr.“ (Beifall bei der FPÖ.)
17.53
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Grimling. – Bitte.
17.53
Bundesrätin Elisabeth Grimling (SPÖ, Wien): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau Bundesministerin! Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen des Bundesrates! Frau Kollegin Ecker, ich werde jetzt doch auf das Bildungsinvestitionsgesetz eingehen. Vielleicht sind Sie, wenn ich es erklärt habe, eher dafür. (Bundesrätin Mühlwerth: Das kann ich mir nicht vorstellen! – Bundesrätin Ecker: Nein!) Mir ist schon klar, dass Bildung bei Kleinkindern beginnen soll, das wissen wir eigentlich alle, das ist nichts Neues. (Beifall bei der SPÖ.)
Mit dem im Juni dieses Jahres beschlossenen Schulrechtsänderungsgesetz 2016 wurden die ersten großen Umsetzungsschritte zur Reform des österreichischen Bildungs-
wesens gesetzt. Mit dem vorliegenden Bildungsinvestitionsgesetz wird bis 2025 ein flächendeckendes Angebot an ganztägigen Schulformen geschaffen. Alle Schüler und Schülerinnen, gerade auch jene aus sozial schwächeren Familien, erhalten damit ein optimales Lernumfeld, werden individuell unterstützt und gefördert und können so ihre Leistungen steigern.
Der Bund nimmt für die Investitionen insgesamt 750 Millionen € in die Hand, über ein Drittel davon können die Bundesländer für ganztägige Schulformen im Pflichtschulbereich verfügen. Damit wird eine Entlastung der Erziehungsberechtigten durch soziale Staffelung der Betreuungsbeiträge ermöglicht. Es können aber auch Betreuungsangebote in den schulfreien Zeiten geschaffen werden. Der Ausbau ganztägiger Schulformen wird durch die Einrichtung zusätzlicher Klassen beziehungsweise Gruppen abgesichert.
In Österreich arbeitet rund die Hälfte der Frauen Teilzeit. Laut Statistik Austria geben 49 Prozent von ihnen dafür als Grund Betreuungspflichten oder andere familiäre Gründe an. Der Bedarf an ganztägiger schulischer Betreuung übersteigt das bestehende Angebot deutlich. Ein qualitätsvoller, bedarfsorientierter Ausbau ist dringend erforderlich, aber mit entsprechenden Aufwendungen für die Schulerhalter verbunden.
Vorgesehen sind folgende Maßnahmen im Rahmen der allgemeinbildenden Pflichtschulen, Praxisschulen und allgemeinbildenden höheren Schulen: Der Bund übernimmt die Kosten für die Besoldung der Lehrerinnen und Lehrer in den Lernzeiten und garantiert damit eine fachlich-kompetente Betreuung der Kinder. So können Aufwendungen der Eltern, die sonst in die Nachhilfe fließen, reduziert werden. Darüber hinaus werden Infrastrukturmaßnahmen und Personalkosten im Freizeitbereich gefördert. In den ganztägigen Schulformen kommen auch Pädagogen und Pädagoginnen zum Einsatz, die für den Freizeitbereich ausgezeichnet ausgebildet sind.
Der Personenkreis für Zweckzuschüsse beziehungsweise Förderungen zu den Personalkosten im Freizeitbereich sowie für außerschulische Betreuungsangebote, die an ganztägigen Schulformen in den Ferienzeiten gewährt werden, umfasst: Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, Erzieherinnen und Erzieher für die Lernhilfe, Freizeitpädagoginnen und -pädagogen oder Personen mit anderen Qualifikationen, die für die Erfüllung der Aufgaben im Rahmen der Freizeitbetreuung befähigt sind.
Durch den Ausbau der ganztägigen Schulformen wird ein flächendeckendes Angebot beider Formen der Ganztagsschule, der getrennten sowie der verschränkten Form, in einem Umkreis von maximal 20 Kilometern vom Wohnort ermöglicht. Zusätzlich werden somit rund 88 000 Kinder einen besseren Zugang zu Bildung und Betreuung haben. Ganztägige Schulformen stellen eine der wichtigsten Maßnahmen innerhalb eines chancengerechten, qualitativ hochwertigen Bildungssystems dar. Sie garantieren die professionelle Begleitung unserer Kinder.
Das Bildungsinvestitionsgesetz ermöglicht eine Steigerung der Betreuungsquote an ganztägig geführten Schulen von derzeit 22 auf 40 Prozent im Jahr 2025 und ist damit eine Zukunftsinvestition für unser Land. Meine Fraktion wird dem vorliegenden Bundesgesetz ihre Zustimmung geben. – Danke. (Beifall bei der SPÖ.)
17.59
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Saller. – Bitte.
17.59
Bundesrat Josef Saller (ÖVP, Salzburg): Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau Bundesministerin! Sehr geehrte KollegInnen! Bildung ist wichtiger denn je, das zieht sich von der Grundschule bis zum Universitätsabschluss durch das Leben.
Wir leben in einer Zeit, in der man dem Bildungsangebot natürlich ein besonderes Augenmerk schenken muss. Bildungsangebote müssen Vielfalt bedeuten, das heißt: viele Angebote, um sich zu entscheiden, Wahlmöglichkeit – nicht irgendwo zwingend hinein, sondern man muss bestimmte Möglichkeiten, um zu wählen, haben – und auch Vereinbarkeit von Beruf und Familie. (Präsident Lindner übernimmt den Vorsitz.)
Wir leben in einer Zeit, in der Eheleute, Lebensgemeinschaften oder -partner vielfach arbeiten müssen. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Es stellt sich daher die Frage: Kann ich es mir leisten, dass nur einer arbeiten geht, während der Ehepartner beziehungsweise Partner zu Hause bleibt? – Ich habe einen Sohn und seine Lebensgefährtin und meinen sechsjährigen Enkel in Wien, und da müssen auch beide arbeiten gehen. Das ist ganz einfach so. Daher muss man da auch bestimmte Wege finden.
Wichtig ist ein qualitätsvoller – und ich betone bewusst qualitätsvoller – Ausbau ganztägiger Schulformen. Es gibt große regionale Unterschiede zwischen dem städtischen und dem ländlichen Bereich. Ich bin in Hüttschlag oder jemand anderer in Flachau – und das ist halt eine andere Situation als in der Stadt Salzburg und in der Stadt Wien. Das ist völlig logisch, da gibt es große Unterschiede. Entscheidend ist, glaube ich, eben aus diesem Grund der Bedarf vor Ort. Daher ist es wichtig, dass die Entscheidung über bestimmte Bildungsangebote vor Ort getroffen wird, dort, wo man sie braucht. Was gebraucht wird, wird angeboten.
Augenmerk möchte ich auch auf die pädagogisch hochwertige Ferienbetreuung richten. Berufstätige Eltern brauchen eine qualitativ hochwertige Ferienbetreuung, denn in den neun Wochen Sommerferien muss ja irgendetwas mit den Kindern geschehen. Daher braucht man eine Ferienbetreuung, das ist auch ein wichtiger Fokus. Es ist somit wichtig, dass die entsprechenden finanziellen Mittel in diesem Bereich zur Verfügung gestellt werden. – Das geschieht.
Es geht also um eine wichtige Entlastung der Erziehungsberechtigten in den Ferien, und dazu kommt die notwendige Betreuung ab 7 Uhr in der Früh. Es ist ja nicht so, dass die Betreuung ab 8 Uhr, 9 Uhr gebraucht wird, sondern die Eltern brauchen sie schon früher, bevor ihr Arbeitstag beginnt; das muss man richtig sehen.
Bei außerschulischen Bildungsangeboten ist es auch wichtig, glaube ich, mit den örtlichen oder städtischen – das ist egal – Vereinen, Musikschulen – da gibt es eine ganze Fülle von Möglichkeiten – gut zusammenzuarbeiten, denn die schaffen in vielen Bereichen zusätzliche Angebote. Das sollte man auch nicht vergessen.
Insgesamt stehen an die 750 Millionen € für den Ausbau der ganztägigen Schulformen zur Verfügung. Da muss man auch wissen, dass ein Drittel in den Ländern vergeben wird. Das heißt, es entscheidet jeweils das Bundesland, was wo notwendig ist und wo die Mittel innerhalb des Landes eingesetzt werden – und das ist auch wichtig.
Gleichfalls wichtig und keine Selbstverständlichkeit ist, dass die Auszahlungsmodalitäten geändert worden sind. Normalerweise ist es beim Budget so, dass Geld, das bis Dezember nicht verbraucht wird, verfällt oder umgeschichtet wird. Nun gibt es die Möglichkeit des Übertrags nicht verwendeter Mittel in das kommende Jahr beziehungsweise in die kommenden Jahre. Das ist eine wichtige Sache, denn damit bleibt das Geld, wo immer es verwendet wird, stehen.
Ich glaube also, alles in allem – wenn man das alles zusammen sieht – ist das ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Bildungsangebote. Man kann die Maßnahmen nur begrüßen. – Danke, Frau Ministerin. (Beifall und Bravorufe bei der ÖVP.)
18.05
Präsident Mario Lindner: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Stögmüller. – Bitte, Herr Bundesrat.
18.05
Bundesrat David Stögmüller (Grüne, Oberösterreich): Sehr geehrtes Präsidium! Sehr geehrte Frau Bildungsministerin! Sehr geehrte Damen und Herren! „Ich bin grantig …“ – das war ein Zitat von Ihnen, Frau Ministerin, aus den „Oberösterreichischen Nachrichten“ zur Präsentation der PISA-Ergebnisse, und ja, ich verstehe Sie. Grantig zu sein allein reicht aber nicht aus. Was wir brauchen, ist ein Bildungssystem, das nicht vererbt wird, das bereits in der Frühförderung im Kindergarten greift und das auch flächendeckend ausgebaut wird.
Der erste Schritt heute: die ganztägige Schule für 10- bis 14-Jährige. – Es ist leider nur ein kleiner Hopser. Man hätte da wirklich Geld in die Hand nehmen und konsequent eine gemeinsame Schule umsetzen müssen. Das, was wir heute beschließen, ist leider wieder nur ein Flickwerk, keine dauerhafte Lösung, und leider befristet auf ein paar Jahre. Etwas mehr hätten wir uns – wir Grüne, unsere Fraktion – schon erwartet in diese Richtung, nämlich wirklich auch Geld in die Hand zu nehmen.
Es tut mir leid, Frau Ministerin, dass ich jetzt etwas kritisch bin, aber im Gesamten bin ich natürlich froh, dass heute auch auf Bundesebene etwas weitergeht. Ich selbst komme genauso wie Sie aus Oberösterreich, und wenn dann Frau Kollegin Ecker hier am Rednerpult steht und über das Budget schimpft, dann ist das für mich schon ein bisschen schizophren, denn wenn wir nach Oberösterreich schauen, wo Herr Haimbuchner sitzt, und gerade 1 Million € … (Bundesrätin Mühlwerth: Das ist ein Krankheitsbild! Nimm das zurück, das ist ein Krankheitssyndrom: schizophren!) – Ich habe nicht gesagt, dass sie an Schizophrenie leidet. Wenn ich nach Oberösterreich schaue, wenn ich auf Kollegen Haimbuchner schaue, wo gerade 1 Million € im Bildungsbereich eingespart wird, dann braucht man darüber nicht mehr zu diskutieren.
Als positiv in diesem Gesetz sehe ich auch, dass sich die Privatschulen mit Öffentlichkeitsrecht die Förderung abholen können. Was wir in der Fördersystematik dennoch etwas kompliziert finden, ist der Wechsel der Gruppenförderung auf die Pro-Kopf-Förderung.
Auch die weitere Verteilung der Kompetenzen ist etwas, das ich etwas verflechtet finde. Der Bund fördert die Infrastruktur. Das wäre eigentlich die Aufgabe des Schulerhalters. Dafür finanziert der Schulerhalter jetzt das pädagogische Personal mit. Das wurde bisher vom Bund finanziert. Sinnvoll wäre eine klare Trennung, dann könnte der Schulerhalter die Infrastruktur für die Ganztagsschule auch kombiniert nutzen. Sinnvoll wäre es zum Beispiel, dass Kindergarten und Ganztagsschule in einem Gebäude sind. Dafür hätte der Bund mehr Fördermittel für die Finanzierung von Personalkosten zur Verfügung.
Alles in allem halten wir Grünen im Bundesrat, Frau Ministerin, das Ganze aber für einen guten Anfang, und wir werden heute auch sehr gerne zustimmen. – Vielen, vielen Dank. (Beifall bei den Grünen und bei Bundesräten der ÖVP.)
18.08
*****
Präsident Mario Lindner: Zur Geschäftsbehandlung zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Mühlwerth. – Bitte, Frau Bundesrätin.
18.08
Bundesrätin Monika Mühlwerth (FPÖ, Wien) (zur Geschäftsbehandlung): Wir haben uns gestern schon über Ihre Vorsitzführung unterhalten, und ich sehe, Sie sind nicht lernfähig, Herr Präsident! „Schizophren“, das ist ein Krankheitsbild. Kollege Jenewein hat einen Ordnungsruf bekommen, weil er auf einen Zwischenruf antwortend zu jemandem gesagt hat: Erzählen Sie doch bitte nicht so einen Holler! – Das ist total harmlos. Das
ist ein Wiener oder auch ein niederösterreichischer Ausdruck, aber „schizophren“, das ist ein Krankheitsbild. (Bundesrat Stögmüller: Ich habe es nicht als Krankheitsbild verwendet!)
Kollege Stögmüller hat nicht den Anstand zu sagen: Okay, es tut mir leid, ich nehme es zurück, obwohl gerade die Grünen immer so Sensibelchen sind, wenn es um irgendwelche Ausdrucksweisen geht; da ist es gleich immer schlimm genug.
Da Kollege Stögmüller jetzt also nicht die Größe hat, zu sagen: Entschuldigung!, verlange ich einen Ordnungsruf für den Ausdruck im Zusammenhang mit meiner Kollegin Ecker, dass das „schizophren“ sei. (Beifall bei der FPÖ. – Bundesrat Stögmüller: Das habe ich nicht so verstanden!)
18.09
Präsident Mario Lindner: Frau Kollegin Mühlwerth, ich habe sofort reagiert. Ich habe schon das Stenographische Protokoll anfordern lassen, und ich habe mir auch die Liste von Beispielen für Ordnungsrufe geholt. Nach § 70 der Geschäftsordnung kann der Präsident oder der vorsitzführende Präsident auch noch am Ende der Sitzung nachträglich einen Ordnungsruf erteilen. Ich werde den Sachverhalt prüfen.
Zur Geschäftsbehandlung: Herr Bundesrat Stögmüller. – Bitte.
18.10
Bundesrat David Stögmüller (Grüne, Oberösterreich) (zur Geschäftsbehandlung): Werte Kollegin Mühlwerth, ich habe das nicht auf Frau Ecker bezogen, sondern gesagt: die FPÖ – unter anderem, weil auch die Frau Ecker das gesagt hat. Schizophren heißt auch absurd oder widerspenstige Argumentation. Bitte suchen Sie das auf Wikipedia, das ist Allgemeinbildung! Es gibt Schizophrenie … (Zwischenrufe bei der FPÖ.) – Dann googeln Sie das bitte in anderen Foren. Schizophrenie ist die Krankheit, und schizophren ist ein Wort und eine Definition, wenn etwas widersprüchlich ist. – Bitte, Allgemeinbildung! Ich weiß … (Rufe und Gegenrufe zwischen Bundesräten der FPÖ und Bundesrätin Schreyer.)
18.10
Präsident Mario Lindner: Herr Kollege Stögmüller, das ist nicht mehr zur Geschäftsbehandlung.
Meine Damen und Herren – wie angesprochen –, ich habe das Vorläufige Stenographische Protokoll angefordert und werde den Vorfall prüfen.
*****
Zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Blatnik. – Bitte, Frau Bundesrätin.
18.10
Bundesrätin Ana Blatnik (SPÖ, Kärnten): Herr Präsident! Gospod president! Frau Bundesministerin! Gospa zvezna ministrica! (Unruhe im Sitzungssaal.)
Präsident Mario Lindner: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Frau Bundesrätin Ana Blatnik ist am Wort. – Bitte, Frau Bundesrätin.
Bundesrätin Ana Blatnik (fortsetzend): Danke vielmals! Noch einmal: Herr Präsident! Gospod president! Frau Bundesministerin! Gospa zvezna ministrica! Liebe Kollegen und Kolleginnen! Drage kolegice in kolegi! Ich werde nichts wiederholen, was meine Vorredner, Elisabeth Grimling und Herr Saller, gesagt haben, wie viel Geld investiert wird, wie das organisatorisch aufgebaut wird. Ich möchte aus der Sicht einer begeisterten Lehrerin diese positiven Seiten einer Veränderung unterstreichen, die selbstverständlich – was, glaube ich, auch ganz normal und äußerst legitim ist – Unsicherheiten
und auch Fragen mit sich bringen, die ausdiskutiert und evaluiert werden müssen, und das wird auch bei dieser Ganztagsschule selbstverständlich geschehen.
Ja, auch ich bin für das Grundwissen, ich bin (in Richtung FPÖ) voll deiner Meinung. Es ist nur die Frage: Wie lange brauche ich für dieses Grundwissen? – Einige, die Talente haben, werden kürzer brauchen, die anderen werden ein bisschen länger brauchen, und deswegen ist dieses ganztägige Schulsystem so wichtig, weil man den Schülern und Schülerinnen einfach mehr Zeit in der Schule gibt, die absolut keine Zwangsschule ist, das muss ich euch ehrlich und wahr sagen. (Beifall bei der SPÖ sowie des Bundesrates Stögmüller.)
Der zweite Punkt: Das, was vor 20 oder 30 Jahren gut war, ist jetzt nicht schlecht, aber es ist nicht mehr aktuell, weil ich ganz einfach glaube, dass sich die Gesellschaft geändert hat. Die Gesellschaft stellt andere Anforderungen an unser Schulsystem, wie auch die Wirtschaft ganz einfach andere Anforderungen an unser Schulsystem stellt, und darauf müssen wir Antworten geben. Wie oft bin ich schon hier am Rednerpult gestanden und habe gesagt: Vereinbarkeit von Familie und Beruf!
Elisabeth Grimling hat darauf hingewiesen: Bildung fängt bei den Kinderbetreuungseinrichtungen an, auch da fordern und haben wir ganztägige Kinderbetreuungseinrichtungen. Ein ganztägiges Schulsystem ist nichts Negatives. (Beifall bei der SPÖ.)
Grantig – ich war auch grantig, weil ich das einfach nicht habe erklären können, aber nehmen, nützen und sehen wir diese ganztägige Schulform als Chance, als Konsequenz auf das Ergebnis der PISA-Studie – das wäre doch einmal ein Anfang –, und dann werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Vielleicht sind wir in zwei, drei Jahren so weit, dass wir sagen: Super war es, das ist es!
Der nächste Punkt, der für mich als Lehrerin so wichtig ist: Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir vor zehn Jahren in meiner Schule vom Frontalunterricht zum offenen Unterricht umgestiegen sind und der Lehrer und die Lehrerin nicht mehr diejenigen waren, die frontal unterrichtet haben, sondern ganz einfach zu den Schülerinnen und Schülern gesagt haben: Liebe Schüler und Schülerinnen, die besten Schüler, die liebsten Schüler der ganzen Welt, macht doch selber, tut euch im Team zusammen und versucht, die Themen selbständig zu erarbeiten!
Ich muss euch sagen, die Leistung war und ist famos. Ich bin so stolz auf diese Leistungen meiner Schüler und Schülerinnen und muss euch sagen: Ich lerne so viel von ihnen, wir sind gegenseitig eine Bereicherung, und darauf kommt es mir an. (Beifall bei der SPÖ.)
Es geht nicht um Zwang – überhaupt nicht. Also ich sehe das nicht als Zwang, ich sehe das als Spaß, als Freude, als Teamfähigkeitsentwicklung – was ja normalerweise ein sozialer Aspekt ist, etwas, worauf wir stolz sein müssen und das wir auch fördern müssen –: gemeinsam Hausaufgaben zu machen, gemeinsam zu Mittag zu essen, gemeinsam zu spielen, gemeinsame Freizeitgestaltung zu planen. Das kann ja bitte nichts Negatives sein. (Bundesrätin Mühlwerth: Es kann aber auch nichts Negatives sein, bei der Familie zu sein!) – Absolut nicht, überhaupt nicht! Das sage ich ja nicht! Die Ganztagsschule nimmt dir ja nichts weg. Sie hat für mich einen Mehrwert. Du hast eine andere Meinung, und ich habe eine andere Meinung, und sie nimmt auf keinen Fall den Eltern das Recht auf Erziehungsarbeit. – Ich sehe das nicht!
Ich sehe diese Ganztagsschule ganz einfach: Sie bedeutet, den Schülern mehr Zeit zu geben, den Lehrern mehr Zeit zu geben, um Talente zu erkennen, sie zu fördern, sie zu unterstützen, den Schwächeren – und das ist ja auch diese Chancengleichheit – die Chance zu geben, praktisch den ganzen Tag denselben Input zu bekommen, ohne viel Geld für Nachhilfe ausgeben zu müssen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Für mich ist die ganztägige Schulform sicherlich etwas Positives. Ich sehe ganz mutig in eine positive Zukunft. Für mich ist das Schulsystem für die Zukunft nur ganztägig. Als Lehrerin, die 36 Jahre unterrichtet und sehr bestrebt ist, die Schülerin und den Schüler in den Mittelpunkt zu stellen, möchte ich euch alle ermutigen, diesem Gesetz zuzustimmen.
Ich möchte mit einer Presseaussendung unserer Bundesrätin Renate Anderl schließen, die Folgendes gesagt hat:
„Mit dem Ausbau der Ganztagsschulen ist die Bildungspolitik auf dem richtigen Weg. (…) Ganztagsschulen sind ein wichtiger Beitrag zur Chancengerechtigkeit, aber auch ein wesentlicher Schritt zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ganztägige Schulformen fördern Kinder bestmöglich, deren Eltern sich keine Nachhilfe leisten können. Durch die ganztägige Betreuung werden aber vor allem auch viele Frauen“ – und Väter – „entlastet, die einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen wollen.“
In diesem Sinne appelliere ich noch einmal und bitte euch um eure Zustimmung, denn es geht um unsere Kinder, um unsere Schüler und Schülerinnen und vor allem um eine Schule für die Zukunft.
(Die Rednerin setzt ihre Ausführungen in slowenischer Sprache fort.)
Und jetzt noch einen Satz (zunächst in slowenischer Sprache, dann auf Deutsch): Ich wünsche euch frohe Weihnachten und viel Gesundheit im neuen Jahr. (Beifall bei der SPÖ.)
18.18
Präsident Mario Lindner: Zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Stöckl-Wolkerstorfer. – Bitte, Frau Bundesrätin.
18.18
Bundesrätin Angela Stöckl-Wolkerstorfer (ÖVP, Niederösterreich): Hohes Präsidium! Frau Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Wenngleich wir heute lediglich das Bildungsinvestitionsgesetz, also eine Förderung zum weiteren Ausbau ganztägiger Schulformen, beschließen, das mehr Qualität bringen soll, so geht es doch um Schule. Es geht um Bildung, es geht um Reform, ja, es geht um Zukunft. Es ist bereits vieles von meinen Vorrednern gesagt worden, durchaus wichtige, kritische und richtige Anmerkungen, aber ich möchte meinerseits als niederösterreichische Bundesrätin doch zu diesem Gesetz Stellung nehmen.
Auch ich sehe die Förderung ausschließlich der verschränkten Form schulischer Ganztagsbetreuung, auf die es letztendlich hinausgeht, wegen der nicht vorhandenen Wahlfreiheit problematisch. Wir sollten nicht zwangsverpflichten und Familien, die daheim ihren Aufgaben wunderbar nachkommen, benachteiligen.
Ja, wahrscheinlich werden auch unsere Kommunen stärker in die Tasche greifen müssen, um Ferienbetreuungen und die Betreuung von Schülerinnen und Schülern in der Schule vor Unterrichtsbeginn zu gewährleisten. Das ist wenig wünschenswert, und ich denke, da muss ehebaldigst evaluiert werden. Da sind wir, da ist die Regierung gefordert. Es bedarf da mehr schulischer Autonomie und kreativer Ansätze.
Noch wichtiger ist mir aber, dass die vielen, die Nachmittagsbetreuung, die weitere Förderung, schulische Förderung, manchmal auch Anforderungen brauchen, in unserem Bildungssystem nicht zu kurz kommen dürfen.
Im Bildungsbereich müssen endlich Gräben zugeschüttet werden, die über Jahrzehnte durch ideologische Betrachtungsweisen aufgerissen wurden. Wir müssen bildungspolitische Brücken bauen. Gräben können in unserem System schon sehr zeitig aufgerissen werden. Sie trennen Menschen, sie trennen Kinder sehr früh und sind dann aus sozialen Gründen kaum mehr überwindbar.
Außerdem behindern ideologische Gräben massiv die Bildungsdiskussionen. Die Gräben entstehen auch zwischen Land und Stadt. Junge Menschen mit guter Ausbildung brauchen entsprechende Rahmenbedingungen und dürfen nicht aus strukturschwachen Regionen fliehen. Da sind eben auch unsere Kommunen gefragt.
Gefährliche Gräben klaffen mittlerweile auch zwischen der scheinbaren Realität sozialer Netzwerke und der Wirklichkeit vor Ort. Wir alle sind nicht davor gefeit, uns von komplexen Programmen, die im Hintergrund arbeiten, Meinungen einsuggerieren zu lassen, wobei gesunder Menschenverstand, der Hausverstand eher gegenteiliger Ansicht wäre.
Heute beschließen wir, unser Bildungssystem zumindest in einem Bereich finanziell zu unterstützen, in dem Eltern Sorge um das Wohl ihrer Kinder haben. Viele wollen sie ganztägig betreut, gefordert und gefördert wissen, und dies ist für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durchaus wichtig und soll auch helfen, Gräben im sozialen Bereich zu überwinden.
Wir beschließen heute ebenso, dass schulische Betreuungsformen dann gefördert werden, wenn Projekte diese rechtfertigen. Dies ist für mich ein wichtiger Qualitätsansatz. Abgesehen von der Momentaufnahme eines partiell abgefragten Wissens durch eine PISA-Studie muss Bildung doch wachsen dürfen. Dazu gehört einerseits das Qualifizieren von Menschen im Sinne von Wissensvermittlung und andererseits das Kultivieren im Sinne des Erlernens sozialer Kompetenz, und das, wenn es sein muss, auch in der verschränkten schulischen Ganztagsform.
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Wir werden mit den Diskussionen, wie die Zukunft für das wichtigste Gut, unsere Kinder, zu gestalten ist, noch lange nicht fertig sein. Wir müssen Schritte setzen, Hand anlegen, Gräben überwinden und Brücken schaffen. Daher stimmt meine Fraktion diesem Gesetz heute zu. – Danke. (Beifall bei der ÖVP und bei Bundesräten der SPÖ.)
18.23
Präsident Mario Lindner: Zu Wort gemeldet hat sich unsere Frau Bildungsministerin Dr. Hammerschmid. – Bitte, Frau Ministerin.
18.23
Bundesministerin für Bildung Mag. Dr. Sonja Hammerschmid: Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzte Mitglieder des Bundesrates! Ich freue mich sehr, dass wir heute hier das Bildungsinvestitionspaket diskutieren dürfen. Ich möchte auch noch einmal ein bisschen ausholen zu PISA und darf vielleicht auch versuchen, ein paar offene oder strittige oder widersprüchlich gesehene Punkte noch einmal kurz zu skizzieren, um auch ein Stück weit Klarheit zu schaffen.
PISA ist schon ein Blick auf das System, den ich sehr ernst nehme, weil diese PISA-Ergebnisse durchaus zusammenpassen mit den Bildungsstandardtests, die wir auf Stufe vier und auch acht durchführen, und natürlich immer wieder auch mit den Ergebnissen der Zentralmatura. Es ist für mich durchaus sehr besorgniserregend, dass österreichische Schülerinnen und Schüler im internationalen Vergleich bei den PISA-Tests in Mathematik, in Lesen und Naturwissenschaften im Durchschnitt liegen. Das ist für mich kein erstrebenswertes Ziel. Durchschnitt ist mir für Österreich, für die Zukunft von Österreich und vor allem für die Zukunft unserer Kinder und jungen Menschen schlichtweg zu wenig. Das ist inakzeptabel; ich habe das auch immer wieder gesagt. (Beifall bei der SPÖ und der Bundesräte Gödl, Mayer und Stögmüller.)
Ich erwarte mir wirklich, dass wir alles daransetzen, dass wir zu den Spitzenländern in Europa gehören. Ich werde immer geprügelt, weil zu den Spitzenländern bei PISA zu gehören, angeblich ein Schulsystem wie im asiatischen Raum impliziert. Wir wissen alle, was damit gemeint ist, und das meine ich nicht. Es geht mir um Spitzenländer in Eu-
ropa oder auch Kanada, weil Kanada ja auch sehr gut abschneidet. Das meine ich damit!
Dass da kreativ gestaltet werden kann, beweisen uns viele Länder mit guten Ergebnissen, wie zum Beispiel auch Estland. Wenn man nach Estland schaut, wenn man fragt – und ich habe auch die Botschaft gebeten, mir zusammenzustellen, was das estnische Bildungssystem vom österreichischen Bildungssystem unterscheidet –, dann sieht man schon, was dort anders gemacht wird. Das deckt sich ziemlich mit Kanada, mit Finnland und auch mit anderen Ländern. Es geht um Folgendes: Diese Länder haben seit Langem ein Schulsystem, in dem die Schulen sehr, sehr viel Gestaltungsspielraum haben, in dem die Schulen viel Autonomie haben, in dem Lehrerinnen und Lehrer, Pädagoginnen und Pädagogen wirklich gestalten können. – Das ist die eine Komponente.
Ganztägige Schulformen sind längst die Regelschule. Und was schon auch noch dazu kommt, und das will ich mir auch nicht verkneifen, weil es in diesem Dossier der Botschaft auch deutlich drinsteht: Es sind Gesamtschulen. – Ich will das nur erwähnt haben. (Beifall bei der SPÖ sowie des Bundesrats Stögmüller.)
Wenn wir weiter in die PISA-Ergebnisse reinschauen, dann sehen wir auch einen Befund zur Bildungsvererbung, der einmal mehr unterstrichen wird. Wir haben es im „Education at a Glance“ gehabt, wir haben es im Nationalen Bildungsbericht gehabt, aber da noch einmal ganz drastisch vor Augen geführt bekommen: Schülerinnen und Schüler aus einem Elternhaus, in dem die Eltern Pflichtschulabschluss haben, schneiden um 100 Punkte schlechter ab als Schülerinnen und Schüler aus einem Haushalt, in dem zumindest ein Elternteil einen akademischen Hintergrund hat. Das sind zwei Lernjahre, 15-Jährige, die um zwei Lernjahre hinten sind! Das müssen wir wirklich sehr ernst nehmen. Das zeigt wirklich drastisch auf, dass Bildung schon „vererbt“ – unter Anführungszeichen – wird und dass der Bildungshintergrund der Elternhäuser sehr, sehr stark prägt und prägend ist.
Das nehme ich schon als zentrale Herausforderung mit und nehme das sehr, sehr ernst – auch das schlechte Abschneiden der Mädchen im Vergleich zu den Burschen in den Naturwissenschaften, das auch herausgestellt, herausgearbeitet wird. Da sind wir sogar das Schlusslicht der OECD-Staaten. Diese unterschiedlichen Ergebnisse von Mädchen und Burschen in den Naturwissenschaften ist sehr, sehr ernst zu nehmen.
Der Befund, den ich für Estland gezeigt habe, gilt auch für andere Staaten. Das unterstreicht Andreas Schleicher, der Bildungsdirektor der OECD. Auch ihn habe ich gefragt, was die Spitzenländer von Österreich unterscheidet, und da war einmal mehr die Autonomie und die ganztägige Schulform die Antwort.
Das Bildungsinvestitionspaket, mit dem wir ganztägige Schulen fördern, ist Teil der Maßnahmen, um besser zu werden. Naturgemäß muss die ganztägige Schulform mit Leben erfüllt werden, vor allem mit pädagogisch innovativen Ansätzen erfüllt werden, damit unsere Kinder und Jugendlichen besser werden. In den ganztägigen Schulformen haben wir die Chance, vor allem mit schwächeren Kindern intensiver zu lernen, ihnen schlichtweg auch mehr Zeit zu geben, um ihre Defizite auszugleichen. Gleichzeitig bieten sie aber auch die Chance, mit den Talentierten intensiv zu arbeiten. Wir können sie besser fördern, wir können sie besser fordern, und zwar mit innovativer Pädagogik. Die steht für mich immer im Mittelpunkt!
Innovative Pädagogik muss es sein; und da müssen wir auch kreativ werden, um an den Schulstandorten mit den Pädagoginnen und Pädagogen, mit den Direktorinnen und Direktoren Projekte, Modelle für eine gelingende ganztägige Schule zu entwickeln, in der offenen Form und in der verschränkten Form. Da kann viel gelingen. Man muss sich hinsetzen und überlegen, was es sein und wie man es gestalten kann. Und es ist selbstverständlich, dass wir es schaffen müssen, dass wir Musikschulen besonders ad-
ressieren, dass wir Sportvereine adressieren – das Angebot muss einfach stimmen. Dann nehmen auch Eltern dieses Angebot gerne an.
Ich habe es ja erleben dürfen. Ich war vor Kurzem in Graz zu Gast in ganztägigen Schulen, verschränkten Schulen, offenen Formen. Manchmal sind auch verschränkte Formen und offene Formen an einem Standort gebündelt. – Schlau! Damit ist wirklich Wahlfreiheit für die Eltern gegeben. Sie können entscheiden, ob sie die Kinder in die offene oder die verschränkte Form geben, und können sich dabei einfach den Bedürfnissen ihrer Kinder entsprechend einstellen und sich danach richten. Es muss uns also gelingen, ein gutes Angebot zu gestalten. Dann werden die Eltern das auch gerne annehmen, und die Schülerinnen und Schüler werden begeistert sein.
Ich habe mit den Jugendlichen und den Kindern an dieser Grazer Schule gesprochen. Alle haben mir einhellig gesagt, dass es ihnen voll taugt, weil sie ihre Freunde da haben. Mit denen können sie ihre Freizeit verbringen oder auch lernen. Und sie haben mir auch bestätigt, dass es über weiteste Strecken gelingt, dass sie ohne Schultasche heimgehen, weil sie in der Schule lernen, weil sie die Hausübung dort machen, weil das ausreichend ist und gutes Lernen dort gelingen kann. Das habe ich in vielen anderen Schulen auch gesehen, nicht nur in Graz, sondern auch in anderen österreichischen Schulen. Da kann viel gelingen, aber wir müssen diese Angebote schaffen.
Was dieses Projekt leisten kann, ist, den Schulstandorten, den Schulerhaltern, denn die müssen sich gemeinsam überlegen, wie sie die Schule gestalten wollen, die Möglichkeit zu geben, das auch umzusetzen. Das ist ein Investitionspaket räumlicher, infrastruktureller Natur und personeller Natur. Es ist klar, dass ganztägige Schule Raum braucht – Raum, um innovativ zu gestalten, um Sportplätze zu haben, auf denen sich die Kinder auch austoben können, Raum, dass es auch eine Mensa geben kann. Mittagessen ist schon ein Thema! All jenen, die behaupten, die Kosten dafür wären kein Thema, muss ich das in Abrede stellen. Das wird deutlich, wenn man sich die Schulen ansieht. Die Kohorten an dieser Grazer Schule waren wirklich eindeutig. Da gab es die verschränkte und die offene Form, und auf meine Nachfrage nach dem sozialen Hintergrund der Kinder in der verschränkten Form, warum da schlichtweg weniger Migrantenkinder und weniger Kinder aus sozial schwächeren Familien drinnen waren, war die Antwort, dass es das Mittagessen sei. Das ist also schon ein ernst zu nehmender Punkt. Wir müssen also auch Räume für das Mittagessen schaffen, für eine Mensa, für eine Küche naturgemäß und für vieles andere mehr.
Es ist aber auch ein personelles Paket. Wir brauchen für die Freizeitgestaltung Freizeitpädagogen, die dafür ausgebildet sind. Da kann es im Übrigen auch die Bewegungspädagogen geben für die zusätzliche Turnstunde am Tag. Da kann also vieles eingebracht werden, untergebracht werden, Förderbedarf kann besonders adressiert werden und Unterstützungsbedarf detto.
Wir müssen mutig gestalten. Ich glaube, das ist das Wichtige dabei. Wir müssen mutig gestalten. Wir müssen unsere Pädagoginnen und Pädagogen motivieren, vielleicht auch ein Stück weit neu zu denken und sich drüberzutrauen. Darum geht es am Ende des Tages.
In der Debatte ist immer wieder die nicht vorhandene Wahlfreiheit im Raum gestanden. 40 Prozent sind unser Ziel – 40 Prozent! Wer da von Zwang redet, den verstehe ich wirklich nicht. 40 Prozent sind leider bei Weitem nicht ausreichend, da bin ich schon dabei. Da bräuchte es viel mehr, aber es ist ein Beginn, die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in ganztägigen Schulformen in einem Umkreis von 20 Kilometern zu verdoppeln. Dieses Angebot bis 2025 schaffen zu wollen, ist ein erster wichtiger Schritt. Wir müssen begleitend evaluieren, aber eines weiß ich auch: Ich werde alles daransetzen, wenn sich das bewährt – und es wird sich bewähren, da bin ich zutiefst davon überzeugt –, dass wir diese Finanzierung naturgemäß weiter haben werden und hochhalten können. Das
ist auch klar, aber lassen Sie uns doch einmal anfangen! (Bundesrätin Mühlwerth: Wie lange wollen Sie noch anfangen?)
Die zweite Geschichte, die mir immer wieder zu Ohren gekommen ist – witzigerweise auch aus Niederösterreich –: dass wir die verschränkte ganztägige Schule bevorzugen würden. Ich verstehe das nicht, denn wir haben in den ersten beiden Jahren in der Tat gesagt, wir werden die verschränkte ganztägige Schulform finanzieren, weil wir noch 220 Millionen € aus den Mitteln aus der Artikel-15a-Vereinbarung haben, die für offene ganztägige Schulen zur Verfügung stehen. Und was auch noch an Kritik dazukommt, ist, dass wir mit der sozialen Staffelung, die im Gesetz zweimal verankert ist, die verschränkte Form bevorzugen würden. Das stimmt nicht! Wir sagen: Schule, Lernzeiten sind kostenfrei. Das ist Bundesangelegenheit, das ist ganz klar. Und für die Freizeitgestaltung muss es eine Kostenstaffelung geben, das ist uns wichtig, in der verschränkten Form genauso wie in der offenen Form, das ist doch klar. Das wurde offensichtlich immer wieder missverstanden. Es ist wirklich eine völlige Gleichbehandlung intendiert. Man muss das Gesetz genau lesen, das ist komplex, das ist überhaupt keine Frage, aber so ist es geplant. (Zwischenruf des Bundesrates Schennach.)
Also wirklich, es gibt eine Gleichbehandlung in der sozialen Staffelung, es gibt eine Gleichbehandlung in der Finanzierung, wir haben Mittel aus der Artikel-15a-Vereinbarung, wir haben die 750 Millionen €. Ich glaube, da kann uns niemand irgendwelchen Zwang in irgendeiner Form unterstellen.
Meine Bitte ist: Gehen wir es an, packen wir es an! Wir sind es unseren Kindern und Jugendlichen schuldig, zu reagieren, schnell zu reagieren und das voranzubringen. (Beifall bei der SPÖ, bei Bundesräten der ÖVP sowie des Bundesrates Stögmüller.)
Um uns bei PISA erfolgreicher zu machen sind ganztägige Schulformen und Autonomie ganz wichtig. Ich habe das heute schon mehrfach betont. Dazu ergänzend braucht es Diagnoseinstrumente, damit Pädagoginnen und Pädagogen sofort reagieren können, im Unterricht sofort nachjustieren können, denn sie sehen dann sehr schnell und genau, wo ihre Schülerinnen und Schüler stehen, und können gleich reagieren. Diese Diagnoseinstrumente entwickeln wir gerade, und teilweise sind sie auch schon im Feld und beispielsweise in den Volksschulen gelandet. Wir müssen uns auch das Thema Lesen genau vornehmen, das ist überhaupt keine Frage. Wir müssen hinschauen, um Abhilfe zu schaffen. Wir müssen es tun, wir müssen es gemeinsam tun und wir müssen es gemeinsam gestalten, und dazu lade ich herzlich ein! – Vielen Dank. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.)
18.35
Präsident Mario Lindner: Danke, Frau Ministerin.
Ich darf den Herrn Bürgermeister von Srebrenica, Mladen Grujicić, Vizepremierminister außer Dienst Desnica Radivojević und ebenso Vizepräsident der Gemeindeversammlung von Srebrenica Radomir Pavlović ganz herzlich bei uns im Bundesrat begrüßen. (Allgemeiner Beifall.) – Ich bitte um Entschuldigung, falls ich einen Namen falsch ausgesprochen haben sollte.
Weiters zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Mühlwerth. – Bitte, Frau Bundesrätin.
18.36
Bundesrätin Monika Mühlwerth (FPÖ, Wien): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Minister! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir hätten den Nationalen Bildungsbericht und diesen Tagesordnungspunkt unter einem verhandeln sollen, denn wir sind ja in Wirklichkeit schon mitten in der Diskussion um den Bildungsbericht und gar nicht mehr so sehr allein bei der Ganztagsvolksschule.
Erlauben Sie mir trotzdem noch, zu unserem Disput mit den Grünen vorhin eine Bemerkung zu machen! Herr Kollege Stögmüller, man merkt bei Ihnen natürlich schon,
dass Sie noch sehr jung sind und dass Sie auch noch einiges zu lernen haben. (Bundesrat Stögmüller: Wer hat denn nicht korrekt zitiert? Ich habe nicht gesagt …!) – Ich bin jetzt am Wort, und ich rede jetzt aus! – Sie haben noch einiges zu lernen. Statt mit uns darüber zu diskutieren, ob „schizophren“ bildungspolitisch im Sinne von „nicht konsequent“ zu verstehen wäre, hätten Sie sagen können: Tut mir leid, ich habe das nicht so gemeint, ich nehme das zurück, ich sage euch aber, ihr sprecht mit gespaltener Zunge. – Das wäre was gewesen, wir hätten auch gelacht, und es wäre nichts passiert. (Bundesrat Stögmüller: Das tue ich auch …!)
So etwas entzündet sich ja immer dann, wenn jemand so sprachpolizeilich überkorrekt unterwegs ist, wie es die Grünen sind. Dann passieren solche Sachen, dann werden nämlich auch wir sensibel. Ich bin normalerweise jemand, der überhaupt kein Problem damit hat, wenn man einmal in der Diktion ein bisschen danebenhaut, weil ich weiß, dass mir das durchaus auch gelingen könnte, und ich nehme das dann nicht so dramatisch. So aber, Herr Kollege, wird man nicht miteinander arbeiten können! Also arbeiten Sie ein bisschen an sich und lernen Sie bitte dazu! Das ist mein Wunsch für Sie zu Weihnachten! (Beifall bei der FPÖ.)
Die Ganztagsvolksschule ist ja jetzt das Allheilmittel für euch alle, genauso wie es die gemeinsame Schule ist: Wir nehmen diese beiden Formen, und alles wird gut, jedes bildungspolitische Problem wird damit gelöst! – Ich möchte der Diskussion zum Nationalen Bildungsbericht jetzt nicht vorgreifen, denn da bin ich ohnehin gleich wieder als Rednerin dran, da bin ich Erstrednerin. Was mich interessiert, Frau Minister, ist: Sie sind jetzt so unglaublich optimistisch, Sie haben diese 750 Millionen € für die Ganztagsschule. Wir haben, glaube ich, 4 576 allgemeinbildende Pflichtschulen in Österreich. Viele davon müssten Sie ordentlich ausbauen, um wirklich eine Ganztagsschule zu bekommen, wie sie Ihnen vorschwebt: Raum für die Schüler, Raum für die Lehrer, Bewegungsraum für die Schüler, Essraum, in dem die Schüler das Mittagessen einnehmen können. Das ist ja jetzt nicht alles abzulehnen, wir lehnen ja die Ganztagsschule auch nicht per se ab, sondern wir haben eben unsere Probleme mit der verschränkten Form, weil wir diese schon als in Richtung Zwang gehend sehen.
Ihre Aussage jetzt am Ende Ihrer Rede lässt genau das befürchten, was wir ohnehin glauben: dass letzten Endes die verschränkte Form der Ganztagsschule das Nonplusultra sein wird. Da ist dann keine Rede mehr von Wahlfreiheit, sondern dann haben alle in eine Ganztagsschule zu gehen. Sie haben selbst gesagt, dass das Angebot, wenn sich das bewährt, verdoppelt, verdreifacht wird.
Auf diese 750 Millionen € möchte ich jetzt noch einmal zurückkommen, denn bei über 4 500 Schulen geht sich das nie aus.
Woher wollen Sie das Geld nehmen, um diesen Raum zu schaffen, den Sie brauchen, wenn Sie wirklich eine qualitätsvolle Ganztagsschule umsetzen wollen, auch wenn es jetzt einmal nur 40 Prozent sind? Ich meine, da beißt sich doch die Katze in den Schwanz beziehungsweise wird die Rechnung ohne den Wirt gemacht; in diesem Fall ist der Finanzminister der Wirt. 750 Millionen € klingt nach wahnsinnig viel – aber wenn man beachtet, was dafür alles getan werden muss, ist es sehr wenig. (Beifall bei der FPÖ.)
18.40
Präsident Mario Lindner: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesministerin Hammerschmid. – Bitte.
18.40
Bundesministerin für Bildung Mag. Dr. Sonja Hammerschmid: Wenn man dieses Gesetz genau liest und die Erläuterungen anschaut, dann kann man sehen, dass da ja
die Kostenansätze angeführt sind. Da sind die Kosten pro Kind pro Betreuungsstunde genau aufgelistet.
Den Entwicklungspfad, den Kostenpfad betreffend ist zu sagen: Die ersten Jahre, zum Beispiel hinsichtlich der personellen Ausstattung für die Betreuungsstunden, sind voll von Bundesseite finanziert – die Lehrer sind immer Bundeskosten, das ist überhaupt keine Frage –, aber später dann sind die Kosten abschmelzend. Natürlich sind das Kosten, die über die Gemeinden und die Schulerhalter zu tragen sind, um diese stärker in die Pflicht zu nehmen. Das war kalkuliert, das steht ganz genau im Gesetz, wie da gerechnet werden muss.
Natürlich ist da ein Hebel drinnen, weil es eine Kofinanzierung mit den Kommunen sein wird, auch keine Frage – detto die Kosten bei der Infrastruktur. Da haben wir die Kostensätze hineingeschrieben, das mag reichen, aber klar, dass es je nach Aufwand und je nach notwendigen Maßnahmen Kofinanzierungsmöglichkeiten oder -notwendigkeiten seitens der Gemeinden und der Schulerhalter gibt. Das steht im Gesetz, das ist dort nachzulesen, und natürlich hebelt sich dann diese Summe, das ist auch klar.
Es ist ja auch im Pflichtschulbereich so, dass der Schulerhalter an und für sich für den Bau zuständig ist – dieser Bau wird jedoch von unserer Seite massiv unterstützt, es sind Kofinanzierungsmodelle. Das haben wir aber auch immer gesagt, und damit erhöht sich natürlich die Summe. Die Details sind alle im Gesetz und in den Erläuterungen nachzulesen. (Beifall bei der SPÖ.)
18.42
Präsident Mario Lindner: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Dies ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir kommen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Dies ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Nationaler Bildungsbericht Österreich 2015 (III-592-BR/2016 d.B. sowie 9721/BR d.B.)
Präsident Mario Lindner: Wir gelangen nun zu Punkt 24 der Tagesordnung.
Berichterstatterin ist Frau Bundesrätin Blatnik. – Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatterin Ana Blatnik: Herr Präsident! Gospod president! Ich bringe den Bericht des Ausschusses für Unterricht, Kunst und Kultur über den Nationalen Bildungsbericht Österreich 2015.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, daher komme ich gleich zur Antragstellung:
Der Ausschuss für Unterricht, Kunst und Kultur stellt nach Beratung der Vorlage am 19. Dezember 2016 den Antrag, den Nationalen Bildungsbericht Österreich 2015 zur Kenntnis zu nehmen.
Präsident Mario Lindner: Danke für den Bericht.
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Mühlwerth. – Bitte.
18.43
Bundesrätin Monika Mühlwerth (FPÖ, Wien): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Minister! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir waren ja eigentlich eh schon mitten in der Diskussion – ich kann also jetzt dort fortsetzen, wo ich aufgehört habe.
Ich möchte schon sagen: Es ist nicht alles so toll, wie das jetzt dargestellt wird. In Wirklichkeit, sage ich Ihnen, ist das Bildungssystem – nicht von Ihnen, Frau Minister Hammerschmid, dazu sind Sie noch viel zu neu im Amt, aber von Ihren Vorgängern – einfach an die Wand gefahren worden. Wir hatten und haben zum Teil noch immer ein ganz gutes System, aber da hängt es dann schon sehr von der Schule ab und nicht so sehr vom System im Allgemeinen.
Begonnen hat diese Geschichte, als man in den Siebzigerjahren unter SPÖ-Ministerin Hertha Firnberg beschlossen hat, Matura müsse es für alle geben – ohne zu berücksichtigen, dass es eben nicht alle schaffen können. Nicht alle sind nämlich gleich begabt, nicht alle sind gleich lernbegabt, aber auch nicht alle sind lernwillig und lernfähig. Was war die Folge? – Man hat das Niveau senken müssen, um diesem Anspruch gerecht werden zu können, und es ist natürlich immer weiter hinunter gegangen.
Dann hat man begonnen, darüber nachzudenken, dass die Kinder bildungsferner Schichten leider am Schulsystem scheitern, was ja heute auch schon angeklungen ist. Da möchte ich an die Worte meiner Kollegin Rosa Ecker anknüpfen: Man fragt sich dann schon unwillkürlich, wie frühere Generationen von Kindern, die keine Akademikereltern hatten, es trotzdem geschafft haben, wenigstens Lesen, Schreiben und Rechnen in einem ausreichenden Maße zu lernen und in ihrem Beruf tüchtig zu sein, ohne dass diese Segnungen des heutigen Bildungssystems über sie hereingebrochen sind.
Die sind zu dreißigst oder zu vierzigst in einer Klasse gesessen! Zugegeben, es war die Erziehung noch nicht so individualisiert, wie sie das heute ist, das darf man natürlich auch nicht vergessen, dennoch war das System eines, in dem man sehr gut und auch sehr nachhaltig gelernt hat. Das haben wir in der Zwischenzeit verloren.
Ich stehe nicht an, zu sagen, dass der Nationale Bildungsbericht wirklich gut gemacht ist, wie ich es im Ausschuss schon gesagt habe. Er ist unglaublich informativ, es stehen unglaublich tolle Sachen drin – nicht erst seit 2015, sondern seit es ihn gibt. Bei all diesen tollen Sachen, die wir jetzt auch schon seit zwanzig Jahren hören, frage ich mich jedoch, und ich frage vor allem Sie: Wann ist das jemals da im System angekommen? – Wir haben 30 Prozent Risikoschüler, wir haben 25 Prozent Schüler, die nicht ausreichend lesen und schreiben können – nach neun Schuljahren!
Das ist ein Wahnsinn, und das ist ja nicht erst seit gestern so – das ist alles Ihr hochgelobtes System, das jeden individuell fördert und fordert, da dürfte das ja eigentlich überhaupt nicht passieren! Es passiert aber dennoch, die Schere zwischen Spitzenschülern und ganz schlechten Schülern geht immer weiter auf. Ihr Rezept dagegen, Ihr Allheilmittel ist die Gesamtschule, und jetzt kommt noch die Ganztagsschule dazu – na toll!
Es kommen immer wieder die Beispiele Estland und Finnland und ich weiß nicht was. Das mit Finnland stimmt ja, wobei ich trotzdem behaupte, die sind Mittelmaß, wenn auch auf sehr hohem Niveau. Finnland will keine Eliten haben – verhindert die Elitenbildung, das sagen auch finnische Erziehungswissenschafter – und hat einen Ausländeranteil von 1,5 Prozent. Bei den Esten gibt es auch die Gesamtschule, die Ganztagsschule, ganz toll – der Ausländeranteil ist auch ungefähr so niedrig wie bei den Finnen. (Bundesministerin Hammerschmid: 25 Prozent!)
Dann nenne ich Ihnen zum Vergleich Schweden. Schweden hat das gleiche System wie Finnland, und wo ist Schweden? – Abgestürzt! Warum ist Schweden abgestürzt?
Das ist jetzt keine Ausländerhetze, sondern ein Faktum: Dort ziehen die Zuwanderer, die nicht Schwedisch können, die nicht lernen wollen, das System hinunter, und Schweden bittet jetzt international um Hilfe, weil es einen totalen Crash hingelegt hat. (Zwischenbemerkung von Bundesministerin Hammerschmid.)
Da müssen Sie ansetzen, und dazu müssen Sie aber der Wahrheit ins Auge sehen. Sie müssen sagen: Ja, wir haben ein Problem mit den Zuwandererkindern, schon mit deren Eltern – denn es geht ja nicht nur darum, dass das Kind die Sprache können soll, sondern es geht auch um die Einstellung zum Lernen und um die Arbeitshaltung. Wenn jetzt islamische Eltern sagen: Sie sind eine Frau, mit Ihnen als Lehrerin rede ich überhaupt nicht – und das kommt an Wiener Schulen sehr oft vor, das kann ich Ihnen versichern! –, dann wird das nie etwas werden. (Zwischenruf der Bundesrätin Gruber-Pruner.)
Man muss eine gewisse Arbeitshaltung haben, eine gewisse Disziplin gehört eben zum Leben dazu, Lernen bringt einen weiter, bedeutet aber auch eine gewisse Anstrengung – wenn die Eltern das ihrem Kind zu Hause nicht schon früh beibringen, dann werden diese Kinder am System scheitern. Egal, wie Sie es organisieren, und egal, was Sie für Kopfstände machen, es wird nicht gehen.
Am besten erleben wir es in Deutschland. In Neukölln gibt es den roten Bürgermeister Buschkowsky, der hat ein Buch geschrieben: „Neukölln ist überall“ – ein sehr empfehlenswertes Buch. Da werden Kinder gefragt, was sie werden wollen – die antworten: Hartz IV!
Wieso gibt es das? – Weil so jemand genau weiß, dass er beim System eh nicht durchfallen kann. Er bekommt schon irgendein Minimum an Geld, und dann hat er halt einen Cousin mit einer Autowerkstatt oder sonst irgendetwas, und dort geht er pfuschen. Damit kommt er ganz gut über die Runden, außerdem hat er in seiner Familie schon das Beispiel, dass der Onkel und der Cousin und der zweite und dritte Cousin es genauso machen.
Das sind die Dinge, wo Sie ansetzen müssen – nicht immer bei Kompetenzen, Ganztagsschule und Gesamtschule. Ja, wir müssen die Schüler fördern, das ist überhaupt keine Frage. Das ist eine Selbstverständlichkeit – dass man darüber überhaupt noch reden muss?!
Man muss die Kinder aber auch fordern. Das ist übrigens ein Teil, der über die letzten Jahrzehnte sehr vernachlässigt worden ist, denn Sie müssen Schüler – und Kinder im Allgemeinen – in einem pädagogisch adäquaten Maß an ihre Leistungsgrenzen heranführen, damit die überhaupt wissen, was sie können, was sie sich zutrauen können. Wenn Sie da einmal an der Schraube drehen würden, wäre ja schon viel gewonnen. Anstatt da – verzeihen Sie den Ausdruck, wenn ich es jetzt so sage – im pädagogischen Wolkenkuckucksheim zu leben, sollte man ein bisschen realitätsnäher sein. (Zwischenruf des Bundesrates Brunner.)
Was diese viel beschworene Selektion angeht: Diese armen Kinder, die keine Akademikereltern oder keine Eltern mit einer Matura haben, könnten ja nur scheitern, weil die im Bildungssystem verloren wären, weil sie das von zu Hause nicht mitbekommen hätten. Dazu möchte ich eine Studie von der Agenda Austria zitieren, die uns Freiheitlichen nicht nahesteht. Die Autoren dieser Studie haben gesagt: Das Datenmaterial, das es gibt, ist top, und die Zahlen sind richtig – man muss nur die Frage anders stellen, dann kommt man aber komischerweise zu einem völlig anderen Ergebnis. Sie schreiben:
„Wenn man die Frage stellt, wie viele Kinder aus einem akademischen Haushalt selbst einen akademischen Abschluss erreicht haben, bekommt man ein ganz anderes Bild, als wenn die Frage umgekehrt gestellt wird: Wie viele Kinder mit einem akademischen Abschluss kommen aus einem akademisch gebildeten Elternhaus?“
Oder man stellt die Frage: Wie viele Kinder haben einen höheren Bildungsabschluss als ihre Eltern erreicht? „42 Prozent der 45- bis 54-Jährigen haben einen höheren Bildungsabschluss als beide Eltern.“ – Nichts also mit der sozialen Selektion, und dass man keinen höheren Bildungsabschluss erreichen könnte, wenn man nicht aus einem Akademikerhaushalt ist!
Ich frage mich ja, warum das immer behauptet wird, welchem Zweck das eigentlich dienen soll. Diese Studie ist ja mindestens genauso wahr wie das, was von Ihnen behauptet wird. Es geht weiter: „bei 40 Prozent der Studienanfänger“ – das sind jene, die die Matura geschafft haben – „haben weder Vater noch Mutter einen höheren Schulabschluss. Also keine Matura.“
Vielleicht gibt Ihnen das auch noch einmal zu denken.
„Der internationale Vergleich weist für Österreich einen Anteil von 67 Prozent an Studierenden aus, bei denen kein Elternteil einen akademischen Abschluss hat.“
Da kann irgendetwas an Ihrer Rechnung auch nicht stimmen, wenn man mit denselben Zahlen zu einem völlig anderen Ergebnis kommt. Vielleicht liegt die Wahrheit ein bisschen in der Mitte, wie das oft der Fall ist. Diese Studie ist jedenfalls genauso eine seriöse Untersuchung wie die anderen behaupten, dass ihre seriös wären.
Abschließend der wesentlichste Punkt – das ist für mich immer so gewesen, und auch viele Erziehungswissenschafter und Pädagogen sagen das –: Die Unterrichtsqualität steht und fällt mit der Qualität des Lehrers!
Wir nehmen uns viele Beispiele, und ich behaupte gar nicht, dass wir nicht unglaublich engagierte Lehrer hätten – und wir haben auch sicher sehr viele sehr gute Lehrer. Engagiert heißt aber nicht unbedingt, dass man ein sehr guter Lehrer ist. Ich bin davon überzeugt, dass der Lehrerberuf nicht ein Job wie jeder andere ist, den man lernen kann, wenn man eine pädagogische Ausbildung hat. Da braucht es schon auch eine gewisse Begabung dafür, es braucht die Liebe zu den Kindern und – Ana, da wirst du mir vielleicht ausnahmsweise einmal recht geben – es braucht auch eine ordentliche Portion Humor, um mit den Schülern klarzukommen. (Bundesrätin Blatnik: Freilich!)
Die Qualität der Ausbildung ist jedoch das Nonplusultra. Da nimmt man sich Finnland ja komischerweise nicht so sehr als Vorbild, denn die haben ein ziemliches Ausleseverfahren, wer überhaupt Lehramt studieren darf. Bei uns versucht man, das so im ersten, zweiten oder vielleicht auch erst im dritten Semester abzufangen, und dann schauen wir einmal. Noch aus meiner Zeit als Vizepräsidentin des Stadtschulrates für Wien kenne ich eine ganze Reihe von Lehrern, bei denen man gewusst hat, den kannst du nie in eine Klasse stellen – und trotzdem durfte er das Studium beenden.
Auch die Akzeptanz der Lehrer und Schulen bei den Eltern und in der Gesellschaft ist immer mit der Qualität der Lehrer verknüpft. Das muss unser oberstes Ziel sein, dass wir dort anfangen, dann haben wir schon einmal die halbe Miete. Über die weiteren Dinge unterhalten wir uns dann gern beim nächsten Mal.
Ich wünsche euch allen ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und bleibt bitte gesund! (Beifall bei der FPÖ.)
18.54
Präsident Mario Lindner: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Mag. Gruber-Pruner. – Bitte.
18.55
Bundesrätin Mag. Daniela Gruber-Pruner (SPÖ, Wien): Herr Präsident! Frau Ministerin! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll (Bundesrätin Mühlwerth: Am Anfang!), weil ich mir so viele Notizen gemacht habe
über das, was Vorrednerinnen und Vorredner zu diesem Thema da schon zum Besten gegeben haben. Eines muss ich jedoch schon vorweg anmerken, Frau Kollegin Mühlwerth: Sie haben jetzt doch tatsächlich manchen Kindern das Menschsein abgesprochen! Ich bin echt fassungslos. (Beifall bei der SPÖ sowie des Bundesrates Stögmüller.) Sie haben nämlich behauptet, dass es Kinder gibt, die nicht lernfähig wären, und dass es Kinder gibt, die nicht lernwillig wären. – Der Mensch zeichnet sich durch Lernwilligkeit und Lernfähigkeit aus, und diese Aussage finde ich wirklich einfach ungeheuerlich.
Die Sache kann vielleicht auch damit zu tun haben, dass unsere Einrichtungen und Systeme noch nicht kindgerecht genug sind. Wir wissen, dass jedes Kind ein Lernbedürfnis und eine Neugierde hat, das ist ihm angeboren. Das kann dem Kind nur abgewöhnt werden, wenn das Schulsystem oder das Bildungssystem es darin einschränken.
Sie haben über die verschränkte Ganztagsschulform gesprochen – das ist genau die Form, die dem Bedürfnis des Kindes entgegenkommt. Ein Kind hat das Bedürfnis, im Laufe des Tages zu lernen, sich zwischendurch auszuruhen, zwischendurch mit Freunden etwas zu machen, sich zwischendurch zu bewegen und dann wieder zu lernen, wieder neugierig zu sein und so weiter. Das kann eine verschränkte Ganztagsschule leisten. (Beifall bei der SPÖ sowie des Bundesrates Stögmüller.)
Man darf da einfach nicht das System in den Mittelpunkt stellen, sondern das Kind und seine Bedürfnisse, nur dann kann eine konstruktive Entwicklung eines Bildungssystems gelingen. Das musste ich jetzt einfach vorweg sagen. (Zwischenruf der Bundesrätin Mühlwerth.)
Was diese hatscherten Vergleiche – tut mir leid, also diese unkorrekten Vergleiche – angeht: Wir wissen, dass Estland einen sehr hohen Anteil an Kindern mit russischer Herkunft hat. Zu behaupten, die hätten einen Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund im Bereich von einem oder zwei Prozent, ist einfach falsch. (Bundesministerin Hammerschmid: 25 Prozent! – Bundesrätin Mühlwerth: Das ist doch etwas ganz anderes – warum wir schon wieder Äpfel mit Birnen vergleichen!)
Jetzt komme ich aber zu meinem eigentlichen Konzept und versuche, da noch ein paar Punkte einzubringen. Ich möchte mich zuerst sehr, sehr herzlich bei allen Mitarbeiterinnen im Ministerium für diesen Nationalen Bildungsbericht, für beide Teile, bedanken.
Ich denke, er liefert nicht nur aktuelle Zahlen, Daten und Fakten, die wesentlich sind, um die richtigen Schlüsse zu ziehen und sich weiterzuentwickeln. Seit es diese Bildungsberichte gibt, gelingt es uns eben, zu vergleichen, Entwicklungen zu dokumentieren, Verbesserungen zu erkennen, aber natürlich auch Verschlechterungen zu sehen und darauf zu reagieren. Ich meine, das ist sehr wesentlich. – Herzlichen Dank für diese fundierte Grundlage, die wir da bekommen.
Wir haben schon darüber gesprochen, dass uns jetzt die neuesten PISA-Ergebnisse wieder eingeholt haben, und die meisten Stichwörter sind schon gefallen. Ich möchte trotzdem noch auf diese Bildungsvererbung eingehen, weil Kollegin Stöckl-Wolkerstorfer dieses Thema der Gräben angesprochen hat. Sie sagt, wir müssen versuchen, diese Gräben, die es offensichtlich zwischen gesellschaftlichen Schichten gibt, zu schließen. Ich ziehe einen anderen Schluss: Ich denke, auch das kann nur gelingen, wenn alle unter einem Dach zusammenkommen und nicht wieder die Bildungselite es sich richten kann, denn genau dann produziert man schon wieder diesen Graben.
Es ist schade, dass Kollegin Stöckl-Wolkerstorfer jetzt nicht anwesend ist. Ich ziehe einfach einen anderen Schluss daraus und denke, Gräben können nur geschlossen werden, wenn man alle Gesellschaftsgruppen beisammen hat und gemeinsam weiterentwickeln kann.
Sie haben schon erwähnt, dass es große Unterschiede, nämlich von bis zu zwei Jahren, in der Entwicklung von verschiedenen SchülerInnengruppen gibt. Ich möchte dazu noch eine aktuelle Studie aus Großbritannien erwähnen. Das ist eine Langzeitstudie, bei der man verfolgt hat, welche Auswirkungen Elementarbildung auf die Bildungskarriere haben kann. Frau Ecker war da sehr unsicher, ob der Elementarbildungsbereich Kinder in ihrem Bedürfnis ernst nehmen kann.
Diese Langzeitstudie zeigt sehr genau, dass, wenn Kinder schon früh über einen gewissen Zeitraum in einer qualitativ hochwertigen Elementarbildungseinrichtung sind, das schlussendlich Folgen für ihre Bildungsentwicklung hat, und zwar positive Folgen. Falls diese qualitativ hochwertige Elementarbildung gewährleistet wird, können damit Unterschiede, die Kinder aus ihrem Elternhaus mitbringen, ausgeglichen und abgefedert sowie eine Chancengleichheit beim Start in das Bildungssystem gewährleistet werden. Ich bin daher eine große Verfechterin der Stärkung der Elementarpädagogik. (Bundesrätin Mühlwerth: Eine amerikanische Studie sagt das Gegenteil!)
Was sich in den letzten Jahren verbessert hat, zeigt auch dieser Bildungsbericht. Nur um ein paar Punkte herauszunehmen: Wir haben relativ stabile Klassengrößen, die sich im Durchschnitt bei 19 Schülerinnen und Schülern pro Klasse einpendeln, das ist erfreulich. Also die Größen der Klassen nehmen ab, das tut den Kindern gut, aber auch den Lehrerinnen und Lehrern.
Wir haben auch gesehen, dass sich die Ergebnisse der Bildungsstandardtestung bei VolksschülerInnen in Mathematik von 2010 auf 2013 gebessert haben, also auch da greifen die Maßnahmen.
Was ich auch sehr erfreulich finde – das ist heute noch nicht zur Sprache gekommen –, ist, dass sich die Zahl der Jugendlichen, die direkt nach Absolvierung der Schulpflicht das Schulsystem verlassen, dieser sogenannten Early School Leavers, ebenfalls reduziert; es wirken offensichtlich auch die Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Sozialministerium, Jugendcoaching et cetera. Es ist sehr positiv, dass diese Tendenz rückläufig ist. Dennoch habe ich das Gefühl, dass diese Jugendlichen unsere verstärkte Aufmerksamkeit verdienen. Jeder Jugendliche, der uns auf diese Weise abhandenkommt, ist einer zu viel. Das möchte ich auch noch als einen Punkt, der mir wichtig ist, mitgeben.
Was sind die Herausforderungen der nächsten Jahre im Bildungssystem? – Wir haben über die individuelle Förderung aller Kinder und Jugendlichen im Bildungssystem gesprochen. Um hier Chancengleichheit herzustellen, braucht es Zeit, es braucht kompetentes Personal, da bin ich bei Ihnen, Frau Kollegin: Die LehrerInnenausbildung ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Es braucht aber auch für jene Standorte, an denen es schwieriger ist, an denen die Heterogenität der Schüler und Schülerinnen sehr groß ist, mehr Ressourcen. Es ist zum Glück das Thema des Chancenindex in der Mittelzuteilung mittlerweile in der Fachdiskussion angekommen. Ich bin der festen Überzeugung, dass das notwendig ist, und möchte den Vergleich zu einem Garten anstellen:
Wenn man einen Garten hat, gibt es Flecken, auf die scheint die Sonne, die haben genug Feuchtigkeit, dort ist die Erde gut durchmischt und gut mit Sauerstoff gefüllt. Auf diesen Flecken ist es leicht, ein gutes Gedeihen der Pflanzen zu erreichen. In einem Garten gibt es aber auch Ecken, die eher schattig sind, wo es mehr zieht und die Erde trockener ist. Jeder Gärtner würde logischerweise dort mehr düngen, mehr rechen, sich intensiver darum kümmern, dass dort bessere Bedingungen herrschen. Und das, denke ich mir, ist die Idee des Chancenindex: genau dort mehr Mittel zu investieren, wo die Bedingungen schwieriger sind.
Alles in allem – ich überspringe einiges, das Lämpchen leuchtet schon – denke ich mir, dass diese Form der verschränkten Ganztagsschule den Kindern und ihren Bedürfnis-
sen wirklich sehr, sehr nahekommt, und ich denke, wir würden ihnen etwas Gutes tun, indem wir das verwirklichen. – Danke schön. (Beifall bei der SPÖ.)
19.03
Präsident Mario Lindner: Liebe Kollegin Mühlwerth! Ich habe Ihre Ausführungen zur Geschäftsbehandlung sehr ernst genommen. Ich habe mir das Vorläufige Stenographische Protokoll vorlegen lassen, dieses Stenographische Protokoll auch mit der Frau Vizepräsidentin und dem Herrn Vizepräsidenten besprochen und bin zur Auffassung gelangt, dass, weil die Situation gemeint war, kein Ordnungsruf zu erteilen ist.
Als Nächste gelangt Frau Bundesrätin Hackl zu Wort. – Bitte.
19.04
Bundesrätin Marianne Hackl (ÖVP, Burgenland): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Minister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Man sieht, mit wie viel Engagement die Vorrednerinnen sich für den Bereich Bildung eingesetzt haben, dieser ist auch mir sehr wichtig. Es besteht auf allen Ebenen im Bildungssystem ein großer Änderungsbedarf.
Die Schulstruktur sollte sozial durchlässiger werden. Die Lernergebnisse müssen sich deutlich verbessern. Im internationalen Vergleich stehen wir eher schlechter da, obwohl unsere Kinder sehr, sehr lernwillig sind. Entscheidender als die Höhe der aufgewendeten Mittel ist für den Bildungserfolg in Österreich aber auch das Elternhaus. Kinder, die etwa Familien mit Migrationshintergrund, niedrigem Status oder Bildungsniveau entstammen, schreibt das BIFIE eine schlechtere Ausgangslage zu, um in der Schule erfolgreich zu sein. Ihre Familien sind oft weniger mit dem schulischen System und dessen Inhalten vertraut und können somit bei der Schulwahl nicht die entsprechende Unterstützung bieten.
Ein besonderes Risiko für ein unterdurchschnittliches Leistungsniveau im Bildungsbereich stellen Schwächen in der Unterrichtssprache dar, vor allem dann, wenn daheim eine andere Sprache gesprochen wird. Bereits in der Volksschule kann man ungleiche Bildungschancen am besten erkennen. Für mich als stolze Südburgenländerin ist es erfreulich, dass die Zugehörigkeit zu den Risikogruppen im eher dünn besiedelten ländlichen Raum, wie eben auch bei uns im Burgenland, wesentlich seltener als im dicht besiedelten urbanen Umfeld ist.
Eine Entlastung der Lehrerinnen und Lehrer von Verwaltungsaufgaben wäre überfällig. Man muss einfach die Realität des Schulalltags und damit verbundene Herausforderungen, nicht zuletzt auch jene durch die Flüchtlingskrise, zur Kenntnis nehmen. Kleine Veränderungen werden zwar groß präsentiert, aber eine echte Bildungsreform ist zum Leidwesen unserer Kinder auf unbekannte Zeit verschoben. Mehr als jedes zehnte Kind ist in seiner Schullaufbahn und seinen weiteren Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe gefährdet. Diese Tatsache sollte uns allen zu denken geben. Es sollen nicht nur Bildungsexperimente mit Kindern gemacht werden, sondern Kindertalente sollen gefördert und gefordert werden, denn der Gleichmacherei gehört nicht unsere Zukunft.
Der Bildungsbericht stellt Hindernisse in der Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Schule durch unterschiedliche Zuständigkeiten fest. Im Rahmen der Schulautonomie geben wir die pädagogischen, finanziellen und persönlichen Spielräume dorthin, wo sie hingehören, nämlich an die Schulen und in die Klassen. Damit stärken wir Freiheit und Eigenverantwortung. Lehrerinnen und Lehrer sollten leichter eigene Schwerpunkte setzen können. Sie bekommen mehr Spielraum bei der Unterrichtsgestaltung, um die vorgegebenen Ziele erreichen zu können. Wenn Schulautonomie den Wettbewerb zwischen Schulen fördern kann, ist das positiv zu sehen.
Die Möglichkeit von Schulleiterinnen und Schulleitern, gezielt auf die Bedürfnisse der Schüler des eigenen Bezirks einzugehen, ermöglicht eine zielgerechte Förderung. Eine
Ganztagsschule darf niemals verpflichtend sein. Es sollte der Bedarf vonseiten der Eltern und Schüler gegeben sein und dann über ein Angebot nachgedacht werden können.
Außerdem braucht es das Mitspracherecht des Schulgemeinschaftsausschusses bei Neuanstellungen und mehr Digitalisierung des Unterrichts. Wie viel in diesem Bereich noch zu tun ist, zeigt jenes Bild, das sich an vielen Schulen des Landes bietet. Während die Kinder im Pausenhof via Smartphone mit der Außenwelt kommunizieren, herrscht in den Klassenräumen oft verstaubte Kreidezeit.
Man darf den Weg von der Kreidezeit in die Zukunft nicht verschlafen. In der Schule von morgen sollen keine Beamten bestimmen, wo es langgeht, sondern die Beteiligten. Schüler, Eltern und Lehrer wissen im Schulalltag am ehesten, wo der Schuh drückt. (Bundesrätin Posch-Gruska: Ein schlechtes Bild von den Schulen im Burgenland!) – Nein, es gibt kein schlechtes Bild im Burgenland. (Zwischenruf der Bundesrätin Posch-Gruska. – Bundesrat Mayer: Das hängt davon ab, von welcher Perspektive man es betrachtet!)
Momentan werden Schulpartner auf allen Ebenen, egal, ob auf Schul-, Landes- oder Bundesebene, aus wichtigen Entscheidungen herausgehalten. Mehr Eigenverantwortung und das Setzen von Schwerpunkten muss auch bei der Zentralmatura möglich sein. Vorgegeben werden soll dabei nur ein Teil der Aufgaben, die alle Schülerinnen und Schüler beherrschen sollten. So viel Autonomie muss die Bildungsministerin den Schülern und Lehrern ermöglichen.
Ich persönlich investierte bei meinen drei Kindern nie in das Materielle, sondern in ihre Ausbildung und in unsere Zukunft, und es hat gefruchtet. Darauf bin ich stolz. – Ich wünschen allen schöne Weihnachten. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
19.10
Präsident Mario Lindner: Als Nächster gelangt Herr Bundesrat Stögmüller zu Wort. – Bitte.
19.10
Bundesrat David Stögmüller (Grüne, Oberösterreich): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Bildungsministerin! Sehr geehrte Damen und Herren! Ein Bildungsbericht ist immer ein Aufzeigen von Weiterentwicklung. Wir schauen nun Ende 2016 auf das Jahr 2015. Es gibt in diesem Bericht ein paar mir wichtige Punkte, auf die ich auch ganz explizit eingehen möchte.
Zum einen gibt es in den Schulen Unterstützungsbedarf, vor allem im Bereich Professionalisierung, Fachdidaktik und Team Teaching, zum anderen bemühen sich die Schulen wiederum um mehr Lesekompetenz und Freude, Gesundheitsentwicklung, Bewegung, soziale Kompetenzen und gewaltfreie Konfliktlösungen.
Was auch aufgefallen ist, sind die großen Leistungsdifferenzen zwischen Kindern aus Akademikerfamilien und solchen, in denen die Eltern maximal den Pflichtschlussabschluss haben. Hierbei sind auch nichtdeutsche Umgangssprachen sowie fehlendes kulturelles Kapital, wie zum Beispiel Bücher, natürlich weitere Risikofaktoren, die darauf Einfluss nehmen. Auch dass bereits die Volksschule für Kinder selektiv ist, wird in diesem Bericht klar aufgezeigt. Zum Beispiel besuchen 1,8 Prozent der Kinder im Volksschulalter, die einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben, eine Sonderschule. 6 Prozent der Volksschulkinder besuchen eine Privatschule, also da beginnt bereits die Selektion.
Wie auch im Bericht steht, führen frühe Bildungslaufbahnentscheidungen zu Chancenungleichheiten, zu einem Druck auf die Lehrkräfte, zu Stress bei den Eltern und Ängsten bei den Kindern. Hierbei ist auch die Empfehlung eines Gesamtschulkonzepts zu verfolgen und die Richtungsentscheidung in der Bildungslaufbahn auf ein Alter zu ver-
schieben, in dem eine emanzipierte Entscheidung über den weiteren Bildungsverlauf auch wirklich selber getroffen werden kann.
Ein Punkt, dessen sich dieser Bericht auch annimmt, ist die Medienkompetenz und das digitale Lernen. E-Books sind ja für die Oberstufe in diesem Schuljahr zum ersten Mal verfügbar. Sie sind aber leider kaum interaktiv und ersetzen gedruckte Schulbücher, wenn überhaupt, nur zum Teil. Auch bei Open Educational Ressources gibt es noch Probleme, sagen wir einmal so, gerade was die Frage des Urheberrechts angeht. Die Empfehlungen im Bericht sind neben einer Bildungscloud als zentraler Infrastruktur nicht nur für Schulbücher, sondern auch als Flipped Classroom für Vor- und Nachbereitung und Hausaufgaben, auch eine umfassende Medienkompetenzausbildung für die Pädagoginnen und Pädagogen zu schaffen – und das halte ich für essenziell.
Was ich auch noch sehr spannend gefunden habe, war die Zusammensetzung der Klassen und deren Einfluss auf den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler. Dabei geht es um die Möglichkeit der Wahlfreiheit von Eltern, ihre Kinder in weit entfernte Schulen zu schicken. Das ist ein erneuter Selektionsvorgang, denn nicht alle Eltern haben die finanziellen, sozialen, aber auch emotionalen und kognitiven Ressourcen, um sich die notwendigen Informationen zu beschaffen, um für ihr Kind die vorteilhafteste Option herauszufiltern und die Entscheidung zu treffen. Für manche Eltern ist es leichter, für manche ist es halt schwieriger. Und hierbei muss mit den VertreterInnen der gewünschten Schulen einfach erfolgreich verhandelt werden.
Auch innerhalb der Schulen geschieht eine Segregation, zum Beispiel durch Mehrstufenklassen versus Jahrgangsklassen, Religionszugehörigkeiten, ganztägig verschränkte oder nicht verschränkte Schulklassen, in den Sekundarstufen zum Beispiel zwischen humanistischen Schulklassen, neusprachlichen Schultypen und durch Spezialisierung der Schwerpunktsetzung wie Sport, Musik oder Kreativität. Das führt dann oft zu unterschiedlichsten Selbstwahrnehmungen von SchülerInnen in derselben Schule, die sogenannten Restklassler, das sind zum Beispiel Leistungssportlerinnen und Leistungssportler.
Es gäbe noch viel, das der Bericht aufzeigt und das auch dringend angegangen werden muss. Daher: Gehen wir es an! Arbeiten wir noch zahlreiche Problemfelder auf! Uns haben Sie, Frau Ministerin, sicher als Partnerinnen und Partner, wenn es um zukunftsfähige Bildungspolitik geht. Wir Grüne im Bundesrat werden gerne den Bildungsbericht zur Kenntnis nehmen.
Und ich möchte wegen des Weihnachtsfriedens auch noch ein paar Worte an die Frau Kollegin Ecker richten. – Es tut mir wirklich leid, wenn du – ich sage jetzt du als Oberösterreicher – das persönlich genommen hast. Ich habe ganz klar – und das möchte ich auch feststellen – nicht dich gemeint, sondern wirklich das Gesamtkonzept und die Partei. Vielleicht war „schizophren“ das falsche Wort, vielleicht hätte man es auch anders ausdrücken können. Auch, wenn es keinen Ordnungsruf gab, will ich wirklich klarstellen: Ich meine natürlich keine Person, wenn ich hier am Pult etwas sage, sondern wenn, dann immer den Gesamtkomplex der Partei – Okay, ich bitte um Entschuldigung. Schöne Weihnachten euch allen und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Schönen Tag! (Beifall bei Grünen und SPÖ.)
19.15
Präsident Mario Lindner: Als Nächste hat sich Frau Bundesministerin Dr. Hammerschmid zu Wort gemeldet. – Bitte.
19.15
Bundesministerin für Bildung Mag. Dr. Sonja Hammerschmid: Geschätzter Herr Präsident! Geschätzte Mitglieder des Bundesrates! Erlauben Sie mir einen kurzen Side-
step, da ich schon ansprechen möchte, was Frau Bundesrätin Mühlwerth hinsichtlich Neukölln angeschnitten hat, die schlechten Schulerfolge in Neukölln, und auch die Begründung dahinter, dass das auf die hohe Anzahl von Migrantenkinder zurückzuführen wäre. Neukölln ist das Thema, ich muss es leider kurz aufgreifen. Ich möchte diese Möglichkeit aber nutzen.
Ich war vorige Woche in Neukölln. Ich war an der Rütli-Schule in Neukölln. Und wem die Rütli-Schule bekannt ist, der weiß, wovon ich jetzt spreche: Diese Schule stand vor acht Jahren vor der Schließung, weil diese Schule unglaubliche Probleme hatte: Gewalt, Konflikte – Ende nie! –, Lehrer, die sich eigentlich ohne Handy nicht mehr in die Klassen getraut haben, weil es immer wieder so heftige Konflikte gab, dass es zu Polizeieinsätzen kam et cetera, und von den Schulerfolgen dort brauche ich nicht zu reden.
Die Pädagoginnen und Pädagogen haben innegehalten und darüber nachgedacht, ob sie die Schule schließen oder ob sie sich ein neues Konzept überlegen. 20 Prozent der Pädagoginnen und Pädagogen haben gesagt, das tun sie sich nicht mehr an, und haben die Schule verlassen, aber 80 Prozent der Pädagoginnen und Pädagogen haben gesagt: Okay, probieren wir es noch einmal, setzen wir uns hin und überlegen wir uns, wie diese Schule mit dieser Zusammensetzung der Kinder gelingen kann.
Sie haben Unterstützung von der Stadt bekommen – ganz klar! Sie haben dahin gehend Unterstützung bekommen, dass sie weitreichend freie Hand in der Unterrichtgestaltung, zusätzliche Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und Psychologinnen und Psychologen bekommen haben. Mit diesem Konsortium sind sie hergegangen und haben Schule neu gezeichnet.
Sie haben eine Schule entwickelt, die aus einer Grundschule, also sprich: unserer Volksschule, aus einer Sekundarstufe I und einer Sekundarstufe II bis zur Matura besteht, und zwar als Gesamtkonzept. Man beginnt also am Schulstandort mit der Volksschule und kann bis zur Matura kommen. Sie haben dem ein pädagogisches Konzept zugrunde gelegt, das ein Stück weit an das Konzept von Margret Rasfeld angelehnt ist, mit Lernbüros, mit sehr autonomer Gestaltung des Unterrichts in unterschiedlichen Unterrichtsformen wie Flipped Classroom – das war heute schon Thema –, aber auch andere Unterrichtsformen kommen dort zur Anwendung.
Die Sprache, der Sprachkompetenzerwerb stehen im Mittelpunkt. Das ist auch keine Frage, weil es dort viele Kinder und Jugendliche gibt, die Migrationshintergrund haben und die Deutsch nicht als Erstsprache nutzen. Und sie haben gerade in der Sekundarstufe I Wert darauf gelegt, dass auch in Werkstätten gearbeitet werden kann, dass Holz, Metall, Stoffe ausprobiert werden können, also in der Schule schlichtweg unterschiedliche Gewerke ausprobiert werden können.
Die Rechnung ist aufgegangen: Mittlerweile machen die Anmeldungen in der Volksschule von Kindern aus deutschen Familien mehr als 60 Prozent aus. Sie können nicht einmal alle nehmen! Die Schule hat mittlerweile nämlich einen so guten Ruf, dass sie von Anmeldungen von Schülerinnen und Schülern für die Grundschule überrannt wird, aber auch Pädagoginnen und Pädagogen finden es plötzlich superattraktiv, an dieser Schule zu arbeiten. Und die Direktorin kann sich – und das tut sie aus Überzeugung – ihre Pädagoginnen und Pädagogen aussuchen. Sie sagt aus Überzeugung: Ohne das Aussuchen von Pädagoginnen und Pädagogen hätte sie es nie hinbekommen, das Gesamtkonzept Schule so zu entwickeln. Das ist das ganz klare Credo.
In der Mittelstufe und in der Oberstufe hat sie immer noch 95 bis 97 Prozent der Kinder mit Migrationshintergrund. Ich habe mit diesen Kindern aus der Mittelstufe gesprochen, also Elf- und Zwölfjährige und Maturantinnen und Maturanten: brillantes Deutsch, ganztägige Schule. Ich habe eine 15 Jahre alte Schulsprecherin mit brillantem Deutsch kennengelernt. Sie ist seit drei Jahren in Deutschland, und ich hätte keinen ausländischen
Hintergrund – sprich: dass Deutsch nicht die Muttersprache ist –, erkennen können. Sie sprechen wirklich gutes Deutsch, weil sie den ganzen Tag in der Schule sind.
Es sind so viele Schüler aus unterschiedlichen Nationen, dass Deutsch die verbindende Sprache ist und sie somit in der Schule automatisch Deutsch reden und daher diese Sprachkompetenz besonders entwickeln.
Ich habe mit Maturantinnen und Maturanten – nämlich aus dem Irak, aus Afghanistan stammend – gesprochen, die mit voller Inbrunst und aus Überzeugung gesagt haben: Ich will Mediziner werden, ich will Bauingenieur werden, ich will studieren! – Die wissen ganz genau, was sie wollen, und haben wirklich erkannt, dass Bildung ihre Chance ist. Also es kann wirklich viel gelingen, wenn man sich gemeinsam hinsetzt und den Mut hat, Schule ganz neu zu denken und ganz neu zu konzipieren.
Dort ist das wirklich gelungen. Also auch in Neukölln kann Schule gelingen, auch in Neukölln kann es gelingen, sehr, sehr gute Ergebnisse zu haben und zu maturieren. (Bundesrätin Mühlwerth: Ich wünsche es mir eh!) – Ja. Also ich wollte das nur voranstellen. Ich glaube, daran sollten wir uns auch mit unseren Konzepten orientieren. (Bundesrat Krusche: Und wie viel Geld haben die in die Hand genommen?)
Dass sich die Schule verändern muss, glaube ich, ist auch dem geschuldet, dass sich unsere Gesellschaft in den letzten 20, 30 Jahren stark verändert hat und dass sich unsere Arbeitswelten in den letzten 20, 30 Jahren ganz stark verändert haben. Wir haben Arbeitswelten, die wir überhaupt nicht mehr einschätzen können, geprägt durch technologischen Wandel unterschiedlichster Natur, und da ist die Digitalisierung nur ein Teil davon; das heißt natürlich in der Konsequenz, dass wir auch die Schule verändern müssen. Wir müssen darauf abstellen, wie sich die Gesellschaft und wie sich die Berufswelten verändert haben. Das erfordert eine neue Konzeption der Schule entlang der Fächer, aber auch eine neue Konzeption des Unterrichts, sprich: themenspezifischer Unterricht, projektspezifischer Unterricht, einfach um Kompetenzen zu adressieren, die entlang des Fächerkanons so nicht machbar sind.
Ich rede von Problemlösungskompetenz, von Teamfähigkeit, von Selbstorganisation, von Neugier und Kreativität sowieso, das geht bis hin zu unternehmerischem Handeln und der Lust am Lernen, welche wir den Kindern wirklich vermitteln müssen. Sie werden nämlich ein Leben lang lernen müssen. Das alles muss uns in der Schule gelingen. Wir dürfen ihnen die Kreativität und die Neugier nicht nehmen. Da müssen wir uns einfach ein Stück weit dieser Herausforderung stellen, zu Recht stellen – die Gesellschaft hat sich verändert, die Berufswelt hat sich verändert, und das müssen wir mutig angehen.
Das zeigt auch der Nationale Bildungsbericht. Ich möchte noch einmal betonen, dass der Nationale Bildungsbericht – und es waren, glaube ich, 40 Wissenschafterinnen und Wissenschafter dabei am Werk – ein unabhängiger Bericht ist, der uns einmal mehr eine Sicht ins System erlaubt, damit wir evidenz- und faktenbasiert gestalten können. Das ist mir ganz, ganz wichtig!
Was mir aber auch wichtig ist, und das möchte ich auch nicht verhehlen: Ich war an wirklich vielen Schulen! Ich versuche, viel draußen zu sein, mit den Pädagoginnen und Pädagogen zu sprechen, auch mit den Kindern und mit den Eltern zu sprechen, um zu sehen, wo der Schuh drückt und was denn die Herausforderungen an Österreichs Schulen sind, um das mit den Fakten, Daten und Zahlen zusammenfließen zu lassen und neue Konzepte zu entwickeln.
Ich muss Ihnen eines sagen: Ich habe ganz viele hoch motivierte, höchst kreative Pädagoginnen und Pädagogen erleben dürfen, und es war schön zu sehen, wie sie versuchen zu gestalten. Wir müssen ihnen diesen Rahmen und die Möglichkeiten, stärker zu gestalten, besser zu gestalten, pädagogisch innovativ zu gestalten, in die Hand geben, um die Schule einfach weiterzuentwickeln.
Außerdem möchte ich schon betonen, dass wir ganz, ganz viele ganz tolle Lehrer und Lehrerinnen haben, und wir haben auch schon ganz, ganz viele tolle Schulen.
Zum Thema Digitalisierung: Das ist mir sehr wichtig, Digitalisierung nehme ich sehr ernst! Ich bin ja selbst Technologin und habe natürlich auch einen Zugang zu diesen technologischen Innovationen. Wir arbeiten zur Zeit an einer Gesamtstrategie zum Thema Digitalisierung in der gesamten Komplexität, die (in Richtung Bundesrat Stögmüller) Sie ja angerissen haben; die werden wir Anfang des nächsten Jahres auch vorstellen. Wir haben aber wirklich gerade im Bereich der Open Educational Resources super Lernmaterialien gefunden – hoch innovativ, hoch interaktiv, gut gestaltet.
Beim E-Book haben wir Verbesserungsbedarf, das wissen wir, das war der erste Schritt. Wir wissen auch, dass wir sehr viel interaktiver und ergänzender zum Schulbuch sein müssen, um da einfach die Jugendlichen im Besonderen zu adressieren, denn das, was ich in diesen Schulen schon gesehen habe, ist, dass die Begeisterung, mit diesen Tools zu arbeiten, hoch ist. Plötzlich ist die Begeisterung, die Motivation dafür, eine Hausübung zu machen, da. Das muss uns gelingen. Das kann aber alles eingepflegt werden, auch beim Thema Autonomie und in dem großen Projekt, das wir nächstes Jahr vorhaben. Das soll alles möglich werden.
Das spricht ja dieser Bildungsbericht auch so stark an: Gebt den Pädagoginnen und Pädagogen Freiheit, da wirklich gut zu gestalten! Es geht um die Innovation in der Pädagogik, und das werden wir jedenfalls adressieren.
Es geht auch darum, sehr viel individualisierter zu unterrichten. Da sind wir wieder in der Autonomie, da sind wir wieder in der Digitalisierung. Talenteförderung gelingt mit digitalen Instrumenten ganz besonders gut, das habe ich selbst gesehen.
Wir müssen aber auch – und das zeigt uns dieser Bildungsbericht sehr gut – ganz gezielt auf die Herausforderungen der Schulstandorte schauen, insbesondere auch dort, wo besondere Herausforderungen bestehen, sprich: wo besonders viele Kinder sind, die beispielsweise Deutsch nicht als Erstsprache haben; aber auch Inklusion ist da ein Thema.
Ja, wir müssen uns dem stellen, wir müssen da hinschauen, wir müssen die Mittel chancengerechter zuteilen. Da ist der Integrationstopf II, den wir hier erstmals entlang eines Chancenindex vergeben, für uns ein Beispiel, wie das funktionieren kann.
Es gibt zwei Indikatoren. Der erste Indikator ist der Pflichtschulabschluss der Eltern und der zweite Indikator ist Deutsch nicht als Erstsprache – und entlang dieser beiden Indikatoren haben wir diese 80 Millionen € für das nächste Schuljahr zugeteilt. Wir werden evaluieren und schauen, ob dieser Zuteilungsschlüssel passt oder ob wir noch Verbesserungsbedarf haben. Wir müssen dort hinschauen, wir müssen wirklich die Ressourcenallokation entlang des Sozialindex und des Chancenindex steuern.
Ganz kurz zum Thema Volksschule und Elementarpädagogik: Ja, Elementarpädagogik ist wahrscheinlich einer der zentralen Schlüssel zum Erfolg, weil gerade Sprache im Kindergarten ganz leicht und besonders gut vermittelt werden kann. Da müssen wir noch viel, viel stärker hinschauen, auch da muss es uns gelingen, Qualität in die Pädagogik zu bekommen. Wir haben bereits 96 Prozent der Kinder im fünften Lebensjahr im Kindergarten – das letzte Kindergartenjahr ist ja verpflichtend –, aber die dazugehörige Pädagogik müssen wir noch anpassen. Von den VolksschulpädagogInnen, die im ersten Jahr unterrichten, höre ich nämlich immer von dieser Bandbreite an Kompetenzen, die die Kinder mitbringen, wenn sie das erste Mal in die Schule hineingehen, und von diesen irrsinnig großen Unterschieden dabei. Darum müssen wir im Kindergarten, in der Elementarpädagogik wirklich hinschauen, uns da Bildungsziele vornehmen, einen Qualitätsrahmen vornehmen, um diesen Übertritt in die Schule besser zu gestalten.
Vieles gelingt da ja schon; mit dem Schulrechtspaket ist ein erster Teil der Umsetzung bereits gelungen. Es ist aber nur ein erster Teil, das wissen wir alle, und da müssen wir naturgemäß noch hinschauen. Ich unterstütze hier wirklich nach allen Kräften meine Kollegin Sophie Karmasin, die für die Elementarpädagogik zuständig ist, dass wir da auch weiterkommen.
Ich könnte jetzt noch lange reden, aber ich glaube, ich sprenge jetzt schön langsam jegliches Zeitbudget. – Ich höre jetzt auf. (Heiterkeit der Bundesräte Mayer und Stögmüller.) – Schöne Weihnachten! Schöne Feiertage! Ich freue mich wirklich auf die Kooperation auch im nächsten Jahr. Wir haben vieles vor. Ich nenne nur die Autonomie als ein Stichwort, als großes Thema für das nächste Jahr, die Digitalisierung als zweites. Ich freue mich auf die gute Zusammenarbeit! – Vielen Dank. (Beifall bei SPÖ und ÖVP, bei Bundesräten der FPÖ sowie des Bundesrates Stögmüller.)
19.28
Präsident Mario Lindner: Weitere Wortmeldungen liegen mir dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir kommen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, den gegenständlichen Bericht zur Kenntnis zu nehmen, um ein Handzeichen. – Dies ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Sehr geehrte Frau Bundesministerin! Ich darf mich – auch im Namen des Bundesrates – ganz herzlich für die Zusammenarbeit bedanken. Frohe Weihnachten und alles Gute für das Jahr 2017! (Beifall bei SPÖ und ÖVP, bei Bundesräten der FPÖ sowie des Bundesrates Stögmüller.)
Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Sanierung des Parlamentsgebäudes (Parlamentsgebäudesanierungsgesetz, PGSG) geändert wird (1906/A und 1401 d.B. sowie 9719/BR d.B.)
Präsident Mario Lindner: Nun gelangen wir zum 25. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatter ist Herr Bundesrat Poglitsch. Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatter Christian Poglitsch: Ich bringe den Bericht des Wirtschaftsausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Sanierung des Parlamentsgebäudes (Parlamentsgebäudesanierungsgesetz, PGSG) geändert wird.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher gleich zur Antragstellung.
Der Wirtschaftsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 19. Dezember 2016 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Präsident Mario Lindner: Herzlichen Dank für die Berichterstattung. Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort ist niemand gemeldet.
Wünscht jemand das Wort? – Dies ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir kommen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit angenommen.
Erstattung eines Vorschlages des Bundesrates für die Ernennung eines Ersatzmitgliedes des Verfassungsgerichtshofes
Präsident Mario Lindner: Wir gelangen nun zum 26. Punkt der Tagesordnung. Die Erstattung dieses Vorschlages ist notwendig geworden, da das seinerzeit aufgrund eines Vorschlages des Bundesrates ernannte Ersatzmitglied des Verfassungsgerichtshofes Professorin Dr. Irmgard Griss wegen des Erreichens der Altersgrenze mit Ablauf des 31. Dezember 2016 aus dem Verfassungsgerichtshof ausscheiden wird.
Gemäß § 1 Abs. 3 Verfassungsgerichtshofgesetz wurde die offene Stelle im Amtsblatt der „Wiener Zeitung“ und in den für amtliche Kundmachungen bestimmten Landeszeitungen mit einer Bewerbungsfrist bis 25. November 2016 ausgeschrieben.
Den Mitgliedern des Bundesrates wurde die Möglichkeit zur Einsicht in die eingelangten Bewerbungen geboten. Es liegt mir ein Wahlvorschlag vor, der auf Mag. Werner Suppan lautet.
Es liegt mir ein von fünf Bundesräten unterstütztes Verlangen gemäß § 57 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Bundesrates vor, über diesen Wahlvorschlag eine Debatte durchzuführen.
Wir gehen in die Debatte ein.
Als Erste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Mag. Dr. Dziedzic. – Bitte.
19.31
Bundesrätin Mag. Dr. Ewa Dziedzic (Grüne, Wien): Sehr geehrter Herr Präsident! Wertes Präsidium! Liebe Kollegen und Kolleginnen! Eingangs verlangen wir, weil es eine Personalwahl ist, eine Abhaltung dieser Wahl via Stimmzettel. Diese werden, soweit ich sehe, bereits ausgeteilt.
Wir möchten auch die Vorgangsweise kritisieren, da sie aufgrund eines fehlenden Hearings intransparent war. Viele von Ihnen werden vielleicht den Newsletter des Instituts für Föderalismus gelesen haben. Darin wird auch Bezug auf die Nominierung von Mitgliedern und Ersatzmitgliedern des Verfassungsgerichtshofes genommen, und zwar soll es das Ziel sein, dass das Parlament besser und stärker eingebunden wird. (Vizepräsident Gödl übernimmt den Vorsitz.)
Wir sind der Meinung, dass das sicher nicht durch das Vorschlagsrecht einzelner Parteien geschehen kann, die dann auch noch ein Hearing unmöglich machen. Das ist für uns das eine.
Das andere ist, dass es sieben qualifizierte Bewerber gab – leider war keine Frau darunter, dafür kann aber natürlich die ÖVP nichts –, darunter waren unter anderem zwei OGH-Richter und zwei Uni-Professoren. Wir möchten Herrn Mag. Suppan nicht unterstellen, dass er nicht der Bestqualifizierte gewesen ist, aber hätte es ein Hearing gegeben, dann könnten wir mit gutem Gewissen behaupten, welcher von diesen Bewerbern es tatsächlich gewesen wäre. – Das ist nun diese Sache.
Eine weitere Sache, die wir auch kritisieren möchten, weil es unserer Meinung nach kein gutes Licht auf diese Kammer wirft, ist die Kommunikation nach außen. Sie werden vielleicht alle am Sonntag, dem 18. Dezember, den Artikel in der „Presse“ gelesen haben,
der titelt: „ÖVP-Anwalt Suppan folgt Griss als Verfassungsrichter nach“, und weiter: „Der Bundesrat kürt den Juristen am Mittwoch zum Ersatzmitglied am Höchstgericht.“
Am 19. Dezember steht im „Standard“ ein Userkommentar, worin es heißt: „Griss-Nachfolge: Geheim“; Untertitel „Am Mittwoch entscheidet der Bundesrat über die Nachbesetzung im Verfassungsgerichtshof. Bis dahin unterliegt das Verfahren dem Datenschutz – die Öffentlichkeit bleibt weitgehend uninformiert“. Das heißt nicht nur, dass der Kommentator wahrscheinlich den Artikel vom Vortag nicht gelesen hat, ich glaube, dass sich hier ein weiterer Kommentar von selbst erübrigt. – Wir würden uns wünschen, dass das in Zukunft anders gehandhabt wird.
Da jetzt schon alle vom Weihnachtsfrieden gesprochen haben, möchte ich – vor der Abstimmung und weil es auch mein letzter Redebeitrag für heute ist – allen, die Weihnachten feiern, schöne Feiertage wünschen, und jenen, die nicht feiern, schöne freie Tage. Die Zeit vergeht irrsinnig schnell. Ich wurde mir selber erst jetzt dessen bewusst, dass ich bereits seit einem Jahr hier im Bundesrat bin, und ich wünsche mir, dass diese Zusammenarbeit mit Ihnen auch im zweiten Jahr so hervorragend funktioniert wie im ersten. – Danke schön. (Allgemeiner Beifall.)
19.35
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Mayer. – Bitte.
19.35
Bundesrat Edgar Mayer (ÖVP, Vorarlberg): Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Frau Kollegin Dziedzic, ja, es gehört zu den Usancen des Bundesrates, Nominierungen von Mitgliedern – ich sage nochmals: Mitgliedern des Verfassungsgerichtshofes; auch das steht dem Bundesrat zu – im Rahmen eines Hearings durchzuführen. Wir haben das auch in der Präsidiale besprochen, denn hier geht es um ein Ersatzmitglied des Verfassungsgerichtshofes. Es war bisher üblich und wurde auch so gehandhabt, das hier wohl zu diskutieren, dann einen Wahlvorschlag einzubringen und diesen Wahlvorschlag abzustimmen.
Wir haben uns jetzt in der Präsidiale auch daran gehalten und das so vorgeschlagen. Es wäre schon möglich gewesen, auch ein Hearing zu machen, aber man muss schon auch die komprimierte Situation anschauen: Bis 30. November bestand die Wahlausschreibungsmöglichkeit, und es sollte dieses Jahr noch beschlossen werden. Jetzt sozusagen in aller Eile hier – obwohl es natürlich jedem bekannt ist, dass das kurz vor Weihnachten komprimierte Tage mit Ausschuss, mit Nationalrat, mit Bundesrat et cetera sind – ein Hearing von einem Tag hineinzupressen, wäre schwierig gewesen. Man kann sich aber durchaus darüber unterhalten, und das wird sicher auch Thema in der Präsidiale sein, wie man in Hinkunft mit derartigen Ernennungen umgeht, und dann kann es durchaus sein, dass wir ein Ersatzmitglied des Verfassungsgerichtshofes auch im Rahmen eines Hearings ernennen beziehungsweise das hier beschließen möchten.
Jetzt zu Mag. Werner Suppan: Ich möchte schon anfügen, dass es sehr viele gute Kandidaten gab, aber auch Mag. Suppan ein wirklich sehr geeigneter und fähiger Kandidat ist, der sehr oft als Rechtsanwalt, sagen wir einmal als Mann der Praxis, als praktisch denkender Rechtsanwalt in diesem Bereich mit dem Verfassungsgerichtshof zu tun hat. Das kommt aus seiner Bewerbung deutlich hervor, weil er Beschwerden über Erkenntnisse vom Verwaltungsgerichten nach Artikel 144 B-VG ebenso wie Individualanträge nach Artikel 139 B-VG sehr oft behandelt, auch Wahlanfechtungen sind darunter.
Er ist schon – was die Verfassungsgerichtshoftätigkeit anbelangt – ein sehr, sehr versierter und gefragter Mann. Ich darf deshalb auch namens meiner Fraktion um Unterstützung dieses Wahlvorschlages bitten. – Herzlichen Dank. (Beifall bei der ÖVP und bei Bundesräten der SPÖ.)
19.38
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Todt. – Bitte.
19.38
Bundesrat Reinhard Todt (SPÖ, Wien): Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Uns kommt heute die an sich ehrenhafte Aufgabe zu, ein Ersatzmitglied des Verfassungsgerichtshofes dem Bundespräsidenten zur Ernennung vorzuschlagen. Der Verfassungsgerichtshof ist eines der bedeutendsten Organe des Staates und urteilt über politisch äußerst sensible Rechtsfragen, wie durch die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes bei der Wahlwiederholung zur Stichwahl des Bundespräsidenten in diesem Jahr auch der breiten Öffentlichkeit deutlich gemacht wurde.
Dem Bundesrat kommt dabei eine bedeutende Rolle innerhalb des Verfassungsgefüges zu, da er drei Mitglieder und ein Ersatzmitglied vorschlagen kann. Daneben bestehen auch für die Bundesregierung und für den Nationalrat Vorschlagsrechte. Die Zusammensetzung des Verfassungsgerichtshofes ist daher durchaus eine politische, wobei im Jahr 1994 diese politische Komponente nochmals verstärkt wurde, da bis dorthin Dreiervorschläge zu erstatten waren, aus denen der Bundespräsident frei wählen konnte. Wir haben daher die verfassungsrechtliche Verpflichtung aus den Bewerbern jenen auszuwählen, dem besondere Qualifikationen für diese Funktion zukommen.
Die ÖVP-Fraktion hat Mag. Werner Suppan vorgeschlagen. Einen kurzen Blick auf die Homepage seiner Rechtsanwaltskanzlei zeigt – wie er es auch selbst in seiner Bewerbung angeführt hat –, dass er sich seit Jahren mit einem – in der heutigen Zeit besonders wichtigen Grundrechtsthema – anwaltlich befasst. Ein besonderer Schwerpunkt seiner beruflichen Tätigkeit ist dem Medien- und Persönlichkeitsschutzrecht gewidmet, es geht dabei insbesondere um das Spannungsverhältnis zur Freiheit auf Meinungsäußerung in grundrechtlicher Hinsicht. Wie wichtig dieses Thema aktuell ist, hat Präsident Mario Lindner mit seinen Aktivitäten in seiner Präsidentschaft deutlich gezeigt.
Ich möchte mich aber bei all jenen Bewerbern – es war ja leider keine Bewerberin dabei – dafür bedanken, dass sie sich beim Bundesrat um die Stelle als Ersatzmitglied des Verfassungsgerichtshofes beworben haben, alle Bewerber haben höchste Qualifikationen.
Ich denke, wir sind aufgefordert, darüber nachzudenken – dass wir in der Präsidiale darüber reden, zeigt das auch –, wie wir das zukünftig mit Hearings halten werden, da bin ich mit dir (in Richtung Bundesrat Saller) vollkommen einer Meinung.
Ich möchte mich auch an dieser Stelle für die Zusammenarbeit in diesem Jahr bedanken, wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest, alles Gute, erholsame Feiertage und ein Prosit 2017! (Allgemeiner Beifall.)
19.41
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor. Wünscht noch jemand das Wort? – Bitte, Herr Bundesrat Raml.
19.41
Bundesrat Mag. Michael Raml (FPÖ, Oberösterreich): Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Zu Weihnachten gibt es offenbar doch noch Wunder, und diese Wunder zeigen auf, dass es zwar äußerst selten, aber nicht unmöglich ist, dass die Grünen und die Freiheitlichen hundertprozentig bei einem Thema übereinstimmen. Kollegin Dziedzic, ich kann mich dir hundertprozentig anschließen, du hast das wunderbar dargestellt.
Auch uns Freiheitlichen geht es um eines: Wir haben nichts gegen den Herrn Rechtsanwalt Suppan einzuwenden, aber der Verfassungsgerichtshof – das hat Kollege Todt schon erwähnt – ist wirklich eine der bedeutendsten Einrichtungen unserer Republik.
Ich habe schon manchmal meine Kritik anklingen lassen, dass eine rein politische Besetzung – das ist es, was wir beim Verfassungsgerichtshof erleben – eine sehr heikle ist.
Wenn man dieses System aber schon hat, kann man sich, glaube ich, zu Recht wünschen, dass dieses Verfahren ordentlich durchgeführt wird. Ein Hearing hätte auch in der Weihnachtszeit stattfinden können. Mir ist bewusst, dass die Terminpläne dicht sind. (Zwischenruf des Bundesrates Mayer.) – Ich habe letzte Woche auch an jedem Abend eine Abendveranstaltung gehabt, heute diese Plenarsitzung, aber, lieber Kollege Mayer, ich glaube, zwei Stunden für ein Hearing – an dem jede Partei hätte teilnehmen können – aufzubringen, das wäre auch in der Weihnachtszeit nicht unmöglich gewesen.
Ich hätte mir auch einen Tag Zeit genommen, weil ich das für sehr, sehr wichtig erachte. Nichtsdestotrotz haben wir nichts gegen Rechtsanwalt Suppan; den Bundesräten unserer Fraktion ist es freigestellt, wie sie abstimmen.
Auch ich darf mich in meiner letzten Plenarrede dieses Jahres für ein erstes tolles Jahr in diesem Haus bedanken. Danke für die gute Aufnahme. Ich danke auch Kollegen Forstner für die hervorragende Informationsveranstaltung nach der Ausschussrunde am Montag.
Ich wünsche Euch und Ihnen allen gesegnete Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. (Allgemeiner Beifall.)
19.43
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir gehen nun in den Wahlvorgang ein. Für die Wahl wurde eine Abstimmung mit Stimmzetteln verlangt. Für die Abstimmung sind die weißen Stimmzettel mit „Ja“ oder „Nein“ zu verwenden.
Ich frage Sie: Hat jedes Mitglied des Bundesrates Stimmzettel erhalten, und zwar mit der Aufschrift „Ja“ und „Nein“, und auch nur einen mit „Ja“ und „Nein“? – Gut, es gibt auch eine gewisse Eigenverantwortung.
Bei Aufruf der Bundesräte in alphabetischer Reihenfolge sind die Stimmzettel in der aufgestellten Urne zu hinterlegen. Nach Beendigung der Stimmabgabe werden die SchriftführerInnen mit Unterstützung von Bediensteten des Hauses die Stimmenauszählung vornehmen.
Ich ersuche nun den Schriftführer um den Namensaufruf in alphabetischer Reihenfolge.
*****
(Über Namensaufruf durch Schriftführer Lindinger werfen die Bundesräte ihren Stimmzettel in die Wahlurne.)
*****
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Die Stimmabgabe ist beendet.
Ich bitte nun um die Stimmenauszählung und unterbreche zu diesem Zweck kurz die Sitzung.
*****
(Die Stimmenauszählung wird vorgenommen. – Die Sitzung wird um 19.53 Uhr unterbrochen und um 19.56 Uhr wieder aufgenommen.)
*****
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Meine Damen und Herren! Ich nehme die unterbrochene Sitzung wieder auf und gebe das Ergebnis der Abstimmung bekannt: Es wurden 51 Stimmen abgegeben; davon „Ja“-Stimmen: 43, „Nein“-Stimmen: 8. Der Wahlvorschlag ist somit angenommen. (Allgemeiner Beifall.)
Wahl der beiden Vizepräsidenten/innen, der Schriftführer/innen und der Ordner/innen für das 1. Halbjahr 2017
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Wir kommen nun zum 27. Punkt der Tagesordnung.
Da mit 1. Jänner 2017 der Vorsitz im Bundesrat auf das Bundesland Tirol übergeht und gemäß Artikel 36 Abs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz die an erster Stelle entsendete Vertreterin dieses Bundeslandes, Frau Bundesrätin Sonja Ledl-Rossmann, zum Vorsitz berufen ist, sind die übrigen Mitglieder des Präsidiums des Bundesrates gemäß § 6 Abs. 3 der Geschäftsordnung des Bundesrates für das kommende Halbjahr neu zu wählen.
Wahl der VizepräsidentInnen
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Ich werde die Wahl der Vizepräsidentin beziehungsweise des Vizepräsidenten durch Erheben von den Sitzen vornehmen lassen.
Wir gehen nunmehr in den Wahlvorgang ein und kommen zur Wahl der ersten zu wählenden Vizepräsidentin des Bundesrates.
Gemäß § 6 Abs. 3 der Geschäftsordnung des Bundesrates kommt hiefür der SPÖ-Fraktion das Vorschlagsrecht zu.
Es liegt mir ein Wahlvorschlag vor, der auf Bundesrätin Ingrid Winkler lautet.
Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Wahlvorschlag zustimmen, sich von den Sitzen zu erheben. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Wahlvorschlag ist somit angenommen. (Allgemeiner Beifall.)
Ich frage die Gewählte, ob sie die Wahl annimmt. (Bundesrätin Winkler bedankt sich für das Vertrauen und nimmt die Wahl an.)
Wir kommen nun zur Wahl des zweiten zu wählenden Vizepräsidenten des Bundesrates.
Gemäß § 6 Abs. 3 der Geschäftsordnung des Bundesrates kommt hiefür der ÖVP-Fraktion das Vorschlagsrecht zu.
Es liegt dafür ein Wahlvorschlag vor, der auf Bundesrat Mag. Ernst Gödl lautet.
Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Wahlvorschlag zustimmen, sich von den Sitzen zu erheben. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Wahlvorschlag ist somit angenommen. (Allgemeiner Beifall.)
Ich frage den Gewählten, ob er die Wahl annimmt. (Heiterkeit.) – Ja, ich nehme die Wahl gerne an und danke für das Vertrauen. (Allgemeiner Beifall.)
Wahl der Schriftführer/innen
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Wir kommen nun zur Wahl der Schriftführerinnen beziehungsweise Schriftführer.
Es liegt mir der Wahlvorschlag vor, die Mitglieder des Bundesrates Ana Blatnik, Josef Saller, Werner Herbert, Ewald Lindinger und Anneliese Junker für das erste Halbjahr 2017 zu Schriftführerinnen beziehungsweise zu Schriftführern des Bundesrates zu wählen.
Falls kein Einwand erhoben wird, nehme ich diese Wahl unter einem vor. – Es erfolgt kein Einwand.
Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Wahlvorschlag ihre Zustimmung geben, um ein Handzeichen. – Das ist Stimmeneinhelligkeit. Der Wahlvorschlag ist somit angenommen.
Ich frage die Gewählten, Frau Bundesrätin Ana Blatnik, Herrn Bundesrat Josef Saller, Herrn Bundesrat Werner Herbert, Herrn Bundesrat Ewald Lindinger und Frau Bundesrätin Anneliese Junker, ob sie die Wahl annehmen. (Die Bundesrätinnen Blatnik und Junker sowie die Bundesräte Saller, Herbert und Lindinger nehmen die Wahl an.)
Wahl der Ordner/innen
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Wir kommen nunmehr zur Wahl der Ordnerinnen beziehungsweise Ordner.
Es liegt mir der Wahlvorschlag vor, die Mitglieder des Bundesrates Ferdinand Tiefnig, Mag. Susanne Kurz, Christoph Längle und Dr. Heidelinde Reiter für das erste Halbjahr 2017 zu Ordnerinnen beziehungsweise zu Ordnern des Bundesrates zu wählen.
Falls kein Einwand erhoben wird, nehme ich auch diese Wahl unter einem vor. – Es wird kein Einwand erhoben.
Ich bitte jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Wahlvorschlag ihre Zustimmung geben, um ein Handzeichen. – Das ist Stimmeneinhelligkeit. Der Wahlvorschlag ist somit angenommen.
Ich frage die Gewählten, Frau Bundesrätin Mag. Susanne Kurz, Frau Bundesrätin Dr. Heidelinde Reiter, Herrn Bundesrat Ferdinand Tiefnig und Herrn Bundesrat Christoph Längle, ob sie die Wahl annehmen. (Die Bundesrätinnen Kurz und Reiter sowie die Bundesräte Tiefnig und Längle nehmen die Wahl an.)
Die Tagesordnung ist erschöpft.
Verlesung eines Teiles des Amtlichen Protokolls
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Es liegt mir das schriftliche Verlangen von fünf Mitgliedern des Bundesrates vor, das Amtliche Protokoll hinsichtlich der Tagesordnungspunkte 1 bis 25 zu verlesen, damit dieser Teil des Amtlichen Protokolls mit Schluss der Sitzung als genehmigt gilt. Dadurch soll die umgehende Beschlussfassung ermöglicht werden.
Ich werde daher so vorgehen und verlese nunmehr den entsprechenden Teil des Amtlichen Protokolls:
„TO-Punkt 1: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz 1997 geändert wird (1263 d.B. und 1413 d.B. sowie 9666/BR d.B. und 9716/BR d.B.)
Abstimmung: Berichterstattung: Antrag,
1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen (mit Stimmenmehrheit),
2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 44 Absatz 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen, wird bei Anwesenheit von mehr als der Hälfte der Mitglieder des Bundesrates mit Stimmenmehrheit (und zwar mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit) angenommen.
TO-Punkt 2: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Umweltförderungsgesetz geändert und das Bundesgesetz, mit dem zusätzliche Mittel für Energieeffizienz bereitgestellt werden, aufgehoben wird (1361 d.B. und 1417 d.B. sowie 9712/BR d.B.)
Abstimmung: Berichterstattung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen (mit Stimmenmehrheit).
TO-Punkt 3: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG Zielsteuerung-Gesundheit (1339 d.B. und 1371 d.B. sowie 9702/BR d.B.)
TO-Punkt 4: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend Vereinbarung gemäß Art 15a B-VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens (1340 d.B. und 1372 d.B. sowie 9703/BR d.B.)
TO-Punkt 5: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz zur partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit (Gesundheits-Zielsteuerungsgesetz – G-ZG) erlassen wird sowie das Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, das Ärztegesetz 1998, das Bundesgesetz über die Gesundheit Österreich GmbH und das Bundesgesetz über die Dokumentation im Gesundheitswesen geändert werden (Vereinbarungsumsetzungsgesetz 2017 – VUG 2017) (1333 d.B. und 1373 d.B. sowie 9665/BR d.B. und 9704/BR d.B.)
TO-Punkt 6: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Ärztegesetz 1998 geändert wird (1357 d.B. und 1377 d.B. sowie 9705/BR d.B.)
Abstimmungen:
Zu TO-Punkt 3: Berichterstattung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen (mit Stimmenmehrheit).
Zu TO-Punkt 4: Berichterstattung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen (mit Stimmenmehrheit).
Zu TO-Punkt 5: Berichterstattung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen (mit Stimmenmehrheit).
Zu TO-Punkt 6: Berichterstattung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen (mit Stimmenmehrheit).
TO-Punkt 7: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Gentechnikgesetz und das Versicherungsvertragsgesetz geändert werden (1336 d.B. und 1378 d.B. sowie 9706/BR d.B.)
Abstimmung: Berichterstattung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen (mit Stimmeneinhelligkeit).
TO-Punkt 8: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Elektrotechnikgesetz 1992 (ETG 1992) geändert wird (1326 d.B. und 1402 d.B. sowie 9718/BR d.B.)
Abstimmung: Berichterstattung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen (mit Stimmenmehrheit).
TO-Punkt 9: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz mit dem ein Innovationsstiftung-Bildung-Gesetz erlassen und das Einkommensteuergesetz 1988 und das Körperschaftsteuergesetz 1988 geändert werden (Innovationsstiftungsgesetz – ISG) (1350 d.B. und 1383 d.B. sowie 9717/BR d.B.)
Abstimmung: Berichterstattung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen (mit Stimmenmehrheit).
TO-Punkt 10: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein Finanzausgleichsgesetz 2017 erlassen wird sowie das Finanzausgleichsgesetz 1997, das Finanzausgleichsgesetz 2001, das Finanzausgleichsgesetz 2005, das Finanzausgleichsgesetz 2008, das Umweltförderungsgesetz, das Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfengesetz und das Bundespflegegeldgesetz geändert werden und das Bedarfszuweisungsgesetz aufgehoben wird (1332 d.B. und 1393 d.B. sowie 9669/BR d.B. und 9687/BR d.B.)
TO-Punkt 11: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern, mit der Regelungen zu Haftungsobergrenzen vereinheitlicht werden – HOG – Vereinbarung (1364 d.B. und 1394 d.B. sowie 9688/BR d.B.)
TO-Punkt 12: Beschluss
des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988,
das Körperschaftsteuerge-
setz 1988, das
Umgründungssteuergesetz, das Umsatzsteuergesetz 1994, das Glücksspielgesetz,
das Kommunalsteuergesetz 1993, das Verrechnungspreisdokumentationsgesetz, die Bundesabgabenordnung, das
Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz 2010, das
Bundesfinanzgerichtsgesetz, die Abgabenexekutionsordnung, das
Mineralölsteuergesetz 1995, das Tabakmonopolgesetz 1996, das
Transparenzdatenbankgesetz 2012, das Stabilitätsabgabegesetz, und das
Versicherungssteuergesetz 1953 geändert werden (Abgabenänderungsgesetz
2016 – AbgÄG 2016) (1352 d.B. und 1392 d.B. sowie
9670/BR d.B. und 9689/BR d.B.)
Abstimmungen:
Zu TO-Punkt 10: Berichterstattung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen (mit Stimmenmehrheit).
Zu TO-Punkt 11: Berichterstattung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen (mit Stimmenmehrheit).
Zu TO-Punkt 12: Berichterstattung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen (mit Stimmenmehrheit).
TO-Punkt 13: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz zur Verhinderung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzmarkt (Finanzmarkt-Geldwäschegesetz – FM-GwG) erlassen wird und das Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz, das Bankwesengesetz, das Bausparkassengesetz, das Betriebliche Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz, das Börsegesetz 1989, das Bundesfinanzierungsgesetz, das Bundesgesetz zur Schaffung einer Abbaueinheit, das Bundeskriminalamt-Gesetz, das Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz, das E-Geldgesetz 2010, das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz, das Glücksspielgesetz, das Investmentfondsgesetz 2011, das Kontenregister- und Konteneinschaugesetz, das Rechnungslegungs-Kontrollgesetz, das Sanierungs- und Abwicklungsge-setz, das Sparkassengesetz, das Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, das Verbraucherzahlungskontogesetz, das Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 und das Zahlungsdienstegesetz geändert werden (1335 d.B. und 1391 d.B. sowie 9671/BR d.B. und 9690/BR d.B.)
Abstimmung: Berichterstattung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen (mit Stimmenmehrheit).
TO-Punkt 14: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend Protokoll zur Abänderung des am 5. November 1969 in Vaduz unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen in der Fassung des am 29. Jänner 2013 in Vaduz unterzeichneten Protokolls (1323 d.B. und 1396 d.B. sowie 9691/BR d.B.)
TO-Punkt 15: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend Protokoll zur Abänderung des am 29. Jänner 2013 in Vaduz unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein über die Zusammenarbeit im Bereich der Steuern (1324 d.B. und 1397 d.B. sowie 9692/BR d.B.)
TO-Punkt 16: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Aufhebung des Abkommens vom 13. April 2012 zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt (1327 d.B. und 1398 d.B. sowie 9693/BR d.B.)
TO-Punkt 17: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und Island zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt Protokoll (1252 d.B. und 1399 d.B. sowie 9694/BR d.B.)
Abstimmungen:
Zu TO-Punkt 14: Berichterstattung: Antrag,
1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen (mit Stimmeneinhelligkeit),
2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Absatz 2 Ziffer 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen, wird angenommen (mit Stimmeneinhelligkeit).
Zu TO-Punkt 15: Berichterstattung: Antrag,
1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen (mit Stimmenmehrheit),
2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Absatz 2 Ziffer 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen, wird angenommen (mit Stimmenmehrheit).
Zu TO-Punkt 16: Berichterstattung: Antrag,
1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen (mit Stimmenmehrheit),
2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Absatz 2 Ziffer 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen, wird angenommen (mit Stimmenmehrheit).
Zu TO-Punkt 17: Berichterstattung: Antrag,
1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen (mit Stimmeneinhelligkeit),
2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Absatz 2 Ziffer 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen, wird angenommen (mit Stimmeneinhelligkeit).
TO-Punkt 18: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz über die Enteignung der Liegenschaft Salzburger Vorstadt Nr. 15, Braunau am Inn (1250 d.B. und 1389 d.B. sowie 9713/BR d.B.)
Abstimmung: Berichterstattung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen (mit Stimmeneinhelligkeit).
TO-Punkt 19: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz 2015, das Meldegesetz 1991, das Namensänderungsgesetz, das Personenstandsgesetz 2013, das Sprengmittelgesetz 2010 und das Waffengesetz 1996 geändert werden (Deregulierungs- und Anpassungsgesetz 2016 – Inneres) (1345 d.B. und 1388 d.B. sowie 9714/BR d.B.)
TO-Punkt 20: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG zwischen dem Bund und dem Land Tirol über Hubschrauberdienste für den Zivil- und Katastrophenschutz im Land Tirol (1366 d.B. und 1390 d.B. sowie 9715/BR d.B.)
Abstimmungen:
Zu TO-Punkt 19: Berichterstattung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen (mit Stimmenmehrheit).
Zu TO-Punkt 20: Berichterstattung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen (mit Stimmeneinhelligkeit).
TO-Punkt 21: Beschluss
des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz
1979, das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Richter-
und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Land- und forstwirtschaftliche
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz,
das Landesvertragslehrpersonengesetz 1966, das Bundes-Personalvertretungsgesetz,
das Rechtspraktikantengesetz und das Auslandszulagen- und –hilfeleistungsgesetz geändert sowie ein
Bundesgesetz zur Änderung der Personalstellenverordnung und ein Bundesgesetz zur Umsetzung der
Richtlinie 2014/54/EU über Maßnahmen zur Erleichterung der
Ausübung der Rechte, die Arbeitnehmern im Rahmen der Freizügigkeit zustehen (UmsetzungsG-RL 2014/54/EU) erlassen
werden (2. Dienstrechts-Novel-
le 2016) (1348 d.B. und 1368 d.B. sowie 9673/BR d.B. und
9722/BR d.B.)
Abstimmung: Berichterstattung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen (mit Stimmeneinhelligkeit).
TO-Punkt 22: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz, das Bundesverwaltungsgerichtsgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953 geändert werden (1255 d.B. und 1369 d.B. sowie 9723/BR d.B.)
Abstimmung: Berichterstattung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen (mit Stimmeneinhelligkeit).
TO-Punkt 23: Beschluss des Nationalrates vom 14. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz über den weiteren Ausbau ganztägiger Schulformen (Bildungsinvestitionsgesetz) (1360 d.B. und 1408 d.B. sowie 9720/BR d.B.)
Abstimmung: Berichterstattung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen (mit Stimmenmehrheit).
TO-Punkt 24: Nationaler Bildungsbericht Österreich 2015 (III-592-BR/2016 d.B. sowie 9721/BR d.B.)
Abstimmung: Berichterstattung: Antrag, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen, wird angenommen (mit Stimmenmehrheit).
TO-Punkt 25: Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Sanierung des Parlamentsgebäudes (Parlamentsgebäudesanierungsgesetz, PGSG) geändert wird (1906/A und 1401 d.B. sowie 9719/BR d.B.)
Abstimmung: Berichterstattung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen (mit Stimmeneinhelligkeit).
Es liegt ein schriftliches Verlangen von fünf Mitgliedern des Bundesrates gemäß § 64 Absatz 2 GO-BR vor, das Amtliche Protokoll hinsichtlich der Tagesordnungspunkte 1 bis 25 zu verlesen (Beilage B).“
*****
Erheben sich Einwendungen gegen die Fassung oder den Inhalt dieses Teiles des Amtlichen Protokolls? – Dies ist nicht der Fall.
Dieser Teil des Amtlichen Protokolls gilt daher gemäß § 64 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Bundesrates mit Schluss dieser Sitzung als genehmigt.
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Ich gebe noch bekannt, dass seit der letzten beziehungsweise in der heutigen Sitzung insgesamt eine Anfrage, 3197/J-BR/2016, eingebracht wurde.
Eingelangt ist der Entschließungsantrag 223/A(E)-BR/2016 der Bundesräte Reinhard Todt, Edgar Mayer, Mag. Nicole Schreyer, Kolleginnen und Kollegen betreffend wirkungsvolle Maßnahmen gegen Hasskriminalität im Internet, der dem Justizausschuss zugewiesen wird.
*****
Die Einberufung der nächsten Sitzung des Bundesrates wird auf schriftlichem Wege erfolgen. Als Sitzungstermin wird Donnerstag, der 16. Februar 2017, 9 Uhr, in Aussicht genommen.
Für die Tagesordnung dieser Sitzung kommen insbesondere jene Beschlüsse in Betracht, die der Nationalrat bis dahin verabschiedet haben wird, soweit diese dem Einspruchsrecht beziehungsweise dem Zustimmungsrecht des Bundesrates unterliegen.
Die Ausschussvorberatungen sind für Dienstag, den 14. Februar 2017, 14 Uhr, vorgesehen.
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Bevor die Sitzung geschlossen wird, darf ich Herrn Bundesratspräsidenten Lindner noch einmal das Wort erteilen. (Allgemeiner Beifall.)
Präsident Mario Lindner: Wir haben uns das bewusst so aufgeteilt, denn schneller als der Ernst kann man wirklich nicht sprechen. Herzliche Gratulation! Unglaublich! (Bundesrätin Mühlwerth: Sehr gut gemacht, ja!)
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Abschließend möchte ich mich noch einmal ganz kurz zu Wort melden, weil der Ernst jetzt wirklich so schnell war. Ich möchte noch einmal die Gelegenheit nutzen, mich ganz herzlich
bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Bundesratsdirektion zu bedanken. Ihr habt wirklich großartige Arbeit geleistet. Herzlichen Dank. (Allgemeiner Beifall.)
Ich darf mich ganz herzlich bei meiner Vizepräsidentin beziehungsweise beim Vizepräsidenten bedanken und auch gleichzeitig meine Gratulation zur einstimmigen Wahl kundtun. Es freut mich, dass wenigstens da eine Kontinuität vorhanden ist und ihr weitermachen könnt.
Ganz herzlich bedanke ich mich wirklich noch einmal bei den Fraktionen! Ich weiß, dass mich die FPÖ heute, was den Ordnungsruf betrifft, sehr gefordert hat; ich habe mir das wirklich ganz gut angeschaut.
Auf eines in dieser Kammer bin ich wirklich schon sehr stolz, denn es zeigt die Disziplin, glaube ich, dass wir in meiner Amtszeit keinen Ordnungsruf gegeben haben! Darauf bin ich persönlich schon stolz, weil das nämlich wirklich ein großartiges Zeichen dieser Kammer ist.
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich wünsche euch schöne Weihnachten und alles, alles Gute für 2017! Es war mir eine Ehre. Habe die Ehre! (Anhaltender allgemeiner Beifall.)
*****
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Meine Damen und Herren! Danke auch an den scheidenden Präsidenten Mario Lindner für das halbe Jahr in voller Aktivität! Wir freuen uns dann auch auf Sonja Ledl-Rossmann im nächsten halben Jahr.
Ich darf Ihnen vom Präsidium aus frohe Weihnachten, gesegnete Weihnachten und viel Gesundheit, Glück und Erfolg für 2017 wünschen!
Kommen Sie gut heim!
Die Sitzung ist geschlossen.
Schluss der Sitzung: 20.08 Uhr
|
Impressum: Parlamentsdirektion 1017 Wien |