
Stenographisches Protokoll

866. Sitzung des Bundesrates der Republik Österreich
Donnerstag, 6. April 2017

Stenographisches Protokoll

866. Sitzung des Bundesrates der Republik Österreich
Donnerstag, 6. April 2017
866. Sitzung des Bundesrates der Republik Österreich
Donnerstag, 6. April 2017
Dauer der Sitzung
Donnerstag, 6. April 2017: 9.02 – 19.31 Uhr
*****
Tagesordnung
1. Punkt: EU-Vorhaben des Bundesministeriums für Familien und Jugend 2017
2. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Bundeshaushaltsgesetz 2013, das Bundesfinanzierungsgesetz, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz und das Notarversicherungsgesetz 1972 geändert werden
3. Punkt: Abkommen zwischen der Republik Österreich und Jersey zur Beendigung des Abkommens über die Besteuerung von Zinserträgen
4. Punkt: Abkommen zwischen der Republik Österreich und Guernsey zur Beendigung des Abkommens über die Besteuerung von Zinserträgen
5. Punkt: Abkommen zwischen der Republik Österreich und Isle of Man zur Beendigung des Abkommens über die Besteuerung von Zinserträgen
6. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Flugabgabegesetz geändert wird
7. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetz geändert wird
8. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Ausfuhrförderungsgesetz geändert wird
9. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das IAKW-Finanzierungsgesetz geändert wird
10. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Tierschutzgesetz geändert wird
11. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz geändert wird
12. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Gesundheitsberuferegister-Gesetz, das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz und das MTD-Gesetz geändert werden (GBRG-Novelle 2017)
13. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Apothekerkammergesetz 2001 geändert wird
14. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz geändert wird
15. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das E-Government-Gesetz, das Zustellgesetz, das Bundesgesetz über die Ausstellung der Apostille nach dem Übereinkommen zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von der Beglaubigung, die Bundesabgabenordnung, das Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz 2010, das Neugründungs-Förderungsgesetz, das Unternehmensserviceportalgesetz, das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, das GmbH-Gesetz, das Notariatstarifgesetz, das Gerichtsgebührengesetz, das Arbeitszeitgesetz, das Arbeitsruhegesetz, das Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz, das Bäckereiarbeiter/innengesetz 1996, das Mutterschutzgesetz 1979, das Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz 1987, das Gleichbehandlungsgesetz, das Heimarbeitsgesetz 1960, das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, das Behinderteneinstellungsgesetz, das Gesundheitstelematikgesetz 2012, das Arzneimittelgesetz, das Rohrleitungsgesetz und das Kraftfahrgesetz 1967 geändert werden (Deregulierungsgesetz 2017)
16. Punkt: Bundesgesetz über die Grundsätze der Deregulierung (Deregulierungsgrundsätzegesetz)
17. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Erwachsenenvertretungsrecht und das Kuratorenrecht im Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch geregelt werden und das Ehegesetz, das Eingetragene Partnerschaft-Gesetz, das Namensänderungsgesetz, das Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten, das Außerstreitgesetz, die Zivilprozessordnung, die Jurisdiktionsnorm, das Rechtspflegergesetz, das Vereinssachwalter-, Patientenanwalts- und Bewohnervertretergesetz, das Unterbringungsgesetz, das Heimaufenthaltsgesetz, die Notariatsordnung, die Rechtsanwaltsordnung, das Gerichtsgebührengesetz und das Gerichtliche Einbringungsgesetz geändert werden (2. Erwachsenenschutz-Gesetz – 2. ErwSchG)
18. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Kartellgesetz 2005, das Wettbewerbsgesetz und das Bundesgesetz zur Verbesserung der Nahversorgung und der Wettbewerbsbedingungen geändert werden (Kartell- und Wettbewerbsrechts-Änderungsgesetz 2017 – KaWeRÄG 2017)
19. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Firmenbuchgesetz, das EU-Verschmelzungsgesetz und das Gerichtsgebührengesetz geändert werden (BRIS-Umsetzungsgesetz – BRIS-UmsG)
20. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Gerichtsorganisationsgesetz geändert wird
21. Punkt: Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen (Pauschalreisegesetz – PRG) erlassen wird sowie das Konsumentenschutzgesetz, das Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz und das Verbraucherbehörden-Kooperationsgesetz geändert werden
22. Punkt: Zweites Zusatzprotokoll zum Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen
23. Punkt: Erklärung der Republik Österreich über die Annahme der Beitritte Albaniens, Andorras, Armeniens, Marokkos, der Russischen Föderation, der Seychellen, Singapurs zum Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung
24. Punkt: Erklärung der Republik Österreich über die Annahme der Beitritte Kasachstans, Perus und der Republik Korea zum Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung
25. Punkt: Jahresvorschau des BMJ auf Grundlage des Legislativ- und Arbeitsprogramms der Europäischen Kommission für 2017 sowie des Achtzehnmonatsprogramms des niederländischen, slowakischen und maltesischen Ratsvorsitzes
26. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Wasserrechtsgesetz 1959, das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000, das Immissionsschutzgesetz – Luft, das Klimaschutzgesetz, das Umweltförderungsgesetz, das Bundesluftreinhaltegesetz, das Altlastensanierungsgesetz, das Chemikaliengesetz 1996, das Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz, das Pflanzenschutzgesetz 2011, das Düngemittelgesetz 1994, das Futtermittelgesetz 1999, das BFW-Gesetz, das Rebenverkehrsgesetz 1996, das Produktenbörsegesetz, das Bundesgesetz über die Bundesämter für Landwirtschaft und die landwirtschaftlichen Bundesanstalten, das Klima- und Energiefondsgesetz 2007 und das Spanische Hofreitschule-Gesetz geändert und das Bundesgesetz zur Schaffung eines Gütezeichens für Holz und Holzprodukte aus nachhaltiger Nutzung, das Börsesensale-Gesetz und das Bundesgesetz über das Bundesamt für Wasserwirtschaft aufgehoben werden (Verwaltungsreformgesetz BMLFUW)
27. Punkt: Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und dem Ministerrat Bosnien und Herzegowinas über die wissenschaftlich-technologische Zusammenarbeit
28. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Berufsreifeprüfungsgesetz und das Prüfungstaxengesetz geändert werden
29. Punkt: Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein über Gleichwertigkeiten im Bereich der Reifezeugnisse und des Hochschulwesens
30. Punkt: Vertrag zwischen der Republik Österreich, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über die grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit
31. Punkt: Vereinbarung zwischen der Regierung der Republik Österreich, der Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft sowie der Regierung des Fürstentums Liechtenstein über die Durchführung von Artikel 13 Abs. 1 lit. c und Kapitel VI des Vertrages zwischen der Republik Österreich, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über die grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit
32. Punkt: Bericht des Bundesministers für Inneres an das österreichische Parlament Legislativ- und Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für 2017 Achtzehnmonatsprogramm des niederländischen, slowakischen und maltesischen Vorsitzes des Rates der Europäischen Union
33. Punkt: Bundesgesetz über die Marktüberwachung von Funkanlagen (Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz – FmaG 2016)
*****
Inhalt
Bundesrat
Angelobung der Bundesrätin Jutta Arztmann ............................................................ 16
Schreiben des Bundesministers für Finanzen gemäß Artikel 50 Abs. 5 Bundes-Verfassungsgesetz betreffend Erteilung der Vollmacht zur Aufnahme von Verhandlungen über ein Multilaterales Übereinkommen zur Umsetzung von Maßnahmen betreffend Steuerabkommen zur Vermeidung der Verminderung von Bemessungsgrundlagen und Gewinnverlagerung .............................................................. 39
Schreiben des Generalsekretärs für auswärtige Angelegenheiten gemäß Artikel 50 Abs. 5 Bundes-Verfassungsgesetz betreffend Erteilung der Vollmacht zur Aufnahme von Verhandlungen über die Änderung des Abkommens zwischen der Regierung der Republik Österreich und dem Ministerrat der Republik Albanien über die Zusammenarbeit auf den Gebieten der Kultur, der Bildung und der Wissenschaft durch den Herrn Bundespräsidenten ......................................................................................................... 47
Schreiben des Bundeskanzlers betreffend Nominierung eines Mitgliedes in den Ausschuss der Regionen gemäß Artikel 23c Abs. 5 Bundes-Verfassungsgesetz 50
Schreiben des Bundeskanzlers betreffend Nominierung eines Mitgliedes in den Verwaltungsrat der Europäischen Investitionsbank Artikel 23c Abs. 5 Bundes-Verfassungsgesetz ............ 53
Wortmeldungen zur Geschäftsbehandlung:
Monika Mühlwerth ...................................................................................................... 190
Edgar Mayer ................................................................................................................ 191
Verlesung der vorgesehenen Fassung eines Teiles des Amtlichen Protokolls dieser Sitzung durch Vizepräsidentin Ingrid Winkler ................................................................................. 197
Genehmigung des verlesenen Teiles des Amtlichen Protokolls ................................ 198
Personalien
Verhinderungen .............................................................................................................. 16
Aktuelle Stunde (51.)
Thema: „Rauchen ab 18 – Gesunde Kinder von heute sind gesunde Erwachsene von morgen“ ............................................................................................................................... 16
Redner/Rednerinnen:
Angela Stöckl-Wolkerstorfer ...................................................................................... 17
Renate Anderl ............................................................................................................... 19
Monika Mühlwerth ........................................................................................................ 22
David Stögmüller .......................................................................................................... 23
Bundesministerin MMag. Dr. Sophie Karmasin ................................................ 26, 32
Edgar Mayer .................................................................................................................. 27
Mag. Daniela Gruber-Pruner ....................................................................................... 29
Arnd Meißl ..................................................................................................................... 30
Mag. Nicole Schreyer ................................................................................................... 32
Bundesregierung
Schreiben des Bundeskanzleramtes betreffend
Aufenthalt von Mitgliedern
der Bundesregierung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Uni-
on ................................................................................................................. 35,
36, 37, 38
Nationalrat
Beschlüsse und Gesetzesbeschlüsse ............................................................................ 56
Ausschüsse
Zuweisungen ......................................................................................................... 33, 198
Verhandlungen
1. Punkt: EU-Vorhaben des Bundesministeriums für Familien und Jugend 2017 (III-603-BR/2017 d.B. sowie 9751/BR d.B.) ................................................................................................................. 56
Berichterstatter: Ing. Andreas Pum .............................................................................. 56
Redner/Rednerinnen:
Arnd Meißl ..................................................................................................................... 56
Sandra Kern .................................................................................................................. 59
Mag. Daniela Gruber-Pruner ....................................................................................... 60
David Stögmüller .......................................................................................................... 62
Bundesministerin MMag. Dr. Sophie Karmasin ....................................................... 65
Annahme des Antrages des Berichterstatters, den Bericht III-603-BR/2017 d.B. zur Kenntnis zu nehmen ............................................................................................................................... 67
2. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundeshaushaltsgesetz 2013, das Bundesfinanzierungsgesetz, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz und das Notarversicherungsgesetz 1972 geändert werden (1514 d.B. und 1566 d.B. sowie 9756/BR d.B.) ...................................................................................... 67
Berichterstatter: Peter Heger ........................................................................................ 68
Redner/Rednerinnen:
Dr. Heidelinde Reiter .................................................................................................... 68
Edgar Mayer .................................................................................................................. 69
Ewald Lindinger ........................................................................................................... 70
Ing. Bernhard Rösch .................................................................................................... 71
Bundesminister Dr. Johann Georg Schelling ........................................................... 73
Mag. Gerald Zelina ....................................................................................................... 75
Annahme des Antrages des Berichterstatters, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ..................................................................................................... 76
Gemeinsame Beratung über
3. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und Jersey zur Beendigung des Abkommens über die Besteuerung von Zinserträgen (1500 d.B. und 1558 d.B. sowie 9757/BR d.B.) 76
Berichterstatter: Peter Heger ........................................................................................ 76
4. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und Guernsey zur Beendigung des Abkommens über die Besteuerung von Zinserträgen (1501 d.B. und 1559 d.B. sowie 9758/BR d.B.) ............................................................................... 76
Berichterstatter: Peter Heger ........................................................................................ 76
5. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und Isle of Man zur Beendigung des Abkommens über die Besteuerung von Zinserträgen (1502 d.B. und 1560 d.B. sowie 9759/BR d.B.) ............................................................. 76
Berichterstatter: Peter Heger ........................................................................................ 76
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 3, 1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben und 2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen ............... 78
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 4, 1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben und 2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen ............... 78
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 5, 1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben und 2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen ............... 78
6. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Flugabgabegesetz geändert wird (1524 d.B. und 1561 d.B. sowie 9760/BR d.B.) ........ 79
Berichterstatter: René Pfister ........................................................................................ 79
Redner/Rednerinnen:
Christoph Längle .......................................................................................................... 79
Christian Poglitsch ...................................................................................................... 80
Mag. Nicole Schreyer ................................................................................................... 81
Peter Heger ................................................................................................................... 83
Bundesminister Dr. Johann Georg Schelling ........................................................... 84
Annahme des Antrages des Berichterstatters, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ..................................................................................................... 86
Gemeinsame Beratung über
7. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetz geändert wird (2050/A und 1562 d.B. sowie 9761/BR d.B.) ............................................................................................................................... 86
Berichterstatter: René Pfister ........................................................................................ 86
8. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Ausfuhrförderungsgesetz geändert wird (2049/A und 1563 d.B. sowie 9762/BR d.B.) 86
Berichterstatter: René Pfister ........................................................................................ 86
Redner/Rednerinnen:
Dr. Heidelinde Reiter .................................................................................................... 87
Ing. Eduard Köck .......................................................................................................... 88
Peter Heger ................................................................................................................... 89
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 7, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................... 90
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 8, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................... 90
9. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das IAKW-Finanzierungsgesetz geändert wird (1414 d.B. und 1564 d.B. sowie 9763/BR d.B.) 90
Berichterstatter: René Pfister ........................................................................................ 91
Redner/Rednerinnen:
Dr. Heidelinde Reiter .................................................................................................... 91
Anneliese Junker .......................................................................................................... 91
Peter Heger ................................................................................................................... 92
Gerd Krusche ............................................................................................................... 93
Bundesminister Dr. Johann Georg Schelling ........................................................... 94
Annahme des Antrages des Berichterstatters, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ..................................................................................................... 95
10. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Tierschutzgesetz geändert wird (1515 d.B. und 1544 d.B. sowie 9749/BR d.B. und 9773/BR d.B.) ............................................................................................................................... 95
Berichterstatterin: Mag. Daniela Gruber-Pruner ......................................................... 95
Redner/Rednerinnen:
Thomas Schererbauer ................................................................................................. 95
Adelheid Ebner ............................................................................................................. 97
Mag. Nicole Schreyer ................................................................................................... 99
Martin Preineder ......................................................................................................... 100
Bundesministerin Dr. Pamela Rendi-Wagner, MSc ............................................... 102
Annahme des Antrages der Berichterstatterin, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................................................... 104
11. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz geändert wird (1520 d.B. und 1547 d.B. sowie 9774/BR d.B.) ............................................................................................................... 104
Berichterstatterin: Mag. Daniela Gruber-Pruner ....................................................... 104
Redner/Rednerinnen:
Adelheid Ebner ........................................................................................................... 104
Ing. Eduard Köck ........................................................................................................ 105
Christoph Längle ........................................................................................................ 107
Annahme des Antrages der Berichterstatterin, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................................................... 108
12. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Gesundheitsberuferegister-Gesetz, das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz und das MTD-Gesetz geändert werden (GBRG-Novelle 2017) (1518 d.B. und 1548 d.B. sowie 9775/BR d.B.) 108
Berichterstatterin: Adelheid Ebner ............................................................................. 108
Redner/Rednerinnen:
Gerd Krusche ............................................................................................................. 108
Mag. Daniela Gruber-Pruner ..................................................................................... 109
Angela Stöckl-Wolkerstorfer .................................................................................... 109
David Stögmüller ........................................................................................................ 111
Gregor Hammerl ......................................................................................................... 111
Bundesministerin Dr. Pamela Rendi-Wagner, MSc ............................................... 113
Annahme des Antrages der Berichterstatterin, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................................................... 114
Gemeinsame Beratung über
13. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Apothekerkammergesetz 2001 geändert wird (1467 d.B. und 1549 d.B. sowie 9776/BR d.B.) 114
Berichterstatterin: Adelheid Ebner ............................................................................. 114
14. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz geändert wird (2033/A und 1550 d.B. sowie 9750/BR d.B. und 9777/BR d.B.) ............................................................................................................... 114
Berichterstatterin: Adelheid Ebner ............................................................................. 114
Redner/Rednerinnen:
Rosa Ecker .................................................................................................................. 115
Mag. Daniela Gruber-Pruner ..................................................................................... 116
Dr. Andreas Köll ......................................................................................................... 116
Dr. Heidelinde Reiter .................................................................................................. 117
Bundesministerin Dr. Pamela Rendi-Wagner, MSc ............................................... 118
Annahme des Antrages der Berichterstatterin zu Punkt 13, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................. 119
Annahme des Antrages der Berichterstatterin zu Punkt 14, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................. 120
Gemeinsame Beratung über
15. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das E-Government-Gesetz, das Zustellgesetz, das Bundesgesetz über die Ausstellung der Apostille nach dem Übereinkommen zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von der Beglaubigung, die Bundesabgabenordnung, das Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz 2010, das Neugründungs-Förderungsgesetz, das Unternehmensserviceportalgesetz, das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, das GmbH-Gesetz, das Notariatstarifgesetz, das Gerichtsgebührengesetz, das Arbeitszeitgesetz, das Arbeitsruhegesetz, das Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz, das Bäckereiarbeiter/innengesetz 1996, das Mutterschutzgesetz 1979, das Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz 1987, das Gleichbehandlungsgesetz, das Heimarbeitsgesetz 1960, das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, das Behinderteneinstellungsgesetz, das Gesundheitstelematikgesetz 2012, das Arzneimittelgesetz, das Rohrleitungsgesetz und das Kraftfahrgesetz 1967 geändert werden (Deregulierungsgesetz 2017) (1457 d.B. und 1569 d.B. sowie 9747/BR d.B. und 9752/BR d.B.) ........................................................................................................ 120
Berichterstatterin: Sandra Kern .................................................................................. 120
16. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz über die Grundsätze der Deregulierung (Deregulierungsgrundsätzegesetz) (1503 d.B. und 1570 d.B. sowie 9753/BR d.B.) ............................................................................................................................. 120
Berichterstatterin: Sandra Kern .................................................................................. 120
Redner/Rednerinnen:
Peter Samt ................................................................................................................... 121
Wolfgang Beer ............................................................................................................ 122
Dr. Heidelinde Reiter .................................................................................................. 124
Dr. Magnus Brunner, LL.M ........................................................................................ 125
Annahme des Antrages der Berichterstatterin zu Punkt 15, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................. 127
Annahme des Antrages der Berichterstatterin zu Punkt 16, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................. 127
17. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Erwachsenenvertretungsrecht und das Kuratorenrecht im Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch geregelt werden und das Ehegesetz, das Eingetragene Partnerschaft-Gesetz, das Namensänderungsgesetz, das Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten, das Außerstreitgesetz, die Zivilprozessordnung, die Jurisdiktionsnorm, das Rechtspflegergesetz, das Vereinssachwalter-, Patientenanwalts- und Bewohnervertretergesetz, das Unterbringungsgesetz, das Heimaufenthaltsgesetz, die Notariatsordnung, die Rechtsanwaltsordnung, das Gerichtsgebührengesetz und das Gerichtliche Einbringungsgesetz geändert werden (2. Erwachsenenschutz-Gesetz – 2. ErwSchG) (1461 d.B. und 1528 d.B. sowie 9764/BR d.B.) ............................................................................................................................. 127
Berichterstatter: Günther Novak ................................................................................. 127
Redner/Rednerinnen:
Gregor Hammerl ......................................................................................................... 128
Martin Weber ............................................................................................................... 130
Mag. Michael Raml ..................................................................................................... 132
Mag. Dr. Ewa Dziedzic ............................................................................................... 133
Bundesminister Dr. Wolfgang Brandstetter ........................................................... 134
Annahme des Antrages des Berichterstatters, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................................................... 137
Gemeinsame Beratung über
18. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Kartellgesetz 2005, das Wettbewerbsgesetz und das Bundesgesetz zur Verbesserung der Nahversorgung und der Wettbewerbsbedingungen geändert werden (Kartell- und Wettbewerbsrechts-Änderungsgesetz 2017 – KaWeRÄG 2017) (1522 d.B. und 1529 d.B. sowie 9765/BR d.B.) .............................. 137
Berichterstatter: Günther Novak ................................................................................. 137
19. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Firmenbuchgesetz, das EU-Verschmelzungsgesetz und das Gerichtsgebührengesetz geändert werden (BRIS-Umsetzungsgesetz – BRIS-UmsG) (1517 d.B. und 1530 d.B. sowie 9766/BR d.B.) 137
Berichterstatter: Günther Novak ................................................................................. 137
Redner/Rednerinnen:
Gerhard Schödinger .................................................................................................. 138
Martin Weber ............................................................................................................... 139
Mag. Michael Raml ..................................................................................................... 140
Mag. Dr. Ewa Dziedzic ............................................................................................... 140
Bundesminister Dr. Wolfgang Brandstetter ........................................................... 141
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 18, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................. 142
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 19, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................. 142
20. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Gerichtsorganisationsgesetz geändert wird (1504 d.B. und 1531 d.B. sowie 9767/BR d.B.) 142
Berichterstatter: Günther Novak ................................................................................. 142
Redner/Rednerinnen:
Dr. Magnus Brunner, LL.M ........................................................................................ 143
Mag. Susanne Kurz .................................................................................................... 143
Mag. Michael Raml ..................................................................................................... 144
Bundesminister Dr. Wolfgang Brandstetter ........................................................... 144
Annahme des Antrages des Berichterstatters, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................................................... 145
21. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen (Pauschalreisegesetz – PRG) erlassen wird sowie das Konsumentenschutzgesetz, das Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz und das Verbraucherbehörden-Kooperationsgesetz geändert werden (1513 d.B. und 1533 d.B. sowie 9768/BR d.B.) ............................................................................................................................. 145
Berichterstatter: Martin Weber .................................................................................... 146
Redner/Rednerinnen:
Ing. Bernhard Rösch .................................................................................................. 146
Armin Forstner, MPA ................................................................................................. 147
Günther Novak ........................................................................................................... 148
Mag. Dr. Ewa Dziedzic ............................................................................................... 149
Bundesminister Dr. Wolfgang Brandstetter ........................................................... 150
Annahme des Antrages des Berichterstatters, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................................................... 150
Gemeinsame Beratung über
22. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend Zweites Zusatzprotokoll zum Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen (1470 d.B. und 1536 d.B. sowie 9769/BR d.B.) ............................................................................................................... 150
Berichterstatter: Martin Weber .................................................................................... 151
23. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend Erklärung der Republik Österreich über die Annahme der Beitritte Albaniens, Andorras, Armeniens, Marokkos, der Russischen Föderation, der Seychellen, Singapurs zum Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung (1459 d.B. und 1534 d.B. sowie 9770/BR d.B.) ................................................... 151
Berichterstatter: Martin Weber .................................................................................... 151
24. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend Erklärung der Republik Österreich über die Annahme der Beitritte Kasachstans, Perus und der Republik Korea zum Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung (1476 d.B. und 1535 d.B. sowie 9771/BR d.B.) ............................................................................................................................. 151
Berichterstatter: Martin Weber .................................................................................... 151
Redner/Rednerinnen:
Mag. Ernst Gödl .......................................................................................................... 152
Mag. Susanne Kurz .................................................................................................... 154
Werner Herbert ........................................................................................................... 155
Mag. Dr. Ewa Dziedzic ............................................................................................... 155
Bundesminister Dr. Wolfgang Brandstetter ........................................................... 156
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 22, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................. 157
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 23, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................. 157
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 24, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................. 157
25. Punkt: Jahresvorschau des BMJ auf Grundlage des Legislativ- und Arbeitsprogramms der Europäischen Kommission für 2017 sowie des Achtzehnmonatsprogramms des niederländischen, slowakischen und maltesischen Ratsvorsitzes (III-611-BR/2017 d.B. sowie 9772/BR d.B.) .................... 157
Berichterstatter: Martin Weber .................................................................................... 157
Redner/Rednerinnen:
Werner Herbert ........................................................................................................... 158
Armin Forstner, MPA ................................................................................................. 160
Mag. Susanne Kurz .................................................................................................... 161
Mag. Dr. Ewa Dziedzic ............................................................................................... 162
Bundesminister Dr. Wolfgang Brandstetter ........................................................... 163
Annahme des Antrages des Berichterstatters, den Bericht III-611-BR/2017 d.B. zur Kenntnis zu nehmen ............................................................................................................................. 165
26. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Wasserrechtsgesetz 1959, das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000, das Immissionsschutzgesetz – Luft, das Klimaschutzgesetz, das Umweltförderungsgesetz, das Bundesluftreinhaltegesetz, das Altlastensanierungsgesetz, das Chemikaliengesetz 1996, das Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz, das Pflanzenschutzgesetz 2011, das Düngemittelgesetz 1994, das Futtermittelgesetz 1999, das BFW-Gesetz, das Rebenverkehrsgesetz 1996, das Produktenbörsegesetz, das Bundesgesetz über die Bundesämter für Landwirtschaft und die landwirtschaftlichen Bundesanstalten, das Klima- und Energiefondsgesetz 2007 und das Spanische Hofreitschule-Gesetz geändert und das Bundesgesetz zur Schaffung eines Gütezeichens für Holz und Holzprodukte aus nachhaltiger Nutzung, das Börsesensale-Gesetz und das Bundesgesetz über das Bundesamt für Wasserwirtschaft aufgehoben werden (Verwaltungsreformgesetz BMLFUW) (1456 d.B. und 1568 d.B. sowie 9748/BR d.B. und 9754/BR d.B.) 165
Berichterstatterin: Sandra Kern .................................................................................. 166
Redner/Rednerinnen:
Peter Samt ................................................................................................................... 166
Wolfgang Beer ............................................................................................................ 167
Mag. Nicole Schreyer ................................................................................................. 168
Martin Preineder ......................................................................................................... 170
Bundesminister Dipl.-Ing. Andrä Rupprechter ....................................................... 171
Annahme des Antrages der Berichterstatterin, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................................................... 173
27. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und dem Ministerrat Bosnien und Herzegowinas über die wissenschaftlich-technologische Zusammenarbeit (1370 d.B. und 1505 d.B. sowie 9755/BR d.B.) ...... 173
Berichterstatterin: Anneliese Junker .......................................................................... 173
Redner/Rednerinnen:
Ing. Andreas Pum ....................................................................................................... 173
Ana Blatnik .................................................................................................................. 174
Annahme des Antrages der Berichterstatterin, 1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben und 2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen ................................................... 175
28. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Berufsreifeprüfungsgesetz und das Prüfungstaxengesetz geändert werden (2017/A und 1580 d.B. sowie 9778/BR d.B.) ............................................................................................................... 175
Berichterstatter: Hubert Koller, MA ............................................................................ 175
Redner/Rednerinnen:
Elisabeth Grimling ..................................................................................................... 175
Sandra Kern ................................................................................................................ 176
Rosa Ecker .................................................................................................................. 177
David Stögmüller ........................................................................................................ 177
Bundesministerin Mag. Dr. Sonja Hammerschmid ................................................ 178
Annahme des Antrages des Berichterstatters, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................................................... 179
29. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein über Gleichwertigkeiten im Bereich der Reifezeugnisse und des Hochschulwesens (1512 d.B. und 1581 d.B. sowie 9779/BR d.B.) ............................. 179
Berichterstatterin: Elisabeth Grimling ........................................................................ 179
Redner/Rednerinnen:
Hubert Koller, MA ....................................................................................................... 180
Josef Saller ................................................................................................................. 180
Rosa Ecker .................................................................................................................. 181
David Stögmüller ........................................................................................................ 181
Annahme des Antrages der Berichterstatterin, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................................................... 182
Gemeinsame Beratung über
30. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend Vertrag zwischen der Republik Österreich, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über die grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit (1469 d.B. und 1571 d.B. sowie 9780/BR d.B.) ............................................................................................................................. 182
Berichterstatter: Armin Forstner, MPA ...................................................................... 182
31. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend Vereinbarung zwischen der Regierung der Republik Österreich, der Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft sowie der Regierung des Fürstentums Liechtenstein über die Durchführung von Artikel 13 Abs. 1 lit. c und Kapitel VI des Vertrages zwischen der Republik Österreich, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über die grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit (1471 d.B. und 1572 d.B. sowie 9781/BR d.B.) ............................................................................................................................. 182
Berichterstatter: Armin Forstner, MPA ...................................................................... 182
Redner/Rednerinnen:
Mag. Dr. Ewa Dziedzic ............................................................................................... 183
Peter Oberlehner ........................................................................................................ 183
Martin Weber ............................................................................................................... 185
Werner Herbert ........................................................................................................... 186
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 30, 1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben und 2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen ............. 187
Annahme des Antrages des Berichterstatters zu Punkt 31, 1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben und 2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen ............. 187
32. Punkt: Bericht des Bundesministers für Inneres an das österreichische Parlament Legislativ- und Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für 2017 Achtzehnmonatsprogramm des niederländischen, slowakischen und maltesischen Vorsitzes des Rates der Europäischen Union (III-610-BR/2017 d.B. sowie 9782/BR d.B.) ............................................................................................................... 188
Berichterstatter: Armin Forstner, MPA ...................................................................... 188
Redner/Rednerinnen:
Werner Herbert ........................................................................................................... 188
Gerhard Schödinger .................................................................................................. 189
Mag. Dr. Ewa Dziedzic ............................................................................................... 191
René Pfister ................................................................................................................ 192
Annahme des Antrages des Berichterstatters, den Bericht III-610-BR/2017 d.B. zur Kenntnis zu nehmen ............................................................................................................................. 193
33. Punkt: Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz über die Marktüberwachung von Funkanlagen (Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz – FmaG 2016) (1460 d.B. und 1573 d.B. sowie 9783/BR d.B.) 193
Berichterstatterin: Renate Anderl ............................................................................... 193
Redner/Rednerinnen:
David Stögmüller ........................................................................................................ 193
Hubert Koller, MA ....................................................................................................... 195
Ing. Andreas Pum ....................................................................................................... 195
Peter Samt ................................................................................................................... 196
Annahme des Antrages der Berichterstatterin, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben ................................................................................................... 197
Eingebracht wurden
Anträge der Bundesräte
Mag. Michael Raml, Kolleginnen und Kollegen betreffend Artikel 1 Charta der Grundrechte der Europäischen Union „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen“ im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Vorbeugung von sexuellen Übergriffen auf minderjährige, wehrlose sowie psychisch beeinträchtigte Personen (225/A(E)-BR/2017)
Thomas Schererbauer, Kolleginnen und Kollegen betreffend Finanzierung und Koordinierung einer Ehrungsstätte für Sportler (226/A(E)-BR/2017)
Mag. Michael Raml, Kolleginnen und Kollegen betreffend die Angleichung der Strafobergrenzen für junge Erwachsene an jene bei Erwachsenen (227/A(E)-BR/2017)
Peter Samt, Kolleginnen und Kollegen betreffend die Straffung und Entbürokratisierung der Verfahren nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 (228/A(E)-BR/2017)
Werner Herbert, Kolleginnen und Kollegen betreffend Rufnummernunterdrückung bei der Exekutive (229/A(E)-BR/2017)
Arnd Meißl, Kolleginnen und Kollegen betreffend Verankerung des Prinzips „Schulsprache Deutsch“ (230/A(E)-BR/2017)
Gerd Krusche, Kolleginnen und Kollegen betreffend unverzüglichen Ausstieg aus dem EURATOM-Vertrag (231/A(E)-BR/2017)
Monika Mühlwerth, Kolleginnen und Kollegen betreffend Wechsel von Schulstufen (232/A(E)-BR/2017)
Monika Mühlwerth, Kolleginnen und Kollegen betreffend Deutsch-Klassen für Schüler ohne ausreichende Kenntnis der Unterrichtssprache (233/A(E)-BR/2017)
Rosa Ecker, Kolleginnen und Kollegen betreffend Computertomografie(CT)- oder Magnetresonanztomografie(MRT)-Untersuchungen für Sozialversicherte (234/A(E)-BR/2017)
Thomas Schererbauer, Kolleginnen und Kollegen betreffend Erhalt des Botanischen Gartens Schönbrunn sowie des freien Eintritts in diesen (235/A(E)-BR/2017)
Christoph Längle, Kolleginnen und Kollegen betreffend Anpassung des Einkommens von Militär-Fluglotsen und Militär-Flugberatern an den Marktwert (236/A(E)-BR/2017)
Anfragen der Bundesräte
Rosa Ecker, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Gesundheit und Frauen betreffend Versorgung mit neonatologischen Intensivbetten in Österreich (3224/J-BR/2017)
Mag. Reinhard Pisec, BA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft betreffend die Entfernung der unter Denkmalschutz gestandenen Präsenzbibliothek und des historischen Lesesaals in der Wirtschaftskammer Wien (3225/J-BR/2017)
Arnd Meißl, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Bildung betreffend Investitionen in Bundesschulen – Standort Mürzzuschlag (3226/J-BR/2017)
Arnd Meißl, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Sonderbetreuungsstelle (SBS) Steinhaus am Semmering (Gemeinde Spital/S.) (3227/J-BR/2017)
Gerd Krusche, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Bildung betreffend Fördermittel für „Sexuelle Bildung“ an Schulen (3228/J-BR/2017)
Christoph Längle, Dr. Magnus Brunner, LL.M, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Bildung betreffend Investitionen in Vorarlberger Schulen (3229/J-BR/2017)
Arnd Meißl, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend PKK-nahe Veranstaltung in der Arbeiterkammer Steiermark (3230/J-BR/2017)
Peter Samt, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Bildung betreffend Schulbuch „Lesen mit Sinn“ über Mehmet und die Moschee (3231/J-BR/2017)
Martin Weber, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend AGM-Planstellen in Halbenrain (3232/J-BR/2017)
Anfragebeantwortung
der Bundesministerin für Gesundheit und Frauen auf die Anfrage der Bundesräte David Stögmüller, Kolleginnen und Kollegen betreffend Berufsregister für Rettungssanitäter/innen (2966/AB-BR/2017 zu 3203/J-BR/2017)
Beginn der Sitzung: 9.02 Uhr
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich eröffne die 866. Sitzung des Bundesrates.
Das Amtliche Protokoll der 865. Sitzung des Bundesrates vom 16. März 2017 ist aufgelegen, unbeanstandet geblieben und gilt daher als genehmigt.
Als verhindert gemeldet sind die Mitglieder des Bundesrates Mag. Klaus Fürlinger, Marianne Hackl, Stefan Schennach, Dr. Dietmar Schmittner und Robert Seeber.
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Das neue Mitglied des Bundesrates, Jutta Arztmann, ist im Hause anwesend; ich werde daher sogleich die Angelobung vornehmen.
Nach Verlesung der Gelöbnisformel durch die Schriftführerin wird die Angelobung mit den Worten „Ich gelobe“ zu leisten sein.
Ich ersuche nun die Schriftführerin um die Verlesung der Gelöbnisformel.
Schriftführerin Ana Blatnik: „Sie werden geloben unverbrüchliche Treue der Republik Österreich, stete und volle Beobachtung der Verfassungsgesetze und aller anderen Gesetze sowie gewissenhafte Erfüllung Ihrer Pflichten.“
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Ich begrüße das neue Mitglied des Bundesrates ganz herzlich in unserer Mitte. (Allgemeiner Beifall. – Das neu angelobte Mitglied des Bundesrates wird von seinen Kolleginnen und Kollegen beglückwünscht.)
*****
Es ist mir ein großes Bedürfnis, mich, bevor wir zur Aktuellen Stunde kommen, bei allen Fraktionen dafür zu bedanken, dass sie die gestrige Enquete zum Thema Pflege mitgetragen haben. Ich bedanke mich vor allem bei jenen, die dabei waren und sich mit eingebracht haben, und bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauses für die Unterstützung und den reibungslosen Ablauf. Ich denke, es war für uns alle eine sehr interessante Enquete mit vielen Impulsen für die Zukunft. – Vielen Dank dafür. (Allgemeiner Beifall.)
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Wir gelangen nun zur Aktuellen Stunde zum Thema
„Rauchen ab 18 – Gesunde Kinder von heute
sind gesunde Erwachsene von morgen“
mit der Frau Bundesministerin für Familien und Jugend, die ich herzlich willkommen heißen darf. (Allgemeiner Beifall.)
In der Präsidialkonferenz wurde Einvernehmen über folgenden Ablauf erzielt:
Zunächst kommt je ein Redner/eine Rednerin pro Fraktion zu Wort, dessen beziehungsweise deren Redezeit jeweils 10 Minuten beträgt. Sodann folgt die Stellungnahme der Frau Bundesministerin, die ebenfalls 10 Minuten nicht überschreiten soll. Danach folgt wiederum je ein Redner/eine Rednerin der Fraktionen sowie anschließend je eine Wort-
meldung der Bundesräte ohne Fraktionszugehörigkeit mit jeweils einer 5-minütigen Redezeit. Zuletzt kann noch eine abschließende Stellungnahme der Frau Bundesministerin erfolgen, die nach Möglichkeit 5 Minuten nicht überschreiten soll.
Als Erste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Stöckl-Wolkerstorfer. Ich erteile es ihr und mache darauf aufmerksam, dass entsprechend der Vereinbarung in der Präsidialkonferenz die Redezeit 10 Minuten beträgt. – Bitte.
9.06
Bundesrätin Angela Stöckl-Wolkerstorfer (ÖVP, Niederösterreich): Hohes Präsidium! Frau Bundesministerin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Vorab ein Wort des Dankes an dich, geschätzte Frau Bundesminister, für deinen Besuch letzten Freitag gemeinsam mit Landesrätin Mag. Barbara Schwarz bei uns im Bezirk Baden. Du hast die erste familienfreundliche Region Österreichs kennengelernt. Zwölf Gemeinden des Triestingtales arbeiten wirklich intensiv und eng zusammen, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern, um das Thema Kinderbetreuung gemeinsam anzugehen und um eine Wohlfühlregion für Familien nicht nur zu bleiben, sondern diese auch stetig auszubauen.
Da sind wir nun auch beim Thema der heutigen Aktuellen Stunde: Unsere Kinder sind unsere Zukunft, und gesunde Kinder von heute sind gesunde Erwachsene von morgen. Glückliche, zufriedene, gesunde Familien und gesundheitspräventiv denkende Menschen sind mir persönlich ein Herzensanliegen, und dies deswegen, weil ich selbst Mutter von drei Töchtern bin, weil ich als Mutter, als Frau, auch als Physiotherapeutin in der Betreuung der älteren Generation und schließlich als Politikerin bei unterschiedlichsten Begegnungen alle Höhen und Tiefen miterleben darf.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, so sehe ich es als meine Verpflichtung an, mich immer wieder für Verbesserungen im Familien-, im Frauen- und im Gesundheitsbereich einzusetzen. In punkto Familie sowie deren Förderung und Absicherung und in punkto Gesundheit hat sich sehr vieles in eine positive Richtung bewegt. Wenn ich daran denke, was ich allein in den letzten vier Jahren an Wegweisendem mitbeschließen durfte, so meine ich, wir dürfen durchaus stolz auf das Geleistete sein. Ich denke da an den Ausbau der institutionellen Kinderbetreuung, an die Gratiszahnspange, an die Gratis-HPV-Impfung bei Kindern, an die Erhöhung und monatliche Auszahlung der Familienbeihilfe, an die tägliche Bewegungseinheit in Ganztagsschulen, an das verpflichtende letzte Kindergartenjahr und dessen Weiterentwicklung, an das Pensionssplitting und letztendlich an das Kindergeldkonto, das es seit 1. März gibt.
Es muss aber auch weitergehen. Wir sprechen salopp immer wieder von der „Gesundheit als höchstem Gut“. Damit das auch so bleibt, oder besser gesagt, damit wir auf einem Weg dorthin bleiben, bedarf es weiterer gesundheitsfördernder Maßnahmen, die nicht früh genug ansetzen können, denn dadurch erhöhen wir die Chancen, in unseren Kindern das Bewusstsein dafür zu wecken, wie wichtig eine gesunde Lebensweise für unser aller Leben ist. Der Slogan von uns Physiotherapeuten lautet ja: Prävention vor Rehabilitation. – Genau das ist auch der Grund dafür, dass wir heute über die Anhebung des Schutzalters für den Kauf von Zigaretten für Jugendliche auf 18 Jahre debattieren.
Dieses Thema stand auch im Mittelpunkt der zweitägigen Jugendreferentenkonferenz in Krems, die vergangenen Donnerstag und Freitag über die Bühne ging. In dieser Länderkonferenz wurde unter dem Vorsitzenden Landesrat Mag. Karl Wilfing beschlossen, das Schutzalter für das Rauchen bis spätestens Mitte 2018 auf 18 Jahre anzuheben.
Klar ist – und das belegen auch Studien –: Ein höheres Einstiegsalter beim Rauchen hat positive Folgen für die Gesundheit und bewirkt eine allgemeine Verringerung der Raucherzahlen. Jetzt frage ich Sie: Sollen wir diese Möglichkeit einer präventiven Maßnah-
me in jugend- und gesundheitspolitischer Hinsicht vorüberziehen lassen? Im Zuge dieser Konferenz wurde auch eine weitere Harmonisierung beim Jugendschutz gewünscht, die à la longue kommen sollte und vernünftig wäre.
Aus Niederösterreich darf ich berichten, dass bereits jetzt seitens unserer Fachstelle für Suchtprävention viele Maßnahmen gesetzt werden, die nun speziell im Bereich des Rauchens verstärkt werden, weil neben den notwendigen gesetzlichen Regelungen die Vernunft und das Verständnis vorhanden sein müssen. Bereits jetzt finden rund 250 Rauchfrei-Workshops direkt an den Schulen statt. Diese werden nun vermehrt unter dem Aspekt Raucherprävention stehen. Das Land Niederösterreich wird parallel dazu mit den Kolleginnen und Kollegen aus den Bundesländern zusammenarbeiten, um gemeinsame, länderübergreifende Präventionsprojekte umzusetzen.
Es freut mich auch, dass die Bundesländer nun gemeinsam mit dem Bund eine einheitliche Position einnehmen. Abgesehen davon möchte ich auch auf das allgemeine Rauchverbot in der Gastronomie verweisen, das im Mai 2018 in Kraft treten wird. Unsere Gesellschaft – wir alle, nicht nur die Jugend – wird sich an diese gesundheitspolitische Maßnahme gewöhnen, und das ist gut und vernünftig.
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Mit dem Anheben des Schutzalters für das Rauchen auf 18 Jahre soll ein Meilenstein sowohl in der Jugend- als auch in der Gesundheitsförderung gesetzt werden, der präventive Wirkung haben wird.
Frühes Rauchen führt logischerweise zu einer größeren Abhängigkeit, und über die Schädlichkeit des Rauchens, über die gesundheitsgefährdende Wirkung von Tabakkonsum wissen am besten die Raucher selbst und jene, die leidvoll mit Erkrankungen wie einem Lungenkarzinom oder obstruktiven Lungenerkrankungen, COPD, umgehen müssen, Bescheid.
Aus internationalen Literaturrecherchen österreichischer Experten der Med Uni Graz geht hervor, dass die Anhebung des Mindestalters für den Zigarettenkauf eine 30-prozentige Verringerung des Zigarettenkonsums in der betroffenen Altersgruppe bringt.
Ich darf Ihnen ein weiteres Beispiel bringen: In Großbritannien wurde im Oktober 2007 das Alterslimit von 16 auf 18 Jahre erhöht, und eine Studie stellte fest, dass der Raucheranteil der 16- bis 17-Jährigen nach dem Verbot von 23,7 Prozent auf 16,6 Prozent zurückging. Auch bei den Elfjährigen bis 15-Jährigen kam es zu einer Reduktion des Raucheranteils um ein Drittel.
Natürlich sagt diese Studie nichts darüber aus, ob eine solche Reduktion auch in Österreich erzielt werden wird, aber ich denke, es ist aufgrund der internationalen Erfahrungen zu erwarten.
Aktuelle Daten aus Österreich zeigen, dass der Raucheranteil bei den österreichischen Jugendlichen von einem ehemals gehaltenen Spitzenplatz im Europavergleich in den vergangenen Jahren zurückgegangen ist. Laut einer Umfrage der österreichischen Krebshilfe unter rund 3 000 Schülerinnen und Schülern in Oberösterreich rauchten dort 2005 noch 20 Prozent regelmäßig – das bedeutet, mindestens drei Zigaretten pro Tag –, im Jahre 2014 waren es nur mehr 11 Prozent.
Es zeigt sich, dass präventive, aufklärende Maßnahmen durchaus wirken. Um aber die gewünschten Erfolge zu erzielen, wollen wir einfach mehr. Im jüngsten OECD-Bericht wird der Raucheranteil für das Jahr 2013/14 für Österreich bei den 15-jährigen Mädchen mit 14 Prozent und bei den 15-jährigen Burschen mit 15 Prozent angegeben, und damit befinden wir uns exakt im EU-Durchschnitt.
Abschließend möchte ich Ihnen gerne noch eine persönliche Erfahrung mitteilen: Als 16-Jährige verbrachte ich meinen ersten Urlaub in Kärnten. Dort herrschte eine tolle Stimmung – Diskothekenbesuche, Girl Power –, und Rauchen war damals einfach wirk-
lich cool. Vor meinem 16. Lebensjahr war es für mich, obwohl mein Vater selbst Raucher war, kein Thema, doch damals in dieser Stimmung habe ich es natürlich auch gemacht, zumal mir bewusst war, dass ich ja gemäß den gesetzlichen Bestimmungen rauchen durfte. Gelegentlich, muss ich gestehen, rauche ich auch heute noch. Ich stelle mir aber auch immer wieder die Frage, ob ich mit 18 Jahren nicht anders gedacht hätte, ob ich mit der Verlockung, weil ich älter und reifer gewesen wäre, nicht doch anders umgegangen wäre. (Bundesrat Längle: Das weiß man nicht!) – Ja, das weiß man nicht.
Das Anheben des Schutzalters auf 18 Jahre und die präventive Aufklärung der Jugend mag daher der Schlüssel dafür sein, dass immer mehr Jugendliche von heute auch gesunde Erwachsene von morgen werden. All die Facebook-Sprüche wie: Wählen mit 16, Führerschein mit 17, aber Rauchen mit 18?!, sind wenig hilfreich und bauschen nur ein Thema emotional auf, bei dem Sachverstand gefragt wäre. Wir haben ja auch die Ausbildungspflicht bis 18 Jahre im Kopf.
Frau Bundesminister, ich danke dir und deinem Team für diesen mutigen Weg, diesen Beschluss herbeizuführen. Es ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, den wir umfassender sehen müssen.
Wir Erwachsene von heute sollen Vorbilder für unsere Kinder sein, die morgen gesünder leben werden. – Danke schön. (Beifall bei ÖVP und SPÖ sowie bei Bundesräten der Grünen.)
9.17
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Vielen Dank, Frau Bundesrätin.
Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Anderl. Ich erteile ihr dieses.
9.17
Bundesrätin Renate Anderl (SPÖ, Wien): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau Ministerin! Werte Kolleginnen! Werte Kollegen! Meine Vorrednerin hat kurz die Kinderbildungseinrichtungen angesprochen. – Ja, auch in meiner Tätigkeit als Bundesfrauenvorsitzende des ÖGB kann ich sagen: Da haben wir einen richtigen Schritt in die richtige Richtung getan – auch von meiner Seite ein herzliches Danke dafür –, denn wir haben nicht nur für mehr Kinderbildungseinrichtungen gesorgt, sondern auch dafür, dass mehr Menschen in Beschäftigung kommen. Das ist ein Aspekt, den wir dabei nicht vergessen dürfen, wohl wissend, dass wir in dieser Richtung noch ganz viel zu tun haben und noch lange nicht am Ende sind.
Über unser heutiges Thema, nämlich Rauchen erst ab 18 Jahren, hat auch meine Vorrednerin ausführlich gesprochen. „Gesunde Kinder von heute sind gesunde Erwachsene von morgen“ – ich denke, diesem Satz ist nichts hinzuzufügen.
Ich gehe auch davon aus, dass niemand hier im Saal anzweifelt, dass Rauchen tatsächlich schädlich ist, und dass uns allen die Gesundheit unserer Jugendlichen am Herzen liegt. Wenn ich davon spreche, dass Rauchen schädlich ist, dann meine ich damit, dass es ja nicht nur für den Raucher/die Raucherin schädlich ist, sondern dass es, wie ja auch Studien belegen, auch für die Mitmenschen, die sogenannten Passivraucher/-raucherinnen negative Auswirkungen auf die Gesundheit hat.
Wir wissen auch, dass wir in Österreich, wenn wir den Zahlen der OECD Glauben schenken dürfen – und davon gehe ich aus –, zu den Spitzenreitern gehören, wenn es um das Thema Rauchen und Jugendliche geht.
Wenn wir jetzt aber darüber nachdenken, wann wir mit Gesetzen einschreiten sollen, dann drängen sich mir schon einige Fragen auf, und ich sehe das etwas anders als meine Vorrednerin.
Ich habe mir schon eine Frage gestellt. Einerseits sehen wir unsere Jugendlichen mit 16 Jahren als sehr verantwortungsvolle Mitmenschen. Wir sehen sie als reife Mitbürgerinnen und Mitbürger. Wir gehen davon aus, dass sie fähig sind, sich im Straßenverkehr ordnungsgemäß zu verhalten. Wenn ich jetzt an den Führerschein L17 denke, in dessen Rahmen Jugendliche in Wirklichkeit schon mit 16 Jahren im Straßenverkehr unterwegs sind, und wenn ich daran denke, dass Jugendliche – außer in Vorarlberg – eigentlich die Nacht zum Tag machen können, dann frage ich mich schon, warum wir dann bei der Frage des Nikotinkonsums unseren Jugendlichen plötzlich nicht mehr vertrauen, warum wir nicht mehr daran glauben, dass sie reif genug sind, und jetzt in dieser Art – meiner Ansicht nach mit einer Verbotskeule – drüberfahren.
Sehr geehrte Frau Minister, ich weiß, was der Zweck ist, aber ich persönlich zweifle daran, dass wir durch Verbote und Strafdrohungen das Ziel, das wir alle erreichen wollen und das auch ich persönlich erreichen möchte, wirklich erreichen werden, denn – das belegen uns auch Studien – in Österreich haben wir auch das Problem, dass ja bereits Elf- und Zwölfjährige zu rauchen beginnen, obwohl – oder besser gesagt: weil – es verboten ist. Denken wir doch an unsere eigene Jugend, und auch ich denke kurz an meine Jugend! – Ich glaube, dass gerade für Jugendliche Verbotenes viel interessanter ist als jene Dinge, die ohnehin erlaubt sind.
Was auf jeden Fall besonders wichtig ist, ist, dass wir zu diesen Gesetzesänderungen, die ja auf Landesebene durchgeführt wurden, auf jeden Fall begleitende Präventionsmaßnahmen brauchen. Auch die wurden ja von meiner Vorrednerin schon sehr intensiv besprochen. Da stellt sich für mich die Frage: Wer sorgt dafür, dass wir dann auch wirklich die finanziellen und vor allem die personellen Ressourcen haben, um flächendeckende Aufklärung tatsächlich umzusetzen beziehungsweise auch für flächendeckende Kontrollen zu sorgen? – Ich möchte dazu jedoch anmerken, dass ich mir jetzt noch nicht sicher bin, wie man es dann kontrolliert. Wenn wir da bereits gute Kontrollen hätten, dann würden heute ja nicht so viele Elf- und Zwölfjährige rauchen.
Meiner Meinung nach wäre es einfach ein wichtiger Schritt gewesen, im Vorfeld schon Prävention vor Strafe zu stellen, das heißt, im Vorfeld schon dafür zu sorgen, dass wir mehr Aufklärung haben, und nicht dafür, dass wir unsere Jugendlichen jetzt kriminalisieren. (Beifall bei SPÖ und Grünen.)
Die zweite Frage, die sich mir auch gestellt hat, ist, ob es nicht auch ein besserer Weg gewesen wäre, bei diesen Diskussionen auch die Jugend mit ins Boot zu holen, nämlich die Bundesjugendvertretung, um mit ihr auch im Vorfeld darüber zu sprechen, um vielleicht das eine oder andere zu klären und auch die Erfahrungen der Jugendlichen miteinzubeziehen.
Ich selbst bin seit einigen Jahren Nichtraucherin. Das heißt, auch ich habe geraucht. Wenn ich ehrlich bin, habe auch ich in der Schule begonnen, zu rauchen, und dies – um ganz ehrlich zu sein – deshalb, weil es einfach cool war, weil andere geraucht haben. (Zwischenruf der Bundesrätin Mühlwerth.) Ich sage es ehrlich: Es war cool, es war verboten – und es ist auch richtig, dass es verboten ist. Auf jeden Fall ist für jene, die sehr jung anfangen, das Risiko größer, dass sie von dieser Sucht nicht wieder wegkommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, glaubt mir, ich weiß, wovon ich spreche! Gerade deshalb hoffe ich, dass wir den Jugendlichen nicht nur mit der Verbotskeule entgegentreten, sondern dass wir nebenbei tatsächliche Aufklärungsarbeit leisten, um den Jugendlichen die Konsequenzen, vor allem die gesundheitlichen Konsequenzen, aufzuzeigen, die mit dieser Sucht verbunden sind. Ich glaube, dass wir mit dieser Aufklärungsarbeit nicht früh genug ansetzen können, und ich gebe auch jenen recht, die sagen, dass wir Erwachsene ein großes Vorbild sein sollten.
Zusammengefasst: Na selbstverständlich bin ich auch dafür, dass wir unsere Jugendlichen vor dem Rauchen schützen und dass wir unsere Jugendlichen vor den gesund-
heitlichen Schäden – vor allem durch das Rauchen – warnen. Nichtsdestotrotz bin ich nicht wirklich davon überzeugt, dass die Verbote das richtige Mittel sind. Studien belegen aber, dass das Rauchen dadurch reduziert worden ist – auch das hat meine Vorrednerin angesprochen –, daher werden wir uns einmal anschauen, was tatsächlich herauskommt. (Zwischenruf des Bundesrates Mayer.) – Ja, du hast recht.
Wenn sich schon alle Jugendlandesräte zusammengesetzt haben, dann wäre es vielleicht auch vernünftig gewesen, einmal die ernsthafte Diskussion zu starten, warum Jugendschutzgesetze eigentlich überhaupt Landessache sind und nicht auf Bundesebene geregelt werden. (Beifall bei SPÖ und Grünen sowie des Bundesrates Schererbauer. – Zwischenruf des Bundesrates Mayer.) Es ist für mich nicht wirklich nachvollziehbar, dass der 16-Jährige in Tirol die Nacht zum Tag machen, bis 5 Uhr morgens unterwegs sein kann, während der Jugendliche in Vorarlberg spätestens um 2 Uhr morgens zu Hause sein muss. (Allgemeine Heiterkeit. – Bundesrat Längle: Stimmt gar nicht, Frau Kollegin! – Zwischenruf der Bundesrätin Mühlwerth.)
Ich habe heute Morgen im Radio die nächste Diskussion, die läuft, mitbekommen. Sie ist sicher genauso wichtig und notwendig und betrifft den Alkohol. Ich habe also erfahren, ab wann man in den Bundesländern Alkohol konsumieren darf und dass das sehr, sehr unterschiedlich ist. Ich glaube, wenn wir in diesem Bereich Regelungen schaffen, dann sollten wir sie für alle gleich machen. Das heißt, wir brauchen eine Vereinheitlichung der Jugendschutzgesetze – das wäre nicht nur zeitgemäß, sondern auch ein wichtiger Schritt, um angesichts der Mobilität der Jugendlichen für Fairness zu sorgen.
Sehr geehrte Frau Minister, es sei kurz angesprochen, wenn ich schon die Möglichkeit habe – es betrifft meist auch junge Menschen, nämlich junge Eltern –: Es gibt in Österreich – wenn ich nicht irre – seit 1990 für Väter die Möglichkeit, dass sie in Väterkarenz gehen können, und mittlerweile haben Väter ja auch einen Rechtsanspruch darauf. Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
Wir wissen aus den Beratungen auch, dass junge Väter bereit sind, aktiv diese Vaterrolle zu übernehmen. Wir wissen gleichzeitig aber auch, dass wir viel zu wenig Väter haben, die diese Rolle überhaupt übernehmen. Grund dafür ist – neben der noch immer existierenden Einkommensschere – vor allem die Tatsache, dass viele Betriebe nicht bereit sind, Rücksicht auf die privaten Lebensumstände ihrer Mitarbeiter zu nehmen. Ein Betrieb profitiert jedoch von einem Vater, der die Erfahrung macht, einen Haushalt und Kinder zu versorgen. Diese Aufgabe verlangt nämlich Ausdauer, Geduld, Konfliktlösungskompetenz, also auch Managementqualitäten. – Jede Mutter weiß jetzt, wovon ich spreche.
Wir machen leider immer wieder die Erfahrung, dass, wenn Väter nur ansatzweise vorhaben, sich kurze Zeit ihrer Familie zu widmen, die Arbeitgeber absolut nicht entgegenkommend sind, sondern das Gegenteil ist der Fall. (Zwischenruf des Bundesrates Stögmüller.) Aus der Erfahrung muss ich leider berichten, dass es selbst Betriebe sind, die am sogenannten Audit berufundfamilie – das ich sehr begrüße – teilgenommen haben, die Vätern oft mit einer Kündigung drohen, wenn sie sich erlauben, sich diese kurze Zeit zu gönnen.
Aus diesem Grund sind die Politik ebenso wie alle Unternehmer und Unternehmerinnen gefordert, diesbezüglich Rahmenbedingungen der Vereinbarkeit zu schaffen, die wirklich Frauen wie Männer gleichermaßen stärkend unterstützen. Wir brauchen eine Unternehmenskultur, die Männer auch als Väter wahrnimmt und Väterkarenz fördert. Sehr geehrte Frau Ministerin, wir hoffen auch auf Ihre Unterstützung, dass wir es auch auf Betriebsebene wirklich schaffen, den Vätern diese Chance zu geben, dass sie ihre Vaterrolle aktiv übernehmen können. – Danke. (Beifall bei der SPÖ sowie der Bundesräte Schererbauer und Stögmüller.)
9.28
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Bevor ich anhand der RednerInnenliste fortfahre, begrüße ich sehr herzlich eine Gruppe des Tiroler Seniorenbundes bei uns im Bundesrat. Herzlich willkommen! (Allgemeiner Beifall.)
Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Mühlwerth. Ich erteile ihr dieses.
9.29
Bundesrätin Monika Mühlwerth (FPÖ, Wien): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau Minister! Sehr geehrte Gäste! Sehr geehrte Damen und Herren! Es ist interessant, was bei dem Thema der Aktuellen Stunde „Rauchen ab 18“ von den Kolleginnen so alles hineingepackt wird.
Ja, wir sind uns einig, dass es uns wichtig ist, dass unsere Jugendlichen gesund aufwachsen und möglichst auch gesund bleiben. Nur – es ist ja schon gesagt worden, und es steht auch auf meinem Notizzettel – gilt bereits jetzt, dass Rauchen erst ab 16 Jahren erlaubt ist, und trotzdem liegt das Einstiegsalter der Jugendlichen oder Kinder – das kann man da ja eigentlich noch sagen – bei elf bis zwölf Jahren. Also wird die neue Regelung hinsichtlich der 18 Jahre jetzt nicht der große Renner sein, sodass sie plötzlich nicht beginnen, zu rauchen, denn natürlich ist gerade bei Jugendlichen der Reiz des Verbotenen besonders groß. Das war bei uns so, und es ist auch bei den heutigen Jugendlichen so. Sie gehen dann halt, so wie es die früheren Generationen gemacht haben – wir haben heute ja schon von Raucherkarrieren gehört –, heimlich aufs Klo rauchen.
Jugendliche und Kinder sind ab 14 Jahren beschränkt geschäftsfähig. Sie dürfen den Mopedführerschein machen, sie dürfen mit dem Einverständnis der Eltern ab 15 Jahren mit dem Moped fahren, obwohl wir wissen, dass sie gerade in diesem Alter in ihrem jugendlichen Überschwang, in einer Selbstüberschätzung der eigenen Kräfte die schwersten und die meisten Unfälle bauen – dennoch dürfen sie das. (Zwischenruf des Bundesrates Stögmüller.) Sie dürfen ab 16 Jahren wählen, weil wir sie für reif halten mitzubestimmen, wie das künftige Geschick Österreichs gestaltet sein soll. Sie dürfen nach Ihrem Dafürhalten aber nicht entscheiden, ob sie vor oder erst ab dem Alter von 18 Jahren rauchen. (Bundesrat Stögmüller: Wählen tötet aber nicht!) – Ja, ich komme jetzt auch zu Ihnen.
Normalerweise sind ja die Grünen die Verbotspartei, die alles und jedes verbieten will. Meiner Ansicht nach ist interessant, dass das jetzt auch die Regierungsparteien machen wollen. Die Grünen sind interessanterweise beim Rauchen sehr strikt (Bundesrat Stögmüller: ... Rauchen ...!), wenn es aber um Haschisch geht, sind sie überhaupt nicht strikt. Das würden sie am liebsten in der Trafik verkaufen, und zwar völlig frei und ohne Alterslimit (Bundesrat Stögmüller: Ab 18! – Heiterkeit bei der ÖVP), obwohl Studien belegen, dass das noch viel gefährlicher ist, dass sich das viel länger im Körper festsetzt und dass das für viele der Einstieg in eine veritable Drogenkarriere ist. (Bundesrat Stögmüller: Ab 18!) Gratulation den Grünen zur Forderung der Freigabe von Haschisch – das ist natürlich der richtige Gesundheitsaspekt. (Beifall bei der FPÖ.)
Vielleicht sollten Sie auch darüber nachdenken, als Nächstes gleich den Alkohol zu verbieten, denn der ist nämlich mindestens genauso gefährlich.
Wenn wir wollen, dass die Jugendlichen möglichst nicht rauchen – und das ist ja das Ziel –, dann würde ich auch mehr auf Prävention setzen. Ich glaube auch, dass es besser ist, das Bild zu vermitteln, dass Rauchen einfach uncool ist, denn das wirkt noch am ehesten. Verbote – das hat ja auch meine Vorrednerin schon angemerkt – wirken wenig.
Aber ich verstehe das schon: Das ist jetzt ein Thema, das wir hier in einer Aktuellen Stunde diskutieren, mit dem man ein bisschen Aufmerksamkeit erregen kann. Nicht böse sein, Frau Ministerin: Ihre Arbeit in Ihrer Amtszeit ist nach unserem Dafürhalten ja
nicht von großen Erfolgen gekrönt gewesen. (Bundesrat Mayer: ... Maßstab ...!) Da ist die Familienbeihilfe, die Sie für jene Kinder, die im Ausland leben, deren Eltern aber hier arbeiten, kürzen wollen – das ist übrigens ein FPÖ-Zug, auf den Sie aufgesprungen sind, denn das fordern wir seit 10 Jahren; da sind Sie eines Sinnes mit Ihrem Kollegen Kurz, der jetzt ja auch die freiheitlichen Forderungen entdeckt hat und so tut, als ob er sie gerade erfunden hätte –, aber da haben Sie ja gerade eine Absage bekommen, zuerst von der EU, die gesagt hat, da droht ein Vertragsverletzungsverfahren, dann hat auch Ihr Parteichef und Vizekanzler kalte Füße bekommen und gesagt: Na ja, lassen wir es lieber, denn ein Vertragsverletzungsverfahren wollen wir doch nicht riskieren. – Deshalb braucht man jetzt also irgendein Thema, mit dem man ein bisschen Aufmerksamkeit erregen kann.
Wobei ich meine – bei aller Wichtigkeit der Gesundheit –, wir haben im Moment schon auch noch drängendere Probleme zu besprechen, die meines Erachtens ein passenderes Thema für eine Aktuelle Stunde gewesen wären. Wir haben viele Jugendliche hier, die als unbegleitete Flüchtlinge gekommen sind. Nicht alle sind vor dem Krieg geflüchtet, das wissen wir auch. Viele davon haben falsche Altersangaben gemacht. Jeden Tag lesen wir in der Zeitung, dass es unter den Jugendlichen der verschiedenen Ethnien Messerstechereien gibt, bei denen dann auch Österreicher unschuldig zum Handkuss kommen. Wir wissen um die Kriminalität. Wir wissen auch, dass es für die, die Asylstatus haben und hierbleiben werden, noch keinen richtigen Plan, wie sie zu integrieren sind, gibt. Wir haben ein Problem mit der Angabe eines Ausbildungsstands. Das sind alles Dinge, die viel eher besprochen gehören.
Die Gesundheit ist schon ein wichtiges Thema, das will ich überhaupt nicht bestreiten; und man kann gar nicht früh genug beginnen, man muss bei den Kindern beginnen und bei den Jugendlichen bis hin zu den Erwachsenen fortsetzen – da gebe ich Ihnen vollkommen recht –, aber ich glaube dennoch, dass das im Moment nicht das allerdringendste Problem ist, von dem ich meine, dass wir es in einer Aktuellen Stunde besprechen sollten, weil sich ja ohnedies alle im Großen und Ganzen einig sind. Frau Ministerin, bei aller Wertschätzung sage ich Ihnen daher schon: Dieses Thema der Aktuellen Stunde ist nach unserem Dafürhalten eine Themenverfehlung! (Beifall bei der FPÖ.)
9.35
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Stögmüller. Ich erteile ihm dieses.
9.35
Bundesrat David Stögmüller (Grüne, Oberösterreich): Sehr geehrte Frau Ministerin! Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Zuerst einmal möchte ich mich bei Ihnen, Frau Ministerin, dafür bedanken, dass Sie das wichtige Thema „Rauchen ab 18“ in die Bundesländerkammer gebracht haben. Ich halte das für wichtig, denn Österreich ist trauriger Spitzenreiter in Europa, wenn es um die Zahl jugendlicher Raucher geht und wenn es um das Mindestalter für den Kauf von Zigaretten geht. Das ist Faktum.
77 Prozent der Raucherinnen und Raucher sind bereits mit 18 Jahren regelmäßige KonsumentInnen – 77 Prozent mit 18 Jahren regelmäßige KonsumentInnen! Das freut natürlich die Tabakindustrie. Dazu passend gibt es einen Satz von Philip Morris – das ist ein Zigarettenhersteller –, der besagt: „Die Kinder von heute sind die potenziellen Kunden von morgen“. Ich finde es erschreckend, dass Zigarettenhersteller sagen, man müsse schon Jugendliche mit Zigaretten anfüttern, sodass sie irgendwann süchtig werden und dann weiter rauchen werden. Genau da müssen wir handeln, da müssen wir einschreiten.
Für die Jugendlichen ist das Zigarettenrauchen cool. Auch ich selbst, das muss ich zugeben, habe als Jugendlicher ein paarmal eine Zigarette geraucht, weil es einfach cool
war, wie es schon die Kollegin gesagt hat, weil es einfach ein cooler Effekt war, dass man im Raucherhof eine Zigarette geraucht hat – sozusagen als Rebellion gegen die Erwachsenenwelt.
Ich habe zum Glück damit aufgehört, nie regelmäßig damit angefangen, aber viele meiner Freundinnen und Freunde, meiner Bekannten haben damit begonnen und auch nicht mehr aufgehört. Das spiegelt auch die aktuelle Statistik wider; diese besagt, dass es 80 Prozent der 20-jährigen Raucher bereuen, überhaupt mit dem Rauchen angefangen zu haben. Ich bin mir sicher, dass kaum ein Jugendlicher die Entscheidung, mit dem Rauchen anzufangen, bewusst trifft, und kaum ein Jugendlicher ist sich der Gefahr der langfristigen Abhängigkeit bewusst.
Ich möchte aber auch betonen, dass einzelne Maßnahmen meiner Ansicht nach eher ziellos sein oder sich verlaufen werden, denn es muss ein Gesamtpaket geschnürt werden. Das betrifft den in Österreich vernachlässigten Nichtraucherschutz und die Tabakprävention. Laut der OECD ist Österreich neben der Slowakei und Rumänien das einzige EU-Land, in dem der Anteil der RaucherInnen seit dem Jahr 2009 nicht reduziert werden konnte. Im Vergleich von 34 untersuchten europäischen Ländern nimmt Österreich im Bereich des Nichtraucherschutzes und der Tabakprävention den letzten Platz ein. Ich sehe da also ganz dringenden Handlungsbedarf.
Nochmals zurück zu meinem Eingangsstatement: Es freut mich, dass wir heute im Bundesrat darüber diskutieren, denn die Maßnahme des Jugendschutzes, das Rauchen erst ab 18 Jahren zu erlauben, erfordert nicht nur die gemeinsame Anstrengung der Bundesregierung, der SPÖ und der ÖVP, sondern sie erfordert auch die Unterstützung der Länder – und das ist partout nicht so einfach, wir wissen das. Wir haben in den Bundesländern viele politische Konstellationen, wir haben Rot-Blau, wir haben Schwarz-Grün, wir haben Niederösterreich – die Kollegin ist nicht da –, wir haben Rot-Grün und so weiter. Das macht es partout nicht einfach, dabei auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen.
Eines muss uns allen in dieser Diskussion aber klar sein: Es geht dabei um Jugendschutz, es geht dabei um junge Menschen und Kinder, es geht darum, dass Jugendliche – wenn überhaupt – später zu rauchen beginnen. Darum geht es, denn jedem hier ist, glaube ich, klar: Rauchen tötet! Wählen tötet nicht, Frau Kollegin Mühlwerth, das ist ein Unterschied. (Bundesrätin Grimling: Alkohol tötet! – Ruf bei der FPÖ: Moped?! – Zwischenruf der Bundesrätin Mühlwerth.) – Alkohol tötet natürlich auch, ja, das ist ein anderes Thema. Ich will mich ja auf das heutige Thema beschränken und nicht über etwas anderes reden.
Also: Rauchen tötet! Glauben Sie mir, werte Kolleginnen und Kollegen, ich habe in meiner beruflichen Tätigkeit schon mehr als genügend Menschen leiden gesehen, die nach jahrelangem Tabakkonsum und nach jahrelanger Tabakabhängigkeit an COPD, Krebs oder Asthma bronchiale erkrankt sind, und solche Leiden sollten wir so weit wie möglich hinauszögern oder überhaupt verhindern.
Wir brauchen wirklich ein Gesamtpaket, nicht nur Verbote – da bin ich bei Frau Kollegin Anderl –, sondern auch Präventionsmaßnahmen. Ich habe mir den Beschluss der LandesjugendreferentInnenkonferenz von letzter Woche durchgelesen: Darin geht es um die Anhebung des Schutzalters für das Rauchen auf 18 Jahre bis zum Jahr 2018 – ich glaube, Mitte 2018. Das wird dann in etwa so wie das Rauchverbot in den Lokalen umgesetzt werden. Ich glaube, das ist so geplant, wie ich aus einem Gespräch mit der Kollegin aus Salzburg erfahren habe.
Mir ist es wichtig, dass es zu keiner Kriminalisierung von Jugendlichen kommt, die ab und zu doch einmal eine Zigarette im Schulhof rauchen, hinten im Schulhof eine paffen oder einfach deshalb eine Zigarette rauchen, weil es cool ist, und dann angezeigt wer-
den, weil sie geraucht haben. Das ist in meinen Augen eine Kriminalisierung, und das sollte man verhindern.
Ich möchte betonen, dass es wichtig ist, eine Änderung des Mindestalters für den Verkauf von Tabakprodukten vorzunehmen. Das muss kommen, da müssen wir ansetzen, damit das Rauchen bei Jugendlichen verhindert wird. Das wird aber meiner Einschätzung nach über die Gewerbeordnung erfolgen, also in Bundeskompetenz und nicht in Länderkompetenz. Prinzipiell ist ohnehin relativ viel in Bundeskompetenz, man kann beispielsweise zwar in den Ländern das Jugendalter anheben, aber hinsichtlich der Bestrafung müsste auch wieder der Bund gefragt werden, nämlich ob es möglich ist, eine Strafe zu erteilen. Es ist also ohnehin sehr viel in Bundeskompetenz, aber dazu vielleicht noch später.
Ich glaube, dieser Schritt ist wichtig, denn die Zahlen und Statistiken sprechen für eine Anhebung des Abgabealters. Zum Beispiel wurde in Großbritannien – das wurde ja schon erwähnt – 2007 das Alterslimit von 16 auf 18 Jahre erhöht, danach ist die Zahl der 16- bis 17-Jährigen, die rauchen, um 30 Prozent gesunken. Bei den elfjährigen bis 15-jährigen Jugendlichen – elf bis 15 Jahre, das muss man sich vorstellen! – konnte der Raucheranteil signifikant, nämlich um 33 Prozent, vermindert werden.
Auch in Schweden war es so. In Schweden wurde 1997 das Abgabealter von 16 auf 18 Jahre erhöht – es gab damals auch einige Zweifel und Widerstand in den politischen Gremien –, und dort konnte in den ländlichen Regionen der Raucheranteil der 15- bis 16-Jährigen signifikant, um 35 Prozent, reduziert werden.
Ich glaube, diese Zahlen sprechen für sich. Natürlich lässt sich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es in Österreich einen ähnlichen Erfolg geben wird, aber die internationalen Studien lassen zumindest hoffen und sind vielversprechend, gerade dann, wenn auch umfassende Präventionsmaßnahmen umgesetzt werden. Wir müssen bereits in der Elementarpädagogik mit Prävention anfangen und in den Schulen weitermachen. Es braucht ein umfassendes Programm zur Suchtprävention, es geht aber auch um den Umgang mit Konflikten, mit emotionalen Belastungen und Stress, den Jugendliche lernen sollten.
Ich denke, dass Raucherkammerl für PädagogInnen, wie es sie noch manchmal in Schulen gibt, nicht die beste Vorbildwirkung für Kinder und junge Menschen haben. Dagegen müssten wir auch etwas unternehmen, wenn wir von Prävention reden.
Frau Jugendministerin, ich bitte Sie, Ihre Kontakte zur neuen Gesundheitsministerin zu nutzen und diese aufzufordern, Geld für Prävention auch im Gesundheitsbereich aufzuwenden. Zurzeit wird 1 Prozent des gesamten Gesundheitsbudgets Österreichs für Prävention ausgegeben – ein einziges Prozent! Ich bin mir sicher, da geht noch viel mehr.
Abschließend möchte ich noch etwas zum letzten Punkt des Beschlusses der LandesjugendreferentInnenkonferenz sagen, der die Harmonisierung des Jugendschutzgesetzes im Bereich von Ausgehzeiten und Konsum von Alkohol betrifft. Ich sage das jetzt ganz bewusst in der Länderkammer: Für mich und sicher für einen Großteil der Menschen in Österreich ist es nicht nachvollziehbar, dass wir in Österreich noch immer neun unterschiedliche Jugendschutzgesetze brauchen. Wenn wir uns jetzt ohnehin schon um eine Harmonisierung bemühen, dann machen wir das doch gleich bundeseinheitlich und daraus endlich ein Bundesgesetz. Das wäre dringend notwendig. – Danke. (Beifall bei Grünen und SPÖ.)
9.43
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Zu einer ersten Stellungnahme hat sich Frau Bundesministerin für Familien und Jugend Dr. Karmasin zu Wort gemeldet. Auch Ihre Redezeit, Frau Ministerin, soll 10 Minuten nicht überschreiten. – Bitte, Frau Ministerin.
9.43
Bundesministerin für Familien und Jugend MMag. Dr. Sophie Karmasin: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Bundesrätinnen und Bundesräte! Ich glaube, dass das heutige Thema der Aktuellen Stunde sehr, sehr wichtig ist, und freue mich besonders, dass letzten Freitag dieser entscheidende Beschluss der LandesjugendreferentInnen einstimmig nach zweijähriger Beratungszeit gefasst wurde.
Ich möchte jetzt nicht gleich auf das Inhaltliche eingehen – es wurde ja schon sehr viel dazu gesagt –, sondern ein bisschen auf den Prozess, darauf, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist.
Ich bedanke mich ausdrücklich bei den Ländern, bei allen Verantwortlichen, die in diesen Arbeitsgruppen mindestens zwei Jahre lang sehr intensiv gearbeitet haben und sich in sehr seriöser und professioneller Weise – das betone ich – auf die wissenschaftlichen Studien gestützt haben, um zu ihrem Ergebnis zu kommen. Sie haben nicht umfangreich über eigene Erfahrungen und Einschätzungen berichtet, sondern sich um die wissenschaftlichen Erkenntnisse bemüht, die Effektivität von Schutzaltersgrenzen und Gesetzen im internationalen Vergleich analysiert und sind dann einhellig zu diesem Beschluss gekommen – jenseits der Parteigrenzen und jenseits der persönlichen Zugänge.
Ich möchte mich ausdrücklich dafür bedanken, dass diese Entscheidung auf dieser professionellen und sachlichen Ebene gelungen ist. Das bestärkt mich auch darin, dass eine Harmonisierung der Jugendschutzbestimmungen in der Ländergesetzgebung möglich ist. Das ist jetzt im Zusammenhang mit dem Rauchen gelungen, und wir werden im nächsten Jahr versuchen, den nächsten Schritt zu setzen, nämlich in Bezug auf Ausgehzeiten und in Bezug auf den Konsum harter alkoholischer Getränke, also Schnaps. Das wollte ich noch einmal zusammenfassend sagen, um auch den Ablauf des Prozesses ein bisschen aufzuzeigen, der sehr sachlich und professionell verlaufen ist.
Man hat sich – wohlgemerkt – auf die Effizienz solcher Gesetze konzentriert, und das ist ja das, worum es geht. Jeder hat eine Meinung zum Rauchen, man hat vielleicht eigene Erfahrungen, beispielsweise dass man als Jugendlicher auf diese Weise gegenüber der Obrigkeit rebelliert hat. Ich denke, dass heute 16- oder 17-Jährige Rauchen nicht mehr als große Rebellion verstehen; da gibt es ganz andere Themen, die junge Menschen heute ins Treffen führen, im Internet, im Drogenbereich, in anderen Bereichen. Ich denke, Rauchen wird heute nicht mehr als Mittel der Rebellion gegen Eltern oder die Obrigkeit eingesetzt, das ist viel zu alltäglich geworden, insbesondere bei uns in Österreich, wo die höchste Raucherrate bei jungen Menschen im europäischen Vergleich gegeben ist.
Können wir Politiker da zusehen? Können wir hier einfach nur sagen: Das ist halt einfach so, pubertierende Menschen machen einfach Dinge, die nicht gesundheitsförderlich sind? – Das kann doch nicht unser Anspruch sein! Wir müssen doch alle Instrumente bemühen, die dazu dienen und die wirksam einsetzbar sind, damit junge Menschen vom Rauchen abgehalten werden. (Beifall bei der ÖVP und bei Bundesräten von SPÖ und Grünen.)
Rauchen – und das ist heute schon hinlänglich erörtert worden – hat tödliche Folgen, und bei Jugendlichen hat das Rauchen das höchste Suchtpotenzial, bei 16- bis 18-Jährigen ein ebenso hohes Suchtpotenzial wie Heroin. Es ist also ein Unterschied, ob 16-Jährige oder 18-Jährige zu rauchen beginnen. Auf den hirnphysiologischen Entwicklungsstatus eines 16-Jährigen wirkt Nikotin ganz anders als auf jenen eines 18- oder 19-Jährigen, nämlich mit einem extrem hohen Suchtfaktor. Und jetzt frage ich Sie: Können wir das tolerieren? – Nein, das können wir natürlich nicht tolerieren, noch dazu, da die Anhebung des Schutzalters effizient wirkt. Alle internationalen Studien, die schon erläutert wurden, belegen das ja überzeugend.
Ich denke, es geht kein Weg daran vorbei, einerseits alle Ebenen und Maßnahmen zu bedienen, die die Anhebung des Schutzalters betreffen, andererseits selbstverständlich auch alle Präventionsbemühungen und -programme, die uns zur Verfügung stehen, einzusetzen. Ich muss noch dazusagen: Wir haben uns schon die letzten 40 Jahre sehr eindringlich und intensiv bemüht, aber die Raucherrate ist leider nicht gesunken, während sie in jenen Ländern, in denen das Schutzalter angehoben wurde, gesunken ist. Daher befürworte ich natürlich Präventionsmaßnahmen, aber nur als einen Baustein neben der Anhebung des Schutzalters und unter Einbeziehung der Bundesjugendvertreter, der Suchtpräventionsstellen der Länder und aller verantwortlichen Experten in diesem Bereich. Als letzten Punkt brauchen wir auch das Rauchverbot in der Gastronomie.
Ich denke, in Summe wird dieses Paket sehr effizient wirken, sodass junge Menschen vom Rauchen abgehalten werden und erst später – wenn überhaupt – zu rauchen beginnen. Denn wir wissen auch – das ist wissenschaftlich belegt –: Je später man zu rauchen beginnt, desto leichter kommt man wieder weg von dieser Sucht. Es gibt Einzelbeispiele, die vielleicht das Gegenteil belegen, aber konzentrieren wir uns bitte auf wissenschaftliche Erkenntnisse und nicht auf Einzelbeispiele.
Beim Thema Präventionsmaßnahmen möchte ich allen Vorrednern recht geben: Natürlich brauchen wir Präventionsmaßnahmen. Wir brauchen in diesem Bereich auch Investitionen – keine Frage. Im BMFJ haben wir bereits Mittel dafür vorgesehen. Ich bin sehr froh darüber, dass meine neue Kollegin Rendi-Wagner auch schon ganz klar signalisiert hat, dass sie da investieren wird, Präventionsarbeit aufstellen wird und wir Schulter an Schulter diesen Weg verfolgen werden.
Zur weiteren Vorgehensweise: Wir haben jetzt eine Arbeitsgruppe zu den Themen Harmonisierung der Ausgehzeiten und Konsum von harten alkoholischen Getränken eingesetzt. Ich bin überzeugt davon, dass wir uns mit diesen Fragen genauso sachlich und seriös beschäftigen werden, wie wir es beim Rauchen getan haben. Ich bin der Überzeugung, dass diese Vorgangsweise und die vergangenen Freitag getroffene Entscheidung wirklich vorbildlich dafür waren, wie Bund und Länder gemeinsam ein Thema bearbeiten und ausarbeiten können, um dann einen gemeinsamen, konsensualen, einstimmigen bundesweiten Beschluss zu fällen, bei einem Thema, das zweifelsohne einen Meilenstein in der gesundheitspolitischen und jugendpolitischen Arbeit darstellt.
Ich bin überzeugt davon, dass wir auch die Themen Harmonisierung der Ausgehzeiten und Konsum harter alkoholischer Getränke jetzt genauso gut und sachlich auf den Weg bringen können und hoffentlich in einem Jahr wieder hier stehen werden und gemeinsam den nächsten Erfolg im Sinne unserer Jugend feiern können. – Danke schön. (Beifall bei ÖVP, SPÖ und Grünen.)
9.50
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Vielen Dank, Frau Bundesministerin.
Ich mache darauf aufmerksam, dass die Redezeit aller weiteren TeilnehmerInnen an der Aktuellen Stunde nach Beratung in der Präsidialkonferenz 5 Minuten nicht überschreiten darf.
Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Mayer. – Bitte.
9.50
Bundesrat Edgar Mayer (ÖVP, Vorarlberg): Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau Ministerin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch von mir ein herzliches Grüßgott an die Zuschauer und Zuschauerinnen vom Seniorenbund! Ich hoffe, Ihnen gefällt unsere Diskussion! Sie ist ja heute nicht so kontroversiell, aber es geht um ein Thema, das sicher auch für Senioren wichtig ist, da diese ja bemüht sind, die Kinder, die Jugendlichen, die sie zu Hause mitbetreuen und die bei Ihnen aufwachsen, gesund sozusagen ins Erwachsenenalter zu bringen.
Die Frau Ministerin hat an und für sich alles gesagt, ich könnte jetzt hier sagen: Danke, Frau Ministerin, du hast recht in allem, was du gesagt hast, und das war mein Redebeitrag!, und mich zurück an meinen Platz begeben, aber ich möchte doch noch einiges klarstellen.
Frau Kollegin Anderl, die Vizepräsidentin des ÖGB, die ich sehr schätze, und ich sind oft derselben Meinung – heute nicht ganz, zumindest nicht in allen Punkten, etwa was die Kriminalisierung von Jugendlichen anlangt. Das muss ich natürlich zurückweisen! Wenn sich die Länder mit diesem Thema derart auseinandersetzen und eine Einigung erzielt wird, dann haben natürlich auch das Land Wien und der Stadtrat von Wien zugestimmt, und dann dem Stadtrat vorzuwerfen, sozusagen jemanden zu kriminalisieren, ist nicht richtig, aber das müsst ihr dann selbst miteinander ausmachen. (Bundesrätin Grimling: So sind wir in Wien! Das halten wir aus!)
Der Koalitionsfrieden ist deshalb nicht in Gefahr, wir werden dieses Thema aber gemeinsam besprechen. (Zwischenrufe bei SPÖ und FPÖ.) – Na ja, die blaue Raucherlobby mit Frau Kollegin Mühlwerth habe ich schon gehört. (Bundesrat Todt: Hast du sonst auch noch etwas zu reden oder willst du nur über diese Geschichte reden?) – Herr Kollege! (Bundesrat Todt: Ja, Herr Kollege!) Herr Kollege, ich bin am Wort! Ich bin am Wort! Und zum Thema kann ich, glaube ich, sagen, was ich will, und ich finde deinen Zwischenruf mehr als nur deplatziert – in aller Freundschaft, Herr Kollege! (Beifall bei der ÖVP.)
Wo bin ich stehen geblieben? – Beim Bereich Jugend: Mir fehlt das Verständnis, wenn man das infrage stellt. Die Jugend braucht, wie gesagt, auch entsprechendes Lobbying, und wir müssen schauen, wie wir die Jugendlichen gesund ins Erwachsenenalter bringen. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt.
Es wurde schon angesprochen: Österreich liegt, was jugendliche Raucher anlangt, im Spitzenfeld, und dieses Alterslimit jetzt auch noch mit dem Wahlalter sozusagen in Einklang zu bringen, ist meiner Meinung nach deplatziert.
Österreich ist auch sonst, was zum Beispiel Rauchen in Restaurants, in Hotels und so weiter anlangt, an letzter Stelle in Europa, und auch das ist zu kritisieren. Es wird ab 2018 eine Lösung geben, aber bis dahin dauert es noch einige Zeit. Diesbezüglich sind wir auch Europameister, und das ist wirklich kein Ruhmesblatt.
Wie unsere Bundesministerin schon gesagt hat: Dieser Beschluss ist ein Meilenstein in der Jugendpolitik, wodurch nachhaltige Verbesserungsschritte für unsere Jugend gesetzt werden. Wir setzen nicht nur das Schutzalter auf 18 Jahre hinauf, sondern es geht, wie die Frau Ministerin angesprochen hat, auch um klare Präventionsmaßnahmen, und ich denke, das ist ein wichtiges Begleitinstrument.
Es geht um Jugendgesundheit. Es geht darum, dass die Bundesländer in diesem Zusammenhang auch eine einheitliche Position eingenommen haben – das ist bei vielen anderen Themen nicht der Fall. Es gibt oft intensive Diskussionen, aber je früher sich Raucher sozusagen mit der Gesundheitsschädlichkeit des Rauchens auseinandersetzen müssen, je früher wir mit den Jugendlichen darüber sprechen, umso besser ist es.
Es gibt auch viele positive Rückmeldungen von vielen NGOs, von der Gesellschaft für Medizinische Onkologie, von der Krebshilfe und so weiter, von Kinder- und Jugendanwälten, die das sehr positiv dargestellt haben; und dass ein höheres Alterslimit wirkt, hat Frau Kollegin Stöckl-Wolkerstorfer auch klar aufgezeigt. In Ländern wie Großbritannien – ich brauche das Beispiel nicht zu wiederholen – hat die Erhöhung eine ganz klare Auswirkung auf das Suchtpotenzial von jungen Menschen, von Jugendlichen gehabt. Die Raucherquote ist dort zurückgegangen. Das soll auch für uns Beispiel und Ansporn sein, an diesem Thema weiterzuarbeiten, und ich bin froh, dass es hier einen Schulterschluss gegeben hat.
Frau Kollegin Anderl, noch eine Bemerkung: Wir sind die Länderkammer und wir vertreten die Länder, es ist daher nicht der richtige Ansatz für uns als Ländervertreter, den Ländern Kompetenzen wegzunehmen. (Bundesrat Stögmüller: Wenn es unsinnig ist! Entschuldigung!) – Nein, wir sind die Länderkammer und haben die Länderinteressen zu vertreten. Kollege Stögmüller, du hast es auch angesprochen. Wenn wir in den Ländern noch Gestaltungsmöglichkeiten haben, dann sollten wir diese auch nützen. (Bundesrat Stögmüller: Wenn eh alles harmonisiert werden soll!)
Dass man mit den Ländern verhandeln kann, hat die Frau Ministerin ganz klar bewiesen. Da gibt es einen erfreulichen Schulterschluss – im Sinne der Jugendgesundheit und zum Wohl unserer Jugendlichen in Österreich –, und ich darf der Frau Ministerin zu diesem Erfolg herzlich gratulieren. (Beifall bei der ÖVP und bei Bundesräten der SPÖ.)
9.56
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Es freut mich, dass ich nunmehr die zweite Gruppe des Tiroler Seniorenbundes bei uns willkommen heißen darf, ganz besonders den ehemaligen Bundesratspräsidenten aus Tirol, Helmut Kritzinger. Herzlich willkommen! (Allgemeiner Beifall.)
Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Mag. Gruber-Pruner. Ich erteile es ihr.
9.56
Bundesrätin Mag. Daniela Gruber-Pruner (SPÖ, Wien): Frau Präsidentin! Frau Ministerin! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Über das Jugendschutzgesetz und das Rauchen ab 18 Jahren ist jetzt schon einiges gesagt worden. Ich denke, die Debatte passt heute deshalb besonders gut, weil morgen, am 7. April, der Weltgesundheitstag begangen wird. Daher ist diese heutige Debatte sehr passend.
Es muss das Ziel sein, das Rauchen generell zurückzudrängen, und zwar in allen Generationen. Es ist etwas scheinheilig, wenn wir Erwachsenen jetzt mit dem Finger auf die Jugendlichen zeigen und finden, sie sollten die Finger vom Rauchen lassen, aber selbst dem Rauchen frönen. Ich meine, es sollte eine gemeinsame Anstrengung aller Generationen geben, denn es geht um die Gesundheit aller, und da müssen wir uns alle an der Nase nehmen.
Aber natürlich geht es auch darum – und da gebe ich Ihnen, Frau Ministerin, recht –, das Einstiegsalter für das Rauchen zu erhöhen beziehungsweise zu versuchen, Menschen davon abzuhalten, mit dem Rauchen zu beginnen.
Als Pädagogin ist es mir ein besonderes Anliegen, auf die Gesundheitsförderung und auch auf die Förderung der Selbstbestimmtheit junger Menschen hinzuweisen. Das ist bestimmt der nachhaltigere und effektivere Weg, einen gesunden Lebensstil zu entwickeln, als noch mehr über Verbote nachzudenken, denn wir alle wissen, wenn man etwas lernen möchte, wenn man sich für etwas entscheiden will, dann braucht es Eigenmotivation, und diese kann am besten dann entstehen, wenn wir in Gesundheitsprävention und Gesundheitsförderung investieren.
Im Bereich der Pädagogik ist auch bekannt, dass das am besten gelingt, speziell bei jungen Menschen, wenn man mit Elementen der Peer Education arbeitet, wenn also junge Menschen für junge Menschen Aufklärungsarbeit, Gesundheitsförderung betreiben. Daher plädiere ich bei diesem Thema sehr stark dafür, junge Menschen in die Erarbeitung von Begleitmaßnahmen einzubeziehen. Ich plädiere sehr stark dafür, die Expertise der Bundesjugendvertretung zu nutzen. Das sind junge Menschen, die tagtäglich mit jungen Menschen arbeiten und die viel Erfahrung haben, wie man an junge Menschen herankommt, wie man sie anspricht, wie man sie für ein Thema begeistert und wie man sie vor möglichen Gefahren schützen kann.
Ich würde also dafür plädieren, dass – und das ist von der LandesjugendreferentInnenkonferenz auch versprochen worden –, wenn jetzt Begleitmaßnahmen erarbeitet werden, wirklich die Jugendorganisationen und die Bundesjugendvertretung miteinbezogen werden, damit man flächendeckend an alle Kinder und Jugendlichen in Österreich herankommt.
Zum Thema Schutz der Jugendlichen fallen mir auch noch einige andere Themen ein: Schutz von jungen Menschen, gerade wenn sie einer besonders vulnerablen Gruppe angehören; dann muss ihnen, denke ich, unsere Aufmerksamkeit gewidmet sein.
Ein Thema ist bestimmt der Schutz junger Menschen vor Gewalt, aber dazu kommen wir noch beim nächsten Tagesordnungspunkt, beim EU-Bericht. Es geht aber auch um den Schutz von Kindern und Jugendlichen, die eine Behinderung haben und besondere individuelle Fürsorge und Förderung brauchen. Es geht auch darum, den Schutz von Kindern und Jugendlichen auf der Flucht auszubauen. Wir wissen, dass es da in den einzelnen Ländern sehr unterschiedliche Bestimmungen gibt. Weiters geht es um den Schutz von Kindern, die in Einrichtungen der Kinder- und Jugendwohlfahrt untergebracht sind. Ich denke, der Schutzbegriff soll generell nicht nur bei Verboten, sondern beim Schutz aller unserer Jugendlichen und aller vulnerablen Gruppen ansetzen.
Es hat sich jetzt gezeigt, dass eine Lösung, wenn man eine gemeinsame Sicht auf eine Problemlage entwickelt, möglich ist. Ich wünsche mir solche Lösungen und eine solche gemeinsame Sicht für die verschiedenen Problemlagen, die unsere Jugendlichen betreffen. – Danke schön. (Beifall bei der SPÖ, bei Bundesräten der ÖVP sowie der Bundesrätin Schreyer.)
10.01
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Als Nächster ist Herr Bundesrat Meißl zu Wort gemeldet. Ich erteile ihm dieses.
10.01
Bundesrat Arnd Meißl (FPÖ, Steiermark): Frau Präsidentin! Frau Ministerin! Meine Damen und Herren! Rauchen ist gefährlich, das haben alle gewusst, aber dass Rauchen auch den Koalitionsfrieden gefährdet, ist mir neu. Das ist spannend. (Zwischenruf des Bundesrates Mayer.) – Na ja, das hat sich für mich anders angehört.
Jetzt kommt wieder einmal ein Outing – die Vorredner haben ja auch alle mit einem Outing begonnen –: Ja, ich bin mit 14 Jahren auch Raucher gewesen, und das war schlecht so. Die Betonung liegt aber auf 14.
Ich habe mir dazu eine passende Statistik herausgesucht. Wir besprechen heute ja das Rauchverbot bis 18, und es sind schon einige Statistiken zitiert worden. Ich habe eine gefunden, die durchaus interessant ist. Sie betrifft 15-jährige Raucher, die mindestens einmal in der Woche rauchen. In Österreich sind das 27 Prozent, und damit sind wir Europameister, wenn nicht gar Weltmeister.
Ich frage mich, warum das bloße Hinaufsetzen des gesetzlichen Alters, ab dem geraucht werden darf, Wirkung zeigen sollte, wenn wir es nicht schaffen, die Jugend vom Rauchen abzuhalten.
Eines sei schon gesagt: Die Jugend ist offenbar gescheiter als wir. Den meisten von uns sitzt der Marlboro-Mann ein bisschen im Hinterkopf. Ich glaube, es hat insgesamt sieben gegeben, sechs davon sind dann mit einem Lungenpatschen vom Pferd gefallen. Wir haben damals nichts daraus gelernt, die Jugend lernt aber daraus, sie lernt auch beim Alkohol. In diesen Bereichen zeigt die Jugend durchaus, dass sie gescheiter ist als wir Älteren, und verzichtet einfach auf diese unseligen Errungenschaften.
Eine weitere Statistik ist mehrfach zitiert worden – auch von Ihnen, Frau Ministerin –, die besagt, dass das Hinaufsetzen des gesetzlichen Alters etwas bringen würde. In Bel-
gien zum Beispiel ist, glaube ich, auch 16 Jahre das gesetzliche Alter. Die OECD-Studie zeigt, dass die Belgier genau im OECD-Schnitt liegen. Das allein kann also nicht der Grund sein, warum man nicht raucht.
Einige Experten – nicht alle – sagen übrigens auch, das Einzige, was die Jugend wirklich beeindruckt, ist der Preis. Wenn das Rauchen so teuer wird, dass es sich die Jungen nicht mehr leisten können oder sie vor die Entscheidung Rauchen oder Smartphone gestellt werden, dann schnappen sie sich das Smartphone und ersparen sich das Rauchen.
Eine Sache gibt es noch zur Überwachung zu sagen: Sie funktioniert jetzt schon nicht richtig, auch wenn man in die Automaten eine Karte hineinstecken muss. Es hat Testungen gegeben, wonach abgelaufene Kreditkarten ausreichen, um das „Alter“ – unter Anführungszeichen – des Benützers zu bestimmen. Wenn er bar bezahlt, kann also auch ein 14-Jähriger mit einer abgelaufenen Kreditkarte von Mama oder Papa Zigaretten kaufen. Da wäre auch einmal anzusetzen, damit man das wirklich in den Griff bekommt.
Dass Rauchen schädlich ist, brauchen wir nicht zu diskutieren, denn das ist ganz eindeutig so. Ich bin auch dafür, dass man alle Nichtraucher vor den Auswirkungen des Rauchens schützt. Ich sage als Person, die Gott sei Dank seit 20 Jahren Nichtraucher ist: Ich bin ein militanter Nichtraucher, mich stört der Rauch mittlerweile, und ich brauche das Rauchen nicht. Der Knackpunkt ist aber schon, dass es eigentlich im Rahmen der Selbstbestimmung jedes Einzelnen liegt, ob er seine Gesundheit aufs Spiel setzen will oder nicht, ob er rauchen will oder nicht.
Es ist bereits am Anfang angesprochen worden, dass wir das Rauchverbot nicht mit bestimmten anderen Verboten oder Geboten vergleichen können. Die Jugend darf mit 16 wählen, also unter Umständen über das Leben anderer bestimmen, mit 16 den Führerschein beginnen und mit 17 fahren, dabei wird Verantwortung für das Leben anderer übernommen, aber die Jugend darf nicht selbst entscheiden, ob sie die eigene Gesundheit aufs Spiel setzen will oder nicht. Grundsätzlich bin ich dafür, dass man jede Maßnahme setzt, um die Jugend darüber aufzuklären, wie schlecht und ungesund das ist, damit sie die Folgen, die sie noch nicht abschätzen kann, dann doch frühzeitig begreift.
Meine Redezeit ist fast vorbei, aber ich möchte noch den Bezug zu Cannabis ansprechen, das kann ich mir nicht sparen: Der Besitz von Cannabis ist zum Beispiel strafbar, und wir wissen, dass Cannabis eine andere Qualität im Bereich der Drogen hat als das Rauchen selbst. Rauchen kann durchaus auch die Einstiegsdroge Nummer eins sein, aber da stimmt die Verhältnismäßigkeit nicht.
Ich bin bei Ihnen, was die Vereinheitlichung des Jugendschutzgesetzes betrifft. Das ist auch mehrfach angesprochen worden, und da stimme ich David Stögmüller zu. Das ist eine Materie, die nicht in den Bundesländern geregelt werden sollte, sondern für das ganze Land, denn die Jugendlichen sind überall gleich. Ein Beispiel sind die Ausgehzeiten in der Grenzregion Steiermark und Niederösterreich: Wenn man an der Landesgrenze steht und hin und her springt, darf man auf der einen Seite noch fortbleiben, auf der anderen Seite muss man aber heimgehen, denn die einen haben 1 Uhr und die anderen 23 Uhr als Grenze. Das passt nicht, da muss man etwas machen.
Wie gesagt: Die Wahlfreiheit muss gegeben bleiben. Rauchen ist nicht toll, es ist ungesund, und das muss man den Leuten sagen. Mein Schlusssatz lautet: Ohne Rauch geht’s auch. – Danke. (Beifall bei der FPÖ sowie des Bundesrates Mayer.)
10.07
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Als Nächste ist Frau Bundesrätin Mag. Schreyer zu Wort gemeldet. – Bitte, Frau Bundesrätin.
10.07
Bundesrätin Mag. Nicole Schreyer (Grüne, Tirol): Hohes Haus! Sehr geehrte Frau Ministerin! Sehr geehrte Gäste hier im Saal und zu Hause! Es ist schon sehr viel gesagt worden, und als Letztrednerin steht man immer vor der großen Herausforderung, nicht zu viel zu wiederholen. Es sind viele Studien zitiert worden, die eigentlich alle eindeutige Ergebnisse gebracht haben, die die Gefahren aufzeigen.
Ich möchte noch einen ganz neuen Aspekt einbringen: Gestern fand die Pflege-Enquete des Bundesrates statt. Unter anderem war ein Vertreter der Europäischen Kommission dabei, der eine Studie vorgestellt hat, die zeigt, dass Österreich beim Durchschnittsalter im EU-Schnitt liegt. Beim Gesundheitsalter aber, also bei der Zeit, die ein Mensch durchschnittlich als gesunder Mensch verbringt, liegen wir viereinhalb Jahre unter dem EU-Schnitt. Viereinhalb Jahre sind schon viel, wir liegen bei circa 57 Jahren, der EU-Schnitt liegt bei etwa 61 Jahren. Das sind wirklich ganz gravierende Zahlen. Ich war auch ganz baff, denn wir sind doch ein gesundes Bergsteigerland. Vielleicht liegen die Tiroler ein bisschen unter viereinhalb. (Zwischenruf des Bundesrates Mayer.) Ich habe gedacht, dass wir als mitteleuropäisches Land mit einem hohen Lebensstandard und einer hohen Einkommensrate schon näher am Durchschnitt liegen würden.
Es geht wirklich darum, an dieser Zahl zu arbeiten, die gesund erlebte Zeit zu verlängern. Das gilt vor allem im volkswirtschaftlichen Sinn, denn gesündere Menschen kosten weniger und haben mehr vom Leben. Dabei geht es gar nicht um Verbote, sondern einfach darum, die Gesundheitserwartung zu steigern.
Es ist schon gesagt worden, dass man den Hauptfokus auf Prävention, Bewusstseinsbildung und Preisgestaltung legen soll. Wir sind uns einig, dass die Preisgestaltung wahrscheinlich die größte Erfolgsaussicht hat. Ich bin auch kein Fan von Verboten, der Dialog sollte immer den Verboten vorgezogen werden, in diesem Fall geht es aber auch wieder um eine Sache, die im Rest von Europa ganz normal ist. Ein weiteres Beispiel ist, dass es außer in Österreich nur mehr in drei Ländern der EU eine Wehrpflicht gibt. Rauchen ab 18 ist in Europa total normal und Realität. Es gibt nur mehr zwei Länder außer Österreich, nämlich Belgien und Luxemburg, die noch Rauchen ab 16 erlauben, alle anderen Länder in Europa erlauben Rauchen erst ab 18.
Wie gesagt: Es sind einige Studien zitiert worden, und die gesundheitlichen Vorteile sind einfach wirklich ausschlaggebend. Die Debatte darf eigentlich nur so gesehen werden, dass es nicht gegen die Jugendlichen geht, nicht gegen das Selbstbestimmungsrecht von Jugendlichen, sondern um ihre Gesundheit, auch später als Erwachsene. – Danke schön. (Beifall bei den Grünen und bei Bundesräten von ÖVP und SPÖ.)
10.09
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Zu einer abschließenden Stellungnahme hat sich die Frau Bundesministerin für Familien und Jugend zu Wort gemeldet. Ich darf Sie bitten, die Redezeit von 5 Minuten nach Möglichkeit einzuhalten. – Bitte, Frau Ministerin.
10.10
Bundesministerin für Familien und Jugend MMag. Dr. Sophie Karmasin: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte die Zeit nicht überstrapazieren, ich denke, es wurde schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Ich möchte daher zusammenfassen und vielleicht noch ein paar Zusatzargumente bringen, die noch nicht angeführt wurden.
Dadurch, dass wir das Schutzalter auf 18 legen, wird der Erwerb und der Konsum von Tabak bei 14- und 15-Jährigen deutlich reduziert. Warum? – In Studien wurde ganz klar herausgearbeitet, dass 14- und 15-Jährige Freunde haben, die 16 und 17 sind, die jetzt eben legal Zigaretten kaufen können. Wenn 14-Jährige aber dann 18- und 19-Jährige bitten müssen, Zigaretten zu kaufen, fällt das viel schwerer, weil man einfach nicht diesen
Bekanntenkreis hat. Daher ist es nachvollziehbar, dass wir mit der Anhebung des Schutzalters auch den Konsum bei 14- und 15-Jährigen entscheidend reduzieren werden, weil sie nicht mehr an das Rauchwerk kommen werden. – Das ist das eine.
Das Zweite, das ich noch kurz einbringen möchte, betrifft die Arbeitsgruppe: Ja, auf jeden Fall wird die Bundesjugendvertretung einen massiven Anteil haben, das ist schon so vorgesehen, und es ist überhaupt keine Frage, dass Jugendspezialisten im eigentlichen Sinne zu Wort kommen werden. Es wird auch eine ganz interessante Erkenntnis aus Amerika einfließen, nämlich die Tatsache, dass das Rauchen in Soap Operas und Filmen einen ganz massiven Einfluss auf den Tabakkonsum bei Jugendlichen hat. Das heißt also, wenn in diesen klassischen Jugendserien junge Menschen rauchen – vielleicht auch noch Schauspielerinnen oder Schauspieler, die Role Models sind –, dann hat das einen ganz entscheidenden Effekt. Wir müssen uns auch dafür starkmachen, dass wir dieses Thema auf nationaler Ebene diskutieren und möglicherweise auch bearbeiten werden.
Das sind also noch zwei Themen, die ich einbringen wollte. Ansonsten möchte ich mich noch einmal dafür bedanken, dass dieser Entschluss, diese Entscheidung gefallen ist, die zum Wohle unserer Gesellschaft, zum Wohle unserer Jugend und in weiterer Folge auch zur gesamten Gesundheitsprävention beiträgt, und wir das einstimmig beschließen konnten. Ich bedanke mich für diese sachliche Entscheidungsfindung. – Danke. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
10.12
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Vielen Dank, Frau Bundesministerin.
Die Aktuelle Stunde ist beendet.
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Hinsichtlich der eingelangten, vervielfältigten und verteilten Anfragebeantwortung 2966/AB-BR/2017,
jener Verhandlungsgegenstände, die gemäß Artikel 42 Abs. 5 B-VG nicht dem Mitwirkungsrecht des Bundesrates unterliegen,
von Schreiben des Ministerratsdienstes des Bundeskanzleramtes
betreffend den Aufenthalt des Bundesministers für Finanzen Dr. Johann Georg Schelling vom 6. (abends) bis 8. April 2017,
betreffend den Aufenthalt des Bundesministers für Landesverteidigung und Sport Mag. Hans Peter Doskozil am 5. und 6. April 2017,
betreffend den Aufenthalt des Bundeskanzlers Mag. Christian Kern am 6. April 2017 beziehungsweise
betreffend den Aufenthalt des Bundesministers für Europa, Integration und Äußeres Sebastian Kurz am 6. April 2017 in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union
verweise ich auf die im Sitzungssaal verteilten Mitteilungen gemäß § 41 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Bundesrates, die dem Stenographischen Protokoll dieser Sitzung angeschlossen werden.
Eingelangt ist ein
Schreiben des Bundesministers für Finanzen gemäß
Artikel 50 Abs. 5
B-VG betreffend Aufnahme von Verhandlungen über ein Multilaterales
Übereinkommen zur Umsetzung von
Maßnahmen betreffend Steuerabkommen zur Vermeidung der Verminderung von Bemessungsgrundlagen und
Gewinnverlagerung beziehungsweis
e
ein Schreiben des Generalsekretärs des Bundesministeriums für Europa, Integration und Äußeres gemäß Artikel 50 Abs. 5 B-VG betreffend Aufnahme von Verhandlungen über die Änderung des Abkommens zwischen der Regierung der Republik Österreich und dem Ministerrat der Republik Albanien über die Zusammenarbeit auf den Gebieten der Kultur, der Bildung und der Wissenschaft,
ein Schreiben des Bundeskanzlers gemäß Artikel 23c Abs. 5 B-VG betreffend die Nominierung von Frau Landeshauptmann-Stellvertreterin Mag. Johanna Mikl-Leitner als Mitglied des Ausschusses der Regionen in Nachfolge von Herrn Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll sowie
ein Schreiben des Bundeskanzlers gemäß Artikel 23c Abs. 5 B-VG betreffend die Nominierung von Frau MMag. Karin Rysavy als Mitglied im Verwaltungsrat der Europäischen Investitionsbank.
Hinsichtlich des Wortlautes verweise ich ebenfalls auf die im Sitzungssaal verteilten Mitteilungen gemäß § 41 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Bundesrates, die dem Stenographischen Protokoll dieser Sitzung angeschlossen werden.
Die schriftlichen Mitteilungen haben folgenden Wortlaut:
Anfragebeantwortung (siehe S. 15)
*****
Beschlüsse des Nationalrates, die gemäß Art. 42 Abs. 5 B-VG nicht dem Mitwirkungsrecht des Bundesrates unterliegen:
Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2017 bis 2020 geändert wird (1567/NR der Beilagen)
Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die unentgeltliche Eigentumsübertragung von Liegenschaften und Mobilien des Bundes an das Land Salzburg erlassen und das Bundesimmobiliengesetz geändert wird (1415/NR und 1565/NR der Beilagen)
*****
Schreiben des Bundeskanzleramtes betreffend Aufenthalt von Mitgliedern der Bundesregierung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union:
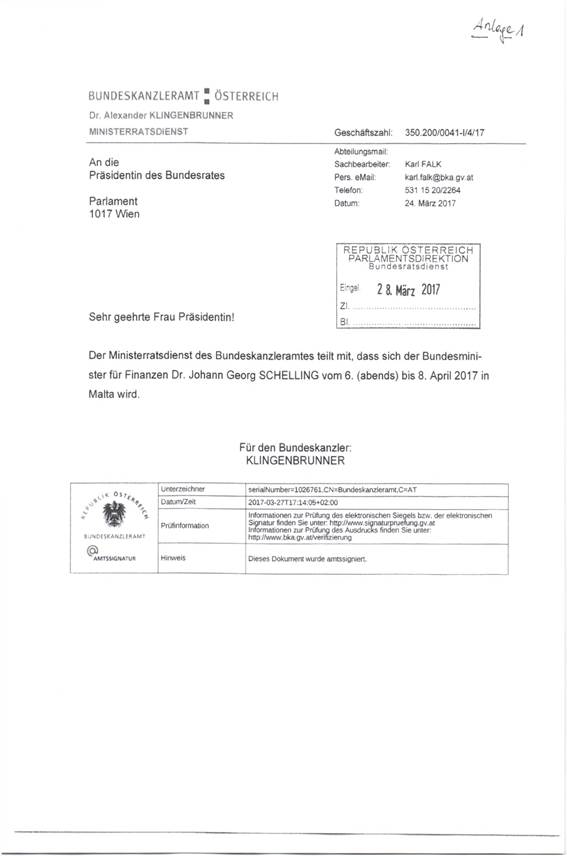
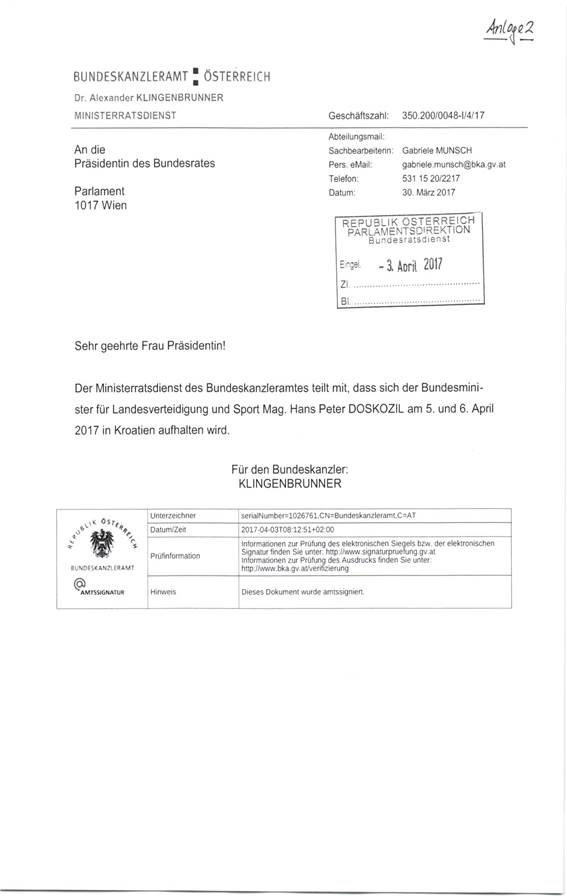
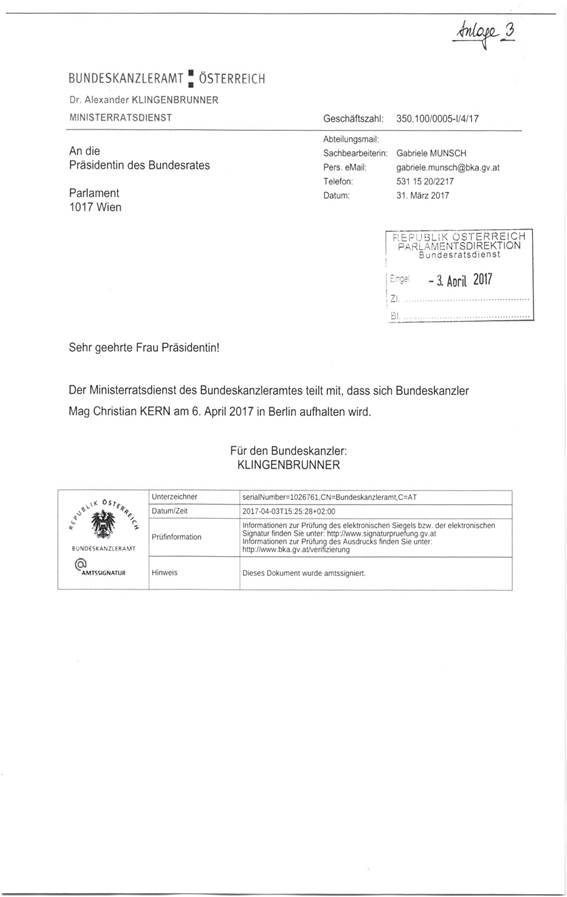
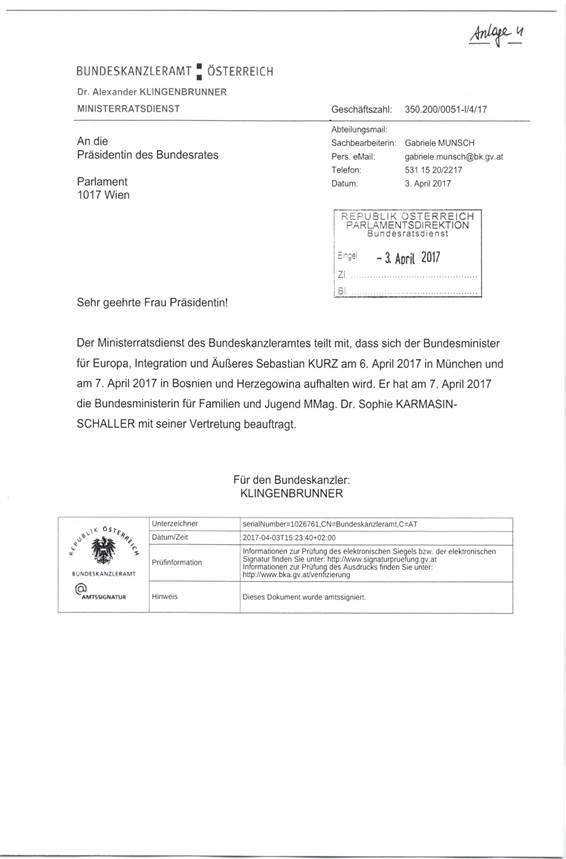
*****
Schreiben des Bundesministers für Finanzen gemäß Artikel 50 Abs. 5 B-VG:
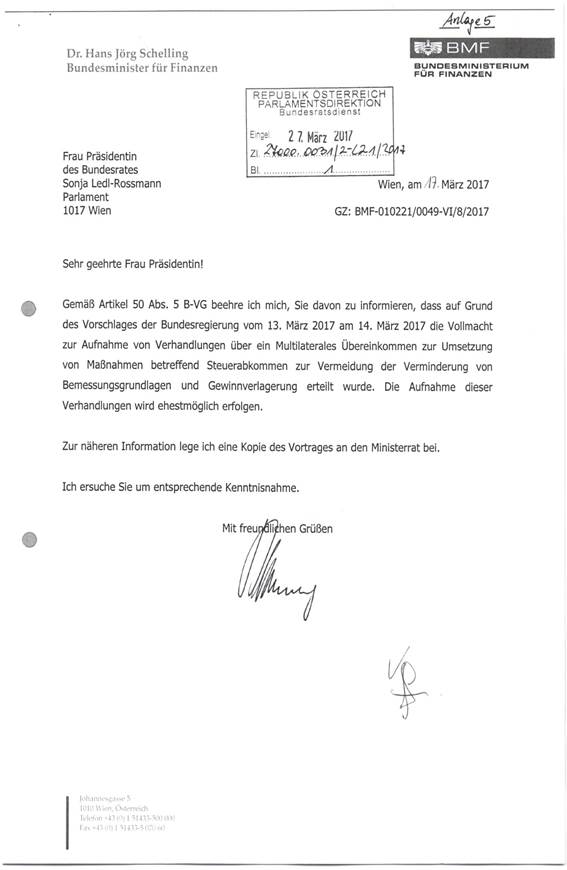
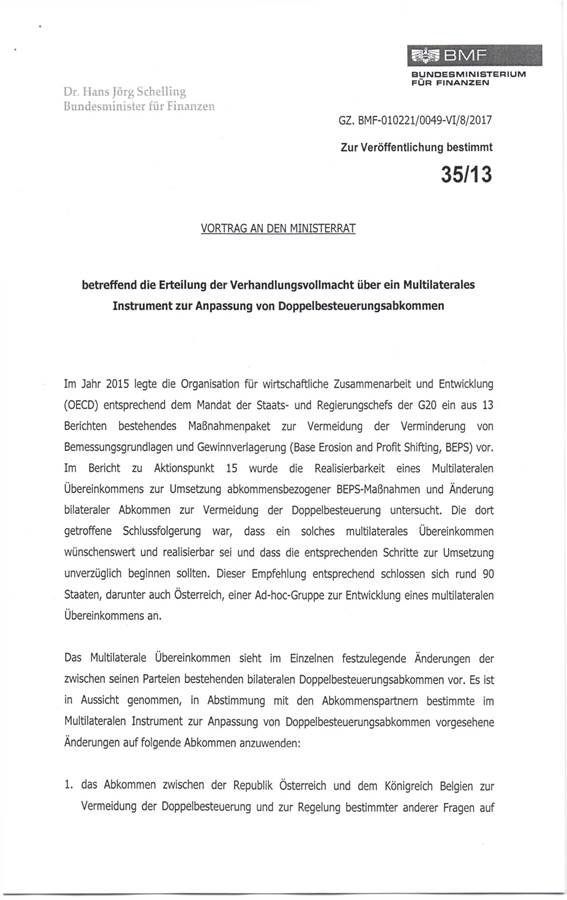
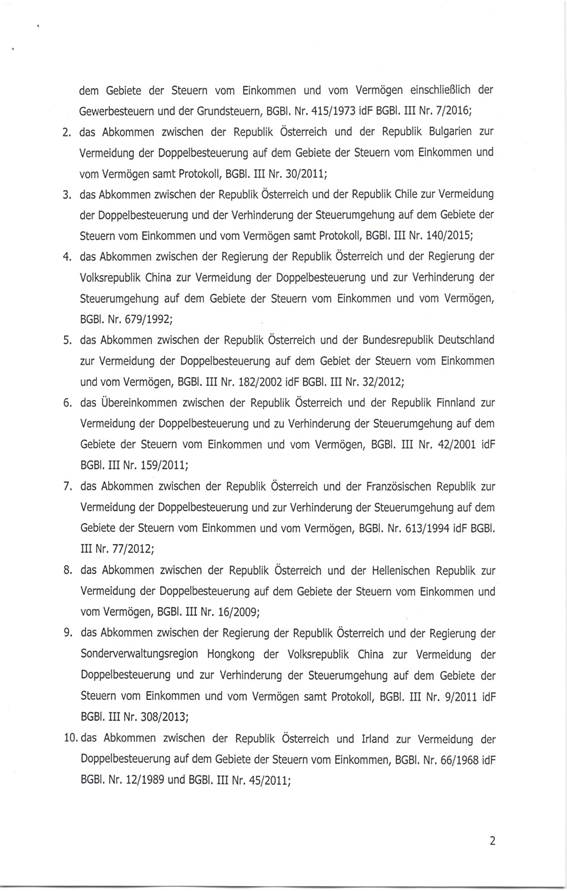
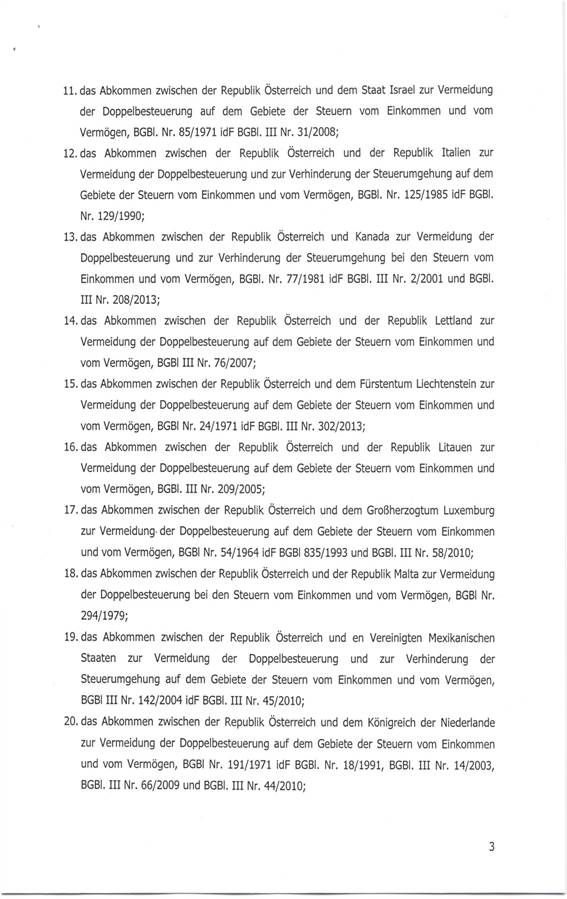
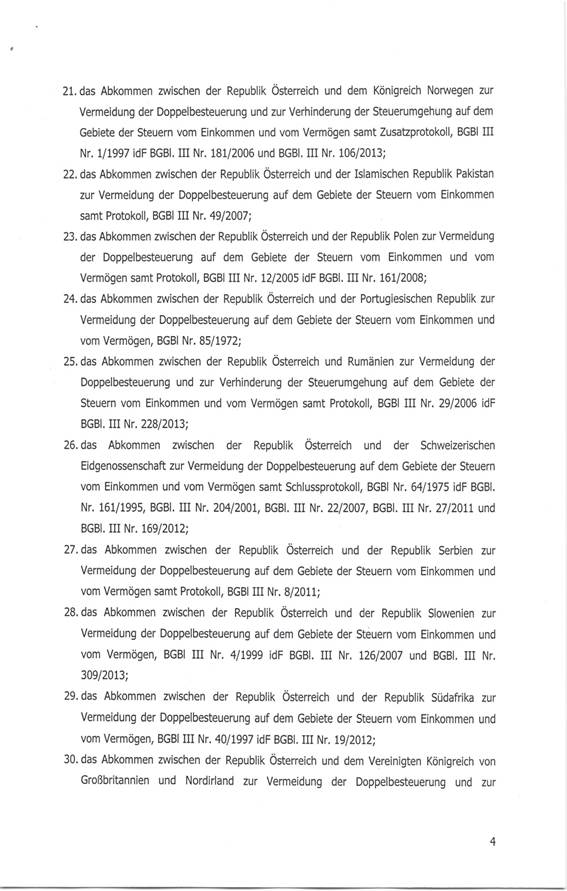
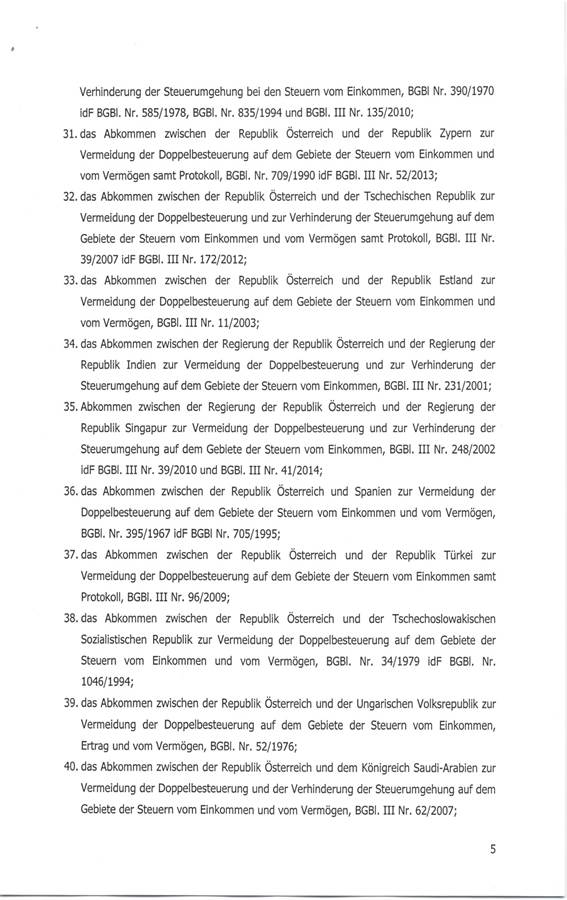
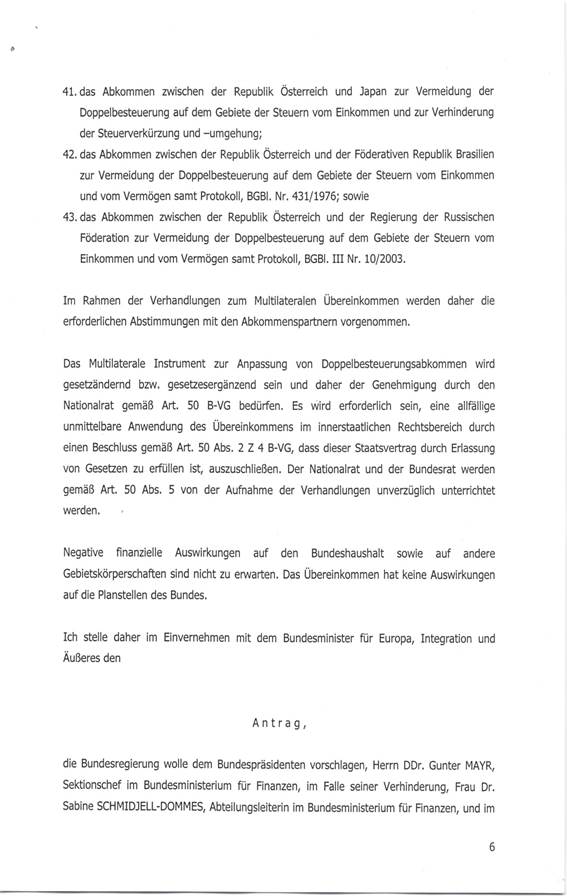

*****
Schreiben des Generalsekretärs für auswärtige Angelegenheiten gemäß Artikel 50 Abs. 5 B-VG:
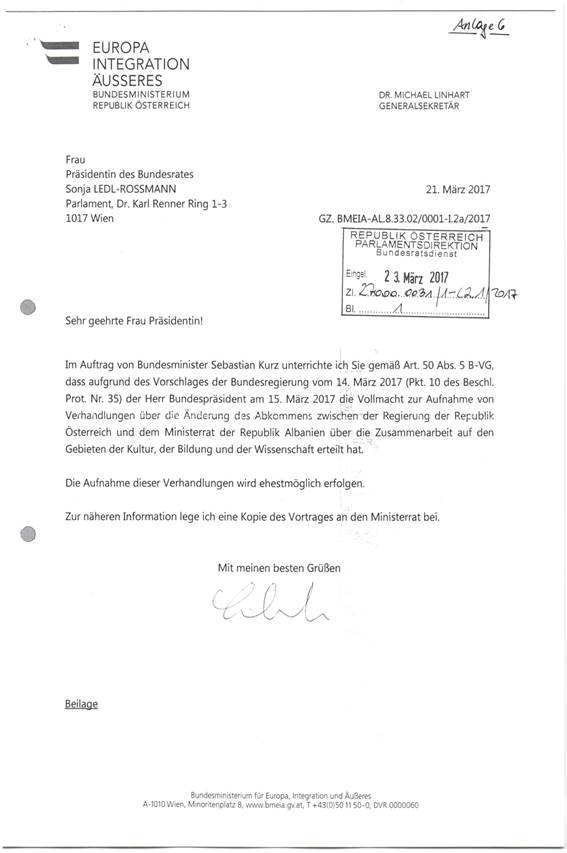
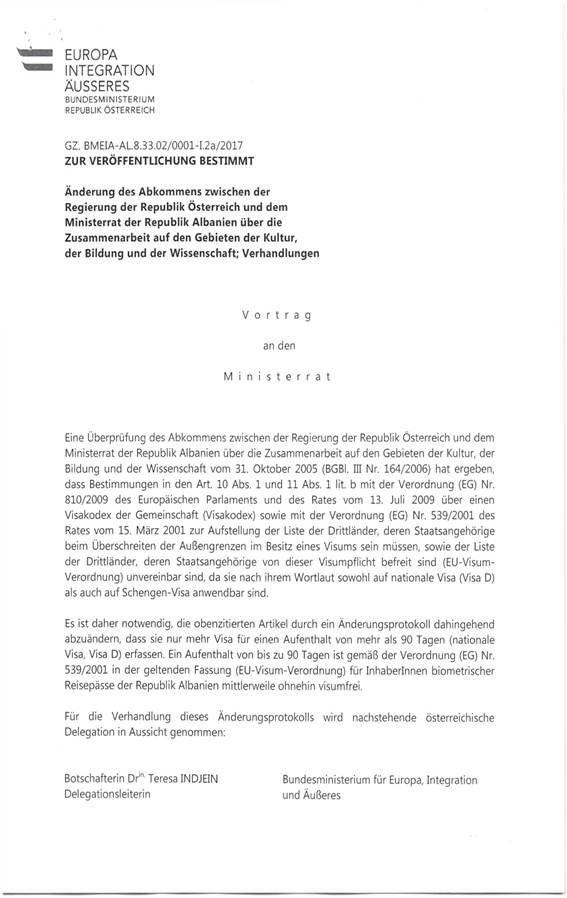
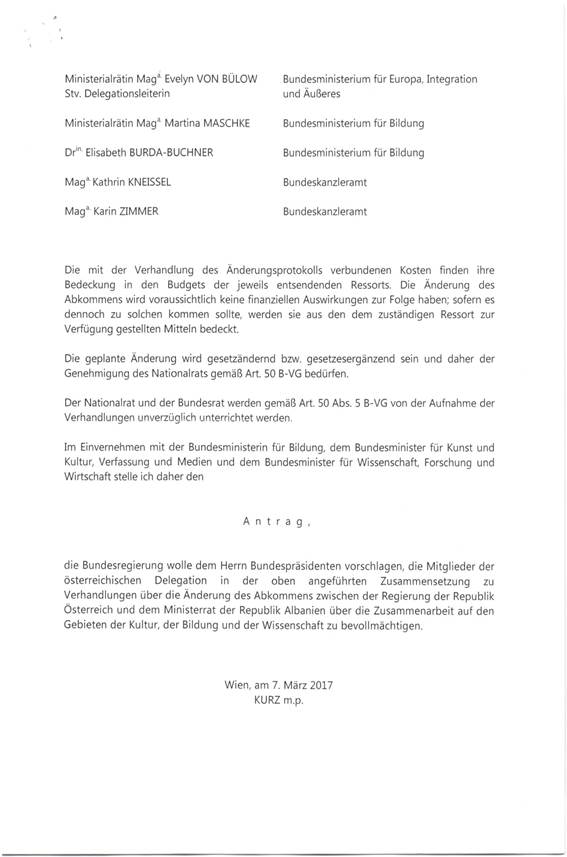
*****
Schreiben des Bundeskanzlers betreffend Nominierung gemäß Artikel
23c Abs. 5
B-VG:
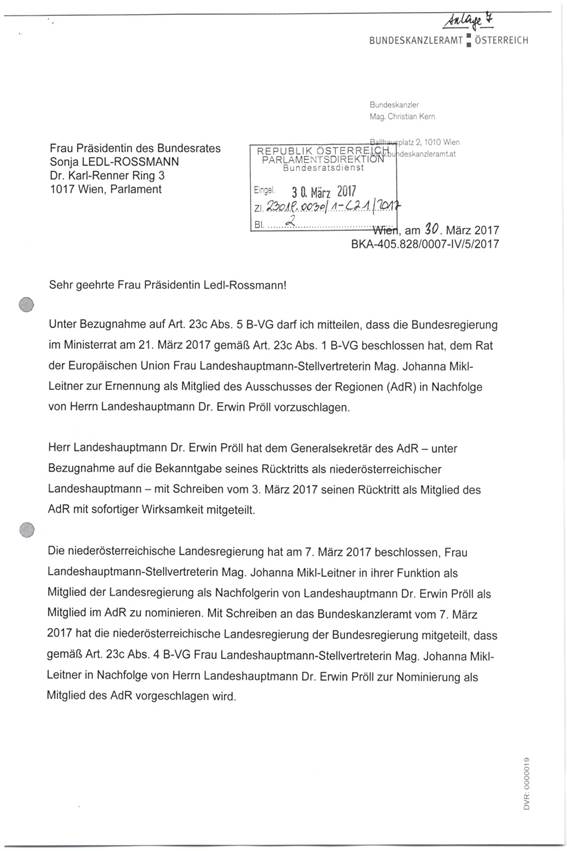
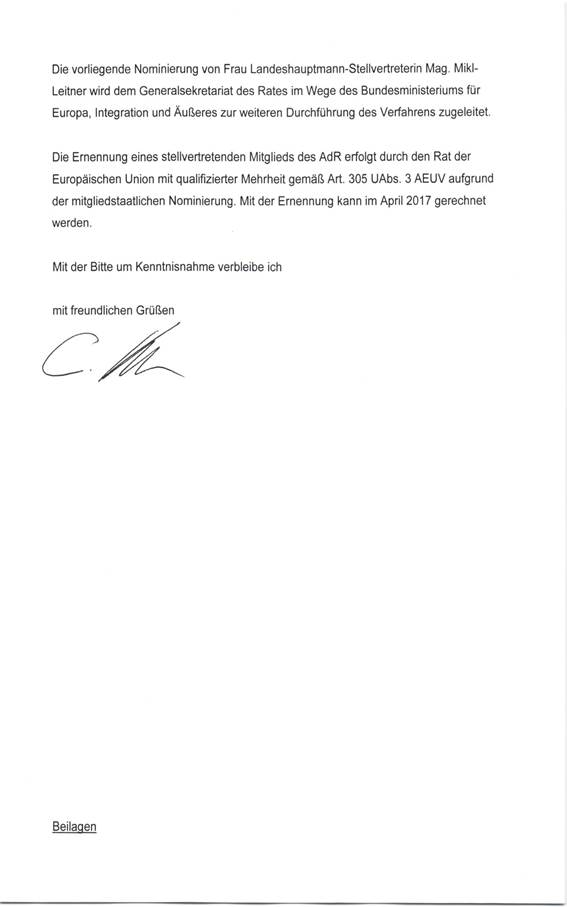
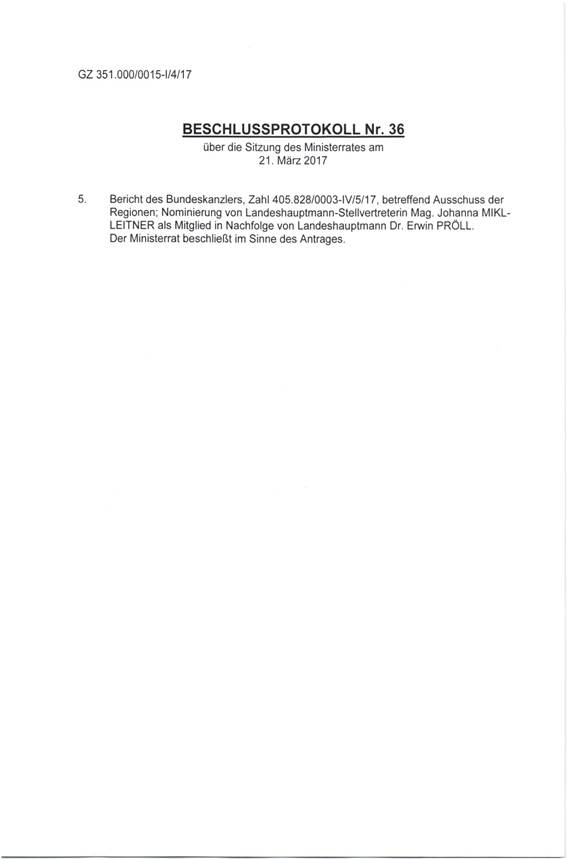
*****
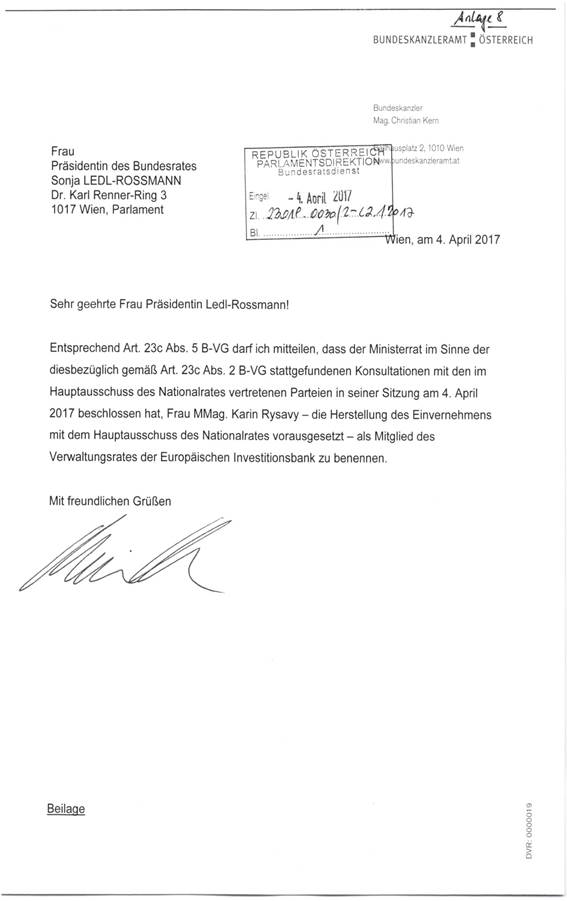
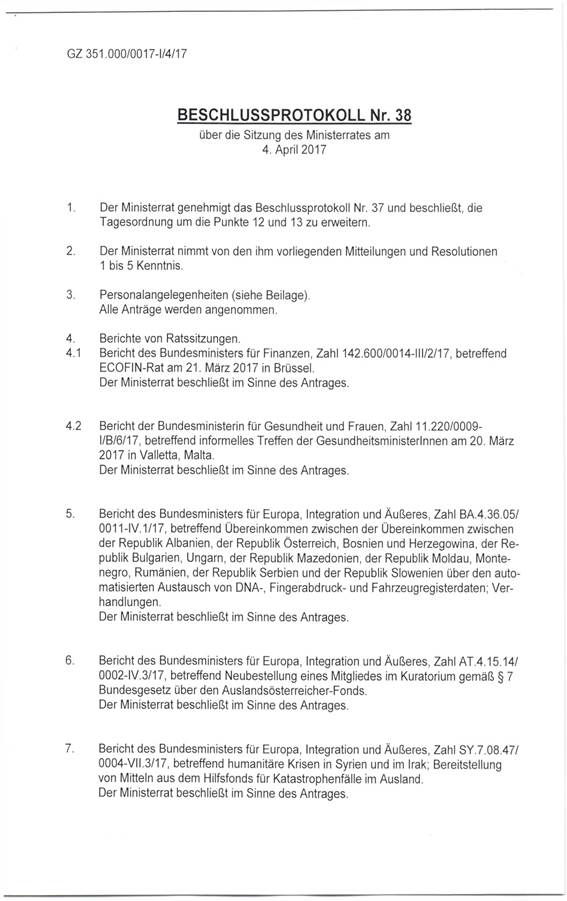
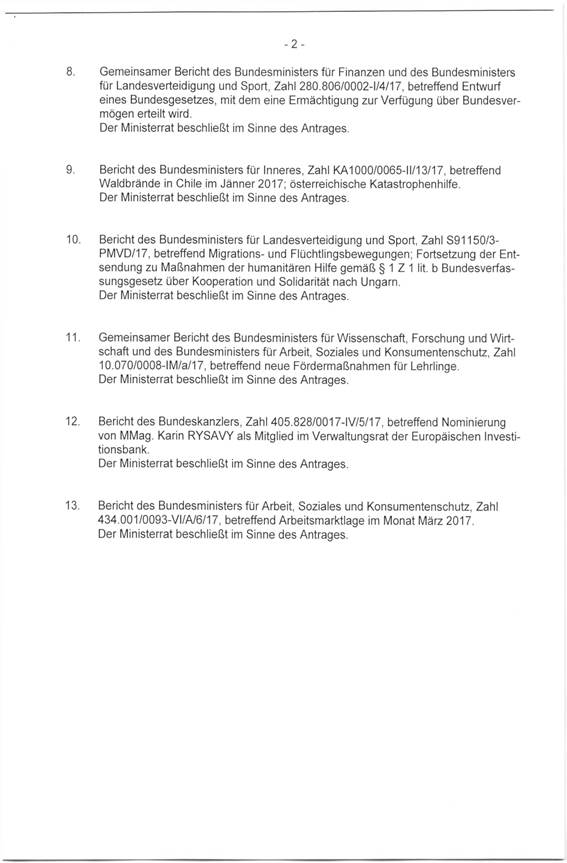
*****
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Eingelangt ist weiters der Bericht der Bundesanstalt für Verkehr über technische Unterwegskontrollen im Jahr 2016, vorgelegt vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie (III-619-BR/2017 d.B.), der dem Ausschuss für Verkehr zur Vorberatung zugewiesen wurde.
Weiters eingelangt sind und den zuständigen Ausschüssen zugewiesen wurden jene Beschlüsse des Nationalrates sowie jene Berichte, die jeweils Gegenstand der heutigen Tagesordnung sind.
Die Ausschüsse haben ihre Vorberatungen abgeschlossen und schriftliche Ausschussberichte erstattet.
Ich habe die zuvor genannten Verhandlungsgegenstände auf die Tagesordnung der heutigen Sitzung gestellt.
Wird zur Tagesordnung das Wort gewünscht? – Das ist nicht der Fall.
Behandlung der Tagesordnung
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Aufgrund eines mir zugekommenen Vorschlages beabsichtige ich, die Debatte über die Tagesordnungspunkte 3 bis 5, 7 und 8, 13 und 14, 15 und 16, 18 und 19, 22 bis 24 sowie 30 und 31 jeweils unter einem durchzuführen.
Erhebt sich dagegen ein Einwand? – Das ist nicht der Fall.
EU-Vorhaben des Bundesministeriums für Familien und Jugend 2017 (III-603-BR/2017 d.B. sowie 9751/BR d.B.)
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Wir gehen in die Tagesordnung ein und gelangen zu Punkt 1.
Berichterstatter zu diesem Punkt ist Herr Bundesrat Ing. Pum. Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatter Ing. Andreas Pum: Geschätzte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau Ministerin! Werte Kolleginnen und Kollegen des Bundesrates! Ich bringe den Bericht des Ausschusses für Familie und Jugend über das EU-Vorhaben des Bundesministeriums für Familien und Jugend 2017.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor; ich komme daher gleich zur Antragstellung:
Der Ausschuss für Familie und Jugend stellt nach Beratung der Vorlage am 4. April 2017 mit Stimmenmehrheit den Antrag, das EU-Vorhaben des Bundesministeriums für Familien und Jugend 2017 zur Kenntnis zu nehmen.
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Vielen Dank für den Bericht.
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Meißl. Ich erteile ihm dieses.
10.17
Bundesrat Arnd Meißl (FPÖ, Steiermark): Frau Präsidentin! Frau Bundesminister! Meine Damen und Herren! Bevor ich meine Rede beginne, darf ich meinen Landesparteiobmann, den Klubobmann der FPÖ im Steirischen Landtag, Mario Kunasek, bei uns im Haus begrüßen. Er war auch als Nationalrat in diesem Haus tätig. Servus, Mario! (Beifall bei FPÖ, ÖVP und SPÖ.)
Der vorliegende EU-Vorhabensbericht des Bundesministeriums für Familien und Jugend 2017 ist aus unserer Sicht durchaus differenziert zu betrachten. Grundsätzlich
macht es aus unserer Sicht ja wenig Sinn, einen Bericht zur Abstimmung zu bringen. Sinnvoller wäre es, die darin enthaltenen Maßnahmen zu beraten, dann gemeinsam nach Lösungen zu suchen und darüber zu befinden, nur so ist es halt leider nicht, deswegen gibt es diese Vielzahl an Berichten. Was die Sache in dem Fall noch ein bisschen zäher macht, ist, dass der neue Bericht dem Bericht 2016 und dem der Vorjahre sehr ähnlich ist. Das ist einfach darauf zurückzuführen, dass es manchmal Fortschreibungen gibt, und da und dort stellt sich dann doch die Frage, warum in manchen Bereichen nichts weitergeht.
Im Bericht selbst finden sich dann durchaus interessante Themen wie die Einbindung junger Menschen unter Berücksichtigung der grundlegenden europäischen Werte, der Generationendialog oder der einfache Übergang junger Menschen vom Jugend- ins Erwachsenenalter, insbesondere was den Arbeitsmarkt betrifft. Es finden sich auch die Themen Gesundheit und der Umgang der Jugend mit der Digitalisierung, wobei die Chancen und Gefahren beleuchtet werden. Das ist ja durchaus ein gescheiter und richtiger Ansatz.
Spannend wird es dann aus unserer Sicht schon beim Kapitel zu Herausforderungen und Chancen, die sich der Jugend angeblich aufgrund der wachsenden Zahl junger Migranten und Flüchtlinge bieten. Schlussendlich befasst sich der Bericht auch noch mit dem Bereich Extremismus und mit dem Erasmus-Programm. Am Ende streift er noch kurz das Thema Verbot jeglicher Gewalt gegen Kinder, wobei wir uns in diesem Haus sowieso darin einig sind, dass das etwas ist, das absolut und bedingungslos zu verfolgen ist, weil Kinder einfach die Schwächsten in der Gesellschaft sind.
Jetzt – in diesem Zusammenhang – ist vielleicht auch der geeignete Zeitpunkt, daran zu erinnern, was gerade in Syrien passiert ist. Nach dem Giftgasangriff vor zwei Tagen, der über 80 Tote gefordert hat – darunter sehr viele Kinder –, dürfen wir einfach nicht zur Tagesordnung übergehen. Da muss es Maßnahmen geben. Ich glaube, es wäre ein schönes Zeichen, wenn zumindest im Rahmen dieser Debatte jeder Redner darauf eingehen würde. Damit würden wir ein Zeichen nach außen setzen, dass wir das nicht tolerieren können oder wollen.
Eines der grundlegendsten familienpolitischen Anliegen ist aus meiner Sicht die Kinderbetreuung und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf – die kommt im Bericht zum Schluss auch noch vor, in verkürzter Form. Aus dem Bericht, der nicht allzu lang, aber durch die jährliche Wiederholung doch manches Mal ein bisschen anstrengend zu lesen ist, habe ich mir erlaubt, zwei, drei Dinge herauszupicken.
Das erste ist die Eingliederung der Jugend in den Arbeitsmarkt, oder wie es so schön heißt, der „Übergang junger Menschen vom Jugend- ins Erwachsenenalter“. Vor einem Jahr wurde die Ausbildungspflicht bis zum 18. Lebensjahr beschlossen. Das ist einerseits eine gute Sache, weil man der Jugend Beschäftigung bietet, auf der anderen Seite ist es so, dass die Ausbildungspflicht viele Probleme im Bereich der Bildung einfach zudeckt und überdeckt. Die Ausbildungspflicht als solche kann kaum Erfolg haben, wenn man sieht, wie viele Schwächen Pflichtschulabgänger heute haben. Das BIFIE hat diesbezüglich Daten erhoben und kommt zu dem Schluss, dass 69 Prozent aller Pflichtschulabgänger große Leseschwächen haben; bei den jugendlichen Pflichtschulabgängern mit Migrationshintergrund sind es sogar 84 Prozent.
Da wäre es aus unserer Sicht durchaus wünschenswert, wenn man die Prioritäten richtig setzt und in diesem Bereich zuerst einmal schaut, dass die Kinder grundlegende Fähigkeiten erlernen, denn kein Lehrherr will einen jungen Menschen zur Ausbildung übernehmen, der grundlegende Fähigkeiten nicht beherrscht. Das beklagen die Unternehmer ja zu Recht. Es ist überhaupt sehr problematisch, dass immer weniger Unternehmen Lehrlinge selbst ausbilden. Da fehlt es einfach an den geeigneten Anreizen für Unternehmer, da hat es sicher Versäumnisse gegeben. Die Ausbildung in Betrieben ist mit
Sicherheit immer noch die bessere Form, da lernen die Jugendlichen immer noch mehr, als es durchschnittlich in den überbetrieblichen Ausbildungsstätten der Fall ist.
Ein spannender Punkt ist aus unserer Sicht, wie gesagt, das Thema der Herausforderungen, vor denen die EU aufgrund der wachsenden Zahl junger Migranten und Flüchtlinge steht, und der Chancen, die sich in dem Bereich bieten. Die Herausforderungen einer verfehlten Zuwanderungspolitik sieht man wohl, die Chancen, die sich daraus ergeben, sind aber nur sehr schwer zu erkennen. Die meisten der Zuwanderer sind schlecht ausgebildet, wollen sich kaum bis gar nicht in die Gesellschaft integrieren und sind in erster Linie ein Fall fürs AMS oder auch für die Mindestsicherung.
Viele angeblich minderjährige Zuwanderer sind übrigens gar nicht mehr so jung, wie sie behaupten. Das Thema hatten wir schon einmal, du wirst dich erinnern, Kollege Stögmüller. (Bundesrat Stögmüller: Oft genug!) Medizinische Tests zeigen, dass sehr viele jener, die behaupten, sie seien unter 18, eigentlich 20 oder älter sind. Es gibt diesbezüglich immer mehr Altersfeststellungstests durch das Innenministerium, weil es der Polizei einfach komisch vorkommt, dass ihr bei den Erstgesprächen minderjährige Männer mit Falten und Rauschebärten gegenübersitzen. Die Zahl der Überprüfungen ist zu steigern. (Bundesrat Mayer: Rauschebart ist ein bisschen überspitzt für einen 18-Jährigen!) – Für einen 18-Jährigen schon, aber der Punkt ist eben, dass die Leute behaupten, sie seien 18 Jahre alt, obwohl sie nicht 18, sondern älter sind. Sie wollen sich einfach in unser Sozialsystem einschleichen, und das verursacht weit höhere Sozialkosten für uns.
Bei allem Verständnis für diese Menschen: Es ist einfach nicht tolerierbar, dass sich diese Menschen unter Angabe falscher Tatsachen in unsere Gesellschaft einschleichen. Wenn minderjährige Mädchen auf erwachsene Zuwanderer treffen, gibt es die dubiosesten und spannendsten Vorfälle. Das habe ich bei einem Schulprojekt in meiner Heimatstadt erlebt, das dann auch abgebrochen wurde. Ganz grundsätzlich ist es aber so, dass wir es mit einer Zuwanderung in unser Sozialsystem zu tun haben. Das ist eher eine Herausforderung als eine Chance.
Abschließend möchte ich noch ein paar Worte zur Kinderbetreuung verlieren. Es sind einige Dinge dabei – die Verbesserung der Betreuungsqualität, die Ausweitung der Öffnungszeiten der Kindergärten und flexible Betreuungslösungen –, die man getrost unterschreiben kann, die sehr viel Sinn machen und die wir gerne unterstützen. Ich möchte als Gemeindevertreter auch darauf hinweisen, dass diese Ausweitung natürlich auch finanzielle Konsequenzen für die Gemeinden hat. Aus dieser Sicht wäre es wichtig, dass der Bund auch verstärkt das Seine dazu beiträgt. Ich weiß, es gibt Anreize, aber wir können diese Dinge in den Gemeinden kaum schultern, zudem wir auch in vielen Bereichen der Sozialhilfe – das ist zwar ein anderer Themenbereich – schon sehr stark belastet sind.
Was bei all dieser Ausweitung der institutionellen Familienbetreuung nicht passieren darf, ist, dass man die familieninterne Betreuung von Kindern schlechterstellt. Da gilt es, die Wahlfreiheit zwischen familieninterner und familienexterner Kinderbetreuung sicherzustellen. Es ist so: Während zunehmend Maßnahmen gesetzt werden, um das Betreuungsangebot für unter Dreijährige auszubauen – das ist, wie gesagt, nichts Schlechtes –, werden die Eltern von Kindern, die die Erziehung eigenverantwortlich wahrnehmen, massiv benachteiligt. Das Betreuungsangebot wird immer stärker gefördert, und auf die Förderung jener, die ihre Kinder möglichst lange zu Hause behalten wollen, wird kaum Wert gelegt. Es gilt also, die Wahlfreiheit zu sichern.
Genau das wäre auch ein Grund, um beim Kindergeldkonto nachzuschärfen. Es ist zwar eine Weiterentwicklung des bisherigen Systems – man kann dazu stehen, wie man will –, aber wer seine Kinder länger selbst betreuen will, wird in diesem Fall finanziell ein bisschen benachteiligt, vor allem auch aus dem Grund, dass eine Gesamtsumme auf die-
sen Zeitraum aufgeteilt wird und Leute, die ihre Kinder in Institutionen geben, noch eine zusätzliche Förderung durch die Länder erhalten.
Kurz zusammengefasst: Es gibt viel Licht, aber auch viel Schatten in diesem Bericht und vor allem noch viel Luft nach oben in der Familienpolitik; daher geben wir diesem Bericht keine positive Beurteilung.
Der abschließende Appell von meiner Seite stößt, glaube ich, in diesem Haus auf offene Ohren: Bei allem, was wir tun, ist es ganz wichtig, die Kinder in den Mittelpunkt zu stellen und darauf zu achten, dass wir den Kindern nicht die Kindheit stehlen. Ich spreche damit nur das zweite verpflichtende Kindergartenjahr an, das aus meiner Sicht nicht nötig ist und mit dem man die Wahlfreiheit in der Erziehung wieder einschränken würde. – Danke schön. (Beifall bei der FPÖ.)
10.27
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Kern. – Bitte.
10.27
Bundesrätin Sandra Kern (ÖVP, Niederösterreich): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Geschätzte Frau Ministerin! Liebe Gäste! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir diskutieren heute die EU-Vorhaben des Familien- und Jugendministeriums. Das Ministerium verfolgt heuer das Ziel, die soziale Inklusion junger Menschen zu fördern. Sieht man sich den Bericht an, muss man klar sagen: Wir wissen, wo wir ansetzen müssen, und sind auf dem richtigen Weg. Sieht man sich einzelne Kapitel an, kann man sehen, dass Österreich in vielen Dingen Vorreiter ist. (Vizepräsidentin Winkler übernimmt den Vorsitz.)
Ich möchte vier Bereiche hervorheben; zum Ersten den klassischen Bereich der Jugendarbeit: In Österreich profitieren rund 1,5 Millionen junge Menschen von den verschiedenen Angeboten der Jugendarbeit. Diese reichen von Gruppenstunden über offene Jugendzentren bis zum individuellen Jugendcoaching. Mehr als 160 000 Freiwillige engagieren sich in ganz Österreich in der Jugendarbeit – denken wir an die zahlreichen Sportvereine, an die Feuerwehren, an die Musikvereine! Danke an dieser Stelle für Ihren Beitrag, Sie alle leisten wichtige Arbeit für junge Menschen!
Zweitens: Österreich hat eine gute Ausgangsbasis für den Einstieg Jugendlicher in den Arbeitsmarkt. Wir haben eine relativ niedrige Jugendarbeitslosigkeit, aber natürlich ist jeder Arbeitslose einer zu viel. Wir haben ein vorbildliches System der dualen Berufsausbildung, damit bieten wir Jugendlichen die besten Startchancen in ihr Berufsleben. Wir dürfen uns aber auf diesen Ergebnissen nicht ausruhen. Wir wissen, dass etwa 40 Prozent der Arbeitslosen maximal einen Pflichtschulabschluss haben. Die NEET-Zahlen der letzten Jahre – also die Zahlen der Jugendlichen zwischen 15 und 24, die sich weder in Ausbildung, Job oder Lehre befinden – sind alarmierend. In Österreich sind mehr als 70 000 Jugendliche weder in einer Ausbildung noch in einem Job noch in der Schule.
Wir sind nicht untätig geblieben, wir haben zahlreiche Maßnahmen gesetzt und beschlossen. Ich denke da zum Beispiel an das Lehrlingscoaching, das Lehrlingen mit Rat und Hilfe zur Seite steht, ich denke aber auch an die Unterstützung der Wirtschaftskammer zur Vorbereitung auf Lehrabschlussprüfungen oder die Anlaufstellen der Jugendberatung in den Bundesländern, die umfassende Beratung anbieten.
Wir als Gesetzgeber haben im Juli die Ausbildungspflicht bis 18 Jahre beschlossen – das ist schon angesprochen worden –, damit soll jungen Menschen eine über den Pflichtschulabschluss hinausgehende Ausbildung ermöglicht werden. Dieses Gesetz gilt erstmals für jene Jugendlichen, die im heurigen Schuljahr die Pflichtschule abschließen. Damit soll den jungen Erwachsenen der beste Start in ihr Berufsleben ermöglicht werden.
Das dritte Thema – das wurde auch schon kurz vom Kollegen angesprochen – ist das Thema Jugend und Digitalisierung. Kinder- und Jugendarbeit kommt heute um eine Aus-
einandersetzung mit dem Thema Digitalisierung und Chancen und Risken der digitalen Welt nicht herum. Die Vermittlung von Medienkompetenzen muss bereits im Kindergartenalter beginnen. Wir müssen unsere Kinder und Jugendlichen auf den Umgang mit den Gefahren und mit den Chancen der vernetzten Welt hinweisen und ihnen klarmachen, wie Smartphone und Tablet funktionieren. Das Familienministerium hat in den letzten Jahren bereits 1 000 Workshops zur Förderung der Medienkompetenz durchgeführt. – Das ist der richtige Schritt.
Mir persönlich geht es darum, dass in der Schule digitale Kompetenzen so vermittelt werden, dass jeder, der das Schulsystem verlässt, verstanden hat, wie die digitale Welt funktioniert. Es muss nicht jeder Programmierer werden, aber dass Jugendliche verstehen, wie zum Beispiel ein Algorithmus auf Facebook funktioniert, und zu kritischem Denken und Hinterfragen angeregt werden, wäre eine wichtige Basis für die Herausforderungen der Zukunft.
Zum Vierten darf ich noch kurz auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie eingehen – für mich als Arbeitnehmervertreterin ist das ein wichtiger Themenbereich –: Der Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen ist ein wesentlicher Faktor für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Beim Thema Kinderbetreuung braucht es gemeinsame nationale Anstrengungen. Die Finanzierung des Ausbaus der Kinderbetreuung muss unser aller Anliegen sein, daher ist meine Bitte die Verlängerung der 15a-Vereinbarung zur Finanzierung von Kinderbetreuungseinrichtungen, die heuer im Sommer auslaufen wird. Das muss unser gemeinsames Ziel sein.
Wir sehen also, im Familien- und Jugendbereich ist viel geschehen. Es ist viel in Planung, und wir sind in der Jugend- und Familienpolitik auf dem richtigen Weg. – Danke. (Beifall bei der ÖVP und bei Bundesräten der SPÖ.)
10.32
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Mag. Gruber-Pruner. – Bitte.
10.32
Bundesrätin Mag. Daniela Gruber-Pruner (SPÖ, Wien): Hohes Präsidium! Frau Ministerin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Im Zusammenhang mit dem EU-Vorhabensbericht des Familien- und Jugendministeriums möchte ich gleich zu Beginn die Gelegenheit nutzen, um über den ersten Besuch des Kinderrechteausschusses des Bundesrates in einem Bundesland zu berichten, der vergangene Woche stattgefunden hat.
Wir haben uns im Kinderrechteausschuss dazu durchgerungen, dorthin zu fahren, wo die Kinder und Jugendlichen sind, nämlich in die Bundesländer, sie dort zu besuchen, um die Erfahrungen, Anliegen und Forderungen der Kinder und Jugendlichen einzusammeln und im Parlament zu bearbeiten. Unser erster Besuch hat uns nach Tirol geführt.
Wir haben uns folgenden Rhythmus gegeben: Wir besuchen einmal im halben Jahr ein Bundesland, entsprechend den Bundesratspräsidentschaften. Als Nächstes würden wir im Herbst gerne nach Vorarlberg kommen. (Bundesrat Mayer: Da gab es schon Vorgespräche!) – Es gab schon Vorgespräche, wunderbar. Wir freuen uns darauf! Der Besuch in Tirol hat sich als sehr, sehr wertvoll herausgestellt.
Wir haben uns vorgenommen, immer direkt Kinder und Jugendliche zu treffen. In diesem Fall waren es die TeilnehmerInnen des Jugendparlaments zur Alpenkonvention, die sich mit dem Leben in den Alpen beschäftigt haben. Es war sehr beeindruckend zu sehen, mit welcher Ernsthaftigkeit und mit welcher Expertise diese Jugendlichen alle Debatten auf Englisch führen und an gemeinsamen Beschlüssen arbeiten.
Wir haben aber auch die Kinder- und JugendsprecherInnen des Tiroler Landtages getroffen und ihre Erfahrungen eingeholt, und nicht zuletzt haben wir auch mit einer Vertreterin der Kinder- und Jugendanwaltschaft Gespräche geführt. Sie hat uns mehrere Themen mitgegeben, und eines davon passt sehr gut zur Priorität C dieses EU-Jugendplans, „einfacherer Übergang junger Menschen vom Jugend- ins Erwachsenenalter“. Dabei handelt es sich um ein Thema, das speziell Kinder und Jugendliche betrifft, die in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe aufwachsen.
Der Kinder- und Jugendanwaltschaft kommen regelmäßig Härtefälle unter, nämlich dann, wenn Jugendliche in diesen Einrichtungen ihren 18. Geburtstag feiern und eigentlich laut offiziellen Maßnahmen und laut Gesetz aus allen Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe herausfallen würden. Gerade diese Jugendlichen haben oft eine sehr belastende Lebensgeschichte, tragen einen großen Rucksack und sind mit dem 18. Lebensjahr einfach oft noch nicht in der Lage, ein autonomes, eigenständiges Leben zu führen, sich um eine eigene Wohnung und um einen Arbeitsplatz zu kümmern.
Das Anliegen dieser Kinder- und Jugendanwaltschaft ist – das hören wir auch aus anderen Organisationen in der Kinder- und Jugendhilfe –, dass es für diese Härtefälle, für diese Jugendlichen mit 18 Jahren Ausnahmebestimmungen und die Möglichkeit, Maßnahmen zu verlängern, gibt, wenn es zum Wohle von diesen besonders belasteten Jugendlichen wäre. – Ich habe mir gedacht, es passt heute gut, wenn es um diesen EU-Vorhabensbericht geht, von unserem Besuch in Tirol zu berichten.
Ein anderes Thema, das in diesem Bericht genannt wird und das ich im Austausch mit PädagogInnen sehr oft höre, ist das Thema Gewalt, vor allem Gewalt unter Kindern und Jugendlichen, und das Thema Mobbing, das offensichtlich im Schulalltag, im Alltag unter Kindern und Jugendlichen doch sehr verbreitet ist.
Ich habe auch hierzu einen passenden Passus in diesem Vorhabensbericht gefunden: „Förderung der Gesundheit und des Wohlergehens junger Menschen, einschließlich der psychischen Gesundheit“. Mobbing hat sehr viel mit psychischem Wohlbefinden und psychischer Gesundheit zu tun, und da sind alle Maßnahmen in Richtung Präventionsarbeit, in Richtung Deeskalierung, in Richtung des richtigen Umgangs miteinander begrüßenswert, aber es braucht durchaus auch Anstrengungen im Bereich der Burschenarbeit und der Arbeit mit jungen Männern.
Ich als Pädagogin habe mir das Thema Kinderbetreuung herausgenommen, weil das natürlich ein Bereich ist, der mich massiv beschäftigt. Ich unterstütze alle Maßnahmen, das Angebot flächendeckend auszubauen. Meiner Fraktion ist es wichtig, dass die VIF-Kriterien stark im Fokus stehen, bei denen es um die Öffnungszeiten – die Tages-, aber auch die Jahresöffnungszeiten – der Betreuungseinrichtungen geht, und zwar nicht nur, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten.
Ich bin davon überzeugt, dass jedes Kind ab der Geburt ein Recht auf Bildung hat – das ist in der Kinderrechtskonvention festgeschrieben –, und dieses Recht auf Bildung kann in qualitativ hochwertigen Einrichtungen einfach bestmöglich geboten werden. Darum bin ich eine Verfechterin des Ausbaus des Kindergartenangebotes, auch des verpflichtenden zweiten Kindergartenjahres. Wir wissen aus allen Studien, dass ein längerer Besuch gut geführter Einrichtungen, qualitativ hochwertiger Einrichtungen einen massiven Einfluss auf die Bildungskarriere von Kindern und Jugendlichen nimmt.
Ich freue mich über jede Anstrengung, dieses verpflichtende zweite Kindergartenjahr voranzutreiben, wobei es auch – ich war gestern bei einem Treffen von LeiterInnen von Kinderbetreuungseinrichtungen – einiges an Verunsicherung gibt, was die verpflichtenden Elterngespräche betrifft. Die funktionieren noch nicht überall so, wie sie sollten. Es werden nicht alle Eltern erreicht; gerade die, die widerspenstig sind, nehmen diese Einladungen oft nicht an. Auch rund um den Bildungskompass gibt es viele, viele Fragezei-
chen, die PädagogInnen in den Ländern, in den Regionen sind etwas verunsichert. Ich glaube, da braucht es noch viel Aufklärung und Kommunikation, um diese Dinge voranzutreiben.
Bevor ich zum Schluss komme, noch eine kleine Anmerkung zu dem, was mein Vorredner zum Thema Altersfeststellung gesagt hat. Ich wollte das Thema eigentlich nicht behandeln, aber ich will etwas richtigstellen.
Die Altersfeststellung und die Methoden, die dafür zurzeit angewendet werden, sind im Bereich der Wissenschaft sehr umstritten. Wir wissen, dass es, was das Ergebnis dieser Altersfeststellungen betrifft, keine Garantie gibt, und die deutschen Kinder- und Jugendärzte haben sich dazu durchgerungen, sich gegen diese Methoden der Altersfeststellung einzusetzen, weil sie der Meinung sind, dass das Risiko, das durch die Röntgenstrahlung et cetera entsteht und dem diese jungen Menschen dadurch ausgeliefert sind, in keinem Verhältnis zu den sehr vagen Ergebnissen, die dabei herauskommen, steht. Ich habe es sehr beachtlich gefunden, dass sich die deutschen Ärzte dagegen aussprechen.
Zum Schluss möchte ich noch folgenden Punkt ansprechen, der mir auch ein Anliegen ist: Ich begrüße all die Anstrengungen im Rahmen der EU, gemeinsame Verbesserungen für Kinder und Jugendliche in der EU vorzunehmen, und auch das Engagement Österreichs in diesem Bereich; doch ein bisschen im Widerspruch dazu steht meiner Meinung nach der Versuch Österreichs, in der Frage der Indexierung der ins Ausland bezahlten Familienbeihilfe einen nationalen Alleingang zu unternehmen. (Beifall der Bundesrätin Anderl.)
Ich habe große Schwierigkeiten damit, weil ich der Meinung bin, dass da Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegeneinander ausgespielt werden, dass ihnen nicht dieselben Leistungen zuerkannt werden, wenn sie ihre Leistung in Österreich erbringen. Ich finde es sehr bedenklich, wenn man anfängt, bei einzelnen Leistungen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen an den Schrauben zu drehen, und ich frage mich: Was sind dann die nächsten Schritte, die nächsten Einsparungen, die bei Familien vorgenommen werden?
Ich würde mir von Ihnen, Frau Familienministerin, wünschen, dass Sie sich für alle Familien einsetzen – insbesondere für diejenigen, die unter besonders schwierigen Lebensbedingungen leben müssen – und nicht gerade bei den schwächeren zu sparen anfangen. – Danke schön. (Beifall bei der SPÖ.)
10.41
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Bevor wir in der Debatte fortfahren, darf ich in unserer Mitte Herrn Bundesminister Dr. Schelling begrüßen. – Herzlich willkommen, Herr Minister. (Allgemeiner Beifall.)
Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Stögmüller. – Bitte.
10.42
Bundesrat David Stögmüller (Grüne, Oberösterreich): Wertes Präsidium! Sehr geehrte Frau Jugendministerin Karmasin! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe vorhin in der Aktuellen Stunde über die neun unterschiedlichen Jugendgesetze in Österreich geredet und muss jetzt sagen, nicht nur Jugendliche sind von den Auswirkungen des Föderalismus betroffen, sondern auch Kinder.
Es kann doch bitte nicht sein, dass es in einem so kleinen Land wie Österreich nicht egal ist, ob ein Kind in Oberösterreich, in Vorarlberg oder im Burgenland geboren ist, denn es gibt tatsächlich in jedem Bundesland eine andere Art der Hilfestellung! Wir brauchen daher dringend Rahmengesetze und entsprechende jugendrechtliche Anpassungen, um allen Kindern und Jugendlichen die beste Hilfestellung angedeihen zu lassen.
Ich habe in den letzten Wochen und Tagen mit mehreren VertreterInnen verschiedener Kinderrechtsorganisationen, Jugendanwaltschaften sowie Kinder- und Jugendhilfsorganisationen gesprochen und nachgefragt, wo die Problemfelder sind, wo es gesetzlicher Anpassungen bedarf und welche Expertinnen und Experten vor Ort gebraucht werden, um den Kindern und Familien bestmöglich helfen zu können. Es sind dabei viele Probleme angesprochen worden, aber ein Problem zog sich wie ein roter Faden durch alle diese Gespräche, nämlich das Problem Gewalt und Mobbing und die gemeinsame Überzeugung, dass es da eine entsprechende Prävention braucht.
Gewalt in den Familien – eine Kollegin hat es bereits angesprochen – beginnt meistens mit Überforderung und Überlastung der Familien, und das kann dramatische Auswirkungen haben. Gewalt in der Familie und sogar Kindesmisshandlungen sind leider auch bei uns in Österreich traurige Realität. Da stellt sich die Frage: Wie können wir es schaffen, ehestmöglich mit den Familien gemeinsam zusammenzuarbeiten, um es gar nicht so weit kommen zu lassen?
Ein großes Problem ist da sicherlich die Stigmatisierung, wenn es zu einer Intervention durch die Kinder- und Jugendhilfe kommt; das ist sicherlich ein Problem. Es braucht daher eine niederschwellige Begleitung der Eltern schon vor der Geburt des Kindes. Das könnte man zum Beispiel bereits im Zusammenhang mit dem Mutter-Kind-Pass anbieten. So ein Angebot gibt es ja bereits, die Frühen Hilfen, aber auch da zeigen sich wieder die Auswirkungen des Föderalismus: In manchen Bundesländern funktioniert es wirklich sehr gut, zum Beispiel in Vorarlberg, Herr Kollege Edgar Mayer (Bundesrat Mayer: Stimmt!), das in diesem Bereich ein Vorzeigebundesland ist – da gibt es ein derartiges Programm schon seit über zehn Jahren, aufgrund des tragischen Todes eines Kleinkindes wurde das seinerzeit eingeführt –, aber trotz aller politischen Bekenntnisse und Bemühungen sind wir leider noch meilenweit vom Ziel entfernt, das wir anpeilen. Es braucht eine verpflichtende Kooperation und eine Vernetzung mit den Gesundheitspartnerinnen und -partnern, mit dem Familien- und dem Sozialressort und natürlich auch eine ausreichende finanzielle Unterstützung, damit ein solches Projekt überhaupt funktioniert.
Gewalt gibt es aber nicht nur in den Familien, sondern auch in der Schule. Erst vor Kurzem wurde von der Jugendanwaltschaft Oberösterreich eine Studie veröffentlicht, die besagt, dass 28 Prozent der oberösterreichischen Schülerinnen und Schüler in der Schule Angst vor Mitschülerinnen und Mitschülern haben. Also fast jeder dritte Schüler in Oberösterreich hat Angst vor Mitschülern – für mich eigentlich unglaublich! –, und das kann Angst vor körperlicher Gewalt oder Angst vor psychischer Gewalt sein, etwa durch gezieltes Mobbing, das immer mehr zunimmt.
Man sieht also, wie wichtig da Prävention ist. Wir haben in Oberösterreich das Glück, auf ein breites Netzwerk von SchulsozialarbeiterInnen zurückgreifen zu können – zumindest in den Pflichtschulen –, aber auch in diesem Bereich kommt wieder der Föderalismus zum Tragen: Jedes Land kocht sein eigenes Süppchen!
Eine weitere Gruppe junger Menschen, die meiner Meinung nach ebenfalls geschützt gehört – Kollegin Daniela Gruber-Pruner hat es schon angesprochen –, sind die sogenannten Care Leavers. Im Schnitt ziehen junge Erwachsene in Österreich mit circa 24 Jahren von zu Hause aus – meistens noch mit finanzieller Unterstützung der Erziehungsberechtigten –, was aber nicht so ist, wenn man außerhalb der Familie aufgezogen worden ist, zum Beispiel in einer Wohngemeinschaft oder in einer Pflegefamilie; da muss man schon mit 18 Jahren auf den eigenen Füßen stehen, und genau da sprechen wir von Care Leavers.
Diese Jugendlichen haben es wirklich schwer, auf eigenen Füßen zu stehen, weil sie nicht den Familienverband, das familiäre Umfeld, das soziale Umfeld haben, das wahrscheinlich jeder von uns hier herinnen gehabt hat. Diese Jugendlichen, die aus einer Fremdunterbringung ausziehen müssen, tragen ein erhöhtes Risiko, an den Hürden des
Erwachsenenlebens zu scheitern oder auf dem Arbeitsmarkt zu versagen. Da gibt es zwar die Möglichkeit der vollen Erziehung, aber es kommt wieder auf das Bundesland an, in dem man aufwächst – und genau das ist auch hier wieder der Punkt!
Daher brauchen wir Maßnahmen, dass der Rechtsanspruch auf Verlängerung oder Wiederaufnahme der Betreuung mindestens bis zum 21. Lebensjahr gewährleistet wird. Sich dafür einzusetzen, würde ich Sie, Frau Ministerin Karmasin, im Sinne dieser jungen Menschen bitten. Das ist mir wirklich ein großes Anliegen.
Im EU-Vorhabensbericht finden sich auch wieder schöne Stehsätze, zum Beispiel: Es sollen „folgende Ziele erreicht werden: [...] einfacher Übergang junger Menschen vom Jugend- ins Erwachsenenalter, insbesondere Integration in den Arbeitsmarkt“.
Frau Ministerin, ich habe Sie schon im letzten Jahr bei der Diskussion über den EU-Vorhabensbericht 2016 gebeten, sich für alle Jugendlichen in Österreich einzusetzen – wirklich für alle, egal, ob der Jugendliche hier geboren ist oder nicht. (Zwischenruf des Bundesrates Mayer.) Bitte? (Bundesrat Mayer: Das tut sie sicher!) Nach wie vor ... (Neuerlicher Zwischenruf des Bundesrates Mayer.) Nicht für alle! – Wirklich für alle, egal, ob sie hier geboren sind oder nicht.
Nach wie vor sind UMFs, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, von der Ausbildungspflicht ausgenommen, was für diese Gruppe von jungen Menschen in Österreich die Integration in den Arbeitsmarkt und den Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter erschwert und eindeutig auch den von Ihnen gesetzten EU-Zielen widerspricht.
Und wieder einmal ein Appell: Setzen Sie sich bitte für alle Jugendlichen ein, auch für die UMFs, und führen Sie Gespräche dazu!
Abschließend auch ein paar Sätze zum Thema Familie – und die werden sehr kritisch sein, Frau Ministerin, ich möchte Sie nur gleich vorweg warnen –: Eine Familienministerin, die im EU-Vorhabensbericht von sozialer Inklusion, von einem vielfältigen und inklusiven Europa und von Chancen schreibt, aber dann selber Schlagzeilen produziert, in denen es um Streichungen der Familienbeihilfe für Kinder außerhalb Österreichs geht (Bundesrätin Mühlwerth: „Streichung“ ist nie gefallen!), ist meiner Meinung nach mehr als zu kritisieren und in diesem Fall unglaubwürdig.
Da geht es um Menschen, die bei uns in Österreich einer Arbeit nachgehen, die bei uns in der 24-Stunden-Pflege arbeiten und unsere alten Menschen zu Hause pflegen, ohnehin oft unter Arbeitsbedingungen, unter denen die Österreicherinnen und Österreicher niemals arbeiten würden, und dann streicht man ihnen auch noch dieses Geld. Na, was wird dann passieren, Frau Ministerin? – Diese Menschen gehen in die Scheinselbständigkeit, und ihre Kinder ziehen wahrscheinlich nach Österreich. (Neuerlicher Zwischenruf der Bundesrätin Mühlwerth.)
Für mich ist Ihr Vorgehen ein Frontalangriff auf die europäische Grundidee der Niederlassungsfreiheit, der Bewegungsfreiheit und der Solidarität. (Zwischenrufe bei der ÖVP.) Aber zum Glück wird es nicht so weit kommen, weil ja ohnehin die SPÖ schon einen Rückzug gemacht und angekündigt hat, da nicht mitzumachen.
Es gibt aber noch andere Baustellen in der Familienpolitik – vielleicht sollten wir uns einmal darum kümmern! –, zum Beispiel bei Einbußen der Familien durch die Neuregelung des Kindergeldes. Das wäre einmal etwas, was man angehen sollte.
Oder: Was passiert im Zusammenhang mit der EcoAustria-Studie zur Reform des Familienlastenausgleichsfonds? – Wir Grüne weisen schon seit Jahren darauf hin, dass es durch die immer wiederkehrende Streichung von Geldern aus dem FLAF zu immer mehr Druck kommt, im Bereich der Kinderbetreuung und Familienbeihilfe sparen zu müssen. Und dazu darf es nicht kommen! (Bundesrat Mayer: Im EU-Vorhabensbericht steht das nicht drinnen! Wir reden über den EU-Vorhabensbericht!)
Es steht im EU-Vorhabensbericht unter anderem drinnen, was Familien in diesem Bereich betrifft. – Also – Entschuldigung! – machen Sie bitte keine Schlagzeilen, in denen es heißt, zum Schutz der Kinder und Jugendlichen oder für ein gerechtes Kindergeld, sondern machen Sie sich für den Erhalt oder eine Überarbeitung des FLAF stark! Das wäre dringend notwendig – und nicht irgendwelche Aktionen auf Kosten der europäischen Grundwerte!
Wir werden diesen Bericht trotz dieser Problemfelder zur Kenntnis nehmen, aber nehmen Sie bitte diese Kritik mit! (Beifall bei den Grünen.)
10.50
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Zu Wort gemeldet ist Frau Bundesministerin Dr. Karmasin. – Bitte, Frau Ministerin.
10.50
Bundesministerin für Familien und Jugend MMag. Dr. Sophie Karmasin: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Kollegen und Kolleginnen! Ich möchte kurz Stellung zu ein paar Punkten nehmen und ein paar für mich wichtige Themenbereiche aus dem EU-Vorhabensbericht herausgreifen – nicht alle kann ich heute beschreiben, aber die wichtigsten.
Erasmus+ ist, denke ich, ein Erfolgsprojekt in Europa, und gerade in der jetzigen Phase der Europäischen Union ist es meiner Meinung nach ganz besonders wichtig, dass Erasmus+ hinsichtlich seiner Notwendigkeit und Wichtigkeit herausgehoben wird. 1,4 Millionen Jugendliche in Europa nutzen dieses Programm jährlich, und es ist etwas sehr Relevantes für junge Menschen, andere europäische Länder kennenzulernen, andere Kulturen kennenzulernen und sich den Einstieg in die Universität oder auch in den Beruf mit Erasmus+ zu erleichtern. – Punkt eins.
Punkt zwei: das große Thema Jugendscreening. – Wir haben uns starkgemacht, dass in allen Ministerien Verantwortliche gefunden werden, die zu diesem Jugendscreening die verantwortlichen Ansprechpartner sind. Es geht dabei darum, alle Gesetze und Vorhaben hinsichtlich ihrer Wirkungen auf die jungen Menschen zu analysieren. – Ein ganz entscheidender, wichtiger Punkt!
Die außerschulische Jugendarbeit ist in unserem Ressort ein Schlüsselthema. Und das „Jahr der Jugendarbeit“, das letztes Jahr ausgerufen wurde und mit einigen sehr großen und herausragenden Projekten dann auch in den Österreichischen Jugendpreis gemündet ist, wird dieses Jahr fortgeführt, um noch einmal die außerschulische Jugendarbeit in all ihren Facetten und ihrer Wertigkeit herauszuheben. Vor allem im Zusammenhang mit dem gesamten Thema Integration, das vorhin schon angesprochen wurde, ist die außerschulische Jugendarbeit ein zentraler Baustein auf dem Weg, auf dem junge Menschen auf niederschwelligem Niveau in unsere Gesellschaft, in unsere Lebensart, in Sprache, Kultur und Alltäglichkeiten eingeführt werden können.
Das ist meiner Meinung nach ein hervorragendes Instrument auch im Sinne der Integration, aber auch der Gewaltprävention, weil in der außerschulischen Jugendarbeit auch sehr viel im Sinne der Deeskalation, im Sinne der Teamfähigkeit, im Sinne der Kommunikationsfähigkeit unternommen wird, um junge Menschen genau vor den Themen Mobbing, Cyber-Mobbing oder aggressives Verhalten in den Schulen oder in den Jugendzentren zu schützen und sie zu trainieren, dass sie sich wehren. Da denke ich vor allem an junge Mädchen.
In diesem Zusammenhang stehen natürlich alle Aktivitäten der europäischen Jugendplattform „No Hate Speech Movement“, die wir sehr gern mit all unseren Möglichkeiten unterstützen, und auch die Beratungsstelle Extremismus, die mittlerweile ein Vorzeigeprojekt auf europäischer Ebene darstellt, weil sie wirklich hervorragende Präventionsarbeit leistet und der Krisenintervention dient, wenn eine solche notwendig ist.
Zum Thema Familie ist zwar sehr viel zu sagen, ich möchte mich aber kurz fassen: Für mich ist die Wahlfreiheit oberstes Prinzip! Wahlfreiheit ist aber nur dann möglich, wenn sie alle Lebensformen wirklich realisierbar werden lässt, sprich wenn die häusliche Betreuung von Kindern möglich ist – sie ist es ja –, und die wird vor allem auch durch unsere großzügigen finanziellen Instrumente Familienbeihilfe und Kindergeld unterstützt. Ich möchte nur daran erinnern, dass bis 24 000 € innerhalb der ersten 14 Monate nach der Geburt des Kindes abrufbar sind – 24 000 €: diese Summe, die wir in Österreich bezahlen, ist, glaube ich, Weltspitze! Also die klassische Form der Familie wird mit unseren Leistungen sehr, sehr gut und großzügig unterstützt.
Wenn wir für Wahlfreiheit sind, dann brauchen wir aber auf der anderen Seite auch ein ausreichendes Angebot an Kinderbetreuung, und da sind wir sehr froh, dass wir in dieser Periode in die größte Ausbauoffensive des Bundes 305 Millionen € investieren dürfen – dank der Hilfe des Finanzministeriums und der guten Verhandlungen mit den Ländern, die dieses große Ausbauvorhaben finanziell unterstützen und motivieren.
Wir sind in der weiteren Arbeit natürlich daran interessiert und davon überzeugt, dass wir diese große Ausbauoffensive weiter vorantreiben können und auch über die nächste Legislaturperiode hinaus sichern können (Beifall der Bundesrätin Blatnik), denn wir sind, wie eingangs gesagt wurde, bei der Stärkung der Kinderbetreuung in quantitativer und qualitativer Sicht noch nicht an unserem Ziel angelangt.
Ich möchte noch einmal kurz zur Frage des zweiten Kindergartenjahres eine Bemerkung in Bezug auf die Wahlfreiheit machen: Das ist keine Maßnahme im Sinne einer Einschränkung der Wahlfreiheit. Bitte führen wir uns vor Augen, dass 97 Prozent der Vierjährigen bereits den Kindergarten besuchen – ich betone: 97 Prozent! Also ich glaube, da schränken wir niemanden ein, wenn es diese zusätzliche Pflicht gibt. Die Pflicht ist aber nicht das Entscheidende, sondern die Frage des Gratiskindergartens für die Vierjährigen (Beifall bei ÖVP und SPÖ), ein Umstand, der eine entscheidende Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Systeme darstellt, weil – und das ist, glaube ich, zusätzlich entscheidend – Elementarpädagogik sinnvoll, richtig und gut für Kinder ist, wovon wir alle überzeugt sind. Das ist keine Einschränkung oder Pflicht, denn es nehmen ohnehin schon 97 Prozent dieses wertvolle Angebot in Anspruch.
Zum Bildungskompass ganz kurz auch ein paar Worte: Der steigert natürlich noch einmal die pädagogische Qualität in der Elementarpädagogik, und ja, das ist noch nicht allgemein bekannt, das ist richtig, aber vor allem deswegen nicht, weil dazu ja in Oberösterreich eine Pilotphase stattfindet und wir erst nach Abschluss der Evaluierung in Oberösterreich alle informieren können, wie das Instrument flächendeckend aufzusetzen sein wird.
Aber seien Sie getrost, natürlich wird es dafür Zeit geben und auch die notwendigen Schulungsangebote, damit dieses wertvolle Instrument, das Ressourcen und Potenziale von Kindern ab dem vierten Lebensjahr bis zum Ende der Schulpflicht heben soll – nicht Defizite herausstreichen, sondern Ressourcen und Potenziale und Talente stärken und heben –, gut funktioniert. Das ist, glaube ich, ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Stärkung der Elementarpädagogik.
Vermeidung von Gewalt ist mir persönlich im Zusammenhang mit Familienpolitik ein großes Anliegen. Nach unser Teilnahme an der diesbezüglichen internationalen Konferenz im letzten Jahr werden wir auch dieses und nächstes Jahr wieder an internationalen Konferenzen dieses Thema betreffend teilnehmen und zusätzlich im Rahmen des Kinderrechte-Monitoring-Boards tätig sein, an dem ich vor drei Wochen persönlich teilgenommen habe und im Zuge dessen auch ein Projekt definiert wurde, bei dem es darum geht, dass ganz niederschwellige Gewaltpräventionsmaßnahmen in Form von Anleitungen und Beratungen für Eltern, Lehrer und Kinder aufgesetzt werden, damit Eltern schon ganz früh beziehungsweise rechtzeitig sensibilisiert werden, um zu wissen:
Was passiert, wenn ich Überforderung spüre, wie gehe ich damit um, was mache ich, an wen kann ich mich wenden? – Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
Abschließend auch ein paar Worte zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Das ist das Herzstück meines Ressorts. Wir arbeiten im Rahmen von verschiedensten Maßnahmenpaketen an diesem Thema, unter anderem auch gemeinsam mit Unternehmen im Rahmen des Netzwerkes Unternehmen für Familien, und zwar auch im Sinne der Eigenverantwortung, wo Unternehmen aus eigener Entscheidung zu dem Schluss kommen: Familienfreundlichkeit macht Sinn, rechnet sich, sie ist nicht nur gut für die Familien der Mitarbeiter, sondern auch für das Unternehmen selbst!
In diesem Zusammenhang möchte ich berichten, Frau Anderl: Der Familienzeitbonus wird sehr gut angenommen, das sehen wir in unseren Statistiken, er wird gut realisiert, und wir hören auch immer mehr Unternehmen aus unserem Netzwerk sagen: Wir definieren und regeln auf Betriebsebene quasi proaktiv den Rechtsanspruch, dass unsere Mitarbeiter das selbstverständlich in Anspruch nehmen können! (Zwischenruf der Bundesrätin Anderl.) – Bitte? (Bundesrätin Anderl: Meine Wortmeldung war Karenz!) Okay! Ich wollte Ihnen nur sagen, dass der Familienzeitbonus gut funktioniert. (Bundesrätin Anderl: Das stimmt!) Die Unternehmen regeln das für sich, auch proaktiv, da sind wir sehr zufrieden. Wir werden das natürlich beobachten, sind aber nach einem Monat Laufzeit sehr zufrieden.
Betreffend das Kindergeldkonto, das Kindergeldsystem möchte ich darauf hinweisen, dass wir in den nächsten Jahren unter diesem Titel mehr ausgeben werden. Also da geht es überhaupt nicht um Einsparungen, sondern da geht es um Erhöhungen der Budgets, weil diese Maßnahmen der Flexibilität und Individualität dienen sollen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten: Wechselmöglichkeit, Väterbeteiligung, Familienzeitbonus, Partnerschaftsbonus – alles durchaus Investitionen, für die wir eintreten und die wir als notwendig empfinden.
Und alles andere, was hier ... (Bundesrat Stögmüller: Und die ECO-Studie?) – Die wird im Ausschuss präsentiert, das ist schon vorgesehen. (Bundesrat Stögmüller: Wann wird die veröffentlicht?) – Die wird im Ausschuss präsentiert – überhaupt keine Frage, natürlich! An diesem Ausschuss können Sie gerne teilnehmen. – Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
10.59
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Danke, Frau Ministerin.
Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir gelangen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, den gegenständlichen Bericht zur Kenntnis zu nehmen, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit, der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundeshaushaltsgesetz 2013, das Bundesfinanzierungsgesetz, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz und das Notarversicherungsgesetz 1972 geändert werden (1514 d.B. und 1566 d.B. sowie 9756/BR d.B.)
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Wir gelangen nun zu Punkt 2 der Tagesordnung.
Berichterstatter ist Herr Bundesrat Heger. Ich bitte um den
Bericht.
Berichterstatter Peter Heger: Frau Präsidentin! Herr Minister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich bringe den Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundeshaushaltsgesetz 2013, das Bundesfinanzierungsgesetz, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz und das Notarversicherungsgesetz 1972 geändert werden.
Der gegenständliche Beschluss des Nationalrates umfasst im Wesentlichen die folgenden Maßnahmen: die gesetzliche Verankerung von Grundsätzen für das Finanzmanagement des Bundes und die Möglichkeit zur Bündelung des Finanzmanagements bei der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur.
Der Finanzausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates, der in schriftlicher Form vorliegt, in der Sitzung des Finanzausschusses am 4. April 2017 in Verhandlung genommen. Nach Beratung der Vorlage stellt der Finanzausschuss mehrheitlich den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Dr. Reiter. – Bitte, Frau Kollegin.
11.02
Bundesrätin Dr. Heidelinde Reiter (Grüne, Salzburg): Frau Präsidentin! Herr Minister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Es wurde im Regierungsprogramm 2013 bis 2018 ein einheitliches Spekulationsverbot für den gesamten Sektor Staat vereinbart. Das klingt als Zielsetzung natürlich sehr ambitioniert und sehr toll – wie schwierig die Umsetzung ist oder dass sie vielleicht sogar unmöglich ist, zeigt die Vorlage des heutigen Gesetzes, mit dem ein Bündel von Gesetzen geändert wird.
Mit diesem Gesetz wird das Spekulationsverbot für den Bund und dessen Rechtsträger auf einfachgesetzlicher Ebene umgesetzt. Es wird also nicht so etwas wie ein Spekulationsverbot im Verfassungsrang geben, das dann wirklich flächendeckend gelten würde, und es wird sicher nichts Einheitliches für alle Gebietskörperschaften geben. Das Problem beginnt schon damit, dass es sehr schwierig ist, zu definieren, was denn Spekulation eigentlich ist. Es geht eben um eine risikoaverse Ausrichtung der Finanzgeschäfte, aber klar ist, dass risikoloses Handeln in diesem Bereich nicht möglich ist.
Untergraben wurde eine klare und einheitliche Regelung eigentlich schon im Regierungsprogramm, in dem auf die Artikel-15a-Vereinbarung verwiesen wurde, die mit den Ländern abgeschlossen wurde, die aber qualitativ oder überhaupt nicht in den Ländern umgesetzt wurde. Auch da haben wir eine große Bandbreite, von einem einheitlichen Spekulationsverbot im Sektor Staat kann sicher nicht die Rede sein. Es kann in Niederösterreich nach wie vor mit Wohnbaugeldern spekuliert werden, auch im Burgenland sind Swapgeschäfte ohne Grundgeschäfte offensichtlich möglich, was durch dieses Gesetz zumindest im Bereich des Bundes verhindert werden soll.
Das zeigt einmal mehr, dass Artikel-15a-Vereinbarungen im Grunde genommen nicht nur ein sehr undemokratisches Instrument sind und sich auch nicht wirklich dazu eignen, Regelungen zu vereinheitlichen, sondern oft auch das Gegenteil bewirken.
Wir hatten heute die Debatte über das Rauchverbot bis 18, wo es die Notwendigkeit gab, mit den Ländern über ein oder gar zwei Jahre zu verhandeln. Da muss ich sagen, das ist eigentlich eine relativ einfache Regelung im Vergleich dazu, ein Spekulationsverbot für alle Gebietskörperschaften in der Finanzverfassung zu verankern. Also ich beneide Sie nicht um Ihre Aufgabe oder den Wunsch, das auch in den Ländern entsprechend umzusetzen.
Trotzdem sind wir der Überzeugung, dass es durch mehr Transparenz in diesen Bereichen möglich wäre, eine verbesserte Situation im Kampf gegen die Spekulation zu schaffen und auch im Kampf dagegen, dass die Finanzwirtschaft, eine überbordende Finanzwirtschaft, die Gebietskörperschaften in vielen Bereichen eigentlich ausnimmt wie die Weihnachtsgänse. Bessere Instrumente für den Staat zur Verfügung zu haben, um dagegen ankämpfen zu können, wäre, glaube ich, schon möglich. Man könnte über die Finanzverfassung zum Beispiel ein einheitlicheres Spekulationsverbot sicherstellen. Es hat dazu auch einen entsprechenden Antrag im Nationalrat gegeben, wo diese Punkte aufgelistet waren, der aber leider vertagt wurde.
Die Länder werden jetzt mittelbar schon über die Bundesfinanzierungsagentur erwischt, also über die OeBFA, die Ländern und anderen Rechtsträgern nur dann Mittel zur Verfügung stellen darf, wenn hinsichtlich der Verwendung dieser Mittel die gleichen strengen Auflagen erfüllt werden, die im Zusammenhang mit Bundesmitteln angewendet werden. Da stellt sich dann wieder die Frage: Wer beurteilt das auf welcher Stufe für die Länder? Soll das der Rechnungshof sein? Wer stellt diesen Persilschein aus, dass diese Mittel dann auch abgerufen werden können?
Es zeigt sich auch in den Begutachtungen und den Einwendungen durch die Länder, dass es eine große Bandbreite der Ansichten gibt. So will Oberösterreich, dass gewisse Veranlagungsgeschäfte für Sozialversicherungsträger möglich sein sollten, die den Gebietskörperschaften, insbesondere den Gemeinden, nicht offenstehen. Oberösterreich hat ganz klar den starken Wunsch nach Differenzierung des Spekulationsverbots formuliert.
Es zeigt sich auch im Bericht zu diesem Gesetzesvorhaben, dass es schwierig ist, diese Geschäfte sozusagen risikoavers zu machen, und es wird darauf hingewiesen, dass eine professionelle Steuerung des Schuldenportfolios ohne Einsatz von Zinsswaps nur schwer möglich ist. Allerdings muss denen jetzt ein Grundgeschäft zugrunde liegen, und die Abwägung der Verhältnismäßigkeit haben immer die jeweils zuständigen Organe vor dem Eingehen des Risikos vorzunehmen. Das ist natürlich auch wieder ein schwieriger Punkt, erstens die zuständigen Organe zu empowern, dieses Risiko abwägen zu können, und zweitens auch die Transparenz all dieser Dinge für die demokratischen Entscheidungsorgane sicherzustellen.
Wir glauben, dass mehr möglich gewesen wäre, als in dem vorliegenden Gesetz getan wurde – in Richtung mehr Transparenz und auch mehr demokratische Möglichkeiten, um Einblick zu bekommen, mitentscheiden zu können und auch vergleichen zu können, wie in diesen Bereichen in verschiedenen Bundesländern, in verschiedenen Gebietskörperschaften umgegangen wird. Aus diesem Grund lehnen wir die vorliegenden Bestimmungen ab. – Danke. (Beifall bei den Grünen.)
11.09
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Mayer. – Bitte, Herr Kollege.
11.10
Bundesrat Edgar Mayer (ÖVP, Vorarlberg): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Minister! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Ich kann mich, glaube ich, kurz halten. In dieser Sammelnovelle geht es auch um das Bundesfinanzrahmengesetz bis 31. Dezember 2018, das zusammen mit dem Bundesfinanzgesetz jeweils im Herbst behandelt werden wird. Ich denke, das ist sicher eine gute Maßnahme, weil es dann auch evaluiert und bis zum Frühjahr abgeschlossen werden soll. Dann werden die Ergebnisse dieser Evaluierung auch in einen entsprechenden Budgetprozess einfließen.
Ich finde es sinnvoll, dass diese Zusammenlegung der mittelfristigen und der jährlichen Budgetplanung erfolgen soll. Das ist gut so, das können wir gut nachvollziehen, und
das beschließen wir auch heute in dieser Sammelnovelle, obwohl das Budget und die Budgetplanung an und für sich nicht im Bundesrat diskutiert werden und hier auch keine Zuständigkeit besteht. Anders verhält es sich mit den Budgetbegleitgesetzen, da ist sehr wohl unsere Zuständigkeit vorhanden. Aber das ist heute nicht das Thema.
Frau Kollegin Reiter, ich finde, das ist schon ein Meilenstein. So, wie du das hier dargestellt hast, stimmt das meiner Meinung nach nicht. Wir haben im Regierungsprogramm dieses Spekulationsverbot festgeschrieben, und das kommt auch in dieser Form. Es haben alle Bundesländer – bis auf zwei: Kärnten und das Burgenland – auch schon längst umgesetzt, und die beiden erwähnten Länder werden das auch bis Ende 2017 nachholen. Gerade im Falle von Kärnten denke ich – ohne dass ich das jetzt weiter ausführe –, dass es ein Gebot der Stunde wäre, dieses Spekulationsverbot rasch einzuführen.
Bei der Finanzierung der Länder und der Rechtsträger – das hast du schon ausgeführt, liebe Kollegin Reiter – über die Bundesfinanzierungsagentur ist das schon längst Part of the Game, denn alle, die sich über die OeBFA ihr Geld sozusagen abholen, haben auch die Regeln des Bundes einzuhalten. Das bedeutet im Klartext: Wer dem bundeseinheitlichen Spekulationsverbot nicht nachweislich gerecht wird, kann in Zukunft nicht mehr über den Bund finanzieren, dann gibt es einfach keine Kohle. Ich glaube, dass damit ganz deutlich aufgezeigt wird, wie eng und wie ernst der Bund diese Aufgabenstellung zum Spekulationsverbot sieht.
Wir haben dieses Spekulationsverbot lange diskutiert, auch mit den Ländern, bereits in der letzten Legislaturperiode gab es eine wirkliche Initiative, das umzusetzen – und es ist nicht gelungen. Jetzt hat es der Finanzminister im Zuge der Finanzausgleichsverhandlungen geschafft, was man ihm hoch anrechnen muss. Und man muss sich keine Sorgen machen, Frau Kollegin Reiter, er schafft das. Er hat eine dicke Haut, das hat er schon mehrfach bewiesen. Er ist auch entsprechend standhaft, ein guter Alemanne, der schafft es auch, mit den Finanzen umzugehen. (Heiterkeit.)
Ich darf mich deshalb sehr herzlich beim Herrn Finanzminister für die vorliegende Sammelnovelle bedanken. Wir stimmen gerne zu. (Beifall bei der ÖVP.)
11.13
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Lindinger. – Bitte, Herr Kollege.
11.13
Bundesrat Ewald Lindinger (SPÖ, Oberösterreich): Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Geschätzte Damen und Herren! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Die Welt hat sich verändert seit 2010, als es die ersten Gerüchte um Spekulationen in vielen Bundesländern gegeben hat. Man darf sich da nicht nur auf Salzburg konzentrieren, auch in den anderen Bundesländern ist viel spekuliert worden, bis hinunter zu den Gemeinden, mit Fremdwährungskrediten und Swapgeschäften, wo jetzt noch verhandelt wird, um einen Ausgleich zu finden.
Mich als Bürgermeister hat es damals schon gestört, dass den Gemeinden empfohlen wurde, Fremdwährungskredite für die Finanzierung von Kanalbauten, Wasserversorgung und so weiter aufzunehmen. Die Gemeindeabteilungen der Länder haben gesagt: Könnt ihr da nicht eine günstige Finanzierung finden?, und haben das den Gemeinden empfohlen.
Da ich in diesem Bereich in meiner Gemeinde sehr konservativ bin, bin ich dieses Risiko nicht eingegangen. Ich weiß schon, das Risiko kann reizvoll für eine Gemeindeverwaltung sein, denn je höher das Risiko, desto niedriger sind die Zinsen, die man bezahlt – aber es kann auch umgekehrt sein, es kann einen auch zerstören. Ich habe das
in einer kleinen Gemeinde gesehen, die die Laufzeit eines Darlehens verlängern musste, damit sich die Tilgungsrate nicht erhöht, weil sich eben der Kurs der Fremdwährung zu ihrem Nachteil verändert hat. Es ist schon schlimm, wenn man die Laufzeit von 20 auf 30 Jahre oder noch mehr verlängern muss, um die Höhe der Annuität halten zu können.
Gerade deswegen war es wichtig, dass man 2013 darangegangen ist, dem mit dem Spekulationsverbot, das man jetzt eigentlich neuerlich verschärft hat, Frau Kollegin Reiter, einen Riegel vorzuschieben. 2013 hat man die ersten Maßnahmen gesetzt, und jetzt weiß man ganz genau, wo man den Hebel noch ansetzen sollte. Das ist unter anderem bei einigen Sozialversicherungsträgern der Fall, die man jetzt in das Spekulationsverbot einbindet, das zwischen Bund, Ländern und Gemeinden einheitlich vereinbart wurde. Damit werden auch diese Sozialversicherungsträger, die Finanzierungsbedarf haben und ihr Geld auch spekulativ anlegen könnten, daran gehindert.
Die strengeren Regeln bei den Fremdwährungskrediten sind absolut gerechtfertigt, denn das Risiko tragen ja die Bürger und nicht die verantwortlichen Mandatare in den kleinen Gemeinden oder der Amtsleiter; wenn es hoch hergeht, gibt es noch einen Finanzabteilungsleiter. Ein Verbot der Aufnahme von Fremdwährungskrediten für kleine Gemeinden und zu schauen, dass man schnell wieder aus dieser Finanzierung herauskommt, sind für mich ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
Ebenso richtig ist, dass die Länder bei Finanzierungen über die Bundesfinanzierungsagentur OeBFA den Nachweis erbringen müssen, dass sie die Regeln des Spekulationsverbotes einhalten und den Auflagen gerecht werden, die in diesem Gesetz verankert sind. Der Zeitraum, für den die OeBFA eine Schuldenmanagementstrategie vorzulegen hat, wurde von einem Jahr auf vier Jahre verlängert; diese Verlängerung der Vorausschau auf vier Jahre ist wichtig und richtig. Weiters wurde die maximale Laufzeit von sogenannten Staatskrediten von 70 auf 100 Jahre verlängert, wobei zu sagen ist, dass die durchschnittliche Laufzeit laut Bundesrechnungshof bei 8,8 Jahren liegt.
Geschätzte Damen und Herren! Mit diesem Gesetz soll das Vertrauen in die Finanzpolitik zurückgewonnen und die Spekulation unterbunden werden. Ich weiß, es ist schwierig zu sagen, wo die Spekulation anfängt und wo sie aufhört – das haben Sie richtig gesagt, Frau Kollegin. Mit diesem Gesetz gibt es nun aber klare Regeln für die öffentliche Hand, und darum werden wir diesem wichtigen Gesetz auch zustimmen. (Beifall bei der SPÖ und bei Bundesräten der ÖVP.)
11.19
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Ing. Rösch. – Bitte.
11.19
Bundesrat Ing. Bernhard Rösch (FPÖ, Wien): Wertes Präsidium! Sehr geehrter Herr Finanzminister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Es ist ein heikles Thema, das wir heute zu beschließen haben – heikel deswegen, weil es in der Vergangenheit schon sehr viele Emotionen ausgelöst hat, und Gott sei Dank gibt es jetzt eine Änderung hinsichtlich des Bundeshaushaltsgesetzes von 2013, das sich mit dem Spekulationsverbot für den Sektor Staat beschäftigt.
Kollege Mayer hat versucht, Schützenhilfe zu geben, derer es an und für sich bei einer solchen Änderung gar nicht bedarf. Trotzdem kann ich die Kritik von Frau Dr. Mayer auch teilen, und das war sehr ... (Zwischenrufe bei den Bundesräten Mayer und Reiter.) – Entschuldigung, Dr. Reiter natürlich! Die Kritik kann ich natürlich auch teilen, denn das Zurückrudern bei den vielen Möglichkeiten, wie man im Staat früher mit Geld umgehen konnte – das war ja sensationell –, bleibt ein bisschen amorph.
Das Geld der Bevölkerung war nicht so geschützt wie das eigene Geld; man hat es viel salopper ausgegeben. Wir haben das ja in der Vergangenheit gesehen. Ganz kurz ist Niederösterreich angesprochen worden, aber ich denke auch an Salzburg, wo es viele Tränen gab und wo wir viel Geld verloren haben. Ich denke an Linz in Oberösterreich, wo auch fest spekuliert wurde. Ich denke auch an Wien, wo der Herr Finanzminister allerdings noch ein bisschen etwas lernen kann, denn in Wien sind ... (Ruf bei der SPÖ: Und was ist mit Kärnten?) – Bitte? (Ruf bei der SPÖ: Kärnten darf man nicht vergessen!) – Ja, Kärnten kommt ja erst, Kärnten hat ja eine Sonderstellung! (Heiterkeit bei ÖVP, SPÖ und Grünen. – Bundesrat Lindinger: In ein laufendes Verfahren darf man sich ja nicht einmischen!) – Natürlich, ich bin ja noch lange nicht mit allen neun Bundesländern durch und zeige damit ja nur die Breite und Brisanz und dass es eben überall Handlungsbedarf gab. Zwar gehen die Maßnahmen für uns jetzt natürlich auch nicht weit genug, aber es ist ein guter Schritt.
In Wien – das wollte ich eigentlich sagen – erzählt die Frau Finanzstadträtin immer, dass die Spekulationen keine Spekulationen sind, weil es ja nur eine andere Währung ist, in der wir drinnen sind. Und jetzt haben wir mittlerweile 600 Millionen € nicht realisiert, denn wenn man kein Ende eines solchen Kredites hat, diesen einfach offen und rollieren lässt – so heißt nämlich das Zauberwort –, dann sind die 600 Millionen €, die zurzeit zusätzlich da sind beziehungsweise theoretisch da wären, nicht da, weil wir das Ende nicht kennen, also haben wir sie gar nicht. Das ist eine ganz tolle Sache, und ich glaube, dass wir mit dieser Änderung des Bundeshaushaltsgesetzes da schon ein bisschen mehr Klarheit hineinbringen werden.
Im Unterschied zur Kollegin glaube ich auch, dass die Wohnbaugelder in Zukunft natürlich nicht mehr so leicht vergeudet und verzockt werden können, sondern dass sie wirklich für den Wohnbau genutzt werden, und damit werden wir auch wieder eine Entlastung haben, sodass sich praktisch auch jeder in Österreich eine Wohnung und deren Miete wird leisten können. Schon allein deswegen ist es in unserer Abwägung so gewesen, dass wir eher dafür sind.
Wenn man sich mit der Materie auseinandersetzt, stört natürlich ein bisschen, dass es um Gebote geht und da gleichzeitig „Spekulationsverbot“ geschrieben steht. Gebote und Verbote sind nicht nur sprachlich, sondern auch tatsächlich etwas Unterschiedliches. Es ist eben ein Kompromiss. Zum Fremdwährungsrisiko steht drinnen, dass man sich gegen das Risiko absichern muss. Na, wenn man wüsste, wie man sich wirklich gegen so ein Risiko absichern kann, würde man das Risiko erst gar nicht eingehen. Es kann ja auch positiv ausgehen, und es hat ja immer wieder Leute gegeben, die in der Vergangenheit in Yen, in Franken und, und, und spekuliert haben. Da gibt es welche, die gut ausgestiegen sind, und es gibt welche, die zu lange geblieben sind, und die sind eben schlecht ausgestiegen.
Die Begrenzung auf 100 Jahre sehe ich nicht so positiv, auch wenn Kollege Lindinger gesagt hat, dass es im Schnitt nur 8,5 Jahre sind. Auf 100 Jahre nimmt man keine Kredite auf, denn das sollte schon in einer Menschenära bleiben, damit man sich und den Kindern dann noch in die Augen schauen und sagen kann: Ich habe das damals beschlossen, ich stehe dazu!, statt für die Ururenkelkinder irgendetwas zu beschließen und einfach zu sagen: Ja, wir haben damals geglaubt, es ist einfach so günstig, es herrschte gerade eine Zinssituation, die so toll war, aber in Wirklichkeit hat sich das dann ganz anders entwickelt. Es hat den Anschein, dass man zu 100-jährigen Beschlüssen ganz einfach nie mehr stehen möchte, man das vielleicht auch nie mehr zurückzahlen möchte, so wie das an und für sich auch mit Staatsschulden ist, die man ja nicht wirklich zurückzuzahlen plant. Da hat ja der Herr Finanzminister ganz andere Instrumente.
Das mit der Inflation geht natürlich in der Europäischen Union nicht mehr so einfach; das macht jetzt schon die EZB für uns. Wenn wir uns anschauen, was wir an Zinsen zah-
len – nicht bekommen, sondern zum Teil zahlen, also die, die mehr bekommen, sonst liegt es ungefähr bei null –, bei der Inflation der letzten, sagen wir, zehn Jahre, dann haben wir ein Delta von im Schnitt 2 Prozent gehabt. Wenn wir die Zahlen der Nationalbank zugrunde legen, die die Finanzvermögen so ungefähr bei 600 Milliarden € ansetzt, dann verlieren wir jedes Jahr 12 Milliarden € an Kaufkraft. Da bedeutet das, was wir bei der Steuerreform gemacht haben, eine Kommastelle. Diese 12 Milliarden € gehen weg, die bekommt irgendjemand. Natürlich brauchen wir das zur Bereinigung, denn man kann Geld nicht ewig nachbilden – nachdrucken kann man ja gar nicht sagen, denn die Nationalbank druckt es ja nicht mehr, sondern die EZB verschickt es virtuell durch Europa. Man versucht, die Märkte zu stabilisieren, und irgendjemand zahlt dann die Zeche. Das sind wir, aber wir wissen das.
Vor diesem Hintergrund werden wir natürlich noch viel mehr an diesen Gesetzen arbeiten müssen, weil die nächste Finanzkrise auf uns zukommt, wenn zum Beispiel BlackRock oder sonst eine der großen Vermögensfirmen mit ihren vielen, vielen, vielen Milliarden den Markt in der IT-Branche zu bereinigen beginnt. Das wird wahrscheinlich irgendwann kommen, weil ja schließlich alles, was jetzt durch die Digitalisierung bis hin zur Industrie 4.0 aufgekommen ist, auch irgendjemand finanziert hat. Das waren die Fonds dieser ganz großen Giganten – BlackRock zum Beispiel besteht erst seit 1988 –, diese sind riesig schnell gewachsen, und wenn sie zum Bereinigen anfangen, laufen alle hinterher. Und dann schaue ich mir unsere Pensionsfonds an, und dann schaue ich mir an, wo wir da überall drinnen sind. Da werden die Versicherungen und die Banken wieder zum Weinen anfangen. Da brauche ich kein Prophet zu sein, das kommt wie das Amen im Gebet.
Ich will nicht unken, aber ich erwarte das – ich komme aus der Versicherungsbranche – ungefähr in einem Jahr; es kann ein bisschen früher, ein bisschen später kommen. Dass man sich von denen, die sich nicht durchsetzen werden, einfach trennt, ist eine ganz normale Sache, so wie man sich damals bei der Internetblase von denen getrennt hat, die nicht mitgekommen sind. Die Starken sind durchgekommen, das sind Milliardenimperien geworden, und die anderen waren einfach weg. All das haben die Fonds bezahlt.
Das müssen wir wissen, und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir niemandem mehr raten, solche Risiken einzugehen. Ich bin guter Hoffnung, dass die Wohnbaugelder damit wieder zweckgewidmet und für die Österreicherinnen und Österreicher eingesetzt werden, damit leistbares Wohnen ganz einfach wieder möglich wird. Ich kann unserem Herrn Finanzminister damit nur viel Erfolg wünschen. (Beifall bei der FPÖ.)
11.27
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesminister Dr. Schelling. – Bitte, Herr Minister.
11.27
Bundesminister für Finanzen Dr. Johann Georg Schelling: Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Dieses Spekulationsverbot ist ja auch so etwas wie eine unendliche Geschichte, in der wir jetzt versuchen, einmal zu einem vernünftigen, praktikablen Ende zu kommen. Und ich glaube, es ist ein guter Weg, und es darf auch nicht isoliert betrachtet werden. Sie dürfen nicht vergessen, dass wir im Rahmen der Finanzausgleichsverhandlungen mit den Ländern und den Gemeinden und übrigens auch für den Bund Haftungsobergrenzen fixiert haben, sodass wir dort Beschränkungen dahin gehend einziehen, wie viel man denn überhaupt an Haftung übernehmen darf, um solche Fälle, wie sie passiert sind, nicht mehr eintreten zu lassen.
Natürlich haben Sie völlig recht: Die Bewältigung der Vergangenheit in einzelnen Bundesländern wird uns noch in Anspruch nehmen. Ich bin derzeit in intensiven Verhand-
lungen auf europäischer Ebene, um die Strafzahlung, die wir für Salzburg zu erwarten haben, wegzubekommen, zu minimieren oder zu reduzieren. Derzeit laufen diese Gespräche und ich erkenne daraus, dass man damals einen Weg beschritten hat, der dann nicht mehr möglich sein wird. Das ist aber natürlich in der Vergangenheit passiert, auch wenn es ein Kriminalfall war. Wir sind dabei, die HETA abzuwickeln. Auch das ist ein Fall, der massiv in diese Kategorie einzuordnen ist, und wir versuchen nun auch da, das Bestmögliche für die Republik zu erreichen, und wir sind auf gutem Wege.
Neben diesen Haftungsobergrenzen kommt nun also dieses Spekulationsverbot. Sie wissen – Sie sind alle Vertreter der Länder –, dass in einigen Ländern diese Spekulationsverbote bereits beschlossen wurden. Bei einem bundeseinheitlichen Spekulationsverbot ist natürlich auch eine Frage, ob man einfach alle Landtage noch einmal aufmacht. Wir haben daher den Weg beschritten, dass wir festgelegt haben: Wer mit dem Bund finanziert, muss die Regeln des Bundes einhalten. Das wird durch den Landesrechnungshof oder durch den Landtag zu bestätigen sein, und von der OeBFA, der Bundesfinanzierungsagentur, ist zu prüfen, ob diese Regeln eingehalten werden. Ansonsten wird eine Finanzierung nicht mehr möglich sein. Das gilt also für jene Länder, die sich über die OeBFA finanzieren. Das sind im Moment sieben Bundesländer mit einem Volumen von knapp 10 Milliarden €. Das entspricht etwa einem Drittel der Gesamtfinanzierung der Bundesländer.
Wir finanzieren über die OeBFA aufgrund dessen, dass wir die Dinge auf dem Kapitalmarkt wieder in Ordnung gebracht haben. Diesbezüglich noch einmal beispielhaft die Lösung für die HETA: Diese finanzieren wir im Moment so günstig, dass die Bundesländer eine so günstige Finanzierung derzeit nur über die OeBFA realisieren können. Wer diese haben will, muss die Regeln des Bundes einhalten. Und bei einer Differenz von fast null Zinsen ist der Spread von 0,5 Prozentpunkten Anreiz genug, um die Regeln einzuhalten.
Herr Bundesrat Rösch! Wir hatten bisher schon die Möglichkeit, 70-jährige Anleihen zu begeben, und seien Sie unbesorgt, wir werden diese 100-jährigen nur kurz andiskutieren. Wir versuchen, in der Bundesfinanzierungsagentur einen äußerst soliden Mix zwischen kurz-, mittel- und langfristiger Finanzierung zu haben, und das ist uns bisher auch sehr gut gelungen. Natürlich ist derzeit eine Situation auf dem Markt gegeben, die man auch mittel- und langfristig nutzen muss.
Frau Dr. Reiter, ich muss Ihnen leider recht geben: Es gibt keine risikolose Gesellschaft; das ganze Leben ist ein Risiko, und deshalb wird man am Ende nicht alles davon beseitigen können. Es wird möglicherweise immer noch Risken geben, aber unser Job ist es, die bisher eingegangenen Risken nicht mehr zuzulassen.
Damit komme ich zu dem Punkt Sozialversicherungen, weil das auch von Herrn Bundesrat Rösch angesprochen wurde und auch davor schon von Herrn Lindinger: Die Sozialversicherungen unterliegen in Zukunft dieser Regelung, und das ist ganz wichtig, weil wir da eine ganz klare und saubere Struktur haben wollen.
Lassen Sie mich noch einmal kurz auf die Frage eingehen, was denn eigentlich risikoavers ist – einige Punkte sind hier bereits erwähnt worden, die es mir einfach wichtig erscheint, noch einmal zu betonen –: Es muss auf ein Mindestmaß beschränkt werden; die Risken sind stärker zu gewichten, was im Zusammenhang mit den Haftungsobergrenzen ganz wichtig ist; keine Kreditaufnahme zum Zwecke mittel- und langfristiger Veranlagungen; Kreditaufnahme, um zu investieren, aber nicht, um zu veranlagen und damit zu spekulieren; keine Derivate ohne Grundgeschäft – das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass es keine Derivate ohne Grundgeschäft gibt, denn die Derivate sind das größte Gift in diesem Spiel –; eine detaillierte Regelung zu allen Risikoarten; eine strategische Planung bezüglich Schulden- und Liquiditätsmanagement und die personelle
Funktionstrennung von Front- und Backoffice-Bereichen und des Controlling. – Das sind die Auswirkungen dessen, was wir in der Vergangenheit erlebt haben.
Nun kann man sagen, das geht alles nicht weit genug, natürlich kann man sagen, man bräuchte so etwas im Verfassungsrang. Ich kann dazu nur sagen: Den Versuch dazu hat es schon einmal gegeben, und wir konnten dann die Mehrheiten nicht herstellen. Daher sage ich ganz offen und in aller Ehrlichkeit und Deutlichkeit: Mir ist dieser Weg, den wir jetzt beschreiten, lieber, als ich bekomme gar nichts und es geht munter weiter. Wir haben einen wichtigen Schritt gesetzt; dass das verbesserungsfähig ist, ist gar keine Frage.
Mir ist aber noch etwas wichtig – und da erbitte ich auch die Unterstützung derer, die diese Länder vertreten –: Wir haben das Problem im Burgenland noch nicht gelöst, wir haben das Problem in Kärnten noch nicht gelöst. Da wäre es aus meiner Sicht eigentlich richtig, dass die beiden Bundesländer, die noch Beschlüsse fassen können, eigentlich von sich aus erklären sollten: Wir nehmen das Bundessystem des Spekulationsverbotes, damit es dort gleich einheitlich umgesetzt wird. – Die Länder haben sich in einer Vereinbarung im Rahmen des Finanzausgleichs verpflichtet, bis Ende 2017 in ihren eigenen Bereichen diese Spekulationsverbote zu beschließen und umzusetzen.
In der Kombination mit der Finanzierung ist uns jetzt ein Brückenschlag gelungen, der wichtig ist, um das Manko – das zu Recht kritisiert wurde –, dass es eben keine bundesweit einheitliche Regelung gibt, zu beseitigen und über die Finanzierung Einfluss darauf zu bekommen, dass unsere Regeln auch eingehalten werden.
Ich halte es für gut, dass diese Regelung gelungen ist. Sie haben darauf verwiesen: Ganz einfach sind die Gespräche und Verhandlungen zu diesem Thema nicht, es ist jedoch die generelle Einsicht vorhanden und der Zeitpunkt auch günstig.
Lassen Sie mich abschließend begründen, warum dieser Zeitpunkt günstig ist. Eigentlich ist die Frage der Haftungen – Sie erinnern sich – 2004 geregelt worden, nämlich dahin gehend, dass die Länder für ihre Banken keine Haftungen mehr übernehmen dürfen. Dann wurde eine Übergangsbestimmung bis 2007 geschaffen, die übrigens nicht nur von Österreich, sondern auch von Deutschland gewünscht wurde, mit der Bedingung, dass 2017 alle diese Haftungen abreifen. Es gab natürlich Bundesländer, die zwischen 2004 und 2007 keine weiteren Haftungen übernommen haben. Es gab aber auch Bundesländer, die in dieser Zeit massive Haftungen übernommen haben.
Es ist müßig, darüber zu diskutieren, warum und weshalb, aber es ist passiert. Und deshalb – und damit schließe ich – ist dieser Zeitpunkt 2017 so wichtig für die Umsetzung sowohl der Haftungsobergrenzen als auch des Spekulationsverbots, weil jetzt die Haftungen für die Landesbanken abreifen und auch nicht mehr neu eingegangen werden dürfen. Ich halte das daher für ein ganz, ganz wichtiges Zeitfenster, in dem wir jetzt mit den Haftungsobergrenzen und dem Spekulationsverbot gearbeitet haben, und bedanke mich bei allen, die diesem Gesetzesvorschlag zustimmen werden. (Beifall bei ÖVP und SPÖ sowie bei Bundesräten der FPÖ.)
11.35
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Bitte, Herr Mag. Zelina.
11.36
Bundesrat Mag. Gerald Zelina (STRONACH, Niederösterreich): Sehr geehrter Herr Finanzminister! Noch ein Anliegen: Die Problematik besteht ja hauptsächlich darin, dass uns die Banken beraten. Auf der einen Seite verkaufen sie die Kredite, auf der anderen Seite, wenn Länder Liquidität haben, wird diese veranlagt, mit dem Ziel, eine höhere Rendite zu erzielen, als sie auf der Kreditseite zahlen.
Es wäre natürlich sinnvoll, sämtliches Cash zu bündeln, ein Cash-Management der Länder, von mir aus auch über die Bundesfinanzagentur, über den Bund, um jede Über-
schussliquidität täglich zu setteln und damit dann in Summe geringere Kreditzinsen zu zahlen.
Auf der anderen Seite wäre auch zu überlegen, ein Fremdwährungskreditverbot für öffentliche Finanzierungen zu installieren. Dann brauchen wir auch keine Yenkredite oder Frankenkredite mehr mit Futures abzusichern. Das ist ja auch wieder ein Doppelgeschäft. Das wäre auch zu überlegen.
Ein Cash-Management auf Bundesebene würde ich also für sehr sinnvoll halten. Das nur noch als Anmerkung. – Danke.
11.37
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Wünscht noch jemand das Wort? – Es ist dies nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir gelangen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und Jersey zur Beendigung des Abkommens über die Besteuerung von Zinserträgen (1500 d.B. und 1558 d.B. sowie 9757/BR d.B.)
4. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und Guernsey zur Beendigung des Abkommens über die Besteuerung von Zinserträgen (1501 d.B. und 1559 d.B. sowie 9758/BR d.B.)
5. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und Isle of Man zur Beendigung des Abkommens über die Besteuerung von Zinserträgen (1502 d.B. und 1560 d.B. sowie 9759/BR d.B.)
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Nun gelangen wir zu den Punkten 3 bis 5.
Berichterstatter zu diesen Punkten ist Herr Bundesrat Heger. – Ich bitte um die Berichte.
Berichterstatter Peter Heger: Frau Präsidentin! Herr Minister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich bringe Ihnen den Bericht des Finanzausschusses zu den Tagesordnungspunkten 3, 4 und 5.
Zuerst berichte ich zu Tagesordnungspunkt 3, dem Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und Jersey zur Beendigung des Abkommens über die Besteuerung von Zinserträgen.
Die Beendigung des Abkommens über die Besteuerung von Zinserträgen und die vorläufige Anwendung dieses Abkommens zwischen der Republik Österreich und Jersey ist aufgrund aktueller Entwicklungen sowohl auf internationaler als auch auf europäischer Ebene erforderlich.
Österreich hat sich durch den Abschluss eines Regierungsübereinkommens vom 29. Oktober 2014 der Mehrseitigen Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden über
den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten, zu einem automatischen Austausch von Finanzkonten mit teilnehmenden Drittstaaten verpflichtet.
Der gegenständliche Staatsvertrag ist gesetzändernd beziehungsweise gesetzesergänzend. Da auch Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbereichs der Länder geregelt werden, ist eine Zustimmung des Bundesrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG erforderlich.
Der Finanzausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates, der in schriftlicher Form vorliegt, in der Sitzung des Finanzausschusses am 4. April 2017 in Verhandlung genommen.
Nach Beratung der Vorlage stellt der Finanzausschuss mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag,
1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben,
2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
Damit komme ich zum Tagesordnungspunkt 4 und bringe den Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und Guernsey zur Beendigung des Abkommens über die Besteuerung von Zinserträgen.
Dieser gegenständliche Staatsvertrag ist ebenfalls gesetzändernd beziehungsweise gesetzesergänzend. Da auch Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbereichs der Länder geregelt werden, ist eine Zustimmung des Bundesrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG erforderlich.
Auch dieser Bericht liegt in schriftlicher Form vor. Der Finanzausschuss hat den gegenständlichen Beschluss in seiner Sitzung am 4. April 2017 in Verhandlung genommen.
Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 4. April 2017 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag,
1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben,
2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
Ich komme zum Tagesordnungspunkt 5 und bringe den Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und Isle of Man zur Beendigung des Abkommens über die Besteuerung von Zinserträgen.
Auch dieser Bericht liegt in schriftlicher Form vor. Der gegenständliche Staatsvertrag ist ebenso gesetzändernd beziehungsweise gesetzesergänzend. Da auch Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbereichs der Länder geregelt werden, ist auch hier eine Zustimmung des Bundesrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG erforderlich.
Der Finanzausschuss hat den gegenständlichen Beschluss in seiner Sitzung am 4. April 2017 in Verhandlung genommen.
Nach Beratung der Vorlage stellt der Finanzausschuss mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag,
1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben,
2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Ich danke für die Berichte.
Zu Wort ist dazu niemand gemeldet.
Wünscht jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Die Abstimmung erfolgt getrennt.
Wir gelangen zunächst zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und Jersey zur Beendigung des Abkommens über die Besteuerung von Zinserträgen.
Da der gegenständliche Beschluss Angelegenheiten der selbständigen Wirkungsbereiche der Länder regelt, bedarf dieser der Zustimmung des Bundesrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG.
Wir gelangen zunächst zur Abstimmung, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist angenommen.
Nun lasse ich über den Antrag abstimmen, dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist angenommen.
Nun gelangen wir zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und Guernsey zur Beendigung des Abkommens über die Besteuerung von Zinserträgen.
Da der gegenständliche Beschluss Angelegenheiten der selbständigen Wirkungsbereiche der Länder regelt, bedarf dieser der Zustimmung des Bundesrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG.
Wir gelangen zunächst zur Abstimmung, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit angenommen.
Nun lasse ich über den Antrag abstimmen, dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, um ein Handzeichen. – Auch das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist angenommen.
Schließlich kommen wir zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Isle of Man zur Beendigung des Abkommens über die Besteuerung von Zinserträgen.
Da der gegenständliche Beschluss Angelegenheiten der selbständigen Wirkungsbereiche der Länder regelt, bedarf dieser der Zustimmung des Bundesrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG.
Wir gelangen zunächst zur Abstimmung, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit angenommen.
Nun lasse ich über den Antrag abstimmen, dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, um ein Handzeichen. – Auch das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Flugabgabegesetz geändert wird (1524 d.B. und 1561 d.B. sowie 9760/BR d.B.)
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Wir gelangen nun zu Punkt 6 der Tagesordnung.
Berichterstatter ist Herr Bundesrat Pfister. Ich ersuche um den Bericht.
Berichterstatter René Pfister: Frau Präsidentin! Herr Minister! Ich bringe den Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Flugabgabegesetz geändert wird.
Der gegenständliche Beschluss beinhaltet die Senkung des Tarifs der Flugabgabe. Die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Österreich in der Luftfahrt wird durch die Flugabgabe potenziell beeinflusst. Um den veränderten Rahmenbedingungen im innereuropäischen Wettbewerb zu entsprechen und gleichzeitig die Standortattraktivität zu erhöhen, soll es zu einer Halbierung der Flugabgabe ab 1. Jänner 2018 kommen.
Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 4. April 2017 mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Wir gehen in die Debatte ein.
Als Erster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Längle. – Bitte.
11.48
Bundesrat Christoph Längle (FPÖ, Vorarlberg): Frau Vizepräsidentin! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrter Finanzminister! Es wurde bereits viel über das in Verhandlung stehende Flugabgabegesetz gesagt. Zum Flugverkehr allgemein ist selbstverständlich festzuhalten, dass er sehr wohl umweltschädigend ist.
Es liegt auf der Hand, dass dabei viele Abgase produziert werden. Es ist aber auch so, dass wir in der heutigen Zeit eine gut funktionierende Verkehrslandschaft brauchen, und dazu gehören eben auch Flugsysteme, Flughäfen und Flugzeuge.
Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass wir in Zukunft gute Technologien haben, die immer sauberer werden. Ich meine auch, dass es unser aller Anliegen sein sollte, dass wir in die Zukunft investieren und versuchen, die Abgase ständig zu reduzieren und somit in diesem Bereich im Sinne des Umweltschutzes eine Verbesserung herbeiführen können.
Mit diesem Gesetz ist nun geplant, die Flugabgabe zu halbieren, sie wird von 7 €, 15 € und 35 € auf 3,5 €, 7,5 € und 17,5 € für die Kurz-, Mittel- und Langstrecke reduziert. Unsere freiheitliche Meinung dazu ist jene, dass wir das einmal positiv sehen, doch wir gehen auch noch einen Schritt weiter und fordern eine vollständige Reduktion dieser Flugabgabe, denn eigentlich sollten wir gar nichts verlangen. (Bundesrat Stögmüller: ... umweltschädigend ...!)
Was erzielen wir damit? – Wir erzielen damit eine Stärkung unserer Standorte, insbesondere sind da selbstverständlich die Flughäfen in Österreich zu nennen – Graz, Salz-
burg, Innsbruck, Klagenfurt, und insbesondere Wien hat da seine Wichtigkeit. Es sollte unser Ziel sein, die Wirtschaft zu stärken, Arbeitsplätze abzusichern, und dies können wir mit einer vollständigen Reduktion herbeiführen.
Zu den Grünen: Ihr habt jetzt hier nett dazwischengerufen. Dazu fällt mir selbstverständlich auch etwas ein. Ich habe mir natürlich auch die Reden eures Kollegen Willi im Nationalrat angesehen, der insbesondere die Kurzstrecke kritisiert hat und gemeint hat, dass man diese nicht mit dem Flugzeug fliegen sollte, sondern beispielsweise auf die Bahn umsteigen könnte. (Zwischenruf des Bundesrates Stögmüller.)
Dazu muss ich aber schon klar sagen: Ihr müsst anfangen, vor eurer eigenen Türe zu kehren. Kollege Harald Walser von den Grünen sitzt nämlich ständig im Flugzeug, also das zur Erklärung. (Bundesrat Mayer: Ja, bei den Grünen ist das ganz etwas anderes!) – Ja, ja, eben! Herr Kollege Mayer, Sie sagen es: Das ist etwas anderes. – Beginnt einmal damit, vor eurer eigenen Tür zu kehren, und dann schauen wir weiter! (Beifall bei der FPÖ. – Zwischenruf des Bundesrates Stögmüller.)
Bezüglich des Tagesordnungspunktes halten wir Freiheitliche deutlich fest, dass die Wirtschaft gestärkt, die Standorte abgesichert und unsere Arbeitsplätze geschützt werden müssen. – Danke. (Beifall bei der FPÖ.)
11.51
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Bundesrat Poglitsch. – Bitte, Herr Kollege.
11.51
Bundesrat Christian Poglitsch (ÖVP, Kärnten): Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen des Bundesrates! Sehr geehrter Herr Finanzminister! Ich verstehe die Position der Freiheitlichen nicht ganz.
Im Ausschuss seid ihr dagegen gewesen – gegen die Senkung der Abgabe. Ich nehme an, da ich hier so positive Beiträge gehört habe, dass ihr heute zustimmt. (Bundesrat Längle: Nein!) – Ihr geht nicht mit? – Also das ist dann relativ unverständlich. (Bundesrat Längle: Wir sind für komplette Reduktion!) Wenn die Wirtschaft in Österreich und die Konsumenten um fast 60 Millionen € entlastet werden, dann gehen die Freiheitlichen nicht mit. (Ruf bei der FPÖ: Wir wollen um 120 Millionen € entlasten!) – Ja, aber das wäre der erste Schritt. Das wäre der erste Schritt, dass ihr zustimmt und bei der Entlastung der Wirtschaft vielleicht auch einmal mitwirkt. Das waren positive Worte, ja, aber ihr geht bei diesem Punkt nicht mit. (Bundesrätin Mühlwerth: Wir wollen große Schritte machen!) Das ist für mich unverständlich. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
Eines muss an dieser Stelle klar und deutlich gesagt werden: Wenn Wirtschaft und Konsumenten entlastet werden, dann ist das immer ein positiver Schritt. Wenn es auch nur 60 Millionen € sind – es ist absolut positiv zu betrachten. Man darf die Entlastung nicht nur hinsichtlich der Zahl an Millionen sehen (Bundesrat Längle: Habe ich nie gesagt!), sondern muss auch bedenken, was es zum Beispiel für den Standort Wien, für den Flughafen und für den Standort Österreich bedeutet. So ist dieses positive Signal, das der Finanzminister und der Nationalrat mit dem Mehrheitsbeschluss gesetzt und somit den Standort dementsprechend abgesichert haben, zu sehen.
Die AUA hat das sehr positiv aufgenommen. Wir reden da auch von Arbeitsplätzen an den verschiedenen Standorten, in Wien und bei den vielen Regionalflughäfen. Daher wird das von unserer Seite sehr positiv gesehen, und wir werden das natürlich auch mittragen.
Es sind viele kleine Flughäfen und auch – das sollte man nicht unterschätzen – der Tourismus in Österreich, der es gerade jetzt schwer hat und der belastet ist, davon betroffen. Wenn es für den Tourismus eine Entlastung gibt, sichert das in weiterer Folge auch Arbeitsplätze.
Nur eine Bemerkung zu den Grünen: Ich habe mir auch die Redebeiträge im Nationalrat durchgelesen. Ich bin ganz gespannt, was ihr heute zu dem Thema sagen werdet. Hinsichtlich Umweltbelastung: Wenn das seinerzeit, als die Abgabe im Jahr 2011 eingeführt wurde, einen Lenkungseffekt hätte zeigen sollen, dann hat der nicht funktioniert. Es hat trotzdem mehr Flugbewegungen gegeben. Ein Vorteil, der daraus resultiert, ist, dass die Flieger etwas größer geworden sind, mehr Passagiere transportieren und daraus automatisch eine geringere Umweltbelastung folgt.
Wollt ihr, dass die Fluggäste vom Flughafen Wien abwandern, auf das nahe Bratislava ausweichen und dorthin mit dem Auto oder mit dem Bus fahren? – Dann erklärt mir, wo dabei – in eurer grünen Wirtschaftspolitik oder in euren grünen Köpfen – die große Entlastung stattfindet! (Zwischenruf des Bundesrates Stögmüller.) Diese gibt es in Wirklichkeit nicht; deshalb ist das eine positive Beschlussfassung.
Den Freiheitlichen möchte ich einfach nur Folgendes mitgeben: Wenn ihr in Österreich die Wirtschaft entlasten wollt, dann geht da mit, auch wenn ihr mehr wollt. Man kann nicht immer alles haben, aber in dem Fall könnt ihr ruhig und locker mitgehen, das hier mitbeschließen, denn es ist eine durchwegs positive Geschichte, immerhin sind davon auch 10 Millionen Passagiere in Österreich betroffen.
Tickets werden dadurch vielleicht nicht billiger werden, aber wir sind auf dem internationalen Markt mit unseren Flughäfen konkurrenzfähig. (Neuerlicher Zwischenruf des Bundesrates Stögmüller.) Wien hat gegenüber Deutschland einen Wettbewerbsvorteil, den sollte man nicht unterschätzen.
Wir stimmen daher selbstverständlich zu. – Danke schön. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
11.55
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächste zu Wort gelangt Frau Bundesrätin Mag. Schreyer. – Bitte, Frau Kollegin.
11.55
Bundesrätin Mag. Nicole Schreyer (Grüne, Tirol): Hohes Haus! Sehr geehrter Herr Minister Schelling! Sehr geehrte Gäste hier und zu Hause! Es geht hier um ein Abgabegesetz, deshalb sitzt der Herr Finanzminister da, obwohl ich das natürlich – auch im Ausschuss – sehr viel lieber mit dem Herrn Landwirtschaftsminister oder mit dem Herrn Verkehrsminister besprechen würde, denn es geht ja eigentlich um Fragen aus diesen Ressorts.
Die Halbierung der Flugabgabe – ich verstehe einfach wirklich nicht, warum alle anderen Parteien anscheinend dafür sind – ignoriert den Klimawandel. Der Grund für die Einführung der Flugabgabe war ja der Klimaschutz, ökologisch verträglichere Verkehrsmittel sollten dadurch preislich weniger benachteiligt werden.
Treibhausgasemissionen aus dem Luftverkehr haben einfach einen bedeutenden Anteil an der Erderwärmung, sie nehmen exponentiell zu und könnten jeden Versuch, den Klimawandel einzudämmen, komplett zunichtemachen, da der Luftverkehr eine so starke Lobby hat, dass die Emissionen aus dem Luftverkehr nicht einmal im Pariser Klimavertrag miterfasst sind.
Gott sei Dank setzten sich viele Menschen – auch in der EU-Kommission – dafür ein, dass global und koordiniert Maßnahmen gesetzt werden, um endlich den Anstieg der Emissionen aus dem Luftverkehr irgendwie in den Griff zu bekommen. Mit dieser Maßnahme wird genau das Gegenteil gemacht, das ist ein wahnsinniger Rückschritt.
Ich habe das auch schon bei der Vorstellung des Regierungsarbeitsabkommens gesagt: Ich verstehe einfach nicht, warum Sie das machen, ich verstehe es auch in Bezug auf den Tourismus nicht. Es ist nämlich auch für den heimischen Tourismus nicht förderlich, wenn es wieder billiger wird, von Österreich wegzufliegen.
Wir haben uns im Ausschuss einmal angesehen, was das finanziell bedeutet. Der Kollege hat es eh schon ein bisschen erklärt: Es gibt drei Flugabgaben, für die Kurzstrecke, für die Mittelstrecke und für die Langstrecke. Kurzstreckenflüge haben Ziele innerhalb von Europa, in Nordamerika und Russland, da zahlt man zurzeit 7 € Flugabgabe. Mittelstrecke: Das sind Flüge nach Indien und ins mittlere Afrika, da zahlt man 15 €. Alles andere sind Langstreckenflüge, da sind es 35 €. Diese Flugabgabe soll jetzt halbiert werden. 80 Prozent der Flüge überwinden kürzere Entfernungen als 1 200 Kilometer, das heißt, dass 80 Prozent der Flüge Kurzstreckenflüge sind. Das heißt, Sie schenken den Fluggästen 3,50 €, das ist einfach gar nichts im Vergleich zu den Ticketpreisen.
Der Flugverkehr ist eh schon so privilegiert. Auf der Einnahmenseite schaut es so aus – da reden wir nicht mehr von Peanuts –: In den letzten fünf Jahren wurden durch die Flugabgabe 500 bis 600 Millionen € Steuern eingenommen. (Zwischenruf der Bundesrätin Junker.) – Aus dem Ausschuss! Hast du nicht aufgepasst? (Weiterer Zwischenruf bei der ÖVP.)
Nur durch diese Halbierung der Flugabgabe, also einem Minus von 3,5 € ... (Bundesrat Fürlinger: War der falsche Ausschuss!) – Das war der Finanzausschuss, Herr Kollege. Für den Städtetrip nach London, für das Wochenende auf Malé oder für den Businessflug nach Berlin fällt das – im Vergleich zu den Gesamtkosten – überhaupt nicht ins Gewicht, der Staatskasse entgehen ab 2018 aber fast 60 Millionen € jährlich.
Ich möchte noch einmal kurz auf die Privilegien des Flugverkehrs zurückkommen. Allein durch die fehlende Kerosinbesteuerung entgehen dem Staat zusätzlich 200 Millionen € pro Jahr. Wir kommen da immer noch weiter weg vom Verursacherprinzip. Von einer ökosozialen Steuerreform sind wir mit solchen Sachen meilenweit entfernt. Auch wenn vielleicht kurzfristig die Flugkunden entlastet werden, die Klimafolgeschäden zahlt die Allgemeinheit. Ein weltweites Preisdumping kann keine Lösung dafür sein, wir sollten beim weltweiten Preisdumping oder zumindest EU-weiten Nachbarland-Preisdumping nicht auch noch mitziehen.
Die Flugabgabe ist ja 2011 eingeführt worden. Warum? – In der Begründung der Flugabgabe von 2011 steht wortwörtlich drinnen – und das haben ja nicht wir geschrieben, sondern die Regierungsparteien: Der Flugverkehr ist der größte Klimasünder, der Flugverkehr genießt sehr hohe Steuerprivilegien, die auch mit der internationalen Steuerlage zu tun haben, und man muss dafür sorgen, dass sich eine Verschiebung mehr hin zur Bahn ergibt. – Da steht also alles das, was ich auch gerade gesagt habe. So steht das ziemlich genau in der Begründung für die Flugabgabe.
Das Allerbeste ist die Begründung, die es im Ausschuss für die Halbierung der Flugabgabe gegeben hat: Anstatt ehrlich zu sagen, dass man vor den FlughafenbetreiberInnen in die Knie gegangen ist, kommt dann als Begründung, die Lenkung Richtung Bahn hat offensichtlich nicht funktioniert, es wird gleich viel oder sogar noch mehr geflogen, und deswegen wird jetzt halbiert.
Ist das so? Hat sich wirklich niemand von den 7 € davon abbringen lassen, nach Frankfurt zu fliegen, statt mit dem Zug zu fahren? Dann liegt es wohl eher an den halbherzigen Summen. Anstatt die Abgabe zu erhöhen, Fliegen wirklich teurer und dafür die Bahn billiger zu machen, wird sie verringert. Das ist vom Lenkungseffekt her total unlogisch, mit 260 Millionen € im Jahr. Wenn man die Kerosinsteuer einhebt und die Flugabgabe nicht halbiert, lässt sich bei der Bahnpreisgestaltung sicher sehr viel machen, und das wäre dann ein echter Lenkungseffekt. – Danke schön. (Beifall bei den Grünen.)
12.00
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Zu Wort gelangt Herr Bundesrat Heger. – Bitte, Herr Kollege.
12.01
Bundesrat Peter Heger (SPÖ, Burgenland): Frau Präsidentin! Herr Minister! Geschätzte Kollegen des Bundesrates! Der Hauptpunkt des Beschlusses des Nationalrates umfasst eine wichtige Maßnahme, nämlich die Senkung des Tarifs der Flugabgabe. Diese soll ab 2018 halbiert werden, um die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Österreich zu stärken. Die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Österreich wird durch die Flugabgabe potenziell beeinflusst. Um den veränderten Rahmenbedingungen im innereuropäischen Wettbewerb zu entsprechen und gleichzeitig die Standortattraktivität zu erhöhen, soll es zu einer Halbierung der Flugabgabe ab 1. Jänner 2018 kommen.
Damit soll aber auch die internationale Drehkreuzfunktion des Flughafens Wien-Schwechat langfristig abgesichert werden. Die Tarifreduktion bei der Flugabgabe soll zudem den Konsumentinnen und Konsumenten zugutekommen. Mit der Einführung der Flugabgabe im Jahr 2011 ist der Plan, dadurch Mehreinnahmen für den Staatshaushalt zu lukrieren, voll aufgegangen. Derzeit werden ja auch mehr als 100 Millionen € pro Jahr an Flugabgaben eingenommen. Die Halbierung der Flugabgabe wird, wie gesagt, mit 1. Jänner 2018 in Kraft treten, und die Abgabe für Abflüge mit Zielflughafen innerhalb der Kurzstrecke soll 3,50 €, der Mittelstrecke 7,50 € und der Langstrecke 17,50 € pro Passagier betragen.
Ein zweiter, ursprünglich gewünschter und beabsichtigter Lenkungseffekt der Flugabgabe ist aber nicht eingetreten: Trotz dieser Abgabe, die übrigens nur in wenigen europäischen Staaten wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland und Schweden eingeführt wurde, wurden die Flugtickets nicht automatisch teurer und die Passagiere sind nicht auf alternative Verkehrsmittel umgestiegen. Zudem hat die Geiz-ist-geil-Mentalität zu einem neuen Preisdruck beziehungsweise Preiskampf der Fluglinien geführt.
Auch die erhoffte Reduktion der Emissionen ist aus den bereits erwähnten Gründen nicht erfolgt, denn eines ist klar: Wenn ein alternativer Abflughafen weniger als eine Stunde von Wien-Schwechat oder einem anderen Regionalflughafen entfernt ist, dann kann es auch keine Reduktion der Emissionen geben, denn ob ein Flugzeug zum Beispiel in Bratislava startet und über Österreich fliegt oder am Flughafen Wien-Schwechat startet, macht, was die Luftemissionen betrifft, keinen Unterschied.
Selbstverständlich gibt es dazu aber sehr unterschiedliche Meinungen, das hat die heutige Debatte ja bisher deutlich gezeigt. Einerseits lässt sich leicht sagen, dass man die aus der Steuer entstehenden Einnahmen besser in umweltfreundliche Bereiche investieren soll, statt dass der schon jetzt stark geförderte Flugverkehr mit der Halbierung noch mehr Anreize bekommt, sein klimaschädliches Wachstum fortzusetzen, und auch, dass durch die Halbierung Österreich jährlich mehr als 50 Millionen € an Steuereinnahmen entgehen und dieses Geld besser in Förderungen für nachhaltige und leistbare Mobilität, erneuerbare Energie und Energieeffizienzmaßnahmen investiert werden kann. Im anderen Fall helfe man aber eigentlich nur den Fluglinien und Flughäfen dabei, höhere Gewinne zu machen.
Andererseits kann man wiederum sagen, da die Flugabgabe die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Österreich beeinflusst, zielt die Halbierung der Flugabgabe auf die positive Beeinflussung der Wettbewerbsfähigkeit Österreichs in der Luftfahrt ab.
Die Maßnahme soll mit 1. Jänner 2018 umgesetzt werden, um den veränderten Rahmenbedingungen im europäischen Wettbewerb gerecht zu werden und die Standortattraktivität zu erhöhen. Durch die Senkung der Flugabgabe soll das Passagieraufkommen der betroffenen österreichischen Flughäfen weiter steigen, denn die Senkung der Flugabgabe soll auch den KonsumentInnen zugutekommen.
Wichtig ist mir noch, zu erwähnen, dass die Halbierung der Flugabgabe ab 2018 auch rund 500 Unternehmen betrifft. 140 von diesen 500 Unternehmen haben eine Nieder-
lassung in Österreich, und 50 davon haben auch ihren Sitz in Österreich. Das sind sehr viele Arbeitsplätze, am Flughafen Wien-Schwechat direkt 16 000 Arbeitsplätze, in der Ostregion sind davon insgesamt 90 000 Arbeitsplätze betroffen. Vergessen wir diesen, so meine ich, ganz, ganz wichtigen Gesichtspunkt heute nicht!
Von dieser Flugabgabe sind, ausgehend von den Zahlen des Jahres 2015, rund 10 Millionen Passagiere in Österreich betroffen. Deshalb glaube ich, dass diese knapp 60 Millionen €, die den Kunden zugutekommen, gut investiert sind. Ich denke, dass damit die Standortattraktivität tatsächlich erhöht wird, denn diese Flugabgabe war für die kleinen Regionalflughäfen ein zumindest genauso großes Problem wie für den großen Flughafen Wien-Schwechat. Vergessen wir nicht, dass gerade die Regionalflughäfen um jede Maschine kämpfen, denn auf jedem Flughafen geht es um viele Arbeitsplätze, die wir erhalten müssen. Nehmen wir nur Klagenfurt als Beispiel her: Da sagen viele Passagiere, dass sie günstiger von Laibach wegfliegen. Das ist ökologisch gesehen ein Problem, denn man fährt mit dem Auto rund eine Stunde nach Laibach, und die Emissionswerte sind dadurch wesentlich höher.
An diesem Beispiel möchte ich nur aufzeigen, dass unsere Regionalflughäfen dieselben Probleme haben wie der Flughafen Wien-Schwechat, nämlich dass, wenn es Flughäfen im nahen Ausland gibt, diese wesentlich billiger kalkulieren können, auch deshalb, weil es keine Flugabgabe gibt. Und auch die Passagiere kalkulieren genau und vergleichen ständig. Sie haben ein kleines, knappes Haushaltsbudget beziehungsweise Urlaubsbudget und leben diese Geiz-ist-geil-Einstellung. Die Flughäfen im nahen Ausland schaffen damit günstige Voraussetzungen dafür, dass die Menschen von dort wegfliegen beziehungsweise die Fluggesellschaften diese Flughäfen anfliegen.
Es sind aber unsere Arbeitsplätze, für die wir verantwortlich sind, und daher glaube ich, dass die Halbierung ein Schritt, vielleicht nur ein erster Schritt, in die richtige Richtung ist. Die geplante Halbierung der Flugabgabe ist deshalb absolut richtig. Faire Wettbewerbsbedingungen im internationalen Kontext wirken sich positiv auf den heimischen Tourismus aus und beflügeln den Wirtschaftsstandort Wien und Österreich.
Ich denke, dass mit der Halbierung der Flugabgabe und damit mit der Änderung des Flugabgabegesetzes die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft der internationalen Drehkreuzfunktion des Flughafens Wien-Schwechat und für eine erfolgreiche Zukunft unserer Regionalflughäfen gestellt sind, dass damit aber auch der Erhalt vieler Tausend Arbeitsplätze langfristig abgesichert wird. Die Tarifreduktion bei der Flugabgabe soll zudem den Konsumenten und Konsumentinnen zugutekommen. Meine Fraktion wird daher der Änderung des Flugabgabegesetzes die Zustimmung erteilen. – Danke. (Beifall bei der SPÖ.)
12.08
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Zu Wort gelangt Herr Bundesminister Dr. Schelling. – Bitte, Herr Minister.
12.08
Bundesminister für Finanzen Dr. Johann Georg Schelling: Frau Präsidentin! Hohes Haus! Die Bundesregierung hat sich entschlossen, verschiedenste Maßnahmen zu setzen, um Wachstum und Beschäftigung zu generieren. Dazu haben wir Maßnahmen für die Betriebe gesetzt, wir haben Maßnahmen für die Kommunen gesetzt, und wir setzen jetzt eine Maßnahme, um auch für die Drehscheibe Flughafen ein investitionsfreundliches Klima zu entwickeln.
Herr Abgeordneter Willi hat ja erklärt, er wird für das Bürgermeisteramt in Innsbruck kandidieren und als erste Maßnahme in seinem Wahlprogramm die Schließung des Flughafens Innsbruck angekündigt. Da warte ich jetzt einmal darauf, wie der Tirol-Tourismus darauf regieren wird! Man muss im Sinne der Stärkung des Wirtschaftsstandortes
einmal klarstellen: Was Sie von den Grünen wollen, ist, dass wir die Emissionen haben und Bratislava die Passagiere hat.
Das Zweite ist: Auch die Flughäfen stehen in einem Wettbewerb, und es ist eine entscheidende Frage, auf welchem Flughafen investiert wird. Wenn Sie sich die Entwicklung der europäischen Luftfahrt anschauen, so sehen Sie, dass die Fluglinien konzentrierter agieren und zum Beispiel die Lufthansa, die die Mutter der Austrian Airlines ist, auch über andere Gesellschaften wie Brussels Airlines verfügt, übrigens auch über die Swiss, und die können entscheiden, ob sie in München, Zürich oder Wien investieren.
Daher ist es so wichtig, dass diese Investitionen in Wien erfolgen, um dieses Drehkreuz Wien zu stabilisieren. Ich war, meine sehr geehrten Damen und Herren, vor Kurzem in unserer Elite-Universität in Maria Gugging. Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Menschen aus der ganzen Welt dort hervorragende Forschungsarbeit leisten. Diese Forscher brauchen eine Verbindung und können – bei allem Respekt! – aus den, wie ich glaube, 36 Ländern, aus denen sie kommen, nicht mit dem Auto oder dem Zug anreisen. Sie brauchen diese Drehscheibe und werden vielleicht nicht kommen, wenn sie keine günstige Verbindung zu ihren Heimatorten haben und dann Stunden benötigen, um über andere Flughäfen zu fliegen. Das ist einer der Gründe, aus denen wir vorgeschlagen haben, die Flugabgabe zu halbieren: da sie standortpolitisch in den Rahmen des Beschäftigungs- und Wachstumspakets der Bundesregierung sehr gut hineinpasst.
Die Senkung der Flugabgabe kommt aber auch den Menschen hier zugute, denn wir haben natürlich auf diesen großen Flughäfen eine große Anzahl von Transitpassagieren, und die sind alle nicht von der Flugabgabe betroffen, sondern es sind diejenigen betroffen, die den Flughafen entsprechend nutzen. Daher halte ich diese Maßnahme für geeignet.
Wir können natürlich auch darüber diskutieren, dass diese Bundesregierung auch andere Maßnahmen setzt, die in eine völlig andere Richtung gehen. Wir investieren 72 Millionen € in die Elektromobilität, in die Infrastruktur, in die Prämien für den Ankauf von Elektrofahrzeugen. Daher nehmen wir das Thema sehr wohl ernst. Was aber natürlich keinen Sinn macht, ist – und das zeigen ja alle Studien –, dass letzten Endes die Emissionen nicht reduziert werden, wir aber den wirtschaftlichen Schaden haben. Daher sind andere Maßnahmen erforderlich, die da gesetzt werden; dazu wird es im Rahmen der Klimastrategie auch verschiedene Überlegungen geben. Jetzt erfolgt diese Maßnahme zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes. Ich halte es für gut, dass man sich dazu entschieden hat. Es hat lange Diskussionen darüber gegeben.
Am Ende noch zur Klarstellung, da es dazu Zwischenrufe gegeben hat: Die Lobbyisten der Flughäfen haben mit dem überhaupt nichts zu tun, da sie nicht davon profitieren. Sie profitieren, wenn überhaupt, davon, dass wir ein starker Standort bleiben, aber sie profitieren nicht von der unmittelbaren Senkung der Flugabgaben; davon profitieren die Konsumentinnen und Konsumenten.
Und zur Korrektur: Ich weiß auch nicht, woher diese Zahl – ich hoffe, ich habe sie richtig gehört – von 500 Millionen kommt. Es sind in etwa 100 Millionen, das ist ziemlich stabil. (Bundesrätin Schreyer: Während fünf Jahren!) – Ach so, Sie reden von Perioden? Dann könnte man aber auch sagen, es sind 5 Milliarden, wenn wir über einen längeren Zeitraum reden. Vielleicht darf ich einmal aufklären: Herr Kollege Mayer hat in seinem vorigen Redebeitrag über die Verantwortung für das Budget gesprochen. Die Verantwortung für das Budget trägt zuallererst einmal der Finanzminister, der es erstellt, und dann der Nationalrat, der es beschließt. Üblicherweise, mit ganz wenigen Ausnahmen, beschließen wir Jahresbudgets, daher ist es natürlich aus Ihrer Sicht gerechtfertigt, über lange Perioden nachzudenken, letztendlich beschließen wir das aber von Jahr zu Jahr. Wir beschließen übrigens auch Steuerveränderungen von Jahr zu Jahr, daher ist es ja
völlig offen, auch diese Änderungen durchzuführen, ob es nun in die Richtung geht, die sich die Freiheitlichen wünschen, oder in eine andere Richtung.
Fest steht: Es ist eine Maßnahme zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes und auch zur Stärkung der regionalen Flughäfen, die ohnehin massive Probleme haben. Ich halte es für richtig und wichtig, dass wir den Wirtschaftsstandort Österreich nicht nur auf Wien konzentriert als Drehscheibe sehen, sondern auch die Erhaltung der Regionalflughäfen, insbesondere in Hinblick auf den enormen Faktor, den sie für den Tourismus darstellen, sicherstellen. Sie können sich ja gerne einmal im Detail anschauen, wie viele Passagiere aus allen möglichen Ländern dieser Welt gerne zu uns nach Österreich kommen, die aber vermutlich eine drei- oder viertägige Zugreise nicht auf sich nehmen würden.
Daher kann ich nur sagen: Wer so wie Sie argumentiert, hat auch die Vergangenheit noch nicht verstanden. Da wird immer mit Flugbewegungen argumentiert. Aber es werden die Flugbewegungen derzeit nicht mehr, da die Maschinen viel größer werden. Jetzt kommen auf einmal 300 Passagiere in einer Maschine, früher sind 100 in einer Maschine gekommen. Ich glaube daher, dass wir das nicht unterschätzen sollten.
Ich glaube, dass wir durch diese Maßnahme für den wichtigen Faktor Wirtschaftsstandort und, vor allem was die Regionalflughäfen betrifft, für den Tourismus ein entsprechendes Signal setzen und damit auch das Ziel der Bundesregierung, Wachstum und Beschäftigung zu generieren, umsetzen können. – Vielen Dank. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
12.14
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Weitere Wortmeldungen liegen mir dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Es ist dies nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir gelangen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetz geändert wird (2050/A und 1562 d.B. sowie 9761/BR d.B.)
8. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Ausfuhrförderungsgesetz geändert wird (2049/A und 1563 d.B. sowie 9762/BR d.B.)
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Nun gelangen wir zu den Punkten 7 und 8 der Tagesordnung.
Berichterstatter zu beiden Punkten ist Herr Bundesrat Pfister. Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatter René Pfister: Frau Präsidentin! Herr Finanzminister! Ich bringe den Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetz geändert wird.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor; ich komme daher sogleich zur Antragstellung.
Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 4. April mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Ich bringe weiters den Bericht des Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Ausfuhrförderungsgesetz geändert wird.
Die vorliegende Novelle soll die Fortsetzung des seit Jahrzehnten bewährten Exportförderungsverfahrens durch turnusmäßige Verlängerung der gesetzlichen Ermächtigung zur Übernahme von Haftungen für Rechtsgeschäfte und Rechte um weitere fünf Jahre (bis 2022) sicherstellen.
Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 4. April 2017 mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gelangt Frau Bundesrätin Dr. Reiter. – Bitte, Frau Kollegin.
12.17
Bundesrätin Dr. Heidelinde Reiter (Grüne, Salzburg): Frau Präsidentin! Herr Minister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Wir stimmen dem Tagesordnungspunkt 7 zu, dem Tagesordnungspunkt 8 aber nicht, und das möchte ich hier kurz begründen:
Es ist bei diesem Gesetz so, dass bei Projektprüfungen der Entwicklungsbank künftig neben wirtschaftlichen Kriterien auch entwicklungspolitische Prinzipien berücksichtigt werden müssen. Das ist gut so. Diese Kriterien sind die Standards der Weltbankgruppe, der ILO und der OECD. Wir glauben aber, dass das nicht ausreicht. Wir möchten darüber hinaus die UN-Leitlinien für Wirtschaft und Menschenrechte und die UN-Leitlinien zur verantwortungsvollen Verwaltung von Boden- und Landnutzungsrechten, Fischgründen und Wäldern im Rahmen der nationalen Ernährungssicherheit berücksichtigt wissen.
Grund dafür ist ein ganz konkretes Vorkommnis, das von der FIAN gut dokumentiert ist. Die Entwicklungsbank investierte 12 Millionen Dollar in einen Entwicklungsfonds für Afrika, ein Investor kaufte damit Land in Sambia, wo jetzt Soja, Weizen und Mais im industriellen Stil angebaut werden. Es waren 1 600 Arbeitsplätze versprochen, das wurde nicht eingehalten, de facto sind es nur 200, wobei anscheinend nicht einmal Mindestlöhne gezahlt werden. Angedacht war ein Kleinbauernförderprogramm, passiert sind Vertreibungen – es wurde ein ganzes Dorf vertrieben – und Landraub.
Die Prinzipien und Leitsätze der Weltbankgruppe, der ILO und der OECD geben keine konkreten Handlungsschritte vor, sie sind schlicht und einfach älter und tradiert und reichen nicht aus, gerade das Phänomen des Land Grabbing entsprechend in den Griff zu bekommen. Deshalb hat die UNO 2011 und 2012 entsprechende Leitlinien verfasst, die konkrete Handlungsmaxime und praktische Hilfestellungen geben, wie legitime Nutzungsrechte geschützt werden können und unrechtmäßiger Landraub verhindert werden kann. 125 Mitgliedsländer des UN-Komitees für Welternährungssicherheit haben dieses Papier am 11. Mai 2012 offiziell angenommen.
Landraub mit österreichischen Steuergeldern – das darf nicht passieren, werte Kolleginnen und Kollegen! Und deshalb gehören diese Leitlinien unserer Meinung nach in ein Gesetz, das den Anspruch erhebt, modern und fortschrittlich zu sein. – Danke. (Beifall bei den Grünen.)
12.20
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Ing. Köck. – Bitte.
12.20
Bundesrat Ing. Eduard Köck (ÖVP, Niederösterreich): Sehr geehrte Frau Präsident! Sehr geehrter Herr Minister Schelling! Hohes Haus! Die vorliegenden Gesetze bieten unseren Exporteuren Sicherheit. Das ist ganz, ganz wichtig für uns Österreicher, denn 54 Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts kommen aus dem Export. Jedes Prozent mehr oder weniger bringt 10 000 zusätzliche Arbeitsplätze oder vernichtet 10 000 Arbeitsplätze, deshalb sind diese Gesetze und ihre Verlängerung sehr, sehr wichtig für uns.
Fast 70 Prozent der Exporte gehen in die EU, und das zeigt, wie wichtig diese Europäische Union für uns ist. Auch darüber sollte einmal gesprochen werden, denke ich, denn manche kokettieren immer wieder mit dem Öxit. Wenn man sich den Brexit ansieht, ist der nur deswegen passiert, weil in England lange Zeit nur über das gesprochen wurde, was in der EU nicht gut ist – und über das, was in der EU gut ist, wurde nicht mehr gesprochen und das wurde übersehen.
Gerade diese Daten zeigen, dass die EU für uns sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut ist. Auch der Euro ist sehr wichtig, denn der Euro hat sehr viele Risiken bei den Exporten vorweggenommen: Es gibt keine Währungsschwankungen mehr, und deshalb muss die Absicherung durch Gesetze nicht so hoch sein.
Österreichische Firmen haben ihre Direktinvestitionen in den letzten zehn Jahren im Ausmaß von 80 Milliarden € auf 136 Milliarden € gesteigert. Auch das zeigt die Verflechtung. Die Exporte sind allein im letzten Jahr um 2,7 Prozent gestiegen.
Einziger Wermutstropfen bei dieser Entwicklung ist die Geschäftsbeziehung mit Russland, die durch die Sanktionen sehr stark gelitten hat. In diesem Bereich sind die Exporte um 35 Prozent zurückgegangen, gerade der Lebensmittelhandel sowie die Bauern und Bäuerinnen in Österreich haben das gespürt. Auch die Exporte in diesem Bereich sind letzten Endes von 237 Millionen € auf 117 Millionen € gefallen, bei den Preisen für Rind, Schwein und Milch haben das die Betroffenen zu spüren bekommen.
Zu den Exportmöglichkeiten muss man sagen, dass auch die Wirtschaftskammer eine sehr starke Unterstützung bietet, zum Beispiel durch das Programm „go-international“: Dabei werden 56 Millionen € jährlich in die Förderung des Exportes hineingepumpt. Nicht allein deshalb, aber sicher unter anderem dadurch konnte die Zahl der exportierenden Firmen in den letzten zehn Jahren von 12 000 auf 52 000 gesteigert werden.
Es wurde auch die Teilnahme an der EXPO 2017 in Astana beschlossen. Ich denke, auch das ist ein wichtiger Entschluss. Diese Expo steht unter dem Motto „Future Energy“, und gerade in diesem Bereich sind wir weltweit federführend. Wir bauen ja in Kasachstan bereits ein Wasserkraftwerk, und ich meine, unsere Firmen werden von dort sehr, sehr viele Geschäftsbeziehungen mit nach Hause bringen. Mit diesem Gesetz werden sie dann auch eine gewisse Sicherheit bei dortigen Investitionen haben, deshalb befürworten wir dieses Gesetz.
Wenn auch meine Vorrednerin gesagt hat, dass es vielleicht da und dort gewisse Unschärfen gibt, ist es doch bei ihrer Rede so herübergekommen, als hätte Österreich dort in Sambia bei diesem Projekt direkt investiert. Das ist jedoch über einen Fonds gelaufen, in den sehr viele Länder einzahlen und bei dem die Kontrolle nicht allein von Österreich ausgeübt wird. Ich meine, das wird besprochen werden, und man wird danach trachten, dass so etwas in Zukunft nicht mehr vorkommt.
Ich meine also, dieses Gesetz ist ein gutes Gesetz, wir werden ihm zustimmen und hoffen auf große Erfolge bei den Exporten. – Danke. (Beifall bei der ÖVP sowie bei Bundesräten der SPÖ.)
12.24
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Heger. – Bitte.
12.24
Bundesrat Peter Heger (SPÖ, Burgenland): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Herr Minister! Geschätzte Damen und Herren! Das Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetz und das Ausfuhrförderungsgesetz stellen aus meiner Sicht einen ganz wichtigen Motor für die österreichische Wirtschaft dar, denn jeder dritte Arbeitsplatz ist durch den Export gesichert. Belegt wird das durch den aktuellen Bericht zur Ausfuhrförderung vom 4. Quartal 2016. Demnach beträgt der Ausnützungsgrad der Haftung derzeit 45 Prozent, der Höchststand laut Rechnungshofbericht 2013 lag im Jahr 2008 – also vor der Finanzkrise – bei 44 Milliarden €.
Dieses Ausfallsystem ist selbsttragend und bringt der Republik versicherungstechnische Überschüsse in der Höhe von rund 200 Millionen €. Insgesamt hat das österreichische Ausfuhrvolumen mehr als 130 Milliarden € erreicht, und in besonders schwierigen Märkten sind Exporte nur mit staatlicher Sicherung möglich. Das zeigt also, dass die Exportförderung eine wesentliche Funktion für die wirtschaftliche Entwicklung einnimmt.
Viele Länder, auch Schwellenländer, verfügen über Exportförderungen, aus diesem Grund ist eine funktionierende Exportförderung entscheidend für die Teilnahme der österreichischen Exportwirtschaft am internationalen Markt. Durch die Änderung des Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetzes und des Ausfuhrförderungsgesetzes werden einerseits die Haftungsrahmen abgesenkt und andererseits der Geltungsbereich um jeweils fünf Jahre verlängert. Das heißt, das Ausfuhrförderungsgesetz wird bis 2022 verlängert und das Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetz ebenfalls um fünf Jahre bis 2023.
Neben dieser Verlängerung ist, wie schon erwähnt, die Absenkung des Haftungsrahmens wichtig: Im Ausfuhrförderungsgesetz wird der Haftungsrahmen von 50 Milliarden € auf 40 Milliarden € gesenkt, und im Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetz von 45 Milliarden € auf 40 Milliarden €.
In der Statistik des Außenhandels über den Zeitraum von Jänner bis Dezember 2016 wird auf die positive Wirkung der Exportförderung auf Beschäftigung und Einkommen in Österreich deutlich hingewiesen. Bedingt durch die schwierige Situation auf den Kapitalmärkten ist der Haftungsrahmen nicht ausgeschöpft worden. Für das Jahr 2017 ist eine nur leicht steigende Nachfrage zu erwarten, damit bleibt auch mit einer Senkung des Haftungsrahmens die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit mit Sicherheit ausreichend gegeben.
Wichtig ist auch, dass durch die Präzisierung im § 9 Abs. 6 Ausfuhrförderungsgesetz international anerkannte Standards berücksichtigt werden und neben unseren international tätigen Großbetrieben auch die Klein- und Mittelbetriebe profitieren. Die Geltungsdauer dieser beiden Gesetze zu verlängern, bedeutet, die österreichische Exporterfolgsgeschichte fortzuschreiben.
Sehr geehrte Damen und Herren! Diese beiden Gesetze sind wesentliche Werkzeuge, die unsere Betriebe – und das kleine Österreich – zu Top-Playern im Export gemacht haben. Wie schon gesagt, profitieren nicht nur Großbetriebe von dieser staatlichen Sicherung, sondern auch Klein- und Mittelbetriebe. Insgesamt wurde durch diese Gesetze eine Situation geschaffen, bei der es aus meiner Sicht nur Gewinner gibt. Es ist somit eine Win-win-Situation, wie man auf Neudeutsch so schön sagt: für alle exportierenden Betriebe, aber auch für den Staat.
Jene Betriebe, die diese Haftungen in Anspruch nehmen, bekommen einerseits schneller Kredite von den Banken, sie müssen andererseits aber auch an den Staat eine Prämie bezahlen. Wichtig ist aber auch, die Ergebnisse von Jänner bis Dezember 2016 zu
betrachten: „Die österreichische Exportwirtschaft verzeichnet aufgrund des schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes Rückgänge.“
„Nach den vorläufigen Ergebnissen der Statistik Austria für das Gesamtjahr 2016 nahmen die Importe gegenüber dem Vorjahr um 1,5% zu. Sie belaufen sich damit auf 135,6 Mrd. Euro. Bei den Ausfuhren musste ein Rückgang von 0,2% auf 131,2 Mrd. Euro verzeichnet werden.“
„Bei den
Ausfuhren nach Übersee waren nach den starken Zuwächsen im Vorjahr von 6,2% heuer
Rückgänge von 2,0% zu verzeichnen. Das Wachstum der Ausfuhren
nach Europa ging von 1,8% auf 0,2% zurück.
Verantwortlich dafür sind die nur leichten Zuwächse im Export in die EU (0,3%) sowie die Einbußen beim
Export nach Russ-
land (-4,8%) und in die Türkei
(-5,7%). Für die schwächelnden Exporte nach Übersee sind vor allem die Rückgänge bei den
Ausfuhren nach Nordamerika (-4,0%) sowie nach Asien (-3,2%)
verantwortlich. Im Gegensatz dazu konnten die Exporte nach Mexiko (22,9%)
aufgrund der Zuwächse im Bereich Maschinen wieder stark ausgebaut werden.
Für das Jahr 2017 werden im Außenhandel etwas stärkere Zuwächse als zuletzt erwartet.“
Diese beiden Gesetze stehen also für eine aktive Arbeitsplatzsicherungspolitik, die da betrieben wird. Schön wäre es, wenn diese in allen Fraktionen Unterstützung fände. Meine Fraktion wird jedenfalls der Änderung des Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetzes und des Ausfuhrförderungsgesetzes die Zustimmung erteilen. – Danke. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.)
12.31
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Die Abstimmung erfolgt getrennt.
Wir gelangen zunächst zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetz geändert wird.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist angenommen.
Wir gelangen nun zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Ausfuhrförderungsgesetz geändert wird.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das IAKW-Finanzierungsgesetz geändert wird (1414 d.B. und 1564 d.B. sowie 9763/BR d.B.)
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Wir gelangen nun zu Punkt 9 der Tagesordnung. Berichterstatter ist Herr Bundesrat Pfister.
Bevor ich ihn um diesen Bericht bitte, darf ich die Delegation der SPÖ Frauen aus dem Bezirk Spittal in Kärnten begrüßen: Herzlich willkommen bei uns! (Allgemeiner Beifall.)
Da Herr Kollege Pfister ein Frauenversteher ist, wird er mir das verzeihen. – Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatter René Pfister: Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Liebe Gäste! Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite!
Ich bringe den Bericht des Finanzausschusses des Bundesrates über den Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das IAKW-Finanzierungsgesetz geändert wird. (Vizepräsident Gödl übernimmt den Vorsitz.)
Der gegenständliche Beschluss des Nationalrates umfasst hauptsächlich folgende Maßnahmen: Baumaßnahmen zur Verbesserung der baulichen Infrastruktur im Eingangsbereich und am Vorplatz des Österreichischen Konferenzzentrums, besser bekannt als Austria Center Vienna, sowie die Schaffung von zusätzlichen Ausstellungsflächen. Das gesamte Investitionsvolumen wird von der IAKW-AG mit einem Maximalbetrag von 32 Millionen € präliminiert.
Bisher wurde die Errichtung des Austria Center Vienna und die 1997 gebaute Ausstellungshalle im Austria Center Vienna zu 65 Prozent vom Bund und zu 35 Prozent von der Stadt Wien finanziert.
Ich komme zur Antragstellung.
Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 4. April mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Danke für den Bericht.
Wir gehen in die Debatte ein.
Als Erste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Dr. Reiter. – Bitte.
12.34
Bundesrätin Dr. Heidelinde Reiter (Grüne, Salzburg): Herr Präsident! Herr Minister! Werte Kollegen und Kolleginnen! Wir stellen nicht infrage, dass es notwendig ist, diese Arbeiten für den Standort des Konferenzzentrums durchzuführen. Es kommt zu einer Kostenteilung zwischen dem Bund und der Stadt Wien beziehungsweise wird geregelt, wer Bauaufsicht, Planung, Errichtung und so weiter innehat.
Was wir allerdings hinterfragen, sind Verflechtungen der IAKW-AG mit dem Österreichischen Konferenzzentrum sowie dessen Hälfteeigentümerschaft durch arabische Investoren, das heißt Saudi-Arabien, Kuwait und Vereinigte Arabische Emirate. Die IAKW ist ja zu 100 Prozent in österreichischer Hand, aber die ÖKZ-AG ist eben zu 50 Prozent in österreichischer Hand und zu 50 Prozent in Hand dieser arabischen Investoren.
Diese arabischen Aktionäre sind Darlehensgeber, sie sind weder am Verlust oder allfälligen Gewinn der ÖKZ-AG beteiligt und auch nicht am Substanzwert des Österreichischen Konferenzzentrums. Diesen Aktionären wird allerdings eine Vorzugsdividende in Höhe von 6 Prozent bezahlt, das sind 6,5 Millionen € im Jahr. Wir meinen, dass diese Verflechtung hinterfragenswert ist und dass es nicht angeht, dass diese Regimes auf diese Art und Weise mit österreichischem Steuergeld unterstützt werden. Wir lehnen daher diese Regelung ab. – Danke. (Beifall bei den Grünen.)
12.36
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Junker. – Bitte.
12.36
Bundesrätin Anneliese Junker (ÖVP, Tirol): Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzter Herr Finanzminister! Meine Damen und Herren! Das Österreichische Konferenzzen-
trum, das Austria Center Vienna, ist in den Jahren 1982 bis 1987 erbaut und im April 1987 eröffnet worden. Zehn Jahre später wurde dann im Zuge eines Umbaus die zweigeschossige Halle im Bereich des westlichen Vorplatzes errichtet.
Das ACV ist Österreichs größtes Konferenzzentrum und hat als Veranstaltungsort für Wien und Österreich eine hohe volkswirtschaftliche Bedeutung: So hat das Austria Center Vienna eine Bruttowertschöpfung von circa 378 Millionen € im Jahr und bringt circa 461 000 Nächtigungen pro Jahr.
Wie wir wissen, sind die Kongressgäste auch spendierfreudig und geben etwa 500 € pro Tag in Wien und Umgebung aus, was ja auch nicht zu unterschätzen ist. Zudem finden 2 000 Personen Beschäftigung, was als sehr, sehr wichtig hervorzuheben ist. Die öffentliche Hand bekommt jährlich ungefähr 94 Millionen € an Abgaben.
Das alles aufs Spiel zu setzen, indem nicht weiter investiert würde, fände ich einfach grob fahrlässig, denn auch andere europäische Länder haben auf Kongresse gesetzt und in den letzten Jahren maßgeblich aufgerüstet. Die Wirtschaftskraft von Kongressen muss auch in Wien erhalten bleiben. Auch wir in Tirol schätzen den Kongressgast, und unsere Kongressstätten sind auf dem neuesten Stand.
Um den Erfolg des Austria Center Vienna auch weiterhin zu sichern, ist eine Investition wichtig, um den Außenbereich zu optimieren und die Eingangssituation zu verbessern. Im Ausschuss ist es ja angesprochen worden: Bei größeren Veranstaltungen sind die Zu- und Abfahrt sowie die Zugänge zu den Räumlichkeiten eine mittlere Katastrophe. Es werden zusätzliche Ausstellungsflächen auf dem Vorplatz und ein direkter Zugang zu den Hallen auf allen Ebenen geschaffen.
Die Kosten für die Planung und Errichtung des Außenumbaus dürfen höchstens 32 Millionen € betragen, und wie wir im Ausschuss erfahren haben, soll die Planung 2017 und 2018 erfolgen. 2019 wird mit den Bauarbeiten begonnen und 2023 soll die Neueröffnung vonstattengehen.
Mit dieser Investition kann die Stadt Wien weltweit führend im Kongressbereich werden. Stimmen wir also gemeinsam diesem Umbau zu! – Danke. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
12.40
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Zu Wort gemeldet ist als Nächster Herr Bundesrat Heger. – Bitte, Herr Bundesrat.
12.40
Bundesrat Peter Heger (SPÖ, Burgenland): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Minister! Geschätzte Damen und Herren! Wien ist – ich denke, da sind wir uns alle einig und auch wirklich stolz darauf – eine der bekanntesten und beliebtesten Kongressstädte der Welt. Damit das auch so bleibt, ist es absolut notwendig, in das Austria Center Vienna zu investieren. Es ist notwendig, umzubauen und zu sanieren. Jeder von uns kennt den Außen- und Eingangsbereich; diese Bereiche sind von der Zufahrt bis zum Eintrittsportal einfach nicht mehr zeitgemäß. Das Austria Center Vienna wurde ja schließlich bereits im Jahr 1987 errichtet und ist jetzt eindeutig in die Jahre gekommen.
Es ist, wie bei jedem Gebäude, das 25 bis 30 Jahre alt ist, notwendig, Maßnahmen zur Verbesserung der baulichen Infrastruktur durchzuführen, etwa im Eingangsbereich und am Vorplatz; es ist auch notwendig, zusätzliche Ausstellungsflächen zu schaffen. Jährlich finden in Wien mehr als 4 000 Kongresse statt, und im heurigen Jahr werden im Austria Center Vienna 13 Großkongresse abgehalten. Das Projekt stellt eine einmalige Investition in der Höhe von maximal 32 Millionen € für Planungs- und Baukosten dar. Dieser Aufwand für den Bund wird zu 35 Prozent von der Stadt refundiert. Die laufenden Instandhaltungsaufwendungen fallen bei der Internationales Amtssitz- und Konferenz-
zentrum Wien AG an und werden von dieser durch entsprechende Einnahmen getragen.
Jetzt kann man sich natürlich fragen: Warum schießt der Staat überhaupt 20 Millionen € zu? Dieses Projekt kann ja auch die Internationales Amtssitz- und Konferenzzentrum Wien AG gemeinsam mit der Stadt Wien tragen. Warum werden die Planungs- und Baukosten von immerhin 32 Millionen € zu 65 Prozent vom Bund und zu 35 Prozent von der Stadt Wien getragen? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach: weil es sich auszahlt; weil in den nächsten 20 Jahren mit einem positiven Bruttoinlandsprodukteffekt in der Höhe von 473 Millionen € und mit der Schaffung von 6 000 neuen Arbeitsplätzen als Folge der Investition zu rechnen ist.
Was ist eigentlich besonders wichtig für den Tagungstouristen? – Wir haben schon gehört, dass der Tagungstourist ungefähr 500 € pro Tag ausgibt. Eine Befragung zeigt ganz deutlich, dass dafür die Infrastruktur und die Einrichtungen wichtig sind. Ein Tagungszentrum wie das Austria Center Vienna ist ein Wettbewerbsvorteil für die Stadt Wien, aber auch für ganz Österreich. Tagungszentren wie das Austria Center Vienna sind also ein gewaltiger Wettbewerbsvorteil, ein riesiger Wettbewerbsfaktor und eine wunderbare Visitenkarte für uns alle. Die Dynamik, die von diesen Kongressen ausgeht, darf dabei auch nicht vernachlässigt werden, und dass wir dabei große europäische Metropolen wie zum Beispiel Paris hinter uns lassen, ist mittlerweile Tatsache.
Experten und Expertinnen sagen aber auch voraus, dass wir als Tagungsstadt allmählich an Bedeutung verlieren könnten, wenn wir nicht investieren. Gerade deshalb ist es besonders wichtig, das zu tun. Das Austria Center Vienna wurde, wie bereits gesagt, im Jahr 1987 errichtet. Es ist also wirklich höchste Zeit, einen Modernisierungsschub durchzuführen. Daher ist es auch wichtig, dass Barrierefreiheit geschaffen wird und dass damit direkter und barrierefreier Zugang zu allen Hallen gewährleistet wird. Nur mit einer Verbesserung dieser Standortqualität können auch der Standort und die Internationalität Wiens als Tagungsort erhalten werden. Dass das, ebenso wie die Schaffung der Arbeitsplätze, auch ganz wesentlich im Interesse des Bundes liegt, ist selbstverständlich.
Wir wissen alle: Politik kann nicht direkt Arbeitsplätze schaffen, aber sie kann die Rahmenbedingungen dafür schaffen, denn von den Investitionen in das Austria Center Vienna profitieren sowohl die Wirtschaft als auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Wien und ganz Österreich.
Meine Fraktion wird jedenfalls der Änderung des IAKW-Finanzierungsgesetzes im Interesse des Tagungsstandortes Wien, der Wirtschaft, der ArbeitnehmerInnen und des Bundes die Zustimmung erteilen. – Danke. (Beifall bei der SPÖ und bei Bundesräten der ÖVP.)
12.45
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Krusche. – Bitte, Herr Bundesrat.
12.45
Bundesrat Gerd Krusche (FPÖ, Steiermark): Hohes Präsidium! Herr Bundesminister! Kolleginnen und Kollegen! An die Kollegin Reiter gerichtet: Es stimmt schon, auch wir sind mit diesem Konstrukt nicht ganz glücklich. Herr Minister Schelling, ich gehe aber davon aus, dass das nicht von Ihnen stammt, sondern mittlerweile schon etwas älter ist und noch auf Kreiskys Zeiten zurückgeht. Vor über 30 Jahren waren halt die Zeiten noch ein bisserl anders, und die Haltung gegenüber Ländern wie Saudi-Arabien, Kuwait oder so war vielleicht etwas unkritischer als derzeit, in Anbetracht der aktuellen Ereignisse.
Was mich aber wirklich wundert, ist, dass Sie grundsätzlich für den Ausbau sind. Ich hätte mir eigentlich erwartet, dass Sie dieselbe Argumentation strapazieren wie bei der Flug-
abgabe, denn der überwiegende Teil der Kongressgäste reist ja mit dem Flugzeug an und ist daher klimaschädlich. Daher ist eigentlich ein Ausbau des Zentrums aus umweltschutzpolitischen Erwägungen abzulehnen.
Wir folgen dieser Argumentation natürlich nicht. Pro-Argumente wurden bereits ausführlich dargestellt. Ich habe mich also im Vorfeld, zur Vorbereitung, ein bisserl im Internet schlaugemacht und in anderen Städten wie Berlin, London und so weiter geschaut, und man muss sagen, das Austria Center Vienna braucht sich durchaus nicht zu verstecken.
Es ist ganz klar: Die Entwicklung schläft nicht. Wer nicht investiert und nicht modernisiert, der wird überholt – von rechts und von links, von allen Seiten –, und daher ist dieser Ausbau sicherlich wichtig. Ich weiß das aus leidvoller Erfahrung aus meiner Heimatstadt Leoben, wo wir auch ein – natürlich wesentlich kleineres – Kongresszentrum haben, das jetzt auch in die Jahre gekommen ist, in das aber nicht investiert wird und das schön langsam den Bach hinuntergeht. Ich glaube, das brauchen wir in Wien keinesfalls, und deshalb unterstützen wir diese Investition sehr gerne. – Danke. (Beifall bei der FPÖ sowie bei Bundesräten von ÖVP und SPÖ.)
12.48
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Abschließend zu Wort gemeldet hat sich nun Herr Bundesminister Schelling. – Bitte.
12.48
Bundesminister für Finanzen Dr. Johann Georg Schelling: Herr Präsident! Hohes Haus! Ja, Frau Dr. Reiter, natürlich kann man alles kritisieren, also zumindest hier. „Alles“ muss man eigentlich zurücknehmen – wenn man die Entwicklung der letzten Tage in Ihrer Partei anschaut, dann darf man nicht alles kritisieren. (Bundesrat Stögmüller: Oooh!)
Der Vertrag wurde 1984 abgeschlossen – Herr Bundesrat Krusche, das war wahrscheinlich lang vor unser beider Zeit, in dem Zusammenhang –, und es gibt eine Put-Option bis 2034. Solch langfristige Verträge sind natürlich durchaus sinnvoll, wenn man die Summe des Investments, das damals notwendig war, für den Standort Wien entwickelt.
Nach 30 Jahren ist es halt erforderlich, dass wir diese Sanierung durchführen, egal wie lange die Verträge vorhanden sind. Das Gebäude – Sie alle kennen das Zentrum – ist in die Jahre gekommen, entspricht heute einfach nicht mehr dem internationalen Standard, hat verkehrstechnische Probleme und muss daher saniert werden. Ich würde mir wünschen, dass wir viele solche Investitionen machen können, die einen solchen Hebel in der Wertschöpfung haben wie das Konferenzzentrum.
Der zweite Punkt: Man hat auch Fragen gestellt wie: Warum dauert das jetzt eigentlich? Warum findet die Beschlussfassung jetzt statt? – Das ist ganz einfach: Wir müssen jetzt in die Planungsphase eintreten. Sie wissen, dass wir im zweiten Halbjahr 2018 die EU-Präsidentschaft innehaben. Dazu benötigen wir das Konferenzzentrum, sodass wir jetzt zu planen und nach der Präsidentschaft mit dem Bau beginnen. Das ist der einzige Grund, warum das so ist. Ich möchte mich an dieser Stelle auch ausdrücklich bei der Stadt Wien für den Beschluss zur Kofinanzierung dieser notwendigen Investitionen bedanken, der dort bereits gefasst wurde.
Für einen Standort wie Wien ist der Kongresstourismus von ganz entscheidender Bedeutung, und daher glaube ich, dass diese Investition sich rechnet, sinnvoll ist und auch dazu führen wird, dass wir den Standort des Zentrums, aber auch den Standort Wien und damit den Standort Österreich aufwerten können und den Kongresstourismus tatsächlich hierher kanalisieren können.
Wenn man international vergleicht – ich mache mich in den nächsten Stunden auf den Weg nach Malta zum informellen ECOFIN-Gipfel, der am Freitag und Samstag stattfin-
det –, dann sieht man auch, wie schwierig der Wettbewerb ist, wenn man keine solche Infrastruktur hat, um den internationalen Kongresstourismus auf sich zu ziehen. Wien hat diese Möglichkeit. Ich verstehe Ihre Argumentation, dass wir einen Vertrag, der 1984 abgeschlossen wurde, jetzt vollziehen, nur es hat mit der Investition als solcher nichts zu tun, und Sie wissen – das wurde auch im Finanzausschuss besprochen –, dass diese Put-Option keinerlei Auswirkungen auf die Wertzuwächse hat, weil die Verlust- und Gewinnbeteiligungen anders geregelt sind.
Ich bedanke mich bei allen, die zu diesem wichtigen Projekt ihre Zustimmung geben. Sie sehen, wir runden damit unsere Strategie ab, den Wirtschaftsstandort zu stärken und Wachstum und Beschäftigung zu generieren. Das ist das oberste Ziel dieser Bundesregierung, und viele dieser Maßnahmen werden uns helfen, dieses Ziel auch zu erreichen. – Vielen Dank. (Beifall bei der SPÖ sowie bei Bundesräten von ÖVP und FPÖ.)
12.51
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Dem ist nicht so. Damit ist die Debatte geschlossen.
Wir gelangen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Dies ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Tierschutzgesetz geändert wird (1515 d.B. und 1544 d.B. sowie 9749/BR d.B. und 9773/BR d.B.)
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Nun gelangen wir zum 10. Punkt der Tagesordnung.
Bevor ich der Berichterstatterin, Frau Bundesrätin Mag. Gruber-Pruner, das Wort erteile, darf ich die neue Frau Gesundheitsministerin sehr herzlich in unseren Reihen begrüßen. Herzlich willkommen! (Allgemeiner Beifall.) – Bitte um den Bericht.
Berichterstatterin Mag. Daniela Gruber-Pruner: Hohes Präsidium! Sehr geehrte Frau Ministerin, herzlich willkommen! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich bringe den Bericht des Gesundheitsausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Tierschutzgesetz geändert wird.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, daher komme ich sogleich zur Antragstellung.
Der Gesundheitsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 4. April 2017 mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Danke für den Bericht.
Wir gehen in die Debatte ein.
Als Erster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Schererbauer. – Bitte, Herr Bundesrat.
12.53
Bundesrat Thomas Schererbauer (FPÖ, Oberösterreich): Herr Präsident! Frau Ministerin! Grüß Gott, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Wir diskutieren heute ein Bundesgesetz, mit dem das Tierschutzgesetz geändert wird. In § 2 des entsprechenden Bundesverfassungsgesetzes steht: „Die Republik Österreich [...] bekennt sich zum Tier-
schutz.“ Und das ist auch gut so, denn in vielen Teilen der Welt passiert genau das Gegenteil.
Mahatma Gandhi hat einmal gesagt, je hilfloser ein Lebewesen ist, desto größer ist sein Anrecht auf menschlichen Schutz vor menschlicher Grausamkeit, und wenn wir uns anschauen, was sich vor der Küste Neufundlands momentan abspielt, wo die Robbenbabys brutalst abgeschlachtet werden, dann zweifelt man wirklich an allem und es kommen einem die Tränen.
Ich weiß schon, dass wir heute das österreichische Tierschutzgesetz diskutieren, aber ich glaube, dass der Tierschutz keine Grenzen kennt. Bitte gestatten Sie mir, sozusagen zur Sensibilisierung in dieser Thematik, ein paar Zeilen von einem besorgten Tierschützer vorzutragen – es dauert nur ein paar Sekunden –:
„Das Ministerium für Fischerei
ist wieder einmal voll dabei
wie jedes Jahr, es anzustreben,
das Robbenmorden freizugeben.
Viele Schlächter stehen schon
in allererster Position,
die mit Freude danach trachten,
Robbenbabys abzuschlachten.
Da wird den Robben unbekümmert
hart und brutal der Kopf zertrümmert.
Dann zieht man ab vom Leib das Fell,
ganz routiniert und auch sehr schnell,
so geht es dann in einem fort,
sie töten schließlich im Akkord.
Auch ist es wunderbar und schön,
knöcheltief im Blut zu stehen.
Mit toten Körpern roh und heiß,
der Schlächter riecht nach Tod und Schweiß.
Stolz wird am Abend dann erzählt,
wie viele Robben man gequält.
Es rühmt der Mensch sich wieder mal,
dass er verbreitet Tod und Qual.
Ohnmächt’ge Wut, es ist zum Kotzen,
wenn sie damit auch noch protzen –
wieder mal wird uns vor Augen geführt,
wie krank der Mensch ist und pervertiert.“
So, jetzt widme ich mich aber dem Tierschutzgesetz. Ich habe versucht, in diesem doch sehr umfangreichen Gesetz die positiven und die noch verbesserungswürdigen Punkte herauszufiltern. 642 Stellungnahmen dazu zeugen ja von sehr großem Interesse.
Positiv zu erwähnen wäre: Die Hundehalsbänder mit Zugmechanismus, die das Atmen des Hundes erschweren, gelten ebenso wie das Tätowieren oder Verfärben der Haut oder des Fells aus modischen oder kommerziellen Gründen als Tierquälerei und werden mit dem neuen Tierschutzgesetz verboten.
Ebenso gibt es ein Verbot des Handels von Tieren über Internetplattformen; dies gilt für Privatpersonen. Zertifizierungen von Stalleinrichtungen regeln, ob die Einrichtung auch tiergerecht ist. Eine Verbesserung der Rechtstellung der Tierschutzombudspersonen wird in Aussicht gestellt, das würde zum Beispiel die Möglichkeit der Revisionserhebung beim Verwaltungsgerichtshof und Akteneinsicht bei den Strafgerichten in Tierschutzvergehen betreffen.
Jetzt komme ich in den Bereich der Nutztierhaltung, und da schaut es nicht mehr ganz so positiv aus. Hohe Anforderungen zum Beispiel für Schweinebauern stellen Kleinst- und Kleinbetriebe vor schier unlösbare Aufgaben. Eine Verordnung zwischen Gesundheits- und Landwirtschaftsministerium schreibt in einer sogenannten Schweinegesundheitsverordnung bei Freilandhaltung Folgendes vor: ab fünf Zucht- oder 30 Mastschweinen eine doppelte Einfriedung, ebenso eine fix montierte Verladerampe und einen eigenen Desinfektionsraum. Also der Bauer ist schon pleite, bevor er das erste Ferkerl verkauft hat, das ist in diesem Fall nicht begrüßenswert.
Zur Kastration der Schweine – im wahrsten Sinne des Wortes eine Schweinerei –: Seit vielen Jahren wird vom Tierschutz geeint gefordert, dass die grausame betäubungslose Ferkelkastration endlich verboten wird. Eine derartig tierquälerische Vorgehensweise kann nach heutigem Wissensstand nicht gerechtfertigt werden.
Die betäubungslose Ferkelkastration ist nach dem neuen Entwurf der ersten Tierhaltungsverordnung immer noch nicht verboten. Ferkel bis zu einem Alter von sieben Tagen benötigen nun zwar eine Schmerzbehandlung, welche auch postoperativ wirkt, eine tatsächliche Schmerzausschaltung oder Betäubung wird allerdings nach wie vor nicht vorgeschrieben.
Zur Anbindehaltung für Rinder: Die Ausnahmen für das dauernde Fixieren von Rindern sind so allgemein gehalten, dass sie praktisch für alle gelten können. Die dauernde Anbindehaltung von Rindern ist auch nach dem neuen Entwurf der ersten Tierhaltungsverordnung de facto nicht verboten, obwohl sie nicht mit dem Tierschutzgesetz zu vereinbaren ist. Nach der Änderung der ersten Tierhaltungsverordnung ändert sich daran jedoch nichts. Sämtliche Ausnahmen vom Verbot der dauernden Anbindehaltung müssen ersatzlos gestrichen werden.
Ein Gütesiegelgesetz für den Bereich Tierschutz, das dem Konsumenten Sicherheit über die Herkunft von Daunen gibt und garantiert, dass das Gütesiegel nur an Lieferanten vergeben wird, die auf Lebendrupfen oder Stopfmast verzichten, wäre sehr begrüßenswert, denn laut einer Recherche der Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ wandern Daunen durch sehr viele Hände, bis sie schlussendlich in Kissen und Decken landen. Die Lieferketten sind sehr undurchsichtig, und Marken können nicht ausschließen, dass für die von ihnen verarbeiteten Daunen Tiere gequält wurden. Der Grund dafür ist ein lückenhaftes Kontrollsystem. Ein diesbezügliches Gütesiegelgesetz würde nachhaltige und tierschutzgerechte Landwirtschaft unterstützen.
Abschließend ist festzustellen, dass einzelne Punkte in diesem Gesetz sehr begrüßenswert sind, es aber keine echte Weiterentwicklung bei der Nutztierhaltung und der Anbindehaltung gibt. Daher können wir dieser Gesetzesänderung keine Zustimmung erteilen. – Danke schön. (Beifall bei der FPÖ.)
12.58
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Ebner. – Bitte, Frau Bundesrätin.
12.58
Bundesrätin Adelheid Ebner (SPÖ, Niederösterreich): Geschätzter Herr Präsident! Frau Bundesministerin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Geschätzte Besucher! Zu Beginn darf ich dich, geschätzte Frau Bundesministerin Rendi-Wagner, im Namen unserer SP-Fraktion ganz herzlich hier im Bundesrat begrüßen. (Beifall bei der SPÖ und bei Bundesräten der Grünen.) Wir freuen uns natürlich, dass wieder eine sehr erfahrene und kompetente Frau an der Spitze beider Ressorts – Gesundheit und Frauen – steht, und wir wünschen dir für deine Aufgabe alles Gute und viel Erfolg. (Beifall bei der SPÖ sowie bei Bundesräten von FPÖ und Grünen.)
Ja, der Umgang mit Tieren ist das Spiegelbild unserer Gesellschaft, und es heißt nicht umsonst: Wie wir den Tieren begegnen, so begegnen wir – entweder wertschätzend oder nicht wertschätzend – unseren Mitmenschen. Daher kann und darf Tierschutz nie zu Ende sein, und diese Novelle ist längst notwendig gewesen.
Tierschutz kann nie weit genug gehen, allerdings müssen Kompromisse zwischen den unterschiedlichsten Interessenlagen geschlossen werden. Einerseits gibt es Gott sei Dank die vielen aktiven Tierschutzorganisationen, andererseits muss ein Konsens zwischen ihren Interessen und jenen der Wirtschaft und der Landwirtschaft gefunden werden, was oft sehr, sehr schwierig ist.
Es war deswegen nicht nur richtig, sondern auch notwendig, dass Anfang des letzten Jahres bereits die Strafbestimmungen für Tierquäler deutlich verschärft wurden. Wir müssen dieses Gesetz weiterentwickeln und Schritt für Schritt verbessern. Es gab dazu sehr viele Stellungnahmen, mein Kollege hat es schon erwähnt, und nach Protesten zahlreicher Experten wurde die vorliegende Novelle nochmals überarbeitet, und es konnten einige Verbesserungen im Sinne der Tiere erreicht werden.
Die Novelle enthält unter anderem ein Verbot von privaten Tierinseraten auf den Onlineplattformen. In Zukunft bedürfen alle wirtschaftlichen Tierhaltungen einer Bewilligung. Zusätzlich kommt die verpflichtende Kennzeichnung von Zuchtkatzen durch einen Mikrochip. Des Weiteren gibt es auch Klarstellungen bei der Verwendung von speziellen Hundehalsbändern, der Auswilderung von Wildtieren oder strengere Ausnahmeregelungen in Bezug auf die permanente Anbindehaltung von Rindern.
Ich freue mich als Hundebesitzerin ganz besonders, dass die Hundehalsbänder mit Zugmechanismen, welche das Atmen der Hunde erschweren oder ihnen sogar die Luft abschneiden, in Zukunft verboten sind, und bin wirklich froh, dass diese Tierquälerei endlich ein Ende hat.
Das Anbinden von Hunden wird ebenfalls nicht unbegrenzt erlaubt sein, sondern nur im Rahmen einer gesetzeskonformen Hundeausbildung beziehungsweise für eine kurzzeitige Aktivität wie die Dauer eines Einkaufes.
Des Weiteren wird es ein Verbot geben, Wildtiere, die gezüchtet werden, in die freie Wildbahn auszuwildern. Ich darf hier vielleicht die Fasane erwähnen, die in Volieren gezüchtet und dann für die Jagd ausgesetzt werden – eine Jagd, die wahrscheinlich nur für die Sonntagsjäger interessant ist.
Leider gab es keine Einigung betreffend die Rinderanbindehaltung. Betriebe, die ihre Rinder auch in Zukunft noch ständig angebunden haben, müssen das zwar künftig unter Angabe der Gründe, warum sie das machen, der Behörde melden, eine zufriedenstellende Lösung sehe ich darin allerdings nicht. Bei dieser Anbindehaltung sprechen wir von 365 Tagen im Jahr ohne freie Bewegung für die Rinder, und dies ist im 21. Jahrhundert absolut keine verständliche Regelung und auch beschämend.
Wir haben zwar im Ausschuss gehört, dass einige Betriebe nicht die Möglichkeit haben, ihre Rinder auf die Weide zu führen, jedoch müsste gesetzlich schon zumindest ein Freilaufstall und auch die finanzielle Unterstützung kleinerer Betriebe verankert werden. Hier darf ich vielleicht den ÖVP-Tierschutzsprecher im Nationalrat erwähnen, der behauptet hat, dass seine Viecher durch den Laufstall nicht wesentlich glücklicher wirken. (Allgemeine Heiterkeit.) Seine Äußerungen möchte ich absolut nicht kommentieren, es ist mir nicht einmal eine Bemerkung wert.
Ich freue mich aber, dass sich beim Tierschutz noch mehr bewegen wird, denn als Nächstes sind die Tierhalteverordnungen an der Reihe.
Einige Änderungen noch im Überblick: Katzenhalter müssen sich zukünftig entscheiden, ob sie ihre Freigänger kastrieren oder als Zuchtkatzen chippen und registrieren las-
sen. Landwirte haben in jedem Fall die Kosten dafür zu tragen und die Unterlagen für ihre Stubentiger vorzuweisen. Die Erfüllung aller Voraussetzungen wird von den Behörden hoffentlich auch kontrolliert. Gibt es freilaufende und unkastrierte Katzen auf ihrem Grundstück, muss den Behörden beziehungsweise auch den Tierschutzorganisationen Zugang ermöglicht werden, damit die Tiere kastriert werden können. Im Privatbereich gibt es überhaupt keine Diskussionen mehr, alle privaten Tierhalter haben ihre Katzen, die freien Auslauf haben, auch zu kastrieren.
Jedes Angebot zur Abgabe von Tieren, die nicht von Züchtern oder autorisierten Personen beziehungsweise Vereinen stammen, wird ebenfalls verboten. Laut vorliegender Novelle wird der Tatbestand auch durch das Anbieten im Internet bereits erfüllt, was eigentlich heißt, dass die Betreiber von Internetplattformen auch als Beitragstäter zur Verantwortung gezogen werden können.
Das Tätowieren von Hunden sowie das Verfärben von Haut, Fell oder Federkleid aus ästhetischen Gründen werden ebenfalls verboten. Es gibt tatsächlich auch „bunte Hunde“ – unter Anführungszeichen – in der Tierwelt.
Es ist auch positiv zu bewerten, dass in Zukunft Tiere nicht mehr an Minderjährige unter 16 Jahren ohne Einwilligung ihrer Erziehungsberechtigten abgegeben werden dürfen. Bisher war die Altersgrenze vierzehn Jahre, und wir wissen alle, dass sich Kinder Tiere wünschen und oft ohne die Einwilligung der Eltern Tiere sogar aufnehmen. Leider werden immer wieder Tiere später ausgesetzt oder in ein Tierheim gegeben.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, in der vorliegenden Novelle zum Tierschutzgesetz konnten zwar einige Verbesserungen für die Tiere erreicht werden, vieles ist aber in Zukunft noch zu tun. Der Mensch trägt Verantwortung für das Tier als Mitgeschöpf. Tierquälerei ist absolut kein Kavaliersdelikt.
Ich erlaube mir heute, uns allen mitzugeben: Die Rechte der Tiere sind genauso wichtig wie die Rechte der Menschen, denn beide machen uns Menschen erst aus. Unsere Fraktion wird diesem Gesetz die Zustimmung erteilen. (Beifall bei der SPÖ.)
13.06
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Als Nächste zu Wort gelangt Frau Bundesrätin Mag. Schreyer. – Bitte.
13.06
Bundesrätin Mag. Nicole Schreyer (Grüne, Tirol): Hohes Haus! Sehr geehrte Frau Ministerin! Sehr geehrte Gäste hier und zu Hause! Bei der Novelle des Tierschutzgesetzes zeigt sich, wie wichtig der Tierschutz den Österreicherinnen und Österreichern ist. Es hat ja wirklich eine rekordverdächtige Zahl an Stellungnahmen zu dem Gesetzentwurf gegeben, nämlich 641, einige haben ja auch Eingang gefunden. Auch in der bisherigen Diskussion hier fällt mir auf, dass wir uns relativ einig sind.
Es sind auch ein paar sehr gute Inhalte im Gesetz drinnen. Genau bei diesen guten Inhalten sind wir uns ohnehin sehr einig, zum Beispiel eben beim Auswilderungsverbot von nicht lebensfähigen Tieren für die Jagd, die schon angesprochenen gezüchteten Fasane oder Enten. Das ist ja Gott sei Dank von NGOs bei der Begutachtung eingebracht worden; dadurch ist das wieder herausgenommen worden. Weitere Beispiele sind das Verbot von Zughalsbändern bei Hunden, die Einschränkung beim Verkauf von Tieren und natürlich auch das Verbot des Tätowierens oder Einfärbens von Tieren aus ästhetischen Gründen.
Es gibt aber noch sehr viele Punkte, mit denen wir nicht d’accord gehen können, und deswegen werden wir hier heute das Gesetz auch ablehnen. Zum Beispiel ist vor knapp zehn Jahren mit der Novelle des Tierschutzgesetzes 2008 der Verkauf von Hunden und Katzen in Zoofachhandlungen wieder eingeführt worden. Das war vorher schon verbo-
ten, und der Haupthintergrund damals war, dass man den unkontrollierten Handel mit Welpen in kontrollierbare Bahnen bringen wollte. Das hat überhaupt nicht funktioniert, man beharrt aber trotzdem weiter darauf, obwohl es aus Tierschutzsicht wirklich sehr viele Gründe gibt, die gegen den Verkauf in Zoofachhandlungen sprechen. Tiere sind nun einmal keine Ware. Haustiere sollten nicht im Affekt gekauft werden, sondern überlegt.
Ein weiterer Kritikpunkt ist die Zuchtdefinition bei Katzen, das ist in dieser Vorlage viel zu lax reglementiert. Laut der Definition in dieser Vorlage würde fast alles unter Zucht fallen und wäre auch gar nicht mehr kontrollierbar.
Unsere Kritikpunkte sind vor allem die ganzen Ausnahmemöglichkeiten, zum Beispiel die Ausnahmemöglichkeiten für Tierquälerei bei Diensthunden. Das darf es einfach nicht geben. Es geht um die Ausnahmemöglichkeiten betreffend Verordnungen bei Kastrationen, vor allem bei der Ferkelkastration, das ist heute auch schon ein paar Mal angesprochen worden. Es muss ganz einfach klar geregelt sein, dass Eingriffe, die zu erheblichen Schmerzen führen, nur unter Schmerzausschaltung durchgeführt werden dürfen. Das muss sich auf alle Fälle ändern.
Eine weitere Ausnahme ist auch schon von beiden VorrednerInnen angesprochen worden, nämlich die Ausnahme betreffend Weidehaltung und Auslauf von Rindern. Wir wollen nicht, dass es einfach nur behördliche Meldesysteme gibt und nur diese eingeführt werden. Es muss sichergestellt sein, dass die Ausnahmen nur einzelbetrieblich und nur befristet sein können. Beispiele, die wir im Ausschuss besprochen haben, sind Baustellen – man kann die Tiere nicht auf die Weide bringen, weil da gerade die Straße gebaut wird, und da kommt man nicht durch – oder Überschwemmungen, wodurch die Weiden gerade nicht benutzbar sind. Das muss aber vorübergehend sein, es darf aber kein Dauerzustand sein.
Ich möchte hier noch einmal ganz genau festhalten: Es geht nicht darum, die Anbindehaltung zu verbieten, es geht darum, die ständige Anbindung ohne irgendeine Form von Auslauf oder Weidehaltung zu verbieten, dass Tiere jahrelang, immer, also quasi von der Wiege bis zur Bahre, an der Kette gehalten werden, ohne jemals auch eine Wiese, geschweige denn den Himmel gesehen zu haben. Darum geht es. Im Ausschuss sind da als Beispiele Höfe genannt worden, die so mitten im Ort liegen, dass Austreiben aus Verkehrsgründen einfach nicht geht. In dem Fall ist es eben vielleicht auch gar nicht möglich, dass dort Kühe gehalten werden.
Es gibt auch überhaupt keine Statistik darüber, wie viele Daueranbindehaltungen von Rindern es in Österreich gibt. Mir hat auch niemand Auskunft darüber geben können, ob wir hier von 100 000 oder von 10 000 Betrieben sprechen, die das so machen. Es hat genau an dieser Anbindehaltung jetzt auch hier in der Diskussion schon so viel Kritik gegeben. Ich finde, man kann da wirklich an Verbesserungen arbeiten. Nach dieser Novelle, denke ich, sollte die Diskussion fortgeführt werden und an einer besseren Lösung gearbeitet werden. – Danke schön. (Beifall bei den Grünen und bei Bundesräten der SPÖ.)
13.10
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Bundesrat Preineder. – Bitte, Herr Bundesrat.
13.10
Bundesrat Martin Preineder (ÖVP, Niederösterreich): Herr Präsident! Geschätzter Bundesrat! Frau Bundesminister! Herzlich willkommen auch namens der ÖVP-Fraktion! Wir hoffen auf eine gedeihliche, gute Zusammenarbeit hier im Bundesrat.
Wir diskutieren heute das Bundestierschutzgesetz und die Novelle dazu. 2004 wurde das erste Mal ein bundesweites Tierschutzgesetz beschlossen und damit dem Tierschutz eine klare Note gegeben. Mit der Zeit ist es notwendig, eben auch Anpassungen vorzu-
nehmen, weil – und das haben auch alle Vorredner bestätigt – der Tierschutz, das Tierwohl in Österreich einen sehr, sehr hohen Stellenwert haben und auch sehr, sehr emotional diskutiert werden. Damit ist es auch notwendig, zu vernünftigen Umsetzungen zu kommen.
Es gab eine sehr breite Diskussion, und damit ist, glaube ich, das Ergebnis auch eines, das sich sehen lassen kann und dem man auch gut zustimmen kann. Ein Dankeschön gilt all jenen, die sich in diese Diskussion eingebracht haben, die mitgearbeitet haben, auch den Tierschutzsprechern, dem Bundesministerium.
In diesem Bundestierschutzgesetz werden Regelungen betreffend Nutztiere und Haustiere festgelegt, nicht betreffend Wildtiere. Es ist wesentlich, sich von dem Gedanken zu lösen, dass Nutztiere immer leidende Tiere und Haustiere immer Wohlfühltiere sind, denn manchmal wird Tierliebe auch falsch verstanden. Es können auch Haustiere falsch gehalten werden, und es geht Nutztieren manchmal durchaus gut und sie können ein glückliches Leben führen.
Wir müssen bei dieser Novelle zum Bundestierschutzgesetz aber auch bedenken, dass man manchmal auch Menschen vor Tieren schützen muss, weil auch der Umgang mit Tieren, vor allem mit Rindern, wenn sie zum Beispiel nicht enthornt sind, ein gewisses Risiko darstellt. Uns sollte bewusst sein, dass Menschenschutz vor Tierschutz geht.
Damit darf ich auf einige Themen eingehen: Die Kastration von Ferkeln wurde angesprochen. Es gilt dabei, Schmerzlinderung zu gewährleisten. Die Enthornung von Rindern darf nur unter Schmerzausschaltung vorgenommen werden. Das ist klar geregelt und auch notwendig.
Die Diskussion um die dauernde Anbindehaltung – und laut Gesetz ist eine dauernde Anbindehaltung eine solche, die weniger als 90 Tage Auslauf gewährt; wenn es also nur 30 Tage sind, wäre das gesetzlich auch schon eine dauernde Anbindehaltung – ist sicher etwas problematischer zu sehen. Vielen Kleinbetrieben, die aufgrund der räumlichen Lage, der örtlichen Situation keine Möglichkeit einer Weide, eines Auslaufs haben, aber nicht unbedingt auf einen Laufstall umstellen können, müssen oder sollen, gibt man die Möglichkeit, diese Anbindehaltung auch weiterhin aufrechtzuerhalten, natürlich – und zu dem stehe ich auch – unter der Voraussetzung, das behördlich zu melden und damit auch stärker in ein Kontrollsystem eingebunden zu sein. Es ist nicht automatisch so, dass ein Laufstall ein gutes System und ein Anbindestall ein schlechtes System ist, es kommt nämlich immer auf den Tierhalter an, auf die Art der Pflege. Das sollte durchaus entsprechend berücksichtigt werden.
Auch das Thema der streunenden Katzen wurde sehr vernünftig gelöst, dass nämlich wild laufende Katzen zu kastrieren sind. Jener, der sagt, dass das seine Katze ist, hat die Möglichkeit, dass sich die Katzen auch vermehren dürfen, was bisher für mich eigentlich nicht so zufriedenstellend geregelt war.
Es ist auch klar geregelt, dass privater Internethandel mit Tieren, der ein gewisses Risiko dargestellt hat, jetzt unterbunden oder hintangehalten wird, und ein Tierhalter beziehungsweise ein Tierhändler zwischengeschaltet werden muss.
Tierwohl ist etwas, was uns immer wieder wichtig ist. Vor allem in meiner Eigenschaft als Landwirt darf ich auch darauf hinweisen, dass Tierwohl auch vom Konsumenten durchaus gesteuert werden kann, nämlich insofern, als man tierische Produkte verwendet, die eben mit Tierwohl oder mit weniger Tierleid produziert werden. Ich weise nur auf die Hühnerhaltung hin. Wenn man Eier aus Freilandhaltung bezieht, dann haben die Tiere mehr Bewegungsspielraum als bei Bodenhaltung.
Es gibt für die Konsumenten auch andere Möglichkeiten, dahin gehend aktiv tätig zu sein. Bei uns in der Region gibt es ein Problem mit Aludosen, auf das ich hinweisen
möchte. Es werden nämlich Aludosen aus dem Fenster geworfen, sie landen auf einer Weide, werden dort vom Mähwerk zerkleinert, von den Kühen aufgenommen, und die Kühe verenden dann. Ich bitte auch da um Mitarbeit beim Tierschutz, beim Tierwohl.
Wir haben damit eine Anpassung, die durchaus zeitgemäß ist. Danke schön noch einmal allen, die mitgearbeitet haben. Wir werden dieser Vorlage zustimmen. (Beifall bei der ÖVP und bei Bundesräten der SPÖ.)
13.16
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Nun darf ich unserer Frau Bundesministerin Dr. Pamela Wendi-Rendi-Wagner – Entschuldigung!, das erste Mal den Namen geprobt! –, Frau Dr. Pamela Rendi-Wagner das Wort erteilen. – Bitte, Frau Ministerin. (Allgemeine Heiterkeit.)
13.16
Bundesministerin für Gesundheit und Frauen Dr. Pamela Rendi-Wagner, MSc: Herr Präsident! Sehr geehrte Bundesrätinnen und -räte! Sehr geehrte Damen und Herren! Wir werden hoffentlich noch öfter das Vergnügen haben und wir können dann gerne auch meinen Namen noch üben. Da haben einige Leute Schwierigkeiten, da sind Sie nicht der Einzige.
Ich darf die Gelegenheit auch dazu nützen, mich ganz kurz bei Ihnen allen vorzustellen, da es mein erstes Mal im Bundesrat ist. Heute ist übrigens der erste Tag meiner fünften Woche in der Funktion der Frauen- und Gesundheitsministerin.
Das wissen Sie alle: Die Gesundheitspolitik per se ist mir nicht ganz fremd. Ich bin seit 2011 Sektionsleiterin – damals noch im Gesundheitsministerium ohne Frauenpolitik, noch unter Alois Stöger – und hatte auch das Vergnügen, über zwei Jahre lang sehr eng, sehr intensiv und sehr leidenschaftlich mit Sabine Oberhauser zusammenarbeiten zu dürfen. Das waren sehr gute sechs Jahre, die ich als Sektionsleiterin, verantwortlich für den Bereich öffentliche Gesundheit und alle medizinischen Angelegenheiten, verbringen durfte, weil ich mich in meiner Funktion als Medizinerin, Ärztin sehr, sehr gut verwirklichen und einbringen konnte und vor allem, weil ich gestalten konnte. Daher war ich zu der Zeit auch dem Minister oder der Ministerin immer sehr nah, weil wir als Sektionsleiter immer ein sehr partnerschaftliches Verhältnis, und gerade zu Sabine ein sehr, sehr enges Verhältnis, hatten.
Woher komme ich? – Ich bin, wie gesagt, Fachärztin für Tropenmedizin, habe meine Ausbildung größtenteils an der Medizinischen Universität Wien gemacht, die Facharztausbildung zum Teil auch an der London School of Hygiene and Tropical Medicine in London. Die Ausbildungsanteile ein bisschen aus London zu bekommen, war durchaus zweckmäßig, da Tropenmedizin praktischer Natur in Österreich nicht ganz so verbreitet ist. Es hat mir auch meine Perspektive und Einblicke, was öffentliche Gesundheit, Public Health, betrifft, gegeben, ein gutes Fundament, das ich auch sehr gut in meiner Sektionsleitungstätigkeit im Ministerium einbauen konnte.
Das zweite Gebiet, die Frauenpolitik, ist mir bis vor fünf Wochen – bis auf die persönlichen Berührungspunkte natürlich – noch nicht professionell begegnet, ist für mich aber ein sehr emotionales Thema. Frauenpolitik ist ein Gesellschaftsthema und deshalb natürlich auch mir ein großes Anliegen. Mir ist bewusst, dass ich und wahrscheinlich viele der hier sitzenden Frauen nicht in diesen Positionen wären und wir diese Karrieren nicht machen hätten können, wenn nicht schon sämtliche wichtige Errungenschaften der letzten Jahrzehnte im Bereich der Frauenpolitik erreicht worden wären. Das ist mir bewusst, und auch, dass vor allem noch vieles vor uns liegt, denn die Gleichstellung von Mann und Frau, vor allem im professionellen, im beruflichen Setting ist noch nicht erreicht. Wir haben Lohndifferenzen, die es zu überwinden gilt, wir haben Unterschiede, was die Verteilung in Aufsichtsräten betrifft. Das sind alles Themen, die wir in Zukunft ganz stark
bearbeiten müssen. Wir haben vor allem das große Thema der Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Kindern, das zu einem sehr großen Teil – und da spreche ich auch aus eigener Erfahrung – immer noch auf den Schultern der Frauen lastet. Deswegen sind hier noch weite Wege zu gehen.
Klar ist mir auch, dass ich weder als Gesundheits- noch als Frauenministerin ganz alleine alles umsetzen kann. Es braucht die partnerschaftliche Unterstützung und Zusammenarbeit mit anderen Ressorts, anderen RessortkollegInnen, aber natürlich auch mit Ihnen allen und mit der Zivilgesellschaft, um die Ziele zu erreichen, die für uns alle sehr wichtig sind. In diesem Sinne freue ich mich auf diese Arbeit.
Es liegen sehr intensive vier Wochen, in denen ich sehr viel gelernt habe, hinter mir. Ich konnte Einblicke gewinnen, zu denen wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten noch viele hinzukommen werden. Ich freue mich darauf und bin voller Neugier dabei. Ich bin gekommen, um zu arbeiten. (Allgemeiner Beifall.)
Noch mehr freut mich, dass ich heute die Gelegenheit habe, bei Ihnen dieses wichtige Thema des Tierschutzes zu diskutieren. Wir haben eine Novelle zum Tierschutzgesetz vorgelegt, die wir nun diskutieren. Aus meiner Sicht ist sie eine sehr wichtige Novellierung, da – und das wurde von einigen der Vorredner schon angesprochen – eine zeitgemäße Adaptierung einfach notwendig war. Das Rad der Zeit hat sich weitergedreht. Die gesellschaftspolitischen Anforderungen im Bereich Tierschutz haben sich verändert. Der Bedarf und die Situationen im Bereich der Landwirtschaft haben sich verändert. Dies alles hat einen Anpassungsbedarf ergeben, weshalb es nun nach acht Jahren an der Zeit war, eine Novellierung des Tierschutzgesetzes vorzulegen.
Was ist das Ergebnis? – Erstens freut es mich, dass die Inhalte dieser Regierungsvorlage zum allergrößten Teil noch persönlich mit Sabine Oberhauser abgestimmt wurden und es sicher auch noch ihr Erbe ist, das wir heute hier – hoffentlich – zum Abschluss bringen werden.
Wenn wir über das Ergebnis diskutieren – und die Diskussion mit Ihnen hat das auch gezeigt –, ist klar: Tierschutz ist ein emotionales Thema und wird immer ein emotionales Thema sein. Daher kann Tierschutz aus der Perspektive der Tierschützer – und dazu zähle auch ich – nie weit genug gehen. Das ist, glaube ich, ein Faktum. Gleichzeitig ist Politik immer auch Kompromiss. Es gibt viele Interessenlagen, die es zu berücksichtigen gilt, insbesondere im Tierschutz und in der Nutztierhaltung. Den Ausgleich dieser Interessenunterschiede gilt es zu erreichen.
Ich denke, mit der vorliegenden Novelle wurde ein guter Ausgleich geschaffen. Zwei Jahre lang sind intensive Verhandlungen und Diskussionen mit den verschiedensten Stakeholdern und Interessengruppen geführt worden. Es waren zwei intensive Verhandlungsjahre, und ich glaube, das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Bereits erwähnt wurde, dass im Rahmen des Begutachtungsverfahrens über 600 Stellungnahmen eingegangen sind. Das zeigt die Emotionalität und die gesellschaftspolitische Bedeutung dieses Themas in Österreich und überhaupt. Von daher kann ich sagen: Es waren zwei intensive Vorverhandlungsjahre.
Wir haben sehr viele der im Rahmen der Begutachtung eingegangenen Stellungnahmen in die Regierungsvorlage übernehmen können. Das ist sehr wichtig und nicht bei allen Regierungsvorlagen in diesem hohen Ausmaß der Fall.
Mir ist noch wichtig zu erwähnen, dass es in letzter Sekunde gelungen ist, noch zwei wichtige Punkte aufzunehmen, nämlich das Verbot des Auswilderns von Tieren, die in der Freiheit nicht überlebensfähig wären – Sie haben es erwähnt, es ist ein wichtiger Punkt, denke ich – sowie das Thema der Anbindehaltung bei Rindern. Dazu konnte ein Verbot noch nicht in das Gesetz aufgenommen werden. – Ja, für ein Verbot der Anbindehaltung scheint die Zeit noch nicht reif zu sein.
Ich glaube aber, dass die Meldeverpflichtung, die wir in der Novelle erreicht haben, ein sehr wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist und es möglicherweise in Zukunft auch zu anderen oder weiter gehenden Lösungen kommen wird. Ich bin jedoch froh, dass wir in letzter Sekunde noch ein positives Verhandlungsergebnis zu diesen Punkten erreichen konnten und sie aufgenommen haben.
In diesem Sinne glaube ich, dass ein guter, fortschrittlicher Kompromiss gelungen ist. Ich danke Ihnen für diese lebendige Diskussion und hoffe auf Ihre Zustimmung. – Vielen Dank. (Beifall bei SPÖ, ÖVP und Grünen.)
13.24
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir gelangen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist mit Stimmenmehrheit beschlossen. Der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz geändert wird (1520 d.B. und 1547 d.B. sowie 9774/BR d.B.)
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Nun gelangen wir zum 11. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatterin ist Frau Bundesrätin Mag. Gruber-Pruner. – Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatterin Mag. Daniela Gruber-Pruner: Hohes Präsidium! Geschätzte Frau Ministerin! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich bringe den Bericht des Gesundheitsausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz geändert wird.
Der Bericht liegt in schriftlicher Form vor, ich komme daher sogleich zur Antragstellung.
Der Gesundheitsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 4. April 2017 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Danke für den Bericht.
Wir gehen in die Debatte ein.
Als Erste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Ebner. – Bitte.
13.26
Bundesrätin Adelheid Ebner (SPÖ, Niederösterreich): Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzte Frau Bundesministerin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Werte Zuhörer! Ja, wir sind wieder einmal bei der Umsetzung einer EU-Richtlinie. Die Anpassung an das EU-Recht ist auch bei der Novelle zum Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz der Hauptgesichtspunkt.
Durch die Umsetzung der Vorgaben aus Brüssel fällt das Konzept der diätetischen Lebensmittel weg. Neu ist hingegen der Begriff der „Lebensmittel für spezielle Gruppen“. Die Kontrolle von Lebensmitteln ist in Österreich durch Gesetze und Verordnungen ge-
regelt. Jährlich gibt es einen ausführlichen Bericht zur Lebensmittelsicherheit, welcher der Öffentlichkeit zugänglich und auch gut dokumentiert ist.
Was konkret ist neu in diesem Gesetz? – Konkret werden nun Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung, Getreidebeikost, Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke und Tagesrationen für eine gewichtskontrollierende Ernährung unter der Bezeichnung „Lebensmittel für spezielle Gruppen“ in das Gesetz aufgenommen. Neu ist auch eine Meldeverpflichtung für Lebensmittel, die noch nicht auf dem Markt sind, jedoch besonderen medizinischen Zwecken dienen.
Was sind Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke? – Es sind dies Lebensmittel, die für Patienten entwickelt werden, deren Nährstoffbedarf aufgrund bestimmter Erkrankungen, Störungen oder spezifischer Beschwerden nicht durch den Verzehr von normalen Lebensmitteln gedeckt werden kann.
In den letzten Wochen gab es Diskussionen über die Krankheit Diabetes. Die WHO schlägt Alarm, denn immer mehr Menschen in der Welt erkranken an Diabetes. Die Zahl der Erkrankten weltweit hat sich innerhalb der letzten 35 Jahre vervierfacht.
In Österreich dürften – die geschätzte Dunkelziffer ist hier miteingerechnet – rund 10 Prozent der Erwachsenen an Diabetes erkrankt sein. Präventionsmaßnahmen müssen flächendeckend und für alle Altersgruppen etabliert werden. Ziel muss es sein, die Schädlichkeit des Zuckers in der Bevölkerung noch mehr aufzuzeigen und den Zuckerverbrauch zu senken. Die WHO empfiehlt 6 bis 12 Teelöffel täglich, also einen maximalen Zuckerverbrauch von 50 Gramm pro Tag. 5 Dekagramm, das ist nicht wirklich sehr viel, wenn man bedenkt, wie viel versteckter Zucker in den unterschiedlichsten Lebensmitteln zu finden ist.
„Lebensmittel für spezielle Gruppen“ müssen auch speziellen Ernährungserfordernissen bestimmter Personengruppen, wie zum Beispiel jenen von Kranken, Schwangeren, Kleinkindern oder Säuglingen, entsprechen. In Zukunft soll in detaillierten Regelungen über Zusammensetzung, Herstellung und Kennzeichnung dieser Lebensmittel sichergestellt werden, dass für besonders empfindliche Verbrauchergruppen nur Lebensmittel angeboten werden, die für diese geeignet sind. Die Erzeugung und die in Verkehr gebrachten Lebensmittel selbst müssten dann stets dem aktuellen Wissensstand angepasst sein.
Das Thema Lebensmittelsicherheit ist in unserem Land, in dem es auch einen hohen Anteil an Biolebensmitteln gibt, ein sehr wichtiges, wobei der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit als Einrichtung für die Sicherheit der Lebensmittel eine bedeutende Rolle zukommt. Beispielsweise erhebt die AGES seit 2010 auch den Einsatz von Antibiotika im Bereich der Tiermedizin. Es wurde festgestellt, dass die im Jahr 2010 eingesetzte Menge von circa 62 Tonnen auf 48 Tonnen gesenkt werden konnte. Das ist schon sehr beachtlich, wenn man bedenkt, dass die Menschen in Österreich sehr viel Fleisch konsumieren.
Unsere Lebensmittel sind Substanzen, die konsumiert werden, um den menschlichen Körper zu ernähren. Um aber für gesunde Lebensmittel und Lebensmittelsicherheit zu sorgen, brauchen wir auch eine starke EU. Unsere Fraktion stimmt diesem Gesetz heute zu. (Beifall bei SPÖ, ÖVP und Grünen.)
13.29
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Ing. Köck. – Bitte, Herr Bundesrat.
13.30
Bundesrat Ing. Eduard Köck (ÖVP, Niederösterreich): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Minister! Hohes Haus! Sehr geehrte Gäste! Die Gesetzesänderun-
gen wurden von meiner Vorrednerin hervorragend dargelegt. Ich möchte mich daher mehr mit der Lebensmittelsicherheit und dem Verbraucherschutz insgesamt befassen.
Angesichts der Globalisierung der Lebensmittelproduktion, die wir beobachten – Sie müssen sich vorstellen, derzeit kommen die Teiglinge für Italien aus Thailand und werden dann in Italien zur italienischen Semmel! –, und den damit verbundenen Skandalen – denken wir zurück an den Gammelfleischskandal aus Brasilien! – wurde die Sensibilität der Konsumenten bezüglich der Herkunft sowie der Art und Weise der Produktion der Lebensmittel immer höher. Darum braucht es auch ein derartiges Gesetz.
Viele Menschen wollen Klarheit, wie und wo produziert wird. Auch die österreichischen Bauern wollen klare, nachvollziehbare Regelungen, die auch vollziehbar sind, denn wir haben in sehr vielen Bereichen der Produktion höhere Anforderungen.
Ein Gesetz haben wir gerade diskutiert, nämlich das Tierschutzgesetz, das doch zeigt, dass in Österreich andere Produktionsbedingungen bestehen als zum Beispiel in anderen EU-Ländern und höhere Standards als in vielen anderen Ländern der Welt. Was mich in diesem Zusammenhang besonders ärgert, sind immer wieder die Preisvergleiche der Arbeiterkammer oder manches Mal der „Kronen Zeitung“. Darin wird ein Warenkorb mit Waren aus Österreich mit entsprechenden Waren aus Deutschland verglichen, die dann dort um vieles billiger sind. Letztlich wird damit Arbeitskraft verglichen – dort arbeiten Lohnarbeitskräfte an den Schlachtbändern, die um 5 € arbeiten –, und man sagt damit auch dem Konsumenten: Kauf Waren, die unter einem Tierschutzgesetz produziert wurden, das nicht mit dem österreichischen vergleichbar ist! – Das muss man hier auch einmal sagen. Deshalb würde ich meinen, man sollte in Zukunft solche Vergleiche unterlassen.
Viele Produzenten und Vermarkter versuchen, durch Irreführung die Konsumenten zu täuschen und sich dadurch natürlich einen finanziellen Vorteil zu holen. Ich bin selbst in der Vermarktung aktiv, als Gegenüber habe ich den Lebensmittelhandel und die Gastronomie. Mir ist schon sehr vieles passiert. Ich habe schon Bergkäse aus Holland gesehen – ich kenne aber die Berge dort nicht. Ich habe schon Fleisch von Firmen bei Gastronomiebetrieben gesehen, die bei diesen Firmen nie bestellt oder gekauft haben, und vieles andere. Solche Sachen werden mit diesem Gesetz unterbunden.
Es gibt aber noch immer viele Möglichkeiten: Im heurigen Jahr habe ich zum Beispiel ein Bioregal gesehen, das als solches ausgewiesen war, in dem jedoch konventionelle Ware aus Übersee gelegen ist. Ein anderes Beispiel sind vor allem die Eigenmarken. Mit ihnen kreieren Lebensmittelketten Marken, bei denen sie die Zulieferer beliebig austauschen können. Auch wenn eine derartige Marke lange Zeit mit österreichischen Zulieferern betrieben worden ist, erkennt man einen möglichen Wechsel eigentlich nur an einem ganz kleinen ovalen Stempel, wobei man meistens auch noch eine Brille braucht, damit man ihn lesen kann. Letzten Endes werden da über Nacht Produkte ausgewechselt, die an einem Tag noch unter dem österreichischen Tierschutzgesetz produziert wurden, am nächsten Tag aber schon unter einem ganz anderen. Wenn wir die Debatte mit dem Tierschutzgesetz von vorhin ernst gemeint haben, dann müssen wir auch den zweiten Schritt machen und für Eigenmarken ebenfalls ein Gesetz schaffen, sodass in einer gewissen Größe gekennzeichnet werden muss, wer dieses Produkt produziert hat und wo es produziert wurde – aber eben nicht mit einem so kleinen Stempel.
Insgesamt gibt es in Österreich sehr viele gute Ideen und Projekte, die zur regionalen Herkunft hinleiten. Ein Beispiel ist das aktuelle Projekt mit dem Bundesheer. Ich halte es für sehr wichtig, denn wenn Lebensmittel schon mit österreichischem Steuergeld finanziert werden, sollen sie auch von österreichischen Bauern kommen. Ein anderes Beispiel ist die Aktion „Unser Essen: Wissen wo’s herkommt“, in deren Rahmen dokumentiert werden soll, dass die Lebensmittel, die in großen Gastroküchen angeboten werden, aus Österreich kommen. (Präsidentin Ledl-Rossmann übernimmt den Vorsitz.)
Bereits angesprochen wurde, dass wir in Zukunft der Rolle des Zuckers viel mehr Gewicht, vielleicht auch durch Gesetze, geben sollten, aber auch der Rolle des Glutamats. Beide Stoffe machen süchtig, beide sind ungesund und machen krank. Ich denke, dass wir vielleicht auch in diesem Bereich noch gesetzliche Regelungen finden können.
Zum Schluss möchte ich allen KonsumentInnen eines mitgeben: Für schlechtes Geld kann man nur schlechtes Essen erhalten. Deshalb brauchen wir ordentliche Regeln, damit wir die Herkunft der Lebensmittel dokumentieren und unseren Konsumenten große Sicherheit geben können. Wir werden dem Gesetz zustimmen. – Danke. (Beifall bei der ÖVP.)
13.36
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Längle. Ich erteile es ihm.
13.36
Bundesrat Christoph Längle (FPÖ, Vorarlberg): Frau Präsidentin! Geschätzte Frau Ministerin! Auch von meiner Seite: Herzlich willkommen hier im Bundesrat! Geschätzte Damen und Herren! Geschätzte Zuhörer! Geschätzte Besucher auch aus Vorarlberg! – Es sind heute Vorarlberger da, nicht nur immer Besucher aus den anderen Bundesländern, sondern auch einmal aus meinem Heimatland. (Beifall bei Bundesräten von ÖVP und SPÖ.)
Zum Tagesordnungspunkt und zu dieser Gesetzesänderung: Aus freiheitlicher Sicht ist klar zu sagen, dass diese Änderungen und Anpassungen alle logisch und schlüssig sind. Daher gleich vorneweg: Wir werden dieser Gesetzesänderung unsere Zustimmung geben.
Frau Kollegin Ebner hat einiges schon ausgeführt, das ich nur unterstreichen kann. Auch zum vorhergehenden Tagesordnungspunkt hat Kollege Schererbauer einiges angesprochen, das ebenfalls zu unterstreichen ist. Mir persönlich ist wichtig, dass eine Irreführung der Konsumenten auf das Schärfste zu verurteilen ist. Gerade bei Lebensmitteln, die wir alle brauchen, muss in Bezug auf Herkunft, Zusammensetzung und Haltbarkeit selbstverständlich immer die Wahrheit an den Tag gelegt werden. Irreführungen in diesem Bereich sind, wie erwähnt, auf das Schärfste zu verurteilen.
Ich denke, dass wir mit dieser Gesetzesänderung den guten, wertvollen und dementsprechend gekennzeichneten Lebensmitteln aus Österreich beziehungsweise – Kollege Köck hat es auch angesprochen – aus dem europäischen Raum sowie aus dem allgemein internationalen Raum Rechnung tragen. Ich glaube, wir alle können froh sein, dass in diesem Bereich gut zusammengearbeitet wird und man das Bestmögliche für die Konsumenten und die Verbraucher macht.
Mir ist auch wichtig, dass unsere Landwirte und all jene, die in der Lebensmittelproduktion und ‑verarbeitung, aber auch im Verkauf zu tun haben, gelobt werden, weil viele österreichische Unternehmerinnen und Unternehmer dahinter stehen, die ihr Bestes geben.
Zwei Dinge möchte ich noch erwähnen: Zum einen geht es um die Verschwendung von Lebensmitteln. Wenn man sich dazu Zahlen, Daten und Fakten anschaut, kommt doch die sehr stolze Summe von jährlich insgesamt 40 000 Lkw-Ladungen zusammen, die weggeschmissen werden. Betrachtet man das weltweit und denkt an Hungersnöte und Engpässe, so ist es eigentlich ein Wahnsinn, dass so viel weggeschmissen wird. Ich glaube aber, dass das kein gesetzliches, sondern vielleicht eher ein gesellschaftliches Problem ist.
Zum anderen ist zur Tierhaltung noch zu sagen, dass es selbstverständlich sehr wichtig ist, für die Tiere auch einen Freilauf, eine freie Bewegung zu gewährleisten – wie vorhin bereits angesprochen. Wenn aber Meldungen kommen, dass das offensichtlich nicht von so großer Bedeutung sein soll, kann ich das nur auf das Schärfste negieren. Ich halte es für sehr wichtig.
Betreffend Tiertransporte gab es in der Vergangenheit auch in Österreich negative Beispiele. Es sind Dinge vorgekommen, die ebenfalls nicht sein sollten. Ich hoffe, dass die Polizei und unsere Exekutive alles lückenlos aufklären und die Personen, die dahinter stehen, zur Rechenschaft ziehen kann.
Es kann nämlich nicht sein, dass man in einer Nacht-und-Nebel-Aktion viele, viele Tiere auf engstem Raum Hunderte Kilometer weit transportiert und dann irgendwo in der Nacht auf Parkplätzen stehen lässt. Das darf nicht passieren! Tiere sind Lebewesen und gehören respektiert und unterstützt. (Allgemeiner Beifall.)
Abschließend zur Gesetzesänderung: Wie ich schon eingangs gesagt habe, werden wir aus den von mir erwähnten Gründen dieser Änderung sehr gerne unsere Zustimmung erteilen. – Danke. (Allgemeiner Beifall.)
13.40
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir gelangen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Gesundheitsberuferegister-Gesetz, das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz und das MTD-Gesetz geändert werden (GBRG-Novelle 2017) (1518 d.B. und 1548 d.B. sowie 9775/BR d.B.)
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Wir gelangen zum 12. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatterin ist Frau Bundesrätin Ebner. Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatterin Adelheid Ebner: Geschätzte Frau Präsidentin! Frau Bundesministerin! Kolleginnen und Kollegen! Ich bringe den Bericht des Gesundheitsausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Gesundheitsberuferegister-Gesetz, das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz und das MTD-Gesetz geändert werden.
Der Bericht liegt in schriftlicher Form vor, ich komme daher gleich zur Antragstellung:
Der Gesundheitsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 4. April 2017 mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Vielen Dank für den Bericht.
Wir gehen in die Debatte ein.
Als Erster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Krusche. – Bitte, Herr Bundesrat.
13.42
Bundesrat Gerd Krusche (FPÖ, Steiermark): Frau Präsident! Frau Bundesminister! Kolleginnen und Kollegen! Irgendwie ist das hier für mich eine Premiere: Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich ein Gesetz dreimal ablehnen oder dreimal dagegenstimmen kann. Das erste Mal ist es am Widerstand der Länder gescheitert, dann wurden diese zwei Stellen für die Registrierung geschaffen, und jetzt sind wir in der pikanten Situation, ein Gesetz, das eigentlich de facto noch gar nicht in Kraft getreten ist, schon zu
novellieren. Das bestärkt uns nur in unseren ursprünglichen Argumentationen, dass man damit Bürokratie auf- statt abbaut und das Ganze ein Murks-Gesetz ist. Dass wir es schon wieder novellieren müssen, ist genügend Beweis.
Wir haben bereits zweimal Gelegenheit gehabt, uns über die näheren Argumente auszutauschen, daher: Wir werden dem auch ein drittes Mal nicht zustimmen. – Danke. (Beifall bei der FPÖ.)
13.43
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Als Nächste ist Frau Bundesrätin Mag. Gruber-Pruner zu Wort gemeldet. – Bitte, Frau Bundesrätin.
13.43
Bundesrätin Mag. Daniela Gruber-Pruner (SPÖ, Wien): Frau Präsidentin! Frau Ministerin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben dieses Gesundheitsberuferegister-Gesetz – das ist ein Zungenbrecher – schon vor einem Jahr hier im Haus gehabt. Heute geht es darum – ich sehe das Glas in diesem Fall halb voll –, Änderungen, nämlich Verbesserungen, Vereinfachungen und auch Klarstellungen, vorzunehmen.
Das dient einerseits der Qualitätssicherung für die Menschen, die in den betroffenen Berufsgruppen beschäftigt sind, und damit auch der Aufwertung ihres Berufes. Sie müssen ab jetzt ihre Qualifikation nachweisen und bekommen dafür für fünf Jahre einen Berufsausweis. Dieses Gesetz dient aber auch der Sicherheit der PatientInnen, dass sie eben von ausgebildeten und qualifizierten Personen behandelt werden.
Dieses Gesundheitsberuferegister und die Daten, die darin erhoben werden, haben natürlich auch etwas mit der regionalen und der bundesweiten Bedarfsplanung zu tun und können in Zukunft dafür herangezogen werden. Nicht zuletzt erfolgt durch das Gesundheitsberuferegister auch eine Anpassung an die internationalen Standards und eine Erleichterung der Migration und des internationalen Informationsaustausches.
Es wird mit dieser Änderung, die wir heute hoffentlich beschließen werden, möglich sein, sich für dieses Register online zu registrieren. Übrigens rechnet man im Rahmen dieser Bestandsregistrierung mit circa 100 000 Anträgen von Berufsangehörigen. Das Highlight, das ich einbringen will: Es wurde bei den Verhandlungen durchgesetzt, dass die Registrierung gebührenfrei angeboten wird. Dabei entstehen keine Kosten. Es wäre ja auch komisch, dass man, wenn man schon jahrelang in diesem Beruf tätig ist, dann registriert wird und dafür etwas bezahlen muss. Über diesen Verhandlungserfolg freuen wir uns also, und dafür möchte ich mich herzlich bedanken.
Meine Fraktion möchte diesen Klarstellungen, Verbesserungen und Vereinfachungen sehr gerne zustimmen. – Danke schön. (Beifall bei SPÖ, ÖVP und Grünen.)
13.46
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Ich darf bei uns im Bundesrat sehr herzlich die Schülerinnen und Schüler der Handelsakademie Hollabrunn begrüßen. (Allgemeiner Beifall.)
Als Nächste ist Frau Bundesrätin Stöckl-Wolkerstorfer zu Wort gemeldet. Ich erteile ihr dieses.
13.46
Bundesrätin Angela Stöckl-Wolkerstorfer (ÖVP, Niederösterreich): Hohes Präsidium! Frau Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Wie wir bereits gehört haben, beschließen wir heute das Gesundheitsberuferegister-Gesetz, dem eine lange Entstehungsgeschichte vorausgeht. Von Murks, Herr Kollege, kann man aber wirklich nicht sprechen, denn die Berufsverbände haben sich wirklich massiv in die Erarbeitung dieses Gesetzes und dieser Novelle eingebracht.
Ursprünglich gab es sicher viel Unruhe bei den einzelnen Berufsgruppen und ‑verbänden, da niemand so richtig wusste, wohin die Reise eigentlich gehen soll. Auch ich selbst war als Angehörige des gehobenen medizinisch-technischen Dienstes skeptisch. Letztlich gelang aber 2016 eine gute Lösung, und das Gesetz konnte beschlossen werden, selbst wenn der Start erst 2018 erfolgt. Es ist eine Novellierung, die dem 21. Jahrhundert, dem Onlinezeitalter gerecht wird.
Nicht allein das Sprichwort: Aller guten Dinge sind drei, sondern auch: Was lange währt, wird endlich gut, passen heute. (Bundesrätin Mühlwerth: Das sieht nicht jeder so!) Obwohl wir hier die Novelle zum Gesetz beschließen, die der Onlineregistrierung gewidmet ist, muss grundsätzlich erwähnt werden, dass es im ursprünglichen Gesetz zur Registrierung der Gesundheitsberufe darum geht, systematisch alle Angehörigen der Pflegeberufe wie auch Angehörige der medizinisch-technischen Dienste an zentralen Stellen zu erfassen.
Ein paar Zahlen dazu: Wir sprechen in Österreich von rund 100 000 Personen, die im Gesundheitsbereich tätig sind, 80 000 in der Pflege und 20 000 in gehobenen medizinischen Berufen. Es herrscht durch dieses Gesetz Sicherheit, dass alle Berufsangehörigen eine Ausbildung gemäß den österreichischen Standards haben, und das hat Qualität. Ebenso ist dies für Patientinnen und Patienten nur vorteilhaft: Sie können sicher sein, qualitativ hochwertig von sehr gut ausgebildeten Personen aus den diversesten Gesundheitsberufen betreut, versorgt und behandelt zu werden. Schließlich dürfen auch wir in der Politik uns glücklich schätzen, weil bei Ausbildungen im Bereich der Gesundheitsberufe besser gesteuert werden kann.
Die Registrierung der Gesundheitsberufe entspricht also den Interessen so vieler, und ich sehe nun breite Zustimmung und keine nennenswerte Gegnerschaft in den einzelnen Verbänden und Gruppen. Nun wird die Onlineregistrierung möglich sein, obendrein gebührenfrei, Gott sei Dank. Sie wird zu einer massiven Verwaltungsvereinfachung führen. Wir von der ÖVP bekennen uns zur Verwaltungsvereinfachung und zum Bürokratieabbau.
Dass die Registrierung der Unselbständigen bei der Arbeiterkammer und die Registrierung der Freiberufler bei der Gesundheit Österreich GmbH erfolgt, ist durchaus legitim und soll weitere Sicherheit geben. Jedenfalls ist eine deutliche Klarstellung darüber erfolgt, wo die Registrierung erfolgen muss.
Kritik, die besagt, dass über diverse Verbände bereits Onlineregistrierungen stattgefunden haben, mag durchaus ihren Stellenwert haben. Ich gehöre als Physiotherapeutin selbst zu den gehobenen medizinisch-technischen Diensten und weiß, dass MTD Austria, das ist der Dachverband der medizinisch-technischen Dienste Österreichs, bereits vor mehreren Jahren zwecks Registrierung die MTD-Register GmbH gegründet hat. Dieses Register hat ebenfalls Qualität.
Da wäre es angebracht, Frau Bundesminister, mit den Verbänden in Verhandlungen zu treten, um eine möglichst einfache Datenübermittlung zu gewährleisten. Die Arbeit der Behörden würde erleichtert werden, insbesondere im Bereich der freiberuflichen Therapeutinnen und Therapeuten.
Über Kostenersatz muss natürlich ebenso diskutiert werden. Dazu meinte schon meine Berufskollegin Nationalratsabgeordnete Claudia Durchschlag fairerweise, dass zum Beispiel MTD nicht von Steuergeldern gefördert wird, sondern einzig und allein durch die Mitglieder durch deren Mitgliedsbeitrag finanziert wurde. Ich schließe mich ihrer Ansicht und ihrem Wunsch an.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe schon öfters erwähnt, wir haben eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Das ist gut so. Wir in der Politik brauchen uns dafür
nicht zu genieren, und wir wollen es weiterentwickeln. Dieses Gesetz, diese Novelle gehört ebenfalls dazu. Ich freue mich daher, dieses Gesetz mitbeschließen zu dürfen. So darf ich nun im Namen meiner Fraktion, aber auch im Namen meiner Berufskolleginnen und ‑kollegen sprechen, mit denen ich nach wie vor in Kontakt bin. – Danke schön. (Beifall bei ÖVP, SPÖ und Grünen.)
13.51
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Stögmüller. Ich erteile es ihm.
13.51
Bundesrat David Stögmüller (Grüne, Oberösterreich): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau Ministerin! Zuerst einmal herzlich willkommen im Namen der grünen Fraktion und auch der Grünen Oberösterreich! Vielen Dank, dass Sie uns heute hier besuchen! (Allgemeine Heiterkeit. – Zwischenruf des Bundesrates Mario Lindner.) Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, darauf wollte ich eigentlich hinaus.
Zum Gesundheitsberuferegister: Im Vorfeld hat es ja relativ viel Aufregung um dieses Gesetz, um diese Novelle gegeben. Mittlerweile hat sich das Ganze aber schon gelegt, glaube ich. Jetzt wissen alle Berufsverbände und Berufsangehörigen, wohin die Reise gehen soll. Ich glaube, das ist schon einmal sehr gut, und es gibt eine breite Akzeptanz in diesem Bereich.
Ich möchte trotzdem noch ein paar Worte zu dieser Novelle, zu dieser Vorlage sagen. Wir sind nicht ganz so glücklich mit der Fristverlängerung von zwölf auf 18 Monate, weil das eine weitere Verzögerung der Registrierung ist. Das ist auch problematisch im Zusammenhang mit der Planung im Gesundheitswesen, denn da brauchen wir endlich valide Daten. Wir brauchen diese Daten für die Transparenz, für die Koordination und auch, weil es wichtig ist, die Anzahl der Berufsangehörigen festzustellen, herauszufinden, wie viele den Beruf tatsächlich ausüben. Auch im Hinblick auf den verstärkten Einsatz von Pflegekräften und MTD-Berufsangehörigen in der Primärversorgung wäre das von ganz großer Relevanz.
Für die Planung wäre es auch wichtig, zu wissen, wie viele Berufsangehörige mit wie vielen Stunden am Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund hat die GÖG in ihrer Stellungnahme angeregt, dass auch das Ausmaß der beabsichtigten Berufsausübung angegeben werden soll. – Schade, dass dieser Vorschlag nicht in diese Novelle aufgenommen wurde. Das hätten wir uns gewünscht. Es ist aber des Weiteren zu begrüßen, dass der Antrag auf Aufnahme in das Register nunmehr sowohl persönlich als auch online gestellt werden kann. Das finde ich sehr gut, weil es eben einfach ist, wenn man sich online registrieren kann.
Noch eine kleine Bitte an Sie: Vielleicht können Sie feststellen beziehungsweise festlegen, dass jetzt keine Registrierungsgebühr oder ‑abgabe kommt. Ich finde es einfach sinnlos, dass man noch Geldbeschaffung auf Kosten dieser in den Gesundheitsberufen tätigen Menschen einführt. Das wäre vielleicht noch festzustellen und festzulegen. Ich glaube, das wäre sinnvoll. Ansonsten stimmen wir diesem Gesetz natürlich zu. – Vielen Dank. (Beifall bei Grünen und SPÖ sowie bei Bundesräten der ÖVP.)
13.54
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Hammerl. – Bitte, Herr Bundesrat.
13.54
Bundesrat Gregor Hammerl (ÖVP, Steiermark): Liebe Frau Präsident! Geschätzte Frau Minister! Meine Damen und Herren! Dieses Gesundheitsberuferegister-Gesetz ist ein gutes Gesetz. Ich gehe ganz kurz darauf ein. Meine Vorredner, abgesehen von einem, sind bereits positiv darauf eingegangen.
Meine Damen und Herren, wenn man auf die Dienste von Physiotherapeuten oder anderem Gesundheitspersonal angewiesen ist, dann merkt man erst, wie wichtig diese Menschen sind. Sie tragen wesentlich zur Heilung und zum Wohlbefinden der gesundheitlich beeinträchtigten Menschen bei. Es wurde schon gesagt, es sind über 100 000 Personen, die in Österreich in Pflegeberufen und im gehobenen medizinischen Dienst tätig sind. Bei mir im Hilfswerk Steiermark sind es über 1 500, zum Großteil Frauen.
Diesen Personen, meine Damen und Herren, gilt es in erster Linie für ihren wesentlichen Dienst im Gesundheitswesen zu danken, für das, was sie zum Wohle derer, die Hilfe brauchen, für die Erhaltung der Qualität unseres Gesundheitswesens beitragen.
Meine Damen und Herren, um diese Personen geht es im vorliegenden Gesundheitsberuferegister-Gesetz. Wir alle wissen, es handelt sich bei der Gesundheit um ein sensibles Thema, deswegen muss sehr verantwortungsvoll mit diesem Thema umgegangen werden. Die Registrierung aller, die in diesem Bereich tätig sind, stellt ein Element solchen Verantwortungsbewusstseins dar.
Mit der Registrierung wird Sicherheit in mehrfacher Richtung zu erreichen versucht. Da geht es einerseits um die Sicherheit in Bezug auf die Ausbildung – sehr wichtig. Mit der Registrierung werden Standards eingefordert, die bewirken, dass die Menschen, die Hilfe dieser Personen in Anspruch nehmen, davon ausgehen können, dass sie bestmöglich behandelt werden. Zweitens geht es um Sicherheit für die fachlich und politisch Verantwortlichen im Gesundheitswesen, weil sie einen Überblick über die verschiedenen Bereiche bekommen, im Bezug darauf, wo beispielsweise Spezialisten fehlen und wo Überbesetzungen vorliegen.
Damit, meine Damen und Herren, wird die Planung erleichtert und die Wahrscheinlichkeit, dass Spezialisten für die Behandlung eines Problems zur Verfügung stehen, erhöht. Zudem können in der Ausbildung Weichenstellungen vorgenommen werden. Schließlich bringt es auch Sicherheit für die im Pflegeberuf und für die im gehobenen medizinischen Gesundheitswesen Tätigen, weil sie mit der Registrierung den Nachweis ihrer Professionalität haben.
Besonders im Gesundheitswesen zeigt sich ja eine starke Dynamik, die immer wieder zu neuen Herausforderungen führt. Die gestrige Enquete „Die Zukunft der Pflege: schaffbar, sichtbar, leistbar“ hat das aufgezeigt – liebe Frau Präsident, noch einmal ein großes Danke für dein Engagement für diese Enquete! Deswegen bedarf es auch immer wieder der Anpassung der Strukturen des Gesundheitswesens. Das ist auch der Grund dafür, dass wir uns schon mit diesem Gesetz befasst haben und uns damit auch weiter befassen müssen und werden.
Beispielsweise im Bereich der Hospiz- und Palliativbetreuung bedarf es einiger Veränderungen der Bestimmungen. Die Weltgesundheitsorganisation fordert, auch im Projekt, einen Ansatz zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen und ihren Familien, welche sich in ihrem Leben mit einer lebensbedrohlichen, unheilbaren und fortschreitenden Krankheit auseinandersetzen müssen. Dies soll, meine Damen und Herren, durch Prävention und Linderung von Leiden, durch eine frühzeitige Identifikation, durch eine fachgerechte Einschätzung und die Linderung von Schmerzen und anderen belastenden Ereignissen psychischer, sozialer, kultureller und spiritueller Natur erfolgen.
Meine Damen und Herren, wir sehen ein sehr anspruchsvolles Programm, das strukturelle Maßnahmen in Bezug auf die, die diese Betreuung vornehmen, fordert. In dieser Hinsicht wird das Gesetz angepasst. Dieses Beispiel zeigt, dass es immer wieder Entwicklungen gibt, die neu aufgenommen werden müssen, um die Menschlichkeit so weit als möglich garantieren zu können.
Über die Registrierung kann natürlich nicht alles geschehen, sie bildet aber einen Rahmen, in dem wichtige Weichenstellungen getroffen werden. Die bürokratische Umset-
zung der Maßnahmen, zum Beispiel die Registrierung bei der Bundesarbeiterkammer für die unselbständig Erwerbstätigen einerseits und für die selbständig Erwerbstätigen bei der Gesundheit Österreich GmbH andererseits, und die konkrete Form der Onlineregistrierung – das wurde heute schon gesagt – im Zusammenhang mit bereits vorhandenen Daten sind wichtige Punkte, die gerade in Zukunft im Auge behalten werden müssen.
Meine Damen und Herren, es geht da um die Zukunft eines internationalen Vergleichs unseres hervorragenden Gesundheitssystems. Wir sind auf dem richtigen Weg. Danke, Frau Minister! Ich glaube, meine Damen und Herren, dass wir alle mit diesem Gesetz zufrieden sein können. Wir stimmen sehr gerne zu. – Danke schön. (Beifall bei ÖVP, SPÖ und Grünen.)
13.59
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Als Nächste ist Frau Bundesministerin Dr. Rendi-Wagner zu Wort gemeldet. – Bitte.
13.59
Bundesministerin für Gesundheit und Frauen Dr. Pamela Rendi-Wagner, MSc: Frau Präsidentin! Hohes Haus! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich darf ganz kurz an die Redebeiträge anschließen und möchte Ihnen sagen, dass ich gerade von der Veranstaltung „7. Tag der Gesundheitsberufe“ komme, die im Gesundheits- und Frauenministerium stattfindet.
Auch dort wurde dieses Thema diskutiert und ein klarer Bezug zwischen der Einführung dieses Registers und der Verbesserung der Qualität – was die Gesundheitsberufe betrifft – hergestellt. Ich darf mich auch dem Dank an Sie für die gestrige Enquete anschließen, die dieses Thema der Wertschätzung und des Werts der Gesundheitsberufe, vor allem in der Pflege, im Bereich des österreichischen Gesundheitssystems unterstrichen hat, auch die Bedeutung dessen, dass wir da dranbleiben müssen und weitere Verbesserungen, was die Rahmenbedingungen betrifft, schaffen müssen.
Nun zur vorliegenden Novelle: Ja, Sie haben recht, das Gesundheitsberuferegister-Gesetz wurde im Sommer 2016 beschlossen und ist im September 2016 in Kraft getreten. Warum jetzt eine Novelle? Warum war sie notwendig? – Das darf ich ganz kurz skizzieren; die meisten haben das schon ausgeführt.
Es ist im Zuge der Vorbereitungsarbeiten offensichtlich geworden, dass die Registrierungsbehörden am Anfang mehr Zeit dafür brauchen, die eingehenden Daten oder die Anträge für das entsprechende Register zu bearbeiten, und deswegen eine längere Entscheidungsfrist benötigen. Das wurde in diese Novelle aufgenommen.
Darüber hinaus ist es so, dass der Hauptverband, der die Daten auch übermittelt, diese erst zu Jahresbeginn übermitteln kann. Das wäre dann zu Beginn 2018, und damit kann die wirkliche Arbeit im Zusammenhang mit diesem Register erst etwa ein halbes Jahr später aufgenommen werden. Daher erfolgt eine Verschiebung des Beginns der Registrierungspflicht auf 1. Juli 2018. Das Startdatum musste also aufgrund dieser notwendigen technischen Arbeiten, die auch in diesem Zeitraum notwendig sind, auf Juli 2018 verschoben werden.
Eines ist mir wichtig, und das wurde auch in dieser Novelle berücksichtigt: Eine Gebührenbefreiung bei der Registrierung war ein großer Wunsch und ein großes Anliegen der Vertreterinnen und Vertreter der Gesundheitsberufe. Dem wurde Rechnung getragen, und diese Befreiung wurde in die Novelle aufgenommen.
In diesem Sinne denke ich, ja, das Gesetz hat einen längeren Weg gehabt als vielleicht manch anderes, aber umso wichtiger ist es aus meiner Sicht. Es ist ein wichtiges Gesetz, daher soll die Umsetzung einwandfrei funktionieren, und daher sollte man sich für
diese notwendigen Änderungen, die es für eine einwandfreie Umsetzung braucht, Zeit nehmen. Das haben wir mit dieser Novelle vollzogen. – Vielen Dank. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.)
14.02
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Vielen Dank, Frau Bundesministerin.
Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir gelangen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit, der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Apothekerkammergesetz 2001 geändert wird (1467 d.B. und 1549 d.B. sowie 9776/BR d.B.)
14. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz geändert wird (2033/A und 1550 d.B. sowie 9750/BR d.B. und 9777/BR d.B.)
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Nun gelangen wir zu den Punkten 13 und 14 der Tagesordnung.
Berichterstatterin zu beiden Punkten ist Frau Bundesrätin Ebner. Ich bitte um die Berichte.
Berichterstatterin Adelheid Ebner: Frau Präsidentin! Frau Bundesministerin! Ich bringe den Bericht des Gesundheitsausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Apothekerkammergesetz 2001 geändert wird.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor; ich komme daher sogleich zur Antragstellung.
Der Gesundheitsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 4. April 2017 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Der zweite Bericht des Gesundheitsausschusses erfolgt über den Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz geändert wird. Der Bericht liegt Ihnen ebenfalls in schriftlicher Form vor; ich komme daher sogleich zur Antragstellung.
Der Gesundheitsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 4. April 2017 mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Vielen Dank für die Berichte.
Wir gehen in die Debatte ein.
Als Erste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Ecker. – Bitte.
14.04
Bundesrätin Rosa Ecker (FPÖ, Oberösterreich): Sehr geschätztes Präsidium! Sehr geschätzte Frau Minister! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebes Publikum! In aller Kürze, wie schon im Bericht gehört, die Änderungen zum Apothekerkammergesetz: Einführung einer Haushaltsordnung, Änderungen in der Aspirantenausbildung und in der abzuschließenden Berufshaftpflicht, und der Disziplinaranwalt wird künftig auf fünf Jahre bestellt. Das ist eine zeitgemäße Vorgangsweise, dagegen gibt es nichts zu sagen. Der Gesetzentwurf findet auch unsere Zustimmung.
Beim Tagesordnungspunkt 14, Änderungen zum Sozialversicherungsgesetz, schaut die Sache schon ein bisschen anders aus, und zwar in der Art und Weise, wie vorgegangen wurde. Es wurde einfach während einer laufenden Nationalratsdebatte zu diesem Tagesordnungspunkt ein gesamtändernder Abänderungsantrag zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz eingebracht. Da wird wirklich offensichtlich, mit welcher Wertschätzung – nämlich im negativen Bereich der Skala – man der Opposition entgegentritt.
Neue und teure Medikamente dürfen in Österreich nicht mehr als im EU-Schnitt kosten. Auch für Generika und die sogenannten Biosimilars soll es eine Regelung geben. Dafür wurde vom Hauptverband 14 Monate mit der Pharmaindustrie verhandelt.
Total ungewöhnlich ist – das erleben wir ja in diesen Zeiten sonst nicht –: Die ÖVP und die SPÖ, unsere Regierungsparteien, einigten sich einvernehmlich und so schnell, dass man die Oppositionsparteien nicht mehr informieren konnte. Die anderen Parteien sollen dann in dieser Nationalratssitzung den Text lesen, sich vielleicht die Auswirkungen zusammenreimen und dann womöglich auch noch zustimmen. Also wenn das auch ein New Deal ist – nicht mit uns! (Beifall bei FPÖ und Grünen.)
Meine Damen und Herren, das kann es ja wirklich nicht sein! Das ist eine Vorgangsweise, die im Herzen, glaube ich, eigentlich niemand hier billigt. So geht man nicht mit einer Partei um, die im Land auch mitgestalten darf. Außerdem gibt es gültige Verträge mit der Pharmaindustrie, die sowieso erst ein Jahr laufen. Wo bleibt da die Rechtssicherheit für die Zukunft, wenn man etwas verhandelt?
Heilende und lindernde Medikamente müssen für Patienten verfügbar sein. Dafür ist zu sorgen, das ist ganz klar. Man hört aber auch immer wieder von teuren Medikamenten, etwa von Zusatztherapien für Chemotherapien, die von der Sozialversicherung nicht bezahlt werden. Die Patienten müssen dafür selbst aufkommen, so sie es sich leisten können. Da wird bei Menschen gespart.
Wir sind davon überzeugt – und wir haben das schon oft genug gesagt –, dass endlich einmal bei den Sozialversicherungen selbst angesetzt werden muss. Es kann nicht so sein, dass immer nur bei den Patienten und in der Ärzteversorgung gespart wird. Wir sehen, wo das hinführt. Wir haben im Rahmen von Sitzungen – ich bin seit gut eineinhalb Jahren im Bundesrat – schon sehr, sehr oft davon gesprochen, dass wir einen Ärztemangel haben. Wir hören immer wieder von langen Wartezeiten bei CT- und MRT-Untersuchungen. Da könnte ich auch Geschichten aus der eigenen Familie erzählen, wovon ich jetzt aufgrund der vorliegenden, noch längeren Tagesordnung absehe.
Zusammengefasst: Auch wenn es sachlich eine gerechtfertigte Änderung ist – dass Regierungsvorhaben einfach in Form eines gesamtändernden Abänderungsantrags eingebracht und durchgedrückt werden, können wir nicht akzeptieren. (Beifall bei der FPÖ.)
14.08
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Gruber-Pruner. – Bitte, Frau Bundesrätin.
14.08
Bundesrätin Mag. Daniela Gruber-Pruner (SPÖ, Wien): Hohes Präsidium! Werte Frau Ministerin! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Besucherinnen und Besucher! Mit diesem vorliegenden Gesetz soll also das Apothekerkammergesetz 2001 geändert werden. Es werden einige zeitgemäße Anpassungen vorgenommen, die der modernen Zeit entsprechen, und es gibt auch redaktionelle Klarstellungen. Einige Regelungen werden vereinfacht und inhaltlich präzisiert, um schlussendlich auch die Vollziehung zu vereinfachen. Meine Vorrednerin hat das zum Teil bereits ausgeführt.
Es wurden auch Anregungen des Rechnungshofes berücksichtigt, und zwar dahin gehend, dass sich auch die Apothekerkammer – wie übrigens alle anderen Kammern – eine Haushaltsordnung geben muss, dass Kundmachungen im Rahmen des Wahlverfahrens auf der Homepage der Kammer getätigt werden müssen oder dass Anfechtungen von Wahlen der Apothekerkammer direkt beim Verfassungsgerichtshof eingereicht werden können. All diese Dinge entsprechen einem modernen Gesetz, darum stimmt meine Fraktion diesem Gesetz natürlich gerne zu.
Der zweite Teil, in dem es um die Änderung im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz geht, ist eine wesentliche Veränderung. Es hat auch hierzu einige Monate lang Verhandlungen gegeben. Diese waren, wie man gehört hat, recht intensiv und auch recht kontroversiell, aber es geht um ein Thema, das speziell für die PatientInnen von äußerster Wichtigkeit ist, nämlich um den Zugang zu modernen und sicheren Arzneimitteln, darum, dass PatientInnen bei Bedarf auf hochwertige Medikamente zurückgreifen können, und zwar – das ist ein wichtiger Punkt – zu vernünftigen Preisen.
Das ist aus meiner Sicht schlussendlich auch eine Frage der Chancengerechtigkeit in unserem Gesundheitssystem. Nur als Beispiel, um die Tragweite zu veranschaulichen: In Österreich geben die Krankenkassen, am Beispiel des Jahres 2016, rund 3,5 Milliarden € für Medikamente aus. Es geht dabei also um finanzielle Summen, die schon enorm sind, und umso bedeutender ist da natürlich die Preisgestaltung bei Medikamenten.
In Österreich regelt der Erstattungskodex, welcher Preis von den Krankenkassen für ein Medikament zu bezahlen ist. Es gibt einige Pharmaunternehmen – man kann sie durchaus als Pharmariesen bezeichnen –, die sich weigern, dass ihre hochpreisigen Medikamente in diesen Kodex aufgenommen werden. Und warum? – Natürlich damit sie weiterhin die Hoheit über die Preisdefinition behalten können.
Ich denke aber, im Interesse aller PatientInnen müssen wir einfach an der bisherigen Preispolitik festhalten. Es muss um eine transparente und nachvollziehbare Preisgestaltung gehen, die auch mit der Finanzierbarkeit und der Rechtssicherheit unseres Gesundheitssystems zu tun hat. Im Gesundheitsministerium wurde eine Preiskommission eingerichtet, die regelmäßig überprüfen soll, wie der EU-Durchschnittspreis für ein und dasselbe Medikament ausgestaltet ist. Dieser Preisdurchschnitt soll dann quasi bindend für den Hauptverband sein. Das passt natürlich der Pharmaindustrie nicht so ganz, das ist logisch, aber ich denke, nur so kann diese Preisgestaltung reguliert werden. Das ist uns sehr wichtig.
Ich denke, wir übernehmen mit diesem Beschluss eine Verantwortung, nämlich dafür, dass die Sicherstellung und auch die Verlässlichkeit unseres Gesundheitssystems weiterhin gewährleistet bleiben. – Danke schön. (Beifall bei SPÖ, ÖVP und Grünen.)
14.12
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Köll. Ich erteile dieses.
14.13
Bundesrat Dr. Andreas Köll (ÖVP, Tirol): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Geschätzte Frau Bundesminister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Von meinen beiden Vorrednerinnen, Frau Ecker und Kollegin Pruner, wurde bereits einiges zu diesem Thema gesagt.
Ich kann natürlich, Frau Kollegin Ecker, nicht darauf eingehen, wie die Befindlichkeiten einzelner Fraktionen im Nationalrat waren. Hier im Bundesrat haben wir glaublich eine etwas andere Gesprächskultur, da ist das alles, glaube ich, etwas besser nachzuvollziehen. (Zwischenruf der Bundesrätin Mühlwerth.) – Meistens, sagen Sie, Frau Mühlwerth? Das glaube ich nicht, ich glaube immer.
Zum Apothekergesetz ist nicht viel zu sagen, da es sich hauptsächlich um redaktionelle Verbesserungen handelt, um gewisse Adaptierungen, die durchaus nachvollziehbar sind.
Das zweite Thema ist sicher etwas komplexer. Ich als Obmann eines Rechtsträgers, des Gemeindeverbandes Bezirkskrankenhaus Lienz, kann natürlich sagen, dass die Medikamentenkosten bekanntlich zu den größten Kostentreiberinnen im öffentlichen Gesundheitswesen zählen. Es ist sicherlich sinnvoll, auf europäischer Ebene gewisse Kostenvergleiche durchzuführen und auch durch zentralen Einkauf, beispielsweise jetzt bei den Krankenanstalten, aber auch bei den Apotheken und anderen Bereichen, letztendlich zu günstigeren Preisen beizutragen.
Es ist ja bekannt, dass die Pharmaindustrie nicht gerade zu den notleidendsten Branchen zählt – nicht in Europa und auch nicht in Österreich. Es ist natürlich auch wichtig, den Standort zu sichern, aber die Wahrheit liegt bekanntlich immer in der Mitte. Und es ist im Interesse unserer Patientinnen und Patienten, wenn die Medikamentenkosten generell gesenkt werden können, obwohl es im Einzelfall wieder zu Problemen kommen könnte, wenn man trotz ethischer Gründe Medikamente aus Kostengründen nicht genehmigen würde.
Letztendlich ist das aber ein sehr großes Beziehungsgeflecht, und andererseits muss man auch wieder sagen, dass dann natürlich auch die Sozialversicherungsbeiträge steigen würden, was letztendlich auch wieder Arbeitgeber und Arbeitnehmer treffen würde. Man muss das also als Gesamtthema sehen.
Die Regelung selbst erscheint uns, unserer Fraktion, als durchaus sinnvoll. Wenn auch diese periodische Überprüfung, was diesen Erstattungskodex betrifft, durch das Gesundheitsministerium stattfindet, dann sollte da nicht viel passieren. Ich darf also namens meiner Fraktion empfehlen, diese beiden Gesetzesvorlagen nicht zu beeinspruchen. – Danke. (Beifall bei ÖVP, SPÖ und Grünen.)
14.16
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Ich darf nun die zweite Gruppe, die Schülerinnen und Schüler der Handelsakademie Hollabrunn, sehr herzlich bei uns im Bundesrat begrüßen. (Allgemeiner Beifall.)
Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Reiter. – Bitte.
14.16
Bundesrätin Dr. Heidelinde Reiter (Grüne, Salzburg): Wir werden dem Apothekergesetz zustimmen. Wir werden auch dem zweiten Gesetz zustimmen.
Die Vorgangsweise wurde von uns nicht begrüßt und wurde auch entsprechend kritisiert. Ich glaube, gerade dieses Thema ist ein sehr sensibler Bereich: Die Preise von Medikamenten, und die Frage, wer was unter welchen Bedingungen bekommt. – Das ist ein sehr sensibler Bereich, und die Fragen hinsichtlich des Umgangs damit sind, glaube ich, nur lösbar, wenn das Thema sehr breit diskutiert wird. Transparenz in diesem Bereich und Diskussion darüber halten wir also für notwendig, nicht nur auf politscher, sondern auch auf öffentlicher Ebene.
Dass das hier nicht einmal auf politischer Ebene erfolgt ist, sondern dass das mit diesem Abänderungsantrag ins Parlament gekommen ist, ohne die Möglichkeit, es breit zu diskutieren, halte ich für einen Nachteil, auch für die Fragestellung und für das, was
man erreichen will. Die Regelung an und für sich halten wir jedoch für gut und vertretbar. Ich bitte nur darum, dass sozusagen auch vonseiten Ihres Ministeriums mit diesen Fragen entsprechend umgegangen wird, was die Öffentlichkeit betrifft.
Die Probleme, die das für die Kostenträger verursacht, für die im Krankenhaus Beschäftigten, auch für die Ärzte in ihrer Verschreibungspraxis, sind bekannt. Das kann aber nur in einer breiten öffentlichen Diskussion entsprechend transportiert und vermittelt werden und so auch einer Entscheidung zugeführt werden.
Es ist aber, glaube ich, notwendig, dass es auch Preisvergleiche innerhalb Europas gibt, denn Pharmakonzerne haben eine Größenordnung und eine Durchsetzungskraft, denke ich, die sehr groß ist, auch in ihrem Marketing und so weiter. Da muss man die Kräfte bündeln, um sich durchzusetzen oder um eben zu erreichen, dass Medikamente zu einem vernünftigen, fairen, vertretbaren Preis zur Verfügung gestellt werden und die Menschen darauf Zugriff haben.
Es ist klar, dass die Pharmaindustrie immer damit argumentiert – und das ist ja auch richtig –: Es steckt sehr viel Forschungsarbeit drinnen, es ist sehr kostenintensiv, diese Dinge zu entwickeln, zu testen und zur Marktreife zu bringen. Ich glaube aber trotzdem, dass es gilt, diese Interessen im Sinne eines fairen Preises zueinanderzubringen. Das kann nur in internationaler Zusammenarbeit geschehen.
Ich glaube, dass da sehr wohl auf beiden Seiten das Know-how gebündelt werden muss, auch international, um die Entwicklung nicht aufzuhalten, sondern voranzutreiben, und eben für die Patienten sicherzustellen, dass sie Zugang zu entsprechenden Medikamenten haben – zeitgerecht, zu fairen Preisen und gerecht.
Ich glaube, es ist notwendig, sich weiter darum zu bemühen, und ich bitte Sie, das auch zu tun, aber die Regelung, so wie sie jetzt ist, ist, glaube ich, gut und findet unsere Zustimmung. (Beifall bei den Grünen sowie bei Bundesräten von ÖVP und SPÖ.)
14.20
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Zu Wort gemeldet hat sich nun Frau Bundesministerin Dr. Rendi-Wagner. – Bitte.
14.20
Bundesministerin für Gesundheit und Frauen Dr. Pamela Rendi-Wagner, MSc: Frau Präsidentin! Hohes Haus! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte vor allem zu Tagesordnungspunkt 14 betreffend die Novelle des ASVG Stellung beziehen, weil es mir wirklich wichtig ist, die Bedeutung dieses Antrags für das österreichische Gesundheitssystem zu unterstreichen. Die Menschen in diesem Land müssen sich darauf verlassen können, dass sie, wenn sie krank sind, Zugang zu innovativen, modernen und vor allem leistbaren Medikamenten haben. Dass das keine Selbstverständlichkeit ist, zeigt der Blick über die Grenzen. Es gibt einige europäische Länder, in denen das nicht der Fall ist, auf deren Märkten keine innovativen Arzneimittel zu finden sind, weil die Firmen gar nicht erst versuchen, dort Marktzulassungen zu erreichen, weil sie wissen, dass sich diese Länder diese Arzneimittel ohnehin nicht leisten können.
In Österreich liegt der Arzneimittelpreis über dem EU-Durchschnittspreis. Genau aus dieser Logik heraus war es notwendig, möglichst rasch Verhandlungen mit der Pharmaindustrie zu führen, und genau aus diesem Grund waren diese Verhandlungen auch nicht ganz einfach. Sie haben sehr lange gedauert, es wurde sehr ausgiebig diskutiert, und es war bis zur letzten Sekunde nicht klar, ob es tatsächlich noch gelingen wird, im Sinne der Patientinnen und Patienten dieses Landes eine Einigung auf parlamentarischer Ebene zwischen den Parlamentsklubs und auch unter Moderation meines Hauses herzustellen.
Diese Einigung ist deswegen so bedeutend und wichtig, weil es um das Thema Planbarkeit geht, um die Finanzierbarkeit, um das Thema Versorgungssicherheit, und das sind ganz wichtige Schlüsselelemente im Gesundheitssystem, die nicht nur wir und die Sozialversicherung, die ja als Finanzier auftritt, brauchen, sondern – und das ist mir auch ganz klar; Sie haben ja auf der anderen Seite auch gerade die Industrie hervorgestrichen – die natürlich auch die Industrie braucht, vor allem wenn es um das Thema Rechtssicherheit und Planbarkeit geht. Und diese Einigung schafft das auch: für die Pharmaindustrie das Thema Planbarkeit zu konkretisieren und auf den Tisch zu legen.
Ich glaube, dass es uns damit wirklich gelungen ist, einer Entwicklung, die wir in diesem Bereich auf europäischer und internationaler Ebene erkennen können, adäquat zu begegnen. Ich kann Ihnen versichern – ich war erst vor zwei Wochen beim EU-Ministerrat in Malta –, dieses Thema ist auch auf europäischer Ebene zwischen den Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsministern enorm wichtig, und Österreich steht in Kooperation mit einigen Ländern, die eben zusammenarbeiten wollen, um diesem Thema auf europäischer Ebene gebündelt zu begegnen. Wir treten also einer gewissen Staatengemeinschaft, der sogenannten Beneluxer Gruppe, bei, die sich seit der EU-Präsidentschaft der Niederlande mit dem Thema sehr intensiv und fortschrittlich befasst. Wir treten dieser Gruppe bei, um diesem Thema auch auf europäischer Ebene mit gebündelter Kraft zu begegnen, denn es ist klar: Das sind internationale Konzerne – und wir sind natürlich auf europäischer Ebene noch stärker als auf nationaler Ebene. – So viel zu Ihrem Vorschlag, sich da auch international aufzustellen, Frau Bundesrätin Reiter, der natürlich mehr als vernünftig und zweckmäßig ist.
Es ist aber auch äußerst wichtig, die Entwicklung auf nationaler Ebene aufmerksam zu verfolgen. Sie haben sicher die Preisentwicklungen einiger Medikamente in den letzten Jahren verfolgt. Da gab es die einen oder anderen – ich möchte jetzt hier im Parlament keine Namen und schon gar keine Hersteller nennen – spezifischen Arzneimittel, die in der Preisentwicklung einem Paradigmenwechsel unterlegen sind. Es kam zu Preisentwicklungen, die es vorher in keinem Land weltweit gegeben hat. Wenn wir dieser Entwicklung nicht mit adäquaten Regeln, Verträgen und Verhandlungen, die wir diesbezüglich vollzogen haben, begegnen, dann sind wir ausgeliefert und riskieren die Nichtfinanzierbarkeit des österreichischen Gesundheitsversorgungssystems oder auch den Umstand, dass Patientinnen und Patienten in diesem Land keinen Zugang mehr zu innovativen, neuen – und das sind ja die teuren – Arzneimitteln haben.
Genau deswegen waren diese Verhandlungen notwendig. Und ja, sie waren hart, ja, deren Ausgang war bis zur letzten Sekunde ungewiss. Deshalb konnte wahrscheinlich auch das Housekeeping dieses Parlaments nicht in dem Sinne eingehalten werden, wie das auch aus meiner Sicht notwendig gewesen wäre, um einen ausreichenden Diskurs dazu zu führen. Es war aufgrund dieser schweren, dieser schwierigen Verhandlungen einfach eine Notwendigkeit, diese Gespräche rasch zu führen, sonst hätten wir wieder Zeit verloren, die sehr kostbar ist. Ich glaube, dass diese Einigung im Sinne der Versorgungssicherheit des österreichischen Gesundheitssystems ein gutes Ergebnis darstellt, und ich freue mich über Ihre breite Zustimmung dazu. – Danke schön. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.)
14.25
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Vielen Dank, Frau Bundesministerin.
Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Die Abstimmung erfolgt getrennt.
Wir gelangen zunächst zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Apothekerkammergesetz 2001 geändert wird.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist Stimmeneinhelligkeit, der Antrag ist somit angenommen.
Nun kommen wir zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz geändert wird.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit, der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das E-Government-Gesetz, das Zustellgesetz, das Bundesgesetz über die Ausstellung der Apostille nach dem Übereinkommen zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von der Beglaubigung, die Bundesabgabenordnung, das Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz 2010, das Neugründungs-Förderungsgesetz, das Unternehmensserviceportalgesetz, das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, das GmbH-Gesetz, das Notariatstarifgesetz, das Gerichtsgebührengesetz, das Arbeitszeitgesetz, das Arbeitsruhegesetz, das Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz, das Bäckereiarbeiter/innengesetz 1996, das Mutterschutzgesetz 1979, das Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz 1987, das Gleichbehandlungsgesetz, das Heimarbeitsgesetz 1960, das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, das Behinderteneinstellungsgesetz, das Gesundheitstelematikgesetz 2012, das Arzneimittelgesetz, das Rohrleitungsgesetz und das Kraftfahrgesetz 1967 geändert werden (Deregulierungsgesetz 2017) (1457 d.B. und 1569 d.B. sowie 9747/BR d.B. und 9752/BR d.B.)
16. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz über die Grundsätze der Deregulierung (Deregulierungsgrundsätzegesetz) (1503 d.B. und 1570 d.B. sowie 9753/BR d.B.)
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Nun gelangen wir zu den Punkten 15 und 16 der Tagesordnung.
Berichterstatterin zu beiden Punkten ist Frau Bundesrätin Kern. Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatterin Sandra Kern: Hohes Haus! Sehr geehrte Frau Minister! Ich erstatte den Bericht des Ausschusses für Verfassung und Föderalismus über den Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz zur Deregulierung mit insgesamt 25 Gesetzesänderungen.
Der Bericht liegt in schriftlicher Form vor; ich darf deshalb gleich zur Antragstellung kommen:
Der Ausschuss für Verfassung und Föderalismus stellt nach Beratung der Vorlage am 4. April 2017 mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Weiters erstatte ich den Bericht des Ausschusses für Verfassung und Föderalismus über den Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz über die Grundsätze der Deregulierung.
Auch dieser Bericht liegt in schriftlicher Form vor; ich darf deshalb gleich zur Antragstellung kommen:
Der Ausschuss für Verfassung und Föderalismus stellt nach Beratung der Vorlage am 4. April 2017 mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Vielen Dank für die Berichte.
Wir gehen in die Debatte ein.
Als Erster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Samt. – Bitte, Herr Bundesrat.
14.28
Bundesrat Peter Samt (FPÖ, Steiermark): Frau Präsidentin! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Frau Bundesminister! Liebe Zuhörer und Zuseher! Das Deregulierungsgesetz 2017 ist eine sehr umfangreiche und sperrige Sammelnovelle, die insgesamt 25 Gesetzesänderungen umfasst; dieses sowie das Deregulierungsgrundsätzegesetz sollen für eine Reduktion von Bürokratie für Unternehmen und Bürger, für vereinfachte Verwaltungsabläufe und für mehr elektronische Kommunikation mit den Behörden sorgen. Es sind auch Fristen für einige Gesetzesvorlagen enthalten, die eine systematische Durchforstung der gesetzlichen Bestimmungen auf deren Notwendigkeit betreffen. – So steht es auch in den Vorblättern. Des Weiteren wird auch eine präzise Umsetzung von EU-Vorgaben, die in weiterer Folge nicht ohne darüber hinausgehende Regelungen in Österreich vonstattengehen sollte, verfolgt.
Natürlich sind einige Dinge in dieser Gesetzesnovelle durchaus begrüßenswert und machen durchaus auch Sinn. Der Rechtsanspruch auf elektronischen Behördenverkehr soll eingeführt werden und die Unternehmen ab dem Jahr 2020 zur Teilnahme an elektronischen Zustellungen verpflichten. Die Beweislast – und die Anmerkungen sind auch im Ausschuss schon besprochen worden –, dass man schlussendlich eine Benachrichtigung nicht bekommen hat, liegt bei einem selbst, beim Unternehmer selbst, und dadurch wird der Rechtsschutz unserer Meinung nach doch eingeschränkt.
Es wird Erleichterungen für Auto- und Motorradfahrer insofern geben, als sie bei einem Wohnungswechsel innerhalb des Zulassungsbezirkes keinen neuen Zulassungsschein mehr brauchen. Das ist natürlich durchaus begrüßenswert.
Die Gründung von Einzelunternehmen und kleinen GesmbHs soll künftig einfacher werden. Ist der Gesellschafter auch der einzige Geschäftsführer der Gesellschaft, so wird er ab 2018 keinen Notar mehr brauchen, sondern das Unternehmen per Bürgerkarte beziehungsweise Handysignatur registrieren lassen können. Voraussetzung in dem Fall ist, dass eben im Zuge der zu leistenden Stammeinlage, die bar bei der Bank zu hinterlegen ist, die Bank eine Identifizierung vornehmen muss. Auch alle weiteren Schritte des Gründungsprozesses – so lesen wir in dem vorliegenden Beschluss – sollten danach elektronisch und über das Unternehmensserviceportal USP abgewickelt werden.
Unsere Meinung dazu ist, dass es durchaus sinnvoll ist, den elektronischen Datenverkehr zu forcieren, aber, geschätzte Damen und Herren, wir erleben doch eigentlich laufend Hackerangriffe und Unsicherheiten vor allem im Bereich des Datenmissbrauchs, die durchaus Bedenken unsererseits in diese Richtung aufkommen lassen und es uns als heikel ansehen lassen, dass man Firmengründungen jetzt einfach per Handysignatur und Bürgerkarte vornehmen und den Notar als den bisherigen Firmengründer mehr oder weniger ausschalten kann.
Es ist auch sehr interessant, dass es dazu eine Stellungnahme der Notariatskammer gibt, die – so liest man dort – meint, dass der Entwurf in weiten Bereichen sehr allgemein gehalten ist und daher oftmals sehr unklar bleibt. Es steht auch drin, dass die Aus-
wirkungen in vielen Fällen gar nicht genau abgeschätzt werden können und dass die im Entwurf enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe die Konsequenzen der geplanten Vorhaben nicht wirklich erkennen und auch nicht seriös abschätzen lassen können.
Vor allem in Bezug auf die Firmengründungen sagt die Notariatskammer – und das ist auch für mich sehr interessant –, dass man bereits heute – bereits heute! – innerhalb von 48 Stunden mit einem Notar eine GesmbH gründen kann, im Sinne eines klassischen One-Stop-Shops, und dass auch bei diesen Gründungen keine weiteren Schritte oder behördlichen Stellen zur firmenbuchrechtlichen Durchführung notwendig sind.
Genau diese Stellungnahmen, geschätzte Damen und Herren, erhärten bei uns natürlich den Verdacht, dass es sich bei diesen sperrigen Sammelgesetznovellen – wir werden ja heute noch so eine verhandeln – um reine Scheinaktivitäten der Regierung handelt. Man sollte doch eigentlich als Staatsbürger davon ausgehen, dass jedes Ressort, jede gesetzgebende Körperschaft auch ohne eine gesetzliche Vorgabe in der Lage ist, Gesetzesvorschläge und Gesetzestexte zu entwerfen, und bezüglich deren Gesetzwerdung überlegt, ob diese notwendig ist oder nicht und vor allem, welche Auswirkungen sie hat.
Bezüglich der EU-Richtlinien wird auf das Gold Plating verzichtet, und dem kann man einiges abgewinnen. Viele Dinge, die Österreich in den letzten Jahren als Musterschüler der EU immer wieder durchgeführt hat, sind zum Teil überbordend durchgeführt worden, aber – und auch das gebe ich zu bedenken – viele EU-Richtlinien und -Vorgaben, die auf Österreich herabbröseln, sind eben nicht vollständig beziehungsweise bedürfen eindeutig einer zusätzlichen Gesetzgebung in Österreich oder einer Erweiterung oder Vertiefung. Wenn wir diese gesetzlichen Richtlinien, so, wie sie jetzt hier beschlossen werden sollen, durchführen, dann wird das nicht mehr möglich sein oder eben nicht mehr gemacht werden, dann wird auf dieses Recht verzichtet werden.
Auch bei „One in, one out“ – es gibt sehr interessante englische Wortkreationen – neigen wir ein bisserl zur Vorsicht. Nicht jedes Gesetz, das heute sozusagen auf den Markt kommt, wird ein anderes Gesetz ersetzen können. Deswegen finden wir auch diese Regelung nicht wirklich sehr sinnvoll.
Geschätzte Damen und Herren! Unsere kritische Haltung zum Deregulierungsgesetz und unsere Zustimmung zum Deregulierungsgrundsätzegesetz basieren eigentlich einzig und allein auf der Tatsache, dass in diesen Gesetzentwürfen nichts Falsches drinsteht, und Selbstverständlichkeiten kann man eben nicht wirklich ablehnen. – Danke schön. (Beifall bei der FPÖ sowie bei Bundesräten von ÖVP und SPÖ.)
14.35
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Beer. – Bitte.
14.35
Bundesrat Wolfgang Beer (SPÖ, Wien): Frau Präsidentin! Frau Ministerin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Beide jetzt vorliegenden Beschlüsse des Nationalrates haben mit Deregulierung zu tun. Kollege Samt hat schon ausgeführt, in wie vielen Bereichen dieses Gesetz zur Anwendung kommen wird. Es sind wirklich 25 Gesetze, die dereguliert und entbürokratisiert werden sollen. Es stand und steht ja immer der Vorwurf im Raum, dass alles zu kompliziert, zu teuer ist und außerdem alles viel zu lange dauert, antiquiert ist, rückständig und nicht modern ist. Mit diesen Gesetzesbeschlüssen werden wir Österreich moderner, schneller, leistungsfähiger und effizienter machen. Zu achten war darauf, dass diese Umstellung nicht von heute auf morgen erfolgen soll – kann sie auch nicht –, denn es werden Teile der Bevölkerung nicht an dem elektronischen Verkehr mit Behörden teilnehmen können.
Es gibt sehr viele Menschen, die jetzt schon diese Services in Anspruch nehmen. Denken wir nur an FinanzOnline! Sehr viele Menschen nutzen diesen Service, es gibt aber auch einige, die ihn ablehnen.
Im ersten Schritt werden Erleichterungen für Betriebe eingeführt. Natürlich kann auch der normale Bürger daran partizipieren, sich anmelden und den Service ebenso nutzen. Bis 2020 müssen Betriebe einer gewissen Größe verpflichtend am elektronischen Behördenverkehr teilnehmen. Es wird also in Zukunft möglich sein, RSa- und RSb-Briefe sowohl elektronisch als auch nach wie vor in Papierform – nämlich für diejenigen, die keine andere Möglichkeit haben – zu empfangen.
Deregulierung bedeutet eine Verwaltungsvereinfachung sowohl für die Betriebe als auch für den österreichischen Staat, sie bringt eine Kostenersparnis und auch eine Zeitersparnis. Elektronische Eingaben an Behörden werden ebenso möglich sein wie Beglaubigungen und das Erwirken einer Apostille. Viele wissen, wie schwierig es manchmal ist, von einer Behörde zur anderen zu laufen, um die richtige Bestätigung oder Beglaubigung zu erhalten. Österreich ist bei der Einführung des E-Government weltweit im oberen Drittel angesiedelt – die Regierung geht aber mit viel Feingefühl vor.
Ich habe schon erwähnt, dass es Menschen gibt, die keinen Zugang zu elektronischen Medien haben, sei es aus finanziellen Gründen oder eben auch aus Gründen des Verständnisses. Es wird daher noch einige Zeit dauern, bis alle den elektronischen Behördenverkehr nützen können. Bis dahin wird es aber auf jeden Fall den gewohnten Papierweg geben.
Da sich die Welt verändert und wir mit Riesenschritten in Richtung Digitalisierung schreiten, manchmal fast hineingestoßen werden, und weil so viele Menschen und auch viele Betriebe nicht dazu bereit sind und noch nicht angepasst sind, versucht der österreichische Staat da auch Hilfestellungen zu geben.
Da es zwar Vorteile, aber auch sehr viele Nachteile gibt, die durch diese elektronischen Verkehrswege entstehen – Kollege Samt hat bereits die Hackerangriffe und die möglichen Unsicherheiten im Netz angesprochen –, sind wir gefordert, in diesem Bereich gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die dies verhindern. Ich denke, dass es der Technik möglich sein wird, da sichere Systeme zu entwickeln.
Tun wir das alles nicht, dann werden wir ins Hintertreffen geraten und in nicht allzu ferner Zeit Entwicklungsländern gleichgestellt werden. Ich glaube nicht, dass das jemand will, und ich glaube auch nicht, dass unsere Jugend es verdient hat, vom weltweiten Markt ausgeschlossen zu sein. Es haben schon unsere Altvorderen gesagt: „Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.“ – Genau das müssen wir verhindern.
Wir beschließen auch noch das Deregulierungsgrundsätzegesetz, das wurde bereits ein wenig kritisch beleuchtet. Viele werden sagen: Das ist ein No-na-Gesetz. Warum brauchen wir das denn? Das musste doch schon immer so gemacht werden! Diese Überlegungen werden auftauchen, das ist gar keine Frage, aber das Abwägen, was notwendig ist und was wir brauchen, war schon immer eine Herausforderung. Es kommt ganz auf die Einstellung und auch auf die Klientel der verschiedenen Fraktionen und Parteien an, in welche Richtung ein Gesetz geht.
Ebenso muss man immer wieder überprüfen, ob alte Vorschriften und Gesetze noch zeitgemäß sind oder bereits obsolet. Während wir das hier zwar versucht haben – aber ich finde, in einem zu geringen Ausmaß –, gibt uns dieses Gesetz jetzt die Möglichkeit, das doch genauer zu überprüfen. Wir sind übrigens nicht der einzige Staat – weil die Frage in den Raum gestellt wurde, wofür wir das denn wirklich brauchen –, der solche Vorschriften hat. Neuseeland und auch Großbritannien haben ein ähnliches Gesetz. Dort ist es auch so, dass im gleichen Zug mit dem Erlassen von neuen Gesetzen alte Gesetze zu überprüfen und, falls nötig, auch aufzulassen sind.
Alles in allem sind das zwei sehr gute Gesetze, die unserem Staat eine Modernisierung garantieren. Wir dürfen bei dieser Entwicklung einfach nicht stehen bleiben, sondern müssen immer wieder weiterarbeiten und schauen, dass Österreich weiterhin zu den führenden Industriestaaten gehört. (Beifall bei der SPÖ und bei Bundesräten der ÖVP.)
14.43
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Reiter. – Bitte.
14.44
Bundesrätin Dr. Heidelinde Reiter (Grüne, Salzburg): Frau Präsidentin! Werte Kollegen und Kolleginnen! Die erste Gesetzesmaterie umfasst 25 Novellen aus sieben verschiedenen Ministerien; nur die Hälfte dieser Novellen wurde einer Begutachtung zugeführt. Im Nationalrat wurde dann zwei Stunden verhandelt, wobei nicht alle Experten und Ministerien vertreten waren. Ob sich die Deregulierungen bewähren, kann nicht wirklich seriös beurteilt werden, aber eines ist sicher: Der parlamentarische Gesetzgebungsprozess wurde damit massiv dereguliert – eigentlich eine ziemlich offensichtliche Missachtung des Parlaments, so wie da vorgegangen wurde.
In mir kommt der Wunsch auf, dass es zu diesem Zeitpunkt dieses „One in, one out“ schon gegeben hätte, denn es würde mich interessieren, was passieren würde, wenn man sich jetzt für alle diese 25 Novellen auf die Suche nach einem anderen Gesetz machen müsste, das man dann rausschmeißt. Also wie das die Entwicklung dieses Gesetzes beeinflusst hätte, das wäre eine ganz interessante Frage gewesen.
Einige Punkte finden ja durchaus unsere Zustimmung, die wurden auch schon erwähnt, andere hingegen sehen wir sehr kritisch, zum Beispiel die Änderung des E-Government-Gesetzes. Dass Gerichte und Behörden bis zum Jahr 2020 flächendeckend gerüstet sind, ist zu hoffen, dass aber Unternehmen zwingend den elektronischen Weg nutzen müssen, außer sie sind nicht umsatzsteuerpflichtig, sehen wir doch sehr kritisch, einerseits wegen der Kosten, andererseits aber auch wegen der notwendigen Aufmerksamkeit im E-Mail-Verkehr, die diese Unternehmen dann immer wieder aufbringen müssen. Das betrifft zum Beispiel die Änderung des Zustellgesetzes, wonach ein Schriftstück nach zwei elektronischen Verständigungen als zugestellt gilt. Es gibt keine subsidiäre postalische Zustellung mehr, die Beweislast über die Nichtlesbarkeit einer Nachricht liegt beim Adressaten, und das ist eine Einschränkung des Rechtsschutzes.
Offen sind auch in einigen Fällen datenschutzrechtliche Bestimmungen oder Überlegungen, zum Beispiel bei Einführung des Anzeigenmoduls, also einer Art elektronischer Tafel, worauf die Onlinezustellungen der diversen Behörden eingesehen werden können, oder eben der Entfall datenschutzrechtlicher Meldepflichten für alle mit ELGA verbundenen Gesundheitsdiensteanbieter; auch das sehen wir sehr kritisch.
Wir begrüßen die Vereinfachung der Gründung von Einzelunternehmen und Standard-GmbHs, da geschieht auch derzeit schon sehr viel, ebenso begrüßen wir die Erleichterungen für BürgerInnen bei Wohnsitz- und Namenswechsel. Da wir das aber nur gesamt abstimmen können und nicht einzeln, überwiegen bei uns diese Bedenken.
Noch einige Worte zum Deregulierungsgrundsätzegesetz: Vom Standpunkt der Deregulierung aus bin ich der Meinung, dass man sich dieses Gesetz einfach hätte sparen können, also das wäre auch ein One-out-Kandidat. Eine Begutachtung hat man sich gespart, ist ja auch nicht lang, die meisten Inhalte dieses Gesetzes gelten ja schon. Es gibt das Deregulierungsgesetz 2001 und auch die Deregulierungsgrundsätze im Bundeshaushaltsgesetz 2013, also die wesentlichen Bestimmungen gibt es dort eigentlich schon.
Einiges entbehrt einer gewissen Komik nicht: Ich habe eigentlich immer angenommen, selbst als Oppositionspolitikerin, dass eine Regierung Gesetze nicht aus Jux und Tol-
lerei erlässt, sondern weil sie sie für notwendig und zeitgemäß erachtet, und dass sie neue Regelungen für Unternehmen und BürgerInnen für gerechtfertigt und adäquat hält. Jetzt gibt es eigene Kommissionen, die sich das im Vorhinein überlegen müssen. – Also ich erachte das eigentlich als grundlegend für das politische Arbeiten und für die Gesetzgebung; die Notwendigkeit, das in dieser Form festzuhalten erschließt sich mir nicht. Es gibt ja auch noch Begutachtungsverfahren und auch im Rahmen der parlamentarischen Arbeit werden Gesetze daraufhin abgeklopft. Also: Was soll diese Vorschrift?
Bei unvermeidlichen Zusatzbelastungen geht die Regierung jetzt zur Kompensation auf die Suche nach vergleichbar intensiven Regulierungen und schafft diese ab – nach dem „One in, one out“-Prinzip. Was für ein seltsamer Basar wird da entstehen?
Zum Beispiel beim Gesundheitsberuferegister-Gesetz: Natürlich gibt es da Belastungen und Veränderungen für große Berufsgruppen, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, dass man sich da auf die Suche begibt, was man denen jetzt erleichtert, welche gesetzlichen Regelungen man da hinausschmeißt.
Zum Gold Plating: Bei der Umsetzung der Richtlinien der Europäischen Union ist schon derzeit darauf zu achten, dass die vorgegebenen Standards nicht ohne Grund übererfüllt werden; das gibt es ja schon. Das soll in Hinkunft für die Umsetzung aller Rechtsakte der Europäischen Union gelten, also auch für Begleitgesetze zu EU-Regelungen. Wir sehen das kritisch.
Die EU-Vorschriften sind immer nur der kleinste gemeinsame Nenner von allen EU-Staaten. Es kann in vielen Bereichen auch vorteilhaft sein, durch entsprechenden Druck Unternehmen in Österreich international zu Vorreitern und zu Leitbetrieben zu machen – denken wir an die Entwicklung innovativer Verkehrslösungen, an effiziente Energieproduktion, an den Bereich Naturschutz, in welchem es durch Übererfüllung gelingen könnte, sehr attraktive und wichtige Gebiete zu schaffen, an die Lebensmittelproduktion, wobei es unter Umständen politisch durchaus wünschenswert ist, zum Beispiel glyphosatfreie oder von Pflanzenschutzmitteln rückstandsfreie Lebensmittel anbieten zu können, auch wenn das noch nicht durch EU-Gesetze verlangt wird! Auch die Entwicklung der hohen Biostandards, GMO-Freiheit oder Ähnliches ist zu erwähnen, denn damit ist es gelungen, sich Marktvorteile zu holen. Also in der Umsetzung solcher Ideen über das Gold Plating hinauszugehen, kann durchaus auch vorteilhaft für den Unternehmensstandort Österreich sein, und sich das als solches durch solche Regelungen zu verbauen, sehen wir nicht als vorteilhaft an.
Die meisten Bestimmungen hier gibt es ohnehin schon. Wie schwach der wahre Wille zur Deregulierung ist, zeigt zum Beispiel die Reform der Gewerbeordnung, eine weitere Klärung der Bund-Länder-Beziehungen, die Bauordnungen, die wir in großer Zahl haben und bei welchen eine Deregulierung für viele Betriebe vorteilhaft wäre, aber auch im Gesundheitsbereich, im Schulbereich und im Bereich Arbeit würde mir viel für „out“ und nichts Neues für „in“ einfallen. Darum: Bitte, liebe Regierung, tun Sie es einfach, aber verschonen Sie uns und auch das Parlament mit solchen Scheinaktivitäten wie diesem Gesetz. (Beifall bei den Grünen und bei Bundesräten der FPÖ.)
14.52
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Dr. Brunner. – Bitte.
14.52
Bundesrat Dr. Magnus Brunner, LL.M (ÖVP, Vorarlberg): Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau Bundesministerin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Tun Sie es endlich! – Ja, das ist heute eben ein Schritt in die Richtung, dass wir etwas tun, und weitere werden folgen. (Heiterkeit bei Bundesräten der FPÖ.) Das, liebe Kollegin Reiter, verstehe
ich wirklich nicht ganz. Gerade heute tun wir ja mit diesen vielen Novellierungen sehr viel, und wenn ich gleich bei Ihren Ausführungen bleiben darf: Novellierung heißt nicht neues Gesetz, 25 Novellierungen bedeutet nicht 25 neue Gesetze, und das „One in, one out“-Prinzip gilt für neue Gesetze – nur so viel zur Klarstellung; das war, glaube ich, ein Missverständnis von Ihnen.
Eine moderne und effiziente Verwaltung ist jedenfalls die Voraussetzung für eine positive Entwicklung in wohl fast allen Bereichen, und es gilt eindeutig das Prinzip – und das setzen wir heute auch um – weniger ist mehr. Weniger Bürokratie ermöglicht schnellere und bessere Entscheidungen, sichert höhere Standards und sichert auch eine höhere Rechtsicherheit.
Ganz kurz möchte ich auf das vom Kollegen Samt angesprochene Thema eingehen, nämlich die vereinfachte Gründung von Ein-Personen-GmbHs. Mit dieser Lösung können Unternehmen einfacher gegründet werden, wobei es einem auch freisteht, ob beim Notar oder bei der Bank. An dieser Stelle muss man auch einmal den Notaren für das Entgegenkommen, das sie da leisten, Danke sagen. Es ist natürlich nicht prickelnd, wenn Einnahmemöglichkeiten zurückgefahren werden, aber zumindest jene Notare, mit denen ich im Vorfeld gesprochen habe, sehen schon die Vorteile im Sinne der Vereinfachung und der Beschleunigung von Verfahren für die Unternehmen insgesamt, die ja ihre zukünftigen Klienten sind. Ich glaube, die Kommunikation zwischen den zukünftigen Klienten und den Notaren funktioniert ganz gut, und darum haben die Notare das natürlich nicht mit großer Freude, aber schlussendlich dann doch mitgetragen.
Wir werden diese Maßnahmen beobachten. Wir werden sie drei Jahre lang beobachten und dann evaluieren, also mit Hilfe einer Sunset Clause schauen, ob es ein taugliches Modell ist oder nicht – wenn ja, kann man es auch weiterentwickeln, beispielsweise auch in Richtung einer elektronischen Identität, aber so weit sind wir noch lange nicht, und man muss dann sicher auch schauen, ob eine solche Identität auch sicher genug sein wird. 25 Gesetze – Kollegin Reiter hat es angesprochen – werden geändert, Frau Kollegin Reiter, geändert, nicht neu beschlossen!
Wir müssen die Gesetzesflut insgesamt eindämmen, darum geht es, glaube ich. Frau Kollegin, dass sich manche über gewisse Formulierungen lustig machen, das verstehe ich auch, ich finde Ihre Formulierungen zum Teil auch lustig, aber so lustig es für manche ist, so wichtig, so entscheidend und so ernst ist auch der Kern, nicht der Bundeskanzler Kern, sondern der Kern dieses Gesetzes, nämlich eben die Gesetzesflut einzudämmen (Bundesrätin Reiter spricht mit Bundesrat Tiefnig) – Sie hört mir zwar nicht zu, ich hätte es ihr aber gerne weiter erklärt; ich kann das vielleicht nachher noch machen –, das bedeutet, sich von Liebgewordenem zu trennen, aber auch von Dingen, die uns nur stören, die kompliziert sind.
Deswegen beschließen wir heute diese Regelungen: die „One in, one out“-Regelung – noch einmal, Frau Kollegin: One in, one out zielt nicht auf Novellierungen ab, sondern auf neue Gesetze; für jede neue Regelung soll also nach Möglichkeit eine alte abgeschafft werden –, die erwähnte Sunset-Clause-Bestimmung, aber auch die Vorgaben zur Vermeidung von Gold Plating.
Zum Gold Plating: Ja, da werden wir auch in Zukunft die Möglichkeit haben, wenn es Sinn macht, weiter zu gehen als die EU-Vorschriften, aber beim Großteil der EU-Regelungen und -Vorschriften, muss man sagen, ist ein Verbot des Gold Plating sicher sinnvoll.
Man kann natürlich auch, Kollege Samt, darüber diskutieren, wie eine „One in, one out“-Regelung auszusehen hat, und das ist in diesem Fall nicht sehr konkret, das muss ich zugeben, aber wichtig ist, dass der Aufwand für die Bürgerinnen und Bürger und für die Unternehmen geringer wird. Das muss am Schluss bei diesem „One in, one out“
rauskommen. Wie die Regelung dann umgesetzt wird, da haben Sie schon recht, ist noch etwas offen.
Insgesamt glaube ich, dass diese Gesetze zur Jahreszeit passen; wir machen sozusagen einen Frühjahrsputz. (Bundesrat Samt – erheitert –: Frühjahrsputz!) Wir hauen alte Sachen raus, wir lüften durch, wir entrümpeln und wir entstauben, das ist sicher wichtig. Die ÖVP hat vor einigen Wochen die Aktion „Kampf dem Amtsschimmel“ gestartet, und die heutigen Maßnahmen leisten wiederum, glaube ich, einen sehr wichtigen Beitrag dazu. Es werden weitere folgen, es werden natürlich auch weitere folgen müssen, weil ein moderner Staat auch dringend eine kostengünstige und effiziente Verwaltung braucht. – Danke. (Beifall bei der ÖVP, bei Bundesräten der SPÖ sowie der Bundesrätin Schreyer.)
14.57
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Die Abstimmung erfolgt getrennt.
Wir gelangen zunächst zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend ein Deregulierungsgesetz 2017.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Nun kommen wir zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend ein Deregulierungsgrundsätzegesetz.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Erwachsenenvertretungsrecht und das Kuratorenrecht im Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch geregelt werden und das Ehegesetz, das Eingetragene Partnerschaft-Gesetz, das Namensänderungsgesetz, das Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten, das Außerstreitgesetz, die Zivilprozessordnung, die Jurisdiktionsnorm, das Rechtspflegergesetz, das Vereinssachwalter-, Patientenanwalts- und Bewohnervertretergesetz, das Unterbringungsgesetz, das Heimaufenthaltsgesetz, die Notariatsordnung, die Rechtsanwaltsordnung, das Gerichtsgebührengesetz und das Gerichtliche Einbringungsgesetz geändert werden (2. Erwachsenenschutz-Gesetz – 2. ErwSchG) (1461 d.B. und 1528 d.B. sowie 9764/BR d.B.)
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Wir gelangen nun zum 17. Punkt der Tagesordnung.
Ich darf hiezu Herrn Bundesminister Dr. Brandstetter begrüßen. (Allgemeiner Beifall.)
Berichterstatter ist Herr Bundesrat Novak. – Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatter Günther Novak: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Ich bringe den Bericht des Justizausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Erwachsenenvertretungsrecht und das Kuratorenrecht im Allgemei-
nen Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt werden
und das Ehegesetz, das Eingetragene Partnerschaft-Gesetz,
das Namensänderungsgesetz, das Bundesgesetz über Krankenanstalten
und Kuranstalten, das Außerstreitgesetz, die Zivilprozessordnung, die Jurisdiktionsnorm, das Rechtspflegergesetz, das
Vereinssachwalter-, Patientenanwalts- und Bewohnervertretergesetz, das
Unterbringungsgesetz, das Heimaufenthaltsgesetz, die Notariatsordnung, die Rechtsanwaltsordnung, das Gerichtsgebührengesetz
und das Gerichtliche
Einbringungsgesetz geändert werden (2. Erwachsenenschutz-Gesetz
–
2. ErwSchG).
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor; ich komme daher gleich zur Antragstellung.
Der Justizausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 4. April 2017 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Danke für den Bericht.
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gelangt Herr Bundesrat Hammerl. – Bitte.
15.00
Bundesrat Gregor Hammerl (ÖVP, Steiermark): Sehr geehrte Frau Präsident! Sehr geehrter Herr Minister! Meine geschätzten Damen und Herren! Es liegt uns heute ein Entwurf eines Erwachsenenschutz-Gesetzes vor, welches das bestehende Sachwalterrecht neu regeln wird. Der Entwurf des Justizministeriums stellt Autonomie, Selbstbestimmung und Entscheidungshilfe für die Betroffenen in den Mittelpunkt. Derzeit gibt es in Österreich knapp 70 000 Frauen und Männer, die besachwaltet sind und laufend bis zum nächsten Jahr, bis das Gesetz im Juli in Kraft tritt, müssen alle Besachwalteten überprüft werden.
Meine Damen und Herren, ich glaube, das Gesetz, das wir heute beschließen, ist eines der wichtigsten Gesetze der letzten Jahre.
Zum Thema: Sachwalter – wenn ich dieses Wort höre, verbinde ich damit oft das Gefühl, dass man den Menschen, der besachwaltet wird, zur Sache macht. Aus dem in der Werbung gebrauchten Kürzel: der Mensch als Mittelpunkt, wird nämlich nur zu leicht die Haltung: der Mensch als Mittel – Punkt.
Die Konsequenzen des Gesetzes, meine Damen und Herren, gingen oft auch in diese Richtung – denken wir nur an die verschiedenen Skandale! – die mit einer Entmündigung von Menschen verbunden waren und in die Schlagzeilen von Medien gefunden haben. Denken wir nur an die leichte Demenz, wie einfach man damit in die Besachwaltung hineinkommen kann! So heißt es einmal: Nach dem Schlaganfall holte sich der Anwalt gleich das Haus, wobei der Anwalt auch gleich der Sachwalter war.
Besonders störte dabei die Tatsache, dass verschiedene Grade von Beeinträchtigungen gleich behandelt wurden. Man ging in der Bewertung davon aus, was die Menschen nicht können, und nicht von dem, was sie können, und danach wurden sie beurteilt und besachwaltet. So war dies zum Teil auch in Bezug auf das Behinderteneinstellungsgesetz, das davon ausgeht, was Menschen nicht können, und von diesem Punkt ein Arbeitsverhältnis zu gestalten versucht. Dabei bleiben viele Fähigkeiten und Talente auf der Strecke. (Vizepräsidentin Winkler übernimmt den Vorsitz.)
Insofern setzt das neue Gesetz goldrichtig an, wenn es schon in der Wahl der Begriffe diesen eingeschränkten Zugang über die Beeinträchtigung vermeidet. Jetzt heißt es Erwachsenenschutz-Gesetz und nicht Sachwalterrecht, und es wird nicht von Behinderten, sondern von betroffenen Personenoder Vertretenen gesprochen. Damit wird zum Aus-
druck gebracht, dass die Selbstbestimmung des Menschen als oberstes Prinzip geachtet wird, der Betroffene als Erwachsener und nicht als minderjähriges Kind betrachtet oder einer Sache gleichgestellt wird.
Diesem Anliegen, meine Damen und Herren, dient auch die Tatsache, dass es nunmehr nicht nur eine Kategorie von Vertretung gibt, nämlich den Sachwalter, der alle Bereiche der Vertretung innehat, sondern es gibt jetzt vier Kategorien von Vertretung, die den derzeitigen Sachwalter ersetzen und den Erfordernissen angepasst sind: die Vorsorgevollmacht, die gewählte Erwachsenenvertretung, die gesetzliche Erwachsenenvertretung und die gerichtliche Erwachsenvertretung.
Mit diesen Formen verschiedener Vertretungen kann den Grundsätzen Unterstützen statt entmündigen und Schluss mit der kompletten Entmündigung entsprochen werden. Es können damit nämlich die individuellen Bedürfnisse und Schutznotwendigkeiten Berücksichtigung finden. Vertreter sollen nach Möglichkeit die Menschen unterstützen und sie nicht entmündigen.
Die Vorsorgevollmacht wird dabei aus dem geltenden Recht übernommen, weil sie sich bewährt hat. Wenn der von der betroffenen Person definierte Vorsorgefall eintritt, übernimmt der Bevollmächtigte seine Aufgabe der Vertretung, die vom Gericht nur bei erkennbarem Widerspruch zwischen Vertreter und Vertretenem kontrolliert wird.
Meine Damen und Herren! Das Gericht schreitet also erst im Konfliktfall ein, etwa wenn es um eine Entscheidung das Leben betreffend geht. Die gewählte Erwachsenenvertretung soll eine Lücke im jetzigen Gesetz schließen. Eine Person kann auch dann einen Erwachsenenvertreter bestimmen, wenn sie nicht mehr voll geschäftsfähig ist. Dabei muss die Person die Tragweite einer Bevollmächtigung wenigstens in Grundsätzen abschätzen können und sich entsprechend verhalten. Natürlich muss dabei Täuschung möglichst ausgeschlossen werden.
Die gesetzliche Erwachsenenvertretung bedeutet die Vertretung durch nächste Angehörige. Diese Form der Vertretung verschafft dem nahestehenden Angehörigen weitergehende Befugnisse als bisher, unterliegt aber auch, anders als nach geltendem Recht, der gerichtlichen Kontrolle – Gott sei Dank. Dazu muss die Vertretung auch im Österreichischen Zentralen Vertretungsverzeichnis eingetragen sein, wie auch alle anderen Formen der Vertretung.
Der gerichtliche Erwachsenenvertreter ersetzt den bisherigen Sachwalter. Die Befugnisse, meine Damen und Herren, sind aber deutlicher als bisher auf bestimmte Vertretungshandlungen beschränkt.
Eine Erwachsenenvertretung für alle Angelegenheiten gibt es nicht mehr. Mit Erledigung der konkreten Aufgabe beziehungsweise spätestens drei Jahre nach der Bestellung endet die Vertretung. Dabei stellt der gerichtliche Erwachsenenvertreter das letzte Mittel dar, das erst nach Ausschöpfung aller anderen Mittel eingesetzt wird.
Meine Damen und Herren! Was ist noch zu bedenken? – Keine dieser Vertretungsarten führt zu einem automatischen Verlust der Handlungsfähigkeit der vertretenen Person. Damit sind der Person und der Situation angepasste Lösungen möglich. Die Autonomie der Person wird dadurch gestärkt, die Möglichkeiten der Selbstbestimmung damit erweitert.
Voraussetzung für die Wirksamkeit des Gesetzes ist, meine Damen und Herren, dass es genügend Menschen gibt, die die verantwortungsvolle Aufgabe der Erwachsenenvertretung wahrnehmen. Neben dieser Bereitschaft ist ein verstärkter Ausbau von geförderten Erwachsenenschutzvereinen notwendig. Solche Vereine haben nicht nur die Aufgabe, konkrete Vertretungsmandate zu übernehmen, sondern auch den Vertreterinnen und Vertretern beratend zur Seite zu stehen sowie in der Bevölkerung das Bewusstsein für die Autonomie der Person zu stärken.
Keine Person, meine Damen und Herren, darf zur Sache gemacht werden, über die man verfügt, sondern es müssen ihre Fähigkeiten gestärkt werden! Das zeigt sich im Besonderen in der Personenvorsorge bei medizinischen Behandlungen. Psychisch beeinträchtigte Menschen, die nicht mehr entscheidungsfähig sind, dürfen nur mit Zustimmung ihres Vertreters oder ihres Vereines behandelt werden, außer es ist Gefahr im Verzug. Zusätzlich müssen sie von der behandelnden Person über die Behandlung informiert und um ihre Meinung befragt werden.
Mit diesem Gesetz, meine Damen und Herren, sind also wesentliche Schritte hin zur Stärkung der Person gesetzt. Es ist allen zu danken, die an der Veränderung der Sichtweise mitgewirkt haben, im Besonderen ist unserem Herrn Justizminister Dr. Wolfgang Brandstetter für seine engagierte Umsetzung der neuen Sichtweise Anerkennung auszusprechen.
Mit dem Erwachsenenschutz-Gesetz ist ein Meilenstein für alle kranken Menschen in der Bevölkerung gesetzt. Sie brauchen nur nachzuschauen, wir sind das einzige Land von allen 28 EU-Ländern, die so ein Gesetz haben. Wir können stolz darauf sein, und wir stimmen alle diesem Gesetz gerne zu. – Herr Bundesminister, noch einmal ein großes, großes Danke! (Beifall bei ÖVP, SPÖ und Grünen.)
15.07
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächster ist Herr Bundesrat Weber zu Wort gemeldet. – Bitte.
15.07
Bundesrat Martin Weber (SPÖ, Steiermark): Sehr geschätzte Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Sehr geehrte Damen und Herren! Werte Kolleginnen und Kollegen! Mein Landsmann Gregor Hammerl hat schon sehr eindringlich das neue Gesetz gut erklärt, ich möchte mit dem Jahr 1916 beginnen. (Allgemeine Heiterkeit.)
Aus dieser Zeit stammt nämlich die damalige Entmündigungsordnung. Das Sachwalterrecht, das wir heute sozusagen ablösen, war 1980 das Folgegesetz dieser Entmündigungsordnung und zur damaligen Zeit ein sehr modernes, ja gar revolutionäres Gesetz. Nach drei Jahrzehnten jedoch genügen die Inhalte des geltenden Sachwalterrechts nicht mehr den heutigen Herausforderungen. Es gibt auch berechtigte gesellschaftspolitische und rechtspolitische Kritik. Entgegen den Erwartungen ist nämlich die Anzahl der Sachwalterschaften nicht zurückgegangen, sondern, ganz im Gegenteil, massiv gestiegen. Wir haben heute schon gehört, rund 70 000 Menschen sind bisher in Österreich besachwaltet. Demgegenüber gibt es eine viel zu geringe Anzahl an geeigneten Sachwaltern.
Auch die UN-Behindertenrechtskonvention, die in Österreich seit 2008 in Kraft ist, weist auf gewisse Defizite unseres Sachwalterrechts hin. Die Betitelung der Regelung der Sachwalterschaft mit dem Begriff Erwachsenenschutz-Gesetz – wir haben es heute schon gehört – ist eine wichtige Maßnahme und zeigt die richtige Richtung des neuen Gesetzes auf.
Dieses wichtige Thema stellen wir, salopp gesagt, auf völlig neue Beine. Es wird damit ein Paradigmenwechsel eingeleitet, weg von der Entmündigung, hin zur Ermächtigung.
Die Änderungen werden den Menschen mehr Selbstbestimmung ermöglichen, es wird die persönliche Eigenständigkeit und Freiheit gestärkt. Frei nach dem Grundsatz: So viel Unterstützung wie nötig und so viel Autonomie wie nur möglich.
In Zukunft soll die gerichtliche Rechtsvorsorge auf den Kern zurückgeführt werden, das ist die Vertretung von Menschen in rechtlichen Belangen.
Ansonsten gibt es noch die Erwachsenenvertretung. Da kann man sich die Erwachsenenvertreterinnen und -vertreter selber aussuchen, ob es die gesetzliche oder die gewählte Erwachsenenvertretung ist.
Ich bin sehr froh darüber, dass all jene, die bisher unter Sachwalterschaft gefallen sind, mit dem neuen Gesetz – dieses gilt ab 1. Juli 2018 – auch überprüft werden. Es wird überprüft, ob diese Maßnahme noch gerechtfertigt ist. Von diesen Clearingstellen, sozusagen von Mixed Teams, in denen jemand von der Justiz und auch jemand von der Sozialarbeit mit dabei ist, wird genau geprüft, wenn solche maßgeblichen Maßnahmen gesetzt wurden, die in die persönliche Freiheit eines Menschen eingreifen. Es ist doch oft so, dass es, wenn man einmal in den Mühlen des Gesetzes landet, sehr schwierig ist, wieder herauszufinden und herauszukommen.
Nun werden Maßnahmen gesetzt, die genau diese Menschen berücksichtigen. Es besteht die Möglichkeit, dass alle drei Jahre überprüft wird, ob die Sachwalterschaft noch gerechtfertigt ist.
Auch das Heimaufenthaltsgesetz, das sicherstellt, dass Kinder und Jugendliche bei unzulässigen Freiheitsbeschränkungen Schutz und Vertretung erhalten, ist Gott sei Dank in dieser Novelle enthalten. Dieser Punkt war in der eigentlichen Regierungsvorlage nicht enthalten, aber es ist wichtig, dass auch Heime und andere Einrichtungen, die zur Pflege und Erziehung Minderjähriger dienen, in diesem Gesetz miterfasst sind, speziell auch im Hinblick auf die Unterstützung für jene Menschen, die in der Vergangenheit leider Opfer in Heimen wurden; das ist ganz wichtig. Den Staatsakt „Geste der Verantwortung“, zu dem unsere Nationalratspräsidentin Doris Bures und unser Bundesratspräsident Mario Lindner geladen haben, werde ich wohl nie vergessen können, und ich glaube, wir alle sollen es auch nie vergessen.
Es gibt vier Arten der Erwachsenenvertretung, wir haben es heute schon gehört. Ich möchte nur ganz kurz zur Vorsorgevollmacht sprechen: Mit der Vorsorgevollmacht hat man die Möglichkeit, zu einem Zeitpunkt, zu dem man selber noch keine Beeinträchtigung hat, für die Zeit, in der man möglicherweise eine haben wird, vorzusorgen. Das heißt, jeder und jede kann selbst entscheiden, wie man mit ihr, mit ihm umgehen soll, etwa bei Fragen der medizinischen Versorgung, wenn Schwächen eintreten. Man kann sagen, wie man im einen oder im anderen Fall behandelt werden will. Davon sollte man Gebrauch machen. Das verstehen wir unter Selbstbestimmung.
Alle Erwachsenenvertreter, das heißt, die gewählten und auch die gesetzlichen, müssen dem Gericht regelmäßig über die Lebenssituation der betroffenen Personen berichten und auch Rechnung legen.
Das Reformkonzept beruht auf einem weiteren Ausbau, nämlich auf den durch die öffentliche Hand geförderten Erwachsenenschutzvereinen. Ihre Beratungsfunktionen werden ausgeweitet. Auch kann man von ihnen eine Vorsorgevollmacht errichten beziehungsweise einen Erwachsenenvertreter eintragen lassen. Die Erwachsenenschutzvereine werden de facto zur Drehscheibe der Rechtsfürsorge ausgebaut.
Ich hoffe, Herr Minister, dass die noch offenen Fragen der Finanzierung – der einzige Schatten, der auf diesem Gesetz liegt – geklärt und für die Zukunft auch gesichert und geregelt sind.
Alles in allem ist das Erwachsenenschutz-Gesetz ein großer und positiver Wurf. In diesem Gesetz werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass für zahlreiche Menschen mit einer psychischen Krankheit oder mit einer vergleichbaren Beeinträchtigung der Entscheidungsfähigkeit deutlich bessere und menschenwürdigere Lebensumstände geschaffen werden. Es ist ein wichtiges Gesetz, ein gutes Gesetz, das man ruhig auch so bezeichnen kann, das vor allem die Würde und die Rechte der Menschen bestmöglich wahrt. Ich danke allen, die zustimmen werden. – Danke. (Beifall bei der SPÖ und bei Bundesräten der ÖVP.)
15.15
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächster gelangt Herr Bundesrat Mag. Raml zu Wort. – Bitte, Herr Bundesrat.
15.15
Bundesrat Mag. Michael Raml (FPÖ, Oberösterreich): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Herr Minister! Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Erwachsenenschutz-Gesetz betrifft einen sehr, sehr heiklen Bereich. Es geht um die Fragen: Wie gehe ich mit Menschen um, die nicht oder nicht mehr die volle Einsichtsfähigkeit haben? Wie gehe ich mit Menschen um, die Dinge nicht mehr selbst regeln können?
Wir befinden uns da in einem Spannungsverhältnis: Auf der einen Seite haben wir die Selbstbestimmung, die wir alle hochhalten und schätzen, auf der anderen Seite haben wir aber die Schutzbedürftigkeit der Menschen. Wir wissen aus der Realität, dass gerade Menschen, die nicht mehr die volle Einsichtsfähigkeit haben, der Gefahr unterliegen, ausgenutzt zu werden. Da gibt es Menschen, die versuchen, einem Verträge anzudrehen, die man nicht einmal in einem völlig gesunden Zustand benötigen würde. Da gibt es Menschen, die überhaupt einen Schritt weitergehen und sich von Betroffenen Geld ausleihen oder ihnen sonst irgendwie Geld abknöpfen. Diese Menschen haben das nicht verdient, und es ist auch Aufgabe des Staates, da schützend einzugreifen.
Es wurde uns von meinen Vorrednern bereits sehr ausführlich und auch mit einem historischen Rückblick auf die Geschichte der Sachwalterschaft ein sehr guter Eindruck davon vermittelt, worum es bei diesem Gesetz geht. Ich kann mich kurzhalten: Wir werden dem Gesetzesbeschluss des Nationalrates unsere Zustimmung erteilen.
Ich habe aber ganz kurz ein paar kritische Anmerkungen oder auch Fragen an Sie, Herr Minister. Erstens sehen wir es kritisch, dass die gerichtliche Erwachsenenvertretung künftig auf drei Jahre beschränkt sein soll, wenn ich das richtig herausgelesen habe. Wir wissen aber natürlich, dass diese oftmals leider dauerhaft bis zum Tod eines Menschen notwendig ist. Wir sehen da die Gefahr eines drohenden bürokratischen Aufwandes: Zum einen ist das möglicherweise für die Familienangehörigen auch mit Kosten verbunden, aber zum anderen bedeutet das natürlich auch einen Aufwand für die Gerichte.
Zweitens: Bei der bisherigen Rechtslage hat man bei der derzeitigen Sachwalterschaft immer ein psychiatrisches Fachgutachten benötigt. Künftig soll dieses nur noch notwendig sein, denke ich, wenn der Richter es für notwendig erachtet oder auf Antrag der betroffenen Person. Wir sind nicht ganz davon überzeugt, dass das so zielführend ist. Da es sich bei dieser Materie eben um eine sehr heikle Angelegenheit handelt, wissen wir nicht, ob das im Sinne der Sache ist, wenn man das Gutachten nicht mehr verpflichtend vorsieht.
Drittens: Es ist offenbar im Vorfeld dieses Gesetzesbeschlusses zu mehreren Kostenschätzungen durch das Justizministerium gekommen, wobei mir von den Kollegen aus unserem Klub mitgeteilt wurde, dass zunächst eine sehr, sehr hohe Kostenschätzung durch das Justizministerium vorlag. Dann kam offenbar der Einwand des Herrn Bundesministers Schelling, dass der Gesetzesbeschluss unter diesen hohen Kosten nicht durchzuführen wäre, und man ist noch einmal im Justizministerium in sich gegangen und hat die Kosten auf rund ein Fünftel des ursprünglichen Betrages herunterkürzen können.
Sehr geehrter Herr Minister Brandstetter! Ich ersuche Sie daher, das Gesetz nicht nur zu Recht über den grünen Klee zu loben, sondern auch auf diese unsere Fragen einzugehen. – Vielen herzlichen Dank. (Beifall bei der FPÖ sowie des Bundesrates Todt.)
15.19
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächste gelangt Frau Bundesrätin Mag. Dr. Dziedzic zu Wort. – Bitte.
15.19
Bundesrätin Mag. Dr. Ewa Dziedzic (Grüne, Wien): Sehr geehrter Herr Bundesminister! Werte Frau Präsidentin! Geschätzte Kollegen und Kolleginnen! Ausnahmsweise gebe ich allen drei Vorrednern recht.
Auch wir sind der Meinung, dass das ein sehr, sehr wichtiges Gesetz ist, und ich beginne bei den terminologischen Änderungen, hinsichtlich derer wir der Meinung sind, dass diese tatsächlich notwendig waren und zum Inhalt haben, dass in Zukunft jenen Menschen mit mehr Wertschätzung begegnet wird, die Schutz, die Vertretung benötigen.
Der Ausbau der Vertretungsmodelle und auch der Alternativen zur Sachwalterschaft ist sicher eine gute Sache, genauso wie die Stärkung der Autonomie.
Wir finden auch, dass die Wirkungsdauer – Kollege Raml hat das angesprochen – von drei Jahren eine gute ist. Wir wissen, dass die derzeitige viel zu lang war, nämlich dann, wenn es um die Abklärung ging, inwiefern die Notwendigkeit überhaupt besteht und in welchem Ausmaß die Personen vertreten werden müssen.
Auch positiv zu bewerten ist, dass die vertretene Person in Zukunft selbst geschäftsfähig bleibt und dass es auch bei der gesetzlichen Erwachsenenvertretung Voraussetzung ist, dass diese ins Vertretungsverzeichnis aufgenommen wird.
Auch mehr Befugnisse für Angehörige bewerten wir positiv, müssen aber darauf achten, dass es nicht einen Mehraufwand für die Angehörigen bedeutet, das heißt, dass es nicht zu einer Verlagerung kommt, auch genau aus dem Grund, weil es eben künftig keine Vertretung für alle Angelegenheiten geben soll, sondern ein Splitting vorhanden sein wird.
Die gerichtliche Kontrolle wurde auch erwähnt; diese ist unserer Meinung nach auch ganz, ganz wichtig.
Was die Terminologien anbelangt, vielleicht noch eine Ergänzung, die ich vorhin vergessen habe, die uns aber auch im Nationalrat wichtig war. Da gab es einen Antrag – Sie werden sich vielleicht noch daran erinnern –: Da gäbe es schon noch ein paar Kleinigkeiten, die zu ändern wären, wie zum Beispiel, dass man „einsichts- und urteilsfähig“ durch „entscheidungsfähig“ ersetzt. Das sind zwar alles Terminologien, aber diese weisen darauf hin, dass es auch ein Anliegen der Politik ist, den Menschen so lange wie möglich diese Selbstbestimmung, diese Autonomie zu gewährleisten.
Zwei kritische Punkte gibt es natürlich schon von unserer Seite. Das eine betrifft die Finanzierung, die zweite Sache betrifft das Monitoring. Sowohl die vier Sachwaltervereine als auch die Vereinigung österreichischer Richterinnen und Richter gehen davon aus, dass es dabei zu einem Mehraufwand kommen wird. Ich weiß, Sie beurteilen das womöglich anders. Wir sind der Meinung, dass es, wenn man dieses Clearing wirklich ernst nimmt, wenn man diese gerichtliche Kontrolle ernst nimmt, wenn man sich sozusagen diese drei Jahre vor Augen hält, die eine häufigere Prüfung erforderlich machen werden, einfach finanzielle Mittel brauchen wird.
Wir wissen, dass Sie sich dahin gehend mit dem Finanzminister nicht so ganz einig waren. Wir wissen aber auch, dass es wahrscheinlich sehr schwierig ist vorherzusagen, welche Kosten am Ende de facto entstehen werden. Umso wichtiger ist es für uns, dass dieses Monitoring, diese Evaluierung sowohl dem Nationalrat als auch dem Bundesrat vorgelegt wird, damit wir uns anschauen können, ob sich das mit der Zeit bewährt hat, ob all diese Neuerungen auch sinnvoll gewesen und haltbar sind und inwiefern es notwendig wäre, mehr Geld in die Hand zu nehmen.
Machen wir das nicht, entsteht vielleicht der Eindruck oder könnte der Vorwurf im Raum stehen, dass dieses Gesetz auch dazu dienen sollte, ein bisschen gute Stimmung für
2018 zu machen. Wir wissen, da ist eine Prüfung durch das UN-Behindertenrechtskomitee vorgesehen, und ich glaube, wir wollen alle nicht, dass dieser Vorwurf überhaupt zustande kommt oder ans Tageslicht tritt, sondern dass wir alle hier gemeinsam dieses Erwachsenenschutz-Gesetz tragen und es hoffentlich so weit ausfinanziert sein wird, dass es tragfähig ist. – Vielen Dank. (Beifall bei den Grünen sowie bei Bundesräten von ÖVP und SPÖ.)
15.24
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesminister Dr. Brandstetter. – Bitte, Herr Minister.
15.24
Bundesminister für Justiz Dr. Wolfgang Brandstetter: Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren Bundesräte! Ja, auch ich bin in der angenehmen Situation, dass ich eigentlich allen Vorrednern recht geben kann. Ich gehe auch gerne auf die Fragen ein, die hier noch geäußert wurden, und auch auf die Bedenken.
Herr Bundesrat Raml hat gemeint, dass die Kontrolle alle drei Jahre unter Umständen zu bürokratisch sein könnte und es einen unnötigen Aufwand gäbe. Da muss ich sagen, das haben wir uns auch sehr gut überlegt, aber selbstverständlich muss man letztlich eine Entscheidung zugunsten der sicheren Kontrolle oder zugunsten der Verfahrensökonomie im Sinne von weniger Bürokratie treffen. In diesem Fall war für uns klar, das alle drei Jahre überprüfen zu lassen, was in vielen Fällen dann natürlich sehr rasch und sehr einfach sein wird, in eindeutigen Fällen. Das hatte für uns Priorität, und so gesehen, glaube ich, haben wir das auch entsprechend berücksichtigt.
Umgekehrt – und das betrifft jetzt den zweiten Punkt Ihrer Kritik, Herr Bundesrat Raml – haben Sie auch gemeint, ob es nicht sinnvoll oder zumindest kritikwürdig oder überlegenswert wäre, diese Begutachtungen hinsichtlich der Betroffenen vielleicht doch weiter verpflichtend zu machen; diese sollten nicht nur auf Antrag beziehungsweise von Amts wegen durch den Richter erfolgen. – Da haben wir jetzt genau den umgekehrten Effekt, Herr Bundesrat Raml. Diesbezüglich haben wir gemeint, man sollte eigentlich im Sinne der Verfahrensökonomie vorgehen und es dem Richter überlassen, allenfalls aus eigenem Antrieb, von Amts wegen oder eben auf Antrag einen Gutachter zu beauftragen.
Ich habe erst kürzlich, letzte Woche war das, ein Gespräch mit einem unserer Bezirksrichter gehabt, der mir gesagt hat, dass er nicht einsieht, dass er nach dem Unterbringungsgesetz zwingend eine Begutachtung bei Personen in Auftrag geben muss, die sich im Koma befinden. Diese sei aufwendig und koste Geld, und es wäre doch auch einfacher, wenn es in seinem Ermessen läge oder wenn man das nur auf Antrag des Patientenanwalts gestatten würde.
Ich habe das als sinnvolle Anregung aufgenommen, und das ist genau so ein Fall, bei dem man sagen kann: Na ja, da ist eigentlich die Abwägung zwischen Verfahrensökonomie und Sicherheit in Bezug auf die Ziele, die das Gesetz vorgibt, doch auch für die Zukunft und vielleicht für eine allfällige Änderung des Unterbringungsrechts anders zu wählen. Wir sehen, und wir haben das auch immer gesehen, dass das ein heikler Punkt ist, aber ich glaube, wir haben die Abwägung der Interessen durchaus richtig getroffen und das alles, was Sie jetzt hier erwähnt haben, berücksichtigt.
Der dritte Punkt betrifft die Frage der Kosten. Also eines muss man einmal ganz klar sagen: Dass die Finanzierung dieses Gesetzes auf absehbare Zeit gesichert ist, kann niemand ernsthaft bestreiten. Es ist richtig, dass die ursprünglichen Kostenschätzungen deutlich höher waren als jene, die letztlich, auch im Konsens mit dem Finanzressort, zugrunde gelegt wurden, und ich sage Ihnen auch ganz offen und gerne, warum es diese Divergenz gab. Sie müssen davon ausgehen, dass ich im Haus Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter habe, Richter, Staatsanwälte, Beamte, die sehr, sehr vorsichtig sind, was Kostenschätzungen betrifft, daher ist es für uns typisch, dass unsere Kostenschätzungen zu Beginn immer an der Obergrenze oder oft auch höher sind als das, was dann tatsächlich herauskommt.
Das erklärt vielleicht auch den Gott sei Dank glücklichen Umstand, dass wir über relativ hohe Rücklagen verfügen, die wir auch einsetzen können, wenn es notwendig ist. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn wir nicht immer sehr, sehr vorsichtig agiert hätten, bei allen Kostenschätzungen in allen Bereichen.
Zu einem Punkt gab es Diskussionen mit dem Finanzressort; da hat das Finanzressort etwa bei der Frage, ob es hierfür zusätzliches Personal im Bereich der Richter benötigt, darauf hingewiesen, dass wir in bestimmten Bereichen der Justiz bei der Belastung von Richtern tatsächlich einen Rückgang haben, insbesondere bei manchen Bezirksgerichten. Das kann man genau feststellen, wir haben ein sehr genaues Bewertungsmodell, das kennt auch das Finanzressort, und da mussten wir schon auch konzedieren: Ja, das ist richtig. Es gibt da doch einen Rückgang an Belastung, der durch dieses neue Gesetz natürlich wieder deutlich kompensiert werden würde, aber da muss ich sagen, war der Einwand richtig; bevor man daran denkt, neue Planstellen zu installieren, sollte man einmal schauen, dass die Auslastung dort, wo es offenbar möglich und sinnvoll ist, auch entsprechend gesteigert werden kann.
Jetzt kommt der Hauptpunkt, der auch erwähnt wurde – auch das ist richtig –: Es ist äußerst schwer, zu prognostizieren, wie sich die Kosten bei einem Gesetz entwickeln, bei dem man eben schwer einschätzen kann, wie es sich in der Praxis bewähren wird. Die gewählte Erwachsenenvertretung, die Angehörigenvertretung: Wie wird das dann tatsächlich auch zahlenmäßig zu Buche schlagen? – Daher gibt es da von vornherein – das geht gar nicht anders – gewisse Unabwägbarkeiten.
Ein weiterer Punkt, den ich schon erwähnen möchte, weil er hier eben nicht erwähnt wurde: In der Kostenschätzung war ja, mehr oder weniger ohne Not, auch die Kostenschätzung für das Heimaufenthaltsgesetz enthalten. Diese haben wir dann im Sinne der Kostenwahrheit herausgenommen, weil das eine mit dem anderen nicht zwingend etwas zu tun hat. Damit sind auch die Kosten für das Heimaufenthaltsgesetz separat erfasst worden. Das erklärt, warum sich die Kostenschätzung dann entsprechend reduziert hat. Das ist im Einvernehmen mit dem Finanzressort erfolgt, und es macht auch Sinn, sachlich darüber zu diskutieren, was an Kostenschätzung wirklich realistisch ist und was nicht.
Es wird einen Mehraufwand geben, ja, aber dieser Mehraufwand, den wir jetzt auch klar deklariert haben, ist auf absehbare Zeit wirklich problemlos gedeckt, nicht zuletzt durch die Rücklagen, die wir haben. Auch das hat das Finanzministerium anerkannt und, mein Gott, ich glaube nicht, dass es jemals der Fall war, dass man sozusagen die finanzielle Bedeckung eines Gesetzes für einen Zeitraum von, ich weiß nicht, fünf, zehn, 20 Jahren verlangt hätte – das ist mir neu. Da kann ich nur sagen: Auf absehbare Zeit ist das sicher kein Problem. Und letztlich, meine Damen und Herren Bundesräte, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen, gilt: Der Souverän ist das Volk, und die Volksvertretung ist das Parlament, und auf lange Sicht wird es daher am Parlament liegen, nicht nur dieses Gesetz haben und aufrechterhalten zu wollen, sondern auch die entsprechenden Budgetmittel dafür zur Verfügung zu stellen und zu beschließen.
Ich bleibe bei dem, was ich – zugegebenermaßen schon in österlicher Stimmung – bereits im Nationalrat gesagt habe: „Wem das Parlament gibt das Haserl, dem gibt es sicher auch das Graserl.“ – Das wird auf lange Sicht so sein, und so gesehen mache ich mir da überhaupt keine Sorgen.
Zum Inhalt des Gesetzes möchte ich nur sagen, dass alles eigentlich schon erwähnt worden ist, insbesondere Herr Bundesrat Hammerl hat das sehr schön zum Ausdruck
gebracht, indem er mit seinem Wortspiel auf diese zentrale Unterscheidung hingewiesen hat: „der Mensch als Mittelpunkt“ oder „der Mensch als Mittel – Punkt“.
Das ist wirklich die zentrale Frage, um die es hier geht, denn wir haben in den letzten Jahren schon gesehen, dass es da zu Fehlentwicklungen gekommen ist, dass die enorme Steigerung der Zahl an Sachwalterschaften auch damit erklärt werden muss, dass es oft nicht so sehr darum gegangen ist, eine für den Betroffenen sinnvolle Lösung zu finden, sondern dass es um die Frage gegangen ist: Wie kann man sicherstellen, dass im Geschäftsverkehr keine Unsicherheiten dadurch auftreten, dass die Geschäftsfähigkeit beeinträchtigt ist? – Mit anderen Worten, etwas hart formuliert: Wer im Geschäftsverkehr nicht funktioniert, der wird substituiert, durch einen Sachwalter. Das ist aber keine menschliche Lösung, und wie oft haben wir alle, wenn wir ehrlich sind, schon in Reden, nicht nur an Sonntagen, davon gesprochen, dass der Mensch im Mittelpunkt der Politik steht? – Jetzt können wir es beweisen. Mit diesem Gesetz können wir beweisen, dass es auch so ist und dass es auch so sein soll.
Ich habe eigentlich an dieser Stelle hinsichtlich dieses völlig neuartigen Gesetzes, das wirklich dem Schutz der Erwachsenen, dem Schutz der Menschen dient und nicht dem Schutz anderer Teilnehmer am Geschäfts- oder Rechtsverkehr, nur noch zu danken. Ich habe jetzt nur noch zu danken, das möchte ich aber ganz bewusst auch tun.
Danken möchte ich allen, die auch durch ihre kritischen Bemerkungen dazu beigetragen haben, dass dieses Gesetz so gut werden konnte, wie es ist, und das ist es wirklich. Ich muss natürlich zuallererst den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in meinem Haus danken, die dieses hervorragende Gesetz konzipiert und entwickelt haben.
Ich muss auch vielen, vielen Menschen danken, die im Zuge der Erprobung dieses Gesetzes durch das Pilotprojekt, das wir an 18 Bezirksgerichten hatten, dafür gesorgt haben, dass wir auch durch diese praktischen Erfahrungen die Sicherheit haben konnten: Ja, das funktioniert wirklich! – All diese Menschen waren beseelt von einer großen Idee, nämlich dass dieses Gesetz wirklich wieder dafür sorgt, dass der Mensch und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt gestellt werden und alles dem untergeordnet wird, übrigens ganz im Sinne auch der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen, die wir zu erfüllen haben. Da geht es nicht nur darum, gut auszuschauen, nein: Da müssen wir wirklich liefern, und wir haben da durchaus noch Umsetzungsbedarf. Durch dieses Gesetz wird das wirklich auch entsprechend sichergestellt.
Zu danken ist auch den Vertretern der Seniorenverbände, das war etwa Herr Präsident Blecha genauso wie Frau Präsidentin Korosec, und ich möchte auch ganz besonders jenen danken, die uns und auch mir im Zuge der Arbeit und der Konzipierung dieses Gesetzes mit Rat und Tat zur Seite gestanden sind. Da waren auch viele Richter dabei, Bezirksrichter, die uns wertvolle Anregungen gegeben haben, nicht zuletzt auch einer, der heute zufällig hier ist, Rat Erhard Neubauer aus Hollabrunn, Gerichtsvorsteher am Bezirksgericht in Hollabrunn.
Ich freue mich, wenn ich ihn sehe, denn er ist auch derjenige, der letztlich eine Strafbestimmung gegen unzulässige Absprachen bei öffentlichen Versteigerungen initiiert hat. Das war eine Anregung von ihm, und ich finde das so schön, dass es immer wieder Richter gibt, die mit Anregungen, die sie uns geben, dazu beitragen, dass wir die Justiz auch im Sinne von mehr Praktikabilität weiterentwickeln können. Danke für die Anregungen, die wir in Bezug auf dieses Gesetz bekommen haben, denn das ist ja so wichtig: Dieses Gesetz lebt davon, dass diejenigen, die es umzusetzen haben, auch wirklich im Geiste dieses Gesetzes handeln, und da ist mir jetzt, nach den Erfahrungen, die wir gemacht haben, überhaupt nicht mehr bange.
Zu Dank verpflichtet bin ich nicht zuletzt auch noch Frau Volksanwältin Gertrude Brinek, die uns viele wertvolle Hinweise gegeben hat, die hier natürlich auch eine gewisse
Kontrollfunktion hat – zu Recht –; der Volksanwaltschaft verdanken wir ja viele, viele Hinweise, auch auf Fehlentwicklungen, die letztlich auch am Beginn der Arbeit an diesem Gesetz gestanden sind.
Ich möchte auch einer Nationalratsabgeordneten persönlich danken, die sich sehr engagiert hat, und zwar Frau Abgeordneter Aubauer. Zuallerletzt fühle ich mich auch persönlich dem früheren Präsidenten des Seniorenbundes Professor Andreas Khol zu Dank verpflichtet, der auch sehr viel an Anregungen geleistet und geliefert hat, die für mich persönlich sehr wichtig waren, und der mir auch gezeigt hat, wie sehr dieses Gesetz vielleicht auch eine Chance für die Zivilgesellschaft, für die Bürgergesellschaft ist, sich zu engagieren.
Wir wissen, wie leistungsfähig diese Zivilgesellschaft in Österreich ist, und wenn es um gewählte Erwachsenenvertretung und um Angehörigenvertretung geht, dann ist dieses Gesetz auch eine Chance dafür, zu zeigen, dass Mitmenschlichkeit auch auf dieser Ebene gefördert werden und dann auch funktionieren kann, weil immer mehr erkennen, dass es nicht nur darum geht, einen Akt rasch zu erledigen, dem ein Problem eines Menschen zugrunde liegt, sondern dass es darum geht, seine Probleme zu lösen.
Das wird mit diesem Gesetz – davon bin ich überzeugt – gelingen, und ich freue mich darüber, wenn auch Sie diesem Gesetz Ihre Zustimmung erteilen können. – Danke schön. (Beifall und Bravoruf bei der ÖVP sowie Beifall bei den Grünen und bei Bundesräten von SPÖ und FPÖ.)
15.37
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir gelangen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Kartellgesetz 2005, das Wettbewerbsgesetz und das Bundesgesetz zur Verbesserung der Nahversorgung und der Wettbewerbsbedingungen geändert werden (Kartell- und Wettbewerbsrechts-Änderungsgesetz 2017 – KaWeRÄG 2017) (1522 d.B. und 1529 d.B. sowie 9765/BR d.B.)
19. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Firmenbuchgesetz, das EU-Verschmelzungsgesetz und das Gerichtsgebührengesetz geändert werden (BRIS-Umsetzungsgesetz – BRIS-UmsG) (1517 d.B. und 1530 d.B. sowie 9766/BR d.B.)
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Nun gelangen wir zu den Punkten 18 und 19 der Tagesordnung.
Berichterstatter zu beiden Punkten ist Herr Bundesrat Novak. – Ich bitte um die Berichte.
Berichterstatter Günther Novak: Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Werte Zuhörer! Ich bringe die beiden Berichte des Justizausschusses zu den Tagesordnungspunkten 18 und 19.
Zu TOP 18: Bericht des Justizausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Kartellgesetz 2005, das Wettbewerbsgesetz und das Bundesgesetz zur Verbesserung der Nahversorgung und der Wettbewerbsbedingungen geändert werden.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor; ich komme daher gleich zur Antragstellung.
Der Justizausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 4. April 2017 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Zu TOP 19: Bericht des Justizausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Firmenbuchgesetz, das EU-Verschmelzungsgesetz und das Gerichtsgebührengesetz geändert werden.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor; ich komme daher gleich zur Antragstellung.
Der Justizausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 4. April 2017 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Ich danke für die Berichterstattung.
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Schödinger. – Bitte, Herr Bundesrat.
15.40
Bundesrat Gerhard Schödinger (ÖVP, Niederösterreich): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Herr Minister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Wir haben hier eine EU-Richtlinie umzusetzen, wobei die Umsetzung aber nicht nur darauf reduziert werden sollte, dass wir das machen mussten, sondern es ist aus meiner Sicht ein für uns sehr gutes Gesetz, das hier beschlossen wird – primär einmal betreffend Kartellgesetz, weil es da anscheinend sehr viele Mankos gegeben hat, die mit dieser neuen Rechtslage ausgemerzt werden. Was ich nebenbei noch erwähnen will, ist, dass die Reform des Kartellrechts auch im Regierungsübereinkommen enthalten war und damit auch dieser Punkt umgesetzt wurde.
Wo liegen für uns die Knackpunkte beziehungsweise wo liegen meiner Meinung nach die Knackpunkte? – Der erste ist einmal – und das ist der wichtigste Punkt –: Wir schaffen damit faire Spielregeln für den Wettbewerb. Wir haben eine höhere Transparenz im Kartellverfahren, und da ist es auch notwendig – was auch beschlossen wurde –, erfolgreiche Kronzeugenprogramme zu installieren.
Weiters wird – das hat uns in der Vergangenheit auch immer zum Nachteil gereicht, das war notwendig – eine Anpassung der Verjährungsbestimmungen vorgenommen, damit Verstöße nicht während der Ermittlungen verjähren. Das wird mit diesem Gesetzespaket alles entsprechend umgesetzt. Ich denke, dass das einige der wichtigsten Punkte sind, um die Kartellspielregeln noch kundenfreundlicher, noch konsumentenfreundlicher zu gestalten.
Ein zweiter Aspekt betrifft die Änderung des Bundesgesetzes zur Verbesserung der Nahversorgung und der Wettbewerbsbedingungen. Das ist natürlich ein Gesetz, das uns alle sehr stark betrifft, vor allem mich als Bürgermeister, weil es dabei um die Nahversorgung geht. Es gibt eine gewisse Marktbeherrschung einiger großer Konzerne, der mehr oder weniger entgegengetreten werden soll.
Viele europäische Initiativen betonen den Handlungsbedarf im Zusammenhang mit Ungleichgewichten im Bereich der Lieferkette. Die KMUs, die an die großen Konzerne, an
die großen Partner liefern, bekommen von diesen teilweise – und gar nicht so selten – die Bedingungen diktiert. Diese Bedingungen haben dann zur Folge, dass die KMUs immer stärker und immer mehr unter diesen Vorgaben leiden, die sie nicht mehr bis zur letzten Konsequenz erfüllen können – und das bedeutet das Aus für die Firmen. Das ist aber nicht nur das Aus für die Firmen, sondern das bedeutet auch einen großen Nachteil für die Kunden und den Verlust von Arbeitsplätzen.
Es gibt einige Punkte, die auch entsprechend hervorgehoben wurden, wie diese Nachteile für die KMUs etwa aussehen. Es sind unter anderem verspätete Zahlungen, ein beschränkter Zugang zum Markt, einseitige oder rückwirkende Änderungen von Vertragsbedingungen, die Bereitstellung unzureichender oder mehrdeutig formulierter Informationen über Vertragsbedingungen, die Verweigerung schriftlicher Verträge und die plötzliche und unbegründete Auflösung von Verträgen. Es gibt noch eine Fülle solcher – ich würde es einmal so sagen – Schikanen, denen man entsprechend entgegentreten sollte und muss.
So denke ich, dass dies, so wie diese Gesetzesvorlage hier beschlossen wird, im Großen und Ganzen nicht nur die Umsetzung einer EU-Richtlinie ist, sondern im Sinne unserer Bürger und im Sinne des Konsumentenschutzes doch auch ein großer Schritt in die richtige Richtung. – Danke. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
15.43
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächster ist Herr Bundesrat Weber zu Wort gemeldet. – Bitte, Herr Kollege.
15.44
Bundesrat Martin Weber (SPÖ, Steiermark): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben schon gehört, mit dem Tagesordnungspunkt 18 – eine Regierungsvorlage – sollen das Kartellgesetz 2005, das Wettbewerbsgesetz und das Bundesgesetz zur Verbesserung der Nahversorgung und der Wettbewerbsbedingungen geändert werden; das Kartell- und Wettbewerbsrechts-Änderungsgesetz. Mein Vorredner, Herr Kollege Gerhard Schödinger, hat das schon sehr ausführlich erläutert, ich möchte aber noch ein paar wesentliche Eckpunkte darlegen.
Das vorliegende Gesetz bezweckt die Schaffung von Rechtssicherheit und die Regelung von Schadenersatzansprüchen bei Wettbewerbsrechtsverletzungen. Es bezweckt weiters die Verbesserung der Transparenz in kartellgerichtlichen Verfahren, die Sicherstellung der Qualität von Sachverständigengutachten in Kartellverfahren, die Sicherstellung des fairen Wettbewerbs in der Lieferkette und weitere Modernisierungsmaßnahmen.
Beim Gesetz – wir haben es schon gehört – handelt es sich um die Umsetzung einer EU-Richtlinie, die damit in das innerstaatliche Recht übergeführt werden soll; eine Reform des österreichischen Kartellrechts ist auch im aktuellen Regierungsübereinkommen enthalten.
Der Erreichung des Ziels, faire Spielregeln für den Wettbewerb zu schaffen, soll unter anderem eine höhere Transparenz im Kartellverfahren dienen, unter anderem zum Beispiel durch Namensnennung nach Abschluss eines Verfahrens. Des Weiteren sollen erfolgreiche Kronzeugenprogramme gesichert und die Verjährungsbestimmungen angepasst werden. Ein Mehr an Rechtssicherheit, ein Mehr an Transparenz und ein Mehr an Fairness ist damit sichergestellt.
Auch Tagesordnungspunkt 19 betrifft eine EU-Richtlinie, welche bis Juni 2017 umzusetzen ist. Es geht dabei um einen grenzüberschreitenden Zugang zu Unternehmensinformationen über das europäische Justizportal. Dieser Zugang soll durch automati-
sierte Kommunikation zwischen den nationalen Registerbehörden der Mitgliedstaaten über eine zentrale europäische Plattform erleichtert werden. Daneben wird diese Vorlage auch zum Anlass genommen, im Firmenbuchgesetz, welches hierdurch geändert wird, gewisse Klarstellungen und Anpassungen vorzunehmen.
Künftige Abfragemöglichkeiten von Unternehmensinformationen über das europäische Justizportal werden diesen Zugang für Unternehmer, aber auch für Konsumenten, Verbraucher und Behörden erleichtern und verbessern.
Die
SPÖ-Fraktion befürwortet daher diese Gesetze und wird natürlich
bei sämtli-
chen Gesetzen mitstimmen. – Danke. (Beifall
bei SPÖ und ÖVP sowie des Bundesrates Stögmüller.)
15.47
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Der nächste Redebeitrag kommt von Herrn Bundesrat Mag. Raml. – Bitte, Herr Bundesrat.
15.47
Bundesrat Mag. Michael Raml (FPÖ, Oberösterreich): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Herr Minister! Hohes Haus! Die Novelle bringt ganz klar Verbesserungen für Konsumenten insgesamt und Verbesserungen für Opfer von Kartellrechtsverletzungen im Speziellen. Natürlich erhält das von uns eine klare Zustimmung.
Weiters stimmen wir selbstverständlich dem zweiten Gesetzesbeschluss sehr gerne zu, der unter anderem eine Kostensenkung von Gerichtsgebühren zum Inhalt hat. Jedoch möchte ich in diesem Zusammenhang, Herr Minister, schon darauf hinweisen – Sie wissen das, zumindest noch aus Ihrer Zeit als Rechtsanwalt, weil die österreichische Rechtsanwaltskammer gleichfalls völlig zu Recht darauf hinweist –, dass die Gerichtsgebühren in Österreich aus unserer Sicht insgesamt viel, viel zu hoch sind. Das heißt, dieser Gesetzesbeschluss ist für uns nur der Anfang eines hoffentlich sehr schönen Endes, indem wir nämlich früher oder später die Gerichtsgebühren insgesamt senken können.
Die beiden heutigen Gesetzesbeschlüsse finden jedenfalls unsere Zustimmung. – Vielen Dank. (Beifall bei FPÖ, ÖVP und SPÖ.)
15.48
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Nun darf ich Frau Bundesrätin Dr. Dziedzic das Wort erteilen. – Bitte.
15.48
Bundesrätin Mag. Dr. Ewa Dziedzic (Grüne, Wien): Sehr geehrter Herr Minister! Werte Präsidentin! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte vor allem auf das Kartellgesetz, das Wettbewerbsgesetz und das Bundesgesetz zur Verbesserung der Nahversorgung und der Wettbewerbsbedingungen eingehen. Da es sich dabei, wie wir bereits gehört haben, um die Umsetzung einer EU-Richtlinie aus dem Jahr 2014 über bestimmte Vorschriften für Schadenersatzklagen nach nationalem Recht wegen Zuwiderhandlungen gegen wettbewerbsrechtliche Bestimmungen handelt, werden auch wir zustimmen – vor allem auch im Sinne der erhöhten Transparenz, die damit in Zukunft gewährleistet sein soll.
Die Vorredner haben bereits die positiven Aspekte erwähnt; diese möchte ich jetzt nicht wiederholen. Ich sehe die Oppositionsrolle mehr darin, das Aber zu formulieren, und da gibt es tatsächlich auch die Frage nach der Ausfinanzierung, die sich für uns stellt. Im Länderbericht der EU-Kommission von 2016 ist nämlich Folgendes zu lesen – ich zitiere –:
„Im Vergleich zu den Wettbewerbsbehörden anderer Mitgliedstaaten ist die Bundeswettbewerbsbehörde nicht mit ausreichend Mitteln ausgestattet, was ein effektiveres Vor-
gehen erschwert. Die Budgetsituation bleibt gegenüber den Vorjahren unverändert, weshalb die Behörde ihr Personal nicht wird aufstocken können.“
Die Bundeswettbewerbsbehörde wünscht sich vor allem eine Zweckbindung. Ein möglicher Vorschlag wäre nämlich, dass man die Bußgelder aus den Kartellverfahren zweckbindet, weil derzeit die Gelder aus den Bußen zur Gänze dem Budget des BMJ zugutekommen, obwohl eigentlich das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft die Kosten für den gesamten öffentlichen Vollzug trägt. – Sie schütteln den Kopf, Herr Minister Brandstetter. Ich bin froh, wenn Sie das sozusagen richtigstellen, das ist die Information, die mir vorliegt.
Vielleicht können Sie mich auch davon überzeugen, dass es irgendwelche Rücklagen dafür gibt. Unsere Information ist nämlich, dass es mehr Ausfinanzierung, mehr Budget brauchen würde, um die Bundeswettbewerbsbehörde mit entsprechenden Mitteln auszustatten. Ansonsten findet das unsere Zustimmung. – Vielen Dank. (Beifall bei Grünen und SPÖ.)
15.51
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesminister Dr. Brandstetter. – Bitte.
15.51
Bundesminister für Justiz Dr. Wolfgang Brandstetter: Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren Bundesräte! Zunächst gleich eine kleine Korrektur – das ist sozusagen die ganz aktuelle Entwicklung –: Künftig werden die Kartellbußen, also die Einnahmen, die man von denjenigen, die sich wettbewerbsrechtliche Verstöße haben zuschulden kommen lassen, erzielt, nicht mehr in das Budget des Justizressorts fließen, sondern direkt ins allgemeine Budget. Gleichzeitig ist ja auch fixiert worden, dass es insofern zu einer Zweckbindung kommt, als die Bundeswettbewerbsbehörde eine entsprechende Dotierung bekommt, um auch finanziell für ihre Aufgaben besser ausgestattet zu sein.
Das ist sozusagen die letzte Entwicklung gewesen, also das, was Sie, Frau Bundesrätin Dziedzic, gesagt haben, ist nicht mehr ganz aktuell. Damit ist aber nicht zuletzt auch der Kritik Rechnung getragen worden, dass die Bundeswettbewerbsbehörde besser ausgestattet werden muss.
Ich kann nur sagen – das wollte ich eigentlich noch ergänzen –, dass es natürlich auch uns wichtig ist, dass die Bundeswettbewerbsbehörde optimal arbeiten kann. Deshalb haben wir im Zuge dieser Richtlinienumsetzung auch dafür gesorgt, dass sie im Rahmen von Hausdurchsuchungen mehr Befugnisse bekommt. Wir haben durch eine Neuregelung der Verjährungsbestimmungen auch dafür sorgen wollen, dass es nicht passieren kann, dass irgendwelche Wettbewerbsverstöße bei bereits laufendem Verfahren verjähren. Da ist also Gott sei Dank einiges zugunsten der Wettbewerbsbehörde geschehen, und das ist auch gut so.
Wir haben auch dafür gesorgt, dass es durch die Überführung der kartellrechtlichen Sachverständigen in die Sachverständigenliste des Sachverständigen- und Dolmetschergesetzes diesbezüglich auch zu einer wirklichen Qualitätssicherung im Bereich der Gutachter kommt. Auch das halte ich für wichtig.
Der wesentliche Punkt, der allen dient, die durch Wettbewerbsverstöße geschädigt wurden, ist natürlich der, dass jetzt auch klar ist, dass es bei wettbewerbsrechtlichen Entscheidungen eine Bindungswirkung für künftige Schadenersatzprozesse gibt. Das heißt, der, der aufgrund von Wettbewerbsverstößen einen Schadenersatzanspruch hat, wird es in Zukunft leichter haben, zu seinem Recht zu kommen.
Jetzt kann man natürlich sagen: Na gut, das könnte dazu führen, dass es dann weniger Verfahren im schadenersatzrechtlichen Bereich gibt. Das wird vielleicht auch dazu füh-
ren – weil das angesprochen wurde –, dass wir weniger Gebühreneinnahmen haben werden. – Ja, das muss man halt in Kauf nehmen.
Weil diese Gebührenthematik angesprochen wurde, möchte ich schon auch eines sagen: Wir haben gerade in der letzten Zeit insbesondere im Familienrecht auch einiges getan, um Gebühren zu reduzieren oder überhaupt abzuschaffen, die als nicht wirklich gerechtfertigt zu qualifizieren waren. – Das wollte ich nur dazu noch sagen.
Dies ist ja eine vergleichsweise schlanke Richtlinienumsetzung. Warum können wir in diesem Bereich mit relativ wenigen Neuerungen auskommen, die eigentlich alle, wie ich klarzumachen versucht habe, wirklich im Interesse von Geschädigten, von Konsumenten und von Behörden, die da tätig sind, gedacht sind und auch so funktionieren werden? – Wir können das deshalb, weil unser Wettbewerbsrecht im europäischen Vergleich wirklich sehr, sehr weit vorne ist und es keinen Vergleich zu scheuen braucht, wie im Übrigen auch die Gebührensituation in der österreichischen Justiz keinen europäischen Vergleich zu scheuen braucht. Das wollte ich auch noch gesagt haben. – Danke. (Beifall bei ÖVP, SPÖ und Grünen sowie des Bundesrates Schererbauer.)
15.54
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Die Abstimmung erfolgt getrennt.
Wir gelangen zunächst zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Kartell- und Wettbewerbsrechts-Änderungsgesetz 2017.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist angenommen.
Nun kommen wir zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein BRIS-Umsetzungsgesetz.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Gerichtsorganisationsgesetz geändert wird (1504 d.B. und 1531 d.B. sowie 9767/BR d.B.)
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Wir gelangen nun zum 20. Punkt.
Berichterstatter ist Herr Bundesrat Novak. Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatter Günther Novak: Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Werte Kolleginnen, werte Kollegen! Ich bringe den Bericht des Justizausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Gerichtsorganisationsgesetz geändert wird.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, der Inhalt ist bekannt, ich komme daher sogleich zur Antragstellung:
Der Justizausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 4. April 2017 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Ich danke für die Berichterstattung.
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Dr. Brunner. – Bitte, Herr Bundesrat.
15.56
Bundesrat Dr. Magnus Brunner, LL.M (ÖVP, Vorarlberg): Hohes Präsidium! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Bei dieser Novelle geht es um einige Anpassungen, die sich aus der Praxis ergeben. Es ist keine Änderung der Gerichtsorganisation allgemein, diese bleibt unverändert. Es geht um Sicherheitsmaßnahmen, es geht um Justizverwaltungsquoten für die Vorsteher von Bezirksgerichten, es geht um die Schaffung einer klaren Zuordnung der Gerichtsabteilungen zu den bei einem Gericht tätigen Richterinnen und Richtern und es geht auch um Effizienzsteigerung, insbesondere bei der elektronischen Aktenführung. – Das sind die wichtigsten Punkte.
Die angesprochenen Sicherheitsmaßnahmen können in Zukunft, wenn ein besonderer Anlass besteht, auch dann ergriffen werden, wenn diese nicht explizit in der jeweiligen Hausordnung stehen. Eine Klarstellung betrifft auch die Zuordnung der Gerichtsabteilung zu dem bei einem Gericht ernannten Richter. Die Zahl der Richter orientiert sich in Zukunft grundsätzlich nicht mehr an der Zahl der systematischen Planstellen, sondern an der Zahl der bei einem Gericht tatsächlich verwendeten Richterinnen und Richter. Das ist sicher eine dringende Anpassung an die Praxis und auch ein dringender Wunsch der Richter.
Für die Bezirksgerichte wird in Zukunft auch eine Justizverwaltungsquote vorgesehen, die nach objektiven Kriterien festgelegt wird und zukünftig auch an der Zahl der Richter ausgerichtet wird.
Insgesamt sind dies also weitere wichtige Schritte zur Modernisierung, zur Effizienzsteigerung, auch zur Anpassung an die Praxis, ohne dabei grundsätzliche Aspekte der Gerichtsorganisation zu berühren. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
15.58
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächste ist Frau Bundesrätin Mag. Kurz zu Wort gemeldet. – Bitte, Frau Kollegin.
15.59
Bundesrätin Mag. Susanne Kurz (SPÖ, Salzburg): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Mein Kollege Magnus Brunner hat ja schon die wichtigsten Ziele genannt, die mit dieser Novelle des Gerichtsorganisationsgesetzes geändert werden sollen. Ich möchte das nicht wiederholen.
Im Zusammenhang mit der Hausordnung geht es um diese Klarstellung, die er schon genannt hat, es geht um das Ziel des Heranziehens von Richterinnen und Richter für die Justizverwaltungsangelegenheiten der Bezirksgerichte, um eine klare Zuordnung der Gerichtsabteilungen, um Änderungen der Geschäftsverteilung und einiges mehr. – Insgesamt sind es sieben Ziele, die damit verfolgt werden und die auch mit sieben Maßnahmen dargestellt werden.
Die Frage der Sicherheitsmaßnahmen ist schon erläutert worden. Es geht auch darum, wie ein objektivierter Personaleinsatz sichergestellt wird, nämlich durch Verankerung einer Justizverwaltungsquote. Es geht weiters um Vertretungseinsatz und darum – ein Thema, das mir auch wichtig ist –, dass die Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter vielfältige Aufgaben im Bereich der richterlichen Fortbildung übernommen hat, was jetzt auch in diesem Gerichtsorganisationsgesetz seinen Niederschlag finden wird.
Insgesamt handelt es sich um Änderungen, die notwendig sind, die sich aus der heutigen Realität ergeben haben. Wir stimmen dieser Gesetzesnovelle gerne zu. – Danke. (Beifall bei der SPÖ, bei Bundesräten der ÖVP sowie der Bundesrätin Schreyer.)
16.00
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Ich darf nun Herrn Bundesrat Mag. Raml um seine Ausführungen bitten.
16.00
Bundesrat Mag. Michael Raml (FPÖ, Oberösterreich): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Herr Minister! Aller guten Dinge sind drei: Die Freiheitlichen werden auch bei diesem Tagesordnungspunkt zustimmen. Die Vorschläge sind zweckdienlich, Herr Minister, sie vereinfachen das Verfahren, und sie sind wirklich inhaltlich sehr gut gelungen.
Eine kleine Anmerkung – meine lieben Kollegen werden es mir verzeihen – kann ich mir dennoch nicht ersparen, und zwar: Wenn man sich den Gesetzestext anschaut, dann merkt man auf den ersten Blick, dass dieser Gesetzestext einer Totalgenderung unterworfen wurde. (Bundesrätin Kurz: Sehr gut!) Und ich sage das jetzt wirklich nicht von einem ideologischen Standpunkt aus gesehen, sondern ganz strikt vom Standpunkt eines Rechtsanwenders aus gesehen: Es ist einfach im Hinblick auf die Lesbarkeit und die Verständlichkeit eines Gesetzestextes absolut nicht zweckdienlich, wenn man seine ideologische Einstellung schon bei der Form eines Gesetzestextes – der ja inhaltlich ohnedies sehr oft ideologisch geprägt ist – einfließen lässt. (Bundesrätin Kurz: Das ist die Zukunft!) – Das ist hoffentlich nicht die Zukunft, Frau Kollegin (Bundesrätin Kurz: Doch!), denn das wird einfach für den Rechtsanwender sehr, sehr kompliziert. (Bundesrätin Kurz: Ihr werdet es schon derlesen!)
Ich darf Ihnen dazu auszugsweise nur als kleines Beispiel – es gäbe noch viel, viel schlimmere – den § 25 Abs. 1a in der Fassung der Regierungsvorlage vorlesen, der wie folgt lautet:
„(1a) Die Vorsteherin oder der Vorsteher des Bezirksgerichts wird bei ihren oder seinen Aufgaben nach Maßgabe der von ihr oder ihm zu erlassenden Geschäftseinteilung für Justizverwaltungssachen durch andere Richterinnen und Richter unterstützt und vertreten. [...]“
Das Ganze wird einfach unnötig verkompliziert. Man versteht das in diesem Fall schon noch, das kann man durchaus sagen, nur: Es ist einfach unnötig. (Bundesrätin Kurz: Na geh! Das ist nötig!) Machen wir bitte Gesetze, die der einfache Mensch auch versteht, für deren Verständnis man nicht ein Germanistikstudium absolvieren muss! (Bundesrätin Kurz: Das muss man nicht!) Das ist nicht nötig. Herr Minister, ich glaube, gerade bei der ÖVP kann ich da noch auf die Vernunft hoffen (Bundesrätin Kurz: Was heißt das?), dass ihr mich da versteht, wenn ich meine, dass wir das einfach nicht brauchen.
Dennoch werden wir aber aus inhaltlicher Sicht dieser Gesetzesnovelle unsere Zustimmung erteilen. – Vielen Dank. (Beifall bei der FPÖ.)
16.03
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Zu Wort gemeldet ist nun Herr Bundesminister Brandstetter. – Bitte, Herr Bundesminister.
16.03
Bundesminister für Justiz Dr. Wolfgang Brandstetter: Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete! Ich wollte eigentlich nur auf einen Punkt hinweisen, der ein praktisches Beispiel auch dafür bietet, welchen Vorteil die Umsetzung dieser Richtlinie jetzt bringt und warum wir das auch haben wollen.
Ein ganz einfaches Beispiel: Stellen Sie sich vor, es geht um groß angelegten Mehrwertsteuerbetrug, der international begangen wird – jetzt unabhängig davon, welche Staaten wie und in welchem Umfang geschädigt wurden, aber das kommt ja immer häufiger vor und das ist ja auch einer der Gründe, weshalb wir die Europäische Staatsanwaltschaft haben wollen: um solchen grenzüberschreitenden Kriminalitätsformen besser begegnen zu können –, da kommt es natürlich leicht dazu, dass ein Ermittlungsorgan auch im Firmenbuch nachschauen muss, weil die Täter in solchen Fällen oft ganz wilde Firmenkonstruktionen in verschiedensten Ländern errichten.
Jetzt ist es nicht so einfach, wenn man vielleicht draufkommt, dass ein potenziell Tatverdächtiger Firmen in Deutschland und in der Schweiz gegründet hat – na, das wird nicht so schwer sein; aber dann hat er vielleicht auch welche in Estland, Lettland und Litauen gegründet, und dort in das nationale Firmenbuch hineinzuschauen und dann dort auch wirklich die Information herauszuholen, die man braucht, das ist schon schwieriger.
Daher ist genau diese Regelung in diesem einen Punkt besonders wichtig und praktikabel. Sie schafft nämlich ein zentrales Firmenbuch für ganz Europa, für die gesamte EU, und wir können das auch zentral nutzen. Das ist ein enormer Vorteil auch für die Ermittlungsorgane, und es ist ein enormer Vorteil auch für die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität. Das möchte ich nur speziell vermerkt haben, denn das ist einfach ein echter Fortschritt, den wir da erzielen: Es wird ein einheitliches Firmenbuch, ein einheitliches Unternehmensregister geben, wo man zentral hineinschauen kann. Es wird eine einheitliche Abfragemaske geben, die man in allen Amtssprachen der Europäischen Union aufrufen kann – und das ist ein ganz wichtiger praktischer Vorteil.
Und ja – speziell auch Herrn Bundesrat Raml sei es gesagt –, ich kann es eh nicht mehr ändern, aber eine Kurzinformation aus diesem zentralen Register, die alle wesentlichen Informationen enthält, die man normalerweise braucht, ist jedenfalls kostenlos. Kann sein, dass wir auch da vielleicht wieder weniger Gebühren haben werden, aber ich wollte es Ihnen auch gesagt haben, weil Sie die Gebührenfrage thematisiert haben. (Bundesrat Raml: Danke schön!)
Vielleicht eines noch, weil Sie auch das thematisiert haben: Mein Gott, also wir können uns darauf einigen, dass das Firmenbuch sächlich ist – da haben wir keine Probleme –; ich glaube auch nicht, dass man Germanistik studiert haben muss, um den § 25 zu verstehen, aber in einem Punkt, da habe ich schon Verständnis für Ihr Anliegen: Auch ich habe schon einmal, glaube ich, zu Recht bemerkt, dass es auch Ausdrücke gibt, die ich um nichts in der Welt gendern würde: den wienerischen Begriff Watschenmann zum Beispiel. Nie und nimmer gendere ich das! Kommt nicht in Frage! Aber ich glaube, dieses Gesetz ist noch einigermaßen in Ordnung, gell? – Danke schön. (Heiterkeit und Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
16.06
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir gelangen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen (Pau-
schalreisegesetz – PRG) erlassen wird sowie das Konsumentenschutzgesetz, das Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz und das Verbraucherbehörden-Kooperationsgesetz geändert werden (1513 d.B. und 1533 d.B. sowie 9768/BR d.B.)
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Wir gelangen nun zum 21. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatter ist Herr Bundesrat Weber. – Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatter Martin Weber: Ich bringe den Bericht des Justizausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen (Pauschalreisegesetz – PRG) erlassen wird sowie das Konsumentenschutzgesetz, das Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz und das Verbraucherbehörden-Kooperationsgesetz geändert werden.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher sogleich zur Antragstellung.
Der Justizausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 4. April 2017 den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Ing. Rösch. – Bitte, Herr Bundesrat.
16.08
Bundesrat Ing. Bernhard Rösch (FPÖ, Wien): Wertes Präsidium! Sehr geehrter Herr Minister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Gäste! Die Regierungsvorlage betreffend die Erlassung eines Pauschalreisegesetzes nimmt den Onlineverkauf und die Liberalisierung zum Vorwand und möchte den Schutz für Konsumenten und Rechtssicherheit für Unternehmer sicherstellen. Da könnte man annehmen, dass man nur dafür sein kann. Es geht um die vorvertragliche Informationspflicht, den Inhalt des Pauschalreisevertrages, Änderungen vor Beginn der Reise, dass man mitgeteilt bekommt, was man da alles machen könnte, bis hin zur Rücktrittsmöglichkeit, zur Nichterfüllung vertraglicher Reiseleistungen und zum Schutz bei Insolvenz.
Es ist nicht so, dass das nicht auch schon bisher, nämlich im Konsumentenschutzgesetz, geregelt gewesen wäre. Es war bis jetzt auch schon kompliziert. Der Bürger hat, wenn er in ein Reisebüro gegangen ist – ob in ein kleines oder in ein größeres oder auch online –, immer gehofft, das wird hoffentlich schon gut gehen, ich werde keinen Anwalt brauchen, auch nicht meine Rechtsschutzversicherung oder sonst irgendetwas. In den meisten Fällen geht es ja auch gut.
Dann aber ist die Europäische Union gekommen und hat gesagt: Ihr sollt das umsetzen! – Ich glaube, ausgegangen ist das von England, wo es irgendwo eine Situation gab, die geregelt gehörte. Dann hat die Europäische Union gesagt: Ja, das machen wir! Dann haben sie ihre Shadows geholt, die natürlich von den ganz Großen kommen, und haben gesagt: Jaja, für die ganz Großen wäre das so und so ganz toll!, und haben das dann formuliert. – Und so wirkt das auf mich auch.
Nun bin ich Arbeitnehmervertreter und komme gar nicht von der Wirtschaftskammer oder von der Seite der Wirtschaft, aber mir tun die KMUs dabei leid, denn wenn man sich das alles anschaut, die ganzen Begrifflichkeiten, dann hat man den Eindruck, man braucht ein Studium, um mit diesen zurechtzukommen. Und ich habe zwar nichts gegen Rechtsanwälte, ich bin aber auch nicht dazu da, dafür zu sorgen, dass sie mit den Konsumenten ein Geschäft machen, indem ich eine Rechtsmaterie schaffe, für deren Verständnis die Rechtsanwälte fünf Jahre oder länger studiert haben und in Wirklichkeit dann auch in den OGH-Urteilen nachschauen müssen, wie das Ganze ausgehen wird.
Ich hätte als Arbeitnehmervertreter gerne eine A4-Seite, auf der diese Dinge, die drauf zu sein haben, ganz eindeutig drauf sind. Ich möchte keine Bedingungen, die 100 Seiten lang sind, wo mir dann gesagt wird, das und das und das kannst du machen. Dann kommt der Verkauf und sagt ganz einfach, klicke das dort an – wenn ich es online mache, über Cookies und so weiter –, nur dann darfst du weiter, nur dann kriegst du deine Reise, nur dann kannst du bestellen. Jeder Zweite – oder vielleicht viel mehr – macht das dann, weil er sagt, das verstehe ich sowieso nicht. Aber auch bei Versicherungen oder Banken wird man mit 120 Seiten konfrontiert, die man – in dem Beamtendeutsch, dem Bürokratiedeutsch, in dem sie abgefasst sind – nicht versteht.
Ich mache mir angesichts all dessen um die kleinen und mittleren Unternehmen große Sorgen, denn diese werden sich ganz einfach nicht Rechtsabteilungen in dieser ganzen Ausformung leisten können. Wir haben jetzt schon die Situation, dass wir alle kleinen und mittleren Unternehmen, die uns in der nahen Umgebung serviciert haben, verloren haben. Ich denke jetzt nur an die Metzger oder an das Fischgeschäft um die Ecke, an den kleinen Greißler und, und, und – sie sind alle den Großen gewichen. Das mag insofern einen Vorteil haben, als man vielleicht sagen kann, das ist ein bisschen billiger. Wenn man aber das Wurstsemmerl umrechnet, so stimmt das auch nicht ganz, denn irgendwann, wenn die Kleinen alle weg sind, gehen die Preise schon in die Höhe – dorthin, wo sie hinmüssen.
Was wir dabei aber auch vergessen, ist, dass sich 80 Prozent der Arbeitsplätze bei den kleinen und mittleren Unternehmen befinden – und um die mache ich mir Sorgen! Und wenn ich das dann so anschaue und überlege, für wen das ist, dann sage ich: Ich als Konsument und als Arbeitnehmervertreter mache mir Sorgen, wenn ich so viel Informationsmüll bekomme und dann im Endeffekt nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Das Gegenteil von gut gemacht ist gut gemeint, und diese Überinformation ist sicher gut gemeint, und es haben sicher einige daran gearbeitet, aber ob alle die gleichen Interessen gehabt haben, das bezweifle ich. (Beifall bei der FPÖ.)
16.13
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Forstner. – Bitte, Herr Kollege.
16.13
Bundesrat Armin Forstner, MPA (ÖVP, Steiermark): Geschätzte Frau Präsidentin! Herr Minister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Beim Pauschalreisegesetz geht es um verschiedene Reiseleistungen, die in Kombination zu einem Pauschalpreis angeboten werden. Diese Richtlinie bringt mit Blick auf den Konsumentenschutz höhere Sicherheit und schafft mehr Vertrauen. Für den Anbieter bedeutet das aber mehr Auflagen in Bezug auf Informationspflichten und zusätzliche Haftungsverpflichtungen.
Das Gesetz soll mehr Rechtsicherheit für Konsumenten, aber auch für Unternehmer bringen. Die Umsetzung der alten sogenannten Pauschalreiserichtlinie war im Konsumentenschutzgesetz enthalten. Dort wurde sie jetzt herausgelöst und dieses neue Regelwerk daraus gemacht. Positiv daran ist, dass für Reisen, die man im Internet oder im Reisebüro bucht, jetzt einheitliche europäische Regeln gelten. Weiters sind die Kundinnen und Kunden geschützt, wenn ein Anbieter in Konkurs geht. Dies war bis jetzt nicht der Fall.
Klar geregelt wird darin auch der Rücktritt vor Reisebeginn. Wenn zum Beispiel unvermeidbare oder außergewöhnliche Umstände auftreten, dann kann man von der Reise zurücktreten, ohne Entschädigung dafür zahlen zu müssen, zum Beispiel bei Kriegshandlungen, Terrorismus oder Naturkatastrophen wie Erdbeben, Hochwasser oder dergleichen, aufgrund deren das Reiseziel nicht erreicht werden kann. Allerdings gelten diese Bestimmungen nicht nur für den Konsumenten, sondern auch für die Reisebüros,
die ihrerseits unter solchen Umständen Reisen absagen können, ohne Entschädigung leisten zu müssen. Also ist das Gesetz sowohl konsumentenfreundlich als auch wirtschaftsfreundlich.
Die Informationspflicht ist jetzt neu geregelt worden. Es wird ein Standardinformationsblatt geben, in dem die einzelnen Punkte dem Konsumenten beziehungsweise dem Reisenden mitgeteilt werden müssen. Das sind im Großen und Ganzen die Reiseleistung, der Gesamtpreis, die Zahlungsmodalitäten, allfällige Mindestteilnehmerzahlen und Informationen über das Rücktrittsrecht des Reisenden.
Alles in allem schafft das neue Pauschalreisegesetz mehr Klarheit bei den Informationspflichten, bei Änderungen des Pauschalreisevertrages und bei den Rechtsfolgen bei nicht ordnungsgemäßer Erfüllung der vertraglichen Reiseleistungen.
Im Gegensatz zur FPÖ glauben wir, dass dadurch eine Verbesserung für den Konsumenten, aber auch für die Wirtschaft gegeben ist. Deshalb stimmen wir diesem Gesetz zu. (Beifall bei der ÖVP, bei Bundesräten der SPÖ sowie des Bundesrates Schererbauer.)
16.15
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Novak. – Bitte, Herr Kollege.
16.16
Bundesrat Günther Novak (SPÖ, Kärnten): Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Wenn ich mir als jemand, der aus der Touristik kommt oder lange Jahre im Tourismus gearbeitet hat, dieses neue Pauschalreisegesetz anschaue, dann unterscheide ich so wie meine Vorredner eigentlich auch zwei Seiten: Zum einen handelt es sich um Regelungen für den Konsumenten – und ich glaube, für den Konsumenten wurde viel gemacht, dem hilft das auf jeden Fall. Ob es andererseits aber für den Unternehmer, sprich das Reisebüro oder einen Hotelbesitzer, dann auch so positiv ist? – Aber darauf werde ich zum Schluss noch einmal anhand einer Aussage eines Touristikers zurückkommen.
Ich habe in der Vergangenheit – ich glaube, auch bei der letzten Sitzung – über Breitband gesprochen. Wenn wir schauen, was im Bereich des Internet los ist und diesbezüglich nur an Österreich denken, daran, dass 80 Prozent der Österreicher sich im Internet bewegen und dass die Geschäftsführerin der Österreich Werbung zum Beispiel 50 Prozent ihrer Marketingmittel für die Zukunft im Internet einsetzt, dann wissen wir, dass diese Branche im Onlinegeschäft einfach boomt und dass sich auch auf dem Reisesektor über die Jahre viele Dinge verändert haben.
Das Verreisen praktisch per Mausklick wird von vielen Konsumenten als selbstverständlich hingenommen. Vielen ist dabei aber wahrscheinlich nicht bewusst gewesen, dass sie bei Buchung einer Reise über Internet nicht denselben Schutz genossen haben, wie wenn sie in ein Reisebüro gegangen wären, um dort die Buchung durchzuführen. Die Pauschalreisenden können sich künftig jedoch auf einheitliche europäische Richtlinien beziehungsweise Regeln verlassen. Wir sind ja der Zeit ein bisschen voraus – denn diese Richtlinie hat erst ab 1. Jänner Gültigkeit –, und ich glaube, das ist auch gut so, weil sich dadurch die Betriebe schon jetzt darauf einstellen können.
Die neue Richtlinie soll also die faktischen Änderungen auf dem Reisemarkt berücksichtigen sowie adäquaten Schutz für Konsumenten und vor allem Rechtsicherheit auch für den Unternehmer bieten. Das heißt, die Richtlinie regelt sehr wesentliche Punkte wie die vorvertraglichen Informationspflichten – auch das wurde schon gesagt, dass es ein Standardinformationsblatt gibt und dass der Gesamtpreis, die Zahlungsmodalitäten, allfällige Mindestteilnehmerzahlen und vor allem auch das Rücktrittsrecht damit geregelt sind.
Neuerungen gibt es auch zum Inhalt des Pauschalreisevertrages, und ich glaube, dort liegt ein bisschen der Hund begraben, weil dessen Definition nun wesentlich weiter gefasst wurde und er entweder aus einem Einzelvertrag oder aber auch aus einer Mehrzahl von Verträgen, die der Reisende mit einzelnen Anbietern abschließt, bestehen kann. Wenn man also jetzt für eine Reise Zimmer und Frühstück oder Zimmer und Halbpension bucht und dann Bestandteile wie Flüge, Hotelangebote, Mietwagen und so weiter noch miteinschließe, dann ist jetzt gewährleistet, dass auch diesbezüglich Rechtssicherheit besteht.
Neu geregelt sind auch Änderungen vor Beginn der Reise und die Rücktrittsmöglichkeiten. Mein Kollege Köck hat das ja auch schon gesagt, dass gerade im Fall von Kriegen, Terrorismus oder Gefährdungen anderer Art nicht nur derjenige, der gebucht hat, zurücktreten kann, sondern auch der Unternehmer vor Ort – etwas, wobei sich bisher ja Probleme ergeben haben. Vor allem – und das ist, glaube ich, das größte Problem gewesen – wenn es eine Insolvenz eines Reisebüros gab, hat der Reisende, der gebucht und seine Anzahlung geleistet hatte, früher meistens durch die Finger geschaut.
Ein wesentlicher Punkt des Pauschalreisegesetzes sind die neuen Richtlinien in Bezug auf kombinierte Internetangebote – das habe ich zu Beginn schon angesprochen –, die auf einem einzigen Portal gebucht und bezahlt werden. Ich klicke mich also durch die Homepage durch und versuche, mir meinen Urlaub einen Punkt nach dem anderen nach einem Baukastensystem zusammenzustellen. Da bin ich dann in Zukunft auch geschützt, weil das eine Pauschalreise ist.
Ganz interessant war für mich, als ich in der Zeitung gelesen – jetzt komme ich zum Schluss meines Beitrags wieder auf den Anfang zurück – und festgestellt habe, dass die Hotellerie, also die ÖHV, die Österreichische Hoteliervereinigung, für sich selbst durch ihren Generalsekretär festgestellt hat, dass das eigentlich nicht sehr unternehmerfreundlich ist. Er hofft, dass sich das Ganze mit dieser Richtlinie nicht unnötig verkompliziert und dass es dann im Sinne der Unternehmer aufgeht. Er hat auch festgestellt, dass der Nationalrat – und das ist heute auch schon festgestellt worden – ein Gesetz gegen sinnlose Gesetze beschlossen hat, und er meint, dass dann zwei Tage später aber eigentlich ein solches beschlossen wurde, nämlich das, von dem wir jetzt sagen, dass es für die Unternehmer und für die Betriebe eigentlich schwierig zu handhaben ist.
Wir werden dem Gesetz auf jeden Fall zustimmen. Es ist ja auch nicht so, dass man nicht gescheiter werden kann und das Ganze im Laufe der Zeit dann nicht auch auf EU-Ebene anpassen kann. (Beifall bei der SPÖ.)
16.21
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Dr. Dziedzic. – Bitte.
16.21
Bundesrätin Mag. Dr. Ewa Dziedzic (Grüne, Wien): Sehr geehrter Herr Bundesminister! Werte Präsidentin! Geschätzte Kollegen und Kolleginnen und natürlich auch Gäste, die ich vorhin nicht erwähnt habe, was ich hiermit nachholen möchte! Die Gründe für die Revision dieser Pauschalreise-Richtlinie – das wurde heute schon gesagt – waren die Zunahme im Onlineverkauf genauso wie die Liberalisierung. Natürlich ist es uns wichtig, dass es einen Schutz der Konsumenten und Konsumentinnen gibt und dass genauso für die Unternehmen Rechtssicherheit gewährleistet ist. Wir werden diesem Gesetz im Gegensatz zur FPÖ auch zustimmen.
Dennoch vielleicht eine kritische Anmerkung: Wir haben im Ausschuss schon besprochen, wie das denn ist, wenn man unterschiedliche Leistungen bucht, aber dann eine gemeinsame Rechnung hat. Wird das dann als Pauschalreise gewertet oder nicht?
Das sind Dinge, die sich dann tatsächlich erst in der Praxis zeigen werden. Insofern sind das für uns hier wichtige Schritte, die erfolgen, aber ob das gehfähig ist, inwiefern das gehfähig ist, wird für uns erst die Praxis zeigen. Insofern also unsere Zustimmung, aber natürlich auch weiterhin in Beobachtung dessen, wie sich das mit dem neuen Gesetz entwickelt. – Danke. (Beifall bei Grünen und SPÖ.)
16.23
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesminister Dr. Brandstetter. – Bitte, Herr Bundesminister.
16.23
Bundesminister für Justiz Dr. Wolfgang Brandstetter: Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren Bundesräte! Ich kann das jetzt ganz kurz machen. Das ist eine Richtlinienumsetzung, dazu waren wir verpflichtet. Wir haben uns bemüht, uns damit wirklich zu beeilen, damit es für alle davon Betroffenen genug Zeit gibt, sich auf das einzustellen, was hier geregelt werden musste.
Daher hat es aus meiner Sicht wenig Sinn, sich sozusagen auf eine Metaebene zu begeben und darüber zu diskutieren oder auch nur nachzudenken, ob es überhaupt Sinn macht, dass diese Regelungen zu Pauschalreisen innerhalb der EU unbedingt vereinheitlicht werden müssen. Die Zunahme des Onlinehandels und der Onlinebuchungen spricht sicher grundsätzlich dafür.
Ich verstehe auch Argumente, dass es natürlich irgendwann einmal zu einem Punkt kommt, an dem Regelungen, die im Interesse des Konsumenten gedacht waren, zu einer solchen Fülle an Informationsverpflichtungen führen, dass die dann letztlich, wie das heute schon gesagt worden ist, erst recht dazu führen, dass der Konsument leicht verwirrt wird und sich schon gar nicht mehr auskennt. Natürlich gibt es da irgendwo einen Zielkonflikt, den man nicht ganz aus den Augen verlieren darf.
Es ist auch ein amüsanter Gedanke, sich zu überlegen, warum es eigentlich so ist, dass man für Deregulierung grundsätzlich ein Gesetz braucht, nämlich das bereits erwähnte Gesetz gegen sinnlose Gesetze. Das ist eben unser System! Das mag man auch durchaus kritisieren, aber es hilft nichts. Das geht eigentlich am Thema vorbei. Das hier ist nichts anderes als eine Richtlinien-Umsetzung, und da gab es eigentlich keinen Spielraum, sondern nur das Bestreben, es allen Betroffenen so leicht wie möglich zu machen, damit sie sich lange genug auf das einstellen können, was eben vonseiten der EU vorgegeben wurde.
Ob man in solchen Bereichen solche Vorgaben überhaupt machen soll, das ist gerade jetzt eine allgemeine Diskussion auf europäischer Ebene, aber das geht weit über das hinaus, worum es heute hier und bei diesem Gesetz gehen kann. – Danke. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
16.25
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir gelangen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend Zweites Zusatzprotokoll zum Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen (1470 d.B. und 1536 d.B. sowie 9769/BR d.B.)
23. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend Erklärung der Republik Österreich über die Annahme der Beitritte Albaniens, Andorras, Armeniens, Marokkos, der Russischen Föderation, der Seychellen, Singapurs zum Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung (1459 d.B. und 1534 d.B. sowie 9770/BR d.B.)
24. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend Erklärung der Republik Österreich über die Annahme der Beitritte Kasachstans, Perus und der Republik Korea zum Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung (1476 d.B. und 1535 d.B. sowie 9771/BR d.B.)
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Wir gelangen nun zu den Punkten 22 bis 24 der Tagesordnung.
Berichterstatter zu diesen Tagesordnungspunkten ist Bundesrat Weber. – Ich bitte um die Berichterstattung.
Berichterstatter Martin Weber: Frau Präsidentin! Herr Minister! Werte Kollegen! Ich darf die Berichte aus dem Justizausschuss erstatten, drei an der Zahl.
Zunächst erstatte ich den Bericht des Justizausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend Zweites Zusatzprotokoll zum Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich darf daher sogleich zum Antrag kommen:
Der Justizausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 4. April 2017 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Ich erstatte weiters den Bericht des Justizausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend Erklärung der Republik Österreich über die Annahme der Beitritte Albaniens, Andorras, Armeniens, Marokkos, der Russischen Föderation, der Seychellen und Singapurs zum Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung.
Der Bericht liegt Ihnen ebenso in schriftlicher Form vor, ich komme daher sogleich zur Antragstellung:
Der Justizausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 4. April 2017 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Schließlich erstatte ich den Bericht des Justizausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend Erklärung der Republik Österreich über die Annahme der Beitritte Kasachstans, Perus und der Republik Korea zum Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung.
Der Bericht liegt Ihnen ebenso in schriftlicher Form vor, ich komme daher sogleich zur Antragstellung:
Der Justizausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 4. April 2017 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Ich danke für die Berichterstattung.
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Herr Vizepräsident Mag. Gödl. – Bitte, Herr Kollege.
16.29
Bundesrat Mag. Ernst Gödl (ÖVP, Steiermark): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Minister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Rechtzeitig vor meiner Vorsitzübernahme darf ich noch ein paar Minuten dazu verwenden, zu den drei Tagesordnungspunkten ein paar Ausführungen zu machen.
Die Tagesordnungspunkte 22 bis 24 beschäftigen sich prinzipiell mit rechtlichen Materien, um internationale rechtliche Abläufe zu verbessern, einerseits im Strafrecht und andererseits im zivilrechtlichen Bereich. Es ist eher untypisch, dass man diese beiden Rechtsgebiete in einem Tagesordnungspunkt vermischt, aber das hat eben damit zu tun, dass es um grenzüberschreitenden Rechtsverkehr geht.
Im Tagesordnungspunkt 22 geht es um die Ratifikation des Zweiten Zusatzprotokolls zum Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen. Das kann man sich ganz einfach vorstellen. Warum ist das notwendig? – Jeder von uns kennt wohl die Situation, dass man auf der Autobahn fährt, es eine 100er-Beschränkung gibt und man das Gefühl hat, dass da manche viel schneller fahren. Es fahren vor allem jene schneller, die Kennzeichen aus Ländern aufweisen, die außerhalb der Europäischen Union liegen. Um auch die verwaltungsstrafrechtliche Verfolgung sicherzustellen, bedarf es eben solcher Übereinkommen.
In diesem Zweiten Zusatzprotokoll – es gibt eben schon ein Erstes Zusatzprotokoll und das ursprüngliche Übereinkommen – soll unter anderem die Rechtshilfeleistung auch in Verfahren wegen Verwaltungsübertretungen bewirkt werden, sofern insbesondere in Strafsachen gegen die Entscheidung ein zuständiges Gericht angerufen werden kann. Das bewegt sich also schon auf hohem Niveau.
Diese Strafverfolgung über die eigenen Grenzen hinaus ist zudem heute technisch ja kein Problem mehr. Es sollen Video-Konferenzen bei Zeugenvernehmungen, bei Beschuldigtenvernehmungen genehmigt werden, sogar Telefonkonferenzen in eingeschränktem Bereich, eben bei Zeugeneinvernahmen, nicht jedoch bei Beschuldigteneinvernahmen; da ist nur eine Videokonferenz zulässig. In diesem Bereich bewegt sich also der erste Tagesordnungspunkt, und mit diesem Beschluss ratifizieren wir dieses Zweite Zusatzprotokoll.
Ganz spannend sind die Punkte 23 und 24, denn es geht um Kindesentführungen, wie wir schon in der Berichterstattung gehört haben. Es mag vielleicht prinzipiell theoretisch klingen, vielleicht hat noch nicht jeder von euch damit zu tun gehabt. Ich möchte jedoch einen kleinen Fall erzählen, der in meiner unmittelbaren Umgebung stattgefunden hat, genau genommen in meiner unmittelbaren Nachbarschaft. Ich habe die Hausnummer 11, und dieser Fall hat sich in Hausnummer 5 meines kleinen Dorfes zugetragen. 2004 gab es dort einen veritablen Streit zwischen Eltern, auch mit Gewalt. Die Mutter geht ins Frauenhaus und nimmt ihre beiden Kinder – damals acht und fünf Jahre alt – mit. Der Vater hat das Besuchsrecht im Frauenhaus und fährt dann nach Monaten mit den Kindern nach einem Besuch zu sich nach Hause, behält die Kinder zu Hause. Es ist noch nichts passiert. Die zuständige Behörde, die Bezirksverwaltungsbehörde, hat gesagt: Das ist in Ordnung. Die Kinder wollen lieber am Bauernhof sein und nicht in einer kleinen Wohnung im Frauenhaus.
Als dann der Scheidungsprozess weiterging, die Scheidung bevorstand und der Vater befürchtete, dass das Sorgerecht für die Kinder der Frau zugesprochen werden wird, ist er im November 2004 mit den Kindern untergetaucht, und er konnte nicht mehr auf-
gefunden werden – neun Jahre lang! Das Haus wurde mehrmals in nächtlichen Aktionen – als Bürgermeister war ich da immer eingeweiht in die Aktionen der Kriminalpolizei – durchsucht, es wurden Nachbarn, Verwandte observiert, aber der Vater und die Kinder konnten nicht gefunden werden.
Plötzlich, im Jahr 2013, neun Jahre später, kommen Meldungen über die Medien, dass zwei entführte Kinder in Paraguay aufgetaucht sind. Der Vater, der die Kinder schlussendlich nach Paraguay entführt hat und dort ein neues Leben begonnen hatte, der übrigens gar keinen falschen Namen verwendet hat, hat es geschafft, neun Jahre in einer Umgebung, in der sehr viele Deutsche leben, in einer deutschsprachigen Gegend, ein neues Leben aufzubauen, eigentlich gar nicht unerkannt, aber dort quasi beschützt von den örtlichen Behörden. Nach neun Jahren passiert 2013 das Missgeschick, dass dieser Vater einen schweren Verkehrsunfall hat und am Totenbett sagt, was wirklich hinter seiner Geschichte steht, und darum bittet, dass mit Österreich Kontakt aufgenommen wird. Er ist dann verstorben. Die Kinder sind nach wie vor in Paraguay. Ich habe auch persönlich Kontakt zu diesen Kindern, aber sie wollen natürlich nach 13 Jahren nicht zurück – logisch, die haben ein völlig neues Leben aufgebaut, einen neuen Freundeskreis, eine Stiefmutter, sogar ein junges Geschwisterl dort.
Genau in einem solchen Fall – und damit komme ich zurück zur Rechtsmaterie – sollen diese Übereinkommen regeln, was im Falle von Kindesentführungen passiert, wie der rechtliche Vorgang ist. Wenn meine Informationen stimmen, gibt es zirka 60 solche Fälle pro Jahr in Österreich – vielleicht nicht in dieser Dramatik, die ich soeben geschildert habe, aber es gibt 60 solche Fälle, in denen jemand in welcher Situation auch immer die Kinder dem Sorgerecht des anderen Elternteils entzieht, sie ins Ausland bringt und damit quasi der Rechtsverfolgung durch Österreich entkommen will.
Daher gibt es seit 1980 dieses Haager Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung. Über 50 Länder haben dieses Übereinkommen bereits angenommen, und jetzt treten diesem Übereinkommen eben zehn weitere Länder bei – zwar leider nicht Paraguay, um das es in dem von mir geschilderten Fall gegangen wäre, aber zum Beispiel Peru, Marokko, Armenien und dergleichen –, um auch dort solche Fälle regeln zu können.
Bei der Regelung steht natürlich – und das ist völlig richtig und wichtig – das Kindeswohl im Mittelpunkt. Sie besagt nämlich auch, dass, wenn ein Staat ein Ansuchen an das Land, wohin das Kind oder die Kinder entführt wurden, stellt, es dann nach diesem Übereinkommen sofort handeln und die Kinder innerhalb von sechs Wochen an das Heimatland zurücküberstellen muss. Wenn das Ansuchen jedoch erst ein Jahr nach dem Verschwinden des Kindes gestellt wird, dann steht das Kindeswohl schon absolut im Mittelpunkt. Haben sich nämlich die Kinder dann bereits in der neuen Umgebung eingelebt, wäre es unverantwortlich, sie automatisch wieder aus dieser neuen Umgebung abzuziehen. Dann ist eine echte Abwägung der Vor- und Nachteile vorzunehmen.
Der Geltungsbereich dieses Haager Übereinkommens wird jetzt wie gesagt um zehn weitere Ländern erweitert. Und mit diesem Beschluss im Parlament – es sind das die Tagesordnungspunkte 23 und 24 – nehmen wir diesen Beitritt von zehn weiteren Ländern an, damit eben solche Fälle, wie ich einen vorhin geschildert habe, die wirklich dramatisch sind, vor Ort im Falle des Falles besser gelöst werden können. Daher ist es selbstverständlich, und so ist es auch hier, dass alle Fraktionen diesem Übereinkommen zustimmen. – Danke schön. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
16.37
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Mag. Kurz. – Bitte, Frau Kollegin.
16.37
Bundesrätin Mag. Susanne Kurz (SPÖ, Salzburg): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Es ist ganz klar, dass die SPÖ diesem Zweiten Zusatzprotokoll zum Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen zustimmt. Mein Kollege Gödl hat geschildert, was dessen Inhalt ist; also ist es für uns natürlich auch mit unserer Zustimmung zu bestätigen. (Vizepräsident Gödl übernimmt den Vorsitz.)
Beim zweiten Punkt, den mein Kollege jetzt sehr ausführlich und auch eindrucksvoll behandelt hat, weil er eine Geschichte erzählt hat, in dem es um die internationale Kindesentführung geht, gibt es natürlich verschiedene Aspekte zu beachten. Ich denke ja nicht, dass der geschilderte Fall durch diese Maßnahme hätte geregelt werden können. Herr Kollege, wenn man nicht weiß, wo die Kinder sind, dann kann man ja auch kein Ansuchen stellen oder nicht gerichtlich tätig werden. (Ruf bei der ÖVP: Ja klar!) In sehr vielen Fällen weiß man es jedoch, weil der betreffende Elternteil ja zumeist dorthin zurückgeht, wo ursprünglich seine Heimat war. Das ist in den meisten Fällen so.
Man muss wirklich immer schauen, welche Auswirkungen eine solche Entführung hat, denn das hängt einfach immer vom Einzelfall ab. Kinderpsychologisch gesehen ist in erster Linie wichtig, wie die Beziehungen zwischen dem Kind und den Erwachsenen vorher gelaufen sind, wie sie weitergeführt werden, wie kindgerecht das Umfeld vor dem Entzug des Kindes war. Man kann also nicht sagen, dass das immer das Gleiche ist und das Kind in jedem Fall zurückgestellt werden muss, so dramatisch das Geschehen auch ist. Wir alle kennen aus den Medien Fälle und möglicherweise einen oder eine Betroffene sogar persönlich. Es ist immer ein Drama, wenn ein Kind entführt wird. Keine Frage!
Wir wissen auch, dass das nicht auf bestimmte Familien beschränkt ist, dass Staatsangehörigkeit in Wirklichkeit keine Rolle spielt, dass aber doch auch mit der steigenden Anzahl binationaler Ehen und Partnerschaften eine Zunahme solcher Fälle zu beobachten ist.
Vereinfacht kann man sagen, dass es sich immer dann um Kindesentführung handelt, wenn ein Elternteil das Kind in einen anderen Staat bringt, ohne dass der zweite Elternteil davon informiert wird und dazu seine Zustimmung gibt. Es werden ja auch manchmal Kindesentführungen verhindert. Ich habe gerade vor Kurzem von einem solchen Fall gehört, in dem ein Vater seine Kinder entführen wollte. Der ist am Flughafen angehalten worden, weil er keine Zustimmung der Mutter beibringen konnte, dass die wüsste, dass er jetzt mit seinen Kindern in ein anderes Land fliegt. Auch solche Dinge gibt es vereinzelt.
Es ist auch immer schwierig zu sagen, was einen Elternteil dazu veranlasst, so etwas zu machen. Da gibt es ganz vielfältige Gründe, und es geht eigentlich immer um die persönliche Situation: fehlende Berufsaussichten in dem Land, fehlende finanzielle Sicherheit, soziale Isolation, weil die Beziehung auseinandergebrochen ist. Sehr oft geht es um die Sorge, das Kind zu verlieren, weil im Streit um die Obsorge klar wird, dass dem anderen Partner das Kind zugesprochen werden könnte.
Es geht um unterschiedliche kulturelle Ansichten betreffend die Erziehung eines Kindes, oder auch um das Gefühl, gescheitert zu sein und in einem anderen Staat versuchen zu wollen, wieder neu anzufangen und ein besseres Leben zu führen, aber die Kinder nicht zurücklassen zu wollen.
Manchmal geht es aber einfach auch um eine Art von Machtausübung, darum, dem anderen Elternteil das Kind zu entziehen, weil man verletzt wurde, weil Gewalt in der Familie herrscht oder ähnliche Dinge.
Mein Kollege Gödl hat ja schon darauf hingewiesen, dass Vorschriften des internationalen Rechts großen Einfluss auf das Kindesentführungsverfahren und auch auf das Haa-
ger Übereinkommen haben. Das Haager Übereinkommen ist ein multilateraler Vertrag, der versucht, Kinder vor den schädlichen Folgen grenzüberschreitender Entführungen und grenzüberschreitender Vorenthaltungen zu schützen und, wenn möglich, ein Verfahren zu ihrer raschen Rücküberstellung bereitzustellen.
In diesem Sinne begrüßen wir natürlich, dass zehn weitere Staaten diesem Übereinkommen beitreten. Wir hoffen, dass dadurch die Zahl der Fälle nicht steigt, sondern sinkt. – Danke. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.)
16.41
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Bundesrat Herbert. – Bitte.
16.42
Bundesrat Werner Herbert (FPÖ, Niederösterreich): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Nach diesen sehr umfangreichen Ausführungen meiner Vorredner und den persönlichen Ausführungen des Herrn Vizepräsidenten Gödl kann ich inhaltlich dem eigentlich gar nichts mehr hinzufügen.
Seitens meiner Fraktion gibt es natürlich gerne die Bereitschaft, diesem Zusatzprotokoll wie auch diesem Übereinkommen in Bezug auf die Verringerung der Möglichkeiten für Kindesentführungen im bilateralen Bereich zuzustimmen.
Ich hoffe, dass wir damit einen wertvollen Beitrag leisten, um diesem unschönen Akt (Zwischenruf der Bundesrätin Mühlwerth), um es einmal so freundlich zu formulieren, einen wirksamen Riegel vorzuschieben.
Wie gesagt, wir wollen gerne unseren Beitrag dazu leisten. – Danke schön. (Beifall bei der FPÖ.)
16.43
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Als Nächste zu Wort gelangt Frau Bundesrätin Dr. Dziedzic. – Bitte.
16.43
Bundesrätin Mag. Dr. Ewa Dziedzic (Grüne, Wien): Sehr geehrter Herr Bundesminister! Wertes Präsidium! Geschätzte Kollegen und Kolleginnen! Ich hatte so einen Fall nicht in meiner unmittelbaren Nachbarschaft, aber ich kann mich erinnern, dass vor ein paar Jahren ein Fall durch die Medien ging, als ein nicht obsorgeberechtigter Vater sein Kind nach Ägypten entführt hat.
Damals hat es tatsächlich keinerlei rechtliche Handhabe gegeben, dieses Kind zurückzuholen. Kollege Gödl hat es schon erwähnt: Solche Fälle gibt es, wie wir wissen, sehr viele, und sehr oft werden sie in Staaten ausgetragen, in denen Österreich keine Handhabe hat. Insofern ist diese Ergänzung um die zehn Staaten natürlich auch aus unserer Sicht sehr begrüßenswert.
Ich erlaube mir aber noch eine letzte Bemerkung: Herr Kollege Gödl, Sie haben gesagt, dass das Besuchsrecht in einem Frauenhaus gewährt wurde. Das kann, glaube ich, kaum der Fall sein, da die Adressen der Frauenhäuser grundsätzlich geheim sind und das Besuchsrecht woanders ausgeübt wird. (Bundesrat Mayer: Das ist zehn Jahre her!)
Ich wollte das nur deshalb anmerken, weil wir an diesem Beispiel, das Sie erzählt haben, sehr gut gemerkt haben, dass es, auch wenn es das Bemühen gibt, zu einer Einigung zu kommen oder das Besuchsrecht weiterhin zu gewährleisten – in dem Fall den Vätern –, keine Garantie gibt, dass Kinder geschützt und nicht entführt werden.
Das heißt, wir stimmen nicht nur in diesem Punkt zu, sondern auch bei den anderen zwei Tagesordnungspunkten. – Vielen Dank. (Beifall bei Grünen und SPÖ.)
16.44
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Nun hat sich Herr Bundesminister Brandstetter zu Wort gemeldet. – Bitte sehr.
16.45
Bundesminister für Justiz Dr. Wolfgang Brandstetter: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren Bundesräte! Eigentlich sind es ja zwei Punkte, um die es hier geht. Zu dem Punkt, der hier jetzt ausführlicher diskutiert worden ist, der wirklich ein hochemotionales Thema betrifft, kann man nur sagen: Man muss froh über jeden Staat sein, der dem Haager Kindesentführungsübereinkommen beitritt.
Dadurch gibt es natürlich auch wieder mehr Chancen, Kinder nach Österreich zurückzubringen, von wo sie illegal entführt wurden, weil jemand faktisch Verhältnisse schaffen wollte. Das wirklich Bedauerliche an diesen Fällen ist, dass sich oft genug derjenige durchsetzt, der illegal agiert, der einfach eine Faktizität schaffen will, in der Hoffnung, dass man es, wenn es lang genug dauert, schon nicht mehr wird ändern können. – Das ist absolut nicht in Ordnung.
Wie Frau Bundesrätin Kurz schon gesagt hat, ist jede Kindesentführung ein Drama, vor allem für das Kind, und dessen Interessen sollten es eigentlich sein, die im Mittelpunkt stehen müssten. So gesehen ist das sicherlich auch eine Weiterentwicklung der Möglichkeiten, die man haben sollte, um diesen illegalen Handlungen so weit wie nur möglich entgegenzuwirken.
Diese Fälle sprechen aber natürlich für den Ausbau der Zusammenarbeit auf Ebene der Behörden, insbesondere auf Ebene der Strafverfolgungsbehörden, und darum geht es im zweiten Punkt. Da möchte ich nur erwähnt haben, dass das, was in diesem Rechtshilfeübereinkommen fixiert ist, auch ein nicht unerheblicher Beitrag zu einem Ziel ist, das wir ganz, ganz oben auf unserer Agenda haben, nämlich die Verfahrensbeschleunigung.
Das ist ganz, ganz wichtig. Da drehen wir an allen Schrauben, an denen wir nur drehen können, um überlange Verfahren zu vermeiden. Dazu nur stichwortartig einige Punkte, die uns dabei helfen: unmittelbarer Behördenverkehr zwischen den Staaten als Normalfall, Informationsaustausch zwischen den Staaten ohne formelles Ersuchen darum, Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen sowie von Beschuldigten auch im Wege einer Videokonferenz – das spart enorm viel Zeit, wir sind dafür ausgestattet, wir können das überall, in allen Gerichten und Staatsanwaltschaften machen –, Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen auch mittels Telefonkonferenzen; auch dafür gibt es eine entsprechende Rechtsgrundlage.
Nicht zuletzt geht es auch um Vorschriften zur Einrichtung und zum Einsatz gemeinsamer Ermittlungsgruppen zur Durchführung strafrechtlicher Ermittlungen in einem oder mehreren der beteiligten Vertragsstaaten; auch das ist wichtig, sozusagen grenzüberschreitend international tätig werdende Ermittlergruppen installieren zu können. Das ist ein wichtiger Aspekt.
Ich glaube, in diesem wichtigen Problembereich Verkürzung der Verfahrensdauer haben wir den Turnaround geschafft, auch diese Maßnahmen sind ein Beitrag dazu, dass wir bei der Begrenzung der Verfahrensdauer auch weiter erfolgreich sein werden. Das dient allen. Es ist mir wichtig, das auch erwähnt zu haben. – Danke schön. (Allgemeiner Beifall.)
16.48
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir kommen zur Abstimmung, die ich über jeden Ausschussantrag getrennt vornehme.
Wir gelangen zunächst zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend Zweites Zusatzprotokoll zum Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist Einstimmigkeit. Der Antrag ist somit angenommen.
Nun kommen wir zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend Erklärung der Republik Österreich über die Annahme der Beitritte Albaniens, Andorras, Armeniens, Marokkos, der Russischen Föderation, der Seychellen, Singapurs zum Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit angenommen.
Schließlich kommen wir zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend Erklärung der Republik Österreich über die Annahme der Beitritte Kasachstans, Perus und der Republik Korea zum Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit angenommen.
Jahresvorschau des BMJ auf Grundlage des Legislativ- und Arbeitsprogramms der Europäischen Kommission für 2017 sowie des Achtzehnmonatsprogramms des niederländischen, slowakischen und maltesischen Ratsvorsitzes (III-611-BR/2017 d.B. sowie 9772/BR d.B.)
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Nun gelangen wir zum 25. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatter ist Herr Bundesrat Weber. Ich bitte um die Berichterstattung.
Berichterstatter Martin Weber: Herr Präsident! Herr Minister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bringe den Bericht des Justizausschusses über die Jahresvorschau des BMJ auf Grundlage des Legislativ- und Arbeitsprogramms der Europäischen Kommission für 2017 sowie des Achtzehnmonatsprogramms des niederländischen, slowakischen und maltesischen Ratsvorsitzes.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher sogleich zur Antragstellung:
Der Justizausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 4. April 2017 den Antrag, die Jahresvorschau des BMJ auf Grundlage des Legislativ- und Arbeitsprogramms der Europäischen Kommission für 2017 sowie des Achtzehnmonatsprogramms des niederländischen, slowakischen und maltesischen Ratsvorsitzes zur Kenntnis zu nehmen.
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Ich danke für die Berichterstattung.
Wir gehen in die Debatte ein.
Als Erster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Herbert. – Bitte.
16.51
Bundesrat Werner Herbert (FPÖ, Niederösterreich): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich verrate Ihnen jetzt von dieser Stelle aus wahrscheinlich kein Geheimnis: Wir stehen diesen EU-Berichten eher kritisch gegenüber.
Ich darf Ihnen versichern: Ich werde Sie auch heute nicht enttäuschen. (Bundesrat Beer: Danke!) Warum – der Herr Bundesminister lächelt –? – Weil sich diese Berichte unserer Erfahrung nach inhaltlich zumeist durch eine sehr hohe Absichtserklärungslastigkeit auszeichnen (Bundesrat Todt: ... schweres Wort!), die dann in der Realität, in der realen Betrachtung einerseits meist den tatsächlichen Notwendigkeiten, auf der anderen Seite aber auch den faktischen Umsetzungsmöglichkeiten eher diametral entgegenstehen.
So ist es auch in diesem Fall: ein – ich würde einmal sagen – politisches Ankündigungsprogramm der Europäischen Union mit durchaus kritischen Anmerkungen des Justizministeriums, wofür ich mich beim Herrn Bundesminister auch durchaus bedanken darf, nämlich dafür, dass man hier nicht alles eins zu eins übernimmt – in einem Land, das ja von einer sehr großen EU-Hörigkeit geprägt ist und in dem die Bundesregierung in der Regel einen eher unterschwelligen Widerspruchsgeist zeigt, wenn es um Angelegenheiten der Europäischen Union geht. Aber in diesem Bericht kann man durchaus den einen oder anderen kritischen Widerspruch erkennen, und da darf ich auch auf den einen oder anderen Punkt zurückkommen.
Bevor ich ins Detail gehe und ein paar Dinge herausgreife, die mir aufgefallen sind oder, sagen wir, am Herzen liegen: Alles in allem ist dieser Bericht – so wie viele Berichte, die wir in den letzten Jahren in diesem Hohen Haus, zum Beispiel hier im Bundesrat, gesehen haben – viel heiße Luft.
Ich darf gleich einmal in die Tiefe dieses Berichtes gehen: Er gliedert sich in einen strafrechtlichen Bereich, einen zivilrechtlichen Bereich und den Justizbereich, wobei beim strafrechtlichen Bereich die Schaffung der Europäischen Staatsanwaltschaft besonders hervorsticht.
Die Frage ist, wofür wir Österreicher das brauchen. Selbst das Justizministerium sieht die Schaffung dieser Europäischen Staatsanwaltschaft höchst kritisch, das ist auch in diesem Bericht so dargelegt. Auch ich meine, wir haben in Österreich ein hohes strafrechtliches Niveau und haben uns in den wichtigen Belangen, wo es internationale Abstimmungen gibt, bilateralen Zugängen, bilateralen Abkommen oder bilateralen vertraglichen Verpflichtungen nicht entzogen.
Dass wir nunmehr heimisches Recht gänzlich in eine große EU-Staatsanwaltschaft legen sollen, das ist doch etwas völlig anderes, nämlich eine neue Form negativer Qualität in Bezug auf die Enteignung der Staaten. (Bundesrätin Kurz: Das gibt’s da nicht wirklich!) Ich denke, aus diesem Ansatz heraus lohnt es sich, diesen Bericht und dieses Vorhaben generell abzulehnen.
Interessant ist im Zusammenhang mit dieser Europäischen Staatsanwaltschaft der Umstand, dass das Justizministerium dazu zwar kritische Anmerkungen macht – nämlich zur Schaffung dieser Europäischen Staatsanwaltschaft und zu den Problemen, die damit einhergehen –, dem aber schlussendlich trotzdem zustimmt.
Darf ich vielleicht Sie, Herr Bundesminister Brandstetter, ersuchen, uns ein bisschen darüber aufzuklären, denn entweder hält man das für in Ordnung und kann dem zustimmen, oder man hat eine Position, in der man sagt, das geht gar nicht und da kann man auch nicht zustimmen. Zu sagen: Ich bin damit nicht einverstanden und stimme aber trotzdem zu!, das ist eine Qualität, die ich nicht als gut erachte. Vielleicht können Sie uns darüber aufklären, vor allem auch deshalb, weil ja nicht alle Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union – das geht aus diesem Bericht hervor – dieser Europäischen Staatsanwaltschaft ihre Unterstützung geben werden.
Österreich sieht das kritisch, stimmt aber zu. Andere Staaten stimmen gar nicht zu, und für manche Staaten steht das noch in Schwebe, wobei man sagt, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass sie zustimmen werden. So gesehen verstehe ich unsere Position, die österreichische, in dieser Frage nicht ganz.
Was ist sinnvoll? – Ich habe es eingangs schon erwähnt: der internationale bilaterale Austausch aufgrund rechtsstaatlicher Verträge und Verpflichtungen über die bilaterale Ebene. Dagegen verwahren wir uns auch nicht, das möchte ich hier nur noch einmal festhalten, damit es nicht wieder heißt, die Freiheitlichen sind grundsätzlich gegen die Europäische Union und gegen alles, was von der Europäischen Union kommt.
Es ist mir wichtig, den inhaltlichen Zugang zu erkennen, aufzuzeigen und Ihnen näherzubringen. Das heißt, gegen das grundsätzliche internationale Hand-in-Hand-Gehen von Gerichtsbarkeit oder Polizeibehörden bei der Verbrechensbekämpfung, bei der Durchsetzung berechtigter rechtsstaatlicher Anliegen, verwahren wir uns nicht. Wir verwahren uns aber dagegen, dass Österreich seine Hoheitsverwaltung, sein Recht, seine nationalen Möglichkeiten in fremde, übergeordnete Hände legt, wobei dadurch kein wirklicher Mehrwert für Österreich zu erkennen ist. Das ist bei dieser Europäischen Staatsanwaltschaft wohl so gegeben.
Im zivilrechtlichen Teil dieses Berichts sieht es nicht viel besser aus: ein Sammelsurium an Absichtserklärungen, die in der Realität wohl in weiter Umsetzungsferne liegen. Interessant ist der Vorschlag von Gesellschaften, nämlich von GesmbHs, mit einem Gesellschafter und 1 €-Einlagekapital. Das ist ein besonders interessanter Vorschlag. Wer auf eine derartige Idee kommt, der kennt sich entweder im Rechtsbereich überhaupt nicht aus oder rechtliche Grundsätze sind ihm völlig egal, denn das ist völlig sinnentleert.
Man braucht überhaupt keine Gesellschaft zu gründen, wenn man allein ist und kein Kapital hat, vor allem deshalb, weil eine Gesellschaft, nämlich eine GesmbH, ja vom Konstrukt her doch einige Verpflichtungen hat und eigentlich eine Sicherstellung der Bonität des Unternehmens darstellen soll. Wenn man die Grundsätze, die Zugänge auf ein solches Minimum reduziert, könnte man sie auch überhaupt abschaffen.
Das ist ein Zugang, der einmal mehr für die negative Qualität der Europäischen Union in diesen Rechtsangelegenheiten spricht. Genauso wenig erkenne ich die Sinnhaftigkeit der Vorschläge für die Regelung von Urheberrechten auf künstlerischer Ebene. Die wollen weder die Künstler noch die Verbraucher, aber die Europäische Union will sie. Auch da ist mir nicht ganz zugänglich, worin der Mehrwert bestehen soll; da schließt sich der Kreis eher in negativer Hinsicht.
Wenn ich noch kurz zur E-Justiz kommen darf: Eine Vernetzung der verschiedenen Register ist durchaus sinnvoll, aber auch nur dann, wenn wir unsere eigenen, nationalen hoheitsrechtlichen Möglichkeiten nicht aus der Hand geben. Bilaterale Verträge, zwischenstaatliche Vereinbarungen, internationale Zusammenarbeit, auch auf Plattformen, auf denen Daten ausgetauscht werden – sofern diese gesichert sind und man weiß, dass dabei nicht manipuliert werden kann –: Das ist durchaus denkbar und auch derzeit gelebtes Recht. Ein quasi Aufgeben jeglicher hoheitsrechtlicher Eigenstaatlichkeit kann es aber nicht sein. Ich glaube, es ist auch nicht Aufgabe dieses Bundesrates, der Länderkammer, das zu unterstützen.
So bleibt mir eigentlich als Resümee für diesen Bericht nur festzustellen: Das ist einmal mehr ein EU-Bericht, der eigentlich, wenn man ihn oberflächlich betrachtet, viele schöne Worte, viele gehaltvolle Erklärungen beinhaltet, sieht man sich das aber im Detail an, kommt man drauf: viel heiße Luft, um nicht zu sagen, viel blanker Unsinn, der da drinnen steht.
Ich würde eher anraten, die EU möge sich wirklich mit den aktuellen Problemen auseinandersetzen, gerade im Bereich des Flüchtlings- und Migrationswesens haben wir genug zu tun. Und wir haben als Ausfluss dieses Migrations- und Flüchtlingswesens auch in der Justiz sehr viele Probleme. Wir haben Strafanstalten, die mit ausländischen Straftätern überfüllt sind. Da wäre beispielsweise eine EU-weite Rückführung von Straftätern aus dem Ausland, damit diese ihre Strafe zu Hause absitzen können, ein vernünftiger und sinnvoller europäischer Ansatz – der auch die Nationalstaaten der EU wesentlich entlasten würde – für gute internationale Zusammenarbeit. Das liest man aber in diesem Bericht nicht. Und aus diesem Grund muss ich Ihnen wieder einmal sagen: leider Nein zu solchen EU-Berichten. – Danke schön. (Beifall bei der FPÖ.)
17.01
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Bundesrat Forstner. – Bitte.
17.01
Bundesrat Armin Forstner, MPA (ÖVP, Steiermark): Geschätzter Herr Präsident! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Herr Minister! Einmal grundsätzlich zum Kollegen Werner Herbert: Man soll Äpfel nicht mit Birnen vermischen. Das ist oft ein wenig schwierig. (Bundesrat Herbert: Wir vermischen keine Birnen!)
Ich meine, wir sollten uns auf die Jahresvorschau des BMJ auf Grundlage des Legislativ- und Arbeitsprogramms der Europäischen Kommission für 2017 konzentrieren. Die Bekämpfung von Terrorismus und organisierter Kriminalität bildet einen Schwerpunkt der Justizpolitik der EU im laufenden Jahr. Wie aus dem vom BMJ vorgelegten Arbeitsprogramm 2017 hervorgeht, soll die EU-Sicherheitsagenda mittels konkreter Maßnahmen zur Schaffung einer Sicherheitsunion umgesetzt werden, um den Bedrohungen durch Terrorismus wirkungsvoll zu begegnen.
Priorität kommt darüber hinaus auch der justiziellen Zusammenarbeit in Zivil- und Strafsachen sowie insgesamt der besseren Rechtssetzung auf europäischer Ebene zu. An konkreten Vorhaben nennt der Bericht zunächst eine Initiative über den Zugang zu elektronischem Beweismaterial, aber auch die weitere Umsetzung des EU-Aktionsplans gegen Terrorismusfinanzierung. Geplant sind einheitliche Sanktionen gegen Geldwäsche sowie eine Harmonisierung der Bestimmungen zur Sicherstellung und Einziehung von Erträgen aus Straftaten. Darüber hinaus will sich die Union auch weiterhin bemühen, Schlepperaktivitäten, Menschenhandel, insbesondere mit unbegleiteten Minderjährigen, zu bekämpfen. Im Mittelpunkt der strafrechtlichen Aktivitäten steht ferner die Fortsetzung des Kampfes gegen Betrügereien, die sich gegen die finanziellen Interessen der EU richten.
Was das Zivilrecht betrifft, misst der Bericht weiteren Schritten der Kommission zur Schaffung eines vernetzten digitalen Binnenmarktes große Bedeutung bei. Ganz weit oben auf der Agenda der EU-Justizpolitik stehen auch die Arbeiten an Initiativen zur Verwirklichung eines digitalen Binnenmarktes sowie Rechtsakte in den Bereichen Onlinehandel und Urheberrecht. Im Privatrecht liegt der Schwerpunkt auf dem Familienrecht. Positiv werden auch die Pläne zur Errichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft und die Harmonisierung der Sanktionen gegen die Geldwäsche gesehen. Wichtig sind auch die Initiativen zur Schaffung eines digitalen Binnenmarktes, wenngleich hier der Bedarf nach neuen Rechtsvorschriften, insbesondere im Bereich des Onlinehandels, gründlich zu hinterfragen sei.
Abschließend: Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, es ist bei allen legislativen Aktivitäten darauf zu achten – und da bin ich schon bei dir, Kollege Werner Herbert –, dass es nicht nur Absichtserklärungen sind, sondern schon das Bekenntnis von Kommission und Rat, die vorhandenen Rechtsinstrumente einheitlich umzusetzen und wirksam anzuwenden. – Danke schön. (Beifall bei ÖVP, SPÖ und Grünen.)
17.04
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Als nächster Rednerin darf ich Frau Bundesrätin Mag. Kurz das Wort erteilen. – Bitte.
17.04
Bundesrätin Mag. Susanne Kurz (SPÖ, Salzburg): Sehr geehrter Herr Bundesminister! Herr Präsident! Ich möchte zuallererst die Gelegenheit nutzen, mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Justizministeriums zu bedanken, denn ich finde, es ist ein sehr umfangreicher Bericht geworden. Vor allen Dingen ist der Bericht, der aus dem Justizministerium kommt, immer einer jener Berichte, die auch klar die österreichische Haltung aufzeigen. Ich finde, es ist für uns sehr wichtig, zu wissen, was die EU mit einer Richtlinie vorhat, wobei wir, wenn wir es befürworten, abwarten müssen, ob da noch etwas kommt, was wir dann beurteilen können – oder wir sind eigentlich dagegen. (Beifall bei SPÖ, ÖVP und Grünen.)
Insgesamt beinhaltet dieser Bericht elf Richtlinien zum Strafrecht und 16 Richtlinien zum Zivilrecht. Es sind dies alles Vorhaben, die die EU haben möchte. Natürlich wird das eine oder andere nicht kommen oder nicht so schnell kommen, wie diejenigen, die es eingebracht haben, sich das vorstellen. Prinzipiell geht es aber um diese Vereinheitlichung, um das Zusammenwirken.
Gerade wenn wir uns die Bekämpfung des Terrorismus – einer der Schwerpunkte dieses Jahres – anschauen, sehen wir, das kann ja nur gemeinsam gehen. Nur gemeinsam kann man Terrorismus, Menschenhandel und Schlepperei bekämpfen, denn was soll Österreich allein dagegen tun? Da wird das österreichische Recht nicht ausreichen, da werden wir nicht weit kommen. Deshalb bin ich sehr froh, dass die Bekämpfung von Terrorismus und organisierter Kriminalität einen Schwerpunkt der Justizpolitik der Europäischen Union im laufenden Jahr bildet. Es sollen ja die EU-Sicherheitsagenden auch noch durch konkrete Maßnahmen ergänzt werden, in einer Sicherheitsunion umgesetzt werden, um eben diesen Bedrohungen des Terrorismus wirkungsvoller begegnen zu können.
Im Mittelpunkt von strafrechtlichen Aktivitäten werden Fortschritte beim Verfahrensrecht im Strafverfahren sowie die Fortsetzung des Kampfes gegen Betrügereien, die sich gegen die finanziellen Interessen der Union richten, einschließlich der Arbeit der Europäischen Staatsanwaltschaft stehen. Ich nehme an, Herr Minister, Sie werden dann aus Ihrer Sicht den Freiheitlichen genau erläutern, was damit gemeint ist und was damit bezweckt werden soll. Ich habe in dem Bericht gelesen, dass das österreichische Justizministerium das durchaus befürwortet, ich habe darin nicht gelesen, dass Sie das nicht befürworten – aber Sie werden das dann klarstellen, nehme ich einmal an.
Der vernetzte digitale Binnenmarkt ist schon erwähnt worden, auch Onlinehandel und Urheberrecht – alles wichtige Dinge. Im Privatrecht liegt der Schwerpunkt auf dem Familienrecht. Die e-Justice-Lösungen sind angesprochen worden. Die Umsetzung des EU-Aktionsplans gegen Terrorismusfinanzierung ist mit Sicherheit auch ein Mittel, um weiterhin gegen Terrorismus vorzugehen. Die Schlepperaktivitäten zu verhindern und Menschenhandel, insbesondere Menschenhandel mit unbegleiteten Jugendlichen, zu bekämpfen muss ein vorrangiges Ziel der Europäischen Union sein.
Es soll ja in diesem Zusammenhang auch konkrete Maßnahmen zur Schaffung einer Sicherheitsunion geben. Und dabei sollen folgende Dinge unter Strafe gestellt werden: Reisen zu terroristischen Zwecken, Finanzierung, Organisation und Erleichterung derartiger Reisen, die Teilnahme an einer Ausbildung für terroristische Zwecke und die Bereitstellung von Finanzmitteln für terroristische Straftaten. All das sollte natürlich verhindert werden, und wenn es nicht verhindert werden kann, dann doch bestraft werden.
Mit der Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche entspricht die Union einem Aktionsplan vom 2. Februar 2016. Es soll mit der Richtlinie internationalen Verpflichtungen wie
dem Warschauer Übereinkommen des Europarates entsprochen werden. Zusammengefasst kann man sagen, dass damit Mindestregeln über die Sanktionen von Geldwäsche im Strafrecht festgelegt werden. Und die Zusammenarbeit, die wichtig ist, und der Informationsaustausch zwischen den Behörden werden damit verbessert werden.
Es soll den Kriminellen in Zukunft nicht mehr möglich sein, Unterschiede, die es in den Straf- und Sanktionssystemen der einzelnen EU-Länder natürlich gibt, auszunutzen. Das ist beispielsweise der Fall, wenn in einem Staat etwas bestraft wird und in einem anderen nicht und sie dann den Staat wechseln, damit sie ungestraft davonkommen.
Dann gibt es Bestandteile, die die Eigengeldwäsche betreffen. Das ist auch sehr wichtig, und ich habe gelesen, dass die Bekämpfung auch einen Schwerpunkt während des Ratsvorsitzes Österreichs bilden wird.
Im Zivilrecht gibt es neben Vorschlägen zu Urheberrecht und Onlinewarenhandel – und das ist das Einzige, wo ich mit meinem Kollegen von den Freiheitlichen übereinstimme – diesen wirklich nicht unproblematischen Vorschlag über die Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet durch eine Person mit einem Mindestkapital von 1 €. Das werden wir hoffentlich nicht bekommen. Vielleicht können Sie, Herr Minister, sagen, ob wir uns da durchsetzen werden. Es geht dann auch noch um eine Initiative für Digitalisierung im Unternehmensrecht und eine Ihrer Initiativen zur Stärkung der Wettbewerbsbehörden, was auch sinnvoll wäre.
Wir nehmen den Bericht jedenfalls gerne zur Kenntnis. – Danke. (Beifall bei SPÖ, ÖVP und Grünen.)
17.10
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Zu Wort gelangt Frau Bundesrätin Dr. Dziedzic. – Bitte.
17.10
Bundesrätin Mag. Dr. Ewa Dziedzic (Grüne, Wien): Sehr geehrter Herr Bundesminister! Werter Herr Präsident! Geschätzte Kollegen und Kolleginnen! Auch wir nehmen den Bericht zur Kenntnis und sind der Meinung, dass es gerade bei der Terrorismusbekämpfung natürlich eine intensive internationale Zusammenarbeit braucht, das steht außer Frage und macht deshalb auch dieses Schließen der Durchsetzungslücken auf jeden Fall notwendig.
Besonders im Fokus in diesem Zusammenhang sind ja auch die Vorbereitungshandlungen wie Ausbildung und Auslandsreisen für terroristische Zwecke sowie die Beihilfe, die Anstiftung und der Versuch der Begehung einer terroristischen Handlung. Da müssen wir uns auch die Frage stellen, inwiefern sich Handlungsbedarf, vor allem konkreter Umsetzungsbedarf für Österreich ergibt. Das Austrian Center for Law Enforcement Sciences hat dazu ein paar Punkte formuliert, die Ihnen vielleicht auch bekannt sein werden, das betrifft die Opferschutzaspekte, aber auch zum Beispiel die Terrorismusfinanzierung.
Ein Punkt, der im Bericht erwähnt wird, ist aus unserer Sicht auch von Relevanz: der Abbau von Hindernissen, die strafrechtlichen Untersuchungen über Cyberstraftaten im Wege stehen. Das ist als Ziel formuliert, aber da hätten wir gerne gewusst, welche Hindernisse konkret im Visier sind, welche Hindernisse abgebaut werden sollen, damit die Untersuchungen voranschreiten können.
Das heißt, für uns stellt sich zum einen die Frage, inwiefern bei der Terrorismusbekämpfung Umsetzungsbedarf entsteht, aber in weiterer Folge – Kollegin Kurz hat erwähnt, dass es einige Zeit benötigen wird, bis diese ganzen Richtlinien umgesetzt werden können – stellt sich für uns auch die zweite Frage, nämlich inwiefern es auch noch den österreichischen Vorsitz betreffen wird. Vielleicht können Sie da eine Einschätzung abgeben,
was uns dann auch noch nächstes Jahr erwarten wird. Wir stimmen dem jedenfalls zu und erwarten uns gute Ergebnisse. – Vielen Dank. (Beifall bei Grünen, ÖVP und SPÖ.)
17.12
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Als letztem Redner zu diesem Punkt darf ich nun Herrn Bundesminister Dr. Brandstetter das Wort erteilen. – Bitte.
17.12
Bundesminister für Justiz Dr. Wolfgang Brandstetter: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren Bundesräte! Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, zu diesem Punkt gar nichts zu sagen, da es ein Bericht ist, den man einfach zur Kenntnis nimmt, und ich glaube, er ist auch – und für dieses Lob danke ich – klar und ausführlich genug. Der Redebeitrag des Herrn Bundesrates Werner Herbert hat mich jetzt aber doch dazu veranlasst, sozusagen in aller Freundschaft einige Punkte aufzugreifen, die, wie ich glaube, aufgegriffen werden müssen – inkludierend einige Klarstellungen und einige Fragen, die bezüglich dieses Berichts und unserer EU-Aktivitäten aufgetaucht sind.
Ich möchte eines vorausschicken: Sie sind immer so freundlich zu mir, und diese Freundlichkeit nehme ich jetzt für ein paar Minuten in Anspruch, ich werde sie nämlich brauchen, da ich durchaus deklarieren möchte, dass jemand aus meiner Generation natürlich auch eine emotionale Bindung an die Europäische Union hat, vor allem auch an die Friedensidee der EU. Ich habe auch im Zusammenhang mit dem früheren Eisernen Vorhang so viel erlebt. Ich bin nicht weit vom Eisernen Vorhang aufgewachsen, ich habe erlebt, dass Flüchtlinge, die bereits auf österreichischem Gebiet waren, von hinten erschossen wurden. Ich habe die Angst unserer Soldaten 1968 und ich habe die große Befreiung 1989 erlebt. Das sind die Dinge, die man nicht vergisst und die einen prägen. Das möchte ich nur gesagt haben, denn das sind emotionale Sachen, die man kennen muss.
Auch Herr Bundesrat Herbert hat ja eigentlich auf zwei Ebenen argumentiert, und es ist immer wichtig, dass man das unterscheidet: Er hat auf einer emotionalen und auf einer rationalen Ebene argumentiert. Man muss sich einfach klarmachen, dass es so ist. Daher sage ich ganz offen, auf emotionaler Ebene bin ich ein glühender Verfechter der Grundidee der Europäischen Union als Friedensidee, denn als Friedensprojekt hat sich das mehr als bewährt. Mittlerweile gibt es auch rationale Argumente jüngsten Datums, die das belegen, wenn Sie nur an die möglichen Brexit-Folgen für Gibraltar denken. Davon komme ich nicht weg.
Gerade deshalb, weil ich die EU als Friedensprojekt emotional immer verteidigen werde, sage ich aber auch, dass man sie in vielen Bereichen reformieren muss und dass es wichtig ist, dass man die kritischen Punkte auch anspricht. Das tue ich auch und damit muss man sich – und das ist die rationale Ebene der Argumentation des Herrn Bundesrates Herbert – auch auseinandersetzen. Ich bin mittlerweile im Justizministerrat in Brüssel einer der Dienstältesten, ich glaube, es gibt nur mehr zwei, die knapp länger im Amt sind als ich. Dadurch hat man schon auch einiges an Erfahrung und kann auch einiges, was sich da auf EU-Ebene tut, vielleicht ganz gut einschätzen, auch in meinem Fachbereich. Ich kann Ihnen etwas sagen, das einen als Österreicher jetzt erfreuen mag: Wir sind in vielen Bereichen des Rechts im Vergleich zu anderen EU-Staaten weit voran. Das ist auch der Grund, weshalb wir uns bei vielen Richtlinienumsetzungen leicht tun, weil wir schon längst dort sind, wohin die EU insgesamt erst will.
Ja, ich sage auch ganz offen – und insofern gebe ich dem Herrn Bundesrat ja recht –, dass man sich schon generell die Frage stellen muss, wie viel Vereinheitlichung eigentlich Sinn macht, in welchen Bereichen die Harmonisierung des Rechts Sinn macht. Es gibt sicher Bereiche, in denen das nicht nur Sinn macht, es gibt sicher auch Entwicklungen, vielleicht auch in der Vergangenheit, bei denen man sagen muss, na ja, da hät-
ten wir vielleicht andere Dinge dringender gebraucht als das, was damals gerade als prioritär angesehen wurde. Daher ist Kritik an der Prioritätensetzung der Europäischen Union, auch im legistischen Bereich – und den kann ich beurteilen –, sicherlich durchaus berechtigt, und die soll man auch wirklich diskutieren – keine Frage!
Ja, auch ich bin der Meinung, dass, wenn man schon vom gemeinsamen Haus Europa spricht und feststellt, das Dach ist undicht, es regnet herein, die Außenhaut ist undicht, das dann das wichtigste Problem und viel wichtiger als die Frage, welche Glühbirnen darunter verwendet werden, ist. Ja, das ist alles richtig, grundsätzlich, generell, wenn Sie wollen, der grundsätzlich emotional geprägten Kritik muss man sich stellen.
Unabhängig davon muss man aber schon auch sagen, in den einzelnen Punkten, die hier angesprochen wurden, geht es um wirklich sachliche Auseinandersetzung, geht es um Argumente. Dazu muss man einiges klarstellen. Erster Punkt: die Europäische Staatsanwaltschaft. Herr Bundesrat, du hast das erwähnt, da geht es bitte nicht darum, dass europäische Staatsanwälte den Job unserer Staatsanwälte im Inland übernehmen sollen – überhaupt nicht! –, sondern da geht es nur darum, dass europäische Staatsanwaltschaften oder eine europäische Staatsanwaltschaft die Möglichkeit haben soll, den Betrug zum Nachteil der Europäischen Union als solchen zu bekämpfen – inkludierend auch den Mehrwertsteuerbetrug –, und das geht nur grenzüberschreitend.
Da ist auch der Mehrwert, den du zu Recht eingefordert hast. Der Mehrwert ist, dass wir etwas bekämpfen können, das wir bisher einzelstaatlich kaum bekämpfen konnten. Das heißt, da können wir eigentlich alle miteinander nur gewinnen, daher macht das durchaus Sinn. Unsere Kritik bezog sich auf die praktische Umsetzung. Ja, ich habe auch im Justizministerrat gesagt: Das ist so wie bei einem Flugzeug, eine große Idee braucht Flügel und ein Fahrgestell. Uns geht es um das Fahrgestell. Es gibt da Regelungen, von denen wir meinen, dass man sie im Sinn von mehr Praktikabilität noch verbessern kann.
Grundsätzlich ist das richtig und kann es nur einen Mehrwert darstellen, wenn wir endlich auch grenzüberschreitende Betrugshandlungen zum Nachteil des Budgets der Europäischen Union – in das wir als Nettozahler selbst einzahlen – besser bekämpfen können. Deshalb bin ich auch dafür, dass wir da mitmachen. Ich kann es nur noch nicht deklarieren, einfach deshalb, weil sich zuletzt auch gezeigt hat, dass Kosten damit verbunden sein könnten. Daher muss ich das mit dem Finanzressort abstimmen – und das tun wir gerade.
Grundsätzlich würde ich aber meinen, es macht auch für Österreich Sinn, bei der kürzlich begonnenen verstärkten Zusammenarbeit mitzutun; und es wäre schön, wenn wir Mitgliedsland Nummer zwölf werden könnten, das da mitmacht – vorausgesetzt, das Finanzressort stimmt dem zu. Unter dem Strich, wie gesagt, kann es ja eigentlich nur einen Mehrwert darstellen, durchaus auch im ökonomischen Sinn.
Was die beiden anderen Punkte betrifft, die hier Gegenstand einer Frage waren: Eine Ein-Mann-GesmbH gibt es auch jetzt in unserem Recht; aber in einem Punkt muss ich Ihnen auch durchaus recht geben, wir werden natürlich – und das ist auch unsere Linie – schon darauf schauen, dass auch der Gläubigerschutz in diesem Bereich nicht zu kurz kommt. Das ist uns wichtig. Und insofern ist das auch etwas, was wir uns immer sehr genau anschauen werden, auch unter dem Aspekt, wie weit man da überhaupt im Sinn einer Vereinheitlichung gehen kann und soll.
Der letzte Punkt, der von Frau Bundesrätin Dr. Dziedzic angesprochen worden ist, ist ein sehr vielschichtiges Problem: Strafbarkeit im Internetbereich. Da geht es einerseits darum, dass Sicherheitsbehörden und Justizbehörden auf Daten im Netz – unter rechtsstaatlicher Kontrolle – besser zugreifen können sollen, andererseits geht es auch darum, dass man Internetkonzerne möglichst dazu zwingen können sollte, illegale Inhalte schnell wieder aus dem Netz zu entfernen.
Das ist eine sehr umfangreiche Thematik, bei der sich eben zeigt: Das ist ein Beispiel für eine sinnvolle Zusammenarbeit auf EU-Ebene, da macht es Sinn, auf EU-Ebene die Dinge anzupacken. Das ist etwas, das man auf internationaler Ebene und auf Augenhöhe mit den global tätigen Konzernen besser bewerkstelligen kann als auf nationalstaatlicher Ebene.
Wenn ich vielleicht eines noch sagen darf, weil das von Herrn Bundesrat Werner Herbert erwähnt wurde – das verstehe ich schon –: Ja, was die Haftzahlen betrifft, muss man schon auch sagen, dass es auch da einen Punkt im Bereich des EU-Rechts gibt, der verbesserungswürdig ist. Es gibt relativ viele Insassen aus EU-Staaten in unseren Haftanstalten. Das würde man vielleicht unterschätzen, aber das ist eine doch beachtliche Zahl. Ich habe das jetzt nicht genau im Kopf, aber einige Hundert sind das jedenfalls.
Wir haben die Rechtsgrundlage dafür, dass diese EU-Staatsbürger zur Fortsetzung der Strafvollstreckung in ihre Heimatländer überstellt werden können und sollen, einfach deshalb, weil sinnvollerweise Resozialisierung dort besser möglich ist, wo die Menschen ihr Umfeld haben, wo sie ihre Angehörigen haben. Da muss man sich halt in der Praxis schon sehr, sehr bemühen, damit diese Dinge auch wirklich funktionieren.
Wir haben in diesem Bereich im Vorjahr sehr schöne Erfolge gehabt, da ist es uns gelungen, einige Hundert EU-Staatsbürger zum Zweck der weiteren Strafvollstreckung in ihre Heimatstaaten zu transferieren. Ja, da gibt es von den Regelungen her – auch aus meiner Sicht, praktisch gesehen – Verbesserungsmöglichkeiten auch auf EU-Ebene. Ich will gesagt haben: Ja, mir ist bewusst, dass da in letzter Zeit einiges gelungen ist, aber da gibt es noch Luft nach oben.
Vor der Europäischen Staatsanwaltschaft braucht sich jedoch niemand zu fürchten, die bringt eigentlich, wenn sie einmal installiert ist, auch für Österreich nur einen Mehrwert. Ich bin daher wirklich dafür, dass wir da mitmachen. – Danke schön. (Beifall bei ÖVP und SPÖ sowie bei Bundesräten der Grünen.)
17.22
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Es ist dies nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir kommen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, den gegenständlichen Bericht zur Kenntnis zu nehmen, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit, der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Wasserrechtsgesetz 1959, das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000, das Immissionsschutzgesetz – Luft, das Klimaschutzgesetz, das Umweltförderungsgesetz, das Bundesluftreinhaltegesetz, das Altlastensanierungsgesetz, das Chemikaliengesetz 1996, das Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz, das Pflanzenschutzgesetz 2011, das Düngemittelgesetz 1994, das Futtermittelgesetz 1999, das BFW-Gesetz, das Rebenverkehrsgesetz 1996, das Produktenbörsegesetz, das Bundesgesetz über die Bundesämter für Landwirtschaft und die landwirtschaftlichen Bundesanstalten, das Klima- und Energiefondsgesetz 2007 und das Spanische Hofreitschule-Gesetz geändert und das Bundesgesetz zur Schaffung eines Gütezeichens für Holz und Holzprodukte aus nachhalti-
ger Nutzung, das Börsesensale-Gesetz und das Bundesgesetz über das Bundesamt für Wasserwirtschaft aufgehoben werden (Verwaltungsreformgesetz BMLFUW) (1456 d.B. und 1568 d.B. sowie 9748/BR d.B. und 9754/BR d.B.)
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Wir gelangen nun zum 26. Punkt der Tagesordnung.
Ich darf Herrn Bundesminister Andrä Rupprechter recht herzlich bei uns begrüßen. – Herzlich willkommen im Bundesrat! (Allgemeiner Beifall.)
Berichterstatterin ist Frau Bundesrätin Kern. Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatterin Sandra Kern: Sehr geehrter Herr Minister! Hohes Haus! Ich erstatte den Bericht des Ausschusses für Verfassung und Föderalismus über den Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend ein Verwaltungsreformgesetz BMLFUW.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich darf deshalb gleich zur Antragstellung kommen:
Der Ausschuss für Verfassung und Föderalismus stellt nach Beratung der Vorlage am 4. April 2017 mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Danke für den Bericht.
Wir gehen in die Debatte ein.
Als Erster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Samt. – Bitte.
17.24
Bundesrat Peter Samt (FPÖ, Steiermark): Herr Präsident! Herr Bundesminister Rupprechter! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Verwaltungsreformgesetz – ich bin heute für die sperrigen Sachen zuständig. Diese Sammelnovelle, die wir vorliegen haben, zielt auf eine Verwaltungsvereinfachung bei insgesamt 18 Gesetzen ab und sieht zudem die Aufhebung von drei weiteren Gesetzen vor, die totes Recht darstellen. Wesentliche Änderungen ergeben sich vor allem durch die Verwaltungsreform in den Bereichen der Umweltverträglichkeitsprüfung und des Wasserrechts.
Um gleich bei diesem Thema zu bleiben: Da hat es berechtigte Kritik von der Wirtschaftskammer gegeben, die im Rahmen der Begutachtung im November 2016 von einem Deregulierungspaket mit Schönheitsfehlern gesprochen hat, bezogen vor allem auf die künftig verpflichtende elektronische Meldung von wasserrechtlichen Befunden.
Da ist man ganz offensichtlich über das Ziel hinausgeschossen: Einerseits soll auf Bundesebene ein digitales Befundportal für alle Wasserberechtigten eingerichtet werden – auch wenn das Ministerium selbst mitgeteilt hat, es wolle eigentlich keine Daten sammeln, ist es doch in diese Richtung angedacht. Andererseits sind Wasserdatensysteme in den Ländern sehr unterschiedlich aufgebaut, sodass ein gemeinsames Portal – zumindest derzeit – ganz offensichtlich wenig Sinn macht.
Bedauernswert ist, dass durchaus sinnvolle Anträge betreffend eine Vereinfachung der wirtschafts- und umweltpolitischen Analysen, um den Ablauf der UVP zu entbürokratisieren, die die FPÖ, aber auch die NEOS im Nationalrat eingebracht haben, von den Regierungsparteien abgelehnt worden sind.
Die Verfahren, vor allem bei großen Infrastrukturprojekten, das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, sind viel zu lang. In vielen Fällen werden durch diese langen Verfahrensdauern Projekte zum Teil unmöglich gemacht oder sie werden vor allem für den, der sie bezahlen muss – nämlich für den Steuerzahler –, massiv verteuert, denn bei größeren Projekten geht es ja oft um Laufzeiten von mehreren Jahrzehnten. Das ist für uns ein absolut unhaltbarer Zustand, denn wir wissen, dass es da sicher sehr viel Nach-
holbedarf gibt. Diese Verbesserung ist mit dieser Novellierung noch nicht wirklich sehr gut beziehungsweise vollständig erfolgt.
Wir wundern uns außerdem massiv – diese Kritik erfolgte ja auch bereits im Nationalrat –, warum die Themen dieser Novelle, die doch überwiegend Umweltthemen sind, im Verfassungsausschuss und nicht im dafür zuständigen Umweltausschuss diskutiert werden. Das ist eine Kritik, die ja nicht nur von unserer Seite kommt, sondern auch von anderen im Nationalrat und im Bundesrat vertretenen Parteien.
Unverständlich ist auch, warum jetzt teilweise eine Reform des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes erfolgt, obwohl im Mai dieses Jahres die Umsetzung einer EU-Richtlinie ansteht.
Es ist für mich blanker Hohn, wenn im Plenum des Nationalrates ein SPÖ-Abgeordneter sagt, na ja, das neue Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz wird heuer eh noch ein zweites Mal novelliert, und dort erwartet er sich, so anscheinend die Ansicht der SPÖ, dass die Forderungen der Opposition – in diesem Fall insbesondere jene der FPÖ und der NEOS – damit erfüllt werden und sich dadurch die Anträge der Oppositionsparteien praktisch erübrigen. Geschätzte Damen und Herren, das ist eine Art von Parlamentarismus, die wir massiv ablehnen, denn mit Demokratie hat das nichts zu tun! (Beifall bei der FPÖ.)
Wir können also grundsätzlich feststellen: Auch wenn in dieser Novelle einige sinnvolle Vereinfachungen enthalten sind, ist jedoch das gesamte Gesetzespaket für uns überwiegend kein großer Wurf, es fehlt die Gesamtlinie. Ähnlich wie beim Deregulierungsgesetz, das wir heute schon besprochen haben, sieht das doch nach schwerem Scheinaktionismus der Bundesregierung aus.
Es darf Sie daher nicht wundern, wenn wir diesem Gesetz nicht zustimmen. – Ich danke für die Aufmerksamkeit. (Beifall bei der FPÖ.)
17.29
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Beer. – Bitte.
17.29
Bundesrat Wolfgang Beer (SPÖ, Wien): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Minister! Sehr geehrte Bundesräte! Das Verwaltungsreformgesetz BMLFUW soll der Verwaltungsvereinfachung dienen. Es wurde bereits gesagt, dass 18 Gesetze abgeändert und 3 Gesetze aufgehoben werden. Ich werde jetzt nicht alle 21 Themen behandeln, da dafür ganz einfach die Redezeit zu kurz wäre.
Diese Novellierungen sollen zu einer Beschleunigung und Vereinfachung in den einzelnen Materien führen. Als Beispiel möchte ich das UVP-Verfahren heranziehen: In diesem Bereich wird es Beschleunigungen geben, ohne die hohen Standards der UVP zu beschneiden. Es wurden Fristenläufe gestrafft, um Rechtsentscheide schneller erlassen zu können. Es wurden auch Doppelgleisigkeiten im Mitentscheidungsverfahren mehrerer Behörden reduziert.
Bei bestehender UVP und einer Sanierung dieser Bauten beziehungsweise Durchführung von Einbauten gibt es nun ein reduziertes Verfahren, eine schnellere Einzelfallprüfung, die auch eine schnellere und bessere Abhandlung gewährleisten wird.
Weil hier der Vorwurf kam, das wäre alles so schnell gegangen, und die Ansinnen der Opposition wären nicht wirklich zur Kenntnis genommen worden, möchte ich doch sagen, dass diese Kommission, die dieses beachtliche Paket auf den Weg gebracht hat, wirklich sehr lange und ausführlich diskutiert hat. Es war immerhin schon im Jahr 2015, dass diese Deregulierungskommission eingesetzt wurde. Seit 2015 hat es also die Mög-
lichkeit gegeben, etwas dazu zu sagen. Das ist von einer Partei nicht wahrgenommen worden, von einer zweiten auch nicht – aber im Nationalrat wurde dann bekrittelt, dass man da niemanden beachtet.
In den Bereichen Umwelt, Wasserwirtschaft und Landwirtschaft war es höchst an der Zeit, Reformen und Vereinfachungen durchzuführen, was mit diesem Gesetz teilweise geschieht. Das kann aber nicht der Weisheit letzter Schluss sein, sondern es muss ein andauernder Prozess der Anpassung stattfinden. Das ergibt sich schon allein aus dem Umstand, dass auch nach EU-Recht angepasst werden muss, wie zum Beispiel, dass eben das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes noch im Jahr 2017 angepasst werden soll.
Mich würde noch interessieren, wie eine Verlegung des Bundesamtes für Wasserwirtschaft von Wien nach Scharfling am Mondsee in Oberösterreich Einsparungen und Verfahrensbeschleunigungen bringen soll. Wie wir alle wissen, ist ein Umzug immer eine teure Angelegenheit, und mich würde interessieren, wie viel an Einsparung durch diese Übersiedlungsmaßnahme dem österreichischen Staat gutgeschrieben werden kann.
Im Großen und Ganzen ist diese Novellierung jedoch trotzdem sehr gut, darum werden wir ihr auch zustimmen. (Beifall bei der SPÖ sowie bei Bundesräten der ÖVP.)
17.33
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Mag. Schreyer. – Bitte.
17.33
Bundesrätin Mag. Nicole Schreyer (Grüne, Tirol): Hohes Haus! Sehr geehrter Herr Minister! Sehr geehrte Gäste, hier und zu Hause! Die Regierungsvorlage umfasst Novellierungen von 21 Gesetzen im Bereich des Lebensministeriums. Behandelt wurde sie bei uns im Verfassungsausschuss – das habe ich ein bisschen komisch gefunden, denn inhaltliche Fragen sind so natürlich komplett unbeantwortet geblieben.
Es ist total unverständlich, dass das bei uns nicht im Umweltausschuss oder im Ausschuss für Land-, Forst- und Wasserwirtschaft – oder am besten in beiden –behandelt wurde. Umso größer ist meine Freude, dass der Herr Minister jetzt hier ist und meine Fragen wahrscheinlich direkt beantworten kann. (Bundesrat Mayer: Keine Fragestunde ist das!) – Aber er wird sicher darauf eingehen, hoffe ich. (Neuerlicher Zwischenruf des Bundesrates Mayer.)
Wir stimmen sehr vielen dieser 21 Punkte zu, zum Beispiel dem Bundesluftreinhaltegesetz, Pflanzenschutzgesetz, Futtermittelgesetz und natürlich auch dem Spanische Hofreitschule-Gesetz. Ich kann jetzt gar nicht alles aufzählen, dazu reicht die Zeit nicht mehr. Vielen Punkten stimmen wir aber nicht zu, und ich werde einfach ein paar Punkte herauspicken, zum Beispiel das Wasserrechtsgesetz.
Wir Grüne werden den vorgeschlagenen Änderungen zum Wasserrechtsgesetz nicht zustimmen, denn wir sehen einige Änderungsvorschläge sehr kritisch. Viele Dinge werden als Vereinfachung dargestellt, sind aber für uns eine Schwächung der Instrumente.
Was etwa den Entfall der Bestimmungen für die Gewässerbeschau angeht: Es soll zwar weiterhin irgendwie vom Instrument der Gewässerbeschau Gebrauch gemacht werden, aber im Rahmen der Gewässeraufsicht. Da haben wir einfach Bedenken, dass dies das Instrument der Gewässerbeschau sehr schwächen könnte.
Ein anderes Beispiel ist die Aufgabe des Sechsaugenprinzips: Künftig kann ein Planer einer Anlage auch die bewilligungsmäßige Ausführung der Anlage, die er selbst geplant hat, bestätigen. Wir denken, dass da der Überprüfungsaufwand der Behörden sogar noch größer werden könnte – das muss aus unserer Sicht weiterhin jemand Unabhängiger machen.
Der Punkt, den wir im Wasserrechtsgesetz am kritischsten sehen, ist die Ausweitung der Verlängerungsfristen für Sanierungen nach dem Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan, weil da einfach genau das Gegenteil von dem geschieht, was geschehen sollte: Es wird noch mehr Zeit gegeben, anstatt dass bisschen mehr Druck gemacht wird.
Es geschieht generell viel zu wenig in der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Der neue Nationale Gewässerbewirtschaftungsplan ist seit über zwei Jahren in der öffentlichen Begutachtung – es ist nichts passiert, es stehen noch keine Mittel zur Verfügung! Im Jänner 2015, wir haben schon einmal darüber gesprochen, wurde er in die öffentliche Begutachtung geschickt, seit Juli 2015 ist diese öffentliche Begutachtung abgeschlossen und seitdem liegt er, es ist nichts mehr geschehen.
Der Nationale Gewässerbewirtschaftungsplan hätte eigentlich Anfang 2016 in Kraft treten sollen, er hat auch einen Gültigkeitszeitraum von 2016 bis 2021, also sind wir jetzt schon über ein Jahr im Verzug. Da gehört wirklich dringend etwas gemacht!
Beim Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz gibt es auch viele Dinge, die einfach nicht passen, zum Beispiel der Entfall der Stellungnahme des Umweltbundesamtes bei Umweltverträglichkeitserklärungen. Es fehlt die Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie von 2014, das hat der Vorredner gerade erwähnt, da läuft jetzt die Umsetzungsfrist aus, da müssen wir auch weitertun.
Zum Immissionsschutzgesetz – Luft: Es gibt einige Verbesserungen wie etwa strengere Strafbestimmungen bei Geschwindigkeitsübertretungen (Bundesrat Beer: Wunderbar!), das betrifft uns in Tirol ja besonders, und notwendige Anpassungen sind im vorliegenden Entwurf auch enthalten.
Wir Grüne können aber trotzdem nicht zustimmen, weil einfach maßgebliche Sachen nicht passen: Es fehlt zum Beispiel das Recht von Einzelpersonen und Umweltorganisationen auf ein geordnetes Verfahren zur Durchsetzung von Feinstaubmaßnahmen, das ist nicht umgesetzt worden. Sie ignorieren damit weiterhin konsequent die einschlägigen Bestimmungen in der Aarhus-Konvention, es gibt sogar bereits Mahnschreiben der EU-Kommission dazu, trotzdem ist nichts umgesetzt worden.
Es gibt weitere Umsetzungsdefizite, die einfach noch nicht angegangen worden sind, die vielleicht noch nicht ganz so dringend oder drückend, wie die aktuellen Feinstaubwerte in ganz Österreich und das laufende Vertragsverletzungsverfahren wegen kontinuierlicher Überschreitungen der Stickstoff-Jahresgrenzwerte sind. Da gäbe es zusätzlichen Änderungsbedarf, zum Beispiel, dass es keine Zulassung von zusätzlichen Emittenten gibt, solange die alten Emittenten nicht saniert worden sind.
Es geht weiter beim Umweltförderungsgesetz – da sind wir wieder beim Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan –: Im Umweltförderungsgesetz ist in der aktuellen Fassung vorgesehen, dass die Minister in regelmäßigen Abständen, spätestens alle drei Jahre, Erfolg und Effizienz der Förderungen und Ankäufe dem Nationalrat zur Kenntnis bringen, damit diese öffentlich diskutiert werden können.
Im vorliegenden Entwurf gibt es einen vorgeschlagenen Entfall der jährlichen Berichtspflicht des Lebensministeriums über die Vollziehung des Umweltförderungsgesetzes, damit entfällt eben auch die öffentliche Debatte. So verschlechtern Sie die Kontrollmöglichkeiten des Parlaments im Zusammenhang mit Umweltförderungen. Angeführt ist das ja unter dem Punkt Kontrolle und Effizienz – wir finden nicht, dass das zu Kontrolle und Effizienz führt, sondern zu weniger Transparenz.
Die vorliegende Novelle, auch jene des Umweltförderungsgesetzes, müsste eigentlich schon die vorhin angesprochene neue Regelung zur Fortführung der Förderungen für gewässerökologische Sanierungsmaßnahmen beinhalten, eben für die zweite Periode des Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplans – 2016 bis 2021. Die Dotierung für diesen
zweiten Gewässerbewirtschaftungsplan ist ja offensichtlich der Grund, warum sie jetzt noch immer nicht drinnen ist, warum sie immer noch nicht verordnet worden ist – das fehlt einfach komplett. Es gibt noch ein paar Restmittel zum Ausschöpfen, aber es sind immer noch keine neuen Mittel für gewässerökologische Sanierungsmaßnahmen bereitgestellt worden. Es ist wirklich eine unhaltbare Situation, dass in Österreich nicht mehr und nicht schneller etwas passiert. Seit Ende 2015 drängen wir schon darauf, dass da endlich verordnet und umgesetzt wird.
Abschließend noch zum Klimaschutzgesetz, bei welchem eine Reorganisation stattfindet: Es gibt eine Zusammenlegung von zwei Gremien mit beratender Funktion, nämlich des Nationalen Klimaschutzbeirats und des Nationalen Klimaschutzkomitees. Wir würden ja prinzipiell begrüßen, dass parallele Gremien zusammengelegt werden, das finden wir sehr gut, aber im Nationalen Klimaschutzbeirat war bis jetzt eh schon ein erhöhtes Quorum erforderlich, eine Zweidrittelmehrheit, um dort Beschlüsse zu fassen oder vorzuschlagen – es ist ja eh nur ein beratendes Gremium –, und im Nationalen Klimaschutzkomitee war eine Dreiviertelmehrheit nötig. Also wir wissen, eine Dreiviertelmehrheit in einem Gremium zusammenzubringen ist nicht einfach, da tun wir uns auch immer schwer.
In der Begutachtung war für das zusammengelegte, neue Nationale Klimaschutzkomitee, das dann daraus entstehen soll, noch die Zweidrittelmehrheit drinnen. Jetzt ist es die Dreiviertelmehrheit. Und uns ist eben total klar: Progressive Ideen werden kaum Chancen haben, da jemals durchzukommen, wenn sie eine Dreiviertelmehrheit brauchen.
Alles in allem können wir einigen Gesetzen dieser Sammelnovelle zustimmen, aber insgesamt überwiegen für uns einfach die Kritikpunkte, und gesammelt abgestimmt können wir einfach keine Zustimmung geben. – Danke schön. (Beifall bei den Grünen.)
17.42
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Preineder. – Bitte.
17.42
Bundesrat Martin Preineder (ÖVP, Niederösterreich): Hoher Bundesrat! Geschätzter Herr Bundesminister! Wenn wir die Bevölkerung fragen, was sie sich von der Politik wünscht, dann ist das in erster Linie Verwaltungsvereinfachung, weniger Bürokratie, Bürokratieabbau; vor allem wenn man mit Unternehmern, mit Selbständigen spricht, ist das ein intensiverer Wunsch als eine Senkung der Steuern, weil wir in vielen Bereichen sehr gut, um nicht zu sagen, übergut verwaltet sind.
Darum spreche ich ein herzliches Dankeschön und Gratulation für den Ansatz, im Haus den Auftrag zu erteilen, eine Verwaltungsreformkommission einzusetzen, die in deinem Verwaltungsbereich – im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft – durchforstet, welche Regeln vereinfachbar sind, aus. Ich denke, das ist ein sehr guter Ansatz, ein Ansatz, der beispielgebend ist und vielleicht auch in anderen Häusern Platz greift. Es ist natürlich Kritik da, und das kennen wir von den Kollegen der Freiheitlichen Partei, nämlich dass es zwar gut ist, aber zu wenig – das macht man halt immer, wenn man nicht zustimmen will.
Dass seitens der Grünen immer wieder mehr Verwaltung und mehr Kontrolle gewünscht wird, vor allem im Umweltbereich, verstehe ich auch, liebe Kollegin Schreyer, aber wenn ich mir die Kritik am Sechsaugenprinzip anschaue – dass der Planer das nicht bestätigen darf –, dann sage ich: Bei uns in Niederösterreich ist es in der Bauordnung, im Baurecht ganz und gar üblich, dass der, der die Bauausführung hat, auch die Richtigkeit der Ausführung bestätigt. Also das kann man durchaus umlegen. (Bundesrat Samt: Ihr habt ja bis jetzt den Erwin gehabt!)
In Summe sind sehr viele Bereiche, ob Wasserwirtschaft, Umwelt, Landwirtschaft, Klimarecht, Spanische Hofreitschule, vereinfacht worden. Das ist ein positiver Ansatz, der wie gesagt für mich beispielgebend ist. Wenn wir das Thema Verwaltungsreform ernst nehmen, dann müssen wir solche Ansätze forcieren. Ich freue mich, dass dieser Ansatz passiert. Ich darf dich, Herr Minister, auch bei der Bestrebung unterstützen, Bundesstellen zu dezentralisieren, in die Bundesländer hinauszubringen, was uns als Bundesräten durchaus entgegenkommt und dem wir durchaus wohlwollend und positiv gegenüberstehen. – Herzlichen Dank für deine Initiative. Wir werden dem zustimmen. (Beifall bei der ÖVP und bei Bundesräten der SPÖ.)
17.44
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Als vorläufig Letzter zu diesem Tagesordnungspunkt hat sich Herr Bundesminister Dipl.-Ing. Rupprechter zu Wort gemeldet. – Bitte.
17.44
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Dipl.-Ing. Andrä Rupprechter: Herr Vorsitzender! Hoher Bundesrat! Geschätzte Bundesrätinnen und Bundesräte! Ich freue mich, dass wir heute diesen Tagesordnungspunkt auf der Grundlage des Berichtes des Ausschusses für Verfassung und Föderalismus, der sich ausführlich mit dieser Sammelnovelle befasst hat, hier behandeln können. Und ich denke schon, dass es richtig ist, die Schlussfolgerung treffen zu können, dass es sich dabei wirklich um einen großen Wurf der Deregulierung, der Entbürokratisierung handelt. Und ich bin dankbar, dass das auch mehrheitlich so zum Ausdruck gebracht worden ist. Es ist tatsächlich ein großer Wurf. Und es ist ein guter Tag für die österreichischen Bürgerinnen und Bürger, wenn wir heute hier in der Kammer des Föderalismus diesen Beschluss fassen können.
Wir haben tatsächlich 50 Bundesgesetze durchforstet, 280 Verordnungen, für die mein Ressort zuständig ist, wir haben die gemeinsame Agrarpolitik ausgeklammert, weil ja die Regulative dort Verordnungen und Richtlinien des Rates und des Europäischen Parlaments sind, aber dennoch haben wir es uns nicht einfach gemacht.
Eine Kommission hat mehr als ein Jahr daran gearbeitet und uns nach ausführlicher Begutachtung und Berücksichtigung der Stellungnahmen diese Vorlage vorgelegt, in der die Interessen im Bereich des Umweltschutzes nicht beeinträchtigt werden, denn das hat die Debatte sowohl im Nationalrat als auch bei Ihnen im Verfassungsausschuss gezeigt: Es konnte kein einziger Tatbestand dargestellt werden, dass die Schutzwirkung unserer Umweltgesetze, die in dieser Sammelnovelle reformiert werden, irgendwo reduziert worden ist oder dass eingegriffen worden ist, wie das von den Grünen wiederholt behauptet worden ist. Das ist einfach nicht zutreffend.
Ich bin übrigens froh, dass die Jungen Grünen doch immer noch hier sind. Ich habe den Medien entnommen, dass ihr hinausgeworfen worden seid. Ich bin jetzt sehr beruhigt, dass ihr doch noch da seid. (Allgemeine Heiterkeit. – Zwischenruf des Bundesrates Stögmüller.) – Das ist Sache des Klubs.
Auf eine Kritik, liebe Frau Bundesrätin Schreyer, möchte ich jetzt aber schon eingehen, weil das auch im Plenum des Nationalrates wiederholt kritisiert worden ist: Die Zuweisung, in welchem Ausschuss die Novellen behandelt werden, ist ausschließlich Sache des Hohen Hauses. Da hat ein Regierungsmitglied einfach demütig zu sein und in den Ausschuss beziehungsweise in das Gremium zu kommen, in dem das behandelt wird. Ich glaube, dass diese Kritik, was mich anbelangt, nicht zutreffend ist, und ich muss sagen, wir haben sowohl im Nationalrat im entsprechenden Ausschuss als auch im Bundesrat, glaube ich, eine wirklich eingehende und gute Debatte geführt. Ich glaube, ich kann es Ihnen ersparen, jetzt im Detail auf die vielen Novellen, die Reduktionen, die wir durchgeführt haben, einzugehen. Die Materie haben Sie ja in dem Bericht wirklich ex-
plizit dargestellt. Wir haben in vielen Bereichen die Verfahren deutlich vereinfacht. Wir haben in vielen Bereichen Bewilligungstatbestände durch Anzeigeverfahren ersetzt, allein im Wasserrechtsgesetz werden wir uns dadurch bei kleinen Projekten jährlich mehr als 2 000 Verfahren sparen, also das bringt schon eine deutliche Entlastung, vor allem auch für viele Betreiber von kleinen Wasserkraftanlagen. Das ist gerade auch ein wichtiger Impuls in Richtung Energiewende, die so notwendig ist.
Im Bereich des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes habe ich mich selbst beschränkt – und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Schritt gewesen –, indem ich das Vorabstellungnahmerecht der Oberbehörde gestrichen habe, denn das UVP-Verfahren ist ein Konzentrationsverfahren. Alle anhängigen Verfahren sollen in einer Behörde konzentriert werden. Es hat sich auch gezeigt, dass die Verfahren tatsächlich schneller geworden sind, und da habe ich für sehr unsinnig gehalten, dass wir, der Minister, das Ministerium als Oberbehörde, in so einem Konzentrationsverfahren der zuständigen Behörde – das sind meistens Landesbehörden – quasi vorab eine Stellungnahme abgeben und damit mehr oder weniger vorgeben, was die Linie ist. Das halte ich für widersinnig. Wir haben ja ganz bewusst dieses Konzentrationsverfahren, deswegen habe ich auch diese Vorabstellungnahme ganz bewusst gestrichen.
Wie bereits auch während der Debatte gesagt: Es ist damit wirklich ein großer Wurf gelungen, und wir haben mit 18 Bundesgesetzen, die novelliert werden, tatsächlich eine deutliche Beschleunigung der Verfahren erreichen können. Drei Gesetze werden überhaupt gestrichen. Ich glaube, das kann man auch anerkennen.
Abschließend zu Bundesrat Preineder: Ich kann das nur voll und ganz unterstreichen. Für mich ist die Stärkung der Regionen ein sehr wichtiges Ziel. Wir haben uns ja auch im Arbeitsübereinkommen der Bundesregierung für die Erstellung eines Masterplans zur Stärkung der ländlichen Regionen ausgesprochen.
Wir arbeiten an diesem Prozess gemeinsam mit den Bundesländern und vor allem auch mit den Gemeinden. Ein wichtiger Meilenstein soll die Verlagerung von Bundeszentraleinrichtungen hinaus in die Regionen sein, wie das beispielsweise Bayern seit zwei Jahren ganz gezielt praktiziert und womit Bayern auch schon sehr gute Erfahrungen gemacht hat. Ich habe mir das vor Ort angesehen. Wir gehen da auch mit gutem Beispiel voran. Ich muss schon sagen, wenn wir das Bundesamt für Wasserwirtschaft bewusst draußen am Wasser in einer Region, in dem Fall in Oberösterreich, in Scharfling am Mondsee, ansiedeln, dann bewirkt das nicht unbedingt eine Verbilligung, da gebe ich Ihnen recht, aber die Stärkung der Regionen muss auch ihren Preis haben, dazu stehe ich, und ich denke, es ist sachlich gerechtfertigt.
Ich bin übrigens auch sehr froh, dass wir mit der Novelle des Spanische Hofreitschule-Gesetzes einerseits den Standort Piber stärken – es war ja auch ein Wunsch des Marketings, diese Novellierung in der Form vorzunehmen – und gleichzeitig auch für Niederösterreich den Heldenberg in dieser Novelle verankern konnten, weil dieser Standort auch, gerade was Tierschutz anbelangt, für unsere Hengste, die das ganze Jahr über sehr harte Arbeit durchführen, sehr wichtig ist. (Allgemeine Heiterkeit.) – Ich rede jetzt nicht von den Zuchthengsten, sondern von der Hohen Schule. Ein Schelm, der Schlimmes denkt, hätte ich jetzt fast gesagt. (Bundesrat Mayer: Es sind die Grünen, bitte!)
Das ist die Sömmerung draußen am Heldenberg, damit die Tiere Auslauf haben und sich von dieser schweren Arbeit erholen können. Auch das ist eine Stärkung der Regionen, die, glaube ich, mehr als wünschenswert ist. In diesem Sinne bedanke ich mich für die sehr positive Grundstimmung.
Herr Bundesrat Samt, ich kann Ihnen versichern, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, die Anliegen der Opposition werden wir auch in der Novelle des UVP-Gesetzes nicht umsetzen. – Danke. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
17.52
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir gelangen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und dem Ministerrat Bosnien und Herzegowinas über die wissenschaftlich-technologische Zusammenarbeit (1370 d.B. und 1505 d.B. sowie 9755/BR d.B.)
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Nun gelangen wir zu Punkt 27 der Tagesordnung.
Ich darf Frau Bundesministerin Sonja Hammerschmid bei uns herzlich willkommen heißen. (Beifall bei der SPÖ und bei Bundesräten von ÖVP und FPÖ.)
Berichterstatterin ist Frau Bundesrätin Junker. Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatterin Anneliese Junker: Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzte Frau Bundesminister! Meine Damen und Herren! Ich berichte aus dem Ausschuss für Wissenschaft und Forschung über den Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und dem Ministerrat Bosnien-Herzegowinas über die wissenschaftlich-technologische Zusammenarbeit.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor; ich komme zur Antragstellung.
Der Ausschuss für Wissenschaft und Forschung stellt nach Beratung der Vorlage am 4. April 2017 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag,
1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben,
2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Ich danke für den Bericht.
Wir gehen in die Debatte ein.
Als Erster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Ing. Pum. – Bitte, Herr Bundesrat.
17.55
Bundesrat Ing. Andreas Pum (ÖVP, Niederösterreich): Geschätzter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Bundesministerin! Werte Kolleginnen und Kollegen des Bundesrates! Liebe Gäste! Die wissenschaftlich-technologische Zusammenarbeit mit Bosnien-Herzegowina hat nicht die Brisanz von TTIP oder CETA, aber letztlich geht es hier auch um eine sehr klare Zusammenarbeit mit einem Anwärterland zur Europäischen Union, und sie rückt vor allem auch das Thema Integration in den Mittelpunkt. Hier geht es darum, diese Vorbereitung im Sinne eines Abkommens zu tätigen.
Ich glaube, dieses Abkommen stärkt Synergien, vor allem ermöglicht es, neue Wege in der Zusammenarbeit zu finden, und nicht zuletzt ist es ein Abkommen, das auf ideelle Unterstützung setzt, und hier geht es vorwiegend um Zusammenarbeit. Gegenseitigkeit und Berücksichtigung staatlicher Prioritäten ist ein Passus dieses Abkommens. Es beschreibt die Festlegung von Zielsetzungen – sei es finanzieller, inhaltlicher oder infrastruktureller Natur – und setzt vor allem innerstaatliche Forschungsschwerpunkte.
Das Abkommen ist in den Kosten beschränkt. 90 000 € werden jährlich seitens des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung übernommen.
Die Zusammenarbeit setzt natürlich auch einen gemeinsamen Schwerpunkt und setzt vor allem voraus, dass die Fragen geklärt sind, wer letztlich für Ergebnisse verantwortlich ist und wer den Schutz des geistigen Eigentums regelt. Das ist eine wesentliche Frage, denn besonders im Bereich der Forschung und Entwicklung geht es um das Ergebnis und darum, wer für diese Ergebnisse verantwortlich ist. Die Nutzung dieser Ergebnisse ist beidseitig in Vereinbarungen geregelt, und da gibt es natürlich auch die nationalen Gesetze, die in diesem Bereich ihren Niederschlag finden.
Ich kann abschließend nur sagen, da es keine klaren Projekte in diesem Abkommen gibt, die beschrieben werden können, dass diese Zusammenarbeit in vielen fruchtbaren Ergebnissen ihren Niederschlag finden wird und dass diese Projekte enorm zu einer Stabilisierung innerhalb Europas und vor allem zur Sicherheit beitragen werden. In diesem Sinne werden wir diesem Abkommen natürlich unsere Zustimmung geben. – Vielen Dank. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
17.57
Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Als Nächster darf ich Frau Bundesrätin Blatnik das Wort erteilen. – Bitte.
17.58
Bundesrätin Ana Blatnik (SPÖ, Kärnten): Herr Präsident! Gospod president! Frau Bundesministerin! Gospod zvezna ministrica! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Drage kolegice in kolegi! Der Mensch kann Grenzen bauen, der Mensch kann aber auch Brücken bauen, und ich glaube, gerade so ein Abkommen ist eine Möglichkeit, Brücken zu bauen – Brücken zu einem friedlichen Miteinander, zur Begegnung –, eine Möglichkeit, die Hand auch zu Andersdenkenden auszustrecken. Wenn ich vom friedlichen Miteinander spreche, dann meine ich, dass so ein Abkommen auch der politischen Spannung entgegenwirken kann und dass ein solches Abkommen, so ein Zusammenarbeiten selbstverständlich auch längerfristig die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Ländern verbessern und fördern kann. (Präsidentin Ledl-Rossmann übernimmt den Vorsitz.)
Im Vordergrund steht das Gemeinsame, Teamwork und nicht Einzelarbeit, weil man glaubt, dass man im Team, in der Teamarbeit mehr erreichen und erfolgreicher sein kann.
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Dieses Miteinander – das hat mein Vorredner schon gesagt, aber ich möchte es noch einmal wiederholen, weil ich es als sehr wichtig empfinde – fördert selbstverständlich die Internationalisierung, das heißt, gerade dieser europäische Gedanke, den ich unterstreichen will, steht im Vordergrund, und auch das ist positiv.
Das Abkommen ist der rechtliche Rahmen für diese Zusammenarbeit zwischen Österreich und Bosnien-Herzegowina, und zwar im Bereich der Wissenschaft und der Technologie. Es geht um den Austausch und die Entsendung der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, der Experten und Expertinnen, es geht um gemeinsame Gespräche, um Kooperationen, es geht um Dokumentationen, die gemeinsam gemacht werden. So eine Zusammenarbeit ist meiner Meinung nach etwas Positives, eine Bereicherung, ein Gewinn; und jede Investition in eine solche Zusammenarbeit begrüße ich sehr.
(Die Rednerin setzt ihre Ausführungen in slowenischer Sprache fort.)
Danke. Hvala lepa. (Beifall bei der SPÖ sowie bei Bundesräten von ÖVP und Grünen.)
18.00
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir gelangen zur Abstimmung.
Da der gegenständliche Beschluss Angelegenheiten der selbständigen Wirkungsbereiche der Länder regelt, bedarf dieser der Zustimmung des Bundesrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 B-VG.
Wir gelangen zunächst zur Abstimmung, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit, der Antrag ist somit angenommen.
Nun lasse ich über den Antrag abstimmen, dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, um ein Handzeichen. – Das ist ebenfalls die Stimmeneinhelligkeit, der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Berufsreifeprüfungsgesetz und das Prüfungstaxengesetz geändert werden (2017/A und 1580 d.B. sowie 9778/BR d.B.)
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Wir gelangen nun zum 28. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatter ist Herr Bundesrat Koller. Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatter Hubert Koller, MA: Hohes Haus! Frau Präsidentin! Liebe Frau Bundesministerin! Ich bringe den Bericht des Ausschusses für Unterricht, Kunst und Kultur über den Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Berufsreifeprüfungsgesetz und das Prüfungstaxengesetz geändert werden.
Der Bericht liegt schriftlich vor; ich komme daher sogleich zur Antragstellung.
Der Ausschuss für Unterricht, Kunst und Kultur stellt nach Beratung der Vorlage am 4. April 2017 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Vielen Dank für den Bericht.
Wir gehen in die Debatte ein.
Als Erste zu Wort gelangt Frau Bundesrätin Grimling. – Bitte, Frau Bundesrätin.
18.03
Bundesrätin Elisabeth Grimling (SPÖ, Wien): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau Bundesministerin! Werte Kolleginnen und Kollegen des Bundesrates! In den bereits jahrelang andauernden Bemühungen um eine umfassende Reform der Bildungsbereiche wurden bereits zahlreiche Schritte der Gesetzgebung gesetzt. Dazu gehört auch die teilzentrale standardisierte Reifeprüfung im Berufsreifeprüfungsgesetz. Mit dem vorliegenden Entwurf sollen vor der erstmaligen Durchführung dieser teilzentralen standardisierten Berufsreifeprüfung zum Haupttermin 2017 Anpassungen an die entsprechenden Bestimmungen im Schul- und Externistenprüfungswesen erfolgen sowie Klarstellungen vorgenommen und redaktionelle Versehen bereinigt werden.
Die Berufsreifeprüfung ist eine große Errungenschaft der Erwachsenenbildung, weil sie durch das Nachholen von Bildungsabschlüssen im zweiten Bildungsweg Chancengleich-
heit durch Zugang zu höherer Bildung ermöglicht. Sie besteht aus vier Teilprüfungen in Deutsch, Mathematik beziehungsweise Mathematik und angewandter Mathematik, einer lebenden Fremdsprache und einem Fachbereich mit einer Klausur- oder Projektarbeit.
Im Prüfungsgebiet Mathematik beziehungsweise Mathematik und angewandte Mathematik soll bei negativer Beurteilung der schriftlichen Klausurarbeit die Möglichkeit einer mündlichen Kompensationsprüfung vorgesehen werden. Die Ablegung der mündlichen Kompensationsprüfung erfolgt auf Antrag der Prüfungskandidatin oder des Prüfungskandidaten und ist nur zum selben Prüfungstermin zulässig.
Prüfungstermine und Aufgabenstellungen mündlicher Kompensationsprüfungen sowie auch die für die Beurteilung maßgeblichen Korrektur- und Beurteilungsanleitungen werden durch die zuständige Bundesministerin vorgegeben.
Maximal drei Teilprüfungen können an einer Erwachsenenbildungseinrichtung abgelegt werden, mindestens aber eine Teilprüfung an einer Schule. Um räumliche Engpässe an den Prüfungsschulen, die durch den einheitlichen Prüfungstermin entstehen können, zu vermeiden, sieht die Änderung des Berufsreifeprüfungsgesetzes vor, dass diese eine Prüfung auch an einem anderen geeigneten Prüfungsort abgehalten werden kann.
Was die Änderungen im Bereich der Abgeltung der Prüfungstaxen für die Vorsitzenden der Prüfungskommissionen anlangt, muss der Mehraufwand berücksichtigt werden, der zusätzlich zum fallweisen Nichterscheinen von Prüfungskandidatinnen oder Prüfungskandidaten zu einzelnen Teilprüfungen dadurch entsteht, dass die Teilprüfungen der Berufsreifeprüfung an unterschiedlichen Tagen und an externen Prüfungsorten, nämlich an den Einrichtungen der Erwachsenenbildung, stattfinden.
Es handelt sich sohin bei dem vorliegenden Gesetzentwurf um eine weitere sinnvolle Neuregelung im Sinne jener Maßnahmen, die die Bildungsreform wirkungsvoll unterstützen sollen.
Meine Fraktion gibt dem vorliegenden Entwurf ihre Zustimmung. – Danke. (Beifall bei der SPÖ.)
18.07
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Als Nächste zu Wort gelangt Frau Bundesrätin Kern. – Bitte.
18.07
Bundesrätin Sandra Kern (ÖVP, Niederösterreich): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Geschätzte Frau Minister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Berufsreifeprüfung feiert heuer ihr zwanzigjähriges Jubiläum. Seit 20 Jahren eröffnet die Berufsreifeprüfung Erwachsenen neue Aussichten in ihrem Job und in ihrem Berufsleben. Pro Jahr gibt es in ganz Österreich zwischen 3 000 und 3 500 Absolventen der Berufsreifeprüfung. In Niederösterreich wurden im letzten Jahr 400 junge Erwachsene mit rund 325 000 € bei ihrer Berufsreifeprüfung gefördert. Das zeigt, dass die Matura im zweiten Bildungsweg beliebt und wichtig ist. Gerade für Menschen, die sehr früh in den Arbeitsprozess einsteigen und erst später den Wunsch nach einer höheren Weiterbildung verspüren, schafft die Berufsreifeprüfung neue Perspektiven.
Heute beschließen wir Änderungen, die die Berufsreifeprüfung endgültig mit der Matura gleichsetzen, so kann nun auch ein Maturant, wie schon besprochen, bei der Berufsmatura im Fach Mathematik eine mündliche Kompensationsprüfung machen, wenn die schriftliche Prüfung negativ ausgefallen ist, so wie alle anderen Maturanten auch. Außerdem schaffen wir mehr Flexibilität, weil wir nicht mehr gesetzlich regeln, wo die Prüfungen stattzufinden haben, und wir schaffen mehr Durchlässigkeit im System.
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit der heutigen Anpassung bei der Berufsreifeprüfung schaffen wir mehr Fairness für die Maturanten und ein besseres System für die Zukunft. – Danke schön. (Beifall bei der ÖVP und bei Bundesräten von SPÖ und Grünen.)
18.09
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Als Nächste zu Wort gelangt Frau Bundesrätin Ecker. – Bitte.
18.09
Bundesrätin Rosa Ecker (FPÖ, Oberösterreich): Geschätztes Präsidium! Geschätzte Frau Minister! Sehr geehrte Damen und Herren! In aller Kürze: Wir haben schon sehr viel darüber gehört, das Berufsreifeprüfungsgesetz an das System der Zentralmatura anzunähern. Die Möglichkeit, die Matura in Form einer Berufsreifeprüfung nachzuholen, ist eine sehr sinnvolle Art, einen Bildungsabschluss nachzuholen, weil man vielleicht nach der allgemeinen Schulbildung direkt ins Berufsleben gestartet ist. Ich kenne aber auch Wiedereinsteigerinnen, die das System nutzen und die es gut geschafft haben.
Ein zweiter Bildungsweg beziehungsweise – heutzutage kann man sagen – mehrere Bildungswege sind notwendig, um in unserer schnelllebigen Arbeitswelt bestehen zu können, bis wir endlich unser Pensionsalter erreicht haben. Die Chancen am Arbeitsmarkt sind für die Menschen am besten, die eine gute Ausbildung haben. Darum können wir uns nur anschließen, wenn man sagt: Alle Formen dieser Qualifizierungen und Ausbildungen sind zu unterstützen. Darum werden wir auch zustimmen. (Beifall bei der FPÖ und bei Bundesräten von ÖVP und SPÖ.)
18.10
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Zu Wort gelangt Herr Bundesrat Stögmüller. – Bitte.
18.10
Bundesrat David Stögmüller (Grüne, Oberösterreich): Wertes Präsidium! Sehr geehrte Frau Bildungsministerin! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich glaube, meine Vorrednerinnen haben bereits angeführt, worum es bei diesem Gesetz geht, hauptsächlich um Korrekturen und Anpassungen, die vorgenommen werden.
Eine Zentralmatura ist im Bereich der berufsbegleitenden Ausbildung natürlich immer eine besondere Herausforderung; Beruf und Schule am Abend zu managen stellt die betroffenen Personen natürlich immer vor Herausforderungen. Ich bin auch davon überzeugt, dass eine berufsbegleitende Möglichkeit, die Berufsreifeprüfung zu absolvieren und dadurch eine Durchlässigkeit zwischen Lehre, berufsbildendem mittlerem Schulwesen und der Hochschule zu schaffen, auch seinen Beitrag leistet, dass Bildung nicht mehr unmittelbar vererbt sein muss.
Ihre Mitarbeiterin hat mir im Ausschuss gesagt, dass es ungefähr 3 Prozent – ich glaube, ein bisschen weniger, 2,8 Prozent – sind, die mit einer Abendmatura an einer Uni studieren. Ich glaube, das zeigt auch, dass der Weg zum Studium gegeben ist.
Natürlich spielen im Bildungsbereich auch noch andere Faktoren mit, bereits in der Volksschule beginnt die Selektierung der Kinder und wird deren Bildungslaufbahn vorgezeichnet: Neue Mittelschule oder Gymnasium. Das möchte ich nur immer wieder anmerken.
Ich möchte noch ein paar Sätze zur Lehre mit Matura anfügen, weil es gut zum Thema passt: Ich bin wirklich überzeugt davon, dass es ganz viele Lehrlinge gibt, die eine Matura ohne Probleme schaffen. Ich habe mich in den letzten Monaten mit vielen Lehrlingen getroffen und mit ihnen geredet, die mit der Matura neben der Lehre angefangen und diesen Weg wieder abgebrochen haben. Ich habe auch im letzten Jahr an Sie eine
parlamentarische Anfrage gerichtet, und da zeigte sich auch ganz klar, dass wir eine extrem hohe Drop-out-Rate haben. In Oberösterreich begannen 10 291 Lehrlinge zwischen 2008 und 2016 mit der Lehre mit Matura, abgemeldet haben sich 4 044 noch während der Ausbildungszeit. Das sind 40 Prozent Drop-out. Abgeschlossen haben die Lehre mit Matura ungefähr 758 Personen in acht Jahren, das sind knappe 7 Prozent.
Ich weiß natürlich, dass die Zahl etwas höher sein kann, weil sich nicht alle rückmelden, aber dann sind es halt 10 Prozent. Das ist meiner Ansicht nach trotzdem eine noch viel zu niedrige Zahl, denn ich glaube, dass damit extrem viel Potenzial verloren geht. Auf die Jugendlichen kommen natürlich viele Belastungen zu: am Tag in der Gastronomie arbeiten, Tischler und Friseur sein und dann abends drei Stunden Abendkurs Mathematik. Für viele Jugendliche wiederholt sich auch vieles in den Kursen, weil sie das schon parallel in den Berufsschulen gelernt haben.
Ich glaube, man muss an den Berufsschulen ein Konzept der Lehrpläne erarbeiten und gemeinsam an einer Bildungsdurchlässigkeit arbeiten, denn die Lehrlinge haben sich das verdient.
Ansonsten kann ich dieser Novelle natürlich nur zustimmen. Ich wollte das einfach nur anmerken, weil es gut zum Thema passt. – Danke schön. (Beifall bei den Grünen und bei Bundesräten von ÖVP und SPÖ.)
18.13
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Zu Wort gelangt Frau Bundesministerin Dr. Hammerschmid. – Bitte.
18.13
Bundesministerin für Bildung Mag. Dr. Sonja Hammerschmid: Geschätzte Frau Präsidentin! Geschätzte Mitglieder des Bundesrates! Auch ich möchte noch einmal ein Plädoyer für die Berufsreifeprüfung halten, die ja vor 20 Jahren eingeführt wurde.
Die Tragweite, glaube ich, muss man an den Zahlen erfassen: Es sind bis jetzt 40 000 Absolventinnen und Absolventen dieser Berufsreifeprüfung. Das zeigt schon, was hier geschaffen wurde. Diese Durchlässigkeit im Bildungssystem ist ganz, ganz wichtig. Die Chancengerechtigkeit geht damit einher, das ist auch keine Frage. Wir wissen alle aus unseren privaten Umfeldern, dass viele, die einmal ins Berufsleben gestartet sind, irgendwann einmal draufkommen: Na vielleicht braucht es doch noch eine Weiterbildungsmaßnahme, vielleicht braucht es Matura, vielleicht braucht es in Folge auch andere schulische Maßnahmen oder auch ein Studium, um einfach ein erfülltes Berufsleben haben zu können. Diese Maßnahmen zu setzen, sodass die Durchlässigkeit über alle Stufen hinweg, über alle Alterskohorten hinweg wirklich da ist, ist ganz, ganz wichtig. Und die Berufsreifeprüfung ist da ein ganz, ganz wesentlicher Schritt.
Es gibt also 40 000 Absolventinnen und Absolventen in 20 Jahren; ich glaube, das ist eine schöne Zahl. 2,84 Prozent ist die Quote jener, die nach der Berufsreifeprüfung an Universitäten und Fachhochschulen zu studieren begonnen haben, aber diese Rate steigt, das muss man auch klar sagen. Die Chancen werden durchwegs und zunehmend ergriffen, eine weiterführende Ausbildungsmaßnahme im tertiären Sektor zu ergreifen.
Weil die Lehre mit Matura auch Thema war: Ja, da gibt es einiges, was wir optimieren können, das ist überhaupt keine Frage, es wurde vor einigen Jahren damit begonnen. Wir haben jetzt aktuell rund 10 000 Studierende in der Lehre mit Matura und wir haben bis jetzt insgesamt 5 276 Absolventen. Das übersteigt jedenfalls die 10-Prozent-Grenze bei Weitem, aber wir haben zu hohe Drop-outs, das ist überhaupt keine Frage. Wir arbeiten sehr intensiv daran, da auch begleitend hinzuschauen: Was kann man verbessern? Wie kann man die Vereinbarkeit in der Doppelbelastung verbessern und durchgängiger gestalten? – Das ist uns sehr, sehr wichtig, denn es wird zunehmend ange-
nommen, das ist überhaupt keine Frage, und dieses Instrument ist es wert, weiter auszubauen.
Eine ganz kleine Korrektur oder Ergänzung möchte ich noch zu den Teilprüfungen machen. Warum Mathematik und warum da die Kompensationsprüfung? – Es ist schlichtweg so, dass man in Deutsch sowieso schriftlich und mündlich maturiert. Es ist in Englisch so, dass man auch mündlich maturieren kann, und im Fachbereich ist es so, dass es eine Klausurarbeit und eine mündliche Prüfung oder eine Projektarbeit inklusive Präsentation und Diskussion sowieso gibt. Das heißt, da sind die Maßnahmen geschaffen, um schriftlich und auch mündlich entsprechend arbeiten und die Prüfung absolvieren zu können. Das heißt, es war wirklich nur die Mathematik, die angeglichen werden musste, und jetzt ist das auf einem Standard mit der „normalen“ – unter Anführungszeichen – zentralisierten Reifeprüfung.
Ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, eine wichtige Maßnahme. Wir wollten das zuerst eigentlich im Rahmen des Autonomiepaketes abhandeln. Jetzt braucht es im Zuge des Autonomiepaketes ein Stück weit mehr Diskussion; der Prozess hat sich ein wenig nach hinten verlagert. Deshalb gibt es auch diesen Initiativantrag, um schnell eine Klärung zu haben, damit unsere Ausbildnerinnen und Ausbildner und vor allem die Studierenden Sicherheit haben, wie damit umgegangen wird. – Vielen Dank. (Beifall bei der SPÖ und bei Bundesräten von ÖVP und Grünen.)
18.17
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Vielen Dank, Frau Ministerin.
Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir gelangen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein über Gleichwertigkeiten im Bereich der Reifezeugnisse und des Hochschulwesens (1512 d.B. und 1581 d.B. sowie 9779/BR d.B.)
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Nun gelangen wir zum 29. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatterin ist Frau Bundesrätin Grimling. – Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatterin Elisabeth Grimling: Frau Präsidentin! Frau Bundesministerin! Liebe Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat!
Der gegenständliche Bericht des Ausschusses für Unterricht, Kunst und Kultur über den Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein über Gleichwertigkeiten im Bereich der Reifezeugnisse und des Hochschulwesens liegt Ihnen in schriftlicher Form vor; ich komme daher gleich zur Antragstellung.
Der Ausschuss für Unterricht, Kunst und Kultur stellt nach Beratung der Vorlage am 4. April 2017 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. – Danke.
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Vielen Dank für den Bericht.
Wir gehen in die Debatte ein.
Als Erster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Koller. – Bitte, Herr Bundesrat.
18.19
Bundesrat Hubert Koller, MA (SPÖ, Steiermark): Geschätzte Präsidentin! Liebe Frau Bundesministerin! Abkommen sind wichtig – wir haben heute schon eines bestätigt –: Der Steiermark-Tourismus hat vor 21 Jahren ein ganz wichtiges Abkommen mit dem Bürgermeister von Wien abgeschlossen. Deshalb haben wir jetzt bis Sonntag am Abend hier am Rathausplatz den Steiermark-Frühling. Man sieht also schon, dass solche Abkommen nachhaltig und wichtig sind. (Allgemeine Heiterkeit – Zwischenrufe bei der ÖVP.)
Nicht unwichtig ist auch dieses Abkommen, das in seinem Kern ebenfalls schon vor 20 Jahren abgeschlossen wurde. Inzwischen hat sich in der Hochschullandschaft in beiden Vertragsstaaten natürlich einiges verändert, sodass es auch notwendig wird, einige Änderungen durchzuführen, den Gegebenheiten der heutigen Zeit anzupassen.
Liechtenstein ist klein, aber für Österreich doch nicht unbedeutend, auch wenn sie nur eine Universität, drei Hochschulen und eine hochschulähnliche Einrichtung haben. Immerhin sind 40 Prozent der Besucher dieser Universität Österreicher. Die Zahlen liegen noch vor jenen der Schweiz. Die Hochschulen sind also auch bei den Österreichern sehr beliebt, und umgekehrt natürlich auch: Liechtensteiner studieren hier in Österreich, vor allem in Innsbruck.
Deshalb ist dieser Schritt ein wichtiger, Frau Ministerin. Er beinhaltet vor allem, dass die Reifezeugnisse gegenseitig anerkannt werden, die Studiengebühren und die Hochschultaxen gleich sind – so als wäre man dort Staatsbürger –, die Studien- und Prüfungsleistungen auf dem ECTS-System basieren und bei weiterführenden Studien die Studienabschlüsse anerkannt werden. Man ist auch berechtigt, die akademischen Grade in beiden Ländern zu führen.
Man kann natürlich andenken, dass in einem weiteren Schritt auch berufsbildende höhere Schulen miteinbezogen werden. In den Reifeprüfungszeugnissen der HTLs und so weiter sind Gruppen von Berufen angeführt, die man ausüben kann. Die Inhalte des heute vorliegenden Abkommens sind jedenfalls sehr wichtig, denn damit erspart man den StudentInnen oder in späterer Folge den AbsolventInnen mühsame Wege und Kosten, die anfallen, wenn man sich die gegenseitige Anerkennung erst sozusagen erarbeiten muss.
Eine Win-win-Situation: Das Abkommen wurde am 23. Februar von unserer Ministerin und der Regierungsrätin von Liechtenstein unterzeichnet. Wir sind jetzt dazu bereit, es zu ratifizieren beziehungsweise dem zuzustimmen. Die SPÖ-Fraktion wird das auch machen. – Danke schön. (Beifall bei SPÖ, ÖVP und Grünen.)
18.21
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Saller. – Bitte.
18.22
Bundesrat Josef Saller (ÖVP, Salzburg): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Frau Bundesministerin! Sehr geehrte Damen und Herren! Seit 1997 gibt es bereits ein Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein über die genannten Themen, also über die Gleichwertigkeiten im Bereich der Reifezeugnisse und des Hochschulwesens. Seit dieser Zeit hat sich natürlich im wissenschaftlichen Bereich, im Bildungsbereich, im Forschungsbereich unheimlich viel verändert. Wir müssen längst über die eigenen Grenzen hinwegschauen und gerade in Europa aufeinander zugehen, aber
auch auf internationaler Ebene ist Zusammenarbeit unerlässlich und besonders wichtig. Wenn wir die großen Anforderungen der Zukunft in Bildung, Forschung, Wissenschaft bewältigen wollen, brauchen wir eine Fülle von Kooperationen. Ob Hochschulen, Verwaltung, Arbeitsplätze, alle müssen etwas davon haben – das ist besonders hervorzustreichen.
Die Eckpunkte des gegenständlichen Abkommens sind bereits genannt worden, es sind die Anerkennung der Reifezeugnisse, die für alle gleichen Studiengebühren, die Anerkennung von Studienabschlüssen und die Berechtigung, den akademischen Grad in beiden Staaten zu führen. Die gute nachbarschaftliche Beziehung der beiden Staaten hat sicher dazu beigetragen, diese Vorteile für unsere Studierenden zu erreichen.
Schade ist – das muss auch ich sagen –, dass die Berufsberechtigungen nicht mitverhandelt wurden. Wir haben touristische Schulen, HTLs, Akademien, wo man auch Berufsberechtigungen erwirbt, welche fallweise auch in den Reifezeugnissen ausgewiesen sind. Es wäre natürlich von Vorteil gewesen, zu wissen, wo man welche Berufe mit dem Reifezeugnis ausüben darf. Es handelt sich also nicht nur um den Hochschulzugang.
Alles in allem ist aber zu danken, es ist ein gutes nachbarschaftliches Abkommen, speziell für unsere junge Generation. – Herzlichen Dank. (Beifall bei ÖVP, SPÖ und Grünen.)
18.24
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Ecker. – Bitte, Frau Bundesrätin.
18.25
Bundesrätin Rosa Ecker (FPÖ, Oberösterreich): Sehr geehrtes Präsidium! Sehr geschätzte Frau Minister! Sehr geehrte Damen und Herren! Die Familienministerin hat heute Vormittag einen Satz gesagt, der lautete: Es wurde schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem. – Ich habe jetzt meine Liste durchgeschaut, es bleibt mir noch zu erwähnen, dass unsere Studierenden auch an Auslandsstudien sehr interessiert sind. In Liechtenstein studieren zum Beispiel wesentlich mehr Österreicher als Schweizer. Liechtenstein ist für uns auch ein Land, bei dem wir darauf vertrauen können, dass die Ausbildungsstandards eingehalten werden, was mit der Berücksichtigung der ECTS-Punkte an sich ja auch kein Problem ist. Das bestehende Abkommen wurde nur im Wortlaut aktualisiert. Wir finden es sehr sinnvoll und stimmen auch zu. (Beifall bei FPÖ und SPÖ sowie des Bundesrates Mayer.)
18.25
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Zu Wort gemeldet ist nun Herr Bundesrat Stögmüller. – Bitte.
18.25
Bundesrat David Stögmüller (Grüne, Oberösterreich): Wertes Präsidium! Sehr geehrte Frau Bildungsministerin! Das Abkommen wurde von meinen Kolleginnen und Kollegen bereits vorgestellt. Ich habe gar nicht mehr vieles zu ergänzen. Der Bildungssprecher meiner Fraktion im Nationalrat, Kollege Harald Walser, ist als Vorarlberger eher davon betroffen und in die Sache involviert. Ich finde es wichtig, dass die Reifezeugnisse und Hochschulqualifikationen gegenseitig voll anerkannt werden.
Ihre MitarbeiterInnen haben ja auch ein paar spannende Daten genannt. In Liechtenstein unterrichten nämlich an den Sekundarstufen I und II auch 16 LehrerInnen, die das betrifft. Sie unterrichten dort, was auch anerkannt werden muss. Acht österreichische LehrerInnen unterrichten an einer berufsbildenden oder höheren Schule – also gar nicht so wenige. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass das anerkannt wird.
Weil der Hubsi (in Richtung Bundesrat Koller) – wo ist er?; da drüben! – gesagt hat, die berufsbildenden Schulen sind auch zu stärken: Wir Grüne können das nur unterstützen, und wir sind gerne dazu bereit, das mitzutragen. Ich hoffe, das geschieht bei der nächsten Überarbeitung oder durch ein zusätzliches Abkommen. Wir wären gerne bereit dazu, es wäre ein Schritt in die richtige Richtung.
Ansonsten kann ich nichts mehr hinzufügen. Wir werden das vorliegende Abkommen natürlich unterstützen. – Danke. (Beifall bei Grünen und SPÖ.)
18.26
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir gelangen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend Vertrag zwischen der Republik Österreich, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über die grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit (1469 d.B. und 1571 d.B. sowie 9780/BR d.B.)
31. Punkt
Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend Vereinbarung zwischen der Regierung der Republik Österreich, der Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft sowie der Regierung des Fürstentums Liechtenstein über die Durchführung von Artikel 13 Abs. 1 lit. c und Kapitel VI des Vertrages zwischen der Republik Österreich, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über die grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit (1471 d.B. und 1572 d.B. sowie 9781/BR d.B.)
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Nun gelangen wir zu den Punkten 30 und 31 der Tagesordnung.
Berichterstatter zu diesen Punkten ist Herr Bundesrat Forstner. – Bitte um den Bericht.
Berichterstatter Armin Forstner, MPA: Geschätzte Frau Präsidentin! Herr Minister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen!
Ich bringe den Bericht zum Tagesordnungspunkt 30: Bericht des Ausschusses für innere Angelegenheiten über den Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend Vertrag zwischen der Republik Österreich, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über die grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher gleich zur Antragstellung.
Der Ausschuss für innere Angelegenheiten stellt nach Beratung der Vorlage am 4. April 2017 mit Stimmenmehrheit den Antrag,
1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben,
2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
Weiters bringe ich den Bericht zu Tagesordnungspunkt 31: Bericht des Ausschusses für innere Angelegenheiten über den Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend Vereinbarung zwischen der Regierung der Republik Österreich, der Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft sowie der Regierung des Fürstentums Liechtenstein über die Durchführung von Artikel 13 Abs. 1 lit. c und Kapitel VI des Vertrages zwischen der Republik Österreich, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über die grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit.
Auch dieser Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, daher komme ich gleich zur Antragstellung.
Der Ausschuss für innere Angelegenheiten stellt nach Beratung der Vorlage am 4. April 2017 mit Stimmenmehrheit den Antrag,
1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben,
2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Vielen Dank für die Berichte.
Ich begrüße recht herzlich unseren Bundesminister für Inneres Wolfgang Sobotka bei uns. (Allgemeiner Beifall.)
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Dziedzic. – Bitte, Frau Bundesrätin.
18.30
Bundesrätin Mag. Dr. Ewa Dziedzic (Grüne, Wien): Sehr geehrter Herr Minister! Werte Präsidentin! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Wie wir gehört haben, hat der Staatsvertrag die stärkere polizeiliche Zusammenarbeit, insbesondere bei der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Ordnung und Sicherheit, der Kriminalitätsbekämpfung im fremdenpolizeilichen Bereich und im Bereich der Sicherheit des Straßenverkehrs, zum Ziel.
Wir haben heute schon einige Male gehört, wie wichtig die internationale Zusammenarbeit ist. Unsere Kritik ist in diesem Fall nicht nur rhetorischer Natur, sondern führt tatsächlich zu einer Ablehnung, nämlich auf Grund datenschutzrechtlicher Bedenken.
Im Ausschuss wurde nachgefragt, wie die Handhabe ist. Wir haben erfahren, dass es sich nicht um ein zentrales Register handelt, sondern um eine Art Drehscheibe, auf die die jeweiligen Personen Zugriff haben. Wir haben aber nicht erfahren, wie es mit der Löschung aussieht. Im Gegenteil, es hat geheißen, dass man nicht wirklich weiß, wie lange diese Löschung der Daten dauern würde. Des Weiteren blieb unklar, wer alles zugriffsberechtigt ist und wie Missbrauch entgegengewirkt werden kann.
Das heißt: Wir sind im Großen und Ganzen für die Zusammenarbeit, dem stehen diesmal jedoch diese Bedenken entgegen – daher unsere Ablehnung. – Danke schön. (Beifall bei den Grünen.)
18.31
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Oberlehner. – Bitte, Herr Bundesrat.
18.32
Bundesrat Peter Oberlehner (ÖVP, Oberösterreich): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Minister! Liebe Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat! Ich möchte zur Vorrednerin nur sagen: Es ist schade, dass dieses Abkommen nicht alle Fraktionen
mittragen, weil es, glaube ich, für den Raum Vorarlberg-Schweiz ein sehr wichtiges ist. Die Frage aber, die von dir aufgezeigt wurde, wird der Herr Minister wahrscheinlich beantworten können.
Ich darf mich zuerst bei meinen beiden Vorarlberger Kollegen, bei Edgar Mayer und bei Magnus Brunner, sehr herzlich dafür bedanken, dass ich als Oberösterreicher überhaupt zu diesem Thema, das eigentlich primär Vorarlberg betrifft, reden darf. Vielleicht ist das ein kleines Geschenk von Vorarlberg an Oberösterreich, weil wir heute Vormittag einen neuen Landeshauptmann bekommen haben. – Danke schön.
Warum wage ich aber überhaupt, mich zu diesem Thema zu Wort zu melden? – Einerseits, weil ich mich sehr für den Raum Vorarlberg, Schweiz, Deutschland, Liechtenstein interessiere und durchaus ein Fan dieser wunderschönen Region bin; andererseits aber auch, weil ich vor wenigen Wochen Teil einer parlamentarischen Delegation in der Schweiz unter der Führung von Magnus Brunner war, in deren Rahmen dieses Thema behandelt wurde – neben vielen anderen Themen wurden wir dort auch mit diesem Thema konfrontiert.
Vorarlberg ist ein sehr schönes Land; vor allem die Grenzregion mit Deutschland, Schweiz und Liechtenstein ist auch touristisch ein hochinteressantes Gebiet. Das ist, glaube ich, nicht zu bezweifeln und auch hier im Bundesrat allen klar und ein Begriff.
Durch die vorteilhafte Lage dieses Dreiländerecks – auch gemeinsam mit Liechtenstein – ist die Region neben dem Tourismus auch in allen wirtschaftlichen Bereichen sehr gut unterwegs. Im europäischen Vergleich ist dieser grenzüberschreitende Wirtschaftsraum sehr erfolgreich und eine in jeder Form aufstrebende Region. Ein reger Austausch an Arbeitskräften, Kaufkraft und Wirtschaftskraft ist die Folge. Davon profitiert vor allem Vorarlberg, weil es das kostengünstigere Land ist und viele Schweizer, Liechtensteiner und Deutsche zum Einkaufen nach Vorarlberg kommen. Auch auf Urlaub oder um ein Gasthaus zu besuchen oder andere Annehmlichkeiten zu genießen fährt man gerne einmal nach Vorarlberg.
So positiv das alles ist, diese Situation an der Grenze bedeutet auch, dass die negativen Dinge genauso über die Grenze kommen und dass leider auch sehr viele Delikte und eine steigende Kriminalität in dieser Region festgestellt werden müssen.
Wichtig ist es daher, dass mit dem vorliegenden Polizeikooperationsvertrag eine Anpassung des bestehenden Vertrages aus dem Jahr 1999 vorgenommen wird. Dieser Vertrag war damals wegweisend und das Musterbeispiel eines trilateralen Abkommens, das europaweit Schule gemacht hat. Ein ähnliches Abkommen wurde später auch mit Deutschland geschlossen.
In diesem Kooperationsvertrag wird auf die Schengenbeteiligung der Schweiz seit dem Jahr 2008 und die Schengenbeteiligung Liechtensteins seit 2011 reagiert, wie überhaupt höhere Standards in der polizeilichen Zusammenarbeit darin vereinbart werden.
Eine besonders wichtige Neuerung und hinkünftige Verbesserung in diesem Vertrag besteht darin, dass für verdeckte Ermittlungen, um auslieferungsfähige Straftaten von erheblicher Bedeutung zu verhindern, wesentliche Erleichterungen geschaffen werden.
Ebenso wird die Möglichkeit des Einschreitens im grenznahen Bereich im Hoheitsgebiet des jeweils anderen Landes grundlegend verbessert – was natürlich auch eine wichtige Form der Zusammenarbeit ist –, und das ohne vorherige Zustimmung bei unmittelbarer erheblicher Gefahr für Leib, Leben oder auch Eigentum.
Weitere Erleichterungen erfahren die Zusammenarbeit beim Zeugen- und Opferschutz, die Unterstützung bei Rückführungen, bei der polizeilichen Durchbeförderung und auch bei der Übergabe von Personen an der Staatsgrenze. Sie werden ebenfalls in diesem Vertrag behandelt und auch entsprechend vereinfacht. Gleichzeitig wird die grenzüber-
schreitende Verfolgung von Verkehrsdelikten erleichtert. Die dafür notwendige Durchführungsvereinbarung ist inzwischen in Kraft getreten, womit auch alle Geschwindigkeitsübertretungen von Ausländern entsprechend nachverfolgt werden können.
Ganz interessant in diesem Zusammenhang ist, dass es pro Jahr circa fünf Millionen Geschwindigkeitsübertretungen gibt – jeder kann für sich jetzt ausrechnen, wie viel Prozent er selbst dazu beiträgt –, circa eine Million von diesen fünf Millionen werden von Ausländern begangen. Daher ist es so wichtig, Möglichkeiten zu haben, diese entsprechend verfolgen zu können.
Ein automatisierter Kraftfahrzeugzulassungsdatentausch, die Übersendung und Zustellung amtlicher Schriftstücke sowie die Vollstreckungshilfe sind weitere wichtige Teile dieses Polizeikooperationsvertrages, die laut Aussagen der Exekutive eine wesentliche Vereinfachung für die Arbeit der Polizei bedeuten und in einer Zeit, in welcher der Kriminaltourismus ansteigt, sehr wichtig sind. Zweifellos wird daher mit diesem Vertrag die Sicherheit im Ländereck Österreich, Deutschland, Schweiz und Liechtenstein wesentlich verbessert.
In diesem Sinne bedanke ich mich noch einmal bei meinen Vorarlberger Kollegen dafür, dass ich als Oberösterreicher dazu reden durfte, und darf festhalten, dass wir aus Sicht meiner Fraktion sehr gerne diesem Polizeivertrag die Zustimmung erteilen werden. – Danke schön. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
18.37
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Weber. – Bitte, Herr Bundesrat.
18.37
Bundesrat Martin Weber (SPÖ, Steiermark): Frau Präsidentin! Herr Minister! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben es vom Vorredner, Bundesrat Peter Oberlehner, schon gehört, es geht beim vorliegenden Beschluss um eine Erneuerung des seit 1999 bestehenden Vertrages mit Liechtenstein und der Schweiz zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit von Sicherheits- und Zollbehörden.
Dieser damalige Vertrag ist der älteste Vertrag betreffend die polizeiliche Zusammenarbeit mit anderen Ländern und war auch eine gute Schule für den 2005 unterzeichneten Prümer Vertrag von elf Staaten, mit dem die grenzüberschreitende Verhinderung und Verfolgung von Straftaten erleichtert wurde.
Sehr geehrte Damen und Herren, wie die tagtägliche Praxis zeigt, ist der Vertragstext von 1999 nach wie vor eine sehr gute Grundlage für eine enge polizeiliche und grenzpolizeiliche Zusammenarbeit zur Gefahrenabwehr und zur Kriminalitätsbekämpfung. Trotzdem ist es nach 18 Jahren an der Zeit, den Vertrag zu überarbeiten und zu modernisieren. Außerdem hat sich in der Praxis gezeigt, dass alle drei Länder nunmehr eine Erweiterung und eine Konkretisierung der Befugnisse in einigen Bereichen für sinnvoll halten.
Mit dem Vertrag werden neben der behördlichen Zusammenarbeit und Fragen des Informationsaustausches unter anderem auch die grenzüberschreitenden Problemstellungen geregelt, nämlich das vorläufige Einschreiten von Exekutivbeamten im Grenzgebiet des Nachbarstaates bei unmittelbarer erheblicher Gefahr ohne vorherige Zustimmung.
Zudem wurde erstmals eine umfassende Amts- und Rechtshilfe bei der Ahndung von Verkehrsdelikten vereinbart und dazu eine ergänzende Durchführungsvereinbarung abgeschlossen. Nicht nur ein automatischer Austausch von Fahrzeug- und Halterdaten, sondern auch sonstige Unterstützung bei der Ausforschung und Vernehmung von Ver-
kehrssündern ist vorgesehen. Gleiches gilt für die Zustellung amtlicher Schriftstücke sowie die Vollstreckungshilfe.
Wenn man weiß, dass in Österreich 30 Prozent der Fahrzeughalter Nichtösterreicher sind – das ist ein europäischer Spitzenwert –, so erkennt man, dass die Erneuerung dieses Vertrages sehr wichtig ist. Es gibt in Österreich auch keine Halterhaftung wie in anderen Ländern. Bei uns haftet immer der tatsächliche Lenker. Deshalb sind genau diese Bestimmungen sehr wichtig, denn es soll und kann ja nicht sein, dass vielleicht Schnellfahrer oder wirkliche Verbrecher uns an der Staatsgrenze, salopp formuliert, auch noch die lange Nase zeigen.
Auf Bereiche wie den Zeugen- und Opferschutz, die Verkehrsregelung sowie die Verfolgung von Verstößen gegen die Straßenverkehrsvorschriften und das Eingreifen in Notfällen wird sich also der vorliegende Beschluss besonders positiv auswirken.
Sehr geehrte Damen und Herren, nach fast zwei Jahrzehnten kann diese trilaterale grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Sicherheits- und Zollbehörden aus der Schweiz, Liechtenstein und Österreich zu Recht auch als Erfolg bezeichnet werden. Die Anpassung der bestehenden Verträge ist notwendig, um die polizeiliche Zusammenarbeit auf der Höhe der Zeit zu halten. Wer die Bodenseeregion kennt, und mein Vorredner hat es kurz angesprochen, der weiß, dass genau bei diesen geografischen Gegebenheiten so eine gute Zusammenarbeit besonders wichtig ist.
Zur Fraktion der Grünen: Die Bedenken des Datenschutzes wurden eigentlich in der Ausschusssitzung ausreichend entkräftet, und diese Thematik wurde umfassend erklärt. Dem Datenschutz wird im höchsten Maße Rechnung getragen. Anhand des Beispiels mit dem Münzautomaten als Drehscheibe, wobei es keine Manipulationsmöglichkeiten gibt, wurde das sehr ausführlich erklärt. Mag sein, dass sich hier jemand als Schutzpatron von notorischen Schnellfahrern oder wirklichen Verbrechern behaupten will.
Die vorliegenden Beschlüsse werden die Effizienz der Polizeiarbeit in Bezug auf Gefahrenabwehr und Strafverfolgung wesentlich verbessern. Mit dieser Aktualisierung und Weiterentwicklung der entsprechenden Verträge ist der Weg für die erfolgreiche polizeiliche Zusammenarbeit auch für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, wie ich meine, gesichert. Dies ist gut für die Sicherheit unserer Landsleute, gut für Österreich. – Danke. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.)
18.42
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Herbert. – Bitte, Herr Bundesrat.
18.42
Bundesrat Werner Herbert (FPÖ, Niederösterreich): Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Auch wir werden diese Abkommen unterstützen und dem unsere Zustimmung geben. Gerade in Zeiten, in denen Kriminalität, insbesondere die organisierte Kriminalität, keine nationalen und staatlichen Grenzen kennt, sondern über Staatsgrenzen hinweg agiert, ist es wichtig, grundlegende Mittel und Möglichkeiten dafür zu schaffen, dass die Polizei in bilateraler oder, wie in diesem Fall, in trilateraler Form zusammenarbeiten kann. Das ermöglicht die Polizeiarbeit in strafrechtlicher und strafprozessualer Hinsicht sowie bei der Vollziehung und Verfolgung von Straßenverkehrsdelikten. Daher ist das absolut zu begrüßen.
Den datenschutzrechtlichen Ansatz der Kollegin der Grünen, die diesen Vorbehalt auch schon im Ausschuss erwähnt hat, kann ich – und das sage ich jetzt als Mitglied des Datenschutzrates – nicht teilen, weil ja da nicht direkt auf Daten des anderen Landes zugegriffen wird, sondern quasi über eine Plattform die Daten ausgetauscht werden. Das heißt, es ist nicht möglich so, wie es auch bei anderen gleich gelagerten Informations- und Datenaustauschmöglichkeiten auf polizeilicher Ebene derzeit die Grundlage ist, un-
mittelbar und direkt auf Datensätze oder Datenregister eines fremden Staates zuzugreifen, sondern es ist dort wie auch hier nur möglich, quasi über eine Zwischenplattform eine Datenanfrage zu machen und von dort die Daten in diese Zwischenablage eingespeist zu bekommen.
Eine Manipulation der Daten ist auf dieser Ebene daher nicht möglich, daher sehe ich auch keinen Grund dafür, dass wir unsere Zustimmung verweigern sollten. – Danke schön. (Beifall bei FPÖ, ÖVP und SPÖ.)
18.44
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Die Abstimmung erfolgt getrennt.
Wir gelangen zunächst zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend Vertrag zwischen der Republik Österreich, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über die grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit. Da der gegenständliche Beschluss Angelegenheiten der selbständigen Wirkungsbereiche der Länder regelt, bedarf dieser der Zustimmung des Bundesrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz.
Wir gelangen zunächst zur Abstimmung, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Nun lasse ich über den Antrag abstimmen, dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Nun kommen wir zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend Vereinbarung zwischen der Regierung der Republik Österreich, der Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft sowie der Regierung des Fürstentums Liechtenstein über die Durchführung von Artikel 13 Abs. 1 lit. c und Kapitel VI des Vertrages zwischen der Republik Österreich, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über die grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit.
Da auch der gegenständliche Beschluss Angelegenheiten der selbständigen Wirkungsbereiche der Länder regelt, bedarf dieser der Zustimmung des Bundesrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz.
Wir gelangen zunächst zur Abstimmung, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
Nun lasse ich über den Antrag abstimmen, dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.
32. Punkt
Bericht des Bundesministers für Inneres an das österreichische Parlament Legislativ- und Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für 2017 Achtzehnmonatsprogramm des niederländischen, slowakischen und maltesischen Vorsitzes des Rates der Europäischen Union (III-610-BR/2017 d.B. sowie 9782/BR d.B.)
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Nunmehr gelangen wir zum 32. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatter ist Herr Bundesrat Forstner. – Ich bitte um den Bericht.
Berichterstatter Armin Forstner, MPA: Frau Präsidentin! Herr Minister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich bringe den Bericht des Ausschusses für innere Angelegenheiten über den Bericht des Bundesministers für Inneres an das österreichische Parlament Legislativ- und Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für 2017 Achtzehnmonatsprogramm des niederländischen, slowakischen und maltesischen Vorsitzes des Rates der Europäischen Union.
Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher gleich zur Antragstellung.
Der Ausschuss für innere Angelegenheiten stellt nach Beratung der Vorlage am 4. April 2017 den Antrag, den Bericht des Bundesministers für Inneres an das österreichische Parlament Legislativ- und Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für 2017 Achtzehnmonatsprogramm des niederländischen, slowakischen und maltesischen Vorsitzes des Rates der Europäischen Union (III-610-BR/2017 d.B.) zur Kenntnis zu nehmen.
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Vielen Dank für den Bericht.
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Herbert. – Bitte, Herr Bundesrat.
18.49
Bundesrat Werner Herbert (FPÖ, Niederösterreich): Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Da ich heute schon einmal die grundsätzliche Meinung der FPÖ zu derartigen EU-Vorhabensberichten dargelegt habe und Sie wahrscheinlich schon eine gewisse Annahme zu meinem grundsätzlichen Zugang zu diesem Bericht haben, darf ich Ihnen auch an dieser Stelle mitteilen: Sie haben recht. Wir werden auch diesem Bericht unsere Zustimmung nicht geben. (Bundesrätin Kurz: So eine Überraschung aber auch!) Warum? – Weil es, wie wohl bei keinem anderen Bericht der EU, bei diesem Bericht augenscheinlich ist, wie sehr die EU in den letzten Jahren auf sicherheitspolitischer Ebene versagt hat. Dieser Bericht ist ein Offenbarungseid des Versagens in der Asyl- und Flüchtlingspolitik der EU.
Vielleicht darf ich an dieser Stelle noch einmal unseren generellen Zugang dazu darlegen: Uns geht es nicht darum, die bestehenden Asylströme so zu lassen, wie sie sind, und durch irgendwelche Versprechungen der EU weiter in diesem ungemäßigten und ungezügelten Zustand verharren zu lassen, sondern wir sagen: Grenzen dicht und den Zustrom minimieren! Wir dürfen nicht die Flüchtlinge in unser Land oder in die EU lassen und dann versuchen, die Flüchtlinge innerhalb der EU aufzuteilen. Das ist eine Politik, die unglaublich erscheint! So wie es sich die EU vorstellt, gibt man jede Möglichkeit, in eigenstaatlicher Verantwortung zu agieren, vollkommen ab. Das bedeutet, dieser Bericht ist der Offenbarungseid des Versagens der Flüchtlingspolitik der EU per se.
Bezeichnend ist auch, dass seit 2015, obwohl vonseiten der Bundesregierung mehrmals darauf hingewiesen, versprochen, dargelegt wurde, dass es künftig Rückführungsabkommen mit anderen Staaten geben würde, tatsächlich erst ein einziges neues Rück-
führungsabkommen abgeschlossen wurde. Seit 2015 gibt es also nur ein einziges Abkommen, und das trotz wiederholter Ankündigungen, sich dahin gehend einzubringen, dass das geändert wird. Auch das ist ein ziemlich klarer Beweis dafür, dass da innerhalb der EU und innerhalb dieser Möglichkeiten, die uns zu unserem staatlichen Nachteil geboten werden, trotz aller – zugegebenermaßen – Bemühungen, die ich vonseiten der Bundesregierung immer wieder höre, praktisch nichts stattfindet.
So gesehen ist es auch ein Kuriosum der Darlegung dieses Berichts, dass hier über eine Erweiterung der Schengenaußengrenze diskutiert wird, obwohl dieser Bericht offenbart, dass Schengen nicht nur gescheitert ist, sondern aufgrund des Scheiterns auch außer Kraft gesetzt wurde. Da frage ich mich: Warum überlegt man sich, einen nicht vorhandenen, faktisch nicht durchführbaren und eigentlich gescheiterten Quasigrenzmechanismus aufrechtzuerhalten, wenn man weiß, dass das nicht funktioniert? – Schimäre, das ist pures Streuen von Sand beziehungsweise von Unwahrheiten in die Augen der österreichischen Bevölkerung.
Ich denke daher, dass in dieser Frage, nämlich der Erweiterung des Schengenraums, genauso zu verfahren sein wird wie in der Frage des Aktionsplans mit der Türkei. Das ist auch so eine Geschichte. Jeder weiß, dass die Türkei völlig eigene Spielregeln geschrieben hat, die mit der EU im weitesten Sinne gar nicht mehr kompatibel sind. Trotzdem hält man aber am Aktionsplan mit der Türkei fest. Auch das ist so eine nicht nachvollziehbare, um nicht zu sagen, völlig verworrene Situation, in der sich die EU befindet und an der wir als leidtragender Mitgliedstaat partizipieren müssen, obwohl wir das in dieser Form gar nicht wollen.
Daher fällt es mir bei diesem Bericht noch viel leichter als beim vorigen EU-Vorhabensbericht, die Zustimmung nicht zu erteilen, sondern einmal mehr einzufordern, Grenzen dicht zu machen und uns auf unsere eigenstaatlichen Möglichkeiten zu besinnen. Das sind wir unserer Bevölkerung schuldig, und es ist die Pflicht dieser Bundesregierung, dieser Schuldigkeit auch nachzukommen! – Danke schön. (Beifall bei der FPÖ.)
18.54
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Schödinger. – Bitte, Herr Bundesrat.
18.54
Bundesrat Gerhard Schödinger (ÖVP, Niederösterreich): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Herr Minister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Lieber Kollege Herbert, wir sind der Bevölkerung eine anständige Politik schuldig und nicht die Politik der FPÖ. Das ist einmal ein Grundsatz. (Beifall bei ÖVP, SPÖ und Grünen. – Zwischenrufe bei der FPÖ.)
Was da soeben gesagt wurde, ist vielleicht ein Standpunkt, den man vertreten kann, aber er widerspricht sich doch in sich selbst, nämlich allein schon mit der Argumentation, dass das Dichtmachen der Grenzen das Allheilmittel ist. Davon bin ich eigentlich nicht überzeugt. (Bundesrat Herbert: Es sagt sogar euer Außenminister, dass das gescheit ist!) Ich weiß schon, dass wir jede Menge Probleme haben, aber mit der Schließung aller Grenzen wird das nicht gelingen. Was wir brauchen – das haben wir nicht, das gebe ich zu –, ist eine starke Europäische Union, die die Außengrenzen schützt, und ein ordentliches, anständiges europaweites Asylsystem. (Beifall bei der ÖVP und bei Bundesräten der SPÖ. – Zwischenrufe bei der FPÖ.)
Für diesen Bericht, den ich aufgrund der Qualität und der wirklich umfangreichen Maßnahmen, die da enthalten sind, ausdrücklich hervorheben möchte, möchte ich mich beim Innenministerium und den dortigen Bediensteten bedanken, nämlich für die Arbeit, die dort geleistet wurde. Ich habe einige wenige Punkte herausgenommen, weil der Bericht doch sehr umfangreich ist. (Zwischenruf des Bundesrates Herbert.)
Das Erste wäre, und das steht auch so drinnen, dass es der EU sehr wohl bewusst ist, dass wir unser Hauptaugenmerk auf die Migrationsagenda in Europa zu legen haben. Daran anschließend wäre das, was für uns wirklich effizient funktionieren müsste, eine europäische Sicherheitsunion. (Bundesrat Längle: Funktionieren müsste!) Wir arbeiten daran, und wir haben einen Innenminister, der das wirklich auf eine tolle Art und Weise vermittelt, sodass selbst für die Freiheitlichen an Realpolitik nicht wirklich viel hinzuzufügen wäre. Was ihr mitunter in die Diskussion einbringt, ist in der Realität nicht umsetzbar und würde uns, Österreich, in unserer Entwicklung um Jahrzehnte zurückwerfen. (Beifall bei der ÖVP. – Zwischenrufe bei der FPÖ.)
Wir sehen, was mit dem Brexit los ist, und eines will ich da auch noch anführen – es ist heute nicht zur Diskussion gestanden, aber ich sage es jetzt schon dazu (Bundesrat Herbert: Danke!) –: Freiheitliche Bundesräte und Bundesrätinnen sind hier gestanden und haben von der Qualität Russlands geschwärmt und gesagt, was das für ein nettes Land ist und was das für gute Demokraten sind. – Ich verweise jetzt auf den Giftgasangriff in Syrien, der durch dieses Land gedeckt wird; durch Russland wird nämlich verhindert, dass er verurteilt wird. Das will ich hier schon einmal angeführt haben, um zu zeigen, in welche Richtung die Politik der FPÖ da geht – nur einmal am Rande gesagt. (Beifall bei ÖVP, SPÖ und Grünen. – Heftiger Widerspruch bei der FPÖ.)
Deswegen, und das ist mir schon ganz wichtig, möchte ich hier als Vertreter der ÖVP stehen und eine Grundsatzerklärung für die Europäische Union abgeben (Bundesrat Krusche: ... Europakarte!), weil das eine Organisation in Europa ist, die nicht an Qualität zu überbieten ist, trotz aller Schwierigkeiten, die wir dort auch zu bewältigen haben. Nur ein starkes, gemeinsames Europa ist in der Lage, all diese Probleme, die wir hier haben, zu bewältigen. (Beifall und Bravorufe bei der ÖVP sowie Beifall bei SPÖ und Grünen. – Widerspruch bei der FPÖ.)
Ich habe mir noch eine Fülle an Punkten aufgeschrieben, die ich anführen wollte, aber das mache ich jetzt nicht, denn ich will das jetzt so stehen lassen. Vor allem möchte ich aber noch einmal daran erinnern: Ihre Freundschaft zu Russland deckt diese Giftgasangriffe in Syrien! (Beifall bei ÖVP, SPÖ und Grünen. – Widerspruch bei der FPÖ.)
18.58
*****
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Zur Geschäftsbehandlung hat sich Frau Bundesrätin Mühlwerth zu Wort gemeldet. – Bitte, Frau Bundesrätin.
18.59
Bundesrätin Monika Mühlwerth (FPÖ, Wien) (zur Geschäftsbehandlung): Lieber Kollege von der ÖVP! Das weise ich in aller Schärfe zurück! Es ist wirklich unglaublich, was sich hier abspielt! Die Präsidentin ist zwar sonst immer sehr empfindsam, wenn es um uns geht, aber vor allem wenn jemand aus ihrer eigenen Fraktion so etwas sagt, ist sie nicht mehr so empfindlich. – Das ist wirklich ungeheuerlich!
Wir haben hier immer gesagt: Die Sanktionen für Russland sind falsch, und dazu stehe ich auch. Wir haben immer gesagt, mit Russland muss man sprechen. Wir haben nie gesagt, das sind die Superdemokraten und der Putin ist der oberüberdrüber-supertolle Bursche. Ich finde es empörend, dann diese Verbindung herzustellen, uns mit den Terroranschlägen in Russland in Verbindung zu bringen und vor allem mit den Giftgasanschlägen in Syrien, wobei es noch nicht einmal sicher ist, wer das gemacht hat. Das ist ja noch gar nicht heraußen. Uns das jetzt so lässig in die Schuhe zu schieben und das dann auch noch lustig zu finden, das finde ich wirklich empörend!
Schämen Sie sich, Herr Kollege Schödinger! Ihnen fehlt in Ihrem Namen nicht zu Unrecht das R. (Beifall bei der FPÖ.)
19.00
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Das war eine tatsächliche Berichtigung.
Zur Geschäftsbehandlung zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat Mayer. – Bitte.
19.00
Bundesrat Edgar Mayer (ÖVP, Vorarlberg) (zur Geschäftsbehandlung): Frau Präsidentin! Zur Geschäftsbehandlung: Frau Kollegin Mühlwerth, echauffieren Sie sich hier nicht so! (Bundesrätin Mühlwerth: Dann beruhigen Sie ...!) Was die FPÖ an Russlandfreundschaft zeigt, das wissen wir alle genau: Lustreisen von H.-C. Strache mit seinen Freunden, mit dem Vizebürgermeister von Wien. Dort wird immer Hof gehalten und werden Verträge abgeschlossen. (Zwischenrufe bei der FPÖ.)
Denunzieren Sie nicht Kollegen Schödinger! Ob er ein R im Namen hat oder nicht, das hat hier nichts zur Sache zu tun. (Zwischenruf der Bundesrätin Mühlwerth.) Mäßigen Sie sich einfach in der Diskussion! Wir mäßigen uns auch in der Diskussion. (Neuerlicher Zwischenruf der Bundesrätin Mühlwerth.) Wenn man Ihnen einen Spiegel vorhält, dann rasten Sie hier aus. Das weise ich in aller Form zurück! (Beifall bei der ÖVP.)
19.00
*****
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Dr. Dziedzic. – Bitte.
19.01
Bundesrätin Mag. Dr. Ewa Dziedzic (Grüne, Wien): Sehr geehrter Herr Bundesminister! Frau Präsidentin! Werte Kollegen und Kolleginnen! Nach so einer brennenden Proeuroparede ist es natürlich nicht einfach, hier wieder sachlich zu argumentieren – auch nach dem Schlagabtausch bezüglich Russland. (Zwischenruf der Bundesrätin Mühlwerth.)
Auch bei diesem Bericht geht es um eine engere EU-Zusammenarbeit, und zwar vor allem in den Bereichen Asyl, Migration, Terrorismusbekämpfung und Datenaustausch, aber auch Austausch von Personen, die sich im EU-Schengenraum bewegen, beziehungsweise Ein- und Ausreisen. Das alles geschieht mit dem Ziel, mit dem deklarierten Ziel, die Migration in die EU zu erschweren, wenn nicht zu verunmöglichen – siehe nur beispielsweise Stärkung von Frontex.
Eine wirksame Bekämpfung von Fluchtursachen, die wir selbst auch für sehr wichtig halten, kommt nicht vor, wird auch nicht von den Mitgliedstaaten eingefordert und auch sonst im Bericht nicht forciert. Damit ist diese Strategie für uns leider sehr einseitig und geht nur in Richtung und Fortführung einer Festung Europa. Also genau das, was Ihnen zu wenig ist, ist uns da zu viel.
Zusammenarbeit ist, wie wir heute schon ein paar Mal gehört haben, sehr wichtig, führt aber nicht immer zu den erwünschten Effekten. Wieso sage ich das? – Auch die Zusammenarbeit mit der Türkei ist im Bericht angeführt und soll sozusagen verstärkt werden, gerade im Bereich Migration. Wir wissen aber, dass dies auch zu unerwünschten Abhängigkeiten der EU und deren Mitgliedstaaten führt und dass wir es da mit einem Staat zu tun haben, der sich demokratiepolitisch, sagen wir es einmal so, zumindest fragwürdig entwickelt und auch gegenüber der EU immer aggressiver auftritt.
Alles in allem finden wir, dass die Reduktion auf diese reine Abwehr in einem europäischen Arbeitsprogramm äußerst bedauerlich ist. Wir finden nicht, dass reine Abschottung die Zukunft von Europa ist, sondern im Gegenteil: Unser Einsatz gegen Elend, gegen Krieg und gegen Hunger liegt in unserer Verantwortung. Wir werden die Fluchtursachen nicht minimieren, wenn wir nur einseitig versuchen, Europa abzuschotten. – Vielen Dank. (Beifall bei den Grünen.)
19.03
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Pfister. – Bitte.
19.03
Bundesrat René Pfister (SPÖ, Niederösterreich): Frau Präsidentin! Herr Minister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich werde da jetzt nicht eine Grundsatzdebatte über die Europäische Union beginnen, wie es Herr Herbert am Dienstag bereits im Ausschuss versucht hat. Er hat sich nämlich mit dem Vorhabensbericht der Europäischen Kommission und dem Achtzehnmonatsprogramm nicht sehr intensiv auseinandergesetzt, sondern er hat hauptsächlich eine Grundsatzrede darüber gehalten, wie er die Europäische Union sieht und was sein Weltbild davon ist.
Ich möchte aber schon, wenn wir diesen Bericht hier zu diskutieren haben, Herr Minister, einige Dinge herausgreifen – was für die Freiheitlichen sehr, sehr von Vorteil wäre, wenn sie es auch läsen. Wenn ich in diesem Vorhabensbericht lese, mich dann auch etwas näher erkundige und nicht auf irgendeine Populismuskeule setze, dann erkenne ich, dass als erster Schritt da drinsteht: die Wirksamkeit der Europäischen Union – auch in einer großen Überschrift – betreffend das Thema Sicherheit und die Verwirklichung einer Sicherheitsunion. Seit Oktober 2016 – lieber Bundesminister, Sie werden mich dann hoffentlich auch bestätigen – gibt es bereits die monatlichen Berichte, die auch einsehbar sind und zeigen, welche Fortschritte auf dem Weg zu dieser Sicherheitsunion bereits passiert sind.
Auch die Migrationsagenden, eine Mörderherausforderung für alle europäischen Staaten, sind in dieser achtzehnmonatigen Präsidentschaft, in dieser Trilogie beinhaltet. Da geht es auch um den Austausch von Daten innerhalb des Schengener Informationssystems, das ebenfalls auf der Agenda steht, und auch den Austausch im Rahmen des Visa-Informationssystems.
Lieber Kollege Herbert, ich würde dir wirklich empfehlen, dass du dir sehr, sehr genau anschaust, was da passiert, da für gemeinsame Asylsysteme hier in Europa Reformen angedacht sind. Natürlich ist es für uns auch ein Schritt zu wenig oder etwas zu langsam, nur wissen wir auch, dass es nicht so einfach ist, wenn alle, die an einem Tisch sitzen, ihre eigenen Mauern aufbauen, nicht sehr bereit sind, sich auch zu bewegen (Zwischenruf des Bundesrates Herbert), und einfach nur sagen, es ist alles dicht zu machen und keine Möglichkeit zu geben, aus- oder einzureisen, oder auch keine Möglichkeit zu geben, für Menschen, die verfolgt werden, die Todesängste leiden, innerhalb des europäischen Raums (Bundesrätin Mühlwerth: Darum geht es ja gar nicht! Das wissen Sie ganz genau, Herr Kollege!) in einem Asylsystem ein faires und gerechtes Verfahren zu machen. (Bundesrätin Mühlwerth: Um die geht es gar nicht!)
Zur Effizienz des Schengenraums: Natürlich stehen mit Rumänien und mit Bulgarien auch zwei weitere Entscheidungen in dieser achtzehnmonatigen Präsidentschaft an, die da dabei sind. Es gibt da aber auch Blockadehaltungen, was man erkennt, wenn man das genau liest, weil einige Länder da noch nicht so dabei sind und das auch nicht unterstützen.
Es ist ein sehr, sehr umfangreiches Programm, aber, Herr Minister, ich hätte auch zwei kleine Bitten an Sie. Das eine ist – es wurde auch bereits von Frau Kollegin Dziedzic angesprochen – die Stärkung von Frontex. Es steht da auch drin, dass bereits 1 500 Personen als schnelle Eingreiftruppe angedacht sind. Meine Frage hiezu ist: Wie weit sind wir da? Inwieweit heißt das, diese Unterstützungen auch für Ströme zu haben, wenn es um diese Eingreiftruppe oder um diese Stärkung bei Personalengpässen geht? Mit wie vielen Personen ist Österreich da dabei, und unterstützt Österreich auch bei diesen Herausforderungen?
Die zweite Frage betrifft das Thema der Blue Card – da Sie ja auch ÖAAB-Obmann sind und auch die Richtlinien für den Arbeitsmarkt in Ihren Bereich fallen –: Wie weit sind wir bereits bei den verkürzten Vertragslaufzeiten, den Anerkennungsprozessen und allem, was mit dem Thema Blue Card bereits seit über einem Jahr auf dem Tisch liegt – wobei die Informationen nur sehr spärlich sind –, wo stehen wir da jetzt?
Die österreichische Position ist da, glaube ich, eine sehr, sehr klare, nämlich dass es da auch darum geht, dass wir den österreichischen Arbeitsmarkt und die Herausforderungen, die wir auf dem österreichischen Arbeitsmarkt haben, sehr, sehr genau im Auge behalten. Dazu wären meine Fragen: Wo stehen wir in dieser Überprüfung der Blue-Card-Richtlinien? Was haben Sie bereits bezüglich dieser Frage getan? (Beifall bei der SPÖ.)
19.08
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir gelangen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, den gegenständlichen Bericht zur Kenntnis zu nehmen, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit, der Antrag ist somit angenommen.
Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz über die Marktüberwachung von Funkanlagen (Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz – FMaG 2016) (1460 d.B. und 1573 d.B. sowie 9783/BR d.B.)
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Wir gelangen nun zum 33. Punkt der Tagesordnung.
Berichterstatterin ist Frau Bundesrätin Anderl. Ich bitte um die Berichterstattung.
Berichterstatterin Renate Anderl: Werte Präsidentin! Sehr geehrter Herr Minister! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich erstatte den Bericht des Ausschusses für Innovation, Technologie und Zukunft über den Beschluss des Nationalrates vom 30. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz über die Marktüberwachung von Funkanlagen (Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz – FMaG 2016).
Der gegenständliche Beschluss des Nationalrates umfasst Neuerungen im Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz.
Der Bericht liegt in schriftlicher Form vor, daher komme ich sogleich zur Antragstellung.
Der Ausschuss für Innovation, Technologie und Zukunft stellt nach Beratung am 4. April 2017 mit Stimmenmehrheit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Vielen Dank für die Berichterstattung.
Wir begrüßen in unserer Mitte recht herzlich Herrn Bundesminister Jörg Leichtfried. (Allgemeiner Beifall.)
Wir gehen in die Debatte ein.
Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Stögmüller. – Bitte.
19.10
Bundesrat David Stögmüller (Grüne, Oberösterreich): Wertes Präsidium! Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Minister! Sehr geehrte Damen und Herren! Mit dieser Re-
gierungsvorlage wird eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates bezüglich der Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt umgesetzt.
Es handelt sich dabei um eine extrem technische Materie, und sie wird in den wichtigeren Punkten wörtlich von der EU-Richtlinie übernommen. Im Wesentlichen geht es um die im Prinzip durchaus zu begrüßende Harmonisierung der Nutzung von Funkfrequenzen, um Gefahren für die Gesundheit und Funkstörungen zu vermeiden. Das war bis dato bereits im Bundesgesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeeinrichtungen geregelt.
Nunmehr sollen auch Änderungen an der Software, welche die Funkparameter verändert, durch technische Sperren faktisch verhindert werden. Es soll dadurch verhindert werden, dass unkontrolliertes, zum Beispiel zu lautes Senden, zum Beispiel durch WLAN-Router, oder Wetterradar in der Umgebung negative Auswirkungen haben können. Andere Veränderungen an der Software bleiben zwar theoretisch möglich, da aber eine Trennung zwischen den verschiedenen Softwarekomponenten technisch schwierig ist und für die Hersteller in der Regel nicht wirtschaftlich sein wird, ist davon auszugehen, dass von den Herstellern und den Betreibern jegliche Nutzung von Alternativsoftware unterbunden wird. Dieser Schluss wird auch in den Erläuterungen des Ministeriums gezogen.
Das Gesetz enthält auch eine Verordnungsermächtigung des BMVIT, Klassen oder Kategorien von Funkanlagen zu bestimmen, für welche der Hersteller sicherzustellen hat, dass nur solche Software geladen werden kann, für die die Konformität ihrer Kombination mit der Funkanlage zuvor nachgewiesen wurde und diese nicht anschließend durch den Benutzer manipuliert werden kann. Da muss der Hersteller für die Software eine Konformitätsbewertung nach § 11 Abs. 1 FMAG durchführen.
Das ist also doch sehr komplex und eine sehr technische Novelle. Vielleicht in einfachen Worten: Wenn der Herr Minister zu Hause einen WLAN-Router hat – ich nehme jetzt einmal an, Sie haben einen WLAN-Router zu Hause –, so hat der Hersteller von ebendiesem WLAN-Router sicherzustellen, dass Sie – oder jemand anderer – keine Software draufspielen können, mit der man die Funkeinstellung verändern kann. Das hat aber wiederum zur Folge, dass die Hersteller die Geräte so konzipieren werden, dass nur ihre Updates und ihre Software draufgespielt werden können. Teilweise ist auch zu befürchten, dass es für gewisse Produkte überhaupt keine Softwareupdates gibt, da das Zertifizieren der Software natürlich auch einen Aufwand bedeutet und Verstöße gegen das Gesetz den Hersteller strafbar oder haftbar machen.
Das führt zu folgenden Problemen – um wieder beim WLAN-Router des Ministers zu bleiben –: Prinzipiell gibt es aufgrund der kurzen Produktzyklen schon bisher Sicherheitslücken der Produktsoftware. Da hat man sich als ein wenig technisch Begabter mit Open-Source-Software oder Sicherheitspaketen geholfen und diese installiert. Genau das wird in Zukunft nicht mehr möglich sein. Daher bleiben für den Minister nur zwei schlechte Alternativen: Entweder betreibt man das Gerät trotz Sicherheitslücke einfach weiter – auch nicht optimal –, oder man tauscht das an sich funktionierende Gerät gegen ein neues aus, was wieder nicht sehr nachhaltig ist. Also in Anbetracht des immer wichtiger werdenden Themas IT-Sicherheit beziehungsweise einer nachhaltigen Ressourcenschonung sind beide Effekte aus grüner Sicht dringendst zu verhindern und abzulehnen.
Eine weitere negative Folge wäre, dass diese Einschränkung in Hinblick auf Alternativsoftware innovationshemmend und gerade für die österreichischen Start-ups in diesem Gebiet problematisch wäre. Projekte mit Open-Source-Nutzung, wie sie zum Beispiel, nehmen wir einfach einmal an, Rettungsorganisationen haben, wären in Zukunft gefährdet, da es immer vom Wohlwollen des Hardwareherstellers abhängig gemacht wer-
den müsste, ob eine Konformitätsbewertung auch für die alternative Software überhaupt eingeholt wird.
Also, ich bin schon sehr gespannt, Herr Minister, wie Sie das mit Ihrem WLAN-Router in Zukunft handeln werden oder wie Sie das machen werden. Vielleicht erzählen Sie uns das ja heute am Steirertag einmal. (Zwischenruf des Bundesrates Novak.) Wir werden zumindest diesem Gesetz aufgrund der genannten Gründe nicht zustimmen. – Vielen Dank. (Beifall bei den Grünen.)
19.15
Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Koller. – Bitte.
19.15
Bundesrat Hubert Koller, MA (SPÖ, Steiermark): Frau Präsidentin! Herr steirischer Minister! Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Jetzt war es ein bisschen technisch hochstehend. Es geht um das neue Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz, das wir jetzt im ganzen EU-Raum umsetzen, eine Richtlinie der EU, 2014/53. Laut Aussagen des Herrn Bundesministers Jörg Leichtfried im Nationalrat ist diese Richtlinie sehr eng gespannt worden, also relativ genau und praxisnah, sodass es eben enge Grenzen beim Gesetzesvorschlag gegeben hat. (Vizepräsidentin Winkler übernimmt den Vorsitz.)
Die wesentlichen Neuerungen gegenüber dem alten Gesetz sind folgende: Es geht ausschließlich um die Marktüberwachung von Funkanlagen. Diese Telekommunikationseinrichtungen sind also aus diesem Gesetz herausgehalten und auch einem anderen Ministerium zugeordnet. Dabei wurde die Definition aus der EU-Richtlinie übernommen und die Gesetzestexte wurden an diese neue Diktion angepasst. Es ist auch eine detaillierte Zusammenfassung der Verpflichtungen der Akteure genau aufgelistet, sprich des Herstellers, der Bevollmächtigten, der Importeure und der Händler.
Das BMVIT ist auch notifizierende Behörde und trifft in diesem Fall auch noch in einem eigenen Notifizierungsverfahren Regelungen. Regelungen über das Notifizierungsverfahren und über Beschwerdeverfahren gegen Feststellungen notifizierter Stellen werden aufgenommen. Es wurde auch eine Warnmöglichkeit vor gefährlichen Produkten eingeführt, und es wurden die Strafbestimmungen angepasst. Laut Aussagen des Ministeriums in der Ausschusssitzung wurden die Anregungen im Begutachtungsverfahren, die Gruppen und Initiativen eingebracht haben, sehr wohl aufgenommen – soweit es möglich war.
Zu den vorigen Ausführungen von David Stögmüller: Wenn die EU-Richtlinie so eng gestrickt war, dann wird es wahrscheinlich im ganzen EU-Raum und nicht nur in Österreich so sein, dass diese alternativen Open-Source-Softwares jetzt erschwerten Zugang haben. Immerhin wurde aber im Ausschuss ausgesagt, dass die grundlegenden Anforderungen im § 3 geregelt wurden. Diese sind zu erfüllen, und es gibt doch eine kleine Öffnung für solche Maßnahmen.
Eine Ausnahme musste im Gesetz auch gemacht werden, und zwar dafür, dass neue Produkte, innovative Funkanlagen auf Messen präsentiert werden können, die dieser Richtlinie noch nicht entsprechen. Es ist also ein praxisorientiertes Gesetz, deshalb werden wir natürlich zustimmen, Herr Minister. – Danke. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.)
19.18
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Ing. Pum. – Bitte.
19.18
Bundesrat Ing. Andreas Pum (ÖVP, Niederösterreich): Geschätzte Frau Präsidentin! Geschätzter Herr Minister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Für das Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz braucht man keine Unterlage mehr, das wird gefunkt – aber Spaß beiseite.
Es geht um drei praktikable Dinge; das eine ist der Konsumentenschutz. Die Diskussion darüber wurde ja schon in der technischen Art und Weise geführt. Ich glaube aber, die praktische Diskussion betrifft ganz einfach den Umstand, dass wir heute in einem technologischen Markt unterwegs sind und die Handlungsweisen und die technischen Grundlagen oftmals nicht mehr verstehen können. Hierbei ist es notwendig, gesetzliche Konformitäten zu schaffen. All das, glaube ich, wird in diesem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz auch geregelt.
Zum Zweiten: eine Warnpflicht. Es ist etwas ganz Wesentliches, nämlich dann, wenn Probleme entstehen, auch gewarnt zu werden und damit immer wieder im Ernstfall eine Benachrichtigung darüber zu erhalten. Zuständigkeiten laufen über das Ministerium, was letztlich zeigt, dass da ebenso die Behörden mit im Spiel sind – und all das unter der Prämisse, ganz einfach im Technologiezeitalter auch zukünftig sicher unterwegs zu sein.
Diese Sicherheit garantiert natürlich immer wieder Fortschritt. Es wurde schon im Ausschuss sehr klar gesagt, dass durch diese Regelungen keine neuen Ideen, keine neuen Start-up-Projekte verhindert werden. Im Gegenteil: Dem ist auch zukünftig Tür und Tor geöffnet.
In diesem Sinne stimmen natürlich auch wir diesem Gesetz zu. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.)
19.19
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Samt. – Bitte.
19.20
Bundesrat Peter Samt (FPÖ, Steiermark): Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Kollege Pum, das stimmt schon, aber da hast du nicht ganz aufgepasst. Kollege Stögmüller hat schon ein paar Dinge angemerkt, die tatsächlich kritisch zu sehen sind. Auch wir sind jedoch der Meinung, dass die Umsetzung dieser EU-Richtlinie 2014/53 eine wichtige und gute ist.
Es ist einfach so, dass wir heute sehr viele Dinge im Zusammenhang mit den Gerätschaften, die uns in unserem Leben umgeben, nicht mehr wahrnehmen. Wir wissen nicht nur nicht mehr, wie sie funktionieren, weil das ja doch nur einschlägigen Technikspezialisten vorbehalten ist, sondern registrieren teilweise auch nicht mehr wirklich, ob diese Dinge sicher sind, die Smartphones und Tablets, die alle nach Hause anrufen, vom Auto über den Autoschlüssel bis hin zu den Kühlschränken, die demnächst beim Kaufhaus anrufen und sich wieder selbst befüllen werden. Dabei entgleitet uns natürlich das Gefühl dafür, ob das wirklich alles sicher ist. Wir hatten schon das Thema Hacker. (Bundesminister Leichtfried: Das Letztere wäre schon praktisch!) – Ja, das kommt.
Es ist daher ganz wichtig, dass auch dieses Gesetz, das inklusive der erwähnten Änderungen, die in den Ausschusssitzungen besprochen worden sind, in Richtung Konsumentenschutz ansetzt, damit wirklich gefährliche Produkte ausgeschlossen werden können. Und da setzt unsere Kritik an, auch wenn wir diesem Gesetz zustimmen werden. Die Provider, deren Stellungnahmen auch gehört worden sind – zumindest hoffen wir, dass sie gelesen worden sind; wir haben sie gelesen –, sagen natürlich, dass bei diesem Gesetz von Systemen ausgegangen wird, die fehlerlos arbeiten. Gerade im EDV- und Internetbereich wissen wir aber, dass es nichts Fehlerloses gibt.
Wir sollten auch vorsichtig sein, dass wir nicht mit dem, was wir jetzt da machen, unser vor längerer Zeit beschlossenes Telekommunikationsgesetz zur Marktliberalisierung wie-
der ein bisschen konterkarieren. Wenn es jetzt wieder in die andere Richtung geht, sodass wir Monopolbildungen zulassen, sodass nur mehr bestimmte Gerätschaften, bestimmte Provider mit bestimmten Softwareupdates arbeiten können, dann wäre das allerdings tatsächlich ein Rückschritt.
Deswegen, geschätzter Herr Bundesminister, setzen wir da schon ein bisschen auf dich, dass alle zur Verfügung stehenden Spielräume, die dieses Gesetz bietet, auch genutzt werden, um diese negativen Auswirkungen wirklich zu dämpfen. Wir werden aber wahrscheinlich – und da bin ich mit dem Kollegen Stögmüller ungefähr auf einer gleichen Position – nicht umhinkommen, auch darauf zu drängen, dass die EU-Richtlinie angepasst werden muss. Das können wir natürlich nicht gut machen, aber wir können es zumindest anregen. Ich glaube, das wäre ein sinnvoller Weg.
In Summe ist das Gesetz für uns soweit okay. Die kritisch angemerkten Punkte gehören beachtet, gehören also nicht weggeschoben. Man soll nicht sagen: Es ist alles schön und es wird schon alles passen! Es wird wichtig sein, dass, wenn es solche Fälle dann tatsächlich gibt – und davon gehen wir aus –, der Gesetzgeber, in diesem Fall das zuständige Ministerium, rasch und richtig reagiert. – Danke schön. (Beifall bei der FPÖ und bei Bundesräten von ÖVP und SPÖ.)
19.23
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.
Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.
Wir gelangen zur Abstimmung.
Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist angenommen.
Die Tagesordnung ist erschöpft.
Verlesung eines Teiles des Amtlichen Protokolls
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Es liegt mir ein schriftliches Verlangen von fünf Mitgliedern des Bundesrates vor, das Amtliche Protokoll hinsichtlich des Tagesordnungspunktes 15 zu verlesen, damit dieser Teil des Amtlichen Protokolls mit Schluss der Sitzung als genehmigt gilt. Dadurch soll die umgehende Beschlussfassung ermöglicht werden.
Ich werde daher so vorgehen und verlese nun den entsprechenden Teil des Amtlichen Protokolls:
„TO-Punkt 15: Abstimmung: Beschluss des Nationalrates vom 29. März 2017 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das E-Government-Gesetz, das Zustellgesetz, das Bundesgesetz über die Ausstellung der Apostille nach dem Übereinkommen zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von der Beglaubigung, die Bundesabgabenordnung, das Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz 2010, das Neugründungs-Förderungsgesetz, das Unternehmensserviceportalgesetz, das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, das GmbH-Gesetz, das Notariatstarifgesetz, das Gerichtsgebührengesetz, das Arbeitszeitgesetz, das Arbeitsruhegesetz, das Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz, das Bäckereiarbeiter/innengesetz 1996, das Mutterschutzgesetz 1979, das Kinder und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz 1987, das Gleichbehandlungsgesetz, das Heimarbeitsgesetz 1960, das Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz, das Behinderteneinstellungsgesetz, das Gesundheitstelematikgesetz 2012, das Arzneimittelgesetz, das Rohrleitungsgesetz und das Kraftfahrgesetz 1967 geändert werden (Deregulierungsgesetz 2017) (1457 d.B. und 1569 d.B. sowie 9747/BR d.B. und 9752/BR d.B.).
Berichterstattung: Antrag, keinen Einspruch zu erheben, wird angenommen (mit Stimmenmehrheit).
Es liegt ein schriftliches Verlangen von fünf Mitgliedern des Bundesrates gemäß § 64 Absatz 2 GO-BR vor, das Amtliche Protokoll hinsichtlich des Tagesordnungspunktes 15 zu verlesen (Beilage B).“
Erheben sich Einwendungen gegen die Fassung oder den Inhalt dieses Teiles des Amtlichen Protokolls? – Das ist nicht der Fall.
Dieser Teil des Amtlichen Protokolls gilt daher gemäß § 64 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Bundesrates mit Schluss dieser Sitzung als genehmigt.
Vizepräsidentin Ingrid Winkler: Ich gebe noch bekannt, dass seit der letzten, beziehungsweise in der heutigen Sitzung insgesamt neun Anfragen 3224/J-BR/2017 bis 3232/J-BR/2017 eingebracht wurden.
Eingelangt sind nachstehend genannte Entschließungsanträge, die den Ausschüssen wie folgt zugewiesen wurden:
Entschließungsantrag 225/A(E)-BR/2017 der Bundesräte Mag. Raml, Kolleginnen und Kollegen betreffend Artikel 1 Charta der Grundrechte der Europäischen Union „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen“ im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Vorbeugung von sexuellen Übergriffen auf minderjährige, wehrlose sowie psychisch beeinträchtige Personen, zugewiesen dem Justizausschuss,
Entschließungsantrag 226/A(E)-BR/2017 der Bundesräte Schererbauer, Kolleginnen und Kollegen betreffend Finanzierung und Koordinierung einer Ehrungsstätte für Sportler, zugewiesen dem Ausschuss für Sportangelegenheiten,
Entschließungsantrag 227/A(E)-BR/2017 der Bundesräte Mag. Raml, Kolleginnen und Kollegen betreffend die Angleichung der Strafobergrenzen für junge Erwachsene an jene bei Erwachsenen, zugewiesen dem Justizausschuss,
Entschließungsantrag 228/A(E)-BR/2017 der Bundesräte Samt, Kolleginnen und Kollegen betreffend die Straffung und Entbürokratisierung der Verfahren nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000, zugewiesen dem Umweltausschuss,
Entschließungsantrag 229/A(E)-BR/2017 der Bundesräte Herbert, Kolleginnen und Kollegen betreffend Rufnummernunterdrückung bei der Exekutive, zugewiesen dem Ausschuss für innere Angelegenheiten,
Entschließungsantrag 230/A(E)-BR/2017 der Bundesräte Meißl, Kolleginnen und Kollegen betreffend Verankerung des Prinzips „Schulsprache Deutsch“, zugewiesen dem Ausschuss für Unterricht, Kunst und Kultur,
Entschließungsantrag 231/A(E)-BR/2017 der Bundesräte Krusche, Kolleginnen und Kollegen betreffend unverzüglicher Ausstieg aus dem EURATOM-Vertrag, zugewiesen dem Umweltausschuss,
Entschließungsantrag 232/A(E)-BR/2017 der Bundesräte Mühlwerth, Kolleginnen und Kollegen betreffend Wechsel von Schulstufen, zugewiesen dem Ausschuss für Unterricht, Kunst und Kultur,
Entschließungsantrag 233/A(E)-BR/2017 der Bundesräte Mühlwerth, Kolleginnen und Kollegen betreffend Deutsch-Klassen für Schüler ohne ausreichende Kenntnis der Unterrichtssprache, zugewiesen dem Ausschuss für Unterricht, Kunst und Kultur,
Entschließungsantrag 234/A(E)-BR/2017 der Bundesräte Ecker, Kolleginnen und Kollegen betreffend Computertomografie (CT) oder Magnetresonanztomografie (MRT) – Untersuchungen für Sozialversicherte, zugewiesen dem Gesundheitsausschuss,
Entschließungsantrag 235/A(E)-BR/2017 der Bundesräte Schererbauer, Kolleginnen und Kollegen betreffend Erhalt des Botanischen Gartens Schönbrunn sowie des freien Eintritts in diesen, zugewiesen dem Umweltausschuss sowie
Entschließungsantrag 236/A(E)-BR/2017 der Bundesräte Längle, Kolleginnen und Kollegen betreffend Anpassung des Einkommens von Militär-Fluglotsen und Militär-Flugberatern an den Marktwert, zugewiesen dem Ausschuss für Verfassung und Föderalismus.
*****
Die Einberufung der nächsten Sitzung des Bundesrates wird auf schriftlichem Wege erfolgen. Als Sitzungstermin wird Donnerstag, der 11. Mai 2017, 9.00 Uhr, in Aussicht genommen.
Für die Tagesordnung dieser Sitzung kommen insbesondere jene Beschlüsse in Betracht, die der Nationalrat bis dahin verabschiedet haben wird, soweit diese dem Einspruchsrecht beziehungsweise dem Zustimmungsrecht des Bundesrates unterliegen.
Die Ausschussvorberatungen sind für Dienstag, 9. Mai 2017, 14.00 Uhr, vorgesehen.
Danke. (Allgemeiner Beifall.)
Die Sitzung ist geschlossen.
Schluss der Sitzung: 19.31 Uhr
|
Impressum: Parlamentsdirektion 1017 Wien |