
Plenarsitzung
des Nationalrates
125. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich
Mittwoch, 13. Oktober 2021
XXVII. Gesetzgebungsperiode
Großer Redoutensaal

Plenarsitzung
des Nationalrates
125. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich
Mittwoch, 13. Oktober 2021
XXVII. Gesetzgebungsperiode
Großer Redoutensaal
Stenographisches Protokoll
125. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich
XXVII. Gesetzgebungsperiode Mittwoch, 13. Oktober 2021
Dauer der Sitzung
Mittwoch, 13. Oktober 2021: 10.01 – 19.55 Uhr
*****
Tagesordnung
1. Punkt: Erklärung des Bundesministers für Finanzen zur Regierungsvorlage betreffend das Bundesfinanzgesetz für das Jahr 2022 samt Anlagen
2. Punkt: Bericht über den Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2020
3. Punkt: Bundesgesetz, mit dem ein Telekommunikationsgesetz erlassen (Telekommunikationsgesetz 2021 – TKG 2021), das KommAustria-Gesetz (KommAustria-Gesetz – KOG), die Strafprozeßordnung 1975 (StPO), das Polizeikooperationsgesetz (PolKG), das Polizeiliche Staatsschutzgesetz (PStSG), das Sicherheitspolizeigesetz (SPG), das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018), das Börsegesetz 2018 (BörseG 2018), das Postmarktgesetz (PMG), das Kraftfahrgesetz 1967 (KFG 1967), das Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMAG 2016), das Funker-Zeugnisgesetz 1998 (FZG), das Rundfunkgebührengesetz (RGG), das Fernsprechentgeltzuschussgesetz (FeZG) und das Audiovisuelle Mediendienste-Gesetz (AMD-G) geändert werden
4. Punkt: Bericht über den Antrag 1276/A(E) der Abgeordneten Mag. Verena Nussbaum, Kolleginnen und Kollegen betreffend Barrierefreie Kommunikation bei Notrufnummern endlich umsetzen!
5. Punkt: Bericht über den Antrag 1730/A(E) der Abgeordneten Mag. Dr. Petra Oberrauner, Kolleginnen und Kollegen betreffend freie Endgerätewahl beim Internetzugang
6. Punkt: Bericht über den Antrag 1824/A der Abgeordneten Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Epidemiegesetz 1950 und das COVID-19-Maßnahmengesetz geändert werden
7. Punkt: Bericht über den Antrag 1925/A der Abgeordneten Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das COVID-19-Zweckzuschussgesetz geändert wird
8. Punkt: Bericht und Antrag über den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über eine COVID-19 Förderung für betriebliche Testungen (Betriebliches Testungs-Gesetz – BTG) geändert wird
9. Punkt: Bericht über den Antrag 1822/A der Abgeordneten Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das COVID-19-Lagergesetz geändert wird
10. Punkt: Bericht über den Antrag 1467/A der Abgeordneten Dr. Josef Smolle, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Gesundheitstelematikgesetz 2012 geändert wird
11. Punkt: Bericht über den Antrag 1924/A der Abgeordneten Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz und das Medizinproduktegesetz geändert werden
12. Punkt: Bericht über den Antrag 1586/A(E) der Abgeordneten Mag. Christian Drobits, Kolleginnen und Kollegen betreffend umgehendes Verbot des Farbstoffs Titandioxid E 171 wegen Krebsgefahr
13. Punkt: Abkommen im Bereich der sozialen Sicherheit zwischen der Republik Österreich und Kanada
14. Punkt: Bericht über den Antrag 1900/A(E) der Abgeordneten Erwin Angerer, Kolleginnen und Kollegen betreffend Energiearmut bekämpfen
15. Punkt: Bericht über den Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für März 2020 bis Juli 2021
16. Punkt: Bericht und Antrag über den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Mutterschutzgesetz 1979 geändert wird
17. Punkt: Bericht über den Antrag 44/A(E) der Abgeordneten Josef Muchitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend rasche Umsetzung eines Arbeitsmarktpaketes
18. Punkt: Bericht über den Antrag 628/A(E) der Abgeordneten Josef Muchitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend arbeitsmarktpolitische Sofortmaßnahmen zur Beschäftigungsförderung
19. Punkt: Bericht über den Antrag 1878/A(E) der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend Ausstieg aus der Corona Kurzarbeit
20. Punkt: Bericht über den Antrag 1880/A(E) der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend Refundierung der überhöhten AK-Beiträge bei Kurzarbeit
21. Punkt: Bericht über den Antrag 905/A der Abgeordneten Josef Muchitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 geändert wird
22. Punkt: Bericht über den Antrag 1201/A der Abgeordneten Josef Muchitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 geändert wird
23. Punkt: Bericht über den Antrag 1436/A der Abgeordneten Josef Muchitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 geändert wird
24. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Handelsstatistische Gesetz 1995 geändert wird
25. Punkt: Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Slowenien zur Beendigung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik Slowenien über die gegenseitige Förderung und den Schutz von Investitionen
26. Punkt: Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Kroatien zur Beendigung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik Kroatien über die Förderung und den Schutz von Investitionen
27. Punkt: Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Malta zur Beendigung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und Malta über die Förderung und den gegenseitigen Schutz von Investitionen
*****
Inhalt
Nationalrat
Ansprache der Präsidentin Doris Bures anlässlich des Tages des metastasierten Brustkrebses ................................................................................................. 74
Personalien
Verhinderungen ........................................................................................................ 14
Geschäftsbehandlung
Antrag gemäß § 69 Abs. 3 GOG, die Regierungsvorlage betreffend das Bundesfinanzgesetz für das Jahr 2022 samt Anlagen in erste Lesung zu nehmen – Annahme ............................................................................................................ 16, 16
Redezeitbeschränkung nach Beratung in der Präsidialkonferenz gemäß § 57 Abs. 5 GOG .............................................................................................................. 16
Verlangen der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Christian Hafenecker, MA, Dr. Stephanie Krisper, Kolleginnen und Kollegen gemäß § 33 Abs. 1 2. Satz GOG auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses betreffend „Klärung von Korruptionsvorwürfen gegen ÖVP-Regierungsmitglieder (ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss)“ (3/US) – Zurückziehung ........................................ 109, 176
Verlangen gemäß § 33 Abs. 4 GOG auf Durchführung einer kurzen Debatte im Sinne des § 57a Abs. 1 GOG (hinfällig) .................................................... 109, 176
Wortmeldung der Abgeordneten Gabriele Heinisch-Hosek im Zusammenhang mit der Nichtzulassung eines Entschließungsantrages zu Tagesordnungspunkt 7 114
Stellungnahme des Präsidenten Ing. Norbert Hofer betreffend die Nichtzulassung eines Entschließungsantrages zu Tagesordnungspunkt 7 ........................ 114
Verlangen der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Christian Hafenecker, MA, Dr. Stephanie Krisper, Kolleginnen und Kollegen gemäß § 33 Abs. 1 2. Satz GOG auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses betreffend „Klärung von Korruptionsvorwürfen gegen ÖVP-Regierungsmitglieder (ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss)“ (4/US) ................................................................................... 176
Verlangen gemäß § 33 Abs. 4 GOG auf Durchführung einer kurzen Debatte im Sinne des § 57a Abs. 1 GOG ................................................................................... 176
RednerInnen:
Kai Jan Krainer ........................................................................................................ 230
Mag. Andreas Hanger ............................................................................................. 232
Nurten Yılmaz .......................................................................................................... 234
Christian Hafenecker, MA ...................................................................................... 235
Mag. Nina Tomaselli ............................................................................................... 237
Dr. Stephanie Krisper ............................................................................................. 238
Zuweisung des Verlangens 4/US auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses an den Geschäftsordnungsausschuss .............................................................. 239
Wortmeldungen im Zusammenhang mit den Verlangen 3/US sowie 4/US:
August Wöginger .................................................................................................... 187
Mag. Jörg Leichtfried ............................................................................................. 187
Mitteilung der Präsidentin Doris Bures betreffend Verteilung des Verlangens 4/US ................................................................................................................. 188
Bundesregierung
Vertretungsschreiben ................................................................................................ 14
Ausschüsse
Zuweisungen ....................................................................................... 14, 170, 239
Verhandlungen
1. Punkt: Erklärung des Bundesministers für Finanzen zur Regierungsvorlage betreffend das Bundesfinanzgesetz für das Jahr 2022 samt Anlagen – Beschluss auf erste Lesung ............................................................................................ 17, 17
2. Punkt: Bericht des Budgetausschusses über den Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2020 (III-321/1062 d.B.) ....................................................................... 24
RednerInnen:
Kai Jan Krainer ........................................................................................................ 24
Gabriel Obernosterer .............................................................................................. 25
MMag. DDr. Hubert Fuchs ...................................................................................... 27
Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA ................................................................................. 31
Mag. Gerald Loacker .............................................................................................. 32
Mag. Andreas Hanger ............................................................................................. 34
Alois Stöger, diplômé (tatsächliche Berichtigung) ................................................. 36
Julia Elisabeth Herr ................................................................................................ 36
Dr. Elisabeth Götze ................................................................................................. 39
Erwin Angerer ......................................................................................................... 40
Mag. Dr. Rudolf Taschner ...................................................................................... 45
Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer ................................................................................. 46
Rechnungshofpräsidentin Dr. Margit Kraker ...................................................... 51
Angela Baumgartner .............................................................................................. 53
Alois Stöger, diplômé ............................................................................................. 54
Christoph Stark ....................................................................................................... 55
Mag. Martina Künsberg Sarre ................................................................................ 56
Nikolaus Prinz ......................................................................................................... 61
Petra Bayr, MA MLS ................................................................................................ 63
Mag. Sibylle Hamann .............................................................................................. 64
Henrike Brandstötter .............................................................................................. 64
Andreas Kollross .................................................................................................... 66
Dr. Johannes Margreiter ........................................................................................ 67
Dr. Christoph Matznetter ........................................................................................ 70
Andreas Ottenschläger .......................................................................................... 72
Mag. Gerhard Kaniak .............................................................................................. 72
Entschließungsantrag der Abgeordneten MMag. DDr. Hubert Fuchs, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Abschaffung der Kalten Progression“ – Ablehnung ............................................................................................................... 29, 74
Entschließungsantrag der Abgeordneten Julia Elisabeth Herr, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Klimainvestitionen statt Körperschaftssteuer-Geschenke für Konzerne“ – Ablehnung ................................................................................. 37, 74
Entschließungsantrag der Abgeordneten Erwin Angerer, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Energiearmut bekämpfen“ – Ablehnung ............................. 42, 74
Entschließungsantrag der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Kalte Progression JETZT abschaffen!“ – Ablehnung 48, 74
Entschließungsantrag der Abgeordneten Mag. Martina Künsberg Sarre, Kolleginnen und Kollegen betreffend „EUR 1,2 Mrd. und Rechtsanspruch auf Nachmittagsbetreuung“ – Ablehnung .................................................................... 58, 74
Entschließungsantrag der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Abschaffung der Rechtsgeschäftsgebühren“ – Ablehnung ............................................................................................................... 68, 74
Annahme des Gesetzentwurfes in 1062 d.B. ........................................................... 74
Gemeinsame Beratung über
3. Punkt: Bericht des Ausschusses für Forschung, Innovation und Digitalisierung über die Regierungsvorlage (1043 d.B.): Bundesgesetz, mit dem ein Telekommunikationsgesetz erlassen (Telekommunikationsgesetz 2021 – TKG 2021), das KommAustria-Gesetz (KommAustria-Gesetz – KOG), die Strafprozeßordnung 1975 (StPO), das Polizeikooperationsgesetz (PolKG), das Polizeiliche Staatsschutzgesetz (PStSG), das Sicherheitspolizeigesetz (SPG), das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018), das Börsegesetz 2018 (BörseG 2018), das Postmarktgesetz (PMG), das Kraftfahrgesetz 1967 (KFG 1967), das Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMAG 2016), das Funker-Zeugnisgesetz 1998 (FZG), das Rundfunkgebührengesetz (RGG), das Fernsprechentgeltzuschussgesetz (FeZG) und das Audiovisuelle Mediendienste-Gesetz (AMD-G) geändert werden (1080 d.B.) ................................................................................................................ 75
4. Punkt: Bericht des Ausschusses für Forschung, Innovation und Digitalisierung über den Antrag 1276/A(E) der Abgeordneten Mag. Verena Nussbaum, Kolleginnen und Kollegen betreffend Barrierefreie Kommunikation bei Notrufnummern endlich umsetzen! (1081 d.B.) ........................................................................................ 75
5. Punkt: Bericht des Ausschusses für Forschung, Innovation und Digitalisierung über den Antrag 1730/A(E) der Abgeordneten Mag. Dr. Petra Oberrauner, Kolleginnen und Kollegen betreffend freie Endgerätewahl beim Internetzugang (1082 d.B.) ................................................................................................................ 76
RednerInnen:
Mag. Dr. Petra Oberrauner ..................................................................................... 76
Eva-Maria Himmelbauer, BSc ................................................................................ 77
Dipl.-Ing. Gerhard Deimek ..................................................................................... 84
Süleyman Zorba ...................................................................................................... 85
Melanie Erasim, MSc .............................................................................................. 86
Douglas Hoyos-Trauttmansdorff .......................................................................... 87
Bundesministerin Elisabeth Köstinger ................................................................ 89
Katharina Kucharowits ........................................................................................... 91
Dr. Josef Smolle ...................................................................................................... 92
Nurten Yılmaz .......................................................................................................... 93
Heike Grebien .......................................................................................................... 94
Carina Reiter ............................................................................................................ 95
Entschließungsantrag der Abgeordneten Eva-Maria Himmelbauer, BSc, Süleyman Zorba, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Relaisfunkstellen“ – Annahme (201/E) ..................................................................................................... 82, 96
Entschließungsantrag der Abgeordneten Eva-Maria Himmelbauer, BSc, Süleyman Zorba, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Amateurfunkprüfungen“ – Annahme (202/E) .......................................................................................... 83, 96
Annahme des Gesetzentwurfes in 1080 d.B. ........................................................... 96
Kenntnisnahme der beiden Ausschussberichte 1081 und 1082 d.B. ...................... 96
Gemeinsame Beratung über
6. Punkt: Bericht des Gesundheitsausschusses über den Antrag 1824/A der Abgeordneten Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Epidemiegesetz 1950 und das COVID-19-Maßnahmengesetz geändert werden (1067 d.B.) ................................................... 97
7. Punkt: Bericht des Gesundheitsausschusses über den Antrag 1925/A der Abgeordneten Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das COVID-19-Zweckzuschussgesetz geändert wird (1068 d.B.) ................................................................................................. 97
8. Punkt: Bericht und Antrag des Gesundheitsausschusses über den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über eine COVID-19 Förderung für betriebliche Testungen (Betriebliches Testungs-Gesetz – BTG) geändert wird (1069 d.B.) ......................................................................................................... 97
9. Punkt: Bericht des Gesundheitsausschusses über den Antrag 1822/A der Abgeordneten Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das COVID-19-Lagergesetz geändert wird (1070 d.B.) ................................................................................................................ 98
10. Punkt: Bericht des Gesundheitsausschusses über den Antrag 1467/A der Abgeordneten Dr. Josef Smolle, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Gesundheitstelematikgesetz 2012 geändert wird (1071 d.B.) ................................................................................................. 98
11. Punkt: Bericht des Gesundheitsausschusses über den Antrag 1924/A der Abgeordneten Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz und das Medizinproduktegesetz geändert werden (1072 d.B.) ....................... 98
RednerInnen:
Philip Kucher ........................................................................................................... 98
Ralph Schallmeiner ................................................................................................ 100
Dr. Dagmar Belakowitsch (tatsächliche Berichtigung) .......................................... 103
Mag. Gerhard Kaniak .............................................................................................. 104
Dr. Josef Smolle ...................................................................................................... 107
Mag. Gerald Loacker .............................................................................................. 109
Bedrana Ribo, MA ................................................................................................... 110
Mag. Verena Nussbaum ......................................................................................... 111
Ing. Mag. (FH) Alexandra Tanda ............................................................................ 112
Mag. Gerald Hauser ................................................................................................ 114
Martina Diesner-Wais ............................................................................................. 118
Dr. Dagmar Belakowitsch ...................................................................................... 119
Bundesminister Dr. Wolfgang Mückstein ............................................................ 123
Mag. Elisabeth Scheucher-Pichler ........................................................................ 125
Alois Stöger, diplômé ............................................................................................. 127
Mag. Ruth Becher ................................................................................................... 129
Mag. Jörg Leichtfried ............................................................................................. 130
Entschließungsantrag der Abgeordneten Philip Kucher, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Pflegeoffensive jetzt“ – nicht zugelassen ..................... 112, 112
Entschließungsantrag der Abgeordneten Mag. Gerald Hauser, Kolleginnen und Kollegen betreffend „betriebliche Gratistests beibehalten“ – Ablehnung . 117, 137
Entschließungsantrag der Abgeordneten Dr. Dagmar Belakowitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Ende aller Covid-Maßnahmen und Corona-Freiheitstag am 26. Oktober 2021“ – Ablehnung .................................................... 121, 136
Entschließungsantrag der Abgeordneten Philip Kucher, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Pflegeoffensive jetzt!“ – Ablehnung .............................. 130, 136
Annahme der sechs Gesetzentwürfe in 1067, 1068, 1069, 1070, 1071 und 1072 d.B. ................................................................................................................... 136
12. Punkt: Bericht des Gesundheitsausschusses über den Antrag 1586/A(E) der Abgeordneten Mag. Christian Drobits, Kolleginnen und Kollegen betreffend umgehendes Verbot des Farbstoffs Titandioxid E 171 wegen Krebsgefahr (1073 d.B.) 133
RednerInnen:
Mag. Ulrike Fischer ................................................................................................. 133
Mag. Christian Drobits ........................................................................................... 133
Ing. Josef Hechenberger ........................................................................................ 134
Clemens Stammler ................................................................................................. 135
Annahme der dem schriftlichen Ausschussbericht 1073 d.B. beigedruckten Entschließung betreffend „umgehendes Verbot des Farbstoffs Titandioxid E 171 wegen Krebsgefahr“ (203/E) ......................................................................................... 136
Gemeinsame Beratung über
13. Punkt: Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über die Regierungsvorlage (1031 d.B.): Abkommen im Bereich der sozialen Sicherheit zwischen der Republik Österreich und Kanada (1083 d.B.) .................................................... 138
14. Punkt: Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 1900/A(E) der Abgeordneten Erwin Angerer, Kolleginnen und Kollegen betreffend Energiearmut bekämpfen (1084 d.B.) .............................................................. 138
15. Punkt: Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für März 2020 bis Juli 2021, vorgelegt vom Bundesminister für Arbeit (III-401/1085 d.B.) ..................................................................................................... 138
16. Punkt: Bericht und Antrag des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Mutterschutzgesetz 1979 geändert wird (1086 d.B.) ......................................................................................................... 138
RednerInnen:
Gabriele Heinisch-Hosek ....................................................................................... 139
MMMag. Gertraud Salzmann ................................................................................. 141
Dr. Dagmar Belakowitsch ...................................................................................... 142
Barbara Neßler ........................................................................................................ 144
Fiona Fiedler, BEd .................................................................................................. 145
Bundesminister Mag. Dr. Martin Kocher .............................................................. 146
Laurenz Pöttinger ................................................................................................... 147
Mag. Verena Nussbaum ......................................................................................... 148
Erwin Angerer ......................................................................................................... 149
Genehmigung des Staatsvertrages in 1083 d.B. ..................................................... 170
Kenntnisnahme des Ausschussberichtes 1084 d.B. ................................................ 170
Zuweisung des Antrages 1900/A(E) an den Ausschuss für Wirtschaft, Industrie und Energie ............................................................................................................... 170
Kenntnisnahme des Berichtes III-401 d.B. ............................................................... 170
Annahme des Gesetzentwurfes in 1086 d.B. ........................................................... 170
Gemeinsame Beratung über
17. Punkt: Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 44/A(E) der Abgeordneten Josef Muchitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend rasche Umsetzung eines Arbeitsmarktpaketes (1087 d.B.) ............................ 150
18. Punkt: Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 628/A(E) der Abgeordneten Josef Muchitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend arbeitsmarktpolitische Sofortmaßnahmen zur Beschäftigungsförderung (1088 d.B.) ................................................................................................................ 150
19. Punkt: Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 1878/A(E) der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend Ausstieg aus der Corona Kurzarbeit (1089 d.B.) .................................... 151
20. Punkt: Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 1880/A(E) der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend Refundierung der überhöhten AK-Beiträge bei Kurzarbeit (1090 d.B.) 151
21. Punkt: Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 905/A der Abgeordneten Josef Muchitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 geändert wird (1091 d.B.) ................................................................................................. 151
22. Punkt: Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 1201/A der Abgeordneten Josef Muchitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 geändert wird (1092 d.B.) ......................................................................................... 151
23. Punkt: Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 1436/A der Abgeordneten Josef Muchitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 geändert wird (1093 d.B.) ......................................................................................... 151
RednerInnen:
Alois Stöger, diplômé ............................................................................................. 151
Mag. Michael Hammer ............................................................................................ 153
Dr. Dagmar Belakowitsch ...................................................................................... 154
Mag. Markus Koza .................................................................................................. 156
Mag. Gerald Loacker .............................................................................................. 158
Bundesminister Mag. Dr. Martin Kocher .............................................................. 159
Bettina Zopf ............................................................................................................. 161
Mag. Christian Drobits ........................................................................................... 162
Mag. Ernst Gödl ...................................................................................................... 163
Mag. Christian Ragger ............................................................................................ 164
Michael Seemayer ................................................................................................... 165
Erwin Angerer ......................................................................................................... 166
Klaus Köchl ............................................................................................................. 169
Entschließungsantrag der Abgeordneten Alois Stöger, diplômé, Kolleginnen und Kollegen betreffend „finanzielle Hilfe für Menschen, die schon lange arbeitslos sind“ – Ablehnung ..................................................................................... 152, 171
Entschließungsantrag der Abgeordneten Erwin Angerer, Kolleginnen und Kollegen betreffend „die Einführung einer Lehrabschlussprämie“ – Ablehnung 167, 170
Kenntnisnahme der sieben Ausschussberichte 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092 und 1093 d.B. .................................................................................................. 170
Gemeinsame Beratung über
24. Punkt: Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie und Energie über die Regierungsvorlage (958 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Handelsstatistische Gesetz 1995 geändert wird (1057 d.B.) ................................................................... 171
25. Punkt: Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie und Energie über die Regierungsvorlage (1033 d.B.): Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Slowenien zur Beendigung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik Slowenien über die gegenseitige Förderung und den Schutz von Investitionen (1058 d.B.) ........................................................................ 171
26. Punkt: Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie und Energie über die Regierungsvorlage (1032 d.B.): Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Kroatien zur Beendigung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik Kroatien über die Förderung und den Schutz von Investitionen (1059 d.B.) ........................................................................................... 171
27. Punkt: Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie und Energie über die Regierungsvorlage (1036 d.B.): Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Malta zur Beendigung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und Malta über die Förderung und den gegenseitigen Schutz von Investitionen (1060 d.B.) ..................................................................................................... 171
RednerInnen:
Peter Haubner ......................................................................................................... 172
Dr. Christoph Matznetter ........................................................................ 172, 181
Erwin Angerer ......................................................................................................... 174
Dr. Elisabeth Götze ................................................................................................. 174
Dr. Helmut Brandstätter ......................................................................................... 175
Johann Höfinger ..................................................................................................... 177
Maximilian Lercher ................................................................................................. 177
Bundesministerin Dr. Margarete Schramböck .................................................... 178
Johann Singer ......................................................................................................... 179
Mag. Dr. Petra Oberrauner ..................................................................................... 180
Rebecca Kirchbaumer ............................................................................................ 181
Mag. Jörg Leichtfried ............................................................................................. 183
Mag. Gerald Loacker .............................................................................................. 184
Mag. Gerald Hauser ................................................................................................ 185
Annahme des Gesetzentwurfes in 1057 d.B. ........................................................... 188
Genehmigung der drei Staatsverträge in 1058, 1059 und 1060 d.B. ...................... 188
Eingebracht wurden
Regierungsvorlage ................................................................................................. 14
1034: Bundesgesetz über die Bewilligung des Bundesvoranschlages für das Jahr 2022 (Bundesfinanzgesetz 2022 – BFG 2022) samt Anlagen
Anträge der Abgeordneten
Mag. Dr. Rudolf Taschner, Mag. Eva Blimlinger, Kolleginnen und Kollegen betreffend Weiterentwicklung des FH-Sektors (1948/A)(E)
Mag. Martina Künsberg Sarre, Kolleginnen und Kollegen betreffend 1,2 Mrd. Euro für die Kinderbetreuung und Rechtsanspruch auf Nachmittagsbetreuung (1949/A)(E)
Mag. Julia Seidl, Kolleginnen und Kollegen betreffend Tourismusreform: Online Umsetzungsscoreboard für mehr Transparenz zur angekündigten Reformagenda des „Comeback-Prozesses“ (1950/A)(E)
Mag. Julia Seidl, Kolleginnen und Kollegen betreffend Arbeitskräfte für den Tourismus: Reform der Rot-Weiß-Rot Karte! (1951/A)(E)
Mag. Yannick Shetty, Kolleginnen und Kollegen betreffend Ausbau der Werte- und Orientierungskurse (1952/A)(E)
Mag. Yannick Shetty, Kolleginnen und Kollegen betreffend Neutrale Elternteil-Bezeichnung in internationalen Geburtsurkunden für gleichgeschlechtliche Eltern (1953/A)(E)
Dr. Stephanie Krisper, Kolleginnen und Kollegen betreffend Evaluierung der Situation für Asylberechtigte und Asylwerber_innen an den EU-Außengrenzen durch die Europäische Grundrechteagentur (1954/A)(E)
Henrike Brandstötter, Kolleginnen und Kollegen betreffend Restitution von afrikanischen Kulturgütern als Teil einer umfassenden Afrikastrategie (1955/A)(E)
Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer, Kolleginnen und Kollegen betreffend Reduzierter Umsatzsteuersatz für Medizinprodukte (1956/A)(E)
Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend Pensionsrückstellungen im Bundesrechnungsabschluss (1957/A)(E)
Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend Rahmenabkommen Rettungsdienst (1958/A)(E)
Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend Abschaffung von Teilzeitanreizen (1959/A)(E)
Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend Flächendeckendes Betriebspensionssystem (1960/A)(E)
Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend Pensionsrückstellungen im Bundesrechnungsabschluss (1961/A)(E)
Mag. Andrea Kuntzl, Kolleginnen und Kollegen betreffend Maßnahmen für Präsenzlehre an den Österreichischen Hochschulen (1962/A)(E)
Mag. Christian Drobits, Kolleginnen und Kollegen betreffend Co2-Steuer – Preis-Monitoring für alle Energielieferanten (1963/A)(E)
Melanie Erasim, MSc, Kolleginnen und Kollegen betreffend Tourismuskasse – Urlaubsansprüche (1964/A)(E)
Melanie Erasim, MSc, Kolleginnen und Kollegen betreffend Städtetourismus und Kurzarbeit (1965/A)(E)
Melanie Erasim, MSc, Kolleginnen und Kollegen betreffend Tourismuskasse – Entgeltfortzahlung bei Krankheit von Mitarbeiter*innen und Überstundenabgeltung via TUAK (1966/A)(E)
Melanie Erasim, MSc, Kolleginnen und Kollegen betreffend Tourismuskasse – Aus- und Weiterbildung (1967/A)(E)
Melanie Erasim, MSc, Kolleginnen und Kollegen betreffend Tourismuskasse – Jahresbeschäftigung (1968/A)(E)
Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Epidemiegesetz 1950 und das COVID-19-Maßnahmengesetz geändert werden (1969/A)
Mag. Klaus Fürlinger, Mag. Markus Koza, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Notarversorgungsgesetz geändert wird (1970/A)
Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das COVID-19-Zweckzuschussgesetz geändert wird (1971/A)
Philip Kucher, Kolleginnen und Kollegen betreffend Maßnahmen gegen den ÄrztInnenmangel in Österreich (1972/A)(E)
Gabriele Heinisch-Hosek, Kolleginnen und Kollegen betreffend Umsetzung Fair-Pay-Manifest (1973/A)(E)
Gabriele Heinisch-Hosek, Kolleginnen und Kollegen betreffend Selbstverpflichtung zu Fair Pay (1974/A)(E)
Katharina Kucharowits, Kolleginnen und Kollegen betreffend faire Vergütung von kreativen Leistungen im Internet (1975/A)(E)
MMMag. Dr. Axel Kassegger, Kolleginnen und Kollegen betreffend Energiearmut verhindern – keine Strom- und Gaspreiserhöhungen durch öffentliche EVUs (1976/A)(E)
Peter Schmiedlechner, Kolleginnen und Kollegen betreffend Förderung der Rehkitzrettung aus Mitteln des Tierschutzes (1977/A)(E)
Philip Kucher, Kolleginnen und Kollegen betreffend Pflegeoffensive jetzt! (1978/A)(E)
Eva Maria Holzleitner, BSc, Kolleginnen und Kollegen betreffend Forderungen des Frauenvolksbegehrens 2.0 endlich umsetzen! (1979/A)(E)
Mag. Jörg Leichtfried, Kolleginnen und Kollegen betreffend außenpolitische Initiative Österreichs für eine gemeinsame Afghanistanpolitik der EU (1980/A)(E)
Anfragen der Abgeordneten
Cornelia Ecker, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend touristischen Kurzzeitvermietungsmodellen wie z.B. AirBnB (8208/J)
Petra Vorderwinkler, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung betreffend Teilnahme am Ethikunterricht (8209/J)
Mag. Christian Drobits, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend datenschutzrechtliche Zulässigkeit des AMS-Projekt Jobimpuls (8210/J)
Anfragebeantwortungen
des Bundesministers für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Julia Elisabeth Herr, Kolleginnen und Kollegen (7502/AB zu 7646/J)
des Bundesministers für Arbeit auf die Anfrage der Abgeordneten Julia Elisabeth Herr, Kolleginnen und Kollegen (7503/AB zu 7647/J)
des Bundesministers für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport auf die Anfrage der Abgeordneten Julia Elisabeth Herr, Kolleginnen und Kollegen (7504/AB zu 7639/J)
der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Julia Elisabeth Herr, Kolleginnen und Kollegen (7505/AB zu 7640/J)
der Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus auf die Anfrage der Abgeordneten Julia Elisabeth Herr, Kolleginnen und Kollegen (7506/AB zu 7641/J)
des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Julia Elisabeth Herr, Kolleginnen und Kollegen (7507/AB zu 7642/J)
des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen (7508/AB zu 7658/J)
des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Hannes Amesbauer, BA, Kolleginnen und Kollegen (7509/AB zu 7693/J)
des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Helmut Brandstätter, Kolleginnen und Kollegen (7510/AB zu 7656/J)
der Bundesministerin für Frauen, Familie, Jugend und Integration im Bundeskanzleramt auf die Anfrage der Abgeordneten Michael Bernhard, Kolleginnen und Kollegen (7511/AB zu 7637/J)
des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abgeordneten Julia Elisabeth Herr, Kolleginnen und Kollegen (7512/AB zu 7638/J)
der Bundesministerin für EU und Verfassung im Bundeskanzleramt auf die Anfrage der Abgeordneten Julia Elisabeth Herr, Kolleginnen und Kollegen (7513/AB zu 7650/J)
des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Helmut Brandstätter, Kolleginnen und Kollegen (7514/AB zu 7655/J)
des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten Hermann Brückl, MA, Kolleginnen und Kollegen (7515/AB zu 7775/J)
des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten Hermann Brückl, MA, Kolleginnen und Kollegen (7516/AB zu 7776/J)
des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten Hermann Brückl, MA, Kolleginnen und Kollegen (7517/AB zu 7777/J)
des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten Hermann Brückl, MA, Kolleginnen und Kollegen (7518/AB zu 7778/J)
des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten Hermann Brückl, MA, Kolleginnen und Kollegen (7519/AB zu 7779/J)
des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten Julia Elisabeth Herr, Kolleginnen und Kollegen (7520/AB zu 7645/J)
des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten Hermann Brückl, MA, Kolleginnen und Kollegen (7521/AB zu 7780/J)
des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten Hermann Brückl, MA, Kolleginnen und Kollegen (7522/AB zu 7781/J)
des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten Hermann Brückl, MA, Kolleginnen und Kollegen (7523/AB zu 7782/J)
des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten Hermann Brückl, MA, Kolleginnen und Kollegen (7524/AB zu 7783/J)
der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Johannes Margreiter, Kolleginnen und Kollegen (7525/AB zu 7653/J)
der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen (7526/AB zu 7652/J)
der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Abgeordneten Peter Schmiedlechner, Kolleginnen und Kollegen (7527/AB zu 7713/J)
Beginn der Sitzung: 10.01 Uhr
Vorsitzende: Präsident Mag. Wolfgang Sobotka, Zweite Präsidentin Doris Bures, Dritter Präsident Ing. Norbert Hofer.
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten! Ich darf die 125. Sitzung des Nationalrates eröffnen und Sie ganz herzlich begrüßen. (Abgeordnete aller Fraktionen tragen Pink-Ribbon-Anstecker.)
Unser besonderer Gruß gilt heute dem Herrn Bundespräsidenten, für dessen Anwesenheit, wie sie anlässlich der Budgetrede traditionell der Fall ist, ich mich recht herzlich bedanke. – Herzlich willkommen, Herr Bundespräsident! (Allgemeiner Beifall.)
Ich darf weiters die Frau Rechnungshofpräsidentin und Herrn Volksanwalt Rosenkranz recht herzlich bei uns begrüßen. (Allgemeiner Beifall.)
Ein spezieller Gruß gilt Frau Feder Lee, sie ist die Enkelin von Hans Kelsen, dem Architekten unserer Bundesverfassung. Sie ist seit mehreren Tagen hier in Wien. Vor wenigen Tagen feierten wir den 140. Geburtstag von Hans Kelsen, seine Enkelin ist heute mit ihrem Sohn anwesend. – Herzlich willkommen hier im österreichischen Parlament! I want to give you a very warm welcome at today’s plenary session! (Allgemeiner Beifall.)
Ich darf die Damen und Herren der Presse herzlich willkommen heißen und vor allem auch die Damen und Herren, die uns vor den Bildschirmen folgen.
Für heute als verhindert gemeldet sind die Abgeordneten Nico Marchetti, Elisabeth Feichtinger, BEd BEd, Mag. Karin Greiner, Josef Muchitsch, Sabine Schatz, Alois Kainz, Peter Wurm und Michel Reimon, MBA.
Vertretung von Mitgliedern der Bundesregierung
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Für den heutigen Sitzungstag hat das Bundeskanzleramt über Vertretung von Mitgliedern der Bundesregierung, welche sich in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union aufhalten, folgende Mitteilung gemacht:
Bundesministerin für EU und Verfassung Mag. Karoline Edtstadler wird durch Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Dr. Margarete Schramböck vertreten.
Einlauf und Zuweisungen
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Hinsichtlich der eingelangten Verhandlungsgegenstände und deren Zuweisungen darf ich gemäß § 23 Abs. 4 der Geschäftsordnung auf die im Sitzungssaal verteilte Mitteilung verweisen.
Die schriftliche Mitteilung hat folgenden Wortlaut:
A. Eingelangte Verhandlungsgegenstände:
1. Schriftliche Anfragen: 8208/J bis 8210/J
2. Anfragebeantwortungen: 7502/AB bis 7527/A
B
3. Regierungsvorlage:
Bundesgesetz über die Bewilligung des Bundesvoranschlages für das Jahr 2022 (Bundesfinanzgesetz 2022 – BFG 2022) samt Anlagen (1034 d.B.)
B. Zuweisungen in dieser Sitzung:
zur Vorberatung:
Ausschuss für Arbeit und Soziales:
Antrag 1938/A(E) der Abgeordneten Dr. Dagmar Belakowitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend "Gesunde Geschäfte von Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl (ÖVP) mit der Pflegeausbildung"
Antrag 1940/A(E) der Abgeordneten Erwin Angerer, Kolleginnen und Kollegen betreffend Energiearmut bekämpfen
Antrag 1945/A(E) der Abgeordneten Mag. Christian Ragger, Kolleginnen und Kollegen betreffend Pflegemodell Kärnten als Vorbild für Österreich
Gesundheitsausschuss:
Antrag 1930/A(E) der Abgeordneten Philip Kucher, Kolleginnen und Kollegen betreffend Maßnahmenpaket zur Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der österreichischen Bevölkerung durch ausreichendes Pflegepersonal
Antrag 1931/A(E) der Abgeordneten Philip Kucher, Kolleginnen und Kollegen betreffend Sofortmaßnahmenpaket für eine ausreichende medizinische Versorgung der österreichischen Bevölkerung
Antrag 1932/A(E) der Abgeordneten Eva Maria Holzleitner, BSc, Kolleginnen und Kollegen betreffend die Schaffung echter Strategien und Lösungen zur Behandlung von Long-Covid Patientinnen und Patienten
Antrag 1933/A(E) der Abgeordneten Mag. Gerhard Kaniak, Kolleginnen und Kollegen betreffend kein Verschenken von Medizinprodukten und Arzneimitteln im Rahmen der Corona-Maßnahmen an das Ausland
Antrag 1934/A(E) der Abgeordneten Mag. Christian Ragger, Kolleginnen und Kollegen betreffend Pflegemodell Kärnten als Vorbild für Österreich
Antrag 1935/A(E) der Abgeordneten Mag. Gerald Hauser, Kolleginnen und Kollegen betreffend betriebliche Gratistests beibehalten
Antrag 1939/A(E) der Abgeordneten Dr. Dagmar Belakowitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend "Gesunde Geschäfte von Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl (ÖVP) mit der Pflegeausbildung"
Antrag 1944/A(E) der Abgeordneten Peter Schmiedlechner, Kolleginnen und Kollegen betreffend Verbot des rituellen Schächtens
Justizausschuss:
Antrag 1941/A der Abgeordneten Mag. Harald Stefan, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz mit dem das Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch – StGB), BGBl. Nr. 60/1974, und das Bundesgesetz über Suchtgifte, psychotrope Stoffe und Drogenausgangsstoffe (Suchtmittelgesetz – SMG), BGBl. I Nr. 112/1997, geändert werden
Antrag 1942/A der Abgeordneten Mag. Harald Stefan, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz mit dem das Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch – StGB), BGBl. Nr. 60/1974, geändert wird
Antrag 1943/A(E) der Abgeordneten Mag. Harald Stefan, Kolleginnen und Kollegen betreffend Schaffung eines Gesetzes zum Elternentfremdungssyndrom = Parental Alienation Syndrom (PAS)
Tourismusausschuss:
Antrag 1936/A(E) der Abgeordneten Mag. Gerald Hauser, Kolleginnen und Kollegen betreffend Sicherheit gewährleisten – betriebliche Gratistests beibehalten
Verfassungsausschuss:
Antrag 1947/A(E) der Abgeordneten Mag. Christian Drobits, Kolleginnen und Kollegen betreffend Löschverbot von Handys von Amtsträgern der Republik
Wissenschaftsausschuss:
Antrag 1937/A(E) Antrag der Abgeordneten Mag. Dr. Martin Graf, Kolleginnen und Kollegen betreffend Prüfung einer möglichen Zusammenlegung von Kunstuniversitäten
Antrag 1946/A(E) der Abgeordneten Mag. Dr. Martin Graf, Kolleginnen und Kollegen betreffend zurück zum normalen Universitätsbetrieb – Schluss mit Covid-Zwangsmaßnahmen
*****
Antrag gemäß § 69 Abs. 3 GOG-NR
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Es liegt mir der Antrag gemäß § 69 Abs. 3 der Geschäftsordnung vor, die Regierungsvorlage betreffend das Bundesfinanzgesetz 2022 samt Anlagen in 1034 der Beilagen in erste Lesung zu nehmen.
Ich darf die Damen und Herren, die diesem Antrag zustimmen, um ein entsprechendes Zeichen bitten. – Das ist einstimmig der Fall.
*****
Ich darf bekannt geben, dass die Sitzung von ORF 2 bis 13 Uhr, von ORF III bis 19.15 Uhr und anschließend wie üblich kommentiert in der TVthek übertragen wird.
Ich darf darauf hinweisen, dass während der heutigen Nationalratssitzung zwei Kamerateams im Auftrag der Parlamentsdirektion unterwegs sind.
Behandlung der Tagesordnung
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Es ist vorgeschlagen, die Debatten über die Punkte 3 bis 5, 6 bis 11, 13 bis 16, 17 bis 23 sowie 24 bis 27 der Tagesordnung zusammenzufassen.
Gibt es dagegen einen Einwand? – Das ist nicht der Fall.
Redezeitbeschränkung
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Es wurde zwischen den Mitgliedern der Präsidialkonferenz Konsens über die Dauer der Debatten erzielt. Dementsprechend wurde eine Tagesblockzeit von 9,5 „Wiener Stunden“ vereinbart, die Redezeiten ergeben sich wie folgt: ÖVP 185, SPÖ 128, FPÖ 105, Grüne 95 sowie NEOS 76 Minuten.
Gemäß § 57 Abs. 7 der Geschäftsordnung beträgt die Redezeit für die gesamte Tagesordnung von jenen Abgeordneten, die keinem Klub angehören, 38 Minuten, je Debattenbeitrag wird sie auf 5 Minuten begrenzt.
Ich darf gleich abstimmen lassen.
Wer mit der Redezeitvereinbarung einverstanden ist, den bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen. – Die morgendliche Sportstunde ergibt in diesem Falle wieder Einstimmigkeit. Ich danke recht herzlich.
Wir gehen in die Tagesordnung ein.
Erklärung des Bundesministers für Finanzen zur Regierungsvorlage betreffend das Bundesfinanzgesetz für das Jahr 2022 samt Anlagen
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Wir gelangen zum 1. Punkt der Tagesordnung.
Ich darf dem Herrn Bundesminister das Wort erteilen. – Herr Bundesminister, bitte sehr.
Bundesminister für Finanzen Mag. Gernot Blümel, MBA: Sehr geehrter Herr Bundespräsident! Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen auf der Regierungsbank! Hohes Haus! Vor allem: Geschätzte Steuerzahlerinnen und Steuerzahler! Vor einem Jahr habe ich bei meiner Budgetrede gesagt, dass diese mit diesem Budget die budgetäre Antwort auf die Krise ist. Heute wissen wir: Es war die richtige Antwort. Es war eine Antwort, die Österreich gut durch diese Krise geführt hat.
Das Budget, das wir Ihnen heute vorlegen, ist eine Ansage Richtung Zukunft, mit diesem Budget wollen wir Aufschwung, Stabilität und Nachhaltigkeit für Österreich ermöglichen. Wir sind alle gemeinsam durch die Pandemie gegangen und jetzt gehen wir hoffentlich mit neuer Kraft und Optimismus in eine erfolgreiche Zeit für unser Land. Je schneller wir die Pandemie hinter uns lassen, umso schneller kommen wir wieder zu gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und auch budgetärer Stabilität. Es liegt dabei an jedem und jeder Einzelnen von uns, wie schnell sich die Wirtschaft erholt und dadurch auch Arbeitsplätze gerettet werden können.
Mit der Impfung hat die Menschheit nicht einmal ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie ein wirksames Gegenmittel erhalten, und das ist ein Erfolg einer globalisierten und vernetzten Welt, und es ist vor allem ein Erfolg der Wissenschaft, für den wir alle wirklich sehr dankbar sein können. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
Diese Errungenschaft hilft aber natürlich nicht, wenn nicht alle Menschen, die das könnten, dieses Angebot auch in Anspruch nehmen. Wir wissen, dass die Impfung wirkt, wir sehen das auch bei der Auslastung der Intensivstationen, in denen kaum Menschen behandelt werden müssen, die geimpft sind. Gerade vor dem Winter appelliere ich daher an alle, die sich impfen lassen können, diese Option auch wahrzunehmen, denn dieser Stich kann nicht nur Ihr eigenes Leben oder das anderer retten, sondern auch Arbeitsplätze und Unternehmen in Österreich. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir alle sind im letzten Jahr, in dieser Pandemie, Zeitzeugen geworden. Hinter uns liegt die schwerste Gesundheits- und Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg, und das spiegelt sich neben vielen anderen Faktoren natürlich auch im Budgeterstellungsprozess wider. Üblicherweise legt ja die Regierung jedes Jahr ein Budget vor. Durch die Pandemie waren wir aber gezwungen, immer wieder Anpassungen und Adaptierungen nach oben hin vorzunehmen.
Es waren in diesen außergewöhnlichen Zeiten außergewöhnliche Maßnahmen erforderlich. Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn hat im April 2020 im Deutschen Bundestag gesagt – Zitat –, dass wir einander in ein paar Monaten wahrscheinlich viel verzeihen werden müssen. Ich halte das für eine ganz wichtige Aussage, die natürlich auch heute noch gilt, denn gemeinsam haben die verschiedenen Verantwortungsträger in der Politik in den vergangenen zwei Jahren Entscheidungen treffen müssen, die große
Auswirkungen auf die Menschen, auf die Arbeitsplätze und Unternehmen in diesem Land gehabt haben. Viele von diesen Entscheidungen sind hier im Parlament gemeinsam von Regierungsfraktionen und Oppositionsparteien getroffen worden, und auch dafür möchte ich mich heute noch einmal bedanken. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
Haben wir in diesen schwierigen Zeiten nur richtige Entscheidungen getroffen? – Wahrscheinlich nicht, das muss man auch offen zugeben.
Was wir heute aber mit Sicherheit wissen, ist, dass jene, die im Nachhinein schon immer alles besser gewusst haben, zu 100 Prozent falschgelegen sind. Sie agieren oft wie jene, die die Feuerwehr für den Wasserschaden kritisieren, nachdem der Brand gelöscht worden ist. Es gab nämlich keine Blaupause für Corona, die man hätte heranziehen können, und ja, auch für uns in der Bundesregierung und für alle Verantwortlichen in dieser Zeit – für uns alle – brachte diese Pandemie Lerneffekte.
Wenn man sich aktuell einzelne Stellungnahmen anhört, dann erkennt man, dass das vielleicht nicht für alle immer selbstverständlich ist, denn nicht nur manche politische Parteien, sondern auch all jene, die noch immer das Virus verharmlosen und die Impfung schlechtreden, sollten sich vielleicht an die Berichte aus Italien erinnern, an die Bilder, die wir damals gesehen haben, die Entscheidungen über Leben und Tod, die Ärzte dort treffen mussten. So tragisch jede und jeder einzelne Covid-Tote auch hier in Österreich war, das Gesundheitssystem war in Österreich nie auf diese Weise überfordert – und einen Kollaps unseres Gesundheitssystems zu verhindern, das war, ist und bleibt in jeder Pandemie die oberste Prämisse, meine sehr geehrten Damen und Herren. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
Um das zu gewährleisten waren harte Einschnitte und Entscheidungen notwendig, und wir als Bundesregierung haben diese Entscheidungen getroffen, wir haben uns nicht vor der Verantwortung gedrückt. Ich glaube, genau das ist es auch, was sich die Bürgerinnen und Bürger jedes Landes in einer Jahrhundertkrise zu Recht von der Politik erwarten können.
Noch nie gab es in der Geschichte der Zweiten Republik ein so dichtes Netz aus Bundes‑, Landes- und Gemeindehilfen wie in dieser schwierigen Zeit. In der Vergangenheit gab es immer wieder Kritik am Staat, am Föderalismus, an der Verwaltung, am Förderwesen. Der von manchen viel gescholtene Föderalismus hat Österreich aber unter anderem wesentlich besser durch diese Krise gebracht, als das in anderen Ländern der Fall gewesen ist. Ohne die Initiativen von Ländern und Gemeinden, ohne das Engagement der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister wäre es auch nicht möglich gewesen, so rasch und effektiv zu helfen und den Aufbau und Betrieb von Test- und Impfstraßen umzusetzen. Ohne diese föderale Struktur hätten wir niemals in so kurzer Zeit so viel geschafft. Ich hoffe, dass sich die Pauschalkritiker am Föderalismus daran erinnern werden, was dieser in dieser so schwierigen Zeit geleistet hat, meine sehr geehrten Damen und Herren. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal explizit bei allen bedanken, die mitgeholfen haben, bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Ressorts, im Parlament, in den verschiedenen Verwaltungseinheiten: Danke für Ihren Einsatz für Österreich in dieser schwierigen Zeit, Sie haben den Menschen in dieser Zeit mehr geholfen, als das viele für möglich gehalten hätten. – Nochmals vielen Dank! (Beifall bei ÖVP und Grünen sowie bei Abgeordneten der NEOS.)
Insgesamt hat allein die Bundesregierung mehr als 200 Hilfsmaßnahmen ins Leben gerufen, und seit dem Marshallplan hat es in Österreich kein größeres Hilfspaket gegeben. Bis dato hat der Bund über 40 Milliarden Euro ausbezahlt oder rechtsverbindlich zugesagt. Dadurch konnten im Jahr 2020 bis zu 350 000 Arbeitsplätze gerettet werden. Am Höhepunkt der Krise wurden allein durch die Kurzarbeit rund 1,2 Millionen Arbeitsplätze gesichert. Die vielen Unternehmen, die von den anderen Maßnahmen profitiert
haben, erwähne ich in dieser Hinsicht auch noch explizit. Knapp 790 Millionen Euro haben die Gemeinden für kommunale Investitionspakete abgerufen. Dieses Paket war zweifellos einmalig in der Geschichte der Zweiten Republik. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
Diese Unterstützungen des Staates sind auch die Basis für den wirtschaftlichen Aufschwung, den wir derzeit erleben. Das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo prognostiziert für heuer ein Wachstum von 4,4 Prozent – zur Erinnerung: im März waren es noch 1,5 Prozent –, und das ist ein weiterer Beleg dafür, dass die Maßnahmen in die richtige Richtung gegangen sind. Auch für das kommende Jahr gibt es mit 4,8 Prozent sehr gute Wachstumsaussichten.
Dieses Hilfspaket in historischer Dimension hat auch eine neue Dimension für das Budget mit sich gebracht. Die Einnahmen des Gesamtstaates sind 2020 um 5,4 Prozent gesunken, 2021 rechnen wir mit einem starken Aufholeffekt und damit einem Anstieg von 6,9 Prozent. Im Gegenzug sind die Ausgaben vergangenes Jahr um 12,1 Prozent gewachsen, heuer werden sie noch um weitere 2,5 Prozent steigen.
Nach dem Rekorddefizit des Bundes von 22,5 Milliarden Euro im vergangenen Jahr rechnen wir heuer, abhängig vom Pandemieverlauf, mit einem ähnlich hohen Defizit, und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Schuldenquote des Staates. Das geltende Budget vom Frühjahr ging aufgrund der Covid-Krise noch von einem Anstieg der Schuldenquote auf 89,6 Prozent aus. Aufgrund dieser Rekordverschuldung sind in manchen Interviews, Kommentaren und Zeitungsmeldungen auch immer wieder Vergleiche zu Bruno Kreisky und seiner Politik – die auch sehr viel Geld gekostet hat – gezogen worden. (Ruf bei der SPÖ: Von wem?)
Es gab aber einen wesentlichen faktischen Unterschied, was die Budget- und Schuldenpolitik betrifft, denn zu dem Zeitpunkt, als der berühmt gewordene Spruch gefallen ist, dass ihm ein paar Milliarden mehr Schulden weniger schlaflose Nächte bereiten als ein paar Hunderttausend Arbeitslose, betrug das Wirtschaftswachstum in Österreich plus 5,4 Prozent, und zwischen 1976 und 1980 gab es ein durchschnittliches Wachstum von mehr als 3 Prozent pro Jahr.
Zum Vergleich: 2020 ist die österreichische Wirtschaft um minus 6,7 Prozent eingebrochen. Daher sage ich, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Schulden zu machen, um zu helfen, ist legitim, in Wachstumsphasen permanent Schulden zu machen ist Bequemlichkeit zulasten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, und das ist sicher nicht unser Weg, meine sehr geehrten Damen und Herren. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
Anders als vielleicht Regierungen in anderen Ländern werden wir daher nicht so tun, als ob wir keine budgetäre Verantwortung für die nächste Generation hätten, und daher unsere Lehren aus der Krise ziehen. Eine dieser Lehren ist, dass eine nachhaltige Budgetpolitik und der Weg des konsequenten Schuldenabbaus die beste Vorsorge für künftige Krisen sind.
Die konsequent sinkende Schuldenquote unter Bundeskanzler Kurz war kein Selbstzweck, sie ist notwendig, um Spielräume für die Herausforderungen der Zukunft zu schaffen. Unsere nachhaltige Budgetpolitik der vergangenen Jahre hat nicht nur die erforderlichen Hilfspakete ermöglicht, sie ist auch ein wesentlicher Grund dafür, warum sich Österreich immer noch zu sehr, sehr günstigen Konditionen auf den Finanzmärkten finanziert. Selbst im Krisenjahr 2020 lag die effektive Verzinsung unserer neu aufgelegten zehnjährigen Staatsanleihen bei durchschnittlich minus 0,177 Prozent. Aktuell zahlen wir für die Schulden des Bundes voraussichtlich 3,6 Milliarden Euro, vor zehn Jahren waren es noch 7,1 Milliarden Euro.
Was aber passiert, wenn die Zinsen irgendwann wieder steigen, etwa weil die Zentralbank sich genötigt sieht, die Zinsen zu erhöhen, um die Gefahr einer höheren Inflation zu bekämpfen? Ein Zinsanstieg um 0,5 Prozent würde die Kosten für unsere Schulden bereits im nächsten Jahr um 120 Millionen Euro erhöhen, und wenn die Folgen eines Zinsanstieges schon für Österreich so deutlich spürbar sind, was ist dann mit Staaten – Italien, Frankreich oder Spanien, um einige zu nennen –, die eine wesentlich höhere Staatsverschuldung als Österreich haben?
Eine mittelfristige Senkung der Schuldenquote ist wichtig, nicht, weil es ums Prinzip geht, auch nicht, damit sich einige sogenannte frugale Staaten in Europa durchsetzen, sondern aus Sorge um die Bürgerinnen und Bürger und den Wohlstand in den Ländern und als Vorsorge für die nächste Krise, meine sehr geehrten Damen und Herren. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
Daher werden wir in Österreich nach der Krise wieder zu einer nachhaltigen Budgetpolitik zurückkehren. Das starke Wachstum hilft uns dabei, und wir müssen alles tun, um diesen Aufschwung auch nachhaltig zu gestalten. Wir gehen davon aus, dass bereits Ende des Jahres die Schuldenquote bei rund 83 Prozent liegen wird, von 2022 bis 2025 peilen wir eine sukzessive Reduktion der Schuldenquote Richtung knapp über 70 Prozent des BIP an.
Aus heutiger Sicht ist mit Ende des Finanzrahmens 2025 sogar ein strukturelles Nulldefizit möglich, meine sehr geehrten Damen und Herren! (Beifall bei der ÖVP.)
Ich möchte hier nicht falsch verstanden werden, denn Schuldenabbau heißt nicht gleich Sparpaket. Es heißt, gezielte Schwerpunkte zu setzen, statt das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler mit der Gießkanne auszugeben – und die ökosoziale Steuerreform ist so ein Schwerpunkt.
Wir haben uns in der Bundesregierung gemeinsam dazu bekannt – gerade vor dem Hintergrund der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg –, die größte Transformation des Steuersystems in dieser Zweiten Republik einzuleiten. Wir verfolgen damit vier große Ziele: erstens, arbeitende Menschen zu entlasten; zweitens, Anreize für umweltfreundliches Verhalten zu setzen; drittens, den Standort Österreich nachhaltig zu stärken; und viertens, die Schuldenquote Österreichs nach der Krise Schritt für Schritt abzubauen. Das war das Versprechen von Sebastian Kurz, und das werden wir auch umsetzen. (Beifall bei der ÖVP.)
Zum ersten Punkt, Entlastung der arbeitenden Menschen: Unter Berücksichtigung der bereits 2020 gesenkten ersten Einkommensteuerstufe entlasten wir im Vollausbau der Steuerreform die Bürgerinnen und Bürger jährlich im Ausmaß von mehr als 6 Milliarden Euro. Damit entfallen zwei Drittel der jährlichen Entlastung auf arbeitende Menschen und solche, die ihr Leben lang gearbeitet haben und nun in Pension sind. Das ist das größte Entlastungspaket in der Geschichte der Zweiten Republik, denn noch nie gab es in einer Steuerreform am Ende so viel mehr zum Leben für die Menschen in unserem Land.
Die Maßnahmen im Detail: Die Senkung der zweiten Einkommensteuerstufe von 35 auf 30 Prozent ab Juli 2022 bringt Steuerpflichtigen bis zu 650 Euro Entlastung pro Jahr. Die Senkung der dritten Einkommensteuerstufe von 42 auf 40 Prozent ab Juli 2023 bringt bis zu 580 Euro Entlastung im Jahr. Eine Reduktion der Krankenversicherungsbeiträge für geringe und mittlere Einkommen soll ab Juli 2022 mit 1,7 Prozentpunkten beginnen. Davon profitieren insbesondere einkommensschwache Personen. Hinzu kommt die Erhöhung des Familienbonus von 1 500 auf 2 000 Euro: Das bringt pro Kind und Jahr bis zu 500 Euro mehr am Konto, und auch die Erhöhung des Kindermehrbetrags spiegelt sich mit 450 Euro wider. Hinzukommt ein Mitarbeitererfolgsbeteiligungsmodell, das bis zu 3 000 Euro steuerfrei für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bringen kann. Damit wird den Österreicherinnen und Österreichern mehr zum Leben gelassen, meine sehr geehrten Damen und Herren. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
Zum zweiten Punkt: Umweltfreundliches Verhalten wird sich in Zukunft noch mehr auszahlen. Daher werden wir im Jahr 2022 erstmals eine CO2-Bepreisung einführen. Im ersten Jahr wird die Tonne CO2 rund 30 Euro kosten, das wird bis 2025 auf 55 Euro ansteigen, und ab 2026 soll das österreichische System in einen Zertifikatehandel übergeführt werden.
Das ist ein gewichtiger Eingriff in das Leben
der Österreicherinnen und Österreicher. Wir werden also die
ökologische Wende in diesem Land nur mit den
Bürgerinnen und Bürgern schaffen, nicht über ihre
Köpfe hinweg, nur mit Verboten, Belastungen und Einschränkungen.
Es braucht Anreize für jene, die umsteigen können, und nicht Strafen
für jene, die keine Alternative haben. Wir müssen Rücksicht
nehmen auf die tatsächlichen Lebensumstände der Menschen, denn klar
ist, wer das Privileg hat, direkt vor einer
U-Bahn-Station zu wohnen, tut sich mit Klimaschutz natürlich leichter als
Pendler am Land oder jene, die auf das Auto angewiesen sind. Daher werden wir natürlich
jenen helfen, die das Auto brauchen, und deswegen gibt es einen Klimabonus mit
einer regionalen Staffelung. Je schlechter unter anderem die Anbindung an den
öffentlichen Verkehr ist, desto mehr Geld wird es in Stufen von 100 bis
200 Euro geben. Damit, meine sehr geehrten Damen und Herren, schaffen wir positive
Anreize für umweltfreundliches Verhalten in der Zukunft. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
Das dritte wesentliche Ziel dieser ökosozialen Steuerreform ist es, den Standort zu stärken. Wir wollen den aktuellen Aufschwung nachhaltig gestalten, um Arbeitsplätze und Wohlstand in Österreich zu sichern. Daher setzen wir bewusst auch auf Maßnahmen, um die Wirtschaft anzukurbeln und uns auch im europäischen Wettbewerb abzuheben. In anderen Staaten wird viel über den Widerspruch zwischen Ökologie und Ökonomie diskutiert. Wir vereinen beides und setzen Anreize für Investitionen und Arbeitsplätze in Österreich.
Unsere Maßnahmen im Detail dazu: Die Unternehmen werden mittels einer Senkung der Körperschaftsteuer von 25 auf 23 Prozent nachhaltig entlastet. Es wird einen Investitionsfreibetrag inklusive Ökologisierungskomponente von bis zu 350 Millionen Euro geben. Steuerliche Begünstigung für die Eigenstromerzeugung bis zu 60 Millionen Euro wird es ebenso wie die Anhebung des Gewinnfreibetrags von 13 auf 15 Prozent geben, um eine auch rechtsformneutrale Entlastung bei Unternehmen zu ermöglichen. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter können bis zu 1 000 Euro abgeschrieben werden. Wir werden auch Maßnahmen setzen, um Unternehmen, die besonders im Wettbewerb stehen, mit der CO2-Bepreisung nicht zu hart zu treffen. Deswegen wird es eine Carbonleakageregelung und auch eine Härtefallregelung mit einer entsprechenden Rückerstattung geben. Hinzu kommt die Rückerstattung für die Mehrbelastung der Landwirtschaft, damit sie auch weiterhin nachhaltig produzieren kann, denn wir alle sind stolz auf die Produkte unserer heimischen Landwirtschaft und wollen sie auch künftig genießen können, meine sehr geehrten Damen und Herren. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
Laut einer ersten Analyse von Eco Austria erhöhen wir mit der Steuerreform im Endausbau das Bruttoinlandsprodukt nachhaltig um 1 Prozent beziehungsweise 4 Milliarden Euro pro Jahr. Die Summe der Beschäftigten steigt um mehr als 30 000 Personen. Und: Trotz all dieser Maßnahmen werden wir die Schuldenquote am Ende des Finanzrahmens Richtung 70 Prozent senken. Damit werden wir auch für kommende Herausforderungen, was auch immer sie sein mögen, gut gerüstet sein, meine sehr geehrten Damen und Herren. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
Wir starten mit diesem Budget und mit den ersten Schritten der ökosozialen Steuerreform den großen Umbau unseres Steuersystems. Von unseren Maßnahmen profitieren Umwelt, Standort und Gesellschaft, und vor allem bleibt den fleißigen Österreicherinnen und Österreichern mehr von ihrem hart erarbeiteten Geld. Ich bin überzeugt davon, dass dieser Weg für viele Länder in Europa beispielgebend sein wird. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
Die ökosoziale Steuerreform ist natürlich das große Projekt, und das spiegelt sich auch in diesem Budget wider. Gleichzeitig geben wir den Ressorts aber Spielräume, um gezielt Schwerpunkte zu setzen. Ich darf das an einigen Beispielen aus den Ressorts kurz erläutern.
Zu UG 14, dem Bundesheer: Dieses wird im nächsten Bundesfinanzrahmen um 206 Millionen Euro mehr Geld erhalten. Damit wird auch Vorsorge für die weiteren Beschaffungen für das Covid-Lager und Massentests mit einem Betrag von 20 Millionen Euro für 2022 getroffen. Nicht nur Corona, sondern auch die Hochwasser im Sommer sowie der Terroranschlag letztes Jahr haben uns gezeigt, wie sehr wir auf die Hilfe des Bundesheeres angewiesen sind. Deswegen werden das Terrorpaket und das Katastrophenpaket im Jahr 2025 mit je 25 Millionen Euro fortgesetzt. Mit zusätzlichen 25 Millionen Euro jährlich kann Österreich nachhaltig bis 2025 einen angemessenen Beitrag zu den verstärkten Aktivitäten der Europäischen Union zur Konfliktverhütung, zur Friedenskonsolidierung und zur Stärkung der internationalen Sicherheit im Rahmen der europäischen Friedensfazilität leisten.
Zu UG 12, dem Außenministerium: Krisenlinderung und -bekämpfung sind nicht nur in Österreich wichtig. Deswegen haben wir das Budget des Außenressorts im nächsten Finanzrahmen um fast 20 Millionen Euro gesteigert. Damit erhöhen wir unter anderem unseren Beitrag zur Flüchtlingshilfe. Darüber hinaus setzen wir Mittel frei, um die Bearbeitung von Staatsbürgerschaftsanträgen von Holocaustüberlebenden und Nachkommen von NS-Opfern zu beschleunigen.
Zu UG 10, Bundeskanzleramt: Um ein aktives jüdisches Gemeindeleben in Österreich sicherzustellen, werden wir im Rahmen des Budgets für das Bundeskanzleramt in den nächsten Jahren 16 Millionen Euro ausbezahlen. Insgesamt steigern wir die Mittel des BKA für 2022 gegenüber dem letzten Finanzrahmen um 18,5 Prozent. Davon entfallen 55,4 Millionen Euro allein auf die Aufstockung der Deutschkursplätze im Österreichischen Integrationsfonds. Um Gewalttaten gegen Frauen vorzubeugen, werden wir im nächsten Bundesfinanzrahmen zusätzlich 22 Millionen Euro ausgeben.
Zu UG 11, Sicherheit und Inneres: Für den Schutz von Frauen vor Gewalt – insbesondere für den Schutz vor Gewalt innerhalb der Familie – wird auch im Sicherheitsressort um 10 Millionen Euro aufgestockt. Insgesamt erhöhen wir das Budget des Innenressorts über den nächsten Bundesfinanzrahmen um 236,4 Millionen Euro. Darunter wird unter anderem das Budget für das Antiterrorpaket um 120 Millionen Euro gesteigert, wovon die Hälfte für das nächste Jahr vorgesehen ist. Die Ausstattung und Ausrüstung der Polizei wird damit modernisiert und an neue Bedrohungsszenarien angepasst.
Zu UG 13, Justiz: Wir werden im Bereich der Justiz Mittel zur Umsetzung des Terrorbekämpfungspakets aufstocken. Mit einer Budgetsteigerung von insgesamt 172,1 Millionen Euro im nächsten Bundesfinanzrahmen wird das Ressort unter anderem von 2022 bis 2025 zusätzliche Mittel für die Terrorbekämpfung vorsehen. Darüber hinaus werden auch in dieser Untergliederung für einen besseren Gewaltschutz für Frauen bis 2025 mindestens 20 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.
Zu UG 25, Familie und Jugend: Passend zu dem vorhin genannten Schwerpunkt wird auch in der UG Familie und Jugend ein Teil des Gewaltschutzpakets umgesetzt. Das Budget für Familienberatungsstellen und Kinderschutzzentren wird ab 2022 um 23 Prozent erhöht.
UG 24 und UG 21, Gesundheit, Soziales, Pflege und Konsumentenschutz: Im Bereich der Pflege, der momentan sehr unter Druck steht, werden wir 2022 3,7 Milliarden Euro ausgeben. Zudem sind für die Pflegeausbildung jeweils 50 Millionen Euro in den Jahren 2022 bis 2024 vorgesehen.
Das Budget des Gesundheitsressorts, UG 24, wird im nächsten Finanzrahmen um 6 Milliarden Euro erhöht. Für das nächste Jahr sind Auszahlungen in der Höhe von 3,2 Milliarden Euro vorgesehen. Neben der rückläufigen Vorsorge für die Pandemiebekämpfung und -prävention und der Finanzierung von Covid-19-Impfstoffen ist die Rückerstattung der Senkung der Krankenversicherungsbeiträge ab 2022 bereits budgetiert.
Zu UG 30, Bildung: Das Bildungsbudget wird im Jahr 2022 die 10-Milliarden-Euro-Marke übersteigen. Damit wird unter anderem die Offensive betreffend Digitalisierung des Unterrichts fortgeführt und auch die psychologische Unterstützung an Schulen ausgebaut. Bis zum Schuljahr 2023/24 wird jeder Schüler und jede Schülerin der Unterstufe mit einem elektronischen Gerät ausgestattet werden. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
Zu UG 31, Wissenschaft und Forschung: Diese bekommt im nächsten Bundesfinanzrahmen 196,6 Millionen Euro mehr. Somit werden wir den Fachhochschulausbau weiter fortsetzen und ab dem Wintersemester 2022/23 jährlich zusätzlich 347 Anfängerplätze bereitstellen. Bei der Forschung wird mit zusätzlichen 17 Millionen Euro schwerpunktmäßig in klimarelevante Zukunftsbereiche, wie zum Beispiel Wasserstoff, mehr Geld investiert werden können. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
UG 33 und UG 34, angewandte Forschung: Diese klima- und konjunkturrelevanten Forschungs- und Investitionsprogramme werden ebenso entsprechend unterstützt. Das Budget in der UG 33 wird über den nächsten Bundesfinanzrahmen um 72,5 Millionen Euro gesteigert, jenes der UG 34 um 291,5 Millionen Euro.
Damit Österreich an Ipcei, an Projekten zu Wasserstoff sowie Mikroelektronik, teilnehmen kann, stehen bis 2026 insgesamt 250 Millionen Euro zur Verfügung. So können sich österreichische Unternehmen an europäischen Projekten und Kooperationen in wichtigen Zukunftsfeldern beteiligen. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
Zu UG 43, Klima, Umwelt und Energie: Im Zuge der ökosozialen Steuerreform wurde das Budget für Klima- und Umweltschutz bis 2025 um 5,9 Milliarden Euro gesteigert. Den größten Beitrag dazu liefert der regionale Klimabonus, mit dem die Einnahmen durch die CO2-Bepreisung direkt an die Menschen rückverteilt werden. Darüber hinaus werden die Förderungen für sauberes Heizen sowie Heizkesseltausch und für die thermische Sanierung um insgesamt 320 Millionen Euro erhöht. Für die Förderung des Fernwärme- und Fernkälteausbaus werden bis 2025 24 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt. Für die Schaffung von energieautarken Bauernhöfen sind im Zeitraum 2022 bis 2025 100 Millionen Euro vorgesehen.
Zu UG 41, Mobilität: Das Budget der UG 41 wird über die gesamte Finanzrahmenperiode um 668,4 Millionen Euro erhöht. Darunter werden vor allem für die regionalen Klimatickets zusätzlich 430 Millionen Euro bis 2025 zur Verfügung gestellt. Förderprogramme für emissionsfreie Busse und Infrastruktur werden mit zusätzlich 204 Millionen Euro gestartet. Die Finanzierung des ÖBB-Rahmenplans kommt noch hinzu, auch das ist ein wesentlicher Beitrag für die Zukunft. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
Zu UG 42, Landwirtschaft, Regionen und Tourismus: Im Bereich der Land- und Forstwirtschaft werden wir zusätzlich 16 Millionen Euro für den Schutz vor Naturgefahren zur Verfügung stellen. Insgesamt steigern wir das Budget der Untergliederung Landwirtschaft, Regionen und Tourismus im nächsten Rahmen um 554,9 Millionen Euro. Darunter werden unter anderem zur Bewältigung der komplexen Herausforderungen im Forstsektor, wie zum Beispiel der Klimaadaptierung oder dem Borkenkäferbefall, insgesamt 350 Millionen Euro bis 2024 zur Verfügung gestellt. Für den Breitbandausbau werden bis 2025 zusätzlich 624 Millionen Euro zur Erreichung der Ausbauziele veranschlagt. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
Zu UG 40, Wirtschaft: Das Budget des Wirtschaftsressorts wird bis 2025 um 924,5 Millionen Euro gesteigert. Darunter werden für zusätzliche Digitalisierungsmaßnahmen in den Jahren 2022 bis 2025 weitere 42,3 Millionen Euro bereitgestellt. Außerdem stehen für IT-Projekte 2022 und 2023 weitere 10 Millionen Euro jährlich zur Verfügung.
Schließlich zu UG 32 und UG 17, Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport: Zum Abschluss freut es mich sehr zu erwähnen, dass wir die Budgetmittel für den Bereich Kunst und Kultur über den nächsten Bundesfinanzrahmen um 90,1 Millionen Euro steigern. Damit sind die Mittel für die Generalsanierung der Festspielhäuser Salzburg und Bregenz sichergestellt und auch zusätzliche Mittel für die Kinderoper der Wiener Staatsoper garantiert. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
Auch die Sportförderung wird in den Jahren 2023 bis 2025 um insgesamt 51 Millionen Euro aufgestockt. Darüber hinaus sind für den NPO-Fonds zusätzlich 250 Millionen Euro für das Jahr 2022 vorgesehen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Dieses Budget, das wir Ihnen heute vorlegen, ist eine Ansage Richtung Zukunft für Aufschwung, Stabilität und Nachhaltigkeit für Österreich. – Vielen Dank. (Anhaltender Beifall bei ÖVP und Grünen.)
10.39
Bericht des Budgetausschusses über den Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2020 (III-321/1062 d.B.)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Wir kommen nun zum 2. Tagesordnungspunkt.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Krainer. – Herr Abgeordneter, Sie haben das Wort. Bitte sehr.
Abgeordneter Kai Jan Krainer (SPÖ): Nach dieser PR-Vorstellung vielleicht ein paar nackte Zahlen und Informationen, wenn Sie, Herr Präsident, mir erlauben, einen Satz zum vorgelegten Budget zu sagen: Ja, das Budget ist eine in Zahlen gegossene Politik. Schlechte Nachricht für alle Arbeitnehmerinnen, für alle Arbeitnehmer, für kleine Selbstständige, für Pensionistinnen und für Pensionisten (Ruf bei der ÖVP: ... nicht genau gelesen!): Die Steuersenkung zahlen sie sich durch die sogenannte kalte Progression selbst. (Abg. Hanger: Das stimmt ja gar nicht!) Sie zahlen sich aber nicht nur diese Steuersenkung selbst, sondern sie bezahlen auch noch ein Geschenk an Milliardäre und Konzerne, weil diese in Zukunft weniger Steuern zahlen und sie diese Steuersenkung auch bezahlen.
Und auch noch eine schlechte Nachricht für das Klima: Der Beitrag dieses Budgets zur Bekämpfung der Klimakrise besteht maximal in homöopathischen Dosen. Ob das überhaupt messbar ist, wird man im Laufe des Budgetprozesses sehen.
Zum vorgelegten Bundesrechnungsabschluss muss man erstens einmal an den Beitrag der drei Oppositionsparteien erinnern, die das Budget damals gerettet haben. Das, was Finanzminister Blümel damals vorgelegt hat, war ja verfassungswidrig. Durch die Arbeit der NEOS, der Freiheitlichen und der Sozialdemokraten konnten wir den Finanzminister dann am Ende des Tages davon überzeugen, dass die Verfassung auch für ihn gilt, und er hat ein Budget vorgelegt, das auch verfassungskonform war. Man darf nicht vergessen, was da unser Beitrag war – und da rede ich noch gar nicht von den fehlenden sechs Nullen, sondern nur davon, dass es überhaupt einmal verfassungskonform war.
Vielleicht noch zwei kurze Sätze zum Bundesrechnungsabschluss: Das eine ist, es ist einfach vollkommen intransparent. Das sagt nicht nur die Opposition, sondern das sagt auch der Rechnungshof. Der Rechnungshof sagt, dieses Budget ist eigentlich nicht mit dem anderer Jahre vergleichbar, weil man durch die Veränderungen der Budgetstruktur das letzte Jahr, das Jahr 2020, überhaupt nicht mit den Jahren davor vergleichen kann.
Das größte Problem ist, dass die Cofag, das heißt, die gesamten Krisenhilfen von über 15 Milliarden Euro, für das Parlament nicht kontrollierbar ist. Die Regierung hat absichtlich ein Instrument gewählt, durch das das Parlament und damit die Öffentlichkeit die Wirtschaftshilfen nicht kontrollieren können. Wir können gar nicht genau nachsehen, wer wie viel Geld bekommen hat, und wir reden da von Beträgen von 15 Milliarden Euro. Das ist mehr Geld, als wir im Jahr für Bildung, für Universitäten, für irgendetwas anderes ausgeben, und als Parlament können wir nicht nachsehen, was da wirklich passiert ist. Das ist ein Rechnungsabschluss der Intransparenz.
Das Nächste, das man auch feststellen kann, weil Zahlen Fakten sind, ist: Kurz, Blümel, und wie sie alle heißen, haben immer behauptet, sie senken die Steuern in Österreich vor allem für die, die arbeiten gehen. Die Steuern werden über die Steuer- und Abgabenquote gemessen, und was sehen wir, seitdem Kurz Kanzler ist, und es wurde bei Finanzminister Blümel nicht besser? – Die Steuer- und Abgabenquote ist höher, als sie unter Faymann/Mitterlehner war, und höher, als sie unter Kern/Mitterlehner war. Das heißt, auch wenn immer behauptet wird, dass die Steuern gesenkt werden, ist die Wahrheit eine andere. Die Steuer- und Abgabenquote war 2020 nach 2018 und 2019 das dritte Jahr in Folge höher, als das unter Faymann/Mitterlehner und unter Kern/Mitterlehner der Fall war – das ist die Wahrheit.
Das heißt, wenn die ÖVP Ihnen sagt, dass sie Steuern senkt, dann meint sie nur die Steuern für Konzerne und Milliardäre, aber nicht für Arbeitnehmer, nicht für kleine Selbstständige, nicht für kleine Firmen, nicht für Pensionistinnen und Pensionisten. Zahlen lügen nicht (Zwischenruf bei der ÖVP): Diese Gruppe hat unter Kurz und unter Blümel mehr Steuern bezahlt als davor. – Vielen Dank. (Beifall bei der SPÖ.)
10.44
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Obernosterer. – Bitte.
Abgeordneter Gabriel Obernosterer (ÖVP): Herr Präsident! Herr Bundeskanzler! Herr Vizekanzler! Herr Finanzminister! Meine Damen und Herren auf der Regierungsbank! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr verehrten Damen und Herren zu Hause vor den Fernsehschirmen! Wir haben gerade die Rede unseres Finanzministers zum Budget gehört und – wer aufgepasst hat – auch alle Details, die in diesem Budget abgebildet sind.
Jeder, der sich mit Budgets auseinandersetzt – das tue ich als Wirtschaftler regelmäßig –, muss sagen: Dieses Budget zeigt in die Zukunft, Herr Finanzminister, dieses Budget gibt diesem Staat – unserem Staat – Stabilität, und dieses Budget werden uns in dieser Stabilität und Zukunftsorientierung, so wie Sie auch gesagt haben (Zwischenruf des Abg. Leichtfried), viele andere Länder erst nachmachen müssen. Es wird nicht verwaltet, sondern es wird in die Zukunft gestaltet. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
Wir haben jetzt den Tagesordnungspunkt Rechnungsabschluss 2020. Wir werden uns morgen in der ersten Lesung mit vielen, vielen Redebeiträgen mit dem Budget in der Tiefe auseinandersetzen, aber trotzdem ein Satz dazu, weil ich nicht so stehen lassen möchte, was Kollege Krainer gesagt hat: Es werden nun in dieser Steuerreform die Milliardärinnen und Milliardäre und die Großindustrie entlastet. – So sage ich jetzt nur zwei Zahlen: 18 Milliarden Euro macht dieses Entlastungspaket aus, und 750 Millionen
Euro gehen in die KöSt hinein, was genau diese Zielgruppe betrifft, wie Sie, Herr Kollege Krainer, gerade gesagt haben.
Wir sind aber schon gewohnt, dass von diesem Rednerpult aus einfach Zahlen und Fakten verdreht werden. (Zwischenruf der Abg. Herr.) Die Österreicherinnen und Österreicher, die arbeitenden Menschen sind mit diesem ökosozialen Steuerpaket entlastet worden. Jeder Österreicher weiß selbst, wie viel ihm am Ende des Monats am Konto bleibt. – Das sind die Fakten und keine Märchen. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
Gehen wir zu unserem Tagesordnungspunkt Rechnungsabschluss 2020 zurück! Als jemand, der sonst auch immer mit Budget zu tun hat, muss ich sagen: Es ist nicht schön, wenn man ein Budget abschließt, in dem über 22 Milliarden Euro Minus drinnen sind. Wir müssen aber auch wissen, warum: Wir wissen, dass es die Coronakrise gab und diese Regierung gesagt hat, sie wird alles tun, dass diese Krise für den Arbeitnehmer und für den Arbeitgeber so überbrückt wird, dass wir ganz schnell wieder in den ganz normalen wirtschaftlichen Alltag hineinkommen – und die Fakten dazu zeigen es.
Immer wieder habe ich an diesem Rednerpult gesagt, wer bis zum Ausbruch der Coronakrise zahlungsfähig war, ist es auch heute noch, und diese Hilfen sind so aufgebaut worden, dass sie es auch heute noch sind. Wenn wir wissen, dass in Deutschland die Experten die Prognosen für den Wirtschaftsaufschwung eher nach unten drücken wollen und jene bei uns in Österreich eher nach oben, dann wissen wir auch, dass diese Regierung mit diesem Finanzminister in Summe das Richtige gemacht hat, wenn auch da und dort kleine Fehler passiert sind. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
Die Pakete für die Kurzarbeit, die Pakete für die Wirtschaft und für die Kultur: Das hat alles viel, viel Geld gekostet. Wie gesagt, die Fakten und Zahlen hat der Finanzminister – ich möchte das nicht wiederholen – selbst auf den Tisch gelegt.
Nun zur Kritik: Natürlich gibt es immer wieder Kritik zu einem Budget, gerade von der Opposition – das wäre ja sonst nicht normal, und das ist auch gut so – und auch des Rechnungshofes. Wir waren mit den Budgetsprechern der einzelnen Fraktionen bei der Präsidentin, und was war denn wirklich die Kritik? – Es hat zwei Kritikpunkte gegeben, die aber fundamental zu entkräften sind. Das betrifft einerseits die Ermächtigung, die der Finanzminister in dieser Coronakrise gehabt hat. Warum hat es diese Ermächtigung gebraucht? – Damit man die Hilfen schnell abwickeln kann. Wissen Sie, was der deutsche Finanzminister – SPDler – gesagt hat, weil wir das über die Cofag abgewickelt haben? – Da waren die Österreicher gescheiter als wir, und das ist auch wesentlich schneller gegangen! – Ich sage, wenn das der deutsche Partner sagt, dann wird es wohl seine Wertigkeit haben. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
Andererseits betrifft es die Kontrolle in der Cofag. Ihr wisst genau, dass die Kontrolle dort wirklich zu 100 Prozent gegeben ist. Es sitzen auch alle Sozialpartner drinnen. Warum ihr von der Oppositionspartei (Zwischenruf des Abg. Matznetter) euch nicht hineingesetzt habt, verstehe ich bis heute nicht. Wisst ihr überhaupt - - (Neuerlicher Zwischenruf des Abg. Matznetter.) – Hören Sie mir zu, ich höre Ihnen auch zu! Wissen Sie, wie viele Anträge in der Cofag abgearbeitet wurden? – Über eine Million Anträge wurden dort abgearbeitet! Und dann erklären Sie von der Opposition mir einmal, wie wir hier herinnen über eine Million Anträge abarbeiten könnten! Da hätten die Unternehmer und die Arbeitnehmer bis heute noch kein Geld bekommen. Das war richtig so, und das würden wir auch in Zukunft wieder machen. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen. – Zwischenruf des Abg. Matznetter.)
Morgen werden wir uns wie gesagt ausführlich mit dem ökosozialen Steuerpaket auseinandersetzen. Herr Finanzminister, ich gratuliere zu dieser Budgetrede, deren Inhalt
einfach dieses Budget aufgezeigt hat. Es ist verantwortungsvoll, und Österreich ist mit dieser ökosozialen Steuerreform in der Zukunft angekommen. – Danke schön. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
10.51
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Fuchs. – Bitte sehr, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter MMag. DDr. Hubert Fuchs (FPÖ): Herr Präsident! Geschätzte Mitglieder der Bundesregierung! Geschätzter Kollege Obernosterer, ich wollte eigentlich über die Cofag überhaupt nicht sprechen, aber wir als Oppositionsparteien haben dir schon x-mal erklärt, warum es keinen Sinn macht, in diese Blackbox zu gehen. Du und die ÖVP habt es nicht verstanden, und es hat keinen Sinn, weitere Argumente zu liefern, weil die Argumente immer dieselben bleiben. (Beifall bei der FPÖ.)
Die Bundesregierung hat durch ihre Coronapolitik ein großes Loch in den Staatshaushalt gerissen. Diese Bundesregierung hat durch die nicht evidenzbasierten Lockdownphasen die Wirtschaft massiv geschädigt. Daher ist es auch kein Wunder, dass sich das Budgetdefizit 2020 auf 22,5 Milliarden Euro beläuft. Österreich befand sich 2020 beim Maastrichtdefizit im obersten Drittel der schlechtesten 27 EU-Mitgliedstaaten. Die Zahlen und Fakten beweisen es: Österreich ist weder gut durch die Krise gekommen, noch ist Österreich besser als andere EU-Mitgliedstaaten durch die Krise gekommen. Gott sei Dank geht es der Wirtschaft jetzt wieder besser, aber nicht wegen dieser Bundesregierung, sondern trotz dieser Bundesregierung. (Beifall bei der FPÖ. – Zwischenruf des Abg. Hörl.)
Kommen wir zur sogenannten großen Steuerentlastung: Das Wifo hat bereits letzte Woche festgehalten, dass die von der Bundesregierung groß und überraschend angekündigte Steuerentlastung keine Auswirkungen auf die Konjunktur bis Ende 2022 haben wird – keine Auswirkungen auf die Konjunktur! Im Übrigen ist es nicht die größte Steuerentlastung in der Zweiten Republik, sondern die größte Mogelpackung in der Zweiten Republik. (Beifall bei der FPÖ. – Abg. Hörl: Na hallo!)
Diese vordergründige Steuerentlastung zahlen sich – Kollege Krainer hat es schon angesprochen – die Österreicher selbst. Es ist keine ökosoziale Steuerreform, es ist eine ökoasoziale Steuerreform. Die Masse der vordergründigen Steuerentlastung wird durch die kalte Progression der Vergangenheit, aber auch der Zukunft und durch die neue CO2-Strafsteuer, die ja nichts anderes als eine Mineralölsteuererhöhung ist, unter dem Deckmantel des Klimaschutzes gegenfinanziert.
Vordergründig bringt uns diese Steuerreform in der Vollausbauphase – in der Vollausbauphase!, und diese erreichen wir erst 2025 – eine Bruttoabgabenentlastung von 7,8 Milliarden Euro. Und das ist nur die halbe Wahrheit! Von dieser Bruttoabgabenentlastung sind noch die kalte Progression und alle Belastungsmaßnahmen abzuziehen, die in den kommenden Jahren auf uns zukommen werden. Angesichts der aktuellen Rekordinflation von 3,2 Prozent – übrigens der höchste Wert seit Dezember 2011 – frisst die kalte Progression die Masse der vordergründigen Steuerentlastung wieder weg. Dies hat auch das Wifo am 8.10.2021 in seiner Presseunterlage bestätigt, wonach – ich zitiere – „die aktuelle Steuersenkung nur eine Abgeltung von vergangener kalter Progression ist.“
Das heißt, den Leuten wird jetzt zizerlweise das zurückgegeben, was man ihnen in der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft wegnimmt. (Beifall bei der FPÖ.)
Der Altkanzler hat im „ZIB 2“-Interview am 3.10.2021 versprochen, dass die kalte Progression am Ende dieser Legislaturperiode abgeschafft werden wird. Vielleicht ist das bald (Heiterkeit des Abg. Kickl), mir fehlt aber der Glaube, dass der Altkanzler dieses Versprechen einhalten wird.
Daher darf ich folgenden Antrag einbringen:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten MMag. DDr. Hubert Fuchs, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Abschaffung der Kalten Progression“
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung und insbesondere der Bundesminister für Finanzen werden ersucht, eine Regierungsvorlage vorzulegen, die die ‚Kalte Progression‘ wirksam bekämpft bzw. abschafft sowie sicherstellt, dass Lohn- bzw. Pensionserhöhungen künftig zu einem tatsächlichen Steigen der Kaufkraft führen.“
*****
(Beifall bei der FPÖ.)
Wie schon gesagt, von der Bruttoabgabenentlastung muss man die zukünftigen Belastungen selbstverständlich abziehen. Wenn man Frau Bundesminister Gewessler bei der Präsentation der Steuerreform genau zugehört hat, dann weiß man ganz genau, welche Belastungen noch auf uns zukommen werden: neben der Mineralölsteuererhöhung, also der CO2-Strafsteuer, die Ökologisierung – ein schönes Wort für Abschaffung – des Pendlerpauschales, die Ökologisierung – also auch Abschaffung – des Dienstwagenprivilegs, die Abschaffung des Dieselprivilegs und weitere Maßnahmen gegen den Tanktourismus.
Wir dürfen aber den ersten Teil der ökoasozialen Steuerreform mit einer massiven Erhöhung der Normverbrauchsabgabe um 510 Millionen Euro – um 510 Millionen Euro! – bis 2025 nicht vergessen, das war ja der erste Vorgeschmack der zukünftigen Ökostrafsteuern. Diese NoVA-Erhöhung – wir haben es schon oft hier besprochen – betrifft insbesondere Kraftfahrzeuge, die von Kleingewerbetreibenden und von Familien angeschafft werden. Diese Kleingewerbetreibenden und Familien waren und sind die ersten Opfer dieser ökoasozialen Steuerreform, und alle Autofahrer, insbesondere die Pendler, aber auch die Kleinunternehmer werden die nächsten Opfer dieser ökoasozialen Steuerreform sein.
Es steht uns aber auch eine massive Erhöhung der Energiepreise, der Wiener Kommunalabgaben und der ORF-Gebühr bevor. Auch das muss man letzten Endes von der Bruttoabgabenentlastung abziehen, denn den Steuerpflichtigen interessiert nicht, an wen er die Steuern zahlt, sondern was letzten Endes im Geldbörserl übrig bleibt, und da schaut es in nächster Zeit ziemlich schlecht aus. (Beifall bei der FPÖ.)
Bedauerlicherweise werden sich viele Familien mit geringem Einkommen diesen Winter das Heizen nicht mehr leisten können, und weder die Bundesregierung noch die Stadt Wien helfen diesen Familien – ein Trauerspiel. (Beifall bei der FPÖ.)
Wenn das schon eine solch tolle Steuerreform ist, dann frage ich mich, warum die ersten Entlastungsschritte erst am 1.7.2022, also in neun Monaten, in Kraft treten und nicht bereits am 1.1.2022, denn damit würden Sie den Leuten helfen, aber nicht mit einer Steuerentlastung nach dem Winter.
Im Übrigen ist ein unterjähriges Inkrafttreten für die Lohnverrechner und Steuerberater, aber auch für die Finanzverwaltung, um die es ja auch geht, ein administrativer und bürokratischer Super-GAU. Jeder vernünftig denkende Legist lässt eine Steuerreform, insbesondere eine Tarifreform, zum 1.1. eines Jahres in Kraft treten, aber nie unterjährig. (Beifall bei der FPÖ. – Abg. Loacker: Das kann der Finanzminister ja nicht wissen!)
Ich wollte eigentlich nicht darauf zu sprechen kommen, aber Folgendes verwundert mich doch sehr: Der Vorwurf der Inseratenkorruption steht ja im Raum, auch das BMF soll involviert sein, und was sieht man (den Ausdruck eines Zeitungsartikels in die Höhe haltend), wenn man die Zeitungen durchblättert beziehungsweise auf Homepages surft? – Der Finanzminister bewirbt eine Steuerreform, die zizerlweise ab dem 1.7.2022 in Kraft tritt und deren Vollausbauphase 2025 erreicht werden soll. Wir alle wissen nicht, ob die angekündigten Schritte letzten Endes auch in Gesetzesform gegossen werden. Wer weiß, wie lange diese Bundesregierung ab jetzt noch hält? Der Finanzminister hält es für notwendig, etwas zu bewerben, was in neun Monaten in Kraft tritt und von dem das meiste vielleicht nie in Kraft treten wird. (Abg. Lausch: Unfassbar!) Ich frage mich – diese Frage wirft auch „Der Standard“ auf –, ob das eine Information oder eine Vermarktung ist. Eine Vermarktung ist natürlich unzulässig. Was ist, glauben Sie, aber das Erste, das man sieht, wenn man auf den im Inserat angegebenen Link klickt? – Es ist das Wichtigste dieser Steuerreform: ein Foto unseres Finanzministers. (Heiterkeit bei der FPÖ.) Probieren Sie das einmal aus! (Beifall bei der FPÖ. – Abg. Deimek: ... Gefängnis!)
Mich würden die Kosten dafür interessieren. Das wären eigentlich Kosten, die man einsparen könnte. Es wäre Geld, das man wirklich den Geringverdienern, den Kleinpensionisten geben könnte, damit diese sorgenfrei überwintern können. (Zwischenruf der Abg. Rössler.) Vielleicht noch ein Wort dazu, weil hier steht: „Die größte Entlastung in der 2. Republik!“, und „Der Standard“ fragt: „Information oder Vermarktung?“ – Ich würde eher sagen: Das ist weder Information noch Vermarktung, sondern das ist eine Desinformation. (Beifall bei der FPÖ.)
Es ist die größte Mogelpackung in der Zweiten Republik. Wir wissen, dass es laut den Präsentationsfolien des Finanzministers 2025 – in der Vollausbauphase der Steuerreform – 7,8 Milliarden Euro Entlastung pro Jahr geben soll. Herr Finanzminister, ich darf Sie daran erinnern, dass die damalige blau-schwarze Bundesregierung am 1. Mai 2019 einen Ministerratsvortrag beschlossen hat, unterschrieben vom Altkanzler und sonstigen Personen, und diese Steuerreform sah eine Entlastung von 8,3 Milliarden Euro jährlich vor; das war um eine halbe Milliarde mehr pro Jahr. Ich weiß, warum in den Präsentationsfolien des BMF jene Steuerreform, die Finanzminister Löger und ich 2019 ausverhandelt haben, fehlt: weil Sie genau wissen, dass Ihre nicht die größte Steuerreform, sondern die größte Mogelpackung aller Zeiten ist. – Vielen Dank. (Beifall bei der FPÖ. – Abg. Deimek: Unverschämt!)
11.03
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
des Abgeordneten MMag. DDr. Hubert Fuchs
und weiterer Abgeordneter
betreffend Abschaffung der Kalten Progression
eingebracht im Zuge der Debatte zu TOP 2, Bericht des Budgetausschusses über den Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2020 (III-321/1062 d.B.) in der 125. Sitzung des Nationalrates, am 13.10.2021
Die „Kalte Progression“ und deren finanziellen Folgen für die Steuerpflichtigen wird seit Jahren immer wieder diskutiert.
Die „Kalte Progression“ ist eine Steuermehrbelastung, die entsteht, wenn nur die Einkommenshöhe, nicht aber die Tarifstufen bzw. die Einkommensteuersätze an die Inflation angepasst werden. Insbesondere Arbeitnehmer und Pensionisten zahlen mit steigendem
Einkommen stetig mehr Lohnsteuer an das Finanzamt. Wenn die Löhne bzw. Pensionen um die jährliche Inflationsabgeltung steigen, rücken zudem immer mehr Steuerpflichtige in höhere Tarifstufen vor. Die Steuerpflichtigen müssen also auf ihr Einkommen höhere Steuern zahlen, obwohl diese real gar nicht gestiegen sind.
Die Abschaffung der „Kalten Progression“ wird von vielen Seiten verlangt. Entsprechende Forderungen gibt es beispielsweise von der FPÖ, den anderen Oppositionsparteien, vom Gewerkschaftsbund und der Industriellenvereinigung.
Mit der geplanten Steuerreform von ÖVP und Grünen soll es ab 1.7.2022 zwar zu einer Lohn- bzw. Einkommensteuersenkung kommen – geplant ist eine Senkung der zweiten und dritten Tarifstufe der Lohn- bzw. Einkommensteuer. Die Abschaffung der „Kalten Progression“ ist aber von der geplanten Steuerreform nicht umfasst.
Nach Berechnungen der Agenda Austria werden Niedrigverdiener aufgrund der „Kalten Progression“ von dieser Entlastung kaum bis gar nicht profitieren.
„Es kann erst dann von einer wirklichen Steuerreform gesprochen werden, wenn die kalte Progression abgeschafft wurde. Erst danach würde eine Tarifreform eine nachhaltige Entlastung für die Steuerzahler bedeuten“, so Agenda-Austria-Ökonom Denes Kucsera.
Im aktuellen Regierungsprogramm 2020-2024 von ÖVP und Grünen wurde unter „Steuerstrukturreform – das Steuersystem vereinfachen“ unter anderem folgender Punkt vereinbart:
„Kalte Progression: Prüfung einer adäquaten Anpassung der Grenzbeträge für die Progressionsstufen auf Basis der Inflation der Vorjahre unter Berücksichtigung der Verteilungseffekte“.
Angesichts der aktuellen Rekordinflation von 3,2% im August und September 2021 – der höchste Wert seit Dezember 2011 – frisst die „Kalte Progression“ die Masse der geplanten Steuerentlastung wieder weg. Dies hat auch das WIFO am 8.10.2021 bestätigt, wonach „[…] die aktuelle Steuersenkung nur eine Abgeltung von vergangener kalter Progression ist.“
Selbst Sebastian Kurz hat am 3.10.2021 – als er noch Bundeskanzler war – im ZIB2-Interview versprochen, dass die „Kalte Progression“ am Ende dieser Legislaturperiode abgeschafft werden wird.
Da die Abschaffung der „Kalten Progression“ nicht Teil der geplanten ÖVP-Grünen Steuerreform ist, stellen die unterfertigen Abgeordneten folgenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung und insbesondere der Bundesminister für Finanzen werden ersucht, eine Regierungsvorlage vorzulegen, die die „Kalte Progression“ wirksam bekämpft bzw. abschafft sowie sicherstellt, dass Lohn- bzw. Pensionserhöhungen künftig zu einem tatsächlichen Steigen der Kaufkraft führen.“
*****
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Der Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht, er ist ausreichend unterstützt und steht mit in Verhandlung.
Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Schwarz. – Bitte.
11.04
Abgeordneter Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA (Grüne): Herr Präsident! Geschätzter Herr Minister! Geschätzte Mitglieder der Bundesregierung! Hohes Haus! Sehr geehrte Damen und Herren! Der Bundesrechnungsabschluss, der hier zur Debatte steht – TOP 2 –, bringt, glaube ich, in erster Linie die volle Wucht der Coronakrise zum Ausdruck. Einerseits sind durch den Wirtschaftseinbruch die Steuereinnahmen zurückgegangen, und andererseits sind durch Wirtschaftshilfen, Kurzarbeit und die Unterstützung von Kunst und Kultur sowie des Sports die Ausgaben nach oben gegangen. Das hat sich im Jahr 2020 in einem dicken Minus von 22 Milliarden Euro niedergeschlagen. Allerdings zeigt sich jetzt, beim Rausgehen aus der Krise, dass wir schneller aus der Krise herauskommen als erwartet, und das hat sicher auch damit zu tun, dass diese Hilfsmaßnahmen relativ treffend und vor allem auch als Zuschüsse ausgestaltet waren. (Beifall bei Grünen und ÖVP.)
Der Rechnungshof – die Frau Präsidentin war vorhin noch da –, der diesen Rechnungsabschluss erstellt hat, hat auch festgehalten, dass unmittelbar nach der Pandemiebekämpfung in eine nachhaltige, langfristig ausgerichtete Haushaltsplanung mit unter anderem zukunftsorientierten Reformen und auch konsequenten Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele, die gleichzeitig die Wachstumspotenziale abschöpfen sollen, übergegangen werden soll. Genau diese Herausforderungen und Empfehlungen greift der Budgetvoranschlag für 2022 auf, und er soll dazu führen, dass wir von einem Krisenbudget zu einem Zukunftsbudget kommen. Das hat der Finanzminister ausgeführt, und ich glaube, das ist sehr gut gelungen.
Das zentrale Element dieses Budgets, die ökosoziale Steuerreform mit einem historisch einmaligen Gesamtvolumen von 18,6 Milliarden Euro, schafft es einerseits, dass allen Menschen in Österreich, insbesondere aber jenen mit kleinen und mittleren Einkommen, mehr Netto vom Brutto bleibt. Andererseits schafft sie quasi eine Steuerstrukturreform, nämlich dadurch, dass mit der CO2-Bepreisung ein neues Element eingeführt wird, dass klimaschädliche Technologien und klimaschädliches Verhalten einen Preis bekommen und gleichzeitig die eingenommenen Euros in Form von einem Klimabonus direkt an die Bürgerinnen und Bürger zurückgehen. Umgekehrt betrachtet: Jeder und jede bekommt einen Klimabonus von mindestens 100 Euro, und je klimafreundlicher man sich verhält, desto mehr bleibt von diesem am Ende des Jahres übrig. (Beifall bei Grünen und ÖVP. – Zwischenruf der Abg. Herr.)
Das heißt, da wird nicht an kleinen Schrauben gedreht, sondern da wird ein neues Zahnrad in die Maschine eingebaut, und das führt dazu, dass das Klima und die zukünftigen Generationen jetzt Teil der Rechnung sind. Warum ist dieses Zahnrad so wichtig? – Wir haben als Generation den historischen Auftrag, die Überleitung in dieses neue, klimaneutrale Zeitalter zu schaffen, und das erfordert große Kraftanstrengungen. Es braucht dafür zum einen die Schaffung der Grundlage für dieses klimaneutrale Zeitalter, die Schaffung der Fundamente; das sind die klimafreundlichen Technologien und Infrastrukturen. Das muss man mittels öffentlicher und privater Investitionen erreichen. Zum anderen ist es notwendig, die gesamte Wirtschaft und die Haushalte in die Nutzung dieser Technologien und Infrastrukturen hinüberzulenken, und dafür braucht es positive und negative Anreize. Das Budget, ausgedrückt durch den Budgetvoranschlag, der für 2022 vorliegt, beinhaltet beides: massive Investitionen in die zukünftigen Fundamente und gleichzeitig auch die Lenkung hin in Richtung einer Nutzung dieser neuen Grundlagen.
Einerseits gibt es massive Investitionen in den Ausbau klimafreundlicher Industrien, da gibt es wichtige technologische Veränderungen, die notwendig sind. Im Bereich der Gebäude, Wohnungen, Häuser, die klimafit werden, gibt es eine massive Aufstockung der Sanierungen, der Möglichkeiten zum Heizkesseltausch. Außerdem betrifft das natürlich den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, und zwar eines emissionsfreien öffentlichen Verkehrs.
Der zweite Teil ist die Umlenkung hin zur Nutzung dieser Technologien, und da gibt es aus meiner Sicht in diesem Budget zwei entscheidende Elemente, die sehr deutlich sind: Das eine ist natürlich die CO2-Bepreisung, die dazu führt, dass man angereizt ist, von Technologien, die CO2 ausstoßen, wegzukommen. Das andere sind Förderungen, Unterstützungen, die sich auch in diesem Budget wiederfinden und die sich insbesondere im Klimaticket ausdrücken. Dafür ist bis 2025 1 Milliarde Euro eingestellt, die dazu führen soll, dass öffentliche Verkehrsmittel und der Umstieg darauf günstiger werden.
In Summe ist es also das, was der Rechnungshof im Bundesrechnungsabschluss empfiehlt, nämlich der Übergang zu einem Budget, das sehr stark in Richtung Zukunft ausgerichtet ist. Wir werden morgen noch die Möglichkeit haben, darüber zu diskutieren.
Ich möchte noch einen Schlusssatz zu Kollegen Fuchs sagen, der gemeint hat, was die kalte Progression aufgefressen hat, werde jetzt zizerlweise wieder an die Menschen zurückgegeben: Die Reform hat ein Gesamtvolumen von 18,6 Milliarden Euro. Ich weiß nicht, ob wir beide uns darüber einig sind, wie man Zizerl definiert (Heiterkeit bei Abgeordneten der ÖVP), aber vielleicht sollten wir uns das noch einmal gemeinsam anschauen. – Vielen Dank. (Beifall bei Grünen und ÖVP. – Zwischenruf des Abg. Deimek.)
11.09
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Loacker. – Bitte sehr.
Abgeordneter Mag. Gerald Loacker (NEOS): Herr Präsident! Geschätzte Präsidentin des Rechnungshofes! Werte Bundesregierungsmitglieder! Wir diskutieren den Bundesrechnungsabschluss, wie ihn die Frau Präsidentin des Rechnungshofes präsentiert hat, und gleichzeitig werfen wir mit der Budgetrede des Finanzministers den Blick ins kommende Jahr. Meine Fraktion kritisiert seit Jahren die fehlende Zukunftsfähigkeit des Budgets.
Budgetsprecherin Karin Doppelbauer hat letztes Jahr treffend gesagt: Dem Budget fehlen smarte Investitionen, vernünftige Entlastungen sowie Transparenz und Kontrolle. Es fehlen Zukunftsstrategien und innovative Ansätze, wie wir es auch noch in zehn Jahren schaffen können, in einem wohlhabenden Land zu leben. – Wenn wir die Empfehlungen des Rechnungshofes anschauen, dann sehen wir, dass es genau darum geht: Es geht um Effizienz in der Verwaltung, um zukunftsgerichtete Reformen im Sinne der Generationengerechtigkeit, darum, langfristig gedacht endlich eine enkelfähige Politik zu machen, um Transparenz in den Budgets und konkrete Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele. – Und Sie sagen: Aufschwung, Stabilität und Nachhaltigkeit!
Aufschwung also aus dem Loch, in das Sie uns hinuntermanövriert haben, denn in ganz wenigen Ländern war die Rezession so stark wie bei uns – weil Sie das schlecht gemacht haben. Stabilität finde ich eine mutige Ansage von dieser Chaosregierung, wie wir sie in den letzten Wochen erlebt haben. Ich glaube nicht, dass das Ausland, das jetzt angeblich auf dieses Budget schaut, als ersten Gedanken Stabilität hat, wenn es auf Österreich schaut. (Beifall bei den NEOS.)
Und Nachhaltigkeit? – Ja, Nachhaltigkeit beim kontinuierlichen Schuldenschreiben! Sie haben zwar in Ihrer Budgetrede vorgelesen: „in Wachstumsphasen permanent Schulden zu machen, ist Bequemlichkeit zulasten der [...] Steuerzahler“. – Bei diesem Satz gebe ich Ihnen recht, aber das, was Sie tun, ist ja genau, in einer Wachstumsphase permanent weiter Schulden zu machen. Sowohl das Maastrichtdefizit wie auch das gesamtstaatliche Defizit werden nämlich weiter – in unterschiedlicher Höhe, aber doch – fortgeschrieben, und 2025 ist ein „Nulldefizit möglich“, sagen Sie – ja, möglich, aber nicht einmal geplant.
Sie verlassen sich wieder einmal darauf, dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler mit ihrem persönlichen Einsatz, mit ihrem Engagement, mit ihrer Tatkraft so viel Steuergeld in die Kassen spülen, dass es sich für Sie irgendwie ausgeht, und Sie bedanken sich in Ihrer Rede bei den Bürgermeistern, nicht aber bei den Steuerzahlern, die Ihnen Ihre Geschenke, die Sie großzügig über verschiedene Gruppen verteilen, überhaupt erst ermöglichen. (Beifall bei den NEOS.)
Eines muss man schon einmal schaffen: Sie gehen her und erzählen von 20 Millionen Euro da und 60 Millionen Euro dort, lassen sich für dieses und jenes applaudieren, reden aber mit keinem einzigen Wort über den größten Posten im gesamten Budget. 23 Milliarden Euro – mehr als ein Viertel – gehen in den Pensionen auf. Das erwähnen Sie mit keinem Wort. Wenn Sie in den Bundesrechnungsabschluss schauen und aufsummieren, wie die Pensionslasten bis zum Jahr 2050 ausschauen, dann sehen Sie: Es fehlen 1 310 Milliarden Euro – 1 310 Milliarden Euro! – bei den Pensionen –, und Sie machen da ein bisschen Milliönchenbrösel!
Nun, nach 1,5 Jahren Pandemie müsste eigentlich die türkis-grüne Regierung zeigen, dass es einen Neustart gibt, dass man den Mut hat, die Kreativität und die Schaffenskraft der Menschen einmal zu entfesseln. Sie aber geben stattdessen Almosen, großzügig, gutsherrenartig, es wird gegeben – das passt auch zu einem adligen Bundeskanzler: Wir geben den Untertanen ein bisschen etwas.
Was es aber brauchen würde, wäre eine umfassende Entlastung mit einer Deregulierung und Entbürokratisierung. Wenn man sich die jungen Menschen anschaut, die sich etwas erarbeiten wollen, eine eigene Wohnung haben wollen, dann merkt man, dass dieses Ziel in immer weitere Ferne rückt, weil zwar minimale Steuerentlastungen daherkommen, aber das, was am Schluss von der eigenen Schaffenskraft in der Tasche bleibt, immer weniger wird. Es fehlt die Entlastung des Mittelstandes, und die kalte Progression muss endlich abgeschafft werden. Da kommen Sie mit leichtem Hinunterschrauben von einzelnen Steuersätzen niemals hin! Es wird den Menschen mehr aus der Tasche gezogen. (Beifall bei den NEOS.) Das ist eigentlich Wegelagerei und nicht Politik.
Wo bleibt die Entlastung der Unternehmerinnen und Unternehmer? Wo bleibt die Entlastung der Klein- und Mittelbetriebe? Was diese bräuchten, wäre eine Senkung der Lohnnebenkosten. Auch die Betriebe brauchen das Ende der kalten Progression, denn sie wollen ja, dass es ihren Mitarbeitern gut geht, sie wollen, dass ihre Mitarbeiter mehr verdienen, dass ihre Mitarbeiter mehr Netto vom Brutto haben, weil die Mitarbeiter immer noch zu viel kosten und zu wenig verdienen.
Wenn man sich die Aktenaffäre ansieht, dann weiß man eigentlich, was das türkise System kaputt gemacht hat: Die kalte Progression könnte schon weg sein, wenn man Kern und Mitterlehner hätte arbeiten lassen. Wir hätten 1,2 Milliarden Euro für Nachmittagsbetreuung, damit dadurch, dass die Kinder gut betreut sind, mehr Leute arbeiten gehen können – dann hätten sie auch mehr Wohlstand. Ihnen aber ging es in Ihrer Zukunftsvergessenheit mehr um die Macht, denn zukunftsvergessen und machtversessen gehen in diesem türkisen System Hand in Hand.
Kollege Fuchs hat es schon angesprochen: Sie senken unterjährig zwei Steuersätze in der Lohn- und Einkommensteuer. Also wie das gehen soll, weiß wahrscheinlich in Ihrem eigenen Ministerium keiner, denn das Finanzamt kann gar nicht wissen, in welchem Monat jemand wie viel verdient hat. Da müsste ein Einkommensteuerpflichtiger unterjährig eine Bilanz machen, und die Unternehmen müssten für jeden Mitarbeiter mit Ende Juni einen Jahreslohnzettel übermitteln. Ich kann Ihnen als Finanzminister eine wichtige Information geben: Das Steuerjahr ist immer das Kalenderjahr. Sie können daher nicht unterjährig einen Einkommensteuersatz senken!
Nun, Rechnungshofpräsidentin Kraker hat auch konsequente Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele eingemahnt. Davon sind wir weit entfernt. Mit einem CO2-Preis von
30 Euro erreichen Sie keinen Lenkungseffekt. Mich irritiert auch das Gegeneinanderausspielen von Bund und Land. Ein gezieltes Anti-Wien-System aufzubauen ist auch dermaßen lächerlich und politisch so durchschaubar, dass man sich eigentlich genieren müsste. (Beifall bei den NEOS und bei Abgeordneten der SPÖ.)
Eine echte Ökologisierung des Steuersystems würde der Umweltverschmutzung einen fairen Preis geben und nicht einen Pseudopreis. Es würde die Menschen auf der anderen Seite entlasten, nämlich bei der Erwerbstätigkeit, bei den Steuern. Dazu fehlt Ihnen der Mut. Zukunftsvergessenheit und Machtversessenheit – das steht für Sie im Vordergrund. Was Österreich jetzt aber braucht, wäre ein Neustart, um Österreich die Flügel zu heben. (Beifall bei den NEOS.)
11.16
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Hanger. – Bitte.
Abgeordneter Mag. Andreas Hanger (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Finanzminister! Sehr geehrte Mitglieder der Bundesregierung! Sehr geehrte Frau Präsidentin des Rechnungshofes! Werte Kolleginnen und Kollegen! Hohes Haus! Wir debattieren den Bundesrechnungsabschluss 2020. Für die Erstellung des Bundesrechnungsabschlusses ist ja der Rechnungshof zuständig. Ich möchte daher die Gelegenheit nutzen, mich sehr herzlich beim Rechnungshof zu bedanken. Da wurde ausgezeichnete, professionelle Arbeit geleistet. Für jeden, der sich einen Überblick über die finanzielle Situation der Republik verschaffen will, insbesondere auf der Bundesebene, ist der Bundesrechnungsabschluss einen Blick wert. Es gibt auch eine Kurzfassung für den eiligen Leser. – Ein großes Danke einmal an den Rechnungshof für diese professionelle Arbeit! (Beifall bei ÖVP und Grünen sowie bei Abgeordneten von SPÖ und NEOS.)
Wenn wir uns den Rechnungsabschluss anschauen, dann müssen wir uns natürlich zuallererst einmal die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen anschauen. Diese waren natürlich von der Coronapandemie geprägt, gar keine Frage: ein Konjunktureinbruch von minus 6,6 Prozent, 2 Prozent Rückgang bei den Beschäftigten, die Arbeitslosigkeit ist deutlich in die Höhe gegangen, die relative Verschuldung ist auf knapp 84 Prozent gestiegen. – Das sind einleitend natürlich die schlechten Nachrichten, darüber kann man sich nicht freuen, wenn man sich mit Finanzfragen beschäftigt.
Jetzt kommt jedoch das große Aber: Sehr erfreulich ist – und das möchte ich schon in aller Ausdrücklichkeit festhalten –, dass diese schlechten Zahlen natürlich den unglaublichen Programmen geschuldet sind, die die Bundesregierung gemeinsam mit dem Parlament auf den Weg gebracht hat. Das waren die Kurzarbeit, der Fixkostenzuschuss, der Umsatzersatz, der Fonds für die Non-Profit-Organisationen, ein eigener Fonds für Künstlerinnen und Künstler, das Kommunalinvestitionsgesetz und vieles andere mehr.
Das will ich schon in aller Deutlichkeit festhalten: Diese Programme haben gewirkt! (Zwischenruf der Abg. Doppelbauer.) Einmal mehr möchte ich an das Finanzministerium ein großes Danke sagen. Diese Programme in dieser Schnelligkeit auf den Weg zu bringen war schon außerordentlich gute Arbeit. Der Herr Finanzminister hat selber gesagt, man könne natürlich immer in Details alles auch besser machen, ganz klar ist aber – das lässt sich auch durch internationale Studien belegen, es lässt sich durch Studien belegen, die mittlerweile en masse gemacht worden sind –: Wie der Herr Finanzminister und die gesamte Bundesregierung gemeinsam mit dem Parlament Österreich durch diese Krise geführt haben, war hervorragend, das will ich schon festhalten! (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
Ein Blick in die Zukunft: Wir diskutieren zwar den Bundesrechnungsabschluss 2020, der Großteil der Redner hat sich aber schon mit der Zukunft beschäftigt, weil wir natürlich vor der Beschlussfassung zum neuen Bundesbudget stehen. Dazu möchte ich schon eines festhalten – und ich würde mir in unserer Republik wieder ein bisschen mehr Optimismus wünschen –: Wir haben zuallererst Vollbeschäftigung!
Seitdem ich mich mit politischen Fragen beschäftige, sagt man doch immer: Die Beschäftigung der Menschen ist das Wichtigste! Wir haben ganz im Gegenteil in einzelnen Regionen sogar schon einen Arbeitskräftemangel, das ist auch ein Problem, aber zuallererst haben wir Vollbeschäftigung in unserer Republik. Das will ich schon einmal festhalten. Das hilft uns auch budgettechnisch, gar keine Frage, weil das natürlich zuallererst auch höhere Einnahmen bedeutet.
Der zweite Grund für Optimismus ist – und den finde ich unglaublich bemerkenswert –: Wir schaffen es innerhalb kürzester Zeit, die relative Verschuldung wieder auf knapp 70 Prozent zurückzuführen, vorausgesetzt, das Wirtschaftswachstum bleibt. (Zwischenruf der Abg. Doppelbauer.) Da sieht man schon eine hervorragende Finanzpolitik, und ich danke auch da dem Finanzminister, weil er einer der wenigen Finanzminister auf europäischer Ebene ist, der diesen Stabilitätspakt jetzt auch wieder einfordert.
Es war richtig und gut, in Zeiten der Krise diese Schulden zu machen, aber jeder, glaube ich, der finanzpolitischen Hausverstand hat, weiß, dass wir das auch wieder entsprechend zurückführen müssen. Eine Kennzahl, die ich auch sehr bemerkenswert finde, ist die Verzinsung – wie wir derzeit unsere Staatsschulden finanzieren –, die ist nach wie vor negativ. Ja, das ist bei ein paar anderen europäischen Staaten auch so, aber im globalen Vergleich zeigt das, dass wir eine unglaublich starke Volkswirtschaft haben, und darauf können wir schon auch ein bisschen stolz sein. (Beifall bei der ÖVP sowie der Abgeordneten Maurer, Rössler und Jakob Schwarz.)
Zwei Dinge möchte ich jetzt klarstellen: Die Behauptung, dass die Entlastungsmaßnahmen durch die kalte Progression finanziert werden, ist schlichtweg falsch. (Beifall bei der ÖVP.) Natürlich gibt es einen Effekt durch die kalte Progression, gar keine Frage (Zwischenruf des Abg. Deimek), nur halte ich schon auch fest – und da schaue ich insbesondere zur SPÖ –: Wem würde die Abschaffung der kalten Progression helfen? – Die hilft natürlich tendenziell den Beziehern höherer Einkommen. (Zwischenrufe bei den NEOS.) – Na ganz klar, das lässt sich durch jede Studie belegen. Jeder, der ein bisschen Hausverstand hat, weiß das. Der frühere Direktor der Arbeiterkammer, Herr Muhm, hat sich immer vehement gegen die Abschaffung der kalten Progression gewehrt, weil sie den oberen Einkommensschichten natürlich mehr hilft. (Neuerliche Zwischenrufe bei den NEOS sowie des Abg. Deimek.)
Klar ist auch, dass die kalte Progression nur einen Teil der Entlastungsmaßnahmen finanziert. Die sind nämlich sehr stark. Die Senkung der zweiten und dritten Tarifstufe, die Senkung der Krankenversicherungsbeiträge vor allem für die unteren Einkommensbereiche, die Erhöhung des Familienbonus – das sind doch Maßnahmen, die wirklich allen Österreicherinnen und Österreichern helfen, und das sollte man auch zur Kenntnis nehmen.
Mit einer Mär, die seit zwei Tagen zirkuliert, möchte ich auch noch aufräumen: Der Herr Bundeskanzler außer Dienst habe quasi den Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen in Österreich verhindert. – Bitte, schauen wir doch zu den Fakten! Es wurden 1,6 Milliarden Euro ausgegeben. Es ist aber doch bitte legitim, diese Maßnahme mit den Ländern und mit den Gemeinden zu verhandeln, weil die ja die Träger dieser Einrichtungen sind. (Zwischenrufe bei der SPÖ.) Also wirklich, mit dieser Mär muss ich einmal aufräumen. Natürlich wurden diese Investitionen in unserer Republik auch getätigt. (Beifall bei der ÖVP.)
Ich darf noch den Einstieg in die Klimapolitik erwähnen. Ich halte das persönlich auch für sehr, sehr richtig, und das ist, glaube ich, mit unserem Koalitionspartner sehr gut ausverhandelt; auch der Regionalbonus, mit dem man eine Ausgewogenheit zwischen den Regionen schafft.
Abschließend: Wir haben allen Grund für Optimismus in dieser Republik, und von diesem würde ich mir mehr wünschen. (Beifall bei der ÖVP sowie der Abg. Maurer.)
11.22
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu einer tatsächlichen Berichtigung hat sich Herr Abgeordneter Stöger zu Wort gemeldet. – Bitte.
Abgeordneter Alois Stöger, diplômé (SPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Regierungsmitglieder! Frau Rechnungshofpräsidentin! Abgeordneter Hanger hat in seiner Rede behauptet, wir haben Vollbeschäftigung. (Abg. Hanger: Ausgenommen in Wien!) – Es sind laut Aussage von Herrn Johannes Kopf mit Ende September 338 514 Menschen beim AMS (Ruf bei der ÖVP: ... Redebeitrag!) als arbeitslos gemeldet (neuerlicher Zwischenruf des Abg. Hanger), dazu sind über 120 000 Menschen in Österreich langzeitarbeitslos (Ruf bei der ÖVP: ... Redebeitrag!), das sind Menschen, die länger als ein Jahr beschäftigungslos waren. (Abg. Ofenauer: Wo ist die Berichtigung?) Das müsste berichtigt sein. (Beifall bei der SPÖ. – Ruf: ... ÖVP sind es 20 000 Arbeitslose! – Ruf bei der FPÖ: Jetzt sagt der Hanger auch schon die Unwahrheit! – Ruf: Das Recht der Redefreiheit!)
11.23
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordnete Herr. – Bitte.
Abgeordnete Julia Elisabeth Herr (SPÖ): Herr Präsident! Werte Regierungsvertreter, Regierungsvertreterinnen! Hohes Haus! Zu Beginn vielleicht noch zur erneuten lustigen Kabaretteinlage – anders kann man es ja nicht mehr bezeichnen – des Herrn Hanger (Zwischenruf bei der ÖVP), dass es falsch sei, dass der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung verhindert worden ist: Erstens haben Sie das ja gerade gestern wieder verhindert, und zweitens können wir das alle in den Chats nachlesen, Herr Hanger. (Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordneten der NEOS. – Zwischenruf des Abg. Hanger.) Es ist ein bisschen schwierig, da gewagte Aussagen zu machen, da es die Chats ja wirklich gibt.
Ich gehe auf den Bundesrechnungsabschluss ein: Dieser zeigt uns ziemlich deutliche Zahlen. Wer zahlt das Steueraufkommen in Österreich? – 85 Prozent der Steuern und Abgaben zahlen die arbeitenden Menschen, die Pensionisten, Pensionistinnen mit Steuern auf Arbeit, auf Konsum, und nur 15 Prozent sind Einnahmen von Gewinnen oder Einnahmen von Vermögen. 15 Prozent versus 85 Prozent: Das ist jetzt schon eine unglaublich große Schieflage, und die soll – der Finanzminister hat es erklärt – noch weiter verschärft werden, denn die Gewinne der großen Unternehmen und Konzerne in diesem Land sollen weniger besteuert werden. Das sind Milliarden, die uns dann im Budget fehlen werden, und das kann gerade in so einer Krisenzeit nicht der Weisheit letzter Schluss sein. (Beifall bei der SPÖ.)
Wir haben es schon gehört, die KöSt-Senkung, also die Senkung der Gewinnsteuern, werde ja die kleinen Betriebe entlasten. Dass das nicht stimmt, will ich auch mit nur einer Zahl belegen: 65 Prozent dieser riesigen Summe fließen an das Top-1-Prozent der Unternehmen und Konzerne in diesem Land. Es werden also jene mit den größten Gewinnen auch wieder am meisten entlastet. Ich glaube, es geht einem Volksschulkind ein, dass das nicht sozial ist. (Beifall bei der SPÖ. – Zwischenruf bei der ÖVP.)
Ich will noch dazusagen, dass das nicht nur nicht sozial – es wird auch kein einziger Arbeitsplatz damit geschaffen –, sondern auch nicht ökologisch ist. Die Regierung sagt, man soll das Klimafreundliche belohnen, das Klimaschädliche etwas teurer machen. – Das stimmt. Ich als Klimaschutzsprecherin finde es gut, wenn CO2 einen Preis bekommt. Warum aber gilt das immer nur für die arbeitenden Menschen? Die Unternehmen bekommen diese KöSt-Senkung einfach so – wurscht, da gibt es keine Verbindlichkeiten hinsichtlich Klimaschutz –, die bekommen Hunderte Millionen Euro im Jahr einfach so. Klar ist, das ist nicht gerecht, das ist nicht ökologisch. (Beifall bei der SPÖ.)
Das führt dann nämlich dazu, dass ein Konzern wie die OMV, einer der größten CO2-Emittenten in diesem Land, einfach so 13 Millionen Euro pro Jahr mehr bekommt; wurscht, was das mit den CO2-Emissionen zu tun hat.
Ich habe aber einen Vorschlag, wie wir das besser machen könnten, sodass wir einen wirklichen Lenkungseffekt erzielen, denn um den geht es ja. Die CO2-Bepreisung soll ja nicht mehr Einnahmen fürs Budget bringen – wenn es darum geht, dann führen Sie bitte Millionärssteuern ein, Herr Finanzminister –, sondern es geht um den Lenkungseffekt. Die Menschen sollen auf die klimafreundlichen Alternativen umsteigen. Ich komme aus einer ländlichen Region, und wenn dort der Bus nicht fährt, dann kann ich nicht auf ihn umsteigen, wenn es in meiner Gemeinde keinen Bahnhof gibt, dann kann ich nicht vom Auto auf den Zug umsteigen. Das ist ja das Wesentliche! Daher mein Vorschlag: Statt diese Hunderte Millionen Euro an die größten Konzerne und Unternehmen in diesem Land zu verschenken, sollten wir dieses Geld in den öffentlichen Verkehr, in die kleinen Kommunen investieren. Schauen wir, dass wir wirklich ein klimafreundliches Leben für alle möglich machen! (Beifall bei der SPÖ.)
Ich bringe somit einen Antrag ein:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Julia Elisabeth Herr, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Klimainvestitionen statt Körperschaftssteuer-Geschenke für Konzerne“
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, jene Budgetmittel, die als Steuergeschenke für Großkonzerne – in Form einer Körperschaftssteuer-Senkung – vorgesehen sind, in zukunftsfähige klimafreundliche Infrastruktur zu investieren.“
*****
So hätten wir einen Lenkungseffekt, so könnten die Menschen auch umsteigen. Das würde Sinn machen. Ich lade die Kollegen und Kolleginnen von den Grünen, bei denen ich weiß, im Herzen wollen sie mitstimmen, aber auch die ÖVP-Kollegen und ‑Kolleginnen herzlich ein, mitzustimmen.
Nur noch ein letzter Satz: Der Vizepräsident des Gemeindebundes, Johann Hingsamer, ein ÖVP-Kollege, hat diese KöSt-Senkung als das bezeichnet, was sie ist: ein Geschenk an die Industrie. Viele Bürgermeister und Bürgermeisterinnen sitzen ja heute hier: Schenken wir das Geld nicht her, sondern investieren wir es in den öffentlichen Verkehr! Das wäre sozial und ökologisch. Das ist das, was wir uns von so einer Steuerreform erwarten. – Danke schön. (Beifall bei der SPÖ.)
11.29
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
§ 55 GOG-NR
der Abgeordneten Julia Herr,
Genossinnen und Genossen
betreffend Klimainvestitionen statt Körperschaftssteuer-Geschenke für Konzerne
eingebracht im Zuge der Debatte über den Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2020 (III-321/1062 d.B.) (TOP 2)
Die arbeitende Bevölkerung, Pensionist*innen, Verbraucher*innen zahlen rund 85 Prozent der gesamten Steuern und Abgaben, jene mit Kapital und Vermögen nicht einmal 15 Prozent. Das Steuersystem gerät durch die Steuerreform noch stärker in Schieflage. Die Ungerechtigkeit wird vergrößert. Die türkis-grüne Regierung denkt überhaupt nicht daran, von den Millionen-Erbschaften, Milliarden-Stiftungen, den Reichen und Superreichen auch nur einen Euro zu verlangen.
Im Gegenteil: Die Körperschaftssteuer (KÖSt) als Konzern-Gewinnsteuer wird um rund 800 Mio. Euro gesenkt. Das bringt keinen einzigen Arbeitsplatz, das hilft den kleinen Selbstständigen und KMU überhaupt nicht, sondern vermehrt nur das Vermögen der Eigentümer und Aktionäre.
Zur Problematik der Körperschaftssteuer-Senkung hält das Momentum-Institut fest:
„Von der Senkung der Körperschaftssteuer profitiert nur ein Bruchteil der Unternehmen: Sehr gewinnstarke Großunternehmen und in Folge deren Eigentümer:innen erhalten ein Steuergeschenk mit hohen jährlichen Kosten von 774 Mio. EUR. Das forciert die Ungleichheit in Österreich und garantiert keinesfalls den gewünschten Wachstums-Effekt.“1
Der Vizepräsident des Gemeindebundes Johann Hingsamer (ÖVP) nennt die KÖSt-Senkung das was sie ist, ein „Geschenk an die Industrie“.2
Während auf der einen Seite großzügige Steuergeschenke verteilt werden, schafft es die Bundesregierung auf der anderen Seite nicht, die CO2-Steuer mit dem Klimabonus ausreichend sozial abzufedern. Denn statt einer sozialen Staffelung entscheidet künftig die Postleitzahl darüber, ob ein höherer oder geringerer Klimabonus ausgezahlt wird. Und selbst wenn man das „Glück“ der richtigen Postleitzahl hat, ist noch immer nicht sichergestellt, dass der Klimabonus tatsächlich die zusätzliche Besteuerung abfedert. Dass ein Klimabonus allein eine Kompensation nicht sicherstellt, ist seit der Studie des Budgetdienstes aus dem Jahr 2019 nachgewiesen.3
Eine Studie der WU Wien im Auftrag der Arbeiterkammer hat das im Frühjahr 2021 im Detail verdeutlicht und darauf hingewiesen, dass neben zusätzlicher Kompensation in Form eines Klimabonus PLUS vor allem zusätzliche öffentliche Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen erforderlich sind, damit Klimapolitik auch sozial gerecht ist.4
Die Einschätzung des Wegener Center für Klima und Globalen Wandel der Universität Graz zur Steuerreform bekräftigt die Notwendigkeit von weiteren Investitionen in klimafreundliche Infrastruktur:
„Nur wenn von staatlicher Seite ausreichend Anreize zum raschen und umfassenden Umbau der Infrastrukturen geschaffen werden, die eine dauerhafte Transformation erleichtern (massiver Ausbau des öffentlichen Verkehrs, massive Steigerungsraten in der Gebäudesanierung, Umstellung aller Heizsysteme, kompletter Umstieg der Elektrizitätserzeugung auf erneuerbare Energieträger), wird eine signifikante Reduktion der Treibhausgasemissionen in Österreichs national verantworteten Emissionsbereichen (Verkehr, Raumwärme, Gewerbe, Landwirtschaft und Abfall) erzielt werden können.“5
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, jene Budgetmittel, die als Steuergeschenke für Großkonzerne - in Form einer Körperschaftssteuer-Senkung – vorgesehen sind, in zukunftsfähige klimafreundliche Infrastruktur zu investieren.“
1 https://www.momentum-institut.at/steuerreform
2 https://ooe.orf.at/stories/3124341/
3 https://www.parlament.gv.at/ZUSD/BUDGET/2019/BD_-_Anfragebeantwortung_zu_den_Verteilungswirkungen_einer_CO2-Steuer_auf_Haushaltsebene.pdf
4 https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/steuergerechtigkeit/
Klimaschutz.html
5 https://wegccloud.uni-graz.at/s/rM8fyEs5wxjTmry
*****
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Der Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht, ausreichend unterstützt und steht somit mit in Verhandlung.
Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Götze. – Bitte sehr, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete Dr. Elisabeth Götze (Grüne): Herr Präsident! Werte Mitglieder der Bundesregierung! Sehr geehrte Frau Präsidentin des Rechnungshofes! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuseherinnen und Zuseher! Ich möchte zum Thema zurückkommen: Das Thema ist der Bundesrechnungsabschluss des letzten Jahres – Danke auch Ihnen (in Richtung Rechnungshofpräsidentin Kraker) für die gute Arbeit; wie immer, wenn der Rechnungshof prüft.
Was wir hier machen, ist, dass wir auf die Finanzen des Jahres 2020 zurückschauen, und wir wissen, dass wir im Gegensatz zum Jahr 2019, in dem es einen Überschuss gegeben hat, letztes Jahr keinen solchen verzeichnen konnten: Es hat mehr Auszahlungen und weniger Einnahmen gegeben. Das ist aber nicht verwunderlich, weil wir mit der Coronakrise kämpfen mussten. Es hat daher Wirtschaftshilfen, Kurzarbeit und vieles andere, was Mehrausgaben verursacht hat, und weniger Einnahmen gegeben.
Ich möchte aber Kollegen Fuchs – er ist jetzt eh im Saal – widersprechen, der gesagt hat, die Wirtschaftshilfen hätten nicht gewirkt, denn sowohl das Wifo, das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung, als auch die KMU Forschung Austria und die Creditreform haben sich mit den Wirtschaftshilfen beschäftigt und festgestellt, dass die österreichischen Unternehmen dank dieser Wirtschaftshilfen liquider, also zahlungsfähiger, waren und Verluste vermindert wurden, wodurch es auch weniger Insolvenzen gab, und 350 000 Arbeitsplätze wurden allein durch die Wirtschaftshilfen erhalten. (Beifall bei Grünen und ÖVP.)
Darüber hinaus schätzt das AMS, dass 1,3 Millionen Arbeitsplätze durch die Kurzarbeit erhalten wurden – das ist also die zweite Schiene: Die Kurzarbeit hat 1,3 Millionen Jobs gesichert.
Wir können also zusammenfassen: Die Hilfsmaßnahmen wirken, sie haben gewirkt, und das sieht man auch am wirtschaftlichen Aufschwung. Die Arbeitslosenzahlen gehen zurück. Ich würde noch nicht von Vollbeschäftigung reden, aber die Zahlen gehen zurück,
und wir rechnen nächstes Jahr mit Arbeitslosenzahlen auf dem Vorkrisenniveau. Die sind vielleicht noch immer zu hoch, aber es ist der Weg in die richtige Richtung.
Darüber hinaus kommt auch das Wirtschaftswachstum wieder zurück, und daher sieht man für 2022 – wir haben heute schon begonnen, über das Budget zu sprechen, das wird uns noch intensiv beschäftigen –: Im Voranschlag sind nur mehr 4 Milliarden Euro für den Krisenbewältigungsfonds vorgesehen – vorsorglich vorgesehen –, es gibt also weiterhin Unternehmenshilfen zu einem geringen Teil, Non-Profit-Organisationen-Unterstützungsfonds, Kurzarbeit – natürlich ganz wichtig auch für Gemeinden – und Gesundheit und Bildung. Dafür ist Geld vorzusehen.
Jetzt ist Zeit, die Hilfen im Sinne von: Was hat gut und was hat weniger gut funktioniert?, zu evaluieren. Dabei wird der Rechnungshof eine wichtige Aufgabe bekommen; die Frau Präsidentin hat schon eine Prüfung der Cofag angekündigt. Weiters: Wir haben im Budgetausschuss schon mehrfach besprochen, dass die Stundungen und die Übernahme von Haftungen von Unternehmen dahin gehend zu prüfen sind, dass wir sie bewerten wollen und auch im Ausschuss oder als Nationalrat wissen wollen, mit welchen Ausfällen zu rechnen ist.
Abschließend: Es ist jetzt an der Zeit – die Coronakrise haben wir mehr oder weniger überwunden –, uns um das nächste große Thema, die Klimakrise, zu kümmern. Wenn wir an der vergangenen Krise bei all dem Leid also irgendetwas Positives sehen können, dann ist es, dass sie gezeigt hat, wie fähig wir sind, rasch Krisen zu bewältigen. Wir haben gelernt, dass wir sehr flexibel sein können, und in diesem Sinn möchte ich einen Appell an uns alle richten: Wirtschaftswachstum ist per se aus meiner Sicht noch nichts so Gutes, sondern es ist nur dann gut, wenn wir in die richtige Richtung investieren, und richtige Richtung heißt Digitalisierung und Ökologisierung. Genau das machen wir auch mit der ökosozialen Steuerreform. – Danke. (Beifall bei Grünen und ÖVP.)
11.34
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Angerer. – Bitte sehr.
Abgeordneter Erwin Angerer (FPÖ): Herr Präsident! Geschätzte Frau Rechnungshofpräsidentin! Herr Finanzminister! Geschätzte Regierungsmitglieder! Hohes Haus! Sehr geehrte Damen und Herren! Ein kurzer Blick zurück in das Jahr 2019 mit freiheitlicher Regierungsbeteiligung zeigt erstmals seit 65 Jahren ein positives Haushaltsergebnis auf Bundesebene. Wir haben Reformen eingeleitet – die Zusammenlegung der Sozialversicherungsträger sei als ein Beispiel genannt –, es gab die Senkung der Besteuerung der niedrigen Einkommen, die Senkung von Sozialversicherungsbeiträgen für die, die keine Steuern zahlen, weil sie so wenig verdienen, ein Familienbonus wurde eingeführt. Das waren die Maßnahmen einer schwarz-blauen Regierung.
Wenn wir uns jetzt das Jahr 2020 anschauen, sehen wir, dass es unter ÖVP-Grün ein Minus in Höhe von 22 Milliarden Euro gab. Heuer kommen noch einmal rund 30 Milliarden Euro dazu. Die Staatsschuldenquote liegt jetzt bei 90 Prozent, das heißt, das hat die Zukunft, das haben unsere Kinder dann wieder abzubauen.
Sie haben uns auf EU-Ebene in eine Schuldenunion geführt, was sogar vertraglich ausgeschlossen ist. 750 Milliarden Euro, Herr Prof. Taschner, an Schulden wurden auf EU-Ebene für einen sogenannten Wiederaufbaufonds aufgenommen. Österreich haftet mit rund 13 Milliarden Euro. Wir bekommen aus dem Topf 3,5 Milliarden Euro, die Italiener holen sich 200 Milliarden – also ich frage, welchen Sinn es für Österreich gehabt hat, so einen Schritt zu gehen und so eine Schuldenunion zuzulassen.
Österreich erlebte einen Wirtschaftseinbruch von 6,6 Prozent. Wir haben die Gemeinden und die Länder massiv geschwächt, und Sie wehren sich bis heute, entsprechende
Ausgleiche zur Verfügung zu stellen. Das war die Politik des Jahres 2020, die auch diese ÖVP und die Grünen in der Regierung zu verantworten haben.
Wie schaut der Wirtschaftsstandort aus? – Da schaut es nicht viel besser aus. Wir haben immer noch eine überbordende Bürokratie, wir haben Höchststeuern auf den Faktor Arbeit, wir haben einen Fachkräftemangel in Österreich, wobei Sie bis heute Maßnahmen ablehnen, etwas dagegen zu tun, und jetzt versinkt die Regierung im Korruptionssumpf. Welches Unternehmen auf dieser Welt soll sich unter diesen Voraussetzungen also noch überlegen, in Österreich einen Standort zu eröffnen? Das ist die Verantwortung dieser schwarz-grünen Regierung, so hat sie unser Land in eine Sackgasse geführt, aus der wieder herauszukommen schwer wird. (Beifall bei der FPÖ.)
Schauen wir uns die aktuelle Situation an! Wir haben schon das ganze Jahr auf die explodierenden Bau- und Rohstoffpreise, auf die dortigen Preissteigerungen hingewiesen. Wir haben eine Rekordinflation von über 3 Prozent. Die Menschen werden massiv belastet, und jetzt kommt noch die sogenannte ökosoziale Steuerreform dazu.
Kollege Fuchs hat es schon gesagt: Diese Steuerreform ist weder ökologisch noch sozial. Im Vorfeld sind Sie schon hergegangen und haben die NoVA massiv erhöht, was wiederum jeden Einzelnen, vom Kleinunternehmer bis hin zu den Familien, belastet. Und was soll die sogenannte CO2-Bepreisung, die Sie hier immer in den Vordergrund stellen, an CO2-Einsparung bringen? Schauen wir uns das an: Das Wifo hat errechnet, dass allein im Bereich von neuen Treibstoffen, wenn man bei den herkömmlichen Treibstoffen entsprechende Bioethanolbeimischungen verwenden würde, kurzfristig bis zu 1,2 Millionen Tonnen eingespart werden könnten, und die 140 000 Tonnen, die man bei der NoVA insgesamt annimmt, wären damit in einem Jahr erreichbar. Das wären also sinnvolle Maßnahmen gewesen, ohne die österreichische Bevölkerung weiter zu belasten.
Es ist im Grunde ein kalten Enteignung, die zurzeit stattfindet, und jetzt kommt noch eine massive, explodierende Preissteigerung im Bereich der Energieversorgung dazu. Die Gaspreise explodieren, der Strompreis explodiert, und das alles zulasten der Schwächeren in unserer Gesellschaft, zulasten derjenigen, die sich schon heute das Leben nur schwer leisten können, die sich schon heute schwertun, ihre Mieten zu zahlen. Sie werden diese Preissteigerungen haben.
Weil Herr Kollege Schwarz von den Grünen vorhin süffisant gefragt hat, was zizerlweise heißt: Also diese ökologische Steuerreform, wie Sie sie nennen, die Sie heute mit 18 Milliarden Euro verkaufen, tritt erstmals, wenn diese Regierung überhaupt noch besteht – ich habe gestern gewettet, dass es sie Mitte nächsten Jahres ohnehin nicht mehr gibt –, nächstes Jahr im Sommer in Kraft, und dann gibt es – vielleicht – die ersten Entlastungen für die Österreicherinnen und Österreicher. Bis dahin passiert einmal gar nichts.
Also die 18 Milliarden Euro kommen, wenn überhaupt, zizerlweise – das ist so, und diese Entwicklungen, die ich jetzt aufgezählt habe, werden zu einer Energiearmut in diesem Land führen. Das Nächste, was leider passieren wird, ist, dass Menschen ihre Lebenshaltungskosten nicht mehr aufbringen können, dass Menschen sich das Heizen nicht mehr leisten können, dass Menschen sich den Strom in ihren Wohnungen nicht mehr leisten können. Da sollte man etwas tun, weil sonst in Österreich in einigen Wohnungen im wahrsten Sinne des Wortes die Kälte Einzug halten und das Licht ausgehen wird.
Deshalb stellen wir auch einen entsprechenden Antrag, dass man dieser Entwicklung etwas entgegensetzt, denn man muss diesen Menschen helfen.
Wir stellen daher folgenden Antrag:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Erwin Angerer, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Energiearmut bekämpfen“
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, umgehend ein Fördermodell zu entwickeln, das garantiert, dass Personen und Haushalte, die aufgrund der gestiegenen Energiepreise ihre Strom- und Gasrechnungen nicht mehr zahlen können, jedenfalls über eine gesicherte Strom- und Gasversorgung verfügen und ihre Wohnungen entsprechend heizen können.
Die Bundesregierung wird weiters aufgefordert, im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf die heimischen Energieversorgungsunternehmen, an denen die öffentliche Hand beteiligt ist, entsprechend einzuwirken, dass diese von Strom- und Gaspreiserhöhungen jedenfalls Abstand nehmen.“
*****
Danke schön. (Beifall bei der FPÖ.)
11.40
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Erwin Angerer, MMMag. Dr. Axel Kassegger, Dr. Dagmar Belakowitsch
und weiterer Abgeordneter
betreffend Energiearmut bekämpfen
eingebracht im Zuge der Debatte zu TOP 2: Bericht des Budgetausschusses über den Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2020 (III-321/1062 d.B.) in der 125. Sitzung des Nationalrates am 13. Oktober 2021
Die Inflation erreichte im August dieses Jahres ein Niveau, wie schon seit zehn Jahren nicht mehr.
Insbesondere die stark gestiegenen Treibstoff- und Energiepreise sind für einen Anstieg der Inflation auf 3,2 % im August 2021 verantwortlich. Noch im Juli lag die Inflation bei 2,9 %. Insbesondere Haushaltsenergie schlug mit einer Verteuerung im Vergleich zum Vorjahr von im Schnitt 8,6 Prozent zu Buche. Die Preise für Strom stiegen um 7 Prozent, für Heizöl um 30 Prozent und für Gas ebenfalls um rund 7 Prozent. (APA0146/17.Sep 2021)
Wie die Tageszeitung „Die Presse“ am 1. Oktober 2021 berichtete, erreicht laut Schnellschätzung der Statistik Austria die Inflationsrate auch im September 3,2 Prozent. Vor allem die hohen Energie- und Spritpreise sorgen für die Teuerung.
Diese auf ein 10-Jahres-Hoch gestiegene Inflationsrate stellt ein massives Alarmsignal für die durch die Corona-Politik der Regierung bereits massiv belasteten Bürger in Österreich dar.
Wie drastisch sich die Situation für die heimische Bevölkerung entwickeln wird, veranschaulicht Reinhold Baudisch von der Vergleichsplattform durchblicker.at, der „von rund 500 Euro ausgeht, die ein Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3500 Kilowattstunden (kWh) Strom und 15.000 kWh Gas mehr zahlen muss, 400 Euro allein für Gas.“
Der Großhandelspreis von Erdgas ist seit Jahresbeginn um rund 440 Prozent gestiegen. Gas wird genutzt zum Heizen, aber auch zur Stromerzeugung – der fossile Brennstoff hat also auch Einfluss, wie viel Strom kostet. In Deutschland ist Strom an der Börse seit
Jänner um 140 Prozent teurer geworden. Das ist der maßgebliche Markt, der die Preisbildung bei Strom auch in Österreich bestimmt. Während in Deutschland, wo ein CO2-Preis auf Kohle, Benzin, Diesel, Heizöl und Gas (25 Euro/Tonne) Anfang 2021 eingeführt wurde, schon etliche Versorger Preiserhöhungen durchgeführt haben, hat sich in Österreich bisher nur Montana aus der Deckung gewagt. Der aus Deutschland stammende Energiehändler verteuert den Arbeitspreis für Gas ab November um 67 Prozent. (Standard, 05.10.2021)
Anstatt Maßnahmen zu setzen, um diese enorme Belastung der Bürgerinnen und Bürger insbesondere durch stark gestiegene Energiekosten einzudämmen, macht diese Bundesregierung geradezu das Gegenteil.
So kommt mit dem jüngst beschlossenen Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz eine weitere Belastungslawine auf die Haushalte zu, zumal künftig 1 Mrd. Euro jährlich von den Energieverbrauchern aufzubringen sind.
„Die Sorge ist groß, dass die durchaus üppigen Budgetmittel im EAG zu signifikanten Zusatzbelastungen für Haushalte und Betriebe führen könnten. Tatsächlich dürften sich die energiebezogenen Ausgaben mittelfristig erhöhen-,“ so Rechtsanwalt Florian Stangl im Standard am 2. August 2021.
Als ob damit die heimische Bevölkerung nicht schon genug belastet wäre, hat die türkis-grüne Bundesregierung mit der kürzlich präsentierten „ökosozialen“ Steuerreform bewiesen, dass sie vor weiteren enormen Belastungen für die Österreicherinnen und Österreicher nicht zurückschreckt:
So werden sich die Kosten für das Heizen massiv weiter erhöhen.
Denn allein die CO2-Steuer, die ab Mitte des Jahres 2022 Treibstoffe, Öl und Gas verteuern wird, wird in weiterer Folge das Heizen für viele Menschen unleistbar machen.
Herbert Lechner von der Energieagentur rechnet damit, dass Bewohner von Einfamilienhäusern, die beispielsweise mit Gas heizen, dann mit Mehrkosten von 220 Euro rechnen müssen. Jene, die mit Öl heizen, müssen sogar 290 Euro zusätzlich bezahlen.
Der in diesem Zusammenhang in Aussicht gestellte Klimabonus in der Höhe von 100 bis 200 Euro jährlich kann vor dem Hintergrund dieser auf die Österreicherinnen und Österreicher zukommenden Teuerungen wohl nur als blanker Hohn bezeichnet werden und deckt die von der türkis-grünen Bundesregierung zusätzlich verursachten Mehrkosten für Energie, Heizen und vor allem Treibstoffe bei weitem nicht ab.
Diese Teuerungen stellen zudem eine große Bedrohung für den wirtschaftlichen Aufschwung dar, wie der Standard in seiner Ausgabe vom 18. September 2021 berichtet:
„Die gestiegenen Energiekosten belasten zunehmend auch die wirtschaftliche Erholung nach dem Corona-Schock. In Großbritannien hat etwa ein Düngemittelhersteller erste Fabriken geschlossen, weil sich die Produktion bei dem hohen Gaspreis nicht lohne. In mehreren Ländern will die Politik nun durchgreifen. In Spanien wurde diese Woche per Dekret ein Dringlichkeitsprogramm zur Senkung des Strompreises verabschiedet, weil seit dem Frühsommer der Strompreis unaufhörlich steigt. Eine Megawattstunde kostet mittlerweile bereits 172 Euro, im Mai waren es im Schnitt noch 65 Euro. Von Jänner bis Mitte September schoss die Stromrechnung für spanische Endverbraucher um 34,9 Prozent nach oben. (…)
Laut einer Schätzung der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) dämpfen diese Effekte den Anstieg der österreichischen Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal um 0,3 bis 0,4 Prozentpunkte und im dritten Quartal um 0,2 Prozentpunkte. In absoluten Zahlen ausgedrückt summiert sich der Verlust im zweiten und dritten Quartal auf rund eine Dreiviertelmilliarde Euro.“
Gerade die Haushalte mit geringen Einkommen werden in der bevorstehenden kalten Jahreszeit durch die steigenden Energiekosten und die die Teuerung anfeuernden Maßnahmen durch die Bundesregierung am stärksten belastet.
„Die Entwicklung effektiver Konzepte zur Bekämpfung der sich mit steigenden Strom- und Gaspreisen verschärfenden Energiearmut steht noch am Anfang.“ (Florian Stangl im Standard am 2. August 2021)
Daher ist es dringend an der Zeit, dass diese Bundesregierung nicht nur endlich von weiteren Belastungsmaßnahmen, die das Leben der Österreicherinnen und Österreichern weiter verteuern, Abstand nimmt, sondern umgehend effektive Maßnahmen setzt, um Energiearmut in Österreich wirksam zu verhindern.
Es muss mit allen Mitteln verhindert werden, dass Haushalte, Familien, Alleinerzieher, Pensionisten, Arbeitslose etc. mit geringen Einkommen Gefahr laufen, aufgrund der gestiegenen Energiepreise ihre Strom- und Gasrechnungen nicht mehr zahlen zu können und in der Folge in ungeheizten Wohnungen sitzen.
Dies insbesondere auch vor dem Hintergrund der massiven und zum Teil drastischen finanziellen Einschnitte, die die heimische Bevölkerung infolge von enorm gestiegener Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit etc. aufgrund der Corona-Maßnahmen in Kauf nehmen mussten, wie dies auch im gegenständlichen Bundesrechnungsabschluss 2020 zum Ausdruck kommt:
„Das Finanzjahr 2020 stand im Zeichen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID–19–Pandemie. (…) Das reale BIP verzeichnete einen Rückgang von 6,6 %, die Arbeitslosigkeit betrug 9,9 %.
(…)
Im Jahr 2020 betrug der reale Rückgang im Produzierenden Bereich 5,8 %, während der Dienstleistungsbereich um 6,7 % schrumpfte. Die Herstellung von Waren brach mit 7,2 % ähnlich stark ein wie die Energiewirtschaft mit 7,7 %.
Bei den Dienstleistungsbranchen waren die Beherbergung und Gastronomie mit -35,2 % sowie die Kultur–, Unterhaltungs– und persönliche Dienstleistungsbranche mit -19,6 % sowie die Verkehrsdienstleistungen mit -15,5 % am stärksten vom Konjunktureinbruch betroffen. Der Handel als wichtigste Dienstleistungsbranche schrumpfte 2020 real um 5,6 %.
Die Nachfrage nach Anlagegütern verzeichnete 2020 einen deutlichen realen Rückgang um 4,9 %, wobei insbesondere die Nachfrage bei den Fahrzeuginvestitionen (-14,2 %) und den Maschineninvestitionen (-12,1 %) stark zurückging.
Die Konsumausgaben der privaten Haushalte gingen um 9,8 % zurück, während die Konsumausgaben des Staates – aufgrund des Erwerbs von Gütern zur Eindämmung der COVID–19–Pandemie – um 0,8 % wuchsen.
Die Warenexporte und –importe gingen real um 6,9 % bzw. 7,4 % zurück. Auch hier war die Dienstleistungsbranche durch die Einschränkungen im Reiseverkehr besonders stark betroffen.“
Aus Sicht der unterfertigten Abgeordneten ist daher vor dem Hintergrund dieser dramatischen wirtschaftlichen Entwicklungen umgehend ein Fördermodell zu entwickeln, das garantiert, dass Haushalte, Familien, Alleinerzieher, Pensionisten, Arbeitslose etc. mit geringen Einkommen, die Gefahr laufen, aufgrund der gestiegenen Energiepreise ihre Strom- und Gasrechnungen nicht mehr zahlen zu können, jedenfalls ständig über eine gesicherte Strom- und Gasversorgung verfügen und ihre Wohnungen entsprechend heizen können.
Darüber hinaus sind als eine weitere dringende Maßnahme die Energieversorgungsunternehmen, an denen die öffentliche Hand beteiligt ist, aufgefordert, die Energiepreise einzufrieren und jedenfalls nicht zu erhöhen.
In diesem Zusammenhang stellen die unterfertigten Abgeordneten daher nachstehenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, umgehend ein Fördermodell zu entwickeln, das garantiert, dass Personen und Haushalte, die aufgrund der gestiegenen Energiepreise ihre Strom- und Gasrechnungen nicht mehr zahlen können, jedenfalls über eine gesicherte Strom- und Gasversorgung verfügen und ihre Wohnungen entsprechend heizen können.
Die Bundesregierung wird weiters aufgefordert, im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf die heimischen Energieversorgungsunternehmen, an denen die öffentliche Hand beteiligt ist, entsprechend einzuwirken, dass diese von Strom- und Gaspreiserhöhungen jedenfalls Abstand nehmen.“
*****
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Der Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht, ausreichend unterstützt und steht somit in Verhandlung.
Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Taschner. Bei ihm steht das Wort. – Bitte sehr, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Mag. Dr. Rudolf Taschner (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Das Budget des Jahres 2020 stand unter dem Schatten eines tatsächlich epochalen Ereignisses, der Coronakrise. Es ist wirklich so, dass die internationalen Fachleute der Ökonomie, aber auch die Fachleute hier in unserem Lande gesagt haben, dass es beeindruckend ist, mit welcher Zielstrebigkeit, mit welchem Mut, aber auch mit welchem Verantwortungsbewusstsein hier auf finanzieller Basis entgegengehalten werden konnte, sodass Österreich diese Krise auch ökonomisch wunderbar bewältigt hat.
Es wurde tatsächlich viel Geld in die Hand genommen, so sagt man. 40 Milliarden Euro sind zur Verfügung gestellt worden, sind ausbezahlt oder versprochen worden. Nun haben wir also diese 40 Milliarden Euro in die Hand genommen, das heißt, man hat Schulden gemacht. Ja, es gab vor einer Woche einen brillanten Artikel in der „Neuen Zürcher Zeitung“ von Michael Ferber, „Geld aus dem Nichts [...]“, so war der Titel, ein Teil des Titels, dieses Artikels. „Geld aus dem Nichts“ – das spielt darauf an, dass man einfach Geld drucken kann, Geld drucken gleichsam ohne Deckung, Geld drucken dadurch, dass man sagt: Ja, das ist von der Zentralbank einfach ausgegeben, und das wird schon gehen, denn wir haben eine neue Theorie, die Modern Monetary Theory; das läuft, Geld können wir einfach drucken, ohne uns über die Konsequenzen Gedanken machen zu müssen! – Michael Ferber glaubt in diesem Artikel, dass das vielleicht nicht richtig ist. Der vollständige Titel des Artikels lautet nämlich: „Geld aus dem Nichts – doch gratis ist es nicht“. Irgendwie muss das zurückgezahlt werden können, irgendwie müssen diese Schulden beglichen werden können.
Nun sehe ich im Wesentlichen drei Wege, wie man diesem Problem begegnen kann. Es ist ein Problem; es ist keine Herausforderung, es ist wirklich ein Problem. Ob wir es
lösen, weiß ich nicht, aber wir werden ihm wenigstens begegnen können – ich glaube, man muss da ein bisschen bescheidener sprechen. Wie können wir aber diesem Problem begegnen?
Die erste Methode – und ich fürchte, sie wird von manchen Staaten genommen werden – ist: Man macht nichts – in der Hoffnung, dass die Modern Monetary Theory greift. Ich fürchte, dass dies – sogar schon mittelfristig – unter Umständen zu schwersten Verwerfungen führt, und es könnte sein, es könnte tatsächlich sein, dass wir Währungsreformen erleben. Das wäre wirklich fürchterlich. Diese Methode sollte man also abschlägig behandeln.
Der zweite mögliche Weg wäre, zu sagen: Nun gut, dann müssen wir schwere Einsparungen treffen! – Es wird dann Askese gepredigt, man muss den Wohlstand dann leider senken. Auch diese Methode können wir uns und wollen wir uns nicht leisten, schon allein um den sozialen Frieden zu bewahren. Das geht auch nicht, also bleibt eigentlich nur ein dritter Weg.
Der dritte Weg, der bleibt – und ich glaube, den beschreiten wir hier und den werden wir auch mit dem Budget, das morgen besprochen wird, weiter fundieren –, besteht darin, dass wir Produktivität fördern. Das bedeutet, dass dadurch mehr Geld als Gewinn in Umlauf kommt. Gewinn ist kein böses Wort, Frau Kollegin Herr, Gewinn ist wichtig, denn Gewinn bringt uns auch wirklich in die Lage, dass wir die Schulden senken können. Wir sind ja jetzt auf über 83 Prozent, und wir werden, wenn wir tatsächlich mit diesem Wirtschaftswachstum reingehen, innerhalb eines Bereiches von fünf bis sechs Jahren bis auf die Größenordnung von 70 Prozent hinunterkommen. Das ist auch noch nicht das, was vorgeschrieben ist, aber wenn wir die anderen europäischen Länder betrachten, sind wir da wirklich sehr gut. – Das also ist die Methode.
Wie werden wir dieses Wirtschaftswachstum in Gang setzen? – Es gibt die Möglichkeit, dass man sagt, wir werden das durch staatliche Eingriffe machen, indem wir die Staatswirtschaft lenken – Herr Kollege Angerer, zum Beispiel dieser Antrag, den Sie da eingebracht haben, geht schon in diese Richtung (Heiterkeit der Abg. Künsberg Sarre): Man hat dafür zu sorgen, der Staat hat dafür zu sorgen! –, oder wir machen es ordoliberal, indem wir sagen, wir schaffen den staatlichen Rahmen und lassen die Wirtschaft wirklich wachsen. Wir nehmen natürlich auch all diese Hemmungen, die existieren – da hat Kollege Angerer durchaus recht, wir versuchen diese Hemmungen zu reduzieren –, damit die Wirtschaft wachsen kann.
Das wird aber wirklich, glaube ich, unser Ziel sein, und ich hoffe, dass wir mit diesem Ziel diesen dritten Weg gehen können (Abg. Loacker: ... 30 Jahre ...!), den dritten Weg, der dann in die Zukunft führt. Herr Kollege Loacker, ich glaube, das könnte uns wirklich aus dieser Krise führen. Wir sind immer in der Krise, aber wir kommen aus dieser einen Krise in die andere, bessere Krise hinein (Heiterkeit des Abg. Loacker), und darauf freue ich mich. – Danke vielmals. (Beifall bei der ÖVP.)
11.46
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordnete Doppelbauer. – Bitte sehr.
Abgeordnete Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer (NEOS): Herr Präsident! Frau Präsidentin des Rechnungshofes! Herr Finanzminister! Mitglieder der Bundesregierung! Hohes Haus! Zu Beginn möchte ich mich, wie auch meine Vorredner, beim Rechnungshof für die Erstellung des Bundesrechnungsabschlusses bedanken. Diese ist wie immer in hoch qualitativer Arbeit erfolgt – von uns wirklich sehr geschätzt, wie immer. Ich möchte nur gleich auch ausführen, warum wir dem Ganzen trotzdem nicht zustimmen können. Es geht uns vor allem um drei Punkte:
Das Erste ist, dass die Steuergelder letztendlich im letzten Jahr sehr intransparent vergeben worden sind. Im Kern sind zum Beispiel allein über die Cofag 9 Milliarden Euro ausbezahlt worden, vollkommen ohne parlamentarische Kontrolle, und – das möchte ich auch noch dazusagen – ohne dass die Unternehmerinnen und Unternehmer einen Bescheid bekommen, also ohne Rechtssicherheit. (Beifall bei den NEOS.)
Der zweite Grund, warum wir nicht zustimmen können, ist: weil sich die Regierung weigert, die Wirksamkeit der Steuergelder, die da eingesetzt worden sind, zu evaluieren. Ich finde es schön, wenn sich hier alle, vor allem die Mitglieder der Bundesregierung, hinstellen und behaupten, die Gelder seien so wirksam gewesen. Das wissen wir nicht, es gibt nämlich keine Evaluierung, und alle Anträge, die ich dazu gestellt habe, werden vom Tisch gewischt. Ich finde das wirklich irritierend.
Der dritte Punkt ist, dass der Rechnungsabschluss in Österreich – und das ist ein Novum – von der Präsidentin des Rechnungshofes präsentiert wird. Wir finden das nicht gut. International gesehen ist es so, dass derjenige, der das Budget verantwortet, das Budget am Jahresende auch präsentiert, und das wäre der Herr Finanzminister; wir haben das schon mehrmals angesprochen. Das wäre auch die Empfehlung, die von vielen Expertinnen und Experten gekommen ist. In Österreich ist das nach wie vor nicht umgesetzt. Wie gesagt, aus der Wirtschaft kommend finde ich das wirklich irritierend, und ich freue mich sehr, wenn wir das vielleicht im Rahmen einer Haushaltskorrektur oder der neuen Haushaltsplanung ändern werden.
Weil wir heute ja schon einiges zum Budget gehört haben – der Finanzminister hat ja seine Budgetrede gehalten –, möchte ich mich auch dazu äußern und zu Wort melden: Was mich wirklich überrascht hat, als ich mir das Budget gestern am Abend angeschaut habe, ist, dass sich der Herr Finanzminister vom konsolidierten Budgetpfad wirklich verabschiedet hat. Wenn man sich das Budget anschaut, dann geht man nicht davon aus, dass bis zum Jahre 2025 wieder ausgeglichen budgetiert wird. Die Schweizer schaffen das übrigens schon nächstes Jahr.
Unsere erste Analyse nach gestern Nacht lautet also jedenfalls: Das Schuldenmachen auf Kosten der nächsten Generationen geht uneingeschränkt weiter. Die Impulse für die Jungen fehlen. Zum Beispiel im Bildungsbereich oder auch beim Ausbau der Kinderbetreuung hat sich nichts getan, zumindest ist es in diesem Budget nicht ablesbar. Dass die Lohnnebenkosten nicht angegriffen worden sind, dass vor allem der Mittelstand unter diesen in Österreich sehr, sehr hohen Lohnnebenkosten leidet, auch das wird sich nicht ändern, auch das ist im Budget nicht ablesbar, und dass der Mittelstand die Melkkuh der Nation bleibt, weil die kalte Progression wieder nicht abgeschafft wird, ist darin ebenfalls festgeschrieben.
Ich möchte aber aus aktuellem Anlass noch auf zwei Dinge eingehen, die mich wirklich wütend machen. Wir haben in den letzten Tagen schwarz auf weiß gelesen, dass die Prätorianer rund um Sebastian Kurz im Wahljahr 2017 zwei Projekte wirklich zerschossen haben. Zum einen ging es um den Rechtsanspruch auf Gratiskinderbetreuung am Nachmittag, dotiert mit 1,2 Milliarden Euro, eine ganz wichtige Maßnahme, die wir NEOS auch schon seit Anbeginn fordern. Das ist nicht passiert. Zum Zweiten hatten Christian Kern und Reinhold Mitterlehner die so wichtige Abschaffung der kalten Progression schon beschlossen. Auch die ist nicht gekommen.
Ich möchte es noch einmal erklären, weil Kollege Hanger – ich weiß nicht, ob er jetzt noch da ist – offenbar nicht ganz verstanden hat, worum es da eigentlich geht: Die kalte Progression entsteht, wenn die Besteuerung von Einkommen aus Arbeit nicht an den Wertverlust durch die Inflation angepasst ist. Wenn nun behauptet wird, das sei nur für die hohen Einkommen relevant, dann ist das schlicht und einfach falsch.
Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben: Eine Person mit einem Medianeinkommen, 3 200 Euro im Monat, circa 45 000 Euro im Jahr, hat seit 2016 circa 1 550 Euro wegen
der kalten Progression verloren. Das heißt, die sind weg. Jetzt werden über die nächsten drei Jahre zwar 1 100 Euro zurückbezahlt, daneben geht aber die kalte Progression lustig weiter, weil sie ja nicht abgeschafft worden ist. Dass Sie sich hierherstellen, ohne zu sagen, dass die kalte Progression eine unglaubliche Auswirkung auf die Einkommen der Menschen in Österreich hat, finde ich fast schon skandalös.
Jetzt komme ich wieder auf das zurück, was mich wirklich wütend macht: Es war ja eigentlich ausgemacht, dass das passiert. Es ist aber nicht passiert. Warum ist es nicht passiert? – Weil ein türkiser Zirkel beschlossen hat, an die Macht zu wollen, und es nicht dazugepasst hat.
Wenn Sie das immer noch nicht glauben, meine Damen und Herren, die Sie hier zusehen, machen Sie sich bitte selbst ein Bild: Lesen Sie sich diese 104 Seiten durch und ziehen Sie Ihre eigenen Schlüsse! Das Ergebnis jedenfalls ist, dass die kalte Progression auch vier Jahre später nicht abgeschafft ist und es noch immer keinen Rechtsanspruch auf Gratiskinderbetreuung am Nachmittag gibt.
Ich bringe deswegen folgenden Antrag ein:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Kalte Progression JETZT abschaffen!“
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Finanzen, wird aufgefordert, dem Nationalrat umgehend eine Regierungsvorlage vorzulegen, die die Kalte Progression abschafft, indem die Steuer-Tarifstufen des § 33 Abs. 1 EStG 1988 an die Inflation gekoppelt werden.“
*****
Vielen Dank. (Beifall bei den NEOS.)
11.52
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer, Kolleginnen und Kollegen
betreffend Kalte Progression JETZT abschaffen!
eingebracht im Zuge der Debatte in der 125. Sitzung des Nationalrats über Bundesrechnungsabschluss 2020 – TOP 2
Die versteckte Steuererhöhung
Die Kalte Progression, also die versteckte jährliche Steuererhöhung, entsteht, weil die Einkommen zwar Jahr für Jahr steigen, die Steuerstufen aber nicht an die Inflation angepasst werden. Somit erhöhen sich der Durchschnittssteuersatz und die Steuerschuld stärker als die Inflation. Die Kalte Progression betrifft also alle Lohnsteuerpflichtigen und, entgegen der gängigen Auffassung, nicht nur jene, die aufgrund der Inflationsabgeltung in die nächst höhere Steuerstufe rutschen. Wenn der Bruttolohn steigt, steigt auch der Durchschnittssteuersatz – jener Anteil des Einkommens, der an den Finanzminister geht,
nimmt also zu. Sie entsteht, sobald das zu versteuernde Einkommen einer Person an die Inflation angepasst wird und in der Folge zumindest den ersten Grenzsteuersatz überschreitet.
Entlastung aufgehalten, versprochen und doch nicht umgesetzt
Die Bundesrechenabschlüsse der letzten Jahre zeichnen ein genaues Bild von der außergewöhnlich hohen Abgabenbelastung in Österreich. Dieser Antrag setzt daher einen wichtigen Markstein für eine nachhaltige Entlastung der Steuerzahler_innen. Mehrfach haben sich Bundesregierungen an die Abschaffung der Kalten Progression versucht. Aktuell bekannt gewordene Akten zeigen auf, dass es bereits 2016 unter der Bundesregierung von Bundeskanzler Kern (SPÖ) und Vizekanzler Mitterlehner (ÖVP) Bestrebungen gab, die Kalte Progression abzuschaffen. Wie nun bekannt ist, intervenierten 2016 einzelne Mitglieder der Bundesregierung und deren Umfeld, wie der spätere Mitterlehner-Nachfolger und der damalige Generalsekretär im Finanzministerium Schmid, um diese wichtige Reform aufzuhalten. Vor der Nationalratswahl 2017 hatten sowohl ÖVP als auch FPÖ die Abschaffung der Kalten Progression angekündigt, vor der letzten Wahl 2019 versprachen dies dann alle Parteien ausdrücklich. Im ausverhandelten Regierungsprogramm der ÖVP und der Grünen fehlt wieder das volle Bekenntnis zum parteiübergreifenden Versprechen aus dem Wahlkampf 2019.
Selbst bezahlte Steuerreform statt versprochener Entlastung für Österreichs Steuerzahler_innen
Am 3. Oktober 2021 präsentierte die Bundesregierung ihren Entwurf einer Steuerreform. Von der größten Entlastung der Steuerzahler_innen in der zweiten Republik war die Rede und dennoch hielt die Bundesregierung entgegen eigener Zusagen an der Kalten Progression fest. Der Effekt für das Budget ist nämlich zu bedeutsam. Pro Prozentpunkt Inflation fließen rund 250 Millionen Euro ins Budget, hat der ehemalige Finanzminister Hartwig Löger einmal vorgerechnet. In den letzten Jahren haben die Menschen in Österreich sich die groß angekündigte Entlastung somit selbst finanziert. Nach Berechnungen von NEOS belaufen sich die Mehreinnahmen durch die Kalte Progression zwischen dem Jahr 2013 und 2023 auf rund 11,88 Milliarden Euro. Das Institut EcoAustria schätzt, dass die Kalte Progression ohne Steuerreform zwischen 2019 und 2025 zu einer zusätzlichen Steuerbelastung von insgesamt 19,5 Milliarden Euro führen würde. Anhand einzelner Beispiele lässt sich dies ebenfalls aufzeigen: Eine Beraterin in einer Kreativagentur mit einem Gehalt von 55.000 Jahresbrutto gab 2016-2021 insgesamt unbemerkt an den Finanzminister 1527 EUR ab und bekommt dafür im Jahr 2022 eine Entlastung von 325 EUR. Von der Entlastung bleibt ihr also nichts mehr übrig. Im Gegenteil: die Kalte Progression hat 1202 EUR mehr gekostet, als sie bei der Steuerreform 2022 wieder zurückbekommt.
Abbildung 1 image2021-10-11_12-15-25.png
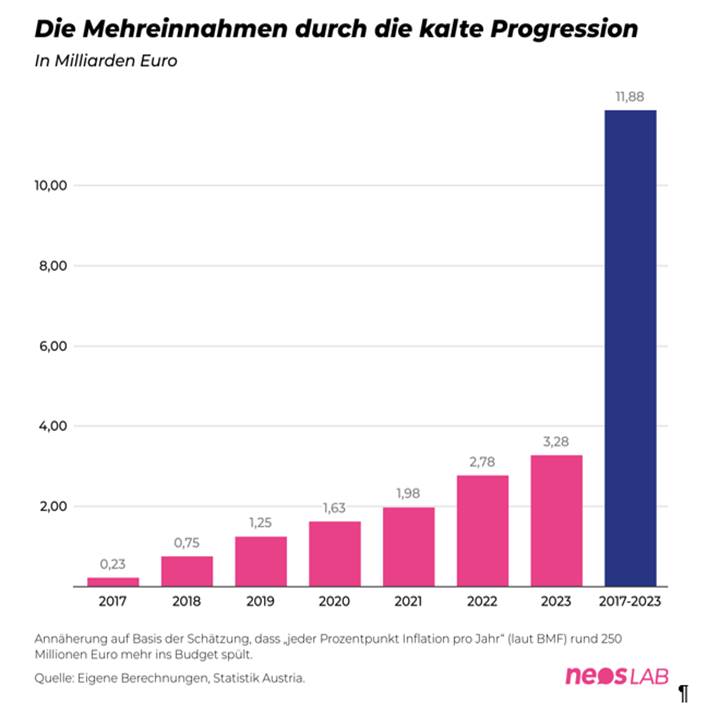
Versprechen ernst nehmen und Kalte Progression abschaffen
Damit nicht jede Regierung aufs Neue die größte Steuerreform aller Zeiten beschließen muss, sollte endlich die Kalte Progression dauerhaft abgeschafft werden. Die Steuerstufen müssen daher automatisch mit der Inflation angehoben werden. Nur so können Entlastungsmaßnahmen eine nachhaltige Wirkung entfalten und Gehaltserhöhung würden in erster Linie jenen zugutekommen, die sich die Gehaltserhöhung mit ihrem Einsatz erarbeitet haben. Jetzt ist der Finanzminister der größte Profiteur, ohne dafür eine Mehrleistung erbringen zu müssen. Bisher war die Möglichkeit, im regelmäßigen Abstand mit vermeintlichen Entlastungen prahlen zu können, für bisherige Bundesregierungen zu verlockend. Zuletzt sagte ÖVP-Parteiobmann Kurz eine Abschaffung für das Ende der Legislaturperiode zu. Angesichts der aktuell innenpolitisch instabilen Lage und der bereits im Wahlkampf 2019 von allen im Nationalrat vertretenen Parteien zugesagten Entlastung sollte diese dringende Reform vorgezogen und unverzüglich umgesetzt werden.
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
"Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Finanzen, wird aufgefordert, dem Nationalrat umgehend eine Regierungsvorlage vorzulegen, die die Kalte Progression abschafft, indem die Steuer-Tarifstufen des § 33 Abs. 1 EStG 1988 an die Inflation gekoppelt werden."
*****
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Der Entschließungsantrag ist ausreichend unterstützt, ordnungsgemäß eingebracht und steht daher mit in Verhandlung.
Zu Wort gemeldet ist die Frau Präsidentin des Rechnungshofes. – Bitte sehr.
Präsidentin des Rechnungshofes Dr. Margit Kraker: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Hohes Haus! Geschätzte Damen und Herren Abgeordnete! Heute stehen einerseits die Budgetrede des Herrn Bundesfinanzministers, also die Rede über die budgetpolitischen Schwerpunkte der Zukunft, und andererseits der Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2020 auf der Tagesordnung.
Der Rechnungshof ist gemäß der Bundesverfassung verpflichtet, den Bundesrechnungsabschluss jährlich bis Ende Juni des Folgejahres vorzulegen. Der Ihnen zur Verfügung stehende Bundesrechnungsabschluss ist ein umfassendes Zahlenwerk – mit den Istzahlen, den Ergebnissen und Abschlusszahlen, für das Jahr 2020 –, das gleichzeitig auch Ausgangspunkt für die kommenden Jahre ist. Er bietet einerseits einen Rückblick auf die Zahlen, das Defizit, die Neuverschuldung im Jahr 2020, andererseits wird das Ergebnis des Abschlusses 2020 natürlich auch Auswirkungen auf künftige Budgets haben – etwa wenn wir sehen, dass wir im Jahr 2020 eine Neuverschuldung, ein Defizit von 8,9 Prozent hatten.
Der Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2020 muss natürlich im Lichte der Coronakrisenbewältigung gesehen werden, das hat auch der Rechnungshof so getan. Wir haben in diesem Rechnungsabschluss aufgezeigt, welche Hilfsmaßnahmen gesetzt wurden, etwa im Wege des Krisenbewältigungsfonds, und wir haben auch Prüfungshandlungen im Zusammenhang mit dem Covid-19-Krisenbewältigungsfonds gesetzt.
Der Rechnungshof hat immer anerkannt, dass es ein Gebot der Stunde ist, in der Krise zu unterstützen, aber natürlich ist es Rolle und Aufgabe des Rechnungshofes, derartige Hilfspakete in der Folge sowohl systematisch als auch inhaltlich zu prüfen. Das gehört zum Thema Transparenz und Kontrolle, und der Rechnungshof verlangt ja Kostentransparenz in allen staatlichen Bereichen.
Ich möchte kurz auf die wirtschaftliche Entwicklung und die Arbeitsmarktlage des Jahres 2020 eingehen. Es war so, dass die Grundlagen sich verändert haben – das BIP ging um 6,6 Prozent zurück, die Arbeitslosigkeit stieg um 9,9 Prozent an –, weshalb der Bund folgende finanzielle Hilfsmaßnahmen setzte: Insgesamt wurden 31,8 Milliarden Euro für Covid-19-Maßnahmen genehmigt, davon gelangten 14,5 Milliarden Euro zur Auszahlung, und es gab 6,4 Milliarden Euro Mindereinzahlungen in den Bundeshaushalt. Vom Covid-19-Haftungsrahmen in Höhe von 10,4 Milliarden Euro wurden 6,5 Milliarden Euro ausbezahlt, dieser wurde also zu knapp zwei Drittel ausgeschöpft.
Der Krisenbewältigungsfonds, der mit 28 Milliarden Euro dotiert war, stellte das zentrale Instrument dar, um den einzelnen Ressorts innerhalb des Bundes die finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Ressorts haben 11,4 Milliarden Euro abgerufen, und davon gelangten 8,5 Milliarden Euro zur Auszahlung. Aus der variablen Gebarung für die arbeitsmarktpolitischen Leistungen wurde die Coronakurzarbeit im Ausmaß von 5,5 Milliarden Euro finanziert. Alle Maßnahmen standen einzelnen gesellschaftlichen Gruppen
zur Verfügung, die zu unterstützen waren. Das Nettoergebnis wies im Jahr 2020 ein Minus von 23,6 Milliarden Euro auf, das war ein hoher negativer Wert, allerdings gab es 2019 einen Überschuss, ein Plus von rund 0,8 Milliarden Euro.
Der Nettofinanzierungssaldo lag bei minus 22,5 Milliarden Euro, und für 93 Prozent davon waren Covid-19-Maßnahmen verantwortlich. Das ohnehin schon negative Nettovermögen hat sich um 25 Milliarden Euro auf minus 175,4 Milliarden Euro erhöht. Der Stand der bereinigten Finanzschulden des Bundes belief sich im Jahr 2020 auf 238 Milliarden Euro und war damit um 29,2 Milliarden Euro höher als 2019. Damit war der Anstieg innerhalb eines Jahres – ein Plus von 14 Prozent – so hoch wie der in den vorangegangenen acht Jahren zusammengenommen. Gesamtstaatlich hat Österreich im Jahr 2020 ein Defizit von 8,9 Prozent des BIP erzielt, der Schuldenstand stieg durch diese Maßnahmen auf 83,9 Prozent des BIP an. Mittlerweile liegt der öffentliche Schuldenstand noch höher, Mitte des Jahres bei lag er bei rund 86,2 Prozent.
Der Rechnungshof hat den Covid-19-Krisenbewältigungsfonds geprüft. Dabei ging es um dessen rechtliche Einordnung in den Bundeshaushalt, um die Zahlungsflüsse. 8,5 Milliarden Euro wurden davon ausbezahlt, die Hälfte davon ging an die Covid-19-Finanzierungsagentur des Bundes, an die Cofag. Ich habe bereits im Budgetausschuss gesagt, dass der Rechnungshof, der die Cofag prüfen kann, eine Gebarungsüberprüfung vornimmt, die schon im Laufen ist.
Die über den Covid-19-Krisenbewältigungsfonds vergebenen Mittel konnten nachverfolgt werden. Gleichzeitig ist es so, dass auch zusätzliche Mittel aus den einzelnen Ressortbudgets verausgabt wurden, die aber nicht, wie es sich der Rechnungshof gewünscht hätte, verpflichtend gekennzeichnet waren.
Wir haben bereits im Juni festgestellt, dass es für die Zukunft wichtig ist, dass man entlang der Entwicklung der Coronapandemie, postpandemisch und auch der wirtschaftlichen und konjunkturellen Entwicklung entsprechend, wieder nachhaltig agiert. Wir brauchen eine haushaltspolitische Strategie, die nachhaltig wirksam ist. Dazu gehört natürlich auch – das hat der Rechnungshof in den vergangenen Jahren schon gesagt, und wir haben auch einzelne Prüfungen zum Haushaltsrecht insgesamt gemacht – eine transparente Budgetierung im Sinne des Haushaltsrechts sowie eine Weiterentwicklung des Haushaltsrechts selbst. Es wurde schon angesprochen: Da geht es etwa um die Frage, wer den Abschluss macht, aber es gibt auch andere Themen, etwa im Bereich der Rücklagen, et cetera.
Das muss man dann einmal angehen, auch eine zeitnahe Evaluierung der gesetzten Maßnahmen im Hinblick auf die Wirksamkeit. Es geht zukünftig um die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen, es geht um Reformen im Sinne der Generationengerechtigkeit, insbesondere erwähne ich hier noch den Pflegebereich, auch Pensionen wurden angesprochen, und den Bildungsbereich. Die Digitalisierung soll dazu führen, dass Verwaltung neu gedacht und das auch entsprechend umgesetzt werden kann. Und natürlich geht es um konsequente Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele.
Wie gesagt, der Rechnungshof geht davon aus, dass langfristiges Denken wichtig ist, dass es um eine nachhaltig wirksame Haushaltsstrategie des Bundes geht, und es geht uns auch um eine zielgerichtete Verwendung der Mittel der europäischen Aufbau- und Resilienzfazilität; auch das wird aus Sicht des Rechnungshofes wichtig sein. – Ich danke für die Aufmerksamkeit. (Beifall bei der ÖVP sowie bei Abgeordneten von SPÖ, Grünen und NEOS.)
12.00
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordnete Baumgartner. – Bitte.
12.01
Abgeordnete Angela Baumgartner (ÖVP): Herr Präsident! Herr Finanzminister! Frau Rechnungshofpräsidentin! Die Frau Rechnungshofpräsidentin hat es gerade gesagt: Der Bundesrechnungsabschluss 2020 stand ganz im Zeichen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie und deren Auswirkungen. (Präsidentin Bures übernimmt den Vorsitz.)
Im Finanzjahr 2020 ist das Defizit auf 22,48 Milliarden Euro und die Staatsschuldenquote auf 83,9 Prozent gestiegen. Gesamtstaatlich erzielte Österreich ein Defizit von 8,9 Prozent. 2019 hatten wir noch einen Überschuss erzielt, erstmals seit 1954. Corona hat die Vorzeichen leider geändert. Die Pandemie und ihre unmittelbaren Auswirkungen auf die Menschen und unsere Wirtschaft mussten abgefedert werden. Das konnte in einer nicht abzusehenden Gesundheits- und Wirtschaftskrise recht gut und ordentlich gemacht werden. Die Regierung unter der Führung der ÖVP hat bewiesen, dass für die Menschen im Land Antworten und Lösungen gesucht wurden. Die notwendigen und vom Covid-Krisenbewältigungsfonds finanzierten Maßnahmen summierten sich auf 8,5 Milliarden Euro. Steuererleichterungen führten zu Mindereinnahmen im Ausmaß von 6,4 Milliarden Euro. 5,5 Milliarden Euro an Coronakurzarbeitshilfen wurden ausbezahlt.
Die Cofag wird – ich möchte darauf eingehen – von der Opposition immer wieder kritisiert. Ich verstehe das wirklich nicht. Die Homepage ist für jeden einsehbar, sie ist transparent, und dort werden alle Unterstützungsleistungen veröffentlicht. Hilfen ab 100 000 Euro werden zusätzlich in die europäische Transparenzdatenbank eingepflegt und dort erfasst. Ebenfalls werden von der Cofag die Berichtspflichten gegenüber dem Bundesministerium für Finanzen erfüllt, und das Ministerium wiederum übermittelt diese Berichte zur Kontrolle an das Parlament.
Weil Kollege Fuchs – er ist jetzt nicht da – gesagt hat, dass die Cofag praktisch eine „Blackbox“ ist: Die Cofag ist keine Blackbox. Da sitzen Sozialpartner drinnen, das ist keine Blackbox, sondern da sind auch ÖGB und AK, auch Experten drinnen. Ich weiß nicht, was das alles immer soll, warum die Cofag da immer kritisiert wird. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
Wir sehen, dass die Coronamaßnahmen gegriffen haben: Die Wirtschaft erholt sich, die Prognosen sind positiv, und das Comeback für Österreich wird gelingen. Wir dürfen den Aufschwung nicht gefährden. Die Wirtschaftszahlen machen Mut, die Arbeitslosenzahlen sinken, und es gibt gleichzeitig ein Rekordhoch an offenen Stellen.
Mit dem von Finanzminister Blümel präsentierten Budget schaffen wir die Grundlage für die dringenden Projekte, die für die Zukunft Österreichs wegweisend sind. Mit der Steuerreform schaffen wir eine Entlastung, die bei den Menschen, in der Wirtschaft und in der Umwelt ankommt. Sie wird nachhaltig Effekte zeigen, den wirtschaftlichen Aufschwung verstärken und unseren Wohlstand mit nachhaltigem Klimaschutz verbinden – 18 Milliarden Euro Gesamtvolumen; Senkung der Tarifstufen, damit sich Arbeit auszahlt; Entlastung der Familien durch die Erhöhung des Familienbonus auf 2 000 Euro pro Kind und die Erhöhung des Kindermehrbetrages auf 450 Euro; Stärkung des Standortes durch Senkung der KöSt; Investitionsfreibetrag inklusive Ökologisierungskomponenten; Klimabonus.
Ökosoziale Marktwirtschaft und ökosoziale Steuerreform, Kontinuität, Stabilität, fortdauernd und zukunftsorientiert – das geht nur mit der Österreichischen Volkspartei! – Danke schön. (Beifall bei der ÖVP. – Zwischenruf des Abg. Deimek.)
12.05
Präsidentin Doris Bures: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Alois Stöger. – Bitte.
Abgeordneter Alois Stöger, diplômé (SPÖ): Frau Präsidentin! Frau Präsidentin des Rechnungshofes! Herr Bundesminister! Hohes Haus! Sehr geehrter Herr Bundespräsident! Der Herr Bundespräsident hat sich am Sonntag für das Bild, das die Politik in Österreich abgibt, entschuldigt. (Abg. Obernosterer: ... Budget sind wir! Jahresabschluss!) – Wir rechnen das Jahr 2020 ab, und daher ist das wichtig.
Das Bild, für das er sich entschuldigt hat, hat nicht die gesamte Politik abgegeben, sondern das Bild, für das er sich entschuldigt hat, haben Kurz und sein türkis-schwarzer Freundeskreis zu verantworten (Beifall bei der SPÖ), nicht die Politiker in den Gemeinden, in den Landtagen, auch nicht hier im Nationalrat, weil eine Mehrheit, eine ganz große Mehrheit aller Politikerinnen und Politiker hier herinnen nicht korrupt ist. Sie engagieren sich dafür, dass es den Menschen in diesem Land besser geht. Genau das nehme ich auch für mich in Anspruch. Ich war neun Jahre lang Regierungsmitglied. Ich habe mich bewusst an solchen Machtspielen nicht beteiligt, ich habe auch nicht bewusst Tabubrüche gegenüber dem Rechtsstaat begangen, und ich habe vor allem nicht die eigene Regierungsarbeit sabotiert. (Beifall bei der SPÖ.)
Bei mir und bei den meisten Politikerinnen und Politikern in Österreich stehen Sacharbeit, Dialog und Konsens im Vordergrund – und dafür braucht man sich nicht zu entschuldigen. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, wollte ich sagen, weil es auch meine Regierungskollegen, mit denen ich in der Regierung gewesen bin, anders gehalten haben. Was da eingetreten ist, ist eine neue Qualität von Politik, die auf Fakenews repliziert, die Unwahrheit zur Wahrheit macht und damit den demokratischen Diskurs in diesem Land verhindert.
Warum sage ich das, wenn wir über das Budget 2020 reden? – Weil diese Inhalte in diesem Budget drinnen sind! Da geht es darum, dass sich Herr Kurz Gelder aus dem Budget geholt hat, die er für Pressearbeit verwenden kann. Wir sagen heute Ja oder Nein zu dieser Politik, und das machen wir – auch – mit diesem Budget.
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es zeigt sich hier schwarz auf weiß, wer die Kosten der Pandemie zu tragen hat. Wenn Sie sich die Zahlen anschauen – danke an den Rechnungshof, Sie haben das sehr klar dargestellt –: Dort, wo die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer etwas bekommen haben, waren das im Wesentlichen die Kurzarbeit und ein bisschen die Erhöhung beim Kinderbonus. Alle anderen Maßnahmen haben sich an die Unternehmen gerichtet, an diese ist das ausgezahlt worden. Das heißt, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Abg. Taschner: ... Kurzarbeit!) – habe ich gesagt, Herr Professor – haben wenig davon gehabt.
Ich frage ganz bewusst in Richtung Sektor der ÖVP, und ich frage auch die Österreicherinnen und Österreicher: Haben Sie schon jemals Körperschaftsteuer gezahlt? Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenn man nie Körperschaftsteuer zahlt, dann kann man von einer Kürzung der Körperschaftsteuer keinen Nutzen haben. Selbst wenn ich in Richtung ÖVP frage: Ich glaube, die meisten von euch haben noch nie Körperschaftsteuer gezahlt, aber ihr würdet diese jetzt reduzieren. – Das kann es nicht sein (Abg. Ottenschläger: ... Arbeitsplätze!), und das zeigt, dass es zu einer klaren Umverteilung von unten nach oben gekommen ist. (Beifall bei der SPÖ.)
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich war ganz überrascht, als ich heute die Budgetrede gehört habe. Der Herr Bundesminister für Finanzen hat keinen Satz zum Kapitel Arbeit gesagt. Er redet zwar von Arbeit und Arbeitslosigkeit, aber wenn es darum geht, wie er das in dem entsprechenden Kapitel abgebildet hat, sagt er wohl deswegen nichts, weil die Mittel dort weniger werden, weil er nichts dafür tut, weil das in diesem Voranschlag einfach nicht abgebildet worden ist. (Beifall bei der SPÖ.)
Jetzt zu den Grünen: Seid mir nicht böse, wenn ich sage, ihr geht den Neoliberalen so auf den Leim, aber richtig auf den Leim! Es können nicht nur die Arbeiter und Angestellten die Klimakrise zahlen. Auch wenn man CO2 besteuert, heißt das nicht, dass CO2 nicht entsteht. Ihr braucht Maßnahmen. Ich unterstütze sie alle, wir müssen etwas tun, dass CO2 nicht mehr entsteht. Es braucht eine Änderung der Produktionsprozesse, es braucht eine Stärkung des öffentlichen Verkehrs, denn dort, wo die Bahn bereits elektrifiziert worden ist, wird weniger CO2 produziert. Also da müssen wir Veränderungen herbeiführen.
Wenn wir die Verkehre für die arbeitenden Menschen verteuern – in der letzten Woche sind die Spritpreise um 20 Prozent oder 15 Prozent angestiegen –, obwohl wir steuerlich noch gar nichts gemacht haben, dann sage ich: Das geht nicht, das können sich die Leute nicht leisten! Daran erkennt man auch, dass alle Leistungen, über die man jetzt im Zuge der Steuerreform redet, von den Menschen in Österreich bezahlt worden sind. (Beifall bei der SPÖ.)
Liebe Grüne, geht den Neoliberalen bitte nicht auf den Leim! Wir brauchen ordnungspolitische Maßnahmen, eine Stärkung des öffentlichen Verkehrs, mehr Geld für den Ausbau – dann können wir das Klima gut schützen.
Wir werden diesem Bundesrechnungsabschluss nicht zustimmen, weil die 1,2 Milliarden Euro – die Herr Kurz verhindert hat – nicht darin enthalten sind. Liebe ÖsterreicherInnen, ihr alle habt das im Jahr 2020 gemerkt, vor allem in der Coronakrise, nämlich dann, wenn ihr für eure Kinder keinen Platz gehabt habt, wenn ihr habt nachfragen müssen, ob die Oma das Kind nimmt, ob ihr es zur Oma geben könnt, damit ihr in die Arbeit gehen könnt. Genau diese Probleme, die ihr da erlebt habt, all diese Probleme sind in dem Budget abgebildet, weil Kurz und Co verhindert haben, dass ihr entsprechende Ausbildungseinrichtungen in den Gemeinden habt.
Darüber werden wir heute abstimmen, und die SPÖ wird dazu keine Zustimmung erteilen. (Beifall bei der SPÖ.)
12.13
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Christoph Stark. – Bitte.
Abgeordneter Christoph Stark (ÖVP): Frau Präsidentin! Herr Finanzminister! Liebe Frau Präsidentin des Rechnungshofes! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Werte Damen und Herren, die Sie diese Sitzung heute verfolgen! Ja, Kollege Stöger hat hier gut unter Beweis gestellt, dass er weder von Wirtschaft noch von der Kinderbetreuung viel Ahnung hat. Herr Kollege Stöger, das, was Sie heute über die KöSt gesagt haben, war eine schallende Ohrfeige für Tausende Klein- und Mittelbetriebe, die Arbeit geben und die auch KöSt bezahlen. Das sollten Sie sich einmal überlegen. (Beifall bei der ÖVP sowie des Abg. Bernhard.)
Zum Zweiten: Die Kinderbetreuung war und ist seit ewigen Zeiten von den Gemeinden organisiert, und das auch während der Krise. Es wäre schön, wenn Sie den Gemeinden einfach Danke sagen, dass sie das auch in der Krise unter schwierigsten Verhältnissen mit Vorkehrungen perfekt getan haben, so es möglich war. Also das hat mit den 1,2 Milliarden Euro rein gar nichts zu tun. (Beifall bei der ÖVP.)
Zum Dritten: Wir sprechen immer noch über den Bundesrechnungsabschluss – was Sie, Herr Kollege Stöger, hier trefflich vermischt haben –, und dieser Bundesrechnungsabschluss ist ein Blick zurück auf das Faktische. Der Rechnungshof zeigt auf, dass eins und eins zwei ist. Wenn man der Opposition zuhört, dann glaubt man, dass eins und eins null oder noch weniger ist – und das ist nicht so.
Meine Damen und Herren! Der Rechnungsabschluss entwirft ein klares Bild von der Zeit unserer größten Krise und lenkt den Scheinwerfer auf diese Zeit. Fakt ist auch – und ich weiß, das können Sie nur mehr schwer ertragen und nicht gut hören –: Wir sind gut durch diese Krise gekommen, meine Damen und Herren! Wir sind gut durch diese Krise gekommen. (Beifall bei der ÖVP.)
Das sagen auch nicht nur wir, das sagt beispielsweise auch die internationale Agentur Bloomberg. Meine Damen und Herren, all jene, die etwas anderes sagen, bezichtigen die Fachleute von Bloomberg der Nackerpatzelei. Ist das Ihre ernst gemeinte Meinung? – Wir liegen europaweit auf Platz drei und weltweit auf Platz fünf, belegt durch die Zahlen, die der Bundesrechnungsabschluss hergibt. Das spricht eine ganz klare Sprache. (Beifall bei der ÖVP. – Zwischenrufe bei der SPÖ.)
Meine Damen und Herren! Wir sind gut durch die Krise gekommen – durch einige Faktoren, die heute schon mehrfach genannt worden sind: durch die Kurzarbeit, durch diverse Hilfen und anderes. Eine kleine Erzählung in diesem Zusammenhang: Ich durfte vor wenigen Tagen einen Kurzausflug nach Italien machen und habe dort mit einer Unternehmerin gesprochen, die ein Tourismusunternehmen mit rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bereich Friaul hat. Wissen Sie, was dieses Unternehmen vom Staat Italien in dieser Zeit bekommen hat? – Das waren einmal 7 000 Euro und Kurzarbeit im Rahmen von 70 Prozent bei einer Auszahlung vier Monate später. Das vergleichen Sie bitte einmal mit den Leistungen, die wir in Österreich haben! Dazu sage ich ganz klar: Da haben ganz viele Menschen einen guten Job gemacht und allen voran unser Herr Finanzminister! (Beifall bei der ÖVP.)
Lenken wir den Blick wieder zurück nach Österreich – und ich spreche jetzt von meiner Heimatregion –: In Stadt und Region Gleisdorf leben rund 20 000 Menschen, und die Arbeitsmarktsituation stellt sich jetzt so dar: Wir haben 600 arbeitslose Menschen, das sind in etwa 3 Prozent, und diesen stehen 1 022 offene Arbeitsstellen gegenüber. Da soll doch bitte noch einmal jemand sagen, die Wirtschaft funktioniere nicht mehr, es gehe allen so schlecht! – Die Wirtschaft springt grandios an! Ich bin dankbar für die Maßnahmen, durch die das gelungen ist. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
Zu guter Letzt, meine Damen und Herren, ein kleiner Ausblick auf das Budget: Es wurden schon viele Fakten genannt, aber ich möchte auch noch ein Faktum anschließen. In der Coronakrise hatten wir, die Bevölkerung in Österreich, einen guten Partner, und das war und ist das österreichische Bundesheer. Das vergessen wir gleich wieder einmal, wenn die Damen und Herren in Grün nicht mehr so oft präsent sind. Ich möchte an dieser Stelle Klaudia Tanner gratulieren, denn auch ihr ist es gelungen, das Budget zum dritten Mal in Folge zu erhöhen. 2022 weist das Budget des Bundesheeres 2,7 Milliarden Euro aus, und das ist die dritte Steigerung in Folge. Das, meine Damen und Herren, sichert eines, nämlich die Stabilität in Österreich – auch durch das österreichische Bundesheer.
Ich freue mich auf eine Steuerreform, die uns weiterbringen wird, und ich gratuliere nochmals allen handelnden Personen. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
12.18
Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Martina Künsberg Sarre. – Bitte.
Abgeordnete Mag. Martina Künsberg Sarre (NEOS): Frau Präsidentin! Frau Rechnungshofpräsidentin! Herr Bundesminister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer! Die ÖVP und die Grünen haben gestern einen Antrag eingebracht, der den Bildungsminister auffordert, die Punkte aus dem Regierungsprogramm umzusetzen. Ich glaube, Sie merken mittlerweile überhaupt nicht mehr, wie lächerlich Sie sich eigentlich damit machen. Sie haben letzte Woche im Unterrichtsausschuss
noch sämtliche Anträge der Opposition, nämlich insbesondere auch die Elementarbildungsthemen betreffend, mit der Begründung, dass eigentlich quasi alles auf dem Weg und in Umsetzung ist, es unsere Anträge eigentlich überhaupt nicht mehr braucht, vertagt. Wenn ich mir jetzt den Bundesrechnungsabschluss anschaue und auch den Blick ins nächste Jahr mache, dann glaube ich, dass es diese Anträge der Opposition sehr wohl braucht. (Beifall bei den NEOS und bei Abgeordneten der SPÖ.)
Wir hören unentwegt von den Grünen, dass durch sie in der Regierung das Thema Bildung einen größeren Stellenwert bekommt. Wir hören gebetsmühlenartig vor allem von den Grünen, aber heute auch vom neuen Elementarbildungsexperten Hanger, wie wichtig ein Ausbau im Bereich Elementarbildung sei und dass ohne die Länder leider, leider, leider nichts weitergehen werde. Wir hören von den Grünen, dass viel Geld in die Hand genommen wird, um eben den Kindergartenbereich auszubauen.
Und was ist? – Uh! Wenn wir uns das Jahr 2022 anschauen, sehen wir: Für den Elementarbildungsbereich sind 142,6 Millionen Euro veranschlagt, das ist exakt der Betrag, den die 15a-Vereinbarung vorsieht, kein Cent mehr.
Liebe Kollegin Hamann, Sie haben letzte Woche im Ausschuss gesagt, dass wir uns überraschen lassen und auf das Budget warten sollen. Das haben wir getan, und wir sind auch sehr überrascht, aber leider nicht positiv, weil da natürlich von einer Steigerung überhaupt keine Rede ist. Wir müssen endlich einmal festhalten, dass es für die Grünen offensichtlich ein Erfolg ist, wenn der Betrag gleich bleibt – das ist schon einmal ein Erfolg gegen die ÖVP oder mit der ÖVP. Und halten wir weiters fest: Die Grünen bringen in der Bildungspolitik einfach nichts zustande. (Beifall bei NEOS und SPÖ.)
Kollegin Plakolm hat gestern gemeint – sie hat ja gestern mit vollem Elan ihren Ex-Kanzler verteidigt –, wir sollten doch nicht immer gegen etwas, sondern für etwas sein.
Ich möchte Ihnen jetzt noch gerne etwas vorlesen, man kann das ja nicht oft genug tun: „1,2 Mrd für Nachmittagsbetreuung mit Rechtsanspruch“, „Mega Sprengstoff!“, „Gar nicht gut!!!“, „Wie kannst du das aufhalten?“ (Zwischenruf des Abg. Ofenauer.) – Das, werte Kolleginnen und Kollegen von der ÖVP, hat ihr neuer Klubobmann geschrieben, unter anderem. Diese Sätze zeugen von Arroganz, Unwissenheit und fehlendem Gespür dafür, was die Menschen hier in diesem Land wirklich brauchen. (Beifall bei NEOS und SPÖ sowie bei Abgeordneten der FPÖ.)
Es hätte selbstverständlich heißen müssen: 1,2 Milliarden für Nachmittagsbetreuung und Rechtsanspruch! Mega wichtig! Super! Wie können wir das schnellstmöglich gemeinsam umsetzen? – So hätte es heißen sollen! (Beifall bei den NEOS sowie bei Abgeordneten von SPÖ und FPÖ.)
Die Ausschnitte aus den Akten sind der blanke Hohn gegenüber allen Kindern, Eltern und allen, die im Kindergarten oder in Kinderbetreuungseinrichtungen im frühkindlichen Bereich arbeiten, aber auch gegenüber allen Unternehmerinnen und Unternehmern, die händeringend nach Fachkräften suchen. (Beifall bei den NEOS und bei Abgeordneten der SPÖ.)
Weil es immer heißt, dass ohne die Länder in der Elementarbildung überhaupt nichts geht: Wie wir sehen, ginge ja etwas, wenn zwei moderne, nach vorne blickende Parteiobleute sich darauf einigen und nicht zukunftsvergessene Politik machen, sondern Politik für die nächsten Generationen – und das schaffen Sie beide offensichtlich nicht. (Beifall bei den NEOS.)
Was hätten wir mit diesen zusätzlichen 1,2 Milliarden Euro für Österreich gemacht? – Wir hätten bereits vor Jahren damit begonnen, eine flächendeckende Nachmittagsbetreuung in Österreich zu sichern, wir hätten einen Betreuungsplatz für jedes Kind und jede Familie, die ihn benötigt und in Anspruch nehmen möchte, wir hätten es geschafft,
dass Eltern nicht mehr wie Bittsteller um einen Kindergartenplatz ansuchen müssen, wir hätten es geschafft, dass es genügend Plätze und weniger Schließtage gibt und dass nicht mehr die Hälfte der Einrichtungen vor 16 Uhr schließt. Und vielleicht hätten wir es auch geschafft, dass alle Bürgermeister lieber eine dritte Kindergartengruppe eröffnen, als ein drittes Feuerwehrauto anschaffen. (Abg. Stark: ... keine Ahnung!)
Liebe ÖVP, seit diese unsäglichen Nachrichten ausgetauscht wurden, sind fast 2 000 Tage vergangen, in denen sich die Eltern abgerackert und bemüht haben, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen (Ruf bei der FPÖ: So ist es!), 2 000 Tage, in denen man Familien, Alleinerziehende, aber auch das Personal im Elementarbildungsbereich massiv hätte entlasten können, 2 000 Tage, in denen Kindern frühkindliche Bildung zuteil geworden wäre, 2 000 Tage, die stattdessen dafür verwendet worden sind, Medien mundtot zu machen, politische Rivalen abzudrängen und ein türkises System der Macht aufzubauen für eine Familie, die die alltäglichen Herausforderungen der Bevölkerung offensichtlich nicht kapiert hat. (Abg. Rauch: Die Dame bringt es auf den Punkt ...!)
Die Messlatte für Sie ist mittlerweile ziemlich niedrig, aber wenn Sie nicht mehr zustande bringen als die Fortschreibung vom letzten Jahr und das Bummerl immer den Ländern umhängen, wird sich da nichts verändern.
Ich bringe daher folgenden Antrag ein:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Mag. Martina Künsberg Sarre, Kolleginnen und Kollegen betreffend „EUR 1,2 Mrd. und Rechtsanspruch auf Nachmittagsbetreuung“
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, nachdem die ,Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Elementarpädagogik für die Kindergartenjahre 2018/19 bis 2021/22‘ nächsten Sommer ausläuft, in den bevorstehenden Verhandlungen über die Folgevereinbarung sicherzustellen, dass fortan statt 142,6 Mio. Euro die bereits 2016 geplanten 1,2 Mrd. Euro jährlich inklusive Rechtsanspruch auf Nachmittagsbetreuung zur Verfügung gestellt werden.“
*****
(Beifall bei den NEOS.)
12.24
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Mag. Martina Künsberg Sarre, Kolleginnen und Kollegen
betreffend EUR 1,2 Mrd. und Rechtsanspruch auf Nachmittagsbetreuung
eingebracht im Zuge der Debatte in der 125. Sitzung des Nationalrats über Bericht des Budgetausschusses über den Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2020 (III-321/1062 d.B.) – TOP 2
Aufgrund der Kompetenzverteilung des elementaren Bildungswesens in Österreich, welche die Zuständigkeit bei den Ländern sieht, wurde eine Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern beschlossen, damit der Bund Investitionen tätigt, welche an gewisse Bedingungen für die Länder geknüpft sind. Diese
Vereinbarung regelt letztlich den Umgang und die Bedingungen bzw. Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme der Zweckzuschüsse. Zweckzuschüsse stellen zusätzliche finanzielle Mittel dar, die der Bund den Ländern zur Verfügung stellt. Für das Schuljahr 2021/22 sind Zweckzuschüsse in der Höhe von jeweils 142,5 Millionen Euro vereinbart. Wie die Causa rund um den ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz zeigt, hätten die Zuschüsse weitaus höher ausfallen sollen. Aus untenstehendem Schriftverkehr zwischen Herrn Schmid und Herrn Kurz aus dem Jahr 2016 geht klar hervor, dass der damalige Bundeskanzler Christian Kern und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner planten, 1,2 Mrd. Euro für Nachmittagsbetreuung samt Rechtsanspruch zur Verfügung zu stellen. Doch wie die Akten der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) zeigen, befand Sebastian Kurz diese Entwicklungen für "gar nicht gut!!!". Nicht, weil die Summe nicht angemessen oder dringend notwendig gewesen wäre - der flächendeckende Ausbau der Kinderbetreuung wäre ein großer Erfolg für den Kollegen und Kurz-Rivalen Mitterlehner gewesen und hätte sich negativ auf die Machtergreifung von Sebastian Kurz ausgewirkt. Der Schriftverkehr zeigt auf, dass durch "terrorisieren", "aufhetzen" etc. diese wichtige Investition einfach sabotiert wurde.
|
|
|
|
Doch wäre eine solche Investition mehr als überfällig gewesen, da es gerade im Bereich der Kinderbetreuung in Österreich massive Defizite gibt. Wie ein Europa-Vergleich zeigt, schneiden nur wenige Staaten schlechter ab, wenn es darum geht, für Eltern von Unter-3-Jährigen ein zumindest 30-stündiges Betreuungsangebot pro Woche anzubieten. Diese Defizite machen es vor allem Frauen schwer, den (Vollzeit-) Berufseinstieg nach der Karenz wieder zu schaffen, sie werden weniger oft befördert, verdienen weniger (Stichwort großer Gender Pay Gap in Österreich) und enden nicht selten in Altersarmut.
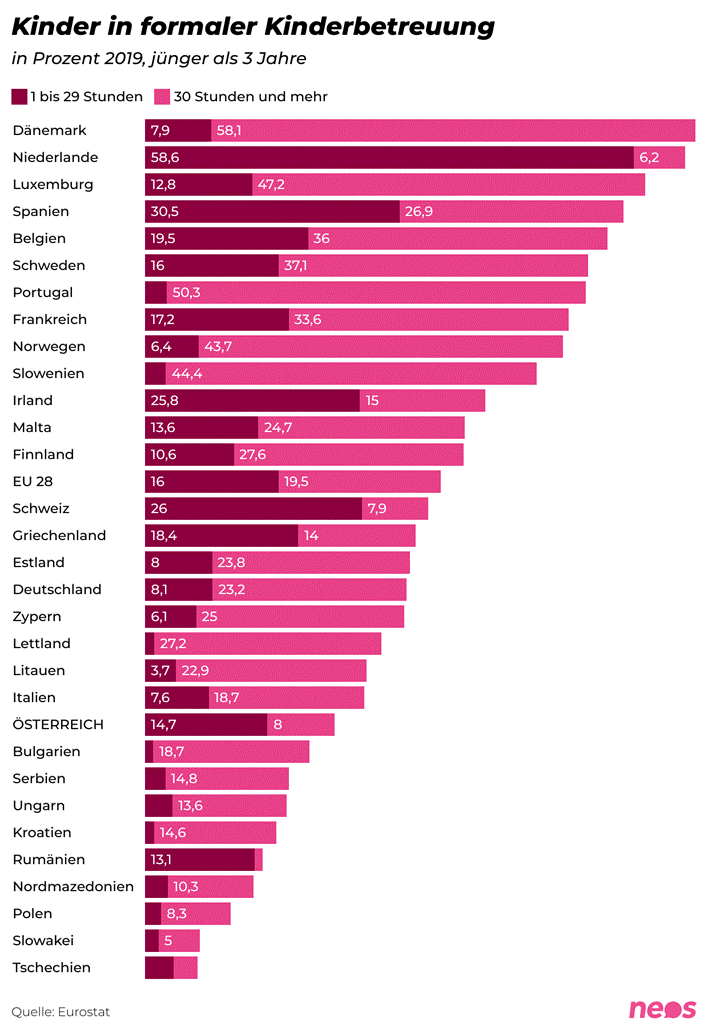
Wie schon etliche Studien zeigen, würde der Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen massive Auswirkungen auf das Einkommen von Frauen haben, da diese nach der Geburt aufgrund des Mangels an Kinderbetreuungsplätzen besonders häufig einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen und im weiteren Erwerbsverlauf nur in den seltensten
Fällen in eine Vollzeitbeschäftigung wechseln. Laut Statistik Austria waren im Jahr 2020 ganze 72,8% der Frauen im Alter von 25 bis 49 Jahren mit Kindern unter 15 Jahren teilzeitbeschäftigt - im Vergleich dazu waren nur 6,9% der Väter in Teilzeitarbeit (vgl. Gender-Statistik, Statistik Austria). Besonders verschärft stellt sich diese Situation für Alleinerziehende dar - ebenfalls zu über 90% Frauen -, sie sind die am stärksten von Armutsgefährdung betroffene Gruppe. Aber nicht nur Betreuungsplätze alleine sind Mangelware, auch zu kurze Öffnungszeiten und häufige Schließtage würden Teilzeitarbeit bei Frauen verstärken, meint Ökonomin Köppl-Turyna. Außerhalb Wiens hat mehr als die Hälfte aller Kinderbetreuungseinrichtungen mehr als fünf Wochen im Jahr geschlossen (51,2 Prozent) – das heißt, dass nicht einmal die Hälfte aller Kinderbetreuungseinrichtungen es Alleinerzieher_innen ermöglichen, erwerbstätig zu sein und keine private Kinderbetreuung organisieren zu müssen. Auch was die Öffnungszeiten der Kindertagesheime angeht, zeigt sich ein deutliches Stadt-Land-Gefälle: Knapp die Hälfte der Betreuungseinrichtungen außerhalb Wiens (47,2 Prozent) schließt bereits vor 16 Uhr, fast ein Drittel (rund 32 Prozent) sogar vor 15 Uhr. Knapp die Hälfte der Betreuungseinrichtungen in Österreich hat täglich weniger als acht Stunden geöffnet (vgl. Kindertagesheimstatistik, Statistik Austria).
Während in den Bundesländern mit NEOS Regierungsverantwortung, nämlich Salzburg und Wien, die Kinderbetreuung in den letzten Jahren deutlich ausgebaut wurde und wird - in Wien werden z.B. ab September 2022 die Assistenzstunden in Kindergärten verdoppelt und Sprachförderkräfte aufgestockt -, wurde darüber hinaus der österreichweite Ausbau der Kinderbetreuung durch Altkanzler Sebastian Kurz und sein türkises System aufgrund von Machtinteressen gezielt sabotiert. Die finanziellen Mittel von 1,2 Mrd. Euro für eine flächendeckende Nachmittagsbetreuung inklusive Rechtsanspruch hätte die Möglichkeit geschaffen, all jenen Kindern und Familien Betreuungsplätze zur Verfügung zu stellen, die diese dringend brauchen und in Anspruch nehmen möchten. Dadurch wären Familien und insbesondere Mütter sowie Alleinerziehende massiv entlastet und persönliche Freiheit sowie finanzielle Sicherheit gefördert worden.
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
"Die Bundesregierung wird aufgefordert, nachdem die „Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Elementarpädagogik für die Kindergartenjahre 2018/19 bis 2021/22" nächsten Sommer ausläuft, in den bevorstehenden Verhandlungen über die Folgevereinbarung sicherzustellen, dass fortan statt 142,6 Mio. Euro die bereits 2016 geplanten 1,2 Mrd. Euro jährlich inklusive Rechtsanspruch auf Nachmittagsbetreuung zur Verfügung gestellt werden."
*****
Präsidentin Doris Bures: Der Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht und steht daher auch mit in Verhandlung.
Nächster Redner: Herr Abgeordneter Nikolaus Prinz. – Bitte.
Abgeordneter Nikolaus Prinz (ÖVP): Frau Präsidentin! Herr Bundesminister für Finanzen! Frau Rechnungshofpräsidentin! Meine Damen und Herren! Frau Kollegin Künsberg Sarre, Oppositionspolitik hat vielleicht den Vorteil, dass man viel fordern kann, hat aber den Nachteil, dass man bei der Umsetzung sozusagen hinkt. Und der Unterschied
zwischen Opposition und Regierung ist einfach, dass wir für etwas stehen müssen, was manchmal schwieriger ist, aber das erfüllt einen auf Dauer viel mehr, weil man etwas bewegen kann, als wenn man immer im Frust schmachten muss, weil man nichts weiterbringt. (Zwischenrufe bei den NEOS.) Aber: Ihr habt ja jetzt in Wien Gelegenheit – schauen wir uns das in ein paar Jahren an, aber dann wird wahrscheinlich Herr Landeshauptmann und Bürgermeister Ludwig schuld sein, dass Herr Wiederkehr nichts zustande gebracht hat; das ist aber ein anderes Paar Schuhe. (Beifall bei der ÖVP. – Zwischenrufe bei den NEOS.)
Wir behandeln unter diesem Tagesordnungspunkt den Rechnungsabschluss für das Jahr 2020. Der Rechnungsabschluss 2020 weist bei 73,63 Milliarden Euro Einnahmen und 96,11 Milliarden Ausgaben ein Defizit von 22,48 Milliarden aus. Die Gründe dafür sind hinlänglich bekannt, das sind einfach die Folgen der Coronapandemie, nicht mehr und nicht weniger, die Auswirkungen auf die Wirtschaft und damit auch auf die Steuereinnahmen.
Es ist viel gegengesteuert worden, die Maßnahmen sind heute schon mehrmals aufgelistet worden – von der Kurzarbeit bis zu all den Hilfen –, aber man muss auch sagen, dass auf der anderen Seite auch wesentliche Mehrkosten zum Beispiel im Gesundheitsbereich entstanden sind. Wenn man mit Leuten redet, die auf einer Intensivstation Arbeit leisten müssen, hört man, welche Mehrbelastung sie gehabt haben und was es heißt, dort zu arbeiten. Da müsste vielleicht so mancher nachdenken, der fragt: Na ja, gibt es Corona überhaupt? Wie tun wir denn damit?, und vor allem sagt: Ich bin so gesund, mich kann das sowieso nicht treffen! – Diese Menschen sollen einmal mit Leuten reden, die dort arbeiten, die Erfahrung und Praxis in diesem Bereich haben.
Worum ist es denn in den letzten eineinhalb Jahren gegangen? – Dass wir durch diese Pandemie finden, es schaffen, die Balance zwischen der Wirtschaft auf der einen Seite und der Gesundheit auf der anderen Seite zu halten. Wenn man einen Vergleich mit anderen Ländern anstellt, dann darf man, glaube ich, sagen, dass Österreich im Verhältnis gut durch die Krise gekommen ist, bisher sehr gut durch die Krise gekommen ist und dass die Wirtschaft wirklich wieder flott wächst – sie boomt eigentlich.
Weil heute schon ein paar Mal das Thema Beschäftigung angesprochen worden ist: Ich glaube nicht, dass man mit mehr Geld Arbeitslosigkeit gegensteuern kann, denn wenn wir uns anschauen, wie viele offene Stellen es gibt und wie viele Arbeitslose, dann wissen wir, dass wir eigentlich wieder Vollbeschäftigung haben, wir sind auf dem Vor-Corona-Niveau. Direkter gesagt: Mit 3 Prozent Arbeitslosigkeit muss man ja praktisch ständig rechnen. Allein durch die Jobwechsel, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einfach vornehmen, gibt es eine gewisse permanente Arbeitslosigkeit. Wir müssen uns mehr damit beschäftigen, wie viele offene Stellen es gibt und wie wir die Leute bestmöglich in Richtung Arbeit bringen, damit die Wirtschaft auch in der Zukunft die entsprechenden Fachkräfte hat, denn die Politik gestaltet die Rahmenbedingungen.
Die Stimmung kann, glaube ich, nicht so schlecht sein, andernfalls ginge es uns hinsichtlich der Wirtschaftsentwicklung nicht so gut. Neben der Stimmung ist Vertrauen wichtig, und die Unternehmen in Österreich wissen, dass sie dieser Bundesregierung, was die Rahmenbedingungen betrifft, auch tatsächlich vertrauen können, und das ist wertvoll. (Beifall bei der ÖVP.)
Wir haben heute schon die Budgetrede des Herrn Finanzministers gehört, es gibt praktisch in allen Bereichen zusätzliches Geld, einen Schwerpunkt Bildung, zusätzliche Maßnahmen. Ich denke dabei nur an den Breitbandausbau, der wirklich ganz wichtig für den ländlichen Raum ist. Es gibt aber auch zusätzliche Mittel für die Justiz. Ich verhehle nicht, dass ich in den letzten Tagen mehrmals angeredet und gefragt worden bin: Wie kann es sein, dass aus dem Bereich Justiz so viel an die Öffentlichkeit geht, bevor es die Betroffenen überhaupt erfahren? – Ich glaube schon, dass man erwarten darf – keine
Vorverurteilungen –, dass man die undichten Stellen dort schließt, dass objektiv und rasch aufgeklärt wird und dass sich jede Institution im Dreieck Staatsanwaltschaft, Verteidigung auf der anderen Seite und die Richter oben drüber richtig einordnet, dass man das sieht.
Bei so mancher Oppositionsrede darf man, glaube ich, schon fragen: In welchem Land leben Sie denn eigentlich? Wenn alles so schlecht wäre, dann müsste es uns ja ganz anders gehen, denn objektiv gesehen geht es uns in Österreich gut und Österreich ist erfolgreich.
Der Bundesrechnungsabschluss 2020 bringt einfach zum Ausdruck, dass man gut gegengesteuert hat, die richtigen Maßnahmen gesetzt hat, und der Budgetentwurf 2022, den wir morgen in erster Lesung diskutieren werden, ist die richtige Ansage in Richtung Zukunft, denn Österreich braucht in Wirklichkeit Aufschwung, Stabilität (Abg. Brandstätter: Weniger Korruption!) und eine nachhaltige Politik – und das machen wir gemeinsam. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Brandstätter: Weniger Korruption!)
12.29
Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Petra Bayr. – Bitte.
Abgeordnete Petra Bayr, MA MLS (SPÖ): Frau Präsidentin! Frau Rechnungshofpräsidentin! Herr Finanzminister! (Abg. Brandstätter: Keine Korruption!) Der Rechnungshof kritisiert den Bundesrechnungsabschluss insofern, als dieser die Grundsätze von Budgetklarheit und Budgetwahrheit nicht erfüllt, weil innerhalb von kurzer Zeit mehrere Male die Struktur des Budgets geändert worden ist und so keine Nachvollziehbarkeit zwischen den unterschiedlichen Budgets gegeben war, respektive einfach die Transparenz fehlt.
Ich denke mir, gerade angesichts dessen, wozu die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gerade ermittelt, müsste eigentlich Transparenz die erste Finanzministerpflicht und auch die absolute Pflicht der Regierungsparteien sein. Umso mehr verwundert es, dass es bis heute keine Bereitschaft gibt, einen Unterausschuss des Budgetausschusses einzurichten, der sich konkret anschaut, wo und wie denn die Coronahilfen geflossen sind; einen Unterausschuss, der die Möglichkeit hat, Akteneinsicht zu nehmen, Fachleute einzuladen, Auskunftspersonen einzuladen und wirklich zu schauen, was mit diesem Geld passiert ist. Ich frage mich: Wer hat da etwas zu verbergen? Offensichtlich gibt es etwas zu verbergen, denn sonst gäbe es nicht so vehemente Ablehnung gegenüber dieser Idee, und es würde nicht so vehement versucht, bloß keine Transparenz in diese Frage zu bringen.
Eine andere Frage, die die Menschen auch sehr bewegt, ist, wer am Ende des Tages die Schulden aus dieser Coronakrise, die uns noch jahrelang begleiten werden, zahlen wird und wie es gelingen kann, dass es da wirklich eine gerechte Verteilung gibt und dass jene, die über großes Vermögen verfügen, wirklich ihren Beitrag leisten und nicht die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Pensionistinnen und Pensionisten, die Studierenden, indem sie dann wieder einmal – wir hatten das schon – Selbstbehalte im Gesundheitswesen zu bezahlen haben oder indem Sozialtransfers gekürzt oder gestrichen werden.
Wenn man sich die ersten Zahlen zum Budgetentwurf anschaut, erkennt man, dass ganz offensichtlich das Gegenteil der Fall ist. Die Großspender von Sebastian Kurz werden nämlich diejenigen sein, die bedient werden, diejenigen, die Steuererleichterungen bekommen, und diejenigen, die Milliardengeschenke bekommen. Allein Großkonzernbesitzer und Stiftungen werden mit 1 Milliarde Euro pro Jahr entlastet, belohnt. Das ist im Lichte der aktuellen Ermittlungen gegen Ex-Bundeskanzler Kurz und der Machenschaften seines türkisen Systems nicht nur unglaublich frech, sondern – nicht böse sein – es verspottet, es verhöhnt die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Das kann einfach nicht wahr sein. (Beifall bei der SPÖ.)
Weil Sie Ihr Budget quasi am Motto „Aufschwung, Stabilität und Nachhaltigkeit“ aufhängen: Ja, die Menschen haben ein Recht auf Aufschwung, aber nicht auf einen Aufschwung von Korruption, von Bestechung und Bestechlichkeit; sie haben ein Anrecht auf Stabilität, aber nicht auf Stabilität zur Verschleierung dessen, wer denn die Krisengewinner sind; und ja, die Menschen haben auch ein Recht auf Nachhaltigkeit, aber nicht auf Nachhaltigkeit dahin gehend, in gekaufter Medienberichterstattung zugunsten der ÖVP das Nachsehen zu haben. Das ist sicherlich nicht das, was die Bürgerinnen und Bürger wollen. Mit Verlaub: Ich selber werde dem Budget ohnehin nicht zustimmen, aber trotz alledem ist es wirklich zum Fremdschämen. (Beifall bei der SPÖ.)
12.33
Präsidentin Doris Bures: Die nächste Rednerin ist Frau Abgeordnete Sibylle Hamann. – Bitte.
Abgeordnete Mag. Sibylle Hamann (Grüne): Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte nur kurz auf den Redebeitrag von Kollegin Künsberg replizieren, und ich bedanke mich auch für den nochmaligen Antrag bezüglich der 1,2 Milliarden Euro für die Kinderbetreuung.
Für alle Zuschauer und Zuschauerinnen, die das gestern vielleicht verpasst haben: Wir haben gestern schon über das Thema diskutiert, und es ist und bleibt natürlich wichtig, unabhängig von den Chats und den Sabotageversuchen, die uns nicht davon abhalten werden, in dieser Sache das Richtige zu tun. (Zwischenruf des Abg. Einwallner. – Weitere Zwischenrufe bei der SPÖ.) Deswegen – ich möchte das auch Kollegin Künsberg Sarre noch einmal sagen – haben wir gestern einen gemeinsamen Entschließungsantrag der Regierungsparteien eingebracht, mit genau den zwei Punkten, die Sie erwähnt haben, nämlich einerseits dem massiven Ausbau der Nachmittagsbetreuung und der ganztägigen Schulformen (Zwischenrufe bei der SPÖ) und andererseits der Neuverhandlung der 15a-Vereinbarung zur Elementarpädagogik, mit den expliziten Zielen: Ausbau der Plätze, massive Qualitätsverbesserungen und eine erhebliche Erhöhung des Zweckzuschusses. (Beifall bei Abgeordneten der Grünen. – Zwischenruf der Abg. Heinisch-Hosek. – Weitere Zwischenrufe bei der SPÖ.)
Wenn bei diesen Verhandlungen mit den Ländern 1,2 Milliarden Euro herausschauen, soll es mir recht sein. (Neuerliche Zwischenrufe bei der SPÖ.) Leider wurde dieser Antrag allerdings gestern von der Opposition abgelehnt. Ich finde das sehr schade, und ich hoffe sehr, dass wir doch wieder auf den konstruktiven Weg zurückfinden (neuerlicher Zwischenruf der Abg. Heinisch-Hosek), denn es wird alle konstruktiven Kräfte in diesem Land brauchen, sowohl im Bund als auch in den Ländern, damit wir in dieser Sache gemeinsam etwas zustande bringen. – Danke schön. (Beifall bei den Grünen. – Abg. Matznetter: Die Konstruktiven haben hier keine Mehrheit, Frau Kollegin!)
12.35
Präsidentin Doris Bures: Nun gelangt Frau Abgeordnete Henrike Brandstötter zu Wort. – Bitte.
Abgeordnete Henrike Brandstötter (NEOS): Sehr geehrter Herr Bundesminister! Frau Rechnungshofpräsidentin! Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuseherinnen und Zuseher zu Hause! Ja, 1,2 Milliarden Euro für Kinderbetreuung sind halt auch nicht im Budget abgebildet. Das macht es natürlich auch ein bisschen schwierig. (Beifall bei den NEOS sowie der Abgeordneten Herr und Matznetter.)
Kommen wir zur nächsten tibetanischen Gebetsmühle! Was sind tibetanische Gebetsmühlen? – Das sind diese Walzen, die auch leseunkundigen Menschen die Möglichkeit
geben sollen, ein positives Karma zu erhalten. Meine Gebetsmühle ist: runter mit diesen irrwitzig hohen Ausgaben für Inserate, rauf mit der Presseförderung! Ich kann Ihnen dafür nicht nur ein positives Karma versprechen, sondern auch eine offene, liberale Demokratie, informierte Bürgerinnen und Bürger, eine vierte Säule, die nicht bröckelt, und Journalistinnen und Journalisten, die ihren Job machen können.
Gehen wir also im Schnelldurchlauf die wichtigsten medienpolitischen Baustellen durch, die wichtigsten Gebetsmühlen! Der erste Punkt ist die „Wiener Zeitung“. Wo bleiben weiterführende Überlegungen zur Zukunft der „Wiener Zeitung“? Ende 2022 fällt ja die Pflichtveröffentlichung für Unternehmen, und das ist auch gut so. Jeder Euro, den Unternehmen nicht in die Zwangsveröffentlichung von Bilanzen und Jahresabschlüssen stecken müssen, ist ein Euro, der in Innovation und Arbeitsplätze fließen kann, aber der Wegfall dieser Haupteinnahmequelle der „Wiener Zeitung“ darf nicht darin münden, dass sie geschlossen wird. Diese Zeitung hat eine ernst zu nehmende Debatte verdient, sie hat einen Gedanken darüber, wie ihre Zukunft aussehen kann, verdient. Dass man bis jetzt nicht darüber gesprochen hat, kann vielleicht auch damit zusammenhängen, dass das türkise System noch keinen Hebel gefunden hat, wie man denn in der „Wiener Zeitung“ einen Mehrwert für den persönlichen Nutzen, für die eigene Karriere findet.
Zwei weitere zentrale Forderungen, die auch 2018 bei der Medienenquete schon als To-dos, als Prioritäten rausgekippt sind – damals, als Sie, Herr Finanzminister, als für Medien zuständiger Minister auch noch ein echtes Anliegen gehabt haben –, sind die ORF-Gremienreform und die Presseförderung.
Zum ORF: Die Gremienreform ist immer noch eine Randnotiz. Es gibt immer noch keinen mehrköpfigen Vorstand. Stattdessen will der ORF eine 8-prozentige Erhöhung seiner Gebühren, will oder kann aber kein Konzept dazu vorlegen, wo er denn eigentlich Geld einspart, was die Strategie ist, worin er dieses Geld investieren möchte und wie es seinem eigentlichen Auftrag zugutekommt, nämlich Public Value zu produzieren, also gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Das ist nur eine der vielen ORF-Baustellen. Die Liste reicht da vom Betrieb des Newsrooms über die längst fälligen Digitalisierungs- und Positionierungskonzepte und den Generationenwechsel bei den Mitarbeitern bis zum Ankommen im Streamingzeitalter.
Der nächste Punkt ist die Presseförderung, besser bekannt als Inseratenkorruption. Kollege Sebastian Kurz hat ja die vielen Inserate während der Pandemie als Hilfe für in Not geratene Medien bezeichnet und damit auch einmal mehr sein Verständnis von Medienförderung skizziert, nämlich Inserate, Inserate, Inserate und damit Abhängigkeiten, Medienmacher zu Bittstellern zu degradieren und Einfluss und Gefälligkeitsjournalismus zu erwirken. Auch 2018 in der Medienenquete wurde eine Neuaufstellung der Presseförderung formuliert, die nur in eine Handlung münden kann: runter mit den Inseratenmillionen, rauf mit der Presseförderung!
Ein letzter Punkt in der sehr langen Liste: Transparenz – let’s put Transparenz into Medientransparenzgesetz! Ein Beispiel von vielen: Die Wirtschaftskammer ist der drittgrößte Werber Österreichs. Das wird Sie vielleicht überraschen. Diese 70-fach verzettelte Organisation mit Länderkammern, Sparten, Fachgruppen und Fachverbänden ist ein Moloch, der 2020 knapp 17 Millionen Euro für Werbung ausgegeben hat. Das herauszufinden ist mühsame Handarbeit. Da habe ich mich gestern Nacht hingesetzt und eine Stricherlliste geführt. Man kann es Bürgerinnen und Bürgern nicht zumuten, dass sie auf diese Art und Weise, in Nachtarbeit, herausfinden müssen, wofür unser Steuergeld ausgegeben wird.
Gestern hat Bundeskanzler Schallenberg gesagt: Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Schritte! – Dem kann ich nur zustimmen. Wir können also in dieser außergewöhnlichen Zeit daran anknüpfen und die Situation nützen, damit wir mit allem
gebotenen Ernst die Forderungen aus der Medienenquete 2018 endlich umsetzen, und ich rufe deshalb auch all meine Kollegen in den Fraktionen, alle Mediensprecherinnen und Mediensprecher dazu auf, gemeinsam mit den Stakeholdern, mit Medienmachern, mit Standesvertretern, mit Vereinen wie dem Presseclub Concordia, mit Kontrollinstanzen wie dem Presserat endlich für ein neues System zu sorgen, ein neues System der Finanzierung zu finden und endlich über die Rampe zu bringen. – Vielen Dank. (Beifall bei den NEOS.)
12.40
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Andreas Kollross. – Bitte.
Abgeordneter Andreas Kollross (SPÖ): Frau Präsidentin! Frau Präsidentin des Rechnungshofes! Herr Finanzminister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Werte Zuseherinnen und Zuseher! Kollege Hanger ist jetzt leider nicht da, aber vielleicht richtet man es ihm aus: Da er gesagt hat, dass das mit diesen 1,2 Milliarden Euro, was den Kindergartenausbau, was die Nachmittagsbetreuung betrifft, alles nicht stimmt, und wir ja heute hier den Rechnungsabschluss diskutieren, würde ich einfach nur darum bitten: Er soll uns die Zeile zeigen, wo die 1,2 Milliarden Euro stehen – dann wären wir wirklich Lügen gestraft. (Beifall bei SPÖ und NEOS.) Ansonsten, glaube ich, stimmt das sehr wohl – das nur als Voranmerkung.
Jetzt zum Budget: Das ist es oder das soll es also gewesen sein, warum die Grünen Angst vor ihrer eigenen Courage haben und warum sie nicht bereit sind, mit dem System Kurz, mit dem System ÖVP zu brechen, und warum sie sich damit zufriedengeben, dass Herr Kurz, sofern er überhaupt je hier herinnen auftaucht – bis jetzt ist er ja nicht da –, von dort nach da (erst auf die Regierungsbank, dann auf die Sitzplätze der ÖVP-Abgeordneten weisend) wechselt.
Das genügt euch (in Richtung Grüne) in Wirklichkeit, und dafür seid ihr bereit, Pendlerinnen und Pendler zu belasten, Mieterinnen und Mieter zu belasten, die Abschaffung der kalten Progression nicht zu machen, weiterhin bei der Boykottierung des Ausbaus der Kinderbetreuung, der Nachmittagsbetreuung mitzuspielen und nach wie vor dafür zu sorgen, dass es keine Kindergartenmilliarde gibt. (Beifall bei der SPÖ.)
Stattdessen gibt es durch die KöSt-Senkung eine Entlastung für die Spenderinnen und Spender von Herrn Kurz, für die Spenderinnen und Spender der ÖVP – Spenden soll sich ja bekanntlich auszahlen –, stattdessen gibt es keine Einsparung bei den überbordenden Geldern für Inserate, keine Einsparung beim aufgeblähten Medienmenschenapparat, den es im Bundeskanzleramt gibt. Das System Kurz, das System ÖVP wird einfach in diesem Budget fortgeschrieben. Es gibt daher keinen Systembruch, sondern es ist in Wirklichkeit das System Kurz, das System ÖVP in diesem Budget weiterhin abgebildet, es ist more of the same.
Herr Finanzminister, Sie haben sich, was mich als Bürgermeister ja prinzipiell freut, bei den Gemeinden, bei den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern bedankt. Das ist auch gut so, weil es die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister waren, die letztendlich infolge des Coronamissmanagements die Kohlen aus dem Feuer holen mussten. Wie bei den Coronaheldinnen und -helden gilt aber: Danke alleine ist zu wenig. Es bräuchte vor allen Dingen endlich finanzielle Hilfen für die Gemeinden, und ich werde nicht müde, das hier herinnen zu formulieren, weil alles, was von dieser Regierung, leider auch von Ihnen, von der ÖVP, von den Grünen bisher im Bereich Gemeinden und Städte gemacht wurde, keine Hilfspakete, sondern Hilflosenpakete sind. (Beifall bei der SPÖ.)
4,5 Milliarden Euro fehlen den Gemeinden und Städten. Mit diesem Budget, in dem nicht einmal abgebildet wird, dass es irgendeine Hilfe gibt, seid ihr nicht einmal bereit,
irgendwie zu helfen, sondern dieses Budget, das Sie heute präsentiert haben, belastet die Gemeinden und Städte noch einmal jedes Jahr mit 800 Millionen Euro. Ihr seid also nicht nur nicht bereit, die 4,5 Milliarden Euro irgendwie abzugelten, sondern belastet die Gemeinden und Städte zusätzlich.
Was bedeutet das? – Bei Gemeinden und Städten geht es ja nicht um einen Bürgermeister, um das Rathaus, sondern es geht letztendlich um die Lebensqualität jedes Menschen in diesem Lande (Beifall bei der SPÖ), weil alle Menschen in einer Gemeinde beziehungsweise in einer Stadt wohnen. Wenn sich die Gemeinden das alles irgendwann nicht mehr leisten können, dann werden sie darüber nachdenken, ob sie Gebühren erhöhen müssen, ob sie im Kinderbetreuungsbereich die Beiträge erhöhen müssen, welche Leistungen sie nicht mehr erbringen können, welche Investitionen sie nicht mehr tätigen können.
Sie werden schlicht und einfach mit diesem Budget und mit dieser Belastung der Gemeinden und Städte einen Investitionsstau in Österreich produzieren und damit nachhaltig die regionale klein- und mittelständische Wirtschaft boykottieren, und das alles nur, weil es Ihnen wichtiger ist, die Spenderinnen und Spender zu bedienen, als den Gemeinden und Städten und somit den Bürgerinnen und Bürgern mehr Finanzmittel zu geben.
Wenn ihr es uns, die es euch jetzt schon seit eineinhalb Jahren hier herinnen erzählen, nicht glaubt und ihr nicht bereit seid, in diesem Bereich etwas zu tun, dann hört wenigstens auf eure eigenen Leute! Was hat der Präsident des Oberösterreichischen Gemeindebundes, Hingsamer, zum Budget gesagt? – „Das ist ein Wahnsinn“. Es gibt ausschließlich Nachteile für die Gemeinden, die Spender werden bedient, die Pflege wird nicht einmal in irgendeiner Form berücksichtigt.
An die Kolleginnen und Kollegen von der ÖVP – die Bürgermeisterinnen- und Bürgermeisterstichwahl hat es ja schon gezeigt –: Die Bürgerinnen und Bürger glauben euch das schön langsam nicht mehr. (Abg. Michael Hammer: Blödsinn!) Ich möchte nur daran erinnern: Eferding, Vöcklabruck, Freistadt, Schärding (Abg. Michael Hammer: Traun! Ansfelden!) – überall müssen die ÖVP-Bürgermeisterinnen und -Bürgermeister den Hut nehmen (Beifall bei der SPÖ), weil sie in Wirklichkeit die Rechnung von der ÖVP hier herinnen präsentiert bekommen. (Neuerlicher Zwischenruf des Abg. Michael Hammer.)
Dieses Budget ist nicht sozial, dieses Budget ist nicht ökologisch. Zurück zum Start, bitte! (Beifall bei der SPÖ.)
12.47
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Johannes Margreiter. – Bitte.
Abgeordneter Dr. Johannes Margreiter (NEOS): Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau Präsidentin des Rechnungshofes! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Kolleginnen und Kollegen! Werte ZuseherInnen vor den Bildschirmen! Die Debatte zum Bundesrechnungsabschluss 2020 gibt mir Gelegenheit, auf eine fiskalische Kleinigkeit, die aber im Verwaltungsablauf, in der Administration und vor allem für die Betroffenen äußerst ärgerlich ist und viel Aufwand verursacht, hinzuweisen. Es geht um die Rechtsgeschäftsgebühr.
Die Rechtsgeschäftsgebühr wird in Österreich als frühere Papiersteuer aus vordigitalen Zeiten eingehoben. Sie war immer schon einigermaßen fragwürdig, weil bei Gebühren ja immer eine Gegenleistung des Staates dahinterstehen sollte, was bei der Rechtsgeschäftsgebühr eigentlich nicht erkennbar ist.
In der Praxis schaut das so aus – wir haben heute auch im Zuge Ihrer Rede, Herr Bundesminister, gehört, wie wichtig es ist, Gründungen zu fördern, Jungunternehmer zu fördern –: Was ist das Erste, das eine Jungunternehmerin oder ein Jungunternehmer, wenn sie ein Unternehmen starten wollen, brauchen? – Das Erste ist ein Geschäftslokal. Meistens werden sie dieses anmieten. Geschäftsraummieten unterliegen der Rechtsgeschäftsgebühr, und da gibt es dann eine Menge Probleme: Natürlich will der Unternehmer einen möglichst langen Vertrag haben, sodass er möglichst sicher ist und nicht nach drei Jahren wieder ein neues Lokal suchen muss. Das heißt, er ist an einem langfristigen Vertrag interessiert. Die Rechtsgeschäftsgebühr orientiert sich aber an der Vertragsdauer, und das kann dann ein ganz erheblicher Betrag werden, der gleich beim Starten des Unternehmens an den Fiskus an Rechtsgeschäftsgebühr zu zahlen ist. Selbst wenn es gelingt – und das sind juristisch äußerst diffizile Fragen –, das Mietverhältnis so zu konstruieren, dass es als eines auf unbestimmte Zeit gilt, hat man zwar nur die 36-fache Jahresleistung als Bemessungsgrundlage für die Rechtsgeschäftsgebühr, aber auch das geht ins Geld, das sind gleich einmal 1 000, 2 000 Euro. Das tut am Anfang einer Gründung weh. Es wäre also höchst an der Zeit, sich zu überlegen, ob es diese Rechtsgeschäftsgebühr braucht.
Da möchte ich den berühmten Satz in Erinnerung rufen: Auch Kleinvieh macht Mist! Das könnten Sie als Finanzminister natürlich gerne sagen.
Was macht die Rechtsgeschäftsgebühr aus? – Ich habe eine parlamentarische Anfrage gemacht, die zwar nicht ganz aktuell ist: Die letzte Zahl, jene von 2018, zeigt 142 Millionen Euro. Die Jahreseinnahmen waren noch in keinem Jahr über 200 Millionen Euro. Der fiskalische Ertrag ist also äußerst überschaubar, der administrative Aufwand für die Betroffenen äußerst groß. Man sollte also schon überlegen, ob man diese Rechtsgeschäftsgebühr nicht streichen kann. Einen Bedeckungsvorschlag hätte ich auch: Bei den Inseraten ein bisschen sparen, dann hätten wir das Geld sehr schnell herinnen. (Beifall bei den NEOS.)
Ich bringe folgenden Antrag ein:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Abschaffung der Rechtsgeschäftsgebühren“
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung, und insbesondere der Bundesminister für Finanzen, werden aufgefordert, dem Nationalrat eine Gesetzesinitiative vorzulegen, die eine Abschaffung der Rechtsgeschäftsgebühren zum Inhalt hat. Sämtliche mit der Einhebung dieser Gebühren verknüpften Planstellen soll damit eingespart werden.“
*****
Vielen Dank. (Beifall bei den NEOS.)
12.51
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Dr. Johannes Margreiter, Kolleginnen und Kollegen
betreffend Abschaffung der Rechtsgeschäftsgebühren
eingebracht im Zuge der Debatte in der 125. Sitzung des Nationalrats über Bundesrechnungsabschluss 2020 – TOP 2
Abschaffung der Rechtsgeschäftsgebühren
In kaum einem europäischen Land gibt es eine derartige Vielfalt und Höhe an Gebühren wie in Österreich. Eine wesentliche Rolle spielt hierbei das österreichische Justizsystem, das die europaweit höchste Gebührenbelastung aufweist. Neben den Gerichtsgebühren treffen dabei die Rechtsgeschäftsgebühren nicht nur die eigenen Bürger_innen und deren uneingeschränkten Zugang zum Recht, sondern auch ausländische Unternehmer_innen und Investor_inen und damit den Wirtschafts- und Wettbewerbsstandort Österreich. Die Rechtsgeschäftsgebühr war ursprünglich als "Papierverbrauchssteuer" konzipiert und ist damit in einer digitalisierten Welt, zu der auch der Rechtsverkehr und die Verwaltung rechtlich relevanter Daten zählen, anachronistisch. Die aus dem Bundesrechnungsabschluss 2020 klar ersichtlichen überbordenden Belastung von Unternehmer_innen und Private durch Gebühren soll durch diesen Antrag endlich beseitigt werden.
Rechtsgeschäftsgebühren bedeuten für sozial Schwache ein faktisches und ganz wesentliches Hindernis beim Zugang zum Recht, per se eine unverhältnismäßig hohe finanzielle Belastung jedes Rechtsgeschäfts, einen massiven Standortnachteil und nicht zuletzt einen großen Wettbewerbsnachteil für österreichische Unternehmer_innen. Wo möglich, werden schriftliche Verträge vermieden, was zu Rechtsunsicherheit und Streitfällen führt. Die eingehobenen Beträge stehen in keinem Verhältnis zu dem Aufwand, den die auslösenden Rechtsgeschäfte für die Justiz verursachen. Vielmehr entsteht dem Staat aus dem Abschluss eines Vertrages zwischen Privaten gar kein Aufwand, oder aber nur ein sehr geringer, der ohnehin durch andere Gebühren abgedeckt wird. Wenig nachvollziehbar ist insbesondere, warum ein außergerichtlicher Vergleich, durch den das Justizsystem eben gerade nicht belastet wird, gebührenpflichtig ist. Auch nicht nachvollziehbar ist, dass etwa Ehepakte durch Rechtsgeschäftsgebühren als prozentualer Anteil an der vertraglich verfügten Summe belastet sind. Ehewillige, die vorausplanend einen Ehepakt errichten wollen, werden in Österreich durch eine eigene Steuer belastet. Besonders abwegig ist auch die Belastung eines außergerichtlichen Vergleichs mit Rechtsgeschäftsgebühr.
Expert_innen fordern Reform: Belastung der österreichischen Bevölkerung hoch genug - Rechtssicherheit darf keine Frage der finanziellen Mittel sein
Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag (ÖRAK) schließt sich dieser Forderung auch in seinem Tätigkeitsbericht 2019 an:
"Förderung der Rechtssicherheit durch Evaluierung des Gebührengesetzes
Ganz allgemein sind Gebühren, deren Höhe sich nach der Anzahl beschriebener Bögen oder Beilagen bemisst im 21. Jahrhundert entbehrlich und geradezu bürgerfeindlich.
Die Sinnhaftigkeit von Rechtsgeschäftsgebühren ist in Frage zu stellen. Es kann nicht im Interesse eines Rechtsstaates sein, dass schriftliche Vereinbarungen unterbleiben, nur weil Bürger bestrebt sind, hohe Rechtsgeschäftsgebühren zu vermeiden.
Hier treibt der Gesetzgeber die Bürger in eine gefährliche Zwickmühle. (...)
Rechtsgeschäftsgebühren wirken sich aber auch negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und des Wirtschaftsstandortes Österreich aus.
Unternehmerinnen und Unternehmer, die eine Auseinandersetzung einvernehmlich beilegen und darüber eine schriftliche Vereinbarung schließen, müssen eine 2%-ige Vergleichsgebühr entrichten.
Unternehmerinnen und Unternehmer, die zur Betriebsansiedlung eine Gewerbefläche anmieten und darüber einen 18-jährigen Mietvertrag schließen, müssen dafür 1% des 18-fachen Jahreswertes entrichten. Kostet also die Anmietung einer Gewerbefläche € 7.000,- pro Monat, so ergibt dies eine Gebühr von € 15.120,–.
Der ÖRAK empfiehlt daher die ersatzlose Abschaffung der Rechtsgeschäftsgebühren. Sie belasten Bürger und Unternehmen über die Maßen und haben negative Auswirkungen auf die Rechtssicherheit."
Abschaffung der Rechtsgeschäftsgebühren auch für Verschlankung der Verwaltung nutzen
Im Jahr 2018 betrugen die Budgeteinnahmen aus der Vergebührung von Rechtsgeschäften in Summe 142 Mio. Euro, wovon alleine auf die Wettgebühr 45 Mio. Euro entfallen (NEOS Anfrage 121/AB). Die Wettgebühr ist daher die mit Abstand aufkommensstärkste Rechtsgeschäftsgebühr und soll deshalb beibehalten werden. Im Übrigen betreibt die Republik, in diesem Fall das Finanzministerium, im Bereich der Gebühreneinnahmen budgetären Blindflug. Das BMF kann nämlich keine Aussage dazu treffen, in welcher Höhe Einnahmen aus den einzelnen Tarifposten der Rechtsgeschäftsgebühren generiert werden. Bis zum Beweis des Gegenteils muss davon ausgegangen werden, dass die übrigen Tarifposten nicht wesentlich zum Gebührenaufkommen im Bereich der Rechtsgeschäftsgebühren beitragen, bzw. der Verwaltungsaufwand der Finanzbehörden in diesem Bereich zu den Einnahmen außer Verhältnis steht. Im Zuge der Abschaffung der Rechtsgeschäftsgebühren sollen sämtliche mit der Einhebung dieser Gebühren verknüpften Planstellen eingespart werden.
Quellen:
• http://www.rechtsanwaelte.at/fileadmin/user_upload/PDF/02_Kammer/
Stellungnahmen/Taetigkeitsbericht/tb_2019_hp.pdf
• https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/AB/AB_00121/index.shtml
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
"Die Bundesregierung, und insbesondere der Bundesminister für Finanzen, werden aufgefordert, dem Nationalrat eine Gesetzesinitiative vorzulegen, die eine Abschaffung der Rechtsgeschäftsgebühren zum Inhalt hat. Sämtliche mit der Einhebung dieser Gebühren verknüpften Planstellen soll damit eingespart werden."
*****
Präsidentin Doris Bures: Der Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht und steht somit auch mit in Verhandlung.
Nächster Redner ist Herr Abgeordneter Christoph Matznetter. – Bitte.
Abgeordneter Dr. Christoph Matznetter (SPÖ): Frau Präsidentin! Frau Präsidentin des Rechnungshofes! Herr Finanzminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben sehr oft die grüne Regierungsfraktion kritisiert, heute möchte ich mit einem Kompliment beginnen. Heute waren es ausnahmsweise nicht die grünen Abgeordneten, die diesen Unsinn der Kontrollmöglichkeit bei der Cofag durch Entsendung von Beiratsmitgliedern beworben haben. Hervorgetan mit dieser sonderbaren Argumentation haben sich wie immer die ÖVP-Abgeordneten.
Wir wollen einmal klarstellen, was das heißt: Es war 2020 ein unfassbarer Vorgang! Es wird aus der Krisensituation quasi freihändig die Vergabe von zig Milliarden Euro beschlossen. Und das findet nicht durch staatliche Organe statt, die der ganz normalen Kontrolle, der Ingerenz des Finanzministers und damit der parlamentarischen Kontrolle unterliegen – nein! Es wird eine Blackbox errichtet – unfassbar! Und das Argument, das dann gebracht wird – na ja, ihr hättet ja Beiratsmitglieder entsenden können –, ist in sich absurd, denn diese sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.
Nicht so schauen! Am Plakat der Grünen stand bei der letzten Nationalratswahl: Der Anstand würde Grün wählen. – Der hat wegen dieser Fehlentscheidung inzwischen einen Antrag auf politisches Asyl in Skandinavien stellen müssen, denn der Anstand hätte verlangt, dass eine grüne Regierungspartei, die sich Transparenz auf die Fahnen geschrieben hat, die gesagt hat, wir wollen Informationsfreiheit, längst mit uns zusammen den parlamentarischen Unterausschuss eingerichtet hätte, um lückenlos zu kontrollieren, wo das Geld hingeflossen ist. Das habt ihr verhindert! (Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordneten der FPÖ. – Zwischenrufe bei den Grünen.) – Bei diesen Zwischenrufen ziehe ich mein Kompliment gleich zurück.
Ich komme zur Frage zurück, was das für einen Rechnungsabschluss heißt, bei dem es für das Parlament nicht möglich war, einen wesentlichen Bestandteil zu kontrollieren. Das Allerbeste ist dann noch, wenn Kollegin Baumgartner von der ÖVP sagt: Na, es war ja wunderbar transparent, denn es gab ja die EU-Transparenzdatenbank. – Zum Glück gibt es diese, aber die hätten Sie am liebsten auch verhindert, denn was wir bei den Förderungen über 100 000 Euro gesehen haben, war, wer die wirklichen Profiteure waren.
Da finden wir sie wieder: Herr Pierer hat bei der KTM genau so viel öffentliche Förderungen bekommen, wie er sich Dividende ausgezahlt hat. Da gab es das System McDonald’s. – Sie erinnern sich, meine Damen und Herren: Die Gasthäuser, die Wirtshäuser haben alle zu gehabt, die Autokolonnen standen beim Drive-in von McDonald’s. Die haben die höchsten Förderanteile kassiert. Starbucks hat so viele Förderungen in Anspruch genommen, dass es bei der derzeitigen durchschnittlichen Steuerleistung der letzten 15 Jahre über 250 Jahre – das ist ein Vierteljahrtausend – Ertragssteuern zahlen müsste, um so viel einzuzahlen, wie es in einem Jahr bekommen hat.
Das ist in der Blackbox Cofag passiert. Ich habe alleine auf der Homepage www.blackbox-cofag.at mit heutigem Stand 984 Beschwerden, darunter viele Hunderte von Personen, die im November, im Jänner beantragt haben und bis heute das Geld nicht haben. (Abg. Obernosterer: Na, na!)
Es kommt dann noch der ÖVP-Kollege und sagt: Na, in Italien hat das ja vier Monate gedauert. – Sie sollten sich lieber an diesen Herrn hier (in Richtung Bundesminister Blümel weisend) wenden und mit uns beim Misstrauensantrag aufstehen, denn er hat im Jänner versprochen, er kümmert sich um jeden Fall. Er hat sich leider um keinen einzigen Fall gekümmert, weil Ihnen die kleinen Selbstständigen am Ende des Tages einfach egal sind. (Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordneten der FPÖ.)
Das sieht man ja an dem, was bei der Steuerreform kommt. Es wird die KöSt en gros gesenkt, aber die Mindestkörperschaftsteuer – vergessen, Herr Wöginger? Da zahlen kleine Unternehmen, wenn sie null Gewinn oder einen Verlust haben, unendlich viel Körperschaftsteuer. Das haben Sie nicht abgeschafft, daran haben Sie nicht gedacht, nein, aber bei KTM kann es dann wieder ein bisschen mehr für Herrn Pierer sein. Der kann dann wieder das Portemonnaie aufmachen, wenn ein Wahlkampf ansteht.
Warum macht ihr das? – Ich verstehe es nicht. Versucht doch als Ausgleich den Kleineren mehr zu geben und dort, wo es notwendig ist, zu kassieren! Selbst Herr Biden schafft es, dass man die Körperschaftsteuer wieder anpasst, die Deutschen haben eine
weitaus höhere. Warum gebt ihr in diesem Bereich das Geld ein paar wenigen, anstatt es den kleinen Unternehmern und den kleinen Selbstständigen zu geben, wenn ihr schon für die Arbeitnehmer nicht einmal die kalte Progression ausgleicht?
Ich wünsche mir ein bisschen mehr Engagement für Kleine und ein bisschen weniger Sahnehäubchen für die Großen. Das würde auch der ÖVP sehr guttun. – Danke. (Beifall bei der SPÖ.)
12.56
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Andreas Ottenschläger. – Bitte.
Abgeordneter Andreas Ottenschläger (ÖVP): Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Werte Zuseherinnen und Zuseher! Herr Kollege Matznetter hat jetzt – ich weiß nicht, zum wievielten Mal – die Cofag kritisiert. Das sei ihm natürlich unbenommen. Ich möchte vor allem für die Zuseherinnen und Zuseher noch einmal klipp und klar feststellen:
Erstens: Es gibt ein parlamentarisches Kontrollinstrument – das wissen Sie –, das ist der Rechnungshof – die Frau Präsidentin sitzt hier –, und dieser Rechnungshof prüft die Cofag. Das sollte man auch einmal zur Kenntnis nehmen. Das tun Sie vielleicht nicht, aber für die Zuseherinnen und Zuseher sei das hier einmal klargestellt. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
Zum Zweiten: Sie haben ja selbst gesagt, es gibt auch die Transparenzdatenbank auf europäischer Ebene, wo man ab einer gewissen Größenordnung einsehen kann, welche Unternehmen welche Förderungen oder Unterstützungsleistungen erhalten haben. Ich finde es von Ihnen nicht richtig, dann immer einzelne Unternehmen herauszuziehen. Es haben Zigtausende Unternehmen diese Förderung bekommen. Kollege Obernosterer hat es heute auch schon gesagt: Bei der Cofag sind über eine Million Anträge abgearbeitet worden. – Herr Kollege Matznetter von der SPÖ, da können Sie sich selbst ausrechnen, wie viele Klein- und Mittelbetriebe dabei sind und ihr Geld erhalten haben. Schauen Sie es sich dann auch einmal im internationalen Vergleich an, dabei sind wir absolute Topklasse! (Beifall bei ÖVP und Grünen. – Abg. Haubner: Genau!)
Zum Dritten: Sie ziehen den Beirat, in dem die Sozialpartner drinnen sind und in den Sie ebenfalls eingeladen wurden, immer so ins Lächerliche. Wenn Sie das schon nicht als Kontrollfunktion sehen wollen, so hätten Sie dort – und das ist das, was wir dort immer wieder tun – einen Beitrag zur Verbesserung dieser Unterstützungsmaßnahmen leisten können. Dieses Angebot haben Sie immer ausgeschlagen, denn dazu haben Sie wahrscheinlich keine Ideen gehabt. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
12.59
Präsidentin Doris Bures: Zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Gerhard Kaniak. – Bitte.
Abgeordneter Mag. Gerhard Kaniak (FPÖ): Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Sehr geehrte Rechnungshofpräsidentin! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer! Wir haben nun eine sehr lange Debatte über den Rechnungsabschluss 2020 gehört. Von vielen Rednern vor mir wurde richtigerweise die Coronakrise als das maßgebliche Ereignis benannt, welches den Budgethaushalt natürlich massiv durcheinandergeworfen hat. Sehen wir uns aber die Zahlen doch einmal tatsächlich aus gesundheitspolitischer Sicht an! Es freut mich, dass nun auch wieder so viele Kolleginnen und Kollegen da sind, um sich diese Ausführungen anzuhören. (Abg. Obernosterer: ... abstimmen! – Weiterer Zwischenruf bei der ÖVP.)
Die Bundesregierung hat es im Jahr 2020 zusammengebracht, im Bundeshaushalt circa 30 Prozent mehr Geld auszugeben, als eingenommen wurde. Auf Bundesebene wurde ein Gesamtdefizit von 22,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. Wie viel, glauben Sie, ist davon tatsächlich in den Gesundheitsbereich geflossen? – 610 Millionen Euro, keine 3 Prozent, sind tatsächlich in den Gesundheitssektor geflossen, um damit die Krise zu bewältigen. Wofür wurden diese 610 Millionen Euro ausgegeben? – Die wurden großteils für die überteuerte und verspätete Anschaffung von Schutzausrüstung – in den meisten Fällen ohne jegliche ordentliche Ausschreibung – und für PCR-Testungen, die vielfach nicht zielgerichtet eingesetzt wurden und ebenfalls überteuert gekauft wurden, ausgegeben.
Wurden zusätzliche Behandlungskapazitäten geschaffen? Wurden die Pfleger im intensivmedizinischen Bereich besser entlohnt? – Nein, Fehlanzeige. Nichts dergleichen ist erfolgt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn das Budget die in Zahlen gegossene Politik ist, dann müssen wir uns anhand dieser Zahlen auch anschauen, welcher Erfolg mit diesem Budget bewerkstelligt wurde. In einigen Medienhäusern liegt schon ein Rohbericht des Rechnungshofes vor, der das Krisenmanagement der Bundesregierung im Jahr 2020 und auch den Gesundheitsbereich analysiert hat. Ich erzähle Ihnen, was da zur Gesundheitsversorgung der Österreicherinnen und Österreicher im Jahr 2020 drinsteht:
Da steht drin, dass es im Jahr 2020 um 6,55 Millionen weniger Arzt-Patienten-Kontakte gegeben hat. Da steht drin, dass es im Jahr 2020 um 135 000 weniger Vorsorgeuntersuchungen gegeben hat. Da steht drin, dass es in den österreichischen Spitälern in den Ambulanzen um 3,8 Millionen weniger ambulante Behandlungen gegeben hat. Da steht drin, dass es in den österreichischen Spitälern um 1,8 Millionen weniger Belegstage auf den Normalstationen gegeben hat. Die Überlastung der Intensivstationen wurde bereits thematisiert. In dem Bericht steht auch drin, dass es auf den österreichischen Intensivstationen 32 000 Belegstage weniger gegeben hat. Ja meine sehr geehrten Damen und Herren, inwiefern passt denn das zusammen? – Überhaupt nicht. (Beifall bei der FPÖ.)
Da wurde offensichtlich auf der komplett falschen Seite gespart und das Geld für Sachen ausgegeben, die überhaupt keinen Effekt zur Krisenbewältigung gehabt haben. Das Geld wurde nämlich dafür ausgegeben, die überschießenden, unverhältnismäßigen Maßnahmen der Bundesregierung zu kaschieren und zu korrigieren. Es wurde im Bereich der Wirtschaft und der Ersatzzahlungen ausgegeben, anstatt diese Krise im Gesundheitsbereich ordentlich abzuarbeiten und zu bewältigen. Das ist die Wahrheit, meine sehr geehrten Damen und Herren, und es ist eine erschütternde Wahrheit. (Beifall bei der FPÖ.)
Wer nun glaubt, dass das Ganze 2021 mit den laufenden Budgets besser geworden ist, den muss ich enttäuschen. Im entscheidenden Bereich der Krankenanstaltenfinanzierung wurde das Budget um über 130 Millionen Euro gekürzt, nicht erhöht – darauf haben wir schon im Herbst 2020 hingewiesen. Auch für das kommende Budget 2022 ist diesbezüglich gerade einmal eine natürliche Anhebung auf den Stand vor der Coronakrise vorgesehen, aber keine aktive Aufstockung der Kapazitäten, keine zusätzlichen Mittel für die Anschaffung von alternativen Medikamenten zur Covid-Therapie.
Nein, es sind 550 Millionen Euro zur weiteren Anschaffung von Impfstoffen vorgesehen, ohne dass dazugesagt wird, dass geplant ist, allein in den nächsten zwölf Monaten Impfstoffe im Wert von 100 Millionen Euro zu verschenken. Der Herr Gesundheitsminister, der jetzt nicht mehr da ist, hat das auch in der letzten Sitzung des Gesundheitsausschusses bestätigt. Da frage ich mich: Bei uns fehlt in den Spitälern das Personal; da fehlt das Geld für eine anständige Entlohnung der intensivmedizinischen Pflege, der Ärzte im Pflegebereich und jener im niedergelassenen Bereich sowieso – aber gleichzeitig
werden einfach 100 Millionen Euro verschenkt, die bei uns selbst zur Krisenbewältigung für das eigene Gesundheitssystem notwendig gewesen wären?! Das ist doch eine Riesensauerei, meine sehr geehrten Damen und Herren! (Beifall bei der FPÖ. – Zwischenruf des Abg. Zarits.)
Es ist auch scheinheilig von jedem Abgeordneten der Regierungsfraktionen, der heute da sitzt und diese Schleife trägt. Zum Thema Brustkrebsvorsorge weiß man, dass die Zahl der Vorsorgeuntersuchungen stark abgenommen hat und dass allein im Jahr 2020 aufgrund der mangelnden Vorsorgeuntersuchungen um 11 Prozent weniger Krebsdiagnosen als im Jahr davor gestellt wurden. Das sind allein im Jahr 2020 mehr als 550 nicht erkannte Krebserkrankungen. Die Bilanz im Jahr 2021 wird nicht viel besser sein, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Deshalb sage ich, die Bundesregierung wäre gut beraten, ihren Budgetentwurf noch einmal ordentlich zu überarbeiten, die Mittel für den tatsächlichen therapeutischen Bereich und für die Gesundheitsversorgung im Allgemeinen massiv aufzustocken und aufzuhören, mit beiden Händen Geld zu verteilen, das der österreichische Staat gar nicht mehr hat – stattdessen sollte sie über das Gesundheitssystem zielgerichtet in die Bewältigung dieser Krise investieren. – Vielen Dank. (Beifall bei der FPÖ.)
13.05
Präsidentin Doris Bures: Herr Abgeordneter, Sie wissen, dass wir Ausdrücke wie „scheinheilig“ und „Sauerei“ an sich in Debatten nicht verwenden. Ich würde ersuchen, dass wir im weiteren Verlauf auf diese Ausdrücke verzichten – bei aller Emotion, die die eine oder andere Debatte auslöst. (Zwischenruf der Abg. Baumgartner.)
Zu Wort ist dazu nun niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
Wünscht der Herr Berichterstatter ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall.
Ansprache der Zweiten Präsidentin anlässlich des Tages des metastasierten Brustkrebses
Präsidentin Doris Bures: Bevor ich frage, ob wir zu den Abstimmungen gelangen können, möchte ich mich bedanken. Sie wissen alle, dass heute der Tag des metastasierten Brustkrebses ist und dass das österreichische Parlament mittlerweile seit zehn Jahren im Brustkrebsmonat Oktober über seinem Eingang die große rosa Schleife trägt. Ich möchte mich heute bei Ihnen allen, bei allen Fraktionen des Parlaments, bedanken, dass auch wir diese Schleife als Zeichen der Solidarität mit den betroffenen Frauen und ihren Familien tragen. Ich bedanke mich bei der Österreichischen Krebshilfe für ihren tagtäglichen Einsatz für die Frauen und ihre Familien. Ich freue mich von ganzem Herzen, heute hier im Hohen Haus 20 betroffene Frauen begrüßen zu dürfen. (Anhaltender allgemeiner Beifall.)
*****
Präsidentin Doris Bures: Ich frage nun, ob wir gleich zum Abstimmungsvorgang übergehen können. – Das ist der Fall.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 1062 der Beilagen.
Wer sich für den Gesetzentwurf ausspricht, den bitte ich um ein zustimmendes Zeichen. – Das ist mit Mehrheit so angenommen.
Wir gelangen sogleich zur dritten Lesung.
Wer stimmt dem Gesetzentwurf in dritter Lesung zu? – Der Gesetzentwurf ist in dritter Lesung mit Mehrheit angenommen.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Hubert Fuchs, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Abschaffung der Kalten Progression“.
Wer sich für diesen Entschließungsantrag ausspricht, den bitte ich um ein zustimmendes Zeichen. – Dieser Entschließungsantrag hat nicht die Mehrheit gefunden und ist abgelehnt.
Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Julia Herr, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Klimainvestitionen statt Körperschaftssteuer-Geschenke für Konzerne“.
Wer ist für diesen Entschließungsantrag? – Das ist die Minderheit, abgelehnt.
Wir stimmen ab über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Erwin Angerer, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Energiearmut bekämpfen“.
Wer für diesen Entschließungsantrag ist, den bitte ich um ein Zeichen. – Der Antrag hat nicht die Mehrheit gefunden, abgelehnt.
Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Kalte Progression JETZT abschaffen!“.
Wer ist für diesen Entschließungsantrag? – Das ist die Minderheit, abgelehnt.
Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Martina Künsberg Sarre, Kolleginnen und Kollegen betreffend „EUR 1,2 Mrd. und Rechtsanspruch auf Nachmittagsbetreuung“.
Wer sich dafür ausspricht, den bitte ich um ein zustimmendes Zeichen. – Das ist die Minderheit, abgelehnt.
Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Abschaffung der Rechtsgeschäftsgebühren“.
Wer sich dafür ausspricht, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist die Minderheit, abgelehnt.
Bericht des Ausschusses für Forschung, Innovation und Digitalisierung über die Regierungsvorlage (1043 d.B.): Bundesgesetz, mit dem ein Telekommunikationsgesetz erlassen (Telekommunikationsgesetz 2021 – TKG 2021), das KommAustria-Gesetz (KommAustria-Gesetz – KOG), die Strafprozeßordnung 1975 (StPO), das Polizeikooperationsgesetz (PolKG), das Polizeiliche Staatsschutzgesetz (PStSG), das Sicherheitspolizeigesetz (SPG), das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018), das Börsegesetz 2018 (BörseG 2018), das Postmarktgesetz (PMG), das Kraftfahrgesetz 1967 (KFG 1967), das Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMAG 2016), das Funker-Zeugnisgesetz 1998 (FZG), das Rundfunkgebührengesetz (RGG), das Fernsprechentgeltzuschussgesetz (FeZG) und das Audiovisuelle Mediendienste-Gesetz (AMD-G) geändert werden (1080 d.B.)
4. Punkt
Bericht des Ausschusses für Forschung, Innovation und Digitalisierung über den Antrag 1276/A(E) der Abgeordneten Mag. Verena Nussbaum, Kolleginnen und Kollegen betreffend Barrierefreie Kommunikation bei Notrufnummern endlich umsetzen! (1081 d.B.)
5. Punkt
Bericht des Ausschusses für Forschung, Innovation und Digitalisierung über den Antrag 1730/A(E) der Abgeordneten Mag. Dr. Petra Oberrauner, Kolleginnen und Kollegen betreffend freie Endgerätewahl beim Internetzugang (1082 d.B.)
Präsidentin Doris Bures: Wir gelangen nun zu den Punkten 3 bis 5 der Tagesordnung, über welche die Debatten unter einem durchgeführt werden.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Erste Rednerin ist Frau Abgeordnete Petra Oberrauner. – Bitte, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete Mag. Dr. Petra Oberrauner (SPÖ): Frau Präsidentin! Frau Ministerin! Kolleginnen und Kollegen! Geschätzte Zuseherinnen und Zuseher zu Hause! Die Überarbeitung des Telekommunikationsgesetzes hat sehr lange gedauert, über drei Jahre, und wir hatten jetzt als Parlamentarier drei Wochen Zeit, das zu begutachten. Ich bedanke mich in diesem Zusammenhang bei den Expertinnen und Experten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dafür, dass sie so schnell und so kompetent gearbeitet haben.
Es gibt bei diesem Entwurf viele Punkte, die sich zum Positiven verändert haben. So wurde zum Beispiel die Definition der Kleinst- und Kleinbetriebe an die österreichischen Verhältnisse angepasst. Das ist gut. Die kleinen Unternehmen werden jetzt bessergestellt und privaten Personen gleichgestellt. Das heißt, wenn sie einen Vertrag unterschreiben, müssen sie nicht mehr komplizierte Vertragswerke durchforsten – wofür sie weder Geld noch Zeit, noch Personal haben.
Die Haftungsregeln wurden verbessert, die Haftung ist jetzt zwischen Betreibern und Grundeigentümern ausgewogen. Die ein Jahr verpflichtende E-Mail-Weiterleitung ist ein guter Punkt. Was die Notfall-SMS betrifft, so war die Verbesserung für Gehörlose oder Gehörbeeinträchtigte in diesem Zusammenhang auch unser Wunsch.
Es gibt aber auch erhebliche Verschlechterungen für die Konsumenten und Konsumentinnen. Das bisherige Recht der VerbraucherInnen, kostenlos aus Verträgen auszusteigen, die einseitig vom Anbieter verändert werden, gibt es nicht mehr. Es wurde gekippt und es gibt jetzt die Formulierung der Abschlagszahlungen oder der Rückgabe der Smartphones.
In der Praxis wird damit der Vorgangsweise Vorschub geleistet, dass Personen durch Billigtarife dazu motiviert werden, einen Vertrag abzuschließen, aber wenn die Angebotszeit vorbei ist, kann der Anbieter diese Tarife dann nach Belieben und einseitig erhöhen. Das halten wir für nicht in Ordnung. Deshalb wird es von uns zu diesem Punkt keine Zustimmung geben. (Beifall bei der SPÖ.)
Ein weiterer schwieriger Punkt ist, wie im TKG mit dem Entfall der Informationsverpflichtung umgegangen werden soll. Die jetzige Formulierung halten wir für nicht klar genug: Geht es hier um eine Klarstellung, dass im Falle eines Notrufes keine Information erfolgt, oder entfallen sämtliche Informationspflichten? Werden Österreicherinnen und Österreicher also nicht mehr im Nachhinein darüber informiert, ob ihre Stammdaten oder ihre Standorte abgefragt wurden?
Das ist eine extrem sensible Materie. Da geht es darum, dass in die grundlegenden Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger eingegriffen wird. Deshalb muss sichergestellt sein, und zwar auch im Gesetzestext, dass es keine Gesetzeslücken gibt, durch die diese Grundrechte für Bürgerinnen und Bürger durch den Staat eingeschränkt werden. (Beifall bei der SPÖ.)
Unsere Verbesserungsvorschläge, in denen es darum ging, sicherzustellen, dass Kundinnen und Kunden kostenfrei aus den Verträgen aussteigen können, die der Anbieter
zu ihrem Nachteil verändert, in denen es darum ging, sicherzustellen, dass die Bürgerinnen und Bürger darüber informiert werden, wenn ihre Standortdaten und ihre Stammdaten abgefragt werden, all diese Verbesserungsvorschläge wurden von den Regierungsparteien abgelehnt. Ohne diese entscheidenden Verbesserungen können wir diesem Gesetz nicht zustimmen. – Danke. (Beifall bei der SPÖ.)
13.14
Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Eva-Maria Himmelbauer. – Bitte.
Abgeordnete Eva-Maria Himmelbauer, BSc (ÖVP): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Geschätzte Frau Ministerin! Werte BesucherInnen! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Hohes Haus! Ich freue mich sehr darüber, dass dieses Telekommunikationsgesetz heute hier zur Beschlussfassung vorliegt.
Es liegt eine umfassende Novelle des TKG vor. Einerseits wird das Gesetz neu kodifiziert, nämlich anstelle eines Gesetzestextes, der aus 2003 stammt und seitdem mehrfach überarbeitet worden ist – 2003, wenn man sich das vorstellt: Damals hatten nur 37 Prozent der Haushalte einen Internetanschluss. Damals sind gerade die Handys mit Kamerafunktion aufgekommen, 0,1 Megapixel war damals schon eine Errungenschaft. Das war also durchaus eine Zeit, die bereits vergangen ist, und jetzt haben wir die Neukodifizierung; das heißt, das Gesetz wurde neu geschrieben, neu strukturiert und soll somit für den Anwender, für die Anwenderin leichter lesbar werden.
Wir machen nicht nur eine Neukodifizierung, sondern wir setzen auch den EECC um. Das ist eine Richtlinie, die sich mit der elektronischen Kommunikation, mit Kommunikationsnetzen und -diensten auseinandersetzt und diese regelt. Das klingt vielleicht im ersten Moment nicht so aufregend, aber das TKG ist die Grundlage für den Telekommunikationsmarkt in Österreich. Es regelt zum Teil den Ausbau des Breitbandnetzes – und nicht erst seit der Pandemie mit Homeoffice und Distancelearning ist uns bewusst, wie wichtig es ist, schnelles und leistungsfähiges Internet zu haben.
Das TKG regelt auch den Konsumentenschutz, es regelt datenschutzrechtliche Aspekte, es regelt Cybersicherheitsaspekte im Telekommunikationsmarkt und auch die Frequenzvergabe.
Somit gibt es hier und heute einige Neuerungen, die wir mit der Richtlinienumsetzung umgesetzt haben. So wird ein Notfall- und Katastrophenwarnsystem eingesetzt, das Bürgerinnen und Bürger per SMS oder Ähnlichem informiert, wenn es zu einer Gefahrensituation kommt, nämlich im ganzen Land oder auch nur in einer bestimmten Region.
Es gibt für Menschen mit besonderen Bedürfnissen nun die Möglichkeit, die Notrufnummer 112 textbasiert zu nutzen. Das heißt, wenn diesbezüglich Einschränkungen bestehen, gibt es die Möglichkeit, per SMS einen Notruf abzusetzen. Auch für Menschen, die vielleicht in einer Gefahrensituation sind, in der sie gerade nicht telefonieren können, ist es wichtig, dass sie diese Möglichkeit eines textbasierten Notrufs haben.
Wir vereinfachen einiges im Bereich der Kooperation zwischen Telekommunikationsunternehmen. Wir alle wollen einen Mobilfunk vor Ort haben, wir alle wollen mobil surfen, aber was wir nicht wollen, ist ein Sendemastenwald, der überall wächst. Somit sollen zum Beispiel Sendemasten von den unterschiedlichen Unternehmen auch gemeinsam genutzt werden, um dem Einhalt zu gebieten.
Wir stellen Konsumentinnen und Konsumenten bei Vertragsabschluss alle wichtigen, zentralen Informationen der Vertragsbestandteile zur Verfügung, damit diese das bei Vertragsabschluss auf einen Blick erkennen, sehen können und bestmöglich informiert werden können. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
Was auch relevant ist: Wir schieben auch der leidigen Praxis von Bis-zu-Paketen im Internetbereich einen Riegel vor, indem wir der Regulierungsbehörde die Möglichkeit geben, eine Verordnung zu erstellen, in der klar und transparent geregelt werden muss, was ein Anbieter bei seinen Paketen auflisten kann. Nichts ist nämlich ärgerlicher, als wenn ich ein Paket mit einem Tarif, mit einer Download- und Uploadgeschwindigkeit beziehe, die ich aber in Wahrheit nie oder nur um 3 Uhr in der Früh erreichen kann, also zu einer Zeit, zu der ich nicht am PC sitze, nicht am Computer surfe oder arbeiten muss. Auch damit gehen wir einen wichtigen Schritt.
Es gäbe noch viel mehr dazu zu sagen. Meine Kollegin Reiter und mein Kollege Smolle werden sich sicherlich auch noch auf die regionalen Auswirkungen des Telekommunikationsgesetzes beziehen.
Ich darf aber abschließend noch ein paar wichtige Punkte einbringen, nämlich einen Abänderungsantrag und zwei Entschließungsanträge, die sich teilweise auf den Amateurfunkbereich beziehen. Der Amateurfunkdienst ist eine sehr wichtige Funktion in unserem Land, vor allem im Not- und Katastrophendienst. Ich möchte das heute an dieser Stelle voranstellen und natürlich einen persönlichen Dank für die Bereitschaft und den Einsatz der Amateurfunker aussprechen. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
Im Zuge der Überarbeitung des Telekommunikationsgesetzes wurden an uns einige Vorschläge und Bitten herangetragen. Nicht allen konnten wir gerecht werden, nicht alles konnte umgesetzt werden. Wir möchten heute aber sicherstellen, dass es für Amateurfunker zu einer Liberalisierung kommt und dass deren Lizenzverlängerungen weniger bürokratisch ablaufen.
In diesem Sinne darf ich einen Abänderungsantrag der Abgeordneten Eva-Maria Himmelbauer, BSc, Süleyman Zorba, Kolleginnen und Kollegen einbringen, eingebracht im Zuge der Debatte zu 1080 der Beilagen. Der Antrag liegt Ihnen schon vor, sodass ich ihn nur kurz inhaltlich erläutern darf.
Zum einen geht es bei der Lizenzverlängerung von Amateurfunklizenzen darum, dass diese unbürokratisch vonstattengehen und sehr einfach erfolgen kann. Wir setzen redaktionelle Änderungen um, die bei einem so umfangreichen Gesetz notwendig sein können. Wir führen Umsetzungsfristen für einzelne technische Schritte ein, die bei Inkrafttreten des Gesetzes mit 1. Dezember, so wie es geplant wäre, durch Provider noch nicht zu bewerkstelligen wären, was so eine Übergangsfrist notwendig macht.
*****
Ich hoffe, dass ich somit den Antrag ausreichend erläutert habe.
Ich darf auch noch zwei Entschließungsanträge einbringen, die sich spezifisch auf den Amateurfunkdienst beziehen:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Eva-Maria Himmelbauer, BSc, Süleyman Zorba, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Relaisfunkstellen“, eingebracht im Zuge der Debatte zu 1080 der Beilagen, TOP 3
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus wird ersucht, zu prüfen, ob es im Bereich des Amateurfunkes zu teilweisen Gebührenreduktion bzw. ‑befreiungen kommen kann. So ist auch zu prüfen, ob die Gebühren bei Relaisfunkstellen entfallen bzw. entsprechend der tatsächlichen Leistungsstufe festgelegt werden können.“
*****
Zum Zweiten bringe ich folgenden Antrag ein:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Eva-Maria Himmelbauer, BSc, Süleyman Zorba, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Amateurfunkprüfungen“, eingebracht im Zuge der Debatte zu 1080 der Beilagen, TOP 3
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus wird ersucht, eine Regelung zu erarbeiten, mittels welcher die Prüfungskommission für die Amateurfunkprüfungen bezüglich einer anderen als der höchsten Bewilligungsklasse künftig ausschließlich aus durch das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus bestellten und erfahrenen Funkamateuren bestehen kann.“
*****
Damit erreichen wir auch, dass die Funkamateure, die jetzt schon einen wesentlichen Beitrag zur Ausbildung liefern, auch in Zukunft ihre Prüfungen abhalten können.
Abschließend ein Danke an alle Beteiligten, die an dem Telekommunikationsgesetz mitgearbeitet haben. Danke an das Ministerium, an die Beamten, die dabei sehr federführend tätig waren, aber natürlich auch an meinen Koalitionspartner, namentlich Herrn Abgeordneten Zorba. Danke an alle, die sich bereit erklärt haben, uns mit Inputs entgegenzukommen. Ich hoffe auf Ihre Zustimmung. – Danke. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
13.22
Die Anträge haben folgenden Gesamtwortlaut:
Abänderungsantrag
der Abgeordneten Himmelbauer, Zorba
Kolleginnen und Kollegen
eingebracht im Zuge der Debatte über den Bericht des Ausschusses für Forschung, Innovation und Digitalisierung über die Regierungsvorlage (1043 d.B.): Bundesgesetz, mit dem ein Telekommunikationsgesetz erlassen (Telekommunikationsgesetz 2021 – TKG 2021), das KommAustria-Gesetz (KommAustria-Gesetz – KOG), die Strafprozeßordnung 1975 (StPO), das Polizeikooperationsgesetz (PolKG), das Polizeiliche Staatsschutzgesetz (PStSG), das Sicherheitspolizeigesetz (SPG), das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018), das Börsegesetz 2018 (BörseG 2018), das Postmarktgesetz (PMG), das Kraftfahrgesetz 1967 (KFG 1967), das Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMAG 2016), das Funker-Zeugnisgesetz 1998 (FZG), das Rundfunkgebührengesetz (RGG), das Fernsprechentgeltzuschussgesetz (FeZG) und das Audiovisuelle Mediendienste-Gesetz (AMD-G) geändert werden (1080 d.B.)
Der Nationalrat wolle in 2. Lesung beschließen:
Die eingangs bezeichnete Regierungsvorlage wird wie folgt geändert:
1. In Artikel 1 § 4 Z 61 entfällt der Doppelpunkt nach der Wendung „„Objekt““.
2. In Artikel 1 lauten § 39 Abs. 2 und 3:
„(2) Die Bewilligung ist außer in den Fällen des Abs. 6 sowie des § 38 Abs. 5 auf zehn Jahre befristet zu erteilen. Wenn die Bewilligung mit zehn Jahren befristet wurde, informiert die Behörde den Bewilligungsinhaber sechs Monate vor Ablauf der Befristung. In
dieser Information ist dem Bewilligungsinhaber die Möglichkeit einzuräumen, binnen drei Monaten der Fernmeldebehörde mitzuteilen, dass die Amateurfunkbewilligung im selben Umfang und mit dem in der erloschenen Amateurfunkbewilligung zugewiesenen Rufzeichen um weitere zehn Jahre verlängert werden soll, eine solche Mitteilung gilt als Antrag im Sinn des § 35.
(3) In der Amateurfunkbewilligung ist dem Antragsteller ein Rufzeichen zuzuweisen. Wird dem Funkamateur innerhalb von fünf Jahren nach Erlöschen der ihm erteilten Amateurfunkbewilligung neuerlich eine Amateurfunkbewilligung erteilt, ist diese auf Wunsch des Funkamateurs im selben Umfang und mit dem in der erloschenen Amateurfunkbewilligung zugewiesenen Rufzeichen neuerlich zuzuweisen. Die Laufzeit einer im Sinn des Abs. 2 verlängerten Amateurfunkbewilligung beginnt mit Ablauf der bisherigen Bewilligung.“
3. In Artikel 1 § 45 Abs. 11 wird das Wort „fünf“ durch das Wort „sechs“ ersetzt.
4. In Artikel 1 § 59 Abs. 5 wird der Ausdruck „Abs. 3“ durch den Ausdruck „Abs. 4“ ersetzt.
5.In Artikel 1 § 89 Abs. 4 lautet der 1. Satz:
„Die Regulierungsbehörde hat die Märkte für elektronische Kommunikation zu beobachten und berücksichtigt die Auswirkungen neuer Marktentwicklungen, unter anderem im Zusammenhang mit kommerziellen Vereinbarungen, die die Wettbewerbsdynamik beeinflussen.“
6. In Artikel 1 § 107 Abs. 6 wird das Wort „Bundesgeseztes“ durch das Wort „Bundesgesetzes“ ersetzt.
7. In Artikel 1 § 114 Abs. 6 wird die Wortfolge „innerhalb von 2 Wochen“ durch die Wortfolge „in der in der Verordnung gemäß Abs. 7 vorgesehenen Frist“ ersetzt.
8. In Artikel 1 § 133 Abs. 4 wird das Wort „zwei“ durch das Wort „drei“ ersetzt.
9. In Artikel 1 § 144 entfällt der letzte Satz.
10. Die Überschrift des Artikel 1 § 181 lautet „Informationspflichten“.
11. Artikel 1 § 181 Abs. 12 lautet:
„(12) Das Fernmeldebüro hat die Anwendung der Verordnung (EU) 2020/1070 zu überwachen, dabei insbesondere die Anwendung des Artikels 3 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2020/1070 und der Europäischen Kommission darüber jährlich Bericht zu erstatten.“
12. Der Strichpunkt nach Artikel 1 § 188 Abs. 4 Z 28 wird durch einen Punkt ersetzt.
13. In Artikel 1 § 200 Abs. 1 wird die Wendung „Z 13 und 17“ durch die Wendung „Z 13, 17 und 20“ ersetzt.
14. In Artikel 1 § 212 Abs. 8 Z 1 wird die Jahreszahl „2022“ durch die Jahreszahl „2024“ ersetzt.
15. In Artikel 1 § 212 Abs. 8 Z 2 wird die Jahreszahl „2023“ durch die Jahreszahl „2025“ ersetzt.
16. In Artikel 1 § 212 Abs. 8 Z 3 wird die Jahreszahl „2024“ durch die Jahreszahl „2026“ ersetzt.
17. In Artikel 1 § 212 Abs. 8 Z 4 wird die Jahreszahl „2025“ durch die Jahreszahl „2027“ ersetzt.
18. In Artikel 1 § 212 Abs. 8 Z 5 wird die Jahreszahl „2026“ durch die Jahreszahl „2028“ ersetzt.
19. In Artikel 1 § 212 Abs. 8 wird im Schlussteil die Jahreszahl „2027“ durch die Jahreszahl „2029“ ersetzt.
20. Nach Artikel 1 § 212 Abs. 15 werden folgende Abs. 16 und 17 angefügt:
„(16) Die Verpflichtung des Anbieters zur Weiterleitung nach § 144 besteht ab einem Jahr nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes.
(17) Die für die Erfüllung der in den §§ 118, 119, 124, 135 Abs. 4, 135 Abs. 7, 135 Abs. 8, 135 Abs. 11, 136, 138 Abs. 5 und 138 Abs. 6 vorgesehenen Pflichten der Betreiber gegenüber Endnutzern erforderlichen technischen oder organisatorischen Vorkehrungen sind unverzüglich, spätestens jedoch bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes umzusetzen. Bis zu diesem Zeitpunkt sind gegenüber dem Endnutzer weiterhin jene Pflichten sinngemäß anzuwenden, welche sich aus der bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes bestehenden und auf den neuen Sachverhalt anwendbaren Rechtslage ableiten lassen.“
Dieser Antrag wird begründet wie folgt:
Begründung
Zu Z 1
Bei Begriffsdefintionen ist kein Doppelpunkt zu setzen, daher wird dieser gestrichen.
Zu Z 2
Damit wird klargestellt, dass eine abgelaufene Amateurfunkbewilligung nach Information durch die Behörde im selben Umfang und mit dem selben Rufzeichen durch formlosen Antrag verlängert werden kann.
Zu Z 3
Das Quorum für den Beirat wird an die Anzahl der Mitglieder angepasst.
Zu Z 4
Es handelt sich um ein Redaktionsversehen, das bereinigt wird.
Zu Z 5
Durch die Verschiebung des Ausdrucks „zu beobachten“ wird die Satzstellung richtig gestellt.
Zu Z 6
Hiermit wird die Korrektur eines Tippfehlers vorgenommen.
Zu Z 7
Da die Regulierungsbehörde für bestimmte Informationspflichten eine der Praxis angepasste Frist durch Verordnung vorsehen kann, ist eine starre Frist von 2 Wochen für ähnliche Tatbestände für die Vollziehung unpraktisch. Die Fristen sollen daher synchron laufen.
Zu Z 8
Die Fristen für Anzeigen von Änderungen der AGB an Endnutzer und Regulierungsbehörde werden synchronisiert.
Zu Z 9:
Die Bestimmung über das Inkrafttreten wird in die Übergangsbestimmung (siehe Z 20) verschoben.
Zu Z 10:
Hiermit wird ebenfalls die Korrektur eines Tippfehlers vorgenommen.
Zu Z 11:
Das unvollständige Zitat in § 181 Abs. 12 wird vervollständigt.
Zu Z 12:
Da die Aufzählung hier endet, wird statt eines Strichpunkts ein Punkt am Ende gesetzt.
Zu Z 13
Dabei handelt es sich ohne inhaltliche Änderung um die Richtigstellung von fehlerhafen Zitaten auf Grund eines Redaktionsversehens.
Zu Z 14 bis 19
Die Fristen für das Außerkrafttreten von Amateurfunkbewilligungen wird um zwei Jahre nach hinten verschoben, um Amateurfunkern mehr Zeit zur Vorbereitung zu geben.
Zu Z 20
Abs. 16 siehe oben zu Z 9
Abs. 17 stellt klar, dass, wenn die Umsetzung von Maßnahmen auf Grund dieses Gesetzes Zeit erfordert, bis dahin die alten Regelungen sinngemäß anzuwenden sind.
*****
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Himmelbauer, Zorba
Kolleginnen und Kollegen
betreffend Relaisfunkstellen
eingebracht im Zuge der Debatte über den Bericht des Ausschusses für Forschung, Innovation und Digitalisierung über die Regierungsvorlage (1043 d.B.): Bundesgesetz, mit dem ein Telekommunikationsgesetz erlassen (Telekommunikationsgesetz 2021 – TKG 2021), das KommAustria-Gesetz (KommAustria-Gesetz – KOG), die Strafprozeßordnung 1975 (StPO), das Polizeikooperationsgesetz (PolKG), das Polizeiliche Staatsschutzgesetz (PStSG), das Sicherheitspolizeigesetz (SPG), das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018), das Börsegesetz 2018 (BörseG 2018), das Postmarktgesetz (PMG), das Kraftfahrgesetz 1967 (KFG 1967), das Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMAG 2016), das Funker-Zeugnisgesetz 1998 (FZG), das Rundfunkgebührengesetz (RGG), das Fernsprechentgeltzuschussgesetz (FeZG) und das Audiovisuelle Mediendienste-Gesetz (AMD-G) geändert werden (1080 d.B.),TOP 3
Der Nationalrat wolle beschließen:
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus wird ersucht, zu prüfen, ob es im Bereich des Amateurfunkes zu teilweisen Gebührenreduktion bzw. -befreiungen kommen kann. So ist auch zu prüfen, ob die Gebühren bei Relaisfunkstellen entfallen bzw. entsprechend der tatsächlichen Leistungsstufe festgelegt werden können. “
Begründung
Relaisfunkstellen ermöglichen durch automatischen Empfang und Wiederaussendung von Funksignalen eine Datenübertragung über größere Strecken. Der Funkamateur ist nach § 148 Abs. 1 verpflichtet, über Aufforderung der für den Hilfseinsatz zuständigen Behörden im Rahmen seiner Möglichkeiten Unterstützung bei der Durchführung von Not- und Katastrophenfunkverkehr zu leisten und hat den Anordnungen der Behörden Folge zu leisten. Die Umsetzung dieser Verpflichtung und die technische Sicherstellung eines funktionierenden Not- und Katastrophenfunkverkehrs kann nur dann erfolgen, wenn dem Amateurfunkdienst ausreichend Relaisfunkstellen im gesamten Bundesgebiet zur Verfügung stehen, wie das auch bei den Behörden und Organisationen für Rettungs- und Sicherheitsaufgaben der Fall ist. Solche Relaisfunkstellen werden aber nicht von der öffentlichen Hand finanziert, sondern von Amateurfunkvereinen, die ein solches Netz von Relaisfunkstellen - im Wesentlichen mit den Mitgliedsbeiträgen - auf freiwilliger Basis errichtet haben und betreiben. Derzeit werden Relaisfunkstellen als Klubfunkstellen gemäß §7 AFGV klassifiziert und somit ist die höchste Jahresgebühr zu entrichten. Es scheint gerechtfertigt die tatsächliche Leistungsstufe heranzuziehen, wenn nicht sogar eine Gebührenbefreiung auf Grund der Relevanz für Not- und Katastrophenfunk vorzusehen.
Der inhaltliche Zusammenhang ist gegeben, da das TKG die Regelungen bezüglich des Amateurfunks enthält.
*****
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Himmelbauer, Zorba
Kolleginnen und Kollegen
betreffend Amateurfunkprüfungen
eingebracht im Zuge der Debatte über Bericht des Ausschusses für Forschung, Innovation und Digitalisierung über die Regierungsvorlage (1043 d.B.): Bundesgesetz, mit dem ein Telekommunikationsgesetz erlassen (Telekommunikationsgesetz 2021 – TKG 2021), das KommAustria-Gesetz (KommAustria-Gesetz – KOG), die Strafprozeßordnung 1975 (StPO), das Polizeikooperationsgesetz (PolKG), das Polizeiliche Staatsschutzgesetz (PStSG), das Sicherheitspolizeigesetz (SPG), das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018), das Börsegesetz 2018 (BörseG 2018), das Postmarktgesetz (PMG), das Kraftfahrgesetz 1967 (KFG 1967), das Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMAG 2016), das Funker-Zeugnisgesetz 1998 (FZG), das Rundfunkgebührengesetz (RGG), das Fernsprechentgeltzuschussgesetz (FeZG) und das Audiovisuelle Mediendienste-Gesetz (AMD-G) geändert werden (1080 d.B.), TOP 3
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus wird ersucht, eine Regelung zu erarbeiten, mittels welcher die Prüfungskommission für die Amateurfunkprüfungen bezüglich einer anderen als der höchsten Bewilligungsklasse künftig ausschließlich aus durch das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus bestellten und erfahrenen Funkamateuren bestehen kann.“
Begründung
Ein zwingendes Mitglied der Fernmeldebehörde in der Prüfungskommission führt dazu, dass Prüfungstermine seltener anberaumt werden können. Die Beiziehung von Bediensteten der Fernmeldebehörden erscheint aber nicht bei allen Bewilligungsklassen erforderlich.
Bei den Amateurfunkprüfungen bezüglich anderer als der höchsten Bewilligungsklasse (das sind nach der derzeit gültigen Amateurfunkverordnung BGBl. II Nr. 126/1999 in der Fassung BGBl. II Nr. 398/2019 die Bewilligungsklassen 3 und 4) wäre es wünschenswert, dass hier die Prüfungskommission nur aus durch das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus bestellten, erfahrenen Funkamateuren besteht, da diese Kategorien für „Anfänger“ bestimmt sind, eine leichtere Prüfung vorgesehen ist und auch die Berechtigungen geringer sind.
Der inhaltliche Zusammenhang ist gegeben, da in § 158 TKG die Regelungen zur Prüfungskommission bezüglich des Amateurfunks enthält.
*****
Präsidentin Doris Bures: Der Abänderungsantrag wurde jetzt von Frau Abgeordneter Himmelbauer in den Grundzügen erläutert, er wurde auch an alle Abgeordneten verteilt und steht daher mit in Verhandlung. Auch beide Entschließungsanträge sind ordnungsgemäß eingebracht.
Der nächste Redner ist Herr Abgeordneter Gerhard Deimek. – Bitte.
Abgeordneter Dipl.-Ing. Gerhard Deimek (FPÖ): Frau Präsidentin! Frau Bundesminister! Ich möchte das heute zur Debatte stehende Telekommunikationsgesetz aus zwei Blickpunkten näher betrachten. Der eine ist einmal aus Sicht der Investoren und aus Sicht der Provider. Da haben sich im Rahmen der Neukodifizierung, wie das so schön heißt, einige Verbesserungen ergeben, die durchaus erwähnenswert sind.
Das ist zumindest einmal die Festlegung einer Mindestvergabedauer für die Funkfrequenzen durch die Regulierungsbehörde, natürlich auch die Kooperationsvereinbarungen und Koinvestitionen, die jetzt möglich sind, und natürlich die Anpassung für den Universaldienst an die technologische Weiterentwicklung. Warum ist das vor allem auch für uns als Bürger interessant? – Weil bis 2030 in diesem Bereich 6 Milliarden Euro Investitionsvolumen notwendig sind. Davon wird nur den geringeren Teil der Staat investieren, der Rest kommt von den Providern oder systemischen Investoren.
Da sind wir bereits bei den Providern im internationalen Markt, beispielsweise beim Eigentümer unserer A1. Für den mexikanischen Investor ist es ziemlich egal, ob er in Österreich, in Rumänien, in Deutschland oder sonst irgendwo investiert. Dort, wo die besten Bedingungen sind, dort wird er investieren. Das trifft nicht nur für diesen, sondern für alle Investoren zu.
Das heißt, wenn wir es schaffen, legistisch gute Konditionen zu machen, dann werden wir auch in Österreich bald flächendeckend Breitbandinternet haben, und nicht nur Internet, sondern auch Sprachfunk und so weiter, also die ganzen Dinge, die dabei zu berücksichtigen sind. Wenn wir es nicht machen, dann wird vielleicht Rumänien oder vielleicht Griechenland oder sonst irgendein Land vor uns dran sein. Was das für unsere Wirtschaft heißt, brauche ich, glaube ich, nicht näher zu erläutern.
Es ist aber auf der anderen Seite auch notwendig, für die Konsumenten einiges zu tun. Das öffentliche Warnsystem und die Aufwertung der Notrufnummer 112 wurden schon
erwähnt. Was für den Konsumenten finanziell interessant ist, sind die Informationen für Verbraucher durch transparente Vertragsinformationen und Tarifinformationen und natürlich ein guter Wechsel von Anbietern. Das muss möglich sein und das wird ermöglicht.
Wir hätten uns in diesem Zusammenhang noch bei zwei Punkten eine Verbesserung gewünscht. Das eine ist die Abgeltung des Standortrechts: Wir schaffen dadurch Einnahmenmöglichkeiten für die ÖBB, für die Asfinag; beide stehen im Eigentum des Staates. Der Steuerzahler als solcher, der Konsument hat nicht direkt etwas davon.
Der zweite Punkt – das ist der Antrag der Kollegin Nussbaum – ist, dass wir im Bereich der staatlichen Informationsdienste bessere Zugänge für behinderte Menschen brauchen.
Das hätten wir uns noch gewünscht. Im Großen und Ganzen ist es aber ein gutes Gesetz. Wir sind jetzt an dem Punkt, dass sowohl 5G, also die Funklösung, als auch Fiberglas, die kabelgebundenen Lösungen, fertig sind; die Katastralgemeinden sind an die jeweiligen Serviceleister zugeteilt. Jetzt geht es darum, Anreize für die Gemeinden zu schaffen. Die Gemeinden sind diejenigen, die wirklich den letzten Zusammenhang zwischen dem Provider auf der einen Seite und dem Konsumenten auf der anderen Seite schaffen. Der Bürger, der Nutzer muss auch entsprechend Druck aufbauen, dass das in seiner Gegend, egal ob das jetzt Remote Area oder mitten im urbanen Gebiet ist, auch geschaffen wird. – Danke schön. (Beifall bei der FPÖ sowie der Abg. Himmelbauer.)
13.27
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Süleyman Zorba. –Bitte.
Abgeordneter Süleyman Zorba (Grüne): Frau Präsidentin! Sehr geschätzte Frau Bundesministerin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher! Das bis zuletzt gültige Telekommunikationsgesetz ist aus dem Jahre 2003. Damals waren Klapphandys in Mode, mit Begriffen wie Smartphones und 5G konnte noch niemand etwas anfangen, und ich selbst war gerade einmal zehn Jahre alt.
Die für den Bereich relevanten Technologien, einschließlich der Kommunikationsnetze und Endgeräte, sowie deren Rolle für unseren Alltag, die Wirtschaft und den Klimaschutz haben sich seither drastisch verändert. Um auf den technologischen Fortschritt zu reagieren, wurden die relevanten Rahmenbedingungen auf EU-Ebene erheblich geändert und in einer Richtlinie, dem Europäischen Kodex für elektronische Kommunikation, kurz EECC, zusammengefasst.
Die neue Struktur und die Vielzahl der Änderungen wurden gleich zum Anlass genommen, das gesamte TKG neu zu kodifizieren und übersichtlich zu gestalten. Mit diesem neuen Gesetz schaffen wir die erforderlichen Rahmenbedingungen für den Bereich Telekommunikation und somit für eine Vielzahl von Akteuren auf diesem Gebiet. Betroffen sind nicht nur MobilfunkanbieterInnen, sondern insbesondere auch Nutzerinnen und Nutzer sowie Regulierungsbehörden.
Besondere Anliegen waren uns die Förderung des Infrastrukturausbaus, die Stärkung des KonsumentInnenschutzes sowie die Netzsicherheit und der Datenschutz. Wir schaffen Anreize für den notwendigen Infrastrukturausbau, indem wir beispielsweise die Mindestvergabedauer für Frequenzen verlängern oder neue Wettbewerbsregeln zur Bündelung von Kosten und Risiken implementieren. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.) Dadurch soll insbesondere auch die Versorgung des ländlichen Raums mit Breitband forciert werden.
Eine weitere Neuerung ist die Gründung eines Fachbeirates in der relevanten Regulierungsbehörde. Dieser Beirat soll die von den Zulieferern bereitgestellten Lösungen genauestens überprüfen und so eine sichere Nutzung des neuen Mobilfunkstandards möglich
machen. Dem Beirat werden nicht nur WirtschaftsvertreterInnen angehören, sondern auch Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Forschung.
Ein besonderes Anliegen waren uns neben den wesentlichen Neuerungen im Bereich der Inklusion, von denen meine Kollegin Grebien berichten wird, die zahlreichen Verbesserungen im Bereich des KonsumentInnenschutzes. Zum Beispiel wurde das Vertragskündigungsrecht im Falle einer nachteiligen einseitigen Vertragsänderung durch die Mobilfunkanbieter auf drei Monate verlängert. Das heißt konkret: Wenn mein Anbieter meinen Vertrag zu meinen Ungunsten verändert, habe ich nun mehr Zeit, um mich nach besseren Optionen umzuschauen.
Außerdem haben wir ein neues Kündigungsrecht bei Wohnsitzwechsel eingeführt: Wenn der Telekomanbieter am neuen Wohnsitz nicht die gleichen vertraglichen Leistungen anbieten kann, wie dies am alten Wohnsitz der Fall war, können KonsumentInnen nun ihren Vertrag auch vor Ablauf der Mindestvertragslaufzeit außerordentlich kündigen. So erspart man sich lästige Doppelzahlungen.
Beim Abschluss von neuen Verträgen gibt es künftig mehr Transparenz für KonsumentInnen. Wir kennen das: Kaum jemand hat Zeit, Lust oder die Fachkenntnis, einen kompletten Vertrag auf ungünstige Klauseln zu überprüfen. Das kann später zu bösen Überraschungen führen. Mit dem neuen TKG verpflichten wir nun die Telekomanbieter, all ihre Verträge kurz und leicht verständlich zusammenzufassen. (Beifall bei Grünen und ÖVP.) Das erleichtert die Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Angeboten und ermöglicht KonsumentInnen, Fallstricken künftig aus dem Weg zu gehen.
Ich darf mich an dieser Stelle herzlich bei allen bedanken, die bei diesem Gesetz mitgewirkt haben. Insbesondere richte ich meinen Dank an die Frau Ministerin und an das Ministerium, einen ganz besonderen Dank an meine Kollegin Himmelbauer für die gute Zusammenarbeit und an die vielen Stakeholder, die mit ihren konstruktiven Stellungnahmen einen wesentlichen Beitrag zu diesem aus meiner Sicht gelungenen Gesetzentwurf geleistet haben. (Beifall bei Grünen und ÖVP.)
Es war kein leichtes Unterfangen, es hat lange gedauert, es waren etliche Verhandlungsrunden und Gespräche, die wir seit über einem Jahr geführt haben; nun ist es fertig: Mit dem Telekommunikationsgesetz 2021 schaffen wir die Grundlage für den weiteren Ausbau der digitalen Infrastruktur und ermöglichen Menschen in Österreich, die Chancen, die sich daraus ergeben, sicher zu nutzen. Ich bitte um breite Zustimmung. – Danke. (Beifall bei Grünen und ÖVP.)
13.31
Präsidentin Doris Bures: Als Nächste zu Wort gelangt Frau Abgeordnete Melanie Erasim. – Bitte.
Abgeordnete Melanie Erasim, MSc (SPÖ): Geschätzte Präsidentin! Frau Ministerin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! (In Richtung VertreterInnen der Pink-Ribbon-Aktion:) Geschätzte Kämpferinnen und Kämpfer auf der Galerie, herzlich willkommen auch von meiner Seite! Liebe Zuseherinnen und Zuseher vor den Bildschirmen! Ich möchte auf einen Aspekt vertieft eingehen, der für mich einen Grund darstellt, dass wir als sozialdemokratische Parlamentsfraktion dem vorliegenden Gesetzesantrag unsere Zustimmung nicht erteilen können. Dieser Aspekt wird auf den ersten Blick im Vergleich zum Umfang des Gesetzes vielleicht als Kleinigkeit gesehen, es ist aber ein Aspekt, der sehr klar ans Tageslicht bringt, welchen Stellenwert die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen in dieser zerrütteten Regierung haben, denn was im neuen Telekommunikationsgesetz nur sehr stiefmütterlich behandelt wurde, ist eben die Umsetzung der EU-Richtlinie betreffend barrierefreie Kommunikation. Lediglich das Mindestmaß, lediglich das Plansoll wurde erfüllt, es wurde keinen Millimeter weiter gegangen.
Für die meisten Menschen ist der Zugang zu Kommunikations- und Informationssystemen selbstverständlich, viele Menschen mit Seh- oder Hörbeeinträchtigungen sind aber davon ausgeschlossen. In Österreich leben rund 9 000 Gehörlose, weitere 450 000 Menschen sind von einer Hörbeeinträchtigung betroffen. Das ist also keine kleine Gruppe. Jetzt legen Sie eine Neufassung des Telekommunikationsgesetzes vor, die es verabsäumt, alle Möglichkeiten moderner Kommunikation ausreichend auszuschöpfen, um schlichtweg mehr Sicherheit zu bieten. Das Thema Sicherheit ist Ihnen ja sonst sehr wichtig, aber meist nur, wenn es gegen jemanden geht, und nicht, wenn es darum geht, einer Gruppe, die ohnehin mit Benachteiligungen zu kämpfen hat, zu helfen.
Frau Ministerin! Warum wurde das nicht in vollem Umfang umgesetzt, nämlich mit allen Mitteln, welche die digitale Welt zu bieten hat, zum Beispiel das Relayservice, den Dolmetschdienst mit Videotelefonie? Da bin ich auf Ihre Erklärung schon sehr, sehr gespannt; die Verantwortung wieder auf die Bundesländer abzuschieben, das allein wäre mir als Erklärung zu wenig.
Gerade jetzt in der Coronakrise hat sich gezeigt, wie wichtig der Zugang zu barrierefreien Informationen für alle ist. Auch in der mit üppigsten Steuergeldern dotierten Regierungskommunikation finden barrierefreie Alternativen kaum Berücksichtigung. Erst die Interventionen einiger Behindertenverbände, nicht zuletzt aber auch unserer Parlamentsfraktion, allen voran meiner Kollegin Verena Nussbaum – auch dir ein herzliches Dankeschön, dass du dich da an vorderster Front immer für diese Rechte starkmachst (Beifall bei der SPÖ) –, haben dafür gesorgt, dass zum Beispiel der Coronanotruf auch über barrierefreie Apps erreichbar ist.
Wenn man sich die barrierefreie App DEC112 ansieht – ich sage es auch für die Zuseherinnen und Zuseher, weil sie doch noch sehr unzulänglich bekannt ist –: Lediglich rund 1 300 Menschen sind bei diesem Projekt, das sich zum Ziel gesetzt hat, eine moderne, standardisierte und barrierefreie Infrastruktur für Notrufdienste zu entwickeln, registriert. – In diesem Bereich sollte man die Bewusstseinsbildung und Informationsoffensive vorantreiben.
Sie sehen also, dass wirklich viel zu tun wäre. Ich bin mir sicher, wenn Sie sich in dieser wankenden Regierung nicht ständig mit Chatprotokollen, Anzeigen und Hausdurchsuchungen beschäftigen müssten, hätten Sie genügend Energie und Muße, sich diesen wichtigen Details zu widmen. Genau diese wichtigen Details sind eben ausschlaggebend dafür, ob ein Gesetz als gelungen oder als unzureichend bewertet werden kann.
Dieses Telekommunikationsgesetz ist, so wie vieles in dieser Bundesregierung, einfach nicht zu Ende gedacht. Es braucht mehr Engagement für wesentliche Details, weniger Inszenierung auf Kosten der Steuerzahler und mehr Interesse daran, für die Menschen in Österreich zukunftsweisende Lösungen zu finden, die diesen Namen auch verdient haben. – Danke schön. (Beifall bei der SPÖ.)
13.37
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Hoyos-Trauttmansdorff. – Bitte.
Abgeordneter Douglas Hoyos-Trauttmansdorff (NEOS): Frau Präsidentin! Frau Bundesministerin! Hohes Haus! Werte Zuseherinnen und Zuseher vor den Fernsehgeräten! Flächendeckendes schnelles Internet ist eines der Hauptthemen, wir brauchen es, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Egal ob es um die Wirtschaft geht, egal ob es um Bildung geht, egal welchen Lebensbereich es eigentlich betrifft: Das schnelle Internet – Highspeedinternet – ist dafür notwendig. Ich glaube, dass genau dafür dieses TKG eine gute Grundlage ist.
Ich bin normalerweise jemand, der durchaus auch die Regierungsmitglieder kritisiert. Man muss ehrlich sagen, dass in den Stellungnahmen einiges drinnen gewesen ist, dass im ersten Entwurf – ich glaube, Sie, Frau Bundesministerin, wissen das am besten – einige Dinge noch nicht perfekt waren, aber es wurde wirklich viel an Energie investiert, um diese Dinge zu verbessern. Ich glaube, dass der jetzt vorliegende Entwurf ein durchaus akzeptabler und in weiten Teilen sogar sehr guter Entwurf ist. Ich kann Ihnen da durchaus auch gratulieren – auch einmal vonseiten der Opposition.
Insbesondere für den 5G-Ausbau ist eine der tragenden Säulen, die notwendig sind, natürlich das Thema Standortrecht für Antennenmasten. Da gab es Verbesserungen gegenüber dem ersten Entwurf: Die verpflichtende Mitbenutzung ist gefallen. Das ist, gerade wenn wir auf schnellen, breiten Ausbau schauen, ein wichtiger Punkt gewesen, das wurde auch sehr stark kritisiert, und da sind Sie überall mitgegangen.
Wenn man sich die Zahlen anschaut, sieht man, wie notwendig dieses Gesetz ist und wie notwendig auch die Maßnahmen sind, um den Ausbau schneller und einfacher voranzutreiben. Österreich war 2019 mit nur 1,9 Prozent bei der Glasfaserdurchdringung Schlusslicht in der Europäischen Union. Auch wenn wir uns die Geschwindigkeit anschauen: In Österreich liegt sie bei durchschnittlich 8 bis 14 Mbit, und die Spitzenreiter in Europa sind irgendwo bei 40 bis 50 Mbit pro Sekunde; da sind wir weit abgeschlagen. Das zeigt, wie dringend notwendig jetzt Maßnahmen sind, die ich aber auch von der Regierung einfordere, und ich erwarte, dass sie jetzt, da diese Grundlage geschaffen wird, auch möglichst schnell kommen.
Es gibt aber – das muss man natürlich auch dazusagen – in dem Entwurf ein paar Dinge, die nicht ganz so optimal sind; ich möchte nur kurz auch darauf eingehen. Das ist einerseits das Thema Konsumentenschutz. Es wurde schon angesprochen: KonsumentInnenschutz ist in manchen Bereichen durchaus ausbaufähig, da ist nicht alles zu 100 Prozent so, wie wir uns das vorgestellt hätten.
Ein Thema, das ich auch schon im Ausschuss angesprochen habe, ist der Fachbeirat für Sicherheit in elektronischen Kommunikationsnetzen. Dieser Fachbeirat soll nun entscheiden – anders als im ersten Entwurf vorgesehen, bei dem das noch nicht ganz so klar und der Beirat auch noch sehr viel politischer geplant war –, wer Hochrisikolieferant ist. Zur Erklärung für die Zuseherinnen und Zuseher zu Hause: Da geht es darum, von welchem Hersteller wir Infrastruktur kaufen beziehungsweise nicht kaufen können. Das in letzter Zeit sehr oft genannte Paradebeispiel für einen solchen Hochrisikolieferanten ist Huawei, in nächster Zeit wird diese Regelung aber möglicherweise auch andere Lieferanten betreffen.
Gemäß dem aktuellen Gesetzentwurf soll dieser Fachbeirat aus 13 Personen bestehen, die von der Bundesregierung bestellt werden und aus verschiedenen Bereichen kommen. Da sind auch die Ministerien gefordert, zu liefern. Der Entwurf verlangt allerdings nur von zwei Mitgliedern des Fachbeirats fachliche Kompetenz – für die anderen ist das im Entwurf nicht vorgesehen. Das ist etwas, das wir durchaus bemängeln, denn gerade in einem so sensiblen Bereich ist es wichtig, darauf zu achten, dass da wirklich fachlich kompetente und nicht politisch opportune Menschen vertreten sind. Es geht darum, dass dieser Fachbeirat eine fachliche Entscheidung, nicht eine politische treffen soll. Das ist etwas, bei dem wir insbesondere Sie, Frau Bundesministerin Köstinger, dann bitten, genau darauf zu achten, dass in diesem Gremium wirklich fachlich versierte Personen und nicht politisch opportune sitzen. – Danke schön. (Beifall bei den NEOS sowie der Abg. Himmelbauer.)
13.41
Präsidentin Doris Bures: Nun hat sich Frau Bundesministerin Elisabeth Köstinger zu Wort gemeldet. – Bitte.
Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus Elisabeth Köstinger: Geschätzte Frau Präsidentin! Geschätzte Damen und Herren Abgeordnete! Ich freue mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, das Telekommunikationsgesetz 2021 im Nationalrat zu behandeln.
Die Bundesregierung hat sich ja das sehr ambitionierte Ziel gesetzt, bis 2030 ganz Österreich flächendeckend mit festen und mobilen Gigabitanschlüssen zu versorgen und damit das gesamte Land mit schnellem Internet auszustatten. Das ist ein durchaus sehr ambitioniertes Ziel – die Zahlen sprechen aber für sich: Allein in den letzten drei Jahren konnten wir die Gigabitversorgung in Österreich von 14 Prozent auf 48 Prozent steigern. Das heißt also: Die Geschwindigkeit stimmt, die finanziellen Mittel, die wir einsetzen, stimmen, und vor allem das Engagement der privaten Telekombetreiber stimmt. Ich bin mittlerweile wirklich überzeugt, dass wir dieses Ziel erreichen werden. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
Zum Zweiten, und das spielt beim Telekomausbau
eine wesentliche Rolle, helfen uns neue Technologien sehr. Wir waren in Europa
Vorreiter bei der Ausschreibung der
5G-Lizenzen im Jahr 2018 und sind nunmehr auf Platz drei in Europa, was
den
5G-Ausbau betrifft. Dabei kommt uns vor allem das letzte Ausschreibungsdesign
sehr zugute, mit dem wir erstmals auch Ausbauverpflichtungen festgelegt haben.
Die Telekombetreiber, die 5G-Lizenzen ersteigern, können somit ein
Drittel ihrer 5G-Masten im urbanen Bereich aufstellen und müssen zwei
Drittel der Sendestationen in unterversorgten Regionen aufstellen, das
hilft uns natürlich vor allem beim Versorgungsausbau im ländlichen
Raum massiv.
Zum Dritten – auch das ist entscheidend, es ist ja gerade eine Budgetrede vorangegangen –: Uns stehen bis zum Jahr 2026 1,4 Milliarden Euro zur Verfügung, die wir in den Ausbau schnellen Internets stecken, vor allem in unseren Gemeinden, in unseren Regionen, in unseren ländlichen Gebieten, um damit Chancengleichheit zwischen Stadt und Land herzustellen. Ich meine, die Ausgangsbedingungen und die Ausgangslage für den Breitbandausbau in Österreich waren noch nie so gut wie jetzt. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
Wir kümmern uns auch intensiv um die technischen Details, um die rechtlichen Rahmenbedingungen: Es war für uns eine sehr weitreichende Entscheidung, eine komplette Neukodifizierung des Telekommunikationsgesetzes aus dem Jahr 2003 vorzunehmen. In den letzten 20 Jahren gab es in der Telekommunikation viele Meilensteine, es ist bereits angesprochen worden. Ich kann mich selber noch erinnern, als ich den Messengerdienst ICQ am Stand-PC installiert hatte. Das Wort App hat es im Sprachgebrauch im Jahr 2003 noch nicht gegeben, und Smartphones wurden erst fünf Jahre später entwickelt. Wenn man sich also ansieht, was die gesetzlichen Rahmenbedingungen bisher waren, kann man sich ungefähr vorstellen, wie viele Hürden es bei der Erarbeitung des TKG 2021 gab.
Ganz entscheidend war natürlich auch die Liberalisierung des Telekommarkts mit Jänner 1998, die uns in Österreich massiv nach vorne gebracht hat, was die Mobilfunkinfrastruktur betrifft. Vor allem aber, und das darf man niemals vergessen, hat uns die Liberalisierung auch eine im Vergleich zu anderen Ländern günstige Tariflandschaft verschafft, da war der Wettbewerb ein essenzieller Faktor.
Heute stehen wir an einer weiteren sehr wichtigen Schwelle, was die Ära des schnellen mobilen Internets angeht. Es ist die Basis für das Internet der Dinge, das sehr viele Bereiche des Lebens revolutionieren wird: Assisted Living kann da beispielsweise genannt werden, bei dem es darum geht, die Lebensqualität älterer beziehungsweise beeinträchtigter Personen zu verbessern.
Anwendungen im Bereich der Industrie 4.0 werden den Wirtschaftsstandort Österreich massiv voranbringen, aber auch Technologien wie automatisiertes Fahren, das eine völlig neue Perspektive im Bereich Mobilität bringt.
Mit dem TKG 2021 setzen wir auch das neue europäische Telekommunikationsrecht in Österreich um. Auf EU-Ebene wurden dabei vier der fünf wesentlichen Richtlinien zusammengeführt, überarbeitet und in den Europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation übergeführt.
Wir haben die Gelegenheit genutzt, um nach 20 Jahren das gesamte Telekommunikationsrecht mit 217 Paragraphen einer textlichen Neukodifizierung zu unterziehen, es klarer zu strukturieren und auch lesbarer zu machen. Das war ein sehr ambitioniertes Vorhaben, und mit dem Ministerratsbeschluss vom 22. September und der parlamentarischen Behandlung haben wir die Grundlage geschaffen. Die wesentlichen Änderungen betreffen die Schaffung von Anreizen für Investitionen in die Telekommunikationsinfrastruktur, die Optimierung der Frequenzvergabeverfahren – das ist wichtig für den raschen Ausbau des Mobilfunks – und Verbesserungen im Bereich des Zivilschutzes. Das war uns ein ganz besonderes Anliegen: Wenn man sich die Naturkatastrophen der letzten Jahre vor Augen führt, ist klar, dass es essenziell ist, da auch europaweit vernetzt zu sein. Weiters gibt es Änderungen im Konsumentenschutz und im Bereich der Netzsicherheit.
Vielleicht ganz kurz zu einigen Details: Wir schaffen Regulierungsansätze, die den Ausbau von Breitband beschleunigen werden, und setzen eine wettbewerbsrechtliche Vereinfachung von Kooperationen um, etwas, das längst notwendig war – die gemeinsame Nutzung von Sendemasten sei in diesem Zusammenhang beispielsweise angesprochen. Auch die Mindestvergabedauer für Frequenzen im Mobilfunkbereich wird eine wichtige Rolle spielen, und es gibt ein neues Standortrecht für die einfachere Errichtung von Mobilfunkinfrastruktur.
Bei den Neuerungen im Notrufwesen und bei Katastrophenwarnsystemen nehmen wir Anleihe an den europaweit einheitlichen öffentlichen Warnsystemen für Krisen. Da darf ich mich ganz herzlich beim Innenministerium und bei den Bundesländern für die gute Zusammenarbeit bedanken. Wir werden unsere Vorhaben in diesem Bereich dann bis Mitte nächsten Jahres vollständig umgesetzt haben.
Wir schaffen einen einfacheren Zugang zur Notrufnummer 112 für Menschen mit besonderen Bedürfnissen: In Zukunft wird es die Möglichkeit textbasierter Notrufe geben, auch das war längst an der Zeit. Frau Abgeordnete Erasim hat das Relayservice für gehörlose und schwerhörige Menschen angesprochen: Wir haben es bereits im Ausschuss dargelegt, auch die Expertinnen und Experten meines Hauses haben bereits erklärt, dass Relayservices von dieser Neuerung umfasst sind. Ich verstehe, dass die SPÖ als einzige Partei noch einen Grund gesucht hat, das neue TKG abzulehnen, ich möchte aber darauf hinweisen, dass es sich da um den falschen Grund handelt. (Zwischenruf der Abg. Heinisch-Hosek.)
Wir haben für Menschen mit besonderen Bedürfnissen einiges überarbeitet und verbessert, was ja auch der ausdrückliche Wunsch der Bundesregierung und der befassten Ministerien war, die Hauptzuständigkeit liegt ja beim Gesundheitsministerium.
Kurz noch zu den Neuerungen im Konsumentenschutz: Die kompakte Vertragszusammenfassung, die den Verbrauchern bereitgestellt werden muss, wird für eine deutliche Verbesserung betreffend Lesbarkeit und Verständlichkeit der Verträge sorgen. Auch Verbesserungen bei Maßnahmen gegen Nummernmissbrauch sind ein zentrales Thema, ebenso die neue Möglichkeit, zwölf Monate nach Kündigung eines Internetvertrags E-Mails weiter an die zur Verfügung gestellte Adresse zu erhalten. All das sind wesentliche Verbesserungen.
Der letzte Punkt, den ich noch ansprechen darf, ist die Netzsicherheit, ein auch auf europäischer Ebene natürlich sehr intensiv diskutiertes Thema.
Wir schaffen ein Monitoringsystem für etwaige Hochrisikozulieferer im Bereich des Ausbaus der 5G-Netze. Wir setzen damit eben auch die 5G-Toolbox, die die Europäische Kommission für die Mitgliedstaaten vorsieht, in nationales Recht um. Es wird ein Fachbeirat bei der Regulierungsbehörde eingesetzt, der alle zwei Jahre einen Wahrnehmungsbericht erstellen wird. Das alles wird dazu beitragen, dass wir vor allem auch im Bereich der Netzsicherheit gerüstet sind, nicht nur in der derzeitigen Ausgangslage, sondern vor allem auch für zukünftige Entwicklungen.
Das war so weit ein Überblick über das Telekommunikationsgesetz 2021. An dieser Stelle möchte ich dem überwiegenden Teil der Parlamentsparteien, den Telekomsprechern ein ganz großes Dankeschön für die gute Zusammenarbeit aussprechen. Ein ganz großes Dankeschön geht auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meines Hauses, die in den letzten Monaten massiv gefordert waren, dieses Telekommunikationsgesetz auch umzusetzen, und die sehr intensiv daran gearbeitet haben.
Ich möchte um Zustimmung zur Regierungsvorlage bitten. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
13.51
Präsidentin Doris Bures: Ich erteile nun Frau Abgeordneter Katharina Kucharowits das Wort. – Bitte.
Abgeordnete Katharina Kucharowits (SPÖ): Frau Präsidentin! Werte Frau Bundesministerin! Geschätzte Kollegen und Kolleginnen! Liebe Zuseherinnen und Zuseher! Wir haben jetzt einiges gehört. Nach sehr langen Verhandlungen steht heute ein neues Telekommunikationsgesetz auf der Tagesordnung, das wir debattieren. Es geht zum einen um längst überfällige Adaptierungen und Anpassungen, die eine digitale Welt dringend benötigt, und zum anderen natürlich auch um Änderungen auf Grundlage der europäischen Richtlinie.
Es geht um Frequenzen – wir haben es gehört –, es geht um deren Vergabe, es geht um Kooperationen, um KonsumentInnenschutzfragen und es soll – und ich sage bewusst soll – auch um verstärkten Netzausbau gehen. Ganz offen gesprochen ist aber das, was da stattfindet und was uns da heute auch vonseiten der Bundesministerin, aber auch von Kollegen und Kolleginnen der Regierungsfraktionen verkauft wurde, einfach zu wenig. Es ist nicht die Breitbandoffensive, von der da gesprochen wird, weil es einfach immer noch, und nicht nur irgendwo in den abgelegensten Tälern, sondern auch – wie soll ich sagen? – im Nachbarbundesland Niederösterreich, Flecken gibt, die nicht vom Internet erschlossen sind. Damit bleibt das Recht auf Internet aus, und das ist im Jahr 2021 höchst problematisch. (Beifall bei der SPÖ.)
Ja, Frau Bundesministerin, es gibt einige Punkte, die sind gut, Kollegin Oberrauner ist darauf eingegangen. Es gibt aber ganz klar – und wir haben das auch schon im Ausschuss kundgetan – drei Punkte, die für uns wesentlich sind, warum wir auch heute – auch heute, nicht nur im Ausschuss – diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen werden.
Das eine ist das Thema Netzsperren, ein wirklich wichtiges Thema, das leider im Rahmen dieser TKG-Novelle nicht angegangen wurde. Da geht es zum einen um Netzneutralität, die gewährleistet sein muss, und zum anderen eben darum, Zensur zu verhindern. Es geht um beide Pole, nämlich um AnbieterInnen und NutzerInnen. Es ist sehr schade, dass die Gelegenheit nicht wahrgenommen wurde, um Netzsperren zu regeln. Im Rahmen des Ausschusses wurde ein Entschließungsantrag in Aussicht gestellt, um eine StakeholderInnenrunde einzuladen. Jetzt sehen wir da leider keinen Entschließungsantrag zur Thematik, Netzsperren zu regeln. (Zwischenrufe der Abgeordneten
Zorba und Himmelbauer.) Das ist ein Punkt, warum wir heute ganz einfach auch nicht mitgehen. (Beifall bei der SPÖ.)
Ein zweiter, ganz, ganz wichtiger Punkt: KonsumentInnenschutzfragen, etwa die einseitige Auflösung von Verträgen von AnbieterInnen, weil sich die AGBs ändern. Wir sind der Meinung, es hätte Optionen gegeben, dass man keine Abschlagszahlungen für ein Handy zahlt (Zwischenruf der Abg. Himmelbauer), wenn der Anbieter, die Anbieterin plötzlich den Vertrag ändert. Diese Varianten gäbe es und auch die Richtlinie, werte Kollegen und Kolleginnen, gäbe das her. Wir haben konkrete Vorschläge geliefert, die leider nicht angenommen wurden.
Der dritte Aspekt, der heute auch noch zu erwähnen ist und der mir immer noch Bauchweh bereitet, ist die Auskunftspflicht, die Informationspflicht über die Abfrage meines Standortes. Wenn ich eine Notrufnummer wähle, entfällt im neuen TKG sozusagen die Informationspflicht darüber, der Anbieter braucht mich also nicht mehr automatisch darüber zu informieren. Es soll – ja! – neu geregelt werden, aber ganz ehrlich: Das ist eine ganz große Datenschutzgeschichte und es ist unserer Meinung nach ein Problem, dass auch das leider nicht gelöst wurde. Wir hätten eine Präzisierung vorgeschlagen, leider sind weder die ÖVP noch die Grünen darauf eingegangen.
Aufgrund der genannten Punkte werden wir dem Gesetzentwurf heute nicht zustimmen, weil es nämlich um einen stärkeren KonsumentInnenschutz, um das Recht auf Datenauskunft gehen muss, und das ist nicht gewährleistet. – Vielen Dank. (Beifall bei der SPÖ.)
13.54
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Josef Smolle. – Bitte.
Abgeordneter Dr. Josef Smolle (ÖVP): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau Bundesministerin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Zuerst möchte ich mich einmal dafür bedanken, dass man sich die Mühe gemacht hat, nicht ein existierendes Gesetz aufgrund von EU-Richtlinien etwas zu überarbeiten, sondern es wirklich neu zu kodifizieren und in eine transparente und gut lesbare Form zu bringen. Da geht das Danke an Sie, Frau Ministerin, an Ihr gesamtes Team, an all die Fachleute, die mitgewirkt haben, an die Sprecherinnen und Sprecher aller Parlamentsparteien, die sich in die Diskussion eingebracht haben, und schließlich auch an das Legistikteam, das das letztlich in eine so saubere, gut lesbare Form gebracht hat. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
Inhaltlich möchte ich auf zwei Themen eingehen. Das eine Thema kann man als ökosoziale Marktwirtschaft, das zweite als Kundinnen- und Kundenorientierung bezeichnen.
Was meine ich mit ökosozialer Marktwirtschaft? – Dieser Gesetzentwurf hat ja das Ziel, dass wir rasch einen guten, breiten Ausbau der Telekommunikationsinfrastruktur bekommen. Dazu nützt man die Kräfte des Marktes, dazu nützt man den Wettbewerb, der sich ja auch schon in vieler Hinsicht bewährt hat. Gleichzeitig ist uns aber auch bewusst, dass es Wettbewerbsversagen geben kann, zum Beispiel in ganz entlegenen Regionen. Da besteht die Möglichkeit, steuernd einzugreifen. Letztlich ist das Ganze eine Infrastruktur, die so vital ist wie das Wasser, der Strom, die Schiene oder die Straße. Deshalb ist es auch ganz, ganz wichtig, dass sich die öffentliche Hand zur Verantwortung dafür bekennt und gegebenenfalls auch regulieren kann.
Es ist auch ökologisch, denn es werden gerade in der Produktion, in der Unfallverhütung, aber auch in der Erschließung des peripheren ländlichen Raumes sehr viele Grundlagen geschaffen, um unser Leben ökologischer und nachhaltiger zu machen.
Ich komme zum zweiten Punkt: Kundinnen- und Kundenorientierung, die man in diesem Entwurf ganz deutlich spürt. Einiges wurde schon angesprochen, ich denke an die Verpflichtung der Provider, eine transparente, gut verständliche Zusammenfassung für die Verträge vorzulegen. Kundenfreundlich ist es aber auch, im Hinblick auf die Frage, ob man auch andere Endgeräte, Endeinrichtungen verwenden kann, die Provider dazu zu verpflichten, dass sie die technischen Spezifikationen klarlegen, sodass jemand, der das Interesse hat, diesbezüglich etwas zu ändern, das auch durchaus machen kann.
Ein ganz wichtiger Punkt sind natürlich die Notrufe, vor allem für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Dass das jetzt textbasiert möglich ist, ist ein großer Fortschritt. Es wird auch der technische, regulatorische Rahmen geschaffen, damit Videorelaycalls möglich gemacht werden. Schließlich gibt es auch die Möglichkeit, dass auf einen Notruf oder Notcall per App reagiert wird, auch wenn die Person nicht die Möglichkeit hat, eine Botschaft dazu abzusetzen. Das kann in ganz prekären Situationen – denken Sie an einen Überfall oder an einen schweren medizinischen Notfall! – sehr, sehr hilfreich sein.
Das Thema der Netzsperren bleibt offen. Das ist wirklich ein hochsensibles, ganz wichtiges und komplexes Thema. Ich freue mich, wenn auch das angegangen wird, und möchte wirklich alle politischen Kräfte einladen, sich intensiv am Stakeholderprozess zu beteiligen, damit dann auch zu diesem Thema ein tragfähiger Entwurf herauskommt. – Ich sage herzlich Danke. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
13.59
Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Nurten Yılmaz. – Bitte.
Abgeordnete Nurten Yılmaz (SPÖ): Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau Ministerin! Herr Minister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Wir sprechen hier über das neue Telekommunikationsgesetz, das sehr lange diskutiert wurde. Umso mehr würde man sich ja von einem Gesetz, das so lange diskutiert wurde, erwarten, dass es so perfekt wie möglich ist. (Zwischenruf des Abg. Zorba.) – Nein, eben nicht! Eben nicht! Das würden wir uns sehr wünschen.
Meine Kolleginnen haben ja schon vorgebracht, was uns abgeht: von Netzsperren bis Information über Datenabfragen an die Betroffenen nach § 53 Sicherheitspolizeigesetz. Wenn man weiß, wie das BMI aufgestellt ist, dann, muss ich sagen, mache ich mir umso mehr Sorgen, dass die Konsumentinnen und Konsumenten davon nicht informiert werden, dass Datenabfragen stattgefunden haben. Es gibt nicht einmal eine Alternative, sondern das ist ersatzlos gestrichen.
Vielleicht könnten Sie auch noch das heutige Ö1-„Morgenjournal“ nachhören, da ist auch einiges aufgezeigt worden. Es ist auch gelobt worden, auch von meinen Kolleginnen. Ich kann es, wenn Sie wollen, auch loben, denn es gibt wirklich Maßnahmen, die wir sehr begrüßen, deswegen war ja auch unsere Bereitschaft vorhanden, diesen Gesetzentwurf sehr wohl zu unterstützen, mit der Auflage, dass es einen Abänderungsantrag gibt, in dem eben diese Wünsche auch berücksichtigt werden. Was ist? – Nein, schmeckʼs! Wir werden es also nicht unterstützen können. (Abg. Himmelbauer: Wir haben uns zurückgemeldet und haben auch unsere Gründe dazu genannt!) – Bitte? (Abg. Himmelbauer: Wir haben uns zurückgemeldet, wir haben auch unsere Gründe dazu genannt, wieso es nicht möglich ist, diese Änderungen zu machen!) – Die Gründe, ja - - (Abg. Himmelbauer: Ja! Zum Beispiel, dass der Kodex das so vorsieht, dass es auch hier eine Abschlagszahlung gibt!) – Ja, ja. (Abg. Himmelbauer: Ja! – Weiterer Zwischenruf bei der ÖVP.)
Wir haben auch unsere Gründe genannt, warum wir nicht mitgehen können. Wir werden den Gesetzentwurf leider nicht unterstützen, was uns sehr leidtut, denn nach so vielen Jahren Diskussion und Vorbereitung wären wir sehr gerne mitgegangen. (Präsident Hofer übernimmt den Vorsitz.)
Ich hoffe, dass es eben zu diesen Netzsperren eine Enquete geben wird, dass wir uns da auch einbringen können. (Zwischenruf des Abg. Zorba.) – Das ist aber nur so ein Versprechen zwischen zwei Abgeordneten, das steht nirgends drinnen, und ich kenne diese unverbindlichen Versprechen der Regierungsparteien, deswegen sage ich: Schauen wir einmal! – Danke vielmals. (Beifall bei der SPÖ.)
14.02
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt nun Heike Grebien. – Bitte schön, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete Heike Grebien (Grüne): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Bundesministerin! Sehr geehrte KollegInnen! Wertgeschätzte ZuseherInnen hier auf der Galerie und auch zu Hause! Wie wir bereits von meinem Kollegen Abgeordnetem Zorba gehört haben, umfasst das TKG 2021 zahlreiche Änderungen, zum Beispiel im Bereich der flächendeckenden Breitbandversorgung oder auch Verbesserungen im Bereich des KonsumentInnenschutzes.
In meiner Rede gehe ich auf die Erweiterung der Notrufnummer 112 um textbasierte Nachrichten näher ein. Was bedeutet das? Was bedeutet es, dass ich eine textbasierte Nachricht an die Notrufnummer 112 absenden kann? Für welche Menschen könnte das wichtig sein?
Der Österreichische Gehörlosenbund fordert nun seit über zehn Jahren die Umsetzung des technisch bereits Machbaren im Bereich barrierefreie Notrufe. Laut Österreichischem Gehörlosenbund umfasst ein solcher barrierefreier Notruf insbesondere eine SMS-Notrufmöglichkeit mit Dialogfunktion. Anmerkung hierzu: Der Gehörlosennotruf 0800 133 133 war zu der Zeit nur auf einseitige Kommunikation ausgerichtet, das heißt, als gehörlose Person wusste man nicht, ob der Notruf eingelangt ist. 2016 gab es dann ein Schreiben vom Österreichischen Gehörlosenbund an die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH, RTR.
Wer zum Beispiel in Österreich versucht, eine SMS an die europaweite Notrufnummer 112 zu schicken, um die Polizei, die Feuerwehr oder die Rettung zu alarmieren, wird derzeit keine Hilfe erwarten können. Der Österreichische Gehörlosenbund forderte die Umsetzung des diskriminierungsfreien und barrierefreien Zugangs zum einheitlichen Euronotruf 112 rund um die Uhr. Ein kleiner internationaler Exkurs: In Amerika zum Beispiel gibt es diese Möglichkeit seit 2014.
Ja, und nun ist 2021 und wir beschließen endlich auch in Österreich den ersten Schritt, um die Notrufbarriere kleiner zu machen. Der Betreiber der Notrufnummer 112 wird nun verpflichtet, textbasierte Notrufe entgegenzunehmen und auch per Text zu antworten. Andere Notrufdienste sollen folgen. § 122 Abs. 4: „Insbesondere ist sicherzustellen, dass eine zweiseitige Kommunikation erfolgen kann.“
Unter textbasierten Notrufen kann man SMS verstehen, kann man aber auch Messengerdienste oder andere Anwendungen wie zum Beispiel Apps verstehen. Es ist wichtig, dass eben diese zweiseitige Kommunikation zur Notrufleitstelle ermöglicht wird. Erwartet wird, dass auch Leitstellen anderer Notrufdienste ohne gesetzliche Verpflichtung solche Notrufe annehmen werden. Sollte das nicht der Fall sein, können die Regulierungsbehörde und die Frau Bundesministerin gemäß Abs. 4 das per Verordnung auch anordnen. Weiters kann die Regulierungsbehörde mittels Verordnung weitere Notdienste verpflichten, textbasierte Notrufe entgegenzunehmen.
Zusammenfassend kann also festgehalten werden: Für den Fall, dass die Verpflichtung betreffend textbasierte Notrufe nicht zum gewünschten Erfolg führen sollte, nämlich der gleichwertigen Versorgung aller EndnutzerInnen mit Behinderungen mit Notdiensten,
können weitere Maßnahmen, zum Beispiel auch der Ausbau des Relayservice, per Verordnung festgelegt werden. Somit ist, denke ich, eigentlich klar, dass wir hiermit einen wichtigen und notwendigen Schritt gesetzt haben. Aus meiner Sicht wird es weitere Verordnungen dazu brauchen, um wirklich diesen gewünschten Erfolg zu bekommen, nämlich die gleichwertige Versorgung aller EndnutzerInnen mit Behinderungen sicherzustellen.
Wir Grüne – das kann ich Ihnen sagen – werden ganz besonders darauf achten, ob sich dieser gewünschte Erfolg für Gehörlose, für Hör- und Sprechbehinderte sowie für taubblinde Menschen einstellt. – Danke für die Aufmerksamkeit. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
14.06
Präsident Ing. Norbert Hofer: Nächste Rednerin ist Carina Reiter. – Bitte schön, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete Carina Reiter (ÖVP): Herr Präsident! Geschätzte Frau Minister! Geschätzter Herr Minister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Werte Zuschauerinnen und Zuschauer! Wir beschäftigen uns heute mit dem TKG, dem Telekommunikationsgesetz. Da ist mir der Bereich des Ausbaus von Breitband- und Mobilfunknetzen besonders wichtig, der maßgeblich beschleunigt werden soll.
Ich selber wohne in Pöham, das ist eine Ortschaft bei Pfarrwerfen und das ist knapp 7 Kilometer vom Ortszentrum entfernt, auf einem Bauernhof am Berg oben, also zentral ist nicht zwingend eines der Wörter, die ich zur Beschreibung meiner Wohnlage benutzen würde. (Heiterkeit bei der ÖVP.) Wenn man aber im Breitbandatlas nachschaut, sieht man: Bei mir daheim gibt es eine Downloadrate von 80 Megabit pro Sekunde – das ist nicht schlecht, damit kann man schon einmal ein bissl arbeiten.
Prinzipiell haben wir in Österreich eine gute Grundversorgung mit Festnetzbreitband von 99 Prozent, das sind circa 3,9 Millionen Haushalte. Gerade Bundesländer wie Salzburg, Tirol, Vorarlberg und Wien haben heute schon gigabitfähige Anschlüsse, die sich mit den besten Ländern Europas messen können. Wir haben also schon einiges in diesem Bereich geschafft, das muss man klar sagen.
Unser Ziel ist aber eine flächendeckende Breitbandversorgung, einfach um eine Chancengleichheit für alle unsere Regionen zu schaffen. Das heißt, die Regierung will flächendeckend feste und mobile Gigabitanschlüsse bis 2030 sicherstellen. Wir kennen die Siedlungsstruktur in Österreich: Es gibt Täler, die sehr entlegen sind, es gibt große Flächenbundesländer, in denen es auch nicht unbedingt einfach ist, mit den Anschlüssen weiterzukommen. Für uns als Volkspartei ist es aber sehr, sehr wichtig, gerade auch die entlegenen Regionen mit schnellem Internet zu versorgen.
Wenn man zum Beispiel den Ortsteil Hintergföll der Gemeinde Unken hernimmt: Dort muss man beim Download ein bisschen Geduld haben, da ist man mit 1 Megabit pro Sekunde im etwas langsameren Bereich unterwegs. Es herrscht dort aber Licht am Ende des Datentunnels. 2022 wird Hintergföll nämlich mit Glasfaser angeschlossen, somit ist dann auch dort wirklich eine adäquate Internetversorgung möglich. Das heißt, dass in diesem Bereich in Unken 140 Objekte angeschlossen und 355 000 Euro investiert werden. Damit können wir einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, die berühmt-berüchtigte letzte Meile zu überbrücken. Um das zu schaffen, müssen Bund, Länder und Gemeinden Hand in Hand arbeiten. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
Gerade mit diesem Telekommunikationsgesetz schaffen wir eine gute Grundlage dafür, denn unsere Lebensrealitäten sind einfach so, dass digitales Arbeiten Standard ist, das gilt für das Homeoffice genauso wie für das Hofoffice, denn auch unsere Landwirtschaft ist schon sehr stark digitalisiert. Der Fortschritt ist uns etwas wert.
Oft ist uns gar nicht bewusst, was unsere Infrastruktur, seien es Kanal oder Straße, aber auch die digitale Infrastruktur kostet. Bis 2026 stellt aber die Bundesregierung 1,4 Milliarden Euro zur Verfügung, womit wir Schwung in den Breitbandausbau gerade für die benachteiligten Gebiete bringen. Mit den neuen Förderrichtlinien können wir einen raschen und effizienten Ausbau garantieren.
Zwei wichtige Punkte in diesen Förderrichtlinien sind für mich ganz klar: Wer Gemeinden flächendeckend ausbaut, kriegt eine deutlich höhere Bundesförderung zur Verfügung gestellt, und alle Gebiete sind de facto bis 100 Megabit förderbar, was sehr essenziell für den Ausbau ist. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
Wir haben ehrgeizige, aber machbare Ziele. Es ist uns ganz klar, dass das Internet ein Teil der Grundversorgung ist, und unser Credo als Bundesregierung lautet: weiter ausbauen und aufrüsten. Mit dem Telekommunikationsgesetz sind wir ganz klar am Puls der Zeit, und gerade im Bereich der Forschung, Innovation und Digitalisierung wissen wir: Gehe mit der Zeit, sonst gehst du mit der Zeit! (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
14.10
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
Ist seitens der Berichterstattung ein Schlusswort gewünscht? – Das ist nicht der Fall.
Bevor wir in den Abstimmungsvorgang eingehen: Wünschen die Klubs eine Unterbrechung? – Auch das ist nicht der Fall.
Wir kommen zur Abstimmung, die ich über jeden Ausschussantrag getrennt vornehme.
Wir gelangen zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 3: Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein Telekommunikationsgesetz erlassen, das KommAustria-Gesetz, die Strafprozeßordnung, das Polizeikooperationsgesetz sowie weitere Gesetze geändert werden, in 1043 der Beilagen.
Hiezu haben die Abgeordneten Himmelbauer, Zorba, Kolleginnen und Kollegen einen Zusatz- beziehungsweise Abänderungsantrag eingebracht.
Weiters liegt ein Verlangen auf getrennte Abstimmung des Abgeordneten Hoyos-Trauttmansdorff vor.
Ich werde daher zunächst über die vom erwähnten Zusatz- beziehungsweise Abänderungsantrag sowie vom Verlangen auf getrennte Abstimmung betroffenen Teile – der Systematik des Gesetzentwurfes folgend – und schließlich über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes abstimmen lassen.
Die Abgeordneten Himmelbauer, Zorba, Kolleginnen und Kollegen haben einen Abänderungsantrag betreffend Art. 1 §§ 4, 39 und 45 eingebracht.
Wer hierfür ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist mehrheitlich angenommen.
Wir gelangen zur getrennten Abstimmung über Art. 1 § 56 Abs. 5 in der Fassung der Regierungsvorlage.
Wer hiefür ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist ebenfalls mehrheitlich angenommen.
Die Abgeordneten Himmelbauer, Zorba, Kolleginnen und Kollegen haben einen Zusatz- beziehungsweise Abänderungsantrag betreffend Art. 1 §§ 59, 89, 107, 114, 133, 144, 181, 188, 200 und 212 eingebracht.
Wer hiefür ist, den ersuche ich um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist mehrheitlich angenommen.
Schließlich komme ich zur Abstimmung über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang in der Fassung der Regierungsvorlage.
Wer hiefür ist, den ersuche ich um ein Zeichen der Zustimmung. – Auch das ist mehrheitlich angenommen.
Wir kommen damit sogleich zur dritten Lesung.
Ich bitte jene Damen und Herren, die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, um ein diesbezügliches Zeichen. – Das ist die Mehrheit. Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung angenommen.
Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Eva-Maria Himmelbauer, Süleyman Zorba, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Relaisfunkstellen“.
Ich bitte jene Damen und Herren, die für den Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist mehrheitlich angenommen. (201/E)
Wir gelangen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Eva-Maria Himmelbauer, Süleyman Zorba, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Amateurfunkprüfungen“.
Ich bitte jene Damen und Herren, die für diesen Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. – Auch das ist mehrheitlich angenommen. (202/E)
Wir gelangen nun zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 4: Antrag des Ausschusses für Forschung, Innovation und Digitalisierung, seinen Bericht 1081 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen.
Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes Zeichen. – Das ist mehrheitlich angenommen.
Wir gelangen zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 5: Antrag des Ausschusses für Forschung, Innovation und Digitalisierung, seinen Bericht 1082 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen.
Ich bitte jene Damen und Herren, die dazu ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes Zeichen. – Das ist ebenfalls mehrheitlich angenommen.
Bericht des Gesundheitsausschusses über den Antrag 1824/A der Abgeordneten Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Epidemiegesetz 1950 und das COVID-19-Maßnahmengesetz geändert werden (1067 d.B.)
7. Punkt
Bericht des Gesundheitsausschusses über den Antrag 1925/A der Abgeordneten Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das COVID-19-Zweckzuschussgesetz geändert wird (1068 d.B.)
8. Punkt
Bericht und Antrag des Gesundheitsausschusses über den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über eine COVID-19 Förderung für
betriebliche Testungen (Betriebliches Testungs-Gesetz – BTG) geändert wird (1069 d.B.)
9. Punkt
Bericht des Gesundheitsausschusses über den Antrag 1822/A der Abgeordneten Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das COVID-19-Lagergesetz geändert wird (1070 d.B.)
10. Punkt
Bericht des Gesundheitsausschusses über den Antrag 1467/A der Abgeordneten Dr. Josef Smolle, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Gesundheitstelematikgesetz 2012 geändert wird (1071 d.B.)
11. Punkt
Bericht des Gesundheitsausschusses über den Antrag 1924/A der Abgeordneten Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz und das Medizinproduktegesetz geändert werden (1072 d.B.)
Präsident Ing. Norbert Hofer: Wir gelangen nun zu den Punkten 6 bis 11 der Tagesordnung, über welche die Debatten unter einem durchgeführt werden.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Philip Kucher. – Bitte schön, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Philip Kucher (SPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzter Herr Bundesminister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, nach dem heutigen Vormittag ist es an der Zeit, dass wir über alle Parteigrenzen hinweg Bundesminister Mückstein den Rücken stärken (Abg. Belakowitsch: Warum?), dass wir mitten in der Coronakrise jetzt wirklich miteinander aufstehen und ihm helfen, weil heute in der Früh etwas passiert ist, was in der Gesundheitskrise eigentlich unfassbar ist. Wir haben einen Finanzminister erlebt, der in seiner Budgetrede ganz offensichtlich auf den Gesundheits- und Pflegebereich vergessen hat. Ich weiß nicht, es wäre vielleicht wichtig, dass wir noch persönlich besprechen, wie das passieren konnte. (Abg. Belakowitsch: Weil er schlecht verhandelt hat!)
Wir stehen jetzt alle da, reden über die Gesundheitsthemen, und es wäre dringend an der Zeit, dass wir uns jetzt parteiübergreifend zusammensetzen und miteinander versuchen, das zu reparieren, dass nicht das passiert, was wir bereits im letzten Jahr erlebt haben, nämlich dass Blümel, nachdem er einmal sechs Nullen vergessen hat, diesmal auf den Gesundheits- und Pflegebereich vergisst. (Beifall bei der SPÖ.)
Ich darf daran erinnern: Wenn wir alle miteinander auf einem Zettel eine Stricherlliste darüber geführt hätten, wie oft von Wertschätzung und Respekt gegenüber all den Menschen, die in der Coronakrise Tag und Nacht am Krankenbett für uns dagewesen sind, die Großartiges geleistet haben, gesprochen worden ist, dann wäre der Zettel ziemlich voll. Das Budget aber, das Blümel heute vorgelegt hat, ist jetzt leer, und ich bitte wirklich, dass wir die wichtigsten Punkte miteinander noch einmal reparieren.
Der eine Bereich ist der Gesundheitsbereich. Da ist nichts vorgesehen, um dem Ärztemangel in Österreich zu begegnen. Die ÖVP redet immer vom ländlichen Raum – da ist
gar nichts passiert. Es geht dabei doch auch um die Chancengerechtigkeit im ländlichen Raum – weil ich gerade Herrn Abgeordneten Obernosterer sehe, der mir sehr freundlich zuwinkt und mir dadurch zustimmt. (Heiterkeit des Abg. Obernosterer.) Es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir hier gerade betreffend den Ärztemangel und den ländlichen Raum etwas tun.
Ich frage nur: Wo ist denn die Verdoppelung der Zahl der Studienplätze im Medizinstudium? Das ist doch unfassbar, dass nur ein Zehntel der jungen Menschen die Chance bekommt, Medizin zu studieren. Es geht da um die Hoffnungen von jungen Menschen! Ich kann auch von ganz, ganz vielen Gesprächen berichten, in denen ich mit jungen Leuten geredet habe, die sich seit Jahren ehrenamtlich beim Roten Kreuz engagieren. Es hängt dann von irgendwelchen Tests ab, bei denen es darum geht, dass man gewisse Dinge vielleicht auswendig lernt und in einer Stresssituation wiedergeben kann. Das kann doch nicht euer Ernst sein, dass man im Bereich der Medizinstudienplätze gar nichts tut! (Beifall bei der SPÖ.)
Wo ist denn die Ausweitung - - (Abg. Taschner: Das ist Populismus!) – Bitte, der Wissenschaftssprecher, das ist ganz wichtig, da haben wir jetzt zumindest einen Bündnispartner von der ÖVP. Es wäre wichtig, dass wir zumindest diesbezüglich auch noch im Wissenschaftsbudget die Reparaturmaßnahmen vorsehen. (Abg. Taschner: Kollege Kucher, Sie wissen, es ist viel komplizierter!) Verdoppelung der Zahl der Medizinstudienplätze – eine erste richtige Maßnahme, vielleicht schaffen wir das noch miteinander. Unser Antrag ist bereits eingebracht.
Neben dem Gesundheitsbereich, in dem wir im Bereich der Prävention der psychischen Erkrankungen so viel mehr machen sollten, geht es natürlich auch um die Pflege. Wir alle wissen, dass in der Pflege nicht nur 100 000 Menschen bis zum Jahr 2030 fehlen, sondern dass es auch Menschen gibt, die uns jeden Tag sagen: Ich kann unter diesen Arbeitsbedingungen nicht mehr! – Wo sind die Qualitätskriterien? Wo ist das zusätzliche Geld? Wo ist die Pflegemilliarde für die Patientinnen und Patienten? – Da ist doch so viel zu tun und da wird gar nichts budgetiert. Dem Minister wird ein bisschen Spielgeld gegeben, dass er sagt, es wird schon niemand draufkommen. – Es geht um die Pflege von alten Menschen, die wirklich unsere Unterstützung brauchen. Da muss mehr passieren! (Beifall bei der SPÖ.)
Ich bitte also wirklich darum: Setzen wir uns zusammen und finden wir gemeinsam eine Lösung! Machen wir das, was wir versprochen haben, stärken wir jetzt als Maßnahme nach der Coronakrise miteinander unser Gesundheitssystem!
Eine Sache möchte ich hier noch ansprechen – Herr Präsident Hofer, vielleicht können Sie das Herrn Präsidenten Sobotka auch ausrichten, ich glaube, wenn er dabei gewesen wäre, hätte er es selber nicht glauben können –: Man muss sich das vorstellen, im Gesundheitsausschuss haben Schwarz und Grün von 21 Anträgen, die eingebracht worden sind – von 21 Anträgen! –, 20 Anträge vertagt! Psychische Gesundheit, Psychotherapie als Kassenleistung, Prikraf – man erinnert sich da vielleicht an die 50 000 Euro, die von Privatkliniken auf das Konto der ÖVP gewandert sind, wobei versprochen worden ist, dass das repariert wird –, zu all dem hat man gesagt: Vertagen wir!
Ich sage ehrlich dazu: Wir werden doch alle dafür bezahlt, dass wir arbeiten und etwas weiterbringen, und nicht dafür, dass wir vertagen und auf die lange Bank hinausschieben. Ich bitte also wirklich darum – fünf vor zwölf! –: Stärken wir Minister Mückstein, der neu in der Funktion ist, den Rücken! Vielleicht hat er nicht genau gewusst, wie er das Budget richtig erstellen soll, und hat vergessen, die Forderungen Richtung Blümel einzubringen. Helfen wir alle miteinander Minister Mückstein und sorgen wir dafür, dass das Gesundheits- und Pflegesystem in Österreich abgesichert wird! Wir haben jetzt, fünf vor zwölf, miteinander noch die Chance dazu. (Beifall bei der SPÖ.)
14.19
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt nun Ralph Schallmeiner. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Ralph Schallmeiner (Grüne): Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrter Herr Minister! Sehr geehrte Damen und Herren zu Hause vor den Bildschirmen und hier auf der Galerie! Wenn so ein Angebot von Philip Kucher kommt, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, solche Annäherungen und Rückenstärkungen könnten auch ein Danaergeschenk sein. Ich glaube, dass der Herr Minister sehr wohl weiß, was er gemacht hat und wie er ein Budget einmeldet. (Beifall bei Grünen und ÖVP.)
Kommen wir aber zum eigentlichen Thema, denn unter diesen Tagesordnungspunkten wird ja etwas ganz anderes diskutiert. Eigentlich geht es um Maßnahmen in der Pandemiebekämpfung. Es geht um die Verlängerung diverser Maßnahmen. Es geht darum, dass die Pandemie eben leider noch nicht vorbei ist. Aktuell haben wir in Österreich mehr als 12 000 Menschen, die an Covid erkrankt sind, die zu Hause sind. In den letzten sieben Tagen sind es im Durchschnitt 1 800 neue Fälle pro Tag gewesen. (Abg. Belakowitsch: Das ist falsch, was Sie sagen!) Knapp 10 Prozent der Intensivkapazitäten in den Krankenhäusern sind mit Covid-PatientInnen belegt, der Großteil davon ist ungeimpft. Je jünger sie sind, desto länger liegen diese Menschen auf der Intensivstation, bis zu 35 Tage sind es laut entsprechender Statistik.
Wir sehen auch, dass dort, wo es eine hohe Durchimpfungsrate gibt, die Zahlen positiver sind und die Belastung unseres Gesundheitssystems deutlich geringer ist. Deshalb müssen wir aufmerksam bleiben, deshalb braucht es auch weiterhin entsprechende Maßnahmen, beispielsweise die Verlängerung des Contacttracings, die wir heute beschließen sollten, sowie eine zusätzliche Niederschwelligkeit, weil man es den Ärztinnen und Ärzten in Österreich ermöglicht, Zertifikate für den grünen Pass auszudrucken. Man passt die Systematik der 3G-Regel an die Realität an, auf gut Deutsch gesagt: zukünftig können die drei Nachweise bei den Maßnahmen je nach Stand der Wissenschaft eben differenziert behandelt werden. In der Frage von 3G am Arbeitsplatz treffen wir Konkretisierungen, sodass wir auch da vorbereitet sind, sollte es diesbezüglich eine sozialpartnerschaftliche Einigung geben.
Wir verlängern die Zweckzuschüsse für Kommunen und Länder, damit auch da weiterhin entsprechende Maßnahmen möglich sind, wie beispielsweise Teststraßen oder auch Impfstraßen. Wir schaffen im Sinne internationaler Solidarität die Möglichkeit – das wurde ja heute schon von der FPÖ kritisiert –, vom Bund beschaffte Hilfsmittel an andere Staaten weiterzugeben, bevor diese ablaufen. Das ist durchaus sinnvoll, aber ich weiß schon, dass die FPÖ mit internationaler Solidarität vielleicht nicht immer etwas anfangen kann.
Wir verlängern die Regelung betreffend Fernrezept über die E-Medikation beziehungsweise per E-Mail, um auch damit dafür zu sorgen, dass kranke Menschen wegen eines Rezeptes seltener zu Ärztinnen und Ärzten gehen müssen. Wir verlängern auch diverse Krisenbestimmungen im KAKuG beziehungsweise beseitigen wir Unklarheiten im MPG.
Im Zuge dessen – weil es auch immer heißt, dass wir nicht auf die Opposition hören – möchte ich aufgrund von berechtigten Einwänden, die vor allem von der SPÖ, aber auch von der FPÖ gekommen sind, zwei Abänderungsanträge einbringen:
Abänderungsantrag
der Abgeordneten Dr. Josef Smolle, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen zum Bericht des Gesundheitsausschusses über den Antrag 1924/A der Abgeordneten Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz,
mit dem das Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz und das Medizinproduktegesetz geändert werden, 1072 der Beilagen, TOP 11
Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen:
Der eingangs bezeichnete Gesetzesantrag wird wie folgt geändert:
a) In Artikel 2 wird im Titel nach dem Wort „Medizinproduktegesetzes“ die Zahl „2021“ angefügt.
b) In Artikel 2 lautet die Novellierungsanordnung Z 1:
„In § 14 Abs. 4 Z 6 wird das Wort „und“ durch das Wort „oder“ ersetzt.“
c) In Artikel 2 entfällt die Z 2.
*****
Zur Begründung: Zum einen geht es darum, dass wir im Medizinproduktegesetz eine Klarstellung vornehmen, insbesondere was die Ethikkommission und die Zusammensetzung dieser anbelangt. Zum anderen geht es darum, dass aufgrund einer Reevaluierung nicht mehr davon auszugehen ist, dass eine Verlängerung der Bestimmung des § 81 Abs. 4 über den 31. Dezember 2021 hinaus erforderlich ist.
Zum anderen möchte ich noch einen Abänderungsantrag einbringen:
Abänderungsantrag
der Abgeordneten Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen zum Bericht des Gesundheitsausschusses über den Antrag 1824/A der Abgeordneten Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Epidemiegesetz 1950 und das Covid-19-Maßnahmengesetz geändert werden, 1067 der Beilagen, TOP 6
Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen:
Der eingangs genannte Gesetzesantrag wird wie folgt geändert:
In Artikel 2 Z 8 wird in § 7 Abs. 3a nach dem Wort „Bürgermeister“ die Wortfolge „mit Zustimmung der Bezirksverwaltungsbehörde“ eingefügt.
*****
Da gehen wir eben ganz konkret auf die Kritik ein, dass wir den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern allein zu viele Möglichkeiten in der Epidemiebekämpfung geben. Dem können wir durchaus etwas abgewinnen. Eine Regionalisierung bei manchen Maßnahmen ist aus unserer Sicht zwar sinnvoll, aber wenn wir das in Abstimmung mit den Bezirksbehörden machen, macht das durchaus Sinn.
Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass die beste Möglichkeit aktuell gegen die Pandemie zu kämpfen jene ist, sich impfen zu lassen. Das sehen wir tagtäglich an den Zahlen. Ich weiß schon, dass Kollegin Belakowitsch gleich herauskommen und wahrscheinlich das Gegenteil behaupten wird. (Abg. Belakowitsch: Was Sie alles wissen!) Wenn wir eine hohe Durchimpfungsrate haben, können wir die vielen, leider notwendigen Maßnahmen auch früher wieder beenden, das sehen wir an Ländern wie Dänemark und Norwegen. Dementsprechend wäre es einfach wichtig, sich impfen zu lassen, impfen zu gehen.
Ich möchte meinen Appell für das Impfen damit beenden, dass ich die Jugendlichen in Österreich auf Folgendes hinweise: Bitte geht impfen! Auch euch kann Covid treffen,
auch euch kann Long Covid treffen. Noch ein Hinweis: Liebe Jugendliche in Österreich, ab 14 könnt ihr selber entscheiden und seid nicht mehr darauf angewiesen, dass eure Eltern für euch entscheiden, ob ihr impfen geht oder nicht. Nutzt diese Möglichkeit, seid gescheiter als andere! (Beifall bei Grünen und ÖVP.)
14.26
Die Anträge haben folgenden Gesamtwortlaut:
Abänderungsantrag
der Abgeordneten Dr. Josef Smolle, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen,
zum Bericht des Gesundheitsausschusses über den Antrag 1924/A der Abgeordneten Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz und das Medizinproduktegesetz geändert werden (1072 der Beilagen) (TOP 11)
Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen:
Der eingangs bezeichnete Gesetzesantrag wird wie folgt geändert:
a) In Artikel 2 wird im Titel nach dem Wort „Medizinproduktegesetzes“ die Zahl „2021“ angefügt.
b) In Artikel 2 lautet die Novellierungsanordnung Z 1:
„In § 14 Abs. 4 Z 6 wird das Wort „und“ durch das Wort „oder“ ersetzt.“
c) In Artikel 2 entfällt die Z 2.
Begründung
Zu a):
Artikel 2 (Titel):
Wenngleich dies ohnehin aus der Promulgationsklausel hervorgeht, wird der Titel berichtigt, um zu verdeutlichen, dass es sich um eine Änderung des Medizinproduktegesetzes 2021 handelt.
Zu b):
Artikel 2 Z 1 (§ 14 Abs. 4 Z 6 des Medizinproduktegesetzes 2021):
Klarstellung, dass der Ethikkommission entweder ein technischer Sicherheitsbeauftragter einer Krankenanstalt oder eine Person mit einem Studienabschluss in biomedizinischer Technik oder einem abgeschlossenen Ingenieur- oder naturwissenschaftlichem Studium mit zumindest dreijähriger Erfahrung im Bereich der biomedizinischen Technik anzugehören hat.
Zu c):
Artikel 2 Z 2 (§ 84 Abs. 3 des Medizinproduktegesetzes 2021):
Aufgrund einer Reevaluierung ist nicht mehr davon auszugehen, dass eine Verlängerung der Bestimmung des § 81 Abs. 4 über den 31. Dezember 2021 hinaus erforderlich ist.
*****
Abänderungsantrag
der Abgeordneten Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen,
zum Bericht des Gesundheitsausschusses über den Antrag 1824/A der Abgeordneten Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Epidemiegesetz 1950 und das COVID-19-Maßnahmengesetz geändert werden (1067 d.B.) (TOP 6)
Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen:
Der eingangs genannte Gesetzesantrag wird wie folgt geändert:
In Artikel 2 Z 8 wird in § 7 Abs. 3a nach dem Wort „Bürgermeister“ die Wortfolge „mit Zustimmung der Bezirksverwaltungsbehörde“ eingefügt.
Begründung
Zur Zulässigkeit der Übertragung von Aufgaben im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung auf Gemeinden siehe Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht5 (2017), Rz 334 f. Typische Beispiele des übertragenen Wirkungsbereichs sind die Zuständigkeiten des Bürgermeisters im Bereich des Meldewesens (§ 13 Abs. 1 MeldeG).
In diesem Sinne wird dem Bürgermeister die Zuständigkeit zur Erlassung von Verordnung gemäß § 7 Abs. 3a übertragen. Durch das Erfordernis der Zustimmung der Bezirksverwaltungsbehörde ist der zur Verordnungserlassung erforderliche fachliche Austausch vor Verordnungserlassung sichergestellt. Es ist davon auszugehen, dass damit der Dokumentationspflicht entsprechend den Anforderungen der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes ausreichend nachgekommen werden kann.
Gegen die Sicherstellung der Kooperation zwischen Gemeinde im übertragenen Wirkungsbereich und Bezirksverwaltungsbehörde – als verfahrensrechtliche Voraussetzung der Verordnungserlassung – sprechen auch keine verfassungsrechtlichen Bedenken.
Die Verwaltungsführung der Gemeinden (Gemeindeverbände) in den Angelegenheiten des übertragenen Wirkungsbereichs ist unmittelbar von Verfassungs wegen der Weisungsbefugnis und dem damit zusammenhängenden Aufsichtsrecht des zuständigen staatlichen Organs unterworfen (Art. 119 Abs. 1 B-VG); welches das zuständige Organ des Bundes oder des Landes ist, muss sich aus den anwendbaren Verwaltungsvorschriften ergeben (Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht7 (2017), Rz 373).
*****
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt nun Frau Dr. Dagmar Belakowitsch. – Bitte, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete Dr. Dagmar Belakowitsch (FPÖ): Herr Präsident! Mein Vorredner, der Pharmalobbyist Schallmeiner, hat sich hierhergestellt und hat gesagt: Derzeit sind in Österreich 12 000 Personen an Covid erkrankt und jeden Tag kommen 1 800 dazu.
Herr Kollege Schallmeiner, das ist absolut unrichtig. (Zwischenruf des Abg. Schallmeiner.) – Hören Sie zu, vielleicht lernen Sie nach eineinhalb Jahren Pandemie ein bisschen was! Bestenfalls werden jeden Tag 1 800 Personen positiv getestet. (Neuerlicher Zwischenruf des Abg. Schallmeiner.) Das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob sie erkranken.
In Ergänzung – für Kollegen Schallmeiner, der es sich wieder nicht merken wird, weil er den Saal verlassen möchte –: Nur 4 Prozent der positiv Getesteten (Abg. Schallmeiner: Ich habe den Saal nicht verlassen, ich bin immer noch an meinem Platz!) kommen tatsächlich ins Krankenhaus. (Beifall bei der FPÖ.)
14.26
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt Mag. Gerhard Kaniak. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Mag. Gerhard Kaniak (FPÖ): Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer! Wir haben letzte Woche eine sehr intensive Sitzung im Gesundheitsausschuss gehabt, und einer meiner Vorredner, Abgeordneter Kucher, hat es schon angemerkt: Über 20 Anträge sind von den Regierungsfraktionen erneut vertagt worden, und jene Tagesordnungspunkte, die es heute in das Plenum geschafft haben – sechs an der Zahl –, werden unter einem Tagesordnungspunkt zusammengefasst, sodass kaum die Möglichkeit besteht, tatsächlich auf jeden einzelnen Antrag, auf jede einzelne Gesetzesänderung einzugehen. Dabei sind sie doch sehr unterschiedlich.
Einzelne dieser Tagesordnungspunkte werden von unserer Fraktion auch unterstützt, wie zum Beispiel die Änderungen im COVID-19-Zweckzuschussgesetz, bei denen es um die Verlängerung der Kostenübernahme für die Testungen generell geht, oder auch die Verlängerung der betrieblichen Testungen, die einen eigenen Tagesordnungspunkt darstellen. Das wird von uns positiv gesehen, wobei wir heute auch noch einen darüber hinausgehenden Ergänzungs- beziehungsweise Abänderungsantrag einbringen werden.
Andere Gesetze, die heute hier beschlossen werden sollen, stoßen auf unsere klare Ablehnung, wie das bereits angesprochene COVID-19-Lagergesetz, das vorsieht, dass Schutzausrüstung und Impfstoffe vom österreichischen Staat großzügigst verschenkt werden können. Herr Bundesminister Mückstein hat schon angekündigt, dass Impfstoffe im Wert von 100 Millionen Euro verschenkt werden sollen (Zwischenruf des Abg. Schallmeiner), obwohl wir das Geld für die Versorgung in Österreich benötigen würden.
Das Problem an diesem Flickwerk sind der unterschiedliche Fristenlauf, die vollkommene Unverhältnismäßigkeit der einzelnen Maßnahmen. Es gibt überhaupt keinen roten Faden in der Pandemiebekämpfungsstrategie – so kann man es ja eigentlich gar nicht nennen. Es gibt keinen roten Faden in der Pandemiebekämpfung durch die Bundesregierung. Und ob wir Herrn Bundesminister Mückstein dabei unterstützen können, dass wir das noch hinbekommen, wage ich nach mehreren Monaten vergeblicher Versuche fast zu bezweifeln.
Die größte Änderung, den größten Brocken in den aktuell vorliegenden Gesetzesnovellen stellen naturgemäß die Änderungen im Epidemiegesetz und im COVID-19-Maßnahmengesetz dar. Was sich da abspielt, vor allem an Systematik, ist wirklich erschütternd. Nach über eineinhalb Jahren der Krise und nach unzähligen kritischen Hinweisen auch vonseiten des Verfassungsdienstes haben wir die Situation, dass die Bundesregierung nun das Epidemiegesetz und das COVID-19-Maßnahmengesetz nicht nur bis Sommer 2022 verlängern möchte. Nein, sie möchte auch noch eine Ermächtigung dazu haben, eigenständig und ohne erneute Befragung des Parlaments diese Ausnahmesituation, diese Notstandsregelung um ein weiteres halbes Jahr bis Ende 2022 zu verlängern. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, lehnen wir kategorisch ab. Das wird es mit uns Freiheitlichen nicht gebe
n.
Einer der wesentlichen Punkte, warum wir das ablehnen, ist, dass im Epidemiegesetz und im COVID-19-Maßnahmengesetz nirgends verankert ist, wann denn die Epidemie in Österreich tatsächlich beendet ist und wann all diese freiheitseinschränkenden Maßnahmen beendet werden müssen. Es ist aber umgekehrt durchaus logisch, warum das nicht der Fall ist: Das würde ja voraussetzen, dass wir ehrliche und transparente Zahlen haben, auf deren Basis Entscheidungen getroffen werden. Das haben wir aber leider noch immer nicht.
Wir haben in Österreich seit November 2020 die Situation, dass die von der Bundesregierung und der Ages verkündeten Fallzahlen nicht der Definition der WHO entsprechen. Gut, kann man sagen, kann passieren! Das könnte man aber natürlich ändern. Ich habe Herrn Bundesminister Mückstein darauf hingewiesen, dass sein Amtsvorgänger Anschober da etwas etabliert hat, was international nicht vergleichbar und damit nicht standardisiert ist. Bis heute ist es nicht geändert.
Aber gut, schauen wir weiter: Wir wissen ja nicht einmal, wie hoch unsere tatsächlichen Bettenkapazitäten im intensivmedizinischen Bereich sind – noch immer nicht! Gerade diese Woche ist ein neues Factsheet von der Gesundheit Österreich GmbH veröffentlicht worden, in dem nun erstmalig von der seit 18 Monaten geltenden Zahl von 2 000 intensivmedizinischen Betten abgewichen wurde und interessanterweise 2 102 Betten ausgewiesen wurden. Ich habe keine Ahnung, wie man auf diese Zahl kommt, sie entspricht auch nicht dem Krankenanstaltenbericht, den das Gesundheitsministerium selber herausgegeben hat, wir nähern uns aber vielleicht schön langsam der tatsächlichen Realität an. Ich hoffe, das wird auch bei den entsprechenden Prozentschwellenwerten im Rahmen der aktuellen Verordnung berücksichtigt. Die GÖG hat das bereits gemacht.
Ein weiterer interessanter Aspekt ist natürlich auch die Frage, ob jemand im Spital mit einer Sars-Cov-2-Infektion liegt, also Sars-Cov-2-positiv ist, oder ob er tatsächlich an Covid-19 erkrankt ist. Man hat das heute bei meinem Vorredner, Abgeordneten Schallmeiner, schon gemerkt: Da kommen manche ganz ordentlich ins Schleudern und verwechseln Äpfel mit Birnen.
Dass das auch bei den öffentlichen Zahlen einen großen Unterschied macht, möchte ich Ihnen anhand eines Berichtes von letzter Woche vom Direktor der Tiroler Landeskrankenanstalten zeigen: Er hat gesagt, man müsse doch bei dieser hohen Zahl an Meldungen von Impfdurchbrüchen bei den doppelt Geimpften, die als Covid- oder Coronapatienten im Spital liegen, unterscheiden. Da seien viele dabei, die wegen regulärer Operationstermine oder ganz anderer Geschichten auf der Intensivstation lägen und gar nicht an Covid-19 erkrankt seien. So erklärt er die Bis-zu-60-Prozent-Rate an Covid-Patienten auf der Intensivstation.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, da haben Sie es ja schwarz auf weiß! Offensichtlich schaffen wir es nicht, zu unterscheiden, wer tatsächlich an Covid-19 erkrankt in unseren Spitälern liegt und wer nur im Rahmen des Aufnahmeprozesses und der Routinetestung im Spital Sars-Cov-2-positiv ist, eigentlich aber gar nicht an Covid-19 erkrankt ist. – Herr Minister, wäre das nicht doch ein ganz wesentliches Kriterium und eine ganz entscheidende Zahl, um Belegsituationen im Spital interpretieren und daraus Maßnahmen ableiten zu können? – Ich denke schon. Wie man das vollkommen ignorieren kann, erschließt sich mir leider nicht.
Selbst bei den Verstorbenen haben wir leider noch immer keine Klarstellung. Sie müssen sich vorstellen: Mit oder an Covid-19 verstorben – wir könnten es in Österreich seit Anbeginn der Krise durch Obduktionen ganz einfach klären. Der Gesundheitsminister – Ihr Vorgänger, aber auch der aktuelle – sieht keine Veranlassung, das zu tun. Dabei zeigen die aktuellen Zahlen der Gesundheit Österreich GmbH, dass 55 Prozent der – unter Anführungszeichen – „Covid-Toten“ vor ihrem Ableben ausschließlich auf der Normalstation versorgt waren, 30 Prozent auf der Intensivstation und dass überraschenderweise 15 Prozent der Covid-Toten überhaupt nicht in Spitalsbehandlung waren.
Mir wäre neu, dass Covid-19 eine Erkrankung ist, die einem spontan über Nacht oder innerhalb von wenigen Stunden das Leben raubt. Meistens hat man da einen sehr unschönen Krankheitsverlauf. – Herr Bundesminister, wie erklären Sie sich, dass trotzdem
in Summe 70 Prozent keine intensivmedizinische Betreuung hatten, bevor sie gestorben sind? Ich kann mir das kaum erklären. Möglicherweise haben wir da lauter Palliativfälle, die an Covid-19 erkrankt waren, die Sars-Cov-2-positiv waren und gar nicht an Covid-19 erkrankt waren. Ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass bei den bereitgehaltenen Kapazitäten aus dem Gesundheitssystem 70 Prozent der Verstorbenen vorher gar keine spitals- oder intensivmedizinische Betreuung hatten.
Irgendetwas stimmt da also nicht. Ich würde Sie ersuchen: Schauen Sie sich das einmal ordentlich an, und wenn wir diese Zahlen haben, dann kann man vielleicht auch vernünftige Maßnahmen daraus ableiten!
Kommen wir zu den Maßnahmen! Ich habe das vorhin im Rahmen des Rechnungshofberichtes zum Budget schon angesprochen: Wir könnten diese Krise mit effektivem Mitteleinsatz deutlich besser handeln. Wir brauchen diese Mittel im Gesundheitsbereich, wir brauchen den Schutz der Risikogruppen, und zwar effizient und kostenlos für die Betroffenen, genauso wie wir frühzeitige therapeutische Maßnahmen für Sars-Cov-2-positive Menschen in diesem Land brauchen.
Da gäbe es eine Fülle an Maßnahmen, Herr Bundesminister, wir haben das auch im Gesundheitsausschuss schon mehrmals diskutiert, und da passiert einfach gar nichts. Die Menschen, die positiv getestet werden, werden abgesondert, sitzen nach wie vor – jetzt halt vielleicht nur noch fünf bis zehn Tage statt sieben bis 14 Tage – zu Hause in Quarantäne und bekommen überhaupt keine medizinische Anleitung oder Betreuung, geschweige denn eine medikamentöse Therapie, um ein potenzielles Auftreten von Covid-19 und einen schweren Krankheitsverlauf zu verhindern.
Dabei gibt es so viel! Wir haben in Österreich mit den Budesonid-Inhalatoren zugelassene Arzneimittel, die in den Studien gezeigt haben, dass sie bei regelmäßiger Anwendung mindestens 70 Prozent der schweren Verläufe verhindern können. Das weiß man aus den Daten von Asthmapatienten.
Wir haben in Österreich Ivermectin in der Zulassung, das off label verwendet werden könnte. Andere Staaten wie zum Beispiel die Tschechei haben das bereits gemacht, haben nationale Zulassungen für diese Indikation ausgesprochen und therapieren bereits flächendeckend damit, ganz zu schweigen von der internationalen Situation: Indien, der afrikanische Kontinent, Südafrika und, und, und. Bei uns findet das alles nicht statt.
Es gibt eine neue WHO-Empfehlung für monoklonale Antikörper – eine WHO-Empfehlung, Herr Bundesminister, das müsste bei Ihnen normalerweise sofort auf der To-do-Liste aufscheinen! Casirivimab in Kombination mit Imdevimab, zwei monoklonale Antikörper, die sowohl bei Risikopatienten mit frühzeitiger Gabe als auch bei bereits Erkrankten mit späterer Gabe das Risiko für schwere Verläufe und Todesfälle anscheinend um 50 Prozent reduzieren können.
Dann gibt es noch weitere Dinge: Sotrovimab, ein weiteres monoklonales Antikörperpräparat mit einer Risikoreduktion von mindestens 80 Prozent, das in den USA bereits die Zulassung bekommen hat und in Europa kurz vor der Zulassung steht, das wir auch national vorab zulassen könnten; das erste oral verfügbare Therapeutikum in Tablettenform, Molnupiravir, das jetzt auch gerade in der Zulassung bei der EMA drinnen hängt und das in den Studien nicht nur eine Reduktion von mindestens 70, 80 Prozent der schweren Verläufe gezeigt hat, sondern auch über 90 Prozent der Todesfälle verhindert hat.
Herr Bundesminister, das sind alles Therapieoptionen, die auf dem Markt entweder schon verfügbar sind oder in kürzester Zeit verfügbar sein werden. Ich schaue mir Ihr Budget beziehungsweise das Budget des Herrn Bundesfinanzministers – die Gesundheitsposition – an, und da ist nichts für die Beschaffung dieser Dinge vorgesehen – nichts!
Wie kann das sein? So kommen wir nicht aus der Krise. Ich würde Sie ersuchen, diese Anregungen ernst zu nehmen. Ich kann mich der Forderung von Kollegen Kucher nur anschließen: Kämpfen Sie für einen größeren Anteil im Budget! Nehmen Sie vielleicht die 100 Millionen Euro, mit denen Sie Impfstoff beschaffen und wieder verschenken wollen, her und beschaffen Sie Arzneimittel, die die österreichische Bevölkerung braucht, um schwere Krankheitsverläufe zu verhindern! Nehmen Sie vielleicht etwas von den 200 Millionen Euro für Inseratenkampagnen der Bundesregierung her und geben Sie das den Pflegekräften, damit diese besser entlohnt werden und damit wir vielleicht noch ein paar zusätzliche Pflegekräfte finden!
Mir fallen noch etliche weitere Budgetpositionen ein. Wenn wir all die Einschränkungen, Maßnahmen, Betriebsschließungen und Ähnliches beenden würden und das Geld dafür für medizinische Therapie und Pflegekräfte verwenden würden, dann könnten wir diese Krise tatsächlich rasch überwinden, und zwar ohne weitere freiheitseinschränkende Maßnahmen.
Meine abschließende Forderung lautet daher: Schluss mit diesem Maßnahmenchaos! Schluss mit diesem Fleckerlteppich an Maßnahmen, der sich im Endeffekt nicht als effektiv erwiesen hat! Stützen wir unser hervorragendes österreichisches Gesundheitssystem auch mit den entsprechenden finanziellen Zuwendungen, damit die letzten Züge dieser Krise rasch und erfolgreich beendet werden können! Verschaffen wir den Österreichern am 26. Oktober einen Tag der Freiheit und beenden alle Covid-Maßnahmen! – Vielen Dank. (Beifall bei der FPÖ.)
14.38
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt Dr. Josef Smolle. – Bitte schön, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Dr. Josef Smolle (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Im Gesundheitsausschuss haben wir uns mit einer breiten Palette von Fragen befasst. Ich möchte zuerst aber, weil es angesprochen worden ist, kurz auf das Thema Medizinstudienplätze eingehen.
Wir haben in Österreich in allen internationalen Vergleichstabellen eine der höchsten Zahlen an Ärztinnen und Ärzten, eines der höchsten Level an Medizinabsolventinnen und -absolventen und auch eine der höchsten Zahlen an Medizinstudienplätzen. Dieses Medizinstudium ist extrem nachgefragt – das ist einmal primär etwas Positives.
Man hat aber in Österreich durch die Einrichtung der Medizinischen Fakultät in Linz bereits den Weg für 300 weitere Studienplätze geschaffen, und das Wissenschaftsministerium ist mit den vier öffentlichen Standorten in Österreich in Verhandlung, um auch für die nächste Leistungsvereinbarungsperiode eine moderate Erhöhung der Zahl der Studienplätze in die Wege zu leiten. Das heißt, wir sind punkto Studienplätze international wirklich gut aufgestellt. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
Ich möchte im Folgenden kurz auf das COVID-19-Maßnahmengesetz, das Epidemiegesetz, das Gesundheitstelematikgesetz, das Medizinproduktegesetz und dann ein bisschen allgemein auf das eingehen, was wir bisher gelernt haben, was wir derzeit wissen, wo wir derzeit in der Covid-Pandemie stehen.
Zum Epidemiegesetz und zum COVID-19-Maßnahmengesetz hat es einige legistische Änderungen gegeben, gerade hinsichtlich des rechtlichen Umgangs mit Quarantänebescheiden, was, glaube ich, sehr, sehr gut ist. Man hat den Ärztinnen und Ärzten niederschwelliger die Möglichkeit geboten, für ihre Patientinnen und Patienten Zertifikate von allen drei Arten auszudrucken, und man hat auch die Möglichkeit geschaffen, dass
gewisse Maßnahmen unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen auch relativ regional umgesetzt werden können – auch das eine Erkenntnis der Entwicklung der letzten 1,5 Jahre.
Beim Gesundheitstelematikgesetz ist ein Punkt, dass das Fernrezept, also jenes, das von Ärztinnen, Ärzten direkt in die Apotheke übermittelt wird, vorerst einmal verlängert wird; insbesondere deshalb, damit man einen nahtlosen Übergang zu dem schon in der Pipeline befindlichen E-Rezept im Rahmen von Elga findet. Das heißt, diese elektronische Übermittlung wird in den Regelbetrieb übergehen.
Was mir aber mindestens ebenso wichtig erscheint, ist Folgendes: In der Coronapandemiezeit wurden viele Dinge im Gesundheitswesen digital abgewickelt, zum Teil aus der Not geboren. Nun gilt es, genau zu reflektieren, was davon Bestand haben soll, was davon wertvoll ist und welche Rahmenbedingungen wir schaffen müssen, damit es auch gesichert in der Zukunft im Interesse der Patientinnen und Patienten angewendet werden kann.
Beim Medizinproduktegesetz hat es eher marginale Änderungen gegeben. Ich möchte nur grundsätzlich darauf hinweisen, dass das Medizinproduktegesetz ja relativ neu ist und insbesondere auch die Gewährleistung dafür bietet, dass in Österreich verwendete Medizinprodukte sicher sind. Zum anderen stellt es aber auch die Entwicklungsmöglichkeit, die Forschungsmöglichkeit und die Produktionsmöglichkeit in Österreich in einen konstruktiven Rahmen.
Jetzt komme ich zu dem vielleicht wichtigsten Punkt, nämlich: Wo stehen wir derzeit in der Pandemie? – Die Impfungen betreffend ist es so, dass derzeit etwa 65 Prozent der Gesamtbevölkerung bei uns geimpft sind, bei den Erwachsenen sind es 75 Prozent. Das ist nicht wenig. Der EU-Durchschnitt liegt derzeit bei 80 Prozent. Wie hat sich das bisher ausgewirkt? – Im Jänner dieses Jahres sind von allen positiv getesteten Covid-19-Trägerinnen und -Trägern 2,3 Prozent verstorben. Das ist sehr viel. Der eindrucksvollste Erfolg für mich ist der, dass dieser Wert mittlerweile von 2,3 Prozent auf 0,5 Prozent zurückgegangen ist. Das ist der Tatsache geschuldet, dass eben die Hochrisikopatientinnen und -patienten, die alten und hochaltrigen Menschen weitgehend geschützt sind.
Man weiß, dass die Impfungen cum grano salis zu 90 Prozent vor schweren Erkrankungen schützen. Wir wissen, dass der Impfschutz im Laufe eines halben Jahres, Dreivierteljahres langsam nachlässt. Das ist nichts Ungewöhnliches, auch bei Diphtherie und FSME gibt es ein Zwei-plus-eins-Schema, das heißt: zwei Impfungen knapp hintereinander und dann mit einem Abstand von einem halben, Dreiviertel- bis einem Jahr eine Auffrischungsimpfung. Wir wissen, dass Genesene gut geschützt sind und deren Schutz etwas langsamer abnimmt. Der Ultimo ist, genesen und einmal geimpft zu sein.
Es ist immer wieder die Frage aufgetaucht, wie es denn um die sogenannte Herdenimmunität steht. Das ist ein Wort, das ich nicht verwende, denn es stammt aus der Viehzucht um 1900. Ich spreche von Bevölkerungsimmunität. Dafür, wann die erreicht ist, kann man keine hundertprozentige Zahl festlegen. Man kann nur eines sagen: Solange sich die Erkrankung noch ausbreitet, haben wir die Bevölkerungsimmunität noch nicht erreicht. Andererseits merkt man aber bereits deutlich den bremsenden Effekt dieses sich ausbreitenden immunologischen Schutzes.
Auch dazu einen kleinen Vergleich: Im letzten Monat ist die Zahl der Infizierten, die wir pro Tag oder im Siebentagedurchschnitt hatten, weitgehend gleichgeblieben, sogar um 8 Prozent gesunken, manchmal geht sie wieder ein bisschen hinauf. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum im Vorjahr ist die Zahl der Infizierten um 70 Prozent gestiegen. Das heißt, wir bemerken schon eine deutliche Bremsung in der Ausbreitung. Insgesamt kann ich sagen: Ich bin weiterhin auf dem Weg des vorsichtigen Optimismus.
Was nun die Therapien betrifft, ist es so: Bei der manifesten Erkrankung gibt es intensive Forschung von Anfang an. Die Datenlage für die meisten – auch für die vorhin genannten Therapien – ist noch eher bescheiden. Manches, was ursprünglich gehypt worden ist, hat sich leider als wenig wirksam herausgestellt. Das heißt, wir müssen weiter zusammenhalten, schauen, dass wir die Ausbreitung eindämmen, dass wir gut über den Winter kommen. Noch einmal: Vorsichtiger Optimismus und solidarisches Zusammenwirken. – Danke schön. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
14.46
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort ist nun Mag. Gerald Loacker gemeldet. – Bitte, Herr Abgeordneter. – Herr Abgeordneter, wenn Sie erlauben, ich muss noch kurz etwas bekannt geben.
Präsident Ing. Norbert Hofer: Ich gebe bekannt, dass das von mindestens 46 Abgeordneten unterstützte Verlangen 3/US auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses gemäß § 33 Abs. 1 der Geschäftsordnung betreffend „Klärung von Korruptionsvorwürfen gegen ÖVP-Regierungsmitglieder (ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss)“ eingebracht wurde.
Dieses wird gemäß § 33 Abs. 2 der Geschäftsordnung an alle Abgeordneten verteilt.
Ferner liegt mir das von fünf Abgeordneten gemäß § 33 Abs. 4 der Geschäftsordnung gestellte Verlangen vor, eine Debatte über dieses Verlangen durchzuführen. Diese Debatte findet nach Erledigung der Tagesordnung statt.
Die Zuweisung des gegenständlichen Verlangens an den Geschäftsordnungsausschuss erfolgt gemäß § 33 Abs. 6 der Geschäftsordnung am Schluss dieser Sitzung. (Beifall bei SPÖ, FPÖ und NEOS.)
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort ist nun Mag. Gerald Loacker gemeldet. – Bitte Herr, Abgeordneter.
Abgeordneter Mag. Gerald Loacker (NEOS): Danke, Herr Präsident. Es hat sich ausgezahlt, für die Bekanntgabe dieser Nachricht hier vorne ein bisschen warten zu dürfen. Ich freue mich auf den ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss. (Heiterkeit bei Abgeordneten der FPÖ. – Zwischenruf bei der ÖVP.)
Mit den Tagesordnungspunkten, die da unter einem verhandelt werden, werden mehrere Covid-Maßnahmengesetze verlängert, interessanterweise zu ganz unterschiedlichen Fristen. Das eine läuft bis Oktober, das andere bis März und das andere bis Juni weiter – das alles hat kein Konzept und keinen roten Faden, würde ich jetzt einmal sagen. Wenn man den roten Faden sucht, wird man jedenfalls nicht fündig.
Eine interessante Frage hat die sozialdemokratische Fraktion im Ausschuss aufgeworfen, es wurde gefragt: Warum laufen eigentlich die betrieblichen Testungen bis Ende Oktober – da kostet die Republik ein Test 10 Euro – und die Gratistests in den Apotheken – da kostet die Republik ein Test 25 Euro – bis Ende März nächsten Jahres? Da hat es dann vonseiten des Herrn Minister geheißen: Das müssen wir uns noch anschauen. – Damit war ich nicht glücklich, denn wenn der Antrag daliegt, dann muss ich es mir nicht anschauen, dann muss ich es nämlich abstimmen. Die Mehrheitsfraktionen waren nicht in der Lage, logisch zu erklären, warum das eine bis Ende Oktober 2021 und das andere bis Ende März 2022 läuft. Ich weiß es bis heute nicht.
Was ich schon weiß, ist, dass man davon schon lange hätte abkommen sollen. In Deutschland sind die Tests seit dieser Woche, in der Schweiz seit Beginn des Monats kostenpflichtig, und in Italien sind sie auch kostenpflichtig. Bei uns sind die Apothekentests aber bis März 2022 gratis. Bei aller Wertschätzung für den Apothekerberuf: Da verdienen sich einige eine goldene Nase. Rechnen Sie sich einmal aus: 25 Euro pro Test – da müssen Sie in einer kleinen Apotheke nur 100, 130 Tests am Tag machen und haben ein schönes Zusatzeinkommen. Es sei ihnen vergönnt, aber es geht halt auf Kosten der Steuerzahler.
Was fehlt, ist ein Weg aus dem Pandemiemodus heraus in die Normalität. Wie kommen wir wieder aus diesem Coronapanikmodus in eine gesundheitspolitische und in eine wirtschaftliche Normalität? Wann ist es genug? Wann haben wir, Kollege Smolle, so viele Impfungen und so viele Genesene, dass es reicht und wir wieder normal weiterleben können?
Klar, wenn die FPÖ es so wie die Freiheitlichen im Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus gemacht und zum Impfen aufgerufen hätte, dann wären wir natürlich auch schon ein Stück weiter.
Es wurde auch das Thema angesprochen, dass Österreich überschüssige Impfdosen an andere Länder verschenkt. – Es ist gut, diese an bedürftige Länder weiterzugeben, bevor das Ablaufdatum erreicht ist, aber wie diese Länder ausgesucht werden, erschließt sich mir nicht. So bekommt die Diktatur im Iran eine Million Dosen, während das liberale demokratische China, die Republik Taiwan, von Österreich nichts bekommt – jedoch sehr wohl beispielsweise von der Slowakei etwas bekommen hat, von Litauen etwas bekommen hat, aber von Österreich nicht. Also die Diktaturen kriegen etwas und die Freunde in den liberalen Demokratien bekommen nichts. – Okay, dafür ist der Außenminister verantwortlich, der jetzt Bundeskanzler geworden ist, aber den werden wir das bei Gelegenheit auch noch fragen. – Danke schön. (Beifall bei den NEOS.)
14.50
Präsident Ing. Norbert Hofer: Nun gelangt Bedrana Ribo zu Wort. – Bitte schön, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete Bedrana Ribo, MA (Grüne): Herr Präsident! Geschätzter Minister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe ZuseherInnen auf der Galerie und vor den Bildschirmen! Ich darf heute über eine Änderung im COVID-19-Maßnahmengesetz sprechen. Demnach wird in allen Berufen, bei denen ein physischer Kontakt mit anderen Personen nicht ausgeschlossen werden kann, ein 3G-Nachweis erforderlich sein – kurz gesagt: 3G am Arbeitsplatz.
Ich fange aber einmal ein bisschen anders an: Wir haben in Österreich das Glück, in einem Land zu leben, wo es genug Impfstoff gibt – nicht alle haben dieses Glück. Ich bin gebürtige Bosnierin und weiß zum Beispiel, dass es dort nicht genug Impfstoff gibt. Ich konnte im Sommer sehen, was es heißt, sich nicht impfen lassen zu können: Ich konnte sehen, wie Menschen stundenlang in der prallen Sonne in der Schlange standen, um sich für eine Impfung vormerken zu lassen, ich konnte auch sehen, wie Menschen ihr letztes Geld zusammengekratzt haben und nach Belgrad oder nach Kroatien gefahren sind, um sich dort impfen zu lassen. Und ich konnte auch das Glück und die Erleichterung bei einigen Menschen sehen, die dann von den Gesundheitsbehörden angerufen worden sind, von denen ihnen mitgeteilt wurde, dass sie doch eine Impfung bekommen können.
Wir in Österreich haben alle Möglichkeiten, jede und jeder von uns kann sich impfen lassen, es gibt an jeder Ecke die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Unser gemeinsames Ziel muss es schlussendlich sein, diese Pandemie zu bekämpfen, nicht nur uns selbst
zu schützen, sondern auch unsere Mitmenschen und unsere KollegInnen zu schützen. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
Ich finde diese Regelung wichtig und richtig. Denken wir bitte an die selbstlosen Menschen im Gesundheits- und Pflegebereich! Die haben das bereits von Anfang an konsequent durchgesetzt. Denken wir an all diese MitarbeiterInnen auf den Covid-Stationen, auf den Intensivstationen, die trotz Impfungen tagtäglich in voller Montur für ihre PatientInnen da sind, ihre PatientInnen schützen, uns alle schützen! Allein aus Solidarität mit diesen Menschen, allein aus Solidarität mit den HeldInnen dieser Pandemie muss es für uns eigentlich selbstverständlich sein, da mitzuhelfen und wirklich Verantwortung zu übernehmen.
Noch einmal mein Appell: Nutzen Sie daher das Privileg, das wir in Österreich haben! Nicht alle haben dieses Privileg. – Danke. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
14.53
Präsident Ing. Norbert Hofer: Nächste Rednerin ist Mag.a Verena Nussbaum. – Bitte schön, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete Mag. Verena Nussbaum (SPÖ): Herr Präsident! Hohes Haus! Herr Bundesminister! Ich werde heute zu den betrieblichen Testungen und zum Zweckzuschussgesetz sprechen. Dabei möchte ich positiv erwähnen, dass die Kostenersätze für die Testungen für die Länder und für die Gemeinden, für die telefonische Gesundheitsberatung und auch der Mehraufwand für die Rettungs- und Krankentransportdienste bis Ende März 2022 verlängert werden.
Obwohl die Testmöglichkeiten bei den Apotheken und öffentlichen Teststraßen verlängert werden, entbehrt es jeglicher Logik, warum die betrieblichen Testungen – Kollege Loacker hat das auch schon angesprochen – nur mehr bis Ende Oktober finanziell unterstützt werden sollten – bis jetzt sind Sie uns eine Antwort schuldig geblieben; vielleicht kommt heute noch eine –, nämlich genau angesichts des Aspekts, dass Sie, Herr Minister, es jetzt in der Hand haben, im Verordnungsweg die 3G-Regelung für den Arbeitsplatz auch umzusetzen.
Die Unterstützungen, die wir den Ländern mit dem Zweckzuschussgesetz jetzt zukommen lassen – weiter zukommen lassen –, werden für die Länder beim Thema Pflege aber auch in Zukunft notwendig sein, denn die Coronapandemie hat uns ganz klar aufgezeigt – und für die, für die es noch nicht klar war, ist es, glaube ich, spätestens jetzt sonnenklar geworden –, dass es in Österreich einen Pflegenotstand gibt. Die Bundesregierung war beim Thema Pflege wieder einmal ein Ankündigungsweltmeister, aber von der groß herbeigeredeten Pflegereform ist bis heute nichts zu sehen – und auch im Budget für das kommende Jahr ist nichts vorgesehen.
Wir können es uns aber nicht mehr leisten, da zuzuwarten, deshalb bringe ich heute einen Antrag ein, der konkrete Maßnahmen vorsieht, wie wir den Pflegenotstand in Österreich beenden könnten.
Erstens: Wir brauchen anstelle von neun unterschiedlichen Systemen ein bundeseinheitliches Pflegesystem, mit dem wir hochwertige Qualität der Pflege sicherstellen können.
Zweitens – da möchte ich auf unseren schon lange geforderten Pflegegarantiefonds hinweisen –: Die Pflege soll aus einem Topf finanziert werden. Die Länderleistungen und die von uns geforderte Pflegemilliarde sollen da hineinkommen, denn nur so können Pflegeleistungen in Zukunft kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
Drittens gilt es, und das ist ein wesentlicher Punkt, dem Personalmangel im Pflegebereich entgegenzuwirken. Dazu braucht es eine Ausbildungsoffensive. Wir sprechen
dabei von 100 000 zusätzlichen Pflege- und Betreuungskräften bis zum Jahr 2030. Derzeit können Pflegeeinrichtungen schon nicht alle Betten belegen, weil die dafür notwendigen Pflegekräfte fehlen. Wir müssen dringend die Ausbildungen verbessern, nämlich dadurch, dass man auch schon während des Studiums, ähnlich wie bei den Polizeischülerinnen und -schülern eine Entlohnung und eine Arbeitsplatzgarantie vorsieht.
Auch um die Arbeitsplätze attraktiver zu gestalten, damit Pflegekräfte nicht nur einen kurzen Zeitraum in diesem Beruf arbeiten können, sondern auch längerfristig, sind bessere Arbeitsbedingungen – und da vor allem eine Arbeitszeitverkürzung und eine sechste Urlaubswoche für alle – unabdingbar.
Ich bringe daher folgenden Antrag ein:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Philip Kucher, Kolleginnen und Kollegen, betreffend „Pflegeoffensive jetzt!“
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, sofort eine Pflegeoffensive zu starten und unverzüglich dem Nationalrat Regierungsvorlagen zu übermitteln, mit der
- ein Pflegegarantiefonds für kostenfreie Pflegeleistungen geschaffen
- eine zusätzliche Pflegemilliarde aus Budgetmittel zur Verfügung gestellt
- eine Ausbildungsoffensive sofort gestartet und
- die Verbesserung der Arbeitssituation für Pflegeberufe rasch umgesetzt wird.“
*****
Danke schön. (Beifall bei der SPÖ.)
14.58
Präsident Ing. Norbert Hofer: Sehr geehrte Frau Abgeordnete! Sie haben sehr nachvollziehbar erklärt, warum Ihnen dieser Antrag ein wichtiges Anliegen ist, es ist aber kein nachvollziehbarer Zusammenhang zum COVID-19-Zweckzuschussgesetz gegeben und Sie konnten diesen Zusammenhang auch nicht vom Rednerpult aus herstellen. Ich kann daher diesen Entschließungsantrag zu dieser Debatte nicht zulassen.
Zu Wort gelangt nun Frau Ing. Mag.a Alexandra Tanda. – Bitte, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete Ing. Mag. (FH) Alexandra Tanda (ÖVP): Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen im Plenum! Sehr geehrte Damen und Herren auf der Galerie und zu Hause vor den Bildschirmen! Seit Beginn der Pandemie, also seit 20 Monaten, leistet der Bund einen Zweckzuschuss für die entstandenen Aufwendungen an die Länder und an die Gemeinden. Dazu gehört unter anderem der Kostenersatz für die Schutzausrüstung, für die telefonische Gesundheitshotline, für die Infrastruktur, die Notspitäler und ganz besonders für die Impfstraßen und die Aufrechterhaltung der Testmöglichkeiten. Und auch bei den Rettungs- und Krankentransportdiensten ist der Mehraufwand bedingt durch die Covid-19-Auflagen noch immer hoch und nicht einmal unwesentlich zurückgegangen.
Die zusätzlichen Ausgaben aufgrund des erhöhten Personalbedarfs, aufgrund des besonderen Hygiene- und Desinfektionsbedarfs müssen selbst getragen werden, und dadurch entstehen teils erhebliche Kosten, für deren Deckung unbedingt auch von der
öffentlichen Hand Unterstützung gewährt werden muss, damit weiterhin ein qualitativ hochwertiger Rettungs- und Krankentransport garantiert ist.
Allein im ersten Halbjahr 2021, also von Jänner bis Juli, hat der Bund rund 148 Millionen Euro im Rahmen des Zweckzuschussgesetzes an die Länder und Gemeinden ausbezahlt. Gerade in der Krise hat sich gezeigt, dass diese Investitionen, die für die Bekämpfung der Pandemie erforderlich sind, unerlässlich sind. Die Wirtschaft hat sich dank dieser und anderer Maßnahmen erholt, die Arbeitslosenzahlen sind auf das Vorkrisenniveau zurückgegangen und die Absonderungsbescheide sind rückläufig. Und wir, wir genießen wieder Veranstaltungen, feiern und freuen uns.
Doch das epidemiologische Geschehen ist noch nicht zu Ende, es ist wieder im Steigen, und der Winter steht vor der Tür. (Abg. Belakowitsch: Wo steigt es denn?) Wir verbringen wieder mehr Zeit in Innenräumen, und wir werden auch nachlässiger in den Abstandsmaßnahmen und in den Hygienemaßnahmen. (Zwischenruf der Abg. Belakowitsch.) Die notwendige Durchimpfungsrate ist auch noch immer nicht erreicht; aktuell stehen wir, wie Dr. Smolle gesagt hat, bei circa 65 Prozent. Genau deshalb müssen wir die bewährten Eindämmungsmethoden weiter anwenden und die Zuschüsse des Bundes bis 31. März 2022 verlängern, denn andernfalls wiederholt sich die Geschichte des letzten Winters, und das wollen wir alle zusammen mit Sicherheit nicht. (Neuerlicher Zwischenruf der Abg. Belakowitsch.)
Dass diese Zweckzuschüsse aus Bundesmitteln überhaupt weiter erforderlich sind und die bestehenden Fristen für Covid-19-Maßnahmen wieder verlängert werden müssen, hat einen ganz einfachen Grund: Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Selbst wenn manche Medien andere Geschichten und Mythen verbreiten – allen voran angefeuert von der FPÖ – und uns verkaufen wollen, alles wäre ja vorüber, ist es mir wichtig, hier nochmals zu betonen: Die Pandemie ist nicht vorbei.
Daher hat das Land Tirol eine Landeskampagne gegen Coronamythen gestartet. ExpertInnen der Klinik Innsbruck sowie der Medizin-Uni Innsbruck räumen mit Falschinformationen auf.
Ich möchte hier einen Mythos herausgreifen: „Manche behaupten, dass man mit einem starken Immunsystem nicht an Corona erkranken kann“ – wenn man das so sieht (eine Tafel, auf der der Text dieser Behauptung sowie der Text der entsprechenden Richtigstellung zu lesen und ein Foto der im Folgenden genannten Universitätsprofessorin zu sehen ist, auf das Rednerpult stellend) –, und das ist definitiv falsch.
„Richtig ist“ – und ich zitiere da die außerordentliche Universitätsprofessorin Dr.in Judith Löffler-Ragg von der Universitätsklinik für Innere Medizin Innsbruck –: „Im Einzelfall kann nicht vorhergesagt werden, wer wie auf eine Covid-Infektion reagiert. Schwere Krankheitsverläufe nehmen auch bei jüngeren Menschen zu. Am wirksamsten dagegen ist ein gezielter Schutz durch die Covid-Impfung“ – auch für Jüngere.
Wir bekommen unser gewohntes Leben erst dann wieder zurück, wenn wir unsere Durchimpfungsrate massiv steigern, wie mein Kollege Dr. Smolle bereits gesagt hat. Solange wir als Gemeinschaft – und nicht das Individuum, sondern wir als Gemeinschaft – das nicht hinbekommen, müssen halt begleitende Maßnahmen wie der Zweckzuschuss des Bundes an die Länder beschlossen werden und Mittel aufgewendet werden. Diese Mittel könnte man mit absoluter Sicherheit woanders besser verwenden. Daher: Bitte gehen Sie impfen! (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
15.04
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zur Geschäftsbehandlung zu Wort gemeldet hat sich Frau Abgeordnete Heinisch-Hosek. – Bitte schön, Frau Abgeordnete.
*****
Abgeordnete Gabriele Heinisch-Hosek (SPÖ) (zur Geschäftsbehandlung): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bundesminister! Kolleginnen und Kollegen! Die inhaltliche Klammer – und bitte lassen Sie sich vielleicht auch das Protokoll kommen und überdenken Sie quasi die Ablehnung dieses Entschließungsantrages noch einmal – war das Zweckzuschussgesetz. Das Zweckzuschussgesetz zur Bekämpfung der Pandemie wird – ganz logisch – mit den Ländern verhandelt und soll mit den Ländern verhandelt werden. Und die Kollegin hat gesagt – ich zitiere aus ihrer Rede, deswegen habe ich gemeint, es wäre gut, vielleicht noch einmal das Protokoll zu lesen –: Die Unterstützung, die wir den Ländern mit dem Zweckzuschussgesetz zukommen lassen, wäre für die Länder auch beim Thema Pflege in Zukunft notwendig und von größter Relevanz.
Das heißt: auf der einen Seite Bekämpfung der Pandemie durch das Zweckzuschussgesetz, aber natürlich auch Bekämpfung des Pflegenotstands. Wir sehen schon, dass diese Klammer da ist, und ich bitte Sie, noch einmal zu überlegen, ob dieser Entschließungsantrag der Kollegin Nussbaum nicht doch zugelassen werden könnte. (Beifall bei der SPÖ.)
15.05
Präsident Ing. Norbert Hofer: Frau Kollegin, ich verstehe Ihre Argumentation, aber mit diesem Argument – mit diesen finanziellen Mitteln, die wir hier einsetzen, könnte man auch – könnte man alle Themenbereiche abdecken.
Also wenn es vielleicht Herrn Kollegen Stöger, der auch noch sprechen wird, gelingt, einen etwas engeren sachinhaltlichen Zusammenhang herzustellen, dann wird es wahrscheinlich gelingen, auch den Antrag zuzulassen. (Abg. Heinisch-Hosek nickt zustimmend.)
Ich mache das ja nicht aus Jux und Tollerei, sondern weil wir in der Präsidiale vereinbart haben, dass wir den Begriff etwas enger fassen wollen und auch dazu motivieren wollen, sich noch mehr zu bemühen, diesen inhaltlichen Zusammenhang herzustellen. (Abg. Heinisch-Hosek nickt neuerlich zustimmend.)
Ich bitte um Verständnis. Vielleicht ist es noch möglich, dass Kollege Stöger noch etwas tiefer darauf eingeht. Es müsste dann aber ein neuer Antrag sein, der formell eingebracht werden kann, aber der Wortlaut kann ja ident sein.
*****
Zu Wort gelangt nun Mag. Gerald Hauser. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Mag. Gerald Hauser (FPÖ): Herr Präsident! Geschätzter Herr Minister! Hohes Haus! Auch für die Zuschauer ist es ein Problem, der Debatte zu folgen, weil wir heute einen Blumenstrauß von Anträgen unter einem diskutieren und deswegen auch die Zuordnungen nicht einfach sind. Also besser wäre es schon, wenn wir nicht alle Anträge im Rahmen einer Debatte diskutieren müssten, sondern getrennt, dann wäre die Zuordnung besser möglich. – So weit zu den Vorrednern.
Ich selber rede zur Verlängerung der Gratistestungen und eben auch zu den betrieblichen Testungen. Ich möchte, wie Sie wissen, faktenbasiert argumentieren, und ich darf Ihnen, geschätzte Zuseherinnen und Zuseher, heute und hier (eine Tafel mit den Aufschriften „CDC Centers for Disease Control and Prevention“, „Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) 6. August 2021“, „Outbreak of SARS-CoV-2 Infections...”, „https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm“ auf das Rednerpult stellend) eine Internetadresse kundtun. Die CDC, die amerikanische Gesundheitsbehörde,
hat am 6. August 2021 in ihrem wöchentlichen Bericht festgehalten und festgestellt, dass doppelt Geimpfte sich mit Covid-19 infizieren können und natürlich auch diesen Virus weitergeben können.
Geschätzter Herr Kollege Smolle, das müsste doch seit dem 6. August auch Ihnen und auch dem Gesundheitsministerium bekannt sein. Das heißt, Sie wissen eigentlich seit 6. August, dass doppelt Geimpfte den Virus weitergeben und aufschnappen können. Was haben Sie gemacht? – Zu dieser Zeit haben Sie eine Diskussion darüber geführt, dass die Gratistestungen abgeschafft werden – vollkommen unlogisch! –, und Sie haben damit ein Narrativ befeuert, das sehr gefährlich ist. Sie haben nämlich den Eindruck erweckt, dass Personen, die doppelt geimpft sind, frei sind, dass sie den Virus nicht aufschnappen können, dass sie ihn nicht weitergeben können, dass sie sozusagen das normale Leben retour haben.
Das war das Vortäuschen falscher Tatsachen, und das tut uns wirklich weh. Sie wissen ganz genau – seit 6. August müssen Sie es wissen –, dass es eben aus wissenschaftlicher Sicht nicht so ist, und trotzdem haben Sie Personen, die bis dorthin nicht geimpft waren, genau mit dieser Argumentation in die Impfung – unter Anführungszeichen – „hineingetrieben“, denn viele Personen haben gesagt: Na ja, wenn die Gratistestungen auslaufen – ich kann mir das nicht leisten –, dann muss ich mich daher, ob ich will oder nicht, impfen lassen! – Das war wahrscheinlich der Hintergrund Ihrer Erzählung, aber nicht die wissenschaftlichen Fakten, denn von wissenschaftlicher Seite wissen Sie ja mittlerweile – und ich nehme bewusst diese Tafel her, die ich bereits bei meiner letzten Rede auch verwendet habe (eine Tafel mit der Aufschrift „Impfdurchbrüche“, dem Logo der Ages sowie einer Tabelle auf das Rednerpult stellend) –, dass die Ages festgehalten und festgestellt hat, dass in den Kalenderwochen 33 bis 36, das heißt von Mitte August bis Mitte September, in der Altersgruppe der über 60-Jährigen 53,45 Prozent Impfdurchbrüche vorhanden waren.
Das heißt, von Personen in dieser Altersgruppe, die den Virus hatten, waren mehr als die Hälfte doppelt geimpft, das wissen Sie. Wissen Sie, was interessant ist und was aus meiner Sicht einen wirklichen Skandal darstellt? – Ich habe diese Argumente im Rahmen der letzten Nationalratssitzung vorgetragen. Was ist passiert? – Sie haben nicht Ihre Politik verändert, sondern diese Fakten von der Homepage der Ages gelöscht. Das heißt, wir als Freiheitliche Partei zeigen Fakten, die Sie publizieren, auf, das tut Ihnen weh – und was tun Sie? (Abg. Hörl: Gerald!) – Sie löschen, Sie zensurieren. Das ist unglaublich, dass in dieser Republik Informationen der Ages zensuriert werden, nur weil sie nicht in das politische Narrativ der Regierungsparteien hineinpassen. (Beifall bei der FPÖ.) Herr Minister, ich erwarte mir Aufklärung von Ihnen, wie das passieren konnte. (Abg. Hörl: Gerald! Unglaublich! Gerald! Unglaublich ist der Blödsinn, den er da verzapft!)
Herr Minister, noch etwas: Sie sind ja immer in gutem Kontakt mit Israel, auch mit dem israelischen Ministerpräsidenten. Ich darf für Sie aus der Kabinettssitzung von Ministerpräsident Bennett am 22. August 2021 wörtlich zitieren. Was hat Ministerpräsident Bennett in dieser Kabinettssitzung gesagt? – Lieber Franz Hörl, pass auf und hör dir das an! Nicht Gerald Hauser sagt das, sondern er, ich zitiere: Die gefährlichste Gruppe sind die doppelt Geimpften, weil sie glauben, mit zwei Impfungen geschützt zu sein. Sie registrieren nicht, dass der Impfschutz erodiert. – Zitat Bennett, im Protokoll der Regierungssitzung festgehalten. Auch das wissen Sie. Wieso befördern Sie laufend diese Narrative?
Wenn Sie schon keinen Freiheitstag verkünden wollen, den die Freiheitliche Partei für den 26. Oktober einfordert, so ist es doch logisch und plausibel, dass die Gratistestungen natürlich weitergehen müssen. Was nicht logisch und plausibel ist – und das wurde heute von Vorrednern schon angesprochen –, ist, dass die betrieblichen Testungen, die
ja die billigsten und auch für die Mitarbeiter die angenehmsten sind, weil sie im Betrieb getestet werden können, nur bis Ende Oktober weitergehen.
Herr Minister, wir hatten diese Diskussion im Gesundheitsausschuss, wir haben Sie angesprochen und Sie haben gesagt, Sie werden nachfragen. Haben Sie bei sich selber nachgefragt, ob das geändert wurde, oder wie schaut das jetzt aus? Wir helfen Ihnen diesbezüglich auf jeden Fall weiter.
Ich bringe daher folgenden Antrag ein:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Mag. Gerald Hauser, Kolleginnen und Kollegen betreffend „betriebliche Gratistests beibehalten“
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat umgehend eine Regierungsvorlage zuzuleiten, mit der im Interesse der heimischen Betriebe eine Verlängerung der kostenlosen betrieblichen COVID-19-Tests bis mindestens 30. Juni 2022 sichergestellt wird.“
*****
Sie können heute und hier einer sinnvollen Sache zustimmen, die gut für die Mitarbeiter ist, die gut für die Betriebe ist, und wir reparieren eine Regierungsvorlage, die nicht gut ist. (Beifall bei der FPÖ.)
Abschließend möchte ich noch etwas feststellen, was uns ganz wichtig ist. Da Sie den Freiheitstag nicht haben wollen – wir wollen diesen Freiheitstag haben –, schauen wir einmal in ein anderes Land: Was sagt der kroatische Präsident? – Der kroatische Präsident sagt: 42 Prozent Impfquote reicht aus. (Der Redner stellt eine Tafel, auf der ein Artikel aus der „Kronen Zeitung“ mit der Überschrift „42 Prozent geimpfte Kroaten laut Präsident ‚genug‘“ zu sehen ist, auf das Rednerpult.) Jetzt passt Ihnen der kroatische Präsident nicht, ist mir eh klar, aber er sagt das. Mit dieser Hysterie muss endlich einmal Schluss sein. Ich zitiere: „Kroatiens Präsident [...] Milanović strebt keine großflächige Immunität an. Er macht die Medien für die angebliche ‚Covid-Hysterie‘ verantwortlich.“ (Zwischenruf der Abg. Gabriela Schwarz.) Unrecht hat er in der Sache nicht.
Ich zitiere weiter. Er sagt: „Das Virus vollständig zu beseitigen ist nicht möglich. Wir müssen mit diesem Risiko leben. Überall sterben Menschen aufgrund anderer ernsthafter Krankheiten, und wir sprechen über nichts anderes als Covid.“ – Das sagt der kroatische Präsident.
Wir müssen wirklich anfangen, endlich einmal die Narrative zu ändern. Covid-19 ist da. Jeder in Österreich, der sich impfen lassen wollte – wir stehen für die Impffreiheit –, hat die Impffreiheit, hatte die Chance, aber bitte hören Sie auf, Personen, unsere Bürger in Impfungen hineinzuzwingen und hineinzudrängen! Das widerspricht der Verfassung, das widerspricht auch der persönlichen Entscheidungsfreiheit, für oder gegen Impfungen zu sein.
Sie wissen, dass natürlich auch Personen, die doppelt geimpft sind, schwer an Covid-19 erkranken können. Das wissen Sie! Ich habe letztes Mal ein Beispiel aus Israel gebracht: „Science“, das Wissenschaftsmagazin, hat berichtet, dass dort 59 Prozent der schwer an Covid-19 erkrankten Personen doppelt geimpft waren. Wir wissen das auch aus österreichischen Krankenhäusern: An der Uniklinik Innsbruck pendelt die Quote permanent
zwischen 50 Prozent plus/minus hin und her. (Rufe bei der ÖVP: Völliger Blödsinn! Das stimmt doch nicht!)
Ich zitiere abschließend die Weltgesundheitsorganisation. Der WHO-Direktor für Europa sagt, mit den Impfungen wird man die Pandemie nicht beenden können, es braucht alternative Methoden. (Zwischenruf der Abg. Pfurtscheller.) Frau Belakowitsch wird in ihrer Rede auf unseren Plan B gerne eingehen. – Danke. (Beifall bei der FPÖ. – Abg. Prinz: Die kennt sich aus!)
15.16
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
des Abgeordneten Mag. Gerald Hauser
und weiterer Abgeordneter
betreffend betriebliche Gratistests beibehalten
eingebracht im Zuge der Debatte zu TOP 8: Bericht und Antrag des Gesundheitsausschusses betreffend den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über eine COVID-19 Förderung für betriebliche Testungen (Betriebliches Testungs-Gesetz - BTG) geändert wird (1069 d.B.) in der 125. Sitzung des Nationalrates am 13. Oktober 2021
Die Sitzung des Gesundheitsausschusses vom 5. Oktober 2021 offenbarte einmal mehr, in welchem Ausmaß diese Bundesregierung an den Bedürfnissen der Bevölkerung und insbesondere der Wirtschaft und den Tourismusbetrieben „vorbeiregiert“ und weiterhin Chaosmanagement betreibt.
So sollen – wie in der genannten Sitzung des Gesundheitsausschusses beschlossen – die Regelungen für Kostenersatz für bevölkerungsweite Testungen auf COVID-19 im Rahmen von Screening-Programmen sowie für COVID-19-Tests in öffentlichen Apotheken bis Ende März 2022 weiterlaufen, andererseits aber die kostenlosen Testungen in Betrieben bereits mit Ende Oktober dieses Jahres auslaufen.
Gerade die Ermöglichung der betrieblichen Gratistests ist generell für die Wirtschaft und insbesondere auch für die Tourismusbetriebe von essentieller Bedeutung.
Die nun mehr beabsichtigte frühere Beendigung der betrieblichen Testungen in wenigen Wochen kann wohl nur als Anschlag auf die Wirtschaft und insbesondere den Tourismus bezeichnet werden.
Die Tourismusbranche, die ganz besonders unter den Auswirkungen der Schließungen und Restriktionen infolge der COVID-19 Maßnahmen zu leiden hatte bzw. noch immer leidet, würde durch das Auslaufen der Gratistests immensen Schaden nehmen, dies noch dazu unmittelbar vor Beginn der für die Tourismusbetriebe so wichtigen Wintersaison.
Aus Sicht der unterfertigten Abgeordneten ist daher eine Verlängerung der betrieblichen Gratistests umgehend sicherzustellen, um so weiteren Schaden von den heimischen Tourismusbetrieben abzuwenden.
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher nachstehenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat umgehend eine Regierungsvorlage zuzuleiten, mit der im Interesse der heimischen Betriebe eine Verlängerung der kostenlosen betrieblichen COVID-19-Tests bis mindestens 30. Juni 2022 sichergestellt wird.“
*****
Präsident Ing. Norbert Hofer: Der Entschließungsantrag ist ausreichend unterstützt, ordnungsgemäß eingebracht und steht mit in Verhandlung.
Zu Wort gemeldet ist nun Martina Diesner-Wais. – Bitte, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete Martina Diesner-Wais (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bundesminister! Meine Damen und Herren im Plenum! Sehr geehrte Zuschauer vor den Fernsehgeräten! Covid begleitet uns noch immer. Herr Kollege Hauser, Sie haben hier vieles gesagt, und eines ist sicher: Die Impfung schützt nicht zu 100 Prozent, das weiß jeder, aber es ist der bestmögliche Schutz. Herr Kollege Smolle hat auch schon erörtert, dass der Impfschutz nach einer gewissen Zeit nachlässt, und bei älteren Menschen natürlich viel schneller, weshalb es dann auch wieder zu Erkrankungen kommen kann.
Wenn Sie den kroatischen Präsidenten zitieren, der sagt, 42 Prozent Impfquote sei genug, sage ich: Wir in Österreich sollten uns besser auf unsere Immunologen und die Wissenschaft verlassen. Da sind wir sicherer. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
Wie Sie schon angesprochen haben, verlängern wir heute viele Dinge, darunter auch das Testen, sowohl das Testen in den Apotheken als auch das betriebliche Testen, und wenn es notwendig ist, wird es natürlich auch weiter verlängert. Ich denke, bei diesen Verlängerungen sind kurze Abstände sinnvoll, damit man immer nachprüfen kann, wie lange etwas noch notwendig ist.
Ich möchte aber vor allem über die Änderung des COVID-19-Lagergesetzes sprechen. Das Frühjahr 2020 hat uns gezeigt, wie unumgänglich eine Krisenbevorratung ist. Wenn es zu Engpässen kommt, ist es wichtig, ein Lager zu haben. Wir konnten es schon erfahren: Wenn die globale Nachfrage stärker wird, dann kommt es zu Engpässen in den verschiedenen Bereichen. Nur wenn ein Lager vorhanden ist, kann garantiert werden, dass die nötige Menge an Schutzausrüstungen und medizinischen Materialien zur Verfügung steht. Wenn es Ausfälle gibt, können wir unser öffentliches Gesundheitssystem nicht beliefern. Wir wissen über die Notwendigkeit, für Ärzte und Pfleger Schutzausrüstungen zu haben, damit sie sich selbst am besten schützen können und nicht erkranken, was das System gefährden würde.
In Österreich hat das Bundesheer die Beschaffung, die Verwaltung, die Lagerung und auch teilweise die Auslieferung übernommen. Das war gut und das ist gut! Daher verlängern wir diese Regelung auch bis 31.12.2022. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
Da wir die Lagerhaltung sparsam, effizient und wirtschaftlich betreiben wollen, wollen wir auch ein bisschen flexibler werden. Das heißt, es können auch Dinge, bevor sie ablaufen, abgegeben werden, sowohl im Inland als auch im Ausland, entweder entgeltlich oder unentgeltlich, egal ob es sich um Nachbarschaftshilfe, Entwicklungshilfe oder gesundheitspolitische Aspekte handelt.
Ich möchte das heute auch zum Anlass nehmen, mich besonders bei den Angehörigen des Bundesheers für die vorbildlichen Dienste, die sie für uns und unsere Bevölkerung in Covid-Zeiten gleistet haben, zu bedanken. Sie waren eigentlich überall: Sie sind bei
Firmen, in denen Mitarbeiter im Krankenstand waren, in Einsatz getreten, ebenso bei den Teststraßen und bei den Impfstraßen, und natürlich waren sie auch bei unseren Bezirksbehörden zur Aushilfe, ebenso bei den Kontrollen an den Grenzen. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken.
Ich darf mit einem Aufruf an jene, die noch nicht geimpft sind und die Möglichkeit dazu haben, schließen: Lassen Sie sich impfen! (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
15.20
Präsident Ing. Norbert Hofer: Nächste Rednerin ist Frau Dr. Dagmar Belakowitsch. – Bitte schön, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete Dr. Dagmar Belakowitsch (FPÖ): Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren vor den Bildschirmen! Ja, es geht hier um die Covid-19-Maßnahmen, und ich beginne zunächst einmal mit einem Entschließungsantrag, den ich einbringen möchte:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Dr. Dagmar Belakowitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Ende aller Covid-Maßnahmen und Corona-Freiheitstag am 26.Oktober 2021“
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, die folgende gesetzliche Regelungen umfasst: ein Auslaufen des Covid-19-Maßnahmengesetzes mit 26. Oktober 2021 sowie ein Ende aller Maßnahmen auf der Grundlage des Covid-19-Maßnahmengesetzes, des Epidemiegesetzes und der dazu erlassenen Verordnungen und Erlässe im Zusammenhang mit Corona.“
*****
Was hier so technisch klingt, meine Damen und Herren, bedeutet: Wir wollen ein Ende der Coronamaßnahmen für Österreich – wir wollen das so, wie es in vielen anderen europäischen Ländern bereits gelebt wird, beispielsweise in Großbritannien, in Schweden, in Irland, in Norwegen, aber auch in Dänemark.
Dänemark ist ein Land, das bereits im April angekündigt hat, dass dann, wenn alle erwachsenen Personen ein Impfangebot haben – ein Impfangebot haben! –, die Maßnahmen fallen gelassen werden. Auch in Österreich haben alle ein Impfangebot, und jeder, der dieses Impfangebot annehmen möchte, hat es vermutlich schon getan oder kann es jederzeit tun, meine Damen und Herren.
Was passiert aber in Österreich? – In den letzten paar Tagen war ja Corona kein Thema, weil die Österreichische Volkspartei ins Trudeln geraten war; die Messagecontrol war ausgesetzt und plötzlich hat kein Mensch über Corona gesprochen, über die ach so tödliche Seuche. Die Österreichische Volkspartei versucht heute, wieder ein bisschen Tritt zu fassen, und es wird gleich wieder Panik geschürt, meine Damen und Herren.
Die Österreicher sind es ja schon gewohnt, sie werden mit Paniknachrichten überhäuft. Es gibt kaum ein Medium, das sich da nicht draufstürzt, meine Damen und Herren. Interessant wird auch sein – und da sind wir gerade am Recherchieren –, wie viele der Studien, die in den letzten Wochen und Monaten veröffentlicht worden sind, denn eigentlich vom Institut Karmasin beauftragt wurden. Wie viele dieser Studien sind tatsächlich nachträglich frisiert worden? Meine Damen und Herren, erst vor wenigen Tagen, kurz vor den Hausdurchsuchungen, gab es eine Studie des Instituts Karmasin, die besagt hat: Die Geimpften wollen, dass die Ungeimpften noch viel mehr gequält werden! –
Also mein Erfahrungswert ist das nicht. Es mag schon sein, dass das manche in der ÖVP gerne gehabt hätten, in der Bevölkerung ist das mit Sicherheit nicht der Fall.
Es gibt auch in Österreich
Fernsehwerbungen – Sie werden das alles kennen –, da
stellt sich ein Arzt hin und erklärt: Ich bin Intensivmediziner und seit
vielen Jahren tätig; normalerweise behandle ich Herzinfarkte und
Unfallopfer, aber jetzt liegen bei mir die
25-Jährigen auf der Intensivstation! – Gut, das kann man in
Österreich behaupten, weil wir es mit der Zahlentransparenz nicht so haben.
Schauen wir aber nach Deutschland, das sicherlich vergleichbar ist: Wie viele
unter 27-Jährige liegen denn in der Bundesrepublik Deutschland im
Augenblick – nämlich mit Stand 11. Oktober –
auf einer Intensivstation? – Das sind in Deutschland sage und
schreibe 44 Personen. Umgerechnet auf Österreich würde das
bedeuten: 4,4 Personen – 4,4 Personen unter 27 auf
den Intensivstationen, und da wissen wir aber noch nicht, welche
Vorerkrankungen diese Personen haben, was der Grund dafür ist, dass sie
auf den Intensivstationen liegen.
Ihr Gebäude, das Sie sich in den letzten 19 Monaten so schön gezimmert haben, beginnt nach und nach zu bröckeln, und da kann auf der Ages-Homepage gelöscht werden, was möchte, immer neue Zahlen, immer neue Erkenntnisse dringen doch durch.
Schauen Sie sich etwa einen ganz aktuellen Presseartikel an – Kollege Kaniak hat es ja schon erklärt –: Da schaut das ganz anders aus. Da sehen wir nämlich, dass von den Verstorbenen nur 30 Prozent zuvor auf einer Intensivstation gelegen sind. Alle anderen, die an Corona oder mit Corona verstorben sind, waren gar nicht auf einer Intensivstation. Da stellt sich dann schon die Frage: Was war denn da die Todesursache? Wenn jemand so schwer an Corona erkrankt ist, dann wird er ja wohl auf die Intensivstation kommen. Es sind aber ganze 36 Prozent, und betreffend diese 36 Prozent – also ein bisschen mehr als ein Drittel –, die tatsächlich auf einer Intensivstation an oder mit Corona verstorben sind, wissen wir immer noch nicht: Wie viele dieser Personen hatten schwere Vorerkrankungen? Wie viele von diesen 36 Prozent, von diesen Personen, die auf einer Intensivstation mit oder an Corona verstorben sind, wären ohnehin auf einer Intensivstation gelandet? Wie viele sind erst dort infiziert worden? Auch das ist ein großes Thema!
All diese Fragen formulieren wir in diesem Hohen Haus, wir stellten sie dem Vorgänger des derzeitigen Ministers, wir stellen sie diesem Minister – wir haben bis heute keine Antworten bekommen. Es gibt keine Antworten, und es gibt auch keine Zahlentransparenz, denn würde es da Zahlentransparenz geben, ähnlich wie es in anderen europäischen Ländern ist, dann würde man sofort diese Panikpolitik erkennen, ausgehend vom ehemaligen Bundeskanzler über die Gesundheitsminister, befeuert von der Flex in der österreichischen Bundesregierung, vom Innenminister; er bekämpft es wie eine Flex, wenn die Leute sich nicht an die Coronamaßnahmen halten.
Ja, meine Damen und Herren, das wäre alles nicht möglich gewesen. Die Messagecontrol in diesem Land hat es möglich gemacht, alle Medien wurden eingekauft, damit sie genau diese Werbung senden und genau das berichten, was zur Erzählung dieser Bundesregierung passt.
Jetzt ist nicht nur das System Kurz gerade ein bisschen implodiert, nein, auch diese ganze Coronapolitik dieser Bundesregierung wird implodieren; wir stehen kurz davor. Wenn sich Kollege Smolle hierherstellt und sagt, die Zahlen sind in etwa konstant, manchmal sinken sie sogar, manche andere aus der Österreichischen Volkspartei aber danach rausgehen und sagen, die Zahlen steigen andauernd, dann sieht man ja, was da passiert ist: dass die Abgeordneten nicht einmal mehr ihren Kollegen, die tatsächlich aus dem Krankenhausbereich berichten, zuhören, dass es sich letzten Endes langsam erübrigt.
Wir fordern daher, dass endlich Schluss sein muss mit diesem ganzen Coronawahnsinn, den Sie den Österreichern seit 19 Monaten aufbürden (Beifall bei der FPÖ), dass
Schluss sein muss damit, einen Keil in unsere Bevölkerung zu treiben, einen Keil zwischen unsere Kinder zu treiben. Unsere Kinder werden in Geimpfte und Nichtgeimpfte sortiert: Die ungeimpften Kinder müssen sich jeden Tag oder jeden zweiten Tag testen lassen, und die geimpften bekommen ein goldenes Pickerl, meine Damen und Herren. Damit muss Schluss sein!
Wir wollen, dass am 26. Oktober alles aufgehoben wird (Beifall bei der FPÖ) – als Tag der Freiheit, als Zurückgehen in unsere Normalität, meine Damen und Herren! Das haben sich die Österreicher nach 19 Monaten sinnloser Quälerei verdient. (Beifall bei der FPÖ.)
15.27
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Dr. Dagmar Belakowitsch, Mag. Gerhard Kaniak, Mag. Gerald Hauser
und weiterer Abgeordneter
betreffend Ende aller Covid-Maßnahmen und Corona-Freiheitstag am 26.Oktober 2021
eingebracht im Zuge der Debatte zu Top 6.) Bericht des Gesundheitsausschusses über den Antrag 1824/A der Abgeordneten Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Epidemiegesetz 1950 und das COVID-19-Maßnahmengesetz geändert werden (1067 d.B.) in der 125. Sitzung, XXVII GP., am 13. Oktober 2021
Mit dem § 13 Abs. 1 Covid-19-Maßmaßnahmengesetz (1067 d.B) wurde dieses Bundesgesetz bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Darüber hinaus wurde auch die Verordnungsermächtigung für eine weitere Verlängerung des Covid-19-Maßnahmengesetzes bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. Begründung dazu von Seiten der türkis-grünen Bundesregierung im Bericht des Ausschusses vom 5. Oktober 2021:
„Mit Blick auf das aktuell nach wie vor hohe epidemiologische Grundgeschehen ist nach derzeitigem fachlichen Kenntnisstand davon auszugehen, dass auch nach dem 31. Dezember 2021 Maßnahmen nach dem COVID-19-MG ergriffen werden müssen. Auf Grund der derzeit auch in den mittleren Altersgruppen noch nicht ausreichenden Durchimpfungsraten kann davon ausgegangen werden, dass nicht nur die Infektionszahlen, sondern auch die Hospitalisierungen weiter steigen werden und Einschränkungen zum Schutz des Gesundheitssystems weiterhin getroffen werden müssen. Es wird daher das COVID-19-MG um ein weiteres halbes Jahr (bis 30. Juni 2022) verlängert. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, dass – sofern dies auf Grund der epidemiologischen Situation unbedingt erforderlich ist – durch Verordnung der Bundesregierung ein anderer Zeitpunkt des Außerkrafttretens des COVID-19-MG bestimmt werden kann, wobei dieser nicht nach dem 31. Dezember 2022 liegen darf.“
Diese Vorgangsweise wird von der FPÖ auf das Schärfste abgelehnt, da alle diese Maßnahmen nicht evidenzbasierend sind, sondern nur weiter in eine Sackgasse führen. Die Regierung verlängert den Ausnahmezustand, weil sie Gefallen gefunden hat an der Unterdrückung, Bevormundung und Spaltung unserer Gesellschaft bis hinein in die Familien – und das ohne jede Evidenz und völlig faktenbefreit.
Es ist auch vorgesehen, dass zukünftig auch Geimpfte einer Testpflicht unterworfen werden können. Das ist der Offenbarungseid dafür, dass nicht einmal die Regierungsparteien an die „Gamechanger“-Propaganda des ehemaligen Kanzlers glauben. Was die US-Seuchenbehörde CDC schon vor Monaten festgestellt hat, nämlich, dass sich Geimpfte sehr wohl an Covid infizieren und das Virus weiterverbreiten können, dürfte nun endlich in der komplett evidenzbefreiten Regierung angekommen sein.
Wir Freiheitliche haben immer schon davor gewarnt, sich ohne klare Datenlage einzig auf die Impfungen zu verlassen. Auch unsere Forderungen nach flächendeckenden Antikörpertests, die mittlerweile auch schon manche Regierungseinflüsterer verlangen, verweigert die Regierung noch immer. Viele der Zwangsmaßnahmen dienen nur dem Ziel des Machtausbaus der herrschenden Politik und der Gewinnmaximierung von Großkonzernen.
Dem muss jetzt mit einem Tag der Freiheit – am besten gleich am 26. Oktober, unserem Nationalfeiertag – begegnet werden. Es gibt keinen besseren Tag als diesen, um die Österreicher von den Zwängen und Vorschriften unter dem Verwand der Corona-Bekämpfung zu befreien.
Deshalb hat die FPÖ auch einen „Plan B“ – B für Befreiung – zu den aktuellen Corona-Maßnahmen vorgelegt, der folgende Inhalte umfasst:
• ein Auslaufen des Covid-19-Maßnahmengesetzes mit 26. Oktober 2021,
• ein Ende aller Maßnahmen auf der Grundlage des Covid-19- Maßnahmengesetzes, des Epidemiegesetzes und der dazu erlassenen Verordnungen und Erlässe im Zusammenhang mit Corona,
• das Ende des Impfdrucks und -zwangs,
• den Stopp des Hineinmanipulierens in eine dritte Impfung;
• ein kostenloses Angebot für Antikörpertests für die gesamte Bevölkerung;
• ein normales Leben mit Hygiene- und Abstandsregeln in smarter Form;
• das Testen nur bei Symptomen (bei Geimpften und Ungeimpften);
• das grundsätzliche Testen für den Zutritt zu hochsensiblen Bereichen;
• das Vorantreiben der medikamentösen Behandlung und den raschen Einsatz von Medikamenten im Falle eines positiven Tests;
• das Vorantreiben der Entwicklung alternativer Impfstoffe;
• die Beendigung der Angstkommunikation und
• das Herstellen einer soliden Zahlenbasis.
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, die folgende gesetzliche Regelungen umfasst: ein Auslaufen des Covid-19-Maßnahmengesetzes mit 26. Oktober 2021 sowie ein Ende aller Maßnahmen auf der Grundlage des Covid-19-Maßnahmengesetzes, des Epidemiegesetzes und der dazu erlassenen Verordnungen und Erlässe im Zusammenhang mit Corona.“
*****
Präsident Ing. Norbert Hofer: Der Entschließungsantrag ist ausreichend unterstützt, ordnungsgemäß eingebracht und steht somit auch in Verhandlung.
Zu einer Stellungnahme hat sich Herr Bundesminister Dr. Wolfgang Mückstein zu Wort gemeldet. – Bitte, Herr Bundesminister.
15.27
Bundesminister
für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
Dr. Wolfgang Mückstein: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren
Abgeordnete! Liebe Zuseherinnen und Zuseher zu Hause! Weil heute bereits
über das Budget gesprochen worden ist – das war ja schon auf
der Tagesordnung –, möchte ich einige Worte zum Budget sagen,
was meinen Bereich betrifft.
Thema Armutsbekämpfung: Die Bundesregierung hat eine Reihe von Sofortmaßnahmen gesetzt, um die sozialen Folgen der Pandemie abzufedern. Die aktuellen Zahlen betreffend Sozialhilfe und Mindestsicherung zeigen uns, dass wir mit diesem Weg der raschen Unterstützung erfolgreich waren. Wir gehen aber davon aus, dass die sozialen Folgen der Pandemie noch weiter anhalten werden, und daher wird es auch weitere Mittel geben, um diese abzufedern (Zwischenruf der Abg. Belakowitsch): Sonderrichtlinie betreffend Covid-19-Armutsbekämpfung – 2 Millionen Euro; EU, Internationales, Senioren, Freiwillige – 37 Millionen Euro, davon 8 Millionen Euro für die Delogierungsprävention und Wohnungssicherung, 4 Millionen Euro für die Gewaltprävention und 3 Millionen Euro für die Extremismusprävention.
Thema Gesundheit: Der Kampf gegen die Pandemie bleibt selbstverständlich weiterhin zentral, und das bildet sich auch im Budget ab. Es wird weitere Mittel für Coronamaßnahmen in der Höhe von 1,27 Milliarden Euro geben, aber auch für die Abfederung der gesundheitlichen und psychischen Folgen der Pandemie, konkret 13 Millionen Euro für Kinder- und Jugendpsychologie. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.) Für die Kinder und Jugendlichen war die psychische Belastung in dieser Zeit aufgrund der Schulschließungen und aufgrund dessen, dass sie ihre Freunde nicht treffen konnten, besonders groß.
Bereits vor Corona stand unser Gesundheitssystem vor Herausforderungen, etwa durch den auch heute schon angesprochenen Ärztemangel, speziell im Hinblick auf die Versorgung durch Ärztinnen und Ärzte im ländlichen Gebiet. Wir wollen daher unter Verwendung von EU-Geldern den Ausbau der Primärversorgung vorantreiben. Aus den Mitteln des Resilienzfonds der EU haben wir vor Kurzem 100 Millionen Euro zugesprochen bekommen. Wir sind dabei, die Förderungsbedingungen auszuarbeiten, und erwarten im ersten Quartal 2022 die ersten Auszahlungen für die Stärkung der Primärversorgungsebene in Österreich. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
Thema Pflege: Pflege und Betreuung zählen aufgrund ihrer gesamtgesellschaftlichen Bedeutung zu den größten sozialen Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte – auch das ist heute schon angesprochen worden. Dem wird auch im Regierungsprogramm, das der Sicherstellung einer menschenwürdigen und hochwertigen Pflege sowie der Unterstützung von pflegebedürftigen Menschen und deren An- und Zugehörigen höchste Priorität einräumt und eine Reihe von Maßnahmen in diesem Bereich vorsieht, Rechnung getragen.
Einen ersten und konkreten Schritt im Sinne eines Einstiegs in eine umfassende Pflegereform macht die Bundesregierung mit der finanziellen Unterstützung der Auszubildenden im Bereich der Pflege- und Sozialbetreuungsberufe. Zu diesem Zweck werden zusätzlich zu den bereits jetzt für den Pflegebereich zur Verfügung stehenden Auszahlungen weitere insgesamt 150 Millionen Euro für die Jahre 2022 bis 2024 bereitgestellt. Des Weiteren werden für das Pilotprojekt Communitynursing über die Jahre 2022 bis 2024 in Summe rund 50 Millionen Euro aus dem Wiederaufbaufonds der EU budgetiert. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
Die Communitynurses werden in Rahmen eines niederschwelligen, bedarfsorientierten und bevölkerungsnahen Zugangs die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung fördern. Sie werden dazu beitragen, das Wohlbefinden zu verbessern und so den Verbleib von
älteren Menschen im eigenen Zuhause nicht zuletzt durch die Stärkung der Selbsthilfe von Betroffenen und deren Angehörigen zu fördern und zu ermöglichen. Außerdem wurde die finanzielle Grundlage für die Verlängerung des Pflegefonds geschaffen.
In den kommenden beiden Jahren werden für den weiteren Ausbau der sozialen Dienste und für die Qualitätssicherung insgesamt rund 900 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Gleichzeitig bekennt sich der Bund zur Setzung weiterer positiver Anreize, damit Pflege- und Betreuungspersonen langfristig im Beruf verbleiben können. Derzeit werden seitens des Gesundheitsministeriums entsprechende Vorarbeiten für die Umsetzung zusätzlicher Vorhaben geleistet, die Abstimmungen mit den Ländern laufen.
Jetzt ganz kurz zu Corona, auch das ist heute schon einige Male angesprochen worden: Wir haben heute eine Inzidenz von 142,1, eine leicht gesunkene Bettenbelegung auf den Intensivstationen, wir halten seit ungefähr einem Monat wieder bei 10 Prozent ICU-Belegung. Das – nämlich diese vierwöchige Seitwärtsbewegung – soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die vierte Welle sicher noch nicht vorbei ist. Wir haben jetzt aufgrund der Schultests, die sehr gut angelaufen sind, aufgrund der 3G-Regelung, die in vielen Bereichen erst seit Mai gilt und natürlich auch weiterhin gilt, aber nicht zuletzt auch aufgrund des Wetters eine Seitwärtsbewegung gehabt, die die Belegung auf den Intensivstationen nicht weiter hat ansteigen lassen. Das ist natürlich positiv zu sehen. In Kürze werden auch 70 Prozent der impfbaren Bevölkerung in Österreich zweifach geimpft sein – ein weiterer wichtiger Schritt.
Das heißt, es liegt in unser aller Interesse, die Impfung zu forcieren. Ich glaube, es ist auch schon gut wahrnehmbar, dass die Werbestrategie, die Werbemaßnahmen intensiviert und angepasst worden sind. Durch ein zielgruppenspezifisches Bewerben, ein altersspezifisches Bewerben werden wir hoffentlich noch ein gutes Stück weiterkommen – mit Unterstützung aller Fraktionen hier im Haus, wenn ich Sie darum ersuchen dürfte. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
Wir haben seit Juli endlich ausreichend Impfstoff in Österreich. Wir haben seither knapp 11 Millionen Impfungen verabreichen können. Weltweit sind mehr als 6,5 Milliarden Impfdosen verabreicht worden. Das ist, wie ich glaube, eine unglaubliche Leistung, eine der größten beziehungsweise die größte Impfkampagne, die es jemals auf der Welt gegeben hat. Die aktuellen Zahlen zeigen uns, dass durch die Impfung in diesem Jahr bereits mehr als 12 000 Krankenhausaufenthalte und mehr als 3 700 Todesfälle in Österreich haben verhindert werden können.
Um diesen Schutz auch im kommenden Winter aufrechtzuerhalten, ist es jetzt besonders wichtig, unseren Fokus auf die dritte Dosis zu lenken. Die aktuellen Studien und wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen uns, dass diese Auffrischungsimpfungen vor allem für die älteren Menschen besonders wichtig sind. Wir konnten gemeinsam mit den Bundesländern in den vergangenen Wochen bereits 148 932 dritte Impfungen durchführen, und wir haben uns da besonders auf die Alters- und Pflegeheime und auch auf das medizinische Personal konzentriert. Allein gestern wurden 8 849 dritte Dosen verabreicht. Ich möchte mich daher bei den Bundesländern, bei den Verantwortlichen, bei den Durchführenden, den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Bundesländern recht herzlich für diese Leistung bedanken. (Beifall bei Grünen und ÖVP.)
In den kommenden Wochen wird es einmal mehr darum gehen, noch möglichst viele Menschen in Österreich von der Coronaschutzimpfung zu überzeugen, um die Impfquote weiter zu steigern.
Wer ist jetzt mit dem dritten Stich – ganz wichtig – dran? – Das sind vor allem Menschen ab 65, Hochrisikopatienten, Personal in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen und in den Kindergärten und Schulen sowie all jene, die bisher noch keinen MRNA-Impfstoff
erhalten haben. Wir werden allen, die das betrifft, ein persönliches Informationsschreiben zukommen lassen, und wir werden uns zusätzlich in unserer Kommunikation auf die wichtigen Informationen zur dritten Impfung konzentrieren.
Standen wir vor einem Jahr noch ohne Impfung da, so haben wir heute genügend Impfstoff für alle und können allen Menschen in unserem Land bestmöglichen Schutz vor dem Coronavirus bieten. Standen wir vor einem Jahr noch ohne langfristige Perspektive im Kampf gegen die Pandemie da, so haben wir heute die Lösung in unseren Händen. Es ist ein Sieg für die Wissenschaft und für unsere Gesellschaft, nutzen wir diese Chance gemeinsam! (Beifall bei Grünen und ÖVP.)
Ich darf jetzt zu Tagesordnungspunkt 7, Zweckzuschussgesetz, kommen. Das Gesundheitsministerium hat sich in den letzten Wochen unter Einbindung zahlreicher Expertinnen und Experten intensiv mit den weiteren Maßnahmen zur Pandemiebewältigung beschäftigt. Dabei sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Verlängerung der Zweckzuschüsse zum Beispiel für Impfungen, für Rettungseinsätze, aber auch Schutzausrüstungen notwendig ist.
Auch die Weiterführung der kostenlosen Tests ist für die nächste Zeit vorgesehen. Mit dem heutigen Beschluss wollen wir einen einheitlichen Rahmen schaffen, um dies zu ermöglichen. Das Enddatum für die kostenlose Abgabe der Wohnzimmertests bleibt, wie schon angekündigt, der 31. Oktober. Eine laufende Evaluierung bezüglich aller Maßnahmen findet selbstverständlich weiterhin statt, und künftige Anpassungen sind jederzeit möglich.
Zu Tagesordnungspunkt 10, Stichwort Fernrezept: Das ist mir natürlich ein besonderes Anliegen, ich habe das selber noch in der Ordination erlebt. Es war ja damals so, dass gerade zu Beginn nicht zwingend notwendige Kontakte von Patientinnen und Patienten mit Ärztinnen und Ärzten reduziert werden sollten. Es hat sich damals herausgestellt, dass man mit Faxen, mit Anrufen den Betrieb aufrechterhalten kann. Seitdem können Rezepte auch ohne Arztbesuch an Patientinnen und Patienten ausgestellt werden – das sogenannte Fernrezept. Patientinnen und Patienten, die an Elga teilnehmen, erhalten das Rezept über Elga, über die E-Medikation, PatientInnen, die nicht an Elga teilnehmen, erhalten das Rezept via E-Mail. Diese Regelung würde eben am 31.12.2021 auslaufen, aber aufgrund der aktuellen Lage der Pandemie soll diese Regelung bis 31. März 2022 verlängert werden. Es hat durch die Pandemie einen Innovationsschub in der Digitalisierung im Bereich der Medizin gegeben, den ich sehr begrüße.
Zum betrieblichen Testen möchte ich sagen: Wir sind derzeit in Abstimmung, um das betriebliche Testen über den 31. Oktober hinaus zu ermöglichen. – Danke schön. (Beifall bei Grünen und ÖVP.)
15.40
Präsident Ing. Norbert Hofer: Nächste Rednerin ist Frau Mag. Elisabeth Scheucher-Pichler. – Bitte schön, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete Mag. Elisabeth Scheucher-Pichler (ÖVP): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Herr Bundesminister hat jetzt einiges in Bezug auf das Budget und auch auf die Pandemie klargestellt. Ich möchte aber zuallererst Frau Präsidentin Bures für die Pink Ribbons danken, die Sie uns heute auf den Tisch gelegt hat. Ich finde das wirklich eine ganz besonders nette Geste. (Beifall bei ÖVP, SPÖ, Grünen und NEOS.)
Es tragen ja auch fast alle das Pink Ribbon, wenn ich da so schaue – die Männer haben ja nicht so ein schönes bekommen, aber das passt schon so. Ich finde es besonders schön, dass wir seit vielen, vielen Jahren, über Parteigrenzen hinweg, auch in den
Ländern, diese wichtige präventive Aktion der Österreichischen Krebshilfe unterstützen – das sind wirklich immer tolle Initiativen.
Ich möchte nicht nur jenen Frauen, die heute hier waren und uns besucht haben, sondern auch allen anderen Betroffenen, allen, die erkrankt sind, gute Genesung, viel Kraft und alles Gute wünschen. (Beifall bei ÖVP und Grünen sowie bei Abgeordneten der SPÖ.)
Meine Damen und Herren, ja, die Pandemie ist nicht zu Ende. Herr Kollege Kaniak, sie ist eben nicht zu Ende – der Herr Bundesminister ist auch darauf eingegangen –, das ist einfach eine Tatsache, und daher ist es auch notwendig, bestehende Covid-19-Maßnahmen zu verlängern. Der Winter kommt, es muss alles getan werden, um Infektionen zu verhindern. Niemand möchte noch einmal einen Lockdown. Und wenn ich es vor allem aus der Sicht der Seniorinnen und Senioren sage: Wir wollen so schnell als möglich Normalität! (Zwischenruf der Abg. Belakowitsch.) Gerade die ältere Generation wünscht sich das und braucht das auch so dringend.
Tatsache ist aber, dass die Impfung gegen einen schweren Verlauf hilft. (Zwischenrufe der Abgeordneten Belakowitsch und Hauser.) Herr Kollege Hauser, das ist Tatsache! Und ich appelliere wirklich gerade auch an die ältere Generation: Wenn es jetzt um den dritten Stich geht, informieren Sie sich beim Arzt, bei der Ärztin Ihres Vertrauens! Ich glaube, es geht vor allem darum. Es wird niemand gezwungen. Informieren Sie sich! Da geht es um Vertrauensaufbau, da geht es um Sicherheit. (Abg. Belakowitsch: Natürlich gibt es einen ... Zwang!)
Es ist auch wichtig, dass wir heute Maßnahmen setzen, die den Impfnachweis und weitere Testmöglichkeiten sicherstellen, die die Länder als wichtige regionale Partner ins Boot holen beziehungsweise weiterhin im Boot halten, um eben die Infektionslage im Auge zu behalten – Tagesordnungspunkte 7 und 8, der Herr Bundesminister ist darauf ja auch schon eingegangen.
Ja, noch einmal: All das ist ganz besonders wichtig, auch aus der Sicht der Seniorinnen und Senioren, die ja die vulnerabelste Gruppe und besonders gefährdet sind, die aber auch, und das möchte ich schon auch betonen, mit besonders gutem Beispiel vorangehen und vorangegangen sind, denn in dieser Gruppe ist die Impfrate ja wirklich sehr hoch. Ich appelliere auch an die Großeltern: Sprechen Sie mit den Kindern, aber auch mit den Enkelkindern! Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir mit der Jugend reden. Da geht es sehr oft um Vertrauensaufbau. Ich bemerke in den Gesprächen immer wieder, dass der Grund dafür, dass die Impfung nicht geholt wird, oft auch ein bisschen Nachlässigkeit ist.
Auch die zu beschließende Verlängerung der E-Medikation ist wichtig, der Herr Bundesminister ist ja darauf eingegangen. Damit können Patienten ein Rezept einlösen, ohne persönlich in die Arztpraxis zu kommen. Man kann mit der Sozialversicherungsnummer sein Medikament in ganz Österreich unbürokratisch erhalten – Tagesordnungspunkt 10, das ist eben diese Möglichkeit der Rezeptausstellung ohne Arztbesuch, das Fernrezept, die bis 30. Juni 2022 verlängert wird. Es soll aber dann, das wurde auch schon erwähnt, in das elektronische Rezept übergehen, das im Rahmen von Elga bereits vor Corona auf Schiene gebracht und entwickelt wurde.
Ich möchte noch ganz kurz über ein Pilotprojekt von Ärztinnen und Ärzten, aber auch von Apotheken, die sich da sehr engagieren, berichten, das derzeit in Kärnten läuft. Es findet derzeit im Bezirk Wolfsberg und im Bezirk Völkermarkt statt und wird sehr gut angenommen. Es läuft gerade die Evaluierung, es gibt da noch einige Probleme an der Schnittstelle, da geht es eher um Softwareprobleme, und man sucht jetzt nach Optimierungsschritten. Ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute Sache ist, weil das eben speziell für Patienten mit Vorerkrankungen, chronisch Kranke mit Dauermedikation, aber
eben auch für ältere Menschen und für Menschen mit Behinderung eine wertvolle Erleichterung ist.
Abschließend möchte ich den Seniorinnen und Senioren auch noch ein Kompliment machen, denn sie haben in den letzten eineinhalb Jahren gerade in Bezug auf die Digitalisierung irrsinnig viel dazugelernt und sich da sehr engagiert. Gerade zur Vermeidung von Einsamkeit gibt es da viele Möglichkeiten, wenn man ein Smartphone hat, wenn man sich im digitalen Bereich auskennt, aber auch in Bezug auf die Sicherheit, es ist wichtig in der Pflege – das Notruftelefon; es gibt da viele neue Möglichkeiten, ich habe schon einmal darauf Bezug genommen –, aber auch im medizinischen Bereich. Es haben sich alle Seniorenorganisationen in diesem Bereich engagiert, wirklich alle, über die Parteigrenzen hinweg, und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns da engagieren.
In Kärnten haben wir, der Seniorenbund, gemeinsam mit der Jungen ÖVP das Projekt Aufeinander schauen initiiert und haben da in kleinen Gruppen, wo es eben keine Hemmschwelle gibt, sehr niederschwellig den älteren Menschen das Smartphone und digitale Möglichkeiten erklärt.
Wir lassen aber niemanden zurück – der Herr Bundesminister hat es ja auch schon gesagt –: Es gibt auch das Rezept in Papierform. Es ist wichtig, dass wir da niemanden an den Rand drängen, denn es gibt eben auch Menschen, die das nicht mehr schaffen oder die das nicht wollen, und auch für die haben wir entsprechende Unterstützung.
Zum Schluss noch einmal mein Appell: Nehmen wir aufeinander Rücksicht, schauen wir aufeinander, versuchen wir gemeinsam, vertrauensvoll miteinander durch diese Krise zu kommen! Und vor allem – und das wünsche ich uns allen ganz besonders –: Bleiben Sie gesund! (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
15.46
Präsident Ing. Norbert Hofer: Nächster Redner ist Herr Abgeordneter Alois Stöger. – Bitte schön, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Alois Stöger, diplômé (SPÖ): Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Gesundheitsminister! Hohes Haus! Herr Bundesminister, nicht erst seit Papst Gregor gibt es in Österreich den Kalender. Wir wissen, wie sich das Jahr entwickelt, und wir wissen, wann Schulanfang ist. Wir wissen, wann die Wintersaison kommt, und wir wissen auch, dass manche Organisationen und Einrichtungen Zeit brauchen, um echten Gesundheitsschutz in den Unternehmen umzusetzen.
Mich hat heute in der Früh ein verzweifelter Manager von Magna International angerufen und hat mich gefragt: Herr Stöger, wissen Sie, was die Regierung jetzt tun will, denn ich muss es ja vorbereiten? – Herr Bundesminister, das größte Problem im Umgang mit dem Epidemiegesetz und im Umgang mit dem Covid-19-Maßnahmengesetz ist, dass wir sich so schnell ändernde Regeln haben, dass sich die Einrichtungen nicht daran orientieren können.
Ich sage das sehr, sehr deutlich: Wenn man längerfristige Regeln hätte und wenn man da ein bisschen Sensibilität nicht nur für die Schlagzeile, sondern auch für die Umsetzung eines Gesetzes, einer Verordnung in der täglichen Praxis hätte, dann würden wir weniger Regelungen haben – das wäre effizient. Mittlerweile sagt jeder Österreicher, jede Österreicherin: Ich kenne mich eh nicht mehr aus! – Daher haben sie kein Vertrauen mehr in die Maßnahmen, die tatsächlich noch zu setzen sind.
Die SPÖ hat immer gesagt: Wir empfehlen in Absprache mit dem Arzt, mit der Ärztin die Impfung, weil wir davon überzeugt sind, dass es das geringere Risiko ist.
In der letzten Sitzung des Gesundheitsausschusses haben wir Folgendes erlebt: Die Regierenden haben vier unterschiedliche Fristen betreffend Covid-19-Maßnahmenregelungen festgelegt. Das Covid-19-Maßnahmengesetz soll bis 30. Juni verlängert werden,
und der Minister hat die Möglichkeit, es mit Verordnung noch einmal ein halbes Jahr zu verlängern. Das ist eigentlich staatsrechtlich sehr, sehr heikel – das wollen wir nicht.
Das Zweite: Ihr habt das Zweckzuschussgesetz mit dem Fernrezept und allem Drumherum bis zum 31. März verlängert. Ich frage mich: Warum nicht bis zum 30. Juni? Ihr habt die Freistellung von Schwangeren bis zum 31. Dezember verlängert. Wieder: Warum nicht – wenn man glaubt, dass Corona so lange dauert – bis zum 30. Juni? Und jetzt komme ich zum Punkt: Ihr habt das Betriebliche Testungs-Gesetz bis zum 31. Oktober verlängert – um einen Monat! Heute ist, wenn ich es richtig sehe, der 12. (Abg. Belakowitsch: Der 13.!) – der 13. schon. Also das Gesetz wird erst in Kraft treten und nur wenige Tage in Kraft sein. Das kann nicht richtig sein, und daher verzweifeln die Leute.
Herr Bundesminister, ich würde Ihren Antrag unterstützen und bringe daher einen Abänderungsantrag ein:
Abänderungsantrag
der Abgeordneten Philip Kucher, Kolleginnen und Kollegen zum Bericht und Antrag des Gesundheitsausschusses über den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über eine COVID-19 Förderung für betriebliche Testungen (Betriebliches Testungs-Gesetz – BTG) geändert wird (1069 d.B.) – TOP 8
Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen:
Der eingangs bezeichnete Gesetzesantrag wird wie folgt geändert
Z 1 lautet wie folgt:
„1. In § 2 Abs. 1 zweiter Satz wird die Wortfolge ‚30. September 2021‘ durch die Wortfolge ‚31. März 2022‘ ersetzt.“
*****
Sie brauchen nur Ihre Grünen zu überzeugen, dass sie da zustimmen, und Ihr Ziel ist erreicht. Wenn Sie das tun, werden wir auch den Änderungen des Epidemiegesetzes beziehungsweise COVID-19-Maßnahmengesetzes zustimmen, weil wir glauben, das ist dann geregelt und wir können den Menschen echte Sicherheit vermitteln, die dann auch in der betrieblichen Praxis wirkt.
Herr Präsident, weil Sie mich aufgefordert haben, noch etwas zum Zweckzuschussgesetz zu sagen: Das Zweckzuschussgesetz ist ein Gesetz nach dem Finanz-Verfassungsgesetz, mit dem der Bund den Ländern und den Gemeinden Mittel für ihre Aufgaben zur Verfügung stellt. Das tun wir, und das tun wir aufgrund von Covid-19.
Wir haben im Frühjahr 2020 gesehen, dass die größten Belastungen durch Covid-19 die Menschen in der Pflege gehabt haben, jene, die in Pflegeheimen tätig waren. Es hat sehr lange gedauert, bis die Bundesregierung Maßnahmen zur Unterstützung in der Pflege eingeleitet hat. Wenn wir die Situation der Pandemie bewältigen wollen, dann müssen wir dem sichtbar gemachten Pflegenotstand durch Covid-19 begegnen. (Beifall bei der SPÖ.)
Es hat viele Stationen gegeben, die geschlossen worden sind, weil man keine ausgebildeten Menschen gehabt hat, die diese Stationen betreuen. Ich möchte auch daran erinnern, dass gerade durch Covid-19 dieser Missstand sichtbar geworden ist.
In diesem Sinne sage ich noch einmal deutlich: Wir brauchen diesen Zweckzuschuss auch für den Bereich der Pflege. Wir sehen da einen ganz klaren Zusammenhang, weil wir das Zweckzuschussgesetz auch auf der Tagesordnung haben. Ich bitte Sie, den
Antrag des Abgeordneten Kucher, von Kollegin Nussbaum vorgetragen, zuzulassen. – Herzlichen Dank. (Beifall bei der SPÖ.)
15.53
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Abänderungsantrag
der Abgeordneten Kucher,
Genossinnen und Genossen
zum Bericht und Antrag des Gesundheitsausschusses über den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über eine COVID-19 Förderung für betriebliche Testungen (Betriebliches Testungs-Gesetz – BTG) geändert wird (1069 d.B.) – TOP 8
Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen:
Der eingangs bezeichnete Gesetzesantrag wird wie folgt geändert
Z 1 lautet wie folgt:
„1. In § 2 Abs. 1 zweiter Satz wird die Wortfolge „30. September 2021“ durch die Wortfolge „31. März 2022“ ersetzt.“
Begründung
Es ist erforderlich, dass über den 31. Oktober 2021 hinaus betriebliche Testungen möglich bleiben und den Arbeitgebern ersetzt werden.
*****
Präsident Ing. Norbert Hofer: Herr Abgeordneter, Sie haben jetzt argumentiert, warum dieser Antrag aus Ihrer Sicht zulässig ist. Ich kann dieser Argumentation folgen. Sie hätten den Antrag aber jetzt noch einmal einbringen müssen. Vielleicht kann das Frau Mag.a Becher noch machen. Er muss neu eingebracht werden, damit er zulässig ist. Wenn sich das nicht ausgeht, kann sich vielleicht noch ein Redner kurz dazumelden. Dann geht sich das aus.
Ich darf ergänzen, dass der von Ihnen eingebrachte Abänderungsantrag ausreichend unterstützt ist, ordnungsgemäß eingebracht ist und somit auch in Verhandlung steht.
Zu Wort gelangt nun Frau Kollegin Ruth Becher. Wenn es sich zeitlich mit dem Antrag nicht ausgeht, kann sich vielleicht noch ein Kollege oder eine Kollegin melden und den Antrag neu einbringen. – Bitte, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete Mag. Ruth Becher (SPÖ): Meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Präsident! Herr Minister! Corona ist für die Mehrheit der Bevölkerung in der Zwischenzeit Alltag geworden, oft auch lästiger Alltag. Wer hätte gedacht, dass die neue Normalität so aussehen würde? Was aber sehr viele überrascht, ist, dass die Politik noch immer im Krisenmodus bleibt. Ein Beleg dafür ist der Antrag 1924, der für die Länder eine Verlängerung der Möglichkeit vorsieht, nach Bedarf Barackenspitäler ohne langes Bewilligungsverfahren zu errichten. Das wirft natürlich die Frage auf: Welcher Pessimismus veranlasst die Regierung zu so einem radikalen Schritt?
Ebenso findet sich im Antrag eine Verlängerung der Notzulassung für Selbsttests. Ich verstehe nicht, warum diese Produkte nicht vom Bundesamt für Gesundheit geprüft werden sollen. Die Coronaindustrie ist ein Millionengeschäft geworden, und die Regierung
hat es verabsäumt, die Preise für die Tests nachzuverhandeln. Das ist kein sorgsamer Umgang mit Steuermitteln, und das ist auch kein ordentlicher Umgang mit der Gesundheit. Diesen Verdächtigungen hätte sich die Regierung nicht aussetzen müssen, und daher werden wir diesen Antrag auch ablehnen.
Abschließend möchte ich aber noch etwas Positives in dieser schweren Zeit sagen. Der Antrag 1822 betrifft den Umgang mit medizinischen Krisenvorräten, die kurz vor dem Ablaufdatum stehen. Diese Produkte können zukünftig an Hilfsorganisationen und Länder, die sie benötigen, verschenkt werden. Das ist ein sehr wichtiges und richtiges Signal unter den Staaten, denn Corona ist eine weltweite Krise, und wir werden die Pandemie auch nur gemeinsam besiegen können.
Diese positive Geste hat es auch in meinem Wahlkreisbezirk gegeben. Zu Beginn der Pandemie haben wir völlig überraschend von unserem Partnerbezirk in Peking eine große Ladung an Schutzmasken erhalten. Diese konnten wir dann an Schulen und Kindergärten weitergeben. Das war eine große Unterstützung und auch eine wichtige Völker verbindende Hilfe, die wir gerne angenommen haben. Es freut mich sehr, dass Österreich nun auch den Weg dieser gegenseitigen Hilfe verstärkt. – Vielen Dank. (Beifall bei der SPÖ.)
15.57
Präsident Ing. Norbert Hofer: Nächster Redner ist Herr Abgeordneter Mag. Jörg Leichtfried. – Bitte schön, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Mag. Jörg Leichtfried (SPÖ): Vielen Dank, Herr Präsident. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie trotz dieser Schwierigkeiten jetzt den Zusammenhang mit diesem Dossier festgestellt haben. Mir obliegt es jetzt, den Antrag noch einmal einzubringen. Begründet hat ihn Kollege Stöger schon. Daran möchte ich anschließen und bringe daher folgenden Entschließungsantrag ein:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Philip Kucher, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Pflegeoffensive jetzt!“
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, sofort eine Pflegeoffensive zu starten und unverzüglich dem Nationalrat Regierungsvorlagen zu übermitteln, mit der
- ein Pflegegarantiefonds für kostenfreie Pflegeleistungen geschaffen
- eine zusätzliche Pflegemilliarde aus Budgetmittel zur Verfügung gestellt
- eine Ausbildungsoffensive sofort gestartet und
- die Verbesserung der Arbeitssituation für Pflegeberufe rasch umgesetzt wird.“
*****
Das ist notwendiger denn je. – Herzlichen Dank. (Beifall bei Abgeordneten der SPÖ.)
15.58
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Kucher, Genossinnen und Genossen
betreffend Pflegeoffensive jetzt!
eingebracht im Zuge der Debatte zum Bericht des Gesundheitsausschusses über den Antrag 1925/A der Abgeordneten Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das COVID-19-Zweckzuschussgesetz geändert wird (1068 d.B.) – TOP 7
Die größte Gesundheitskrise seit über 100 Jahren hat unser Land überrollt, Pflegeberufe sind gefragt und gebraucht wie noch nie, die Pflegebedürftigkeit der Bevölkerung nimmt vor allem durch die Demographie enorm zu.
Das Problem des Pflegenotstandes trifft vor allem Länder und Gemeinden, die für die Bereitstellung eines ausreichenden, qualitätsvollen Angebotes verantwortlich sind.
Lange hat es gedauert, bis die Länder von dieser Bundesregierung Unterstützung zur Bewältigung der Pandemie erhalten haben. Die finanzielle Unterstützung wird aber heute zumindest bis Ende März 2021 verlängert. Wo bleibt aber die Unterstützung des Bundes im Bereich des Pflegenotstandes?
Wann wird die dringend erforderliche Pflegereform endlich angegangen?
Diese Regierung schafft es einfach nicht, Lösungen für dieses drängende Problem auf den Weg zu bringen.
Die Sicherstellung einer menschenwürdigen und hochwertigen Pflege nach dem Stand der Pflegewissenschaft und Medizin sowie die Unterstützung von pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörigen müssen in Österreich höchste Priorität haben. Nach der Bevölkerungsprognose wird der Anteil der über 80-Jährigen bis zum Jahr 2030 von derzeit 5% auf 6,8% angestiegen sein. Bedingt durch diese Verschiebung der Altersstruktur in der Bevölkerung sagen sämtliche Studien und Prognosen für die nächsten Jahre einen steigenden Bedarf an Pflegepersonen voraus.
Die drängendsten und wichtigsten Punkte – einheitliches Pflegesystem, garantierte Finanzierung der Pflegeleistungen und Ausbildungsoffensive – wurden bisher nicht angegangen:
Bundesweit einheitliches Pflegesystem
Es braucht anstelle von neun unterschiedlichen Systemen bundesweite Festlegungen: welche Leistungen, welche Angebote sollen in welcher Qualität und Quantität zu welchen Kosten verfügbar sein. Damit kann man Transparenz und Vergleichbarkeit für alle sicherstellen.
Pflege qualitativ ausbauen und die Qualität sicherstellen kann nur durch eine gesamtheitliche Steuerung der Pflege geschehen, die Rücksicht auf regionale Gegebenheiten nimmt und Mindestkriterien festlegt sowie unabhängig kontrolliert.
Garantierte Finanzierung des Pflegeangebotes durch Pflegegarantiefonds
Die Finanzierung aus einem Topf ist ein wichtiger Baustein dazu. Derzeit besteht der Pflegefonds als Provisorium und dient als Ausgleichfonds für die Sozialhilfeträger. Dieser Fonds muss umgestaltet und dauerhaft finanziert werden.
Am wichtigsten aber: Er muss für die Menschen spürbar werden!
Durch Schaffung eines Pflegegarantiefonds sollen die Mitteln der Länder und des Bundes zusammengeführt und um rund eine Milliarde (Pflegemilliarde) erhöht werden, damit alle Pflegeleistungen den Pflegebedürftigen kostenlos zur Verfügung gestellt werden können.
Menschen muss in einer Pflegesituation unverzüglich die erforderliche Pflegeleistung vor allem auch durch Ausbau alternativer und mobiler Betreuung und Pflege garantiert werden können und diese Leistungen sollen in Hinkunft ohne zusätzliche Kosten für die Pflegebedürftigen zur Verfügung gestellt werden.
Ausbildungsoffensive und faire Arbeitsbedingungen
Im Pflegebereich rechnet man bis 2030 mit einem Bedarf von zusätzlichen 100.000 Pflege- und Betreuungskräften. Bis zum Jahr 2050 ist in Österreich mit einem Anstieg pflegebedürftiger Menschen von derzeit 450.000 auf 750.000 Menschen zu rechnen.
Das derzeit beschäftigte Pflegepersonal ist bereits physisch und psychisch extrem belastet. Mehrere hundert Stellen können gar nicht besetzt werden. Der Mitarbeitermangel trifft auch Pflegeeinrichtungen im ganzen Land. Immer mehr Pflegehäuser und Einrichtungen haben mit Personalnot zu kämpfen, sodass es zwar die Betten, nicht aber die dafür nötigen Pflegekräfte gibt.
Dieser Zustand ist unhaltbar!
Es braucht daher sofort eine Ausbildungsoffensive, mit der z.B. Personen, die eine Pflegeausbildung machen, eine Entlohnung (ähnlich den Polizeischülern) angeboten wird, mit der auch die Fachhochschulbeiträge erlassen, das Fachkräftestipendium für die tertiäre Ausbildung des gehobenen Dienstes geöffnet und weitere Anreize geboten werden (z.B. ein fixer Arbeitsplatz nach der Ausbildung).
Um einen Beruf mit Zukunftschancen zu ergreifen, ist es auch wichtig, dass die Arbeitsbedingungen ansprechend sind. Gerade die letzten Monate der Gesundheitskrise haben uns gezeigt, dass Pflegeberufe oft unter dramatischen Bedingungen ihre Arbeit erbringen müssen. Es braucht daher einen Personalbedarfsschlüssel und mehr finanzielle Mittel, um ausreichend Personal beschäftigen zu können.
Es bedarf aber auch attraktiver Arbeitsplätze durch bessere Arbeitsbedingungen: faire Bezahlung und langfristig lebbare Arbeitszeitmodelle: z.B. Bonus für schlechte Arbeitszeit-Lage oder 6. Urlaubswoche ab 40. Lebensjahr Damit kann auch die Drop-Out-Rate erheblich reduziert werden.
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, sofort eine Pflegeoffensive zu starten und unverzüglich dem Nationalrat Regierungsvorlagen zu übermitteln, mit der
• ein Pflegegarantiefonds für kostenfreie Pflegeleistungen geschaffen
• eine zusätzliche Pflegemilliarde aus Budgetmittel zur Verfügung gestellt
• eine Ausbildungsoffensive sofort gestartet und
• die Verbesserung der Arbeitssituation für Pflegeberufe rasch umgesetzt wird.“
*****
Präsident Ing. Norbert Hofer: Der Entschließungsantrag ist ausreichend unterstützt, ordnungsgemäß eingebracht und steht somit auch in Verhandlung.
Zu Wort ist dazu nun niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
Ist seitens der Berichterstattung ein Schlusswort gewünscht? – Das ist nicht der Fall.
Wir vereinbart verlege ich die Abstimmungen an den Schluss der Verhandlungen über die Vorlagen des Gesundheitsausschusses und fahre in der Erledigung der Tagesordnung fort.
12. Punkt
Bericht des Gesundheitsausschusses über den Antrag 1586/A(E) der Abgeordneten Mag. Christian Drobits, Kolleginnen und Kollegen betreffend umgehendes Verbot des Farbstoffs Titandioxid E 171 wegen Krebsgefahr (1073 d.B.)
Präsident Ing. Norbert Hofer: Wir gelangen zum 12. Punkt der Tagesordnung.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Zu Wort gelangt Mag.a Ulrike Fischer. – Bitte, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete Mag. Ulrike Fischer (Grüne): Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Minister! Sehr geehrte Damen und Herren! Titandioxid oder E 171 – jeder von uns hat es sich wahrscheinlich schon auf die Haut geschmiert, ins Gesicht geschmiert, sich damit die Haare gewaschen oder es gegessen. Es befindet sich in Saucen, in Medikamenten oder – was Kinder gerne essen – in Marshmallows, in Mozzarella und in anderen Dingen.
Frankreich hat den ersten Schritt gesetzt, Frankreich hat Titandioxid in Lebensmitteln verboten. Wir haben im letzten Gesundheitsausschuss einstimmig beschlossen, dass Titandioxid auch in Österreich rasch verboten werden soll. (Beifall bei den Grünen sowie des Abgeordneten Mahrer.)
Es ist ein Lebensmittelzusatz, der für den Nährwert komplett egal ist. Es macht die Creme weißer, es macht Dinge glänzender und es ist brandgefährlich. Insofern ist es ganz wichtig, dass wir heute hier im Parlament eine breite Zustimmung dafür finden, dass Titandioxid verboten wird, also in Lebensmitteln verboten wird, und geprüft wird, ob es sinnvoll ist, es in Kosmetika einzusetzen. (Präsident Sobotka übernimmt den Vorsitz.)
Sie müssen sich vorstellen: Man glaubt, man tut etwas Gutes, man schmiert dem Kind eine Sonnencreme auf die Haut, und in Wirklichkeit sind Stoffe enthalten, von denen man sagt, sie können das Erbgut verändern, es sind Stoffe enthalten, von denen wir nicht wissen, ob sie krebserregend sind. Daher: Weg mit Titandioxid! – Danke, Herr Minister, dass Sie sich dafür einsetzen! (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
16.01
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Drobits. – Bitte.
Abgeordneter Mag. Christian Drobits (SPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Werte Zuseherinnen und Zuseher! Gerade an einem Tag, an dem wir 20 von Brustkrebs Betroffene als Gäste in unserer Mitte haben und wir das Monat der Früherkennung von Brustkrebs beziehungsweise der Solidarität im Sinne von Pink Ribbon feiern, ist es mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass ich persönlich, meine Fraktion und wir alle hier, die das unterstützen, mit diesem Antrag, den ich eingebracht habe, einen wesentlichen Erfolg errungen haben – einen Erfolg, der für alle Österreicherinnen und Österreicher sehr hoch einzuschätzen ist. Wenn man nämlich weiß, wie hoch der prozentuelle Anteil von Krebs als Todesursache an allen Todesfällen in Österreich pro Jahr ist, nämlich 23 Prozent, weiß man, wie vielen Menschen, wie vielen Angehörigen und wie vielen Familien, die davon betroffen sind, wir dadurch helfen können. Es ist ein großer Erfolg, der gemeinsam erreicht worden ist.
Wenn wir uns die Ziele von Pink Ribbon anschauen, hinter denen die Solidarität steht, dann möchte ich anmerken, dass es nicht wesentlich ist, dass wir den Antrag eingebracht haben, sondern dass es wesentlich ist, dass alle, inklusive dem Herrn Bundesminister, aufgesprungen sind und zu diesem gemeinsamen Erfolg beigetragen haben.
Ich möchte mich deshalb für diese Zusammenarbeit bedanken, denn es wurde im abgeänderten Antrag nur das Wort unverzüglich herausgestrichen. Das Wort unverzüglich, davon gehe ich aus, ist nicht das wesentliche Merkmal, denn der Herr Bundesminister hat selbst zugesichert, für Österreich die Vorreiterrolle in der EU in diesem Bereich zu übernehmen.
Titandioxid, dieser Lebensmittelzusatzstoff, ist krebserregend. Das ist nachgewiesen, das ist europaweit nachgewiesen. Ich bin deshalb froh, dass wir nicht viele Tage gewartet haben, sondern das Verbot sehr rasch umsetzen. Bedauerlicherweise ist der Antrag im Mai dieses Jahres eingebracht und dann vertagt worden, heute aber, im Oktober, haben wir die Möglichkeit, das rasch umzusetzen.
Herr Bundesminister, ich setze auf Sie, ich setze auf Ihre Signale. Vielleicht möchten Sie selbst auch noch bekunden, dass Sie nach diesem heutigen Beschluss, von dem ich hoffe, dass er einstimmig sein wird, dieses Verbot des Einsatzes von Titandioxid als Lebensmittelzusatzstoff in Österreich endgültig umsetzen. (Beifall bei SPÖ und Grünen.)
Der Kampf gegen Krebs geht weiter. Ich habe selbst als Gerichtsvertreter oftmals gesehen, wie wichtig es ist, genau diese Gruppe zu unterstützen. Wir haben auch einen gemeinsamen Antrag zum Thema Kampf gegen Krebs am Arbeitsplatz aufliegen, mit einer daran geknüpften Petition. Ich lade heute bereits alle Fraktionen dazu ein, den Kampf wie beim Antrag zum Thema Titandioxid parteiübergreifend und gemeinsam anzugehen. Das sind wir diesen Personen auf der Besuchergalerie schuldig, das sind wir allen Familien schuldig, vor allem denjenigen, die noch nicht wissen, dass sie jemanden in der Familie haben, der oder die Krebs bekommen kann. Wir sind gemeinsam aufgefordert, diesen Kampf gegen Krebs solidarisch zu führen. Danke für die Zusammenarbeit, und Herr Bundesminister, bitte um rasche Umsetzung! – Danke sehr. (Beifall bei der SPÖ.)
16.05
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Hechenberger. – Bitte.
Abgeordneter Ing. Josef Hechenberger (ÖVP): Geschätzter Herr Präsident! Geschätzter Herr Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Geschätzte Zuseherinnen und Zuseher hier und auch zu Hause! Wir haben im letzten Gesundheitsausschuss, in dem wir ja viele Themen diskutieren, auch das Thema Titandioxid diskutiert. Eines ist klar: Wir wissen, dass Gesundheitsprävention mit einer gesunden Ernährung beginnt. Deshalb ist das Thema Lebensmittel ein besonders wichtiges, und ich denke, dass wir bei allem, was dazu beiträgt, dass Lebensmittel für unsere Konsumentinnen und Konsumenten besser, sicherer werden, die Entscheidungen gemeinsam und geschlossen treffen müssen.
Aus diesem Grund bin ich auch sehr froh, dass dieser Antrag überparteilich gemeinsam beschlossen wird. Titandioxid, das aufgrund einer Expertenmeinung aus Brüssel verboten werden soll, weil es das Erbgut nachhaltig verändert und somit gefährlich ist, muss wirklich aus der Lebensmittelproduktion genommen werden. Wir wissen alle, dass Titandioxid oder E 171 ein Zusatzstoff ist, den wir nicht unbedingt brauchen. Wir wissen auch, dass viele Konsumentinnen und Konsumenten generell einen schwierigen Zugang zu den E-Nummern bei Lebensmitteln haben. Ich glaube, dass wir da als Gesetzgeber Vorreiter sein müssen, um Lebensmittel sicherer zu machen und positiv weiterzuentwickeln. Aus diesem Grund muss ich auch wirklich ein großes Lob an unsere Produzentinnen und Produzenten, an unsere Bäuerinnen und Bauern aussprechen. Aus dem Lebensmittelbericht des letzten Jahres geht eindeutig hervor, dass unsere Lebensmittel sicher sind. Österreich kann sich glücklich schätzen, von unseren BäuerInnen nicht nur sichere Lebensmittel, sondern diese auch in ausreichender Menge und hoher Qualität
zur Verfügung gestellt zu bekommen. (Beifall bei der ÖVP sowie der Abgeordneten Maurer und Jakob Schwarz.)
Eines ist auch ganz deutlich zum Ausdruck gekommen, und zwar, dass es sich dort, wo es Mängel gibt, meistens um Kennzeichnungsmängel handelt. Aus diesem Grund, geschätzter Herr Bundesminister – wir haben uns schon ausgetauscht –, müssen wir gemeinsam das Thema Herkunftskennzeichnung aufbauend auf den Grundsätzen des Regierungsprogramms weiter voranbringen. Jeder Konsument hat das Recht auf Transparenz. Jede Konsumentin, jeder Konsument muss bei den Lebensmitteln, die er kauft, wissen, wo sie herkommen, wie sie produziert wurden beziehungsweise wie sie zusammengestellt sind. Aus diesem Grund werden wir da auch nicht müde werden, dieses große Projekt gemeinsam und auch überparteilich weiterzutreiben.
Ich möchte zum Abschluss ein Beispiel ansprechen, das wir in unserem Bundesland Tirol umgesetzt haben, und zwar gemeinsam mit der Wirtschaftskammer, der Landwirtschaftskammer, dem Land Tirol und auch der Tirol Werbung: die sogenannte freiwillige Herkunftskennzeichnung, „Ich sag, wo’s herkommt“. Da erklären sich Gastronomen freiwillig bereit, zu kennzeichnen, wo Lebensmittel produziert wurden, wo sie herkommen, schaffen so einen Informations- und Transparenzmehrwert für die Gäste und ziehen gleichzeitig aber auch einen eigenen Vorteil daraus. Wir werden dieses Projekt in Tirol weiter vorantreiben, weiter umsetzen, letztendlich brauchen wir aber, um österreichweit weiterzukommen, die entsprechenden gesetzlichen Beschlüsse. Da, Herr Bundesminister, setze ich sehr auf Sie, damit wir gemeinsam die verpflichtende Herkunftskennzeichnung für die Primärzutaten Milch, Fleisch und Eier, wie im Regierungsprogramm festgeschrieben, ehebaldigst umsetzen.
Ein großes Ziel sollten wir haben: Mit Beginn des neuen Jahres sollte das aus meiner Sicht umgesetzt sein. Die entsprechende Transparenz haben sich der Konsument, die Konsumentin und auch unsere Bäuerinnen und Bauern verdient. Wir wissen: Wir verlangen von unseren BäuerInnen wirklich sehr viel, nämlich dass sie unter strengsten Voraussetzungen Lebensmittel produzieren. Da müssen wir ihnen aber auch die Chance geben, dass man die Kaufentscheidung nicht nur vom Preis alleine abhängig macht, sondern wirklich von der Qualität. Das geht nur, wenn man weiß, wo Lebensmittel herkommen. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
In diesem Sinne ist das heute ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, wir müssen aber noch weitere setzen. Ich bin aber überzeugt, dass wir das auch gemeinsam schaffen können. (Beifall bei der ÖVP sowie der Abgeordneten Disoski und Fischer.)
16.09
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Stammler. – Bitte sehr.
Abgeordneter Clemens Stammler (Grüne): Herr Präsident! Geschätzter Herr Minister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Auf den ersten Blick erscheint das Thema Verbot von Titandioxid ja nicht hochspannend – und es kann ja wirklich nichts: Es schmeckt nach nichts, es macht nicht haltbar, es macht nichts weicher, nichts flaumiger, es macht maximal etwas schöner. Das ist die einzige Eigenschaft beziehungsweise eine von zwei Eigenschaften: Es macht weißer, es macht glänzender und es ist toxisch.
Auch wenn das nur ein Zusatzstoff ist, würden wir es niemals selbst in unserer Küche verwenden. Als Bauer, muss ich schon sagen, bestürzt es mich manchmal, was, nachdem wir die Lebensmittel aus unseren Händen geben haben, in der Verarbeitung alles noch dazukommt.
Es ist aber vielleicht trotzdem ein bisschen ein Phänomen unserer Zeit, selbst toxische Mittel anzuwenden, um etwas besser verkaufen zu können. Toxische Blender sollten,
egal ob in der Marktwirtschaft, in Lebensmitteln oder in sonstigen Lebensbereichen wie der Politik, eigentlich grundsätzlich der Vergangenheit angehören. – Danke. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP:)
16.11
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort ist dazu nun niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
Wünscht der Berichterstatter ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall.
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Wir kommen zu den verlegten Abstimmungen des Gesundheitsausschusses, die ich über jeden Tagesordnungspunkt getrennt vornehme.
Bevor wir in den Abstimmungsvorgang eintreten, darf ich fragen, ob wir abstimmen können. – Das ist der Fall.
Ich komme zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 6: Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Epidemiegesetz 1950 und das COVID-19-Maßnahmengesetz geändert werden, in 1067 der Beilagen.
Hiezu haben die Abgeordneten Schwarz, Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen einen Abänderungsantrag eingebracht.
Wir stimmen zuerst über die vom erwähnten Abänderungsantrag betroffenen Teile und schließlich über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes ab.
Nun zum Abänderungsantrag der Abgeordneten Schwarz, Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend Artikel 2.
Wer hierfür ist, den ersuche ich um ein dementsprechendes Zeichen. – Das ist die Mehrheit.
Wir kommen zur Abstimmung über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang in der Fassung des Ausschussberichtes. – Das ist die Mehrheit.
Wir kommen gleich zur dritten Lesung.
Wer das auch in dritter Lesung annimmt, den darf ich um ein dementsprechendes Zeichen bitten. – Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung mit Mehrheit angenommen.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Belakowitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Ende aller Covid-Maßnahmen und Corona-Freiheitstag am 26. Oktober 2021“.
Wer dafür ist, den bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen. – Das ist die Minderheit, abgelehnt.
Abstimmung über Tagesordnungspunkt 7: Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das COVID-19-Zweckzuschussgesetz geändert wird, samt Titel und Eingang in 1068 der Beilagen.
Wer dafür ist, den bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen. – Das ist die Mehrheit.
Ich darf fragen, wer auch in dritter Lesung dafür ist, und bitte um ein diesbezügliches Zeichen. – Auch in dritter Lesung mit Mehrheit angenommen.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Kucher, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Pflegeoffensive jetzt!“.
Wer dafür ist, den bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen. – Das ist die Minderheit, abgelehnt.
Abstimmung über Tagesordnungspunkt 8: Entwurf betreffend Betriebliches Testungs-Gesetz in 1069 der Beilagen.
Hiezu haben die Abgeordneten Kucher, Kolleginnen und Kollegen einen Abänderungsantrag eingebracht.
Ich werde daher zunächst über den vom erwähnten Abänderungsantrag betroffenen Teil und schließlich über die restlichen Teile des Gesetzentwurfes abstimmen lassen.
Abänderungsantrag der Abgeordneten Kucher, Kolleginnen und Kollegen betreffend Ziffer 1.
Wer dafür ist, den bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen. – Das ist die Minderheit, abgelehnt.
Wir kommen zur Abstimmung über diesen Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung des Ausschussberichtes.
Ich ersuche jene Damen und Herren, die im Sinne des Ausschussberichtes dafür sind, um ein dementsprechendes Zeichen. – Das ist mit Mehrheit angenommen.
Schließlich kommen wir zur Abstimmung über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang in der Fassung des Ausschussberichtes. – Das ist wieder das gleiche Stimmverhalten, mit Mehrheit angenommen.
Wir kommen zur dritten Lesung.
Das ist das gleiche Stimmverhalten. Daher ist dieser Gesetzentwurf auch in dritter Lesung mit Mehrheit angenommen.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Hauser, Kolleginnen und Kollegen betreffend „betriebliche Gratistests beibehalten“.
Wer dafür ist, den bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen. – Das ist die Minderheit, abgelehnt.
Wir gelangen zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 9: Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das COVID-19-Lagergesetz geändert wird, samt Titel und Eingang in 1070 der Beilagen.
Wer dafür ist, den bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen. – Das ist mit Mehrheit angenommen.
Wir kommen zur dritten Lesung.
Wer das auch in dritter Lesung tut, den bitte ich um ein diesbezügliches Zeichen. – Das ist auch in dritter Lesung mit Mehrheit angenommen.
Wir gelangen zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 10: Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Gesundheitstelematikgesetz 2012 geändert wird, samt Titel und Eingang in 1071 der Beilagen.
Wer dafür ist, den bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen. – Das ist einstimmig.
Wir kommen zur dritten Lesung.
Wer das auch in dritter Lesung tut, den bitte ich wiederum um ein dementsprechendes Handzeichen. – Das ist auch in dritter Lesung einstimmig angenommen.
Tagesordnungspunkt 11: Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz und das Medizinproduktegesetz geändert werden, in 1072 der Beilagen.
Hiezu haben die Abgeordneten Smolle, Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen einen Abänderungsantrag eingebracht. Wir stimmen zuerst über die vom Abänderungsantrag betroffenen Teile ab.
Abänderungsantrag der Abgeordneten Smolle, Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend Artikel 2.
Wer dafür ist, den ersuche ich um Zustimmung. – Das ist einstimmig angenommen.
Wir kommen zur Abstimmung über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang in der Fassung des Ausschussberichtes. – Das ist die Mehrheit.
Wir kommen zur dritten Lesung.
Wer dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter Lesung die Zustimmung erteilt, möge ein diesbezügliches Zeichen geben. – Das ist mit Mehrheit angenommen.
Tagesordnungspunkt 12, die dem Ausschussbericht 1073 der Beilagen angeschlossene Entschließung betreffend „umgehendes Verbot des Farbstoffs Titandioxid E 171 wegen Krebsgefahr“.
Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist einstimmig angenommen. (203/E)
Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über die Regierungsvorlage (1031 d.B.): Abkommen im Bereich der sozialen Sicherheit zwischen der Republik Österreich und Kanada (1083 d.B.)
14. Punkt
Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 1900/A(E) der Abgeordneten Erwin Angerer, Kolleginnen und Kollegen betreffend Energiearmut bekämpfen (1084 d.B.)
15. Punkt
Bericht des Ausschusses für Arbeit und
Soziales über den Bericht nach § 3 Abs. 5 des
Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für
März 2020 bis Juli 2021, vorgelegt vom Bundesminister für Arbeit
(III-401/1085 d.B.)
16. Punkt
Bericht und Antrag des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Mutterschutzgesetz 1979 geändert wird (1086 d.B.)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Wir gelangen nun zu den Punkten 13 bis 16 der Tagesordnung, über welche die Debatten unter einem durchgeführt werden.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Zu Wort gemeldet ist Abgeordnete Heinisch-Hosek. Bei ihr steht das Wort. – Bitte, Frau Abgeordnete.
16.19
Abgeordnete Gabriele Heinisch-Hosek (SPÖ): Herr Präsident! Herr Arbeitsminister! Herr Gesundheitsminister! Ich habe mir aus diesen Berichtsvorlagen, Vorschlägen und Anträgen das Thema Sonderbetreuungszeit herausgenommen.
Sonderbetreuungszeit ist mehr als ein Wort, zumal das Recht auf Sonderbetreuungszeit für viele Eltern, für viele Mütter und Väter zu einem Anker geworden ist. Wir wissen, es gibt bei Krankheit von Kindern Pflegefreistellung, es gibt, wenn plötzlich etwas auftritt, die Möglichkeit, sich frei zu nehmen. Es hat aber vor 1,5 Jahren noch keinen Rechtsanspruch gegeben. Damals wurde zum ersten Mal darüber geredet, dass es wichtig wäre, die Sonderbetreuungszeit mit der Arbeitgeberseite zu vereinbaren, damit Eltern – Mütter, Väter und vor allem sehr geforderte Alleinerzieherinnen oder Alleinerzieher –, die beim Lernen geholfen, betreut und nebenbei gearbeitet haben, zumindest auch bis zu drei Wochen Erleichterung bekommen können.
Es hat allerdings doch einige Monate – bis zum November 2020 – gedauert, bis dieser Rechtsanspruch hier im Parlament beschlossen wurde, und dann war im neuen Schuljahr alles wieder ganz anders. Ich glaube, es ist wichtig, die Geschichte dazu zu erzählen, weil bei den Erwachsenen, aber natürlich auch bei den Kindern tiefste Unsicherheit hervorgerufen wurde. Zu Beginn war nicht klar: Ist eine Schule offen, ist eine Schule zu? Gibt es Betreuung oder nicht? – Wenn es Betreuung gibt, gibt es keine Sonderbetreuungszeit und keine Freistellung.
Im Juli letzten Jahres ist die Regelung ausgelaufen, und im Herbst war für Eltern wieder diese Unsicherheit da. Ich darf Sie und uns alle nur daran erinnern: Es waren in der ersten Schulwoche an die 450 positiv getestete Kinder zu verzeichnen, und es wurde über mehr als 300 Klassen Quarantäne verhängt. Das ist nur einen Monat her, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es waren damals schon 8 000 Kinder in Quarantäne – und die Eltern hatten noch immer keinen Rechtsanspruch auf Sonderbetreuungszeit.
Dann hat es viel Druck gegeben. Das war notwendig und wichtig. Die Sozialpartner haben sich diesbezüglich gut verständigt, der Gewerkschaftsbund hat maßgeblich dazu beigetragen. Wir haben unseren Beitrag geleistet und gemeinsam haben wir ein Einlenken erreicht. Der vorläufige Vorschlag war, dass diese Sonderbetreuungszeit ab Oktober wieder eingeführt werden soll. Dann musste noch einmal Druck her, um den Rechtsanspruch auf Sonderbetreuungszeit rückwirkend mit September fortzusetzen.
Man muss schon auch an die Kinder denken: das Chaos zu Beginn, ohne Freitestung 14 Tage Quarantäne, mit Freitestung zehn Tage Quarantäne, ganze Klassen, die heimgeschickt wurden. Momentan beträgt die Quarantäne fünf Tage, wenn nur der Sitznachbar oder die Sitznachbarin positiv getestet wird. Dieses Chaos bedeutet natürlich auch große Sorge für Eltern, einen Anruf zu bekommen und dann nicht zu wissen: Habe ich mein Kind abzuholen? Wie lang muss es nun zu Hause sein? Man muss sofort dem Arbeitgeber bekannt geben, dass Sonderbetreuungszeit beansprucht wird. Man muss darauf achten, dass niemand anderer Zeit hat, nur man selbst. Beide Elternteile müssen arbeiten. Die Regelung ist also sehr verschärft, was die Möglichkeit betrifft, den Rechtsanspruch auf Sonderbetreuungszeit in Anspruch zu nehmen. (Abg. Michael Hammer: Alles so furchtbar, na?!)
Herr Bundesminister Kocher, ich habe Sie bereits im Ausschuss gefragt, ich frage Sie heute noch einmal: Warum endet diese Verlängerung des Rechtsanspruchs auf Sonderbetreuungszeit mit Silvester, also mit 31.12.? Was ist nach den Weihnachtsferien? Sie haben mir und uns allen im Ausschuss geantwortet: Na ja, ich gehe davon aus, dass dann schon ganz viele Kinder geimpft wurden. Der Herr Gesundheitsminister ist jetzt gerade nicht mehr da, ich wollte aber auch ihn noch einmal miteinbeziehen. Erstens
wissen wir noch nicht, wann diese Impfung nun wirklich freigegeben wird. Zweitens wissen wir nicht, welche Eltern ihre Kinder impfen lassen wollen und welche Kinder ab einem gewissen Alter selbst entscheiden, ob sie sich impfen lassen.
Ihre Antwort, Herr Bundesminister Kocher, war folgende Annahme: Da sind dann ohnehin schon viele Kinder geimpft und dann brauchen wir das nicht länger. – Das ist ein bisschen wenig gewesen. (Beifall bei der SPÖ sowie der Abg. Belakowitsch.) Das wollte ich Ihnen noch einmal mitgeben, weil wir ja auch beantragt haben, dass es eigentlich eine niederschwellige Informationskampagne zu dieser Kinderimpfung geben sollte. Eltern sollen verstehen können, was es bedeutet und welche Vorteile es hat, wenn Kinder zwischen sechs und zwölf, in Folge aber auch noch jüngere, die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen.
Diese Krise hat bei den Kindern, aber auch bei den Erwachsenen ziemlich tiefe Spuren hinterlassen. Ich glaube, wir wissen mittlerweile nicht nur aus einigen Studien aus Deutschland und aus den USA, sondern auch aus Befragungen in Österreich, dass die psychosozialen Folgen dieser Krise für Kinder verheerend sein können. Zu Beginn waren sie verängstigt, dass sie jemanden anstecken könnten. Sie erinnern sich an die ersten Aussagen des Altkanzlers, der gesagt hat, vielleicht wird jeder die Großeltern anstecken, daher: Lockdown, alles zu. Kinder waren verängstigt, dass sie Weitergeber oder Weitergeberinnen dieses Virus sein könnten. Später war es dann so, dass Kinder schon mit Niedergeschlagenheit, Depressionen, vielleicht auch mit Essstörungen reagiert haben. 16 Prozent der Kinder, die in Österreich im Rahmen dieser Studie befragt wurden, hatten sogar Suizidgedanken. Exzessiver Medienkonsum, aber auch Ängste und Depressionen haben zugenommen.
Was trägt noch dazu bei? – Enge Wohnverhältnisse und herausfordernde Beziehungsverhältnisse innerhalb der Familien können eine Rolle spielen. Wir alle können die psychischen Folgen heute noch nicht absehen. Ich glaube, es braucht mehr Hilfe für Eltern und für Kinder – das ist wichtig. Nun wurden Therapieplätze in Aussicht gestellt, das war heute sogar dem Finanzminister einen Halbsatz in der Budgetrede wert. Ich glaube allerdings, dass der Ausbau der Schulsozialarbeit und der Kindertherapie – nicht nur der Einrichtungen, sondern auch der Plätze – vervielfacht werden muss. Es geht nicht nur darum, dass man den Stoff nachholt – Kinder werden das, was sie in diesem Jahr nicht erlernen konnten, womöglich nie mehr aufholen können –, sondern vor allem auch darum, dass die Kinder samt ihren Eltern auch anderwärtig gut betreut sind. Es ist nicht wahr, dass die Welt wieder in Ordnung ist, wenn entweder die Kinderimpfung kommt oder wenn die Sonderbetreuungszeit mit 31.12. endet.
Nun komme ich zum Schluss – die Uhr geht nicht, sie ist auf 4 Minuten eingestellt, ich glaube, ich bin schon drüber, Herr Präsident, in der Tat, oder? Den letzten Satz möchte ich noch kurz sprechen: Herr Bundesminister, mit Schulschluss wären wir schon zufrieden gewesen, Oktober wäre uns noch lieber gewesen, damit man auch den nächsten Sommer gut übersteht. Ich bin nicht überzeugt, dass dann schon alle Kinder geimpft sind oder die Pandemie schon zu Ende ist. Daher wäre es wichtig gewesen, dass man nun nicht schon wieder einen Schnitt mit Silvester ansetzt, sondern den Eltern und den Kindern ein bisschen mehr Sicherheit vermittelt, indem man den Rechtsanspruch auf die Sonderbetreuungszeit verlängert hätte. – Schade darum. (Beifall bei der SPÖ.)
16.27
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Der Touchscreen hat nicht funktioniert.
Zu Wort gelangt Frau Abgeordnete Salzmann.
Ich darf Herrn Bundesminister Kocher und auch die Studenten der Journalismusfachhochschule aus Wien recht herzlich begrüßen, weil wir wieder die Möglichkeit haben, verstärkt Zuseher zuzulassen. (Allgemeiner Beifall.)
Frau Abgeordnete, Sie haben das Wort.
16.28
Abgeordnete MMMag. Gertraud Salzmann (ÖVP): Liebe Frau Kollegin Heinisch-Hosek! Ja, ich teile so manche Sorge, die Sie hier am Rednerpult geäußert haben. Geschätzter Herr Arbeitsminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Und auch verehrte Zuseher daheim, die Sie dieser Debatte heute hoffentlich interessiert folgen! Es ist aber so, dass wir die Familien in der Pandemie unterstützen und zeitnah auf das reagieren, was erforderlich ist, meine Damen und Herren! (Zwischenruf der Abg. Belakowitsch.) Die Pandemie hat gezeigt, dass gerade Frauen und Familien in dieser Zeit vieles geschultert haben, und umso wichtiger ist es, dass wir gut auf die Familien und besonders auch auf die Frauen schauen und Unterstützungsmaßnahmen anbieten. Das, meine Damen und Herren, steht nun zur Debatte.
Ich möchte einerseits auf die Sonderbetreuungszeit eingehen, die nun bis Ende dieses Jahres verlängert wird – erst einmal vorab, solange es notwendig ist. Ich werde andererseits auch auf den Schutz der Schwangeren eingehen. Darüber hinaus ist es mir aber ganz wichtig, den Blick heute auf die Familien und insbesondere auf die Frauen zu lenken. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
Die Sonderbetreuungszeit, meine Damen und Herren, ist eine ganz wichtige Hilfe, und seit November letzten Jahres besteht ein Rechtsanspruch. Eingesetzt haben wir die Sonderbetreuungszeit bereits im März letzten Jahres.
Mittlerweile können sich Eltern oder auch Frauen, Alleinerziehende – wie auch immer, Betreuungspersonen –, wenn sie Kinder bis 14 oder Menschen mit Behinderung zu betreuen haben, als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von der Arbeitsleistung freistellen lassen. Der Dienstgeber bekommt das Entgelt ersetzt, und der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin bekommt das Entgelt bis zu vier Wochen weiter ausbezahlt. Das geschieht immer dann, wenn eine behördliche Schließung einer Schule oder Betreuungseinrichtung insgesamt oder zumindest in Teilen erfolgt. 15 Millionen Euro sind allein im letzten Jahr dafür ausgegeben worden, 6,1 Millionen Euro sind es heuer schon, laut dem von Arbeitsminister Kocher im Ausschuss für Arbeit und Soziales vorgelegten Bericht.
Wir unterstützen die Familien und Frauen in der Pandemie darüber hinaus aber auch durch den Kinderbonus, durch den Familienbonus Plus mit 1 500 Euro pro Kind, durch den Coronafamilienhärteausgleich, durch die Coronakurzarbeit – zu 45 Prozent kommt diese den Frauen zugute –, durch die Lohnsteuersenkung von 25 auf 20 Prozent. Das alles geht in die Geldtasche der Familien! Ich möchte auch den Ausbau der ganztägigen Kinderbetreuungseinrichtungen im Ausmaß von 145 Millionen Euro erwähnen. Meine Damen und Herren, uns sind die Familien wichtig, und wir haben gerade in der Pandemie viel für die Familien getan! (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
Ein zweiter Punkt, der mir gerade auch als Arbeitnehmervertreterin ganz wichtig ist, ist der Schutz der Schwangeren. Wir wissen, dass die Schwangeren sich erst seit Mai auf Empfehlung hin impfen lassen können. Wir werden jetzt die Geltungsdauer des § 3a Mutterschutzgesetz bis Ende dieses Jahres verlängern, sodass die Frauen auch weiterhin einen Rechtsanspruch auf bestimmte Schutzmaßnahmen haben, wenn sie in ihrer Berufsausübung Körperkontakt haben. Da gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten, wie der Arbeitgeber das regeln kann. Wir werden das also weiter verlängern; das ist eine ganz wichtige Maßnahme zum Schutz der Schwangeren. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
Meine Damen und Herren, wir werden die Familien mit der ökosozialen Steuerreform massiv entlasten! (Abg. Belakowitsch: Belasten! ...!) Wir werden den arbeitenden Menschen und den Familien ein Entlastungspaket bringen, von dem wirklich jeder profitieren kann. Der Familienbonus wird auf 2 000 Euro erhöht. Wir werden die Familien auch weiterhin unterstützen. Gerade gestern haben wir einen Entschließungsantrag eingebracht und damit Minister Faßmann aufgefordert, gemeinsam mit den Ländern ein zukunftsfähiges
Modell für die Finanzierung der Ganztagsbetreuung, die Verbesserung des Kinderbetreuungsangebots und auch die frühe sprachliche Förderung auszuarbeiten. Wir schauen auf die Familien, wir schauen auf die Kinder und wir schauen insbesondere auf die Frauen! (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
Wir setzen auch auf die Chancengleichheit für Frauen. (Zwischenruf der Abg. Heinisch-Hosek.) Wir werden das automatische Pensionssplitting ausrollen. Frau Kollegin Heinisch-Hosek, Sie haben vielleicht andere Vorstellungen. Erlauben Sie uns, andere Modelle zu haben! (Neuerlicher Zwischenruf der Abg. Heinisch-Hosek.) Sie waren lange in der Regierung und konnten das umsetzen; wir werden es jetzt gemeinsam mit unserem grünen Koalitionspartner umsetzen. Wir werden vor allem auch den Schutz der Frauen und Kinder vor Gewalt noch viel stärker ausbauen. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
Kollegin Bures, die Zweite Präsidentin, ist jetzt nicht da. Wir Frauen tragen einen wunderschönen Anstecker, das Pink Ribbon; auch die Männer tragen es, lieber Christian. Ich möchte das zum Anlass nehmen, hier vom Rednerpult aus alle Frauen, aber auch alle Männer aufzufordern: Bitte geht zu den Vorsorgeuntersuchungen! Die Früherkennung ist das Wichtigste bei der Behandlung und in der Bekämpfung von Krebserkrankungen.
Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Abschluss auf eine Situation eingehen, die, so denke ich, für uns alle hier zum Teil sehr belastend ist! Die letzten Tage waren mehr als fordernd. (Zwischenruf der Abg. Belakowitsch.) Für mich als Juristin ist ganz klar, dass die im Raum stehenden Vorwürfe aufgeklärt werden müssen. Für mich ist aber auch klar: Es gilt ohne Ansehen der Person die Unschuldsvermutung. (Abg. Belakowitsch: Die Unschuldsvermutung!) Sie gilt natürlich auch für die jetzt Beschuldigten, egal wie sie heißen. (Beifall bei der ÖVP.)
In den letzten Jahren haben wir gemeinsam mit den Grünen in der Koalition viel weitergebracht, wir haben viele Reformprogrammpunkte in Angriff genommen, wir haben viel zur Bewältigung der Pandemie getan und wir haben die Wirtschaft in Schwung gehalten. All das ist uns gemeinsam gelungen. Es gibt aber noch ganz viel zu tun, meine Damen und Herren, in der Pandemiebekämpfung, und es gibt in der Umsetzung unseres Regierungsprogrammes noch viel zu tun. Jetzt wollen wir einmal die ökosoziale Steuerreform ausrollen und auch das Klimaticket umsetzen.
Aber: Es gilt jetzt auch, das Vertrauen in die Politik wiederherzustellen. Wir alle sind draußen unterwegs und wir hören, was die Menschen, die Bürger uns sagen. Der politische Diskurs kann nicht mehr in dieser Schärfe, mit dieser Geringschätzung, mit dieser zum Teil untergriffigen Wortwahl und mit dieser Respektlosigkeit geführt werden. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Bösch: Sagen Sie das der Kurz-Truppe! – Zwischenruf der Abg. Belakowitsch.)
Ich bitte euch wirklich: Jeder Einzelne hier trägt Verantwortung dafür. (Neuerliche Zwischenrufe bei der FPÖ.) Wir brauchen in Österreich stabile Verhältnisse, wir brauchen eine gute Reformpolitik, denn es gibt mehr als genug zu tun, und dafür haben uns die Wähler gewählt. – Herzlichen Dank. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
16.37
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordnete Belakowitsch. – Bitte sehr.
Abgeordnete Dr. Dagmar Belakowitsch (FPÖ): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Ja, es geht um die Sonderbetreuungszeiten; darüber ist schon viel gesagt worden. Herr Bundesminister, ich habe es Ihnen schon im Ausschuss gesagt: Sie haben den Beginn des Schuljahres verschlafen. Da ist bei unseren Kindern mit einer sogenannten Sicherheitsphase hineingefahren worden. Da wurden alle Kinder getestet, und es war natürlich
zu erwarten, dass man positive Tests findet. Die Kinder wurden zumindest einmal abgesondert, egal was dann letztendlich beim PCR-Test rausgekommen ist.
Das alles sind Probleme, vor die Eltern gestellt werden, wenn der Anruf aus der Schule kommt und man sagt: Jetzt müssen Sie das Kind abholen und Sie bekommen dann weitere Informationen von der Behörde. – Da ist überhaupt noch gar nichts passiert, außer dass der Antigentest in der Schule positiv war. Dann muss man einmal auf die Anordnungen der Behörde warten. Am nächsten Tag fährt man zum PCR-Test. Dann hat man das Ergebnis. Wenn es glücklicherweise negativ ist, hat man damit zumindest einmal schon eineinhalb Arbeitstage aufgebraucht. Ich möchte das nur einmal sagen.
Das alles ist in Ihren Überlegungen überhaupt nicht drinnen. Wenn man dann das Pech hat, dass das Kind vielleicht noch positiv getestet ist, muss man es ohnehin betreuen, man ist dann als K1 ohnehin freigestellt. Wenn man aber das Pech hat, dass es der Sitznachbar ist und das eigene Kind gar nichts hat, man muss es auch betreuen. Dann muss man auch mit dem Kind zu einer PCR-Test-Station fahren, damit man einmal nachweist, dass das eigene Kind negativ ist. Dieser Test kann dann in fünf Tagen wiederholt werden, damit kann man sich quasi freitesten.
All das war Ihnen völlig und vollkommen egal, Herr Bundesminister! Wissen Sie, was das für Eltern bedeutet, wenn das Kind in Quarantäne ist und wenn das Kind so wie im letzten Jahr vielleicht zwei, dreimal zehn Tage in Quarantäne ist? Haben Sie sich einmal überlegt, was das in einem Schuljahr wie dem letzten bedeutet, in dem die Kinder mehr zu Hause als in der Schule waren? Dann war endlich einmal ein paar Wochen Schule, und dann ist die Quarantäne gekommen! Als diese endlich vorbei war, kam die nächste Quarantäne. Sie ist im heurigen Schuljahr jetzt zwar verkürzt – das war übrigens am Schulanfang ja noch nicht so –, es ist aber wieder genau das Gleiche: Auch an diesen fünf Tagen müssen Kinder betreut werden.
Das haben Sie verschlafen, weil Sie es offensichtlich auch verschlafen wollten, und es war der Druck der Öffentlichkeit und der Eltern, dass Sie sich da jetzt bewegen müssen, dass Sie noch einmal eine Sonderbetreuungszeit beschließen müssen. Und was haben wir auf den Tisch geknallt bekommen? – Bis Ende Dezember!
So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder sagen Sie als Arbeitsminister: Na ja, ab Jänner ist es eigentlich wurscht; wenn die Leute die Kinder impfen lassen, dann ist alles gut. – Das ist nämlich ungefähr die Antwort gewesen, die Sie im Ausschuss gegeben haben. Sie rechnen nämlich damit, dass Ihre Impfkampagnen so großartig werden, und die Eltern, die ihre Kinder dann nicht impfen lassen, sind selber schuld, die sollen schauen, wo sie bleiben.
Es ist ja auch nicht davon auszugehen, dass diese Bundesregierung ehrlich über Kinderimpfungen informiert. Es ist eine Impfung, die für Kinder extrem unethisch ist, aber nicht einmal der Gesundheitsminister würde das wirklich zugeben. Es ist eine Katastrophe, was sich hier in dieser Republik abspielt. Da geht es nur um Druck und um Zwang, das ist das Einzige, was Sie auf die Bürger draußen ausüben wollen, und genau so stellen sich die Gesetze dar.
Was wir jetzt heute hier herinnen alles nicht diskutieren, weil es für Schwarz und Grün nicht interessant ist, betrifft zum Beispiel einen Antidiskriminierungsantrag für Personen, die gehörlos sind. Da ging es darum, dass nicht nur der Gehörlose selbst die Maske soll runternehmen dürfen, sondern natürlich auch sein Begleiter, damit sie sich unterhalten können – dieser Antrag ist nicht wichtig, den braucht man nicht. Von Grün und Schwarz gibt es in dieser Hinsicht für Menschen mit schwerer Hörbehinderung oder für Gehörlose keine Unterstützung, das braucht man nicht!
Es betrifft auch einen weiteren Antrag, der von uns gekommen ist: Da geht es um ein Verbot der Diskriminierung von ungeimpften Menschen. Na um Gottes willen, Ungeimpfte
sind ja sowieso die Schwerstverbrecher in dieser Republik – genau so haben Sie argumentiert und aus genau diesem Grund ist das alles vertagt worden. Ihnen geht es hier ja gar nicht um ehrliche Politik.
Meine Vorrednerin hat gesagt: Wir haben so viel zusammengebracht! – Ja, Frau Kollegin, auf die Schnelle könnte man diesen Eindruck gewinnen, denn es gibt ja ganz tolle Studien. Allerdings wurden all diese Studien vom Institut Karmasin erstellt und dann großartig in den Medien veröffentlicht, wahrscheinlich im Zuge Ihrer Medienkooperationen. Da wird noch so viel rauskommen, meine Damen und Herren!
Wenn Sie sich am Wochenende gefordert gefühlt haben, dann ist das Ihr Problem. Da sind wir nicht alle gemeinsam gefordert, sondern das ist ein Problem der Österreichischen Volkspartei. Sie haben einen Messias groß gemacht, Sie sind ihm alle nachgehoppelt, obwohl Sie wahrscheinlich schon geahnt haben, dass da nicht alles ganz supersauber ist, und jetzt müssen Sie nun einmal mit den Folgen leben – bitte nehmen Sie aber nicht das restliche Parlament in Geiselhaft! Das ist ein Problem der Volkspartei und nicht ein Problem des österreichischen Parlaments.
Wenn die Menschen dann irgendwann frustig und politikverdrossen sind, meine Damen und Herren der Österreichischen Volkspartei, dann ist Ihr Anteil daran mit Sicherheit überproportional groß. Daher sollten Sie endlich demütig sein und sich vielleicht auch entschuldigen. – Und anstatt dauern reinzurufen, Kollege Hörl, würde es den Vertretern der Österreichischen Volkspartei auch gut anstehen, sich hierherzustellen und sich einmal bei der österreichischen Bevölkerung für das Schauspiel, das Sie hier in den letzten Tagen abgegeben haben, auch entsprechend zu entschuldigen, und sich auch dafür zu entschuldigen, dass Sie die Leute an der Nase herumgeführt haben, dass seit 2016, 2017 die Bevölkerung wirklich manipuliert worden ist. Dafür sollten Sie sich entschuldigen, anstatt jetzt hier so präpotent reinzurufen! (Beifall bei der FPÖ.)
16.43
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Als Nächste gelangt Frau Barbara Neßler zu Wort. – Bitte sehr.
Abgeordnete Barbara Neßler (Grüne): Herr Präsident! Geschätzter Minister! Liebe Kollegen und Kolleginnen! Liebe Zuseherinnen und Zuseher! Zum Bericht zur Sonderbetreuungszeit bleibt nur so viel zu sagen, dass die Sonderbetreuungszeit natürlich absolut notwendig war und es leider wenig verwunderlich ist, dass vor allem Frauen die Sonderbetreuungszeit in Anspruch genommen haben. Wenn wir die Coronakrise in Hinblick auf die Gleichstellung untersuchen oder auswerten würden, dann braucht es, glaube ich, kein prophetisches Talent, um zu erkennen, dass die Carearbeit, die unbezahlte Arbeit vor allem die Frauen trifft.
Um an gestern anzuknüpfen: Darum ist es natürlich absolut notwendig, dass wir jetzt schnelle Sprünge nach vorne machen, gerade was die ganztägigen Schulen und Kinderbetreuungsformen anbelangt. Darum haben wir gestern auch den Antrag eingebracht. Es geht nämlich nicht nur darum, Eltern in ihren Betreuungspflichten zu entlasten, sondern auch darum, gleiche Erwerbschancen von Vätern und Müttern zu ermöglichen, und vor allem darum, das muss man schon sagen, Gleichberechtigung innerhalb der Familie herzustellen – etwas, wovon wirklich alle profitieren.
Zur Kritik im Zusammenhang mit der Sonderbetreuungszeit und mit der Freistellung für Schwangere, die wir heute beschließen, zu dieser Kritik, die ich wirklich nachvollziehen kann, nämlich zu der Forderung, dass das auch über das Ende des Jahres hinaus gelten soll, kann ich sagen: Wenn wir das über das Ende des Jahres hinaus brauchen sollten, dann werden wir das verlängern. Was ich aber traurig finde, ist die Tatsache, dass es
diese Beschlüsse heute überhaupt braucht, denn im Kampf gegen die Coronakrise könnten wir wirklich schon ein Stück weiter sein, wenn wir das alle wollten. (Beifall bei Grünen und ÖVP.)
Vor allem Schwangere sind im Fall einer Covid-Erkrankung einem erhöhten Risiko ausgesetzt, das wissen wir. Darum ist es natürlich wichtig, dass wir die Verlängerung der Möglichkeit so einer Freistellung heute beschließen. Im Übrigen haben wir schon 19 Millionen Euro an die Betriebe ausgezahlt, um die Freistellung somit unterstützen zu können.
Ich muss aber sagen, und ich kann es gar nicht oft genug betonen: Die Gefahren, die eine Covid-19-Erkrankung mit sich bringt, sind deutlich höher als etwaige Nebenwirkungen (Abg. Belakowitsch: Können Sie das belegen?), und leider setzt man sich und sein Kind einem Risiko aus, das wirklich vermeidbar wäre. (Abg. Belakowitsch: Falsch ...!)
Zur Kollegin von der FPÖ beziehungsweise zur FPÖ kann ich nur sagen: Sie könnten einen konstruktiven Beitrag leisten, indem sich Personen aus Ihrer Partei herausstellen würden und sagen würden, warum sie sich haben impfen lassen – um sich zu schützen. Das wäre ein konstruktiver Beitrag, eine Vorbildwirkung, und gerade wenn es von Ihnen käme (neuerlicher Zwischenruf der Abg. Belakowitsch), wäre das etwas sehr Konstruktives im Kampf gegen die Pandemie, denn dass Sie munter sind, sehen wir jetzt alle. (Beifall bei Grünen und ÖVP.)
Ich sage euch ganz ehrlich, die Zahlen aus dem Gesundheitsministerium haben mich kurz sprachlos werden lassen. Von Jänner bis August dieses Jahres mussten in Österreich 152 Babys – erstes Lebensjahr – wegen Covid behandelt werden, zehn davon mussten intensivmedizinisch betreut werden, und das ist ein Wahnsinn! Ich bin überzeugt davon, dass es Eltern nicht egal ist, dass ihre Kinder gleich zu Beginn ihres Lebens einer Covid-Infektion ausgesetzt sind und möglicherweise auch an Long Covid erkranken. Dazu kommt – das muss man leider auch sagen –, dass es Studien gibt, die zeigen, dass es bei einem schweren Covid-Verlauf zu Totgeburten kommen kann.
Auch wenn andere das Gegenteil behaupten, gibt es wohl keine Impfung, die wissenschaftlich in kürzester Zeit so gut untersucht worden ist wie die Covid-Impfung. (Abg. Belakowitsch: Wissenschaftlich gut ...!) Daher appelliere ich wirklich: Hören wir bitte auf die Experten und Expertinnen, die ganz klar eine Empfehlung dafür ausgesprochen haben, dass sich schwangere Frauen impfen lassen sollen, dass sich auch Frauen mit Kinderwunsch dringend impfen lassen sollen, und hören wir nicht auf Personen ohne Fachwissen, die irgendwelche Horrorszenarien verbreiten! – Danke. (Beifall bei Grünen, ÖVP und SPÖ.)
16.48
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordnete Fiedler. – Bitte sehr.
Abgeordnete Fiona Fiedler, BEd (NEOS): Herr Präsident! Werte Minister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuseherinnen und Zuseher zu Hause! (Die Begrüßung auch in Gebärdensprache ausführend:) Liebe gehörlose Menschen! Mit der Verlängerung der Sonderfreistellung für Schwangere reparieren wir heute wieder einen Teil des Versagens der Bundesregierung.
Seit Mai dieses Jahres ist es für Schwangere möglich, sich impfen zu lassen – demnach haben wir auch genug Impfstoff, wir haben Gott sei Dank sogar so viel Impfstoff, dass wir ihn an andere Länder weitergeben können –, und im Juni hat Minister Mückstein mitgeteilt, dass alle Impfwilligen bis September geimpft sein werden. Daher ist diese
Fristverlängerung über den September hinaus für uns ein Sonderurlaub nur für impfunwillige Schwangere. Ich frage Sie daher: Wie kommt der Steuerzahler dazu, das zu finanzieren?
Ähnlich verhält es sich mit der Sonderbetreuungszeit. Die Bundesregierung hat es nicht geschafft, eine so hohe Impfquote zu erzielen, dass wir keine Einschränkungen mehr brauchen. Daher müssen wir die Sonderbetreuungszeit wieder verlängern. Vielleicht wäre es an dieser Stelle schlau, die Apotheker doch ins Boot zu holen, um ein niederschwelliges Impfangebot zu erreichen. (Beifall bei den NEOS.)
Da wir es aber bei den Erwachsenen nicht schaffen, diese Impfquote zu erreichen – wir liegen derzeit bei 61,6 Prozent –, legen wir den Fokus auf die Schulen. Die Schulen werden mit Regeln und Maßnahmen überschüttet, und das betrifft Direktorinnen und Direktoren, Lehrerinnen und Lehrer, Kinder und Eltern. So versuchen Sie, die Pandemie über die Kinder zu bekämpfen.
Die ersten Schulwochen haben das eindrucksvoll gezeigt: Es waren mehrere Hundert Schulklassen in Quarantäne, zuerst zehn Tage, dann nur mehr fünf, denn sonst wären wieder alle zu Hause gewesen. Das ist eine Zumutung für Kinder und Eltern, aber auch für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber.
Dänemark hat schon lange keine Einschränkungen mehr, Norwegen und die Schweiz schonen zumindest die Kinder und lassen sie in Ruhe. Wir liegen bei den Schulschließungen im Spitzenfeld, die Schweiz, mit vermutlich ähnlichen Herausforderungen, wie wir sie haben, hat nur sechs Wochen Schulschließungen gehabt.
Volker Strenger, der Chefinfektiologe der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde, hat am 20.9. im „Standard“ zu mehr Gelassenheit aufgerufen, da die Kinder eben nicht so stark betroffen sind und die Schulschließungen viel schlimmere Nachwirkungen haben.
Die Kinder zahlen den Preis für die verfehlte Impfpolitik der Bundesregierung. Das Pandemiemanagement über die Kinder zu machen funktioniert nicht und ist unserer Meinung nach unverantwortlich. Dass die Bevölkerung nach 19 Monaten Pandemiemissmanagement nun skeptisch ist und Sorge um die Bildung ihrer Kinder hat, zeigen ja die Schulabmeldungen. – (Den Dank auch in Gebärdensprache ausführend:) Danke. (Beifall bei den NEOS.)
16.51
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesminister Kocher. Ich darf ihm das Wort erteilen. – Herr Bundesminister, das Wort steht bei Ihnen.
Bundesminister für Arbeit Mag. Dr. Martin Kocher: Sehr geehrter Herr Präsident! Kollege Mückstein! Werte Abgeordnete! Hohes Haus! Die Pandemie hat für alle in Österreich zu Schwierigkeiten und großen Problemen geführt, insbesondere natürlich am Arbeitsmarkt, bei arbeitenden Menschen, Müttern, Vätern, Familien; das wurde alles angesprochen.
Die Impfung ermöglicht es uns jetzt glücklicherweise, in gewissen Bereichen wieder zu einer Normalität zurückzukehren. Ich rufe noch einmal alle dazu auf, verantwortlich und vernünftig mit dieser Möglichkeit umzugehen, weil es für diesen Winter wichtig sein wird. Wir haben uns zwar am Arbeitsmarkt weitgehend von der Pandemie erholt (Zwischenruf der Abg. Belakowitsch), wir haben wieder eine Arbeitsmarktlage, die besser ist als 2019 – dazu werde ich beim nächsten Tagesordnungspunkt etwas sagen –,wir müssen uns aber auf die Zeit im Winter vorbereiten, wenn die Infektionslage möglicherweise wieder etwas schlechter sein wird. Diese Vorbereitung umfasst zwei Maßnahmen, die heute beschlossen werden sollen.
Die erste Maßnahme betrifft die Sonderbetreuungszeit. Da geht es um berufstätige Eltern und die Verlängerung des Rechtsanspruchs auf Sonderbetreuungszeit. Im Gegensatz zu vielen öffentlichen Aussagen, zum Teil auch hier im Parlament, bestand für einen Elternteil, wenn es keine andere Möglichkeit gab, immer ein Anspruch auf eine Dienstfreistellung, wenn ein Kind in Quarantäne musste. Allerdings ist die Sonderbetreuungszeit – mit dem Rechtsanspruch seit letztem Jahr und mit der vollständigen Bezahlung für die Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen seit November 2020 – die einfachste Möglichkeit, das zu tun. Sie löst keine Streitigkeiten zwischen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern auf der einen Seite und Arbeitgeber, Arbeitgeberin auf der anderen Seite aus.
Insofern freut es mich sehr, dass es uns gelungen ist, diese Regelung betreffend Sonderbetreuungszeit rückwirkend – auch da gab es verfassungsrechtliche Bedenken – mit 1.9. wieder in Kraft zu setzen. Das heißt, alle Eltern haben rückwirkend mit 1.9.2021 einen Rechtsanspruch auf Sonderbetreuungszeit. Natürlich werden wir das weiterhin beobachten und schauen, ob es notwendig ist, diesen Rechtsanspruch zu verlängern. Im Moment läuft er bis 31.12.2021. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
Die Sonderfreistellung für Schwangere soll ebenfalls bis Ende des Jahres verlängert werden – das ist die zweite Maßnahme. Als Arbeitsminister ist mir der Schutz von Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern am Arbeitsplatz immer wichtig, insbesondere natürlich von schwangeren Arbeitnehmerinnen. Angesichts der Lage in der Pandemie wollen wir ungeimpfte Schwangere auch weiterhin keinem gesundheitlichen Risiko am Arbeitsplatz aussetzen.
Das ist wichtig, weil die Schutzimpfung für Schwangere erst seit Mai zugelassen ist, erst seit einigen Wochen auch empfohlen ist und es bei Schwangeren eine viel stärkere individuelle medizinische Einschätzung gibt, was diese Schutzimpfung betrifft. Die Impfung ist sicher, es gibt die Empfehlung nicht nur in Österreich, es gibt sie auch vonseiten der Ständigen Impfkommission in Deutschland. Allerdings gibt es eben noch ungeimpfte Schwangere in körpernahen Berufen – das wird jetzt durch diese Maßnahme abgedeckt –, das sind zum Beispiel Kosmetikerinnen, Friseurinnen, Masseurinnen oder Kindergartenpädagoginnen. Wichtig ist auch da, dass die Betriebe Sicherheit haben, dass die Kosten für die Freistellung zu 100 Prozent rückerstattet werden.
Sehr geehrte Damen und Herren! Mit den beiden genannten Maßnahmen leisten wir einen erheblichen Beitrag zum Schutz und zur Unterstützung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in diesen Pandemiezeiten und stellen sicher, dass es durch behördliche Maßnahmen, die manchmal notwendig sind, keine Einschränkungen oder zusätzlichen Schwierigkeiten geben wird.
Mir ist natürlich klar, dass es in jedem Fall gerade bei Kindern, die in Quarantäne müssen, ohnehin genug Schwierigkeiten gibt. Wir versuchen, alles zu tun, um zumindest die finanziellen Schwierigkeiten und die Schwierigkeiten mit dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin am Arbeitsplatz so gering wie möglich zu halten. – Vielen Dank. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
16.56
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Pöttinger. – Bitte.
Abgeordneter Laurenz Pöttinger (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Gesundheitsminister! Herr Arbeitsminister! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Hätten Sie vor einem halben Jahr geglaubt, dass wir jetzt im Oktober de facto Vollbeschäftigung haben? (Zwischenruf der Abg. Belakowitsch.) Hätten Sie vor einem halben Jahr gedacht, dass wir wieder einen derart großen Wirtschaftsaufschwung verspüren?
Ja, das haben wir vielen Menschen in unserem Land zu verdanken, und offenbar haben auch wir im Hohen Haus viele richtige Entscheidungen getroffen. Offenbar hat auch die Regierung hervorragend gearbeitet, sonst wären wir – im internationalen Vergleich – nicht so gut durch diese Krise gekommen. Ohne unser hervorragendes Gesundheitssystem und ohne die Impfbereitschaft der Menschen in unserem Land hätten wir das aber nicht geschafft. – Danke dafür. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.) All jene, die sich noch nicht für eine Impfung entscheiden konnten, möchte ich bitten, diesen Schritt nachzuholen, um unser aller Lebensqualität weiter steigern zu können. (Beifall bei der ÖVP sowie der Abgeordneten Maurer und Scherak.)
Nun zur Sonderbetreuungszeit: Wir haben jetzt schon viel darüber gehört. Ich möchte nur erwähnen, dass wir da schon über 27 000 Personen helfen konnten. Ich glaube, es ist sehr gut, dass wir damals, im November, auch den Unternehmerinnen und Unternehmern 100 Prozent Erstattung haben zuteilwerden lassen, denn es ist nicht einfach für einen Betrieb, alle Fäden richtig zu ziehen und die Arbeitskräfte zu ersetzen. Auch das ist, glaube ich, sehr gut gelungen. Frau Kollegin Belakowitsch, es ist nicht immer Druck, den man ausüben muss, sondern die Regierung sieht es sehr wohl, wenn es notwendig ist, eine Maßnahme zu verlängern. Das werden wir auch tun, wenn es so weit ist. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen. – Abg. Belakowitsch: Ja, ein bissel Druck habts schon gebraucht!)
Einige Sätze noch zum Antrag betreffend Energiearmut, den wir in Kürze im Ausschuss für Wirtschaft, Industrie und Energie behandeln werden: Gott sei Dank ist die Energiearmut in Österreich, vor allem auch im internationalen Vergleich, wenig verbreitet – das hat E-Control Austria vor Kurzem festgestellt. (Zwischenruf der Abg. Belakowitsch.) Ja, es stimmt aber: Wir werden mit Bedacht auf die betroffenen Menschen auch darauf achten müssen, dass die ökologische Wende gelingt. Die Anreize für die Umstellung auf erneuerbare Energieformen müssen so attraktiv sein, dass es zum Beispiel auch den Vermietern möglich ist, die notwendigen Investitionen zu tätigen. Nur so wird es gelingen, leistbare Energie für die Mieter zur Verfügung stellen zu können.
Finanzminister Blümel hat es heute in der Budgetrede schon erwähnt: Anreize statt Strafen, ein Budget und eine Steuerreform, die Aufschwung, Stabilität und Nachhaltigkeit sichern. – Danke an all jene hier im Hohen Haus, die diesen Weg unterstützen!
Ein Wort noch an Abgeordneten Kollross – ich hoffe, er ist hier, sonst richten Sie es ihm bitte aus –: Sie haben die Wahl in Oberösterreich erwähnt. Da Sie Niederösterreicher sind, sei es Ihnen verziehen, dass Sie über die Oberösterreichwahlen schlecht informiert sind. Sie sagten in Anspielung auf die Bundes-ÖVP, „überall müssen die ÖVP-[...]Bürgermeister den Hut nehmen“. (Zwischenruf der Abg. Cornelia Ecker.) – Ich berichtige in meiner Rede hier tatsächlich: Die ÖVP stellt nun mehr Bürgermeisterinnen und Bürgermeister als nach der letzten Wahl 2015. Ich erinnere an die Stadt Traun, welche die fünftgrößte Stadt in Oberösterreich ist, wo es bis jetzt einen SPÖ-Bürgermeister gegeben hat, der nun durch einen ÖVP-Bürgermeister abgelöst wurde. Ich erinnere an Andorf, ich erinnere an Altmünster und ich erinnere an Mattighofen. Übrigens stellt die ÖVP drei Viertel aller Bürgermeister in Oberösterreich, und Oberösterreich fährt sehr gut damit. – Danke sehr. (Beifall bei der ÖVP.)
17.01
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordnete Nussbaum. – Bitte sehr, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete Mag. Verena Nussbaum (SPÖ): Herr Präsident! Geschätzter Herr Minister! Hohes Haus! Auch ich möchte mich jetzt zur Energiearmut, besser gesagt zur
Bekämpfung der Energiearmut, zu Wort melden, denn ich finde, für ein Land wie Österreich ist es eine Schande, dass wir uns hier herinnen bei Themen wie Armutsbekämpfung noch immer uneinig sind.
Seit Monaten ist klar, dass die Energiepreise extrem steigen werden, und die Bundesregierung sieht einfach nur zu, ohne Maßnahmen zu treffen. Da geht es nicht um erneuerbare Energien. Da geht es darum, dass ExpertInnen damit rechnen, dass spätestens nach dem Jahreswechsel für KonsumentInnen spürbare Preissteigerungen erfolgen werden – bis zu 500 Euro im Jahr als Zusatzbelastung für einen durchschnittlichen Haushalt.
Viele andere europäische Länder wie zum Beispiel Spanien und Frankreich haben da bereits Maßnahmen gesetzt. Unsere Bundesregierung ist bislang untätig geblieben. Für einen Großteil der Menschen in Österreich werden 500 Euro für Strom- und Heizkosten zu einer unmöglichen finanziellen Belastung. Es ist unsere Aufgabe als Nationalrat, die Menschen in Österreich davor zu bewahren, dass sie diesen Winter ihre Wohnung nicht heizen können beziehungsweise die Energiekosten für die Versorgung ihrer täglichen Bedürfnisse nicht bezahlen können.
Wir als SPÖ fordern die Bundesregierung dringend auf, rasch wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die Bevölkerung vor zusätzlichen Kosten zu bewahren. Wir haben bereits eine zeitlich befristete Senkung der Mehrwertsteuer auf Strom und Gas und einen einmaligen Winterzuschuss für niedrige Einkommen in Höhe von 300 Euro vorgeschlagen, um die Menschen davor zu bewahren, durch die hohen Energiekosten in die Armut zu schlittern.
Auch bei der geplanten Steuerreform, die alles andere als sozial ist, wurden vor allem jene Menschen wieder nicht bedacht, die aufgrund ihres niedrigen Einkommens ohnehin keine Steuern zahlen. Das sind zum Beispiel Langzeitbeschäftigungslose, das sind auch jene, die von Preissteigerungen bei den Energiekosten am meisten getroffen werden. So verfestigt sich die Armut dieser Menschen weiter, vor allem im Hinblick auf die Langzeitbeschäftigungslosen. Das sind derzeit rund 165 000 Menschen in Österreich, die von der Notstandshilfe leben. Diese beträgt im Durchschnitt 1 000 Euro pro Monat, damit müssen sie auskommen.
Die Zahl der Menschen in Österreich, die von einer mehr als zwei Jahre dauernden Arbeitslosigkeit betroffen sind, hat sich bei den über 45-Jährigen seit 2008 vervierfacht, die Arbeitslosigkeit hat sich durch die Coronapandemie noch weiter verstärkt. Trotzdem schaut die Bundesregierung weg und lehnt jegliche konstruktiven Vorschläge für eine aktive Arbeitsmarktpolitik ab. (Beifall bei der SPÖ.)
Für mich ist es unfassbar, dass dieser Antrag, der zum Ziel hat, die Energiearmut zu bekämpfen, von den Regierungsparteien abgelehnt wird. Von der ÖVP sind wir es ja mittlerweile schon gewohnt, dass sie Politik nicht für die Menschen in unserem Land, sondern nur für die Konzerne macht, ich vermisse aber das soziale Gewissen bei den Grünen, das offensichtlich auch nicht mehr vorhanden ist. – Danke schön. (Beifall bei der SPÖ.)
17.04
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Angerer. – Bitte sehr.
Abgeordneter Erwin Angerer (FPÖ): Herr Präsident! Geschätzte Herren Minister! Hohes Haus! Geschätzte Damen und Herren! Kollege Pöttinger hat gerade vorhin den in diesem Paket inkludierten Antrag betreffend Energiearmut angesprochen. Kollege Pöttinger hat gemeint: Hätten Sie vor einem Jahr gemeint, dass wir heute wieder so eine
Beschäftigung haben? – Jetzt muss ich Sie fragen, Herr Pöttinger: Hätten Sie vor einem Jahr gemeint, dass wir heute Stromkosten und Gaskosten haben, die explodieren? Hätten Sie vor einem Jahr gemeint, dass wir eine Inflation von 3,2 Prozent haben? Hätten Sie vor einem Jahr gemeint, dass sich Leute in Österreich das Heizen und den Strom nicht mehr leisten können? Hätten Sie das gemeint? (Zwischenruf des Abg. Eßl.)
Sie meinen aber offensichtlich: Es gibt wenige, die das in Österreich betrifft. Jetzt schauen wir einmal: Wie wenige sind denn das? Es gibt aktuelle, sogenannte Armutszahlen von der Armutskonferenz: 17,5 Prozent der österreichischen Bevölkerung, das sind rund 1,5 Millionen Menschen, sind „armuts- oder ausgrenzungsgefährdet“. 13,9 Prozent, das sind 1,2 Millionen Menschen, sind „armutsgefährdet“, das heißt, sie leben von einem Einkommen unter der Armutsgrenze. 2,7 Prozent der österreichischen Bevölkerung, das sind immer noch 233 000 Menschen, sind „erheblich materiell depriviert“ und können sich Waschmaschine, Handy, Wohnung und die Wohnung angemessen warm zu halten nicht mehr leisten.
Das sind für Sie offensichtlich wenige. 1,5 Millionen Menschen sind wenige. Auch wenn es nur 230 000 sind: Für mich sind das sehr viele, es sind zu viele, und deshalb haben wir auch diesen Antrag eingebracht, denn wie sollen sich diese Menschen in Zukunft Strom, Energie und das Heizen leisten, wenn das – wie wir jetzt wissen – pro Haushalt rund 400 bis 500 Euro ausmachen wird? Wie sollen sie sich das leisten? Ich verstehe ja vielleicht noch, dass euch von der ÖVP das egal ist, aber dass den Grünen das auch wurscht ist - - Ihr müsst euch ja wirklich in Grund und Boden schämen! Was würde da ein Rossmann oder ein Pilz sagen, wenn ihr euch da herinnen so verhaltet? Das ist euch offensichtlich egal, wie es diesen Menschen geht.
Jetzt verschiebt ihr einen Antrag aus dem Sozialausschuss in den Wirtschaftsausschuss. Was werdet ihr dann im Wirtschaftsausschuss damit tun? Stimmt ihr ihm dann zu? Ihr habt ihn heute schon einmal abgelehnt. – Herr Pöttinger, stimmt ihr im Wirtschaftsausschuss dem zu, dass man diesen Menschen hilft, dass diese Menschen im Winter ihre Wohnung heizen können, dass diese Menschen am Abend das Licht einschalten können, oder lehnt ihr den Antrag dort ab? Oder grabt ihr ihn dort mit einer entsprechenden Vertagung ein? Das würde mich interessieren, Herr Pöttinger. – Danke schön. (Beifall bei der FPÖ.)
17.08
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist damit geschlossen.
Wird seitens der Berichterstatter ein Schlusswort gewünscht? – Das ist nicht der Fall.
Wir verlegen die Abstimmung an den Schluss der Verhandlungen über die Vorlagen des Ausschusses für Arbeit und Soziales.
Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 44/A(E) der Abgeordneten Josef Muchitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend rasche Umsetzung eines Arbeitsmarktpaketes (1087 d.B.)
18. Punkt
Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 628/A(E) der Abgeordneten Josef Muchitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend arbeitsmarktpolitische Sofortmaßnahmen zur Beschäftigungsförderung (1088 d.B.)
19. Punkt
Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 1878/A(E) der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend Ausstieg aus der Corona Kurzarbeit (1089 d.B.)
20. Punkt
Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 1880/A(E) der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend Refundierung der überhöhten AK-Beiträge bei Kurzarbeit (1090 d.B.)
21. Punkt
Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 905/A der Abgeordneten Josef Muchitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 geändert wird (1091 d.B.)
22. Punkt
Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 1201/A der Abgeordneten Josef Muchitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 geändert wird (1092 d.B.)
23. Punkt
Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 1436/A der Abgeordneten Josef Muchitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 geändert wird (1093 d.B.)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Wir kommen zu den Tagesordnungspunkten 17 bis 23, über welche die Debatten wieder unter einem durchgeführt werden.
Es sind dies Berichte des Ausschusses für Arbeit und Soziales; hinsichtlich der einzelnen Ausschussberichte verweise ich auf die Tagesordnung.
Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Stöger. – Bitte sehr. Das Wort steht bei dir, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Alois Stöger, diplômé (SPÖ): Herr Präsident! Herr Arbeitsminister! Hohes Haus! Meine sehr verehrten Damen und Herren! – Herr Bundesminister, wie geht es Ihnen heute? Wir haben eine Budgetrede gehört, und da hat der Finanzminister zum Thema Arbeit außer einer Floskel nichts gesagt. Wenn man sich das Arbeitsmarktbudget anschaut, dann merkt man, dass da eigentlich wenig Geld da ist und außer ein paar Überschriften vor allem keine Maßnahmen beschrieben sind, die im Bereich der Arbeitsmarktpolitik eine Rolle spielen.
Es ist richtig – und darüber sind wir alle miteinander froh –, dass sich jetzt, auch ausgelöst durch Corona, die Arbeitsmarktsituation massiv verbessert hat. Das ist gut so. Wir haben aber das Problem, dass gerade um die 120 000 Menschen langzeitarbeitslos sind, und genau für diese Menschen muss die Regierung etwas tun. Das sind jene Menschen, die ganz besonders armutsgefährdet sind. Da braucht es Beschäftigungsprojekte, da braucht es Maßnahmen, um diese Menschen in den Arbeitsmarkt einzugliedern. (Zwischenruf des Abg. Zarits.) Ich kann Ihnen ein gutes Beispiel sagen: Nachdem
wir 2017 mit der Aktion 20 000 begonnen hatten, ist im folgenden Jahr die Arbeitslosigkeit von Menschen, die langzeitarbeitslos oder über 50 waren, massiv zurückgegangen, und auf solche Maßnahmen warten die Betroffenen bis jetzt vergebens. (Abg. Zarits: Aktion Sprungbrett!)
Wir haben sehr deutlich gesagt, dass wir eine Arbeitsmarktpolitik brauchen, die auch wirkt – und wenn hier ein Abgeordneter meint, mit der Aktion Sprungbrett brächte man etwas zusammen (Abg. Zarits: 50 000!): Seien Sie vorsichtig, denn wenn man hinunterspringt, obwohl kein Wasser im Pool ist, ist das Sprungbrett nicht sehr geeignet. Ich würde ersuchen, in diesem Bereich wirklich etwas zu tun!
Wir als Sozialdemokratie haben auch eine erhöhte Auszahlung der Notstandshilfe – in der Höhe des Arbeitslosengeldes – gefordert; auch das ist von den Regierungsparteien abgelehnt worden.
In Wirklichkeit kann man zusammenfassen: Die Arbeitnehmer haben von Türkis-Grün nichts zu erwarten, vor allem jene Menschen nicht, die von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind. Oft sind das Menschen, die schon älter sind und die auch gesundheitliche Einschränkungen haben.
Aus diesem Grund bringe ich folgenden Antrag ein:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Alois Stöger, diplômé, Kolleginnen und Kollegen betreffend „finanzielle Hilfe für Menschen, die schon lange arbeitslos sind“
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Der Bundesminister für Arbeit wird aufgefordert, unverzüglich zu handeln und die Regelung, wonach die Notstandshilfe in Höhe des zuvor geleisteten Arbeitslosengeldes zumindest vorerst bis zum 30. Juni 2022 verlängert wird, dem Nationalrat zur Beschlussfassung zuzuleiten.“
*****
Herzlichen Dank. (Beifall bei der SPÖ.)
17.12
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Stöger,
Genossinnen und Genossen
betreffend finanzielle Hilfe für Menschen, die schon lange arbeitslos sind
eingebracht im Zuge der Debatte zum Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 1436/A der Abgeordneten Josef Muchitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 geändert wird (1093 d.B.) – Top 23
Vordergründig hat sich die Situation am Arbeitsmarkt entspannt, die Arbeitslosenzahlen sind fast auf Vorkrisenniveau gesunken. Schaut man aber genau hin, erkennt man, dass Menschen, die länger als ein Jahr arbeitslos sind, nach wie vor geringere Jobchancen haben.
Heute haben rund 120.000 Personen eine AMS-Geschäftsfalldauer von mehr als 365 Tagen und zusätzlich 45.000 solcher Arbeitsloser befinden sich in Schulungen. Das sind noch immer deutlich mehr, als vor Ausbruch der Pandemie. Die Krise hat das Risiko, dass sich bei vielen Personen die Arbeitslosigkeit verfestigt, erhöht.
Heute machen die Langzeitarbeitslosen unter den Gesamtarbeitslosen einen Anteil von mehr als 48 Prozent aus. Das bedeutet, jeder 2. Arbeitslose ist bereits länger als 12 Monate arbeitslos oder in Schulung. 2019 lag der Anteil noch bei 32,7 Prozent!
Hinzu kommt, dass Langzeitbeschäftigungslose sehr häufig über 50 Jahre alt sind. In vielen Studien wurde bereits nachgewiesen, dass ältere Personen, die einmal arbeitslos werden, ein hohes Risiko haben, von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen zu sein. Gleichzeitig sinkt auch die Chance, wieder in eine dauerhafte Beschäftigung zu kommen.
Die Armutsgefährdung in dieser Gruppe steigt enorm. Die Regierung verabsäumt es auch, durch wirklich wirksame Beschäftigungsprojekte jetzt steuernd in den Arbeitsmarkt einzugreifen. Es muss den Betroffenen daher rasch zumindest finanziell geholfen werden.
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher nachfolgenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Der Bundesminister für Arbeit wird aufgefordert, unverzüglich zu handeln und die Regelung, wonach die Notstandshilfe in Höhe des zuvor geleisteten Arbeitslosengeldes zumindest vorerst bis zum 30. Juni 2022 verlängert wird, dem Nationalrat zur Beschlussfassung zuzuleiten.“
*****
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Der Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht, auch ausreichend unterstützt und steht somit mit in Verhandlung.
Zu Wort gemeldet ist nun Herr Abgeordneter Michael Hammer. – Bitte sehr, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Mag. Michael Hammer (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Geschätzte Zuseher! Wir diskutieren unter diesen Tagesordnungspunkten eine Reihe von Anträgen, die sich mit dem Arbeitsmarkt und der Arbeitsmarktpolitik beschäftigen. Wir haben jetzt im Vorspann wieder die ewige Schallplatte des Kollegen Stöger gehört, die er ja schon seit vielen Jahren abspielt – wir haben da gänzlich andere Zugänge und auch wirksamere Maßnahmen, als die SPÖ sie vorschlägt. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Heinisch-Hosek: ... ist keine Schallplatte! ... despektierlich!)
Weil immer wieder darüber diskutiert wird, warum in manchen Ausschüssen Anträge vertagt werden, möchte ich eingangs Folgendes festhalten: Bei den Anträgen der SPÖ ist das logisch und sinnvoll. Ihr seht ja nicht einmal ein, dass die Maßnahmen, die ihr vorschlagt, in vielen Bereichen so gar nicht mehr notwendig sind, weil sich der Arbeitsmarkt erfreulicherweise sehr positiv entwickelt hat. Ihr bringt trotzdem die Murmeltieranträge immer wieder ein und nehmt nicht zur Kenntnis, dass sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt erfreulicherweise deutlich gebessert hat. (Beifall bei der ÖVP.)
Herr Bundesminister Kocher hat gestern die neuen Arbeitsmarktzahlen vorgestellt, ich möchte aber auf die Zahlen gar nicht eingehen, denn ich glaube, der Herr Minister wird sich diesbezüglich selber noch zu Wort melden. Wir sind jedenfalls bei den Arbeitslosenzahlen jetzt schon unter Vorkrisenniveau, also niedriger als im Jahr 2019. Das ist einfach auch ein Zeichen dafür, dass die von uns gesetzten Maßnahmen wie Kurzarbeit, Wirtschaftshilfen, aber auch die Stundungen die Betriebe und die Mitarbeiter gut durch die Krise gebracht haben. Es gibt eine hohe Dynamik und eine gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt.
Der springende Punkt ist – und das ist auch das, was den Erfolg auf dem Arbeitsmarkt bringt –, dass die gesetzten Maßnahmen auch entsprechend erfolgreich sind, ob das jetzt die Qualifizierung ist, ob das die Coronajoboffensive ist oder ob das die sehr sinnvolle und gute Aktion Sprungbrett ist, die bei den Langzeitarbeitslosen wichtige Verbesserungen bringt. (Abg. Heinisch-Hosek: Warum haben wir dann ...?)
Ich möchte eines noch dazusagen – weil Sie das immer so dramatisieren (Abg. Heinisch-Hosek: Nein, das ist die Wahrheit!); der Herr Bundesminister hat es auch ganz klar ausgeführt –: Jeder und jede Arbeitslose bekommt ein Angebot seitens des Arbeitsmarktservice (Zwischenruf der Abg. Heinisch-Hosek) – ob das jetzt ein Stellenangebot ist, ob das eine Qualifizierungsmaßnahme im Rahmen der Coronajoboffensive oder eine Vermittlung über die Aktion Sprungbrett für Langzeitarbeitslose ist, die entsprechend sinnvoll ist. Das ist der richtige Weg – und nicht diese öffentlichen Scheinjobs, die die SPÖ immer schaffen will, denn das ist nicht das, was wir brauchen. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Heinisch-Hosek: Keine Ahnung!)
Ja, Frau Kollegin Heinisch-Hosek – weil Sie immer wieder Zwischenrufe tätigen –, unser Zugang ist ganz einfach, dass diejenigen, die arbeiten können, auch arbeiten müssen und dass wir die auch entsprechend vermitteln. (Ruf bei der SPÖ: Wo ist denn der Kurz eigentlich? – Heiterkeit bei der SPÖ.) Euer Ansatz ist, dass man speziell bei Arbeitslosigkeit die Leistungen noch erhöhen soll – das ist nicht der Zugang, mit dem wir zusätzlich Menschen in Beschäftigung bringen.
Diese unsägliche Aktion 20 000 hat außer viel Bürokratie nichts gebracht, Herr Kollege Stöger. (Abg. Heinisch-Hosek: ... war sehr erfolgreich!) Jetzt habt ihr die Zahl auf 40 000 verdoppelt, und jetzt könnte man sagen, das macht es nicht gescheiter oder es ist ein doppelt so großer Blödsinn, aber es ist auf jeden Fall eine sinnlose Maßnahme. (Abg. Heinisch-Hosek: Hallo! – Ruf: Herr Präsident, schlafen wir ...?!)
Wir werden diesem Vorschlag also nicht nähertreten, weil wir mit der Aktion Sprungbrett schon in genau diesem Bereich ansetzen, und die Maßnahmen, die der Herr Bundesminister und die Bundesregierung setzen, sind zielführend. (Zwischenruf bei der SPÖ.)
Wir lehnen Ihre Anträge jetzt ab, denn ewig zu vertagen bringt nichts, weil sich die Situation schon gebessert hat. Ihr werdet sie aber eh wieder einbringen, und dann werden wir sie wieder ablehnen. – Danke sehr. (Beifall bei der ÖVP. – Ruf bei der SPÖ: ... Korruption!)
17.16
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist nun Frau Abgeordnete Belakowitsch. – Bitte sehr, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete Dr. Dagmar Belakowitsch (FPÖ): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Wenn man Ihnen zugehört hat, Kollege Hammer, dann muss einem wirklich übel werden, vor allem jenen Menschen, die daheim sitzen und viele Bewerbungen geschrieben haben, teilweise aber nicht einmal Antworten bekommen. Dann stellen Sie sich hier ans Rednerpult und sagen: Es bekommt eh jeder Arbeitslose ein Angebot, entweder einen
Job oder eine Qualifizierungsmaßnahme, es ist eigentlich eh alles wunderbar! Kollege Pöttinger hat ja vorhin erklärt, es gäbe de facto Vollbeschäftigung – ich glaube, auch Kollege Hanger hat das am Vormittag schon einmal gesagt, da habe ich es nicht ganz so ernst genommen, denn bei ihm wissen wir schon, dass er ein Satireprojekt ist. (Zwischenruf des Abg. Hörl.)
Meine Damen und Herren von der Volkspartei, was verstehen Sie unter Vollbeschäftigung? Wenn mehr als 300 000 Personen in unserem Land arbeitslos sind, sprechen Sie von Vollbeschäftigung?! Wenn über 120 000 Personen aufgrund Ihrer völlig sinnlosen und überzogenen Maßnahmen jetzt in Langzeitarbeitslosigkeit sind, sprechen Sie von Vollbeschäftigung?! Wir alle wissen, was Ihr Wirtschaftsbund fordert, meine Damen und Herren von der Österreichischen Volkspartei – das ist nicht der Zugang, den ich mir erwarten würde, nachdem Sie das Land so an die Wand gefahren haben!
Der Herr Bundesminister hat im Ausschuss erklärt, wie großartig sich unser Arbeitsmarkt entwickle: Ja, die Zahlen sind jetzt zurückgegangen, und ja, es gibt eine tolle Prognose – aber was er nicht gesagt hat, das ist, dass irgendwann die Steuerstundungen auslaufen. Herr Bundesminister, das haben Sie im Ausschuss nicht dazugesagt, und auch nicht, dass noch eine Welle auf uns zurollen wird, bei der es dann möglicherweise Pleiten gibt, und da wird die Arbeitslosigkeit wieder steigen.
Das, meine Damen und Herren, haben Sie alle nicht auf dem Radar, denn das passt nicht in Ihre wunderschöne Erzählung, dass in diesem Land alles wunderbar wäre. Wie es mit dieser Erzählung steht, meine Damen und Herren Kollegen von der Volkspartei, spüren aber die Bürger draußen. Sie spüren ja den Druck auf dem Arbeitsmarkt, und sie wissen ganz genau, dass das jetzt alles auf Sand gebaut ist. Die leichte Erholung ist noch nicht nachhaltig, dieser Arbeitsmarkt ist noch lange nicht nachhaltig.
Die Menschen spüren auch die Geringschätzung der Politik für die Leistungen, die sie erbringen. Wenn sie arbeitslos sind, dann werden sie von Ihnen jetzt auch noch so abgekanzelt: Na ja, wenn sie arbeiten wollen, kriegen sie eh ein Angebot – so quasi: die wollen ja nicht –, und jeder, der kann, muss! Wer bestimmt denn, wer was kann? Wer bestimmt das? Bestimmen Sie das? Bestimmt das der Herr Minister? Bestimmt das das AMS? (Ruf bei der ÖVP: Die Frau Belakowitsch!)
Oder wird das über irgendwelche menschenverachtenden Tests herausgefunden, bei denen man die Leute dann fragt: Haben Sie einen Geburtsfehler? Da sind aber auch noch ganz andere Fragen enthalten, wie: Haben Sie vielleicht eine Entzündung der Nasennebenhöhlen? Haben Sie einen Harnwegsinfekt? Irgendetwas werden dann die Leute mit Ja ankreuzen, denn irgendetwas hat jeder, akut ablaufend oder auch chronifiziert. Jeder hat etwas, und dann sind die Menschen sofort auf dem Abstellgleis – das ist die Art, wie Sie die Leute behandeln!
All jene, die sich aufgrund dieses Medienberichts gemeldet haben, all jene, die sich gemeldet haben, waren Langzeitarbeitslose, die von Ihnen dorthin geschickt worden sind – von Freiwilligkeit keine Spur, meine Damen und Herren! Ihnen wurde gesagt: Das müssen Sie jetzt machen – es steht sogar darunter –, und wenn Sie fertig sind, meldet sich Ihr Betreuer bei Ihnen!
Sie wollen die Leute kategorisieren in die Guten, die man vermitteln kann, und alle anderen, die Pech gehabt haben, wird man dann aussteuern. Das ist Ihr Zugang, und das ist abstoßend und das ist menschenverachtend, meine Damen und Herren. Anstatt dass Sie sich endlich auch einmal Gedanken darüber machen, wie wir tatsächlich in eine Situation kommen können, in der vielleicht über 50-jährige Langzeitarbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt zurückgebracht werden, setzen Sie sich hin und sagen: Alles in Ordnung, de facto Vollbeschäftigung!, meine Damen und Herren! (Ruf bei der ÖVP: ... Aktion Sprungbrett!)
Ja, Aktion Sprungbrett: Da springen die Leute auf und nieder, auf und nieder. (Abg. Gödl: Zügeln Sie Ihre Sprache!) Noch überhaupt nichts haben Sie damit erreicht. Die Aktion - - (Abg. Gödl: Zügeln Sie Ihre Sprache!) – Herr Kollege Gödl, Sie können sich ja dann hierherstellen, ich glaube, Sie sind eh eingemeldet. Erzählen Sie den Leuten von Ihren präpotenten Ansichten, die Sie über Arbeitslose haben! (Zwischenruf des Abg. Hörl.) Sie werden sich davon schon ein Bild machen. Machen Sie das, aber lassen Sie mich jetzt einmal ausreden!
Ich weiß schon: Das tut euch weh, weil ihr nämlich nicht nur im Korruptionssumpf versinkt, ihr versinkt auch in eurer eigenen Präpotenz (Zwischenruf bei der ÖVP), weil euch die Bürger im Land egal sind (Abg. Michael Hammer: ... nicht zum Aushalten!), weil euch die Arbeitslosen im Land egal sind, weil euch die Lebensbedingungen der Menschen egal sind; darum werden auch die Maßnahmen gegen Energiearmut von euch in Bausch und Bogen im Wirtschaftsausschuss abgelehnt werden. Euch ist es wurscht, wie die Lebensbedingungen da draußen sind. (Ruf bei der ÖVP: Aufhören!) Das sind spezielle Bedingungen, die schwierig sind.
Alles wird teurer, die Energie wird massiv teurer (Abg. Michael Hammer: Sollen wir Ihnen helfen?), die Fernsehgebühren werden erhöht, und ihr sitzt da in der warmen Stube und sagt: Na, dann sollen sie sich halt einen Job suchen! – Das ist nicht der Zugang von Politik. Politik hat den Menschen zu dienen und nicht umgekehrt, meine Damen und Herren. Ja, da können Sie schon grinsen, Kollege Gödl! Sie haben bis jetzt politisch nichts weitergebracht, Sie haben in der Pflege nichts weitergebracht – da kommt auch nichts, haben wir heute gehört, im neuen Budget kommt gar nichts –, Sie haben aber auch auf dem Arbeitsmarkt nichts weitergebracht, also hören Sie mit Ihrer Präpotenz auf und kommen Sie einmal ins Arbeiten für die Bürger! (Beifall bei der FPÖ. – Abg. Michael Hammer: Das ist ja nicht zum Aushalten!)
17.22
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Koza. – Bitte sehr.
Abgeordneter Mag. Markus Koza (Grüne): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Minister! Sehr geehrte Damen und Herren! Vielleicht noch einmal ganz kurz zu den konkreten und aktuellen Zahlen: Aktuell sind circa 264 000 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen, 70 000 Menschen sind in Schulungen, circa 120 000 Menschen sind langzeitbeschäftigungslos und knapp 69 000 Menschen befinden sich aktuell noch in Kurzarbeit. In Summe bedeutet das, dass wir aktuell – wie schon öfter erwähnt worden ist –, was die Arbeitslosigkeit betrifft, erfreulicherweise auf Vorkrisenniveau sind. Das ist auch deshalb sehr überraschend, weil es noch vor gar nicht allzu langer Zeit – wie Sie sich vielleicht alle noch erinnern – hieß, wir würden frühestens im Jahr 2024 das Niveau von vor Covid erreichen und die hohe Arbeitslosigkeit würde uns sehr lange begleiten.
Die Arbeitslosigkeit ist erfreulicherweise gesunken, sehr geehrte Damen und Herren, von Vollbeschäftigung sind wir allerdings noch sehr weit entfernt, weil das bei 2, 3 Prozent Arbeitslosigkeit der Fall wäre und wir jetzt, glaube ich, bei circa 6 Prozent, 6,5 Prozent liegen. Das heißt, von Vollzeitbeschäftigung sind wir noch weit entfernt, aber erfreulicherweise gibt es eine sehr positive Entwicklung. Diese positive Entwicklung zeigt letztlich einerseits, dass wir erfreulicherweise eine relativ robuste Wirtschaft haben, die diese Krise ganz gut überstanden hat, sie zeigt aber auch, dass diese Regierung offensichtlich nicht alles falsch gemacht hat, weil wir sonst nicht die entsprechenden Zahlen hätten. (Beifall bei Grünen und ÖVP.)
Diese Zahlen haben wir nicht zuletzt deshalb, weil wir in der Krise eine sehr expansive Budgetpolitik gefahren sind, weil wir in dieser Krise den Sparpfad, der uns leider in der
letzten Wirtschaftskrise 2011/2012 dramatische Arbeitslosenzahlen, einen dramatischen Anstieg an Arbeitslosigkeit gebracht hat, erfreulicherweise verlassen haben – verlassen mussten! –, die automatischen Stabilisatoren haben wirken lassen und auch den Investitionsmotor entsprechend angeworfen haben.
Die Folge war relativ klar: Es ist uns tatsächlich gelungen, in dieser Krise die Einkommen einigermaßen zu stabilisieren. Ich möchte nur daran erinnern: Wir haben einen Wirtschaftseinbruch von knapp 6 Prozent gehabt, die Einkommen der ArbeitnehmerInnen sind allerdings nur um 1,8 Prozent eingebrochen. Das sind Zahlen von der Statistik Austria, Zahlen, die sicher nicht manipuliert sind, Zahlen, die sicher nicht irgendwie umgeschrieben wurden, das sind ganz offizielle, öffentliche Zahlen der Statistik Austria. (Abg. Belakowitsch: Ah, interessant ...!)
Es war die Kurzarbeit, die da einen massiven Beitrag geleistet hat, es war die Erhöhung der Notstandshilfe – und wir haben in dieser Krise über Monate hindurch die Notstandshilfe erhöht. Ich möchte an die Krise 2008, 2011 und Folgejahre erinnern: Um wie viel Cent wurde die Notstandshilfe damals, in einer Krise, in der die Langzeitarbeitslosigkeit und die Arbeitslosigkeit dramatisch gestiegen sind, erhöht? (Abg. Hörl: Null!) – Es waren exakt 0 Cent. Um wie viel Euro wurde das Arbeitslosengeld in dieser Krise erhöht? – Es waren exakt 0 Euro. Das heißt: Wir haben in dieser Krise durchaus und ganz klar soziale Verantwortung übernommen und entsprechend auch Geld ausgegeben. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
Es geht bei der Erhöhung von Sozialleistungen und Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung ja nicht nur um die Frage der Armutsbekämpfung – die steht natürlich im Mittelpunkt, um die soziale Krise zu verhindern –, es geht auch darum, die Ökonomie, die Nachfrage und die Wirtschaft zu stabilisieren. Glücklicherweise ist dank dieser expansiven Politik die Wirtschaft auch aktuell auf einem sehr guten Weg.
Ich möchte darauf hinweisen, dass wir glücklicherweise – das haben auch das IHS und das Wifo bestätigt – diesen Pfad der expansiven Budgetpolitik auch jetzt, da der Höhepunkt der Krise hoffentlich überwunden ist, nicht verlassen haben. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir einerseits Milliarden in Klimaschutzmaßnahmen, in den Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel, in den Ausbau erneuerbarer Energien, in Althaussanierung und, und, und investieren, und andererseits die Joboffensive mit 170 Millionen Euro nach wie vor weiterlaufen lassen.
Es gibt die Aktion Sprungbrett mit 300 Millionen Euro, das ist eben eine spezielle Maßnahme für Langzeitarbeitslose, diese hat auch durchaus Anleihen an der Aktion 20 000 genommen. Tun wir doch bitte nicht immer so, als ob nur das eine das Lösungsmodell und das andere furchtbar wäre! Nein, man muss Sachen zusammen denken, zusammen durchführen, sinnvolle Elemente übernehmen und andere Elemente einfach in anderen Bereichen fortführen. Das ist schlichtweg eine Aufgabe von Politik, das ist pragmatische Politik, das ist zukunftsweisende Politik.
Wir haben 20 Millionen Euro für Arbeitsstiftungen im Bereich Umwelt und Verkehr, für das, was Just Transition heißt, damit Menschen, die bislang in Bereichen gearbeitet haben, in denen sie ihre Jobs aufgrund der Klimakrise verlieren, auf andere Bereiche umgeschult werden.
Wesentlich wird jetzt sein, dass wir diesen Weg der expansiven Budgetpolitik, der Investitionen und der aktiven Arbeitsmarktpolitik auch konsequent weiterführen, denn was nicht passieren darf, ist genau der Fehler, den wir 2011 gemacht haben: dass wir viel zu früh heruntergefahren sind. Davor möchte ich hier ausdrücklich warnen, das darf nicht passieren. Wir müssen diesen Wirtschaftsaufschwung einerseits nutzen, um Arbeitslose in Beschäftigung zurückzuführen, aber andererseits auch, um dort zu investieren, wo es sinnvoll, wo es notwendig ist.
Abschließend noch eine andere Lehre aus der Krise: Wir haben in der Krise auch erlebt, dass unser System Lücken im Sozialnetz hat. Wir haben erlebt, dass Einpersonenunternehmen, Menschen, die nicht in der Arbeitslosenversicherung waren, auf einmal vor dem Nichts gestanden sind, weil sie zu kurz arbeitslosenversichert waren, weil sie eine Jobzusage gehabt haben, diesen Job aber nicht bekommen haben, und weil sie als Einpersonenunternehmen, als Selbstständige nicht in der Versicherung drinnen waren.
Wir werden uns gerade auch im Zuge der Arbeitsmarktreform überlegen müssen, wie wir die soziale Sicherheit von Menschen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, die durch Arbeitslosigkeit gefährdet sind und die arbeitslos oder langzeitarbeitslos sind, verbessern und sie besser absichern können, weil das eine der zentralen Lehren aus der Krise ist. – Danke. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
17.28
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Loacker. – Bitte.
Abgeordneter Mag. Gerald Loacker (NEOS): Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Ich glaube, die Zahlen geben Anlass dazu, optimistisch zu sein und einmal über Chancen und nicht über Probleme zu reden. Wir haben so viele offene Stellen in Österreich wie noch nie, wir haben Jobchancen in allen Qualifikationskategorien, und das ist einmal erfreulich. Kollege Hanger hat heute Vormittag schon gesagt, es gibt Regionen, in denen haben wir mehr offene Stellen als Arbeitsuchende. – Da sind wir aber schon wieder bei einem Problem, wenn der Arbeitsmarkt das Angebot gar nicht hergibt, das eigentlich nachgefragt würde.
Jetzt ist die Frage: Wo kriegen wir das Arbeitskräftepotenzial her? – Da gibt es natürlich mehrere Ansätze (Ruf bei der ÖVP: Das ist die Frage!), manche wirken nicht gleich. Zum Beispiel würde bessere Kinderbetreuung dafür sorgen, dass Frauen mehr arbeiten gehen können, aber das wurde ja erfolgreich verhindert. (Beifall bei den NEOS. – Zwischenrufe der Abgeordneten Lausch und Rauch.)
Was auch schnell gehen würde, wäre ein Ende der Coronakurzarbeit (Zwischenruf des Abg. Lausch), weil wir da mit viel, viel Steuergeld Mitarbeiter in Jobs festhalten, in denen sie nicht mehr voll gebraucht werden. Sie würden in der nächsten Firma vielleicht voll gebraucht, und wir müssten nicht einmal Steuergeld drauflegen, sondern es käme mehr herein.
Die Kurzarbeit war am Anfang der Coronakrise superwichtig und hat gute Dienste getan, aber ihre Zeit ist abgelaufen. Sie war die teuerste Maßnahme in der Krise und jetzt hilft sie den Falschen. Unternehmen, die Logistikprobleme haben, die Probleme mit der Lieferkette haben, lassen sich jetzt vom Steuerzahler ihre Lieferkettenprobleme durch Coronakurzarbeit finanzieren. Unternehmen wie der Flughafen Wien profitieren auch von der Kurzarbeit. Ich weiß nicht, ob die Grünen das im Sinn hatten, dass sie den Flughafen und die Jobs am Flughafen retten, bis dort wieder so viel geflogen wird wie vor der Krise – kann man wollen, muss man aber nicht.
Daher sagen wir, die Coronakurzarbeit gehört gestoppt und wieder auf die Logik der alten Kurzarbeit zurückgeführt. Das sagt übrigens auch das AMS, dass viele Betriebe Probleme haben, Personal zu finden, und auch der neue Wifo-Chef Gabriel Felbermayr hat in der „Pressestunde“ darauf aufmerksam gemacht, dass jetzt die Zeit wäre, die Kurzarbeit zurückzufahren. (Abg. Hörl: Nichts Neues, Herr Loacker!) – Es ist nichts Neues, Herr Hörl, aber ihr tut es nicht, auch wenn man es euch fünfzehnmal sagt; das ist das Problem. (Beifall den NEOS.) In diesem türkisen Gehörgang ist irgendeine Bohne drin und darum kommt das nicht bis zum Hirn hin, bleibt akustisch irgendwo außen hängen; das ist das Problem. (Heiterkeit bei Abgeordneten von NEOS und SPÖ. – Zwischenrufe bei ÖVP und SPÖ.)
Wir haben noch einen Antrag eingebracht, denn wer hat von der Kurzarbeit am meisten profitiert? – Die Arbeiterkammer. Wenn nämlich jemand in Kurzarbeit war, hat der Steuerzahler dafür gesorgt, dass die Arbeiterkammer gleich viel Geld kriegt, wie wenn der Mitarbeiter voll gearbeitet hätte. (Zwischenruf des Abg. Hörl.) Jetzt war aber wenig Arbeit, weil sie auch keine Ausbildungsmaßnahmen gemacht haben und so weiter, und die Arbeiterkammern haben im vorigen Jahr einen Rekordgewinn geschrieben: 40 Millionen Euro sind denen übrig geblieben. (Neuerlicher Zwischenruf des Abg. Hörl.) Der Arbeiterkammerdirektor würde sagen: Das ist kein Gewinn, das ist ein gebarungsmäßiger Überschuss! – Mir ist es wurscht, wie das Ding heißt (Zwischenruf bei der SPÖ): Denen sind 40 Millionen Kröten übrig geblieben und das gehört den Arbeitnehmern zurückbezahlt! (Beifall bei den NEOS.)
Ich habe aber noch eine Frage an den Herrn Bundesminister, weil ja zutage getreten ist, dass möglicherweise – es gilt die Unmutsverschuldung und es gilt die Unschuldsvermutung – ein Zusammenhang zwischen publizierten Umfragen und Geldern, die geflossen sind, und der politischen Kommunikation der ÖVP besteht. (Abg. Scherak: Ja!) Sie waren als Bundesminister für Arbeit am 4. Juli in der „ZIB 2“ und haben dort gesagt, dass der Druck auf die Arbeitslosen erhöht werden sollte und dass da Maßnahmen kommen werden, und zufällig am 10. Juli publiziert Frau Beinschab eine Umfrage mit der Überschrift „ÖsterreicherInnen sprechen sich klar für Druck auf unwillige Arbeitslose aus“, mit sechs Tagen Abstand. (Zwischenruf der Abg. Belakowitsch. – Heiterkeit und Zwischenrufe bei Abgeordneten der SPÖ. – Ruf bei der FPÖ: Sehr gut!)
Es gibt schon Zufälle, nur an die glaube ich nicht, und wenn es eine Erklärung gibt, wäre es auch spannend, die zu hören. – Danke schön. (Beifall bei den NEOS sowie bei Abgeordneten von SPÖ und FPÖ.)
17.33
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesminister Kocher. – Bitte sehr.
Bundesminister für Arbeit Mag. Dr. Martin Kocher: Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Abgeordnete! Hohes Haus! Das gibt mir gleich die Gelegenheit, darauf zu reagieren: Ich habe nie erwähnt, dass der Druck auf Arbeitslose erhöht werden sollte – das habe ich so sicher nie gesagt. Was ich, glaube ich, damals gesagt habe, war, dass die möglichen Sanktionen wieder auf das Niveau gehoben und in der Verbindlichkeit so umgesetzt werden, wie das vor Corona der Fall war, weil sich der Arbeitsmarkt erholt hat. Und: Ich kenne Frau Beinschab nicht. Das erklärt, glaube ich, jetzt, was die Frage war. (Beifall bei der ÖVP. – Zwischenruf des Abg. Scherak. – Rufe und Gegenrufe zwischen Abgeordneten von FPÖ und ÖVP.) Solche Sachen kann man relativ rasch klären.
Ich komme zum Thema Arbeitsmarkt. Ich glaube, es ist wichtiger, über den Arbeitsmarkt zu sprechen. Wir haben mittlerweile eine Lage, die glücklicherweise um einiges besser ist als noch vor der Coronakrise. Wir haben Ende September/Anfang Oktober eine Arbeitsmarktlage, die besser als in den letzten acht Jahren, bis 2013 zurückgehend, ist. Ich glaube, das ist für alle zumindest eine Gelegenheit, sich einigermaßen glücklich zu schätzen, dass das passiert ist, unabhängig davon, was man glaubt, wo das herkommt, ob das die Regierung war, ob das die wirtschaftliche Lage insgesamt betrifft, aber: Die Arbeitsmarktlage ist besser.
Wir haben natürlich im Herbst erste saisonale Effekte, das heißt, die Arbeitslosigkeit wird im Winter wieder steigen – das ist ganz normal. Wir müssen für die Gruppen, die am Arbeitsmarkt große Schwierigkeiten haben, weiter aktive Arbeitsmarktpolitik betreiben, die notwendig ist. Ich wiederhole das sehr, sehr gerne, weil immer wieder der Vorwurf kommt, dass die Bundesregierung keine aktive Arbeitsmarktpolitik betreibt – das stimmt
so nicht –: Das Budget für die aktive Arbeitsmarktpolitik dieses Jahr und nächstes Jahr ist höher als je zuvor. Wir haben zwei große Programme, die Coronajoboffensive, bei der dieses Jahr weit über 400 Millionen Euro für Qualifizierungsmaßnahmen ausgegeben wurden – da sage ich gleich mehr dazu –, und das Programm Sprungbrett, bei dem es auch um mehrere Hundert Millionen Euro zur Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen geht.
Das ist, sage ich, eine ganz wichtige Maßnahme, weil es gerade bei der Langzeitarbeitslosigkeit natürlich noch eine etwas erhöhte Zahl im Vergleich zur Lage vor der Krise gibt. Allerdings ist auch diese zurückgegangen. Im April 2021, ungefähr vor einem halben Jahr, war die Langzeitarbeitslosigkeit bei ungefähr 148 000. Wir stehen jetzt bei 120 000 Personen, die langzeitarbeitslos sind – die Zahl wurde schon genannt. Wir werden weiter versuchen, die Langzeitarbeitslosigkeit, so schnell es geht, unter das Vorkrisenniveau von ungefähr 100 000 Personen zu bringen.
Das ist keine einfache Aufgabe. Es gab viele Krisen, viele Rezessionen, die bei Weitem nicht so tief waren, als die Coronarezession war, und wir hatten danach in Österreich immer eine höhere Zahl von Langzeitarbeitslosen als davor über mehrere Jahre hinweg. Wenn uns das gelingt – und ich bin überzeugt davon, dass uns das gelingt, wenn es keinen Rückschlag bei der Pandemiebekämpfung gibt –, dann haben wir mehr erreicht als viele Regierungen vor uns. (Beifall bei der ÖVP.)
Wir haben derzeit ungefähr 70 000 Personen in Schulungen. Das sind Schulungen von kurzen Schulungen bis hin zu langen Programmen im Rahmen des Fachkräftestipendiums, bei dem Pflegekräfte über ein Jahr lang und länger ausgebildet werden. 70 000 Personen: Das ist relativ viel, mehr als 2019 zum gleichen Zeitpunkt, um ungefähr 5 000 mehr. Das zeigt auch, dass da mehr Mittel fließen.
Wir haben uns angeschaut, was denn mit diesen Menschen, die in der Coronajoboffensive gefördert wurden, aufqualifiziert oder umqualifiziert wurden, passiert. Es sind bisher ungefähr 60 000 Personen, 100 000 bis Ende nächsten Jahres ist das Ziel. Von diesen 60 000 Personen, die bis vor drei Monaten eine Ausbildung absolviert haben, haben gut 30 000 Personen schon wieder einen Job gefunden – innerhalb von drei Monaten 50 Prozent ist auch eine sehr gute Quote. Die Maßnahmen wirken auch am Arbeitsmarkt. (Beifall bei der ÖVP. – Zwischenruf des Abg. Matznetter.)
Mir ist wichtig, noch kurz darauf einzugehen, was noch zu tun ist. Nachdem sich die Arbeitsmarktlage einigermaßen entspannt hat, geht es nun darum, sich Gedanken darüber zu machen, wie man Vermittlung und Arbeitslosenversicherung gestaltet, damit die Arbeitslosigkeit dauerhaft noch weiter zurückgeht. Wir haben eine Reformdiskussion zur Arbeitslosenversicherung neu initiiert. Ich freue mich sehr, dass wir auch mit den Arbeits- und Sozialsprechern des Parlaments sehr bald einen Termin haben werden. Es wird einen weiteren Termin für alle interessierten Abgeordneten geben, bei dem wir sehr offen über die Maßnahmen diskutieren können. Es gibt natürlich auch Termine mit den Sozialpartnern, mit dem AMS, mit den Expertinnen und Experten, den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, um zwei Ziele zu erreichen – das ist mir besonders wichtig –: Menschen möglichst rasch in Beschäftigung zu bringen und die Arbeitslosigkeit weiter zu senken und gleichzeitig die Einkommen besser abzusichern.
Ich bin davon überzeugt, dass es da gute Möglichkeiten gibt, das zu tun, gemeinsam mit dem Parlament, gemeinsam mit allen Parteien. – Vielen Dank. (Beifall bei der ÖVP sowie bei Abgeordneten von Grünen und NEOS.)
17.39
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordnete Zopf. – Bitte.
Abgeordnete Bettina Zopf (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzter Herr Minister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuseherinnen und Zuseher zu Hause und auf der Galerie! Es geht wieder um den Antrag auf Erhöhung der Notstandshilfe von den Kolleginnen und Kollegen der SPÖ, den die FPÖ unterstützt. Bei Notstandshilfebeziehern ist der Anspruch auf Arbeitslosengeld schon ausgelaufen und sie sind ausschließlich langzeitarbeitslos. Als Notstandshilfebezieher gelten bei uns Personen, die arbeitswillig, arbeitsfähig und trotzdem arbeitslos sind. Helfen wir ihnen, Arbeit zu finden!
Natürlich ist es ein einfacher Weg, das Geld unserer Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zu verteilen. Jedes Jahr im Herbst muss man die Kolleginnen und Kollegen der SPÖ daran erinnern: Ihr seid nicht wie der heilige Martin, ihr teilt nicht euer Geld, so wie der heilige Martin seinen eigenen Mantel geteilt hat, sondern das hart verdiente Steuergeld unserer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die täglich fleißig arbeiten gehen. (Beifall bei der ÖVP.) Falls ihr jedoch die Geschichte des heiligen Martin nicht gut kennt, so könnt ihr euren Landeshauptmann Doskozil fragen, er wird die Geschichte des Landesheiligen wohl kennen und ist ohnehin sehr mitteilungsbedürftig.
Dieser Antrag ist nicht gerecht, das ist nicht sozial und ganz klar der falsche Weg. (Beifall bei der ÖVP. – Zwischenruf der Abg. Belakowitsch.)
Ein Beispiel aus der Praxis: Vor einigen Jahren führte ich ein Gespräch mit einem Gewerkschaftskollegen aus Deutschland. Dieser arbeitet in einem Sozialamt einer deutschen Kommune, und dort gibt es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die arbeitslose Familien, Hartz-IV-Empfänger in der zweiten Generation unterstützen. Langzeitarbeitslose – über Generationen – können selbst einen normalen Alltag nicht mehr bewältigen. Die Sozialarbeiter wecken deren Kinder auf und schicken sie zur Schule, denn selbst diese Tätigkeiten sind diesen Familien nicht mehr möglich. Für mich war damals schon klar: Das müssen wir in Österreich verhindern!
Schauen wir auf Oberösterreich: Dort gibt es 31 000 offene Stellen und 29 000 Personen, die Arbeit suchen. Wir hätten keine Arbeitslosen, wenn wir es schaffen würden, die Arbeit suchenden Personen dabei zu unterstützen, einen Arbeitsplatz anzunehmen – und da setzen wir an. Wir bieten Ausbildungs- und Umschulungsprogramme. Weitere Maßnahmen haben wir mit dem Neustartbonus und der Aktion Sprungbrett gesetzt, und sie wirken. Unterstützung dabei zu bieten, wieder in ein Arbeitsleben zu finden und dadurch selbstbestimmt leben zu können, das ist sozial und gerecht. Das ist gut für diese Menschen selbst sowie wichtig und richtig für eine funktionierende Gesellschaft. (Beifall bei der ÖVP.)
Wir werden weiter daran arbeiten, die Hilfe zur Selbsthilfe zu unterstützen und auszubauen. In den vergangenen Wochen und Monaten und nicht zuletzt anhand des Budgets haben wir ganz deutlich aufgezeigt, wie erfolgreiche Sozialpolitik funktioniert. Während ihr nur fordert und kritisiert, haben wir zielführende Lösungen bereits umgesetzt. Gott sei Dank haben wir eine Regierung, die diesen mühsamen Weg wählt. Auf lange Sicht gesehen ist dies der richtige Weg, daher möchte ich mich nochmals bei der gesamten Regierung, insbesondere bei unserem Arbeitsminister Kocher und bei Finanzminister Blümel, für den immensen Einsatz bedanken. (Abg. Belakowitsch: Den Altkanzler nicht vergessen!)
Notstandshilfebezieher sind arbeitsfähig, arbeitswillig und trotzdem arbeitslos. (Abg. Belakowitsch: Woran liegt das jetzt?) Helfen wir ihnen, Arbeit zu finden! (Beifall bei der ÖVP.)
17.43
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Drobits. – Bitte. (Abg. Belakowitsch: Was soll man da jetzt darauf sagen? – Ruf bei der ÖVP: Gar
nichts mehr, es ist alles gesagt! – Abg. Belakowitsch: Ein Ding der Unmöglichkeit! – Abg. Leichtfried: Wenn nicht einmal mehr die ÖVP klatscht!)
Abgeordneter Mag. Christian Drobits (SPÖ): Geschätzter Präsident! Herr Bundesminister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher! Nun, Kollegin Zopf und Kollege Hammer tragen beide das gleiche Pink-Ribbon-Zeichen (auf das Pink-Ribbon-Zeichen auf seinem Revers zeigend), und ein Kennzeichen von Pink Ribbon heißt Solidarität. – Bitte, wo ist eure Solidarität mit krebskranken Personen, die langzeitbeschäftigungslos sind? Wo ist da die Solidarität? (Beifall bei der SPÖ.) Wo ist da die Solidarität, wenn Sie behaupten, dass diese Menschen Unterstützung in der Familie und in anderen Bereichen brauchen? Wo ist die Solidarität, wenn Sie die Arbeitslosen und nicht die Arbeitslosigkeit bekämpfen? – Das ist nämlich die Wahrheit!
Herr Bundesminister, ich habe das Gefühl, dass manche in diesem Haus derzeit eher die Arbeitslosen verfolgen und bekämpfen und nicht die Arbeitslosigkeit und die Langzeitbeschäftigungslosigkeit, die das große Problem sind. (Abg. Hanger: Kollege, haben Sie schon einmal etwas gehört von ...?) Sie haben das letzte Mal im Ausschuss gesagt, dass wir grundsätzlich eine Vervierfachung der Langzeitbeschäftigungslosigkeit seit 2008 haben – 120 000 Personen. Unter diesen 120 000 Personen sind viele, die sich gerne als Menschen fühlen würden. Sie werden derzeit – das behaupte ich und das höre ich immer wieder – als Zahl genannt. Kollegin Belakowitsch hat es gesagt: Algorithmen sind an der Tagesordnung. Es gibt weiterhin Fragebögen, aber es geht nicht mehr darum, dass diese Menschen wie Menschen behandelt werden.
Herr Bundesminister, ich fordere Sie deshalb auf, schleunigst danach zu trachten, dass der Personalstand beim AMS bedeutend erhöht wird. Wir haben beim AMS momentan eine Quote von einer Beraterin zu 250 Kundinnen und Kunden, und diese Quote ist weit höher als jene in anderen Ländern. Die Forderung muss also sein: Das AMS braucht mehr Personal! Wir brauchen keine Algorithmen, und wir brauchen schon gar nicht diese Fragebögen, die meiner Meinung nach menschenunwürdig sind. (Beifall bei der SPÖ sowie der Abg. Belakowitsch.)
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Das Problem ist eigentlich, dass es viele Beschäftigte gibt, die 30 Jahre gearbeitet haben und dann krank geworden sind und dann alt geworden sind. Diese werden vom AMS weggeschickt, es heißt: zu alt!, bei der Krankenkasse heißt es: zu gesund!, und bei der Pensionsversicherungsanstalt: zu jung! – Bitte, wohin soll ich mich wenden?
Herr Bundesminister, es ist Zeit, endlich einmal diese Schnittstellen hinsichtlich der Arbeitsfähigkeit zu entfernen, damit diese beschäftigungslosen Personen auch die Möglichkeit haben, in Würde zu altern und entsprechend in Würde – ab einem gewissen Alter, nachdem sie auch länger beschäftigungslos waren – auch in Pension gehen zu können.
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Es ist mir ganz wichtig, Folgendes zu sagen: Die Botschaft muss lauten: Nicht die Arbeitslosen sind es, die wir bekämpfen müssen, sondern es ist rein die Arbeitslosigkeit. Wenn der Herr Bundeskanzler – eigentlich der Altkanzler – und Herr Kollege Hammer sagen, dass alle, die arbeiten können, arbeiten müssen, so stelle ich die Forderung auf: Sagen Sie das bitte auch den Söhnen und Töchtern der Millionäre! Dort wäre diese Aussage wahrscheinlich auch besser angebracht als bei arbeitslosen Menschen, die teilweise nicht mehr wissen, wo sie das Geld herbekommen sollen, von dem sie in weiterer Folge auch leben können. – Das ist die Frage, die sich stellt.
Herr Bundesminister, in diesem Sinne wünsche ich, dass Sie endlich einmal auch das Thema Arbeitsfähigkeit angehen und die Schnittstellen für uns finden werden, denn da
gibt es, glaube ich, viel Potenzial. Die Zielvorgaben beim AMS sind zwar übermotiviert, aber sie bringen auch nichts, weil das AMS gar nicht durchführen kann, was Sie ihm vorgeben. – Danke für die Aufmerksamkeit. (Beifall bei der SPÖ.)
17.47
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Gödl. – Bitte.
Abgeordneter Mag. Ernst Gödl (ÖVP): Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Sehr geehrte Frau Bundesminister, grüß Gott! Geschätzte Damen und Herren! Hohes Haus! Eine kurze Replik zu meinem Vorredner: Es ist ganz klar und unser Konsens: Wir bekämpfen ausschließlich die Arbeitslosigkeit und niemals Arbeitslose! Das würde niemandem in den Sinn kommen. (Beifall bei der ÖVP.)
Ich kann Ihnen auch sagen, warum, und ich denke, es ist auch unverfänglich, wenn wir zum Beispiel internationale Studien betrachten, die Österreich gerade in der Krisenbekämpfungszeit als besonders erfolgreich ausweisen. Das hat mit einer sehr offensiven Politik dieser Regierung in den letzten Jahren zu tun, nämlich einer offensiven Politik im Rahmen der Gesundheitskrise, mit der wir die Gesundheitskrise bekämpft haben, in der es für manche Menschen um Leben und Tod gegangen ist, in der es um gesundheitliche Langzeitfolgen geht. Wir haben im Zuge dessen natürlich auch die Wirtschaftskrise massiv bekämpft.
Meine Damen und Herren! Wir haben in Österreich bislang – gerechnet bis zum gestrigen Tag – 40,8 Milliarden Euro für Covid-Hilfen in die Hand genommen und ausgegeben, damit wir in allen Bereichen helfen, über diese Krise hinwegzukommen. Ein Viertel davon, nämlich 10,3 Milliarden Euro, haben nur den Bereich der Kurzarbeit gestützt. Ich glaube daher, dass man dieses Kurzarbeitsmodell durchaus etwas unter die Lupe nehmen sollte.
Ich schätze Kollegen Loacker, der jetzt gerade spricht (Abg. Loacker spricht mit Abg. Tomaselli), wirklich sehr dafür, dass er immer wieder sehr sachlich und fachlich fundiert seine Beiträge bringt, aber ich möchte zu seinem Antrag Stellung nehmen, in dem er die Regierung auffordert, die Coronakurzarbeit einzustellen. Dazu meinen wir, dass das definitiv noch zu früh ist, denn wir haben die Kurzarbeit sehr wohl Phase für Phase immer nachgeschärft, und wir sind jetzt in der Phase fünf. Diese ist am 1. Juli gestartet. Wir sind ursprünglich davon ausgegangen, dass etwa 100 000 bis 120 000 Menschen für diese Phase angemeldet werden, und sehen auch da eine extrem positive Entwicklung. Es sind nämlich derzeit viel, viel weniger, wie auch der Herr Minister schon ausgeführt hat: Etwa 69 000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind für die Phase fünf der Coronakurzarbeit angemeldet, und das heißt ja noch gar nicht, dass das dann auch abgerechnet wird, weil manche die Kurzarbeit vielleicht gar nicht in Anspruch nehmen werden, wie es auch in der Vergangenheit zu sehen war.
All diese Maßnahmen haben dafür gesorgt, dass wir heute betreffend Arbeitslosigkeit auf diesem guten Niveau stehen, nämlich bei in Summe 334 000 Arbeitslosen, was etwas weniger als vor zwei Jahren, also vor der Coronakrise, ist. Das ist also sicher ein Erfolgsmodell, das Österreich in den letzten Monaten und im letzten Jahr im Zuge der Coronakrise geschaffen hat, und das hat ganz dezidiert mit den arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen zu tun. Herr Kollege Stöger, Herr Kollege Drobits, es ist sehr viel getan worden, eben weil wir die Arbeitslosigkeit und keineswegs die Arbeitslosen bekämpfen. (Beifall bei der ÖVP sowie der Abg. Ribo.)
Meine Damen und Herren! Ja, wir stehen vor vielen Herausforderungen am Arbeitsmarkt, das sehen wir. In meinem Wahlkreis hat es vor etwa zwei Wochen einen Zeitungsbericht darüber gegeben, dass ein sehr bekannter Wirt sein Gasthaus zur Gänze zusperrt, weil er keinen Koch mehr findet. Das ist eine Auswirkung des Fachkräftemangels,
den wir in vielen Bereichen spüren. Ich ziehe meine Region, Graz, Graz-Umgebung, die eine sehr, sehr florierende und pulsierende Region ist, als Beispiel heran: Es gibt sehr viele offene Stellen und gleichzeitig sind auch etwa 15 000 Menschen auf Arbeitssuche. Da fehlt es also noch am Matching, da fehlt es vielleicht noch an der einen oder anderen Initiative, damit wir Arbeitslose tatsächlich besser in den Arbeitsmarkt integrieren können. Ja, da stehen wir vor ganz großen Herausforderungen.
Genauso stehen wir im Bereich der Pflege vor großen Herausforderungen. Bei den mobilen Diensten gibt es genauso wie bei den stationären Diensten durchaus viel Nachfrage, derzeit können auch Pflegebetten nicht belegt werden, weil es zu wenig Fachkräftepersonal gibt. Keine Frage, es gibt da große Herausforderungen; diese können wir gemeinsam meistern, wenn wir gute Politik betreiben, dafür wurden wir gewählt.
Übrigens: Mit schreienden Vorträgen und dem fragwürdigen Wortschatz, den Sie verwenden, Frau Belakowitsch, haben Sie bislang überhaupt keinen Beitrag zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit geleistet.
Wir werden uns weiterhin bemühen – das ist unsere Aufgabe als Regierungsparteien –, den Arbeitsmarkt zu stärken und eben auch die Arbeitslosigkeit massiv zu bekämpfen. Ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind, die Zahlen sprechen jedenfalls dafür. (Beifall bei der ÖVP.)
17.52
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Ragger. – Bitte.
Abgeordneter Mag. Christian Ragger (FPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzte Frau Ministerin! Geschätzter Herr Minister! Kollege Gödl, wann fangt ihr endlich damit an, dass ihr gute Politik macht? (Heiterkeit der Abg. Belakowitsch.) Ich glaube nämlich, die einzigen Jobs, die wirklich sicher sind – das hat Altbundeskanzler Kreisky, glaube ich, einmal gesagt –, sind jene beim Rundfunk oder im öffentlichen Dienst. Das sind die einzigen sicheren Jobs, alle anderen sind marktpolitisch zu erarbeiten.
Ich glaube, wir sollten einmal aus unserem Elfenbeinturm in der Politik rauskommen und wirklich auf die Realität schauen. (Zwischenruf des Abg. Strasser.) Kollege Koza hat heute schon gesagt, wir sind auf Vorkrisenniveau gelandet, es gibt jetzt nur mehr 260 000 oder 270 000 Arbeitslose. – Sie müssen aber einmal sehen, mit welchem Aufwand wir das geschafft haben, dass wir auf Vorkrisenniveau zurückkommen, und es ist auch kein Ruhmesblatt, dass es vorher 270 000 Arbeitslose gab.
Wenn man sich jetzt die Statistiken anschaut, die besagen, dass es 120 000 Langzeitarbeitslose gibt, dann muss man sich ja fragen: Wo kommen diese arbeitsmarktpolitischen Programme denn an? Sie müssen sich ja auch bei den Langzeitarbeitslosen früher oder später niederschlagen, wenn diese nicht nur in Schulung oder in Qualifizierung sind. Da zeigt sich, dass die Ansätze in der Qualifizierung falsch sind. Wie die Frau Kollegin vorhin erwähnt hat: Es gibt in Oberösterreich 31 000 Jobangebote und 29 000 Jobsuchende. – Da ist letztendlich in der Qualifizierung etwas Falsches passiert, denn es kommt – das ist leider die Realität und das sehe ich tagtäglich in meinem Tal und im Bereich Unterkärnten – bei den Firmen nichts mehr an und die Firmen bekommen kein Personal.
Der Ansatz muss daher ein flexiblerer, ein schnellerer und besser auf die Wirtschaft zugeschnittener Ansatz sein, sodass die Menschen in Beschäftigung kommen und auch aus dem AMS herauskommen. Dafür braucht man keine neuen AMS-Mitarbeiter, sondern man muss die Leute aus dem AMS herausbekommen, damit sie wieder in die Jobs kommen. (Abg. Gödl: Ja!) Diese Ansätze müssen wir schaffen. Das erwarte ich mir von
einem Arbeitsminister und einer flexibleren Arbeitsmarktpolitik. Wenn wir das schaffen, dann erreichen wir auch eine nachhaltige Senkung der Zahl der Langzeitarbeitslosen, die letztendlich, und das beinhaltet der Satz ja auch, Arbeitsmarktpolitik nach sich zieht. – Das ist der erste Punkt.
Der zweite Punkt ist folgender: Sie brauchen sich nur einmal Ihre Kammern anzuschauen! Es gibt in Österreich ja nichts, bei dem nicht die Arbeiterkammer die Wirtschaftskammer und die Wirtschaftskammer die Arbeiterkammer blockiert. Wir reden seit Jahren, nein, schon seit Jahrzehnten davon, bei neuen Pflegeberufen anzusetzen. Wir reden mit Gust Wöginger seit mittlerweile schon drei Perioden über eine Pflegelehre, und er sagt: Jetzt fahren wir einmal in die Schweiz, um uns das anzuschauen! – Passiert ist das aber nie. Die Schweizer haben seit 15 Jahren eine Pflegelehre, im Zuge derer man beginnt, Jugendliche ganz normal in einen Pflegeberuf einzuführen, und man schafft es sogar, sie auf ihrem Weg zu begleiten. Natürlich werden in Österreich viele Veränderungen notwendig sein, damit wir das einführen können, aber wir müssen doch irgendwann einmal in der Lage sein, neue Berufe im Pflegesystem und auch andere Lehrberufe anzudenken. Das sind Punkte, die wir letztendlich gemeinsam mit unserem Arbeitsminister zu erarbeiten haben.
Mein letzter Kritikpunkt: Wenn es schon so viele Menschen in Armut gibt und wir heute einen Antrag des Kollegen Angerer betreffend Energiearmut vorliegen haben, der dann blindlings von einem Ausschuss in einen anderen verschoben wird, dann gebe ich Ihnen einen Tipp dazu, wie es die Franzosen gelöst haben, was sie mit Langzeitarbeitslosen gemacht haben: Sie haben sie alle zu Energieberatern ausgebildet, indem sie einen Fonds mit 2,5 Millionen Euro gegründet haben, den die GDF Suez gespeist hat. So haben sie Langzeitarbeitslose zu Energieberatern ausgebildet, sie losgeschickt und dafür Sorge getragen, dass die Energiekosten sinken. Das ist ein Lösungsansatz, von dem ich mir wünschen würde, dass man dessen innovative Kraft auch in Österreich erkennt. Man kann nur an den Minister appellieren, dass er das auch umsetzt. – Danke für die Aufmerksamkeit. (Beifall bei der FPÖ.)
17.57
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Seemayer. – Bitte.
Abgeordneter Michael Seemayer (SPÖ): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Frau Bundesministerin! Als Kollegin Zopf vorhin die Geschichte des heiligen Martin zitiert hat, waren Sie, Herr Bundesminister, glaube ich, nicht gemeint. Da vom Verteilen von Steuergeld die Rede war, muss man schon feststellen, dass alle Vorschläge, die die SPÖ im Rahmen dieser Tagesordnungspunkte dazu einbringt, wie Steuergeld bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ankommen soll, abgelehnt werden. Schaut man sich aber an, wie die ÖVP Steuergeld verteilt, dann sieht man eh, was da ans Tageslicht kommt. Das ist inzwischen ja nicht mehr unbekannt.
Zur Kurzarbeit Phase fünf: Es gibt inzwischen zwei Modelle, eines, das sich ganz klar an die von Coronamaßnahmen betroffenen Branchen richtet, und eines, das – wie Kollege Loacker angemerkt hat – ein ähnliches Modell ist, wie es früher die Kurzarbeit war.
Leider sind Branchen wie der Städtetourismus, die Messe- oder Veranstaltungstechnik immer noch von Maßnahmen betroffen. Es wäre uns auch lieber, wenn wir die Coronakurzarbeit da nicht mehr brauchen würden. Da braucht es aber auch eine ordentliche wirtschaftliche Auslastung, das wird man nicht mit dem Abschaffen der Coronakurzarbeit beseitigen können, da brauchen die Betriebe und die Unternehmen entsprechende Aufträge und Arbeit, um das zu bewältigen.
Herr Bundesminister, wenn man die richtigen Programme schafft und die richtigen Maßnahmen setzt, wird es auch dort gelingen, aus der Coronakurzarbeit herauszukommen.
Wenn uns das nicht gelingt, werden wir zum Jahresende vermutlich eine Verlängerung der Kurzarbeit benötigen. (Präsidentin Bures übernimmt den Vorsitz.)
Es liegt ein Antrag der FPÖ zu einer Lehrabschlussprämie vor, der, glaube ich, nach meinem Redebeitrag eingebracht wird. Dazu kann ich sagen, dass wir diesen gerne unterstützen. Ob allerdings eine Prämie für die Lehrabschlussprüfung am Ende der Lehrzeit dazu führt, dass sich junge Menschen mit 15 Jahren dazu entscheiden, eine Lehre zu machen, statt in die Schule zu gehen, bleibt eher fraglich. Bei dieser Entscheidung spielen ja auch viele andere Faktoren eine Rolle, unter anderem die Erfahrungen der Eltern an deren Arbeitsplätzen. Wenn Eltern an Arbeitsplätzen als Facharbeiterinnen, als Facharbeiter die Erfahrung gemacht haben, dass sie schlechtere Arbeitsbedingungen vorfinden als jene, die eine höhere Schule besucht haben, dann werden sie ihren Kindern kaum eine Lehre nahelegen.
Zu diesen Arbeitsbedingungen, die eigentlich passen müssten, gehören natürlich auch Fragen wie die Lage der Arbeitszeit, wie viele Überstunden geleistet werden müssen, ob Schichtarbeit geleistet werden muss, ob man seinen Urlaub selbstbestimmt planen kann und vieles mehr. Die derzeitige Forderung nach der Ausdehnung der Höchstgrenzen betreffend Arbeitszeit, wie wir sie in der Industrie haben, bringt uns da sicher keinen Schritt weiter. Wer künftig ausgebildete Fachkräfte haben will, der muss nicht nur eine gute Ausbildung, eine gute Lehrlingsausbildung, bieten; er muss auch gute Arbeitsbedingungen für die Zeit nach der Lehre bieten. – Danke. (Beifall bei der SPÖ.)
18.00
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Erwin Angerer. – Bitte.
Abgeordneter Erwin Angerer (FPÖ): Frau Präsidentin! Geschätzter Herr Minister! Frau Minister! Hohes Haus! Geschätzte Damen und Herren! Wir freuen uns jetzt ja alle, dass die Wirtschaft angesprungen ist und die Arbeitslosenzahlen zurückgegangen sind. Ich würde einmal sagen: Es liegt nicht an der Arbeit der Regierung, es liegt daran, dass die Menschen Angst haben, dass ihr Geld weg ist, und alle auf Teufel komm raus investieren – deshalb ist die Wirtschaft Gott sei Dank angesprungen.
Wir haben aber die Situation, dass immer noch fast 400 000 Menschen arbeitslos und beim AMS gemeldet sind. Leider, Herr Minister, gibt es auch junge Leute, die nach ihrer Ausbildung gleich direkt beim AMS landen. Da stelle ich mir die Frage: Was ist da los in diesem System? Bilden wir junge Leute vielleicht in die falsche Richtung aus? – Sie schütteln den Kopf. In der Wirtschaft fehlen uns Fachkräfte, die Wirtschaft sucht nach Lehrlingen, findet keine Lehrlinge – das ist ein Riesenproblem. In den Branchen verzeichnen bis zu 60 Prozent der Unternehmen starken Fachkräftemangel. Sie setzen in diesem Bereich kaum oder gar keine Maßnahmen.
Wir haben schon mehrfach Lehrlingsunterstützung gefordert, einerseits für die Betriebe, mithilfe eines Blum-Bonus, das heißt, dass ein Betrieb über die gesamte Lehrzeit einen Zuschuss bekommt – leider wurden alle diese Anträge abgelehnt. Wir haben auch Imagekampagnen für die Lehre gefordert, um die Lehre attraktiver zu machen – ich merke nichts davon, dass die Regierung irgendetwas in diese Richtung tut –, und ich habe in einem Ausschuss schon einmal einen Antrag betreffend eine Lehrabschlussprämie eingebracht.
Diesen Antrag werde ich jetzt wieder einbringen, und zwar:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Erwin Angerer, Kolleginnen und Kollegen betreffend „die Einführung einer Lehrabschlussprämie“
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, jene Maßnahmen zu setzen bzw. Schritte einzuleiten, die die Einführung einer bundesweiten, aus öffentlichen Mitteln finanzierten Lehrabschlussprämie in Höhe von 10.000 Euro für jede erfolgreich abgeschlossene Lehre sicherstellen, wobei 5.000 Euro dieser Prämie dem Lehrling bei erfolgreichem Lehrabschluss direkt ausgezahlt und 5.000 Euro in Form eines Bildungsschecks für seine berufliche Fortbildung zur Verfügung gestellt werden sollten.“
*****
Ich glaube, das ist eine sehr sinnvolle Maßnahme, Herr Minister. Wir haben circa 100 000 Lehrlinge in Österreich, 30 000 werden jedes Jahr fertig. Das Geld wäre gut investiert. 5 000 Euro davon können sie dann für eine Meisterprüfung verwenden. Von zehn Lehrlingen werden drei Unternehmer. – Das wäre eine Investition in die Zukunft, eine Investition in unser System, eine Investition in die Bildung unserer jungen Leute. In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie den Antrag unterstützen. – Danke schön. (Beifall bei der FPÖ.)
18.03
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Erwin Angerer, Dr. Dagmar Belakowitsch
und weiterer Abgeordneter
betreffend die Einführung einer Lehrabschlussprämie
eingebracht im Zuge der Debatte zu TOP 18: Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 628/A(E) der Abgeordneten Josef Muchitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend arbeitsmarktpolitische Sofortmaßnahmen zur Beschäftigungsförderung (1088 d.B) in der 125. Sitzung des Nationalrates am 13. Oktober 2021
Der Fachkräftemangel in Österreich wird zusehends zu einem massiven Problem für die heimische Wirtschaft.
So legen die Ergebnisse der aktuellen Konjunkturumfrage beispielsweise im Kärntner Gewerbe und Handwerk das Ausmaß des Fachkräftemangels in Kärnten dar: 24 Prozent der Betriebe gaben an, ihren Beschäftigungsstand in den nächsten Monaten um durchschnittlich 6,8 Personen erhöhen zu wollen. Spartenobmann Klaus Kronlechner betonte, dass die Erholung der Auftragslage im ersten Quartal 2021 gegenüber dem ersten Quartal 2020 zu diesem dramatischen Fachkräftemangel führte: „Wir trommeln seit Jahren, dass der Fachkräftemangel bedrohende Ausmaße für das Gewerbe und Handwerk annimmt. Jetzt ist die Situation eingetreten, vor der wir immer gewarnt haben: Unsere Betriebe können die Aufträge kaum noch abarbeiten, da ihnen qualifizierte Mitarbeiter fehlen. Wir sind jetzt leider an einem Punkt angekommen, an dem der Fachkräftemangel die Produktivität bremst.“1
Laut einer Studie, die im Auftrag der WKO durchgeführt wurde2, waren bereits im September 2020 62 Prozent der Betriebe von starkem Fachkräftemangel betroffen. Insgesamt gaben 81 Prozent der Betriebe an, dass sie zumindest in irgendeiner Form vom Mangel an Fachkräften betroffen sind. „Besonders intensiv wird der Mangel an Fachkräften am Bau, in der Herstellung von Holzwaren, im Tourismus, im handwerklichtechnischen Bereich sowie in mittelgroßen Betrieben erlebt. Hochgerechnet auf Österreich kann zum Befragungszeitpunkt September 2020 von einem geschätzten Fachkräftebedarf (offene Stellen) von rund 177.000 Personen (bezogen auf alle Mitgliedsbetriebe der
WKO) ausgegangen werden.“ In rund 61 Prozent der Betriebe hat der Fachkräftemangel auch zu Umsatzeinbußen geführt. Rund 50 Prozent der Unternehmen gaben an, dass in Folge des Mangels auch weniger qualifizierte Bewerber eingestellt werden mussten, was sich wiederum auf die Möglichkeit zur Innovation bzw. Entwicklung neuer Produkte auswirkte. Zudem wird von über 70 Prozent der Betriebe eine Verschärfung des Fachkräftemangels in den nächsten drei Jahren befürchtet.
Auch die EY-Studie vom Februar 2021 „Fachkräftemangel im österreichischen Mittelstand“ bestätigt diese Zahlen und den Fachkräftemangel in Österreich: 76 Prozent der Mittelstandsunternehmen haben Probleme damit, geeignete Fachkräfte zu finden und 35 Prozent der Mittelstandsunternehmen gaben an, Umsätze aufgrund des Fachkräftemangels zu verlieren.3
Auch der diesem Antrag zugrunde liegende Entschließungsantrag der Abgeordneten Muchitsch, Genossinnen und Genossen betreffend arbeitsmarktpolitische Sofortmaßnahmen zur Beschäftigungsförderung zielt unter anderem auf Maßnahmen zur Bekämpfung des Fachkräftemangels und zur Unterstützung der Lehrlingsausbildung ab.
Es bedarf dringend geeigneter Maßnahmen, um dem Fachkräftemangel effektiv zu begegnen. Neben einer Informationsoffensive der Jugend, müssen vor allem Schüler angesprochen und dazu motiviert werden, einen Lehrberuf zu ergreifen. Die Lehre muss insgesamt attraktiver werden und wieder an Stellenwert gewinnen. Mit einer aus öffentlichen Mitteln finanzierten Lehrabschlussprämie für jede erfolgreich abgeschlossene Lehre in Höhe von 10.000 Euro könnte den Lehrlingen der Start in ihre private und berufliche Zukunft erleichtert werden. 5.000 Euro dieser Prämie sollten dem Lehrling direkt ausgezahlt und 5.000 Euro in Form eines Bildungsschecks für seine berufliche Fortbildung zur Verfügung gestellt werden.
In diesem Zusammenhang stellen die unterfertigten Abgeordneten daher nachstehenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, jene Maßnahmen zu setzen bzw. Schritte einzuleiten, die die Einführung einer bundesweiten, aus öffentlichen Mitteln finanzierten Lehrabschlussprämie in Höhe von 10.000 Euro für jede erfolgreich abgeschlossene Lehre sicherstellen, wobei 5.000 Euro dieser Prämie dem Lehrling bei erfolgreichem Lehrabschluss direkt ausgezahlt und 5.000 Euro in Form eines Bildungsschecks für seine berufliche Fortbildung zur Verfügung gestellt werden sollten.“
1 https://www.5min.at/202107396224/wkk-fachkraeftemangel-bremst-produktivitaet-in-kaernten/
2 https://news.wko.at/news/oesterreich/ibw-summary_Fachkraeftebedarf_mangel-in-Oesterreich-2020_FIN.pdf
3 https://presse.ikp.at/news-ey-studie-fachkraeftemangel-im-oesterreichischen-mittelstand-2021?id=125943&menueid=2186&l=deutsch
*****
Präsidentin Doris Bures: Der Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht und steht mit in Verhandlung.
Nächster Redner: Herr Abgeordneter Klaus Köchl. – Bitte.
18.03
Abgeordneter Klaus Köchl (SPÖ): Geschätzte Frau Präsidentin! Geschätzter Herr Minister! Frau Minister! Herr Minister Kocher, ich habe am Anfang eine Frage an Sie als ehemaligen Chef eines Forschungsinstitutes mit ganz langer Tradition, wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Forschungsergebnisse aufzuarbeiten, genau, effizient zu arbeiten, diese wahrheitsgemäß und korrekt bereitzustellen, damit die Politik etwas damit anfangen kann und wir hier im Nationalrat damit weiterarbeiten können: Wie geht es Ihnen eigentlich, wenn Herr Klubobmann Kurz – und es gilt ja die Unschuldsvermutung – genau das Gegenteil macht? Wenn er Umfragen fälschen lässt, wenn er manipulieren lässt, wenn Schmiergeld bezahlt wird – wie fühlen Sie sich dabei? Ich kenne Sie jetzt schon lange und habe das lange beobachtet, ich frage Sie wirklich: Wie fühlen Sie sich dabei? Wie geht es Ihnen dabei? – Das ist meine Frage, die ich Ihnen stellen möchte, bevor ich auf die Lehrlinge eingehe.
Das Stiefkind in Österreich ist in den letzten Jahrzehnten immer der Lehrling gewesen. Wir als Sozialdemokratie haben ganz einfach gesagt, so ein Notausbildungsfonds für Lehrlinge wäre jetzt in der Coronazeit irrsinnig wichtig. Wir haben den Antrag 2020 eingebracht. Mein Kollege Angerer, als Freiheitlicher, hat jetzt über die Lehrlinge geredet. 2021 ist das abgelehnt worden. – Warum beschäftigt man sich damit nicht? Warum sollen Tausende junge Menschen nicht arbeiten können, nur weil diese Regierung für die Lehrlinge nichts übrig hat, weil sie keine Ausbildungsstätten schafft? Tausende offene Lehrstellen in Österreich können ganz einfach nicht besetzt werden.
Ihre Vorgängerin hat gesagt, die Lehrlinge sollen flexibel sein, sie müssen in die Bundesländer hinaus. – Ganz ehrlich: Wie soll denn das gehen? Ein Leben zu finanzieren – Miete zu bezahlen, Strom zu bezahlen, die Heizung zu bezahlen, wo man jetzt schon weiß, dass das um 500 Euro im Jahr mehr kosten wird –, wie soll das gehen? Wie soll da jemand pendeln? Man verdient da nicht ein Ministergehalt, man hat keinen Chauffeur, das sind Eltern, die sich das nicht leisten können. Warum macht die Regierung in diese Richtung genau nichts? Warum kann das für die jungen Menschen nicht gemacht werden? Warum werden die Millionen nicht in die Lehrlinge investiert? Stattdessen investiert ihr Millionen in Marketingstrategien und dergleichen.
Ich glaube, das sind Sachen, die ganz einfach nicht passen, Herr Minister, und ich bitte Sie wirklich, das in die Hand zu nehmen, damit die Lehrlinge anständig ausgebildet werden: Lehrwerkstätten zu schaffen, den Lehrlingen die Möglichkeit zu geben, in die Berufsschule zu gehen und in der Berufsschule dann eine gute Ausbildung zu machen, ihnen Englischunterricht zu bieten, Freizeitmöglichkeiten zu bieten, genug Lehrpersonal zur Verfügung zu stellen.
Sprechen Sie da mit Herrn Faßmann als Bildungsminister! Das sind Dinge, die wir ganz, ganz dringend brauchen. Wenn eine Ausbildungspflicht bis 18 Jahre gemacht wird, warum gibt es keine Ausbildungsgarantie bis 25, dass jemand, der die Schule abbricht, dann eine Lehre anfangen kann? Diese Sachen müssten doch möglich sein, Herr Minister! Das kostet doch nicht Millionen. Das kostet sehr viel weniger, als Konzerne zu fördern, die ohnehin schon so viel Geld haben, und diese dann nicht einmal zu besteuern. (Beifall bei der SPÖ.)
18.07
Präsidentin Doris Bures: Zu Wort ist dazu nun niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
Wird seitens der Berichterstattung ein Schlusswort gewünscht? – Das ist nicht der Fall.
Bevor wir zu den Abstimmungen kommen, frage ich wie vereinbart alle Fraktionen, ob wir gleich fortfahren können? – Gut, damit gehe ich auch so vor.
Abstimmung über die Tagesordnungspunkte 13 bis 23
Präsidentin Doris Bures: Wir kommen zu den verlegten Abstimmungen über die Berichte des Ausschusses für Arbeit und Soziales.
Wir gelangen zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 13: Antrag des Ausschusses für Arbeit und Soziales, dem Abschluss des Staatsvertrages: Abkommen im Bereich der sozialen Sicherheit zwischen der Republik Österreich und Kanada, in 1031 der Beilagen, gemäß Art. 50 Abs. 1 Z 1 Bundes-Verfassungsgesetz die Genehmigung zu erteilen.
Wer dafür seine Zustimmung gibt, den ersuche ich um ein Zeichen. – Das ist einstimmig so angenommen.
Abstimmung über Tagesordnungspunkt 14: Antrag des Ausschusses für Arbeit und Soziales, seinen Bericht 1084 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen.
Wer ist dafür, den bitte ich um ein Zeichen? – Auch das ist mit Mehrheit angenommen.
Ich weise den Antrag 1900/A(E) dem Ausschuss für Wirtschaft, Industrie und Energie zu.
Abstimmung über Tagesordnungspunkt 15: Antrag des Ausschusses für Arbeit und Soziales, den Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des Covid-19-Krisenbewältigungsfonds für März 2020 bis Juli 2021, vorgelegt vom Bundesminister für Arbeit, III-401 der Beilagen, zur Kenntnis zu nehmen.
Wer ist für diese Kenntnisnahme? – Das ist die Mehrheit, angenommen.
Abstimmung über Tagesordnungspunkt 16: Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Mutterschutzgesetz geändert wird, samt Titel und Eingang in 1086 der Beilagen.
Wer sich für diesen Gesetzentwurf ausspricht, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung? – Das ist mit Mehrheit angenommen.
Wir kommen sogleich zur dritten Lesung.
Wer in dritter Lesung dem Gesetzentwurf seine Zustimmung gibt, den ersuche ich um ein Zeichen. – Der Gesetzentwurf ist in dritter Lesung mit Mehrheit angenommen.
Abstimmung über Tagesordnungspunkt 17: Antrag des Ausschusses für Arbeit und Soziales, seinen Bericht 1087 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen.
Wer ist für diese Kenntnisnahme? – Das ist die Mehrheit. Damit ist dieser Bericht zur Kenntnis genommen.
Abstimmung über Tagesordnungspunkt 18: Antrag des Ausschusses für Arbeit und Soziales, seinen Bericht 1088 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen.
Wer spricht sich dafür aus? – Der Bericht ist mit Mehrheit zur Kenntnis genommen.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Erwin Angerer, Kolleginnen und Kollegen betreffend „die Einführung einer Lehrabschlussprämie“.
Wer sich dafür ausspricht, den bitte ich um ein Zeichen. – Das ist die Minderheit, abgelehnt. (Unruhe im Saal.)
Abstimmung über Tagesordnungspunkt 19: Antrag des Ausschusses für Arbeit und Soziales, seinen Bericht 1089 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen.
Wer für diese Kenntnisnahme ist, den bitte ich um ein Zeichen. – Der Bericht ist mit Mehrheit zur Kenntnis genommen.
Abstimmung über Tagesordnungspunkt 20: Antrag des Ausschusses für Arbeit und Soziales, seinen Bericht 1090 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen.
Wer für diese Kenntnisnahme ist, den bitte ich um ein Zeichen. – Der Bericht ist mit Mehrheit so angenommen.
Abstimmung über Tagesordnungspunkt 21: Antrag des Ausschusses für Arbeit und Soziales, seinen Bericht 1091 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen.
Wer spricht sich dafür aus? – Der Bericht ist mit Mehrheit so angenommen.
Abstimmung über Tagesordnungspunkt 22: Antrag des Ausschusses für Arbeit und Soziales, seinen Bericht 1092 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen.
Wer ist dafür? – Das ist mit Mehrheit so angenommen.
Abstimmung über Tagesordnungspunkt 23: Antrag des Ausschusses für Arbeit und Soziales, seinen Bericht 1093 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen.
Wer spricht sich dafür aus? – Der Bericht ist mit Mehrheit zur Kenntnis genommen.
Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Alois Stöger, Kolleginnen und Kollegen betreffend „finanzielle Hilfe für Menschen, die schon lange arbeitslos sind“.
Wer sich für diesen Entschließungsantrag ausspricht, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung? – Das ist die Minderheit, abgelehnt.
Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie und Energie über die Regierungsvorlage (958 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Handelsstatistische Gesetz 1995 geändert wird (1057 d.B.)
25. Punkt
Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie und Energie über die Regierungsvorlage (1033 d.B.): Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Slowenien zur Beendigung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik Slowenien über die gegenseitige Förderung und den Schutz von Investitionen (1058 d.B.)
26. Punkt
Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie und Energie über die Regierungsvorlage (1032 d.B.): Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Kroatien zur Beendigung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik Kroatien über die Förderung und den Schutz von Investitionen (1059 d.B.)
27. Punkt
Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie und Energie über die Regierungsvorlage (1036 d.B.): Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Malta zur Beendigung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und Malta über die Förderung und den gegenseitigen Schutz von Investitionen (1060 d.B.)
Präsidentin Doris Bures: Damit gelangen wir nun zu den Tagesordnungspunkten 24 bis 27, über welche die Debatten unter einem durchgeführt werden.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Als erster Redner zu diesen Tagesordnungspunkten gelangt Herr Abgeordneter Peter Haubner zu Wort. – Bitte.
Abgeordneter Peter Haubner (ÖVP): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau Ministerin! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich rede heute zum Handelsstatistischen Gesetz. Österreich ist ja bekanntlich ein sehr erfolgreiches Exportland. Wir verdienen 6 von 10 Euro im Ausland, 5 von 10 Euro in Europa. Wir haben 62 000 exportierende Betriebe in unserem Land und eine Exportquote, die höher als 50 Prozent des BIPs ist, und jeder zweite Job ist direkt oder indirekt mit dem Export verbunden. Es ist auch sehr deutlich erkennbar, dass wir als Exportnation im weltweiten Ranking ziemlich weit vorne liegen. Schaut man sich die Pro-Kopf-Exportquote an, dann sieht man, dass wir weltweit auf dem siebten Platz liegen.
Das sind die erfreulichen Exportdaten der österreichischen Wirtschaft, und da ist es natürlich auch wichtig, dass es statistische Erhebungen gibt. Die Außenhandelsstatistik ist eine wichtige Datenquelle und eine Grundlage für viele multilaterale und bilaterale Verhandlungen, und wir versuchen natürlich auch immer, die Statistik, nämlich die Erhebungen dafür, so einfach wie möglich zu machen, und da setzt diese neue Maßnahme an.
Es gibt ja, wie wir wissen, international zwei Statistiken für den Außenhandel: eine Statistik über den Extra-EU-Handel, die sich mit den Exporten und Importen der europäischen Länder und Drittländer beschäftigt, und die andere ist eben die Intra-EU-Handelsstatistik, die den Warenverkehr innerhalb der EU-Staaten erfasst. Heute beschäftigen wir uns mit der Modernisierung der Intra-EU-Handelsstatistik. Ein Kernelement dieser Modernisierung ist natürlich die gänzliche Umstellung auf die elektronische Meldeschiene. Damit verbunden ist eine Erhöhung der Datenqualität.
Mit dieser Novelle vollziehen wir einen Lückenschluss in der digitalen Landschaft und stellen die Weichen für ein qualifiziertes Single-Flow-System. Das ist ganz wichtig, weil es für die Unternehmer eine Vereinfachung darstellt und eine wesentliche Modernisierung mit sich bringt. In diesem neuen System wird auch auf die direkte Erhebung der Intra-EU-Einfuhrseite verzichtet, und das ist ein ganz wichtiger Punkt für unsere Unternehmen, da zu erwarten ist, dass sich die statistische Belastung für diese wesentlich reduziert, meine Damen und Herren. (Beifall bei der ÖVP sowie der Abgeordneten Jakob Schwarz und Weratschnig.)
Ich denke, dass wir hier wieder einen richtigen Schritt in Richtung Förderung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft setzen und dass es auch ganz wichtig ist, dass wir im internationalen Konzert der Wirtschaft auch immer gutes Datenmaterial für unsere Verhandlungen und für unsere Abkommen haben. In dieser Hinsicht bin ich froh, dass wir das heute hier so beschließen und damit wieder einen Beitrag zur Modernisierung und Entbürokratisierung leisten. – Danke. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
18.17
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Christoph Matznetter. – Bitte.
Abgeordneter Dr. Christoph Matznetter (SPÖ): Frau Präsidentin! Frau Bundesministerin! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Geschätzte Zuseherinnen und Zuseher! Im
Unterschied zu den Regierungsfraktionen stehen wir ja für eine ernsthafte Beteiligung in diesem Parlament. Während Anträge, wenn sie von der Opposition kommen, von den Regierungsfraktionen entweder abgelehnt oder vertagt werden, egal wie vernünftig oder unvernünftig sie sind, werden wir den hier gemeinsam verhandelten Punkten zustimmen, weil sie durchgeführt werden sollten oder müssten. Daran sieht man: „Der Vergleich macht Sie sicher“, um es mit der Werbung eines großen Elektrokonzerns aus der Vergangenheit zu sagen.
Ich möchte aber die Gelegenheit nützen, Frau Bundesministerin, wenn wir hier schon über die Chancen und Risken für die österreichische Wirtschaft sprechen, das Folgende zu sagen: Die Pandemie ist nicht vorbei. Die Folgewirkungen, auch im wirtschaftlichen Bereich, sind nicht vorbei. Auch wenn Investitionen in Malta und anderswo künftig durch EU-Recht geschützt werden, haben wir dennoch eine Reihe von Branchen und vor allem Unternehmen und Unternehmer, die noch mit ernsthaften Schwierigkeiten zu kämpfen haben.
Ich möchte an dieser Stelle darauf verweisen, dass zum Beispiel die ganze Branche der Fremdenführerinnen und Fremdenführer im stadttouristischen Bereich seit Anfang 2020 – also noch vor dem März! – de facto ohne Umsätze ist. Deren Existenz ist vom Härtefallfonds abhängig, damit gibt es zumindest seit Mitte März 2020 eine Möglichkeit des Überlebens. Frau Bundesministerin, wir haben es bereits mehrfach angesprochen: Es kann nicht sein, dass der Härtefallfonds auch für diese Branchen einfach ersatzlos ausläuft.
Was ist damit? Wieso kommt keine Verlängerung des Härtefallfonds? Was ist mit den Tontechnikern von Veranstaltungen, was ist mit vielen Teilen der Nachtgastronomie? Wir haben eine Reihe von Branchen, die mit 2,5G oder möglicherweise überhaupt nur noch mit 2G oder 1G in diesen Winter gehen und wahrscheinlich keine Chance haben, vor dem nächsten Jahr entsprechende Umsätze zu machen, die das Überleben aus dem Unternehmerlohn erlauben.
Warum schläft da die Bundesregierung? Warum lässt man diese Förderungen einfach auslaufen? Man kann ja im Einzelfall überprüfen, ob ein Anspruch besteht, und wenn einer sowieso genug Einnahmen hat, dann braucht er sie auch nicht zu bekommen – wir haben ja die Regeln längst in anderen Bereichen, beispielsweise bei den Fixkosten. Und wiederum meine Annahme: Wenn ich vonseiten der Opposition jetzt einen Antrag stelle, kommt die Reaktion Begräbnis erster Klasse durch Vertagen oder Ablehnung, nur weil er von der Opposition kommt.
Jetzt frage ich Sie, Frau Bundesministerin, was sollen wir da tun? – Ich kann Sie nur vom Pult daran erinnern, dass Sie in diesem Bereich Handlungsbedarf haben, und hoffen, dass Sie den Antrag bringen, weil meiner vertagt wird, wurscht wie gescheit er ist.
In diesem Sinne mein Appell, diese Gesetzesmaterien nicht nur einvernehmlich zu beschließen, sondern auch sinnvolle Dinge zu tun – jetzt schaue ich den Wirtschaftsbundabgeordneten (in Richtung ÖVP) besonders tief in die Augen. Schaut, dass ihr das auf die Reihe bekommt! Ich verspreche, dass ich jeder Verlängerung des Härtefallfonds zustimmen werde, weil ich mich für die kleinen Selbstständigen einsetze und ganz genau weiß, dass darunter Tausende oft Einpersonenunternehmen sind, deren Existenz daran hängt.
An der Stelle sei auch daran erinnert, dass es oft Frauen sind, die am Arbeitsmarkt in einem Alter ab 40 oder 50 kaum mehr eine Chance haben, weshalb sich viele davon selbstständig gemacht haben – eigentlich das machen, was man von ihnen erwartet – und jetzt ihre Existenz gefährdet sehen. Und dann haben wir eine Bundesregierung, die in der Pendeluhr schläft und nicht in der Lage ist, den Härtefallfonds zu verlängern.
In diesem Sinne hoffe ich auf produktive Beiträge und darauf, dass die Oppositionsanträge vielleicht weniger vertagt oder abgelehnt werden, sondern dass die gescheiteren
vielleicht angenommen werden. Das hilft dem ganzen Land und auch der Regierung, die eh schon genug taumelt, seien wir uns ehrlich. – Danke. (Beifall bei der SPÖ.)
18.21
Präsidentin Doris Bures: Als nächster Redner gelangt Herr Abgeordneter Erwin Angerer zu Wort. – Bitte.
Abgeordneter Erwin Angerer (FPÖ): Frau Präsidentin! Frau Minister! Ja, auf der Tagesordnung stehen jetzt tatsächlich das Handelsstatistische Gesetz und drei Investitionsschutzabkommen, die aufgehoben werden. Über die drei Investitionsschutzabkommen kann man noch reden, ja, auch im Ausschuss haben wir darüber geredet. Investitionsschutz ist wichtig, drei Abkommen sind aufgehoben worden und da wird es neue Regelungen brauchen. Aber das Handelsstatistische Gesetz, mit dem sich ja Kollege Haubner sehr intensiv befasst hat? – Ich glaube, zurzeit haben viele Unternehmer andere Probleme!
Eines dieser Probleme würde ich gerne ansprechen, Frau Minister, und vielleicht können Sie in Ihrem Redebeitrag etwas dazu sagen. Ich weiß nicht, ob Sie mit der Branche schon Kontakt gehabt haben, aber eine Branche, die von der Coronakrise massiv betroffen ist, ist die Friseurbranche. Dort sind auch viele in die Schwarzarbeit abgedriftet. Die Branche kämpft massiv mit diesem Problem. Es gibt auch schon lange die Forderung – auch über die Wirtschaftskammer, aber die Wirtschaftskammer interessiert das offensichtlich gleichfalls nicht –, dass man in diesem Bereich die Mehrwertsteuer auf 10 Prozent senkt. – Kollege Kopf schüttelt schon den Kopf; offensichtlich ist ihm das Problem bekannt.
Es wäre mir ein wichtiges Anliegen, dass Sie vielleicht auch für solche Branchen – ich habe jetzt mit der Friseurbranche nur ein Beispiel herausgenommen, aber da gibt es doch 18 000 Unternehmen mit Tausenden Mitarbeitern in Österreich – etwas zu tun gedenken und überlegen, dieses Problem der Schwarzarbeit in den Griff zu bekommen. – Danke schön. (Beifall bei der FPÖ.)
18.23
Präsidentin Doris Bures: Als nächste Rednerin gelangt Frau Abgeordnete Elisabeth Götze zu Wort. – Bitte.
Abgeordnete Dr. Elisabeth Götze (Grüne): Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau Ministerin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Liebe ZuseherInnen! Auch ich spreche zum Handelsstatistischen Gesetz sowie zur Beendigung der Handelsabkommen mit Slowenien, Kroatien und Malta – da geht es um technische Änderungen, die notwendig sind. Ich möchte das aber zum Anlass nehmen, über etwas Fundamentales, das uns hier, glaube ich, intensiv beschäftigt, zu sprechen, und das ist die EU: die Chancen, die uns die EU bietet, sicher auch die Möglichkeiten und zum Teil die Verpflichtungen.
1952 als Montanunion gegründet, ist sie ein großartiges Friedensprojekt, und dieses Friedensprojekt funktioniert über einen gemeinsamen Markt. Österreich profitiert davon sehr stark, wir haben schon Kollegen Haubner gehört, der die Zahlen genannt hat. Zwei Drittel der Importe und Exporte macht Österreich mit der EU, circa im gleichen Ausmaß, und so steigert dieser gemeinsame Markt, dieser Binnenmarkt, könnte man auch sagen, unser Bruttoinlandsprodukt um jährlich mehr als 1 500, um fast 1 600 Euro pro Kopf. Das ist wesentlich mehr als bei anderen EU-Ländern, wir profitieren also besonders stark von der EU.
Es gibt neue Herausforderungen, und auch denen wendet sich die EU zu, beispielsweise der Bekämpfung der Klimakrise und auch der Forcierung der Digitalisierung: All das
schaffen wir gemeinsam mit der EU, auch eine gemeinsame, eine EU-weite CO2-Bepreisung. Mit der ökosozialen Steuerreform haben wir das auch in Österreich geschafft. Verschiedene Länder haben auch CO2-Bepreisung, aber eine gemeinsame ist sicher ein nächster Schritt, insbesondere auch der Grenzausgleich, um diese, wie es genannt wird, Carbonleakage zu verhindern, das heißt, dass Unternehmen nach außerhalb der EU abwandern, wo CO2 nicht bepreist wird, und dadurch einen Wettbewerbsvorteil haben. Das müssen wir zukünftig verhindern. (Beifall bei den Grünen, bei Abgeordneten der ÖVP sowie der Abg. Krisper.)
Ich bitte also um Zustimmung zu diesen technischen Punkten, zu diesen technischen Details. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, uns wieder der Bedeutung der EU bewusst zu werden. Wir sind gerne Teil dieser Staatengemeinschaft. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
18.26
Präsidentin Doris Bures: Als nächster Redner gelangt Herr Abgeordneter Helmut Brandstätter zu Wort. – Bitte.
Abgeordneter Dr. Helmut Brandstätter (NEOS): Frau Präsidentin! Frau Bundesministerin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher! Zum rein Technischen: Diese Investitionsschutzabkommen brauchen wir nicht mehr, weil wir in der EU etwas Besseres haben. Das ist sehr gut.
Jetzt möchte ich gleich auf das replizieren, was Kollege Haubner gesagt hat. Ja, wir sind sehr erfolgreich im Export, und ja, Frau Kollegin Götze, innerhalb der EU geht es uns sehr gut, aber das müssen wir auch weiterentwickeln! Schauen wir uns die Zahlen an! Was die Exportquote etwa nach Südamerika betrifft, beträgt diese nur 0,9 Prozent, obwohl das ein riesiger Exportmarkt wäre, oder die nach Asien beträgt nur 2,1 Prozent – und wir wissen, dass es dort ein besonders starkes Wachstum gibt. Da müssen wir auch gemeinsam innerhalb der EU mehr machen, und das geht wohl nur mit Freihandel.
Heute habe ich ein Buch mitgebracht, das ich nicht nur mitgebracht habe, weil Sie (in Richtung Bundesministerin Schramböck) das lesen sollten: „The World is Flat“. (Der Redner hält das genannte Buch von Thomas L. Friedman in die Höhe.) Das kennen Sie, Frau Bundesminister? (Bundesministerin Schramböck: Das kriege ich jetzt?) – Ja (das genannte Buch Bundesministerin Schramböck überreichend), sehr gut! Dieses Buch von Thomas Friedman von der „New York Times“ ist deswegen so spannend, weil es nicht neu ist, sondern 2005 geschrieben wurde, und er vieles vorausgesehen hat, womit Sie, Frau Bundesministerin, sich jetzt zu beschäftigen haben, zum Beispiel die Frage der Supplychains – das alles wird darin schon angesprochen –, weil das mit Asien möglicherweise schwieriger wird.
Auch der Freihandel wird angesprochen – und da gehe ich ein Stück weiter, ich möchte sehr gerne von wertebasiertem Freihandel sprechen –: Wir können nicht sagen, nein, wir handeln nicht mit Nationen, deren Regime und deren Systeme uns vielleicht nicht gefallen. Nein – wir handeln dann nicht mit ihnen, wenn sie gewisse Bedingungen nicht erfüllen, und da ist für mich das Wesentliche natürlich der Sozialbereich und natürlich auch der Umweltbereich. Wenn ich den neuen Herrn Bundeskanzler gestern richtig verstanden habe, möchte er seine erste Reise nach Brüssel zur Kommission machen, und da wird er auch über Freihandel sprechen.
Da stelle ich aber dann die Frage, warum, wenn wir – Kollege Matznetter hat es ja auch angesprochen; es ist offensichtlich das Leid der Opposition – im Ausschuss einen Antrag zum Freihandel stellen, dieser dann einfach abgeschmettert wird. Ich verstehe das nicht, weil es, wie gesagt, nicht um irgendeinen Freihandel geht, sondern natürlich um wertebasierten Freihandel, und diesbezüglich glaube ich, dass wir da auch in eine Diskussion eintreten sollten, die eben dem ganzen Land nützt.
Lassen Sie mich von wertebasiertem Freihandel sprechen – da gibt es jetzt eine Aktion ‑: Sie kennen natürlich diesen Mann (eine Tafel in die Höhe haltend, auf der ein Foto von Jair Bolsonaro und der Text: „The Planet vs Bolsonaro“ zu sehen ist), das ist ein Böser. Das lässt sich sehr einfach sagen, weil er den Amazonas anzündet. Das ist Jair Bolsonaro, und da können wir jetzt natürlich sagen: Gut, wir wollen mit den Brasilianern nichts zu tun haben!, und kaufen denen nichts ab. Das wird aber nicht reichen. Wir müssen nicht nur in einen Dialog eintreten, sondern das sehen, was diesbezüglich eine österreichische NGO namens Allrise gemeinsam mit anderen NGOs macht, und das ist, ein strafrechtliches Verfahren gegen Jair Bolsonaro vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag anzustrengen.
Ich kann nur sagen: Schauen Sie sich das bitte an! „The Planet vs Bolsonaro“ – das kann man sich im Internet anschauen, das kann man unterstützen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass es auch auf dieser Ebene zum Thema gemacht wird, nämlich: Da geht es um Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Andere Unrechtsregime und Führer von Unrechtsregimen sind auch schon draufgekommen, was es bedeutet, wenn etwas als Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft wird. Da ging es dann eben um Verbrechen gegen Personen, in dem Fall geht es um Verbrechen gegen die Umwelt, weil das ja genauso nicht nur das Leben der Menschen in Südamerika, im Amazonasgebiet bedroht, sondern auch uns. – Einen Klimavortrag muss ich Ihnen nicht halten. Sie wissen, wie da der Zusammenhang ist.
In diesem Sinne möchte ich, dass wir eine differenzierte Debatte führen: Ja zu Handel, ja zu Freihandel, auch zu wertebasiertem Freihandel. Gleichzeitig aber sollen wir diejenigen, die unseren Planeten zerstören, anklagen, und sie sollen erleben, was ihnen dann passiert. – Danke schön. (Beifall bei den NEOS.)
18.30
Zurückziehung eines Verlangens auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses
Präsidentin Doris Bures: Ich gebe bekannt, dass das heute eingebrachte Verlangen 3/US zurückgezogen wurde und das hierzu gestellte Verlangen auf Durchführung einer kurzen Debatte auch hinfällig ist.
Verlangen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses
Präsidentin Doris Bures: Jedoch gebe ich weiters bekannt, dass das von mindestens 46 Abgeordneten unterstützte Verlangen 4/US auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses gemäß § 33 Abs. 1 der Geschäftsordnung betreffend „Klärung von Korruptionsvorwürfen gegen ÖVP-Regierungsmitglieder (ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss)“ eingebracht wurde.
Dieses wird gemäß § 33 Abs. 2 der Geschäftsordnung an alle Abgeordneten verteilt.
Ferner liegt das von fünf Abgeordneten gemäß § 33 Abs. 4 der Geschäftsordnung gestellte Verlangen vor, eine Debatte über dieses Verlangen durchzuführen. Diese findet nach Erledigung der Tagesordnung statt.
Die Zuweisung des gegenständlichen Verlangens an den Geschäftsordnungsausschuss erfolgt gemäß § 33 Abs. 6 der Geschäftsordnung am Schluss dieser Sitzung.
*****
Zu der jetzt laufenden Debatte betreffend Handelsstatistisches Gesetz erteile ich Herrn Abgeordnetem Johann Höfinger das Wort. – Bitte.
18.32
Abgeordneter Johann Höfinger (ÖVP): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Frau Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist erfreulich, dass die Punkte, die jetzt in diesem Block diskutiert werden, so wie es aussieht, von allen Fraktionen mitgetragen werden. Das ist auch ein wichtiges Signal an unsere Wirtschaft.
Ich darf ganz kurz auf das Handelsstatistische Gesetz eingehen – es wurde von meinen Vorrednern schon sehr ausführlich erläutert –: Es geht dabei auch um Vereinfachungen, es geht um die Digitalisierung, um einen Lückenschluss in der Digitalisierung. Das ist wichtig, denn wenn etwas vereinfacht wird, dann braucht man dafür auch weniger Zeit aufzuwenden, und diese kann dann in unternehmerischer Art und Weise woanders eingesetzt werden. Daher ist es wie gesagt von unserer Seite eine Selbstverständlichkeit, dass wir dies unterstützen.
Ich möchte die Gelegenheit aber auch ganz kurz nutzen, um mich bei allen Unternehmerinnen und Unternehmern in diesem Land zu bedanken, die in den letzten eineinhalb Jahren unter dieser besonderen Herausforderung, unter ganz schwierigen Bedingungen ihr Unternehmen am Laufen gehalten haben. Ich möchte auch jenen danken, die Teil einer Branche sind, die in Wirklichkeit zum Erliegen gekommen ist, aber jetzt wieder den Ansporn haben, unsere Wirtschaft anzukurbeln. Das ist so wichtig für sie als Arbeitgeber, für die Menschen, die bei ihnen Arbeit finden, das ist so wichtig für die Wertschöpfung in diesem Land, und das gibt uns allen Mut. Dafür meinen herzlichen Dank. Ich darf ihnen für die Zukunft wirklich alles, alles Gute wünschen. – Vielen Dank. (Beifall bei der ÖVP.)
18.33
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Maximilian Lercher. – Bitte.
Abgeordneter Maximilian Lercher (SPÖ): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Frau Ministerin! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ja, wir werden unsere Zustimmung geben, und ich glaube, es ist auch ein gutes Zeichen für dieses Haus, dass es Materien gibt, die über alle Parteigrenzen hinweg Zustimmung finden.
Nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man, wenn man an dieser Stelle von Parlamentarismus spricht, festhalten, was Kollege Matznetter schon angesprochen hat, nämlich dass natürlich auch die Oppositionsparteien gute, sinnvolle Gesetzesvorschläge einbringen, diese aber aufgrund der Machtlogik der Volkspartei immer und immer wieder vertagt werden. Wenn Sie hier immer davon sprechen, dass wir im Sinne von Österreich zusammenarbeiten sollen, wäre es nett, wenn Sie selbst auch diese Zusammenarbeit leben würden. (Beifall bei der SPÖ sowie des Abg. Brandstätter.)
Das wäre für uns und, wie ich glaube, auch für diese Republik sehr, sehr wichtig, denn das Leben ist keine Einbahnstraße, und wie man sieht, kann man sehr, sehr schnell auch wieder auf andere angewiesen sein. Wenn es um Österreich geht, dann, glaube ich, hat Machtlogik keinen Platz.
Ich habe mir, weil viel von Wettbewerbsfähigkeit gesprochen wurde, angeschaut, wie Vermögen in Österreich verteilt ist, Frau Ministerin. Es gibt 46 Personen beziehungsweise Familien, die ein Milliardenvermögen besitzen. Das werden die sein, die hauptsächlich von der Körperschaftsteuersenkung profitieren. Warum geben Sie dieses Geld, das frei wird, nicht den Klein- und Mittelbetrieben in Österreich, die in jeder Sonntagsrede beschworen werden? Warum geben Sie das Volumen, das frei wird, nicht jenen, die jetzt schon den Großteil an Steuerlast tragen, die die Ausbildungsplätze garantieren, die sich Tag für Tag bemühen: den EPUs, den Kleinen, den Mittleren, die unseren Exportstandort am Laufen halten und die in Wahrheit auch einen Großteil der Steuerlast tragen?
Warum bekommen die nicht das Geld? – Ich sage es Ihnen ganz ehrlich: weil die eben nicht so gespendet haben. Das ist doch der Grund in all Ihren Entscheidungen, wie wir jetzt auch aus den Chats wissen. Da geht es nie um die wirklichen Leistungsträgerinnen und Leistungsträger in diesem Land (Zwischenruf des Abg. Hörl), sondern ausschließlich um jene, die Ihnen gegeben haben. Die bekommen jetzt zurück, und das ist nicht in Ordnung, das hat sich der Wirtschaftsstandort nicht verdient.
Anstatt dass Sie die Spekulation und die großen Vermögen fördern, fördern Sie doch bitte wieder die Realwirtschaft, die es dringend brauchen würde (Zwischenrufe der Abgeordneten Haubner und Hörl), damit Beschäftigung entsteht, damit Wertschöpfung und Wohlstand gerecht verteilt werden! Die haben es sich verdient und die warten schon viel zu lange darauf, Frau Ministerin. (Beifall bei der SPÖ.)
Kollege Obernosterer hat das ja heute in seiner Rede, glaube ich, auch unbewusst zugegeben. Ich habe genau zugehört, als er sagte: Ja, die Körperschaftsteuer ist für die Milliardäre, aber der Rest kommt eh für die anderen. – Das ist ja ein wahres Wort aus eurem Munde! (Neuerlicher Zwischenruf des Abg. Hörl.) Wenn ich richtig hingehört habe, hat er das heute so gesagt, und damit hat er etwas Wahres gesagt, denn es ist natürlich volkswirtschaftlich nicht richtig, was Sie hier tun.
Entlasten Sie doch die wirklichen Leistungsträgerinnen und Leistungsträger! Machen Sie einen Systemwandel für all jene, die schon unter dem Druck stöhnen, die eh schon zu viel bezahlen und zu viel einbringen! Entlasten wir doch die, die sich jeden Tag bemühen! – Das sind in Sonntagsreden doch immer auch Ihre Worte. Die kleinen und mittleren Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich sind diejenigen, die Sie im Fokus haben sollten, und nicht die großen, die die Spenderinnen und Spender sind. Die haben genug. Es ist an der Zeit, dass die anderen auch wieder genug bekommen, und darum würde ich bitten. (Zwischenruf des Abg. Schnabel.) – Vielen Dank. (Beifall bei der SPÖ.)
18.38
Präsidentin Doris Bures: Nun hat sich Frau Bundesministerin Margarete Schramböck zu Wort gemeldet. – Bitte, Frau Ministerin.
Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Dr. Margarete Schramböck: Frau Präsidentin! Hohes Haus! Es geht in diesem Zusammenhang natürlich um Folgen, die aus einem europäischen Urteil abzuleiten sind, dem sogenannten Achmea-Urteil. Man glaubt oft nicht, welche Auswirkungen diese Urteile haben, denn sie haben natürlich den geringeren Schutz österreichischer Unternehmen, die vor allem in Osteuropa als die größten Investoren auftreten, zur Folge. Deshalb ist es mir ein Anliegen – und ich danke Ihnen für die Unterstützung in diesem Zusammenhang –, dass wir über die Abkommen mit diesen Ländern nicht in Bausch und Bogen entscheiden, sondern mit jedem Land verhandeln, und das tun wir auch – zum Schutz der österreichischen Investitionen.
Es ist auch weiters wichtig, dass wir mehr für den Schutz dieser Investitionen tun. Sie wissen, dass ich mich stark für die Investitionskontrolle eingesetzt habe, wir haben das Gesetz auch gemeinsam verabschiedet. Das ist ein gutes Gesetz: Wir können jetzt zum ersten Mal transparent sehen, wer denn österreichische Unternehmen übernimmt, da Auflagen erteilen. Es ist auch wichtig, dass wir aufseiten der Europäischen Union da weiterarbeiten, denn beides ist notwendig: Offenheit auf der einen Seite, aber auch weniger Naivität als in den letzten 20 Jahren auf der anderen Seite.
Ich habe das selbst miterlebt. Ich war in der IT-Branche tätig, und – Sie wissen das – wir sind ausverkauft worden. Wir wurden übernommen, primär nicht so sehr von chinesischen, sondern von amerikanischen Unternehmen, und diese Unternehmen sind jetzt
nicht mehr da. Man wundert sich oft und fragt sich: Warum gibt es eigentlich keine großen Technologieunternehmen mehr in Europa?
Das ist Aufgabe der Kommission – und da arbeite ich intensiv mit ihr zusammen –: Es braucht ein neues Wettbewerbsrecht für Europa, es braucht einen Investitionsschutz und es braucht auch den Schutz der europäischen Unternehmen, und zwar im Beihilfenrecht. Es geht darum, dass China im Hintergrund Unternehmen mit Förderungen unterstützt, und das übrigens schon seit Jahrzehnten, und daher europäische Technologieunternehmen – es geht vor allem um Technologieunternehmen – diesen asiatischen, vor allem chinesischen, Technologieunternehmen gegenüber nicht mehr wettbewerbsfähig sind.
Es braucht auch ein Abkommen mit China zum Investitionsschutz. Was die Europäische Kommission macht, nämlich das Thema aufzuschieben und mit anderen Themen zu junktimieren, sehe ich als nicht sehr gut an. Wir brauchen den Investitionsschutz für die europäischen Unternehmen, denn die werden nicht aufhören, in China zu investieren. Ich werde alles dafür tun, dass wir diesbezüglich wieder in die Gänge kommen und dass die Europäische Union das auch entsprechend in Angriff nimmt.
Sie haben auch einen weiteren Punkt angesprochen: Produktionen. Ja, es ist wichtig, auf genau diese Wertschöpfungsketten zu schauen, denn es reicht nicht aus, dass wir sagen, wir geben alles nach Asien und es wird schon kein Problem für uns sein. Nicht erst Covid hat uns diesbezüglich aufgeweckt, sondern das Thema hatten wir auch vorher schon. Es braucht mehr Wertschöpfung in Österreich und in Europa. Es geht darum, Produktionen hier zu halten, Produktionen zurückzubringen, denn auch das hat mit Wertschöpfung zu tun.
Ich möchte noch auf das Thema KMUs und Unterstützung der KMUs eingehen. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass von den 40,8 Milliarden Euro an Covid-Hilfen ein Großteil den österreichischen KMUs zugutegekommen ist, und das wird auch bei der Steuerreform so sein. Die österreichischen KMUs werden vor allem davon profitieren, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter netto mehr bekommen. Diese werden dadurch mehr konsumieren, mehr ausgeben können, und das ist auch wichtig und gut so.
Ich bin vor Kurzem von einem Journalisten gefragt worden, warum ich als Wirtschaftsministerin der ÖVP dafür bin, dass wir da ein nachfrageorientiertes Modell fahren. – Ich bin dafür, weil ich davon überzeugt bin, dass das richtig ist, und weil es nicht darum geht, wer früher was in welche Richtung gesagt hat, sondern darum, dass wir die Wirtschaft unterstützen, dass wir sie gerade in dieser Phase ankurbeln, und dass wir enorm weiterwachsen. Das wollte ich mit Ihnen teilen. Ich danke Ihnen für die Unterstützung hinsichtlich der vorgelegten Punkte. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
18.42
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Johann Singer. – Bitte.
Abgeordneter Johann Singer (ÖVP): Frau Präsidentin! Frau Bundesministerin! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren vor den Bildschirmen! Wir haben zu diesem Tagesordnungspunkt schon vieles angesprochen. Ein Thema, das auf der Tagesordnung steht, ist die Auflösung von Abkommen über die gegenseitige Förderung und den Schutz von Investitionen. Danke, Frau Bundesministerin, Sie haben schon die entsprechenden Erläuterungen, warum diese Auflösungen notwendig sind, gegeben.
Ein paar Punkte darf ich dazu noch anführen. Österreich hat ja nicht nur mit EU-Ländern solche Abkommen geschlossen, sondern auch mit Drittstaaten, insgesamt 48 an der
Zahl. Das betrifft Länder wie zum Beispiel Ägypten, Vietnam, Argentinien und Malaysia, also Länder aus der gesamten Welt.
Worum geht es? – Es geht um Abkommen zur Sicherheit von Investitionen, natürlich auf gegenseitiger Basis. Welche Maßnahmen sind da betroffen? – Es geht vor allem um den Grundsatz fairer und gerechter Behandlung. Was ist gemeint? – Gemeint ist ein Vertrauensschutz, das Verbot der Rechtsverweigerung und natürlich auch die Transparenz bei Gerichts- und Verwaltungsverfahren. Auch der Schutz gegen rechtswidrige Enteignung oder der Anspruch auf Entschädigung bei Verlusten durch kriegerische Handlungen sind inkludiert. Es ist also eine Reihe von Punkten, die in diesen Abkommen abgesichert werden.
Weil der Investitionsschutz so wichtig ist, hat die Bundesregierung im Regierungsübereinkommen auch festgehalten, dass man sich bemühen wird, innerhalb der EU rechtliche Rahmenbedingungen zu setzen, um die Rechtssicherheit für Investitionen zu gewährleisten.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, es ist wichtig, dass es diesen Rechtsschutz gibt, und es ist zu unterstützen, dass sich unsere Bundesregierung sehr bemühen wird, im Bereich der EU entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen. – Herzlichen Dank. (Beifall bei der ÖVP.)
18.45
Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Petra Oberrauner. – Bitte.
Abgeordnete Mag. Dr. Petra Oberrauner (SPÖ): Frau Präsidentin! Frau Ministerin! Ich möchte auch zur Kündigung der bilateralen Handelsverträge sprechen und daran erinnern, dass diese Kündigung auf einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes beruht, das besagt, dass diese bilateralen Abkommen beendet werden müssen, weil sie mit dem Unionsrecht nicht vereinbar sind.
23 von 27 EU-Mitgliedstaaten haben unterzeichnet. Als Folge ist bereits seit 2020 ein Vertrag zur Beendigung der bilateralen Investitionsschutzverträge mit den Mitgliedstaaten in Kraft. Österreich muss zwölf Verträge kündigen, um ein Vertragsverletzungsverfahren abzuwenden, deshalb werden wir da auch zustimmen.
Das Interessante ist, dass seit dem Urteilsspruch Großkonzerne, Investoren und Industrieverbände in Brüssel Sturm laufen, weil sie einen Ersatz für diese Investorenschutzabkommen haben möchten. Die Kommission hat nachgegeben und für Ende dieses Jahres die Einführung eines EU-internen Investorengerichts angekündigt, also eines Sondergerichts, bei dem Investoren Mitgliedstaaten verklagen können, wenn diese unliebsame Gesetze, zum Beispiel betreffend Umweltschutz oder Arbeitnehmerschutz, beschließen.
Diese Geschichte hat ein Déjà-vu bei mir ausgelöst. Wir haben so etwas schon einmal mit Ceta erlebt. Wenn Sie sich erinnern: Damals ist es auch um ein privates Schiedsgericht gegangen und Mag. Kern hat in Brüssel sehr nachhaltig verhandelt, weil das einfach nicht in unserem Sinne war.
Frau Bundesministerin Schramböck redet darüber, einen umfassenden, effektiven Rechtsschutz für Unternehmen im Binnenmarkt schaffen zu wollen, und meint damit natürlich auch dieses Investorengericht. Die Einführung eines solchen Gerichts kann jedoch zur Folge haben, dass es zu einem Chillingeffect kommt und Staaten in vorauseilendem Gehorsam und aus Angst vor teuren Prozessen keine Gesetze mehr in sensiblen Bereichen wie Arbeitnehmerschutz oder Klimaschutz beschließen.
Es geht also um einen Interessenkonflikt zwischen unternehmerischen und öffentlichen Interessen, und es wäre wichtig, da einen ausgewogenen Vorschlag einzubringen. Ein solches Investorengericht schafft unter dem Titel des Standortvorteils natürlich auch Privilegien für Unternehmen, während die öffentlichen Interessen – etwa die Interessen der ArbeitnehmerInnen, Klimaschutz und so weiter – nicht im gleichen Maße berücksichtigt werden. Es gibt in der EU unabhängige Gerichte und ich glaube, dass diese besser als private Investorengerichte dazu geeignet sind, sich mit dieser Thematik im Sinne eines Ausgleichs, auch unter Einbeziehung des öffentlichen Interesses, zu befassen. – Vielen Dank. (Beifall bei der SPÖ.)
18.48
Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Rebecca Kirchbaumer. – Bitte.
Abgeordnete Rebecca Kirchbaumer (ÖVP): Frau Präsidentin! Werte Frau Bundesministerin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuseherinnen und Zuseher zu Hause! Wir sprechen heute über das Handelsstatistische Gesetz. Im Wesentlichen geht es dabei darum, Erleichterungen für Unternehmen zu schaffen. Die vielen bilateralen Abkommen zwischen europäischen Staaten sind in der Form nicht mehr notwendig. Es braucht eine gesamteuropäische Lösung und Mechanismen, welche die heimische Wirtschaft mit ihren Investitionen schützen. Dafür setzt sich unsere Bundesministerin sehr stark ein. – Vielen Dank dafür. (Beifall bei der ÖVP.)
Wir leben in einer globalisierten Welt, als Wirtschaftsstandort Europa, als Wirtschaftsstandort Österreich. Wir als Europa müssen uns als Einheit begreifen und es sollte nicht jedes Land sein eigenes Süppchen kochen, indem es nur Einzelabkommen abschließt. Gemeinsame Rahmenbedingungen zu schaffen, das wird in Zukunft ein wichtiges Instrument sein. Wie wichtig es wäre, zusammenzuarbeiten, hat uns nicht zuletzt die Pandemie gezeigt.
Die Handelsstatistik sagt auch aus, wo wir in Österreich im internationalen Wettbewerb stehen – ein wichtiges Instrument für die Wirtschaft, das dabei hilft, die dazugehörigen Arbeitsplätze zu halten. Unternehmen entlasten, Bürokratieabbau – das brauchen die Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich, damit sie sich mit dem beschäftigen können, was sie gerne tun und was sie auch können, nämlich Unternehmerin oder Unternehmer zu sein.
Nach all der Aufgeregtheit in den letzten Tagen liegt es nun an uns allen, welches Bild wir nach außen tragen. Skandalisierung schädigt das Ansehen Österreichs. Die Wintersaison steht vor der Tür, wir brauchen dazu Gäste und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bitte geben wir ein anderes Bild ab! (Zwischenruf bei der SPÖ.) Wir stehen vor einer Wintersaison, die wirtschaftlich für uns alle ganz, ganz wichtig ist. Damit Gäste zu uns kommen, müssen wir uns auf unsere Herzlichkeit und auf unsere Stärken besinnen. Leben wir mehr Herzlichkeit und weniger Schadenfreude! – Vielen Dank. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
18.50
Präsidentin Doris Bures: Nun ist Herr Abgeordneter Christoph Matznetter zu Wort gemeldet. – Bitte.
Abgeordneter Dr. Christoph Matznetter (SPÖ): Frau Bundesministerin, Sie sind der Anlass, dass ich mich noch einmal zu Wort gemeldet habe. Noch einmal zur Klarstellung: Es ist keine unvernünftige Judikatur. Wir haben eine Europäische Union, in der wir uns auf das Rechtssystem des jeweils anderen Landes verlassen müssen, und daher ist es
grundvernünftig, dass wir diese Dinge wechselseitig anerkennen und diesen Dingen folgen. Wir erwarten dasselbe auch von jenen Unternehmen, die in Österreich investieren; sie haben sich, wenn es Probleme gibt, gefälligst an die österreichische Justiz zu wenden und kommen hier zu ihrem Recht.
Damit sind wir mittendrin in dieser langjährigen politischen Auseinandersetzung und Frage betreffend den Investitionsschutz: Soll es eine Sondergerichtsbarkeit für Konzerne geben? Ich erinnere an die lange dauernde Diskussion zum Thema Ceta. Was soll am Ende des Tages aus so einem Abkommen erwachsen? – Dass ein kanadischer oder – wenn wir dann unter Umständen auch ein Abkommen mit den USA machen – ein amerikanischer Konzern hergeht und ein Land wie Österreich zwingen kann, Regeln aufzustellen, die der hiesige Gesetzgeber nicht aufgestellt hat. Ehrlich gesagt, bei aller Liebe zum Liberalismus, das ist kein faires Spielfeld, weil der kleine Unternehmer, der Einzelunternehmer, der Konsument nur die Gerichtsbarkeit hat; der hat keine Staffel von Anwälten und keine Sondergerichtsbarkeit, wo er Schadenersatz bekommt.
Diese Durchbrechung ist kein vernünftiges System, daher ist das EU-System als solches zu begrüßen. Und gerade in Zeiten wie diesen, in denen ein Gericht in Polen meint, es muss die gesamte Rechtsordnung der Europäischen Union sprengen, ist es wohl der ungünstigste Zeitpunkt, darüber zu philosophieren, dass man irgendwelche Sonderregelungen braucht.
Innerhalb der Europäischen Union muss gelten: überall Rechtsstaat, wechselseitige Anerkennung, wechselseitiger Vollzug. Wenn die Bürgerinnen und Bürger ihre Verkehrsstrafen aus Italien oder Kroatien zu Hause zahlen müssen, dann wird gefälligst auch für große Unternehmen gelten, dass sie sich den dortigen Regeln zu unterwerfen haben. – Full stop an dieser Stelle.
Der andere Teil, Frau Bundesministerin, dass Sie sagen, es braucht eine vernünftige Investitionskontrolle, ist selbstverständlich eine Notwendigkeit. Ich erinnere nur – ich war ja selber nicht unbeteiligt – an das Vorläufergesetz, das wir mit dem Außenhandelsgesetz 2011 hatten. Da haben wir ja schon gesagt: Bitte, wenn man mehr als 25 Prozent erwirbt, muss man bei kritischen Fragen eine entsprechende Genehmigung des zuständigen Bundesministers oder der zuständigen Bundesministerin einholen! Das ist ja deswegen vernünftig, weil es da um Fälle gehen könnte, in denen zum Beispiel eine kritische Infrastruktur besteht.
Jetzt schaue ich Ihnen ganz tief in die Augen, gerade weil Sie bei der Telekom Austria Managerin waren: Was tun Sie dagegen, dass jetzt mit Unterstützung der Öbag, mit Unterstützung von Frau Hlawati die kritische Infrastruktur, nämlich die Sendemasten, veräußert werden sollen? Was tun Sie dagegen, Frau Bundesministerin? Nicht einmal eine Katastrophenmeldung kann man wegschicken, wenn man den Zugriff darauf nicht hat! Demnächst fangen wir auch noch an, die Straßen zu verkaufen.
Noch einmal: Wenn man das ernst nimmt, dann müssten Sie sofort ausreiten und sagen: Schluss damit und Schluss mit diesen Experimenten, kritische Infrastruktur irgendwohin zu verkaufen! Wer bezweifelt, dass das kritische Infrastruktur ist, der möge einmal einen Blick in die Gebiete Deutschlands werfen, in denen im Frühherbst die Hochwasserkatastrophe war. Wie wichtig wäre es gewesen, ein Katwarn-System auf Basis der Handys zu haben, um die Menschen rechtzeitig zu warnen, damit sie nicht im Wasser ertrinken! Es gab Hunderte Tote. Ich lasse jetzt den lachenden Laschet weg.
Da, Frau Ministerin, sind Sie nicht eingeschritten, sind Sie nicht sofort vorstellig geworden und haben nicht sofort gesagt: Nein, Frau Catasta – die sitzt jetzt in der Öbag statt Thomas Schmid – und Frau Hlawati – sie sitzt als künftige Chefin im Aufsichtsrat ‑, stopp mit dem, egal ob es den Slims angenehm ist oder nicht angenehm ist! Das sind doch eh nicht Ihre Freunde, die Familie Slim. Das verstehe ich nicht, Frau Bundesministerin. Da
sollten Sie einschreiten, und zwar auf der Stelle einschreiten, auf dass es nicht geschehen kann, dass wir in diesem Lande die Infrastruktur verlieren, auf dass es möglich ist, kritische Infrastruktur zu bewahren, weil es ein übergeordnetes Interesse daran gibt, nicht nur das pure Bilanzschönungsinteresse irgendwelcher Aktionäre.
Ich denke, meine Damen und Herren, das wäre ein erster Ansatz einer vernünftigen Politik, und wenn Margarete Schramböck da die Vorkämpferin wird, dann würde ich mich sehr darüber freuen. Sie werden dafür meinen Applaus bekommen, Frau Bundesministerin. – Danke. (Beifall bei der SPÖ.)
18.56
Präsidentin Doris Bures: Zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Jörg Leichtfried. – Bitte.
Abgeordneter Mag. Jörg Leichtfried (SPÖ): Frau Präsidentin! Frau Bundesministerin! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Die Frage der Schiedsgerichte ist eine, die man meines Erachtens sehr intensiv diskutieren muss; das ist vor allem im historischen Zusammenhang zu sehen. Wenn man über Schiedsgerichte insgesamt – internationale Schiedsgerichte, Handelsschiedsgerichte – diskutieren möchte, muss man selbstverständlich hinterfragen, warum es die von Anfang an gegeben hat. Was glauben Sie, wer das erfunden hat, Frau Bundesministerin? (Ruf bei der ÖVP: Die Deutschen!) – Die Deutschen haben das erfunden, genau. (Abg. Hörl: Richtig!)
Die Deutschen haben das deshalb erfunden, weil sie als Exportnation in einer Situation waren, in der Märkte in sehr, sehr unsicheren Gegenden erschlossen werden sollten. Ich muss offen zugeben, zu dieser Zeit hatten die Schiedsgerichte und all die Normen rundherum ja auch einen gewissen Sinn. Der Sinn war, dass einerseits der Investor geschützt wurde – vor Zuständen der Rechtlosigkeit, vor Anarchie, vor Revolutionen und was da sonst alles passieren konnte –, auf der anderen Seite aber auch das Land, in das sonst vielleicht keine Investoren gekommen wären, profitiert hat. Es war also eigentlich auf eine gewisse Art und Weise eine Situation, in der beide davon profitieren konnten.
Dieser ursprüngliche Gedanke hat sich aber meines Erachtens in etwas sehr, sehr Schlechtes weiterentwickelt, nämlich in ein System, das Investoren, Investorinnen Schutz vor rechtsstaatlichen Institutionen bietet, und es hat eine große Anzahl von Fällen gegeben, in denen das auch tatsächlich so war. Das bekannteste Verfahren in dieser Frage war das Vattenfall-Verfahren. Da ist es darum gegangen, dass ein schwedischer Energiekonzern die Bundesrepublik Deutschland, als sie sich entschlossen hat, aus der Atomenergie auszusteigen, mithilfe der Investor-State-Dispute-Settlement-Clauses – so heißen diese Klauseln, die zwischen Staaten und Investoren Frieden und Ruhe schaffen sollten – geklagt hat und den Atomausstieg als Szenario, als Begründung für diese Klage herangezogen hat.
Geschätzte Damen und Herren, das widerspricht natürlich vollkommen dem ursprünglichen Sinn dieser Klauseln. Sowohl Schweden als auch die Bundesrepublik Deutschland sind Rechtsstaaten, sowohl Schweden als auch die Bundesrepublik Deutschland sind Demokratien, sowohl Schweden als auch die Bundesrepublik Deutschland haben ein funktionierendes Rechtssystem, deshalb ist es meines Erachtens eine Perversion dieses ursprünglichen Systems und führt dazu, dass große Investoren außerhalb des Rechtsstaates gestellt werden. Und das geht natürlich nicht, geschätzte Damen und Herren! (Beifall bei der SPÖ.)
Ich kann Ihnen noch viele Beispiele aufzählen. Man sieht, dass es insbesondere Länder mit einer nicht so wehrhaften Verfasstheit wie beispielsweise jener von großen Wirtschaftsgiganten wie Deutschland sind, die unter diesen Systemen leiden. Beispielsweise
war es in Ecuador so, dass Ecuador 1 Milliarde US-Dollar zahlen musste, weil das Land aus Ölförderverträgen mit einem amerikanischen Ölkonzern, die direkt zum Abholzen des Amazonas geführt hätten, einseitig ausgestiegen ist. Das ist natürlich etwas, geschätzte Damen und Herren von den Grünen, das wahrscheinlich auch für Sie inakzeptabel ist. Es kann nicht sein, dass durch private Schiedsgerichte die Amazonasabholzung fortgesetzt wird. Das ist wirklich etwas, das zutiefst abzulehnen ist. Ich denke, da sind wir uns einig. (Beifall bei der SPÖ. – Zwischenruf des Abg. Wöginger.)
Auch ganz interessant: Uruguay. Uruguay beispielsweise hat sich entschlossen, den Nichtraucherschutz zu verstärken, was ja auch sehr bemerkenswert und sehr sinnvoll ist. Die Reaktion darauf war eine Klage des Philip-Morris-Konzerns. Der Philip-Morris-Konzern konnte das Land massiv unter Druck setzen. Es geht ja nicht darum, wie am Ende geurteilt wird, allein der mögliche Druck auf die Gesetzgebung ist natürlich etwas, das zutiefst abzulehnen ist.
Kanada musste sich im Rahmen des Nafta-Freihandelsabkommens gegenüber mehreren Ölkonzernen verantworten – auch eine Situation, die wir sicher alle gemeinsam nicht als positiv erachten, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, und auch das ist Ausfluss dieser Verträge.
Jetzt können Sie natürlich fragen, was das für uns bedeutet und warum wir das heute diskutieren. Es stellt sich einerseits die Frage, ob innereuropäisch Handlungsbedarf besteht. Ich bezweifle einmal, ob der wirklich besteht (Bundesministerin Schramböck: Der besteht!), weil die Europäische Union ein Rechtsstaat ist (Bundesministerin Schramböck: Bulgarien, Rumänien, Ungarn!) und die Europäische Union durch Rechtsstaaten gebildet wurde und sich meines Erachtens europäische Konzerne selbstverständlich an die Gesetze der jeweiligen Mitgliedstaaten zu halten und auch die Gerichtsentscheidungen zu akzeptieren haben. Das ist das eine. Das Zweite ist, dass natürlich die Europäische Union als Gesamtes auch als europäischer Player agiert. (Abg. Gerstl: Redezeit!)
Was mich so fasziniert hat: Es war eigentlich nie ein Thema in Österreich, es gibt ja unzählige Abkommen, die die Europäische Union geschlossen hat, auch diese Investor-State-Dispute-Settlement-Abkommen. Plötzlich ist dann Ttip zu uns gekommen, und bei Ttip ist das erste Mal ernsthaft über diese Frage diskutiert worden, und da haben wir gesehen, dass wir in Österreich diese Investor-State-Dispute-Settlement-Clauses nicht wollen, geschätzte Damen und Herren. – Herzlichen Dank. (Beifall bei der SPÖ.)
19.03
Präsidentin Doris Bures: Zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Gerald Loacker. – Bitte. (Abg. Wöginger: Brauchst du auch so lange?)
Abgeordneter Mag. Gerald Loacker (NEOS): Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau Bundesministerin! Hohes Haus! Kollege Wöginger macht sich schon Sorgen, dass ich zu lange reden würde. Ich weiß nicht, wovor er sich um diese Tageszeit fürchtet. Ich weiß es nicht. Ich bin ja sonst mit dem Austeilen auch schnell, also wenn es der ÖVP zu langsam geht, kann ich auch in ein Austeilstakkato wechseln, aber darum geht es nicht. (Zwischenrufe des Abg. Gerstl.) – Herr Gerstl ist so laut. Ich weiß nicht, in meinem Ohr rauscht es, in Ihrem vielleicht auch.
Es geht hier um etwas ganz anderes, gar nicht um Kollegen Gerstl, sondern es geht um das Handelsstatistische Gesetz und um die Handelsabkommen. (Neuerliche Zwischenrufe des Abg. Gerstl.) – Kollege Gerstl, Sie könnten sich auch zu Wort melden, dann wäre es jetzt nicht so laut. Ich kriege sonst einen Tinnitus. (Heiterkeit und Beifall bei den NEOS sowie Heiterkeit bei der ÖVP.)
Im Übrigen: Für Sie redet ja normalerweise Abgeordneter Hanger, denn der bringt das präziser auf den Punkt. (Heiterkeit bei NEOS und ÖVP. – Abg. Ottenschläger: Das ist
jetzt wieder die Überheblichkeit!) – Nein, das ist nicht die Überheblichkeit, Kollege Ottenschläger. Ihre Fraktion hat Hanger Kollegen Gerstl vorgezogen, das ist doch eine Tatsache. (Oh-Rufe bei der ÖVP.)
Gut: Also, es werden jetzt verschiedene Abkommen gekündigt (Abg. Gerstl: Verschiedene? Welche?), weil es notwendig war, auf europäischer Ebene einen Schritt zu setzen, aber die Frage ist: Was ist der Ersatz für diese Abkommen, die gekündigt werden?
Es sind sich alle einig, dass internationale Handelsabkommen einen wesentlichen Beitrag – Kollege Stögmüller nickt, danke vielmals – zu einem funktionierenden Freihandel leisten. Dieser muss natürlich innerhalb der Europäischen Union umso mehr funktionieren, als er über die Europäische Union hinaus funktioniert. Was mich da besonders stört, ist, dass die ÖVP nach außen hin die Wirtschaftsthemen immer forciert, aber wenn es dann nach innen geht, darum, wirklich etwas für den Freihandel zu tun, da ist es dann leise. Ministerin Köstinger hat sich gegen das Mercosur-Abkommen in Position gebracht – und Ministerin Schramböck schaut zu, wie ihre Regierungskollegin den Freihandel mit mieser Propaganda sabotiert.
Das könnte man als Wirtschaftsministerin natürlich auch anders sehen, man könnte auch einmal etwas sagen, statt nur zu schweigen. (Bundesministerin Schramböck schaut auf ihr Smartphone.) – Vielleicht schreiben Sie jetzt gerade Ministerin Köstinger eine SMS. (Bundesministerin Schramböck: Ich schreibe mit, was Sie sagen! Ich mache das digital!) Das ist super, die Frau Ministerin schreibt mit, was ich sage. Jetzt bin ich aber stolz, das habe ich noch nie geschafft. (Bundesministerin Schramböck: Ja, so ist das!) Das habe ich noch nie geschafft. (Beifall bei den NEOS.)
Ich glaube, ich sollte ein bisschen über das Digitale Amt und über solche Apps reden, vielleicht schreiben Sie dann auch mit. Das wäre auch noch cool. (Bundesministerin Schramböck: Sie können sich ja wieder bei mir anmelden!) Ja, ich werde wieder einmal eine Wohnsitzmeldung vornehmen und schauen, ob die App schon weiter ist, als sie einmal war. (Bundesministerin Schramböck: Ist sie!)
Aber zurück zum Mercosur-Abkommen: Es ist ja ein Witz, was der Bauernbund da wegen ein paar Kilo Rindfleisch aufführt. (Heiterkeit bei NEOS und SPÖ.) Also tun Sie jetzt nicht so, als ob Sie ein Rindschnitzel weniger verkaufen würden, wenn das Mercosur-Abkommen zustande kommt!
Das war mein Anliegen: Für den Freihandel hier ein gutes Wort einzulegen. – Ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit. (Heiterkeit und Beifall bei den NEOS sowie Beifall bei der SPÖ.)
19.07
Präsidentin Doris Bures: Zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Gerald Hauser. – Bitte. (Abg. Ribo – in Richtung des sich zum Rednerpult begebenden Abg. Hauser –: Das Taferl haben Sie vergessen! – Heiterkeit bei den Grünen.)
Abgeordneter Mag. Gerald Hauser (FPÖ): Frau Präsidentin! Hohes Haus! Ich habe einen grünen Fanklub, das stelle ich wirklich mit Freude fest. Sie vermissen meine Tafeln! Super! (Heiterkeit und Beifall bei den Grünen.) Da war ich auf jeden Fall schon sehr erfolgreich, wenn die Grünen bei mir irgendetwas vermissen. Also es wirkt, Tafeln wirken, das finde ich gut. Das hat übrigens Jörg Haider mit Erfolg in die Politik eingeführt, und ich als Freiheitlicher darf eine gute Errungenschaft natürlich gerne und gut weiterführen. Wenn das bei den Grünen so gut ankommt, werde ich mich bemühen, dass ich für morgen wieder eine Tafel vorbereite. (Beifall bei FPÖ und Grünen.) Aber gut, es muss ja nicht immer eine Tafel sein.
Ich weiß ja nicht, wie viel Redezeit ich habe, aber das muss ich jetzt wirklich mit Freude feststellen: Ich habe noch nie geschlossenen Applaus der grünen Fraktion bekommen. Sensationell! (Heiterkeit, Yeah-Rufe und Beifall bei den Grünen.) Das muss man als Blauer einmal schaffen. Das muss man als Blauer schaffen! Das ist gar nicht schlecht, ich fühle mich da wirklich geehrt. (Ruf bei den Grünen: Das ist eine super Sache!) Danke, das ist eine super Sache.
Ich sollte jetzt inhaltlich auch noch etwas zur Thematik sagen, das wäre vielleicht nicht schlecht, also grundsätzlich zu den Freihandelsabkommen: Ich sehe da wirklich einen riesengroßen Unterschied zwischen den Ansprüchen, die die ÖVP immer wieder stellt, und dem, wie sie dann tatsächlich agiert, zum Beispiel beim Mercosur-Abkommen, meine lieben Freunde, letzte Woche im Landwirtschaftsausschuss. (Zwischenrufe bei der ÖVP.) Jetzt muss ich einmal die ÖVP ansprechen, vielleicht gelingt es mir, auch von der ÖVP geschlossenen Applaus zu kassieren. Das wäre ja auch nicht schlecht!
ÖVP und Mercosur-Abkommen und Landwirtschaftsausschuss – wie ist die Sache gelaufen? – Auf der einen Seite setzen wir uns im Landwirtschaftsausschuss, auch mit Unterstützung zum Beispiel der Kollegen Hechenberger und Hermann Gahr, immer wieder dafür ein, dass wir die Landwirtschaft, den ländlichen Raum stärken.
Wir sind stolz auf unsere Landwirtschaft, das möchte ich in Richtung unserer Bäuerinnen und Bauern einmal festhalten. Worin aber besteht denn der Widerspruch? – Der Widerspruch ist völlig klar: Während wir als Freiheitliche Partei sagen, wir meinen es ernst und wir wollen unsere Landwirtschaft, die kleinstrukturierte Landwirtschaft, tatsächlich vor Billigimporten aus dem Ausland schützen – da spreche ich das Mercosur-Abkommen an –, gibt es quer durch die ÖVP einen Riss. Das Mercosur-Abkommen wäre nämlich schon längst gescheitert und Geschichte, wenn nicht vier EU-Mandatare der ÖVP im Jänner für die Weiterverhandlung des Mercosur-Abkommens gestimmt hätten. Das ist der Punkt! Die Entscheidung im Europäischen Parlament war Spitz auf Knopf, und genau die vier Stimmen vom ÖAAB und vom Wirtschaftsbund, zum Beispiel von Kollegin Barbara Thaler – Tirolerin, das kränkt mich ganz besonders –, die für die Verlängerung der Verhandlungen betreffend Mercosur-Abkommen waren, haben entschieden – das ist unglaublich –, sonst hätten wir das Ganze vom Tisch. Das muss man sagen, das ist der Punkt! (Beifall bei FPÖ und NEOS sowie bei Abgeordneten der Grünen.)
Wieder Applaus seitens der Grünen, also heute geht es mir wirklich gut. Ich fühle mich unglaublich geehrt. (Heiterkeit bei Grünen und NEOS.) Das muss man einmal schaffen: im Zuge einer Rede mehrmals Zwischenapplaus von der grünen Fraktion zu kriegen. Normalerweise würde ich sagen: Da mache ich alles falsch (allgemeine Heiterkeit), aber heute scheine ich wirklich alles richtig zu machen.
So, jetzt geht es weiter: Wir sagen immer, Österreich ist der Feinkostladen. Wir haben eine sensationelle, tolle Landwirtschaft, Berglandwirtschaft, und was tun wir? (Zwischenruf des Abg. Zarits.) – Ihr müsst einmal in euch gehen, ihr müsst einmal versuchen, in der ÖVP eine klare Linie herbeizuführen. Kollege Hermann Gahr und Kollege Hechenberger würden uns schon unterstützen, die wissen, wie notwendig und wichtig die Landwirtschaft ist, aber was macht ihr? – Ihr wollt einen großen Pakt, ein Mercosur-Abkommen abschließen, wo wir Autos gegen billiges Rindfleisch eintauschen. Das ist genau der falsche Weg. (Beifall bei der FPÖ.)
Also, liebe Bauern, liebe Freunde, eines sage ich euch: Ihr seid bei der Freiheitlichen Partei, bei uns perfekt aufgehalten (Heiterkeit bei der ÖVP – Abg. Zarits: „Aufgehalten“!), wenn es darum geht, die Berglandwirtschaft und die Landwirtschaft zu schützen. (Abg. Wöginger hebt die Hand.)
Das Licht am Rednerpult blinkt. Ich habe meine Redezeit ohne Tafel schon fast aufgebraucht. (Heiterkeit bei Abgeordneten der ÖVP.) – Bitte, mehr Ernsthaftigkeit!
Da brauchen wir wirklich einmal eine klare Linie. Es kann nicht sein, dass wir unsere Landwirtschaft, unseren Feinkostladen durch Billigexporte aus den Mercosur-Staaten zu Tode konkurrenzieren (Abg. Gerstl: Merkst du, dass du dich widersprichst?) und dort einen massiven CO2-Abdruck produzieren, denn wir wissen, dass die Anbauflächen durch das Abholzen der Regenwälder erweitert werden. Das ist ein totaler Widerspruch.
Also: Geht einmal in euch, schauen wir, dass wir dieses Abkommen wegbringen, und machen wir etwas Gescheites für unsere Landwirtschaft! – Ich danke. (Beifall bei der FPÖ. – Abg. Wöginger: Zur Geschäftsbehandlung!)
19.13
Präsidentin Doris Bures: Herr Klubobmann Wöginger, ich habe Sie gesehen und ich habe Ihnen gedeutet, dass ich Ihnen für eine Geschäftsordnungsdebatte, wie das die Geschäftsordnung vorsieht, nach der Rede das Wort erteilen werde.
Zur Geschäftsbehandlung: Herr Klubobmann Wöginger. – Bitte.
*****
Abgeordneter August Wöginger (ÖVP) (zur Geschäftsbehandlung): Frau Präsidentin! (Ruf: Sind Sie überhaupt der Klubobmann? – Ruf bei der ÖVP: Ja!) Ich hätte einen Vorschlag, damit wir diese Filibusterreden nicht in einer noch größeren Zahl hier fortsetzen müssen. (Ruf bei der FPÖ: ... was Sie da behaupten!) – Das war der Eindruck bei den letzten Reden.
Wir wissen auch, worum es geht (Zwischenruf bei der FPÖ): Im Verlangen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses fehlen zwei wichtige Wörter. Der Meister der Nullen, Kai Jan Krainer, hat auch einen Fehler gemacht und hat zwei wesentliche Wörter vergessen, nämlich die Wörter: der Vollziehung. Und wenn diese Wörter nicht drinnen stehen, dann wäre das natürlich so nicht durchsetzbar oder umsetzbar.
Daher ein Vorschlag zur Güte: Ich glaube, man könnte die Meldungen für Filibusterreden zurückziehen, und wir unterbrechen die Sitzung, bis die Verteilung in der korrekten Fassung erfolgt ist. (Ruf: Nein ...!) – Das ist ja nur ein Vorschlag. (Beifall bei ÖVP und Grünen sowie bei Abgeordneten der NEOS.)
Das ist ein wichtiger Themenbereich, keine Frage, aber damit wir die Zuseherinnen und Zuseher nicht noch - - (Zwischenruf bei der SPÖ.) Ich möchte aber auch ankündigen, dass die Frau Bundesministerin einen wichtigen Folgetermin hat, und sicherstellen, dass wir dann auch über alle Fraktionsgrenzen hinweg der Meinung sind, dass das in Ordnung ist.
Wie gesagt, das Angebot von unserer Fraktion wäre da, ich habe das jetzt nicht mit dem Koalitionspartner direkt besprochen; aber ob wir jetzt Filibusterreden hören oder ob wir sagen, wir unterbrechen für eine gewisse Zeit – ich würde Zweites für sinnvoller erachten. (Beifall bei ÖVP und Grünen sowie bei Abgeordneten der NEOS.)
19.15
Präsidentin Doris Bures: Gibt es eine weitere Wortmeldung zur Geschäftsbehandlung? – Herr stellvertretender Klubobmann Abgeordneter Leichtfried. – Bitte. (Abg. Stögmüller: So läuft es im Untersuchungsausschuss dann!)
Abgeordneter Mag. Jörg Leichtfried (SPÖ) (zur Geschäftsbehandlung): Frau Präsidentin! Ich darf darauf eingehen, was Kollege Wöginger jetzt angemerkt hat. Mein Wissensstand ist, dass erstens die Debatte, die wir jetzt geführt haben, natürlich eine sehr
wichtige und interessante war. (Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordneten der NEOS. – Heiterkeit bei der ÖVP.) Ich glaube, es wird in diesem Haus viel zu selten über Freihandelsabkommen diskutiert.
Weiters ist mein Wissensstand, dass die Verteilung eh schon beinahe abgeschlossen ist. Wenn sich das irgendwie feststellen ließe, dann wäre das Ganze vielleicht noch einfacher zu lösen.
Ich glaube, die endgültige Entscheidung trifft ohnedies die Frau Präsidentin, und ich denke, das ist auch gut so. – Danke schön. (Beifall bei der SPÖ. – Zwischenrufe bei der ÖVP.)
19.16
Präsidentin Doris Bures: Weitere Wortmeldungen zur Geschäftsbehandlung? – Das ist nicht der Fall. (Zwischenrufe bei der ÖVP.)
In diesem Fall entscheidet die Geschäftsordnung, und die Präsidentin hält sich an die Geschäftsordnung.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie nur darauf aufmerksam machen: Es ist so, dass der Text des eingebrachten Verlangens auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses bereits an alle Fraktionen verteilt war und dass er aufgrund eines – wie mir mitgeteilt wurde – technischen Problems in der Parlamentsdirektion noch nicht an alle Abge- - (Ruf bei der ÖVP: Weil zwei Wörter fehlen! – Weitere Zwischenrufe bei der ÖVP sowie Zwischenrufe bei SPÖ und FPÖ.) – Sie können das gerne verifizieren.
Ich kann Ihnen diese Mitteilung machen – ich weiß nicht, wie das bei Ihnen mit Vertrauen so ist. Sie können mir vertrauen, dass ich Ihnen das sage, was mir die Parlamentsdirektion übermittelt. (Beifall bei SPÖ, FPÖ, Grünen und NEOS.)
Ich möchte Sie daher davon in Kenntnis setzen, dass nach § 23a der Geschäftsordnung auch die elektronische Verteilung möglich ist. Diese ist, wie mir auch mitgeteilt wurde und ich den Informationen der Parlamentsdirektion entnehmen kann, bereits an alle Abgeordneten erfolgt. In diesem Fall würde ich vorschlagen, dass wir – so, wie das vorgesehen ist – jetzt in der Tagesordnung fortfahren, wenn alle Fraktionen einverstanden sind, auch gleich die Abstimmungen vornehmen und dann in die kurze Debatte betreffend Einsetzung eines Untersuchungsausschusses eingehen.
Sind Sie damit einverstanden, wenn ich so vorgehe? (Rufe bei der ÖVP: Ja!) – Ja, dann werde ich das auch so machen.
*****
Präsidentin Doris Bures: Es ist dazu nun niemand mehr zu Wort gemeldet, und damit ist die Debatte geschlossen.
Wird seitens der Berichterstattung ein Schlusswort gewünscht? – Das ist nicht der Fall.
Wir kommen sogleich zu den Abstimmungen.
Abstimmung über Tagesordnungspunkt 24: Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Handelsstatistische Gesetz geändert wird, samt Titel und Eingang in 958 der Beilagen.
Wer dem die Zustimmung gibt, den ersuche ich um ein entsprechendes Zeichen. – Der Gesetzentwurf ist einstimmig angenommen.
Wir kommen sogleich zur dritten Lesung.
Wer in dritter Lesung die Zustimmung gibt, den ersuche ich um ein Zeichen. – Der Gesetzentwurf ist in dritter Lesung einstimmig angenommen.
Tagesordnungspunkt 25: Antrag des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie und Energie, den Abschluss des Staatsvertrages: Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Slowenien zur Beendigung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik Slowenien über die gegenseitige Förderung und den Schutz von Investitionen, in 1033 der Beilagen, gemäß Art. 50 Abs. 1 Z 1 Bundes-Verfassungsgesetz zu genehmigen.
Wer spricht sich dafür aus? – Das ist einstimmig angenommen.
Abstimmung über Tagesordnungspunkt 26: Antrag des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie und Energie, den Abschluss des Staatsvertrages: Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Kroatien zur Beendigung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik Kroatien über die Förderung und den Schutz von Investitionen, in 1032 der Beilagen, gemäß Art. 50 Abs. 1 Z 1 Bundes-Verfassungsgesetz zu genehmigen.
Das ist einstimmig so angenommen.
Abstimmung über Tagesordnungspunkt 27: Antrag des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie und Energie, den Abschluss des Staatsvertrages: Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Malta zur Beendigung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und Malta über die Förderung und den gegenseitigen Schutz von Investitionen, in 1036 der Beilagen, gemäß Art. 50 Abs. 1 Z 1 Bundes-Verfassungsgesetz zu genehmigen.
Wer spricht sich dafür aus? – Auch das ist einstimmig so angenommen.
Die Tagesordnung ist erschöpft. (Ruf bei der ÖVP: Juhu! – Heiterkeit bei der ÖVP.)
Kurze Debatte über ein Verlangen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses
Präsidentin Doris Bures: Wie bereits angekündigt gelangen wir nunmehr zur kurzen Debatte über das Verlangen 4/US auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses betreffend „Klärung von Korruptionsvorwürfen gegen ÖVP-Regierungsmitglieder (ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss)“.
Dieses Verlangen wurde, wie bereits angekündigt, teilweise verteilt, jedenfalls an alle Abgeordneten elektronisch verteilt. Ist das so? – Gut.
Das Verlangen hat folgenden Wortlaut:
Verlangen
auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses
gemäß § 33 Abs. 1 2. Satz GOG-NR
der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Christian Hafenecker, MA, Dr.in Stephanie Krisper, Kolleginnen und Kollegen
betreffend Klärung von Korruptionsvorwürfen gegen ÖVP-Regierungsmitglieder (ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss)
Der „Ibiza“-Untersuchungsausschuss hat ein Sittenbild türkiser Politik offenbart, das ansonsten hinter einer teuren PR-Fassade versteckt geblieben wäre. Die Realität türkiser Politik ist eine, wo es um „Kriegst eh alles, was du willst“, um die türkisen „Aufsichtsratssammler“, um „Wer vorbereitet Gernot auf seine Vernehmung“, um Millionenaufträge aus türkisen Ministerien an eng mit der ÖVP verbundene Unternehmen und zuallererst um die Frage geht: Gehörst du zur Familie?
Die von der Staatsanwaltschaft erhobenen Vorwürfe und die von ihr vorgelegten Belege für ein System des parteipolitischen Missbrauchs öffentlicher Gelder und Strukturen unter der Führung von Sebastian Kurz und seinen Gefolgsleuten übertreffen sämtliche Befürchtungen. Das bisher Bekannte ist womöglich nur die Spitze des Eisbergs.
Damit klar wird, wer die politische Verantwortung dafür trägt, dass in unserem Land in den letzten Jahren ein mutmaßliches System der Korruption und des Machtmissbrauchs zum zentralen Instrument von Regierungspolitik werden konnte, muss die Aufklärung dort fortgesetzt werden, wo der „Ibiza“-Untersuchungsausschuss aufhören musste. Der Kontrollauftrag, den die Bundesverfassung dem Nationalrat überträgt, gebietet dies.
Die unterzeichneten Abgeordneten verlangen daher gemäß Art. 53 Abs. 1 2. Satz B VG sowie § 33 Abs. 1 2. Satz GOG NR die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses mit folgendem
Untersuchungsgegenstand
Untersuchungsgegenstand ist das Gewähren von Vorteilen an mit der ÖVP verbundene natürliche und juristische Personen durch Organe der Vollziehung des Bundes im Zeitraum von 18. Dezember 2017 bis 11. Oktober 2021 sowie diesbezügliche Vorbereitungshandlungen auf Grundlage und ab Beginn des „Projekts Ballhausplatz“ auf Betreiben eines auf längere Zeit angelegten Zusammenschlusses einer größeren Anzahl von in Organen des Bundes tätigen Personen, bestehend aus der ÖVP zuzurechnenden Mitgliedern der Bundesregierung, StaatssekretärInnen sowie MitarbeiterInnen ihrer politischen Büros, zu parteipolitischen Zwecken und die damit gegebenenfalls zusammenhängende Umgehung oder Verletzung gesetzlicher Bestimmungen sowie der dadurch dem Bund gegebenenfalls entstandene Schaden.
Beweisthemen und inhaltliche Gliederung des Untersuchungsgegenstands
1. Beeinflussung von Vergabe- und Förderverfahren
Aufklärung über Vorwürfe der parteipolitischen Beeinflussung der Vergabe von Aufträgen in den Bereichen Beratung, Forschung, Kommunikation und Werbung einschließlich Eventmanagement sowie von Aufträgen und Förderungen mit einem Volumen von 40.000 Euro oder mehr zu mutmaßlichen Gunsten von mit der ÖVP verbundenen Personen und den dem Bund daraus entstandenen Kosten, und insbesondere über
- Einflussnahme auf Vergabeverfahren zu Gunsten politisch nahestehender Unternehmen mit dem mutmaßlichen Ziel, indirekte Parteienfinanzierung zu tätigen, insbesondere in Hinblick auf die Vergabe von Kommunikations- und Meinungsforschungsaufträgen und sonstigen wahlkampfrelevanten Dienstleistungen;
- Beauftragung von Studien und Umfragen zu mutmaßlichen Gunsten politischer Entscheidungsträger der ÖVP durch Bundesministerien sowie durch Unternehmen, an denen der Bund direkt oder indirekt beteiligt ist;
- Beauftragung von Unternehmen, die auch für die ÖVP oder verbundene Personen tätig sind, insbesondere das Campaigning Bureau, die Blink Werbeagentur, die GPK GmbH, die Media Contacta GmbH, Schütze Positionierung, Research Affairs und das tatsächliche Erbringen der gewünschten Leistungen; allfällige Mängel in der Dokumentation der Leistungserbringung; die mögliche Umgehungskonstruktion, diese Unternehmen als Subunternehmer zu tarnen;
- Buchungen von Inseraten, insbesondere den sprunghaften Anstieg der Inseratenausgaben im Jahr 2017 im Bundesministerium für Europa, Integration und
Äußeres, des Bundeskanzleramts im Jahr 2020 sowie Einflussnahme auf die Vergabe von Media-Agenturleistungen im Ausmaß von insgesamt 180 Millionen Euro und der Vergabe dieses Auftrags an die Unternehmen mediacom, Wavemaker und Group M sowie eines korrespondierenden Werbeetats im Ausmaß von 30 Mio. Euro über die Bundes-Beschaffungsgesellschaft an u.a. Jung von Matt im Jahr 2021; Buchung von Inseraten im Zusammenhang mit dem sogenannten „Beinschab ÖSTERREICH Tool“ im Bundesministerium für Finanzen und ab 2018 im Bundeskanzleramt sowie parteipolitisch motivierte Tätigkeiten der „Stabsstelle Medien“ im Bundeskanzleramt, insbesondere die Einflussnahme auf Inseratevergaben von Organen des Bundes;
- mögliche Kick-Back-Zahlungen zu wirtschaftlichen Gunsten der ÖVP oder mit ihr verbundenen natürlichen oder juristischen Personen, insbesondere in Hinblick auf die indirekte Finanzierung von Wahlkampfaktivitäten durch das Verlangen eines Überpreises gegenüber Organen des Bundes bei Auftragsvergaben, insbesondere bei Aufträgen des Bundesministeriums für Inneres an Werbeagenturen in der Amtszeit von Wolfgang Sobotka;
- mögliche Umgehung der vergaberechtlichen Bestimmungen zu Gunsten von mit der ÖVP verbundenen Personen, insbesondere im Wege von Rahmenverträgen der Bundes-Beschaffungsgesellschaft sowie von Aufträgen an das Bundesrechenzentrum;
- Vorwürfe des “Maßschneiderns“ von Ausschreibungen der Bundesministerien auf bestimmte mit der ÖVP verbundene AnbieterInnen und allfällige außergerichtliche Absprachen (zB Verzicht auf Rechtsmittel) mit den unterlegenen BieterInnen;
- Vergabe von Förderungen der Bundesministerien und mit Förderzwecken des Bundes betrauten Einrichtungen an mit der ÖVP verbundene natürliche und juristische, insbesondere über die Rechtfertigung des Förderzwecks und über die Erbringung der erforderlichen Nachweise durch die FördernehmerInnen sowie die Angemessenheit der Förderhöhe im Vergleich zu gleich gelagerten Förderanträgen;
- Ausmaß und Einsatz der im Bundesfinanzgesetz vorgesehenen Mittel für Werbemaßnahmen in ÖVP-geführten Bundesministerien, insbesondere im Vorfeld und in Zusammenhang mit Wahlkämpfen;
- Schaffung und Gestaltung von Finanzierungsprogrammen des Bundes für Unternehmen spezifisch in Hinblick auf eine spätere Gegenleistung in Form einer Begünstigung von politischen Parteien oder WahlwerberInnen einschließlich von damit zusammenhängenden gesetzlichen Änderungen wie etwa im Falle des Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfondsgesetzes.
2. Einflussnahme auf Beteiligungen des Bundes
Aufklärung über (versuchte) Einflussnahme auf Unternehmen, an denen der Bund direkt oder indirekt beteiligt ist, einschließlich der Bestellung der jeweiligen Organe, dem Zusammenwirken mit weiteren EigentümerInnen und jeweiligen OrganwalterInnen sowie der Ausübung von Aufsichtsrechten durch Mitglieder des Zusammenschlusses mit dem mutmaßlichen Ziel, die Geschäftstätigkeit dieser Unternehmen im Sinne der ÖVP zu steuern, und insbesondere über
- (vorzeitige) Abberufung von Organen ausgegliederter Gesellschaften, insbesondere in Hinblick auf die Bestellung von Bettina Glatz-Kremsner als ÖVP-Kandidatin in den Vorstand der Casinos Austria AG und das Bestehen eines politischen Hintergrunddeals für diese Bestellung; den durch vorzeitige Abberufungen entstandene Schaden für die Republik;
- den Informationsfluss in Angelegenheiten des Beteiligungsmanagements zwischen dem Bundesministerium für Finanzen und den Bundesministern Blümel, Löger sowie Bundeskanzler Kurz, insbesondere in Hinblick auf die Auswahl von Organen der ÖBIB und ÖBAG und der Entstehung der Vorschläge für die Besetzung des Aufsichtsrats der ÖBAG sowie den Vorstand der ÖBAG;
- Motive für Vorbereitungen für einen Verkauf (Privatisierung) von Anteilen an Beteiligungen des Bundes sowie entsprechende Szenarienentwicklung und Analyse, insbesondere von Anteilen der Austrian Real Estate als Tochter der Bundesimmobiliengesellschaft, und das Zusammenwirken mit ParteispenderInnen der ÖVP aus dem Immobiliensektor sowie die Rolle von René Benko in Hinblick auf die Geschäftstätigkeit der BIG und der ARE, insbesondere die Hintergründe des 99-jährigen Mietvertrags mit der BIG für das Gebäude der Postsparkasse.
3. Beeinflussung von Ermittlungen und Aufklärungsarbeit
Aufklärung über (versuchte) Einflussnahme auf die Führung von straf- und disziplinarrechtlichen Verfahren und die Verfolgung pflichtwidrigen Verhaltens von mit der ÖVP verbundenen Amtsträgern sowie über den Umgang mit parlamentarischen Kontrollinstrumenten zum mutmaßlichen Zweck der Behinderung der Aufklärungsarbeit im parteipolitischen Interesse der ÖVP, und insbesondere über
- Einflussnahme durch Justiz- bzw. InnenministerInnen, deren jeweilige Kabinette sowie durch Christian Pilnacek einerseits und Michael Kloibmüller, Franz Lang sowie Andreas Holzer andererseits auf Ermittlungsverfahren mit politischer Relevanz, insbesondere in Folge des Bekanntwerdens des „Ibiza“-Videos sowie gegen (ehemals) hochrangige politische FunktionsträgerInnen der ÖVP wie Josef Pröll und Hartwig Löger; Vorwürfe der politisch motivierten Einflussnahme auf Strafverfahren gegen mit der ÖVP verbundenen Personen wie (potentielle) SpenderInnen, insbesondere Ermittlungen gegen René Benko in der Causa Chalet N;
- Informationsflüsse über Ermittlungen in politisch für die ÖVP relevanten Verfahren an politische EntscheidungsträgerInnen und deren MitarbeiterInnen, insbesondere den Informationsstand des/der jeweiligen BundesministerIn für Justiz und des/der jeweiligen BundesministerIn für Inneres über laufende Ermittlungen im „Ibiza“-Verfahrenskomplex; Weitergabe von vertraulichen Informationen an nicht-berechtigte Personen, insbesondere über Hausdurchsuchungen bei Hartwig Löger, Gernot Blümel, Thomas Schmid und Sabine Beinschab, sowie bei der ÖVP Bundespartei;
- Pläne von mit der ÖVP verbundenen Personen für die Erlangung von Daten der WKStA, den Informationsfluss zwischen dem damaligen Bundesminister, seinem Kabinett und dem ehemaligen Bundeskanzler Kurz;
- Einflussnahme auf aus der Veranlagung von Parteispenden an die ÖVP oder ihr nahestehende Organisationen resultierende Finanzstrafverfahren bzw. die mögliche Verhinderung der Einleitung solcher Verfahren; Einflussnahme auf gegen (potentielle) SpenderInnen der ÖVP geführte Finanzstrafverfahren;
- die Ausübung der Fach- und Dienstaufsicht gegenüber der WKStA, insbesondere durch die Oberstaatsanwaltschaft Wien und deren Leiter Johann Fuchs, und die mutmaßlich schikanöse Behandlung der WKStA in für die ÖVP politisch relevanten Fällen;
- Vorwürfe der Behinderung der Beweiserhebungen des Ibiza-Untersuchungsausschusses, insbesondere die interne Vorbereitung und Kommunikation zur Frage der Erfüllung der Beweisanforderungen und Erhebungsersuchen des Ausschusses im Bundesministerium für Finanzen einschließlich der Einbindung des
Bundesministers für Finanzen und der Finanzprokuratur in diese Angelegenheiten zum mutmaßlichen Zwecke des Schutzes von mit der ÖVP verbundenen Personen einschließlich des Bundesministers Blümel selbst.
4. Begünstigung bei der Personalauswahl
Aufklärung über Bestellung von Personen in Organfunktionen des Bundes oder Ausübung von Nominierungsrechten des Bundes abseits jener in Beteiligungen des Bundes sowie Aufnahme von Personen in Beratungsgremien (insbesondere Think Austria) oder Delegationen mit dem mutmaßlichen Ziel, einen kontrollierenden Einfluss für mit der ÖVP verbundene Personen auf die Tätigkeiten dieser Organe zu erreichen, oder Bestellungen als mutmaßliche Folge oder in Erwartung einer Begünstigung der ÖVP, und insbesondere über
- Einhaltung der Bestimmungen des Ausschreibungsgesetzes bei der Vergabe von Leitungsfunktionen in ÖVP-geführten Bundesministerien;
- Interventionen für (ehemalige) PolitikerInnen der ÖVP und deren Versorgung mit Beschäftigungsverhältnissen; möglichen Schaden für den Bund durch Ermöglichung solcher Begünstigung insbesondere durch frühzeitige Abberufung anderer OrganwalterInnen oder die Schaffung neuer Funktionen;
- Vorwürfe des „Maßschneiderns“ von Ausschreibungen von Leitungsfunktionen auf parteipolitisch loyale KandidatInnen durch Mitglieder des ÖVP-Zusammenschlusses;
- Einhaltung der Qualifikationserfordernisse bei der Besetzung von Planstellen durch mit der ÖVP verbundene Personen, insbesondere durch MitarbeiterInnen politischer Büros von ÖVP-Regierungsmitgliedern.
Unter einem wird gemäß § 33 Abs. 4 GOG-NR die Durchführung einer Debatte verlangt.
Begründung
Untersuchungsziele:
Der Untersuchungsausschuss soll entlang der Beweisthemen umfassend klären, ob es ausgehend vom „Projekt Ballhausplatz“ durch eine Gruppe von in Organen des Bundes tätigen, der ÖVP zuzuordnenden Personen zu Missbrauch von Organbefugnissen zum Zweck der Förderung der parteipolitischen Interessen der ÖVP gekommen und dadurch staatlichen Interessen möglicherweise ein Schaden entstanden ist. Zu dieser Aufklärung gehört unter Anerkennung des in einer demokratischen Gesellschaft selbstverständlichen Ausmaßes an parteipolitischer Motivation, festzustellen, inwieweit die gesetzlichen Regelungen lückenhaft sind oder wo solche Regelungen umgangen oder gebrochen wurden und somit der Verdacht auf Gesetzesverstöße besteht. Die Untersuchung soll die Grundlage für zukünftige gesetzliche Maßnahmen zur Stärkung der Korruptionsprävention, zur Verminderung der Missbrauchsanfälligkeit bei der Vergabe von Finanzmitteln und Funktionen sowie zur Stärkung der Kontrollmechanismen bilden.
Zum bestimmten Vorgang:
Mit der Möglichkeit, Untersuchungsausschüsse einzusetzen, wird dem Nationalrat ein Instrument der politischen Kontrolle eröffnet (Kahl, Art. 52b B-VG, in: Korinek/Holoubek et al. [Hrsg.], Bundesverfassungsrecht, 7. Lfg. 2005, 4). Die Befugnisse, die dem Untersuchungsausschuss durch das Bundes-Verfassungsgesetz übertragen werden, sollen eine wirksame parlamentarische Kontrolle durch den Nationalrat ermöglichen. Da mit Art. 53 Abs. 1 B-VG einem Viertel der Mitglieder des Nationalrates ein Minderheitsrecht eingeräumt wurde (siehe AB 439 BlgNR XXV. GP, 2), kommt der verlangenden
Minderheit – im Sinne der wirksamen Ausgestaltung dieses Rechtes – grundsätzlich auch das Recht zu, das zu untersuchende Thema frei zu bestimmen, in das gegen ihren Willen nicht eingegriffen werden darf (VfSlg. 20370/2020, 167).
Die Autonomie der Einsetzungsminderheit ist demokratiepolitisch geboten. Denn Untersuchungsverfahren haben in der parlamentarischen Demokratie eine wichtige Aufgabe zu erfüllen (vgl. Kahl, aaO, 6; Neisser, Art. 53 B-VG, in: Kneihs/Lienbacher [Hrsg.], Rill-Schäffer-Kommentar Bundesverfassungsrecht, 17. Lfg. 2016, 20). Durch sie erhält der Nationalrat die Möglichkeit, unabhängig von Regierung, Behörden und Gerichten mit hoheitlichen Mitteln selbständig die Sachverhalte zu prüfen, die er in Erfüllung seines verfassungsgesetzlichen Auftrags zur Kontrolle der Vollziehung für aufklärungsbedürftig hält. Art. 53 Abs. 3 B VG räumt dem Untersuchungsausschuss daher ein die Legislative einseitig begünstigendes Recht zur Selbstinformation ein (vgl. AB 439 BlgNR XXV. GP, 5).
In der Sicherstellung der Wirksamkeit dieses Kontrollinstruments liegt die verfassungsrechtliche Bedeutung des Minderheitsrechts. Denn das ursprüngliche Spannungsverhältnis zwischen Parlament und Regierung, wie es in der konstitutionellen Monarchie bestand, hat sich in der parlamentarischen Demokratie, deren Parlamentsmehrheit regelmäßig die Regierung trägt, gewandelt. Es wird nun vornehmlich geprägt durch das politische Spannungsverhältnis zwischen der Regierung und den sie tragenden Parlamentsparteien einerseits und der Opposition andererseits. Im parlamentarischen Regierungssystem überwacht daher in erster Linie nicht die Mehrheit die Regierung, da die Regierung ja von gerade dieser Mehrheit getragen wird (vgl. Öhlinger, Die Bedeutung von Untersuchungsausschüssen als besonderes Instrument parlamentarischer Kontrolle, in Bußjäger [Hrsg.], Die Zukunft der parlamentarischen Kontrolle, 2008, 108f; Neisser, aaO, 20f). Diese Aufgabe wird vorwiegend von der Opposition - und damit in der Regel von einer Minderheit - wahrgenommen. Das durch die Verfassung garantierte Recht der Minderheit auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses darf - soll vor diesem Hintergrund die parlamentarische Kontrolle ihren Sinn noch erfüllen können - nicht angetastet werden.
Der Verfassungsgerichtshof hat in diesem Sinne bereits ausgesprochen, dass der Wahl des Anliegens der Untersuchung zunächst keine Grenzen gesetzt sind. Es ist allein der politischen Wertung von Abgeordneten des Nationalrates anheimgestellt, welches Anliegen der politischen Kontrolle durch einen Untersuchungsausschuss zugeführt werden soll. Es bedarf weder eines Verdachts noch eines Anlasses (VfSlg. 20370/2020, 167).
Ein Verlangen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses kann jedoch nur dann zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses führen, wenn der Vorgang, der untersucht werden soll, den Anforderungen des Art. 53 Abs. 2 B-VG entspricht, es sich also um einen bestimmten, abgeschlossenen Vorgang im Bereich der Vollziehung des Bundes handelt. Soweit ein Verlangen rechtmäßig ist, muss diesem umgekehrt aber auch entsprochen werden.
Vor dem Hintergrund, dass der Verfassungsgesetzgeber bei der Beschlussfassung über Art. 53 Abs. 2 B-VG und insbesondere über die Verwendung des Begriffes "bestimmter […] Vorgang" das "etablierte parlamentarische Konzept" (so Konrath/Neugebauer/Posnik, Das neue Untersuchungsausschussverfahren im Nationalrat, JRP 2015, 216 [218]) aus Art. 52b B-VG und § 99 Abs. 2 GOG-NR – der in Ausführung von Art. 126b Abs. 4 B-VG ergangen ist – vor Augen hatte (AB 439 BlgNR XXV. GP, 3; der Begriff wird in der Praxis weit ausgelegt [vgl dazu Konrath/Neugebauer/Posnik, aaO, 218; Kahl, aaO, 4; Zögernitz, Nationalrat-Geschäftsordnung4, 2020, 622]), sind keine zu strengen Anforderungen an die Bestimmtheit des Gegenstandes der Untersuchung (Art. 53 Abs. 2 B VG) zu stellen (VfSlg. 20370/2020, 171).
Für ein vermindertes Bestimmtheitserfordernis spricht auch, dass zum Zeitpunkt der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses das Tatsachenmaterial, um dessen Ermittlung
es gerade gehen soll, häufig noch sehr lückenhaft sein wird. Würde verlangt, dass in einem Verlangen der zu untersuchende Vorgang exakt benannt werden muss, würde politische Kontrolle, die in der Praxis oft nur von Vermutungen ausgehen kann, unterlaufen (vgl. Konrath/Posnik, Art. 53 BVG, in: Kahl/Khakzadeh/Schmid [Hrsg.] Bundesverfassungsrecht, 2021, 11). Denn gerade im Fall politischer Kontrolle setzt die Notwendigkeit, etwas erst aufzuklären, denklogisch ein hohes Maß an vorausgehender Unbestimmtheit voraus, da dem Nationalrat abseits des Untersuchungsrechts des Art. 53 B-VG kein Recht zur Selbstinformation zusteht, das ggf. auch mit hoheitlichen Mitteln durchgesetzt werden kann. Es wäre in diesem Sinne verfehlt, in einem Einsetzungsverlangen eine Bestimmtheit des zu untersuchenden Vorgangs zu verlangen, die auch nur annähernd jenem Grad entspricht, der gerade erst durch die Untersuchung hervorgebracht werden kann. Die Erfüllung einer solchen Voraussetzung wäre in jedem Fall unmöglich. Insbesondere ist es Wesensmerkmal einer Untersuchung, dass die ihr zu Grunde liegenden Annahmen im Zuge der Untersuchung auch noch widerlegt werden können. Der Rechnungshof hat auf gleichartige Weise darauf hingewiesen, dass von ihm nicht verlangt werden kann, die erst im Rahmen seiner Prüfung erkundbaren Umstände bereits im Vorhinein darzulegen (vgl. VfGH 11.12.2018, KR1/2018 ua). Aus diesen Gründen muss es dem Nationalrat unbenommen bleiben, den Untersuchungsgegenstand umfassender zu formulieren.
Das Bestimmtheitserfordernis kann auch nicht so weit reichen, dass ein Verlangen nur Rechtsbegriffe enthalten darf. Im Hinblick auf den weiten Vollziehungsbegriff des Art. 53 B-VG sowie den politischen Charakter der Untersuchung ist für die Bestimmtheit allein die Eignung der verwendeten Begriffe maßgebend, den Untersuchungsgegenstand in einer Weise zu umschreiben, dass sich jedenfalls anhand einer Auslegung ein eindeutiges Ergebnis gewinnen lässt. In diesem Sinne erläutern die Materialien (AB 439 BlgNR XXV. GP, 4) den Begriff des bestimmten Vorgangs als lediglich "bestimmbare[n] und abgrenzbare[n] Vorgang" in der Vollziehung des Bundes. Die Untersuchung könne – so die Materialien weiter – "mithin nur inhaltlich zusammenhängende Sachverhalte" betreffen. Das Wort "ein" werde als "unbestimmter Artikel und nicht als Zahlwort verwendet". Die "Forderung eines inhaltlichen, personellen oder zeitlichen Zusammenhangs" (Hervorhebung nicht im Original) schließe aus, "dass mehrere, unterschiedliche Vorgänge oder Themen in einem Untersuchungsausschuss untersucht werden, die nur lose miteinander verknüpft sind, etwa weil es sich um Vorgänge innerhalb des Zuständigkeitsbereiches eines Bundesministeriums" handle. "Die Bestimmbarkeit und Abgrenzbarkeit eines Vorgangs" schließe nicht aus, "dass Untersuchungsgegenstand und Untersuchungsauftrag eine Untergliederung in einzelne Abschnitte bzw. Beweisthemen aufweisen, zumal ein Vollzugsakt auch in einzelne Phasen zerlegt werden" könne. Dazu sieht § 1 Abs. 5 VO-UA vor, dass eine inhaltliche Gliederung des Gegenstandes der Untersuchung nach Beweisthemen zulässig, eine Sammlung nicht direkt zusammenhängender Themenbereiche hingegen unzulässig ist. Lediglich „verschiedene, nicht zusammenhängende Vorgänge“, die sich „über einen größeren und jeweils unterschiedlichen Zeitraum erstrecken, und die im Verantwortungsbereich mehrerer Bundesministerien verortet wurden“ (Hervorhebung nicht im Original), dürfen nicht Gegenstand eines Untersuchungsausschusses sein, da sie nicht direkt zusammenhängen.
Würden die Anforderungen an die Formulierung des Untersuchungsgegenstandes doch eng gezogen, wäre es auf Grund des unsicheren Tatsachenmaterials und der damit verbundenen Notwendigkeit einer Prognoseentscheidung über die festzustellenden Tatsachen außerdem erforderlich, dass der Geschäftsordnungsausschuss oder in weiterer Folge der Verfassungsgerichtshof anstelle der Einsetzungsminderheit eine politische Wertungsentscheidung über das Bestehen eines inhaltlichen Zusammenhangs trifft. Eine solche Wertung wäre jedoch im Sinne der Wirksamkeit der politischen Kontrolle verfassungsrechtlich gerade unzulässig (vgl. VfSlg. 20370/2020, 201). Ein „Vorgang“ soll
inhaltlich zusammenhängende Sachverhalte umschreiben und ausdrücklich nicht auf einen einzelnen Vorgang beschränkt sein. Das Vorliegen eines ausreichenden inhaltlichen Zusammenhangs bleibt insofern eine Wertungsfrage (vgl. Konrath/Posnik, aaO, 11). Angesichts dessen, dass das Bundes-Verfassungsgesetz durch Einräumung besonderer Rechte, die auch einer qualifizierten Minderheit zustehen, dem Nationalrat eine wirksame Kontrolle der Vollziehung ermöglichen will und der besondere Charakter politischer Kontrolle zwangsläufig von unterschiedlichen Wertungen geprägt ist, hat sich der Geschäftsordnungsausschuss bzw. in weiterer Folge der Verfassungsgerichtshof zurückzuhalten und die Prüfung des inhaltlichen Zusammenhangs lediglich auf die Nachvollziehbarkeit der im Verlangen vorgebrachten Argumente zu beschränken.
Im Hinblick darauf, dass ein Minderheitsverlangen der Überprüfung durch den Geschäftsordnungsausschuss unterzogen wird und dessen (dieses Verlangen für ganz oder teilweise unzulässig erklärender) Beschluss im Rahmen eines Verfahrens gemäß Art. 138b Abs. 1 Z 1 B-VG vom Verfassungsgerichtshof überprüft werden kann sowie die verlangenden Abgeordneten die Einhaltung der verfassungsgesetzlichen Voraussetzungen bereits gegenüber dem Geschäftsordnungsausschuss darzulegen haben (vgl. VfSlg. 20370/2020, 173), ist dem Verfassungsgerichtshof daher zuzustimmen, wenn er keine zu strengen Anforderungen an die Bestimmtheit des Gegenstands stellt (VfSlg. 20370/2020, 171): Denn ansonsten würde die Arbeit parlamentarischer Untersuchungsausschüsse (Aufdeckung vielleicht doch bestehender Zusammenhänge) auf den Geschäftsordnungsausschuss bzw. den Verfassungsgerichtshof verlagert. Gerade weil den verlangenden Abgeordneten eine nähere Kenntnis der erst zu untersuchenden Zusammenhänge im Vorhinein nicht möglich ist, kann es auch nicht Aufgabe des Geschäftsordnungsausschusses bzw. des Verfassungsgerichtshofes sein, erst im Zuge der Untersuchung mit den besonderen Möglichkeiten eines Untersuchungsausschusses festzustellende Zusammenhänge - gleichsam stellvertretend - zu präzisieren (vgl. dazu auch VfGH 10.6.2016, G70/2016 mwN sowie VfSlg. 20213/2017). Ein Maß an Bestimmtheit, das den von der Untersuchung Betroffenen im Vorhinein ermöglicht, den Umfang der Untersuchung festzustellen, muss daher den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügen (vgl. Konrath/Posnik, aaO, 11).
In diesem Sinne finden sich auch in der deutschen Rechtsprechung, die das Bestimmtheitsgebot gleichermaßen kennt und es für Untersuchungsausschüsse unmittelbar aus dem Rechtstaatsprinzip des Grundgesetzes ableitet, nur vereinzelt auf Ebene der deutschen Bundesländer Beispiele für die Verfassungswidrigkeit eines Untersuchungsgegenstandes. In jenen Fällen, in denen die Verfassungskonformität verneint wurde, handelte es sich abseits von Formalmängeln - durchwegs um offenkundige Verstöße, die zu einer begleitenden Kontrolle der Vollziehung bzw. zu einer Selbstermächtigung des jeweiligen Untersuchungsausschusses geführt hätten. Hingegen wurden auch sehr umfassende Untersuchungsgegenstände höchstgerichtlich akzeptiert, wie etwa jener, der die mutmaßliche Vernetzung von Regierungsmitgliedern mit der „organisierten Kriminalität“ über einen Zeitraum von 18 Jahren zum Gegenstand der Untersuchung erhob (vgl. VerfGH Sachsen, 29.08.2008, 154-I-07). Zum Teil wird im Interesse des Schutzes der Rechte der Einsetzungsminderheit sogar eine Vermutung der rechtlichen Zulässigkeit eines Einsetzungsantrags judiziert (vgl. BayVerfGH NVwZ 1995, 681 [682]).
Aus all dem ergibt sich, dass der den Bestimmungen des Art. 52b B-VG und § 99 Abs. 2 GOG-NR entliehene und Art. 53 B-VG zu Grunde liegende Begriff des "bestimmten Vorganges" lediglich eine sachliche Einschränkung der jeweils von der Minderheit verlangten Untersuchung (vgl. Zögernitz, Nationalrat-Geschäftsordnung4, 2020, 622) in dem Sinne bewirkt, dass der zu untersuchende Vorgang konkret und abgegrenzt sein muss (vgl. Kahl, aaO, 4; vgl auch Hengstschläger, Rechnungshofkontrolle – Kommentar zum fünften Hauptstück des B-VG "Rechnungs- und Gebarungskontrolle", 2000, 211; Scholz, Zum zulässigen Gegenstand parlamentarischer Untersuchungsausschüsse, JRP 2015, 232 [239]).
Hengstschläger/Janko gehen davon aus, dass überhaupt nur solche Prüfaufträge, die „weder ein konkretes Kontrollobjekt noch einen bestimmten Gebarungszeitraum bezeichnen“ die Anforderung eines „bestimmten Vorgangs“ nicht erfüllen (Hengstschläger/Janko, Der Rechnungshof – Organ des Nationalrates oder Instrument der Opposition? in: Österreichische Parlamentarische Gesellschaft [Hrsg.], 75 Jahre Bundesverfassung [1995], 460). Der Verfassungsgerichtshof hat in vergleichbaren Verfahren gemäß Art. 126a B VG ausgesprochen, dass der Prüfungsgegenstand des Rechnungshofes entweder durch sachliche oder zeitliche Eingrenzung ausreichend bestimmt werden kann. Bloße Bestimmbarkeit genügt (VfGH 30.11.2017, KR1/2017 sowie VfGH 11.12.2018, KR1/2018 ua; vgl. Schrefler-König/Loretto, VO-UA [2020], 379).
Auch die parlamentarische Praxis der Prüfbeschlüsse gemäß § 52b B-VG bzw. § 99 Abs. 2 GOG-NR, die der Verfassungsgesetzgeber dem Begriff des „bestimmten Vorgangs“ anlässlich der Beschlussfassung der Novelle zu Art. 53 B-VG (BGBl. I 101/2014) selbstverständlich zu Grunde legte, zeigt, dass die erforderliche Konkretisierung und Abgrenzung durch Heranziehung unterschiedlicher Kriterien bewirkt werden kann. Beschlüsse des Nationalrates auf besondere Gebarungsprüfung bestimmter Vorgänge auf Grundlage der genannten Bestimmungen erfolgten u.a.:
1. Zur Verkehrs- und Infrastrukturpolitik seit dem Jahr 2000 (3/URH2 XXII.GP):
„Die Verkehrs- und Infrastrukturpolitik seit dem Jahr 2000 hinsichtlich der Bereiche Straße und Schiene, insbesondere die Finanzierung des ‚Generalverkehrsplanes‘ sowie Management-, PPP- und LKW-Maut-Problemstellungen der ASFINAG.“
2. Zur Gebarung des BKA und der anderen Zentralstellen (Bundesministerien) hinsichtlich der Vollziehung aller dienst-, besoldungs- und pensionsrechtlichen Bestimmungen (885/A XX.GP):
„Der Rechnungshof wird gemäß § 99 GOG - NR mit der Durchführung einer Sonderprüfung der Gebarung des Bundeskanzleramtes und der anderen Zentralstellen (Bundesministerien) hinsichtlich der Vollziehung aller dienst -, besoldungs – und pensionsrechtlichen Bestimmungen einschließlich des Ausschreibungsgesetzes 1989 insbesondere auch im Hinblick auf finanzielle und laufbahnmäßige Begünstigung von Personen im politischen Nahebereich (z.B. Ministerbüro) der Regierungsmitglieder beauftragt.“
3. Zur Gebarung von BMF und ÖNB sowie Wertpapieraufsicht hinsichtlich der Erfüllung ihrer Aufsichtspflicht (969/A XX.GP):
„Der Rechnungshof wird gemäß § 99 GOG - NR mit der Durchführung einer Sonderprüfung der Gebarung des Bundesministeriums für Finanzen, der Oesterreichischen Nationalbank und der Wertpapieraufsicht hinsichtlich der Erfüllung ihrer Aufsichtspflicht über die in Österreich tätigen Kreditinstitute insbesondere im Zusammenhang
- mit dem Versagen der Organe der Bankenaufsicht im Rahmen der Kontrolle der Rieger - Bank und der Diskont - Bank, das zu einer Schädigung zahlreicher Kleinanleger geführt hat,
- mit der Rolle der Bankenaufsicht bei den Karibikgeschäften der BAWAG sowie
- mit der Mißachtung der vom Rechnungshof bereits 1993 erhobenen Forderung, die Bankenaufsicht zu einem durchschlagskräftigen Kontrollorgan umzugestalten,
beauftragt.“
4. Zur Aufsichtspflicht des BMF, der OeNB und der FMA (5/URH2 XXII.GP):
„Die Gebarung des Bundesministeriums für Finanzen, der Oesterreichischen Nationalbank und der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) einschließlich der Tätigkeit ihrer Rechtsvorgängerin, der Bundes-Wertpapieraufsicht (BWA), hinsichtlich der Erfüllung
ihrer Aufsichtspflicht über die Geschäfte der Bank für Arbeit und Wirtschaft AG (BAWAG) einschließlich ihrer Tochterunternehmen, und zwar insbesondere deren „Karibik-Geschäfte“, Kredite, Haftungen, Garantien, Beteiligungen, Ver- und Rückkäufe von Aktien sowie sonstiger Geschäfte und Geldflüsse zur Verschleierung des tatsächlichen Vermögensstandes der BAWAG vor allem im Zeitraum des wahrscheinlichen Entstehens der Verluste von etwa 1,4 Mrd. €; dies betrifft im Besonderen die Jahre 1994 bis 2000, wobei auch der Zeitraum 2000 bis heute in die Betrachtung mit einzubeziehen ist, da der amtierende Finanzminister umgehend nach seinem Amtsantritt den Auftrag zur Gründung einer unabhängigen und weisungsfreien Allfinanzmarktaufsichtsbehörde gegeben hat.“
5. Zu acht verschiedenen Fragen bezüglich der „Schaltung von Inseraten durch bzw. im Auftrag bzw. im Interesse von Bundesministerien“ (2079/A XXIV.GP).
6. Zur Gebarung des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie, der ÖBB Holding AG sowie den nachgeordneten Gesellschaften des ÖBB-Konzerns und des Bundesministeriums für Justiz (2/URH2 XXIV.GP):
„Die Gebarung des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie, der ÖBB Holding AG sowie den nachgeordneten Gesellschaften des ÖBB-Konzerns und des Bundesministeriums für Justiz, hinsichtlich
a) der Vorbereitung, Durchführung und Aufarbeitung von Finanztransaktionen der ÖBB Holding und den nachgeordneten Gesellschaften des ÖBB-Konzerns mit der Deutschen Bank und anderen beteiligten Finanzdienstleistern, der im Zusammenhang mit diesen Vorgängen beauftragten Gutachten, der darauf folgenden Auflösung von Managerverträgen inklusive der damit einhergehenden Vereinbarungen, (wie beispielsweise Abfertigungen) sowie des Stands etwaiger damit im Zusammenhang stehender gerichtlicher Verfahren;
b) des Ankaufs der ungarischen MAV Cargo, der damit im Zusammenhang stehenden Beratungsverträge sowie möglicher Provisionszahlungen, der bilanzmäßigen Bewertung im Zeitablauf, sowie des Stands etwaiger damit im Zusammenhang stehender gerichtlicher Verfahren;
c) des Beschaffungswesens innerhalb des ÖBB Konzerns seit dem Jahr 2000, insbesonders der Beschaffung von Handys und des Abschlusses von Telekomdienstleistungsverträgen.“
Auch in der auf die Novelle folgenden parlamentarischen Praxis ist keine Änderung an diesem extensiven Verständnis des Begriffs des „bestimmten Vorgangs“ erkennbar. So wurde auf Antrag von Abgeordneten der ÖVP eine besondere Gebarungsprüfung betreffend Ressortführung des Gesundheitsministeriums in der XXIV. und XXV. Gesetzgebungsperiode in den Jahren 2009 bis 2017 durch SPÖ-Gesundheitsminister (561/A XXVI.GP) mit den Stimmen der damaligen Koalitionsparteien ÖVP und FPÖ sowie folgendem Wortlaut beschlossen:
„Der Rechnungshof wird gemäß § 99 Abs. 1 GOG mit einer besonderen Gebarungsüberprüfung des Bereiches Gesundheit im jeweils für Gesundheit zuständigen Bundesministerium einschließlich der Tätigkeit der Ressortleitung in diesem Bereich beauftragt. Diese Gebarungsüberprüfung möge im Sinne der Einleitung des Antrags insbesondere alle
Maßnahmen rechtlicher, organisatorischer, finanzieller und personeller Natur durch den/die jeweilige Gesundheitsminister/in in der XXIV. und XXV. Gesetzgebungsperiode in den Jahren 2009 bis 2017 in den nachstehenden Bereichen umfassen, welche Kosten damit verbunden waren, welche Wirkungen erzielt wurden, und welche Empfehlungen aus den bei der Gebarungsüberprüfung gewonnenen Erkenntnissen abgeleitet werden können:
1. Berücksichtigung der demographischen Veränderungen in der Altersstruktur der Allgemeinmediziner und Fachärzte in Österreich und Maßnahmen zur Vermeidung eines Kassenärztemangels.
2. Bessere Verankerung von Allgemeinmedizin im Studium der Humanmedizin, durch Einrichtung eines Lehrstuhls für Allgemeinmedizin an jeder Medizinischen Universität und durch bessere Integration der Allgemeinmedizin in die Studienpläne sowie verpflichtende Praktika in Hausarztordinationen im Klinisch Praktischen Jahr.
3. Evaluierung der Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten, im Hinblick die nachhaltige Sicherstellung der Attraktivität der Allgemeinmedizin.
4. Verschränkungen zwischen Klinisch Praktischem Jahr, Basisausbildung („Common Trunk“) sowie der weiteren Ausbildung zum/zur Allgemeinmediziner/Allgemeinmedizinerin
5. Inhalte sowie die Dauer der Ausbildung oder einzelner ihrer Bestandteile
6. Monitoring der Ausbildungsplätze im Hinblick auf den künftig zu erwartenden Ärztebedarf.
7. Sicherstellen der Finanzierung von Lehrpraxen und Prüfung der Möglichkeit, dass die Lehrpraxis auch parallel zu Spitals-Turnusausbildung absolviert werden kann
8. Sicherstellung einer für den kassenärztlichen Nachbesetzungsbedarf ausreichenden Anzahl von allgemeinmedizinischen post-graduate- Ausbildungsplätzen in öffentlichen Krankenanstalten als Begleitmaßnahme zur Ärzte-Ausbildungsreform 2015
9. Sicherstellung des ärztlichen Nachwuchses für den extramuralen Bereich in Mangel-Sonderfächern wie z.B. Kinderheilkunde oder Psychiatrie
10. Faire Entlohnung für niedergelassene Allgemeinmediziner/innen im Vergleich zu nicht-technischen Sonderfächern, sowie im Interesse der Patient/innen
Schaffung eines zeitgemäßen Honorarkatalogs für Kassenleistungen in der Allgemeinmedizin oder im zahnärztlichen Bereich.
11. Umsetzung einer wohnortnahen Planung von allgemeinmedizinischen Kassenplanstellen und Primärversorgungsstrukturen mit dem Ziel, eine flächendeckende Versorgung unter Berücksichtigung von Demographie und Erreichbarkeit auch in Zukunft zu sichern. Entlastung von Bürokratie, effektive Unterstützung durch Informations- und Kommunikationstechnologien (Einsatz von ELGA und eMedikation)
12. Umsetzung von flexibleren Vertragsmodellen im Rahmen der Gesamtverträge (z.B. Übergangspraxen vor Pensionierung, Jobsharing-Praxen)
13. Entwicklung von Honorierungsmodellen in der Allgemeinmedizin, die Ergebnis- und Servicequalität fördern und attraktive Rahmenbedingungen für besondere Betreuungsbedarfe bieten (z.B. Disease Management Programme).
14. Bedarfsgerechte Ordinations- und Öffnungszeiten, inklusive Tagesrandzeiten bzw. Wochenende (mindestens fünf Tage, 20 Stunden pro Woche).
15. Schaffung einer Gründerinitiative für Primärversorgungseinheiten
16. Ermöglichung von rechtlich abgesicherten multiprofessionellen Kooperationsformen der Gesundheitsberufe, unabhängig von der Organisations- oder Betriebsform
17. Prüfung der Möglichkeit der Anstellung von Ärztinnen und Ärzten bei Standeskollegen in Primärversorgungseinheiten und anderen ärztlichen Ordinationen einschließlich der dafür erforderlichen rechtlichen Rahmenbedingungen.
18. Maßnahmen zur Verbesserung der quantitativ mangelhaften psychotherapeutischen Versorgung mit vollfinanzierten Therapieplätzen und Qualitätssicherung in diesem Bereich durch eine Reform des in die Jahre gekommenen Psychotherapiegesetzes
19. Zielorientierte Zusammenführung der verschiedenen Präventionstöpfe beim Gesundheitsministerium/GÖG, Sozialversicherung und Zielsteuerung oder klare Aufgabenteilung und Abstimmung der Programme zur Erhöhung der Wirkung von Maßnahmen
20. Zeitgemäße Reform des Mutter-Kind-Passes und der Vorsorgeuntersuchungen
21. Sicherstellung der Versorgung der österreichischen Bevölkerung mit wichtigen Impfstoffen
22. Maßnahmen zur Schaffung einer klaren Datenlage zur Durchimpfungsrate gegen wichtige und gefährliche Infektionskrankheiten und Maßnahmen zur Verbesserung
23. Maßnahmen im Sinne der Frauen-Gesundheit
24. Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung der Volksgesundheit
25. Maßnahmen zur Früherkennung und zeitgerechten Eindämmung eingeschleppter Infektionskrankheiten
26. Schaffung einer klaren Datenlage im Zusammenhang mit sog. „Spitalskeimen" und Maßnahmen zur Reduktion des damit verbundenen Infektionsrisikos
27. Soweit die in den Punkten 1 bis 25 genannten Bereiche ein Zusammenwirken mit Krankenversicherungsträgern, Spitalsträgern oder anderen Gebietskörperschaften erfordert: welche Maßnahmen mit welcher Wirkung wurden im Rahmen der Aufsicht oder im Wege von Verhandlungen oder durch gesetzliche Initiativen konkret durch das Gesundheitsressort gesetzt, um eine gemeinsame Vorgangsweise zu erreichen?“
Der Rechnungshof führte auf Grund dieses Beschlusses auch tatsächlich eine Gebarungsprüfung durch, deren Ergebnisse zunächst in Reihe BUND 2021/30 (III-396 BlgNR XXVII.GP) veröffentlicht wurden.
Der im Sinne der obigen Ausführungen definierte Untersuchungsgegenstand begründet den Rahmen der Tätigkeit des Untersuchungsausschusses, bindet diesen und bildet gleichzeitig die Begrenzung der diesem übertragenen Zwangsbefugnisse. Zugleich dient die Festlegung des Untersuchungsgegenstandes aber auch dem Schutz der betroffenen Organe, weil damit deren Verpflichtung zur Vorlage von Akten und Unterlagen konkretisiert sowie der Umfang bestimmt wird, innerhalb dessen sie Ersuchen um Beweiserhebungen Folge zu leisten haben. Durch das Erfordernis des Vorliegens eines bestimmten Vorganges wird es umgekehrt aber auch nicht ins Belieben der betroffenen Organe gestellt, welche Beweismittel sie dem Untersuchungsausschuss vorlegen. Darüber hinaus bietet die geforderte Konkretisierung auch einen Schutz der Einsetzungsminderheit vor „Bepackung“ und Verwässerung durch die Mehrheit im Zuge der Ausschusstätigkeit.
Den geschilderten gesetzlichen Anforderungen wird im vorliegenden Fall umfassend entsprochen:
Der Untersuchungsgegenstand wird auf Grund der zuletzt ergangenen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs (VfSlg. 20370/2020) im Vergleich zu früheren Einsetzungsverlangen nunmehr kaskadenartig aufgebaut, gegliedert und konkretisiert. Dies dient dem vorrangigen Ziel, den Untersuchungsgegenstand präzise abzugrenzen und den von der Untersuchung Betroffenen, insbesondere den vorlagepflichtigen Organen, die Beurteilung zu ermöglichen, welche Informationen jedenfalls abstrakt für die Untersuchung von Relevanz sein können. Auf diese Art wird außerdem ausgeschlossen, dass der Untersuchungsausschuss selbständig die Untersuchung auf weitere Bereiche ausweiten kann. Der Untersuchungsausschuss verfügt über keinerlei Ermessensspielraum in Hinblick auf den Umfang der Untersuchung, sondern lediglich darüber, auf welche Art er Beweise innerhalb der Grenzen des Untersuchungsgegenstandes erheben will (vgl. auch Konrath/Neugebauer/Posnik, aaO, 218).
Auf der ersten Stufe wird der zu untersuchende Vorgang verbindlich eingegrenzt. Der maßgebliche Untersuchungsanlass (der Verdacht der parteipolitischen Instrumentalisierung von Strukturen des Bundes) wird angeführt. Die relevanten Akteure (die Mitglieder eines auf längere Zeit angelegten Zusammenschlusses bestehend aus der ÖVP zuzurechnenden Personen) und Handlungen (unsachliche Vorteilsgewährung sowie diesbezügliche Vorbereitungshandlungen auf Grundlage des „Projekt Ballhausplatz“), der Zeitraum, der sachliche Umfang (Eignung zur parteipolitischen Begünstigung im Bereich der Vollziehung des Bundes) sowie die Zielrichtung der Untersuchung (Verdacht der Umgehung bzw. Verletzung gesetzlicher Vorschriften) werden als konstitutive Merkmale des zu untersuchenden Vorgangs benannt. Gerade auf Grund des komplexen, der Untersuchung zu Grunde liegenden Sachverhalts muss die Bestimmung des Untersuchungsgegenstands durch eine Kombination mehrerer Elemente erfolgen. Es werden im vorliegenden Untersuchungsgegenstand gleichzeitig mehrere der in den Materialien alternativ als geeignet genannten Abgrenzungskriterien kumulativ angewandt, obwohl – wie Ausschussbericht, Judikatur und Lehre übereinstimmend vertreten (s.o.) – bereits ein einziges dieser Kriterien zur Erfüllung des Bestimmtheitserfordernisses genügen würde. Bei Benennung all dieser Kriterien ist der Untersuchungsgegenstand sogar „jedenfalls (…) bestimmt“ (AB 71 BlgNR XXVI.GP, 19; vgl. auch Konrath/Neugebauer/Posnik, aaO, 218).
Auf der zweiten Stufe wird der Untersuchungsgegenstand inhaltlich nach Beweisthemen gegliedert. Damit wird dem Untersuchungsausschuss ein hinreichend klar umrissenes Arbeitsprogramm vorgegeben (vgl. VfSlg. 20370/2020, 174) und die Schwerpunkte der Untersuchung verbindlich festgelegt, wie es auch der Ausschussbericht (vgl. AB 440 BlgNR XXV.GP, 7) empfiehlt:
„Da solche Vorgänge, auch wenn sie grundsätzlich näher definiert werden, erfahrungsgemäß ein hohes Maß an Komplexität aufweisen, soll im Antrag bzw. Verlangen nach Möglichkeit auch eine inhaltliche Gliederung nach Beweisthemen erfolgen.“
Die Konkretisierung durch Beweisthemen dient zusätzlich dem Zweck, die zu untersuchenden Themen derart festzulegen, sodass dem Untersuchungsausschuss die Erfüllung seines Auftrags im Rahmen der von § 53 VO-UA vorgegebenen Fristen ermöglicht wird. Der notwendige Umfang der Untersuchung bleibt innerhalb der Grenzen des Untersuchungsgegenstandes direkte Folge des vermuteten Missstands (vgl. dazu die Möglichkeiten der allfälligen Verlängerung der Dauer des Untersuchungsausschusses in § 53 VO UA). Zu beachten ist, dass sowohl für den grundsätzlichen Beweisbeschluss eine Gliederung nach den Beweisthemen vorgeschrieben ist (vgl. § 24 Abs. 3 VO-UA), als auch eine Befragung von Auskunftspersonen außerhalb der angeführten Beweisthemen unzulässig wäre (vgl. § 41 Abs. 1 VO-UA). Insofern verfügen die Beweisthemen über eigenständigen normativen Gehalt.
Auf der dritten Stufe werden jene Sachverhalte detailliert beschrieben, die im Zuge der Tätigkeit des Untersuchungsausschusses insbesondere aufgeklärt werden sollen. Damit wird im Vergleich zu früheren Einsetzungsverlangen der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes nachgekommen, wonach ein Untersuchungsausschuss im Rahmen des Beweisverfahrens konkrete Fragen untersuchen soll (VfSlg. 20370/2020, 172). Diese Auflistung kann auf Grund des im Vorfeld der Untersuchung noch nicht feststehenden Tatsachenmaterials zwar nur exemplarisch sein, bietet dem Untersuchungsausschuss aber in Zusammenschau mit dem Untersuchungsgegenstand und den Beweisthemen eine klare Anleitung, wie die Untersuchung zu gestalten ist. Feststeht, dass der Umfang der Untersuchung der genannten Sachverhalte jedenfalls durch den bestimmten, abgeschlossenen Vorgang beschränkt ist, auch wenn die gewählten Formulierungen allenfalls breiter verstanden werden könnten. Die Auflistung beispielhafter Sachverhalte, die aus Sicht der verlangenden Abgeordneten untersuchungswürdig sind, ermöglicht zugleich eine Auslegung des Untersuchungsgegenstands, welcher zwangsweise umfassend
und abstrakt formuliert sein muss, und bietet den vorlagepflichtigen Organen außerdem eine Anleitung, nach welchen Gesichtspunkten sie ihren Aktenbestand zum Zwecke der Erfüllung ihrer Vorlageverpflichtungen auf Grund des grundsätzlichen Beweisbeschlusses insbesondere zu sichten haben. Sollte ein vorlagepflichtiges Organ der Ansicht sein, dass einer der genannten beispielhaften Sachverhalte nicht vom Untersuchungsgegenstand erfasst ist, ist dies gegenüber dem Untersuchungsausschuss konkret und nachvollziehbar darzulegen. Der Untersuchungsausschuss kann diese Argumentation bestreiten und in weiterer Folge den Verfassungsgerichtshof um eine Nachprüfung im Wege eines Verfahrens gemäß Art. 138b Abs. 1 Z 4 B-VG ersuchen (vgl. zuletzt VfGH 10.5.2021, UA4/2021).
Auf der vierten Stufe enthält das vorliegende Verlangen eine ausführliche Begründung, die zur weiteren Erläuterung der verwendeten Begriffe, der bekannten faktischen Grundlagen und untersuchungsauslösenden Sachverhalte sowie des vermuteten Missstands dient. Außerdem wird bereits gegenüber dem Geschäftsordnungsausschuss die Einhaltung der verfassungsgesetzlichen Voraussetzungen umfassend darlegt.
Zu den im Untersuchungsgegenstand verwendeten Begriffen:
Die im Untersuchungsgegenstand genannten Personen bilden gemeinsam einen auf längere Zeit angelegten Zusammenschluss, da diese in der Realität der Regierungsarbeit als einheitliche Gruppe mit eigenen Entscheidungsstrukturen agiert, die von parteipolitischen Loyalitäten geprägt ist und als solche auch einheitlich gegenüber dem Koalitionspartner auftritt. Koordinierungsprozesse in der Bundesregierung belegen dies insofern, als dass Regierungshandeln in Koalitionsregierungen ein ständiges gegenseitiges Abstimmen zwischen den an der Koalition beteiligten Parteien erfordert und daher stets Einigkeit zwischen beiden Parteien hergestellt werden muss und nicht etwa nur zwischen den sachlich zuständigen Ressorts. In diesem Sinne besteht in jeder Koalitionsregierung ein System der „Spiegelung“ mit „RegierungskoordinatorInnen“, entweder zwischen fest zugeteilten Ressorts oder zentral durch ein Koordinierungsgremium. Entsprechende Ausführungen zur Regierungspraxis sind den Befragungen von Bundeskanzler Kurz und den Regierungskoordinatoren Hofer und Blümel im Ibiza-Untersuchungsausschuss zu entnehmen (50/KOMM, 52/KOMM und 55/KOMM XXVII.GP). Auf Grund der selbständigen Struktur dieses Zusammenschlusses ist irrelevant, welche Person konkret die Funktion ausübt. Es kommt vielmehr auf die von ihnen formell oder informell eingenommene Stellung an. So belegen an den Ibiza-Untersuchungsausschuss gelieferte Chats, dass Sebastian Kurz bereits als Außenminister innerhalb seiner Gruppe informell eine führende Rolle zukam. So stattete Thomas Schmid, damals Kabinettschef von Finanzminister Schelling, das BMEIA bereits im Frühjahr 2016 gegen den Willen des damaligen Parteichefs und Vizekanzlers Mitterlehner mit zusätzlichen budgetären Mitteln aus. Die dazugehörige Korrespondenz zwischen Schmid und Gernot Blümel lautete wie folgt:
Am 11. April 2016 schrieb Thomas Schmid – Generalsekretär und Kabinettschef im Finanzministerium – stakkatoartig rasch hintereinander vier Nachrichten an Blümel: „Ich habe Sebastians Budget um 35 Prozent erhöht“ / „Scheisse mich jetzt an“ / „Mitterlehner wird flippen“ / „Kurz kann jetzt Geld scheissen“. Die lapidare Antwort Blümels: „Mitterlehner spiel (sic) keine Rolle mehr…“1
Die Schilderungen des ehemaligen Vizekanzlers Reinhold Mitterlehner in seinem Buch „Haltung“ – insbesondere jene zur Neuverhandlung des Regierungsprogramms im Frühjahr 2017 – lassen außerdem auf eine treibende Rolle von Wolfgang Sobotka als Teil der Gruppe um Sebastian Kurz schließen.
Geradezu elegant verdeutlicht wird der Bestand eines solchen Zusammenschlusses durch diverse Chatnachrichten, die von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) für den Ibiza-Untersuchungsausschuss ausgewertet wurden. Denn auf
nichts anderes kann es sich beziehen, wenn Gernot Blümel an Thomas Schmid schreibt: „Keine Sorge. Du bist Familie.“ Oder Sebastian Kurz an denselben folgende Nachricht sendet: „Kriegst eh alles was du willst 😘😘😘“. Der Journalist Klaus Knittelfelder nannte es „Partie statt Partei“ (Knittelfelder, Inside Türkis, Wien 2020, 19). Es ist dieser Zusammenschluss, dessen Verhalten im Mittelpunkt der Untersuchung steht. Die WKStA referenziert auf den Zusammenschluss in ihren Ermittlungsakten regelmäßig als „Gruppe um Sebastian Kurz“ oder „Sebastian Kurz und die Gruppe seiner engsten Vertrauten“.
Der ÖVP zuzurechnen sind jene Regierungsmitglieder, StaatssekretärInnen sowie MitarbeiterInnen politischer Büros, die der ÖVP angehören, von ihr vorgeschlagen wurden oder von ÖVP-VertreterInnen in ihre jeweiligen politischen Büros und Kabinette bestellt wurden. Maßgeblich ist dabei eine politische Betrachtung anhand der tatsächlichen Gegebenheiten. Eine formale Betrachtung wäre nicht geeignet, da jedes Regierungsmitglied unterschiedslos vom Bundespräsidenten auf Vorschlag des Bundeskanzlers ernannt wird. Es ist jedoch offenkundig, welcher Partei die jeweiligen Personen zuzuordnen sind, da es sich bei den genannten Funktionen um Angehörige der höchsten politischen Entscheidungsebene des Bundes und ihr engstes Umfeld handelt, das von den die Koalitionsregierung stützenden Parteien nicht Personen überlassen wird, auf die diese keinen Einfluss ausüben können oder die ihnen gegenüber nicht loyal sind. So sind selbst „unabhängige“ Mitglieder der Bundesregierung wie Karin Kneissl und Josef Moser zweifelsfrei der FPÖ bzw. der ÖVP zurechenbar gewesen.
Der Begriff des Gewährens bildet eine umfassende Beschreibung sowohl aktiven Tuns als auch Unterlassens und umfasst alle Erscheinungsformen des Vollziehungshandelns (sofern sie zur Vorteilsgewährung abstrakt geeignet sind, s.u.). Es wird dabei regelmäßig auf den potentiellen Wissensstand der jeweiligen Personen ankommen, da dieser Voraussetzung für ihr Verhalten ist. Insofern wird der Kenntnisstand der jeweiligen Regierungsmitglieder sowie ihres Umfelds zentraler Gegenstand der Beweiserhebungen sein. Vom Begriff des Gewährens sind angesichts der Vielfältigkeit der möglichen Einflussnahmeformen insbesondere in hierarchisch organisierten Einrichtungen wie Bundesministerien nicht nur eigene Handlungen der genannten Personen, die direkt zu einer Vorteilsgewährung führen, erfasst, sondern auch formelle Anordnungen wie auch informelle Bitten oder Wünsche, die eine Motivlage erkennen lassen, und so indirekt zu einer Begünstigung durch andere Personen im Bereich der Vollziehung des Bundes führen. Um dies zu verdeutlichen werden auch Vorbereitungshandlungen ausdrücklich erfasst. Es wird dabei regelmäßig auf die Frage der (potentiellen) Kausalität des Verhaltens von Regierungsmitgliedern oder ihren Büros für Handlungen oder Unterlassungen durch Bedienstete der jeweiligen Ressorts ankommen. Diesen Umstand umschreibt der Untersuchungsgegenstand durch die Verwendung der Wortfolge „auf Betreiben“.
Als Vorbereitungshandlungen werden ausdrücklich auch alle Handlungen auf Grundlage des „Projekts Ballhausplatz“ erfasst, da dieses erst die erforderliche machtpolitische Grundlage für die späteren Handlungen des Zusammenschlusses bildete (zu den Inhalten des Projekts Ballhausplatz siehe oben).
Der Begriff der „Verbundenheit“ beschreibt das erforderliche Naheverhältnis zur ÖVP, wobei dessen Grundlage vielfältig sein kann. Der Begriff der Verbundenheit erfasst in der Rechtsordnung unterschiedliche Formen der gegenseitigen Abhängigkeit, insbesondere wirtschaftlicher, aber auch rechtlicher Art. Gemeinsam ist den damit erfassten Sachverhalten ein Abhängigkeitsverhältnis, das gerade dadurch entsteht, dass jeweils eine Seite einen Vorteil anstrebt, der von der anderen Seite zur Verfügung gestellt werden kann, da er sich in dessen Ingerenz befindet. Die Verbundenheit mit der ÖVP indiziert bereits das Vorliegen des parteipolitischen Interesses. Verbunden sind insofern jedenfalls alle Unternehmen, an denen die ÖVP direkt oder indirekt beteiligt ist, ihr nahestehende Organisationen sowie Teilorganisationen, Unternehmen mit dauernder
Geschäftsbeziehung zur ÖVP oder ihren Teilorganisationen sowie solche, die unter kontrollierendem Einfluss von ÖVP-FunktionärInnen stehen oder treuhänderisch für die ÖVP verwaltet werden. Verbunden sind ebenso Personen, die auf parteipolitisches Wohlwollen angewiesen sind, um ihr berufliches Fortkommen zu fördern. Dies wird insbesondere dort der Fall sein, wo Personalentscheidungen (wenn nicht formell, dann faktisch) von ÖVP-PolitikerInnen getroffen werden.
Als Vorteil kommen auf Grund des politischen Hintergrunds des Verhaltens neben geldwerten Leistungen auch Handlungen wie die Ausübung von Ermessensspielräumen auf bestimmte Art sowie Unterlassungen wie etwa der Verzicht auf das Äußern von öffentlicher Kritik in Betracht. In gleichem Sinn besteht ein möglicher Schaden für den Bund, der im Zuge der Untersuchung zu klären ist, nicht nur in vermögenswerten Nachteilen, sondern insbesondere auch in Pflichtwidrigkeiten wie etwa der Verletzung des staatlichen Interesses auf Strafverfolgung oder auf wahrheitsgetreue Information des Nationalrats (vgl. OGH 12.10.1993, 14 Os 125/92), wie es auch in den Beweisthemen jeweils ausgeführt wird.
Auf Grund der gewählten Formulierung kommt zusammenfassend nur solches Verhalten als Untersuchungsobjekt in Betracht, das überhaupt abstrakt geeignet sein kann, mit der ÖVP verbundenen Personen einen Vorteil zu verschaffen. Insofern scheiden Vollziehungshandlungen aus, bei denen dem genannten Zusammenschluss bzw. seinen Mitgliedern keinerlei Ingerenz zukommt, da sie etwa gesetzlich zwingend sind, ihnen keine Entscheidungsbefugnis zukommt und auch keine Annahme besteht, dass gesetzlichen Bestimmungen umgangen worden sein könnten. Beispiele für solche Vorteile sind insbesondere die Auszahlung der Parteienförderung, Bundesjugendförderung oder Handlungen in Zusammenhang mit der gesetzlich der Partei zustehenden Nominierungsrechten, da diese allesamt gesetzlich zwingend sind und keinerlei Ermessensspielraum für Organe des Bundes besteht. Genauso scheidet Verhalten aus, das auf unteren Vollziehungsebenen selbständig und ohne Kenntnis der im gegebenen Zusammenhang im Interesse stehenden Oberbehörden erfolgte, bei denen eine Kenntnis, ein Auftrag oder eine Duldung durch Mitglieder der Bundesregierung oder ihren KabinettsmitarbeiterInnen von vornherein ausscheidet sowie rein private wenn auch parteipolitische - Tätigkeiten. Beispiele für solches Verhalten sind etwa die Behandlung von Verwaltungsangelegenheiten von ÖVP-Ortsparteien oder gewöhnlichen ÖVP-FunktionärInnen, solange keinerlei Hinweise auf eine Befassung der politischen Ebene des jeweiligen Bundesministeriums oder möglichen „vorauseilenden Gehorsams“ bestehen. Es ist insofern nur ein kleiner Teil der Amtsführung der im Untersuchungsgegenstand genannten Personen im Untersuchungszeitraum umfasst, da in jedem Fall das Vorliegen aller weiterer im Untersuchungsgegenstand genannten Voraussetzungen (Verbundenheit, Vorteilseignung, Ingerenz des Zusammenschlusses) abstrakt möglich sein muss und insofern nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen kann im Zweifel im Zuge der Beweiserhebungen des Untersuchungsausschusses sowie schlussendlich im Wege eines Verfahrens gemäß Art. 138b Abs. 1 Z 4 B VG überprüft werden.
Der Untersuchungsgegenstand ist sachlich und wertfrei formuliert, so dass es zu keiner unzulässigen Vorverurteilung kommt. Nachdem die Abgeordneten der ÖVP selbst eine potentielle Einsetzungsminderheit darstellen und ihnen im weiteren Verlauf des Untersuchungsausschusses auch dieselben Rechte (insbesondere auf Beweiserhebung) wie den im gegenständlichen Fall verlangenden Abgeordneten zukommt, ist außerdem Chancengleichheit und eine umfassende Erkundung des Sachverhalts im Sinne eines fairen Verfahrens gewährleistet (zur Zulässigkeit mittelbarer Untersuchung privater Personen siehe unten „Zur Einordnung in den Bereich der Vollziehung des Bundes“).
Zu den untersuchungsauslösenden Sachverhalten:
Ausgangspunkt der Untersuchung ist ein Missstand, den die allgemeine Öffentlichkeit als unveränderliche Gegebenheit des österreichischen politischen Systems zu akzeptieren
scheint, der jedoch das Vertrauen in die Sachlichkeit und Unabhängigkeit der politischen Institutionen der Republik untergräbt. Konkret angesprochen ist damit die Bevorzugung von Personen aus parteipolitischen Motiven, wobei der Kern des Vorwurfs darin besteht, dass gewisse Vorteile gerade eben nur auf Grund einer solchen parteipolitischen Nähe erlangt werden, weil ohne diese Nähe die Voraussetzungen für den besagten Vorteil nicht bestehen würden. Durch die Beweiserhebungen des Ibiza-Untersuchungsausschusses sind in Hinblick auf VertreterInnen der Österreichischen Volkspartei schwerwiegende Vorwürfe zu Tage getreten, die über den genannten, allgemeinen Missstand hinaus konkretisiert wurden und eine besondere, gesteigerte Ausprägung der österreichischen Kultur der – verniedlichend gesprochen - „Freunderlwirtschaft“ darstellen. Dieser Missstand konnte jedoch auf Grund der Beendigung des Ibiza-Untersuchungsausschusses und der Abgrenzung seines Untersuchungsgegenstandes nicht umfassend aufgeklärt werden.
Die Grenze zwischen jener parteipolitischen Interessensverfolgung, die in einem demokratischen System selbstverständlich und gar gewünscht ist, zu jener, die einen Missstand darstellt, verläuft entlang der Schädigung der Interessen des Bundes. In einem demokratischen System ist das oberste Ziel die Förderung des Gemeinwohls und nicht die Förderung von Partikularinteressen unter Umgehung des demokratischen Gleichheitsgebots, das sich insbesondere aus der Bundesverfassung ergibt, deren Einhaltung alle Mitglieder der Bundesregierung anlässlich ihres Amtsantritts förmlich geloben.
Zu berücksichtigen ist auch, dass die vermuteten Handlungen eine besondere Beeinträchtigung der demokratischen Kultur darstellen können. Die WKStA fasst dies in der Anordnung der Hausdurchsuchung wie folgt zusammen:
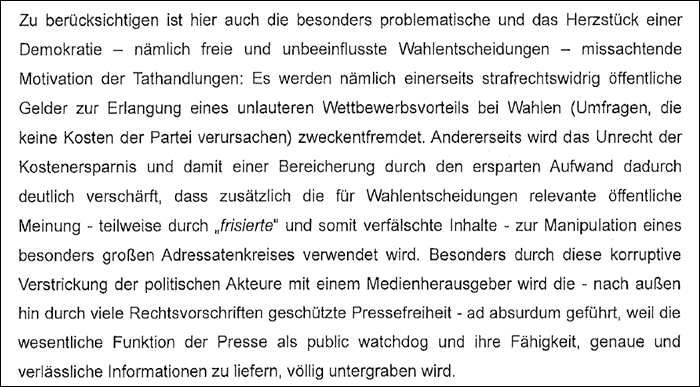
Durch die Beweiserhebungen des Ibiza-Untersuchungsausschusses wurde zudem klar, dass es sich bei diesem Missstand um keinen „naturgesetzlichen“ Zustand handelt, der ohne entsprechende Absprachen und ohne gegenseitiges Wissen der beteiligten AkteurInnen von Statten geht. Vielmehr ergab sich auf Grund der Aussagen mehrerer Auskunftspersonen wie insbesondere des früheren Vizekanzlers Reinhold Mitterlehner sowie aus den dem Untersuchungsausschuss vorgelegten Akten in Hinblick auf das „Projekt Ballhausplatz“ (vgl. AB 1040 BlgNR XXVII.GP, 475ff), dass im Umfeld des nunmehrigen Bundeskanzlers Sebastian Kurz bereits im Jahr 2014 begonnen wurde, generalstabsmäßig, zentral koordiniert und mutmaßlich ohne Rücksicht auf bestehende gesetzliche Verpflichtungen vorzugehen und dafür auch auf staatliche Ressourcen
zurückgegriffen wurde.2 Nicht zuletzt auf Grund dieser zentralen Steuerung und Planung erweist sich der Untersuchungsgegenstand als einheitlicher Vorgang, der sich zunächst in einer Vorbereitungsphase einer kleinen Gruppe an eingeschworenen Personen und mit der Angelobung von Sebastian Kurz als Bundeskanzler als umfassende Handlung manifestierte. Die beteiligten Personen schlossen sich gerade zum Zwecke der Machterlangung zusammen, ohne aber noch konkret jene Handlungen zu kennen, die zur Zielerreichung zu setzen sein werden. Insofern schadet die Ablehnung einzelner konkreter Maßnahmen nicht der Zugehörigkeit zur Gruppe, solange nur grundsätzlich Ziel und Struktur der Gruppe fortlaufend akzeptiert werden.
Die WKStA fasst das „Projekt Ballhausplatz“ in der Anordnung der Hausdurchsuchung im Bundeskanzleramt, Bundesministerium für Finanzen und der ÖVP-Zentrale wie folgt zusammen (S. 16):
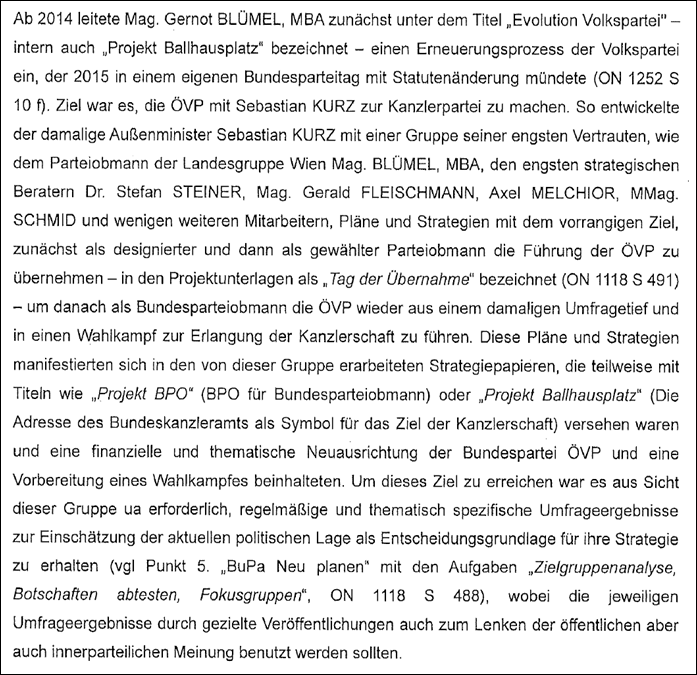
Ein allgemeines Einbeziehen des Vollziehungshandelns etwa im BMEIA und BMF im Zeitraum vor der Angelobung von Sebastian Kurz als Bundeskanzler erscheint auf Grund der Spezifität des „Projekt Ballhausplatz“ als Vorbereitungsphase für die Machtübernahme durch Sebastian Kurz und der vergleichsweise geringen Zahl an beteiligten Personen angesichts der verfassungsrechtlichen Vorgaben nicht rechtfertigbar. Die Vorbereitungshandlungen im Zuge des „Projekt Ballhausplatz“ stehen jedoch in untrennbarem Zusammenhang mit der späteren Amtstätigkeit unter Bundeskanzler Kurz, da die Instrumente zur mutmaßlichen Beeinflussung der öffentlichen Meinung unter Einsatz von Steuermitteln
zu parteipolitischen Zwecken wie das „Beinschab-ÖSTERREICH-Tool“ in dieser Zeit entwickelt und über den 18. Dezember 2017 hinaus fortgeführt wurden. Das „Projekt Ballhausplatz“ wird daher mit der nunmehrigen Formulierung ausdrücklich in den Untersuchungsgegenstand einbezogen.
Zentraler Bestandteil der Bemühungen des „Projekt Ballhausplatz“ war es zudem, finanzielle Mittel für einen Wahlkampf einzuwerben. Entsprechende Dokumente waren dem Ibiza-Untersuchungsausschuss auf Grund einer von der WKStA übermittelten Sachverhaltsdarstellung bekannt. In den Unterlagen ist etwa festgehalten: „Unternehmen animieren einzuzahlen“ und „Erstellung einer Sektionsleiterliste fürs BKA und mögliche Szenarien“. Als Zuständigkeiten werden u.a. „Inseratemanagement“, „Ablauf Wechsel Vizekanzler“ und „BMEIA managen“ sowie „BKA Reform“ angeführt. Außerdem sind mehrere Einrichtungen und Unternehmen genannt, die unterstützend tätig werden sollen. So insbesondere die Blink Werbeagentur und das Campaigning Bureau, außerdem das Alois-Mock-Institut und die Julius-Raab-Stiftung. Die Dokumente enthalten darüber hinaus umfassende Listen an potentiellen SpenderInnen, teils gekennzeichnet mit „€“-Zeichen, und deren jeweiligen politischen Interessenlagen. Die Sachverhaltsdarstellung enthält außerdem Listen mit Namen möglicher Regierungsmitglieder und von KandidatInnen für Listenplätze der ÖVP in mehreren (zeitlichen) Versionen. Wie den Ausführungen von Arno Melicharek im Ibiza-Untersuchungsausschuss zu entnehmen ist (161/KOMM XXVII.GP), stammen diese Dokumente offenbar aus Druckerspeichern des BMEIA.
Die Authentizität der Dokumente aus dem „Projekt Ballhausplatz“, wie sie der Sachverhaltsdarstellung beigelegt wurden, wurde von den potentiell Mitwirkenden jedoch stets beinahe wortident bestritten. In den Dokumenten namentlich genannt sind neben Sebastian Kurz folgende Personen: Stefan Steiner, Axel Melchior, Lisa Wieser, Kristina Rausch, Christian Ebner, Gerald Fleischmann, Bernd Brünner und Stefan Schnöll. In den Fußnoten der Dokumente ist außerdem der Name Bernhard Bonelli ersichtlich. Die genannten Personen waren über den gesamten Untersuchungszeitraum (teilweise mit Unterbrechungen) in Organen des Bundes tätig und sorgen somit zusätzlich für personelle Kontinuität innerhalb des im Interesse stehenden Zusammenschlusses. Dabei ist es nicht erforderlich, dass die jeweiligen Handlungen stets von den Mitgliedern des Zusammenschlusses gemeinsam gesetzt werden. Es genügt, dass sie dem gemeinsamen Zweck dienen und zumindest in unregelmäßigen Abständen koordiniert werden.
Aus den Akten des Ibiza-Untersuchungsausschusses ergab sich außerdem, dass mehrere weitere Personen in diese Vorbereitungen eingebunden waren. So belegen Chats zwischen Gernot Blümel und Thomas Schmid, dass letzterer dafür sorgte, dass dem BMEIA und somit Sebastian Kurz durch das BMF zusätzliche budgetäre Mittel zukommen, obwohl dies keine politische Zustimmung des damaligen Vizekanzlers gefunden hätte. Schmid schrieb – Zitat – „Kurz kann jetzt Geld scheißen“ sowie später an Kurz selbst: „Du schuldest mir was“. Die genaue Verwendung dieser zusätzlichen Mittel ist unklar, jedoch ergibt sich auf Grund eines Berichts des Rechnungshofs eindeutig eine beinahe Verdoppelung der Inserateausgaben des BMEIA zwischen 2016 und 2017, wofür offensichtlich keine sachliche Rechtfertigung besteht, sondern vielmehr in Erwartung einer Wahlauseinandersetzung erhöht wurde.
Weitere Akten belegen Interventionen zu Gunsten einzelner der ÖVP nahestehender Personen, ehemaligen FunktionsträgerInnen und Günstlingen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft führt in Hinblick auf mögliche falsche Angaben zum Informationsstand des Bundeskanzlers bezüglich der Bestellung des Aufsichtsrates der ÖBAG vor dem Untersuchungsausschuss gegen diesen ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht des Verstoßes gegen § 288 StGB. Im Zuge dieses Verfahrens wurden Kommunikationsverläufe ausgewertet, die belegen, dass für die Bestellung gewisser nahestehender Personen auch ein Schaden für die Republik in Kauf genommen wurde, in dem etwa Organwalter vorzeitig abberufen werden sollten.
Das prominenteste Beispiel einer solchen vorzeitigen Abberufung bildet die Vorstandsbestellung in der Casinos Austria AG – auch hierzu besteht ein Ermittlungsverfahren der WKStA. Dokumentiert ist gleichzeitig auch der enge Kontakt zwischen VertreterInnen der ÖVP, insbesondere Gernot Blümel und Bettina Glatz-Kremsner (Kurz‘ Stellvertreterin als Parteiobmann), und VertreterInnen der Novomatic AG. Insgesamt lässt sich der deutliche Wunsch ableiten, in allen relevanten Positionen ÖVP-VertreterInnen unterzubringen, wobei die konkrete Personalentscheidung in allen wesentlichen Fällen direkt dem Bundeskanzleramt zukam.
Es würde zu weit führen, sämtliche Ergebnisse des Ibiza-Untersuchungsausschusses in Hinblick auf solche Handlungen an dieser Stelle wiederzugeben. Im vorliegenden Zusammenhang kann auf den Ausschussbericht (AB 1040 BlgNR XXVII.GP) sowie auf die umfassende mediale Berichterstattung verwiesen werden. Exemplarisch können aus dem Bericht genannt werden:
- Seite 136 zur Verschränkung der Bestellungen Schmid und Sidlo: „Nach den dem Untersuchungsausschuss vorliegenden Beweismitteln […] ist ein derartiger Zusammenhang in Bezug auf die beiden Bestellungen in hohem Maßen wahrscheinlich.“
- Seite 137: Das Verhältnis Novomatic zur türkis-blauen Regierung: „Die offenkundig enge Verbindung der Vertreter der Novomatic mit Mitgliedern der Österreichischen Bundesregierung und leitenden Beamten des BMF erscheint umso ungewöhnlicher und auffälliger, als die Novomatic im Bereich des Glücksspiels ein potentieller Konkurrent der Casag ist“. Es „entwickelte sich jedenfalls ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis. Dieses besondere Verhältnis führte nicht nur zur Mitsprachemöglichkeiten im Bereich des Glücksspiels und die Aussicht auf eine wunschgemäße Änderung des Glücksspielgesetzes. Festzustellen waren zahlreiche sehr intensive Kontakte zwischen Vertretern der Regierung und des BMF mit Vertretern der Novomatic, die weit über die Fragen der Anteilsverwaltung hinausgingen. Als auffälliges Beispiel für die Erwartungen der Vertreter der Novomatic an die damals zukünftige Regierung ist der Chat vom 8.7.2017 zu nennen, in dem Neumann gegenüber Blümel die Auswahl der Kandidaten der ÖVP für die Nationalratswahl 2017 kritisierte, weil „der Oktober […] zu wichtig“ sei.“
- Seite 138 zu gegenseitigen Abhängigkeiten: „Zentrale Personen des Geschehens waren Schmid, in seinem Gefolge Löger und mit vehementem Einsatz Strache. Allerdings ist davon auszugehen, dass Kurz über alle wesentlichen Vorgänge informiert wurde und diese zumindest stillschweigend gebilligt hat.“
- Seite 237: „Ziel von Novomatic war es, Berechtigungen für das Glücksspiel in Österreich und zwar sowohl im terrestrischen als auch im Onlinebereich zu erhalten. Novomatic strebte daher eine Änderung des Glücksspielgesetzes an. Dafür nutzten die Vertreter von Novomatic ihre guten Kontakte zum BMF, insbesondere zu Schmid, über den sie auch Zugang zu Minister Löger hatten. Ein gutes Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen Novomatic und BMF ist die von Löger im Dezember 2017 an die ÖLG erteilte Bewilligung zur Aufstellung von VLTs in Wien in den Hallen der Novomatic-Tochter Admiral.“
- Seite 333: „Entscheidend für ein ordnungsgemäßes Ausschreibungsverfahren sind die Angemessenheit der zur Verfügung stehenden Zeit, die Objektivität, die Effektivität und die Transparenz des zur Bestellung als Vorstand führenden Vorgangs. Gegen diese genannten Grundsätze wurde bei Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibung des Postens eines Vorstandes der Öbag mehrfach verstoßen“.
- Seite 333: „Der vom BMF vorgegebene Zeitplan reichte weder dafür aus, dass sich die Aufsichtsratsmitglieder mit ihrer Aufgabe vertraut machen konnten, noch konnte erwartet werden, dass ernst zu nehmende Kandidaten aus dem privaten Berufsleben in etwas mehr als einem Monat nach der Ausschreibung zur Übernahme der ausgeschriebenen Tätigkeit bereit sein konnten.“
- Seite 334: „Die Objektivität des Ausschreibungsvorgangs war nicht gegeben. Die mit der Vorbereitung der Ausschreibung befassten Personen, nämlich der potenzielle Bewerber Kabinettschef und Generalsekretär des BMF Schmid und seine Mitarbeiter, setzten, wie im Bericht ausführlich festgestellt, alles daran, Formulierungen zu finden, die die Kandidatur Schmids mit großer Wahrscheinlichkeit erfolgversprechend machen konnten.“
- Seite 334: „Die bewusst zur Bevorzugung der Kandidatur Schmids in die Ausschreibung aufgenommenen Passagen minderten die Effektivität der Ausschreibung, weil allein durch das Kriterium „Erfahrung in Aufsichtsräten staatlicher und teilstaatlicher Unternehmen“ Bewerber aus der internationalen und der nationalen Privatwirtschaft ausgeschlossen werden konnten.“
- Seite 335: „Der Bestellung von Schmid zum Vorstand der Öbag mangelte es trotz der durchgeführten Ausschreibung im Ergebnis auch an der Transparenz, weil für den Uneingeweihten nicht erkennbar war, dass durch den dargestellten Kriterienkatalog und dessen unkritische Übernahme durch die Aufsichtsratsmitglieder Schmid besonders bevorzugt wurde.“
- Seite 335: „Wenngleich eine Verschränkung der beiden Vorgänge nicht mit letzter Sicherheit festgestellt werden konnte, hat die Untersuchung doch eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen „Deal“ in Zusammenhang mit der Vorstandsbestellung von Schmid ergeben.“ (335)
- Seite 567 zu Spenden als Gegenleistung für Gesetze: „Auffällig ist allerdings eine Spende über insgesamt EUR 50.000, die Ende 2017 und Mitte 2018 in zwei Tranchen von der Premiqamed Group an die ÖVP geleistet wurde. Ein Zusammenhang mit der für die Premiqamed Group vorteilhaften gesetzlichen Erhöhung des Prikraf-Fonds um EUR 14,7 Millionen liegt nahe (siehe Kapitel 8 „Prikraf“ Punkt 4.4.). Strafverfahren sind anhängig.“
- Seite 669: „Zwar liegen, wie ebenfalls bereits in den Feststellungen und der Beweiswürdigung thematisiert, mehrere ungewöhnliche Handlungsweisen insbesondere von Fuchs und Pilnacek vor. […] Sehr ungewöhnlich erscheint, dass auf dem Mobiltelefon Pilnaceks Fotografien von Aktenbestandteilen aufgefunden wurden, die möglicherweise aus Verschlussakten stammen. Diese Dokumente lassen sich auch als Informationsquellen für von den Ibizaermittlungen betroffene Politiker interpretieren.“
- Seite 700: „Weder Pilnacek und Fuchs, noch die beteiligten Oberstaatsanwälte konnten für die Ermittlungen in der Ibizaaffäre im gegenseitigen Kontakt als unbefangen bezeichnet werden. Dieser Umstand wurde schon durch die Ausgangssituation nahe gelegt und ist in der Folge durch zahlreiche im Bericht festgestellte Verhaltensweisen offenbar geworden.“
- Seite 700: „Probleme gab es aber nicht nur in der Zusammenarbeit der WKStA mit der OStA und dem BMJ, sondern auch zwischen der WKStA und der Soko Tape. Dass durch die gegenseitige sich ständig verhärtende Kompromisslosigkeit auch Ermittlungserfolge beeinträchtigt wurden, wird eindrücklich durch die offenbar aufgrund von Informationsschwierigkeiten unterbliebene Sicherstellung des Mobiltelefons und des Laptops von Melicharek sichtbar.“
- Seite 783: „Entgegen dem Vorschlag des Rechnungshofes und der Übung in den meisten EU-Mitgliedstaaten sollte die Finanzmarktaufsicht nicht zur OeNB verlagert werden, sondern von dieser weg zur FMA. Dort war die Abberufung des zweiten, national und international angesehenen Vorstandes Ettl, der der SPÖ zugerechnet wird, während laufenden Vertrags geplant. Ob allein die Einziehung einer zweiten Leitungsebene mit drei Bereichsdirektoren eine tragfähige sachliche Begründung für diese Vorgangsweise geben kann, war für den Untersuchungsausschuss mangels der Möglichkeit eingehender Analyse nicht feststellbar. Jedenfalls stellt die Abberufung eines Vorstands bei laufendem Vertrag ohne ihm vorwerfbaren wichtigen Grund im Wege der einfachen Gesetzgebung eine durchaus ernst zu nehmende Gefährdung der Unabhängigkeit der FMA dar.“
Von den Befragungen des Ibiza-Untersuchungsausschusses enthalten insbesondere folgende wörtliche Protokolle der Befragung von Auskunftsperson für das vorliegende Verlangen relevante Sachverhalte:
o Mitterlehner (195/KOMM, XXVII.GP), 26.05.2021
o Kurz (271/KOMM, XXVII.GP), 15.07.2021
o Kurz (50/KOMM, XXVII.GP), 16.07.2020
o Bonelli (239/KOMM, XXVII.GP), 24.06.2021
o Bonelli (160/KOMM, XXVII.GP), 13.04.2021
o Blümel (268/KOMM, XXVII.GP), 15.07.2021
o Blümel (200/KOMM, XXVII.GP), 26.05.2021
o Blümel (52/KOMM, XXVII.GP), 16.07.2020
o Schmid (51/KOMM, XXVII.GP), 16.07.2020
o Moser (266/KOMM, XXVII.GP), 15.07.2021
o Köstinger (267/KOMM, XXVII.GP), 15.07.2021
o Melchior (172/KOMM, XXVII.GP), 13.04.2021
o Zadic (270/KOMM, XXVII.GP), 15.07.2021
o Zadic (45/KOMM, XXVII.GP), 16.07.2020
o Vrabl-Sanda (249/KOMM, XXVII.GP), 24.06.2021
o Vrabl-Sanda (124/KOMM, XXVII.GP), 27.01.2021
o Johann Fuchs (192/KOMM, XXVII.GP), 26.05.2021
o Johann Fuchs (72/KOMM, XXVII.GP), 20.10.2020
o Spiegelfeld (247/KOMM, XXVII.GP), 24.06.2021
o Spiegelfeld (173/KOMM, XXVII.GP), 13.04.2021
o Hofer (55/KOMM, XXVII.GP), 16.07.2021
Außerdem wurden auch durch andere parlamentarische Instrumente Sachverhalte angesprochen, in denen es zu unsachlichen Bevorzugungen gekommen sein soll. Verwiesen werden kann hier exemplarisch auf folgendes:
- Beantwortung der Dringlichen Anfrage 8207/J durch den Bundesminister für Finanzen in der 124. Sitzung des Nationalrates am 12.10.2021
- Beantwortung der Dringlichen Anfrage 5384/J durch den Bundesminister für Finanzen in der 83. Sitzung des Nationalrates am 16.2.2021
- Beantwortung der Dringlichen Anfrage 6179/J durch den Bundesminister für Finanzen in der 95. Sitzung des Nationalrates am 9.4.2021
- Beantwortung der Dringlichen Anfrage 6611/J durch den Bundeskanzler in der 103. Sitzung des Nationalrates am 17.5.2021
- Beantwortung der Dringlichen Anfrage 7411/J durch den Bundesminister für Finanzen in der 119. Sitzung des Nationalrates am 19.7.2021
- Beantwortung von schriftlichen Anfragen, insbesondere 4101/AB, 4134/AB und 4136/AB in der XXVI.GP sowie 9/AB, 11/AB, 364/AB, 419/AB, 532/AB, 650/AB, 718/AB, 871/AB, 1038/AB, 1085/AB, 1126/AB, 1518/AB, 1519/AB, 1521/AB, 1523/AB, 1526/AB, 1530/AB, 1531/AB bis 1533/AB, 1537/AB, 1540/AB bis 1542/AB 1546/AB, 1547/AB, , 1885/AB, 2157/AB, 2201/AB, 2207/AB, 2212/AB, 2262/AB, 2271/AB, 2277/AB, 2285/AB, 2347/AB, 2413/AB, 2416/AB, 2418/AB, 2421/AB, 2422/AB, 2426/AB, 2429/AB, 2430/AB, 2432/AB, 2436/AB, 2439/AB, 2441/AB, 2444/AB, 2449/AB, 2453/AB, 2458/AB, 2461/AB,2464/AB, 2470/AB, 2474/AB, 2479/AB, 2481/AB, 2487/AB, 3031/AB, 3106/AB, 3305/AB, 3435/AB, 3436/AB, 3550/AB, 3578/AB, 3736/AB, 3915/AB, 3921/AB, 4385/AB, 4587/AB, 4845/AB, 4846/AB, 4987/AB, 5076/AB, 5115/AB, 5116/AB, 5120/AB, 5122/AB, 5379/AB, 5383/AB, 5681/AB, 5726/AB, 6010/AB, 6059/AB, 6074/AB, 6279/AB, 6360/AB, 6395/AB, 6464/AB, 6770/AB, 6771/AB in der XXVII.GP
Der Ständige Unterausschuss des Rechnungshofausschusses prüfte zudem im Frühjahr 2021 mehrere Vergaben in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (AB 1024 BlgNR XXVII.GP). Auslöser waren Vorwürfe gegen die Hygiene Austria LP Gmbh. Der Ständige Unterausschuss des Rechnungshofausschusses konnte dem Vorwurf der Beeinflussung des genannten Vergabeverfahrens nicht weiter nachgehen, da keine Auskunftsperson dazu nähere Auskunft geben wollte und daher insbesondere nicht die Motive hinter dem ausdrücklichen Wunsch des Bundeskanzleramts nach Vergabe an Hygiene Austria aufklären.
In den Akten des Ibiza-Untersuchungsausschuss fand sich ebenso eine Vielzahl an Hinweisen auf den nun zu untersuchenden Missstand. Zu nennen sind insbesondere:
- Amtsvermerk der WKStA über weitere Erkenntnisse aus der Datenauswertung in Zusammenhang mit Funktionären der ÖVP: Dieser legt u.a. diverse Interventionen zur Versorgung von (ehemaligen) ÖVP-FunktionärInnen dar;
- Amtsvermerk der WKStA über den Kontakt zwischen Thomas Schmid, Gernot Blümel und Novomatic-CEO Harald Neumann: Aus den ausgewerteten Korrespondenzen ist ein intensiver, bereits über mehrere Jahre bestehender vertrauter Kontakt zwischen Neumann und den beiden genannten ÖVP-Vertretern feststellbar;
- Amtsvermerk der WKStA über Befragungssituation im Untersuchungsausschuss bezüglich der Auskunftsperson Sebastian Kurz: Dieser führt die Wahrscheinlichkeit der Absprachen im Vorfeld der Befragungen im Untersuchungsausschuss aus;
- Amtsvermerk der WKStA über die Erkenntnisse aus der Datenauswertung in Bezug auf die Vorstandsbestellung von MMag. Schmid bei der ÖBAG und die Befassung von MMag. Schmid mit „Postenbesetzungswünschen“ Dritter: In diesem Vermerk werden eine Vielzahl von Versorgungswünschen für ÖVP-PolitikerInnen sowie ein enger Kommunikationsfluss zwischen dem Bundeskanzleramt und dem Bundesministerium für Finanzen in Personalangelegenheiten und in Hinblick auf das Beteiligungsmanagement dokumentiert;
- Anonyme Anzeige unter Anschluss von Unterlagen aus dem „Projekt Ballhausplatz“: Der Großteil dieser Unterlagen war bereits auf der Webseite der Wochenzeitung Falter zum Download verfügbar – im Kern steht der Vorwurf der umfassenden Ausrichtung des Vollziehungshandelns von Sebastian Kurz nach Gesichtspunkten der Spendenlukrierung (vgl. AB 1040 BlgNR XXVII.GP, 475ff);
- Mitteilungen gemäß § 50 StPO an Sebastian Kurz, Gernot Blümel, Bernhard Bonelli, Thomas Schmid, Melanie Laure, Josef Pröll, Hartwig Löger: In diesen Unterlagen werden jeweils die strafrechtlichen Vorwürfe gegen die Genannten benannt und mit dem entsprechenden Tatsachensubstrat untermauert;
- Beschuldigtenvernehmungen Blümel, Löger, Hadschieff, Glatz-Kremsner, Pröll: Im Zuge dieser Beschuldigtenvernehmungen wurden die Genannten mit dem sie belastenden Material konfrontiert und erhielten Gelegenheit zur Stellungnahme;
- Zeugeneinvernahmen Spiegelfeld, Melchior, Krumpel: In diesen Zeugenvernehmungen steht der Kontakt zwischen VertreterInnen der ÖVP und potentiellen SpenderInnen im Mittelpunkt;
- Unterlagen der Task Force Steuerreform im BMF: Diese enthalten eine Vielfalt an gesetzlichen Reformvorhaben, die Personen begünstigt hätten, die für die ÖVP gespendet haben;
- Korrespondenz zwischen den Kabinettschefs von Bundeskanzler Kurz und Bundesminister Blümel einerseits sowie Thomas Schmid, Kabinettschef im Bundesministerium für Finanzen, andererseits: In diesen (vorwiegend) E-Mails werden regelmäßig Personalwünsche in Beteiligungsunternehmen vom Bundeskanzleramt an das Bundesministerium für Finanzen übermittelt;
- Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft Wien wegen Verstößen gegen § 310 StGB: Es besteht der Verdacht, dass die Hausdurchsuchungen bei Harald Neumann, bei Hartwig Löger und bei Gernot Blümel vorab verraten wurden. Entsprechenden Verdachtsmomenten geht die Staatsanwaltschaft nach;
- Vorbereitungsunterlagen für die Sitzungen des Nominierungskomitees der ÖBIB: Darin enthalten sind eine Reihe von Vorschlägen zur vorzeitigen Abberufung amtierender Organe in Beteiligungen des Bundes und Vorschläge für Neubestellungen mit ÖVP-nahen Personen.
- Erhebungen des Rechnungshofs zu Zahlungen an Agenturen: In dieser Auswertung sind Zahlungen im Umfang mehrerer Millionen Euro im Zeitraum 2017 bis 2019 für Aufträge an Agenturen angeführt, die ebenfalls für die ÖVP tätig waren;
- Einladungen
zu „Wirtschaftsrunden“ im Bundeskanzleramt: In einer Reihe von
E-Mailkorrespondenzen tauschen sich MitarbeiterInnen des Kabinetts des Bundeskanzlers
über die zu persönlichen Terminen einzuladenden Personen und die von
diesen vorgebrachten Inhalte aus;
- Auswertungen des Mobiltelefons von Christian Pilnacek: Auf diesem fanden sich neben Chatverläufen mit Wolfgang Sobotka während des laufenden Untersuchungsausschusses insbesondere auch Unterlagen aus Ermittlungsakten sowie Entwürfe parlamentarischer Anfragen an die Justizministerin, die von einem Mitarbeiter des NR-Präsidenten verfasst wurden sowie regelmäßige Korrespondenz mit dem Kabinettschef von Finanzminister Blümel sowie Nachrichten, die während der Zeit der Bundeskanzlerin Bierlein auf einen Informationsfluss zum ehemaligen Bundeskanzler Kurz schließen lassen;
- Sicherstellungsanordnung betreffend die Mobiltelefone von Christian Pilnacek und Johann Fuchs: Darin werden die Verdachtsmomente in Hinblick auf die Beeinflussung der Ermittlungen zum Ibiza-Video zusammengefasst;
- Tagebucheinträge der Leitenden StaatsanwältInnen der WKStA: Darin werden vielfach schikanöse Aufsichtsmaßnahmen bis hin zu Disziplinarmaßnahmen durch die Oberstaatsanwaltschaft, Ressourcenverknappung sowie Überflutung mit Berichtsaufträgen geschildert;
- E-Mailkorrespondenzen zwischen MitarbeiterInnen der Kabinette Kurz und Löger: In diesen ist die enge Einbindung von ÖVP-VertreterInnen sowie ÖVP-SpenderInnen in die Erstellung von Gesetzesvorhaben dokumentiert, insbesondere wurden gegenüber dem Bundeskanzler durch Personen wie Sigi Wolf geäußerte Wünsche regelmäßig an die jeweils zuständigen Ressorts übermittelt;
- Unterlagen zum „Projekt Edelstein“: Der geplante Verkauf des Bundesrechenzentrums an die Post AG wurde auf Betreiben des Bundeskanzleramts vom BMF geprüft und stand kurz vor der Due Diligence Prüfung des BRZ durch die Post, wobei an den Gesprächen seitens der Post insbesondere auch ehemalige MitarbeiterInnen von ÖVP-Regierungsmitgliedern teilnahmen;
- Dokumentation von „Frühstückscafés“ im BMF: So wurden etwa zum Stiftungsrecht exklusive Veranstaltungen mit vermögenden Personen abgehalten, bei denen diese ihre Wünsche an eine Reform des Stiftungsrechts vorstellen könnten, wobei das eigentlich zuständige Justizministerium nicht eingebunden war;
Seit dem Ende des Untersuchungszeitraums des Ibiza-Untersuchungsausschusses wurden medial noch weitere Vorwürfe bekannt, die eine Bevorteilung zu Gunsten von mit der ÖVP verbundenen Personen oder parteipolitischen Interessen der ÖVP nahelegen:
- Falter.at, 6.10.2021: Razzia im Kanzleramt: „Wer zahlt, schafft an. Ich liebe das“: Chats und Scheinrechnungen belegen den Verdacht, dass Sebastian Kurz manipulierte Umfrageergebnisse und Berichterstattungen in Boulevardmedien zugunsten seiner Person erkauft haben soll – mit 1,2 Mio. Steuergeld bezahlt durch das Finanzministerium.
- Der Standard, 9.10.2021: Wie die türkise Clique den Aufstieg von Sebastian Kurz orchestriert hat.
- derstandard.at, 29. Juli 2020: ÖVP-nahe Agentur arbeitete bei Tourismus-Corona-Tests mit und Zackzack.at, 29.7.2020: Kurz’ ORF-Stiftungsrat steckt hinter Köstinger Coronatest-Desaster: Die Agentur von ORF-Stiftungsrat Gregor Schütze, Schütze Positionierung GmbH, war zu einem Corona-Testprogramm in Vorarbeiten der Beratungsfirma McKinsey eingebunden. Schütze wickelte u.a. Bewerbungen von Laboren für das Testprogramm ab, das vom BMLRT mit 150 Mio. Euro angekündigt wurde.
- Derstandard.at, 22.10.2020: ÖVP-nahe Agenturen sind bei Köstinger gut im Geschäft: Weitere ÖVP-nahe Agenturen profitierten von Aufträgen der Bundesministerin Köstinger. Darunter befinden sich Philipp Maderthaners Campaigning Bureau; ORF-Stiftungsrat und PR-Berater der türkisen Fraktion im Ibiza-Untersuchungsausschuss Jürgen Beileins zbc3; und die Agentur Best Heads.
- Kurier.at, 31.8.2021: Brisanter Rechtsstreit um PCR-Tests für Schulen: Zwei Wochen vor Ende der Angebotsfrist einer Ausschreibung für PCR-Tests an Schulen präsentierte Bundesminister Faßmann bereits die auserwählte Firma Novogenia. Nicht nur zeitlich wurden andere Firmen vom Bildungsministerium und der Bundesbeschaffung GmbH ausgeschlossen, auch die Ausschreibung war so formuliert, dass nur Novogenias und jene PCR-Tests der Covid Fighters angewendet werden können. Novogenia erhielt bereits 2020 Aufträge vom Tourismus- und vom Verteidigungsministerium.
- Falter 36/2021: Gurgel! Spül! Verdiene!: Neben Novogenia kamen die ÖVP-lastigen Covid Fighters aus Niederösterreich zum Zug der 340 Millionen Euro schweren Ausschreibung von Schultests. Der Geschäftsführer Boris Fahrnberger hat eine ÖVP-Vergangenheit, des Weiteren war VP-Landtagsabgeordneter Anton Erber bis April 2021 mit 20 Prozent an der Firma beteiligt.
- Orf.at, 24.11.2020: Regierung will sich um 30 Mio. Euro selbst bewerben: Die türkis-grüne Regierung suchte ab November 2020 eine Werbeagentur und schrieb 30 Millionen Euro für eine PR-Strategie aus; parallel dazu wurde in einer weiteren Ausschreibung eine Schaltagentur gesucht, die Regierungsinserate bis zu 180 Millionen Euro abwickeln sollte – eine Verdoppelung der Inserate bis zur Nationalratswahl 2024 auf jährlich 45 Millionen Euro. Den Zuschlag erhielt eine Agentur, bei der bekannte für die ÖVP-tätige Unternehmen als Subunternehmer tätig sind.
- Zackzack.at, 14.9.2021: Chats: Kripo-Chef Holzer hat Telefonüberwachung an ÖVP-Leute verraten: Der heutige Leiter des Bundeskriminalamts, Andreas Holzer, soll 2016 Angehörigen der ÖVP-Familie Telefonüberwachungen verraten haben. Konkret informierte Holzer – damals Leiter der Abteilung „Organisierte Kriminalität“ im BKA – den Kabinettschef mehrerer ÖVP-Innenminister, Michael Kloibmüller, und den ÖVP-nahen ehemaligen stellvertretenden Leiter des BVT, Wolfgang Zöhrer.
- Derstandard.at, 29.3.2021: "Intervention erledigt": Die Jobsuche des ÖVP-Umfelds im Finanzministerium: Nicht nur Thomas Schmid kriegte offenbar alles was er wollte – zusammen mit u.a. Hans-Jörg Schelling, Gernot Blümel und August Wöginger hat Schmid selbst auch für andere jobsuchende ÖVP-Familienmitglieder interveniert.
- Der Standard, 4.3.2021: Die umtriebige Frau Spiegelfeld: Nach mehreren Verstößen gegen die Compliance-Richtlinien verabschiedete sich Agnes Husslein als Direktorin vom Belvedere. Zuvor hatte sie Gabi Spiegelfeld noch in das Kuratorium bestellt, diese trat aber auch zurück. Schmid und Spiegelfeld waren in den Sommermonaten gern gesehene Gäste in Hussleins Villa am Wörthersee. 2017 wurde Husslein dank Schmid und Spiegelfeld in den Vorstand der Leopold-Museum-Privatstiftung berufen – just dort, wo ÖVP-Großspenderin Heidi Horten bald darauf Teile ihrer Kunstsammlung zeigen sollte.
- Falter 23/2021: „Die schießen die Republik zusammen!“: Die sichergestellten Chats vom mittlerweile suspendierten und angeklagten Sektionschef Christian Pilnacek offenbaren den immensen Einfluss der türkisen Familie auf die Justiz. Verschlussakten aus dem Ibiza-Komplex fanden sich genauso auf seinem Mobiltelefon, wie auch Interventionen für seine Ehefrau bei Landeshauptmann Schützenhöfer, und Pilnaceks Frage an Blümels Kabinettschef „Wer vorbereitet Gernot auf seine Vernehmung?“. Bereits zuvor war Pilnacek mit fragwürdigem Verhalten aufgefallen (Treffen mit Beschuldigten der Casinos-Affäre, Verdacht des Verrats von Hausdurchsuchungen).
- Benkos Postsparkasse nach BIG-Deal mehr wert - wien.ORF.at, 23.02.2020: René Benkos Postsparkasse ist nach einem Deal mit der Bundesimmobiliengesellschaft massiv aufgewertet worden. 2013 kaufte die Signa Prime Selection die Wiener Postsparkasse um 130 Millionen Euro. Nachdem Benko die BIG als Mieter gewonnen hat (Jahresmiete rund 3,5 Mio. Euro), ist das Gebäude nun 250 Millionen Euro wert.
- Kurier, 08.12.2020, Corona-Familienhärtefonds: Vorwurf der "Vetternwirtschaft" bei Auftragsvergabe: Mit Grant Thornton Austria hat ein weiteres ÖVP-nahes
Unternehmen vom türkisen Familiennetzwerk profitiert. Der Ehemann von ÖVP-Nationalrätin Carmen Jeitler-Cincelli ist Partner im Unternehmen, das den Zuschlag erhielt.
Anfang Oktober sind außerdem neue Ermittlungsakten der WKStA an die Öffentlichkeit gelangt3, insbesondere die 104 Seiten starke Anordnung der Hausdurchsuchung sowie über 750 Seiten an Auswertung von Korrespondenzen zwischen mehreren Personen aus dem Umfeld von Sebastian Kurz.
Zu den Beweisthemen:
Die Festlegung von Beweisthemen ist auf Grund der VO-UA nicht zwingend erforderlich, jedoch in Hinblick auf die Konkretisierung des Untersuchungsgegenstandes und eine zweckmäßige Bearbeitung der zu untersuchenden Themen geboten. Auf Grund der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes, wonach in einem Verlangen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses auszuführen ist, welche Themenbereiche der Untersuchungsausschuss im Rahmen seines nachfolgenden Beweisverfahrens untersuchen soll (vgl. VfSlg. 20370/2020, 174), ist ein Verzicht auf Beweisthemen nur unter schwierigen Voraussetzungen denkbar. Im vorliegenden Verlangen legen die Beweisthemen daher die Schwerpunkte der Untersuchung verbindlich fest. So empfiehlt es auch der Ausschussbericht (vgl. AB 440 BlgNR XXV.GP, 7):
„Da solche Vorgänge, auch wenn sie grundsätzlich näher definiert werden, erfahrungsgemäß ein hohes Maß an Komplexität aufweisen, soll im Antrag bzw. Verlangen nach Möglichkeit auch eine inhaltliche Gliederung nach Beweisthemen erfolgen. Der Untersuchungsgegenstand kann in einzelne Abschnitte und nach Beweisthemen gegliedert sein, zumal ein Vollzugsakt auch in einzelne Phasen zerlegt werden kann.“
§ 1 Abs. 5 VO-UA sieht vor, dass eine inhaltliche Gliederung des Gegenstandes der Untersuchung nach Beweisthemen zulässig, eine Sammlung nicht direkt zusammenhängender Themenbereiche hingegen unzulässig ist. Dies ist insofern logisch, als dass die Beweisthemen nicht über den Untersuchungsgegenstand hinausgehen können und bereits dieser nicht mehrere unzusammenhängende Vorgänge umfassen darf. Denn der Untersuchungsgegenstand bildet den Rahmen der Tätigkeit des Untersuchungsausschusses, bindet diesen und bildet gleichzeitig die Begrenzung der diesem übertragenen Zwangsbefugnisse (VfSlg. 20370/2020, 172) und nicht die Beweisthemen. Gleichzeitig ist aber zu beachten, dass sowohl für den grundsätzlichen Beweisbeschluss eine Gliederung nach den Beweisthemen vorgeschrieben ist (vgl. § 24 Abs. 3 VO-UA), als auch eine Befragung von Auskunftspersonen außerhalb der angeführten Beweisthemen unzulässig wäre (vgl. § 41 Abs. 1 VO-UA). Insofern verfügen die Beweisthemen über eigenständigen normativen Gehalt. Dies entspricht auch dem sonstigen Verständnis von Beweisthemen im gerichtlichen Verfahrensrecht.
Die Beweisthemen des vorliegenden Verlangens gliedern den Untersuchungsgegenstand nach machtpolitischen Einflussformen. Das Vorliegen einer unsachlichen Gewährung von Vorteilen im Bereich der Vollziehung des Bundes an mit der ÖVP verbundene Personen zum Zwecke der parteipolitischen Interessen der ÖVP sowie entsprechende Vorbereitungshandlungen auf Grundlage des Projekts Ballhausplatz soll vom Untersuchungsausschuss in diesen Bereichen überprüft werden, da sie auf verschiede Arten Zugang zu staatlichen Ressourcen eröffnen, die nicht jedem gleichermaßen zur Verfügung stehen, in der Regel beschränkt und insofern begehrt sind. Die Verfügungsgewalt über solche Ressourcen ermöglicht der ÖVP die Förderung parteipolitischer Loyalitäten, da nur dadurch ein System von Belohnungen und Bestrafungen für das Verhalten Dritter besteht. Belege dafür sind mannigfaltig: Von der Bestellung loyaler Personen in verschiedenste Funktionen über die Gewährung besonderer Mitspracherechte bei der Erstellung von Gesetzesvorhaben bis hin zur Einrichtung besonderer Förderprogramme
sind beinahe jedem, der/die sich mit österreichischer Politik beschäftigt, zahlreiche Beispiele zumindest anekdotisch - bekannt. Wohlgemerkt sind mit solchem Verhalten nicht zwangsläufig Gesetzesverstöße verbunden. Wie bereits ausgeführt besteht die Grenze zum untersuchungswürdigen Verhalten dort, wo parteipolitische Motive zu Lasten staatlicher Interessen gefördert werden.
Das erste Beweisthema widmet sich der Aufklärung über die Beeinflussung von Vergabe- und Förderverfahren. Es enthält im Kern die Aufklärung über jene Sachverhalte, die auch den strafrechtlichen Vorwürfen gegen Bundeskanzler Kurz und mehrere seiner Mitarbeiter zu Grunde liegen (vgl. dazu die ausführliche Medienberichterstattung sowie die bereits zitierte Hausdurchsuchungs-Anordnung sowie die weiterführenden Auswertungsberichte der WKStA, die ebenfalls medial berichtet wurden).
Es werden konkrete Bereiche von Vergaben genannt, die auf Grund der Art der zu erbringenden Leistungen besonders für Einflussnahmen geeignet sind, da die Angemessenheit der zu erbringenden Leistung oftmalig ein Werturteil erfordert. Es wird für sonstige Aufträge sowie Förderungen eine Erheblichkeitsschwelle eingezogen, die bei 40.000 Euro festgesetzt wird. Diese Grenze ist bewusst unterhalb der vergaberechtlichen Schwelle von 100.000 Euro, jedoch über einer Bagatellgrenze angelegt, um mögliche bewusste Preisgestaltung zur Ermöglichung einer Direktvergabe zu erfassen. Der aufzuklärende Vorwurf besteht in Zusammenschau mit dem Untersuchungsgegenstand darin, dass Ausschreibungen und Förderkriterien derart gestaltet wurden, dass mit der ÖVP verbundene Personen und Unternehmen Aufträge bzw. Förderungen erhalten. Der maßgebliche Verdacht besteht insbesondere darin, dass in Weiterentwicklung des „Guthabenkontos“ der ÖVP bei der Telekom Austria solche Förderungen und Vergaben zur indirekten Parteienfinanzierung der ÖVP verwendet wurden. Dieses im Telekom-Skandal aufgedeckte Muster sah vor, dass die ÖVP über Leistungen in gewisser Höhe bei der Telekom abrufen konnte, ohne dass diese Leistungen als Parteispenden aufschienen.4
Auf das mögliche Vorliegen einer solchen Weiterentwicklung des Telekom-Schemas stießen die verlangenden Abgeordneten im Zuge der Beweiserhebungen des Ibiza-Untersuchungsausschusses. Aus mehreren Beweisanforderungen sowie einer Erhebung des Rechnungshofes ergaben sich auffällig hohe Zahlungen an Agenturen und Unternehmen, die ebenfalls für die ÖVP im Nationalratswahlkampf 2017 und 2019 tätig waren. Dazu zählen u.a. das Campaigning Bureau sowie die Blink Werbeagentur und die Media Contacta Gmbh. Diese erhielten verstreut über mehrere ÖVP-geführte Ressorts Aufträge mit teils erheblichem Volumen, wobei die Angemessenheit der Gegenleistungen und des Preises bezweifelt werden kann. So erstellte das Campaigning Bureau für das Innenministerium etwa um mehrere tausend Euro eine Social Media Strategie, für die als Gegenleistung zumindest gegenüber dem Ibiza-Untersuchungsausschuss lediglich eine Powerpoint-Präsentation belegt war. Das Landwirtschaftsministerium vergab einen mehrjährigen Rahmenvertrag für Öffentlichkeitsarbeit an eine Arbeitsgemeinschaft, die aus mehreren der genannten, für die ÖVP tätigen Unternehmen bestand. Die Vergabekommission bestand u.a. aus dem Pressesprecher der Ministerin und der Kabinettschef wohnte der Kommissionssitzung bei. In der ELAK-Dokumentation mehrerer weiterer Aufträge des BMNT (nunmehr BMLRT) wurde von den zuständigen Bediensteten vermerkt, dass die Beauftragung „auf Wunsch des Büros der Bundesministerin“ erfolge.
Weitere Hinweise für unsachliche Einflussnahme auf Auftragsvergaben ergeben sich im Bereich der Regierungswerbung. Bei einer Analyse der Ausgaben des BMEIA unter Bundesminister Kurz sticht ein sprunghafter Anstieg der Ausgaben für Inserate in Zeitungen sowie Online-Medien von 2016 auf 2017 ins Auge. Die Ausgaben wurden zum Teil verdoppelt. Ein sachlicher Grund für den Anstieg ist nicht erkennbar, weshalb ein Zusammenhang mit der Nationalratswahl 2017 vermutet werden muss. Ähnliche Kostensteigerungen
finden sich in der Amtszeit des Bundesministers Kurz bei ausgegliederten Gesellschaften des BMEIA, nämlich dem Österreichischen Integrationsfonds und der Austrian Development Agency.
Die Hintergründe der Vergabe von Aufträgen für Schutzmasken an Hygiene Austria und somit an eine Gesellschaft, deren Geschäftsführung enge familiäre Beziehungen zu engsten MitarbeiterInnen des Bundeskanzlers hat, auf ausdrücklichen Wunsch des Bundeskanzleramts, wecken ebenso den Verdacht parteipolitischer Einflussnahme:
„Eine Spitzenbeamtin schrieb der Kabinettschefin von Minister Rudolf Anschober Ende November, dass im Ministerrat ‚keine Festlegung auf die Provenienz der FFP2-Masken‘ vorgenommen worden sei. Jedoch sei ‚am Rand deutlich kommuniziert‘ worden, dass ‚die Bundesregierung in diesem Vorhaben gerne österreichische Firmen/Produkte beschaffen würde‘. Damit war offenbar auch klar, welche Firma zum Zug kommen sollte: Hygiene Austria sei ‚derzeit der einzige österreichische Anbieter dafür (CE gekennzeichnete FFP2-Masken)‘. Aus diesem Grund habe die BBG im Auftrag des Ministeriums mit Hygiene Austria Verhandlungen aufgenommen ‚und auch exklusiv geführt‘.
Bemerkenswert scheint, dass Hygiene Austria auch über eine besondere Verbindung ins Bundeskanzleramt verfügt: Die Schwägerin von Unternehmenschef Wieser ist Büroleiterin von Kanzler Kurz. Wieser und der Ehemann der Büroleiterin sind Miteigentümer von Palmers und somit auch von Hygiene Austria. Dass das Bundeskanzleramt beim Projekt ‚65+‘ möglicherweise etwas mitzureden gehabt haben könnte, ergibt sich ebenfalls aus dem erwähnten Mail.“ 5
Die Oberalp AG mit Sitz in Südtirol erhielt über den Umweg einer Einkaufsgesellschaft des Roten Kreuzes im Rahmen der ersten großen Bestellungen von Schutzausrüstung Aufträge in Höhe von 43 Mio. Euro, somit rund ein Drittel des Gesamtvolumens. Die Oberalp, die an sich im Sportartikelgeschäft tätig ist, steht in engem Kontakt zu führenden SVP-Politikern sowie zur Tiroler Adler Runde, deren Mitglieder im Wahlkampf 2017 zusammen rund 1,1 Mio. Euro an die ÖVP gespendet haben. Im Südtiroler Landtag tagte in Hinblick auf die Beschaffungen durch die Oberalp ein eigener Untersuchungsausschuss, da große Teile des gelieferten Schutzmaterials nicht über die erforderlichen Zertifikate verfügten und qualitativ minderwertig waren. In mehreren Anfragebeantwortungen verweigerte die zuständigen BundesministerInnen nähere Auskünfte zu den Hintergründen der Beschaffungen und der konkreten Auswahl der Oberalp AG (vgl. 1538/AB, 1545/AB, 1549/AB, 1552/AB, 1561/AB, 1565/AB, 1571/AB, 1705/AB, 1711/AB, 1907/AB, 2194/AB, 2197/AB XXVII.GP). Die Agentur eines ehemaligen ÖVP-Kabinettsmitarbeiters wickelte u.a. Bewerbungen von Laboren für ein Coronatestprogramm ab, das vom BMLRT mit 150 Mio. Euro angekündigt wurde.6
Die Ausschreibung von PCR-Tests an Schulen durch das BMBWF soll auf einen ÖVP-nahen Anbieter zugeschnitten worden sein, indem mögliche konkurrenzierende Anbieter durch die Anwendung unsachlicher Ausschreibungskriterien von der Angebotslegung ausgeschlossen wurden.7
Landwirtschafts- und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger ließ sich Inserate einiges kosten. Das teuerste Inserat des ersten Halbjahres 2021 um rund 30.000 Euro schaltete Köstinger anlässlich des internationalen Frauentages in der „Österreichischen Bauernzeitung“ – laut offiziellen Mediadaten der Bauernzeitung ist das teuerste Inserat, das man bei ihnen buchen kann, um 19.000 Euro zu haben. Eigentümer der Bauernzeitung ist über eine komplizierte Konstruktion der österreichische Bauernbund – eine ÖVP-Teilorganisation. Zum Vergleich: Ein Inserat in der Kronen Zeitung bekam Köstinger schon für 11.613 Euro (vgl. 7212/AB XXVII.GP). Laut Recherchen der Salzburger Nachrichten sind im Untersuchungszeitraum rund 1 Mio. Euro von öffentlichen Stellen an die Bauernzeitung geflossen.8
Im BMDW erhielt der Verein „aed“, dem der ehemalige Vizekanzler und ÖVP-Obmann Spindelegger als Präsident vorsteht und ÖVP-Parteianwalt Suppan als Vorstandsmitglied angehört für die Durchführung eines Projekts mit dem Titel „Best Practice Austria“ eine außertourliche Förderung über rund eine Million Euro.
Bemerkenswert war außerdem, dass die zuvor von der ÖVP beschäftigte Immobilienunternehmerin Gabi Spiegelfeld nach Antritt von Thomas Schmid als ÖBAG-Vorstand von der ÖBAG einen Beratungsvertrag für Public Relations erhielt, nachdem sie im Zuge einer Ausschreibung der Bundesbeschaffungsgesellschaft ausgewählt worden war. Solche Rahmenverträge, die nach ungenauen Kriterien vergeben werden können, erübrigen in weiterer Folge Ausschreibungen für Einzelprojekte. Genauso soll es im Bereich des Bundesrechenzentrums, für das auf Grund des in-house-Privilegs eine Ausnahme von vergaberechtlichen Vorschriften besteht, zur Durchleitung von Aufträgen an Dritte, insbesondere an Beratungsunternehmen, mit Nähe zur ÖVP, die sich insbesondere aus der persönlichen Vernetzung der handelnden Personen wie Antonella Mei-Pochtler ergibt, gekommen sein.
In Zusammenhang mit den Spenden der Premiqamed an die ÖVP in den Jahren 2017 und 2018 führt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ebenfalls ein Verfahren gegen u.a. Hartwig Löger, allerdings wegen Untreue und nicht auf Grund von Korruptionsvorwürfen in Zusammenhang mit seiner Amtstätigkeit. Im Zuge des Verfahrens sagte der Geschäftsführer der Premiqamed jedoch aus, dass der Aufruf zur Spende an die ÖVP nicht von der Gesellschaft selbst, sondern von außen an ihn herangetragen worden sei und der damalige Geschäftsführer der ÖVP Bundespartei, Axel Melchior, ihm gegenüber einen konkreten Betrag genannt habe. Fakt ist außerdem, dass im Zuge einer Änderung des Privatkrankenanstaltenfinanzierungsgesetzes nicht nur die Privatklinik Währing mit zusätzlichen Mitteln bedacht wurde (vgl. die Anklageschrift gegen u.a. Heinz-Christian Strache wegen Bestechlichkeit), sondern auch die Kliniken der Premiqamed durch die Gesetzesänderung höhere Zuschüsse erhielten. Der Untersuchungsausschuss sollte in seinem Beweisverfahren den Zusammenhang zwischen beiden Sachverhalten weitergehend prüfen als der Ibiza-Untersuchungsausschuss dies vermochte. Aus diesem Grund sollen im Zuge des ersten Beweisthemas auch Änderungen an den Grundlagen von Förderprogrammen und die dahinterliegenden Motive aufgeklärt werden.
Das zweite Beweisthema dient der Aufklärung über das im Untersuchungsgegenstand beschriebene, potentiell missbräuchliche Verhalten im Bereich der Beteiligungen des Bundes. Die untersuchungsauslösenden Umstände sind in diesem Bereich auf Grund der umfassenden medialen Berichterstattung großteils offenkundig. Im Zentrum steht der Vorwurf, dass Thomas Schmid als Generalsekretär des BMF und gleichzeitig Kabinettschef mehrerer von der ÖVP nominierter Finanzminister wesentlichen Einfluss auf seine eigene Bestellung zum Alleinvorstand der ÖBAG sowie auf weitere Bestellungen genommen hat und die Personalauswahl aus parteipolitischen Motiven erfolgte. So lagen dem Ibiza-Untersuchungsausschuss umfassende Dokumente vor, die sowohl die direkte Einflussnahme von Schmid als auch seine Korrespondenz zu Themen des Beteiligungsmanagements mit Sebastian Kurz und Gernot Blümel sowie mit weiteren EigentümervertreterInnen belegen. Darin wird regelmäßig Bezug darauf genommen, dass Organwalter von Beteiligungsunternehmen zum vorzeitigen Ausscheiden „überredet“ werden sollten, um sie durch parteipolitisch vertraute Personen zu ersetzen. Prominentestes Beispiel einer solchen vorzeitigen Abberufung ist die Vorstandsbestellung bei der Casinos Austria AG im Frühjahr 2019, die zur Bestellung von Bettina Glatz-Kremsner – damals stellvertretende ÖVP-Vorsitzende – zur Generaldirektorin der CASAG führte. Zu diesen Vorgängen führt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft unter der Zahl 17 St 5/19d ein umfangreiches Ermittlungsverfahren. Dem vorausgegangen war ein gemeinsames Vorgehen des Bundes und der Novomatic bei der Wahl des Aufsichtsrates
der CASAG im Juni 2018. Die entsprechende Koordination zwischen Novomatic-CEO Neumann sowie Gernot Blümel und Thomas Schmid ist auf Grund der von der Staatsanwaltschaft ausgewerteten Chatnachrichten umfassend nachvollziehbar. Schlussendlich wurden u.a. der ehemalige ÖVP-Obmann Josef Pröll und ÖVP-„Urgestein“ Walter Rothensteiner in den Aufsichtsrat gewählt, die nun beide ebenfalls von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft als Beschuldigte geführt werden.
Im Zuge des zweiten Beweisthemas soll außerdem der tatsächliche Entscheidungsablauf und Informationsfluss in Angelegenheiten des Beteiligungsmanagements geklärt werden. Auf Grund des Herunterspielens der eigenen Rolle in diesen Fragen bei seiner Aussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss wird gegen den Bundeskanzler wegen Falschaussage ermittelt. Tatsächlich hat die Staatsanwaltschaft bereits umfassend herausgearbeitet, dass Kurz bei Personalentscheidungen in ausgegliederten Gesellschaften die Letztentscheidung hatte. Zudem entstand im Zuge des Ibiza-Untersuchungsausschusses der Eindruck, dass viele Entscheidungen unter Umgehung des damaligen Bundesministers Löger im Kanzerlamt getroffen wurden. Besonders in Erinnerung ist dabei auch, dass Schmid „steuerbare“ Frauen zur Besetzung in Aufsichtsräten suchte. Dabei dürfte sich „steuerbar“ weniger auf das konkrete Geschlecht, sondern vielmehr auf die allgemein erforderliche Qualifikation bei ÖVP-Personalentscheidungen beziehen.
In Hinblick auf die geplante Privatisierung der Austrian Real Estate, die von Schmid vorbereitet wurde, sowie deren Geschäftstätigkeit und jene ihrer Mutter, der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG), soll der Verdacht geprüft werden, dass damit SpenderInnen der ÖVP aus der Immobilienbranche begünstigt werden sollten. Auffällig ist dabei u.a. die Einmietung der BIG im dem SIGNA-Konzern gehörenden Gebäude der Postsparkasse für 99 Jahre, die zu einer Verdoppelung der Bewertung der Liegenschaft in den Signa-Büchern führte9 sowie mehrere gemeinsame Projekte der ARE mit SIGNA oder Soravia Group. Sowohl Benko als auch Mitglieder der Familie Soravia sind in den Unterlagen des Projekts Ballhausplatz mit „€“-Zeichen vermerkt.
Das dritte Beweisthema dient der Aufklärung über (versuchte) Einflussnahme auf Aufklärungsbemühungen, die die Tätigkeiten des Zusammenschlusses von der ÖVP zuzurechnenden Personen offenlegen und ggf. sanktionieren sollten. Neben dem Bereich der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen sind von diesem Beweisthema auch die Verfolgung von Hinweisen auf pflichtwidriges Verhalten von Mitgliedern des untersuchungsgegenständlichen Zusammenschlusses in den jeweiligen Bundesministerien selbst sowie die Behinderung parlamentarischer Kontrollinstrumente erfasst. Vermuteter gemeinsamer Zweck der Einflussnahme ist der Schutz parteipolitischer Interessen der ÖVP.
Untersuchungsauslösende Sachverhalte traten im Ibiza-Untersuchungsausschuss zuhauf auf: So informierte Bundeskanzler Kurz am Nachmittag vor der Veröffentlichung des Ibiza-Videos am 17.5.2019 Justizminister Moser über die bevorstehende Veröffentlichung. Moser führte bei seiner Befragung aus:
„Dr. Josef Moser: Ich habe am Tag, ich glaube, es war der Nachmittag, vor der Veröffentlichung des Videos erfahren - -, nachdem ich angerufen worden bin und mir mitgeteilt wurde, dass voraussichtlich in den Abendstunden des gleichen Tages ein Video veröffentlicht wird, das Aussagen von Strache und Gudenus beinhaltet, beinhalten soll, und dass gleichzeitig die Aussagen voraussichtlich auch Elemente beinhalten, die strafrechtlich zu würdigen sind.
Verfahrensrichter-Stellvertreter Dr. Ronald Rohrer: Wer hat Ihnen diese Mitteilung gemacht?
Dr. Josef Moser: Soweit mir erinnerlich ist, wurde ich diesbezüglich von Bundeskanzler Kurz informiert und habe daraufhin, nachdem ich informiert worden bin, den Sektionschef, das war der Generalsekretär meines Hauses, und auch den Kabinettschef informiert, dass er sich am Abend, wenn ein diesbezügliches Video veröffentlicht wird, sich
das Video anschauen, damit wir schauen können, ob daraus allfällige weitere Veranlassungen seitens der Justiz zu treffen sind.“
Welche Aufträge Kurz in dem besagten Telefonat genau an Moser erteilte, wurde von beiden bei ihren Befragungen im Untersuchungsausschuss nicht beantwortet. Es besteht der Verdacht, dass durch frühzeitiges Eingreifen entweder ein Schaden für den Koalitionspartner der ÖVP (zwecks Fortführung der Koalition) oder für die ÖVP direkt verhindert werden sollte. Feststeht, dass der damalige Sektionsleiter Christian Pilnacek noch am selben Abend mit dem Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien Kontakt aufnahm und sich bemühte, die WKStA aus den Ermittlungen herauszuhalten. Noch am selben Abend gab Pilnacek dem Kurier die Auskunft, wonach sich die Justiz bereits in der Ibiza-Causa eingeschalten habe und die Oberstaatsanwaltschaft den Sachverhalt prüfe. Das Nachrichtenmagazin profil hat die Nachrichten dieses Abends zwischen Pilnacek und Fuchs veröffentlicht:
„Um 23.33 Uhr eine weitere Nachricht an Fuchs: „Unterstütze mich bitte; HBM (Anm.: Herr Bundesminister) ist schon wieder fuchsteufelswild, dass ich das gesagt habe; wäre das nicht der Fall gewesen, wäre die WKStS (sic!) … wieder eigenständig vorgegangen; das kann doch gerade jetzt nicht unser Interesse sein; hG“.
Unmittelbar darauf reicht Pilnacek zwei Nachrichten nach, die er jedoch wieder löscht.
Es ist der 18. Mai 2019, exakt 00.00 Uhr, als Fuchs antwortet: „Lieber Christian, ich sehe in der Kurier-Mitteilung überhaupt nichts Dramatisches. Wie kann ich Dich unterstützen? HG“.
Pilnacek antwortet um 00.19 Uhr: „Eben dadurch, dass ich verhindern wollte, dass WKStA von sich aus aktiv wird; gute Nacht“.“
Am 18.5.2019 um 9:01 Uhr teilt Johann Fuchs seinem Vorgesetzten Pilnacek dann mit:
„Guten Morgen Christian, hier mein aktueller Meinungsstand zu einem möglichen Wording (wenn wir wieder ,dürfen‘): ,Die bisher medial veröffentlichten Rechercheergebnisse bieten keine ausreichende Grundlage für die Darstellung eines strafrechtlichen Anfangsverdachts. Konkrete Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Straftat lassen sich daraus nicht gewinnen. Eine (amtswegige) Einleitung eines Ermittlungsverfahrens ist daher zumindest derzeit nicht zulässig. Da das Videomaterial nach dem aktuellen Informationsstand überdies durch das Redaktionsgeheimnis geschützt ist, wäre eine Verbreiterung der Entscheidungsgrundlage auch von einer Kooperation der hier agierenden Medienunternehmen abhängig.‘ HG Hans“.
+ Pilnacek antwortete um 9.44 Uhr: „Danke, das würde ich unterstützen; hG“.“10
Der weitere Tag des 18.5.2019 verlief in der Justiz kommunikationsarm. Vor dem Hintergrund der sonstigen Ereignisse dieses Tages, an dem stundenlang kein Ton aus dem Kanzleramt zu vernehmen war, dürfte dies an der mangelnden Orientierung der handelnden Personen gelegen haben, wie nun weiter vorzugehen sei. Erst am Abend des 18.5.2019 – einem Samstag - entwickelt sich wieder aktives Treiben:
„Aus dem abendlichen E-Mail-Verkehr der Justiz am 18. Mai 2019.
Pilnacek an Fuchs, 20.33 Uhr: „Lieber Hans! Ich habe eben mit HBM telefoniert; wir bitten dich, der WKStA den Auftrag zu erteilen, das gesamte Bildmaterial von den beteiligten Medien anzufordern!“
Fuchs an Pilnacek, 20.46 Uhr: „Lieber Christian, ich kümmere mich darum; sollen wir das von Amts wegen oder aufgrund der bereits avisierten Jarolim-Anzeige machen? (Anm.: Hannes Jarolim, Rechtsanwalt und damals SPÖ-Abgeordneter) Es wäre mE jedenfalls als Erkundigung zur Prüfung, ob ein Anfangsverdacht vorliegt … am besten begründbar.“
Pilnacek an Fuchs, 20.47 Uhr: „HBM wünscht auch, dass die Kommunikation ausschließlich über OStA Wien läuft.“
Pilnacek an Fuchs, 20.50 Uhr: „Ich denke, dass du den Auftrag aktiv stellen solltest; HBM möchte WKStA keine aktive Rolle zukommen zu (sic!) lassen.““11
Moser selbst gab an, die Zuständigkeit der WKStA niemals bestritten zu haben. Offenbar hatte Moser jedoch realisiert, was eine solche Einflussnahme auf ein Ermittlungsverfahren für ihn bedeuten könnte und ließ noch am Montag, den 20.5.2019, über seine persönliche Assistenz ein E-Mail an die Leiterin der WKStA senden, wonach er von der ordnungsgemäßen Erfüllung der gesetzlichen Pflichten der WKStA ausgehe. Pilnacek und Mosers Kabinettschef erhielten diese E-Mail erst nachträglich.
Der Grund für Mosers Nervosität war mutmaßlich, dass die WKStA bereits an diesem Wochenende erkannte, dass ihre Ermittlungen verhindert werden sollten. Da jedoch im Zusammenhang mit der Causa „Wien Wert“ ein Verfahren bei der WKStA anhängig war, in dem auch Spenden an FPÖ-nahe Vereine bereits Thema waren, erstattete die WKStA am Sonntag, den 19.5.2019 einen dringenden Informationsbericht an die Oberstaatsanwaltschaft und das BMJ. Ermittlungen der WKStA waren somit mit den geplanten Mitteln nicht mehr zu verhindern.
Die in weiterer Folge stattgefundene Koordination der Obstruktionsmaßnahmen über mehrere staatliche Institutionen hinweg offenbart einen möglichen, rechtsstaatlich bedenklichen Zustand, in dem nur parteipolitische Interessen der ÖVP maßgeblich sind und der im Zuge weiterer Untersuchungen erkundet werden muss.12
Sinnbildlich für diese Koordination ist der intensive Austausch zwischen Pilnacek, dem späteren SOKO-Leiter Andreas Holzer, dem damaligen interimistischen Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Franz Lang und OStA-Leiter Johann Fuchs. Befragt nach der Rolle von Christian Pilnacek gab der fallführende Staatsanwalt Bernd Schneider bei der Staatsanwaltschaft Wien für das „Hintermänner-Verfahren“ folgendes an (204/KOMM XXVII.GP):
„Er war zu Beginn dabei, bei dieser allerersten Besprechung, die ich Ihnen genannt habe, die kurz nach Veröffentlichung des Ibizavideos bei der Oberstaatsanwaltschaft war. Da war eine Besprechung bei der Oberstaatsanwaltschaft, bei der der Oberstaatsanwalt Fuchs war, Vertreter vom Ministerium, Vertreter vom Bundeskriminalamt – die damals schon gesagt haben, dass eine Soko eingerichtet werden wird –, ich war dort, die Leitende Staatsanwältin Dr. Nittel war dort, und später hinzugekommen ist auch der damalige Noch-Generalsekretär Pilnacek.“
Gleichzeitig besteht der Verdacht, dass die Oberstaatsanwaltschaft Wien durch Berichtsaufträge und Weisungen sowie dienstaufsichtsrechtliche Maßnahmen für eine Zermürbung der WKStA sorgen wollte. Hervorzuheben sind die Weisungen der OStA, gewisse Akten dem Untersuchungsausschuss vorzuenthalten oder die „spontane“ Weisung, das Ermittlungsverfahren in der Schredder-Causa abzutreten.
Diese Kontrollbestrebungen der ÖVP gegenüber der Justiz schienen sogar den Regierungswechsel im Juni 2019 zu überdauern. Selbst unter der Amtszeit von Justizminister Jabloner blieb der Informationsfluss aus der Justiz an die ÖVP unverändert aufrecht. Das Nachrichtenportal zackzack veröffentliche Chats zwischen Christian Pilnacek und der damaligen Kabinettsmitarbeiterin von Jabloner, Andrea Martini. Den Hintergründen dieser Nachrichten konnte auf Grund des Endes der Beweisaufnahme des Ibiza-Untersuchungsausschusses nicht mehr nachgegangen werden:
„23.08.19, 17:03, Pilnacek an Abteilungsleiterin M.: Staatsanwaltschaft ermittelte bis vor kurzem gegen ein Mitglied der Soko Ibiza. Es geht munter weiter, das kann man sich nicht gefallen lassen!!!
17:08, M.: Jetzt wäre echt mal das BMI dran. Das wird wohl auch Peschorn aufregen.
17:13, Pilnacek: Ja, aber wir müssen auch einmal aktiv werden; accounts der WKStA sichern. Damit sind die Mailaccounts der Ermittler gemeint.
17:26, M.: Ja, die OStA (gemeint ist die für die WKStA zuständige Oberbehörde, die Oberstaatsanwaltschaft Wien unter Johann “Hans” Fuchs) kümmert sich darum!
18:02, Pilnacek: Es ist alles so erbärmlich; bitte K. nichts erzählen (Freund von A.). K. ist jener Staatsanwalt, der später auf Falschaussagen seiner Vorgesetzten im Ibiza-U-Ausschuss hinweisen sollte; er genoss das Vertrauen von Justizminister Clemens Jabloner. A. ist der fallführende Staatsanwalt in der Causa Casinos.
18:03, M.: Nein, mach ich sowieso nicht! (Hbm erzählt ihm immer nur alles, aber das ist eh Sache der OStA. Das muss ich hbm jetzt nicht im Detail erzählen.)
18:05, Pilnacek: Ok, man muss aber auch HBK von diesen seltsamen Verbindungen erzählen. “HBK” steht im Beamtensprech für Herr Bundeskanzler. Gemeint ist offenbar Sebastian Kurz – der war zu diesem Zeitpunkt zwar nicht Bundeskanzler, das System Pilnacek betrachtete ihn aber wohl als solchen.
18:07, M.: Ich glaub, ich hab das schon erwähnt. kann das ja wiederholen.“13
Neben dieser genannten Kommunikation mit dem damals (nur) ÖVP-Vorsitzenden Kurz gab der ehemalige Justizminister Moser sowie dessen früherer Strafrechtsreferent im Kabinett auch an, dass sich der Bundeskanzler Kurz bei ihm nach dem Stand des Verfahrens in der Causa Stadterweiterungsfonds erkundigt hatte. Bei diesem Verfahren waren mehrere hochrangige Beamte des BMI mit ÖVP-Nähe beschuldigt, Mittel des Stadterweiterungsfonds veruntreut zu haben.14 Außerdem wurde in diesem Zusammenhang auch gegen Christian Pilnacek wegen Amtsmissbrauch ermittelt. In einer anderen Angelegenheit teilte der Kabinettschef des damaligen Justizministers Moser, Wolfgang-Clemens Niedrist, welcher nunmehr Kabinettschef von Bundesminister Blümel ist, einem Vertrauten mit, dass es doch gut gewesen sei, dass er noch länger im BMJ verblieben ist. Hintergrund waren Vorwürfe gegen Stefan Pierer, steuerrechtliche Regelungen für Vermögenstransaktionen aus dem Ausland umgangen zu haben.
Untersuchungsauslösend sind des weiteren Vorwürfe des Verrats von Ermittlungsmaßnahmen: Neben einer Häufung von Zufällen in der Kommunikation zwischen Kanzler Kurz und Finanzminister Löger rund um die Hausdurchsuchung bei Löger, den Aussagen, wonach Bettina Glatz-Kremsner (damals bereits ehemalige stellvertretende ÖVP-Parteiobfrau) vorab über die Hausdurchsuchung bei Harald Neumann informiert war, Berichten über kurzfristige Datenlöschungen bei „research affairs“15, dem ominösen Treffen Christian Pilnaceks mit den Beschuldigten Pröll und Rothensteiner sind es die jüngsten Vorwürfe gegen den nunmehrigen Leiter des Bundeskriminalamts, aus parteipolitischen Gründen die Ergebnisse einer Telefonüberwachung verraten zu haben, denen nachzugehen sein wird:
Laut der parlamentarischen Anfrage, die Stögmüller an Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) eingebracht hat, geht es um Ermittlungen rund um die Operation "White Milk". Dabei gewährte das BVT einem syrischen Ex-General und mutmaßlichen Kriegsverbrecher Khaled H. Unterschlupf.
Das zog bereits Anfang 2016 Untersuchungen durch die Staatsanwaltschaft nach sich. Im Fokus standen mehrere Beamte im BVT und dem Innenministerium, darunter auch der damalige Kabinettschef Michael Kloibmüller.
Genau diesem schrieb Holzer am 10. April 2016: "I watched you. OK ist überall." OK steht für organisierte Kriminalität, für die Holzer als Leiter des zuständigen Büros im
Bundeskriminalamt damals zuständig war. Den Chatverlauf zitiert Stögmüller unter anderem aus dem aktuellen Buch von Ex-Politiker und "Zackzack"-Herausgeber Peter Pilz. Auch der "Standard" und "Zackzack" berichten darüber.
Und Stögmüller zitiert weitere Chats zwischen Holzer und Kloibmüller. Am 27. April 2016 fragt Holzer über den Messenger-Dienst Signal: "Hat BAK dich über TÜ Inhalte informiert?" BAK steht für das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung, TÜ meint Telefonüberwachung. Kloibmüller antwortet "Nein wieso". Holzer antwortet: "Zöhrer und du kommt vor. Ich glaube, das ist eine Linke aus einem gewissen Bereich". Wolfgang Zöhrer war damals BVT-Vizedirektor, auch er gilt als ÖVP-nah."16
Nicht zuletzt ist die Pressekonferenz der stv. Generalsekretärin der ÖVP Ende September 2021 zu erwähnen, in der sie präventiv für den Fall einer Hausdurchsuchung verkündete, dass in der ÖVP-Zentral „nichts mehr da“ sei. Wenige Tage später fand tatsächlich eine Hausdurchsuchung statt.
Gegenstand der Untersuchung wird im Zusammenhang mit Ermittlungen daher insbesondere sein, wie Informationsflüsse innerhalb des ÖVP-Zusammenschlusses verbreitet wurden. Zu dieser Zeit war Wolfgang Sobotka Bundesminister für Inneres und Sebastian Kurz Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres. Wie die von der WKStA ausgewerteten Chats zeigen sowie es die Aussagen von Christian Kern17 und Reinhold Mitterlehner nahelegen, war Wolfgang Sobotka federführend in die Sabotage von Projekten der damaligen Bundesregierung involviert und trug etwa auch dazu bei, ein 1,2 Mrd. schweres Projekt zum Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen zu verhindern.
Abschließend sollen auch Vorwürfe geprüft werden, wonach sich der Präsident des Nationalrates – soweit er als Organ der Vollziehung und nicht der Gesetzgebung, somit nicht in Ausübung von Rechten nach dem Geschäftsordnungsgesetz tätig wurde - mit Organen der Vollziehung abgesprochen hat, um die Beweiserhebungen des Ibiza-Untersuchungsausschusses zu behindern. Dieser Verdacht ergibt sich einerseits aus den bei Christian Pilnacek sichergestellten Mobiltelefondaten, die einen intensiven Austausch zwischen Sobotka und Pilnacek belegen sowie aus Äußerungen des Präsidenten selbst. Dieser gab selbst an, dass er in direktem Kontakt mit VertreterInnen des BKA stehe und von dort auch untersuchungsrelevante Auskünfte beziehe. Zudem wurden auf dem Handy von Christian Pilnacek Entwürfe für parlamentarische Anfragen gefunden, die vom damaligen Büroleiter des Präsidenten erstellt wurden. Mutmaßlich wurde die Ablehnung des Angebots, das gesamte Ibiza-Video dem Ausschuss zur Verfügung zu stellen, durch den Anwalt von Julian H., auch vorab vom Präsidenten mit ÖVP-VertreterInnen im Bundeskanzleramt abgesprochen. In Zusammenhang mit den Aktenlieferungen an den Untersuchungsausschuss durch Bundesminister Blümel, die erst auf Grund einer Exekution eines Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes durch den Bundespräsidenten erfolgte, sind außerdem die Motive für die Zurückhaltung der Akten durch das BMF und allfällige damit zusammenhängende Pflichtwidrigkeiten zu prüfen. Schließlich steht auf Grund der Befragungen im Ibiza-Untersuchungsausschuss fest, dass die Weisung zur Nicht-Lieferung durch das Kabinett des Bundesministers Blümel erfolgte.
Im Zentrum des vierten Beweisthemas steht die Personalauswahl von der ÖVP-zuzurechnenden Amtsträgern. Der untersuchungsauslösende Verdacht besteht darin, dass ÖVP-nahe Personen mit Organfunktionen ausgestattet wurden, um einen kontrollierenden Einfluss der ÖVP über die jeweiligen Organe zu gewährleisten. An dieser Stelle sind insbesondere die Bemühungen der ÖVP zu nennen, Vertraute insbesondere aus den Kabinetten in Leitungsfunktionen der Bundesministerien unterzubringen. Das bei diesen Neubesetzungen eine 2-zu-1- Regel bestand, wonach dem einen Koalitionspartner jeweils ein Drittel und dem anderen jeweils zwei Drittel der Funktionen zustehen sollten, je nachdem, wer das jeweilige Ministerium leitete, wurde sowohl von Norbert Hofer im Ibiza-Untersuchungsausschuss als auch von Bundeskanzler Kurz anlässlich seiner
Beschuldigteneinvernahme bestätigt. Insofern kamen sachfremde Kriterien für die Personalauswahl zur Anwendung, durch die nicht die besten Personen, sondern die parteilich loyalsten bestellt wurden.
Die Stabstelle Think Austria hat besondere Bedeutung für den Zugang von potentiellen ÖVP-SpenderInnen ins Bundeskanzleramt. Hinzu kommt, dass die Auswahl der Mitglieder der Stabsstelle noch zu beleuchten sein wird. Insbesondere die Rolle von Markus Braun sticht hier hervor, da dieser insgesamt 70.000 Euro an die ÖVP gespendet hatte.
Im Bereich der Wirtschaftsdelegationen gaben mehrere Auskunftspersonen an, vom Bundeskanzler oder seinem Umfeld zu gemeinsamen Reisen eingeladen worden zu sein. Aus welchen Motiven diese Einladungen erfolgten, wird zu klären sein. Dieses Muster bestand bereits im BMEIA in den Jahren 2015 und 2016. Exemplarisch können die gemeinsamen Reisen des damaligen Bundesministers Kurz mit René Benko in den arabischen Raum oder mit OMV-Chef Seele nach Libyen genannt werden,18 wo zu späterem Zeitpunkt auch Jan Marsalek mit der Unterstützung durch die österreichische Regierung für seine dortigen Projekte warb. Entsprechende parlamentarische Anfragen zu diesen Reisen und dem Inhalt der dort geführten Gespräche blieben unzureichend (vgl. zB 3187/AB XXVI.GP).
Die Interventionen zu Gunsten von (ehemaligen) ÖVP-PolitikerInnen sowie Verwandten von ÖVP-SpitzenpolitikerInnen sind – sofern es das BMF betrifft – in einem eigenen Auswertungsbericht der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft erfasst, der dem Ibiza-Untersuchungsausschuss vorlag (ON 1309 zum Verfahren AZ 17 St 5/19d). Dabei ging es u.a. um die Versorgung von Gabi Tamandl, Manfred Juraczka und Harald Mahrer. In dem besagten Auswertungsbericht sind auch die umfassenden Bemühungen u.a. von Thomas Schmid dokumentiert, Personen frühzeitig aus ihren Organfunktionen abzulösen.
Zur Einordnung in den Bereich der Vollziehung des Bundes:
Ein Untersuchungsausschuss des Nationalrates kann nur einen Vorgang im Bereich der Vollziehung des Bundes überprüfen. Der Ausschussbericht (AB 439 BlGNR XXV. GP, 3) führt dazu aus, dass zur Verwaltung des Bundes nach Rechtsprechung und Lehre sowohl die hoheitliche als auch die nicht-hoheitliche Besorgung von Verwaltungsaufgaben sowie die Privatwirtschaftsverwaltung des Bundes zähle. Daher kann auch informelles staatliches Handeln Gegenstand der Untersuchung sein (Pabel, Die Kontrollfunktion des Parlaments, 2009, 85) sowie auch gesetzesvorbereitende Tätigkeit der Verwaltung (Pürgy, Die gesetzesvorbereitende Tätigkeit der Verwaltung als Kontrollgegenstand parlamentarischer Untersuchungsausschüsse, ZfV 2021, 101). Das Untersuchungsrecht erstreckt sich somit grundsätzlich auf jede Art der „Verwaltung“ im verfassungsrechtlichen Sinn.
Gegenstand der Untersuchung ist im vorliegenden Fall das Verhalten von Mitgliedern der Bundesregierung, StaatssekretärInnen und deren unmittelbarem Umfeld in Organen des Bundes. Privates Verhalten ist nicht erfasst, sofern es keinerlei Bezug zur dienstlichen Tätigkeit hat (vgl. Konrath/Posnik, aaO, 9; Wimmer, Staatlichkeit und Kontrolle, in: Fuchs ua. [Hrsg.], Staatliche Aufgaben, private Akteure, 3. Band [2019], 136). Verhalten mit Bezug zur amtlichen Stellung in Organen des Bundes ist logischerweise Vollziehung des Bundes, auch wenn es bloß informelles oder schlichtes Verwaltungshandeln ist oder der Privatwirtschaftsverwaltung zuzuordnen wäre. Als politisches Kontrollrecht ist das Untersuchungsrecht nicht auf die Untersuchung bestimmter Handlungsformen beschränkt. Im Sinne des Ausschussberichts (AB 439 BlgNR XXV. GP, 3) wird bei der Abgrenzung zwischen amtlichem und privatem Verhalten auf die Intentionalität des jeweiligen Handelns, die nach objektiven Kriterien, also rechtlichen Zuständigkeiten und Befugnissen, zu bewerten ist, abzustellen sein (vgl. auch Konrath/Neugebauer/Posnik,
aaO, 217). Es ist somit auch klargestellt, dass etwa die Verwendung der mutmaßlich gewährten Vorteile durch die ÖVP nicht Gegenstand der Untersuchung sein kann, da Parteien genauso juristische Personen des Privatrechts und somit nicht Untersuchungsgegenstand sind, sondern lediglich jene Motive und Handlungen, die im Bereich der Vollziehung des Bundes zur Vorteilsgewährung führten.
Nicht ausgeschlossen ist jedoch, dass die Untersuchung die private Sphäre der ÖVP mittelbar berührt, da an der Aufklärung des behaupteten Missstands ein besonderes öffentliches Interesse besteht und die ÖVP über einen besonderen Bezug zu staatlichen Einrichtungen verfügt, sowie Kenntnis über Strukturen und Prozesse in der ÖVP zum Verständnis von Handlungen im Bereich der Vollziehung des Bundes erforderlich sind, da sie insofern eine Vorfrage darstellen. Die dem Untersuchungsausschuss von der Bundesverfassung eingeräumten, der Wirksamkeit seines Kontrollauftrags dienenden, besonderen Informationsrechte würden ins Leere laufen, könnten private Umstände nicht einmal mittelbar erforscht werden, obwohl diese Folgen im Bereich der Vollziehung des Bundes haben. Aus diesem Grund kann der verfassungsrechtlichen Vorlagepflicht des Art. 53 Abs. 3 B-VG gegenüber dem Untersuchungsausschuss auch keine Geheimhaltungsverpflichtung gegenüber Privaten entgegengesetzt werden (vgl. dazu bereits VfSlg. 19973/2015). Davon zu unterscheiden ist die Frage der eigenständigen Mitwirkungspflicht Privater an den Beweiserhebungen eines Untersuchungsausschusses (vgl. dazu einerseits VfSlg. 19993/2015 bzw. andererseits § 288 Abs. 1 und 3 StGB).
Dass Private mittelbar vom Gegenstand der Untersuchung betroffen sein können, hat der Verfassungsgesetzgeber durch die Erlassung des Art. 138b Abs. 1 Z 7 und die Schaffung des dazugehörigen Beschwerdeverfahrens im VfGG überdies ausdrücklich anerkannt. Schließlich wäre ein solches Verfahren zum Schutz von Persönlichkeitsrechten ansonsten von vornherein obsolet.
Dem Nationalrat kommt gemäß Art. 143 B-VG das Recht zu, beim Verfassungsgerichtshof die Klage gegen (auch ehemalige) Mitglieder der Bundesregierung auch wegen strafgerichtlich zu verfolgender Handlungen zu erheben, die mit der Amtstätigkeit des Anzuklagenden in Verbindung stehen. In diesem Falle wird der Verfassungsgerichtshof allein zuständig, die bei den ordentlichen Strafgerichten etwa bereits anhängige Untersuchung geht auf ihn über. Gemäß § 73 VfGG hat die Klage denselben Maßstäben wie eine Anklageschrift zu entsprechen (vgl. Rohregger in: Eberhard et al. [Hrsg.], Kommentar zum Verfassungsgerichtshofgesetz 1953, 4; Zögernitz, Nationalrat-Geschäftsordnung4, § 75, Anm. 1). Zur Wahrnehmung seiner verfassungsrechtlichen Aufgaben muss es dem Nationalrat unter Einsatz seines weitestreichenden Kontrollinstruments - des Untersuchungsausschusses - daher möglich sein, den Sachverhalt und insbesondere auch die subjektive Tatseite selbsttätig umfassend zu erforschen, auch wenn diese im Bereich der parteipolitischen Gründe zu verorten ist, so lange nur ein ausreichender Zusammenhang mit der amtlichen Tätigkeit besteht. Vorwürfe strafgerichtlich zu verfolgender Handlungen bestehen aktuell gegenüber mehreren der ÖVP zuzurechnenden Regierungsmitgliedern in Zusammenhang mit ihrer Amtsführung, insbesondere gegen den Bundeskanzler sowie Bundesminister Blümel. Eine solche Auslegung entspricht auch dem spezifischen Verständnis parlamentarischer Kontrolle als Informationsgewinnung zur Geltendmachung politischer Verantwortung (vgl. auch Konrath/Neugebauer/Posnik, aaO, 218).
Bei den Vorteilen, die mutmaßlich gewährt wurden, handelt es sich in aller Regel um solche, die im Bereich der Vollziehung des Bundes gelegen sind, da eine Vorteilsgewährung in anderen Bereichen jedenfalls nicht durch die amtliche Tätigkeit der jeweiligen Personen ausgelöst sein kann. Einzige Ausnahme bilden Fallkonstellationen im Dreiecksverhältnis, bei denen sich das jeweilige Organ des Bundes für den Vorteil bei einem Dritten verwendet und der Vorteil somit indirekt gewährt wird. Auf Grund derselben Verwerflichkeit solcher Handlungen – nämlich der Unsachlichkeit des Eingreifens eines
Organs des Bundes wohl jeweils unter der Begründung eines Abhängigkeitsverhältnisses zum Dritten sind solche Konstellationen ebenfalls vom Untersuchungsgegenstand erfasst. Der Nachteil tritt jedenfalls immer beim Bund ein.
Zur Abgeschlossenheit:
Der Ausschussbericht (AB 439 BlgNR XXV. GP, 4) führt aus, dass ein Vorgang jedenfalls dann als „abgeschlossen“ angesehen werden könne, wenn sich die Untersuchung auf einen zeitlich klar abgegrenzten Bereich in der Vergangenheit bezieht. Das Erfordernis der Abgeschlossenheit schließe nicht aus, dass damit in Verbindung stehende Handlungen noch offen sind. Dies ergibt sich im Übrigen bereits daraus, dass anderenfalls die Ausnahme des Art. 53 Abs. 4 B-VG von der Vorlageverpflichtung an einen Untersuchungsausschuss überflüssig wäre.
Als maßgeblicher Beginn der Untersuchung wird im vorliegenden Fall der 18. Dezember 2017 und somit die Angelobung von Sebastian Kurz als Bundeskanzler bestimmt. Ab diesem Zeitpunkt kam Kurz auch formal die führende Stellung zu. Auf Grund ausdrücklicher Anordnung werden auch alle Handlungen auf Grund des Projekts Ballhausplatz, die laut WKStA bereits 2014 und somit vor dem 18. Dezember 2017 begannen, als Vorbereitungshandlungen erfasst, da diese in untrennbarem Zusammenhang mit den späteren Handlungen zur Vorteilsgewährung stehen. Insbesondere das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten sowie das Bundesministerium für Finanzen werden daher ihre Aktenbestände bereits ab dem Jahr 2014 zu sichten haben, da die im „Projekt Ballhausplatz“ relevanten Akteure im Zeitraum vor 18. Dezember 2017 in diesen Ressorts tätig waren.
Das Ende des Untersuchungszeitraumes wird mit 11.10.2021, sohin dem Tag der Entlassung von Sebastian Kurz als Bundeskanzler durch den Bundespräsidenten festgelegt.
Auch wenn mit dem Vorgang in Verbindung stehende Handlungen weiterhin offen sind, ist durch die Festlegung eines ausdrücklichen Enddatums das Erfordernis der Abgeschlossenheit erfüllt (vgl. VfGH 14.9.2018, UA1/2018, 86; VfSlg. 20304/2018, 179ff; Konrath/Neugebauer/Posnik, aaO, 218; Konrath/Posnik, aaO, 12).
1 https://www.profil.at/wirtschaft/bisher-unveroeffentlichte-chats-kurz-kann-jetzt-geld-scheissen/401407647
2 https://www.falter.at/zeitung/20170919/projekt-ballhausplatz
3 https://www.profil.at/oesterreich/die-komplette-anordnung-zur-oevp-hausdurchsuchung-das-sind-die-vorwuerfe/401760906
4 Vgl. https://www.addendum.org/parteienfinanzierung/oevp-mediaselect/
5 https://www.profil.at/wirtschaft/hygiene-austria-geplatzter-masken-deal-mit-der-regierung/401208109
6 https://zackzack.at/2020/07/29/das-mckinsey-kartenhaus-kurz-orf-stiftungsrat-steckt-hinter-koestingers-coronatest-desaster/
7 Falter 36/2021: Gurgel! Spül! Verdiene!
8 https://www.sn.at/politik/innenpolitik/tuerkise-inserate-fuer-den-bauernbund-110232697
9 https://www.falter.at/maily/20200224/kasse-machen-mit-der-postsparkasse
10 https://www.profil.at/wirtschaft/neue-pilnacek-chats-vorpreschen-der-wksta-verhindern/401431324
11 https://www.profil.at/oesterreich/die-ibiza-vertuschung-justizministerium-unter-verdacht/401155287
12 https://www.derstandard.at/story/2000125536069/ein-schamloser-staat-im-staat
13 https://zackzack.at/2021/06/08/intrige-im-justizministerium-so-wollte-pilnacek-an-die-mails-der-wksta-kommen/
14 https://kurier.at/politik/inland/schwarzes-netzwerk-oder-justizskandal-aufregung-nach-anklage-gegen-sektionschefs/400524373
15 https://www.derstandard.at/story/2000130365838/in-inseratenaffaere-beschuldigte-meinungsforscherin-b-offenbar-festgenommen
16 https://www.puls24.at/news/politik/ex-leiter-der-soko-ibiza-andreas-holzer-soll-oevp-nahen-beamten-vor-ueberwachung-gewarnt-haben/244090
17 https://www.derstandard.at/story/2000130382727/ex-kanzler-kern-sobotka-war-die-abrissbirne
18 https://www.derboersianer.com/2019/03/boys-trip-kurz-seele-benko-und-ein-lippizaner/
Beilage 1 zum Verlangen gemäß § 33 Abs. 1 2. Satz GOG-NR
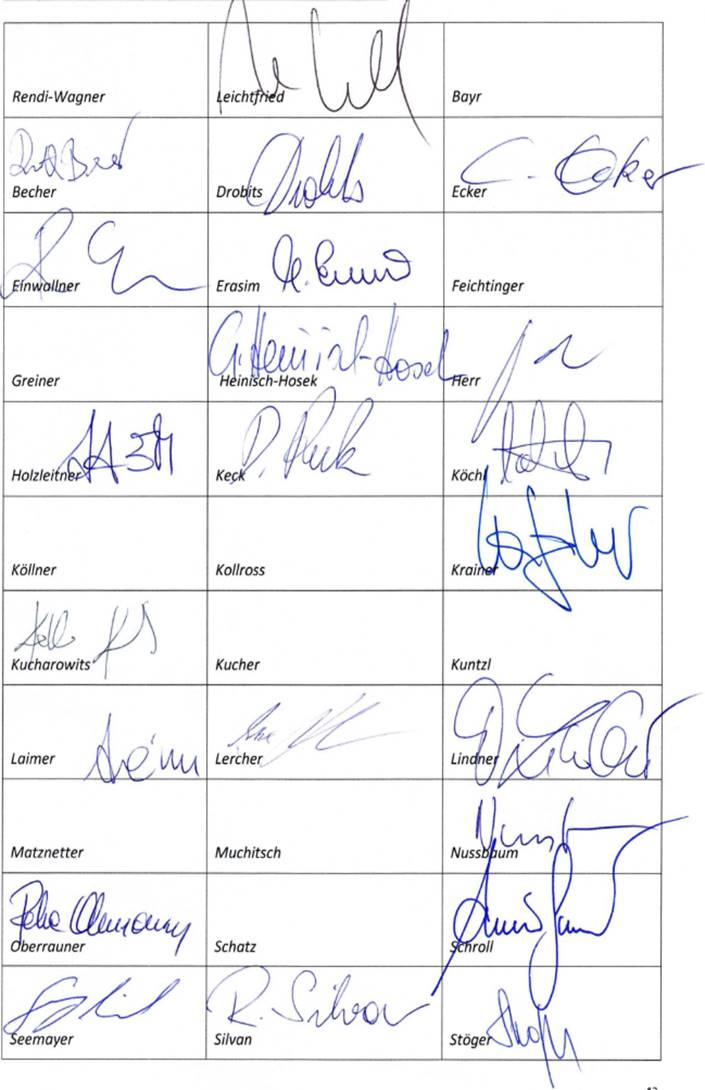
Beilage 2 zum Verlangen gemäß § 33 Abs. 1 2. Satz GOG-NR
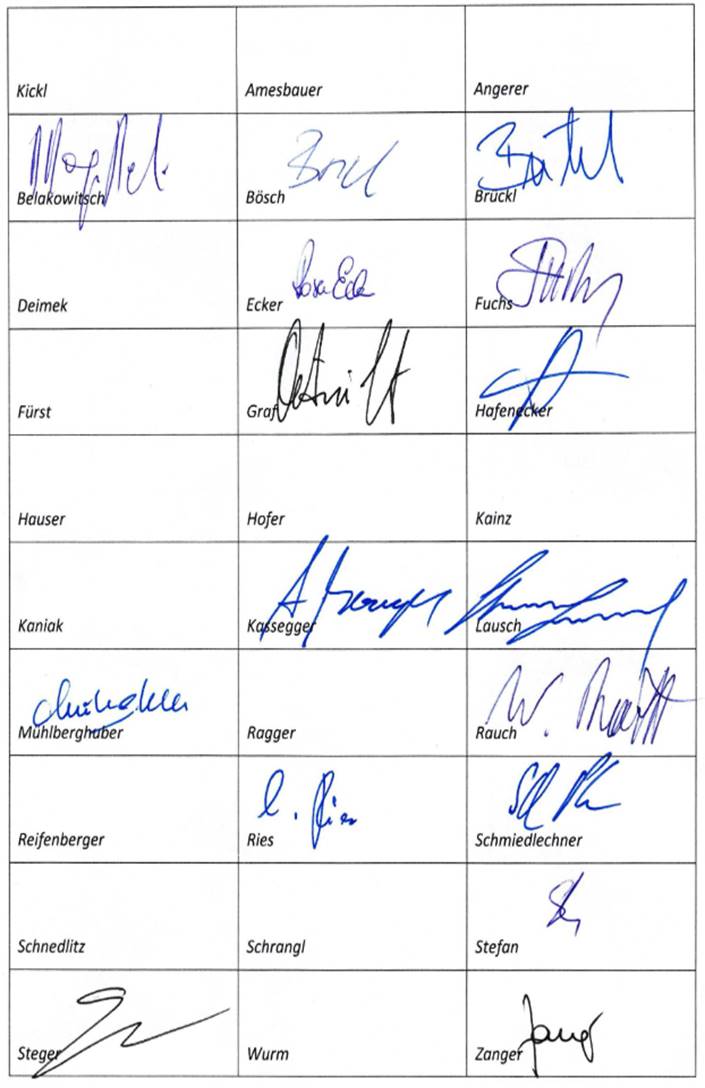
Beilage 3 zum Verlangen gemäß § 33 Abs. 1 2. Satz GOG-NR

*****
Präsidentin Doris Bures: Wir gehen in die Debatte ein.
Im Sinne des § 57a Abs. 1 der Geschäftsordnung beträgt die Redezeit in einer kurzen Debatte 5 Minuten. Der Erstredner oder der Begründer dieses Verlangens erhält jedoch 10 Minuten. Das ist Herr Abgeordneter Kai Jan Krainer, dem ich hiermit auch das Wort erteile. – Bitte.
Abgeordneter Kai Jan Krainer (SPÖ): Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Abgeordneten Krainer, Hafenecker und Krisper, stellvertretend für die Fraktionen der Sozialdemokraten, der FPÖ und der NEOS, bringen heute das Verlangen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses betreffend „Klärung von Korruptionsvorwürfen gegen ÖVP-Regierungsmitglieder (ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss“ ein.
Das Verlangen bringen wir ein, weil es notwendig ist. Notwendig ist es eigentlich schon aufgrund der Ergebnisse des Ibiza-Untersuchungsausschusses und weil dieser durch das vorzeitige Abdrehen auf Betreiben der ÖVP seine Arbeit nicht abschließen konnte; und notwendig ist es auch – das wurde in den letzten Tagen noch erweitert – aufgrund des Bekanntwerdens der Tatsache, dass die ÖVP, ÖVP-Vertreter mutmaßlich – wie es aus den Chats eigentlich für jeden, der die 104 Seiten liest und nicht wegwirft, klar ist – zugunsten des ehemaligen Kurzkanzlers Sebastian Kurz Steuergelder missbraucht haben, um ihm zu helfen, parteiintern die Macht zu ergreifen und auch Wahlen zu gewinnen und in Wahrheit zu manipulieren.
Jeder, der die 104 Seiten der WKStA nicht einfach wegwirft, sondern tatsächlich liest, weiß, dass es so ist. Da steht alles drin. Nicht strafrechtlich – strafrechtlich machen wir hier gar nichts, das machen die Gerichte, die Staatsanwälte, das machen Richter –, politisch, moralisch ist aber klar, was hier passiert ist, und das gehört untersucht, das gehört aufgeklärt, denn wir sehen: Es gibt da Sümpfe der Korruption in Österreich, die trockengelegt werden müssen. (Abg. Strasser: Die SPÖ!) Um genau zu wissen, welche Sümpfe trockengelegt werden müssen, muss jetzt genau untersucht werden, was die ÖVP da alles getan hat. (Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordneten der FPÖ.)
Deswegen sind der Untersuchungsgegenstand „das Gewähren von Vorteilen an mit der ÖVP verbundene natürliche und juristische Personen durch Organe der Vollziehung des
Bundes im Zeitraum von 18. Dezember 2017 bis 11. Oktober 2021“ – das sind Beginn und Ende der Zeit, als Herr Kurz Kurzkanzler war – „sowie diesbezügliche Vorbereitungshandlungen auf Grundlage und ab Beginn des ‚Projekts Ballhausplatz‘ auf Betreiben eines auf längere Zeit angelegten Zusammenschlusses einer größeren Anzahl von in Organen des Bundes tätigen Personen, bestehend aus der ÖVP zuzurechnenden Mitgliedern der Bundesregierung, StaatssekretärInnen sowie MitarbeiterInnen ihrer politischen Büros, zu parteipolitischen Zwecken und die damit gegebenenfalls zusammenhängende Umgehung oder Verletzung gesetzlicher Bestimmungen sowie der dadurch dem Bund gegebenenfalls entstandene Schaden“. Das ist der Untersuchungsgegenstand.
Die sogenannten Beweisthemen, das heißt, was wir diesem Untersuchungsausschuss für einen Auftrag geben wollen, sind Folgende:
Die „Beeinflussung“ – vor allem – „von Vergabe- und Förderverfahren“: Da geht es um das, was wir jetzt auch in den Akten der WKStA sehen, nämlich um das Beauftragen von Studien und Umfragen zu mutmaßlichen Gunsten politischer Entscheidungsträger der ÖVP, die „Einflussnahme auf Vergabeverfahren zu Gunsten politisch nahestehender Unternehmen mit dem mutmaßlichen Ziel, indirekte Parteienfinanzierung zu tätigen“. Genauso muss natürlich das Beinschab-„Österreich“-Tool untersucht werden, also wie ganz gezielt Meinungsumfragen in Auftrag gegeben, dann frisiert, manipuliert und dann veröffentlicht wurden – das alles nur für parteipolitische Zwecke der ÖVP.
Das nächste Beweisthema ist die „Einflussnahme auf Beteiligungen des Bundes“. Das ist ein Thema, mit dem wir im Ibiza-Untersuchungsausschuss nicht fertig geworden sind. Wir wissen ja alle, wie die ÖVP zum Beispiel mit der Novomatic Einfluss auf die Casinos genommen hat, damit sie ihre Leute dort unterbringt.
Die „Beeinflussung von Ermittlungen und Aufklärungsarbeit“ ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir ja aufgrund des Ibiza-Untersuchungsausschusses gesehen haben, wie von Tag eins an – von Tag eins an! – der ÖVP zuzurechnende Personen begonnen haben, die Ermittlungen betreffend Ibiza zu beeinflussen, indem gewisse Ermittlungen unterbunden wurden, indem versuchte wurde – hier in Wahrheit rechtswidrigerweise –, nicht die WKStA zuständig sein zu lassen. Wir kennen ja alle die E‑Mails, die Chats, die es auch aus dieser Zeit gibt, die Herrn Pilnacek betreffen, der in der Zwischenzeit suspendiert wurde; und da hat auch der VfGH gesagt: Ja, diese Suspendierung ist zu Recht ergangen, weil dieser Mann wirklich unter Verdacht steht, dass er da rechtswidrig gehandelt hat oder jedenfalls in einer Art und Weise gehandelt hat, die eine Suspendierung rechtfertigt. Es geht hierbei um die Informationsflüsse betreffend Ermittlungen an Entscheidungsträger der ÖVP. Wir haben im Ibiza-Untersuchungsausschuss auch eine Reihe von Indizien dafür gefunden, dass vor allem vonseiten einerseits Pilnaceks und anderen, aber andererseits auch der Polizei – hier vor allem von ÖVP-Vertrauensmann Holzer – Informationen an die ÖVP gegangen sind. Wir wissen, dass es Verfahren wegen des möglichen Verrats von Hausdurchsuchungen gibt, nicht nur aktuell, sondern auch von früheren Hausdurchsuchungen. Es gibt also wirklich viel Arbeit – das muss man sagen –, die dieser Untersuchungsausschuss haben wird.
Der letzte Bereich ist die „Begünstigung bei der Personalauswahl“. Da gibt es ja auch eine Reihe von Punkten, die im Ibiza-Untersuchungsausschuss erledigt wurden, aber andere sind offengeblieben. Das heißt, wir setzen in Wahrheit dort fort, wo die ÖVP verhindern wollte, dass weiter untersucht wird.
Ich kann aber auch gleich sagen, dass wir als Einsetzungsminderheit diesen Untersuchungsausschuss möglichst kurz und konzentriert durchführen wollen. Das ist auch ein Angebot von uns, dass wir sagen: Wenn die Blockaden, die wir aus dem Ibiza-Untersuchungsausschuss vor allem von der ÖVP kennen, nicht stattfinden, wenn es genug Sitzungstermine gibt, nicht diese Sinnlosladungen, die als ÖVP-Tage in die Geschichte
eingegangen sind, an denen permanent Menschen geladen worden sind, die keinerlei Beitrag leisten konnten, wenn die ÖVP die Befragungen nicht durch Geschäftsordnungsdebatten stört und zerstört und die Auskunftspersonen nicht - - (Abg. Hanger: Geh bitte! – Abg. Scherak: Schau! Sie wachen auf!) – Jaja, sie sind eh munter! – Wenn also die Auskunftspersonen nicht alle plötzlich das Gefühl haben, sie müssen nicht mehr kommen, weil die ÖVP das abdreht, wie wir es ja am Ende erlebt haben, dann glauben wir, dass wir es – wenn es auch wirklich ausreichend Termine gibt – vielleicht sogar schaffen, im ersten Halbjahr 2022 fertig zu werden. (Abg. Belakowitsch: Das ist aber eher unwahrscheinlich!) Das ist unser Angebot. Natürlich müssen dazu auch die Akten und die Unterlagen kommen.
Also wenn das Bundeskanzleramt und das Finanzministerium, die das letzte Mal besonders säumig waren, jetzt gleich liefern und wir nicht wieder zum VfGH gehen müssen, nicht wieder eine Exekution durch den Bundespräsidenten einleiten müssen, die dann erst vom Landesgericht für Strafsachen durchgeführt werden muss, das heißt, wenn die ÖVP kooperiert, wie das an und für sich bei Untersuchungsausschüssen üblich ist, wie das vergangene Regierungen selbstverständlich getan haben, dann glauben wir, dass wir wirklich in einer vernünftigen Zeit fertig werden können. Das ist unser Angebot, kooperativ diesen Ausschuss und diese Aufklärungsarbeit durchzuführen.
Ich kann aus dem Ibiza-Untersuchungsausschuss sagen, dass vier Parteien kooperiert haben, und zwar insofern, als sie, auch wenn sie nicht alle derselben Meinung waren, nicht alle dasselbe gedacht haben, konstruktiv mitgearbeitet haben, um den Untersuchungsgegenstand abzuarbeiten. Wenn diese eine Partei, die da besonders gestört hat, dieses Mal auch konstruktiv mitarbeitet, dann, glaube ich, können wir wirklich im Juni fertig sein und den Bericht womöglich schon im Juli im Plenum haben. Das ist unser Angebot, dass wir das kurz und knackig und zügig durchführen.
Es tut für uns alle not, dass wir den Korruptionsvorwürfen nachgehen, die die ÖVP-Regierungsmitglieder betreffen, und dann auch klar aufzeigen, wo Korruption unserer Meinung nach passiert ist, und die entsprechenden gesetzlichen Maßnahmen setzen, sodass wir diese Korruption für die Zukunft verunmöglichen, und natürlich auch die politisch Verantwortlichen für diese Korruption benennen. Das ist die Aufgabe des gesamten Parlaments, nicht nur der Opposition, sondern von uns allen hier. Ich lade alle ein, sich konstruktiv zu beteiligen, weil die Kontrolltätigkeit des Parlaments genauso wichtig wie die Budgethoheit und genauso wichtig wie die gesetzgeberische Funktion ist. Das ist unsere Aufgabe, damit die Institutionen funktionieren.
Ich hoffe, dass die ÖVP das auch als ihre Aufgabe sieht. Es tut auch Ihnen gut, wenn Sie mithelfen, sauber zu machen, auch wenn es vielleicht eigene Menschen oder eigene Politikerinnen und Politiker betrifft. – Vielen Dank. (Beifall bei SPÖ und NEOS sowie bei Abgeordneten der FPÖ.)
19.32
Präsidentin Doris Bures: Alle weiteren Rednerinnen und Redner in dieser Debatte haben eine Redezeit von 5 Minuten, aber Sie wissen das ohnedies.
Herr Abgeordneter Andreas Hanger, Sie gelangen zu Wort. – Bitte.
Abgeordneter Mag. Andreas Hanger (ÖVP): Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Hohes Haus! Wir erleben gerade einen etwas holprigen Start eines neuen Untersuchungsausschusses. (Ruf bei der SPÖ: Geh bitte!)
Herr Kollege Krainer! Ganz ehrlich: Ein Fehler kann jedem passieren. Das will ich auch nicht näher kommentieren, gar keine Frage. Er wurde auch noch korrigiert, das ist so in Ordnung. Ich habe nur gedacht: Was wäre gewesen, wenn dieser Fehler jemandem anderen passiert wäre, und Herr Kollege Krainer wäre ans Rednerpult getreten? – Voller
Häme hätte er natürlich diesen Fehler zelebriert, aber das ist halt ein bisschen sein politischer Stil. Das ist halt auch so zur Kenntnis zu nehmen.
Ich möchte für meine Fraktion festhalten – und das meine ich wirklich sehr, sehr ernst ‑: Wir gehen sehr unvoreingenommen an diesen Untersuchungsausschuss heran. Es ist das legitime Recht einer Oppositionspartei oder mehrerer Oppositionsparteien, einen Untersuchungsgegenstand einzubringen, die Exekutive zu kontrollieren – ich werde dann noch über Gewaltentrennung reden –, es ist aber genauso unser legitimes Recht, darauf hinzuweisen, dass diese Vorwürfe gegen uns, die schon wieder da sind, ungerechtfertigt sind. Wir werden die Akten liefern lassen, wir werden uns das anschauen, und wir sollten einmal sehr unvoreingenommen an dieses Thema herangehen, in aller Ruhe, mit weniger Aufgeregtheit. Ich bin schon der Meinung, dass wir dieses Kontrollinstrument des Parlaments sehr, sehr ernst nehmen sollten.
Was braucht es aus meiner Sicht, damit das ein guter Untersuchungsausschuss wird, der dieser Kontrollaufgabe seriös gerecht wird? – Wir brauchen zuallererst einen klaren Untersuchungsgegenstand. Die Geschäftsordnung sieht vor, dass sich der Untersuchungsgegenstand mit einem zeitlich und inhaltlich abgegrenzten Vorgang in der Vollziehung des Bundes befasst. Jetzt attestiere ich demjenigen, der diesen Untersuchungsgegenstand definiert hat, viel Mühe, aber – ganz ehrlich – momentan tue ich mir wirklich ein bisschen schwer, diesen abgegrenzten Vorgang zu erkennen.
Zeitlich: Dazu steht im Antrag: „18. Dezember 2017 bis 11. Oktober 2021“, und dann steht dabei: aber auch alle diesbezüglichen vorbereitenden Handlungen. Also mit diesem Zusatz ist aus meiner Sicht der zeitliche Rahmen schon wieder nicht klar definiert.
Inhaltlich: Na ja, beim vorigen U-Ausschuss haben wir von Kraut und Rüben gesprochen. Dieses Urteil will ich derzeit noch nicht abgeben, aber wir diskutieren jetzt zum Beispiel unter Punkt 1 „Beeinflussung von Vergabe- und Förderverfahren“, ganz generell, über alle Ministerien hinweg. – Das grenzt ja den Untersuchungsgegenstand nicht ein. Das wäre in einer höheren Präzision aus meiner Sicht schon wesentlich besser.
Wir diskutieren dann wieder die „Einflussnahme auf Beteiligungen des Bundes“. – Das hatten wir auch im Ibiza-Untersuchungsausschuss.
Ich finde es auch sehr gut, dass wir noch einmal die „Beeinflussung von Ermittlungen und Aufklärungsarbeit“ diskutieren. Da hat ja auch der Herr Verfahrensrichter schon im letzten Ausschuss festgestellt, dass es natürlich keine politische Einflussnahme gegeben hat. Ich schaue aber noch einmal sehr gerne hin auf das Verhältnis der WKStA zur Fach- und Dienstaufsicht. Da sehen wir diese Konfliktpotenziale.
Also vielleicht haben wir die Möglichkeit, über diesen Untersuchungsgegenstand noch zu reden – dazu Einvernehmen herzustellen wäre wichtig –, aber damit, da einen zeitlich und inhaltlich klar abgegrenzten Vorgang zu erkennen, tue ich mir wirklich sehr, sehr schwer. Das ist nämlich – und das will ich schon für die Zuseherinnen und Zuseher erklären – ganz relevant in der Frage der Aktenlieferung. Jetzt haben wir dieses Prozedere über die Bühne zu bringen: Geschäftsordnungsausschuss, Einsetzung im Nationalrat, und dann wird es zu einem Beweisverlangen kommen. Dieses Beweisverlangen wird dann mit dem Untersuchungsgegenstand den einzelnen Ministerien zugestellt. Ganz ehrlich: Wenn man ein Beweisverlangen mit diesem Untersuchungsgegenstand in einem Ministerium bekommt, dann bleibt man ein bisschen ratlos zurück. (Zwischenruf des Abg. Matznetter.)
Dann kommt noch der Begriff der abstrakten Relevanz dazu. Der Verfassungsgerichtshof hat gesagt, es ist alles zu liefern, was abstrakt relevant ist. Das heißt, am besten man liefert eh gleich alles und jedes. Vielleicht können wir da auch ein Prozedere der Aktenlieferung finden – Herr Kollege Krainer, da schaue ich dich an –, gerne, jederzeit. Ich habe wenig Lust, wochenlang Fragen der Aktenlieferung zu diskutieren. Da ein klares Prozedere zu finden erscheint mir wichtig.
Noch ein paar Aspekte möchte ich schon festhalten: Wir müssen mehr darauf achten, dass wir Persönlichkeitsrechte nicht verletzen. Das ist doch unbestritten beim letzten Untersuchungsausschuss passiert. Das darf uns nicht egal sein.
Frau Kollegin Krisper! Es gibt auch ein Informationsordnungsgesetz. Ich appelliere an alle Abgeordneten im Ausschuss, dieses Informationsordnungsgesetz ernst zu nehmen (Zwischenruf des Abg. Stögmüller), damit Persönlichkeitsrechte geschützt werden.
Ein wichtiger Aspekt, den ich auch noch ansprechen möchte, ist die Frage der Leaks. Es ist einfach so – und ich bitte, das nicht einfach zur Kenntnis zu nehmen –, dass permanent Ermittlungsakten, Akten, die an den Untersuchungsausschuss übermittelt werden, bevor sie im Untersuchungsausschuss sind, bevor der Beschuldigte etwas davon weiß, schon in den Medien veröffentlicht werden. Das ist keine seriöse Aufklärungsarbeit, wenn es schon im Vorfeld die öffentliche Debatte gibt. Wir wissen, dass dann immer Vorverurteilungen und anderes passiert. Da würde ich mir einen anderen Zugang wünschen.
Abschließend komme ich noch zur Gewaltenteilung.
Präsidentin Doris Bures: Abschließend geht noch ein Schlusssatz. Herr Abgeordneter, formulieren Sie bitte den Schlusssatz!
Abgeordneter Mag. Andreas Hanger (fortsetzend): Nehmen wir die Gewaltenteilung ernst! Es ist nicht Aufgabe des Parlaments, strafwidriges Verhalten zu untersuchen. – Vielen Dank. (Beifall bei der ÖVP.)
19.38
Präsidentin Doris Bures: Danke vielmals.
Nun gelangt Frau Abgeordnete Nurten Yılmaz zu Wort. – Bitte. Sie haben 5 Minuten Redezeit. (Abg. Matznetter: Na was sagst zum Hanger?)
Abgeordnete Nurten Yılmaz (SPÖ): Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Werte Kolleginnen und Kollegen! Kollege Hanger! Der Untersuchungsgegenstand war schon beim Ibiza-Untersuchungsausschuss sehr klar. Für Sie war er das nicht, das merke ich heute noch, aber der Verfassungsgerichtshof hat ihn für klar befunden. Halten wir uns alle an den Verfassungsgerichtshof, würde ich sagen. (Beifall bei der SPÖ. – Abg. Hanger: Da sind Sie falsch informiert!)
Werte Kolleginnen und Kollegen! Den Ibiza-Untersuchungsausschuss haben Sie abgedreht und uns ausgerichtet: Ihr könnt ja einen neuen einsetzen! Jetzt machen wir das. Ich schaue jetzt einmal liebevoll zu den Grünen. Ich hoffe, ihr erspart uns die Schleife zum Verfassungsgerichtshof, dass das nicht verzögert wird und wir zügig beginnen können. (Beifall bei SPÖ und NEOS sowie bei Abgeordneten der FPÖ.)
Werte Kolleginnen und Kollegen! Es ist vom Ibiza-Untersuchungsausschuss so viel offengeblieben, und nicht nur das, sondern, was da ans Tageslicht gekommen ist, das kann man nicht einfach so liegen lassen und nicht weiter untersuchen wollen.
Ich freue mich, dass wir uns den Verfassungsgerichtshof ersparen können und sehr bald beginnen können. Ich verlange aber auch, dass wir sobald wie möglich mit der Reform der Geschäftsordnung beginnen – gleich parallel dazu, damit das auch transparent stattfinden kann. Her mit den Kameras! Die Öffentlichkeit ist interessiert, dass sie auch live dabei sein kann. Das geht wirklich schnell. Ich habe es von allen so vernommen, alle sind dafür, es gehört geändert, und Sie haben auch nichts gegen die Öffentlichkeit. (Abg. Hanger: Da waren aber andere Punkte auch dabei, Frau Kollegin!) – Sie können die Punkte alle mitnehmen! Das wäre für mich jetzt sehr wichtig. Was Ihnen wichtig ist, können Sie ja einbringen. Bringen Sie es ein, tun Sie nur! Sagen Sie nicht, wir haben
Punkte – machen Sie es gleich! (Abg. Hanger: Die habe ich schon zehnmal formuliert!) – Ja, aber jetzt bin ich dran! „Zehnmal formuliert“? Wo? Bringen Sie es ein! (Beifall bei der SPÖ sowie bei Abgeordneten von FPÖ und NEOS.) Bei wem haben Sie es formuliert? – Mir brauchen Sie es hier jetzt nicht zu sagen. Sie wissen schon, wo Sie es formulieren müssen. (Zwischenruf des Abg. Michael Hammer.) – Ah, Herr Hanger ist auch da (in Richtung Abg. Michael Hammer:) Ach nein, das ist Herr Hammer! (Heiterkeit bei der SPÖ sowie Heiterkeit des Abg. Hanger.)
Auf jeden Fall, werte Kolleginnen und Kollegen, ist es im Interesse der Republik, die Sümpfe, die hochgekommen sind, trockenzulegen. Wir sind bereit, die Opposition ist bereit. Und der ÖVP bleibt sowieso nichts anderes übrig, als mitzumachen, so, wie es jetzt ausschaut, aber wer weiß, was Frau Maurer und Herr Wöginger jetzt gerade aushecken. Ja (in Richtung Abg. Stögmüller), du brauchst gar nicht so zu schauen, du hast auch schon deine Erfahrungen gemacht. (Beifall bei der SPÖ.) Ich würde aufpassen. Ihr habt sehr gut mit uns bei der Aufklärung im Ibizaausschuss zusammengearbeitet, und ich freue mich schon auf die ersten Sitzungen. Was dabei noch rauskommen wird, wird uns noch lange beschäftigen. – Vielen Dank. (Beifall bei SPÖ und NEOS sowie bei Abgeordneten der FPÖ.)
19.42
Präsidentin Doris Bures: Herr Abgeordneter Christian Hafenecker. – Bitte.
Abgeordneter Christian Hafenecker, MA (FPÖ): Eigentlich habe ich gar kein Konzept, kein Papier am Tisch liegen gehabt, aber als Kollege Hanger mit seiner Rede begonnen hat, habe ich dann doch begonnen, mitzuschreiben, weil ich einfach auf ein paar Dinge eingehen muss.
Kollege Hanger, ich möchte vorausschicken, ich finde es nicht fair, dass man dich als Satireprojekt bezeichnet. Das ist absolut über das Ziel hinausgeschossen, das tut man nicht.
Du hast vorhin erwähnt, wie holprig das Einbringen des Verlangens zur Einsetzung des Untersuchungsausschusses abgelaufen sein soll. Die Holprigkeit möchte ich mit dir diskutieren, und zwar hast du da ja selber genug Anlass dafür geboten. Erinnere dich an deine interessante Pressekonferenz! Kollegin Schwarz schaut gleich weg, die hat ja auch eine interessante holprige Pressekonferenz gehalten. (Zwischenruf der Abg. Gabriela Schwarz.) Dann kommst ausgerechnet du daher und redest hier von Leaks, die ein Wahnsinn sind, und woher diese kommen. Ihr müsst doch einfach einmal hier zugeben, dass eure komischen Pressekonferenzen, die bis heute niemand nachvollziehen kann, nur dazu angetan waren, Leaks, die ihr selber in euren Behörden gehabt habt, zu vertuschen. Und ihr wolltet es den Medien in die Schuhe schieben. Das war doch der Grund für eure beiden Auftritte. Gebt es doch zu! (Beifall bei der FPÖ sowie bei Abgeordneten von SPÖ und NEOS.)
Kollege Hanger, dann wundert es mich wiederum nicht, wenn dir gegenüber solche harten Begriffe verwendet werden. Dann kommst du tatsächlich noch mit dem Begriff Gewaltentrennung daher! Na das werden wir morgen vielleicht sehen. Ich weiß ja gar nicht, ob sich der Sebastian überhaupt in das Plenum traut und sich angeloben lässt. Ich glaube es nämlich mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile wird der Groschen gefallen sein, und er wird sehen, dass das ein sinnloses Unterfangen ist.
Aber jemand, der jetzt in Schimpf und Schande als Bundeskanzler abdanken muss und sich morgen ins Parlament setzt – na das ist eine Auffassung von Gewaltentrennung! Zuerst noch in der Exekutive, jetzt möchte er in die Legislative, aber aus der Legislative heraus die Exekutive steuern, denn nichts anderes macht Herr Schallenberg dann in
seinem Auftrag, sollte das, was ihr jetzt vorhabt, auch umgesetzt werden. Bitte, bemüh du also nicht die Gewaltentrennung! (Beifall bei der FPÖ und bei Abgeordneten der SPÖ.)
Zurückkommend auf den Untersuchungsausschuss: Ich glaube, die Vorwürfe, die jetzt Platz greifen, über die jetzt medial berichterstattet wird, sind genau die Vorwürfe, die sich im letzten Untersuchungsausschuss bereits abgezeichnet haben. Wir haben bereits bemerkt, dass ihr euch einen tiefen Staat zurechtgerichtet habt. Wir haben gesehen, dass ihr ein Zwischengeschoß in der Republik eingezogen habt. Wir haben gesehen, dass ihr mit den Schalthebeln der Macht nicht umgehen könnt und dass ihr den ganzen Staat für eure Interessen missbraucht. Das war, ganz kurz gesagt, das Ergebnis des letzten Untersuchungsausschusses. Und genau deswegen, lieber Kollege Hanger, ist es nur die logische Konsequenz, jetzt herzugehen und genau diese Untersuchungen fortzuführen.
Ich kann es nicht mehr hören, dass ihr immer noch sagt: Die Vorwürfe sind falsch! Was braucht ihr denn noch als die SMS, die im Umlauf sind? Was braucht ihr denn noch als eigene Antworten, die der ehemalige Bundeskanzler Kurz von seinem Handy aus geschickt hat? Was braucht ihr denn noch dazu, dass ihr einfach einmal hergeht, euch bei der Bevölkerung entschuldigt und sagt, okay, jetzt machen wir einen Strich darunter (Zwischenruf bei der ÖVP), wir hören jetzt einmal mit diesem Tarnen und Täuschen auf!, das bei euch ständig irgendwie beheimatet ist? Warum sagt ihr nicht, wir entschuldigen uns bei der Bevölkerung, machen den Schaden so weit wie möglich gut und lösen das gemeinsam mit einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss? (Beifall bei der FPÖ sowie bei Abgeordneten von SPÖ und NEOS.)
Wenn die Vorwürfe alle falsch wären, stelle ich mir schon die Frage, warum auf einmal in den Ministerien bei Ihnen – und wir haben die Informationen dazu – die Schredder schon wieder auf Hochtouren laufen, warum Informationen an Mitarbeiter gegangen sind, man möge doch die E-Mail-Postfächer löschen. Warum werden bei Ihnen Akten vernichtet, wenn Sie nichts zu verbergen haben? Kollege Hanger, bitte stellen Sie sich beim nächsten Mal noch einmal heraus und erklären uns, warum diese Vorgänge gerade stattfinden, warum in Ministerien wirklich in klassischer ÖVP-Manier Akten vernichtet, geschreddert und im Prinzip auch Dinge verdunkelt werden! Das hätte ich gerne gewusst, und das ist der Auftrag. (Beifall bei der FPÖ und bei Abgeordneten der SPÖ.)
Ich sage Ihnen Folgendes: Es ist niemandem wohl dabei, so einen Untersuchungsausschuss einzubringen. Das können Sie mir glauben, weil ich aus eigener Erfahrung ganz genau weiß, dass Dinge ans Licht kommen, die unangenehm sind. Ich sagen Ihnen von der ÖVP aber auch: Es ist unsere verdammte Pflicht als Parlamentarier, wenn wir feststellen, dass in der Republik etwas schiefläuft, so einen Untersuchungsausschuss einzubringen.
Dieser Untersuchungsausschuss würde auch für die ÖVP die Möglichkeit bieten, das begangene Unrecht wiedergutzumachen. Die ÖVP müsste sich jetzt herstellen und sagen: Moment, wir hören jetzt einmal mit unseren taktischen Spielchen auf! Wir werden Sie nicht mit irgendwelchen komischen Geheimhaltungsakten bombardieren, sodass man die Statik im Parlament verstärken muss. Wir werden nicht irgendwelche Fristen ausnutzen, wir werden nicht zum Verfassungsgerichtshof laufen und schauen, dass so spät wie möglich mit den Untersuchungen begonnen werden kann, damit man auf der anderen Seite zum Aktenvernichten Zeit hat.
Darum bitte ich auch die Grünen. Auch die Grünen machen hoffentlich bei diesem Spielchen nicht mehr mit, dass man noch einmal im Sinne der ÖVP zum VfGH läuft, um unsere Untersuchungen zu unterbinden.
Wenn wir das schaffen und wenn die ÖVP aus ihrer Schockstarre erwacht ist und sich einmal dessen im Klaren ist, dass einfach Unrecht angerichtet worden ist, und zwar nicht
an Sebastian Kurz, sondern an der österreichischen Bevölkerung, und wenn ihr endlich einmal wieder wisst, was Parlamentarismus heißt und was wir diesem Staat schuldig sind, dann, Kollege Hanger, sind wir am richtigen Weg. Damit sollten wir jetzt beginnen! Ich fordere Sie dazu auf. (Beifall bei FPÖ, SPÖ und NEOS.)
19.46
Präsidentin Doris Bures: Als Nächste: Frau Abgeordnete Nina Tomaselli. – Bitte.
Abgeordnete Mag. Nina Tomaselli (Grüne): Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuseherinnen und Zuseher! Frau Kollegin Yılmaz, ich kann Sie beruhigen: Wir Grüne heißen diesen Untersuchungsausschuss im Hohen Haus recht herzlich willkommen! (Beifall bei den Grünen sowie bei Abgeordneten von SPÖ und NEOS. – Abg. Yılmaz macht eine Faust und streckt den Daumen nach oben.)
Was will ich damit sagen? – Selbstverständlich macht die Härte der Vorwürfe zur Meinungs-, zur Medienmanipulation, die im Raum stehen, die wir auch wirklich gut in den Akten dokumentiert sehen, eine umfassende Aufklärung notwendig. Das ist ja überhaupt nicht von der Hand zu weisen, und ich glaube auch, dass sich die Österreicherinnen und Österreicher jetzt auch erwarten, dass es eine umfassende parlamentarische Aufklärung gibt, die den Machenschaften rund um mutmaßliche Inseraten- und Umfragemanipulation und mutmaßlichen Steuergeldmissbrauch einfach auch nachgeht.
Die Vorgänge, die wir in den letzten Tagen zu Recht wirklich rauf und runter diskutiert haben – das habe ich schon gestern gesagt –, haben natürlich zwei Seiten. Das eine ist die strafrechtliche und das andere ist die politische Seite. Selbstverständlich gilt die Unschuldsvermutung, aber die Unschuldsvermutung gilt für die strafrechtliche Seite. Unschuldsvermutung ist und bleibt keine politische Kategorie, meine sehr geehrten Damen und Herren. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der SPÖ. – Zwischenrufe der Abgeordneten Hanger und Hörl.)
Die strafrechtliche Relevanz müssen die Ermittlungsbehörden und die unabhängige Justiz klären. Daneben gibt es auch eine politische Dimension, und da ist es selbstverständlich nur richtig und wichtig, dass sich das oberste Kontrollgremium dieses Hohen Hauses, unseres Hauses, der Vorwürfe annimmt und schaut, welche politischen Konsequenzen daraus gezogen werden müssen. – Wer, wenn nicht wir, das Parlament, meine sehr geehrten Damen und Herren?!
Wer, wenn nicht wir als Politik – und da versuche ich alle mitzunehmen – sind dazu aufgerufen, wirklich alles dafür zu tun, damit das Vertrauen nach diesen wirklich erschütternden Ereignissen für die ganze Republik wiederhergestellt wird? Wenn Sie an die Bevölkerung von Österreich denken, dürfen Sie nicht vergessen: Seit Ibiza sind nur zwei Jahre vergangen, und es gibt schon wieder das nächste innenpolitische Ereignis, das die Republik wirklich ins Wanken gebracht hat. Deshalb liegt es an uns allen, dafür wirklich alles in unserer Macht Stehende zu tun, um bei allen politischen Unterschieden zu zeigen, dass sich die Österreicherinnen und Österreicher auf ihre Politikerinnen und Politiker verlassen können, meine sehr geehrten Damen und Herren. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der NEOS.)
Das können wir, finde ich, am besten zeigen, indem wir seriöse Aufklärungs- und Kontrollarbeit leisten – das ist eine vertrauensbildende Maßnahme. Jeder Parlamentarier und jede Parlamentarierin, im Übrigen egal von welcher Fraktion und unabhängig von der Betroffenheit, ist eingeladen, in diesem Untersuchungsausschuss einen Beitrag zu dieser Vertrauensrückholaktion zu leisten. Schließlich steht die Aufklärung wirklich im Zentrum unserer Arbeit als Parlamentarierinnen und Parlamentarier; sie gehört zum politischen Reinigungsprozess, der derzeit wirklich wahnsinnig wichtig ist.
Die Kontrolle ist notwendig, denn die Aufklärung darf keinen Schritt zur Seite machen, meine sehr geehrten Damen und Herren (Beifall bei Grünen, SPÖ und NEOS) – und wir Grüne werden selbstverständlich auch in diesem Untersuchungsausschuss wieder mit bestem Wissen und Gewissen und größter Gründlichkeit die Aufklärungsarbeit unterstützen. Wir werden nicht weniger unbequem sein als schon beim Ibiza-Untersuchungsausschuss und unseren Beitrag leisten, wenn es darum geht, auch die finstersten Ecken in dieser Republik auszuleuchten. – Vielen Dank. (Beifall bei Grünen, SPÖ und NEOS.)
19.51
Präsidentin Doris Bures: Als Nächste zu Wort gelangt Frau Abgeordnete Stephanie Krisper. – Bitte.
Abgeordnete Dr. Stephanie Krisper (NEOS): Liebe Grüne, es freut mich, dass ihr den Untersuchungsausschuss herzlich willkommen heißt. Ich möchte auch noch bedauernd fragen, ob es im Sinne der Aufklärung nicht gut gewesen wäre, wenn wir den Untersuchungsausschuss noch laufen hätten. Hätte nicht gerade der Ibiza-U-Ausschuss ab heute oder eigentlich schon seit Wochen eine wichtige Arbeit leisten können? Ist derzeit nicht eh schon genug los, wo wir sagen, es macht nun wirklich einen Unterschied, ob wir verlängert hätten oder, wie Sigi Maurer meinte: Dann richtet halt wieder einen ein? – Wir können nun bis Anfang des nächsten Jahres unsere Arbeit mit Sitzungen und Befragungen nicht aufnehmen. Da vergehen Monate.
Wir schließen uns dem Angebot von Kollegen Krainer an, unsere Aufklärung finalisieren zu wollen – ein halbes Jahr, wenn wir dabei von allen Parteien entsprechende Kooperation erleben. Neu wäre das vonseiten der ÖVP, wir bleiben optimistisch.
Warum richtet sich der Fokus in diesem Ausschuss auf Korruption und auf die türkise ÖVP? – Das ist wahrscheinlich schon die rhetorischste Frage der Nation, ich führe dennoch aus: In diesem Land gibt es leider ausreichend Themen für Untersuchungsausschüsse; für uns NEOS gilt aber immer, dass die Untersuchung von Missständen, die noch bestehen und deren Verursacher und Verursacherinnen noch an den Schalthebeln sitzen, am wichtigsten und prioritär ist (Heiterkeit bei Abgeordneten der FPÖ), denn da besteht die Gefahr, dass weiterhin politisch zutiefst verantwortungsloses Verhalten gesetzt und fortgesetzt werden kann. Wir wollen nicht mehr erleben – und ich glaube, niemand in Österreich will das noch einmal erleben –, dass Kinderbetreuung aus purer persönlicher Machtgier verhindert wird (Beifall bei NEOS, SPÖ und Grünen), dass die kalte Progression aus purem Egoismus nicht abgeschafft wird, dass sich jemand Medien kauft und Wahlen kauft, dann versucht, die Justiz daran zu hindern, dies aufzuklären, und versucht, da zu vertuschen.
Wir erinnern uns nämlich an die multiplen Verdachtslagen, auch daran, dass Hausdurchsuchungen und andere Zwangsmaßnahmen über das türkise Innenministerium verraten wurden. Wer hat dies alles getan und versucht, es zu vertuschen, in dieser noch nie da gewesenen Art und Weise, und ist noch immer da? Auf wen müssen wir uns konzentrieren? – Auf das türkise System. Das gehört klar herausgearbeitet, dessen Korrumpierung unserer Demokratie gehört klar aufgezeigt – und zwar abseits des Strafrechts, Herr Kollege Hanger.
Darum geht es Ihnen doch auch im Grunde, liebe Kolleginnen und Kollegen von der ÖVP: um Politik, die höhere Anforderungen an sich stellt als die strafrechtlichen Maßstäbe, nämlich um anständige Politik. Es ist von unschätzbarem Wert, in diesem U-Ausschuss für eine Politik der sauberen Hände, für das Wohl der Österreicherinnen und Österreicher zu arbeiten; und das ist aus der Sicht von uns NEOS die Verantwortung, die wir hier im Parlament eingehen möchten und der wir nachgehen wollen. (Beifall bei NEOS, SPÖ und Grünen.)
19.54
Präsidentin Doris Bures: Zu Wort ist dazu nun niemand mehr gemeldet.
Die Debatte ist geschlossen.
Gemäß § 33 Abs. 6 der Geschäftsordnung weise ich das Verlangen 4/US auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses betreffend „Klärung von Korruptionsvorwürfen gegen ÖVP-Regierungsmitglieder (ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss)“ dem Geschäftsordnungsausschuss zu.
Präsidentin Doris Bures: Ich gebe bekannt, dass in der heutigen Sitzung die Selbständigen Anträge 1948/A(E) bis 1980/A(E) eingebracht worden sind.
*****
Die nächste Sitzung des Nationalrates, die geschäftsordnungsmäßige Mitteilungen und Zuweisungen betreffen wird, berufe ich für 19.55 Uhr – das ist gleich im Anschluss an diese Sitzung – ein.
Diese Sitzung ist geschlossen.
Schluss der Sitzung: 19.55 Uhr
|
Impressum: Parlamentsdirektion 1017 Wien |