
Plenarsitzung
des Nationalrates
241. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich
Freitag, 24. November 2023
XXVII. Gesetzgebungsperiode
Nationalratssaal

Plenarsitzung
des Nationalrates
241. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich
Freitag, 24. November 2023
XXVII. Gesetzgebungsperiode
Nationalratssaal
Stenographisches Protokoll
241. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich
XXVII. Gesetzgebungsperiode Freitag, 24. November 2023
Dauer der Sitzung
Freitag, 24. November 2023: 9.05 – 16.38 Uhr
*****
Tagesordnung
1. Punkt: Bericht des Rechnungshofes betreffend COVID-19-Maßnahmen für Kunstschaffende sowie Kulturvermittlerinnen und -vermittler – Reihe BUND 2022/25
2. Punkt: Bericht des Rechnungshofes betreffend Neue Formen der Kulturvermittlung aufgrund der COVID-19-Pandemie – Reihe BUND 2023/8
3. Punkt: Bericht des Rechnungshofes betreffend Allgemeiner Einkommensbericht 2022 – Reihe Einkommen 2022/1
4. Punkt: Bericht des Rechnungshofes betreffend AustriaTech – Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH; Follow-up-Überprüfung – Reihe BUND 2022/33
5. Punkt: Bericht des Rechnungshofes betreffend Nationalpark Hohe Tauern – Reihe BUND 2023/18
6. Punkt: Bericht des Rechnungshofes betreffend Verpackungsabfälle aus Kunststoff – Reihe BUND 2022/36
7. Punkt: Bericht des Rechnungshofes betreffend Eisenbahnkreuzungen – Reihe BUND 2023/23
8. Punkt: Bericht des Rechnungshofes betreffend Ökostromförderung am Beispiel Windkraft und Photovoltaik – Reihe BUND 2020/15
9. Punkt: Bericht des Rechnungshofes betreffend Luftverschmutzung durch Verkehr – ausgewählte Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität – Reihe BUND 2021/7
10. Punkt: Bericht des Rechnungshofes betreffend Anpassung an den Klimawandel in der Stadt Linz – Reihe BUND 2021/27
11. Punkt: Bericht des Rechnungshofes betreffend Flughafen Wien – Umbau und Erweiterung Terminal 3 – Reihe BUND 2021/41
12. Punkt: Bericht des Rechnungshofes betreffend MeteoServe Wetterdienst GmbH – nunmehr Austro Control Digital Services GmbH – Reihe BUND 2022/40
13. Punkt: Bericht des Rechnungshofes betreffend Straßenbahnprojekte Graz, Innsbruck, Linz – Reihe BUND 2023/9
14. Punkt: Sammelbericht über die Petitionen Nr. 66, 70, 72, 79, 92, 95, 111, 116, 118 und 120 bis 122 sowie über die Bürgerinitiativen Nr. 41, 43, 52 und 54
15. Punkt: Bericht über den Antrag 3666/A(E) der Abgeordneten Dr. Reinhold Lopatka, Petra Bayr, MA MLS, Dr. Ewa Ernst-Dziedzic, Dr. Nikolaus Scherak, MA, Kolleginnen und Kollegen betreffend Terrorangriff der Hamas auf Israel
16. Punkt: Bericht über den Antrag 3370/A(E) der Abgeordneten Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen betreffend Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler
17. Punkt: Bericht über den Antrag 3655/A der Abgeordneten Mag. Ernst Gödl, Bedrana Ribo, MA, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundespflegegeldgesetz und das Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz geändert werden
18. Punkt: Bericht über den Antrag 3654/A der Abgeordneten Tanja Graf, Mag. Markus Koza, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Nachtschwerarbeitsgesetz geändert wird
19. Punkt: Bundesgesetz zur Unterstützung von Rettungs- und Zivilschutzorganisationen (Rettungs- und Zivilschutzorganisationen-Unterstützungsgesetz)
20. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Meldegesetz 1991, das Personenstandsgesetz 2013 und das Namensänderungsgesetz geändert werden
21. Punkt: Vereinbarung zwischen dem Bund und dem Land Wien gemäß Artikel 15a BVG, mit der die Verrechnung der Differenzbeträge zwischen den Kostenhöchstsätzen der Grundversorgungsvereinbarung – Art. 15a B-VG und den tatsächlich entstandenen Kosten für sämtliche in organisierten Unterkünften untergebrachten Personen inklusive der Unterbringung, Versorgung und Betreuung von vulnerablen Personengruppen ermöglicht werden soll (Realkostenverrechnungsvereinbarung Bund – Wien)
22. Punkt: Bericht über den Antrag 3292/A der Abgeordneten Mag. (FH) Kurt Egger, Mag. Eva Blimlinger, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die Förderung des qualitätsvollen Journalismus in Medien des Print- und Online-Bereichs erlassen wird und das Presseförderungsgesetz 2004 sowie das KommAustria-Gesetz geändert werden
23. Punkt: Bericht über den Antrag 3537/A der Abgeordneten Mag. Martin Engelberg, Mag. Eva Blimlinger, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über den Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus und das Bundesgesetz über die
Einrichtung des Fonds zur Instandsetzung der jüdischen Friedhöfe in Österreich geändert werden
24. Punkt: Bericht und Antrag über den Entwurf einer Änderung des Bundesgesetzes über die Rückgabe von Kunstgegenständen und sonstigem beweglichem Kulturgut aus den österreichischen Bundesmuseen und Sammlungen und aus dem sonstigen Bundeseigentum (Kunstrückgabegesetz – KRG)
*****
Inhalt
Personalien
Verhinderungen ...................................................................................................... 29
Geschäftsbehandlung
Redezeitbeschränkung nach Beratung in der Präsidialkonferenz gemäß § 57 Abs. 5 GOG ............................................................................................................. 32
Verlangen der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Christian Hafenecker, MA, Kolleginnen und Kollegen gemäß § 33 Abs. 1 GOG auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses betreffend „Zwei-Klassen-Verwaltung wegen Bevorzugung von Milliardären durch ÖVP-Regierungsmitglieder (COFAG-Untersuchungsausschuss)“ (6/US) ....................................................................... 176
Verlangen gemäß § 33 Abs. 4 GOG auf Durchführung einer kurzen Debatte im Sinne des § 57a Abs. 1 GOG ............................................................................ 176
Redner:innen:
Kai Jan Krainer ......................................................................................................... 337
Mag. Andreas Hanger .............................................................................................. 340
Dr. Christoph Matznetter ........................................................................................ 343
Christian Hafenecker, MA ....................................................................................... 346
Mag. Nina Tomaselli ................................................................................................ 349
Dr. Nikolaus Scherak, MA ....................................................................................... 351
Zuweisung des Verlangens 6/US auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses an den Geschäftsordnungsausschuss ................. 355
Verlangen der Abgeordneten Mag. Andreas Hanger, Kolleginnen und Kollegen gemäß § 33 Abs. 1 GOG auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses betreffend „Aufklärung, ob öffentliche Gelder im Bereich der Vollziehung des Bundes aus sachfremden Motiven zweckwidrig verwendet wurden (‚Rot-Blauer Machtmissbrauch-Untersuchungsausschuss‘)“ (7/US) ....................................................................................................... 283
Zuweisung des Verlangens 7/US auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses an den Geschäftsordnungsausschuss ................. 355
Ausschüsse
Zuweisungen ................................................................................... 29, 355, 355
Verhandlungen
Gemeinsame Beratung über
1. Punkt: Bericht des Rechnungshofausschusses über den Bericht des Rechnungshofes betreffend COVID-19-Maßnahmen für Kunstschaffende sowie Kulturvermittlerinnen und ‑vermittler – Reihe BUND 2022/25 (III‑722/2256 d.B.) .................................................................................................. 32
2. Punkt: Bericht des Rechnungshofausschusses über den Bericht des Rechnungshofes betreffend Neue Formen der Kulturvermittlung aufgrund der COVID-19-Pandemie – Reihe BUND 2023/8 (III-900/2258 d.B.) ........... 32
Redner:innen:
Hans Stefan Hintner ................................................................................................ 33
Gabriele Heinisch-Hosek ......................................................................................... 34
Dr. Dagmar Belakowitsch ....................................................................................... 36
Mag. Eva Blimlinger ................................................................................................. 37
Mag. Julia Seidl ........................................................................................................ 38
Rechnungshofpräsidentin Dr. Margit Kraker ......................................................... 40
Kenntnisnahme der beiden Berichte III-722 und III-900 d.B. .......................... 42
3. Punkt: Bericht des Rechnungshofausschusses über den Bericht des Rechnungshofes betreffend Allgemeiner Einkommensbericht 2022 – Reihe Einkommen 2022/1 (III-792/2257 d.B.) .............................................................. 43
Redner:innen:
Martina Kaufmann, MMSc BA ................................................................................ 43
Mag. Karin Greiner .................................................................................................. 45
Wolfgang Zanger ..................................................................................................... 47
Christoph Stark (tatsächliche Berichtigung) ......................................................... 50
Dr. Elisabeth Götze .................................................................................................. 51
Mag. Gerald Loacker ................................................................................................ 52
Rechnungshofpräsidentin Dr. Margit Kraker ......................................................... 54
Peter Schmiedlechner .............................................................................................. 58
Kenntnisnahme des Berichtes III-792 d.B. .......................................................... 59
Gemeinsame Beratung über
4. Punkt: Bericht des Rechnungshofausschusses über den Bericht des Rechnungshofes betreffend AustriaTech – Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH; Follow-up-Überprüfung – Reihe BUND 2022/33 (III-793/2273 d.B.) .................................................................... 60
5. Punkt: Bericht des Rechnungshofausschusses über den Bericht des Rechnungshofes betreffend Nationalpark Hohe Tauern – Reihe BUND 2023/18 (III-982/2274 d.B.) ................................................................................. 60
Redner:innen:
Martina Kaufmann, MMSc BA ................................................................................ 60
Mag. Karin Greiner .................................................................................................. 62
Peter Schmiedlechner .............................................................................................. 64
Ulrike Maria Böker ................................................................................................... 65
Rechnungshofpräsidentin Dr. Margit Kraker ......................................................... 67
MMMag. Gertraud Salzmann ................................................................................. 69
Kenntnisnahme der beiden Berichte III-793 und III-982 d.B. .......................... 72
Gemeinsame Beratung über
6. Punkt: Bericht des Rechnungshofausschusses über den Bericht des Rechnungshofes betreffend Verpackungsabfälle aus Kunststoff – Reihe BUND 2022/36 (III-804/2275 d.B.) .................................................................... 72
7. Punkt: Bericht des Rechnungshofausschusses über den Bericht des Rechnungshofes betreffend Eisenbahnkreuzungen – Reihe BUND 2023/23 (III-1013/2276 d.B.) ............................................................................................... 72
8. Punkt: Bericht des Rechnungshofausschusses über den Bericht des Rechnungshofes betreffend Ökostromförderung am Beispiel Windkraft und Photovoltaik – Reihe BUND 2020/15 (III126/2277 d.B.) ....................... 73
9. Punkt: Bericht des Rechnungshofausschusses über den Bericht des Rechnungshofes betreffend Luftverschmutzung durch Verkehr – ausgewählte Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität – Reihe BUND 2021/7 (III-245/2278 d.B.) ................................................................................... 73
10. Punkt: Bericht des Rechnungshofausschusses über den Bericht des Rechnungshofes betreffend Anpassung an den Klimawandel in der Stadt Linz – Reihe BUND 2021/27 (III372/2279 d.B.) .............................................. 73
11. Punkt: Bericht des Rechnungshofausschusses über den Bericht des Rechnungshofes betreffend Flughafen Wien – Umbau und Erweiterung Terminal 3 – Reihe BUND 2021/41 (III488/2280 d.B.) .................................. 73
12. Punkt: Bericht des Rechnungshofausschusses über den Bericht des Rechnungshofes betreffend MeteoServe Wetterdienst GmbH – nunmehr Austro Control Digital Services GmbH – Reihe BUND 2022/40 (III‑820/2281 d.B.) .................................................................................................. 73
13. Punkt: Bericht des Rechnungshofausschusses über den Bericht des Rechnungshofes betreffend Straßenbahnprojekte Graz, Innsbruck, Linz – Reihe BUND 2023/9 (III-906/2282 d.B.) ............................................................ 73
Redner:innen:
Hermann Gahr ......................................................................................................... 74
Mag. Ruth Becher .................................................................................................... 75
Alois Kainz ................................................................................................................ 76
Ulrike Maria Böker ................................................................................................... 78
Douglas Hoyos-Trauttmansdorff ............................................................................ 80
Rechnungshofpräsidentin Dr. Margit Kraker ......................................................... 82
Andreas Kühberger .................................................................................................. 85
Alois Stöger, diplômé ............................................................................................... 87
Christian Lausch ...................................................................................................... 88
Ing. Martin Litschauer ............................................................................................. 91
Hermann Weratschnig, MBA MSc .......................................................................... 92
Kenntnisnahme der acht Berichte III-804, III-1013, III-126, III-245, III-372, III-488, III-820 und III-906 d.B. ............................................................................. 94
14. Punkt: Sammelbericht des Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen über die Petitionen Nr. 66, 70, 72, 79, 92, 95, 111, 116, 118 und 120 bis 122 sowie über die Bürgerinitiativen Nr. 41, 43, 52 und 54 (2237 d.B.) ............................................................................................................... 96
Redner:innen:
Andreas Kollross ...................................................................................................... 96
Hans Stefan Hintner ................................................................................................ 97
Petra Wimmer .......................................................................................................... 100
Christian Ries ........................................................................................................... 101
Rudolf Silvan ............................................................................................................ 104
Mag. Ulrike Fischer .................................................................................................. 106
Michael Seemayer .................................................................................................... 109
Fiona Fiedler, BEd .................................................................................................... 110
Dipl.-Ing. Andrea Holzner ........................................................................................ 112
Christian Lausch ...................................................................................................... 113
Hermann Weratschnig, MBA MSc .......................................................................... 115
Andreas Minnich ...................................................................................................... 117
Mag. Sibylle Hamann ............................................................................................... 118
Joachim Schnabel .................................................................................................... 120
Kenntnisnahme des Ausschussberichtes 2237 d.B. hinsichtlich der Petitionen Nr. 66, 70, 72, 79, 92, 95, 111, 116, 118 und 120 bis 122 sowie der Bürgerinitiativen Nr. 41, 43, 52 und 54 ........................................................ 122
15. Punkt: Bericht des Außenpolitischen Ausschusses über den Antrag 3666/A(E) der Abgeordneten Dr. Reinhold Lopatka, Petra Bayr, MA MLS, Dr. Ewa Ernst-Dziedzic, Dr. Nikolaus Scherak, MA, Kolleginnen und Kollegen betreffend Terrorangriff der Hamas auf Israel (2290 d.B.) ............................................................................................................... 123
Redner:innen:
Dr. Reinhold Lopatka ............................................................................................... 123
Dr. Christoph Matznetter ........................................................................................ 126
Dr. Susanne Fürst ..................................................................................................... 128
Dr. Ewa Ernst-Dziedzic ............................................................................................ 132
Dr. Helmut Brandstätter ......................................................................................... 134
Bundesminister Mag. Alexander Schallenberg, LL.M. ........................................... 137
Mag. Bettina Rausch-Amon .................................................................................... 140
Petra Bayr, MA MLS ................................................................................................ 144
Mag. Muna Duzdar .................................................................................................. 146
Mag. Martin Engelberg ............................................................................................ 148
Annahme der dem schriftlichen Ausschussbericht 2290 d.B. beigedruckten Entschließung betreffend „Terrorangriff der Hamas auf Israel“ (348/E) ........ 152
16. Punkt: Bericht des Außenpolitischen Ausschusses über den Antrag 3370/A(E) der Abgeordneten Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen betreffend Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler (2291 d.B.) ............................................................................................ 152
Redner:innen:
Peter Wurm ............................................................................................. 152, 163
Hermann Gahr ......................................................................................................... 155
Mag. Gerald Hauser ................................................................................................. 156
Mag. Selma Yildirim ................................................................................................. 158
Dr. Reinhold Lopatka ............................................................................................... 160
Alexander Melchior .................................................................................................. 162
Hermann Weratschnig, MBA MSc .......................................................................... 165
Kenntnisnahme des Ausschussberichtes 2291 d.B. .......................................... 167
17. Punkt: Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 3655/A der Abgeordneten Mag. Ernst Gödl, Bedrana Ribo, MA, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundespflegegeldgesetz und das Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz geändert werden (2283 d.B.) ......................................................................................... 167
Redner:innen:
Mag. Verena Nussbaum .......................................................................................... 167
Mag. Michael Hammer ............................................................................................ 169
Mag. Christian Ragger ............................................................................................. 170
Bedrana Ribo, MA .................................................................................................... 171
Fiona Fiedler, BEd .................................................................................................... 173
Annahme des Gesetzentwurfes in 2283 d.B. ..................................................... 174
18. Punkt: Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 3654/A der Abgeordneten Tanja Graf, Mag. Markus Koza, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Nachtschwerarbeitsgesetz geändert wird (2284 d.B.) ...................................... 174
Redner:innen:
Mag. Gerald Loacker ................................................................................................ 175
Tanja Graf ................................................................................................................. 226
Dietmar Keck ........................................................................................................... 227
Dr. Dagmar Belakowitsch ....................................................................................... 229
Bettina Zopf ............................................................................................................. 230
Annahme des Gesetzentwurfes in 2284 d.B. ..................................................... 231
19. Punkt: Bericht des Ausschusses für innere Angelegenheiten über die Regierungsvorlage (2177 d.B.): Bundesgesetz zur Unterstützung von Rettungs- und Zivilschutzorganisationen (Rettungs- und Zivilschutzorganisationen-Unterstützungsgesetz) (2287 d.B.) ...................................................... 232
Redner:innen:
Mag. Andreas Hanger .............................................................................................. 232
Klaus Köchl ............................................................................................................... 235
Maximilian Linder .................................................................................................... 237
David Stögmüller ..................................................................................................... 238
Dr. Stephanie Krisper .............................................................................................. 240
Bundesminister Mag. Gerhard Karner .................................................................... 241
Eva-Maria Himmelbauer, BSc ................................................................................. 243
Mario Lindner ........................................................................................................... 245
Annahme des Gesetzentwurfes in 2287 d.B. ..................................................... 248
20. Punkt: Bericht des Ausschusses für innere Angelegenheiten über die Regierungsvorlage (2202 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Meldegesetz 1991, das Personenstandsgesetz 2013 und das Namensänderungsgesetz geändert werden (2288 d.B.) .................................................................... 248
Redner:innen:
Christian Oxonitsch ................................................................................................. 249
Mag. Faika El-Nagashi ............................................................................................. 250
Ing. Manfred Hofinger ............................................................................................. 251
Mag. Ulrike Fischer .................................................................................................. 256
Annahme des Gesetzentwurfes in 2288 d.B. ..................................................... 257
21. Punkt: Bericht des Ausschusses für innere Angelegenheiten über die Regierungsvorlage (2272 d.B.): Vereinbarung zwischen dem Bund und dem Land Wien gemäß Artikel 15a BVG, mit der die Verrechnung der Differenzbeträge zwischen den Kostenhöchstsätzen der Grundversorgungsvereinbarung – Art. 15a B-VG und den tatsächlich entstandenen Kosten für sämtliche in organisierten Unterkünften untergebrachten Personen inklusive der Unterbringung, Versorgung und Betreuung von vulnerablen Personengruppen ermöglicht werden soll (Realkostenverrechnungsvereinbarung Bund – Wien) (2289 d.B.) .................. 258
Redner:innen:
Christian Lausch ...................................................................................................... 258
Mag. Ernst Gödl ....................................................................................................... 259
Dietmar Keck ........................................................................................................... 262
Mag. Georg Bürstmayr ............................................................................................ 263
Bundesminister Mag. Gerhard Karner .................................................................... 265
Genehmigung der Vereinbarung in 2289 d.B. .................................................... 268
22. Punkt: Bericht des Verfassungsausschusses über den Antrag 3292/A der Abgeordneten Mag. (FH) Kurt Egger, Mag. Eva Blimlinger, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die Förderung des qualitätsvollen Journalismus in Medien des Print- und Online-Bereichs erlassen wird und das Presseförderungsgesetz 2004 sowie das KommAustria-Gesetz geändert werden (2012 d.B.) ................................... 268
Redner:innen:
Henrike Brandstötter ............................................................................................... 269
Mag. (FH) Kurt Egger ............................................................................................... 272
Mag. Muna Duzdar .................................................................................................. 274
Mag. Eva Blimlinger ................................................................................................. 276
Bundesministerin MMag. Dr. Susanne Raab ......................................................... 281
Mag. Jörg Leichtfried ............................................................................................... 313
Annahme des Gesetzentwurfes in 2012 d.B. ..................................................... 315
Gemeinsame Beratung über
23. Punkt: Bericht des Verfassungsausschusses über den Antrag 3537/A der Abgeordneten Mag. Martin Engelberg, Mag. Eva Blimlinger, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über den Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus und das Bundesgesetz über die Einrichtung des Fonds zur Instandsetzung der jüdischen Friedhöfe in Österreich geändert werden (2301 d.B.) ............................................................................................................... 316
24. Punkt: Bericht und Antrag des Verfassungsausschusses über den Entwurf einer Änderung des Bundesgesetzes über die Rückgabe von Kunstgegenständen und sonstigem beweglichem Kulturgut aus den österreichischen Bundesmuseen und Sammlungen und aus dem sonstigen Bundeseigentum (Kunstrückgabegesetz – KRG) (2302 d.B.) ........................... 316
Redner:innen:
Mag. Martin Engelberg ............................................................................................ 316
Mag. Jörg Leichtfried ............................................................................................... 322
Mag. Harald Stefan .................................................................................................. 324
Mag. Eva Blimlinger ................................................................................................. 325
Dr. Nikolaus Scherak, MA ....................................................................................... 328
Mag. Michaela Steinacker ....................................................................................... 330
Sabine Schatz ........................................................................................................... 332
Annahme der beiden Gesetzentwürfe in 2301 und 2302 d.B. ........................ 335
Eingebracht wurden
Regierungsvorlagen ............................................................................................... 30
2318: Vereinbarung zwischen dem Bund und dem Land Wien gemäß Art. 15a B-VG über die Verwaltungsüberprüfung des Projekts „INTERACT Office Vienna 2021-2027“ durch das Land Wien als Kontrollinstanz gemäß Art. 46 Abs. 3 der Interreg-Verordnung
2319: Gemeinnützigkeitsreformgesetz 2023 – GemRefG 2023
2320: Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2023 – GesRÄG 2023
2321: Start-Up-Förderungsgesetz
2322: Mindestbesteuerungsreformgesetz – MinBestRefG
Anträge der Abgeordneten
Eva-Maria Himmelbauer, BSc, Süleyman Zorba, Kolleginnen und Kollegen betreffend die Sicherstellung des reibungslosen Breitbandausbaus (3738/A)(E)
Elisabeth Feichtinger, BEd BEd, Kolleginnen und Kollegen betreffend es braucht mehr Transparenz und konkretere Vorgaben für waldbezogene Förderungen (3739/A)(E)
Dr. Christoph Matznetter, Kolleginnen und Kollegen betreffend Maßnahmenbericht zur Inflationsdämpfung bei Wohnen, Energie und Lebensmittel (3740/A)(E)
Lukas Hammer, Tanja Graf, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz und das Ökostromgesetz 2012 geändert werden (3741/A)
Tanja Graf, Lukas Hammer, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz über einen Zweckzuschuss an die Länder für die Jahre 2024 und 2025 zur Beibehaltung der Förderung für den Umstieg auf klimafreundliche Heizungen (Heizungsumstiegs-Zweckzuschussgesetz – HeUZG) (3742/A)
August Wöginger, Bedrana Ribo, MA, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz und das Allgemeine Pensionsgesetz geändert werden (3743/A)
Mag. Ulrike Fischer, Mag. Peter Weidinger, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Prüfung eines Maßnahmenpakets gegen problematische Praktiken bei Online-Games“ (3744/A)(E)
Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen betreffend rasche und gezielte Maßnahmen für unsere Jugend – Umsetzung Jugendstrategie jetzt (3745/A)(E)
Mag. Gerhard Kaniak, Kolleginnen und Kollegen betreffend Echte Gesundheitsreform statt Verschlimmbesserung der Strukturen und der Versorgung im österreichischen Gesundheitswesen jetzt! (3746/A)(E)
Petra Steger, Kolleginnen und Kollegen betreffend Ausdehnung der Täglichen Bewegungseinheit auf ganz Österreich (3747/A)(E)
Mag. Selma Yildirim, Kolleginnen und Kollegen betreffend statistische Erfassung von misogyner Gewalt und Frauenhass durch Sicherheitsbehörden (3748/A)(E)
Sabine Schatz, Kolleginnen und Kollegen betreffend Parlamentarische Kontrolle für „LEA – Let’s Empower Austria“ (3749/A)(E)
Mag. Christian Drobits, Kolleginnen und Kollegen betreffend verbindliche Vorgaben für an Kinder gerichtetes Lebensmittelmarketing (3750/A)(E)
Mag. Christian Drobits, Kolleginnen und Kollegen betreffend verbindliche Vorgaben für an Kinder gerichtetes Lebensmittelmarketing (3751/A)(E)
Mag. Christian Drobits, Kolleginnen und Kollegen betreffend verbindliche Vorgaben für an Kinder gerichtetes Lebensmittelmarketing (3752/A)(E)
Norbert Sieber, Barbara Neßler, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Kinderbetreuungsgeldgesetz geändert wird (3753/A)
Mag. Michaela Steinacker, Mag. Agnes Sirkka Prammer, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch geändert wird (Abstammungsrechts-Anpassungsgesetz 2023 – AbAG 2023) (3754/A)
Mag. Michaela Steinacker, Mag. Agnes Sirkka Prammer, Kolleginnen und Kollegen betreffend Einrichtung eines zentralen Registers über Samen- und Eizellspenden (3755/A)(E)
Katharina Kucharowits, Kolleginnen und Kollegen betreffend es braucht eine umfassende, nachhaltige und geschlechtergerechte Friedensarbeit (3756/A)(E)
Katharina Kucharowits, Kolleginnen und Kollegen betreffend es braucht eine umfassende, nachhaltige und geschlechtergerechte Friedensarbeit (3757/A)(E)
Petra Bayr, MA MLS, Kolleginnen und Kollegen betreffend Steuergerechtigkeit auch auf internationaler Ebene forcieren (3758/A)(E)
Petra Bayr, MA MLS, Kolleginnen und Kollegen betreffend Steuergerechtigkeit auch auf internationaler Ebene forcieren (3759/A)(E)
Dr. Werner Saxinger, MSc, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Ärztegesetz 1998, das Zahnärztekammergesetz und das Tierärztekammergesetz geändert werden (3760/A)
Dr. Josef Smolle, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über finanzielle Maßnahmen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit von Arzneimitteln erlassen und das Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz geändert wird (3761/A)
Dr. Josef Smolle, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arzneimittelgesetz geändert wird (3762/A)
Werner Herbert, Kolleginnen und Kollegen betreffend Pensionsrechtliche Verbesserungen für Exekutivbedienstete (3763/A)(E)
Werner Herbert, Kolleginnen und Kollegen betreffend besserer Schutz im Disziplinarrecht (3764/A)(E)
Werner Herbert, Kolleginnen und Kollegen betreffend Finanzielle Verbesserungen für die Exekutive (3765/A)(E)
Werner Herbert, Kolleginnen und Kollegen betreffend Schutz des Beamten bei der Diensterfüllung (3766/A)(E)
Herbert Kickl, Kolleginnen und Kollegen betreffend Ausbau der direkten Demokratie in Österreich (3767/A)(E)
Dietmar Keck, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, dem das Bundesgesetz über den Schutz der Tiere (Tierschutzgesetz – TSchG) geändert wird (3768/A)
Petra Steger, Kolleginnen und Kollegen betreffend kostenlose Schwimmkurse für unsere Kinder (3769/A)(E)
Dr. Susanne Fürst, Kolleginnen und Kollegen betreffend Ablehnung des „WHO-Pandemievertrags“ sowie der novellierten Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) (3770/A)(E)
Walter Rauch, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz zur Abschaffung der CO2-Bepreisung, mit dem das Nationale Emissionszertifikatehandelsgesetz 2022, BGBl. I Nr. 10/2022, zuletzt geändert mit BGBl. I Nr. 110/2023, geändert wird (3771/A)
Mag. Gerald Hauser, Kolleginnen und Kollegen betreffend Umsetzung einer Borkenkäferstrategie und finanzielle Sofortmaßnahmen (3772/A)(E)
Peter Schmiedlechner, Kolleginnen und Kollegen betreffend Nein zum Inverkehrbringen von Laborfleisch (3773/A)(E)
Tanja Graf, Hermann Weratschnig, MBA MSc, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Ausländerbeschäftigungsgesetz und das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz geändert werden (3774/A)
Mag. Christian Drobits, Kolleginnen und Kollegen betreffend mangelnder Eingriff bei den Treibstoffpreisen – die Bundesregierung schädigt KonsumentInnen zu Gunsten der Konzerne (3775/A)(E)
Tanja Graf, Lukas Hammer, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die befristete Einführung eines Stromkostenzuschusses für Haushaltskundinnen und Haushaltskunden (Stromkostenzuschussgesetz – SKZG) geändert wird (3776/A)
Karlheinz Kopf, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Umsatzsteuergesetz 1994, das Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992, das Elektrizitätsabgabegesetz, das Erdgasabgabegesetz, das Kohleabgabegesetz und die Bundesabgabenordnung geändert werden (3777/A)
Tanja Graf, Lukas Hammer, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Emissionszertifikategesetz 2011 (EZG 2011) geändert und ein Bundesgesetz über den Vollzug des Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM-Vollzugsgesetz 2023 – CBAM-VG 2023) erlassen wird (3778/A)
Anfragen der Abgeordneten
Katharina Kucharowits, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend „Staatenlose Kinder“ (16922/J)
Christian Oxonitsch, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung betreffend Einladungspolitik bei medienöffentlichen Schulbesuchen des Bildungsministers (16923/J)
Mag. Eva Blimlinger, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Schändungen an Gedenkstätten und antisemitische Vorfälle (16924/J)
Mag. Yannick Shetty, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend Daten zu Modullehrberufen (16925/J)
Mag. Harald Stefan, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend Strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität 2022 (16926/J)
MMag. Katharina Werner, Bakk., Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie betreffend Umsetzung des Mobilitätskonzeptes der Kulturhauptstadt Bad Ischl – Salzkammergut 2024 (16927/J)
Dr. Stephanie Krisper, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Wie schwach kann man bei Ermittlungen zu Geldwäsche sein? (16928/J)
Dr. Dagmar Belakowitsch, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend Schwedisch-österreichischer Schildbürgerstreich bei Doppelbesteuerung (16929/J)
Dr. Dagmar Belakowitsch, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend „housing first österreich“ löst „zuhause ankommen“ ab (16930/J)
Mag. Christian Ragger, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie betreffend Geschützte Werkstätte arbeitet für den Brenner Basistunnel (16931/J)
Mag. Christian Ragger, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend Geschützte Werkstätte arbeitet für den Brenner Basistunnel (16932/J)
Mag. Christian Ragger, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend Geschützte Werkstätte arbeitet für den Brenner Basistunnel (16933/J)
Mag. Christian Ragger, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung betreffend Technologiepark in St. Paul im Lavanttal (16934/J)
Mag. Christian Ragger, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend Technologiepark in St. Paul im Lavanttal (16935/J)
Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend Frist versäumt: Kelag dreht ersten Kunden Strom ab (16936/J)
Maximilian Linder, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Landesverteidigung betreffend Kosten Neubau Kaserne Villach (16937/J)
Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie betreffend Umsetzungsstand des Regierungsprogramms bezüglich Österreichische Jugendstrategie (16938/J)
Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend Umsetzungsstand des Regierungsprogramms bezüglich Österreichische Jugendstrategie (16939/J)
Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend Umsetzungsstand des Regierungsprogramms bezüglich Österreichische Jugendstrategie (16940/J)
Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für EU und Verfassung betreffend Umsetzungsstand des Regierungsprogramms bezüglich Österreichische Jugendstrategie (16941/J)
Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Umsetzungsstand des Regierungsprogramms bezüglich Österreichische Jugendstrategie (16942/J)
Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend Umsetzungsstand des Regierungsprogramms bezüglich Österreichische Jugendstrategie (16943/J)
Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend Umsetzungsstand des Regierungsprogramms bezüglich Österreichische Jugendstrategie (16944/J)
Christian Lausch, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend Umgang und Verwendung von Laptops in den Justizanstalten (16945/J)
Dr. Dagmar Belakowitsch, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend Folgeanfrage zu 16878/J – Schwedisch-österreichischer Schildbürgerstreich bei Doppelbesteuerung (16946/J)
Hermann Brückl, MA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung betreffend Hat Bundesminister a.D. Faßmann gegen das Medizinproduktegesetz verstoßen? (16947/J)
Dr. Dagmar Belakowitsch, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend Ausbildungspflicht bis 18 für nichtösterreichische Staatsbürger (16948/J)
Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend Datenlecks im BMSGPK seit dem 1.1.2020 (16949/J)
Dr. Dagmar Belakowitsch, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend Rote Abzocke-Sterben in Wien wird wieder teurer (16950/J)
Mag. Harald Stefan, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend Ermittlungen gegen Michael Bonvalot (16951/J)
Mag. Harald Stefan, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend Strafbare Handlungen gegen den öffentlichen Frieden (§§ 278b ff) und Rückfallstäter (16952/J)
Dr. Dagmar Belakowitsch, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend Intensivprogramm für die Arbeitsmarktintegration von Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten (16953/J)
Dr. Dagmar Belakowitsch, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend Aktive Arbeitsmarktpolitik für nichtösterreichische Staatsbürger (16954/J)
Dr. Dagmar Belakowitsch, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend Gewerbliche Konsequenzen aus dem Ergebnis finanzpolizeilicher Schwerpunktkontrollen im Handel im Zusammenhang mit dem Allgemeinen Sozialversicherungsrecht (16955/J)
Dr. Dagmar Belakowitsch, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend AMS-Frühwarnsystem 2020-2023 (16956/J)
Dr. Dagmar Belakowitsch, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend Langzeitarbeitslosigkeit bei nicht-österreichischen Staatsbürgern (16957/J)
Dr. Dagmar Belakowitsch, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend Unterstützung der Reintegration von Personen über 50 bei nichtösterreichischen Staatsbürgern (16958/J)
Dr. Dagmar Belakowitsch, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend Datenlecks im BMAW seit dem 1.1.2020 (16959/J)
Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundeskanzler betreffend Umsetzungsstand des Regierungsprogramms bezüglich Österreichische Jugendstrategie (16960/J)
Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten betreffend Umsetzungsstand des Regierungsprogramms bezüglich Österreichische Jugendstrategie (16961/J)
Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung betreffend Umsetzungsstand des Regierungsprogramms bezüglich Österreichische Jugendstrategie (16962/J)
Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien betreffend Umsetzungsstand des Regierungsprogramms bezüglich Österreichische Jugendstrategie (16963/J)
Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport betreffend Umsetzungsstand des Regierungsprogramms bezüglich Österreichische Jugendstrategie (16964/J)
Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Landesverteidigung betreffend Umsetzungsstand des Regierungsprogramms bezüglich Österreichische Jugendstrategie (16965/J)
Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft betreffend Umsetzungsstand des Regierungsprogramms bezüglich Österreichische Jugendstrategie (16966/J)
Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend Abschlussbericht der Branchenuntersuchung Lebensmittel (16967/J)
Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend Abschlussbericht der Branchenuntersuchung Lebensmittel (16968/J)
Thomas Spalt, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport betreffend Europäische Kulturhauptstadt 2024 Bad Ischl (16969/J)
Hermann Brückl, MA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend Hat Bundesminister a.D. Faßmann gegen das Medizinproduktegesetz verstoßen? (16970/J)
Hermann Brückl, MA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend Hat
Bundesminister a.D. Faßmann gegen das Medizinproduktegesetz verstoßen? (16971/J)
Hermann Brückl, MA, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend Hat Bundesminister a.D. Faßmann gegen das Medizinproduktegesetz verstoßen? (16972/J)
Hermann Brückl, MA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Hat Bundesminister a.D. Faßmann gegen das Medizinproduktegesetz verstoßen? (16973/J)
Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend Unfairer Handel? Nach MPreis weitere Ermittlungen der Wettbewerbsbehörde (16974/J)
Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie betreffend VKI: Greenwashing-Beschwerde wegen Plastikflaschen bei EU-Kommission (16975/J)
Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend VKI: Greenwashing-Beschwerde wegen Plastikflaschen bei EU-Kommission (16976/J)
Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend VKI: Greenwashing-Beschwerde wegen Plastikflaschen bei EU-Kommission (16977/J)
Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend VKI startet Sammelaktion zur Refundierung von Entgelten der Bank Austria (16978/J)
Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend VKI: Gesetzliches Widerspruchsrecht auch bei indexbasierter Gaspreiserhöhung (16979/J)
Christian Hafenecker, MA, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend Freimaurernetzwerke in Politik und Justiz (16980/J)
Christian Hafenecker, MA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Freimaurernetzwerke in Politik und Justiz (16981/J)
Mag. Hannes Amesbauer, BA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Räumungsbescheid für Asylgroßquartier in Kindberg (16982/J)
Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend Mord durch einen Pfleger (16983/J)
Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend Rabattaktionen für Babynahrung (16984/J)
Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend Fehler bei der Rezeptgebührenbefreiung (16985/J)
Walter Rauch, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie betreffend Klimabonus-Lotterie: Wer profitiert von der Abwicklung über Sodexo-Gutscheine? (16986/J)
Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien betreffend Verschlechterung der mentalen Gesundheit von Schülern (16987/J)
Mag. Gerhard Kaniak, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend Finanzielle Absicherung von Hepatitis-C-Opfern (16988/J)
Thomas Spalt, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport betreffend Belästigung im Kulturbetrieb (16989/J)
Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend Mord durch einen Pfleger (16990/J)
Philip Kucher, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend wann wird endlich der Mangel an Kassenärzt:innen bekämpft? (16991/J)
Mag. Christian Drobits, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend Privatkonkurs – Aufrechnung von Beitragsschulden bei Sozialversicherungsträgern (16992/J)
Mag. Christian Drobits, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend Regulierung von Nikotinbeutel und neuen Nikotinprodukten im Tabakgesetz (16993/J)
Fiona Fiedler, BEd, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend Bewertungsboard für Medikamente (16994/J)
Mag. Martina Künsberg Sarre, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung betreffend Stillstand in der Elementarpädagogik (16995/J)
Dr. Stephanie Krisper, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend FH Wiener Neustadt und Donau-Uni Krems: Weiterhin bzw. neuer Startpunkt für Postenkorruption? (16996/J)
Dr. Stephanie Krisper, Kolleginnen und Kollegen an den Bundeskanzler betreffend Putins Versprechen an Österreich (16997/J)
Mario Lindner, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Landesverteidigung betreffend „Krise der medizinischen Versorgung im Bundesheer“ (16998/J)
Mag. Eva Blimlinger, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Rechtsextreme Kundgebung vor der Universität Wien (16999/J)
MMag. Katharina Werner, Bakk., Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie betreffend Folgeanfrage: Sanierung Bahnhof Steyr (17000/J)
Petra Wimmer, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend aktualisierte Daten zum Familienbonus plus (17001/J)
Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie betreffend Pensionierungen bei den ÖBB 2022 (17002/J)
Dr. Dagmar Belakowitsch, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend Gewerberechtliche Konsequenzen aus dem Ergebnis finanzpolizeilicher Schwerpunktkontrollen im Handel im Zusammenhang mit dem Ausländerbeschäftigungsgesetz (17003/J)
Dr. Stephanie Krisper, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend Schleppende Ermittlungen zum Ärztekammerskandal (17004/J)
Beginn der Sitzung: 9.05 Uhr
Vorsitzende: Präsident Mag. Wolfgang Sobotka, Zweite Präsidentin Doris Bures, Dritter Präsident Ing. Norbert Hofer.
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, ich darf Sie recht herzlich zur 241. Sitzung des Nationalrates begrüßen. Die Sitzung ist eröffnet. (Abgeordnete aller Fraktionen tragen orange Anstecker, auf denen eine blaue Hand sowie die Aufschrift „Stoppt Gewalt an Frauen“ zu sehen sind.)
Mein Gruß gilt auch den Damen und Herren der Journalistik – herzlich willkommen! –, unseren Besuchern auf der Galerie und den Damen und Herren zu Hause vor den Fernsehgeräten.
Als verhindert gemeldet sind heute die Abgeordneten Lukas Brandweiner, Mag. Johanna Jachs, Ing. Reinhold Einwallner, Julia Elisabeth Herr, Josef Muchitsch, Heike Grebien, Mag. Markus Koza und Dr. Johannes Margreiter.
Einlauf und Zuweisungen
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Hinsichtlich der eingelangten Verhandlungsgegenstände und deren Zuweisungen darf ich gemäß § 23 Abs. 4 der Geschäftsordnung auf die im Sitzungssaal verteilte Mitteilung verweisen.
Die schriftliche Mitteilung hat folgenden Wortlaut:
A. Eingelangte Verhandlungsgegenstände:
1. Schriftliche Anfragen: 16922/J bis 17004/J
2. Regierungsvorlagen:
Gemeinnützigkeitsreformgesetz 2023 – GemRefG 2023 (2319 d.B.)
Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2023 – GesRÄG 2023 (2320 d.B.)
Start-Up-Förderungsgesetz (2321 d.B.)
Mindestbesteuerungsreformgesetz – MinBestRefG (2322 d.B.)
B. Zuweisungen in dieser Sitzung:
zur Vorberatung:
Ausschuss für Arbeit und Soziales:
Bundesgesetz, mit dem das Pflegefondsgesetz, das Pflegeausbildungs-Zweckzuschussgesetz und das Bundespflegegeldgesetz geändert werden, das Bundesgesetz über einen Zweckzuschuss aufgrund der Abschaffung des Zugriffs auf Vermögen bei Unterbringung von Personen in stationären Pflegeeinrichtungen für die Jahre 2025 bis 2028 erlassen und das Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz aufgehoben wird (2303 d.B.)
Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, das Arbeitsmarktservicegesetz und das Ausbildungspflichtgesetz geändert werden (2307 d.B.)
Finanzausschuss:
Bundesgesetz, mit dem ein Finanzausgleichsgesetz 2024 erlassen wird sowie das Finanzausgleichsgesetz 2017, das Umweltförderungsgesetz, das Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz, das Transparenzdatenbankgesetz 2012 und das Bildungsinvestitionsgesetz geändert werden (2305 d.B.)
Bundesgesetz, mit das Transparenzdatenbankgesetz 2012 geändert wird (2306 d.B.)
Gesundheitsausschuss:
Vereinbarungsumsetzungsgesetz 2024 - VUG 2024 (2310 d.B.)
Justizausschuss:
Bundesgesetz, mit dem das Koordinator-für-digitale-Dienste-Gesetz erlassen und das KommAustria-Gesetz, das E-Commerce-Gesetz, das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, das Urheberrechtsgesetz, das Gerichtsgebührengesetz, das Mediengesetz, die Strafprozeßordnung 1975, das Staatsanwaltschaftsgesetz, das Bundesgesetz über die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, das Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz und das Telekommunikationsgesetz 2021 geändert werden (DSA-Begleitgesetz – DSA-BegG) (2309 d.B.)
Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft:
Vereinbarung zwischen dem Bund und dem Land Wien gemäß Art. 15a B-VG über die Verwaltungsüberprüfung des Projekts "INTERACT Office Vienna 2021-2027" durch das Land Wien als Kontrollinstanz gemäß Art. 46 Abs. 3 der Interreg-Verordnung (2318 d.B.)
Verkehrsausschuss:
Bundesgesetz über die Gewährung von Zweckzuschüssen des Bundes an die Gemeinde Graz für die Finanzierung von Straßenbahnvorhaben in Graz (2304 d.B.)
Bundesgesetz, mit dem das Kraftfahrliniengesetz geändert wird (2308 d.B.)
Ausschuss für Wirtschaft, Industrie und Energie:
Bundesgesetz über die höhere berufliche Bildung (HBB-Gesetz) (2312 d.B.)
*****
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Ich darf bekannt geben, dass die Sitzung wie üblich bis 13 Uhr von ORF 2, bis 19.15 Uhr von ORF III und anschließend kommentiert in der TVthek übertragen wird.
Behandlung der Tagesordnung
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Es ist vorgeschlagen, die Debatten über die Punkte 1 und 2, 4 und 5, 6 bis 13 sowie 23 und 24 der Tagesordnung jeweils zusammenzufassen.
Wird dagegen ein Einwand erhoben? – Das ist nicht der Fall.
Redezeitbeschränkung
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Wir haben in der Präsidialkonferenz Konsens über die Dauer der Debatten erzielt. Demgemäß ist eine Tagesblockzeit von 6,5 „Wiener Stunden“ vorgesehen, sodass sich folgende Redezeiten ergeben: ÖVP 127, SPÖ 88, FPÖ 72, Grüne 65 sowie NEOS 52 Minuten.
Gemäß § 57 Abs. 7 der Geschäftsordnung beträgt die Redezeit für die gesamte Tagesordnung von jenen Abgeordneten, die keinem Klub angehören, 26 Minuten, die Redezeit pro Debatte beträgt 5 Minuten.
Wir kommen gleich zur Abstimmung.
Wer für die dargestellten Redezeiten ist, den bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen. – Das ist einstimmig angenommen.
Wir gehen in die Tagesordnung ein.
Bericht des Rechnungshofausschusses über den Bericht des Rechnungshofes betreffend COVID-19-Maßnahmen für Kunstschaffende sowie Kulturvermittlerinnen und ‑vermittler – Reihe BUND 2022/25 (III-722/2256 d.B.)
2. Punkt
Bericht des Rechnungshofausschusses über den Bericht des Rechnungshofes betreffend Neue Formen der Kulturvermittlung aufgrund der COVID-19-Pandemie – Reihe BUND 2023/8 (III-900/2258 d.B.)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Wir gelangen nun zu den Punkten 1 und 2 der Tagesordnung, über welche die Debatten unter einem durchgeführt werden.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Ich darf die Frau Präsidentin des Rechnungshofes recht herzlich bei uns begrüßen.
Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Hintner, bei ihm steht das Wort. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Hans Stefan Hintner (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Frau Präsidentin! Hohes Haus! Bevor ich zum eigentlichen Thema komme, darf ich darauf aufmerksam machen, dass mit 25. November die weltweite Kampagne Orange the World – Stoppt Gewalt an Frauen beginnt. Die Kampagne Orange the World wurde von UN Women initiiert. 16 Tage lang sind öffentliche Institutionen aufgerufen, Denkmäler und andere Gebäude in Orange zu hüllen. Das wird beim Parlament genauso der Fall sein wie zum Beispiel bei der Dreifaltigkeitssäule in meiner Heimatstadt Mödling.
Zum Thema selbst: Es geht nun um die Frage der Unterstützungen für Kunstschaffende und Kulturvermittler während der Coronazeit. Der Zeitraum der Prüfung war zwischen März 2020 und März 2021. Die Mittel stammten hauptsächlich aus dem Covid-19-Krisenbewältigungsfonds, der mit 28 Milliarden Euro dotiert war. Es waren drei Stellen für die Unterstützungen zuständig, darunter der Künstler-Sozialversicherungsfonds und die Wirtschaftskammer. Es sind etwa 114 300 Anträge eingelangt, wobei insgesamt 200 Millionen Euro zur Ausschüttung gekommen sind.
Die Kritik des Rechnungshofes richtet sich im Wesentlichen gegen die fragile Datenlage, die Nichtkoordination der auszahlenden Institutionen, auch was gewisse Überprüfungen anbelangt: unterschiedliche Anrechnungen, zulässige, unzulässige Wechsel und ob die wirtschaftlich signifikante Bedrohung auch
immer geprüft worden ist. In Folge ist eine Reihe von Vorschlägen zur Verbesserung aufgelistet worden, und wir alle hoffen, dass es zu diesen Maßnahmen nicht mehr kommen wird.
Als Mitglied des Kulturausschusses darf ich dennoch anmerken, dass mit den Unterstützungen den Künstlerinnen und Künstlern in größter Schnelle treffsicher (Abg. Belakowitsch: Ja, ja, ja, treffsicher!) geholfen werden konnte, und das in einer Zeit, in der die schnelle Hilfe sehr, sehr notwendig war.
Missbräuche beziehungsweise Mehrfachförderungen sind auch mit anderen Maßnahmen ja nach wie vor in Prüfung, ich darf mich aber trotzdem stellvertretend für jene, denen geholfen wurde, recht herzlich bei den drei Auszahlungsstellen bedanken! (Beifall bei der ÖVP sowie der Abg. Maurer.)
9.11
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Heinisch-Hosek. Bei ihr steht das Wort. – Bitte sehr.
Abgeordnete Gabriele Heinisch-Hosek (SPÖ): Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Präsidentin des Rechnungshofes! Hohes Haus! Liebe Zuseherinnen und Zuseher! Morgen starten die 16 Tage gegen Gewalt, und weil es gut zum Thema passt, möchte ich daran erinnern, dass der österreichische Rechnungshof erst im August die Empfehlung ausgesprochen hat, dass man den Nationalen Aktionsplan Gewaltschutz wieder einführen sollte. (Beifall bei der SPÖ.) Ich glaube, dass es als Präventionsmaßnahme ganz notwendig ist, unter Beteiligung vieler Ressorts wieder intensiv darüber nachzudenken, wie man handeln könnte, bevor etwas passiert, bevor ein Femizid passiert. (Beifall bei der SPÖ.)
Zum Rechnungshof: Ich bedanke mich, auch im Namen meiner Fraktion, bei allen Mitgliedern des Rechnungshofes, bei Ihrem Team, bei Ihnen, Frau Präsidentin, denn Sie überprüfen und kontrollieren unter anderem, wie Bund, Länder und Gemeinden ihre Finanzgebarung handhaben.
Im heutigen Bericht geht es, wie schon erwähnt, um Beihilfen und Förderungen im Zeitraum von März 2020 bis März 2021, also mitten in der Coronapandemie. Es geht um Beihilfen und Förderungen an Kunstschaffende und Kulturvermittlerinnen und -vermittler und darum, wie sich da – wie wir es auch immer gesagt haben – etwas Verwirrung breitgemacht hatte. Es gab nämlich nicht, wie wir immer vorgeschlagen haben, eine Stelle, die diese Förderungen und Beihilfen ausgezahlt hat, sondern es waren drei unterschiedliche Stellen. Vom Rechnungshof wurden einige Problemfelder aufgelistet, wo es in Folge jetzt natürlich zu Rückzahlungen kommen muss, weil ziemlich unklar war: Kann ich Mehrfachförderungen in Anspruch nehmen? Wie sind die Bestimmungen, ob ich eine Förderung als Künstlerin oder Künstler, als Kulturvermittlerin oder -vermittler erhalte? Auch: Zu welcher Anstalt gehe ich? Es waren der Künstler-Sozialversicherungsfonds, die Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen und die Wirtschaftskammer Österreich, also drei unterschiedliche Stellen, die ausgezahlt haben.
Die Hauptprobleme: Die Datenlage war unklar, die Förderkriterien waren nicht einheitlich definiert. Wenn jemand gewechselt hat, war nicht klar, wie die Anrechnungen gehandhabt werden. Auch die nachgelagerte Kontrolle war eines der Kriterien des Rechnungshofes, bei denen festgestellt wurde, dass es Verbesserungsbedarf gibt.
Die Kulturbranche mit allen Menschen, die in diesem Bereich tätig sind, ist eine unglaublich kreative Branche, und nicht alle waren Spitzenverdienerinnen und -verdiener. Und nach der Covid-Krise, nach der Pandemie ist es jetzt so, dass diese Gruppe auch unter der Teuerung sehr zu leiden hat. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir als Kulturausschussmitglieder uns dem Thema Soloselbstständige und Entgang von Honoraren mehr widmen und – wie es der Rechnungshof empfohlen hat – dass sich das nie mehr so wiederholen möge. (Beifall bei der SPÖ.)
9.14
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordnete Belakowitsch. – Bitte sehr.
Abgeordnete Dr. Dagmar Belakowitsch (FPÖ): Herr Präsident! Frau Präsidentin Kraker! Sehr geehrte Damen und Herren vor den Bildschirmgeräten und hier herinnen! Es geht hier um den Umgang mit der Ausschüttung der Covid-Gelder an Kunstschaffende, und das hat schon auch ein bisschen etwas damit zu tun, wie wir damals überhaupt mit der ganzen Covid-Geschichte umgegangen sind.
Gerade bei den Kunstschaffenden ist das halt schon irgendwo sinnbildlich. Genau da sieht man, wie von der Bundesregierung wirklich agiert worden ist. Da gibt es einige wenige Künstler – das sind vor allem die moralisierenden Künstler, die dann sehr gerne auch im Fernsehen auftreten, das sind die, die wir kennen –, die zum Teil Millionenbeträge an Coronaförderungen abgehoben haben. Das sind Personen, die dann mit einer GmbH und mit einer AG und mit ich weiß nicht wie vielen Firmen plötzlich parallel Förderungen abgehoben haben. Das sind aber nicht unbedingt jene Künstler, die am Hungertuch genagt haben. – So viel zur genauen Kontrolle.
Diese Moralisierer sind übrigens auch die, die seit dem 7. Oktober so verstummt sind, man hört von ihnen derzeit relativ wenig. Und genau da, glaube ich, liegt die Krux: Es gibt Hunderte, Tausende Kunstschaffende, die tatsächlich kreativ arbeiten, die wirklich jeden Tag um ihr Überleben kämpfen müssen, die ihr kreatives Potenzial uns allen zur Verfügung stellen. Einige wenige aber sind tatsächlich auch überfördert worden, nämlich jene, die politisch korrekt sind. Das lehnen wir zutiefst ab, weil es in der Coronakrise mit den Förderungen immer wieder die Gleichen getroffen hat; das ist nicht anders als in anderen Bereichen, auch im Kulturbereich ist das so. Und wenn Sie es nicht glauben, dann schauen Sie rein: Was haben Herr Scheuba, Herr Niavarani und ähnliche Moralisierer, deren Kunst und Kultur sich hauptsächlich darauf beschränkt, die Freiheitliche
Partei zu beschimpfen, und das seit vielen, vielen Jahren, tatsächlich bekommen? (Beifall bei der FPÖ.)
Liebe Kollegen von der Österreichischen Volkspartei, das muss ich euch jetzt noch einmal sagen: Gerade ihr stellt euch jetzt hierher, beginnt mit eurem Herrn Bürgermeister Hintner aus Mödling, der zwar in seiner Gemeinde durchaus viel Kultur anbietet – das kann man ihm gar nicht absprechen –, der aber in der Coronakrise auch derjenige war, der gesagt hat, alle Ungeimpften sollen gar keinen Krankenhausplatz mehr bekommen. Auch das ist etwas. Und sich dann hierherzustellen und so zu tun, als wäre alles super toll gewesen: Nein, das war es nicht!
Ich fordere noch einmal dazu auf: Arbeiten wir die gesamten Problematiken, nicht nur das, was bei den Förderungen passiert ist, tatsächlich auch einmal ehrlich auf und schauen wir, wo die Fehler passiert sind! Machen wir endlich einmal reinen Tisch!
Sie können weiterhin glauben, dass Sie sich durch diese Zeit durchducken können. Ich sage Ihnen: Es kommt alles noch auf. Von Tag zu Tag werden mehr Dinge bekannt, erst gestern ist wieder ein Dokument der EMA veröffentlicht worden. Da wird noch so viel herauskommen, und dafür werden Sie irgendwann doch geradestehen müssen: Sie werden das nicht auf Dauer und auf Jahre hin aussitzen können. (Beifall bei der FPÖ.)
9.18
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Blimlinger. – Bitte sehr, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete Mag. Eva Blimlinger (Grüne): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Rechnungshofpräsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren auf der Galerie und vor den Bildschirmen! Insbesondere für freischaffende Künstler und Künstlerinnen waren die Coronakrise und
die ganze Coronasituation wirklich grauenvoll, muss man sagen. Es hat keine Auftrittsmöglichkeiten gegeben, es hat nichts gegeben, wo sie tätig werden konnten, und wir mussten sehr schnell schauen, dass diese doch sehr große Gruppe in Österreich – und darauf sind wir auch stolz – wirklich gute Fördermöglichkeiten bekommt. Sosehr die Kritik des Rechnungshofes berechtigt ist, was mögliche fehlende Kontrolle betrifft, erachte ich sie, was die drei Instrumente betrifft – und das geht auch an die SPÖ –, nicht für gerechtfertigt.
Gerade im Kunst- und Kulturbereich gibt es dermaßen heterogene Situationen, dass es eben notwendig ist, passgenau zu agieren, und das haben wir auch gemacht. Man muss sagen, dass wir das wahnsinnig gut abgefangen haben und es eben auch so abgefangen haben, dass in den letzten eineinhalb Jahren wirklich auch wieder sehr viel möglich ist, weil wir diese große Gruppe, die sehr heterogen ist, über die Runden gebracht haben.
Da mag es wie überall Überförderung beziehungsweise Missbrauch geben. Das werden wir nie ausschließen können, auch wenn das Instrument noch so besonders ist.
Noch ein Wort zum Kulturvermittlungsbericht: Ja, das war ein Experimentierfeld. Da gibt es sicherlich Verbesserungsbedarf, und für die Zukunft wird man vorbereiten, dass man, wenn es zu solchen Situationen kommt, das besser definiert.
Im Übrigen bin ich der Meinung: Bring them home now! (Beifall bei den Grünen sowie der Abg. Kaufmann.)
9.20
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Seidl. – Bitte.
Abgeordnete Mag. Julia Seidl (NEOS): Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Verehrte Zuseherinnen und Zuseher hier im Haus! Sehr geehrter Herr
Präsident! Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir die Rechnungshofkritik nicht nur ernst nehmen und sagen, dass es da berechtigte Kritik gibt, sondern dass wir endlich in die Zukunft schauen und diese Dinge, die gefordert und kritisiert werden, auch endlich in die Umsetzung bringen, denn nur zu sagen: Ja, das stimmt!, und dann nichts zu ändern, macht die Situation beim nächsten Mal nicht besser. (Beifall bei den NEOS.)
Wir haben gesehen, dass es durch diese Parallelstrukturen, die aufgebaut worden sind – Kolleginnen und Kollegen haben es ja schon erwähnt –, verschiedene, unterschiedliche Stellen gegeben hat, die gefördert haben. Man muss sich einmal vorstellen, was das allein für ein bürokratischer Aufwand ist, wenn drei oder noch mehr verschiedene Stellen Förderungen auszahlen, wie viele Menschen da im Hintergrund sitzen und die Dinge bearbeiten müssen, welcher Aufwand das für Künstlerinnen und Künstler ist, die immer in einer Unsicherheit gewesen sind, ob es sich noch ausgeht oder nicht.
Das ist meine Kritik generell. Die Rechnungshofberichte sind immer sehr genau und sehr detailliert, und es ist unsere Aufgabe, dass wir endlich in die Umsetzung kommen, damit diese Strukturen besser werden.
Der Rechnungshofbericht sagt auch – und er beweist das auch –, dass wir mehr Daten brauchen. Wir fordern seit Jahren, dass wir endlich ein Kultursatellitenkonto bekommen, um zu wissen, was alles in der Kultur eigentlich verfügbar ist, welchen Mehrwert es hat, wo die Künstlerinnen und Künstler zu Hause sind, welche einzelnen Sparten es gibt, die was zur Verfügung stellen. Dieses Konto gibt es immer noch nicht.
Ich habe auch gefordert, dass es endlich eine Förder-ID gibt, eine Digitalisierung, das heißt, dass bei Kulturschaffenden und -vereinen durch eine Kennzahl immer nachvollziehbar ist – egal an welcher Stelle, auf welche Ebene, weil die Kulturförderungen immer bis auf die Gemeinden hinunter strukturiert sind –, wer wie viel Förderung von welcher Stelle bekommt.
Wir können insgesamt sagen, dass aus unserer Sicht nicht zu wenig gefördert worden ist, sondern in Teilen wahrscheinlich sogar zu viel, und das ist dem Umstand geschuldet, dass die rechte Hand oft nicht weiß, was die linke Hand tut. Die größte Intransparenz sehen wir ja nach wie vor – NEOS kritisiert das ja von Anfang an und hat auch deren Installierung kritisiert – bei der Cofag, also der Schaffung einer Blackbox, in die niemand hineinschauen kann, bei der das Parlament keine Möglichkeiten hat, auch nur ansatzweise nachzufragen. Das ist aus unserer Sicht einer der größten Fehler gewesen, und deswegen waren wir damals auch schon sehr kritisch.
Generell möchte ich darum bitten, dass wir endlich die Datenlage verbessern. Wir haben alle Daten, wir müssen sie nur sinnvoll zusammenführen. Es ist aus meiner Sicht eine Aufgabe für den Digitalisierungsstaatssekretär, dass wir endlich in der Datenlage besser werden, gute Schnittstellen haben, damit sowohl die Gemeinden, die Länder als auch der Bund Bescheid wissen, wer wo an welcher Stelle wie viel Förderung bekommt. – Herzlichen Dank. (Beifall bei den NEOS.)
9.23
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist die Frau Präsidentin des Rechnungshofes. – Bitte sehr.
Präsidentin des Rechnungshofes Dr. Margit Kraker: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Heute stehen 13 Berichte des Rechnungshofes auf der Tagesordnung, und die Debatte beginnt schon in der Früh – danke dafür!
Ich möchte aus gegebenem Anlass vielleicht dann doch noch einmal außerhalb der Tagesordnung darauf hinweisen, dass wir Ende August den Bericht „Gewalt- und Opferschutz für Frauen“ veröffentlicht haben. In diesem Bericht haben wir drei Ministerien geprüft und auch darauf hingewiesen, dass die Länder für die Bereitstellung von Schutzeinrichtungen zuständig sind und dass es da sozusagen
im Netzwerk der Akteure eine koordinierte Strategie braucht. (Beifall bei der SPÖ.)
Wir haben in diesem Bericht 40 Handlungsempfehlungen ausgesprochen, und es sind eben das diesbezügliche Bewusstsein und das Agieren in dieser Sache sehr wichtig. (Neuerlicher Beifall bei der SPÖ.)
Heute stehen wie gesagt zwölf Berichte des Rechnungshofes und der Einkommensbericht, den wir ja gemeinsam mit der Statistik Austria machen, auf der Tagesordnung, und bei diesen Berichten geht es zu Beginn um solche, die noch aus der Reihe der Covid-Unterstützungsmaßnahmen und der entsprechenden Berichtsreihe stammen. Zunächst geht es um den Bericht „Covid-19-Maßnahmen für Kunstschaffende sowie Kulturvermittlerinnen und -vermittler“.
Das diesbezügliche Fördervolumen betrug rund 200 Millionen Euro. Insgesamt wurden rund 114 000 Anträge bewilligt und die Förderungen eben rasch – je nach Unterstützungsinstrument dauerte es zwischen fünf und 25 Tagen – ausbezahlt. Ziel war die Abfederung von coronabedingten Einnahmenausfällen.
Der Rechnungshof hat sich diese gesamten Förderthemen angeschaut, damit wir Lehren für die Zukunft ziehen können, und wir haben da einige Defizite identifiziert, die sich auch auf künftige Förderabwicklungen beziehen können.
Zunächst geht es um das Thema der unzureichenden Datenlage. Gerade im Kunst- und Kulturbereich ist es für uns natürlich sehr schwierig, festzustellen, wer tatsächlich künstlerisch tätig ist oder wer nur unterstützend tätig ist. Dementsprechend ist es auch schwierig, festzustellen, sozusagen wie viele Personen mit den Beihilfen und Förderungen erreicht wurden und wie hoch der durchschnittliche Förderbetrag war.
Es gab im Kulturressort schon vor der Prüfung Überlegungen zur Verbesserung der Datenlage, und man arbeitete an einem Satellitenkonto. Es wurde uns auch im Ausschuss gesagt, dass daran gearbeitet wird, und das anerkennen wir auch.
Der zweite Punkt ist das Thema der Mehrfachförderungen. Diese Mehrfachförderungen zwischen den Unterstützungsinstrumenten waren ja zulässige Mehrfachförderungen, das waren Mehrfachförderungen, weil es unterschiedliche Anrechnungsmöglichkeiten zwischen den verschiedenen Fonds gegeben hat.
Der dritte Punkt ist – das ist uns ganz wichtig –: Wann immer rasch ausgezahlt wird, braucht man gute nachgelagerte Kontrollkonzepte. Das haben wir im Prüfzeitraum noch nicht festgestellt. Mittlerweile hat die Staatssekretärin auch gesagt, dass diese Kontrollschritte da eben gesetzt werden.
Daher: Wichtig für die Zukunft beim Thema Förderungen durch unterschiedliche Stellen wird es sein, einheitliche Anrechnungsregelungen zu schaffen und Mehrfachförderungen auszuschließen. (Beifall bei der SPÖ.) Das gilt auch pro futuro. – Danke schön. (Beifall bei der SPÖ sowie des Abg. Zanger.)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist damit geschlossen.
Wünscht der Herr Berichterstatter ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall.
Somit kommen wir zur Abstimmung, die ich über jeden der Ausschussanträge getrennt vornehme.
Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 1: Antrag des Rechnungshofausschusses, den Bericht betreffend „COVID-19-Maßnahmen für Kunstschaffende sowie Kulturvermittlerinnen und -vermittler“ in III-722 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen.
Wer das tut, wird um ein Zeichen gebeten. – Das ist die Einstimmigkeit.
Tagesordnungspunkt 2: Antrag des Rechnungshofausschusses, den Bericht betreffend „Neue Formen der Kulturvermittlung aufgrund der COVID-19-Pandemie“ in III-900 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen.
Wer das tut, wird ebenfalls um ein Zeichen gebeten. – Das ist ebenfalls einstimmig angenommen.
Bericht des Rechnungshofausschusses über den Bericht des Rechnungshofes betreffend Allgemeiner Einkommensbericht 2022 – Reihe Einkommen 2022/1 (III-792/2257 d.B.)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Wir kommen zum 3. Punkt der Tagesordnung.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Kaufmann. – Bitte sehr.
Abgeordnete Martina Kaufmann, MMSc BA (ÖVP): Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Rechnungshofpräsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren hier im Hohen Haus, aber auch zu Hause! Als Allererstes möchte ich mich für diesen Einkommensbericht bedanken, den nun schon traditionellerweise der Rechnungshof aufbereitet und uns zur Debatte und zum Diskurs hier im Hohen Haus vorlegt.
Liebe Zuseherinnen und Zuseher, vielleicht auch kurz ein Wort dazu, warum das so wichtig ist: Dieser Bericht ist für uns insofern von großer Wichtigkeit, weil wir damit auch vergleichen können: Welche Maßnahmen, die gesetzt wurden, haben Auswirkungen auf das Einkommen in Österreich für alle, die im Erwerbsleben stehen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch für jene, in Pension sind.
Wenn man sich das über alle Berufsgruppen hinweg anschaut, kann eindeutig gesagt werden, dass immer mehr und mehr verdient wird, aber – und das möchte ich auch sagen, weil heute auch noch einige Beiträge in diese Richtung
kommen werden – das gibt keinen Aufschluss darüber, ob jemand in Armut lebt oder wie groß das Haushaltseinkommen ist. Es geht also wirklich sozusagen um die Betrachtung jener, die Einkommen in Österreich generieren.
Ich möchte zwei Punkte herausgreifen, weil sie sozusagen für unsere politische Arbeit Tag für Tag wichtig sind. Klar gesagt werden kann: Wer eine gute Ausbildung genossen hat, wer sich weitergebildet hat, wer in seine Ausbildung auch viel an Zeit investiert hat, der verdient in Österreich besser.
Wir haben diese Woche im Parlament auch die Regierungsvorlage zur höheren beruflichen Bildung liegen, die wir nächste Woche im Wirtschaftsausschuss und dann im Dezemberplenum diskutieren und dann auch hoffentlich mit sehr breiter Zustimmung beschließen werden. Das ist ein weiterer wichtiger Schritt für die Bildung und ein weiterer wichtiger Schritt, der schlussendlich auch zu mehr Einkommen führen wird. Der Bericht zeigt eindeutig auf, dass es diese Möglichkeit gibt: Je mehr Bildung die oder der Einzelne genossen hat, desto höher wird auch ihr oder sein Einkommen sein, es spiegelt sich also im Einkommen wider.
Einen weiteren Punkt, den uns dieser Einkommensbericht auch ganz klar aufzeigt, möchte ich auch herausgreifen: Es gibt nach wie vor große Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Der Bericht zeigt auf, dass Männer in Österreich quer über alle Berufsgruppen nach wie vor um 67 Prozent mehr verdienen als Frauen.
Ich glaube, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, aufgrund dessen sollten wir alle uns viele Gedanken darüber machen, wie wir politische Maßnahmen setzen, denn eines ist auch klar: Im Jahr 2023 – und das Jahr 2024 steht vor uns – kann es nicht sein, dass aufgrund des Geschlechts unterschiedlich bezahlt wird. Wir müssen da wirklich gut hinschauen und Rahmenbedingungen schaffen (Abg. Heinisch-Hosek: Lohntransparenz, zum Beispiel! – Ruf bei der SPÖ: Da gab es eine EU-Richtlinie zum Beispiel! – Abg. Holzleitner: Nur: umsetzen muss man sie!), die es Frauen ermöglichen, gleich viel zu verdienen wie die männlichen
Kollegen und gut aufzuholen, damit wir in Zukunft, Frau Kollegin, hier Einkommensberichte diskutieren und debattieren können, in denen es nur darum geht, wo es vielleicht die eine oder andere Maßnahme zur Unterstützung braucht, in denen es aber nicht mehr darum geht, dass Männer eindeutig mehr verdienen als Frauen.
Ich bin überzeugt davon, dass wir das schaffen werden und dass wir gemeinsam parteiübergreifend Maßnahmen setzen werden, damit uns das in Österreich gelingt. (Abg. Heinisch-Hosek: Handeln!)
Danke noch einmal an den Rechnungshof für diesen aufschlussreichen Bericht. (Beifall bei Abgeordneten von ÖVP und Grünen.)
9.32
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordnete Greiner. – Bitte sehr, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete Mag. Karin Greiner (SPÖ): Herr Präsident! Frau Rechnungshofpräsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Kollegin Kaufmann hat gerade die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen angesprochen. Mir war es viel zu schwach, wie das jetzt formuliert war. Ich appelliere an die Bundesregierung: Bitte tun Sie doch etwas! (Beifall bei der SPÖ.)
Folgen Sie dem Zeitplan, den die EU möglich gemacht hat! Die EU hat jetzt die Richtlinie für die Lohntransparenz vorgegeben: Unternehmen müssen offenlegen, wie viel sie für die einzelnen Funktionen bezahlen. Das war im April dieses Jahres – bis jetzt gab es großes Schweigen. Bitte warten Sie nicht bis 2026 (Beifall bei der SPÖ), so lange wäre es theoretisch möglich. Bitte beginnen Sie jetzt sofort mit der Umsetzung! Wir stehen bereit.
Warum stehen wir bereit? – Frauen verdienen in Österreich bis zu 20 Prozent weniger – wohlgemerkt – für die gleiche Arbeit, die sie erledigen, wie ihre männlichen Kollegen.
Wie schaut es auf EU-Ebene aus? – Da verdienen sie im Schnitt „nur“ – unter Anführungszeichen – um 13 Prozent weniger. Das bezieht sich auf das aktive Berufsleben. Wie schaut es aber in der Pension aus? – Da verdienen Frauen um bis zu 30 Prozent weniger. (Abg. Loacker: Weil sie weniger Beitragsmonate haben! – Ruf: Pension ist kein Verdienst!) Das ist beträchtlich und kann so nicht akzeptiert werden. (Beifall bei der SPÖ.)
Jetzt stellt sich berechtigterweise die Frage, warum das denn so ist. Wir wissen, ein Großteil der Frauen – vor allem wenn sie Kinderbetreuungspflichten haben – ist in Teilzeit beschäftigt. Ja sind sie das immer freiwillig? – Ich höre aus mancher Ecke: Ja, natürlich!, es ist aber mitnichten so. Das machen sie nicht aus freien Stücken, sondern sie machen es deshalb, weil sie keine entsprechenden Kinderbetreuungsplätze vorfinden, und dann wird man sich als Frau wahrscheinlich natürlich für das Kind entscheiden.
Insofern ist die Budgetdebatte, die wir eigentlich mit gestern für diese Woche beendet haben, umso prekärer, wenn man das Versprechen des Herrn Bundeskanzlers heranzieht, 4,5 Milliarden Euro in die Kinderbetreuung zu investieren. Die sind aber nicht da, die 4,5 Milliarden Euro, weder im beschlossenen Budget noch im Finanzausgleich! Wo sind sie? (Beifall bei der SPÖ. – Abg. Holzleitner: Ein Schmäh! – Ruf bei der FPÖ: Im Zauberhut!)
Ein leeres Versprechen – das ist sehr, sehr bitter für die Frauen, die Kinder und die Familien.
Daher ist wie gesagt mein Appell: sofort die Umsetzung einleiten mit der Lohntransparenz! Das gibt den Frauen nämlich wirklich ein Werkzeug in die Hand, mit dem sie ihre Gehaltserhöhungen verhandeln können und nicht beweisen müssen, wie viel ein männlicher Kollege verdient. Das Unternehmen muss sagen: Ich bezahle so viel – und das auch für eine Frau. (Beifall bei der SPÖ.)
Noch ein wesentlicher Punkt, der uns wirklich eine sofortige Anleitung zum raschen Handeln sein sollte: die Aufforderung, die Empfehlung des Rechnungshofes, einen nationalen Aktionsplan zum Schutz von Frauen und Kindern gegen Gewalt zu erstellen. Dieser Button (auf den Button auf ihrem Revers weisend) weist darauf hin: Morgen beginnt eine 16-tägige Aktion. Auch da bitte sofort mit der Umsetzung anfangen! Gewalt ist zu unterbinden. – Ich danke Ihnen. (Beifall bei der SPÖ.)
9.35
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Zanger. – Bitte.
Abgeordneter Wolfgang Zanger (FPÖ): Herr Präsident! Frau Präsidentin des Rechnungshofes! Ja, es geht um den Einkommensbericht. Ich muss aber eines sagen: Es gibt einen Anlass, der mir heute auch die Gelegenheit gibt, über etwas anderes von Ihnen zu sprechen, das sehr bemerkenswert ist, Frau Präsidentin, nämlich etwas, das schon im Zuge der Budgetdebatte diese Woche ein Thema war: Ihr Interview, das Sie der „Presse“ gegeben haben. Darin ist viel über das Budget gesprochen worden, das haben wir schon abgehandelt, aber da steht noch etwas drinnen, das mich selbst sehr bewegt und sehr berührt und bei dem es mich wahnsinnig freut, dass Sie das aufgegriffen haben.
Es geht darum: Es wurde darauf Bezug genommen, dass Sie einmal gesagt hätten – ich zitiere –, „dass ‚man reinen Tisch machen‘ müsse in der Politik, um ‚mit einer besseren Kultur‘ Vertrauen wiederherzustellen“, und Sie haben die Frage gestellt bekommen, ob Sie den Eindruck haben, dass es besser geworden sei.
Darauf sagen Sie: „[...] es gibt Ereignisse, die einen zum Zweifeln bringen.“
Daraufhin werden Sie gefragt, was Sie damit meinen – Sie beziehen sich auf die „Widmungsfragen im Gemeindebereich“ und sagen, dass man „im Gemeindebereich eine besondere Verantwortung“ hätte, „wenn es um“ – solche – „Transaktionen geht“.
Dann werden Sie noch gefragt: „Glauben Sie, es steckt ein System dahinter, wenn etwa ranghohe SPÖ-Politiker große Umwidmungsgewinne [...] erzielen? Oder ein schwarzer Bürgermeister beim eigenen Bauprojekt?“ Und Sie sagen darauf – und das, muss ich ehrlich sagen, unterschreibe ich voll und ganz –: „Wenn ich eine Funktion habe – ein politisches Amt oder ich bin Interessensvertreter –, trete ich für die Interessen derer ein, die mich gewählt haben. Da gibt es einmal den rechtlichen Maßstab – vor allem aber die politischen Standards, die darüber liegen. Wenn ich ein Amt übernommen habe, darf ich nicht für das eigene Interesse arbeiten.“
Ja, das sind Themen gewesen, die im höherrangigen politischen Bereich angesiedelt sind, aber ich möchte jetzt aufzeigen, dass das bis ganz hinunter geht. In meiner eigenen Gemeinde in Lobmingtal hat der Bürgermeister vor einigen Jahren ein Grundstück erworben, Wald und Wiesen, durchaus zu einem für diese Widmung ortsüblichen Preis, hat das dann aber, nachdem er ja Bürgermeister und Funktionsträger in der Gemeinde ist, sehr schnell in Bauland umgewidmet und dann natürlich um ein Vielfaches zum Verkauf angeboten. – Jetzt mag da ja rechtlich alles in Ordnung sein. (Abg. Baumgartner: Der Bürgermeister allein kann ... !)
Lasst mich mit euren Aussagen in Ruhe! Ich zeige euch jetzt einmal das Moralische auf, so wie ihr seid (Beifall bei der FPÖ – Abg. Ottenschläger: Ganz sicher! Ganz sicher! – weitere Zwischenrufe bei der ÖVP), denn das hat System – von ganz oben bis ganz hinunter.
Was ist also? – Das mag alles rechtlich in Ordnung sein, er soll sich auch von mir aus einen goldenen Schnabel verdienen, das kann ja alles sein (Abg. Höfinger: Der Letzte, der über Moral berichten kann in diesem Haus, bist du!), aber der Punkt ist:
Wer sind die Verkäufer? (Abg. Schmuckenschlager: Ja, wirklich, schon schwierig!) – Die Verkäufer sind zwei betagte Damen, die gesagt haben: Wir schaffen das nicht mehr, dass wir das alles bewirtschaften, verkaufen wir etwas! Sie sind zum Bürgermeister gegangen (Abg. Michael Hammer: Zu welchem?) und haben gesagt, sie würden das gerne verkaufen – denn am Land geht man halt einmal zum Bürgermeister. Wen hat man denn sonst als Ansprechpartner? – Zu einem Rechtsanwalt, Juristen oder auf das Grundbuch geht man ja sowieso nicht, vor allem in einem entsprechenden Alter. (Abg. Michael Hammer: Was willst du denn eigentlich sagen?)
Was ich sagen will, Herr Kollege Hammer, ist, dass es da einen Bürgermeister gibt (Abg. Michael Hammer: Welcher?), der nicht im Interesse seiner Leute handelt und ihnen sagt, welche Handlungsoptionen sie haben, sondern der zwei ältere Weiberle über den Tisch zieht (Heiterkeit des Abg. Michael Hammer), ihnen ihren Grund billig abkauft, ihn umwidmet und teuer verkauft. (Abg. Baumgartner: Der Bürgermeister widmet nicht um! Das macht der Gemeinderat! – Ruf bei der ÖVP: Genau! – Abg. Michael Hammer: Kann ihn wer erlösen von euch? Der ist ja arm! – Weitere Zwischenrufe bei der ÖVP.)
So, aber es geht ja noch weiter: Da gäbe es ja eine gesetzliche Nachbesserungspflicht. Wenn ich heute quasi jemandem etwas abluchse, so wie ihr Schwarzen das die ganze Zeit tut, dann müsste ich ja, wenn der Verkäufer draufkommt, dass er da über den Tisch gezogen worden ist, gesetzlich nachbessern. Was hat er gemacht? – Beraten durch die Frau vom steirischen Wirtschaftsbundpräsidenten, die Notarin ist, hat er den Vertrag aufgesetzt und es innerhalb der Familie weiterverkauft, und damit ist er dieser gesetzlichen Nachbesserungspflicht entkommen.
Es geht da jetzt nicht darum, ob er dabei etwas verdient hat oder nicht. Es geht genau um diesen moralischen Standard, den die Frau Rechnungshofpräsidentin angesprochen hat. Es geht darum, dass nicht das Strafrecht das Maß des Handelns ist (Zwischenruf des Abg. Stögmüller), sondern dass es für einen Politiker immer die Moral ist – für die eigenen Leute etwas zu tun, für die eigenen
Leute etwas zu machen und sich selbst in den Spiegel schauen zu können. (Abg. Michael Hammer: Da seid ihr eh Weltmeister, dass ihr für die eigenen Leute was tut!) – Und du, Kollege Hammer, halte einmal deinen Mund (Beifall bei der FPÖ), denn wenn du sprichst, dann fällt mir nur eines ein: Es sind immer die Armleuchter, die glauben, sie strahlen wie Halogenscheinwerfer! (Beifall bei der FPÖ.)
9.40
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu einer tatsächlichen Berichtigung ist Abgeordneter Stark zu Wort gemeldet. – Bitte.
Abgeordneter Christoph Stark (ÖVP): Herr Präsident! Hohes Haus! Kollege Zanger hat soeben hier behauptet, der Bürgermeister würde Umwidmungen vornehmen.
Ich berichtige tatsächlich: Der Bürgermeister kann keine einzige Umwidmung vornehmen. Es ist eine Aufgabe des Gemeinderates, eine Umwidmung mit Zweidrittelmehrheit vorzunehmen. (Abg. Belakowitsch: Oh, danke! Danke für ...! – Abg. Zanger: Wahnsinn! Mit absoluter Mehrheit ausgestattet! Und alles ..., weil da drinnen steht, überhaupt keiner hat’s! – Präsident Sobotka gibt das Glockenzeichen!) – Herr Kollege Zanger, das ist das kleine Einmaleins des politischen Wissens, das fehlt Ihnen aber genauso wie das kleine Einmaleins des guten Benehmens. (Beifall bei der ÖVP sowie des Abg. Stögmüller. – Abg. Michael Hammer: Benehmen hat er keines! – Abg. Stögmüller: Die Rolle des Bürgermeisters, oder wie? – Unruhe im Saal. – Präsident Sobotka gibt neuerlich das Glockenzeichen. )
9.41
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Götze. – Bitte.
9.41
Abgeordnete Dr. Elisabeth Götze (Grüne): Herr Präsident! Werte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! (Die Rednerin hält die Nachbildung eines Kürbisses aus Karton in die Höhe und schwenkt sie nach links und rechts.) Halloween. – Warum ich das herzeige? – Ja, für Kinder und Jugendliche ist das wirklich noch ein großer Spaß, vor allem heuer aber für Frauen ab dem Einstieg ins Berufsleben nicht mehr: Heuer war der Equal-Pay-Day am 31. Oktober. Der Equal-Pay-Day bedeutet, Frauen verdienen ab diesem Zeitpunkt im Durchschnitt nichts mehr, sie arbeiten gratis.
Vielen Dank, Frau Rechnungshofpräsidentin, für den Einkommensbericht, der uns viele Hintergrundzahlen liefert, damit man versteht, warum das so ist. Zum Teil verstehen wir es, und natürlich gilt es da, viel zu tun.
Der eine Faktor ist Teilzeit. Wenn man ihn abzieht, verdienen Frauen aber im Durchschnitt noch immer um mehr als 8 000 Euro im Jahr weniger. Das allein ist es also nicht.
Dann gibt es den sogenannten bereinigten Equal-Pay-Day: Man rechnet die Branche heraus – es wird gesagt, Frauen suchen sich die schlechtbezahlten Branchen aus –, auch die Firmengröße scheint eine Rolle zu spielen, das Bundesland et cetera, et cetera, der Bildungsabschluss, die Erfahrung. Trotzdem aber bleibt ein bereinigter Equal-Pay-Day-Wert, also das, was wir nicht mehr erklären können, von über 11 Prozent übrig! Das heißt, circa ab jetzt, ab heute, arbeiten Frauen unerklärlicherweise gratis bis zum Ende des Jahres. – Ich glaube, das sind sehr traurige Nachrichten.
In den ersten fünf Jahren der Berufstätigkeit sind es übrigens nur 10 Prozent, bei weiblichen Führungskräften 19 Prozent.
Eine sehr schockierende Zahl – ich möchte hier nur dieses Bild zeigen (eine Tafel mit der Aufschrift „Einkommensunterschiede Männer und Frauen in Österreich“ und einem Säulendiagramm in die Höhe haltend) –: Man sieht – ich hoffe, es ist
halbwegs ersichtlich, ich zeige es allen Interessierten nachher noch einmal –, bei den Beamten und Beamtinnen ist kein Unterschied; bei den Vertragsbediensteten ist ein kleiner Unterschied; ein riesiger Unterschied ist bei den Angestellten und auch bei den Arbeiterinnen und Arbeitern.
Da haben wir also wirklich großen Handlungsbedarf, und übrigens auch bei den Selbstständigen. Da ist die Kluft in den letzten 20 Jahren sogar massiv auseinandergegangen, von – ich glaube, Sie können es nicht erraten, im Hörsaal würde ich jetzt die Frage an die Studierenden stellen – 43 Prozent auf 55 Prozent, wie wir im Rechnungshofausschuss auch diskutiert haben! Ich glaube, da brauchen wir noch mehr Informationen zu den Branchen, und ich hoffe, dass das im nächsten Bericht enthalten ist.
Aber was ist die Lösung? – Teilzeit – wir arbeiten daran, dass zumindest die Möglichkeit besteht, dass auch Menschen mit Betreuungspflichten aller Art jene Art von Berufstätigkeit wählen können, die sie wollen. (Abg. Greiner: 4,5 Milliarden fehlen!) Das allein reicht aber nicht. Ich glaube, es geht auch wirklich ganz stark um Einkommenstransparenz, denn gut ausgebildete Frauen akzeptieren dann einfach nicht mehr, dass sie weniger verdienen als ihre Männer. In Zeiten des Fachkräftemangels wird das eine Pflicht für Unternehmen, ihre Frauen, ihre Mitarbeiterinnen adäquat zu bezahlen. – Danke. (Beifall bei den Grünen sowie der Abg. Pfurtscheller.)
9.45
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Loacker. – Bitte.
Abgeordneter Mag. Gerald Loacker (NEOS): Frau Präsidentin des Rechnungshofes! Ja, da wird lamentiert, von roter Seite, von grüner Seite, beispielsweise dass Frauen niedrigere Pensionen als Männer haben. Da frage ich mich: Wo bleibt das Pensionssplitting, das ihr im Koalitionsvertrag habt, geschätzte Grüne? Das kommt nämlich nicht. (Beifall bei den NEOS.)
Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, die Roten sind überhaupt gegen das Pensionssplitting. Ihnen ist lieber, sie können über den Unterschied der Pensionen zwischen Männern und Frauen jammern, anstatt etwas zu tun!
Der Einkommensbericht des Rechnungshofes schildert ja auch andere Ungerechtigkeiten aus, nicht nur jene zwischen Männern und Frauen, nämlich beispielsweise die Unterschiede zwischen den Beamten und den normalsterblichen Sozialversicherten: Die durchschnittliche Beamtenpension wird bis 2028 von derzeit 3 300 Euro auf 4 000 Euro steigen, während die durchschnittliche Sozialversicherungspension im selben Zeitraum von 1 319 Euro auf 1 870 Euro steigen wird. In Prozent heißt das, der Abstand verkürzt sich, aber in Euro wird er sogar größer.
15 Prozent der Pensionsbezieher sind Bezieher von Mehrfachpensionen. Diese sind dann besonders hoch, wenn die Witwe selbst Beamtin und der verstorbene Gatte auch Beamter war. Dann nämlich kommt eine solche Witwe auf eine durchschnittliche Jahresversorgung von 62 000 Euro. Das sind Dinge!
Jetzt wird man von schwarzer Seite einwenden: Ja die Harmonisierung der Beamtenpension ist eh beschlossen – mit einer Übergangsfrist bis zum Jahre Schnee! Das Pensionskonto wurde ja für Normalsterbliche ab Jahrgang 1955 und für die Beamten ab Jahrgang 1976 eingeführt, und da frage ich mich, woher diese 21 Jahre Unterschied kommen. (Beifall bei den NEOS. – Abg. Ottenschläger: ... Übergangsfrist der Harmonisierung ...!)
Heute tagt auch die Alterssicherungskommission, und sie wird ihre Mittelfristprognose bekannt geben. Unfassbar frech hat mir der Sozialminister in einer Budgetanfragebeantwortung ausgerichtet, dass dieses Gutachten dem Nationalrat nicht vorgelegt werden wird. – Was fällt dem eigentlich ein?
In diesem Mittelfristgutachten steht beispielsweise, dass die Pensionen schneller steigen als die Einkommen der Erwerbstätigen – bitte, in einem Umlageverfahren ist das ein massives Problem, weil wir ja die Pensionen aus den Beiträgen speisen müssen! (Beifall bei den NEOS.)
Einen Bericht mit einem derart desaströsen Ergebnis, bei dem die Handlungsnotwendigkeit offensichtlich ist, dem Parlament vorzuenthalten, das kann ja echt nur ein sozialromantischer, von der Realität völlig abgehobener Sozialminister verantworten. (Beifall bei den NEOS.)
9.48
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Frau Rechnungshofpräsidentin Kraker. – Bitte.
Präsidentin des Rechnungshofes Dr. Margit Kraker: Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Auf der Tagesordnung steht der Allgemeine Einkommensbericht 2022. Es ist dies eine Sonderaufgabe des Rechnungshofes nach dem Bezügebegrenzungsgesetz, und er bezieht sich auf die Einkommen der Jahre 2020 und 2021. Wir haben ihn schon Ende 2022 vorgelegt und auch veröffentlicht.
Dieser Bericht stellt die durchschnittlichen Einkommen der gesamten Bevölkerung nach Branchen, Berufsgruppen und Funktionen getrennt dar und wird jedes zweite Jahr Nationalrat, Bundesrat und auch den Landtagen vorgelegt. Wir differenzieren nach Altersgruppen, nach Branchen, Berufsgruppen, Funktionen, Dauer der Betriebszugehörigkeit, Bildung, Vollzeit, Teilzeit; weiters stellen wir auch die Gruppe der atypisch Beschäftigten dar. Wir haben auch einen Bundesländervergleich in diesem Bericht, und wir stellen Entwicklungen dar: die Entwicklung der Einkommen der unselbstständig Erwerbstätigen ab dem Jahr 1998 – das war das erste Jahr, das Jahr, seit dem es diesen Bericht gibt –, und ergänzt haben wir es um die Entwicklung der Einkommen der ganzjährig Vollzeitbeschäftigten ab dem Jahr 2004.
Dieser Einkommensbericht ist ein transparentes Nachschlagewerk, auch ein statistisches Nachschlagewerk, denn wir erstellen diesen Bericht gemeinsam mit der Statistik Austria, mit Zahlen und Fakten, die eine Grundlage für Ihre Arbeit darstellen können. Wir haben auf unserer Webseite zusätzlich noch interaktive Grafiken erstellt, anhand derer Sie differenziert herausfiltern können, was Sie wissen wollen. Datenquellen sind die Lohnsteuerdaten, Daten der Sozialversicherungsträger und Mikrozensusdaten, und wir stellen das jeweilige Medianeinkommen dar. Es ist dies eine deskriptive Darstellung und, wie es schon gesagt wurde, kein Bericht über die Ursachen von Veränderungen, für die Entwicklung bestimmter Einkommen. Das geht auf Basis dieser Methodik nicht.
Nun zu den wesentlichen Ergebnissen: Es gab im Jahr 2021 rund 4,5 Millionen unselbstständig Erwerbstätige. Verglichen mit 2019 – vor Covid – sank der Wert um 0,9 Prozent. Im Vergleich zu 2012 entspricht das einem Anstieg um 10,8 Prozent. Das mittlere Bruttojahreseinkommen von unselbstständig Erwerbstätigen im Jahr 2021 lag bei 31 407 Euro. Frauen erzielten 64,5 Prozent des mittleren Männereinkommens. Arbeiterinnen und Arbeiter verdienten durchschnittlich 23 248 Euro, Angestellte 35 302 Euro und Vertragsbedienstete im öffentlichen Bereich 37 770 Euro. Die Beamtinnen und Beamten erzielten ein höheres Einkommen. Das hängt auch mit der Kleinheit dieser Gruppe zusammen, weil es ja jetzt überwiegend Vertragsbedienstete gibt, und auch mit der anderen Zusammensetzung.
Während die Beschäftigungsquote in den letzten Jahren deutlich steigt und damit die Zahl der unselbstständig Beschäftigten sich auf einem hohen Niveau bewegt, blieb die Anzahl der insgesamt in Österreich von unselbstständig Beschäftigten geleisteten Arbeitsstunden mit 5,8 Milliarden Stunden im Jahr 2022 seit 2008 weitgehend konstant. Das steht insbesondere mit der Erhöhung der Teilzeitquote im Zusammenhang. 2022 waren in Österreich bereits 31,2 Prozent der unselbstständig Beschäftigten in Teilzeit beschäftigt. Mehr als die Hälfte der unselbstständig beschäftigten Frauen, nämlich knapp 52 Prozent, waren in Teilzeit beschäftigt. Damit lassen sich die Einkommensnachteile der
Frauen zum Teil auf Teilzeitarbeit zurückführen. Bei Männern lag der Anteil von ganzjährig Erwerbstätigen in einem Teilzeitarbeitsverhältnis bei nur 12 Prozent. Aber auch wenn man die ganzjährig Vollzeitbeschäftigten miteinander vergleicht, ergibt sich, dass Frauen nur 87 Prozent des mittleren Männereinkommens erzielen. Da fehlt noch ein Delta von 13 Prozent.
Was sind die Gründe für die Teilzeitbeschäftigung? – Der häufigste Grund für Teilzeitarbeit ist die Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen. In diesem Zusammenhang ist es natürlich wichtig, dass im Rahmen des Finanzausgleichs das Thema Ausbau der Kinderbetreuung und Verbesserungen im Bereich der Elementarpädagogik aufgegriffen wird. Zusätzliche Betreuungsmöglichkeiten für unter Dreijährige sollen die Erwerbstätigkeit für Frauen erleichtern, deshalb brauchen wir die notwendigen Unterstützungsangebote.
Man muss aber zwischen freiwilliger und unfreiwilliger Arbeit in Teilzeit unterscheiden, auch darauf muss man ein Augenmerk legen. Die Gründe für Teilzeitarbeit sind bei Männern und Frauen unterschiedlich. Während bei Frauen die Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen der wichtigste Grund für die Teilzeitbeschäftigung ist, geben Männer das nur zu 7 Prozent als Grund für die Teilzeitarbeit an. Sie bleiben in Teilzeit, weil sie sich schulisch oder beruflich weiterbilden wollen.
Mir ist es ein Anliegen, dass wir in Gesprächen mit der Statistik Austria vielleicht versuchen, darauf noch näher einzugehen, um diesem Phänomen in Zukunft noch mehr auf den Grund zu gehen. Frau Abgeordnete Götze hat das schon gesagt. Es ist nämlich von Interesse, wie sich das stundenmäßige Ausmaß der Teilzeitarbeit entwickelt und wie sich der diesbezügliche Frauenanteil gestaltet. Es wäre wichtig, da einen Vergleich zwischen Bundesländern, Altersgruppen und nach Geschlechtern differenziert anzustellen.
Auch Branchenunterschiede gibt es: Ich nenne beispielhaft die Branche der Energieversorgung, in der man gut verdient, was mit einem hohen Vollzeitanteil und einem geringen Frauenanteil korrespondiert. Im Bereich Gesundheit und
Sozialwesen gibt es ein relativ geringes mittleres Einkommen bei geringstem Vollzeitanteil und höchstem Frauenanteil. Und in der Branche Beherbergung und Gastronomie gibt es das geringste mittlere Einkommen bei geringem Vollzeitanteil und hohem Frauenanteil.
Bei den selbstständig Erwerbstätigen konnten wir nur auf die Zahlen von 2019 zurückgreifen. Da gibt es große Unterschiede zwischen den einzelnen Wirtschaftsbereichen. Im Bereich der freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen gibt es die höchsten Einkommen. Am Ende der Medianeinkommen finden sich bei den ausschließlich Selbstständigen solche im Bereich von Grundstücks- und Wohnungswesen.
Ich komme nun zu den Pensionistinnen und Pensionisten. Im Jahr 2021 hatten 2,2 Millionen Personen in Pension ihren Wohnsitz in Österreich. Diese sind hier erfasst. Da sind die Frauen in der Mehrheit, ihr Anteil unter den Pensionistinnen und Pensionisten beträgt 56 Prozent. Im Mittel betrug das Einkommen der Pensionistinnen und Pensionisten mit Wohnsitz in Österreich 23 296 Euro brutto. Der Einkommensnachteil der Frauen ist auch da erkennbar: Das durchschnittliche Einkommen der Frauen lag bei 18 638 Euro und das der Männer bei 29 574 Euro. Die Pensionistinnen erzielten damit 71 Prozent der männlichen Vergleichsgruppe. Eine Sonderstellung in diesem Zusammenhang nehmen Witwen und Witwer ein, denn wenn man die Witwen- und Witwerpensionen dazurechnet, dreht sich das um, weil die Höhe vom Einkommen der verstorbenen Partnerin beziehungsweise des verstorbenen Partners abhängig ist.
Die höchsten Einkommen der Pensionistinnen und Pensionisten erzielten Alterspensionistinnen und -pensionisten. Diese Pensionsart stellt damit die beste Basis für die Einkommenssicherung im Alter dar, und darauf verweisen wir auch in unserem Bericht zur Nachhaltigkeit des Pensionssystems. In diesem Bericht gehen wir auch auf den Genderpaygap und auf die Abschläge bei
vorzeitiger Alterspension ein. – Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. (Beifall bei der ÖVP sowie bei Abgeordneten von SPÖ, FPÖ, Grünen und NEOS.)
9.57
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Schmiedlechner. – Bitte.
Abgeordneter Peter Schmiedlechner (FPÖ): Sehr geehrte Frau Rechnungshofpräsidentin! Sehr geehrte Zuseher! Herr Präsident – noch immer hier! (Abg. Michael Hammer: Länger da als du!) Das zeigt einmal mehr, dass die ÖVP gerne mit zweierlei Maß messt (Abg. Michael Hammer: Misst! Misst!), mit zweierlei Maß misst. Normalerweise sind nämlich die ÖVPler immer die Ersten, die gleich schreien und Verdächtigungen äußern und andere zum Rücktritt auffordern. (Der Redner stellt eine Tafel mit der Überschrift „Durchschnittliche Einkommen im Jahr 2022“ und einem Säulendiagramm auf das Redner:innenpult.)
Wir diskutieren alle zwei Jahre den Einkommensbericht. Dieses Mal liegt der Durchschnitt der Bruttoeinkünfte bei 31 407 Euro. Die niedrigsten Bruttoeinkünfte von allen unselbstständig Erwerbstätigen haben – wie übrigens immer – die Arbeiter, sie verdienen mit circa 23 248 Euro am schlechtesten. Das ist wenig. Es ist daher kein Wunder, dass sich die Menschen das Leben nicht mehr leisten können, dass sich immer mehr Leute darüber beschweren, sich den Einkauf nicht mehr leisten können, sich das Heizen, die teuren Energiekosten nicht mehr leisten können. Das ist Ihre Politik, liebe ÖVP. (Beifall bei der FPÖ.)
Schauen wir uns im Vergleich dazu die Einkommen in der Landwirtschaft, die Einkommen der bäuerlichen Betriebe an; wir haben ja erst vor Kurzem den Grünen Bericht diskutiert. Das durchschnittliche Betriebseinkommen eines landwirtschaftlichen Betriebs liegt bei 45 757 Euro. In einem Landwirtschaftsbetrieb sind aber mehrere Personen tätig, laut Grünem Bericht im Durchschnitt 2,7 Personen, das heißt, das Einkommen für eine Person liegt bei
16 947 Euro. Da sind wir weit unter dem, was ein Arbeiter verdient. Da stelle ich wirklich die Frage an die ÖVP, an den ÖVP-Bauernbund: Was habt ihr die letzten Jahre getan? – Nichts! (Abg. Zanger: Sind die Bauern selber schuld!)
Wenn man sich das anschaut (Zwischenruf bei der ÖVP) – 365 Tage Arbeit und dieses Einkommen weit unter dem der Arbeiter –, dann muss man sagen, das ist eine schlechte Leistung Ihrer Regierungspolitik. (Abg. Zanger: Wien Energie!) Auf keinen Fall möchte ich jetzt aber anfangen, Gruppen auseinanderzudiskutieren, denn - - (Na-Rufe bei der ÖVP. – Abg. Zanger: Was jammert ihr denn da schon wieder! – Abg. Strasser: Jetzt sind wir wieder für alle da?! – Rufe bei der ÖVP: Was jetzt?! – Abg. Michael Hammer: In dir steckt ein kleiner Sozi! – Abg. Hofinger: Bist jetzt für die Bauern oder nicht? – Abg. Michael Hammer: Was kostet eine Sau derzeit?) – Herr Bauernbundpräsident, Sie können dann gerne hier heraus kommen und die schlechten Zahlen argumentieren.
Trotzdem will ich jetzt nicht die Gruppen auseinanderdiskutieren, denn wir alle spüren die Teuerung, wir alle haben mit den Teuerungen zu kämpfen. Da kann man abschließend einfach nur mehr fragen: Was bleibt von Ihrer Politik übrig? – Armut trotz Arbeit! Das ist die Leistung Ihrer (in Richtung ÖVP weisend) Regierungsbeteiligung und Ihrer (in Richtung Grüne weisend) Regierungsbeteiligung. Bitte treten Sie zurück und erlösen Sie uns alle! (Beifall bei der FPÖ. – Abg. Michael Hammer: Du wirst Erlösung finden, wenn ...! – Abg. Obernosterer – in Richtung des sich zu seinem Sitzplatz begebenden Abg. Schmiedlechner –: Da musst du selber lachen!)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist damit geschlossen.
Wünscht der Berichterstatter ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall.
Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag des Rechnungshofausschusses, den vorliegenden Bericht III-792 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen.
Wer für die Kenntnisnahme ist, den bitte ich um ein entsprechendes Zeichen. – Das ist eine einstimmige Kenntnisnahme.
Bericht des Rechnungshofausschusses über den Bericht des Rechnungshofes betreffend AustriaTech – Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH; Follow-up-Überprüfung – Reihe BUND 2022/33 (III-793/2273 d.B.)
5. Punkt
Bericht des Rechnungshofausschusses über den Bericht des Rechnungshofes betreffend Nationalpark Hohe Tauern – Reihe BUND 2023/18 (III-982/2274 d.B.)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Wir kommen zu den Tagesordnungspunkten 4 und 5, über welche die Debatten unter einem durchgeführt werden.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Kaufmann. – Bitte sehr.
Abgeordnete Martina Kaufmann, MMSc BA (ÖVP): Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Rechnungshofpräsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen hier im Hohen Haus! Meine Damen und Herren zu Hause und hier im Hohen Haus, die Sie jetzt die Debatten mitverfolgen! Ich muss schon sagen, diese stimmt mich wirklich nachdenklich.
Es gibt ganz, ganz viele Kolleg:innen hier im Hohen Haus, die eine ernsthafte politische Debatte führen – natürlich mit allen unterschiedlichen Zugängen –, und dann gibt es Kolleginnen und Kollegen von den Freiheitlichen – heute Männer –, bei denen das nicht so ist. Ich erwähne explizit Herrn Kollegen Zanger,
der sich hierherstellt, auf der einen Seite sexistische Äußerungen von sich gibt und auf der anderen Seite persönliche Beleidigungen ausspricht.
Ich glaube, das müssen auch die Menschen zu Hause erfahren, das auch mitkriegen und hören, wie hier agiert wird. Die Freiheitlichen haben, egal was im Moment passiert, keine einzige Antwort auf die Herausforderungen, die wir haben, sondern äußern Beschimpfungen, Beleidigungen und sind im Dirty Campaigning unterwegs. (Beifall bei der ÖVP.)
Ich glaube, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das haben auf der einen Seite wir alle hier, die wir konstruktive Sachpolitik betreiben, nicht verdient und das haben sich auf der anderen Seite auch die Menschen in Österreich nicht verdient, dass nicht an den Zukunftsthemen gearbeitet wird, sondern dass hier immer wieder sexistische, beleidigende Äußerungen wiederholt werden, und das auf eine Art und Weise, die diesem Haus nicht würdig ist. (Beifall und Bravoruf bei der ÖVP.)
Nun aber zu dem vorliegenden Bericht des Rechnungshofes, der uns auch aufgezeigt hat, wie die AustriaTech sozusagen agiert und welche Maßnahmen dort umgesetzt wurden. Für alle, die es nicht so im Detail wissen: Die AustriaTech beschäftigt sich mit den Klimazielen und diversen Klimaprojekten, die in Österreich durchgeführt werden. Da hat der Bericht auch aufgezeigt, dass sehr, sehr viele Projekte umgesetzt und realisiert wurden, die auch explizit dem Klimaschutz in Österreich dienen.
Viele Maßnahmen wurden aufgezeigt. Bundesministerin Leonore Gewessler hat uns im Ausschuss versichert beziehungsweise konnte der Rechnungshof auch schon attestieren, dass sie umgesetzt worden sind. Viele Bereiche sind damit schon abgedeckt. Zwei Bereiche sind noch offen, nämlich die Schnittstellenanbindung im Ministerium auf der einen Seite und die Personalbewirtschaftung auf der anderen Seite. Da gibt es durchaus noch Verbesserungsbedarf, das zu erkennen ist wichtig. Es ist auch für uns hier im Haus wichtig, für unsere Arbeit,
dass wir das wissen, aber es ist natürlich auch im Sinne der Transparenz wichtig, dass jede Bürgerin und jeder Bürger das nachvollziehen kann.
Daher auch noch einmal ein großes Danke an den Rechnungshof, der das aufzeigt, und auch die Bitte an die Ministerin, die das im Ausschuss sehr klar dargelegt hat, dass sie das mit ihrem Haus auch umsetzen wird. In einigen Jahren wird wieder ein Bericht vorliegen, wobei auch erarbeitet werden wird, inwieweit das im Ministerium umgesetzt worden ist. Wir werden uns das weiter anschauen und werden dahinter sein, damit auch im Klimaschutz in Österreich vieles weitergeht und vieles weiter umgesetzt wird, was in den letzten Jahren ja schon begonnen hat; einiges ist wirklich schon sichtbar geworden. – Herzlichen Dank noch einmal für den Bericht. (Beifall bei der ÖVP.)
10.05
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordnete Greiner. – Bitte sehr.
Abgeordnete Mag. Karin Greiner (SPÖ): Sehr geehrte Damen und Herren! Was ist die AustriaTech? – Die AustriaTech ist eine Gesellschaft des Bundes. Was ist ihre Kernaufgabe? – Kernaufgabe ist es, das Ministerium in Fragen der Transformation, insbesondere der Dekarbonisierung zu unterstützen.
Der Rechnungshof hat einige Punkte kritisch aufgegriffen. Unter anderem hat er kritisiert, dass die Eigentümerstrategie nicht erneuert wurde. Das ist insofern relevant, als davon ja die Mittelfristplanung abhängt, die so nicht erfolgen konnte, und insofern relevant und bedenklich, wenn man sich die sich rasch entwickelnden technologischen Fortschritte anschaut. Da bedarf es schon auch einer aktuellen Strategie dazu.
Welche Punkte hat der Rechnungshof noch beleuchtet? – Er hat gesagt, die Schnittstellen zwischen dem Ministerium und der Gesellschaft sind nicht definiert. Das ist alles andere als ideal, wenn man nicht weiß, wer genau wofür
genau zuständig ist. Die Schnittstellen sollten klar benannt und auch schriftlich fixiert sein.
In diesem Zusammenhang ist auch die Frage der Personalüberlassungen von der AustriaTech an das Ministerium interessant, vor allem deshalb interessant, weil sie auf unbestimmte Zeit erfolgt sind. Mittlerweile sind es zwar nur mehr zwei, aber trotzdem ist nicht erklärlich, warum das so sein muss. Sie haben das auch mit der Frau Ministerin debattiert, und sie hat auch gemeint, dass das nicht der Idealzustand ist. Wir kritisieren das auch deshalb, weil mit dieser Überlassung der Personalstellenplan, den ja der Nationalrat beschließt, unterlaufen wird. Da muss man, glaube ich, wirklich Klarheit schaffen und Personalstände klar führen. (Beifall bei der SPÖ.)
Die Dekarbonisierung – Kernaufgabe der Gesellschaft – schlägt sich prozentuell nur mit 14 Prozent nieder, wie sich zeigt, wenn man sich die Projekte anschaut. Das ist zu wenig. Das hat auch die Frau Ministerin so verstanden, und sie hat gemeint, das sollte man mindestens auf 50 Prozent sichtbar erhöhen.
Im Gegensatz zu meiner Vorrednerin sehe ich noch einige offene Aufgaben. Es war zum Zeitpunkt der Prüfung nur ein Drittel der Empfehlungen de facto umgesetzt, und zwar geht es auch um die Zieldefinitionen bei den Projekten und Initiativen. Ich meine unter anderem die Förderinitiativen, da muss für alle Transparenz hergestellt sein, das heißt, man muss wissen, warum welche Förderung in welcher Höhe gewährt wird; das Problem haben wir in anderen Bereichen mehr als ausführlich zu diskutieren. Und es müssen auch Wirkungsziele und Kennzahlen klar festgeschrieben werden, denn dann ist klar, das geht auch mit den Zuständigkeiten einher – klare Kennzahlen, klare Ziele, insbesondere natürlich auch für Prämienauszahlungen.
Da gibt es noch einiges zu berichtigen, klar zu definieren. Die Geschäftsführung ist, glaube ich, am Arbeiten. Wir sind guter Hoffnung, aber bitte: Tempo erhöhen! – Danke. (Beifall bei der SPÖ.)
10.08
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Schmiedlechner. – Bitte, Herr Abgeordneter. (Zwischenruf des Abg. Hörl.)
Abgeordneter Peter Schmiedlechner (FPÖ): Frau Rechnungshofpräsident! (Der Redner wendet sich Richtung Präsidium.) Jetzt bin ich wieder da, der Herr Präsident ist noch immer da. (Abg. Michael Hammer: Der wird noch länger da sein! – Ruf bei der ÖVP: Länger als wie du!)
Zum Bericht des Rechnungshofes betreffend den Nationalpark Hohe Tauern: Der Bericht ist sehr gut. Man kann vorweg sagen: Österreich hat insgesamt sechs Nationalparks, der Nationalpark Hohe Tauern war der erste Nationalpark in Österreich und ist auch der größte Nationalpark in Österreich. Das Bemerkenswerte an diesem Nationalpark ist, dass er sich über drei Bundesländer erstreckt, und zwar Salzburg, Tirol und Kärnten (Abg. Hörl: Hohe Berge, Schmiedlechner! Hohe Berge!) – hohe Berge, jawohl, keine Seilbahn. (Abg. Hörl: Doch! – Ruf bei der ÖVP: Na sicher!)
Der Rechnungshof hat einige Kritikpunkte hervorgehoben, unter anderem jenen, dass da eine aufwändige Verwaltung stattfindet: Es gibt in jedem Bundesland eine eigene Verwaltung, wodurch die Zusammenarbeit der drei beteiligten Bundesländer ziemlich schwierig ist, was bei der Maßnahmendurchführung oft zu einem Chaos führt.
Dazu kann man nur sagen, das ist typisch ÖVP: Man muss die Verwaltung recht groß aufblasen, damit man dort viele Leute unterbringt: Kuratorium plus ein Komitee in Kärnten, ein Beirat in Salzburg und Tirol, eine Direktion, Geschäftsführung und so weiter und so fort.
Natürlich kann man jetzt sagen, das ist alles sehr wichtig, um die Länderkompetenzen auszuüben und um die Wahrung der Länderinteressen sicherzustellen. Das ist ganz klar. Nichtsdestotrotz denken wir, dass man im Sinne der Verwaltung dort durchaus Maßnahmen setzen kann.
Was mir auch noch besonders wichtig ist: Im Nationalpark befinden sich 300 bewirtschaftete Almen, und momentan sind gerade diese Kulturlandschaft, diese Region und diese Form der Bewirtschaftung massiv durch den Wolf gefährdet. Dort muss man sich in Zukunft wirklich etwas überlegen – nicht nur scheinheilige Aussagen machen und Maßnahmen setzen, die nichts bringen (Abg. Hechenberger: Du wirst es nicht verstehen, Peter! Ich habe es dir schon so oft erklärt! Du musst einmal auf Nachschulung!), sondern man muss sich wirklich etwas überlegen, um diese Kulturlandschaft und den Artenreichtum dort zu erhalten. Es kann nicht sein, dass dort der Wolf das gesamte Ökosystem, das über Jahrzehnte aufgebaut worden ist, zerstört. (Abg. Eßl: Steht das im Bericht? – Abg. Hechenberger: Steht das im Bericht, Peter? Steht das im Bericht? – Abg. Eßl: Steht das im Rechnungshofbericht?)
Wir werden diesen Rechnungshofbericht zur Kenntnis nehmen und geben unsere Zustimmung, und ich hoffe natürlich, dass wir für die Probleme und die Kritikpunkte Lösungen finden können. (Beifall bei der FPÖ. – Abg. Hechenberger: Steht das im Bericht? – Weitere Zwischenrufe bei der ÖVP.)
10.11
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordnete Böker. – Bitte.
Abgeordnete Ulrike Maria Böker (Grüne): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Herr Präsident! Geschätzte Kolleg:innen! Geschätztes Publikum! Vielen Dank an den Rechnungshof, den ich schon im Oberösterreichischen Landtag schätzen gelernt habe. Sehr klar, sehr verständlich, sehr transparent – vielen Dank für diesen Bericht!
Ich möchte mich dabei auf den geplanten Hochwasserschutz im Oberen Pinzgau konzentrieren. Der Obere Pinzgau war ja schon mehrmals und insbesondere 2021 sehr von großen Hochwässern betroffen. Die Betroffenheit der Bevölkerung
ist gut nachzuvollziehen, und selbstverständlich sind Hochwasserschutzmaßnahmen zu planen und umzusetzen. – Ich selbst komme aus dem Eferdinger Becken, aus Ottensheim, und vielleicht können sich manche an das große Hochwasser im Jahr 2013 erinnern, durch das Haus und Hof beschädigt und auch Häuser weggerissen wurden. Ich weiß daher, wovon ich spreche.
Ich kenne als ehemalige Bürgermeisterin aber auch den hohen Nutzungsdruck, den es gibt und der auch vor dem Oberen Pinzgau nicht Halt macht. Ja, Hochwasserschutz ist notwendig, es ist nur die Frage nach dem Wie zu stellen. Das hat der Rechnungshof in seinem Bericht getan, aber nicht nur der Rechnungshof, auch WWF, Naturfreunde, Grundeigentümer:innen und der Alpenverein. Alle stellen die Frage nach einer ernsthaften Alternativenprüfung, damit die Schutzgüter des Nationalparks weniger stark beeinträchtigt werden.
Der Rechnungshof weist auch kritisch darauf hin, dass rund 22 Prozent des Speichervolumens in der Kernzone des Nationalparks, sogar im wunderschönen Wildnisgebiet Sulzbachtäler, liegen würden. Ich war letztes Jahr in diesem Gebiet wandern, und bei Annahme einer Wassertiefe von 20 Metern stünde im Krimmler Achental eine Fläche in der Größe von 26 Fußballfeldern unter Wasser. Ich kann mir nicht vorstellen, was das für diese schöne Gegend bedeuten würde, wenn sowohl die Bau- als auch die Betriebsphase Zufahrtsstraßen und Arbeiten mit schwerem Gerät notwendig machen würden.
Wir haben in den letzten Jahrzehnten dem Wasser viel zu viel Raum weggenommen. Wir haben Flächen gewidmet, die ungeeignet waren und sind, und gleichzeitig den Bodenverbrauch befeuert, und wir verbrauchen noch immer 11 Hektar pro Tag und werden die 2,5 Hektar, die auch im Regierungsprogramm stehen, nicht erreichen, auch nicht bis 2030.
Ja, Hochwasserschutz ist im Oberen Pinzgau notwendig, aber dabei ist sensibel mit dem Schutzstatus umzugehen und sind verträgliche Lösungen für Mensch,
Flora und Fauna zu suchen und auch zu finden. Das muss das gemeinsame Ziel sein.
Vielen Dank für diesen Bericht, der sehr viel umfangreicher ist als das, was ich jetzt hier angesprochen habe! – Danke schön. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
10.14
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort kommt die Frau Präsidentin. – Bitte.
Präsidentin des Rechnungshofes Dr. Margit Kraker: Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Lassen Sie mich auch kurz zu unserem umfangreichen Prüfbericht Nationalpark Hohe Tauern Stellung nehmen. Wir haben diesen Bericht im Juli vorgelegt, und dieser Bericht zeigt eigentlich die Stellung des österreichischen Rechnungshofes, denn wir konnten prüfen und haben geprüft: das Klimaministerium und alle Ländereinheiten, die es dazu in drei Ländern gibt, sowohl die Landesverwaltungen als auch die Nationalparkfonds der Länder und das Ratssekretariat. Das ergibt eben diese übergreifende Sicht des Rechnungshofes, im Rahmen derer darauf geachtet wird, dass sozusagen die Ziele dieses Nationalparks auch entsprechend erreicht werden können und wie die verschiedenen Akteure miteinander interagieren, um gleiche Interessen zu vertreten.
Gegenstand der Prüfung waren die Finanzierung und Organisation des Nationalparks, die Aufgabenwahrnehmung der überprüften Stellen und die Zusammenarbeit und Abstimmung von Bund und Ländern in der Nationalparkverwaltung.
Ja, es wurde schon gesagt, der Nationalpark Hohe Tauern ist der größte und älteste Nationalpark Österreichs, und es ist so, dass es in einem Nationalpark natürlich ein Spannungsfeld zwischen den verschiedenen Interessen gibt. Die
Schutz- und Nutzungsinteressen und die touristische Nutzung stehen in einem Spannungsverhältnis zueinander.
Ich komme damit zu vier zentralen Aussagen des Berichtes. Das Erste, was uns aufgefallen ist: Die Strukturen für die Verwaltung und Steuerung des Nationalparks sind komplex, was aus der Entstehungsgeschichte des Nationalparks resultiert. Die aktuelle Organisationsform stammt schon aus den 1980er-Jahren und hat sich eben so entwickelt. Damit erfüllte sie die Anforderungen an eine Bund-Länder-Verwaltungsstruktur zur Zeit der Gründung. Mittlerweile haben wir auch andere Nationalparks, die etwa in Form einer GmbH organisiert sind.
Zweitens zur Finanzierung: Die Finanzierung des Nationalparks durch den Bund und durch die drei Länder war zunehmend unausgewogen. Die Basisfinanzierung der Nationalparkfonds bestand aus jährlichen Fördermitteln des Bundes sowie Zuwendungen der Länder. Der Anteil des Bundes an der Gesamtfinanzierung betrug durchschnittlich 19 Prozent in Kärnten, 22 Prozent in Salzburg, 26 Prozent in Tirol, und der Bund erhöhte seine Mittel seit 2008 nicht. Der Rückgang des Bundesanteils an der Finanzierung kann natürlich dazu führen, dass man auch einen geringeren Einfluss bei der Verwaltung und Steuerung des Nationalparks hat.
Die dritte zentrale Aussage betrifft das Thema der Eigentumsverhältnisse im Nationalpark. Die Flächen des Nationalparks sind natürlich überwiegend in privatem Eigentum, und das stellt das Nationalparkmanagement vor große Herausforderungen. Um internationalen Vorgaben zu entsprechen, müssen zumindest 75 Prozent der Kernzone im Nationalpark frei von wirtschaftlicher Nutzung sein, und das konnte bislang nur in Tirol erreicht werden. Dazu gibt es den Vertragsnaturschutz, dass man mit Nutzungsberechtigten eben Verträge schließt, und die Vereinbarungen hatten eine Laufzeit von neun oder zehn Jahren und mussten immer wieder verlängert werden. Damit ist die Außernutzungstellung nicht langfristig sichergestellt.
Das Vierte ist die Klimakrise: Das ist natürlich ein Gefährdungspotenzial für die Alpen und im Besonderen für den Nationalpark. Die Temperatur steigt hier schneller als in anderen Regionen. Die Folgen sind eine zunehmende Instabilität des Geländes, abschmelzende Gletscher, Extremwetterereignisse und natürlich auch geänderte Lebensbedingungen und klimatische Voraussetzungen für die Tier- und Pflanzenarten. Das gehört zu den zentralen Herausforderungen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten.
Deshalb haben wir auch zwei Bauvorhaben im Bericht angesprochen: Das sind einerseits die Rückhaltebecken in Salzburg, die geplant sind und bezüglich derer wir empfohlen haben, auch Alternativszenarien zu entwickeln, um zu schauen, wie die Schutzgüter des Nationalparks am besten gesichert werden können. Das Zweite ist das Thema der Schutzhütte mit einem Wegeausbau entlang des Gamsgrubenwegs an der Großglockner-Hochalpenstraße. Auch das stand unserer Meinung nach im Widerspruch mit diesen sensiblen Sonderschutzgebieten.
Die wesentliche Empfehlung ist, sich die Frage der Organisation des Nationalparks noch einmal anzuschauen und da auf eine einheitliche Führung mit einer gut funktionierenden Bund und Länder übergreifenden Struktur hinzuwirken und die ausgewogene Finanzierung des Nationalparks Hohe Tauern auch von Bundesseite sicherzustellen. – Danke schön. (Beifall bei ÖVP, Grünen und NEOS sowie bei Abgeordneten der SPÖ.)
10.19
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordnete Salzmann. – Bitte sehr.
Abgeordnete MMMag. Gertraud Salzmann (ÖVP): Herzlichen Dank, Herr Präsident, für die Worterteilung! Geschätzte Frau Präsidentin des Rechnungshofes! Liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Saal, aber auch liebe Zuseher auf der Galerie und daheim vor den Bildschirmen! Der Rechnungshof, meine Damen und Herren, stellt dem Nationalpark Hohe Tauern ein sehr, sehr gutes Zeugnis
aus. Der Nationalpark Hohe Tauern liegt in drei Bundesländern: Tirol, Kärnten und im schönen Salzburg. Er umfasst 1 800 Quadratkilometer Grundfläche und ist im Jahr 1981 als erster Nationalpark Österreichs errichtet worden.
Im Nationalpark haben wir einerseits eine geschützte Kernzone, wir haben eine Außenzone, wir haben aber auch sensible Sonderschutzgebiete. Der Rechnungshof – sehr geehrte Frau Präsidentin, Sie haben es schon ausgeführt – hat für den Nationalpark den Zeitraum von 2017 bis 2021 überprüft. Die Überprüfung fand im Jahr 2022 statt.
Der Großteil des Nationalparks – und das ist durchaus eine Eigenheit beim Nationalpark Hohe Tauern – liegt eigentlich in der Hand von Privateigentümern, mit denen Verträge über neun bis zehn Jahre geschlossen worden sind, um die Nutzung hintanzustellen, damit wirklich auch das Ziel erreicht wird, dass 75 Prozent der Kernzone frei von wirtschaftlicher Nutzung sind.
Verwaltet wird der Nationalpark durch die Nationalparkkuratorien, in denen einerseits der Bund, andererseits die Länder vertreten sind, aber auch die Stakeholder, das heißt die vielen Grundeigentümer, die auch ein Mitspracherecht haben. Die Finanzierung – Sie haben es ausgeführt, Frau Präsidentin – geht einerseits über die Fördermittel des Bundes und über die Fördermittel der Länder, andererseits aber auch über die privaten Einnahmen, die zum Beispiel die Nationalparkzentren erzielen.
Ich möchte hier hervorheben, dass in diesen Nationalparkzentren wirklich hervorragende, vor allem auch pädagogische Arbeit geleistet wird, was mich als Pädagogin auch sehr freut, weil viele Schulklassen den Nationalpark besuchen.
Ich möchte jetzt aber in zwei Bereichen auf den Prüfbericht eingehen und Folgendes herausgreifen: Einerseits steht im Rechnungshofbericht die Empfehlung, dass eine einheitlichere Bund-Länder-Struktur in der Organisation empfehlenswert wäre. Ich kann versichern, dass sich die Länder diesen Bericht sehr, sehr gut angeschaut haben, dass aber alle drei Länder ihre Stärken
in einer dezentralen Struktur für die Verwaltung sehen, in der die Grundeigentümer auch stärker eingebunden sind. Es gibt dazu auch einen Entschließungsantrag des Salzburger Landtages.
Einen zweiten Punkt möchte ich herausgreifen, der mir als Pinzgauerin natürlich ein besonderes Anliegen ist, meine Damen und Herren – die Rechnungshofpräsidentin hat es angesprochen –: Eine der zentralsten Herausforderungen wird sein, wie man der Klimakrise begegnet. Warum? – Das Gelände wird immer instabiler, die abschmelzenden Gletscher und auch die auftauenden Permafröste verursachen extreme Situationen, was die Geologie anlangt. Dazu tragen auch die Extremwetterereignisse noch zusätzlich bei.
Viele von Ihnen haben vielleicht noch die Bilder aus dem Jahr 2021 im Kopf, als heftige Überschwemmungen den Oberpinzgau quasi unter Wasser gesetzt haben, die Lokalbahn auf vielen Kilometern unterspült haben, sodass sie bis jetzt noch nicht zur Gänze wieder instandgesetzt werden konnte. Das sind viele, viele Millionen, die da hineingeflossen sind.
Meine Damen und Herren! Für uns ist ganz klar, es braucht einen ausreichend starken Hochwasserschutz (Beifall des Abg. Hörl), damit die 45 000 Bewohner im Oberpinzgau geschützt sind. Wir werden alles daransetzen und werden Alternativen prüfen, so wie das der Rechnungshofbericht auch vorsieht, aber es ist für uns klar, wir brauchen unter Umständen auch diese geplanten Retentionsbecken, um die Sicherheit der Bewohner und auch für ihr Hab und Gut zu gewährleisten. Das ist für uns ganz klar, meine Damen und Herren. (Beifall bei der ÖVP.)
Der Schutz des Menschen und der Schutz der Natur müssen Hand in Hand gehen. Dafür werden wir sorgen, das werden wir sehr genau prüfen, aber es braucht auch ganz klar den Hochwasserschutz im Oberpinzgau. – Herzlichen Dank für den ausführlichen Prüfbericht und für die Arbeit des Rechnungshofes. (Beifall bei der ÖVP sowie der Abg. Voglauer. – Abg. Haubner: Bravo, Oberpinzgau!)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist damit geschlossen.
Wünscht der Berichterstatter ein Schlusswort? – Das ist auch nicht der Fall.
Wir kommen zur Abstimmung, die ich über jeden Ausschussantrag getrennt vornehme.
Tagesordnungspunkt 4: Antrag des Rechnungshofausschusses, den Bericht betreffend AustriaTech – Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH; Follow-up-Überprüfung, III-793 der Beilagen, zur Kenntnis zu nehmen.
Wer das tut, möge das bekunden. – Das ist einstimmig.
Tagesordnungspunkt 5: Antrag des Rechnungshofausschusses, den Bericht betreffend Nationalpark Hohe Tauern, III-982 der Beilagen, zur Kenntnis zu nehmen.
Das ist ebenfalls einstimmig angenommen.
Bericht des Rechnungshofausschusses über den Bericht des Rechnungshofes betreffend Verpackungsabfälle aus Kunststoff – Reihe BUND 2022/36 (III-804/2275 d.B.)
7. Punkt
Bericht des Rechnungshofausschusses über den Bericht des Rechnungshofes betreffend Eisenbahnkreuzungen – Reihe BUND 2023/23 (III-1013/2276 d.B.)
8. Punkt
Bericht des Rechnungshofausschusses über den Bericht des Rechnungshofes betreffend Ökostromförderung am Beispiel Windkraft und Photovoltaik – Reihe BUND 2020/15 (III-126/2277 d.B.)
9. Punkt
Bericht des Rechnungshofausschusses über den Bericht des Rechnungshofes betreffend Luftverschmutzung durch Verkehr – ausgewählte Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität – Reihe BUND 2021/7 (III-245/2278 d.B.)
10. Punkt
Bericht des Rechnungshofausschusses über den Bericht des Rechnungshofes betreffend Anpassung an den Klimawandel in der Stadt Linz – Reihe BUND 2021/27 (III-372/2279 d.B.)
11. Punkt
Bericht des Rechnungshofausschusses über den Bericht des Rechnungshofes betreffend Flughafen Wien – Umbau und Erweiterung Terminal 3 – Reihe BUND 2021/41 (III-488/2280 d.B.)
12. Punkt
Bericht des Rechnungshofausschusses über den Bericht des Rechnungshofes betreffend MeteoServe Wetterdienst GmbH – nunmehr Austro Control Digital Services GmbH – Reihe BUND 2022/40 (III-820/2281 d.B.)
13. Punkt
Bericht des Rechnungshofausschusses über den Bericht des Rechnungshofes betreffend Straßenbahnprojekte Graz, Innsbruck, Linz – Reihe BUND 2023/9 (III-906/2282 d.B.)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Wir kommen zu den Tagesordnungspunkten 6 bis 13, über welche die Debatten unter einem durchgeführt werden. Es sind dies Berichte des Rechnungshofausschusses.
Hinsichtlich der einzelnen Ausschussberichte verweise ich auf die Tagesordnung.
Erste Wortmeldung: Abgeordneter Gahr. – Bitte sehr.
Abgeordneter Hermann Gahr (ÖVP): Herr Präsident! Frau Präsident des Rechnungshofes! Geschätzte Damen und Herren! Hohes Haus! Immer öfter kommt es auf Eisenbahnkreuzungen zu schweren Unfällen, sie stellen eine große Gefahrenquelle dar. Meist sind die Ursachen menschliches Fehlverhalten, mangelnde Aufmerksamkeit, fehlender Kontrollblick, Nichteinhaltung von Stoppschildern, Missachten des Rotlichtes oder Überfahren von Schranken.
Der Rechnungshof hat dazu einen sehr aussagekräftigen, aber auch dringlich zu behandelnden Bericht erstellt. Von Februar bis September 2022 wurden drei Infrastrukturunternehmen überprüft: die Graz-Köflacher Bahn GmbH, die ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft sowie die Salzburger Lokalbahn. Fazit dieses Berichtes ist: Wir brauchen auf Eisenbahnkreuzungen bessere Sicherungen und diese Maßnahmen müssten ehestmöglich erfolgen.
Der Rechnungshof hat insgesamt 21 Schlussempfehlungen ausgesprochen. Wenn man das Ganze hier als Bilanz darstellen darf, so ist zu sagen: Von 2017 bis 2021 haben sich 376 Unfälle auf Eisenbahnkreuzungen zugetragen. Dabei wurden 45 Menschen getötet und 81 schwer verletzt. Zusätzlich gab es natürlich auch hohen Sachschaden an Fahrzeugen, aber auch an der Infrastruktur.
Der Rechnungshof fordert mehr Tempo, was die Einhaltung der Eisenbahnkreuzungsverordnung aus dem Jahre 2012 betrifft, weil es da durchaus Zeiträume für Überprüfungen gibt, und diese müssen eingehalten werden.
Wenn man noch einmal Bilanz zieht: Durch die besseren Sicherungen ist die Zahl der Unfälle insgesamt zurückgegangen, seit 2012 um 26 Prozent, und auch die Zahl der Todesfälle um 40 Prozent.
Im Rechnungshofausschuss haben wir uns mit Frau Bundesminister Gewessler ausgetauscht, und es gibt einen klaren Fahrplan: Bis 2024 müssten alle Eisenbahnkreuzungen überprüft werden. Diesbezüglich ist man durchaus in Verzug, in der Zwischenzeit wurde diese Frist um fünf Jahre verlängert.
Woran scheitert das Ganze? – Einerseits sind es die Kosten zwischen Ländern, Gemeinden und Infrastrukturbetreibern, wodurch es zu längeren Verfahrensdauern kommt. Da hat uns die Frau Bundesminister zugesichert, dass es wünschenswert wäre – und sie wird daran arbeiten –, dass es einen normierten Verteilungsschlüssel gibt. Außerdem soll ein Leitfaden zur besseren Sicherung von Eisenbahnkreuzungen erstellt werden.
Zusammenfassend kann man sagen: Jedes Todesopfer, jeder Unfall ist eines beziehungsweise einer zu viel. Wir brauchen hier mehr Nachdruck, es ist notwendig, dass die Fristen eingehalten werden, was die Überprüfungszeiträume betrifft. Wir brauchen auch mehr Aufklärung, damit wir Schäden und Opfer vermeiden können. – Vielen Dank. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
10.29
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Becher. – Bitte.
Abgeordnete Mag. Ruth Becher (SPÖ): Herr Präsident! Frau Präsidentin des Rechnungshofes! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich spreche zum Bericht betreffend Verpackungskoordinationsstelle. Beim Thema Mülltrennung und insbesondere beim Plastikmüll ist Österreich europäischer Nachzügler. Österreich agiert hier, wenn man so sagen kann, immer am letzten Drücker.
Zur Umsetzung der europäischen Vorgaben zur Vermeidung, Sammlung, Verwertung und Wiederverwendung von Verpackungsabfällen waren Novellierungen des Abfallwirtschaftsgesetzes von 2002 und der Verpackungsverordnung von 2014 notwendig. Dies erfolgte erst nach Einleitung mehrerer Vertragsverletzungsverfahren sehr verspätet im Dezember 2021.
Wer Länder wie Italien besucht, sieht dort, wie viele ambitionierte Anstrengungen in diesem Bereich erfolgen. Diese Länder dürften schon heute die zukünftigen Zielvorgaben der EU erfüllen. Für Österreich sieht es aber so aus: Ab 2025 müssen 50 Prozent des Plastikmülls recycelt werden. Das Potenzial ist enorm groß: Es gibt 299 000 Tonnen Verpackungsabfälle aus Kunststoff, davon sind 214 000 Tonnen aus Haushaltsverpackungen und 85 000 Tonnen aus gewerblichen Verpackungen.
Eine der Maßnahmen zur Vermeidung von Plastikmüll ist das Verbot des Inverkehrbringens von Kunststofftragetaschen seit 1.1.2020. 2020 waren es gleich einmal 32 Prozent weniger als 2019. Das ist jetzt drei Jahre her. Meinen Antrag, meine Gesetzesinitiative dazu habe ich schon vor 15 Jahren im Hohen Haus eingebracht; das dauert halt ein bisschen.
Die Empfehlungen des Rechnungshofes sind geradezu ein Klassiker in Bezug darauf, was die Politik zu verbessern hat. Daher ist es auch sehr wichtig, dass Österreich als eines der reichsten Länder die selbst gesetzten Ziele erreicht. Mit dem bisherigen Tempo wird das aber nicht gelingen. – Vielen Dank. (Beifall bei der SPÖ.)
10.31
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Kainz. – Bitte.
Abgeordneter Alois Kainz (FPÖ): Frau Rechnungshofpräsidentin! Geschätzte Kollegen! Werte Zuseher auf der Galerie und zu Hause vor den Bildschirmen!
Frau Rechnungshofpräsidentin, vorerst einmal ein herzliches Danke für den gut aufbereiteten Bericht zur Ökostromförderung. Er ist eine gute Stütze, um sich ein klares Bild davon zu machen, in welchem Zustand diese Regierung ist.
Die derzeitige Umwelt- und Energiepolitik ist sehr von einer „Koste es, was es wolle“-Mentalität geprägt. Egal, wie hoch der Preis ist: Es muss immer eine Energiewende bis 2030 geben. Ob Strom nun teurer wird oder nicht, ob alles effizient ist oder nicht: Vollkommen egal, Schwarz und Grün haben es so beschlossen. Um die Bevölkerung etwas zu entlasten, wird die erneuerbare Energie jedoch massiv gefördert.
Der Rechnungshof hat das Ökostromfördersystem von Windkraft und Fotovoltaik der Jahre 2013 bis 2017 geprüft – eine Zeit, in der die Politik noch nicht so vom Klimawandel geprägt war wie heute. In diesem Zeitraum wurden die Erzeugung und die Einspeisung von gefördertem Ökostrom in Höhe von rund 4,7 Milliarden Euro vergütet. Rund ein Viertel des Betrages wurde vom Endverbraucher eingeholt. Wenn der Rechnungshof zum Beispiel feststellt, dass für die Festlegung der Einspeisetarife über mehr als zehn Jahre immer die gleichen Gutachter tätig waren, dann zeugt das doch von einem gewissen Verantwortungs- und Sorglosigkeitsgefühl gegenüber dem Endverbraucher.
Weiters wurden die Förderverträge sowie die Allgemeinen Bedingungen der Ökostromabwicklungsstelle kritisiert. Diese entsprechen nicht den üblichen Inhalten der Bundesförderungen.
Die von mir genannten Beanstandungen sind nur ein kleiner Auszug aus dem Rechnungshofbericht. Daran sieht man aber das Sittenbild, das im Umgang mit dem Steuergeld vorhanden ist und gelebt wird. (Beifall bei der FPÖ.)
Wie schon eingangs erwähnt, handelt es sich bei den geprüften Jahren – 2013 bis 2017 – um Jahre, in denen die Energiewende noch nicht so allgegenwärtig war, sodass man das Thema normal ansprechen konnte. Nun ist unsere
Politik, vor allem die Regierung, mit einem grünen Klimageist behaftet, und es herrscht eben diese „Koste es, was es wolle“-Mentalität. (Beifall bei der FPÖ. – Abg. Kühberger: Blödsinn!)
Ich möchte gar nicht wissen, was derzeit an Fördergeldern, verteilt nach dem großzügigen Gießkannenprinzip, ausgegeben (Abg. Kühberger: Das ist aber traurig, wenn Sie das nicht wissen!) und in weiterer Folge versenkt wird. Wahrscheinlich wird der nächste Bericht des Rechnungshofes, in dem der aktuelle Zeitraum geprüft wird, noch schlimmer ausfallen als jener, den wir gerade besprochen haben. (Beifall bei der FPÖ. – Zwischenruf des Abg. Kühberger.)
10.35
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordnete Böker. – Bitte.
Abgeordnete Ulrike Maria Böker (Grüne): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kollegen und Kolleginnen! Ich spreche jetzt zum Rechnungshofbericht zum Thema Verpackungsabfälle aus Kunststoff. Der Rechnungshof hat ja im BMK und in der Verpackungskoordinierungsstelle die Sammlung und Verwertung von Verpackungsabfällen aus Kunststoff in den Jahren 2016 bis 2020 überprüft. Anzumerken ist, dass das BMK erst seit 2020 dafür zuständig ist. Ziele der Überprüfung waren die Erhebung der rechtlichen Verpflichtungen und der Zielvorgaben für die Sammlung und Verwertung von Verpackungsabfällen, aber auch die Darstellung der Entwicklung des Abfallaufkommens.
Wenn ich zurückblicke – ich bin nun schon länger auf der Welt –: Ich habe als Kind den Müll noch mit dem Leiterwagen auf den sogenannten Schuttabladeplatz gebracht. Gott sei Dank hat sich in den letzten Jahrzehnten in der Abfallwirtschaft doch vieles von Grund auf in Richtung Abfallvermeidung und -wiederverwendung verändert.
Im Oberösterreichischen Landtag haben wir bereits 2017 in einem Antrag ein bundesweit verpflichtendes Pfandsystem für alle Getränkeverpackungen gefordert. Bei den Regierungsverhandlungen 2019 saß mir ein Kollege der ÖVP – es war Herr Kollege Kopf – gegenüber, der das vehement ablehnte und für nicht durchführbar hielt. (Abg. Hoyos-Trauttmansdorff: Trotzdem habt ihr unterschrieben!) Wie man sieht, konnte man dieses Ziel aber durch gemeinsame Diskussionen erreichen: Per 1. Jänner 2025 wird ein Pfand auf Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff eingeführt – was für ein Erfolg! (Beifall bei den Grünen.)
In den sechs Jahren im Landtag und auch in den zwölf Jahren als Bürgermeisterin war ich unter anderem für die komplexe und auch sehr komplizierte Abfallwirtschaft mit zuständig. Für mich war es oft sehr unüberschaubar, aber vor allem ist es sehr schwer, der Bevölkerung zu erklären, wie Abfallwirtschaft funktioniert: wie sie organisiert ist, wer was zahlt, wer was bekommt, wie sich die Kosten für jeden Haushalt zusammensetzen. Der Rechnungshof beschreibt genau diese umfangreichen gesetzlichen Bestimmungen für Verpackungsabfälle, aber auch die dahinterstehende Vielzahl der Akteure und Akteurinnen, und das sollte transparenter und nachvollziehbarer werden.
Auch die Sammel- und Recyclingquote wurde überprüft. Bei dieser ist doch noch einige Luft nach oben. Seit 2020 sind jedoch viele gesetzliche Bestimmungen beschlossen worden, die die Kreislaufwirtschaft vorantreiben: die Verpackungsverordnungs-Novelle 2021, die Abfallwirtschaftsgesetz-Novelle 2021 oder das schon erwähnte Pfand auf Getränkeflaschen aus Kunststoff.
Herzlichen Dank wiederum dem Rechnungshof für diesen Bericht, der sehr aufschlussreich ist und die Schwachstellen aufzeigt. Seit dem Jahr 2020 ist aber sehr vieles weitergegangen. – Ja, es ist noch genug zu tun, aber das zuständige Ministerium ist auf einem Weg, der die Kreislaufwirtschaft befeuert. Ich danke Ministerin Leonore Gewessler und ihrem Team für dieses Engagement in der Abfallwirtschaft. – Vielen Dank. (Beifall bei den Grünen.)
10.38
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Hoyos-Trauttmansdorff. – Bitte sehr.
Abgeordneter Douglas Hoyos-Trauttmansdorff (NEOS): Herr Präsident! Frau Präsidentin des Rechnungshofes! Wir diskutieren ja heute insgesamt 13 Berichte des Rechnungshofes, die auf der Tagesordnung stehen.
Frau Präsidentin Kraker, Sie haben es schon angesprochen: Ich finde es auch sehr erfreulich, dazu einmal zu einer Tageszeit zu sprechen, bei der der Himmel ein bisschen heller ist, denn normalerweise wird es relativ spät. (Abg. Meinl-Reisinger: Stimmt!) Ich glaube, es ist etwas sehr Positives, wenn wir Rechnungshofberichten hier Aufmerksamkeit geben. (Beifall bei den NEOS sowie der Abgeordneten Hintner und Minnich.)
Ich wäre auch froh, wenn bei diesen Berichten – das betrifft alle Fraktionen inklusive meiner – die Anwesenheit im Plenum ein bisschen höher wäre, weil es ja durchaus sehr spannende Berichte sind.
Die Rechnungshofberichte, die heute diskutiert werden – aber eigentlich alle der letzten Monate –, zeigen ja ein sehr klares Bild und das schließt auch ein bisschen, so finde ich, die Klammer zur Budgetdebatte der letzten Tage, nämlich: Denken wir an die nächste Generation!
Frau Präsidentin, Sie haben ja einen Prüfungsschwerpunkt gesetzt – Next Generation Austria, glaube ich, heißt er –, um sich die Zukunftsprojekte anzuschauen. Wir haben ein Budget – auch das haben Sie in einem Interview erwähnt, auch davon habe ich hier schon gesprochen –, das genau diese Zukunftsprojekte vernachlässigt, und die Tagesordnungspunkte heute zeigen das wieder einmal. Es geht in wesentlichen Fragen zu wenig weiter. Wenn wir über die Zukunft reden, über Zukunftsquoten reden, wenn wir auch darüber reden, wie wir den nächsten Generationen etwas hinterlassen wollen, dann sehen wir in
diesen Berichten, dass beim Thema Umweltschutz zu wenig weitergeht, dass – das haben Sie auch aufgezeigt – beim Thema Pensionen ein Riesenloch klafft.
Es ist ein großartiger Rechnungshofbericht, der uns hier vorliegt, der ganz klar aufzeigt, dass es Reformen braucht, und darüber hinaus auch – und das haben Sie in Ihrem Interview angesprochen –, dass die Schuldenquote für die nächste Generation irgendwann nicht mehr ertragbar sein wird, nicht mehr schulterbar sein wird. Allein in dieser Legislaturperiode haben diese zwei Regierungsfraktionen 105 Milliarden Euro an neuen Schulden angehäuft – all das lastet auf den Schultern der nächsten Generationen, und deswegen sind diese Rechnungshofberichte, die wir heute hier diskutieren, auch so wichtig.
Sie sind deswegen wichtig, weil jetzt die letzte Möglichkeit besteht, eine Kehrtwende zu machen. Sie haben das in Ihrem Interview angesprochen, Frau Rechnungshofpräsidentin, und es ist auch in jedem dieser Berichte enthalten. Deswegen müssen Sie als Regierungsparteien jetzt endlich in die Gänge kommen. Die Anzahl der Anwesenden bei Debatten über Rechnungshofberichte lässt teilweise zu wünschen übrig, der Umstand, dass wir oft zu spät diskutieren, lässt zu wünschen übrig, aber insbesondere lässt zu wünschen übrig, dass die maßgeblichen Reformen, die der Rechnungshof regelmäßig vorschlägt, von den Regierungsparteien nicht ernst genommen werden. (Beifall bei den NEOS.)
Da muss endlich etwas passieren, sonst fahren wir, fahren Sie diese Republik an die Wand. (Neuerlicher Beifall bei den NEOS.) Ich rufe Sie daher hiermit auf: Beginnen Sie, den Rechnungshof ernst zu nehmen, die Forderungen ernst zu nehmen, sorgen Sie dafür, dass die nächste Generation nicht so viele Schulden auf ihren Schultern zu tragen hat! Wenn Sie selber das nicht schaffen, dann – sage ich Ihnen ganz offen und ehrlich – machen Sie den Weg frei, gehen wir in Neuwahlen! Dann haben wir auch das Problem mit unserem Herrn Präsidenten gelöst. (Beifall bei den NEOS.)
10.41
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Frau Rechnungshofpräsidentin Kraker. – Bitte.
Präsidentin des Rechnungshofes Dr. Margit Kraker: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich bedanke mich für die Debatte zu den Berichten des Rechnungshofes, und ich muss schon sagen, dass wir hier im Nationalrat immer wieder unsere Berichte diskutieren, auch Einzelberichte, das zeigt die Vielfalt unserer Themenpalette auf.
Ja, es stimmt, wir haben einen Prüfschwerpunkt, der sich mit der Zukunft beschäftigt, und dieser Prüfschwerpunkt soll sein, dass man eben auch zeitgerecht richtige Maßnahmen setzt, die Strukturen in Österreich verbessert und auch die Themen, die Herausforderungen, die es gibt, angeht. Eine dieser Herausforderungen sind die Umweltthemen oder Klimathemen, die wir heute auf der Tagesordnung haben.
In diesem Zusammenhang möchte ich jetzt zu zwei Berichten Stellung nehmen. Zum Thema Verpackungsabfälle aus Kunststoff möchte ich ganz kurz auf die zentralen Probleme und die noch bevorstehenden Herausforderungen eingehen. Der zweite Punkt ist das Thema Eisenbahnkreuzungen, das ein klassisch österreichisches Problem ist, bei dem es um die Frage geht, wie man das gut finanzieren kann, damit die Sicherungsmaßnahmen zeitgerecht erfolgen und man sich eben nicht im Dickicht der Strukturen und der Kostenaufteilung verliert und so die Dinge nicht zeitgerecht auf den Weg bringt.
Zum Thema Verpackungsabfälle aus Kunststoff ist zu sagen, dass die Kunststoffverpackungen in Österreich seit den Neunzigerjahren in Haushalten und Unternehmen getrennt erfasst werden. Sie werden entweder stofflich oder thermisch verwertet, das heißt, entweder zur Herstellung neuer Kunststoffprodukte verwendet oder in Industrieanlagen verbrannt. Das, was in Österreich nicht zulässig ist, ist die Deponierung von Kunststoffabfällen. Das ist verboten.
Wir sprechen im Jahr 2019 von 1,4 Millionen Tonnen Verpackungsabfällen, darunter 300 000 Tonnen Abfälle aus Kunststoff. Von diesen Kunststoffverpackungsabfällen sind wiederum zwei Drittel Haushaltsverpackungen und ein Drittel gewerbliche Verpackungen, und da gibt es jeweils mehrere Sammel- und Verwertungssysteme.
Was sind jetzt die vier Hauptprobleme? – Erstens: Die gesetzlichen Bestimmungen sind sehr komplex und für die vielen Akteure schwer zu erfassen. Das erschwert die korrekte Entsorgung von Verpackungsabfällen aus Kunststoffen und deren Kontrolle.
Zweitens: Die Trittbrettfahrerquote ist sehr hoch, und zwar von Inverkehrsetzern, und dies betrifft die Herstellerverantwortung. Trittbrettfahrer sind jene Inverkehrsetzer, die nicht oder nur unvollständig an einem Sammel- und Verwertungssystem teilnehmen. Dadurch entgehen dem abfallwirtschaftlichen System finanzielle Mittel, und außerdem verschaffen sich die Unternehmen durch die unterlassene Zahlung der Lizenzgebühren einen unzulässigen Wettbewerbsvorteil.
Damit die unionsrechtlichen Verpflichtungen erfüllt sind, muss sich der Anteil der recycelten Kunststoffverpackungen bis 2025 nahezu verdoppeln und muss auch die getrennte Sammlung von Einwegkunststoffgetränkeflaschen deutlich intensiviert werden. Da sehen wir vor allem bei den gewerblichen Verpackungen Handlungsbedarf.
Die Aufsicht des Klimaministeriums über die Einhaltung der rechtlichen Verpflichtungen im Hinblick auf Sammel- und Verwertungssysteme und die Kontrolle der Inverkehrsetzer hinsichtlich der Teilnahme an diesen Systemen waren unzureichend. Dadurch war die Wirksamkeit dieser Kontrolle beeinträchtigt.
Zu den zentralen Empfehlungen des Rechnungshofes:
Erstens: Eine Empfehlung ist, die rechtlichen Vorgaben für die Entsorgung von Verpackungsabfällen zu vereinfachen. Da ist schon einiges geschehen, aber noch nicht alles. Eine wesentliche Vereinfachung wäre der Wegfall der Unterscheidung zwischen gewerblichen und Haushaltsverpackungen.
Die zweite Empfehlung zielt darauf ab, Rahmenbedingungen und Anreizsysteme auf Basis der Ökomodulation der Lizenzgebühren auszuarbeiten, um die Produktion und den Einsatz von recyclingfähigen Verpackungen zu fördern.
Drittens wäre die Aufsichtstätigkeit zu verstärken und eine wirksame und ausreichend dimensionierte Kontrolle sicherzustellen. Dies könnte durch eine Fokussierung der Kontrollen auf Trittbrettfahrer erfolgen. Alternativ dazu könnte auch die Koordinierungsstelle mit diesen Aufgaben betraut werden.
Ich komme nun zum Thema Eisenbahnkreuzungen. Basierend auf der Eisenbahnkreuzungsverordnung haben wir einige Eisenbahnunternehmen geprüft: die GKB, die ÖBB-Infrastruktur und die Salzburger Lokalbahn. Im überprüften Zeitraum ereigneten sich 376 Unfälle mit 45 Todesfällen und 81 Schwerverletzten. Die Umsetzung der Eisenbahnkreuzungsverordnung 2012 trug dazu bei, das Ziel, Unfälle auf Eisenbahnkreuzungen zu reduzieren, auch zu erreichen. Die jährliche Anzahl an Unfällen auf Eisenbahnkreuzungen ging seit 2012 trotz erhöhtem Verkehrsaufkommen um 26 Prozent zurück, und das ist gut.
Neun Jahre nach Inkrafttreten war aber erst knapp die Hälfte der über 2 660 öffentlichen Eisenbahnkreuzungen der GKB, der ÖBB-Infrastruktur und der Salzburger Lokalbahn durch die Behörden überprüft. Die vorgegebene Überprüfungsfrist bis 2024 war auf diese Weise, realistisch betrachtet, nicht erreichbar, und deshalb wurde diese Frist jetzt um weitere fünf Jahre erstreckt. Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2024 in Kraft.
Das Thema der Kostentragung ist nur zu einem Drittel endgültig geregelt, für rund zwei Drittel sind die Verhandlungen beziehungsweise behördliche, gerichtliche Verfahren noch offen. Insgesamt werden voraussichtlich noch circa
438 Millionen Euro bei den drei überprüften Eisenbahnunternehmen anfallen, um diese Eisenbahnkreuzungen auch entsprechend zu sichern.
Einer der Punkte, den wir auch vorgeschlagen haben: sich doch zu überlegen, wie man die Finanzierung und die Kostentragung vereinfachen und auch Kostenpositionen vereinheitlichen könnte – in Bezug auf das, was da eben verrechnet wird –, um variierende Aufwände der Eisenbahnunternehmen zu vereinheitlichen und auch eine Transparenz gegenüber den Trägern der Straßenbaulast herzustellen.
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. (Allgemeiner Beifall.)
10.48
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Kühberger. – Bitte.
Abgeordneter Andreas Kühberger (ÖVP): Geschätzter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Rechnungshofpräsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Jugendliche auf der Galerie! Liebe Österreicherinnen und Österreicher! Herr Kollege Hoyos, ich möchte kurz auf Ihre Ausführungen eingehen. Sie unterstellen der Regierung, sie würde Empfehlungen des Rechnungshofes nicht ernst nehmen. (Ruf bei der SPÖ: Richtig!) Ich weise das auf das Schärfste zurück! Gerade Sie als Vorsitzender im Ausschuss müssten immer wieder sehen, dass man bei der Follow-up-Überprüfung genau sieht, dass diese Empfehlungen sehr ernst genommen und auch umgesetzt werden. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Zanger: Das haben sie dir jetzt wieder eingeredet, was du sagen sollst!)
Ich bin auch dankbar dafür, Frau Rechnungshofpräsidentin, dass Sie basierend auf der Eisenbahnkreuzungsverordnung 2012 die Monate Februar bis September des letzten Jahres geprüft haben. Geprüft wurden die Salzburger Lokalbahn, die Graz-Köflacher Bahn und auch die ÖBB-Infrastruktur.
Meine Damen und Herren! Überprüft wurde der Zeitraum 2017 bis 2021. 2021 gab es in Österreich 5 017 Eisenbahnkreuzungen.
Die Rechnungshofprüfung hat sich auf die Sicherheit und auf die Kostenaufteilung konzentriert. Wir haben sie heute schon gehört, und das sind wirklich traurige Zahlen: Bei 376 Unfällen auf diesen Kreuzungen sind 45 Menschen ums Leben gekommen und 81 wurden schwer verletzt. Es wurde ausgerechnet, dass so eine Eisenbahnkreuzung 14-mal gefährlicher ist als der Straßenverkehr, dass man dort 14-mal eher tödlich verunglückt. Es hat sich auch gezeigt, dass zum Beispiel eine Signalanlage fünf Mal gefährlicher ist, als wenn sich im Vergleich dazu dort eine Signalanlage und ein Schranken befinden.
Meine Damen und Herren! Wir haben auch gehört, dass diese Umstellung, die noch nicht ganz vollzogen ist – es ist nämlich festgestellt worden, dass 2021 erst 50 Prozent unserer Kreuzungen überprüft waren, und es ist bis August 2024 geplant, das alles umzusetzen, darum wurde das um fünf Jahre verlängert –, gewaltige Kosten bedeutet.
Ich habe in meinem Wahlkreis zu Hause einige Bürgermeister angerufen und habe sie gefragt, was die besondere Herausforderung mit diesen Eisenbahnkreuzungen ist. Unter anderem habe ich den Bürgermeister aus Scheifling Gottfried Reif angerufen, er ist im Oberen Murtal zu Hause, und er hat mir erzählt, dass er in seiner Gemeinde sechs solcher Eisenbahnkreuzungen hat. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass eine Kreuzung 250 000 bis 500 000 Euro kostet und die Gemeinde 50 Prozent davon leisten muss, es dann noch Wartungskosten von 5 000 Euro jährlich gibt – und 5 000 mal sechs ist 30 000 Euro –, die das Budget zusätzlich noch belasten, dann sind das natürlich gewaltige Kosten. Ich möchte den Bürgermeistern da draußen ein großes Danke sagen, weil sie es schaffen, sie setzen sich da ein, um für Sicherheit zu sorgen, obwohl das Budget sehr knapp ist. (Ruf bei der SPÖ: Nur Geld gebts ihnen keines!)
Es ist auch nicht immer einfach – die Frau Rechnungshofpräsidentin weiß es und in der Empfehlung ist es auch enthalten –, dass man die eine oder andere
Kreuzung auflässt – da geht es aber um Sicherheit, um Verantwortung und um das Budget –, da es Anrainer gibt, die über diese Bahnstrecke müssen. Noch einmal: vielleicht einen Applaus für unsere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die da Verantwortung zeigen! (Beifall und Bravoruf bei der ÖVP sowie Beifall bei den Grünen.)
Zwei Sätze noch zur Eisenbahn – es liegt mir einfach am Herzen –, zur neuen Südbahnstrecke. Da entstehen wirklich neue Wirtschaftsräume, Lebensräume, Arbeitsräume, wir müssen aber auch aufpassen, dass wir andere Regionen nicht vernachlässigen. Da ich mit dem Bürgermeister aus dem Oberen Murtal telefoniert habe: Das beginnt mit der Murtalbahn, die unbedingt elektrifiziert oder mit Wasserstoff betrieben gehört, geht bis hin zur Lavanttalbahn, aber auch bei mir zu Hause im Liesingtal, in Traboch zum Beispiel fehlt ein Bahnhof.
Vor allem ist aber auch die Taktung ein Thema. Warum, meine Damen und Herren? – Wir müssen die Zubringer stärken, denn wenn ich heute heimfahren will: Um 18.25 Uhr geht der letzte Zug in meine Heimat, ich muss zweimal umsteigen und komme mit dem Bus an. Das müssen wir in Zeiten der Klimaveränderung ändern. – Danke. (Beifall und Bravorufe bei der ÖVP sowie Beifall bei Abgeordneten der Grünen.)
10.53
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Stöger. – Bitte sehr.
Abgeordneter Alois Stöger, diplômé (SPÖ): Frau Präsidentin! Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ganz besonders begrüße ich für Abgeordneten Rudi Silvan die Betriebsrätinnen und Betriebsräte der Firma Doka-Umdasch. – Danke, dass ihr euch immer für die Interessen der Arbeitnehmer einsetzt! (Beifall bei der SPÖ sowie der Abgeordneten Sieber, Amesbauer, Lausch und Weratschnig.)
Frau Präsidentin des Rechnungshofes! Danke – es ist schon ausgeführt worden – für den Bericht zum Thema Eisenbahnkreuzungen! Ich denke, es ist sehr bemerkenswert, dass seit der Eisenbahnkreuzungsverordnung 2012 die Zahl der Unfälle auf den Eisenbahnkreuzungen um 26 Prozent zurückgegangen ist; das sagt auch dieser Bericht aus. Das ist gut. Daran haben viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister mitgewirkt, denn die sicherste Eisenbahnkreuzung ist jene, die es nicht gibt. Daher ist es wichtig, dass man die Zahl der Eisenbahnkreuzungen reduziert und dass man Eisenbahnkreuzungen, wenn man sie braucht, so gestaltet, dass sie nicht bodengleich sind. Sollte das technisch nicht möglich sein – das ist schon ausgeführt worden –, brauchen wir eine Eisenbahnkreuzung, die auf dem höchsten Stand der Technik ist – und Schranken sind natürlich besser als Licht, das ist deutlich geworden.
Frau Präsidentin! Sie haben im Bericht darauf hingewiesen, dass damals, 2012, festgelegt worden ist, dass alle Eisenbahnkreuzungen Österreichs bis August 2024 überprüft werden sollen. Das ist nicht gelungen. Ich ersuche alle, die Ministerin und aber auch die Bundesländer, entsprechendes Personal zur Verfügung zu stellen, damit die Überprüfung aller Eisenbahnen zeitnah möglich ist. Die Verordnung jetzt bis 2029 zu verlängern halte ich ganz ehrlich für zu lange. Da müsste man jetzt wirklich Personal bereitstellen, um da tätig zu werden. – In diesem Sinne danke ich für diesen Bericht. (Beifall bei der SPÖ sowie des Abg. Weratschnig.)
10.55
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Lausch. – Bitte.
Abgeordneter Christian Lausch (FPÖ): Geschätzte Präsidentin des Rechnungshofes! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Vorweg will ich in Vertretung unseres Justizsprechers Mag. Harald Stefan die Schülerinnen und Schüler der
Klasse 5S des Gymnasiums am Augarten recht herzlich bei uns begrüßen. (Beifall bei der FPÖ sowie bei Abgeordneten von ÖVP, SPÖ, Grünen und NEOS.)
So, jetzt haben wir das Schöne beendet und kommen zu einem ernsten Thema: Der Rechnungshof fordert eine bessere Sicherung von Eisenbahnkreuzungen. Es wurde schon recht viel über diese Problematik gesagt, die schon Jahre, jahrzehntelang besteht. Die Zahl der Unfälle ist eklatant: 45 Menschen in vier Jahren, die an Eisenbahnkreuzungen zu Tode gekommen sind – das ist eine erschreckende Zahl. Noch erschreckender ist, dass man sich bei zwei Dritteln der Kreuzungen, und das ist eine große Zahl, nicht einigen kann, wer die Kosten übernimmt. Ich glaube, diese Kostenübernahme gehört schleunigst von Frau Bundesministerin Gewessler geklärt. Es kann nicht sein, dass es gefährliche Eisenbahnkreuzungen gibt.
Wir haben gehört – und das ist vollkommen richtig –, dass die gesicherten Eisenbahnkreuzungen noch gefährlicher sind. Da verlässt sich der Autofahrer natürlich darauf, dass, wenn der Schranken oben ist, kein Zug kommt. Dem ist aber nicht so. Ich empfehle Ihnen, bleiben Sie immer stehen! Aufgrund eines Blitzschlags, eines Stromausfalls kann der Schranken oben bleiben, dann leuchtet auch kein Licht, und dann kommt es zu diesen schrecklichen Unfällen. Darum ist das Risiko höher als bei ungesicherten Bahnübergängen. Was auch klar ist, denn bei den ungesicherten bleibt man automatisch stehen, aber bei den gesicherten verlässt man sich darauf.
Umso wichtiger ist daher die Kostenübernahme. Ich muss sagen, diese Regierung schmeißt für viele Sachen Geld hinaus, es kann nicht sein, dass die Sicherung von zwei Dritteln der Kreuzungen nicht stattfinden kann, weil es an der Kostenübernahme scheitert. Da muss im Notfall schleunigst das Infrastrukturministerium einspringen, weil die Gemeinden – da gebe ich meinem Vorredner recht – das nicht werden stemmen können, denn so ein beschrankter, gesicherter Bahnübergang kostet circa eine halbe Million Euro. Das ist viel, viel Geld für die Gemeinden, und darum haben wir da keine Lösung.
Da muss einfach der Staat, da muss das Ministerium einspringen. Es kann nicht sein, dass hier zulasten der Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger herumgestritten wird, das haben sich diese nicht verdient. Die Gemeinde wird das nicht stemmen können, daher wäre der Bund da wirklich gefordert. Die Kosten belaufen sich auf fast 100 Millionen Euro, und es kann nicht sein, dass die Gemeinden 50 Prozent davon zahlen müssen. Wie soll das gehen? – Wir wissen, wie marod die Gemeinden finanziell aufgestellt sind, und daher muss natürlich der Bund schleunigst einspringen – dann wird man auch eine Lösung finden, dann wird man sichere Eisenbahnkreuzungen vorfinden –, sonst wird das nichts werden.
Man tut ja nicht erst seit einem Jahr herum, sondern jahrelang, jahrzehntelang beschwert man sich schon, dass unsere Eisenbahnkreuzungen keineswegs sicher sind. In diesem Sinne hoffe ich da auf eine baldige Lösung von Bundesministerin Gewessler. – Danke. (Beifall bei der FPÖ.)
10.59
*****
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Ich darf kurz unterbrechen und mich mit einigen Worten an Sie richten.
Mag. Martin Peyerl wird uns heute nach diesem Dienst verlassen. Nach 30 Jahren im Parlamentsdienst geht er mit 30. November in Pension. Er ist stellvertretender Dienstleiter des Personalwesens. – Für deine exzellente Arbeit dürfen wir uns bei dir recht herzlich bedanken.
Er ist ein passionierter Motorradfahrer – er ist auch heute mit dem Motorrad hierhergekommen – und ein passionierter Schiedsrichter für Volleyballmatches, er hat also in der Pension noch genügend zu tun. – Wir wünschen dir alles Gute! (Der Präsident gibt Mag. Martin Peyerl die Hand und überreicht ihm einen Geschenkkorb. – Allgemeiner Beifall.) – Mit Schokobananen und Whiskey werden wir ihm die Pension versüßen.
*****
Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Litschauer. – Bitte.
Abgeordneter Ing. Martin Litschauer (Grüne): Ich möchte die Gelegenheit auch gleich nutzen, um mich bei unseren Gebärdensprachdolmetscher:innen zu bedanken. Sie fallen vielen vielleicht gar nicht so auf, aber sie leisten hier eine sehr, sehr wichtige und gute Arbeit. Dafür möchte ich heute auch einmal kurz Danke sagen, bevor ich meine Rede beginne. (Allgemeiner Beifall. – Präsidentin Bures übernimmt den Vorsitz.)
Frau Präsidentin, ich darf mich jetzt dem Thema Umweltverschmutzung, eigentlich der Luftverschmutzung widmen. Die Europäische Umweltagentur ermittelte im Jahr 2016 für Österreich 5 300 vorzeitige Todesfälle in Folge von PM2,5-Feinstaubimmissionen und 1 000 vorzeitige Todesfälle durch Stickoxidimmissionen. Das meiste beim Stickoxid kommt zum Beispiel aus dem Pkw-Verkehr. Das sind Zahlen, über die man in Österreich nicht gerne redet, aber im Prinzip sind das zum Großteil eigentlich Verkehrstote. Das sind Tote, die der Verkehr durch die Emissionen von Feinstaub und vor allem von Stickoxid verursacht.
Im Großraum Graz haben wir für beides Sanierungsgebiete. Man sieht auch an den Sanierungsgebieten an den Autobahnabschnitten der A 2 und der A 9, dass der Verkehr der Hauptverursacher ist und wir da genau hinschauen müssen. Was der Rechnungshofbericht aufzeigt, ist, dass Evaluierungen und das Setzen von neuen Maßnahmen jahrelang ausgeblieben sind und nicht gemacht worden sind.
Da möchte ich mich jetzt beim Rechnungshof bedanken, dass man sich des Themas angenommen hat und genau das aufgezeigt hat, was alles an Übertretungen da ist, was alles an Maßnahmen fehlt, damit diese Evaluierung jetzt hoffentlich auch nachgereicht werden kann.
Wir haben ja mehrere Möglichkeiten, das zu reduzieren. Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Auch die Umstellung auf Elektromobilität kann bei den Stickoxiden einiges lösen. Wir haben ja beim Abgasskandal die Verbesserung am Papier und am Teststand gemerkt, diese verbessert die Luft vor Ort aber nicht. Das heißt, wir brauchen schon Maßnahmen, die auch wirken.
Da haben wir, glaube ich, von Bundesseite her mit der Elektromobilität und dem öffentlichen Verkehr einige Maßnahmen gesetzt. Es gibt noch wesentlich mehr Maßnahmen, die gesetzt werden müssen, vor allem auch vom Land Steiermark. Das wäre auch mein Aufruf. Es gibt eine ganze Liste, die man nachlesen kann, was man noch zusätzlich an Maßnahmen setzen kann. Mein Anliegen ist, dass auch das Land Steiermark jetzt endlich dem nachkommt und zusätzlich zu den Bundesmaßnahmen für bessere Luft in der Steiermark sorgt, denn am Ende des Tages rettet das Leben. – Danke. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
11.03
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Hermann Weratschnig. – Bitte.
Abgeordneter Hermann Weratschnig, MBA MSc (Grüne): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau Präsidentin des Rechnungshofes! Es geht bei diesen Tagesordnungspunkten auch um die Straßenbahnprojekte in Graz, Linz und Innsbruck. Das Ergebnis ist ein sehr gutes. Die Projekte sind ein wichtiger Beitrag für den Umstieg auf den ÖV, ein wichtiger Beitrag, um auch Klimaschutzmaßnahmen zu setzen, ein wichtiger Beitrag entsprechend dem Bundesmobilitätsmasterplan und, was Innsbruck betrifft, auch ein gelungenes Beispiel für Bürger:innenbeteiligung auf Stadtebene bereits ab der Projektplanung.
Wenn man sich an die Begebenheiten rund um die Regionalbahn Innsbruck erinnert, muss man dazusagen, dass diese Bürger:innenbeteiligung leider auch von den Freiheitlichen dort für eine unglaubliche Kampagne ihrerseits gegen die Regionalbahn Innsbruck genutzt wurde. Derzeit, muss man dazusagen, übertreffen alle Fahrgastzahlen die Prognosen, und von allen Fraktionen in Innsbruck kommt die Forderung nach mehr Wagenmaterial, nach mehr Rollmaterial. Das hat also funktioniert, der ÖV funktioniert sehr gut in Innsbruck. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
Ich kann auch folgenden Empfehlungen des Rechnungshofes entsprechen: Schieneninfrastrukturprojekte, gemeinsame Finanzierungsaspekte und Finanzierungspakete zu schaffen, Übereinstimmung mit regionalen und überregionalen Verkehrskonzepten und vor allem auch – das wäre auch ganz wichtig – Verkehrssimulation und die Auslastung in Prognoseszenarien auch darzustellen, insbesondere auch in Potenzialanalysen.
Ein anderer Bericht wurde von meinem Kollegen Martin Litschauer schon genannt, das Thema Luftverschmutzung, insbesondere in der Stadt Graz. Es zeigt uns aber auch, was das IG-Luft betrifft, Immissionsschutz überhaupt in Österreich, dass es da, glaube ich, eine Weiterentwicklung braucht. Ich kann nur den Ausblick geben, dass das EU-Parlament mit dem Umweltausschuss gerade daran arbeitet, strengere Leitlinien auszuarbeiten, also die Absenkung von Luftgütegrenzwerten bis 2030.
Entscheidend wird sein, wie rasch sich Parlament, Rat und Kommission in den sogenannten Triloggesprächen einigen werden. Ich glaube, ein ganz wichtiger Bereich im Bestreben der Dekarbonisierung und der CO2-Reduktion ist auch eindeutig die Absenkung von Schadstoffen.
Was bedeutet das für Österreich? – Für Österreich ist es ganz ein wichtiger Bereich, sich auch genau unsere Gesetzeslage, das Immissionsschutzgesetz –Luft anzuschauen. Als Tiroler ist natürlich für die Tiroler Transitpolitik ganz wichtig: Im Abwehrkampf gegen den überbordenden Lkw-Transit braucht es auch ein
Nachdenken und ein Ausarbeiten darüber, wie wir mit diesen Grenzwerten in Zukunft umgehen. Da sind einschränkende, notwendige Maßnahmen zur Absenkung von Schadstoffen zum Schutze der Bevölkerung aufgebaut, und wir sind da, glaube ich, in einem sehr aktiven Gespräch. Wir werden die notwendigen Grundlagen brauchen.
In diesem Sinne danke ich dem Rechnungshof für seine Empfehlungen, für die Ausarbeitung und für eine gute Grundlage für alle Abgeordneten, sich in Themen einzulesen und kundig zu werden. – Danke. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
Präsidentin Doris Bures: Mir liegt nun dazu keine Wortmeldung mehr vor. Damit schließe ich diese Debatte.
Wird seitens der Berichterstattung ein Schlusswort gewünscht? – Das ist nicht der Fall.
Damit kommen wir nun zu den Abstimmungen, die ich über jeden Ausschussantrag getrennt vornehme.
Tagesordnungspunkt 6: Antrag des Rechnungshofausschusses, den Bericht betreffend Verpackungsabfälle aus Kunststoff, III-804 der Beilagen, zur Kenntnis zu nehmen.
Wer sich dafür ausspricht, den bitte ich um ein Zeichen. – Das ist einstimmig zur Kenntnis genommen.
Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 7: Antrag des Rechnungshofausschusses, den Bericht betreffend Eisenbahnkreuzungen, III-1013 der Beilagen, zur Kenntnis zu nehmen.
Ich bitte um ein Zeichen. – Auch das ist einstimmig zur Kenntnis genommen.
Tagesordnungspunkt 8: Antrag des Rechnungshofausschusses, den Bericht betreffend Ökostromförderung am Beispiel Windkraft und Photovoltaik, III-126 der Beilagen, zur Kenntnis zu nehmen. – Auch dieser Bericht ist einstimmig zur Kenntnis genommen.
Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 9: Bericht betreffend Luftverschmutzung durch Verkehr – ausgewählte Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität, III-245 der Beilagen, zur Kenntnis zu nehmen. – Der Bericht ist einstimmig zur Kenntnis genommen.
Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 10: Bericht betreffend Anpassung an den Klimawandel in der Stadt Linz, III-372 der Beilagen, zur Kenntnis zu nehmen.
Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen. – Das ist einstimmig zur Kenntnis genommen.
Tagesordnungspunkt 11: Bericht betreffend Flughafen Wien – Umbau und Erweiterung Terminal 3, III-488 der Beilagen, zur Kenntnis zu nehmen. – Das ist einstimmig zur Kenntnis genommen.
Tagesordnungspunkt 12: Bericht betreffend MeteoServe Wetterdienst GmbH – nunmehr Austro Control Digital Services GmbH, III-820 der Beilagen, zur Kenntnis zu nehmen.
Wer ist dafür? – Das ist einstimmig zur Kenntnis genommen.
Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 13: Bericht betreffend Straßenbahnprojekte Graz, Innsbruck, Linz, III-906 der Beilagen, zur Kenntnis zu nehmen.
Wer für die Kenntnisnahme ist, den bitte ich um ein Zeichen. – Das ist auch einstimmig zur Kenntnis genommen.
14. Punkt
Sammelbericht des Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen über die Petitionen Nr. 66, 70, 72, 79, 92, 95, 111, 116, 118 und 120 bis 122 sowie über die Bürgerinitiativen Nr. 41, 43, 52 und 54 (2237 d.B.)
Präsidentin Doris Bures: Damit gelangen wir nun zu Punkt 14 der Tagesordnung.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Erster Redner: Herr Abgeordneter Andreas Kollross. – Bitte.
Abgeordneter Andreas Kollross (SPÖ): Frau Präsidentin! Kolleginnen und Kollegen! Werte Zuseherinnen und Zuseher! Ich schicke gleich einmal voraus: Wir werden, wie auch die letzten Male, dem Sammelbericht des Petitions- und Bürger:inneninitiativenausschusses nicht zustimmen, da wir nicht damit einverstanden sind, wie die Regierungsparteien mittlerweile mit Petitionen und Bürger:inneninitiativen umgehen. (Beifall bei der SPÖ.)
Egal um welches Thema es sich handelt, letztendlich wird in diesem Ausschuss am Ende mit der Kenntnisnahme alles zu Grabe getragen und gar nicht versucht, Themen, die von Bürgerinnen und Bürgern ans Parlament herangetragen werden, in den zuständigen Fachausschüssen weiter zu behandeln. Ich finde das schade und glaube, dass man in den Regierungsfraktionen, aber vor allen Dingen in der grünen Fraktion ernsthaft darüber diskutieren sollte, ob man wirklich so mit Interessen von Bürgerinnen und Bürgern umgeht, denn ich kann mich eigentlich daran erinnern, dass die grüne Bewegung einmal eine Bürger:innenrechtsbewegung war. Nur: Man merkt davon im Petitions- und Bürger:inneninitiativenausschuss leider gar nichts mehr. (Beifall bei der SPÖ.)
Ich möchte konkret – weil es gut zur Finanzausgleichsdebatte von gestern passt – ganz kurz zur Petition betreffend höhere Mittel für Länder und
Gemeinden im Zuge des Finanzausgleichs für den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung Stellung nehmen. Es ist ja sehr erfreulich, dass die ÖVP mittlerweile auch erkannt hat, dass die Kinderbildung ab dem ersten Lebensjahr ein wichtiges Instrument ist. Wir wissen alle noch, dass das nicht immer so war, denn vor ein paar Jahren wollte man Bundesländer aufhetzen oder hat es wahrscheinlich auch getan, damit in diesem Bereich ja nichts passiert. (Abg. Schnabel: Hallo! Stimmt ja nicht, auch wenn Sie es noch so oft sagen, Herr Kollross, stimmt ja nicht!) Jetzt gibt es einen Bundeskanzler, der in vielen Bereichen in der Ankündigung sehr großmundig ist, so auch in diesem: Er spricht von 4,5 Milliarden Euro, die in den nächsten Jahren investiert werden sollen. Schaut man sich aber am Ende den Finanzausgleich an, dann kommt man drauf, dass man mit den Mitteln, die man jetzt im Finanzausgleich zur Verfügung gestellt hat, um Kinderbildung vor Ort auszubauen, nicht auskommen wird, um das, was der Bundeskanzler angekündigt hat, letztendlich auch umzusetzen, geschweige denn, dass man damit auskommt, dass man wirklich von einem Rechtsanspruch auf Kinderbildung sprechen kann.
Deshalb glaube ich, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass es zwingend notwendig wäre, auch über diese Petition in den zuständigen Fachausschüssen weiterzudiskutieren, denn wir alle wissen – auch ihr wisst das in Wirklichkeit –, dass die Mittel, die jetzt zur Verfügung gestellt werden, nicht ausreichen, um das umzusetzen, was der Bundeskanzler großspurig angekündigt hat. – Danke schön. (Beifall bei der SPÖ.)
11.13
Präsidentin Doris Bures: Nun gelangt Herr Abgeordneter Hans Stefan Hintner zu Wort. – Bitte sehr.
Abgeordneter Hans Stefan Hintner (ÖVP): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Hohes Haus! Zunächst darf ich im Namen von Nationalrat Bürgermeister Joachim
Schnabel die ÖVP-Ortsgruppe Bad Schwanberg aus dem Bezirk Deutschlandsberg mit Bürgermeister Mag. Karlheinz Schuster begrüßen. (Beifall bei der ÖVP, bei Abgeordneten von SPÖ und Grünen sowie der Abg. Fiedler.)
Lieber Bürgermeisterkollege, lieber Andreas, nur zwei Bemerkungen: Du weißt auch, dass sehr, sehr viele Petitionen nicht von Bürgern, nicht von Bürgerinitiativen eingebracht werden (Abg. Kollross: Aber die Anregungen! ... Sprachrohr der Bürger:innen, lieber Kollege! – Zwischenruf des Abg. Lausch), sondern von politischen Parteien, die den Petitionsausschuss als zusätzliches Instrument wahrnehmen wollen, was absolut legitim ist; aber du hast ja insbesondere die Bürgerinnen und Bürger hier betont.
Was den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung anbelangt, so sind wir trotzdem, glaube ich, auf einem guten Weg. Du weißt das auch als Bürgermeister: Länder, Gemeinden, wir sind dafür zuständig und haben es bis jetzt auch in dem Sinn geschafft. Wir haben das letzte Mal im Ausschuss darüber gesprochen, wir können – du in Trumau, ich in Mödling – praktisch 100 Prozent an Kinderbetreuungsplätzen für die suchenden Familien anbieten. Natürlich nehmen wir auch jeden zusätzlichen Euro gerne an, aber da braucht man keine Schwarzmalerei zu betreiben, lieber Andreas. (Beifall bei der ÖVP.)
Ich möchte eigentlich zur Petition betreffend „Spritpreisbremse – Diesel und Benzin müssen bezahlbar bleiben!“ Stellung nehmen. Es ist eine Petition, die Gott sei Dank in den wesentlichen Punkten überholt ist. Der Tenor ist ja, ob man bei gewissen Dingen mit gewissen Bremsen in den Markt eingreifen sollte – von Mehrwertsteuer war auch die Rede.
Wir haben uns, lieber Christian (in Richtung des Abg. Ries), ebenfalls im Ausschuss darüber angeregt unterhalten. Du wohnst ja im schönen Burgenland, und da haben wir das Beispiel der Ungarn gehabt. Die Ungarn haben eine Spritpreisbremse gemacht, was den Staat Milliarden an Forint gekostet hat. Zum Schluss ist ihnen die Luft ausgegangen und dann haben sie gesagt, dass die Österreicher gar nicht mehr zum Tanken kommen dürfen.
Stellt euch vor, wir hätten etwas Ähnliches gemacht und den deutschen Touristen in Salzburg, in Tirol gesagt, sie dürften nicht tanken, das wäre nur für Österreicher – Dinge also, die wir uns gar nicht vorstellen können.
Was haben auf der anderen Seite die Deutschen gemacht? – Die Deutschen haben Mehrwertsteuersenkungen auf Benzin eingeführt, mit der Folge, dass sie jetzt wieder erhöhen müssen. Wir hingegen haben uns für Maßnahmen entschieden, die im allgemeinen Bereich die finanzielle Lebenssituation verbessern.
Ebenfalls sehr interessant ist es, wenn man die Spritpreise im europäischen Bereich hinsichtlich des Verhältnisses des Medianeinkommens zum nationalen Spritpreis vergleicht. Ich habe beim letzten Mal vortragen dürfen, dass wir in Österreich mit 25 119 Euro an dritter Stelle des Nettomedianeinkommens in Europa stehen und Eurosuper 95 vor zwei Tagen bei 1,57 Euro war. Ich habe heute gesehen, dass er schon auf unter 1,50 Euro in der Region rund um Wien gefallen ist. Wenn wir uns jetzt allerdings anschauen, wie der Spritpreis in Ungarn in Relation zum Einkommen steht, dann hat man in Ungarn 10 217 Euro netto im Jahr zur Verfügung und der Sprit kostet mittlerweile 1,58 Euro. Wenn man das also in Relation bringt, dann sieht man – für manche ist der Sprit in Österreich wahrscheinlich zu günstig, für uns selbstverständlich nicht –, wie unterschiedlich das der Kaufkraft entsprechend gehandhabt wird.
Was die Steuersenkungen anbelangt – ob diese bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen –, darf ich nur zwei Dinge in Erinnerung bringen: Ich kann mich nicht daran erinnern, dass bei der Abschaffung der Steuer auf Aufgussgetränke ein Kaffee oder ein Tee billiger geworden wäre; und ich glaube, die wenigsten werden sich daran erinnern können, dass bei der Abschaffung der Getränkesteuer ein Krügerl Bier billiger geworden wäre. Das heißt, das ist geschluckt worden und die erhofften Effekte waren verpufft. (Beifall bei der ÖVP. – Zwischenruf des Abg. Kollross.)
Nichtsdestotrotz hoffen wir als Österreichische Volkspartei auf Bewegung mit unserem Koalitionspartner, was die Erhöhung der Pendlerpauschale und die Erhöhung des amtlichen Kilometergeldes für unsere Pendlerinnen und Pendler anbelangt. (Beifall bei der ÖVP.)
11.18
Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Petra Wimmer. – Bitte.
Abgeordnete Petra Wimmer (SPÖ): Frau Präsidentin! Geschätzte Zuseherinnen und Zuseher! Hohes Haus! Der aktuelle Sammelbericht für Petitionen und Bürgerinitiativen zeigt, wie wichtig es den Bürgern ist, dass sie sich beteiligen können und dass Petitionen und Bürgerinitiativen von Menschen, die direkt betroffen sind, eingebracht werden. Natürlich – an meinen Vorredner gerichtet – werden auch von Politikern gewisse Interessen und gewisse Problemlagen unterstützt. Es ist aber auch unsere Aufgabe, hier den Menschen als Sprachrohr zu dienen, wenn sie mit einem Anliegen auf uns zukommen. (Beifall bei der SPÖ.)
Umso bedauerlicher ist es wirklich, dass wir diese Themen in den zuständigen Ausschüssen sehr selten diskutieren, weil sie fast alle im Sammelbericht enderledigt und damit auch nicht weiter behandelt werden.
So möchte ich auch noch einmal auf die Petition eingehen, die „höhere Mittel für Länder und Gemeinden aus dem Finanzausgleich“ für den „Rechtsanspruch auf Kinderbildung“ fordert. Auch ihr ist es so ergangen, dass sie nicht in den Ausschuss gekommen ist. Wir haben in den letzten Tagen hier das Budget verhandelt, besprochen, diskutiert, und auch da wurden für den Finanzausgleich Mittel beschlossen, um die Kinderbetreuung voranzutreiben. Ich begrüße einmal grundsätzlich, dass auch die Regierung die Sinnhaftigkeit einer qualitativen, hochwertigen Kinderbildung gesehen hat, wenn auch die Höhe der angekündigten Mittel nicht dem entspricht, was vorher signalisiert wurde. Das findet sich dann in den Investitionen im Budget nicht wieder. (Beifall bei der SPÖ. – Abg.
Schnabel: Das stimmt ja nicht, es sind sogar mehr! Da haben Sie recht, es sind sogar mehr!)
Der rasche Ausbau von VIF-konformen Kinderbetreuungseinrichtungen ist dringend notwendig – das sehen wir alle –, um die Barcelona-Ziele zu erreichen, aber auch um unseren Familien eine adäquate Kinderbetreuung anbieten zu können.
Es muss aber nicht nur in den Ausbau investiert werden, sondern ganz wichtig ist auch, dass die Arbeitsbedingungen der Kindergartenpädagog:innen verbessert werden – sie müssen dringend verbessert werden. Vor rund einem Monat sind 10 000 Elementarpädagog:innen auf die Straße gegangen und haben aufgezeigt, wie schwierig es in ihrem Beruf ist. Sie üben ihren Beruf mit viel Liebe, mit viel Herzblut und mit viel Fachwissen aus und sind wirklich gerne für die Betreuung unserer Kinder da, aber sie fühlen sich einfach überfordert, weil ihre Arbeitsbedingungen extrem belastend sind. Sie müssen auf die Straße gehen, weil die Politik sie sonst nicht hört.
Wir wissen alle: Es gibt in der Elementarpädagogik sehr viel zu tun. Wir werden das ganz genau beobachten. Auch wenn die Petition jetzt vom Tisch ist und im Ausschuss nicht weiterbehandelt wird, werden wir als Opposition ganz genau darauf schauen, dass der Ausbau und die Verbesserungen in der Elementarpädagogik zügig vorangehen. Wir werden auch nicht aufhören, einen Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz zu fordern, bis er endlich umgesetzt ist. (Beifall bei der SPÖ.)
11.22
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Christian Ries. – Bitte.
Abgeordneter Christian Ries (FPÖ): Frau Präsidentin! Werte Kollegen und Kolleginnen im Hohen Haus! Die erste Petition, zu der ich heute kurz sprechen
will, ist die Petition meines Kollegen Christian Hafenecker: „Aktive Friedens- und Neutralitätspolitik statt Kriegstreiberei“.
Diese Petition setzt sich für eine gelebte Neutralitätspolitik ein, und zwar ganz im Sinne des Artikels 1 des Neutralitätsgesetzes, den ich kurz zitieren darf: „Zum Zwecke der dauernden Behauptung seiner Unabhängigkeit nach außen und zum Zwecke der Unverletzlichkeit seines Gebietes erklärt Österreich aus freien Stücken seine immerwährende Neutralität.“
Vor allem der Passus mit der immerwährenden Neutralität scheint in letzter Zeit etwas in Vergessenheit geraten zu sein, werte Damen und Herren. Wir hatten im Ausschuss ein Hearing, bei dem ein gewisser Herr Prof. Geistlinger war, ein Experte auf dem Gebiet der Verfassung. Er hat uns das erklärt: Immerwährend heißt ganz einfach nicht temporär oder einmal so und einmal so, sondern es ist so zu verstehen, dass diese Neutralität so lange aufrechtbleibt, bis hier eine Zweidrittelmehrheit hergeht und sie abschafft. Wahrscheinlich wird darauf noch eine Volksabstimmung zu folgen haben. – So lange bleibt sie aufrecht.
Neutral heißt: Bis auf humanitäre Hilfeleistungen gibt es keine weiteren Zuwendungen an kriegsführende Parteien. Die Neutralität macht auch keinen Unterschied, sagt Prof. Geistlinger, wer Angreifer und wer Verteidiger ist. Das ist ganz einfach so hinzunehmen. (Abg. Reimon: Wo steht das im Gesetz?) – Ein Gesetz hat eine Rechtsauslegung, und die werden Sie mir jetzt nicht erklären. (Abg. Reimon: Wo? Wo?) Waren Sie nicht dabei? Prof. Geistlinger hat das wortwörtlich so gesagt – er hat das wortwörtlich so gesagt. Deswegen ist unsere Position auch die, die sie ist – ob sie für Sie jetzt angenehm ist oder nicht, sie bleibt aufrecht. (Beifall bei der FPÖ. – Zwischenruf der Abg. Voglauer.)
Deswegen können wir auch in keiner Weise der Stellungnahme aus dem Bundeskanzleramt folgen, in der steht, die Auslegung der Neutralität hat sich seit der Beschlussfassung 1955 stark gewandelt. – Wo haben die das her? Am Gesetzeswerk hat sich nichts verändert. Wo haben die das her? Es ist bestenfalls
eine Rechtfertigung für das Verhalten dieser Regierung, mehr ist es nicht. (Beifall bei der FPÖ. – Zwischenruf des Abg. Ofenauer.)
Zu Kollegen Hintner – ist er noch da? (Abg. Hintner: Christian! – Abg. Lausch: ... jetzt Demokratie erklären, horch zu! – Abg. Hintner: Ich bin immer ganz Ohr, Kollege Lausch!) –: Kollege Hintner hat die Spritpreisbremse angesprochen. Wir alle wissen, dass die Spritpreise ein wesentlicher Faktor der Teuerung sind und in der Vergangenheit waren. Das wird sich auch nicht bessern, denn die CO2-Bepreisung – wir wissen es – steigt ja jedes Jahr bis zum Jahr 2025 noch etwas an. Die Pendler sind und bleiben die Hauptbetroffenen dieser Teuerung. (Beifall bei der FPÖ. – Abg. Weratschnig: Aber nicht bei den Spritpreisen!)
Wir können auch nicht ändern, dass Österreich größtenteils alpines Gelände ist. Das heißt, öffentliche Verkehrsmittel werden nicht in die letzten Winkel jedes Tales fahren können. Das heißt, wir brauchen den Individualverkehr, wir brauchen den Pkw-Verkehr, aber wir müssen auch schauen, dass er leistbar bleibt.
Deswegen verstehe ich nicht, warum das amtliche Kilometergeld seit 15 Jahren unverändert ist. Das Verhältnis hat sich in den 15 Jahren ja wesentlich verändert. Der ÖAMTC sagt – das sehen Sie, wenn Sie diese Stellungnahme durchlesen –, um circa ein Drittel ist der Pkw in dieser Zeit teurer geworden – in der Anschaffung und in der Erhaltung. Dieses Missverhältnis müssen wir irgendwann ausgleichen.
Wenn Kollege Hintner sagt, die Ungarn haben dann mit diesem günstigen Tarif aufgehört, dann muss man ehrlicherweise auch dazusagen – weil er gefragt hat, was das bringt –: Halb Ostösterreich war zum Tanken in Ungarn, das muss man einmal gesehen haben. Es ist klar, dass die Ungarn dann sagen: Den Sprit werden wir nicht für die Österreicher billiger machen! – Deswegen haben sie damit aufgehört. (Beifall bei der FPÖ.)
Werte Damen und Herren! Die letzte Petition, die ich kurz anreißen möchte, ist eine Petition der Grünen, die im Titel etwas sperrig ist. (Abg. Voglauer: Aha!) Sie lautet: „Schluss! mit weiteren Beschränkungen der Verpackung, der Bezeichnung oder anderer Angaben von Fisch-, Fleisch- und Milchalternativprodukten“.
Jetzt hat der Kollege von der SPÖ vorhin schon gesagt: Wir sind in diesem Ausschuss schon viel gewöhnt. – Normalerweise ist es so: Es werden einige Stellungnahmen eingeholt, dann wird x-mal vertagt, und schlussendlich wird die Petition dann zur Kenntnis genommen. Diese Petition ist aber fast einzigartig: Es wurde lediglich eine Stellungnahme eingeholt, und zwar vom Konsumentenschutzminister. Diese ist aber durchaus lesenswert.
Was diese Petition in Wahrheit meint, ist: Es darf doch nicht wahr sein, dass ein veganes Würstel nicht Würstel heißen darf oder dass eine Hafermilch nicht Milch heißen darf – die Bezeichnung Milch ist nur für tierische Produkte vorgesehen. Da hat Konsumentenschutzminister Rauch ganz einfach zurückgeschrieben: Doch, das geht. Rauch locuta, causa finita. (Beifall bei der FPÖ.)
11.27
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Rudolf Silvan. – Bitte.
Abgeordneter Rudolf Silvan (SPÖ): Sehr geehrte Präsidentin! Hohes Haus! Sehr geehrte Damen und Herren hier auf der Galerie und vor den Bildschirmen! Ich möchte vielleicht ganz kurz zu Kollegen Hintner, der immer ganz Ohr ist, Stellung nehmen.
Du hast ja gesagt, die meisten Petitionen werden von Abgeordneten eingebracht und nicht von der Bevölkerung unterschrieben – viele. Da darf ich daran erinnern, dass wir die Vertreterinnen und Vertreter der Bevölkerung sind und es deswegen sinnvoll ist, dass wir die Problemstellungen aus den Wahlkreisen hierher bringen und einer Lösung zuführen. Deswegen wäre es gescheit, wenn
man das auch immer in den zuständigen Fachausschüssen tun und nicht immer nur die Petitionen zur Kenntnis nehmen würde. (Beifall bei der SPÖ sowie des Abg. Lausch.)
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zu drei Petitionen Stellung nehmen. Zuerst einmal herzlichen Dank an meinen Kollegen Alois Schroll, der sich für einen barrierefreien „Zugang zu den Bahnsteigen am Bahnhof Ernsthofen“ starkgemacht hat. Da haben die ÖBB leider eine Absage erteilt, weil es aus Sicht der ÖBB ein kleiner Bahnhof ist und andere Bahnhöfe Vorrang haben. Umso wichtiger ist es – das ist jetzt eine absolute Ausnahme im gesamten Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen –, dass diese Petition, Kollege Hintner, die einzige ist, die dem Verkehrsausschuss zugewiesen wird. Hoffentlich wird da vonseiten des Verkehrsausschusses Druck auf die ÖBB gemacht, dass am Bahnhof Ernsthofen die Barrierefreiheit Eingang findet.
Die zweite Petition ist von mir selbst, und zwar geht es um den Sicherheitsausbau der Schnellstraße im Weinviertel, der S 3, zwischen Großstelzendorf und Göllersdorf. Dort ist es sehr gefährlich, es gibt keine Beschleunigungsspuren, sondern es gibt lediglich eine Stopptafel. Es kommt immer wieder zu schweren Unfällen. Der ÖAMTC hat uns recht gegeben und uns bei dieser Petition unterstützt, und auch die Asfinag spricht sich dafür aus, um an dieser Stelle im Weinviertel die Sicherheit zu gewährleisten.
Leider Gottes hat uns aber die Asfinag auch ein bisschen vertröstet und hat gesagt, frühestens 2026 wird da etwas geschehen. Bei so einer Petition wäre es wirklich gut, wenn sie dem Verkehrsausschuss zugewiesen würde. Leider wurde sie wieder nur von den Regierungsparteien zur Kenntnis genommen.
Die dritte Petition, zu der ich Stellung will, ist die Petition „Für das Bestehen der Sozialwissenschaftlichen Bibliothek an der Wirtschaftsuniversität Wien“. Es ist geplant, diese abzureißen und der Hauptbibliothek der Wirtschaftsuniversität zuzuführen.
Die ÖH sagt dazu eindeutig – und auch meine Kollegin Kathi Kucharowits hat sich da stark gemacht –, dass die Sozialwissenschaftliche Bibliothek einen zentralen Ort für Volkswirtschafts- und Sozioökonomiestudierende darstellt. Sie ist somit ein wichtiger Treffpunkt zum Austausch zwischen Studierenden dieser Studiengänge. Bereits jetzt ist die Hauptbibliothek an der WU zu Stoßzeiten massiv überfüllt.
Also auch bei dieser Petition wäre es wichtig, sie dem zuständigen Ausschuss zuzuführen. Das ist wieder nicht geschehen, weil eben die Regierungsparteien diese wichtigen Petitionen leider nur zur Kenntnis nehmen. – Danke schön. (Beifall bei der SPÖ.)
11.31
Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Ulrike Fischer. – Bitte.
Abgeordnete Mag. Ulrike Fischer (Grüne): Schönen Vormittag von meiner Seite! Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Abgeordnete! Werte Damen und Herren! Wenn man sich den Bürger:inneninitiativen- und Petitionenausschuss und die Themenlage anschaut, dann wird einem eines sofort klar: Wir leiden unter einer fehlgeleiteten Verkehrs- und Umweltpolitik der letzten Jahrzehnte. Straßen sind zu gefährlich, zu laut. Was wird jedoch verlangt? – Verlangt wird ein Ausbau der Straßen; das heißt, wir bekämpfen Symptome und nicht die Ursachen. (Beifall bei den Grünen.)
Gestern hat unsere Umweltministerin uns das Budget zu Mobilität und Umwelt vorgestellt. Allein aus diesem Budget ist eine Trendwende, eine Klimawende möglich, und diese Trendwende, diese Klimawende brauchen wir. (Beifall bei den Grünen.)
Wir müssen den öffentlichen Verkehr ausbauen, statt immer wieder herzugehen, Straßen um Straßen zu bauen und dann zu sagen: Jetzt brauchen wir einen Lärmschutz, jetzt brauchen wir Sicherheitsmaßnahmen!
Die Vertreter der Initiative Stopp S 34, die die Petition eingebracht haben, haben über 10 000 Unterschriften gesammelt. In diesem Machwerk (ein umfangreiches Schriftstück mit dem Titel „PETITION / ‚Stopp S34 – Wir kämpfen um unsere Natur‘“ in die Höhe haltend) sind nur Unterschriften drinnen.
Worum geht es? – Es geht darum, dass auf sinnlosen 9 Kilometern eine Strecke errichtet werden soll, wodurch 150 Hektar wertvolles Ackerland versiegelt würden. Jetzt frage ich Sie, meine Damen und Herren: Wie gehen wir damit um, dass wir Lebensmittel, Agrarprodukte importieren und wertvolles Ackerland einfach verschwenden, vergeuden? Mit dieser fehlgeleiteten Politik kommen wir nicht weiter. Es braucht eine Trendwende. (Beifall bei den Grünen.)
Wenn man das so liest, dann sieht man, dass es nicht nur um Versiegelung geht, sondern auch darum, dass wir damit massiv das Grundwasser und die Lebensgrundlage von Landwirten gefährden. Wollen wir so weitermachen? – Ich glaube nicht.
Da liegt es jetzt nicht am Bürger:inneninitiativen- und Petitionenausschuss, sondern es braucht eine andere Umwelt- und Verkehrspolitik, und deswegen möchte ich mich bei den Vertretern der Bürger:innen bedanken, die sich dafür einsetzen, dass es zu mehr Ausbau von Fußwegen, Radwegen, öffentlichem Verkehr kommt. Stopp diesen Autobahnschneisen, die unser Ackerland zerstören! (Beifall bei den Grünen.)
Wollen wir in Zukunft alle Bäume nur noch im Glashaus sehen oder in Autoreifen anpflanzen? (Die Rednerin hält eine kleine Grünpflanze, die in einen Reifen einbetoniert ist, in die Höhe.) – Nein, so wird es nicht funktionieren.
Eines noch: Der Bürger:inneninitiativen- und Petitionenausschuss kann viel mehr als nur Einzelanliegen vertreten. Man merkt auch heute wieder: Wozu sprechen
die einzelnen Abgeordneten? Sprechen sie zu einem Ausbau der Straße, sprechen sie zu Konsumentenschutzrechten oder sprechen sie einfach zu Autobahnen und ewig gestriger Politik? Machen Sie sich selber ein Bild, wofür die einzelnen Abgeordneten stehen!
Der Bürger:inneninitiativen- und Petitionenausschuss kann sich nicht nur für den öffentlichen Verkehr einsetzen, sondern er setzt sich auch massiv für Verbraucher:innenrechte ein. Um nur ein Beispiel zu nennen: Der VSV setzt sich für Konsumenten, Konsumentinnen ein, die es sich nicht leisten können, für ihre Rechte einzutreten, denen das Prozesskostenrisiko zu groß ist, die sich unsichere Verfahren schlichtweg nicht leisten können. Da braucht es eine Stärkung, und wir arbeiten gerade massiv an der Umsetzung der Verbandsklagenrichtlinie. Das ist sehr komplex, aber wir stellen das auf die Beine. Danke dafür! (Beifall bei den Grünen.)
Auch die anderen Verbraucherschutzeinrichtungen sind wichtig. Wir müssen ihnen immer wieder Gehör verschaffen, und das tun wir auch über den Bürger:inneninitiativen- und Petitionenausschuss.
Noch abschließend: Es gibt immer die zwei Möglichkeiten, werte Zuseherinnen und Zuseher: Machen Sie, wenn Sie ein Anliegen haben, entweder eine Bürgerinitiative, sammeln Sie 500 Unterschriften, und das kommt in unseren Ausschuss, oder suchen Sie sich eine Wahlkreisabgeordnete, und diese setzt sich dafür ein!
Auf allen Ebenen können wir für unsere Rechte eintreten, und dafür sage ich Danke. (Beifall bei den Grünen.)
11.36
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Michael Seemayer. – Bitte.
11.36
Abgeordneter Michael Seemayer (SPÖ): Es ist schon bezeichnend, wenn man hier für die Petition für den Stopp des Ausbaus einer Schnellstraße Werbung macht, diese aber im Petitionenausschuss nicht dem zuständigen Verkehrsausschuss zugewiesen wurde, sondern auch (in Richtung Grüne) genau von Ihrer Fraktion zur Kenntnis genommen worden ist. Man merkt also schon, wie der Umgang mit manchen Petitionen oder Bürgerinitiativen ist. Es ist nämlich ein respektloser Umgang und somit auch ein respektloser Umgang mit den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger, die wir hier vertreten.
Es sind lediglich zwei von insgesamt 43 Petitionen und Bürgerinitiativen dem zuständigen Ausschuss zugewiesen worden, Kollege Silvan hat es schon angesprochen. Diese zwei haben sogar denselben Inhalt gehabt. Es war auch gut, dass sie zugewiesen worden sind.
14 Bürgerinitiativen oder Petitionen sind hingegen von den Regierungsparteien wieder nur zur Kenntnis genommen worden. Darunter sind die Anliegen – sie sind angesprochen worden –: Ausbau der S 3; die Traisental-Schnellstraße; die Adaptierung der Schülerfreifahrten; die Spritpreisbremse; aber auch die angesprochene Petition „Schluss! mit weiteren Einschränkungen der Verpackung, der Bezeichnung oder anderer Angaben von Fisch-, Fleisch- und Milchalternativprodukten“.
Man kann natürlich unterschiedlicher Auffassung sein, ob es jetzt den Ausbau einer Schnellstraße braucht oder nicht oder ob man weniger Einschränkung bei der Bezeichnung von Lebensmitteln braucht oder nicht. Hinter jeder Petition und hinter jeder Bürgerinitiative, egal, von wem sie eingebracht worden ist, stehen aber Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern. Diese haben es sich verdient, dass ihre Anliegen im zuständigen Fachausschuss dementsprechend behandelt werden (Beifall bei der SPÖ), gerade wenn es um Anliegen geht, die den Lebensmittelbereich betreffen, die Lebensmittelbezeichnung, die Kennzeichnung von Lebensmitteln. Dafür ist der Konsumentenausschuss der
richtige Ausschuss. Dieser bewahrt unter anderem davor, dass Konsumentinnen und Konsumenten durch falsche Bezeichnungen irregeführt werden, und er kennt sich aus. Daher sollten solche Themen auch dort behandelt werden.
Wir hätten insgesamt bei 13 Petitionen und Bürgerinitiativen die Zuweisung an einen Ausschuss vorgeschlagen beziehungsweise unterstützt. Wie es so oft in den letzten vier Jahren vorgekommen ist, haben die Regierungsparteien all diese Petitionen und Bürgerinitiativen aber nur zur Kenntnis genommen.
Wir sind der Auffassung, dass man sich der Anliegen der Bürgerinnen und Bürger annehmen soll, statt sie nur zur Kenntnis zu nehmen, egal in welchem Ausschuss, ob im Petitionenausschuss oder im zuständigen Fachausschuss.
Kolleginnen und Kollegen, wir sehen gerade, dass das immer wieder passiert. Dazu brauchen wir uns nur die Inflationsbekämpfung anzuschauen, die derzeit nicht stattfindet. Stattdessen wird auch die Teuerung nur zur Kenntnis genommen. – Danke. (Beifall bei der SPÖ.)
11.39
Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Fiona Fiedler. – Bitte.
Abgeordnete Fiona Fiedler, BEd (NEOS): Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuseherinnen und Zuseher! (Die Begrüßung auch in Gebärdensprache ausführend:) Liebe gehörlose Menschen! Zum Petitionenausschuss – es ist jetzt eh schon mehrfach erwähnt worden –: Es gab zahlreiche Kenntnisnahmen, es werden Dinge einfach zur Kenntnis genommen. Auffallend ist, dass von den Regierungsfraktionen auch sehr viele eigene Petitionen beziehungsweise Bürgerinitiativen zur Kenntnis genommen worden sind, unter anderem die zwei Bürgerinitiativen zum Verbraucherschutzverein und zu Cobin Claims.
Da hat Österreich wieder einmal etwas versäumt, nämlich der EU-Richtlinie über Verbandsklagen fristgerecht nachzukommen und das umzusetzen. Deswegen hätten wir uns eigentlich eine weitere Behandlung gewünscht.
Frau Kollegin Fischer, wenn Sie sagen, dass Sie intensiv daran arbeiten, dann muss ich sagen, man hätte so eine Bürgerinitiative ja zuweisen können. Das wäre vielleicht der passendere Umgang mit Bürgerinitiativen und der Arbeit, die Bürger da leisten. (Beifall bei den NEOS sowie der Abg. Duzdar.)
Was wir aber auch haben, sind zwei Zuweisungen von Petitionen, nämlich jene betreffend „Barrierefreier Zugang zu den Bahnsteigen am Bahnhof Ernsthofen“ beziehungsweise „der barrierefreien Gestaltung des Bahnhof Ernsthofen“. Das wurde auch schon erwähnt.
Barrierefreiheit – was heißt das eigentlich? – Da gibt es einerseits die bauliche Barrierefreiheit, so wie sie bei diesem Bahnhof gefordert wird. Es gibt aber auch die digitale Barrierefreiheit oder die gesellschaftliche Barrierefreiheit hinsichtlich der Barrieren im Kopf. Ziel der Barrierefreiheit ist, dass alle Menschen gleichberechtigt an unserem alltäglichen Leben teilhaben können und dass niemand aufgrund seiner Behinderungen durch Barrieren ausgeschlossen wird.
Es ist einerseits wichtig, dass diese Petitionen dem Fachausschuss zugewiesen werden, andererseits aber sollte es da längst keine Petitionen mehr brauchen. In Österreich ist nämlich seit 2008 die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft. Wir sollten daher, wenn wir Bahnhöfe oder andere Gebäude errichten, idealerweise schon im Vorfeld Expertinnen und Experten dazu einladen, in der Planungsphase zu schauen, was barrierefrei bedeutet und was beispielsweise bei einem Bahnhof in dieser Hinsicht gebraucht wird. Das würde Umbauten ersparen, das würde irrsinnig viel Bürokratie ersparen, würde aber vor allem auch Kosten ersparen.
Barrierefreiheit ist eine Querschnittsmaterie. Dieses gesamtheitliche Bild auf Barrierefreiheit wird deutlich, wenn man zum Beispiel einen barrierefreien
Bahnhof baut und dann kein barrierefreier Zug kommt – auch wieder ein Problem.
Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, hat der entsprechende UN-Fachausschuss Österreich als Land darauf geprüft, wie weit wir denn mit dieser Umsetzung betreffend die Barrierefreiheit sind. Demnach sind wir nicht nur im Bereich Bildung wirklich grottenschlecht, sondern haben auch im Bereich der Barrierefreiheit einiges zu tun: Wir wurden mit mangelhaft beurteilt. Der Ausschuss empfiehlt da Gesetze zur Verwirklichung der Barrierefreiheit von Dienstleistungen, Produkten und Infrastrukturen, genauso wie er auch Standards und verbindliche Fristen empfiehlt.
Geschätzte Regierungsparteien, das ist ein klarer Auftrag an Sie alle, und ich hätte gerne, dass Sie da endlich ins Tun kommen! – Danke schön. (Beifall bei den NEOS.)
11.43
Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Andrea Holzner. – Bitte.
Abgeordnete Dipl.-Ing. Andrea Holzner (ÖVP): Frau Präsidentin! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher auf der Galerie und zu Hause! Besonders begrüße ich die Gruppe aus Waizenkirchen mit Bürgermeister und DJ Fabian Grüneis. – Herzlich willkommen im Parlament! (Allgemeiner Beifall.)
Sehr geehrte Damen und Herren! Kurz zu zwei Petitionen aus dem Sammelbericht, nämlich zu Petition 121 betreffend Rechtsanspruch auf Kinderbildung ab dem ersten Lebensjahr und Petition 120 betreffend Erhalt der Sozialwissenschaftlichen Bibliothek an der Wirtschaftsuniversität Wien:
Zu dieser zweitgenannten Petition hat das Rektorat gemeinsam mit der Hochschülerschaft der WU Wien eine Stellungnahme abgegeben und
festgestellt, dass sowohl der Erhalt als auch die Pflege der Bibliothek sichergestellt sind. – Herr Silvan, Frau Kucharowits, es geht nur um eine veränderte Raumnützung. Trotzdem nehmen SPÖ, FPÖ und NEOS im Sinne der Bundes-ÖH die Expertise der Studierenden und Lehrenden vor Ort nicht zur Kenntnis.
Genauso fahren SPÖ und NEOS mit ihrer Forderung nach einem Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr über alle Gemeinden einfach drüber. Das wollen wir als Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nicht. Wir kennen die Situation vor Ort und wir schaffen Jahr für Jahr neue Kinderbetreuungsplätze! (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
Mit den zugesagten Mitteln über den Finanzausgleich aus dem Zukunftsfonds können wir nun auch die Lücke bei der Betreuung der unter Dreijährigen schließen. Mit 2,4 Milliarden Euro für die Periode 2024 bis 2028 ist die Summe achtmal so hoch wie zuletzt beim Finanzausgleich 2015, wobei 1,1 Milliarden Euro davon an zukunftsweisende Ziele gebunden sind.
Ich gratuliere allen Verhandlern des Finanzausgleichs, dem Bund, den Ländern, darunter drei rot regierten Ländern, dem Gemeindebund und dem Städtebund, zu diesem Kraftakt! Herzlichen Dank! (Beifall bei der ÖVP.)
Das zeigt: Die Republik funktioniert. Glaub an Österreich! (Beifall bei der ÖVP.)
11.46
Präsidentin Doris Bures: Nun ist Abgeordneter Christian Lausch zu Wort gemeldet. – Bitte.
Abgeordneter Christian Lausch (FPÖ): Frau Präsidentin! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Zuerst muss ein bisschen repliziert werden. Da stellt sich allen Ernstes der Erstredner der ÖVP, nämlich Abgeordneter Hintner, Bürgermeister von Mödling, hierher und rechtfertigt die Schubladisierung, die Zugrabetragung von Petitionen damit, dass die meisten ja eh von Parteien, wie er es bezeichnet – richtiger wäre es: von Abgeordneten dieses Hauses –, kommen.
Jetzt müssen wir Bürgermeister Hintner erst einmal erklären, dass alle Petitionen, die eingebracht werden, auf der Parlamentshomepage von Bürgerinnen und Bürgern unterstützt werden können, was auch zahlreich passiert. (Abg. Kollross: Ja eh!) – Kollege Hintner, schauen Sie sich einmal die Parlamentshomepage an, dann werden Sie vielleicht eine andere Meinung darüber haben! Diese Petitionen werden sehr wohl von vielen Bürgerinnen und Bürgern unterstützt, aber anscheinend sind Ihnen die Bürgerinnen und Bürgern völlig wurscht, das hat man ja im Petitionenausschuss sehen können. (Beifall bei der FPÖ. – Abg. Michael Hammer: Volksbegehren für Straßen ... Volkspartei!)
Die Straßenbauprojekte, die im Petitionenausschuss behandelt wurden, waren großteils reine Sicherheitsmaßnahmen, um tödliche Verkehrsunfälle auf Österreichs Straßen zu verhindern. Man hat deutlich gesehen – schön, dass die Bürgerinnen und Bürger zuschauen können –, dass dieser Bundesregierung die Autofahrer, die Pendler egal sind. Da kommt man mit fadenscheinigen Argumenten, wie schon im Ausschuss.
Das war bezeichnend. Da haben die Grünen, in ihrer Ideologie verhaftet, einfach klipp und klar gesagt, wie auch heute Kollegin Fischer: Sie wollen das nicht. Von der ÖVP hat sich im Ausschuss gar keiner zu Wort gemeldet. Die haben an ihren Handys herumgedrückt, nicht einmal aufgepasst, und es war ihnen völlig wurscht, was mit der Sicherheit der österreichischen Autofahrer ist. Von der ÖVP hat es in der Ausschusssitzung keine einzige Wortmeldung gegeben. (Abg. Zarits: ... vollzählig!) Und dann nimmt man das lediglich zur Kenntnis! Das ist eigentlich ein Witz beziehungsweise eine Brüskierung jedes Verkehrstoten! (Beifall bei der FPÖ.)
Kollegin Fischer kommt, als Grüne besonders gescheit, mit ihrer Plastikbox und mit irgendeinem Plastikbäumchen heraus (Abg. Disoski: Es war ein Geschenk von Bürgerinnen, ...!) und will uns etwas von Versiegelung erzählen. Dabei sind diese Sicherheitsausbauten teilweise Brückenverbreiterungen, bei denen kaum Ackerboden verloren geht. Da wird gar nichts versiegelt, sondern es geht lediglich darum, dass Brücken verbreitert werden. Und da kommt man mit
Bäumchen heraus und sagt, auf die Tränendrüse drückend, Unwahrheiten – so wie das zum Beispiel Kollege Weratschnig im Petitionenausschuss versucht hat. Auch wenn vieles von dem, was er gesagt hat, falsch war, hat er sich im Ausschuss immerhin zu Wort gemeldet, das muss man ihm lassen, während der ÖVP die Sicherheit der Autofahrer komplett wurscht war. Kollege Weratschnig hat dort, so wie heute Kollegin Fischer hier, einiges erklärt, was gar nicht stimmt.
So ist es halt bei Bauprojekten: Als Grüner ist man prinzipiell gegen Autofahrer, gegen Straßen, am liebsten würde man sie sprengen. Dabei hat man komplett übersehen, dass das reine Sicherheitsmaßnahmen wären, und dass es wie gesagt um Verbreiterung von Brücken geht, bei der kaum Ackerboden verloren geht. Es ist traurig, dass es so ist. (Beifall bei der FPÖ.)
An die Österreicherinnen und Österreicher gerichtet: Liebe Autofahrer, liebe Pendler, jetzt sehen Sie, was dieser Bundesregierung eure Verkehrssicherheit wert ist, nämlich gar nichts! (Beifall bei der FPÖ.)
11.49
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Hermann Weratschnig. – Bitte. (Abg Minnich will ans Redner:innenpult treten. – Abg. Matznetter: Kollege Minnich wollte sich vordrängen! – Abg. Weratschnig: Zu zweit, Herr Kollege! – Heiterkeit bei Abgeordneten der SPÖ.) – Das sieht die Geschäftsordnung nicht vor.
Abgeordneter Hermann Weratschnig, MBA MSc (Grüne): Frau Präsidentin! Werte Abgeordnete! Zu dem, was Herr Kollege Lausch gerade gesagt hat: Man sieht, dass sich für die Freiheitlichen Verkehrssicherheit im Ausbau von hochrangigen Straßen erschöpft. Das ist natürlich zu kurz gedacht und genau das habe ich auch im Petitionenausschuss zu erklären versucht: dass wir natürlich auch für notwendige Sicherheitsausbauten eintreten. (Abg. Lausch: Das ist falsch!) Ich habe Ihnen auch erklärt, was das etwa für die S 3 und die S 37 in Kärnten
bedeutet, aber Sie haben es anscheinend nicht verstanden. (Beifall bei den Grünen.)
Bei all diesen Projekten – S 34, S 37, S 3 – sind natürlich diese Fragen zu stellen: Wie schaut es mit dem Sicherheitsausbau aus? Wie schaut es aus, wie viel Boden wird verbraucht? Gibt es auch alternative Varianten? Was passiert nach einem solchen Ausbau? Gibt es eine Sogwirkung auf andere Verkehrsströme, die dann wiederum die Orte belasten und vielleicht auch noch andere Orte belasten, die jetzt noch nicht belastet sind und von denen wir dann wieder Petitionen im Petitionenausschuss zu behandeln haben werden? Diese Gesamtschau ist bei der Mobilität und beim Straßenbau wesentlich, damit keine anderen und neuen Transitrouten entstehen. Alternativen sind zu prüfen, das macht das BMK auch, das macht die Frau Bundesministerin auch, um das untergeordnete Straßennetz zu schützen und Ortskerne zu entlasten.
Da wird es wahrscheinlich auch die eine oder andere Maßnahme im Straßenbau brauchen, keine Frage, aber es wird hier einfach alles mit dem Bade ausgeschüttet: Wir Freiheitliche stehen grundsätzlich für den Straßenausbau, koste es was es wolle. – Das ist ein völlig falscher Ansatz, weil natürlich auch in dieser Frage Kosten und Nutzen entsprechend zu prüfen sind. Das Bild, das sich da ergibt, ist völlig klar.
Eine Anmerkung noch zur Spritpreisbremse und überhaupt zum Thema Spritpreis, weil das heute hier erwähnt wurde. Ich habe mir gerade die aktuellen Spritpreise angeschaut. Jedes Lebensmittel hat sich seit 2019 mehr verteuert als der Sprit. Wenn man sich den heutigen Spritpreis und den Spritpreis von 2019 anschaut, wird man erkennen, dass es eine Teuerung von 15 bis 20 Prozent gibt, also jährlich circa 4 Prozent. Am Spritpreis liegt es also nicht.
Und eines ist auch klar: In den Zeiten, als der Sprit teurer war, haben wir für jene Pendler, die vom Pkw abhängig sind, auch entsprechende Maßnahmen gesetzt, wie den Klimabonus und andere Maßnahmen, die ausgleichend wirken, die sogar darüber hinaus ausgleichen. Das kann der Spritpreis gar nicht. Er ist immer noch
auf einem Stand, von dem ich sagen muss, dass nicht einmal die CO2-Bepreisung dazu geführt hat, dass er entsprechend gestiegen wäre. (Abg. Kassegger: Zu niedrig für euch Grüne, oder was?) Deshalb ist es auch ganz klar, dass es diese Stufen in der CO2-Bepreisung braucht, um tatsächlich Lenkungseffekte zu ermöglichen. – Ich danke für die Aufmerksamkeit. (Beifall bei den Grünen.)
11.53
Präsidentin Doris Bures: Herr Abgeordneter Andreas Minnich, jetzt gelangen Sie zu Wort. – Bitte.
Abgeordneter Andreas Minnich (ÖVP): Frau Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen im Hohen Haus! Liebe Zuseher auf der Zuschauergalerie und zu Hause vor den Fernsehbildschirmen! Liebe Österreicherinnen und Österreicher! Im heutigen Sammelbericht des Petitionenausschusses behandeln wir eine Petition und eine Bürgerinitiative, die sich mit unserer Neutralitätspolitik und den internationalen Konflikten beschäftigen.
Seit Monaten diskutieren wir hier im Plenum, in den Ausschüssen, am Stammtisch oder daheim mit der Familie den Begriff der Neutralität. Permanent wird der Begriff verdreht, anders ausgelegt und werden Rückschlüsse auf die Außenpolitik gezogen. Worin wir uns aber wahrscheinlich alle einig sind, ist, dass sich eine aktive Außenpolitik mit der Neutralität nicht nur ausgeht, sondern sogar eine aktive Außenpolitik sein muss. Aktive Außenpolitik heißt, eine Meinung zu haben und die Interessen Österreichs international zu vertreten.
Eine Meinung haben wir auch 1956 bei der blutigen Niederschlagung des Ungarnaufstandes durch die Sowjetarmee gehabt, ebenso bei der gewaltsamen Niederschlagung des Prager Frühlings; eine Meinung, die wir damals gehabt haben, als es galt, flüchtende Menschen aus diesen beiden Ländern in Österreich schützend aufzunehmen.
Dass eine funktionierende Landesverteidigung und die Neutralität zusammengehören, ist ebenso unumstritten. Österreichs Neutralität ist eine militärische, keine Gesinnungs- oder Meinungsneutralität. Es geht darum, sich zu verteidigen. Das tun wir mit Investitionen in unser Bundesheer und auch mit Sky Shield. Das ist eine Beschaffungsplattform, sonst wäre die Schweiz da auch nicht dabei. Wir schützen uns, denn eines sollte auch unumstritten sein: Die Neutralität ist kein Schutzschild.
Sehr geehrte Damen und Herren! Neutralität heißt, seine Interessen international zu vertreten, und Neutralität heißt, sich zu verteidigen. Verfallen wir nicht in den Glauben, dass unsere Neutralität Österreich zu einer Insel der Seligen macht, die von allen Krisen unberührt bleibt. Das wäre gefährlich und fahrlässig. Glauben wir an Österreich! (Beifall bei der ÖVP.)
11.56
Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Sibylle Hamann. – Bitte.
Abgeordnete Mag. Sibylle Hamann (Grüne): Liebe Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ein paar Worte zur Petition zur Elementarbildung. Diese Petition hat vollkommen recht: Der Ausbau von Kindergärten in Österreich ist absolut dringend notwendig. (Beifall bei den Grünen.)
Warum? – Kindergärten helfen Familien, ihren Alltag zu bewältigen, sie fördern, wie wir wissen, die Bildung, sie erleichtern die Erwerbstätigkeit. Die Petition führt richtig an, dass sie Gemeinden und der Wirtschaft helfen. Ich würde hinzufügen: Sie sind vor allem auch für die Kinder gut und sie fördern eine gleichberechtigte Elternschaft. (Beifall bei den Grünen sowie der Abg. Pfurtscheller.)
Deswegen fordert diese Petition völlig zu Recht viel mehr Geld aus dem Finanzausgleich, und genau das gibt es jetzt. Im Zukunftsfonds ist der allergrößte Brocken, nämlich 500 Millionen Euro pro Jahr sind für die Elementarpädagogik
reserviert. Das darf für nichts anderes verwendet werden. Dazu kommen noch die 200 Millionen Euro aus der laufenden 15a-Vereinbarung, das macht 700 Millionen Euro pro Jahr vom Bund für den Ausbau von Kindergärten im ganzen Land. Bis 2030 sind das also deutlich über 4,5 Milliarden Euro. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP. – Abg. Hörl: Hört, hört! Sie hören nicht zu!)
Was sollen jetzt die Länder und Gemeinden damit machen? – Das wird überall ein bisschen etwas anderes sein, weil die Prioritäten unterschiedlich sind. In manchen Regionen wird das verwendet werden müssen, um die Plätze für die unter Dreijährigen deutlich auszubauen. Sehr wichtig! Es wird verwendet werden müssen, um die Öffnungszeiten zu erweitern, sowohl was die Öffnungszeiten am Tag betrifft, als auch in der Woche, als auch im Jahr. Es wird – ganz wichtig! – dafür verwendet werden müssen, die Gruppen zu verkleinern. Das wird auch die Arbeitsbedingungen der Pädagog:innen verbessern. Und selbstverständlich wird das Geld dafür verwendet werden müssen, um mehr Personal anzustellen, und auch, um das Personal deutlich besser zu bezahlen. (Beifall bei den Grünen sowie der Abgeordneten Bogner-Strauß und Schnabel.)
Soll es auch einen Rechtsanspruch geben? – Aus grüner Sicht vollkommen klar: Ja. Wir freuen uns über jedes Land, das diesen Rechtsanspruch beschließt. Das ist auch schon morgen möglich. Wollen wir diesen Rechtsanspruch in ganz Österreich? – Ebenfalls: Ja. Die Grünen hätten ja, wie wir schon mehrmals betont haben, den ganzen Bereich der Elementarpädagogik gerne in der Bundeskompetenz, und wir freuen uns über alle Verbündeten, die uns bei dieser Verfassungsänderung unterstützen. – Vielen Dank. (Beifall bei den Grünen.)
11.58
Präsidentin Doris Bures: Nun gelangt Herr Abgeordneter Joachim Schnabel zu Wort.
11.59
Abgeordneter Joachim Schnabel (ÖVP): Frau Präsidentin! Hohes Haus! Geschätzte Damen und Herren auf der Zusehergalerie und vor den Monitoren! Ich möchte mich eingangs, da ich den Button „Stoppt Gewalt an Frauen“ wie so viele hier trage, bei einer regionalen Initiative in meiner Bezirkshauptstadt Leibnitz bedanken. Es ist dies Freiraum Leibnitz, ein Verein, der sich seit vielen Jahren großteils ehrenamtlich für dieses Thema einsetzt. Vor allem die Obfrau Sandra Jakomini ist sehr rührig und sehr tatkräftig. Vielen, vielen Dank dafür! (Beifall bei der ÖVP.)
Ich melde mich zu diesem Tagesordnungspunkt zur Petition 92 zum Thema Gelegenheitsverkehr. Das Thema betrifft vor allem den ländlichen Raum, Gemeinden, in denen der Schülertransport mit Kleinbussen funktioniert. Ich habe die Gemeinden Söding-Sankt Johann, Edelschrott und Stallhofen mit einer Petition unterstützt, in denen dieses Thema in den letzten Jahren besonders aufgeschlagen ist.
Worum geht es? – Problemaufriss: Seit 1950 gibt es den Schülertransport in Österreich und die Regeln waren eigentlich bis dato immer gleich. Es gibt eine Zumutbarkeit von 2 Kilometern, diese Entfernung wird den Kindern zugemutet, um in die Schule zu gehen. Es gilt eine Wartezeit von einer Stunde.
Der Bund hat eigentlich auf ÖVP-Initiative bis dato immer die Finanzierung dazu gestemmt. In den letzten Jahren ist es aber zu einer Unterfinanzierung gekommen. Es sind nicht nur die genannten drei Gemeinden an mich herangetreten, sondern auch sieben Gemeinden aus der Region Stiefingtal, und es hat 37 weitere Onlineunterstützerinnen und -unterstützer gegeben, um den Gelegenheitsverkehr weiterzuentwickeln.
Das hat vor einem Jahr begonnen und es ist – das kann ich positiv vermerken – sehr viel gelungen, auch im Zuge des Verhandlungsergebnisses des Finanzausgleiches. (Zwischenruf des Abg. Kollross.)
Auf der finanziellen Seite haben wir jetzt mit einer Valorisierung von über 7 Millionen Euro zu rechnen: Wir geben vonseiten des Bundes 100 Millionen Euro für den Gelegenheitsverkehr aus, und jetzt kommen 7 Prozent Valorisierung plus 15 Millionen aus dem Finanzausgleich dazu.
Man kann das ganz leicht in Prozentsätze umrechnen: Es gibt also 22 Prozent mehr Mittel. Da haben wir dann auch einen relativ kostendeckenden Tarif zu erwarten. Es gibt dann – wenn man das ungefähr hochrechnet – 1,56 Euro für die Busunternehmerinnen und -unternehmer für die Kilometerleistung. Somit ist das Ganze vor allem für den ländlichen Raum ausfinanziert, und die Gemeinden können, was die finanzielle Belastung betrifft, außen vor gehalten werden. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
Geschätzte Damen und Herren, der Gelegenheitsverkehr hat durch den Verhandlungserfolg seitens der ÖVP wirklich eine große Stärkung erfahren, es bedarf aber sicher noch weiterer Schritte. Vor allem im Ausgleich zum städtischen Umfeld sollten wir weiterhin über die 2-Kilometer-Grenze reden, damit die Schülerinnen und Schüler im ländlichen Raum auch den gleichen Komfort haben wie jene, die in der Stadt wohnen.
Zum Abschluss möchte ich mich noch kurz an Kollegen Kollross wenden, der gestern den Finanzausgleich moniert hat: Herr Kollege Kollross, Sie sind ein erfolgreicher Bürgermeister, das muss man sagen (Abg. Lausch: ... klatschen!), wie so viele andere in diesem Lande, die sich wirklich sehr stark für die Bürgerinnen und Bürger einsetzen, und im Gegensatz zu Ihrem Kollegen Max Lercher haben Sie auch wirklich tiefe Kenntnisse der Materie. (Abg. Lercher: ... Steiermark!) Der Finanzausgleich wurde aber auch von der SPÖ mit unterschrieben, das muss man einmal ganz klar sagen (Abg. Kollross: Das macht ihn nicht besser!), das wird in der Diskussion immer vergessen, Sie betreiben da irgendwie Kindesweglegung. Schauen Sie sich an, was da gelungen ist: wesentlich mehr Mittel für die Gemeinden und auch für die Länder!
Durch den Zukunftsfonds, der ja vor allem von Kollegin Hamann schon angesprochen wurde, gibt es direkte Mittel an die Gemeinden. Wenn Sie das Paktum, das Sie anscheinend noch nicht vorliegen haben, weiterlesen: Finanzzuweisungen an Länder und Gemeinden für Gesundheit und Pflege: plus 300 Millionen Euro, auf 600 Millionen Euro aufgestockt (Abg. Kollross: Nur für die Länder, nicht für die Gemeinden!); Finanzzuweisungen an Gemeinden für den Gelegenheitsverkehr: abermals plus 15 Millionen Euro Zuschuss; Zweckzuschuss Eisenbahnkreuzung: verlängert bis 2034, das haben wir unter diesem Tagesordnungspunkt diskutiert; 10 Millionen Euro mehr für Gemeinden, die Theatererhalter sind; 20 Millionen Euro mehr für die Siedlungswasserwirtschaft; 10 Millionen Euro mehr für Assistenzpädagogen; für den Schülertransport, über den ich gesprochen habe, 15 Millionen Euro; 300 Millionen Euro als Vorschuss für Investitionen und, und, und.
Ich gebe Ihnen jetzt dieses Paktum, das auch von Ihren Parteikollegen mit unterschrieben wurde. (Abg. Kollross: Ich hab es! Ich hab es auch verstanden, im Gegensatz zu dir!) Studieren Sie das einmal, denn dieser Finanzausgleich ermöglicht den Gemeinden auch im nächsten Jahr ein positives Wirtschaften! – Danke. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen. – Der Redner übergibt die besagte Unterlage an Abg. Kollross.)
Präsidentin Doris Bures: Zu Wort ist dazu nun niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
Wünscht die Frau Berichterstatterin ein Schlusswort? – Das scheint nicht der Fall zu sein.
Herr Abgeordneter, wenn Sie wieder Platz nehmen, können wir zur Abstimmung kommen.
Wir kommen nun zur Abstimmung über den Antrag des Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen, seinen Bericht 2237 der Beilagen hinsichtlich
der Petitionen 66, 70, 72, 79, 92, 95, 111, 116, 118 und 120 bis 122 sowie der Bürgerinitiativen 41, 43, 52 und 54 zur Kenntnis zu nehmen.
Wer sich dafür ausspricht, den bitte ich um ein Zeichen. – Das ist mit Mehrheit zur Kenntnis genommen.
Bericht des Außenpolitischen Ausschusses über den Antrag 3666/A(E) der Abgeordneten Dr. Reinhold Lopatka, Petra Bayr, MA, MLS, Dr. Ewa Ernst-Dziedzic, Dr. Nikolaus Scherak, MA, Kolleginnen und Kollegen betreffend Terrorangriff der Hamas auf Israel (2290 d.B.)
Präsidentin Doris Bures: Damit gelangen wir nun zum 15. Punkt unserer heutigen Tagesordnung.
Ich begrüße den Herrn Bundesminister in unserer Mitte.
Als Erster zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Reinhold Lopatka. – Bitte.
Abgeordneter Dr. Reinhold Lopatka (ÖVP): Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Politik lebt vom Kompromiss und von solidarischem Handeln. Es gibt aber Grundsatzfragen, wo ein Kompromiss ausgeschlossen sein muss und wo Solidarität eigentlich nur eine falsch verstandene Solidarität sein kann.
Mit Feinden der liberalen Demokratie, unserer offenen Gesellschaft wie mit Hamas-Terroristen darf und kann es keinen Kompromiss geben. (Beifall bei der ÖVP sowie bei Abgeordneten von Grünen und NEOS.) Sie sind kompromisslos zu bekämpfen, um einen weiteren 7. Oktober zu verhindern, einen Tag mit verbrannten Babys, mit enthaupteten Menschen und mehr als 200 Geiseln.
Als ich in Israel war, habe ich ein entsprechendes Video gesehen, sehen müssen, es war der Wunsch unserer Gastgeber. Auch Präsident Jitzchak Herzog hat uns
in einem Gespräch dramatisch geschildert, was dieser 7. Oktober, dieser schwarze Tag, für Israel bedeutet.
Und jetzt gibt es die Feuerpause und erste Geiseln sollen heute freikommen. Eine Feuerpause ist noch kein Ende dieses Krieges. Während es mit Gaza, mit der Hamas diese Feuerpause gibt, schießen Hisbollah-Terroristen vom Libanon weiter unentwegt Raketen auf Israel ab.
Ich habe es schon gesagt: Es darf mit Terroristen keine falsch verstandene Solidarität geben. (Beifall bei der ÖVP sowie der Abgeordneten Disoski, Krisper und Scherak.) Da verstehe ich auch nicht die – ich sage es Ihnen ganz offen -irregeleitete Fridays-for-Future-Aktivistin Greta Thunberg.
Es kann nur heißen: Null Toleranz gegenüber Intoleranten. Das ist die einzig richtige Antwort, denn eine unvorstellbar barbarisch vorgehende Verbrecherbande wie die Hamas kann nur bis zum Schluss bekämpft werden. Jetzt hat ihr abgrundtiefer Hass Juden in Israel getroffen. Ihr Hass gilt aber nicht nur den Juden weltweit, sondern auch der freien, offenen Gesellschaft.
Den Kampf, den Israel jetzt führt, führt es natürlich für die Sicherheit der Menschen im eigenen Land, er wird aber auch für die freie, offene Welt geführt. Es ist daher für mich sehr, sehr positiv und ich kann es nur begrüßen, dass sofort nach dem Angriff alle fünf im Nationalrat vertretenen Parteien durch die Präsidialkonferenz eine gemeinsame Erklärung abgegeben haben.
Ich begrüße es auch außerordentlich – und ich verstehe da die SPÖ nicht –, dass Österreich eine klare Haltung vor der UNO eingenommen hat. Herr Außenminister, ich bedanke mich ausdrücklich dafür. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der NEOS.)
In solchen Zeiten gilt es, Haltung zu zeigen. Es ist begrüßenswert, dass alle fünf im Parlament vertretenen Parteien es auch heute, am Ende dieser Debatte, schaffen, zu einem Fünfparteienantrag zu kommen. Wenngleich in anderen
Bereichen die Auseinandersetzungen hier zugenommen haben, senden wir damit das stärkste Signal aus, das wir als Nationalrat ausschicken können. Andere Möglichkeiten haben wir nicht, und meines Erachtens können wir nicht nur, sondern wir müssen das als parlamentarische Vertretung Österreichs auch ausschicken. Danke, dass wir das gemeinsam machen! (Beifall bei der ÖVP sowie der Abgeordneten Disoski und Ernst-Dziedzic.)
Es war hier in diesem Saal, am 9. November, als ich eine der beeindruckendsten Reden gehört habe, die jemals hier im Plenum gehalten wurden – nicht von einem unserer Abgeordneten, sondern von einem Holocaustüberlebenden, Benno Kern, der genau diese Haltung von uns eingefordert hat, als er gefragt worden ist: Was ist jetzt das Wichtigste?
Wir machen das, wenngleich mir bewusst ist, dass der Druck auf Israel zunimmt, nicht nur eine Waffenpause, sondern eine Waffenruhe zu akzeptieren. Der jüdische Staat hat aber das Recht, das wir auch der Ukraine zusprechen: Wenn ein demokratischer Staat angegriffen wird, muss er sich verteidigen. Es ist immer der Staat selbst, der dann entscheidet, wann der Zeitpunkt gekommen ist, einen Krieg zu beenden und zu Verhandlungen zusammenzukommen.
Natürlich wünschen wir uns alle, dass es möglichst bald zu Verhandlungen kommt, denn am Ende des Tages müssen die Menschen ja zusammenleben. Ich sage es Ihnen, bei dieser Bevölkerungsdichte, die im Gazastreifen gegeben ist, und gleichzeitig dem Recht, dass sich Israel natürlich verteidigen muss und verhältnismäßig vorgehen muss, kann man nicht Israel die Schuld geben, wenn unschuldige Menschen geopfert werden. Es ist die Hamas, die Menschen als Schutzschilde verwendet, es ist die Hamas, die unter einem Spital eine Kommandozentrale einrichtet. Da darf man Täter und Opfer nicht verwechseln. (Beifall bei der ÖVP sowie bei Abgeordneten von SPÖ, Grünen und NEOS.)
Israel ist da nicht der Täter! Die eigene Bevölkerung, arme Palästinenserinnen und Palästinenser, sind die Opfer dieser Terrorgruppe. Daher haben wir hier ohne Wenn und Aber Stellung zu beziehen, wie ich schon mehrfach betont
habe. Wir müssen da – wir sehen ja, dass die Feinde der Demokratie stärker werden – hellwach bleiben. Israel hatte nach Artikel 51 der UNO-Charta das Recht auf Selbstverteidigung. Israel hatte meines Erachtens auch die Pflicht, die eigene Bevölkerung zu schützen. Was würden wir hier in Österreich anders machen?
Lassen Sie mich mit der Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek schließen. Sie hat jüngst in einem Text festgehalten: „Die Hamas hat sich mit diesem Verbrechen ein für allemal selbst zerstört.“ – Ich hoffe, sie behält recht. (Beifall bei der ÖVP sowie bei Abgeordneten von SPÖ, Grünen und NEOS.)
12.12
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Christoph Matznetter. – Bitte.
Abgeordneter Dr. Christoph Matznetter (SPÖ): Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Kolleginnen und Kollegen! Zuseherinnen und Zuseher! Auch ich schließe mich dem Dank an alle Fraktionen an, dass wir nach diesem terroristischen Massaker des 7. Oktober – Reinhold Lopatka hat geschildert, was passiert ist – sehr, sehr rasch zusammengefunden haben.
Es kann wohl keine andere Position geben, wenn Menschen, die zu einem Musikfestival fahren, wenn Menschen, die in ihrem Kibbuz ganz normal aufwachen, binnen Stunden einem solchen terroristischen Akt ausgesetzt sind. Aber – und das Aber sage ich an dieser Stelle bewusst – wir müssen diese Position beibehalten. Das bedeutet, dass wir grundsätzlich auf der Seite der Opfer stehen müssen, dass wir grundsätzlich – ungeachtet der Herkunft, des Geschlechts, der Religion und der Zugehörigkeit – immer die Position derer einnehmen müssen, die die Menschlichkeit, die unantastbare Würde des Menschen im Auge behalten.
Reinhold, du hast richtig aufgezählt: Es ist selbstverständlich und völlig klar, dass jedes Land und jedes Volk dieser Welt das Recht auf Selbstverteidigung hat. Das ist keine Frage. Nur eines darf nicht passieren – und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, zu dem wir Beiträge leisten können –: Auf dem Altar der notwendigen Maßnahmen dürfen nicht welche zu Schaden kommen, die damit nichts zu tun haben. Diesem Grundsatz folgend haben wir heute diesen Antrag vorliegen, der sich darauf richtet, die notwendigen Maßnahmen zu setzen.
Ein bisschen kafkaesk für uns ist, dass wir heute einen Entschließungsantrag behandeln, der durch die Realität überholt ist. Wir haben natürlich eine bedingungslose Freilassung aller Geiseln gefordert. Wir wissen alle, dass die heutige Waffenruhe, die um 7 Uhr lokaler Ortszeit in Kraft getreten ist, aufgrund mittels Vermittlern geführter Verhandlungen zwischen der Netanjahu-Regierung und der Hamas zustande kam. Ich wünsche mir und hoffe, dass die Waffenpause, die jetzt in Kraft ist, so lange anhält, dass möglichst alle Geiseln zu ihren Familien zurückkehren können.
Ich wünsche mir aber auch, dass die Möglichkeit, die jetzt geschaffen wurde, dass die Menschen im Gazastreifen – dort leben Millionen Menschen, dort lebt nicht die Hamas, das sei an dieser Stelle klar gesagt – Wasser und Nahrungsmittel haben, eine Möglichkeit haben, im Spital behandelt zu werden, und auch nicht mehr von einer Terrororganisation als lebende Schutzschilder missbraucht werden, bestehen bleibt.
Ich – und ich glaube, niemand möchte das – möchte nicht in der Rolle der israelischen Sicherheitskräfte stecken. Das ist wie jede unmögliche Situation, die auch bei uns jede Polizeieinheit mühsam übt: Wie kannst du bei der notwenigen Maßnahme, die du setzen musst – Terroristen unschädlich zu machen –, deine Gewaltanwendung so positionieren, so portionieren, so ausüben, dass nicht Unschuldige zu Opfern werden? Diese schwierige Situation bedarf, glaube ich, unserer Unterstützung. Das heißt aber auch – und da müssen wir aufpassen, Kolleginnen und Kollegen –, dass wir bei aller Solidarität auch die mahnenden
Worte nicht vergessen dürfen, dass wir darauf einwirken müssen, dass Bedachtnahme stattfindet, dass nicht andere Kinder Opfer des Konflikts werden.
Mein letzter Punkt: Vielleicht tun wir uns insgesamt leichter, wenn wir diese Zielsetzung gemeinsam formulieren. Was ich mir wünsche, ist, dass es in einem absehbaren Zeitraum ein Israel gibt, in dem man keine Angst haben muss, zum Ravekonzert zu fahren, ein Israel, in dem man in einen Bus steigen kann und dabei nicht Angst haben muss, dass jemand mit einem Sprengstoffgürtel drinnen sitzt, aber auch einen Nahen Osten, einen Gazastreifen und ein Westjordanland, in dem die Menschen in Würde leben können, wo sie eine Perspektive für die Zukunft haben.
Kolleginnen und Kollegen, ich sage euch eines: Wenn das so weitergeht, entstehen mehr neue potenzielle Terroristen als dingfest gemacht werden. Nur wenn es eine Perspektive für alle gibt – dass es nächstes Jahr besser ist, dass es Bildung, dass es Essen und eine wirtschaftliche Zukunft gibt –, kann eine Generation nachkommen, die miteinander leben kann. Das würde ich mir wünschen, und ich freue mich sehr, wenn wir das gemeinschaftlich angehen können. – Danke. (Beifall bei der SPÖ sowie bei Abgeordneten von ÖVP, Grünen und NEOS.)
12.17
Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Susanne Fürst. – Bitte.
Abgeordnete Dr. Susanne Fürst (FPÖ): Frau Vorsitzende! Sehr geehrter Herr Minister! Sehr geehrte Damen und Herren! Der gegenständliche Antrag enthält als zentrale Punkte die Verurteilung des Überfalls der Hamas-Kämpfer auf Israel am 7. Oktober und die Forderung nach Freilassung der Geiseln. Vielfach betroffen sind junge Menschen, die aus ihren Leben gerissen wurden und in das Grauen hineinversetzt wurden. Dass möglichst viele dieser Geiseln gerettet werden, glaube ich, steht im Zentrum all unserer Wünsche. Das
steht im Zentrum der israelischen Bemühungen und sollte auch im Zentrum der internationalen Bemühungen stehen. Wir hoffen alle, dass die jetzt geltende Feuerpause dazu dient, möglichst viele, alle Geiseln zu befreien.
Natürlich wünschen wir uns auch und hoffen, dass die Täter, möglichst viele der Hamas-Täter, gefasst und bestraft werden und dass es dann bald wieder zu einer Beruhigung, zu einer Abkühlung der Lage kommt und man sich wieder den Friedensbemühungen zuwenden kann, dass sich der Prozess, gerade auch der Aussöhnungsprozess zwischen Israel einerseits und Saudi-Arabien, Ägypten und Jordanien andererseits, der im Gang war, möglichst rasch wieder fortsetzen lässt. Aus diesem Grund ist im Antrag sozusagen das Bekenntnis zur Zweistaatenlösung beinhaltet.
Wir hoffen, dass, obwohl es diesen Konflikt seit Jahrzehnten gibt, einmal eine Lösung bestehen kann, dank der es ein Staatsgebiet Israel gibt, ein Staatsgebiet Palästina gibt, der Status Jerusalems geklärt ist und so weiter, und man friedlich zusammenleben kann. Das sind die zentralen Anliegen, die wir unterstützen, daher gehen wir natürlich auch mit diesem Antrag mit, auch wenn er in weiterer Folge widersprüchliche und problematische Inhalte enthält.
Darauf möchte ich nun kurz eingehen. Die vorgesehene ausdrückliche Unterstützung durch Zahlungen an die Palästinenser sehen wir skeptisch; nicht, weil man nicht der Zivilbevölkerung helfen muss – das müssen vor allen Dingen auch die Anrainerstaaten –, sondern weil wir bedenken müssen, dass in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten große Fehler passiert sind. Es sind Milliarden der EU und dann auch bilateral aus den EU-Staaten in den Gazastreifen geflossen, an die Palästinenser gezahlt worden, die, wie wir wissen, zu einem guten Teil – man kann nur hoffen, nicht zum Großteil – von der Hamas sozusagen für sich beansprucht wurden. Die Hamas ist ja nicht nur eine Terrororganisation, sondern auch die Regierung im Gazastreifen.
Sie haben sich mit diesen Geldern aus Europa ein Luxusleben finanziert. Sie haben die palästinensische Zivilbevölkerung in Armut gehalten, obwohl
vorgesehen wäre, damit die Zivilgesellschaft und einen Staat herauszubilden. Sie haben sich an den Geldern bedient, damit ihre Terrorstruktur ausgebaut und das eine oder andere Tunnelsystem, das jetzt natürlich auch für die israelischen Soldaten eine gefährliche Falle ist, finanziert.
Daher kann ich diese – jetzt auch von der EU-Kommission beschlossene – Verdreifachung der EU-Gelder nur sehr, sehr skeptisch sehen. Es ist im Antrag die Klarstellung enthalten, dass die humanitäre Hilfe nicht in die Hände der Hamas fallen darf, aber das ist wohl ein Papiertiger. Wenn man sieht, wie die Milliarden, die in die Ukraine fließen, wohl auch in manche verdächtigen Kanäle fließen und wie unser Geld angelegt wird, dann kann ich nur sagen: Es ist ein frommer Wunsch, dass das Geld nicht von der Hamas für sich beansprucht wird. Daher stellen wir uns da dagegen. Das ändert aber nichts daran, dass wir mit dem grundsätzlichen Anliegen im Antrag voll mitgehen.
Natürlich fehlen in diesem Antrag wieder nicht die unvermeidlichen hohlen Floskeln: das Bekenntnis zur Bekämpfung jeglicher „Form des Rassismus, Extremismus, der Hetze und Hasspropaganda in Österreich und [...] Europa“. Man kann sich auch jetzt noch nicht durchringen, die Dinge wirklich beim Namen zu nennen. Diese neutrale Formulierung hat eigentlich angesichts der Realität auf den Straßen wirklich wenig mit der Realität zu tun.
Fakt ist, dass der Terrorakt hier bei uns, in den Straßen Europas, seit dem 7. Oktober völlig ungeniert gefeiert wird. Nur weil darüber in den Medien – ich sage einmal – zurückhaltend berichtet wird, heißt das nicht, dass es nicht stattfindet. Vor diesen Folgen der Einwanderung haben wir immer gewarnt. Es sind nicht Pro-Palästina-Demonstrationen – das wird vorgeschützt –, es sind Demonstrationen, die pro Hamas, pro Gewalt, gegen Israel und gegen uns, gegen den Westen, gerichtet sind.
Bisher wurden die Kritiker, die genau diese Folgen der ungesteuerten Zuwanderung vorausgesagt haben, als rassistisch, als Hetzer bezeichnet, und sie wurden sozusagen ständig mit einer Verhetzungsanzeige aus dunkler Wolke
bedroht. Wer aber die Herkunft und Kultur und Identität von Menschen leugnet, der wird bestraft und wacht jetzt in der Realität auf. Nur weil wir unsere Herkunft vergessen haben oder uns deren Leugnung sozusagen vorgeschrieben wurde, vergessen die Einwanderer ihre Herkunft nicht. Sie reagieren darauf.
Auch wenn bei uns nicht berichtet wird, so werden die Bilder vom Gebetsteppich in Berlin, die Bilder vorm Stephansdom, die Bilder in London in der arabischen Welt wahrgenommen, gesehen. Sie sehen unsere Schwäche. Es ist eine Machtdemonstration der islamischen Welt. Das ist hochexplosiv und brandgefährlich – im Gegensatz zur Kritik, die vor allen Dingen wir in den letzten Jahren geäußert haben.
Ein Aspekt, der auch völlig untergeht: Wo finden diese Pro-Hamas-Demonstrationen in Europa statt? – Nicht in ganz Europa. Sie finden in Deutschland, bei uns, in Großbritannien, in Frankreich statt. Wir wissen alle, warum. Sie finden nicht in Polen, in der Slowakei, in Tschechien oder in Ungarn statt. Das hat eben mit einem ganz erheblichen muslimischen Bevölkerungsanteil zu tun, den wir uns hereingeholt haben. Bei uns muss natürlich dann auf diese Menschen Rücksicht genommen werden, nicht nur wegen deren verbreiteter Gewaltbereitschaft und Aggressionsbereitschaft, mit der wir nicht fertig werden, sondern auch, weil sie mittlerweile ein erhebliches Wählerpotenzial darstellen. (Abg. Lukas Hammer: Es ist jetzt Zeit, die Rede zu beenden!)
Genau das ist zum Beispiel auch der einzige Grund für die aktuelle Forderung von Bürgermeister Ludwig, dass palästinensische Babys hier intensivmedizinisch betreut werden sollen. Das ist realitätsfern. Das ist wirklich im höchsten Maße populistisch. Das hat nichts mit echter Hilfe zu tun, sondern nur mit Rücksichtnahme auf ein Wählerpotenzial. Bei uns das Gesundheitssystem zu ruinieren und sich gleichzeitig als Gönner in der ganzen Welt aufzuspielen ist wirklich lächerlich, und das heißt einfach auch, nichts aus den Zuständen, die wir jetzt auf unseren Straßen sehen, gelernt zu haben. (Beifall bei der FPÖ.)
12.24
Präsidentin Doris Bures: Frau Abgeordnete Ewa Ernst-Dziedzic, Sie gelangen zu Wort. Bitte.
Abgeordnete Dr. Ewa Ernst-Dziedzic (Grüne): Frau Präsidentin! Herr Minister! Hohes Haus! Werte Zuseher und Zuseherinnen! Vor 48 Tagen versetzte uns alle – die ganze Welt – der brutale Terrorangriff der Hamas auf Israel in eine Schockstarre. Seitdem gab es sehr viele Interpretationen und neue Experten und Expertinnen und deswegen ist es mir am Beginn meiner Rede wichtig, festzuhalten, was bei jeder Debatte, die wir führen, die unumstößlichen Koordinaten sein müssen.
Zum einen ist klar (eine Tafel mit einer Vermisstenanzeige von zwei entführten israelischen Mädchen sowie der Forderung, alle Geiseln müssten befreit und lebend heimgebracht werden, in die Höhe haltend), wie viele unschuldige Menschen bei diesem Terrorangriff ums Leben gekommen sind. Es ist auch klar (von der Tafel ablesend), dass über 240 unschuldige Geiseln verschleppt wurden, dass mehr als 7 000 Israelis verletzt, vergewaltigt, ermordet wurden und dass das jüngste Terroropfer lediglich drei Monate alt gewesen ist.
Zu den Koordinaten, die unumstößlich sind, gehört auch, dass die Hamas eine dezidierte Terrororganisation ist und dass jeder, der versucht, sie als Befreiungsfront zu framen, schlicht den moralischen Kompass verloren hat. (Beifall bei den Grünen sowie bei Abgeordneten von ÖVP, SPÖ und NEOS.)
Zu den Koordinaten, die unumstößlich sind, gehört auch, dass in der Verfassung Israels festgehalten ist, dass sie niemanden zurücklassen dürfen. Leave no one behind ist somit verfassungsrechtlich für Israel eine Verpflichtung – die man sich selbst gegeben hat –, um jedes einzelne jüdische Menschenleben zu kämpfen. Deshalb ist die Auseinandersetzung um die Befreiung der Geiseln solch eine relevante für Israel. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
Für uns ebenso unverhandelbar ist – und das spiegelt sich auch in diesem Antrag wider –, dass es natürlich gilt, diesen Krieg, den langen, komplexen Konflikt insofern zu unterbinden, als dass er sich nicht ausbreiten darf. Sie wissen: Israel ist das einzige Land mit einer demokratischen Verfassung in dieser Region. Das ist auch der Grund, wieso Israel als einziges unser Ansprechpartner ist, wenn wir das Völkerrecht und das humanitäre Recht einfordern. Mit wem sonst, mit welchen Terroristen sonst, könnten wir denn dort reden?
Wichtig ist auch – und das ist auch im Antrag festgehalten –, dass wir natürlich – abseits von den Feuerpausen, die jetzt eingesetzt haben, und der notwendigen bedingungslosen Befreiung der weiteren Geiseln – langfristig eine Friedenslösung für alle Menschen in der Region brauchen. Es stimmt: Wenn wir die eine Seite übersehen, wird sie sich mit der Zeit durch Terror zum Ausdruck bringen.
Das ist nicht nur eine der schwierigsten Aufgaben in den letzten Jahrzehnten gewesen, sondern auch die Verhandlungen, die jetzt, in den letzten Wochen, schon stattgefunden haben, haben sichtbar gemacht, wie schwierig, wie komplex eine Exitstrategie ist. Nichtsdestotrotz – und trotz der Sprachlosigkeit, die vor 48 Tagen eingesetzt hat – haben wir wieder eine Sprache gefunden, haben wir als fünf Parteien einen Antrag formulieren können, der nicht nur diese Koordinaten, die unumstößlich sind, wiedergibt, sondern auch dafür plädiert, dass wir mit allen Mitteln und auf allen Ebenen nach nachhaltigen, friedlichen Lösungen suchen. (Beifall bei den Grünen sowie bei Abgeordneten von ÖVP, SPÖ und NEOS.)
Ich habe gestern auf Social Media gelesen, dass eine Mutter geschrieben hat, dass sie voller Hoffnung darauf gewartet hat, den Namen ihres Kindes unter jenen Geiseln zu finden, die heute am Nachmittag freigelassen werden sollen – er war nicht dabei.
Ich will deshalb damit schließen, weil auch dieser furchtbare Konflikt ein menschliches Antlitz hat, nämlich das der Angehörigen, die Menschen verloren
haben, und der Angehörigen, die noch immer die Hoffnung haben, dass ihre Kinder und Familienmitglieder freikommen. Ich denke, das ist das Erste, wofür wir uns auch in den nächsten Tagen weiterhin starkmachen müssen. Vielen Dank allen, die dazu beitragen! – Danke. (Beifall bei Grünen, ÖVP, SPÖ und NEOS.)
12.30
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner ist Herr Abgeordneter Helmut Brandstätter. – Bitte.
Abgeordneter Dr. Helmut Brandstätter (NEOS): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher! Wir haben im Lauf dieser Woche schon einmal darüber gesprochen, dass die geopolitische Lage so ist, dass es eben auf der einen Seite diese Diktaturen und autoritären Systeme gibt, auf der anderen Seite Demokratien, und heute ist völlig klar, dass wir uns natürlich für Israel aussprechen, für das Opfer in diesem Angriff, und gegen die Terrororganisation Hamas. (Beifall bei den NEOS sowie bei Abgeordneten von ÖVP, SPÖ und Grünen.)
Wenn wir aber weiterdenken, dann müssen wir auch wissen, dass es oft einen Zusammenhang zwischen Diktaturen und Terrororganisationen gibt. Wir erleben das gerade im Nahen Osten. Es ist ja so, dass Hamas natürlich – und das ist rund um die Wagner-Gruppe auch beschrieben worden – von Russland unterstützt wird. Das heißt, wenn wir hier klar gegen Terror sind, dann müssen wir auch gegen den Terror sein, den Russland zum Teil eben im Nahen Osten – auch in Syrien – ausübt, aber auch gegen den, den Russland in der Ukraine ausübt.
Deswegen bin ich sehr froh, dass wir – fünf Parteien – hier heute einig sind, aber umso erstaunter, dass es ein Thema, nämlich das Thema Russland-Ukraine, gibt, bei dem die FPÖ nicht mitkann, und das wird ja wohl Gründe haben. Und doch ist es so klar, dass es auch dort Terror gibt, Terror gegen Kinder, es werden
täglich Spitäler angegriffen, es werden Schulen angegriffen, und von der FPÖ gibt es da nur ein Nicken.
Oder: Gestern hatten wir die stellvertretende Ministerpräsidentin der Ukraine Olha Stefanischyna zu Besuch. Alle haben mit ihr gesprochen, und sie uns hat erzählt, dass auch in dieser Woche ihre Kinder an zwei Tagen nicht in die Schule gehen konnten, da es Terroralarm, Bombenalarm gab. Auch daran nimmt dann leider niemand von der FPÖ teil, weil Sie es gar nicht hören wollen. Das ist bedauerlich, das muss ich hier sehr deutlich sagen. (Beifall bei den NEOS, bei Abgeordneten von ÖVP und Grünen sowie der Abg. Holzleitner.)
Dieses Buch hier ist besonders spannend (das genannte Buch in die Höhe haltend): Philippe Sands, „Rückkehr nach Lemberg“. Philippe Sands ist ein britischer beziehungsweise in London lebender Menschenrechtsaktivist und Rechtsanwalt mit Wiener und interessanterweise auch mit Lemberger Wurzeln: Wiener Wurzeln, weil sein Großvater aus Lemberg nach Wien gekommen ist. Seine Familie ist zum Teil im Holocaust ermordet worden.
Er beschreibt da unter anderem auch die Nürnberger Prozesse nach dem Zweiten Weltkrieg. Da gab es zwei Juristen – einer davon wieder mit Bezug zu Wien, nämlich Hersch Lauterpacht, der bei Kelsen studiert hat, und ein zweiter mit Bezug zu Lemberg, Raphael Lemkin –, die im Zuge dieser Nürnberger Prozesse zwei wesentliche Begriffe entwickelt haben, nämlich den des Genozids, Völkermordes, aber auch den des Verbrechens gegen die Menschlichkeit.
Diese zwei Begriffe sind gerade heute wieder so wichtig, und es sind ja nicht nur diese beiden Regionen, von denen ich spreche – die Ukraine und Israel –, in denen wir sehen, dass es den Versuch des Genozids oder auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit gibt. Das gibt es ja anderswo auch. Umso klarer aber müssen wir eben hier auftreten und sagen, auf welcher Seite wir stehen: Wir sind für die Menschlichkeit, wir sind gegen den Genozid und wir werden natürlich all jenen, bei denen es notwendig ist, weil sie Opfer sind, jede Unterstützung geben.
In dem Zusammenhang ist für mich auch sehr wichtig, dass wir auch über die europäischen Werte sprechen, die auch in diesem Buch angesprochen werden, nämlich die europäischen Werte, die wir verteidigen, und zwar auch bei uns, auf unseren Straßen. Wenn es Demonstrationen gibt, auf denen es heißt: From the River to the Sea!, dann ist das nichts anderes als wieder der Aufruf zum Genozid, zum Völkermord, es ist der Aufruf, alle Juden ins Meer zu treiben und zu vernichten, und das ist nichts anderes als das, was in diesem Buch beschrieben wird: Hans Frank, damals Generalgouverneur in Polen, hat gesagt, man müsse alle Juden vernichten wie die Läuse. Das ist genau dasselbe.
Diese Zusammenhänge bitte ich zu verstehen, und deswegen ist auch klar – Christoph Wiederkehr hat das heute auch in einer großen Rede in Wien gesagt –: Wir müssen für Demokratie, für Menschenrechte, für Toleranz stehen, und dagegen, dass auch hier jemand glaubt, er kann auf die Straße gehen und für einen Genozid auftreten. Das können wir nicht dulden, das muss unsere Polizei verhindern, und da müssen wir alle zusammenstehen, sodass das nicht möglich ist.
Das jetzt ist, glaube ich, wirklich ein ganz wesentlicher Zeitpunkt, an dem wir uns befinden, dass das auch nicht ansatzweise und ein bisschen passiert. Das gilt aber selbstverständlich auch für Buden und bürgerliche Mittags- und Abendtische, wo es auch Antisemitismus in verschiedenen Formen gibt. Treten wir alle gemeinsam dagegen auf: für Menschlichkeit, gegen Genozid! – Ich danke schön. (Beifall bei den NEOS sowie bei Abgeordneten von ÖVP und Grünen. – Abg. Brandstätter – eine Tafel mit dem Bild eines Kindes unter der roten Überschrift „Entführt“ in die Höhe haltend –: Das ist nur einer von vielen – damit das auch hier gesehen wird!)
12.35
Präsidentin Doris Bures: Nun ist Bundesminister Alexander Schallenberg zu Wort gemeldet. – Bitte, Herr Minister.
12.35
Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten Mag. Alexander Schallenberg, LL.M.: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Liebe Besucherinnen und Besucher auf der Galerie! Ich will Ihnen nur sagen, dass ich dankbar bin: dankbar für diesen einstimmigen Beschluss im Hohen Haus. Das ist, glaube ich, ein wirklich wichtiges Signal, das auch mich in meiner Position stärkt.
Wir dürfen nie vergessen, dass der 7. Oktober wirklich ein Zivilisationsbruch war. Das war ein Tag, der in einer Region, die schon so an Grausamkeiten nicht arm ist, in seiner Grausamkeit eigentlich alles in den Schatten gestellt hat. Ich werde nie die Situation vergessen, als ich damals, an diesem Samstag, einen Anruf gekriegt habe und man mich gefragt hat: Herr Bundesminister, wie gut sind Ihre Magennerven? – Ich habe gesagt: Ja, sie sind gut! Dann wurden mir Videos und Fotos geschickt, bei denen man gewusst hat, aus welcher Quelle sie stammen und dass sie authentisch sind. Diese Bilder werden mich nie wieder verlassen. Das letzte Mal, dass ich etwas Ähnliches gesehen habe, war bei den Videos von Daesch – die Grausamkeit, dieser Blutrausch, das fast Entmenschlichste, das man sich nur vorstellen kann.
Ich bin daher sehr dankbar, dass wir hier in Österreich eine so klare Position haben. Ich glaube, jeder ist aufgerufen, bei Terrorismus – ganz egal wo, ganz egal wie – eine klare Position zu haben. Mord ist Mord, da darf man nicht etwas in einen Kontext stellen, denn das heißt relativieren. (Beifall bei ÖVP, Grünen und NEOS.)
Noch nie in der Menschheitsgeschichte ist ein Konflikt aus heiterem Himmel passiert, es gibt immer eine Vorgeschichte – für alles! –, auch für den russischen Angriff auf die Ukraine, aber den haben wir auch nicht in einen Kontext gestellt. (Abg. Meinl-Reisinger: Manche tun das schon!)
Selbstverständlich gilt das humanitäre Völkerrecht, aber das ist ja genau der Unterschied – das haben mehrere Abgeordnete auch unterstrichen –: Israel ist
ein Rechtsstaat, Israel ist eine pluralistische Demokratie, die darum ringt, die versucht, den richtigen Weg zu finden. Abgeordneter Matznetter hat auch gesagt: Man will eigentlich gar nicht in den Schuhen der IDF stecken, weil es ja fast eine unmenschliche Aufgabe ist, in so einer Situation voller Emotionalität auch noch kühlen Kopf zu bewahren.
Ja, sie werfen Flugblätter ab, ja, sie warnen, sie rufen zur Evakuierung auf, sie versuchen, die Zahl der zivilen Opfer auf ein Minimum zu drücken, und ja, wir sehen, was wir eigentlich schon immer gewusst haben, nämlich dass die Hamas ganz bewusst zivile Einrichtungen wie Schulen, Flüchtlingslager, Krankenhäuser und anderes für ihre Kommandozentralen, für ihre Tunneleingänge verwendet, um dort ihre Waffen zu verstecken. Das heißt, wenn man gegen den Terrorismus kämpft, hat man als Demokratie, als Rechtsstaat in Wirklichkeit immer eine Hand hinter dem Rücken gebunden. Das ist aber auch richtig so, das muss auch so sein, und man sieht das auch in Israel, dass man es versucht.
In unserem Aufgabenbereich stehen jetzt drei Prioritäten besonders im Fokus: Das eine ist natürlich die Vermeidung eines Flächenbrandes, der ist weiterhin nicht gebannt. Am Ende könnte das ein Dreifrontenkrieg werden. Wir beobachten natürlich auch die Entwicklung in Nordisrael beziehungsweise im Südlibanon mit der Hisbollah sehr genau, aber – und das will ich hier auch ganz besonders betonen, weil Österreich eben nicht auf einem Auge blind ist, wir sehen mit beiden Augen – das betrifft auch das Westjordanland, und ich muss ganz offen sagen: Diese Siedlergewalt, die ich im Westjordanland sehe, halte ich für unerträglich und auch unsolidarisch. (Beifall bei ÖVP, SPÖ, Grünen und NEOS.)
Wir haben es gerade mit einer Situation zu tun, in der die israelische Armee bis zum Anschlag gefordert ist, deshalb halte ich es eigentlich auch innerhalb der israelischen Gesellschaft für unsolidarisch, wenn einige glauben, ihrer Wut, ihrer Emotion Luft zu machen und im Westjordanland zu zündeln. Das könnte zu einer dritten Front führen. Da, glaube ich, müssen wir sehr deutliche Worte finden.
Der zweite Punkt ist natürlich – das wurde schon oft gesagt – die bedingungslose Freilassung der Geiseln. Ich hatte letzte Woche die Gelegenheit, einige der Überlebenden des 7. Oktober hier in Wien zu treffen, und das ging einem wirklich unter die Haut. Wenn man einen Vater trifft, der einem sagt, dass er eigentlich fast erleichtert ist, weil sein Kind unter den Toten und nicht unter den Geiseln ist, dann kann man sich, wenn das ein Elternteil sagt, vorstellen, was das für diese Menschen bedeuten muss.
Da müssen wir draufbleiben. Es ist eine Terrororganisation, da kann es kein Wenn und Aber geben, da kann es keine Verhandlungen geben. Sie haben die Geiseln bedingungslos freizulassen. (Beifall bei ÖVP, SPÖ, Grünen und NEOS.)
Der dritte Punkt ist mir auch wichtig: Ich habe ja selber, als einer der ersten Minister, die Entwicklungszusammenarbeit mit Palästina einmal auf Eis gelegt, damit wir sie untersuchen. Ich stehe aber nicht an, zu sagen: Wir wollen nicht die Hamas unterstützen, wir werden sie nicht unterstützen, wir wollen aber auch nicht, dass die Zivilbevölkerung Not leidet. Das ist ja wieder der fruchtbare Boden für den nächsten Extremismus.
Daher haben wir über die Austrian Development Agency 2 Millionen Euro als humanitäre Hilfe zur Verfügung gestellt, weitere 6 Millionen Euro für die Region, für Syrien, den Libanon und Jordanien, die natürlich Gefahr laufen, dass sie durch den Prozess destabilisiert werden. Ich finde es gut, dass die Europäische Union die humanitäre Hilfe vervierfacht hat, aber gleichzeitig glaube ich – wir haben ja vor zwei Tagen den Bericht der Europäischen Kommission betreffend die Entwicklungszusammenarbeit gesehen –, wir dürfen in Zukunft nicht naiv sein.
Wir werden uns in Österreich in Zukunft die Partnerorganisationen ganz genau anschauen, egal ob in Gaza, egal ob in Israel. Es kann auch in Afrika sein, es kann auch in Mali, Burkina Faso oder Mosambik sein – wir müssen uns anschauen: Was sind das für Partner? Was haben sie für Homepages? Was sagt der Dachver-
band, in dem sie verbunden sind? Gibt es da Rassismus? Gibt es da Antisemitismus? Gibt es Linien, die wir aufgrund unseres Wertekanons nicht unterstützen?
Das ist für mich auch eine Lehre dieses grauenhaften Zwischenfalls vom 7. Oktober: Wir müssen in Zukunft viel genauer hinschauen, wem wir genau wie helfen. – Danke sehr. (Beifall bei ÖVP, Grünen und NEOS sowie bei Abgeordneten der SPÖ. – Abg. Martin Graf: Das klingt schon einmal ganz anders!)
12.41
Präsidentin Doris Bures: Nun ist Frau Abgeordnete Bettina Rausch-Amon zu Wort gemeldet. – Bitte.
Abgeordnete Mag. Bettina Rausch-Amon (ÖVP): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Werte Zuseher:innen auf der Galerie und vor den Bildschirmen! Apropos Zuseher:innen und Gäste: Im Namen meiner Kollegin Martina Diesner-Wais darf ich zu dieser Debatte die Bäuerinnen aus Raabs an der Thaya herzlich willkommen heißen. – Wir freuen uns, dass ihr hier seid! (Beifall bei ÖVP, SPÖ, Grünen und NEOS.)
„Selten ist in Europa überall Frieden und nie geht der Krieg in den anderen Weltteilen aus.“ –Das hat Carl von Clausewitz in den 1830ern geschrieben, und es scheint, dass sich das bis heute nicht geändert beziehungsweise traurige Realität wiedererlangt hat.
Der sogenannte Nahostkonflikt begleitet uns ja tatsächlich schon sehr lange. Seit ich mich erinnern kann, bewusst erinnern kann, flimmert er über unsere Bildschirme, und man läuft dann als Gesellschaft Gefahr, in so einer Situation auch ein Stück weit abzustumpfen, so nach dem Motto: Das gehört dazu, das müssen wir hinnehmen.
Seit dem 7. Oktober ist alles anders. Am 7. Oktober sind im Zuge des brutalen Angriffs der Hamas 1 200 israelische Zivilistinnen und Zivilisten ermordet, ja, wir
haben es gehört, hingerichtet worden, mehrere Tausend verwundet und rund 240 Menschen als Geiseln verschleppt worden. Es ist etwas passiert, das wir uns nicht einmal in den schlimmsten Albträumen ausmalen konnten, wo wir jetzt nicht mehr zur Tagesordnung übergehen können, was wir auch als Gesellschaft, als Menschen nicht hinnehmen können.
Im Gegenteil, es ist etwas, das wir benennen und worüber wir reden müssen, nämlich über Terror und wie man damit umgehen kann, soll und muss. Insofern bin ich froh, dass wir als österreichisches Parlament heute mit diesem Antrag einstimmig ein sehr klares Zeichen setzen, klar Position beziehen, Terror ablehnen, seine Gefahren aufzeigen, aber auch dafür eintreten, zu einer Lösung des Konflikts einen Beitrag zu leisten.
So klar die Position hier im Hohen Haus ist – danke vielmals dafür –, bin ich durchaus in Gesprächen mit der Bevölkerung immer wieder auch mit Fragen in diesem Zusammenhang konfrontiert. Ich möchte auf ein, zwei dieser Fragen eingehen.
Eine Frage, die mir begegnet, ist: Warum darf Israel da Gewalt anwenden? Warum führen die denn Krieg im Gazastreifen? – Dazu ist einiges gesagt worden, aber ich möchte es noch einmal hier festhalten: Der Terror der Hamas ist der größte Angriff auf Jüdinnen und Juden seit dem Zweiten Weltkrieg. Israel nutzt als Konsequenz sein völkerrechtlich verbrieftes Recht zur Selbstverteidigung. Die Hamas wiederum nutzt Menschen, die Geiseln, aber auch Zivilistinnen und Zivilisten im Gazastreifen, als Schutzschilde, und all das führt natürlich zu einer verheerenden Situation für Einzelne. Es führt zu Leid, natürlich kommen Menschen zu Schaden.
Dieser oft so technisch verwendete Begriff Kollateralschaden lässt mich nicht kalt und ich mag ihn auch nicht verwenden. Leider passiert das und kommt vor, aber nichtsdestotrotz gibt es dieses Recht – Völkerrecht – und damit auch das Recht auf Selbstverteidigung. Das ist etwas, das man als Staatengemeinschaft errungen hat, und wir können jetzt nicht einfach sagen, weil uns eben auch
schreckliche Bilder erreichen, das würde plötzlich nicht mehr gelten. Es gilt genauso wie nach dem 7. Oktober noch heute, und wir stehen da an der Seite Israels. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
Weiters begegnet mir die Frage: Was hat das alles mit uns zu tun? Warum ergreifen wir hier in Österreich Partei für Israel? – Zweifache Antwort: Gerade Österreich hat eine historische Verantwortung: Israel war und ist ein Schutzversprechen an die Jüdinnen und Juden nach dem Holocaust, und Österreich hat sich nicht nur dazu verpflichtet, dafür einzustehen, im internationalen Kontext geradezustehen. Wir haben auch Selbstverpflichtungen übernommen, die Opfer des NS-Regimes zu unterstützen, sie zu entschädigen.
Wer heute in Österreich lebt – ganz gleich, ob er oder sie über Generationen hier lebt oder zugewandert ist –, tritt in diese Geschichte des Landes, der Republik mit ein, auch in die Verantwortung, die dieses Land trägt, und muss diese Werte teilen. Und deswegen dürfen wir weder im Nahen Osten noch bei uns zu Hause wegschauen. Das heißt nicht, dass man keine kritische Haltung gegenüber Israel haben darf; ich denke, der Herr Außenminister hat das klar benannt, auch was das Westjordanland betrifft. In einer Demokratie dürfen wir einander kritisieren, auch Demokratien untereinander dürfen das, es gibt Meinungsfreiheit im politischen Diskurs. Es geht aber darum, die Täter klar zu benennen: die Hamas, und die Gefahr klar zu benennen: den Terror.
Wir sehen in Europa wieder eine Woge des Antisemitismus über den Kontinent fegen, und wir erleben auch auf unseren Straßen und in den sozialen Netzwerken, also auf unseren Handys und Computern, dass Terror gefeiert, ja, verherrlicht wird, dass die Hamas als Terrororganisation nicht nur verharmlost, sondern beworben wird. Dazu ein klares Wort: Terror ist gefährlich, er ist im Kern antidemokratisch, denn er schränkt Lebens- und Freiheitsräume ein. Seine Aktionen sind lebensfeindlich und tödlich. Ihn zu verharmlosen oder ihn wie in manchen Kundgebungen in Europa zu feiern, zu verherrlichen, das können und dürfen wir in dieser Zeit nicht tolerieren! (Abg. Himmelbauer: Super!)
Terror, vor allem islamistischer Terror, ist ein Angriff auf unsere Art zu leben. Wir erleben gerade auch Auswirkungen der hybriden Kriegsführung, der Propaganda auf Social Media, und ich finde es wirklich schade, es tut mir weh zu sehen, dass junge Menschen breit instrumentalisiert und auch verführt werden.
Lassen Sie mich auch das sagen: Jede Art von Extremismus, egal ob von links oder von rechts, aus dem Aus- oder Inland, ist antidemokratisch, denn Extremismus spaltet, wiegelt auf und macht ein Zusammenfinden, ein Zusammenkommen und Arbeiten, wie eine Demokratie es braucht, unmöglich.
Die Volkspartei und mit diesem Antrag auch das Parlament – daher finde ich es auch so wichtig, das noch einmal zu betonen – treten klar gegen Extremismus auf und wir beziehen auch klar Position gegen Antisemitismus. Das können und sollen wir alle weiterhin in dreifacher Hinsicht tun: klar Position beziehen, das heißt, die Kundgebungen, die da passieren, genau zu beobachten.
Ich bin froh, dass Polizei und Innenminister das sehr besonnen machen – Gott sei Dank –, auch im Sinne des Schutzes von Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Ja, das ist im Kern Demokratie, aber mit Bedacht auch darauf, keine Situation eskalieren zu lassen, und mit – das ist wichtig – einem gleichzeitig klaren Blick darauf, wo Grenzen überschritten werden. Ich denke an die Verwendung von Hamas-Symbolen, ebenso an Wiederbetätigung. Da gibt es klare Grenzen und auch null Toleranz! (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
Klar Position beziehen können wir auch hier mit unserem heutigen Antrag, durch den wir Solidarität mit den Menschen bekunden, die von Gewalt betroffen sind. Wir machen klar, dass wir auf der Seite von Völkerrecht, Demokratie und Freiheit stehen, gegen Terror und Antisemitismus, und dass wir davon ausgehend auch international, europäisch, bilateral unseren Einfluss geltend machen, ja, auf eine friedliche Lösung einwirken wollen.
Aber wir alle hier und auch Sie, die Sie heute von zu Hause aus hier zusehen, können klar Position beziehen, etwas beitragen: in Gespräche eintreten, wo immer wir, wo immer Sie können; Bedenken, Sorgen, Fragen, Ängste hören, aber auch Antworten geben und eben klar sagen, auf welcher Seite wir stehen; nicht abschalten nach dem Motto: Was geht uns das an? Das ist weit weg, und wenn ich das Handy abschalte, dann ist es vorbei!
Es geht uns etwas an, denn es geht um nicht mehr oder weniger als unsere Freiheit, unsere Demokratie und unser Lebensmodell! – Danke für Ihr Mitmachen! (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
12.49
Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Petra Bayr. – Bitte.
Abgeordnete Petra Bayr, MA MLS (SPÖ): Frau Präsidentin! Herr Minister! Sehr geehrte Damen und Herren! Noch nie in seiner bisher 75-jährigen Geschichte ist Israel von derartig massiver terroristischer Gewalt und Brutalität heimgesucht worden wie am 7. Oktober. Dieser entmenschlichte Terror der Hamas macht es notwendig, Selbstverständliches festzustellen, nämlich ist es unter anderem selbstverständlich, dass wir zu einem uneingeschränkten Existenzrecht Israels als jüdischem Staat stehen und auch zu Israels Selbstverteidigungsrecht im Rahmen des Völkerrechts.
Der Terror ist niemals ein politisches Mittel. Ich glaube, es muss die höchste Priorität sein, dass die Terroristen des 7. Oktober – und auch jene, die noch danach weitergemordet haben – mit aller Härte strafrechtlich verfolgt werden. Ich glaube, das ist ein wichtiges Ziel. Die Verurteilung jeder Form von Antisemitismus, egal ob anderswo oder in Österreich, ist ganz klar notwendig, und es ist auch unsere klare Verantwortung in Österreich, alles Gebotene zu tun, um jüdisches Leben zu schützen. (Beifall bei der SPÖ sowie bei Abgeordneten von ÖVP, Grünen und NEOS.)
Die sofortige Freilassung aller Geiseln – auch jener, über die bislang noch nicht verhandelt worden ist, auch jener, die noch nicht auf einer Liste gestanden sind – ist wahrscheinlich nach wie vor das Dringendste, das jetzt politisch zu tun ist. Genauso wichtig finde ich es aber, darauf zu drängen – auch wenn das ein Wunschdenken ist –, dass die Hamas, wenn es irgendwie geht, kapituliert, aber jedenfalls entwaffnet wird.
Was mir darüber hinaus wichtig ist zu sagen, ist: Es ist möglich, mit Israel in enger Solidarität zu stehen – gerade jetzt – und gleichzeitig auch das Recht der Palästinenserinnen und Palästinenser auf einen eigenen Staat und auf deren Selbstbestimmung zu fordern. Beides geht gleichzeitig. (Beifall bei der SPÖ sowie des Abg. Schwarz.)
Wichtig ist auch, dass internationales humanitäres Recht für beide Konfliktparteien gelten muss – nämlich auch, um wirklich die Versorgung der Zivilbevölkerung im Gazastreifen sicherzustellen. Dazu werden humanitäre Feuerpausen und humanitäre Korridore notwendig sein. Dazu werden auch die Mittel der humanitären Hilfe erhöht werden müssen. Ich anerkenne die 2 Millionen Euro, die es vonseiten des Auslandskatastrophenfonds aus Österreich schon für Gaza gegeben hat, aber ich denke, das kann nur ein Anfang sein.
Genauso hoffe ich, dass die Überprüfung der entwicklungspolitischen Projekte, die wir im Gazastreifen und in der Westbank machen, bald zu einem Abschluss kommt und diese bald fortgesetzt werden können, ohne dass wir Angst haben müssen, dass irgendwas in Tunnel hinein versickert oder in andere Kanäle der Hamas fließt. Das will wirklich niemand. Das ist sehr wichtig, und ich hoffe, dass wir da sehr flott unterwegs sein werden. (Beifall bei der SPÖ sowie der Abg. Prammer.)
Es geht nämlich darum, dass mittelfristig alle Menschen in der Region in Würde, in Sicherheit und in Freiheit leben können. Ich glaube – auch wenn das wieder einmal ein Stückchen unrealistischer geworden ist –, dass es einzig und allein
eine Zweistaatenlösung der beiden Völker sein kann, die es möglich macht, dass es ein demokratisches, sicheres und selbstbestimmtes Israel und ein demokratisches, selbstbestimmtes und sicheres Palästina gibt. Beides wünsche ich mir für die Menschen in dieser Region.
Ich selbst bin seit 30 Jahren in Nahostfriedensfragen aktiv – wie man sieht, nicht sehr erfolgreich. Trotzdem glaube ich, dass das Lösen dieses Konflikts in dieser Region einfach das Bohren harter Bretter ist. Wann immer es möglich ist, sollten wir als österreichische Gesellschaft, als europäische Gesellschaft den Menschen vor Ort – wenn sie das auch wollen – beistehen und ihnen dabei helfen, diese harten Bretter doch zu durchbohren und in Frieden zu leben. – Danke. (Beifall bei der SPÖ sowie bei Abgeordneten von ÖVP, Grünen und NEOS.)
12.53
Präsidentin Doris Bures: Nun gelangt Frau Abgeordnete Muna Duzdar zu Wort. – Bitte.
Abgeordnete Mag. Muna Duzdar (SPÖ): Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Minister! Während wir heute diesen parteiübergreifenden Entschließungsantrag zum Terrorangriff der Hamas beschließen, überschlagen sich ja gerade die politischen Ereignisse im Nahen Osten. Sieben Wochen nach diesem fürchterlichen Hamas-Massaker auf unschuldige israelische Zivilisten und Zivilistinnen wurde erstmals eine Waffenruhe gestern und heute vereinbart. Glücklicherweise wurden auch erstmals israelische Geiseln freigelassen, und die ersten Hilfslieferungen erreichen den Gazastreifen.
Es gibt ein bisschen Hoffnung auf eine bessere Entwicklung im Nahen Osten. Daher sehen wir es natürlich auch als positiv an, dass es jetzt diese humanitäre Waffenruhe gibt, aber wir erwarten uns von Ihnen, Herr Minister, dass Sie bei den Vereinten Nationen die Friedensbemühungen unterstützen und sich auch dafür einsetzen, dass diese humanitäre Waffenruhe verlängert wird (Beifall bei
der SPÖ), natürlich auch, um alle israelischen Geiseln freizubekommen. Am Ende des Tages muss natürlich der Waffenstillstand im Fokus stehen, Herr Minister.
Es ist so – Sie wissen das –, dass die humanitäre Lage im Gazastreifen katastrophal ist. Der Gazastreifen ist durch die Bombardements auch der israelischen Luftwaffe weitgehend unbewohnbar gemacht worden. Die meisten Kriegsopfer im Gazastreifen sind Kinder – laut Unicef sind 5 000 palästinensische Kinder getötet worden. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie humanitäre Hilfe in der Höhe von 2 Millionen Euro beschlossen haben, aber natürlich fordern wir angesichts dieser dramatischen, katastrophalen Lage die Aufstockung der humanitären Hilfe.
Eines, Herr Minister, kann ich Ihnen auch heute nicht ersparen, nämlich zu erwähnen, dass die Entwicklungszusammenarbeit zwischen Österreich und Palästina auf Eis gelegt wurde. Vielleicht wissen Sie es nicht oder es ist Ihnen egal, aber Österreich und Palästina haben dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum der Entwicklungszusammenarbeit. Sie haben immer gesagt, Sie wollen das prüfen, Herr Minister. Sie wissen, die Europäische Union hat die Prüfung bereits abgeschlossen und festgestellt, dass es keine fehlgeleiteten Zahlungen gegeben hat. Ich möchte Ihnen auch noch eines sagen: Sie wissen doch ganz genau, dass eine österreichische Entwicklungshilfeorganisation die Verwendung der Hilfsgelder im Gazastreifen abwickelt. Die machen gute Arbeit und prüfen ganz genau, wohin die Gelder gehen.
Abschließend möchte ich Ihnen Folgendes sagen: Sie wissen, bei diesen Geldern geht es um Frauenförderprogramme. Es geht darum, den Frauen im Gazastreifen eine Berufsausbildung und eine selbstständige Existenz zu ermöglichen. Daher ist es genau dieses konträre Gesellschaftsbild – im Gegensatz zu dem reaktionären Gesellschaftsmodell der Hamas –, das wir damit fördern. Daher ersuche ich Sie: Bitte schließen Sie endlich die Prüfung ab und geben Sie die Gelder frei! – Danke sehr. (Beifall bei der SPÖ.)
12.57
Präsidentin Doris Bures: Zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Martin Engelberg. – Bitte.
Abgeordneter Mag. Martin Engelberg (ÖVP): Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Minister! Hohes Haus! Wir stehen, so steht es im Entschließungsantrag, in uneingeschränkter Solidarität an der Seite Israels und seiner Bevölkerung und verurteilen die Hamas und ihre brutalen Terroranschläge in Israel auf das Schärfste. Es freut mich sehr, dass wir – alle hier im Parlament vertretenen Parteien – das unterstützen.
Ich bedanke mich beim Außenminister auch noch einmal für die Erläuterung, dass es da keine Relativierung – keine Äquidistanz zwischen einer pluralistischen Demokratie, wie Israel es ist, und einer gelisteten Terrororganisation – geben darf.
Ich bedanke mich auch beim Präsidium und auch bei den vielen Kolleginnen und Kollegen, die sich an dieser Aktion betreffend Parlament fordert Freilassung beteiligt haben. Wir haben (nacheinander vier Tafeln mit der roten Überschrift „Entführt“ und Fotos von sowie Text zu entführten Israelis in die Höhe haltend) diese Plakate – liebe Kollegin Ewa Ernst-Dziedzic, vielen Dank für die Initiative. Sie alle sind Geiseln; sie alle sind Geiseln, die noch immer in der Hand dieser Verbrecher sind.
Sie kennen meine Reden in der Zwischenzeit schon. Ich versuche über, sagen wir, vielleicht sehr allgemeine Worte doch sehr viel konkreter zu werden. Ich finde das Beispiel dieser Geiseln eine ausgezeichnete Möglichkeit, um die Problematik unseres westlichen Wertesystems – unserer Dilemmata – zu veranschaulichen. Was passiert da gerade? –Wenn es gut geht, werden zehn dieser unschuldigen Frauen, Männer, Babys, Senioren heute freigelassen – unschuldige Zivilisten. Wie heißt es jetzt in den Medien? – Im Austausch gegen 150 Frauen und Kinder: Palästinensern. (Präsident Hofer übernimmt den Vorsitz.)
Gestern fragte mich ein Kollege zu Recht: Sag, ist das wirklich so, dass in Israel Frauen und Kinder im Gefängnis sitzen? – Das ist der wichtige Punkt: Das sind Frauen und junge Männer, die Anschläge verübt haben, die rechtskräftig verurteilt sind, die Blut an ihren Händen haben. Diese werden jetzt von der Hamas freigepresst: 150 für zehn – aber unschuldige – Frauen, Babys und Kinder, wobei Israel darum ringen musste, dass nicht die Babys ohne ihre Mütter freigelassen werden.
Das muss man sich schon einmal auf der Zunge zergehen lassen, wie wir da in diese Falle geraten, wie da in den Medien ein Bild transportiert wird: Auf der Seite gibt es Frauen und Kinder, auf der anderen Seite gibt es Frauen und Kinder, und die werden jetzt einmal ausgetauscht. Sie erinnern sich: In meiner letzten Rede habe ich immer vom moralischen Kompass geredet, auf den wir achten müssen. Das ist ein wunderbares Beispiel dafür.
Ich gebe Ihnen aber noch ein Beispiel, was diesen Antrag betrifft. Ich finde es ausgezeichnet, dass wir Israel immer wieder und immer wieder daran erinnern, auf Zivilisten zu achten, nach dem Kriegsrecht darauf zu achten, dass die Zivilbevölkerung maximal geschont wird. Dabei wissen wir aber ganz genau, es gibt keinen Staat in dieser Welt, der in einer Kriegsführung so Rücksicht auf Zivilisten nimmt wie Israel. Wir wissen, dass das so ist. Israel hat die Bevölkerung aufgerufen, den Nordteil des Gazastreifens zu verlassen. Jedes Haus, von dem man weiß, dass es eine militärische Installation beherbergt, wird vorgewarnt. Es werden Flugblätter abgeworfen, die Leute in den Häusern werden angerufen und aufgefordert, dass sie diese Häuser verlassen, weil man ganz genau weiß, dass die Hamas in jeder Moschee, in jeder Schule, in jedem Kindergarten, in jedem Spital militärische Einrichtungen unterbringt. Israel weiß, dass sich in diesem Al-Shifa-Spital in Gaza die militärische Kommandozentrale der Hamas befindet – die ganze Welt weiß es. Es wäre ein Einfaches, das zu bombardieren, Israel tut es nicht, und wir fordern das auch.
Anerkennen wir doch auch, wie schwer das alles, was Israel da tut, ist! Vergessen wir nicht, dass vor ein paar Jahren wir es waren, die internationale Gemeinschaft, die im Kampf gegen die Isis in Mossul, in Rakka genau das Gleiche machen mussten. Es gab genau den gleichen Häuserkampf. Es ging darum, dass die Isis zerstört werden musste. Wir wussten, wir kommen daran nicht vorbei.
Ich stelle Ihnen folgende Frage: Was glauben Sie, wo sind mehr Zivilisten umgekommen: in Mossul, in Rakka oder bis jetzt im Gazastreifen?, so die Zahlen stimmen, aber das ist jetzt irrelevant. Ich kann Ihnen ein Geheimnis verraten: Es war in Mossul und in Rakka, wo viel mehr Zivilisten umgekommen sind. Gab es dazu eine Sitzung des UNO-Sicherheitsrates, des UNO-Menschenrechtsrates?
Damit komme ich zu den internationalen Organisationen, und da finde ich das Beispiel, das ich Ihnen jetzt bringe, besonders interessant. Was machen wir mit diesem himmelschreienden Schweigen der internationalen Organisationen über das, was in Israel passiert ist, welche Verbrechen dort passiert sind? Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel (einen Flyer von UN Women zur Kampagne Orange the World in die Höhe haltend): Sie kennen das, oder? Haben wir das nicht heute sozusagen zelebriert?
Ich mache Ihnen folgenden Vorschlag: Öffnen Sie die Homepage dieser Organisation UN Women. Ich habe es gemacht. Ich öffne diese Homepage (ein Tablet, auf dem die besagte Homepage geöffnet ist, in die Höhe haltend), und schauen Sie, ob da irgendetwas hinsichtlich der fürchterlichen Verbrechen an Frauen, die die Hamas an israelischen Frauen verübt hat, zu finden ist! Die Frauen wurden vergewaltigt, verstümmelt – ich möchte auf die Berichte von der Obduktion der Leichen, die ich bekommen habe, gar nicht mehr näher eingehen. Sie zeigen, wie fürchterlich zugerichtet die Frauen dort wurden. Schauen Sie durch! Schauen Sie durch auf dieser Homepage, ob Sie irgendetwas dazu finden! – Sie finden drei Berichte in diesem Zusammenhang. Der eine ist (auf dem Tablet scrollend) – ich muss mir die Zeit nehmen, Sie verzeihen –, der eine Bericht ist: „In-focus: The conflict in Gaza“, der zweite Bericht ist: „Voices
from Gaza“ – die Geschichte einer Frau über ihr Überleben in Gaza –, und der dritte: „Facts and figures: Women and girls during the war in Gaza“. – Drei Berichte über Gaza. Irgendein Bericht über das, was den israelischen Frauen passiert ist?
Der Begriff himmelschreiend stammt eigentlich aus dem Alten Testament. Ich bin neugierig, ob Sie wissen, woher das kommt. Es kommt von der Geschichte von Kain und Abel. Bekanntlich hat Kain seinen Bruder ermordet. Gott fragt Kain: Was ist eigentlich mit deinem Bruder Abel?, woraufhin er frech antwortet: Bin ich denn der Hüter meines Bruders? Darauf sagt Gott: Was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit bis zum Himmel.
Das Blut dieser israelischen Frauen schreit zum Himmel – und wir, die internationalen Organisationen, schweigen und sagen: Bin ich denn der Hüter meines Bruders? – Wollen wir das wirklich zulassen?
Damit komme ich zum Schluss und sage: Ich bin sehr stolz auf Österreich und auf unseren Minister, dass wir dieser verlogenen Resolution in der UNO-Generalversammlung nicht zugestimmt haben. Es gebührt uns dafür der größte Respekt, und wir bekommen ihn auch.
Ich glaube, dass wir in den internationalen Organisationen den Auftrag haben, diesen moralischen Kompass, diesen Wertekompass wieder richtigzustellen. Ich glaube, dass Österreich den wichtigen Auftrag hat, das zu tun, und ich bedanke mich noch einmal beim Minister und bei der Regierung insgesamt dafür, dass sie diese Arbeit macht. – Vielen Dank. (Beifall bei der ÖVP, bei Abgeordneten der NEOS sowie der Abg. Blimlinger.)
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gemeldet ist dazu nun niemand mehr. Die Debatte ist geschlossen.
Wünscht der Herr Berichterstatter ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall.
Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die dem Ausschussbericht 2290 der Beilagen angeschlossene Entschließung betreffend „Terrorangriff der Hamas auf Israel“.
Ich bitte jene Damen und Herren, die hiefür eintreten, um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist einstimmig angenommen. (348/E)
Bericht des Außenpolitischen Ausschusses über den Antrag 3370/A(E) der Abgeordneten Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen betreffend Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler (2291 d.B.)
Präsident Ing. Norbert Hofer: Wir gelangen zum 16. Punkt der Tagesordnung.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Peter Wurm, Sie gelangen nun zu Wort. – Bitte.
Abgeordneter Peter Wurm (FPÖ): Herr Präsident! Werte Minister! Hohes Haus! Werte Zuseher! Diese Allparteiengeschlossenheit hier im Haus, diese hohen moralischen Ansprüche, von denen wir jetzt gehört haben, diesen moralischen Kompass und diesen Feuereifer erwarte ich jetzt natürlich auch beim Thema Südtirol, beim Thema Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler.
Auch wenn Frau Kollegin Meinl-Reisinger gerne hätte, dass man die Vorgeschichte bei solchen Themen weglässt, sollten wir, glaube ich, hier im österreichischen Parlament die Vorgeschichte zum Thema Südtirol nicht aus den Augen verlieren und auch immer im Blickfeld haben.
Wir haben in der letzten Sitzung des Außenpolitischen Ausschusses – Herr Minister, Sie wissen es – dieses Thema Doppelstaatsbürgerschaft wieder einmal zum Gegenstand gemacht, weil ich vom Herrn Minister wissen wollte – jetzt sind wir wieder beim vorhergehenden Themenbereich –, warum er persönlich mit
großem Aufwand 31 Doppelstaatsbürger aus dem Gazastreifen quasi befreit hat, obwohl diese 31 offensichtlich mit Österreich nicht viel am Hut haben, was man daran sieht, dass man keinen gefunden hat, der ein Interview auf Deutsch geben konnte. Ich wollte einfach wissen, wie diese Doppelstaatsbürgerschaften zustande gekommen sind, ob diese 31 Personen auch sicherheitstechnisch und so weiter überprüft wurden.
Das war eine längere Diskussion mit dem Herrn Minister, weil er sich ja auch persönlich immer gegen diese Doppelstaatsbürgerschaft beziehungsweise gegen alle Ansinnen, für die Südtiroler hier im Parlament etwas zu tun, stellt. Er musste mir im Ausschuss zugestehen, dass diese Personen anscheinend überprüft wurden. Allerdings haben, glaube ich, zwei oder drei Personen dieser Überprüfung nicht standgehalten, die man aber bei dieser Doppelstaatsbürgerschaftsgeschichte nicht draußen gelassen hat. Meine Frage, ob diese zwei oder drei jetzt die Doppelstaatsbürgerschaft verlieren, konnte er mir nicht beantworten.
Was ich damit sagen will, ist Folgendes: Für Menschen in der ganzen Welt gibt es österreichische Doppelstaatsbürgerschaften, das ist alles ganz leicht, da muss man auch keinen Österreichbezug haben, aber bei den Südtirolern, die seit 100 Jahren Unrecht erleben, geht das nicht. Die haben damals – ich darf es erwähnen – auch Widerstand geleistet. Da hat es ganz, ganz viele gegeben, die dabei auch gestorben sind. Es wurden auch Strommasten gesprengt, es hat zivilen Ungehorsam gegeben und ganz, ganz viele mussten leiden. Keiner in Südtirol hat natürlich solche Massaker verübt, von denen wir gerade gehört haben, da wurden keine Babys ermordet und keine Frauen geschändet, aber dort wurde Widerstand geleistet.
Wir wollen nichts anderes, als – ich darf es noch einmal erwähnen, es gibt einen aufrechten Beschluss des Südtiroler Landtages für die Doppelstaatsbürgerschaft und auch einen aufrechten Beschluss des Nationalrates – diese Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler zu ermöglichen. Es gibt also überhaupt keine rechtliche Problemstellung, auch keine fachliche, juristische Problemstellung. Das Einzige, das fehlt, ist der politische Wille dieser vier Parteien hier im Haus,
endlich diese Möglichkeit für die Südtiroler zu schaffen, auf freiwilliger Basis – wenn es jemand will – diese Doppelstaatsbürgerschaft zu beantragen. (Beifall bei der FPÖ.)
Außer uns Freiheitlichen kämpft niemand um diese Selbstbestimmung, diese Autonomie, diese Freiheit für Menschen, die einen – unter Anführungszeichen – „Krieg verloren haben“ und deshalb einfach von Tirol abgetrennt wurden, darum, diese Möglichkeit zu schaffen.
Wir hätten es sehr, sehr leicht – ich sage es noch einmal –, weil wir Gott sei Dank mittlerweile in einem friedlichen Europa leben, weil wir auch mit Italien gute Beziehungen haben; wir sind ja keine Feinde mehr wie vor 100 Jahren. Deshalb wäre es doppelt leicht, diesen Schritt zu machen. Italien macht es im Übrigen für seine Landsleute auf der ganzen Welt so und verteilt Doppelstaatsbürgerschaften. Das heißt, wir brauchen auch niemanden zu fragen. Wir brauchen Italien nicht zu fragen, wir brauchen keine UNO zu fragen, wir brauchen keine Europäische Union zu fragen. Ich brauche nur die Abgeordneten hier im Haus zu fragen, ob sie das möglich machen wollen, aber offensichtlich gibt es viele, die aus welchen Gründen auch immer für die ganze Welt Verständnis haben – für die ganze Welt! –, aber für die Südtiroler gibt es hier im Haus, außer bei uns Freiheitlichen, offensichtlich kein Verständnis. Das kann ich nicht nachvollziehen. (Abg. Weratschnig: Absolut unwahr!)
Herr Minister, ich sage es Ihnen auch ganz ehrlich, und zwar dieses Mal unverblümt: Ich finde es zum Schämen, dass Sie persönlich es nicht schaffen – mit unzähligen Ausreden –, obwohl Sie wissen, dass wir das seit vielen Jahren auch parteiübergreifend versuchen, einer alten Dame, nämlich Frau Orian – diese Dame ist jetzt 105 Jahre alt –, dieser über 100-jährigen Altösterreicherin ihren letzten Lebenswunsch zu erfüllen, nämlich als österreichische Staatsbürgerin zu sterben. Dafür, Herr Minister, sollten Sie sich auch nach Ihrer Amtszeit noch genieren und schämen, denn es dieser über 100-Jährigen nicht möglich zu machen, obwohl es für die ganze Welt möglich ist, ist eigentlich zum
Fremdschämen – für jeden, der das behindert, inklusive der Abgeordneten hier und der Regierung.
Ich möchte schließen, auch ganz eindeutig: Hoch Tirol, ein Tirol! – Danke. (Beifall bei der FPÖ.)
13.12
Präsident Ing. Norbert Hofer: Nächster Redner ist Abgeordneter Hermann Gahr. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Hermann Gahr (ÖVP): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Meine Damen und Herren! Hohes Haus! Südtirol ist für uns hier im Parlament ein wichtiger Partner. Die Schutzfunktion ist ein klarer Auftrag an uns alle, dass wir Südtirol laufend und permanent unterstützen und dass das österreichische Parlament auch jederzeit für Südtirol offen ist. Es gibt einen intensiven Austausch, auch im Unterausschuss Südtirol und natürlich bei politischen Terminen. Gerade in letzter Zeit, glaube ich, haben wir wirklich versucht, uns über die Dinge mit Südtirol gut auszutauschen.
Es hat circa vor einem Jahr im Südtirol-Unterausschuss eine Aussprache mit Herrn Landeshauptmann Kompatscher gegeben, und da wurde auch das Thema Doppelstaatsbürgerschaft angesprochen, das ja seit 2009, sage ich, in Diskussion steht, wobei immer wieder Pro und Contra abgewogen wurden. Dabei hat Landeshauptmann Kompatscher erwähnt, dass er derzeit, auch aufgrund einer Befragung in Südtirol, laut der sich nur 13 Prozent diese Doppelstaatsbürgerschaft wünschen, dieses Anliegen eigentlich eher nicht unterstützt und dass seine Vision eine europäische Staatsbürgerschaft ist. Meiner Meinung nach ist es schon wichtig, dass der oberste Repräsentant eines Landes auch ganz klar Stellung bezieht.
Ein weiterer Punkt ist: Es fanden erst kürzlich in Südtirol Landtagswahlen statt, man ist aktuell in Regierungsverhandlungen. Es hat durchaus Überraschungen
gegeben. Ich bin gespannt, wie die neue Südtiroler Landesregierung ausschaut, bin aber auch gespannt, ob das Thema Doppelstaatsbürgerschaft, das in der Wahlbewegung – ich habe es intensiv beobachtet – kein Thema war, verankert wird.
Ein weiterer Punkt, und das ist ein sensibler: Zur Überraschung von vielen hat Ministerpräsidentin Meloni angekündigt, dass wir die Autonomie für Südtirol verstärken können, dass wir verloren gegangene Rechte und Kompetenzen wieder zurückgewinnen können. Ich glaube, gerade in der aktuellen Situation, in der das verhandelt wird, in der ein Paket für alle Regionen, die das in Italien wünschen, geschnürt werden soll, ist es nicht ganz – sage ich – klug, so ein Thema jetzt wieder in Diskussion zu bringen, denn in Rom braucht es da noch viel Überzeugungsarbeit.
Für mich ist eines ganz wichtig: Es gibt aktuell viele Themen – gestern hat es eine Aussprache mit einer italienischen Delegation gegeben –, wie etwa das Thema Verkehr, aber auch das Thema Migration und Flüchtlinge. Ich glaube, wir müssen die Dinge im Dialog besprechen. Wir müssen Südtirol dort unterstützen, wo wir es unterstützen können. Ich bin auch einer, der wirklich zu Südtirol steht, aber ich glaube, wichtig für Südtirol ist Autonomie, wichtig für Südtirol ist Kooperation und Partnerschaft und wichtig für Südtirol ist in Zukunft, dass wir es auch hier im österreichischen Parlament gemeinsam vertreten. – Vielen Dank. (Beifall bei der ÖVP.)
13.16
Präsident Ing. Norbert Hofer: Nächster Redner ist Abgeordneter Mag. Gerald Hauser. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Mag. Gerald Hauser (FPÖ): Herr Präsident! Werte Minister! Kolleginnen und Kollegen! Zuhörerinnen und Zuhörer und vor allem auch die Personen vor den Bildschirmen! Lieber Hermann Gahr, es geht um die 13 Prozent. Wenn du sagst, dass sich laut einer Umfrage 13 Prozent der
Südtiroler Bevölkerung eine Doppelstaatsbürgerschaft vorstellen können: Das sind 13 Prozent Südtiroler, die sagen: Wir wollen Heimat!
Die Heimat ist doch das, über das wir in Tirol bei jedem Schützenfest, bei jedem Musikfest immer wieder sprechen, und gerade die Vertreter der Österreichischen Volkspartei – das weißt du, weil du viel unterwegs bist – werden nicht müde, immer den Begriff der Heimat zu betonen und zu sagen, Südtirol ist Teil unserer Heimat.
Nur, das sind Worte, das sind immer wieder Worte, die bei Sonntagsreden ausgesprochen werden. Diesen Worten, Herr Minister Schallenberg, müssten doch schon längst Taten folgen. Wir haben nicht das Recht, einen einstimmigen Beschluss des Südtiroler Landtages für die Staatsbürgerschaft wegzuwischen. Wir haben auch nicht das Recht, einen Beschluss des österreichischen Parlaments für die Doppelstaatsbürgerschaft einfach zu ignorieren. Wir müssen endlich ins Handeln kommen.
Wenn wir jetzt so tun, als ob die Republik Österreich Staatsbürgerschaften so selten vergibt: Ich habe mir erlaubt, einmal in der Statistik Austria nachzuschauen. Wenn ihr euch diese Zahlen anschaut – ich habe diese Zahlen mitgebracht (eine Tafel mit der Überschrift „Eingebürgerte Personen in Österreich“ auf das Redner:innenpult stellend) –, nur für das Jahr 2020 und folgende: Wie schaut denn das aus? – Im Jahr 2020 wurden knapp 10 000 Personen eingebürgert, von woher auch immer, im Jahr 2021 wurden 16 171 und im Jahr 2022 20 606 Personen eingebürgert.
Wenn man in der Statistik Austria weiter nachschaut: Wo wohnen denn diese eingebürgerten Personen? – Im Jahr 2022 wohnen von den 20 606 eingebürgerten Personen 9 707 im Ausland. Deswegen verstehen wir überhaupt nicht, dass wir unseren Südtiroler Freunden, den 13 Prozent, von denen du sprichst – das ist eine freiwillige Sache –, nicht die Möglichkeit geben, selbstständig zu entscheiden, ob sie nicht auch die österreichische Staatsbürgerschaft annehmen wollen.
Wie das unser Südtirolsprecher Peter Wurm schon angesprochen hat: Es ist halt auch bei diesem Thema so, dass wir als Freiheitliche Partei die einzige Partei sind, die bei diesem Thema hinter unserer Südtiroler Bevölkerung steht, und das weiß die Südtiroler Bevölkerung. Deswegen haben patriotische Parteien bei der letzten Landtagswahl in Südtirol ihre Mandatszahl von vier auf acht verdoppelt, bei insgesamt 35 Mandaten. Auch das sollte der ÖVP zu denken geben. – Ich danke. (Beifall bei der FPÖ. – Abg. Weratschnig: Und die Freiheitlichen haben verloren! Die Freiheitlichen haben massiv verloren!)
13.19
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt jetzt Frau Abgeordnete Mag.a Selma Yildirim. – Bitte schön, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete Mag. Selma Yildirim (SPÖ): Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Außenminister! Sehr geehrter Herr Sozialminister! Hohes Haus! Werte Damen und Herren! Die Frage der Doppelstaatsbürgerschaft für Südtirolerinnen und Südtiroler beschäftigt uns natürlich seit vielen Jahren, das ist immer wieder Thema. Ich möchte an dieser Stelle klarstellen, dass die Rolle Österreichs, nämlich die Schutzfunktion Österreichs gegenüber der Südtiroler Bevölkerung, sehr ernst genommen wird und auch jedes Mal in jedem Austausch bekräftigt wird, ob wir in Südtirol sind oder ob unsere Südtiroler Kolleginnen und Kollegen uns hier im Parlament besuchen. Ich schätze diesen offenen und sehr kritischen Austausch auch sehr, und meiner Erinnerung nach gibt es gar keinen solchen Beschluss des Südtiroler Landtages. Ich glaube, Sie sollten es genauer zitieren. Ich habe immer wieder nachgeschaut und nachgefragt, und es findet sich kein Beschluss (Abg. Lopatka: Richtig!) – Sie aber stehen hier und behaupten, es gäbe einen Beschluss. Dieser Beschluss ist aber wichtig, und ich sage Ihnen auch genau, warum er wichtig ist: Es geht nicht, dass wir über so heikle Themen entscheiden, die unter Umständen eine ganze Bevölkerungsgruppe und die
Lebensbedingungen beeinträchtigen könnten – ich sage bewusst: beeinträchtigen könnten (Abg. Martin Graf: Wenn einer die Doppelstaatsbürgerschaft bekommt?) –, weil das sehr, wirklich sehr mit Risiken behaftet ist.
Es ist wichtig, dass diesbezüglich wirklich ein einstimmiger Beschluss des Südtiroler Landtages vorliegt, dieser dann mit Rom und auch mit dem österreichischen Nationalrat abgesprochen ist, bevor wir so heikle Entscheidungen treffen.
Wir wollen ja im Geiste Europas und auch weltweit als ein vorbildliches, ein Vorzeigemodell in Bezug auf Autonomierechte, auf den Schutz von Minderheiten, den Schutz von Volksgruppen gelten – ich glaube, zuletzt ist in New York, in der UNO-Generalversammlung wieder einmal darüber gesprochen worden, weil es wirklich visionär ist, was wir damals beschlossen haben –, und an dieser Autonomie und an diesem vorbildlichen Projekt gilt es weiterzuarbeiten, dieses Modell, dieses Erfolgsmodell weiterzuentwickeln. (Beifall bei der SPÖ.)
Ich glaube, damit würden wir unseren Südtiroler Kolleginnen und Kollegen mehr helfen. Es gibt immer wieder Umfragen – und ich nehme diese Umfragen auch sehr ernst –, und die Sorge der Bevölkerung ist natürlich die, dass vielleicht gar nicht so viele, wie die nationalistischen Parteien jetzt glauben, die österreichische Staatsbürgerschaft anstreben (Abg. Belakowitsch: ... ist die Mehrheit!), und das kann natürlich auch die Autonomie gefährden. Es gibt so viele ungeklärte Fälle, die wir behandeln sollten, bevor wir hier über den Kopf vieler Leute entscheiden und womöglich Konflikte, die es nicht gibt, auslösen könnten. Das ist wichtig.
Und weil die Freiheitlichen gerne auch unseren SPÖ-Vorsitzenden in Tirol zitieren: Dieser hat, wie man weiß, wenn man sinnerfassend zuhört und liest, gesagt: Es gilt immer das, was die Volksgruppen wollen; das Selbstbestimmungsrecht ist wichtig! – Wenn das geklärt ist, werden Sie in uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten auch Verbündete finden.
Bis dahin können wir einem Antrag der Freiheitlichen Partei nicht zustimmen. (Abg. Belakowitsch: Weil es ein freiheitlicher ist!) Es braucht da Geschlossenheit und Einstimmigkeit, und bevor diese nicht gegeben sind (Abg. Belakowitsch: Ja, sehr witzig!), gibt es da eigentlich auch keine andere Entscheidung.
Ich danke, und in diesem Sinne: Auf eine gute Zusammenarbeit! (Beifall bei der SPÖ sowie des Abg. Weratschnig.)
13.23
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt Dr. Reinhold Lopatka. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Dr. Reinhold Lopatka (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bundesminister! Meine Damen und Herren! Es gibt immer wieder Initiativen und Wortspenden von Politikern, mit denen sie etwas anrichten, was wahrscheinlich gar nicht intendiert ist, bei denen sie sich aber jedenfalls der Tragweite ihrer Forderungen nicht bewusst sind. Genauso ist es in diesem Fall, bei der Forderung nach der Doppelstaatsbürgerschaft.
Ich sage Ihnen, warum: Ich unterstelle weder Abgeordnetem Wurm noch dem Tiroler Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer, dass sie die guten Beziehungen zwischen Österreich und Italien damit gefährden wollen, aber sie tun es.
Das, was Dornauer fordert, steht im Gegensatz zu allen bisherigen Stellungnahmen und zur bisherigen Festlegung der SPÖ und auch zur Rede jetzt hier von Abgeordneter Selma Yildirim – ich bin Ihnen dankbar für Ihre Ausführungen, sie stehen nur in absolutem Widerspruch zu dem, was Ihr Parteivorsitzender gesagt hat. So hat er in der „Tiroler Tageszeitung“ wortwörtlich gesagt, die neue Bundesregierung solle sich mit der Doppelstaatsbürgerschaft von Südtirol befassen. Meine Damen und Herren, er ist mit dem Staatsbürgerschaftswesen in Tirol betraut, daher nehme ich an, dass er sich mit der Materie beschäftigt hat,
und ich kann nur hoffen, dass jetzt das gilt, was Sie gesagt haben, und nicht das, was Ihr Landeshauptmannstellvertreter und immerhin Parteivorsitzender gemeint hat, jetzt als Maxime genommen wird.
Kollege Wurm, Sie haben eine Partei genannt, aber eigentlich haben Sie in Südtirol ja eine andere Schwesterpartei, nämlich die Freiheitlichen (Abg. Belakowitsch: Das ist nicht unsere Schwesterpartei!), und, das haben Sie vergessen, die sind unter 5 Prozent gefallen. (Abg. Wurm: Ich habe keine Zahlen genannt!) – Nein, Sie haben keine Zahlen genannt? (Abg. Wurm: Der Kollege Hauser war das!) – Oder der Kollege Hauser, danke. – Ihre Schwesterpartei waren bisher aber eigentlich die Freiheitlichen. (Abg. Belakowitsch: Das ist nicht unsere Schwesterpartei! – Abg. Hauser: Acht Mandate! Acht Mandate!) Vielleicht sind sie es nicht mehr. Jedenfalls sind die Freiheitlichen in Südtirol unter 5 Prozent gefallen, und sie waren auch die Einzigen, die im Wahlkampf dieses Thema hochziehen wollten.
Ich will Sie damit nicht länger langweilen, ich will Ihnen damit nur sagen: Das, was Sie hier machen, ist ein tatsächliches Minderheitenprogramm, das den Südtirolerinnen und Südtirolern nicht hilft.
Was den Menschen im Land hilft, sind das bestmögliche Zusammenleben der drei Sprachgruppen – wir dürfen auch die Ladiner nicht vergessen – und der wirtschaftliche Erfolg, der Südtirol auszeichnet, und dafür war und ist die Südtiroler Volkspartei mit ihren Landeshauptleuten die erstverantwortliche Partei – das ist eindeutig. (Beifall bei der ÖVP.)
Was wir hier tun sollten, ist, die Südtiroler dabei zu unterstützen, dass diese Erfolgsgeschichte, nicht nur was die Minderheitenrechte betrifft, sondern auch die wirtschaftliche Erfolgsgeschichte, eine Fortsetzung findet. Als wir mit dem Südtirolausschuss in Bozen waren, war ich beeindruckt, was in dieser Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino an gemeinsamer Arbeit so gut umgesetzt werden kann.
Daher sage ich Ihnen – und damit möchte ich schon zum Ende kommen –, ich bitte Sie: Außenpolitik verlangt vielleicht mehr Augenmaß als innenpolitische Auseinandersetzungen und den Willen zur Zusammenarbeit. Wir brauchen Italien, wenn ich nur an die Verkehrsprobleme denke, wir brauchen Italien, wenn ich an den Brenner denke. Wir können da nicht gegen Italien eine gute Politik machen, sondern immer nur mit Italien. Das haben wir auch gesehen, als diese Woche der außenpolitische Ausschuss des italienischen Parlaments bei uns war. Wir sollten uns daher auch in dieser Frage bestmöglich mit Italien abstimmen, um für Südtirol die besten Ergebnisse zu erreichen.
Ob im Europarat oder wo immer, wenn es um den Schutz von Minderheiten geht, wird Südtirol als Vorbild genannt und nicht als schlechtes Beispiel. Bitte gefährden Sie nicht diese gute Zusammenarbeit – im Interesse der Südtirolerinnen und Südtiroler! (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
13.27
Präsident Ing. Norbert Hofer: Nächster Redner ist Alexander Melchior. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Alexander Melchior (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Herren Minister! Wir merken, dass Südtirol immer ein sehr emotionales Thema für uns in Österreich ist. Wir merken bei diesem Thema auch, dass wir eine starke Verbundenheit mit Südtirol haben. Wir haben eine Schutzfunktion, aber wir merken es auch im täglichen Leben: Viele von uns fahren nach Südtirol auf Urlaub, und Südtiroler kommen gern zu uns. Wenn ein Südtiroler in der Wiener Stadthalle spielt, dann feuern wir ihn an, als wäre er ein Österreicher. (Abg. Belakowitsch: Als wäre er, genau! Als wäre er!) Es gibt da also eine ganz starke Verbundenheit.
Was das Thema der Doppelstaatsbürgerschaft angeht, erleben wir aber – Reinhold Lopatka hat es vorhin auch gesagt –, dass wir da ein Thema angreifen, das sehr mit Vorsicht zu genießen ist. Auf der einen Seite ist es kein großes
Thema bei den Südtirolern – es war auch im Landtagswahlkampf kein Thema –, aber wir merken auch, dass wir innerhalb einer Europäischen Union, der wir seit 28 Jahren als Mitglied angehören, wo man sich überall niederlassen kann, wo man überall zu Hause sein kann, das Thema der Doppelstaatsbürgerschaft immer weniger brauchen.
Der dritte und für mich wesentliche Punkt ist aber: Wir haben gesehen, dass Südtirol immer dann stark ist, wenn es ein geeintes Südtirol gegeben hat, wenn es eine starke Einheit gegeben hat und diese starke Einheit sehr stark aufgetreten ist. Und gerade dieses Thema der Doppelstaatsbürgerschaft treibt da immer wieder einen Keil rein, und man merkt, dass es da zu einer großen Polarisierung kommt. Aus meiner Sicht sollten wir das vermeiden, und deswegen werden wir dem Antrag auch nicht zustimmen. – Vielen Dank. (Beifall bei der ÖVP.)
13.29
Präsident Ing. Norbert Hofer: Herr Abgeordneter Peter Wurm gelangt nun zu Wort. – Bitte schön.
Abgeordneter Peter Wurm (FPÖ): Ja, wenig überraschend hat der moralische Kompass die Herrschaften hier im Haus sehr schnell verlassen, wenn es um Südtirol geht. Bei allen anderen Krisenherden dieser Welt ist der moralische Kompass offensichtlich da. (Abg. Meinl-Reisinger: Na ja, aber „Krisenherde“? Da werden sich die Südtiroler schön bedanken für den Vergleich mit Krisenherden!)
Ich sage es noch einmal: Wir vergeben an die Menschen aller Länder dieser Welt Doppelstaatsbürgerschaften. Das ist für jeden Afghanen, Syrer und Sonstigen ganz einfach. (Abg. Stögmüller: Geh bitte! – Abg. Meinl-Reisinger: Entschuldigung! Das ist ein unintelligenter Vergleich! Die Südtiroler werden sich schön bedanken! ... Krisenherd ... Naher Osten!) Wenn es um Südtirol geht, vermisse ich leider Gottes bei der Sozialdemokratie – und ich sage es bewusst – große Politiker wie einen Bruno Kreisky. Dieser hat nämlich noch verstanden, was Südtirol ist, aber seit
Bruno Kreisky in der SPÖ anscheinend vergessen ist, hat auch die Sozialdemokratie diese Geschichte vollkommen vergessen. (Abg. Stögmüller: ... schon sehr lange verloren!) Ob Dornauer das jetzt links oder rechts sagt, Frau Yildirim, ist mir eigentlich auch egal, weil ich sowieso nichts mehr glaube, was die Sozialdemokratie sagt, denn ihr sagt einmal A und einmal B. Also bei euch ist überhaupt keine Linie da, auch in dieser Frage nicht.
Bei der ÖVP ist es ein Drama, dass es bei der ÖVP in Tirol, aber auch im Bund keine Persönlichkeiten wie Wallnöfer mehr gibt. Auch die Abgeordneten aus Tirol sind halt leider Gottes nicht stark genug, hier einmal eine Linie zu halten. Ihr habt auch keine großen Politiker mehr, deshalb geht dieses Thema einfach unter.
Frau Yildirim! Ich sage es dir noch einmal, ich kann es dir auch gerne geben (ein Schriftstück in die Höhe haltend): Diese Petition (Abg. Yildirim: Ach! Jetzt ist es eine Petition?) haben sieben Herren und Damen von der Südtiroler Volkspartei, drei von der Südtiroler Freiheit, die Bürgerunion und sogar die Fünfsternebewegung unterschrieben. Das kann ich dir zeigen. (Abg. Yildirim: Aber jetzt ist es eine Petition?)
Es geht auch gar nicht darum, was Herr Kompatscher will. Herr Kompatscher ist morgen vielleicht gar nimmer da. Es ist mir völlig egal, was Kompatscher will. Es geht mir darum, was die Südtiroler Bevölkerung will, was die Menschen in Südtirol wollen.
Herr Kollege Lopatka! Den Wohlstand in Südtirol hat nicht die SVP gemacht, auch nicht Kompatscher, den Wohlstand in Südtirol (Abg. Belakowitsch: Die Bevölkerung!) haben die Südtiroler gemacht. (Beifall bei der FPÖ.) Genauso wie in Nordtirol die Nordtiroler den Wohlstand gemacht haben und in Osttirol die Osttiroler. Die Menschen haben den Wohlstand gemacht. (Abg. Lopatka: Aber die Regierung hat ...!)
Ich verstehe es bis heute nicht, es ist mir ein absolutes Rätsel: Wenn Sie sagen, es will in Südtirol eh keiner diese Doppelstaatsbürgerschaft, dann sollte es ja überhaupt kein Problem sein, wenn 20 Leute sie wollen. Wenn das stimmt, was Sie sagen, dass sie eh keiner will, dann kann es doch gar kein Thema sein.
Ich sage Ihnen, was die Wahrheit ist: Ganz, ganz viele Südtiroler werden und würden dieses Angebot annehmen, und wir werden es ihnen früher oder später ermöglichen. (Beifall bei der FPÖ.)
13.32
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt nun Herr Abgeordneter Hermann Weratschnig. – Bitte schön, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Hermann Weratschnig, MBA MSc (Grüne): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Minister! Südtirol ist Teil der Europäischen Union. Südtirol ist Teil eines Europas der Regionen und übernimmt hier einen unglaublich engagierten Teil einer Europaregion, die in Europa wirkt und gemeinsam mit vielen Regionen arbeitet, insbesondere natürlich mit Tirol und auch mit dem bayerischen Raum. Das muss man einfach einmal klar und deutlich sagen. Das funktioniert auch. Die Europaregion Tirol ist auch ein Beispiel dafür, wie kooperiert und in allen Dingen zusammengearbeitet wird, wo wir wissen, wo es noch mehr Engagement braucht, bei allen Barrieren, wo wir wissen, dass es nicht einfach ist, mit den Nationalstaaten einen gemeinsamen Weg zu beschreiten.
Aber es ist unglaublich, wenn sich die Freiheitlichen hier herausstellen, nachdem sie die Landtagswahlen ganz klar verloren haben, und hier andere Mandate von irgendwelchen Rechtsparteien - - Ich weiß nicht: Habt ihr die Südtiroler Freiheit jetzt dazugerechnet, oder seid ihr jetzt Teil von den Fratelli oder Teil der Lega? (Abg. Voglauer: Genau!) Wahrscheinlich ist es so, dass die Freiheitlichen sich hier nicht von diesen Parteien unterscheiden. Ihr habt es
heute gesagt, das hat uns Klarheit gegeben. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
Ihr seid anscheinend Teil der Fratelli, ihr seid Teil der Lega, aber auf jeden Fall dann nicht Partner der Südtirolerinnen und Südtiroler. Das muss man auch sagen. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
Partner der Südtirolerinnen und der Südtiroler ist man dann – Frau Abgeordnete Yildirim hat das heute schon sehr gut, glaube ich, auf den Punkt gebracht –, wenn wir an der Autonomie weiterarbeiten. Beim gemeinsamen Austausch mit Landeshauptmann Kompatscher ist das auch hervorgekommen. Wenn es dazu kommt und wir euch brauchen, dann werden wir hier einen gemeinsamen Weg der Unterstützung finden, wenn es um die Autonomie geht. Das, was die Freiheitlichen da vorhaben, ist brandgefährlich, und es ist eigentlich ein Faktum, dass die Autonomie durch solch ein Vorgehen gefährdet ist.
Abschließend: Südtirol geht einen Weg der Kooperation, der Zusammenarbeit, ist Teil eines Europas der Vielfalt und wird von uns unterstützt.
Ganz am Schluss – deshalb, glaube ich, waren die Worte von Frau Abgeordneter Yildirim heute auch so wichtig –: Kollege Dornauer, Landeshauptmannstellvertreter, steht mit seiner Positionierung ziemlich alleine da und wird sie aller Wahrscheinlichkeit nach bei manchen Gesprächen auch revidieren müssen. Er ist hier ganz klar auf dem Holzweg.
Eines ist klar: Wir brauchen jetzt eine aktive Europapolitik mit Südtirol – Abgeordneter Lopatka hat es bereits beschrieben –, gerade im Bereich der Mobilität, gerade im Bereich der Ausbildung, gerade auch im Bereich der Außenpolitik. Diesen Weg beschreiten wir, diesen Weg unterstützen wir. (Beifall bei Grünen und ÖVP.)
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
Wünscht der Herr Berichterstatter ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall.
Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag des Außenpolitischen Ausschusses, seinen Bericht 2291 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen.
Ich bitte jene Damen und Herren, die dazu ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes Zeichen. – Das ist die Mehrheit. Der Antrag ist angenommen.
Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 3655/A der Abgeordneten Mag. Ernst Gödl, Bedrana Ribo, MA, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundespflegegeldgesetz und das Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz geändert werden (2283 d.B.)
Präsident Ing. Norbert Hofer: Wir gelangen nun zum 17. Punkt der Tagesordnung.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Zu Wort gelangt Frau Mag.a Verena Nussbaum. – Bitte, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete Mag. Verena Nussbaum (SPÖ): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Hohes Haus! Werte Zuseherinnen und Zuseher! Ja, eine Maßnahme, die im Zuge der sogenannten Pflegereform neu eingeführt worden ist, ist der Angehörigenbonus. Diesen Bonus bekommen alle pflegenden Angehörigen, die einen Menschen ab Pflegestufe 4 pflegen und deren monatliches Nettoeinkommen 1 500 Euro nicht übersteigt. Der Bonus selbst beträgt 4,10 Euro am Tag. Aufs Jahr gerechnet sind das 1 500 Euro.
Unserer Meinung nach ist dieser Bonus nur eine symbolische Geste. Pflegende Angehörige sind dadurch weder finanziell abgesichert, noch kann diese Summe einen Anreiz darstellen, die Pflege der Angehörigen zu übernehmen. (Beifall bei der SPÖ.)
Seit der ersten Änderung erhalten mittlerweile pflegende Angehörige den Angehörigenbonus, auch wenn sie nicht mit den zu Pflegenden im gemeinsamen Haushalt wohnen. Es können auch mehrere Personen gepflegt werden, den Angehörigenbonus gibt es allerdings nur einmal. Erstmals beantragt werden konnte dieser Bonus mit Juli 2023, ausbezahlt werden soll er in Zukunft ab 1. Dezember. Trotzdem gibt es heute schon die zweite Novellierung. Das zeigt wieder einmal, wie schlampig die Regierung arbeitet. Genau für solche Fälle würde es eigentlich das parlamentarische Vorverfahren geben, in dem Expertinnen und Experten ihre Meinung zu den Gesetzesvorschlägen kundtun können. (Beifall bei der SPÖ.)
Leider verzichtet die Bundesregierung immer wieder auf dieses Begutachtungsverfahren, und so kommt es, dass Gesetze regelmäßig überarbeitet werden müssen, kaum sind sie in Kraft getreten, damit die Umsetzung überhaupt gewährleistet ist. Bei dieser Änderung heute sind es überwiegend Klarstellungen, aber auch die Regelungen betreffend Rechtsweg waren unzureichend und werden heute korrekt gestaltet werden.
Würde man jedoch pflegende Angehörige wirklich entlasten wollen, müssten die mobilen Dienste, Tageszentren, aber auch Betreuungseinrichtungen in der Kurzzeitpflege massiv ausgebaut werden. Dahin gehend gibt es aber leider keine vorgeschlagenen Maßnahmen der Bundesregierung. Auch in der Pflegereform ist davon nichts zu sehen. Wir haben in den letzten Tagen in der Budgetdebatte gesehen, dass Maßnahmen, die für die Pflegereform angekündigt wurden, fortgesetzt werden, neue Maßnahmen, neue Impulse finden sich jedoch nirgends – und das, obwohl wir gerade im Pflegebereich wirklich vor großen Herausforderungen stehen und diese zukünftig noch größer werden. Neue Akzente, Schwerpunkte vermissen wir eindeutig. Ich gehe davon aus – und wiederhole mich auch heute wieder –, dass für die Regierung diese Pflegereform abgeschlossen ist. Für Fragen, wie wir unser Pflegesystem in Zukunft aufrechterhalten, gut positionieren und auch ausbauen wollen, sieht sich diese Bundesregierung offensichtlich nicht mehr zuständig. Das ist sehr schade, und
wir werden auch diesmal wieder gegen diese Maßnahme stimmen. – Danke schön. (Beifall bei der SPÖ.)
13.40
Präsident Ing. Norbert Hofer: Nächster Redner ist Mag. Michael Hammer. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Mag. Michael Hammer (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Es geht bei dieser Novellierung um den Angehörigenbonus, das hat ja Kollegin Nussbaum sehr ausführlich ausgeführt. Dieser Angehörigenbonus, der von dieser Bundesregierung entsprechend umgesetzt wurde, ist eine gute Einrichtung.
Es sind auch viele Dinge im Bereich Pflege angesprochen worden. – Ja, wir haben schon viele Schritte mit der Pflegereform umgesetzt und wir haben im Zuge der Budgetverhandlungen auch schon die Gelegenheit gehabt, weitere Schritte bezüglich Pflegefonds, Finanzierung der 24-Stunden-Betreuung, auch die Ausbildung im Pflegebereich betreffend vorzunehmen. Also da werden viele Maßnahmen gesetzt.
Aktuell geht es hier – und das wurde auch angesprochen – um legistische Klarstellungen zu den Meldeangelegenheiten und vor allem auch um die Regelung im Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz, die den Rechtsweg für den Angehörigenbonus umfasst. Warum man dem nicht zustimmen kann, wenn man in einem Gesetz Präzisierungen vornimmt, die gerechtfertigt und notwendig sind, erschließt sich uns nicht. Das ist einfach notwendig – und darum gibt es diese Novellierung. Sie bringt aber keine inhaltlichen Änderungen, sondern dient lediglich einer legistischen Korrektur. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
13.41
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt nun Herr Mag. Christian Ragger. – Bitte, Herr Abgeordneter.
13.41
Abgeordneter Mag. Christian Ragger (FPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzter Herr Minister! Lieber Vorredner! Wir wollen das Thema vielleicht aufgrund unserer Position erörtern. Natürlich finden wir, dass der Pflegebonus ein erster Schritt und eine dementsprechend gute Sache ist, weil er das erste Mal das unterstützt, was sowieso Tenor in Österreich ist, nämlich: dass man zu Hause pflegt. Was aber nicht zusammengeht, ist dieses bonsaimäßige Zurechtrücken des Gesetzes, dieses regelmäßige und immer wieder Nachbessern. Es wird immer wieder novelliert, weil Sie nicht in der Lage sind, ein ordnungsgemäßes Gesetz für den gesamten Pflegebereich zu machen.
Ich möchte Ihnen das an einem Beispiel festmachen: Wenn heute ein älterer Mensch eine Verletzung hat, zum Beispiel einen Oberschenkelhalsbruch, dann kommt er ins Krankenhaus – egal in welches Krankenhaus, von Vorarlberg bis ins Burgenland, er wird spätestens nach drei, maximal vier Tagen entlassen werden. Dann hat er Anspruch auf einen Rehaplatz, der wahrscheinlich erst vier Wochen später zum Tragen kommt. Eine Übergangspflege findet man nicht, weil sie nicht gesetzlich verankert ist und weil die Länder es unterschiedlich handhaben. Daher ist die Voraussetzung heute, dass wir eine kongruente Pflegeentwicklung haben, nämlich der Pflege zu Hause, der mobilen Pflege, der wertvollen Übergangspflege, letztendlich der Ausfluss dessen, was wir als Bundesgesetzgeber machen sollten.
Was wir mit dem Herrn Minister auch schon einmal ventiliert haben, ist, dass es neben der Kommission für die Entwicklung des Gesundheitsbereichs natürlich auch eine Entwicklungsstrategie für den Bereich der Pflege geben muss, nämlich eine Vereinheitlichung von Pflegestandards für Gesamtösterreich. Da bin ich absolut bei Ihnen. Dass das notwendig ist, haben Rechnungshofberichte in Tirol, Salzburg und auch Kärnten gezeigt. Allein die Bezahlung eines Pflegebettes wird 64 Mal hin- und hergeschickt, bis sie endgültig bei einer Person ankommt.
Das sind alles Punkte, die wir kritisieren, daher ist für uns klar gewesen, dass wir dieser Gesetzesvorlage so nicht zustimmen können. – Danke. (Beifall bei der FPÖ.)
13.43
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gemeldet ist nun Frau Abgeordnete Bedrana Ribo. – Bitte schön, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete Bedrana Ribo, MA (Grüne): Herr Präsident! Geschätzter Minister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuseher:innen hier auf der Galerie und natürlich auch zu Hause vor den Bildschirmen! Gleich am Anfang kurz zu Ihren Ausführungen, Kollege Ragger: Sie haben eben von Vereinheitlichungen im Pflegebereich, im Pflegesektor gesprochen. – Ja, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, dass es die braucht, aber dass die nicht zustande kommen, das liegt sicherlich nicht an dem Herrn Bundesminister oder an der Bundesregierung, das liegt ganz klar bei den Ländern, wo eben auch Sie mit Ihrer Partei mit am Tisch sitzen und sich sehr, sehr oft weigern, irgendwelche Vereinheitlichungen mitzutragen.
Wir reden immer wieder von der Verbesserung der Pflegeschlüssel. Wo ist das verankert? Das ist keine Bundeskompetenz, das müssen die Länder machen. Die Länder müssen sich zuerst einmal einigen, damit es zu diesen Vereinheitlichungen kommen kann. Wie gesagt, wir sind die Ersten, die sagen: Ja, ja, sehr gerne. (Beifall bei den Grünen.)
Aber zurück zum Tagesordnungspunkt. Ich werde nicht müde, um von diesem Rednerpult aus immer wieder auf eine Personengruppe, eine wichtige Personengruppe in der Pflege hinzuweisen, und das sind die pflegenden Angehörigen. Sie sind eine wichtige, tragende Säule in der Pflegelandschaft. Sie arbeiten beziehungsweise erbringen ihre Leistungen 24 Stunden am Tag; Tag für Tag, Woche für Woche sind sie für ihre Angehörigen da. Da ist nichts mit
40 Stunden Vollzeit oder wie auch immer, da geht es wie gesagt rund um die Uhr.
Auch im Jahr 2023 sind pflegende Angehörige größtenteils nach wie vor Frauen – Frauen, die dann ihre Arbeit entweder reduzieren müssen oder ganz aufgeben müssen, Frauen, die sich dann um ihre Männer, um die Schwiegereltern, um die Schwiegermütter kümmern müssen. Carearbeit ist also wie gesagt auch in diesem Jahrzehnt, Jahrhundert nach wie vor immer Sache der Frauen. Was diese Frauen dann immer wieder hören, ist: Oh, du Arme, ist es anstrengend? – Ja natürlich ist es anstrengend! Es bringt viele an ihre Grenzen, an die psychischen, an die körperlichen Grenzen. Sie brauchen aber nicht unser Mitleid, sie brauchen konkrete Unterstützungsangebote, und diese konkreten Unterstützungsangebote sind mit den zwei Pflegereformen auch umgesetzt worden. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
So etwa: Erschwerniszulage, Unterstützung bei der Ersatzpflege, finanzielle Unterstützung bei den Kursen, die Angehörigengespräche wurden ausgeweitet, und auch der Angehörigenbonus, um den es heute geht, wurde bereits beschlossen.
Wir haben im Mai noch eine Korrektur ausgearbeitet, weil wir gesagt haben, bei häuslicher Pflege muss es nicht sein, dass man in einem Haushalt lebt, es kann wie so oft eben auch ein anderes Haus sein. Der gemeinsame Haushalt ist also weggefallen. Diese jetzt vorliegende legistische Korrektur ist auch noch vorzunehmen, und ich bitte alle um Zustimmung. Am Inhalt ändert sich wie gesagt nichts. – Danke. (Beifall bei Abgeordneten von Grünen und ÖVP.)
13.47
Präsident Ing. Norbert Hofer: Nächste Rednerin ist Frau Abgeordnete Fiona Fiedler. – Bitte, Frau Abgeordnete.
13.47
Abgeordnete Fiona Fiedler, BEd (NEOS): Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Minister! (Die Begrüßung auch in Gebärdensprache ausführend:) Liebe gehörlose Menschen! Wir sprechen wieder über den Angehörigenbonus, der wieder einmal ausgeweitet wird, wieder einmal werden Fehler korrigiert – und dabei gibt es ihn erst seit eineinhalb Jahren, was für uns ein Zeichen ist, dass er einfach nicht funktioniert.
Es kriegt wieder jemand mehr Geld, was sich aber nicht verändert, ist die Situation in der Pflege. Wir wissen auch nicht, ob es den pflegenden Angehörigen mit diesem vielen Geld tatsächlich besser geht. Das scheint aber in dieser Regierung auch niemanden zu interessieren.
Die zusätzlichen Änderungen in der Pflegekarenz sind gut und auch nachvollziehbar, aber mit dem Angehörigenbonus behalten wir wiederum Anreize, Familien untrainiert Pflegearbeiten zu überlassen. Das ist, Frau Kollegin Ribo, ganz ehrlich, wichtige Arbeit, aber es zeigt auch, dass das System in der Pflege bei uns einfach nicht funktioniert. (Beifall bei den NEOS.)
Ein weiterer Punkt ist auch der, dass 40 Prozent der Pflegegeldbezieher keine Pflegeangebote in Anspruch nehmen, weil eben pflegende Angehörige diese Arbeit zu Hause verrichten. Und allein das ist das Armutszeugnis für die Politik, die in der Pflege einfach nicht aktiv wird – oder aber auch für das System hinter diesem Pflegegeld. Angebot und Nachfrage funktionieren nicht. Das, was passiert, ist, dass die Menschen, die zu pflegen sind, aber auch die Menschen, die pflegen, einfach von dieser Regierung im Stich gelassen werden.
Aber das Motto des nun beschlossenen Budgets ist ja offenbar: Mehr Geld dorthin, dann wird alles besser! Dass mehr Geld dieses Pflegeproblem nicht löst, zeigt ja die Politik der letzten 15 Jahre. Da war auch immer viel Geld mit im Spiel, aber gelöst hat es die Probleme im Bereich Pflege aufgrund der demografischen Veränderungen auch nicht.
Was es braucht, sind echte Veränderungen – echte Veränderungen bei der Pflegeausbildung, bei der Kompetenzverteilung im Gesundheitsbereich und vor allem bei der Prävention, damit wir weniger Pflegearbeit leisten müssen. Das sind Sie uns schuldig, das sind Sie vor allem aber auch der Bevölkerung schuldig. – (Den Dank auch in Gebärdensprache ausführend:) Danke schön. (Beifall bei den NEOS.)
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort ist niemand mehr dazu gemeldet.
Die Frau Berichterstatterin wünscht, glaube ich, kein Schlusswort.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 2283 der Beilagen.
Ich ersuche jene Damen und Herren, die für diesen Gesetzentwurf sind, um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist die Mehrheit.
Wir kommen gleich zur dritten Lesung.
Ich bitte jene Damen und Herren, die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, um ein diesbezügliches Zeichen. – Das ist die Mehrheit. Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung angenommen.
Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 3654/A der Abgeordneten Tanja Graf, Mag. Markus Koza, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Nachtschwerarbeitsgesetz geändert wird (2284 d.B.)
Präsident Ing. Norbert Hofer: Wir kommen zum 18. Punkt der Tagesordnung.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Zu Wort gelangt nun Abgeordneter Mag. Gerald Loacker. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Mag. Gerald Loacker (NEOS): Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Nachtschwerarbeit: Da geht es um besonders belastende Arbeitsplätze, für die die Arbeitgeber einen zusätzlichen Beitrag leisten müssen, weil die Erwerbstätigen, die Nachtschwerarbeit verrichten, früher in Ruhestand gehen können. Um das zu finanzieren, gibt es den Nachtschwerarbeitsbeitrag, der 75 Prozent der Kosten, die durch den früheren Ruhestandsantritt ausgelöst werden, decken sollte. – Tut er aber nicht und tut er schon länger nicht. Es wäre jetzt vorgesehen, dass die Unternehmen einen höheren Beitrag für die Kosten, die sie verursachen, leisten – Verursacherprinzip: Ich habe als Arbeitgeber Mitarbeiter beschäftigt, die Nachtschwerarbeit leisten, also muss ich auch dafür zahlen.
Interessanterweise stehen die Grünen sonst immer auf der Matte, wenn es darum geht, etwas zu machen, das die Unternehmen etwas kostet, aber dort, wo die Kosten wirklich verursachergerecht wären, ziehen sie sich zurück; da hält man den Beitrag niedrig und finanziert diese Kosten aus dem allgemeinen Pensionstopf. Das heißt: Die Beitragszahler und die Steuerzahler sowie die Unternehmen, die keine Nachtschwerarbeit nützen, müssen jetzt die Nachtschwerarbeiter anderer Unternehmen querfinanzieren. – Das ist nicht in Ordnung. Es gehören dort die Kosten gedeckt und dort die Beiträge eingehoben, wo die Probleme entstehen, und nicht an anderer Stelle.
Sie könnten genug andere Beiträge senken: Wir haben eine viel zu teure Arbeitslosenversicherung, wir haben einen Wirtschaftskammerbeitrag samt Kammerumlage 2, den kein Mensch braucht, es gibt x Lohnnebenkosten, die Sie senken könnten, ohne dass Leistung verlorengeht, aber dort, wo es wirklich problematische Arbeitsplätze gibt – in der Nachtschwerarbeit –, heben Sie den Beitrag nicht ein. Das ist unfair gegenüber den anderen Unternehmen, die
gesundheitsschonende Arbeitsplätze anbieten und keine Nachtschwerarbeit haben, denn die müssen das querfinanzieren. Das ist so nicht in Ordnung. (Beifall bei den NEOS.)
13.52
Präsident Ing. Norbert Hofer: Frau Abgeordnete Graf, bevor Sie das Wort ergreifen, habe ich noch ganz kurz etwas bekannt zu geben.
Präsident Ing. Norbert Hofer: Das von mindestens 46 Abgeordneten unterstützte Verlangen 6/US auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses gemäß § 33 Abs. 1 der Geschäftsordnung betreffend „Zwei-Klassen-Verwaltung wegen Bevorzugung von Milliardären durch ÖVP-Regierungsmitglieder (COFAG-Untersuchungsausschuss)“ wurde eingebracht.
Dieses wird gemäß § 33 Abs. 2 der Geschäftsordnung an alle Abgeordneten verteilt.
Ferner liegt das von fünf Abgeordneten gemäß § 33 Abs. 4 der Geschäftsordnung gestellte Verlangen vor, eine Debatte über dieses Verlangen durchzuführen. Diese findet nach Erledigung der Tagesordnung statt.
Die Zuweisung des gegenständlichen Antrages an den Geschäftsordnungsausschuss erfolgt gemäß § 33 Abs. 6 der Geschäftsordnung am Schluss dieser Sitzung.
Das Verlangen hat folgenden Gesamtwortlaut:
Verlangen
auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses
gemäß § 33 Abs 1 2. Satz GOG-NR
der Abgeordneten Krainer, Hafenecker, Kolleginnen und Kollegen
betreffend Zwei-Klassen-Verwaltung wegen Bevorzugung von Milliardären durch ÖVP Regierungsmitglieder (COFAG-Untersuchungsausschuss)
„Alle Staatsbürger sind vor dem Gesetz gleich“, so lautet Art 7 der österreichischen Bundesverfassung. Leider haben wir in der Vergangenheit erfahren müssen, dass dies nicht immer der Fall ist.
Während Milliardäre wie René Benko exklusive Tipps vom Finanzminister bekamen, wie sie noch weniger Steuern zahlen, schauen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie jene von Kika/Leiner durch die Finger. Während Konzerne Millionen an Förderungen von der COFAG erhielten, warten viele Klein- und Mittelbetriebe heute noch auf ihr Geld.
Waren dies Einzelfälle oder besteht hier tatsächlich eine Zwei-Klassen-Verwaltung? Dies soll der Untersuchungsausschuss klären. Er hat endlich auch die Möglichkeit dazu.
Seit dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes zur COFAG besteht erstmals die Möglichkeit, Licht in diese Blackbox zu bringen. Die COFAG, die bis zu 19 Milliarden Euro Steuergeld vergeben hat, muss nun dem Parlament ihre Akten vorlegen. Das haben die Oppositionsparteien schon seit Jahren gefordert – jetzt ist es soweit.
Die Aufklärung duldet keinen Aufschub: Denn kaum etwas ist für die Demokratie gefährlicher als der Eindruck, einige Wenige könnten es sich auf Kosten der Vielen richten. Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler haben ein Recht darauf, zu erfahren, wer ihr Geld erhalten hat. Und das, bevor der Finanzminister die COFAG „abgewickelt“ hat.
Die unterzeichneten Abgeordneten verlangen daher gemäß Art 53 Abs 1 2. Satz B VG sowie § 33 Abs 1 2. Satz GOG NR die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses mit folgendem
Untersuchungsgegenstand
Untersuchungsgegenstand ist die Vollziehung durch Bundesorgane, insbesondere die COVID-Finanzierungsagentur des Bundes (COFAG), in Zusammenhang mit Personen, denen ein Vermögen von zumindest einer Milliarde Euro zugerechnet werden kann und die
- die Österreichische Volkspartei etwa durch Spenden unterstützt haben oder
- um deren Unterstützung von der Österreichischen Volkspartei etwa im Zuge des „Projekt Ballhausplatz“ geworben wurde,
zwischen 18. Dezember 2017 und 23. November 2023 im Hinblick auf deren (mutmaßliche) bevorzugte Behandlung.
Der Untersuchungsausschuss hat folgende Fragen zu klären:
1. Welche Motive haben die Verwaltung bei der COFAG geleitet?
2. Wer hat die Ausgestaltung der COFAG-Förderungen bestimmt?
3. In welchem Ausmaß haben die im Untersuchungsgegenstand genannten Personen von COFAG-Förderungen profitiert?
4. Welche Handlungen in Zusammenhang mit den im Untersuchungsgegenstand genannten Personen wurden von Organen bzw Bediensteten der COFAG oder vom Bundesministerium für Finanzen im Zusammenhang mit der COFAG und diesen Personen gesetzt?
5. Wurde von der COFAG in Zusammenhang mit Förderungen an die im Untersuchungsgegenstand genannten Personen „ein Auge zugedrückt“, insbesondere bei der Rückforderung von Zahlungen in Folge der Insolvenz von Kika/Leiner?
6. In welchem Ausmaß erhielten die im Untersuchungsgegenstand genannten Personen Subventionen aus öffentlichen Mitteln? Dabei insbesondere:
a. Erhielten die im Untersuchungsgegenstand genannten Personen Steuerbegünstigungen oder Steuernachlässe, etwa im Zuge von Abgabenprüfungen?
b. Wurden Projekte von im Untersuchungsgegenstand genannten Personen aus Förderprogrammen des Bundes unterstützt und wenn ja, in welcher Höhe?
c. In welchem Ausmaß arbeiteten Stiftungen und Fonds des Bundes wie der Österreichische Integrationsfonds oder der Österreichische Fonds zur Stärkung und Förderung von Frauen und Mädchen mit den im Untersuchungsgegenstand genannten Personen zusammen?
7. Wurde der Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz gegenüber den im Untersuchungsgegenstand genannten Personen eingehalten? Dabei insbesondere:
a. Erhielten die im Untersuchungsgegenstand genannten Personen privilegierten Zugang zu Organen der Vollziehung und allenfalls sogar besondere (im Sinne zB von beschleunigte) Verfahren für sich oder von ihnen benannte Dritte und aus welchem Grund bzw auf Veranlassung von wem innerhalb der Verwaltung?
b. Intervenierte die politische Führungsebene der Bundesministerien in Verwaltungsverfahren und -abläufe betreffend die im Untersuchungsgegenstand genannten Personen?
c. Wurden Aufsichtsbehörden im Zusammenhang mit den im Untersuchungsgegenstand genannten Personen tätig und mit welchen Ergebnissen?
d. Wurde durch Leitungsorgane im Wege von Weisungen oder informell auf Aufsichts- oder Strafverfahren, von denen die im Untersuchungsgenstand genannten Personen (wenn auch nicht alleine) betroffen waren, eingewirkt und wenn ja, auf welche Art?
e. Ließen sich Amtsträger von im Untersuchungsgegenstand genannten Personen Vorteile anbieten oder haben diese sogar angenommen und was war die gewünschte Gegenleistung im Bereich der Vollziehung?
8. Wurden die im Untersuchungsgegenstand genannten Personen bevorzugt in Regierungstätigkeiten eingebunden? Dabei insbesondere:
a. Welche Informationen wurden den im Untersuchungsgegenstand genannten Personen zur Verfügung gestellt (etwa durch Bestellung in Organe von staatsnahen Unternehmungen) und ermöglichten diese Informationen ihnen den Erhalt oder Ausbau ihres Vermögens?
b. Von welchen Unternehmungen des Bundes wurde mit Unternehmen, die den im Untersuchungsgegenstand genannten Personen zuzurechnen sind, zusammengearbeitet und aus welchen Gründen, insbesondere durch die BIG/ARE und den „Österreich-Fonds“ der ÖBAG?
c. In welchem Ausmaß und aus welchen Gründen wurden Unternehmen, die den im Untersuchungsgegenstand genannten Personen zuzurechnen sind, von Bundesorganen – allenfalls im Wege der Bundesbeschaffung GmbH – beauftragt?
Beweisthemen und inhaltliche Gliederung des Untersuchungsgegenstands
1. COFAG
Aufklärung über das Verhalten der Organe und Bediensteten der COVID-Finanzierungsagentur des Bundes („COFAG“) sowie der diesbzgl zuständigen Personen im Bundesministerium für Finanzen gegenüber den im Untersuchungsgenstand genannten Personen sowie die Gewährung geldwerter Vorteile aus öffentlichen Haushalten in deren Einflussbereich und dabei insbesondere über
- Gewährung von Förderungen bzw Beihilfen an Unternehmen, die den im Untersuchungsgegenstand genannten Personen zuzurechnen sind, oder an deren sonstige (allenfalls gemeinnützige) Projekte;
- Behandlung von Förderansuchen und -anträgen;
- Gewährung von Steuernachlässen, Rabatten und Prämien;
- steuerliche Behandlung von Gewinnausschüttungen an im Untersuchungsgenstand genannte Personen und Schenkungen von Milliardären;
- indirekte Förderungen über (möglicherweise) verbilligte Transaktionen wie etwa von Liegenschaften des Bundes in den Einflussbereich von im Untersuchungsgegenstand genannten Personen oder den Abschluss außergewöhnlicher Vertragsverhältnisse.
2. Informationsweitergabe und Interventionen
Aufklärung über Vorwürfe der unmittelbaren oder mittelbaren Weitergabe interner Verwaltungsinformationen an im Untersuchungsgegenstand genannte Personen sowie Einflussnahme auf Verwaltungsverfahren im Interesse der im Untersuchungsgegenstand genannten Personen, insbesondere über
- Vermittlung von Kontakten zu zuständigen Bediensteten der Verwaltung sowie Sicherstellung einer reibungslosen Behandlung der Anliegen von im Untersuchungsgegenstand genannten Personen;
- die Rolle der Führungsebene der Bundesministerien (Mitglieder der Bundesregierung, allfällige Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, Generalsekretärinnen und Generalsekretäre, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kabinette) in diesen Angelegenheiten;
- Weitergabe von Informationen zu Verwaltungsprojekten sowie Projekten von staatsnahen Unternehmen an im Untersuchungsgegenstand genannte Personen;
- Einladungen zu (auch informellen) Gesprächsrunden etwa im Zuge von „Think Austria“ oder Wirtschaftsgesprächen sowie Bestellung in Organe von staatsnahen Unternehmen;
- mögliche Gegenleistungen für Amtsgeschäfte;
- Haftungsübernahmen auf Grund des Ausfuhrförderungs- bzw des Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetzes;
- Informationseinholung, Weitergabe von Wünschen oder sonstige Einflussnahme auf Verwaltungsverfahren betreffend im Untersuchungsgegenstand genannte Personen oder deren Unternehmen, insbesondere in den Abgabenverfahren Benko und Wolf;
- Ausmaß und Inhalt der Beauftragungen von Unternehmen, die den im Untersuchungsgegenstand genannten Personen zuzurechnen sind;
- Informelle Unterstützung bei der Geschäftstätigkeit von im Untersuchungsgegenstand genannten Personen etwa durch Kontaktaufnahme mit Organen anderer Staaten, Wirtschaftsdelegationen oder Vermittlung zwischen möglichen Geschäftspartnerinnen und -partnern wie etwa beim Verkauf der Anteile von Kika/Leiner an René Benko.
3. Kooperationen staatsnaher Unternehmen
Aufklärung über Kooperationen, Joint Ventures, gemeinsame Beteiligungen und/oder Syndizierungen zwischen staatlichen und staatsnahen Unternehmen und im Untersuchungsgegenstand genannten Personen bzw den ihnen zurechenbaren Unternehmen, insbesondere über
- Weitergabe von geschäftlichen Informationen oder Einräumung von Zugang zu Informationen, allenfalls auch Pläne für Privatisierungen;
- Verfahren zur Bestellung von Organen sowie Gremien wie etwa dem Investment Committee der ÖBAG;
- Wünsche, Interventionen oder Weisungen durch die Eigentümervertretung in diesem Sinne;
- Miet-, Pacht- und sonstige Bestandsverträge sowie die Einräumung von Rechten auf Liegenschaften, insbesondere die Verträge der Bundesimmobiliengesellschaft mit der Signa Group;
- Ausgestaltung der Entwicklungsprojekte der ARE samt Tochterunternehmen in Kooperation insbesondere mit der Signa Group.
4. Staatliche Aufsicht
Aufklärung über die Bemühungen von Behörden bei der staatlichen Aufsicht und der Führung von Strafverfahren jeglicher Art in Zusammenhang mit den Handlungen oder dem Vermögen von im Untersuchungsgegenstand genannten Personen einschließlich von Finanzstrafverfahren, nicht jedoch Verwaltungsstrafverfahren in Zuständigkeit der Gemeinden, Bezirksverwaltungsbehörden oder Landeshauptleute, aber insbesondere über
- Beeinflussung solcher Verfahren;
- Ordnungsgemäßes Führen solcher Verfahren;
- Erteilung von Weisungen, formlosen Bitten, Aufträgen, Mitteilen von Rechtsansichten oder anderen Wünschen samt Informationsersuchen durch die Bundesministerinnen bzw Bundesminister, deren Kabinette oder Generalsekretärinnen bzw Generalsekretäre sowie Sektionsleitungen (insbesondere Eduard Müller und Christian Pilnacek);
- die Erfüllung der dem Umweltbundesamt im Umweltkontrollgesetz übertragenen Aufgaben gegenüber Unternehmen, die den im Untersuchungsgegenstand genannten Personen zuzurechnen sind;
- die Behandlung von Geldwäscheverdachtsmeldungen sowie der Vollziehung des Sanktionengesetzes in Zusammenhang mit dem Vermögen von im Untersuchungsgegenstand genannten Personen;
- Wahrnehmung der Anzeigepflicht beim Verdacht auf strafbare Handlungen;
- Aufsicht über Finanzgeschäfte in Zusammenhang mit im Untersuchungsgegenstand genannten Personen einschließlich von Kreditvergaben;
- Fusionskontrolle und Tätigkeiten der Kartellbehörden;
- Überprüfung von Kontobewegungen und Auslandsvermögen von im Untersuchungsgegenstand genannten Personen einschließlich von Zahlungsflüssen aus dem Einflussbereich von Milliardären an PEPs.
BEGRÜNDUNG
Untersuchungsziele:
Der Untersuchungsausschuss hat die dem Untersuchungsgegenstand beigefügten Fragestellungen für den Nationalrat zu beantworten. Der Untersuchungsausschuss soll so dazu beitragen, dass der Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz tatsächlich durchgesetzt werden kann. Zu diesem Zweck wird die Untersuchung auf eine Zahl von weniger als 100 Personen eingeschränkt und lediglich auf bestimmte Vollziehungsbereiche und -organe bezogen. Der Untersuchungsgegenstand wird daher kompakter und fokussierter gefasst als dies rechtlich notwendig wäre.
Zu den untersuchungsauslösenden Sachverhalten:
Die schwarz-grüne Koalition hat sich 2020 trotz Warnungen für die COFAG als Modell zur Abwicklung der Corona-Hilfen entschieden. Die Koalition hat die COFAG bewusst als Blackbox ohne parlamentarische Kontrolle konstruiert, was nunmehr vom Verfassungsgerichtshof für rechtswidrig erklärt wurde. Gleichzeitig kritisierte der Rechnungshof in seinem Prüfbericht zur COFAG massiv die mangelnde Dokumentation seitens der Ministerien über Grundsatzentscheidungen und gleichermaßen die
mangelnde Dokumentation von Vorgängen in der Geschäftsführung der COFAG und ortete „beträchtliches Überförderungspotenzial“.
Für eine Gruppe an Menschen erwies sich die COFAG jedenfalls als wahre Goldgrube: Die Kosten für externe Dienstleisterinnen und Dienstleister lagen bereits im Juni 2021 über 20 Mio. Euro, wie aus dem Bericht des Rechnungshofes hervorgeht. Lukrativ war die COFAG auch für ihre Geschäftsführer, insbesondere den früheren Kollegen von Thomas Schmid im ÖVP-Kabinett DI Bernhard Perner.

Dennoch lässt sich die Vergangenheit nicht ungeschehen machen: Die COFAG verteilte ohne die nötige Transparenz Milliarden an Steuergeldern. Von der Auszahlungskonstruktion der COFAG profitierten zudem vor allem große Unternehmen. EPU und KMU wurden im Stich gelassen und viele stehen mittlerweile vor den Trümmern ihrer Existenz. Einer Existenz, die sie sich oft über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut haben.
Über die COFAG als Tochter der ABBAG wickelte der Bund Wirtschaftsförderungen in der Höhe von bis zu 19 Mrd. Euro ab, wobei der Auszahlungsstand per Juli 2023 15,3 Mrd. Euro betrug:
Über die Empfängerinnen und Empfänger der COFAG-Förderungen wurde wenig bekanntgegeben. Jedoch musste ein Teil der ausbezahlten Corona-Hilfsgelder in die EU-Beihilfentransparenzdatenbank eingemeldet werden. Dies sind bislang die einzigen verfügbaren Angaben zum Umfang der COFAG-Zahlungen. Die Art und Weise der Auszahlung sowie der Förderungs-Wildwuchs führten dazu, dass viele Unternehmen keine oder nur geringe Förderungen erhielten und einige wenige Unternehmen in der Corona-Krise das Geschäft ihres Lebens machen konnten und zudem großzügig gefördert wurden.
Hier zeigt sich ein Problem der österreichischen Corona-Hilfen: Ein Wildwuchs an Förderungen aus Fixkostenzuschuss, Umsatzersatz I und II, Härtefallfonds und Kurzarbeit hat dazu geführt, dass einzelne Betriebe massiv überfördert werden. 2020 haben sich die Staatsgelder für Unternehmen auf 15,1 Mio. verdreifacht, 2021 stiegen sie noch einmal auf 16 Milliarden Euro an. 2022 gingen die Subventionen für Unternehmen zwar zurück, bleiben aber trotzdem mit 8,5 Milliarden ausgesprochen hoch.
So hat etwa René Benko für seine Firmen Staatshilfen in der Höhe von 10,2 Millionen Euro erhalten. Benko verfügt über ein geschätztes Vermögen von 4,9 Milliarden Euro
und es ging ihm auch in den Krisenjahren prächtig. Er zahlte sich mit seiner Signa-Gruppe eine Dividende von 100 Millionen Euro aus und kaufte sich einen Gutshof um 30 Millionen Euro. Benko schickte die MitarbeiterInnen der Kika/Leiner-Gruppe 2020 für sieben Wochen in Kurzarbeit und beantragte zusätzlich Steuergeld – für seine Kika/Leiner-Gruppe 9,2 Millionen, für die Signa Luxury Collection eine Million. Zum Vergleich: Das etwa doppelt so große Möbelhaus XXXLutz bekam „nur“ eine Mio. Euro. Und das alles nur, damit René Benko Kika/Leiner am Ende doch in die Insolvenz schickt und die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Job verlieren.
Stefan Pierers KTM hat insgesamt 11 Mio. Euro an staatlichen Hilfen – in Form von Kurzarbeitsgeldern – in Anspruch genommen. Zusätzlich wurde ein Sonderkreditrahmen von 60 Mio. Euro bei der Österreichischen Kontrollbank beantragt. An das Dividendenverbot wollte man sich zunächst nicht halten. Nur auf Grund eines massiven öffentlichen Drucks ließ man von diesen Plänen ab bzw verschob man die Auszahlung der Gewinne um ein Jahr. Diese Gewinne von KTM waren jedenfalls enorm – und wurden durch Wirtschaftshilfen, also Geld von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, noch aufgefettet und subventioniert. KTM zahlte im Jahr 2020 18,59 Mio. Euro an Dividenden aus, 2021 rund 35 Mio. und 2022 gar 66,6 Mio. Euro!
Die Vorgänge in der COFAG sind aber leider nur ein Mosaik-Stein im Gesamtbild der von der ÖVP geschaffenen Zwei-Klassen-Verwaltung:
Der ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss des Nationalrates hat zwischen Dezember 2021 und April 2023 nicht nur untersucht, wie die ÖVP staatliche Institutionen für ihre Parteipolitik missbraucht, sondern dem Nationalrat auch einen Einblick in eine andere Problemstellung ermöglicht, deren Ausmaß bis dahin lediglich vermutet, aber nicht bestätigt worden war. Durch die Aussagen von Thomas Schmid vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wurden Fälle bekannt, wie Superreiche direkt bei ÖVP-Vertreterinnen und -Vertretern im Bundeskanzleramt und im Finanzministerium in ihren eigenen Angelegenheiten intervenierten und schlussendlich tatkräftige Hilfe von der Leitungsebene des Ressorts erhielten – oft gegen die Ansichten der nachgeordneten Dienststellen.
Das erste Beispiel sind die Geschehnisse rund um einen Steuernachlass für Siegfried Wolf in Millionenhöhe. Wolf soll zwischen 2006 und 2011 seine Einnahmen nicht vorschriftsgemäß versteuert haben und ihm drohte eine saftige Nachzahlung von rund 11 Millionen Euro. Die folgenden Geschehnisse zeigten eine neue Dimension des Einsatzes der ÖVP für ihre Freunde auf. Die WKStA berichtete von einer intensiven Zusammenarbeit zwischen dem Kabinett im Finanzministerium einerseits und den Steuerberatern Wolfs andererseits sowie von intensiven internen Interventionen. Diese bestanden aus einigen Serviceleistungen an Wolfs Steuerberatern, da sie nicht nur tiefe Einblicke in die interne Willensbildung der Finanzverwaltung bekommen haben sollen, sondern auch mit Tipps versorgt worden sind, mit welcher Vorgehensweise der Steuerbetrag am geringsten ausfallen könnte.
Nachdem sich die Steuerprüfung Wolfs im Jahr 2016 mit der Feststellung einer Nachzahlung von 11 Millionen Euro dem Ende zuneigte, wandte sich Wolf, auf Empfehlung Wolfgang Schüssels, an den damaligen Generalsekretär im Finanzministerium Thomas Schmid. Dieser musste aber feststellen, dass auch der zuständige Sektionschef im Finanzministerium das Ergebnis als korrekt einstufte. Im Kabinett des damaligen Finanzministers Schelling war man sich einig, alles dafür zu tun, die Steuerlast von 11 auf 7 Millionen Euro zu senken. Sogleich schloss man sich der für Wolf günstigeren Meinung der zuständigen Finanzamtschefin Helga K. an. Wolf und sie kannten sich bereits aus seinem Golfclub Fontana. Nach intensiven Interventionen durch das Kabinett, über 30 Terminen auf Ministerebene, 350 Nachrichten Thomas Schmids und verschiedensten Tricks, wie der Verschiebung von Terminen, um unliebsame Beamte bzw Beamtinnen ausladen zu können, drohte die Großbetriebsprüfung sogar mit dem Einschalten der Staatsanwaltschaft, was schlussendlich auch geschah und nunmehr zu entsprechenden Ermittlungen geführt hat.
Schließlich gelang es Wolf mit Unterstützung der Kabinette der Bundesminister Schelling, später Löger und Müller im Finanzministerium auch tatsächlich, seine Steuerlast zu mindern. Ein Vorgehen, das fortgeführt wurde, denn Wolf wollte auch nach dem üppigen Nachlass die drohenden Strafzinsen nicht zahlen. Besonders für
den Nachlass hat sich Finanzamtsvorständin Helga K. eingesetzt. Dafür bekam sie mutmaßlich einen Spitzenposten im Finanzamt Baden.
Das zweite Beispiel betrifft das Steuerverfahren von René Benkos Signa Holding: Thomas Schmid räumte schließlich in seinem umfassenden Geständnis vor der WKStA eine Intervention im Steuerverfahren ein. Als Gegenleistung sollte Schmid dafür einen hochbezahlten Job mit 300.000 Euro Jahresgehalt, einer Bonuszahlung von weiteren 300.000 Euro und einen Dienstwagen bei Benkos Signa-Gruppe erhalten. Bereits im Oktober 2017 habe es einen diesbezüglichen Vertragsentwurf gegeben.
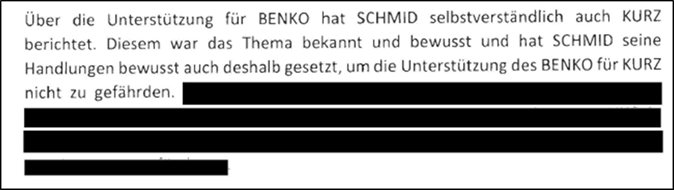

Die Steuerprüfung bei Benko lief bereits einige Jahre – eine komplexe Prüfung rund um internationale Immobilienkäufe, seinen Privatjet, diverse Luxusimmobilien, einen Weinkeller in Innsbruck, sogar Munition und Waffen etc. Für nichts davon wollte Benko Steuern bezahlen. Schlimmer noch, er wollte sich sogar allerlei Luxus-Ausgaben von der Steuer absetzen lassen. Das Finanzamt Wien hatte sich davon nicht beeindrucken lassen und eine Steuerschuld von 50 Millionen Euro berechnet. Zu viel, wie Benko fand, wollte er doch nur 35 Millionen zahlen. Da das Finanzamt in Wien nicht verhandeln wollte, wurde kurzerhand der Unternehmenssitz der Signa und damit die Zuständigkeit des Finanzamtes von Wien nach Innsbruck verlegt.
Rund um diese Übersiedlung wurde außerordentlich viel telefoniert und gechattet, mit dabei Eduard Müller und natürlich Thomas Schmid. Er versicherte Benko immer, dass er an seiner Sache arbeite: „Lieber Rene, in deiner Sache ist alles auf Schiene!“ Der Fachvorstand des vormals zuständigen Finanzamts in Wien, Werner Löffler, hielt hierzu in den Akten fest: „Der Grund für den aus unserer Sicht überstürzten Abzug aus Wien, noch dazu während einigen offenen Prüfungsverfahren, können wir nicht nachvollziehen, nur vermuten.“
Schließlich wurde nach einer Stellungnahme des Steuerberaters von Benko und einem Telefonat mit Eduard Müller die Zuständigkeit Innsbrucks festgestellt. Nur Tage später erging der gewünschte Steuerbescheid in der Höhe von 36 Millionen Euro.
Der Vorwurf wurde durch die Wahrnehmungen zweier Beamten gestützt: Finanzprüfer Roland Macho berichtete von einem Termin mit Schmid, bei dem er ihm Rene Benko – „den besten Unternehmer Österreichs“ – vorstellte. Der Generalsekretär des Finanzministeriums lud zu einem Termin mit dem Steuerprüfer und dem Abgabenschuldner Benko, damit dieser seine Wünsche äußern konnte. „Mein Chef [Thomas Schmid] hat mich öfters verdonnert und hat gesagt: Jetzt kommt der Herr Sowieso, das musst durchhalten, dafür wirst bezahlt!“ Der Beamte höre zwar oft die Geschichten von Unternehmern, aber dass der Generalsekretär ihn persönlich angerufen und ins Ministerium eingeladen habe, das sei schon besonders gewesen. Auch der längstdienende Sektionschef im Finanzministerium, für die Sektion Steuerpolitik und -recht musste für derartige Treffen herhalten. Er hat von Schmid den Auftrag bekommen, gemeinsam mit ihm und René Benko Essen zu gehen.
Mitgeholfen hat bei den Steuercausen der Reichen wieder einmal Eduard Müller. Er war bei den Treffen mit Benko und Schmid, telefonierte mit den Finanzbeamten und unterhielt den Kontakt mit Steuerberatern. Schmid selbst hat sich in die Details nicht eingebracht, dafür hatte er Müller eingeschaltet. Müller hatte seinen Auftrag verstanden und erledigt, gestand Schmid bei seiner Beschuldigtenvernehmung. Müller ist nun einer der beiden Vorstände der Finanzmarktaufsicht und dort ua für die Aufsicht über Kreditvergaben zB an die Signa verantwortlich.
Das dritte Beispiel betrifft den ÖVP-Großspender und Milliardär Stefan Pierer: Pierer soll 2013 vor dem Inkrafttreten des Steuerabkommens mit Liechtenstein 20 Millionen Euro aus dem Fürstentum nach Österreich transferiert haben, um Steuern in Höhe von 6 bis 7 Millionen Euro zu sparen.
Der Fall wurde 2017 publik, als der SPÖ-Abgeordnete Jan Krainer in einer parlamentarischen Anfrage nach der sogenannten „Abschleicherliste“ fragte. Auf dieser Liste standen Personen und Unternehmen, die Kapital aus und nach Österreich transferiert haben – oftmals um Steuerpflichten zu vermeiden.
Der damalige Finanzminister Hans-Jörg Schelling wurde sofort aktiv. Doch nicht etwa, um den mutmaßlichen Steuerbetrug aufzuklären, sondern um herauszufinden, woher die SPÖ ihre Informationen hatte. Das Finanzministerium leitete exzessive Überwachungsmaßnahmen gegenüber seinen eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein und die zuständigen Bediensteten wurden auf Druck des damaligen Sektionschefs (und späteren Ministers) Eduard Müller angezeigt.
Diese drei Beispiele sind möglicherweise nur die Spitze eines weitaus größeren Eisbergs, von dem bislang wenig bekannt ist. Einiges wurde in verworrenen Chats von Thomas Schmid zwar angedeutet, konnte bislang aber nicht weiterverfolgt werden. Die genannten Fälle sind lediglich auf Grund des Geständnisses von Thomas Schmid in diesem Ausmaß öffentlich bekannt. Die nunmehrige Untersuchung soll an diesem Punkt anschließen und das Ausmaß der Bevorzugung von Superreichen durch die va von der ÖVP politisch geführten Bundesvollziehung erhellen.
Zum bestimmten Vorgang:
Mit der Möglichkeit, Untersuchungsausschüsse einzusetzen, wird dem Nationalrat ein Instrument der politischen Kontrolle eröffnet (Kahl, Art 52b B-VG, in: Korinek/Holoubek et al [Hrsg], Bundesverfassungsrecht, 7. Lfg 2005, 4). Die Befugnisse, die dem Untersuchungsausschuss durch das Bundes-Verfassungsgesetz übertragen werden, sollen eine wirksame parlamentarische Kontrolle durch den Nationalrat ermöglichen. Da mit Art 53 Abs 1 B-VG einem Viertel der Mitglieder des Nationalrates ein
Minderheitsrecht eingeräumt wurde (siehe AB 439 BlgNR XXV. GP, 2), kommt der verlangenden Minderheit – im Sinne der wirksamen Ausgestaltung dieses Rechtes – grundsätzlich auch das Recht zu, das zu untersuchende Thema frei zu bestimmen, in das gegen ihren Willen nicht eingegriffen werden darf (VfSlg 20370/2020, 167).
Die Autonomie der Einsetzungsminderheit ist demokratiepolitisch geboten. Denn Untersuchungsverfahren haben in der parlamentarischen Demokratie eine wichtige Aufgabe zu erfüllen (vgl Kahl, aaO, 6; Neisser, Art 53 B-VG, in: Kneihs/Lienbacher [Hrsg], Rill-Schäffer-Kommentar Bundesverfassungsrecht, 17. Lfg 2016, 20). Durch sie erhält der Nationalrat die Möglichkeit, unabhängig von Regierung, Behörden und Gerichten mit hoheitlichen Mitteln selbständig die Sachverhalte zu prüfen, die er in Erfüllung seines verfassungsgesetzlichen Auftrags zur Kontrolle der Vollziehung für aufklärungsbedürftig hält. Art 53 Abs 3 B VG räumt dem Untersuchungsausschuss daher ein die Legislative einseitig begünstigendes Recht zur Selbstinformation ein (vgl AB 439 BlgNR XXV. GP, 5).
In der Sicherstellung der Wirksamkeit dieses Kontrollinstruments liegt die verfassungsrechtliche Bedeutung des Minderheitsrechts. Denn das ursprüngliche Spannungsverhältnis zwischen Parlament und Regierung, wie es in der konstitutionellen Monarchie bestand, hat sich in der parlamentarischen Demokratie, deren Parlamentsmehrheit regelmäßig die Regierung trägt, gewandelt. Es wird nun vornehmlich geprägt durch das politische Spannungsverhältnis zwischen der Regierung und den sie tragenden Parlamentsparteien einerseits und der Opposition andererseits. Im parlamentarischen Regierungssystem überwacht daher in erster Linie nicht die Mehrheit die Regierung, da die Regierung ja von gerade dieser Mehrheit getragen wird (vgl Öhlinger, Die Bedeutung von Untersuchungsausschüssen als besonderes Instrument parlamentarischer Kontrolle, in Bußjäger [Hrsg], Die Zukunft der parlamentarischen Kontrolle, 2008, 108f; Neisser, aaO, 20f). Diese Aufgabe wird vorwiegend von der Opposition – und damit in der Regel von einer Minderheit – wahrgenommen. Das durch die Verfassung garantierte Recht der Minderheit auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses darf – soll vor diesem Hintergrund die
parlamentarische Kontrolle ihren Sinn noch erfüllen können – nicht angetastet werden.
Der Verfassungsgerichtshof hat in diesem Sinne bereits ausgesprochen, dass der Wahl des Anliegens der Untersuchung zunächst keine Grenzen gesetzt sind. Es ist allein der politischen Wertung von Abgeordneten des Nationalrates anheimgestellt, welches Anliegen der politischen Kontrolle durch einen Untersuchungsausschuss zugeführt werden soll. Es bedarf weder eines Verdachts noch eines Anlasses (VfSlg 20370/2020, 167).
Ein Verlangen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses kann jedoch nur dann zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses führen, wenn der Vorgang, der untersucht werden soll, den Anforderungen des Art 53 Abs 2 B-VG entspricht, es sich also um einen bestimmten, abgeschlossenen Vorgang im Bereich der Vollziehung des Bundes handelt. Soweit ein Verlangen rechtmäßig ist, muss diesem umgekehrt aber auch entsprochen werden.
Vor dem Hintergrund, dass der Verfassungsgesetzgeber bei der Beschlussfassung über Art 53 Abs 2 B-VG und insbesondere über die Verwendung des Begriffes „bestimmter […] Vorgang“ das „etablierte parlamentarische Konzept“ (so Konrath/Neugebauer/Posnik, Das neue Untersuchungsausschussverfahren im Nationalrat, JRP 2015, 216 [218]) aus Art 52b B VG und § 99 Abs 2 GOG-NR – der in Ausführung von Art 126b Abs 4 B-VG ergangen ist – vor Augen hatte (AB 439 BlgNR XXV. GP, 3; der Begriff wird in der Praxis weit ausgelegt [vgl dazu Konrath/Neugebauer/Posnik, aaO, 218; Kahl, aaO, 4; Zögernitz, Nationalrat-Geschäftsordnung4, 2020, 622]), sind keine zu strengen Anforderungen an die Bestimmtheit des Gegenstandes der Untersuchung (Art 53 Abs 2 B VG) zu stellen (VfSlg 20370/2020, 171).
Für ein vermindertes Bestimmtheitserfordernis spricht auch, dass zum Zeitpunkt der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses das Tatsachenmaterial, um dessen Ermittlung es gerade gehen soll, häufig noch sehr lückenhaft sein wird. Würde verlangt, dass in einem Verlangen der zu untersuchende Vorgang exakt benannt werden muss, würde politische Kontrolle, die in der Praxis oft nur von Vermutungen ausgehen
kann, unterlaufen (vgl Konrath/Posnik, Art 53 BVG, in: Kahl/Khakzadeh/Schmid [Hrsg] Bundesverfassungsrecht, 2021, 11). Denn gerade im Fall politischer Kontrolle setzt die Notwendigkeit, etwas erst aufzuklären, denklogisch ein hohes Maß an vorausgehender Unbestimmtheit voraus, da dem Nationalrat abseits des Untersuchungsrechts des Art 53 B-VG kein Recht zur Selbstinformation zusteht, das ggf. auch mit hoheitlichen Mitteln durchgesetzt werden kann. Es wäre in diesem Sinne verfehlt, in einem Einsetzungsverlangen eine Bestimmtheit des zu untersuchenden Vorgangs zu verlangen, die auch nur annähernd jenem Grad entspricht, der gerade erst durch die Untersuchung hervorgebracht werden kann. Die Erfüllung einer solchen Voraussetzung wäre in jedem Fall unmöglich. Insbesondere ist es Wesensmerkmal einer Untersuchung, dass die ihr zu Grunde liegenden Annahmen im Zuge der Untersuchung auch noch widerlegt werden können. Der Rechnungshof hat auf gleichartige Weise darauf hingewiesen, dass von ihm nicht verlangt werden kann, die erst im Rahmen seiner Prüfung erkundbaren Umstände bereits im Vorhinein darzulegen (vgl VfGH 11.12.2018, KR1/2018 ua). Aus diesen Gründen muss es dem Nationalrat unbenommen bleiben, den Untersuchungsgegenstand umfassender zu formulieren.
Das Bestimmtheitserfordernis kann auch nicht so weit reichen, dass ein Verlangen nur Rechtsbegriffe enthalten darf. Im Hinblick auf den weiten Vollziehungsbegriff des Art 53 B-VG sowie den politischen Charakter der Untersuchung ist für die Bestimmtheit allein die Eignung der verwendeten Begriffe maßgebend, den Untersuchungsgegenstand in einer Weise zu umschreiben, dass sich jedenfalls anhand einer Auslegung ein eindeutiges Ergebnis gewinnen lässt. In diesem Sinne erläutern die Materialien (AB 439 BlgNR XXV. GP, 4) den Begriff des bestimmten Vorgangs als lediglich „bestimmbare[n] und abgrenzbare[n] Vorgang“ in der Vollziehung des Bundes. Die Untersuchung könne – so die Materialien weiter – „mithin nur inhaltlich zusammenhängende Sachverhalte“ betreffen. Das Wort „ein“ werde als „unbestimmter Artikel und nicht als Zahlwort verwendet“. Die „Forderung eines inhaltlichen, personellen oder zeitlichen Zusammenhangs“ (Hervorhebung nicht im Original) schließe aus, „dass mehrere, unterschiedliche Vorgänge oder Themen in einem Untersuchungsausschuss untersucht werden, die nur lose miteinander verknüpft sind, etwa weil es sich um
Vorgänge innerhalb des Zuständigkeitsbereiches eines Bundesministeriums“ handle. „Die Bestimmbarkeit und Abgrenzbarkeit eines Vorgangs“ schließe nicht aus, „dass Untersuchungsgegenstand und Untersuchungsauftrag eine Untergliederung in einzelne Abschnitte bzw Beweisthemen aufweisen, zumal ein Vollzugsakt auch in einzelne Phasen zerlegt werden“ könne. Dazu sieht § 1 Abs 5 VO-UA vor, dass eine inhaltliche Gliederung des Gegenstandes der Untersuchung nach Beweisthemen zulässig, eine Sammlung nicht direkt zusammenhängender Themenbereiche hingegen unzulässig ist. Lediglich „verschiedene, nicht zusammenhängende Vorgänge“, die sich „über einen größeren und jeweils unterschiedlichen Zeitraum erstrecken, und die im Verantwortungsbereich mehrerer Bundesministerien verortet wurden“ (Hervorhebung nicht im Original), dürfen nicht Gegenstand eines Untersuchungsausschusses sein, da sie nicht direkt zusammenhängen.
Würden die Anforderungen an die Formulierung des Untersuchungsgegenstandes doch eng gezogen, wäre es auf Grund des unsicheren Tatsachenmaterials und der damit verbundenen Notwendigkeit einer Prognoseentscheidung über die festzustellenden Tatsachen außerdem erforderlich, dass der Geschäftsordnungsausschuss oder in weiterer Folge der Verfassungsgerichtshof anstelle der Einsetzungsminderheit eine politische Wertungsentscheidung über das Bestehen eines inhaltlichen Zusammenhangs trifft. Eine solche Wertung wäre jedoch im Sinne der Wirksamkeit der politischen Kontrolle verfassungsrechtlich gerade unzulässig (vgl VfSlg 20370/2020, 201). Ein „Vorgang“ soll inhaltlich zusammenhängende Sachverhalte umschreiben und ausdrücklich nicht auf einen einzelnen Vorgang beschränkt sein. Das Vorliegen eines ausreichenden inhaltlichen Zusammenhangs bleibt insofern eine Wertungsfrage (vgl Konrath/Posnik, aaO, 11). Angesichts dessen, dass das Bundes-Verfassungsgesetz durch Einräumung besonderer Rechte, die auch einer qualifizierten Minderheit zustehen, dem Nationalrat eine wirksame Kontrolle der Vollziehung ermöglichen will und der besondere Charakter politischer Kontrolle zwangsläufig von unterschiedlichen Wertungen geprägt ist, hat sich der Geschäftsordnungsausschuss bzw in weiterer Folge der Verfassungsgerichtshof zurückzuhalten und die Prüfung des inhaltlichen
Zusammenhangs lediglich auf die Nachvollziehbarkeit der im Verlangen vorgebrachten Argumente zu beschränken.
Im Hinblick darauf, dass ein Minderheitsverlangen der Überprüfung durch den Geschäftsordnungsausschuss unterzogen wird und dessen (dieses Verlangen für ganz oder teilweise unzulässig erklärender) Beschluss im Rahmen eines Verfahrens gemäß Art 138b Abs 1 Z 1 B-VG vom Verfassungsgerichtshof überprüft werden kann sowie die verlangenden Abgeordneten die Einhaltung der verfassungsgesetzlichen Voraussetzungen bereits gegenüber dem Geschäftsordnungsausschuss darzulegen haben (vgl VfSlg 20370/2020, 173), ist dem Verfassungsgerichtshof daher zuzustimmen, wenn er keine zu strengen Anforderungen an die Bestimmtheit des Gegenstands stellt (VfSlg 20370/2020, 171): Denn ansonsten würde die Arbeit parlamentarischer Untersuchungsausschüsse (Aufdeckung vielleicht doch bestehender Zusammenhänge) auf den Geschäftsordnungsausschuss bzw den Verfassungsgerichtshof verlagert. Gerade weil den verlangenden Abgeordneten eine nähere Kenntnis der erst zu untersuchenden Zusammenhänge im Vorhinein nicht möglich ist, kann es auch nicht Aufgabe des Geschäftsordnungsausschusses bzw des Verfassungsgerichtshofes sein, erst im Zuge der Untersuchung mit den besonderen Möglichkeiten eines Untersuchungsausschusses festzustellende Zusammenhänge – gleichsam stellvertretend – zu präzisieren (vgl dazu auch VfGH 10.6.2016, G70/2016 mwN sowie VfSlg 20213/2017). Ein Maß an Bestimmtheit, das den von der Untersuchung Betroffenen im Vorhinein ermöglicht, den Umfang der Untersuchung festzustellen, muss daher den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügen (vgl Konrath/Posnik, aaO, 11).
In diesem Sinne finden sich auch in der deutschen Rechtsprechung, die das Bestimmtheitsgebot gleichermaßen kennt und es für Untersuchungsausschüsse unmittelbar aus dem Rechtstaatsprinzip des Grundgesetzes ableitet, nur vereinzelt auf Ebene der deutschen Bundesländer Beispiele für die Verfassungswidrigkeit eines Untersuchungsgegenstandes. In jenen Fällen, in denen die Verfassungskonformität verneint wurde, handelte es sich – abseits von Formalmängeln – durchwegs um offenkundige Verstöße, die zu einer begleitenden Kontrolle der Vollziehung bzw zu einer
Selbstermächtigung des jeweiligen Untersuchungsausschusses geführt hätten. Hingegen wurden auch sehr umfassende Untersuchungsgegenstände höchstgerichtlich akzeptiert, wie etwa jener, der die mutmaßliche Vernetzung von Regierungsmitgliedern mit der „organisierten Kriminalität“ über einen Zeitraum von 18 Jahren zum Gegenstand der Untersuchung erhob (vgl VerfGH Sachsen, 29.08.2008, 154-I-07). Zum Teil wird im Interesse des Schutzes der Rechte der Einsetzungsminderheit sogar eine Vermutung der rechtlichen Zulässigkeit eines Einsetzungsantrags judiziert (vgl BayVerfGH NVwZ 1995, 681 [682]).
Aus all dem ergibt sich, dass der den Bestimmungen des Art 52b B-VG und § 99 Abs 2 GOG-NR entliehene und Art 53 B-VG zu Grunde liegende Begriff des „bestimmten Vorganges“ lediglich eine sachliche Einschränkung der jeweils von der Minderheit verlangten Untersuchung (vgl Zögernitz, Nationalrat-Geschäftsordnung4, 2020, 622) in dem Sinne bewirkt, dass der zu untersuchende Vorgang konkret und abgegrenzt sein muss (vgl Kahl, aaO, 4; vgl auch Hengstschläger, Rechnungshofkontrolle – Kommentar zum fünften Hauptstück des B-VG "Rechnungs- und Gebarungskontrolle", 2000, 211; Scholz, Zum zulässigen Gegenstand parlamentarischer Untersuchungsausschüsse, JRP 2015, 232 [239]).
Hengstschläger/Janko gehen davon aus, dass überhaupt nur solche Prüfaufträge, die „weder ein konkretes Kontrollobjekt noch einen bestimmten Gebarungszeitraum bezeichnen“ die Anforderung eines „bestimmten Vorgangs“ nicht erfüllen (Hengstschläger/Janko, Der Rechnungshof – Organ des Nationalrates oder Instrument der Opposition? in: Österreichische Parlamentarische Gesellschaft [Hrsg.], 75 Jahre Bundesverfassung [1995], 460). Der Verfassungsgerichtshof hat in vergleichbaren Verfahren gemäß Art 126a B VG ausgesprochen, dass der Prüfungsgegenstand des Rechnungshofes entweder durch sachliche oder zeitliche Eingrenzung ausreichend bestimmt werden kann. Bloße Bestimmbarkeit genügt (VfGH 30.11.2017, KR1/2017 sowie VfGH 11.12.2018, KR1/2018 ua; vgl Schrefler-König/Loretto, VO-UA [2020], 379).
Auch die parlamentarische Praxis der Prüfbeschlüsse gemäß § 52b B-VG bzw § 99 Abs 2 GOG-NR, die der Verfassungsgesetzgeber dem Begriff des „bestimmten
Vorgangs“ anlässlich der Beschlussfassung der Novelle zu Art 53 B-VG (BGBl. I 101/2014) selbstverständlich zu Grunde legte, zeigt, dass die erforderliche Konkretisierung und Abgrenzung durch Heranziehung unterschiedlicher Kriterien bewirkt werden kann. Beschlüsse des Nationalrates auf besondere Gebarungsprüfung bestimmter Vorgänge auf Grundlage der genannten Bestimmungen erfolgten ua:
1. Zur Verkehrs- und Infrastrukturpolitik seit dem Jahr 2000 (3/URH2 XXII.GP):
„Die Verkehrs- und Infrastrukturpolitik seit dem Jahr 2000 hinsichtlich der Bereiche Straße und Schiene, insbesondere die Finanzierung des ‚Generalverkehrsplanes‘ sowie Management-, PPP- und LKW-Maut-Problemstellungen der ASFINAG.“
2. Zur Gebarung des BKA und der anderen Zentralstellen (Bundesministerien) hinsichtlich der Vollziehung aller dienst-, besoldungs- und pensionsrechtlichen Bestimmungen (885/A XX.GP):
„Der Rechnungshof wird gemäß § 99 GOG - NR mit der Durchführung einer Sonderprüfung der Gebarung des Bundeskanzleramtes und der anderen Zentralstellen (Bundesministerien) hinsichtlich der Vollziehung aller dienst-, besoldungs- und pensionsrechtlichen Bestimmungen einschließlich des Ausschreibungsgesetzes 1989 insbesondere auch im Hinblick auf finanzielle und laufbahnmäßige Begünstigung von Personen im politischen Nahebereich (z.B. Ministerbüro) der Regierungsmitglieder beauftragt.“
3. Zur Gebarung von BMF und ÖNB sowie Wertpapieraufsicht hinsichtlich der Erfüllung ihrer Aufsichtspflicht (969/A XX.GP):
„Der Rechnungshof wird gemäß § 99 GOG - NR mit der Durchführung einer Sonderprüfung der Gebarung des Bundesministeriums für Finanzen, der Oesterreichischen Nationalbank und der Wertpapieraufsicht hinsichtlich der Erfüllung ihrer Aufsichtspflicht über die in Österreich tätigen Kreditinstitute insbesondere im Zusammenhang
- mit dem Versagen der Organe der Bankenaufsicht im Rahmen der Kontrolle der Rieger-Bank und der Diskont-Bank, das zu einer Schädigung zahlreicher Kleinanleger geführt hat,
- mit der Rolle der Bankenaufsicht bei den Karibikgeschäften der BAWAG sowie
- mit der Mißachtung der vom Rechnungshof bereits 1993 erhobenen Forderung, die Bankenaufsicht zu einem durchschlagskräftigen Kontrollorgan umzugestalten, beauftragt.“
4. Zur Aufsichtspflicht des BMF, der OeNB und der FMA (5/URH2 XXII.GP):
„Die Gebarung des Bundesministeriums für Finanzen, der Oesterreichischen Nationalbank und der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) einschließlich der Tätigkeit ihrer Rechtsvorgängerin, der Bundes-Wertpapieraufsicht (BWA), hinsichtlich der Erfüllung ihrer Aufsichtspflicht über die Geschäfte der Bank für Arbeit und Wirtschaft AG (BAWAG) einschließlich ihrer Tochterunternehmen, und zwar insbesondere deren „Karibik-Geschäfte“, Kredite, Haftungen, Garantien, Beteiligungen, Ver- und Rückkäufe von Aktien sowie sonstiger Geschäfte und Geldflüsse zur Verschleierung des tatsächlichen Vermögensstandes der BAWAG vor allem im Zeitraum des wahrscheinlichen Entstehens der Verluste von etwa 1,4 Mrd. €; dies betrifft im Besonderen die Jahre 1994 bis 2000, wobei auch der Zeitraum 2000 bis heute in die Betrachtung mit einzubeziehen ist, da der amtierende Finanzminister umgehend nach seinem Amtsantritt den Auftrag zur Gründung einer unabhängigen und weisungsfreien Allfinanzmarktaufsichtsbehörde gegeben hat.“
5. Zu acht verschiedenen Fragen bezüglich der „Schaltung von Inseraten durch bzw im Auftrag bzw im Interesse von Bundesministerien“ (2079/A XXIV.GP).
6. Zur Gebarung des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie, der ÖBB Holding AG sowie den nachgeordneten Gesellschaften des ÖBB-Konzerns und des Bundesministeriums für Justiz (2/URH2 XXIV.GP):
„Die Gebarung des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie, der ÖBB Holding AG sowie den nachgeordneten Gesellschaften des ÖBB-Konzerns und des Bundesministeriums für Justiz, hinsichtlich
a) der Vorbereitung, Durchführung und Aufarbeitung von Finanztransaktionen der ÖBB Holding und den nachgeordneten Gesellschaften des ÖBB-Konzerns mit der Deutschen Bank und anderen beteiligten Finanzdienstleistern, der im Zusammenhang mit diesen Vorgängen beauftragten Gutachten, der darauf folgenden Auflösung von Managerverträgen inklusive der damit einhergehenden Vereinbarungen, (wie beispielsweise Abfertigungen) sowie des Stands etwaiger damit im Zusammenhang stehender gerichtlicher Verfahren;
b) des Ankaufs der ungarischen MAV Cargo, der damit im Zusammenhang stehenden Beratungsverträge sowie möglicher Provisionszahlungen, der bilanzmäßigen Bewertung im Zeitablauf, sowie des Stands etwaiger damit im Zusammenhang stehender gerichtlicher Verfahren;
c) des Beschaffungswesens innerhalb des ÖBB Konzerns seit dem Jahr 2000, insbesonders der Beschaffung von Handys und des Abschlusses von Telekomdienstleistungsverträgen.“
Auch in der auf die Novelle folgenden parlamentarischen Praxis ist keine Änderung an diesem extensiven Verständnis des Begriffs des „bestimmten Vorgangs“ erkennbar. So wurde auf Antrag von Abgeordneten der ÖVP eine besondere Gebarungsprüfung betreffend Ressortführung des Gesundheitsministeriums in der XXIV. und XXV. Gesetzgebungsperiode in den Jahren 2009 bis 2017 durch SPÖ-Gesundheitsminister (561/A XXVI.GP) mit den Stimmen der damaligen Koalitionsparteien ÖVP und FPÖ beschlossen, die eine Vielzahl an lediglich über die politische Zuordnung der Ressortleitung verbundene Themen erfasste. Der Rechnungshof führte auf Grund dieses Beschlusses auch tatsächlich eine Gebarungsprüfung durch, deren Ergebnisse zunächst in Reihe BUND 2021/30 (III-396 BlgNR XXVII.GP) veröffentlicht wurden.
Der im Sinne der obigen Ausführungen definierte Untersuchungsgegenstand begründet den Rahmen der Tätigkeit des Untersuchungsausschusses, bindet diesen und bildet gleichzeitig die Begrenzung der diesem übertragenen Zwangsbefugnisse. Zugleich dient die Festlegung des Untersuchungsgegenstandes aber auch dem Schutz der betroffenen Organe, weil damit deren Verpflichtung zur Vorlage von Akten und Unterlagen konkretisiert sowie der Umfang bestimmt wird, innerhalb dessen sie Ersuchen um Beweiserhebungen Folge zu leisten haben. Durch das Erfordernis des Vorliegens eines bestimmten Vorganges wird es umgekehrt aber auch nicht ins Belieben der betroffenen Organe gestellt, welche Beweismittel sie dem Untersuchungsausschuss vorlegen. Darüber hinaus bietet die geforderte Konkretisierung auch einen Schutz der Einsetzungsminderheit vor „Bepackung“ und Verwässerung durch die Mehrheit im Zuge der Ausschusstätigkeit.
Den geschilderten gesetzlichen Anforderungen wird im vorliegenden Fall umfassend entsprochen, sie werden sogar im Sinne der Effizienz der Untersuchung noch enger gefasst als rechtlich erforderlich:
Zunächst ist festzuhalten, dass bereits im Untersuchungsgegenstand der Zweck und die Zielrichtung der Untersuchung mit der Überprüfung möglicher bevorzugter Behandlung einer bestimmten Personengruppe festgelegt wird. Diese Gruppe wird über das sachliche Kriterium Vermögen definiert. Damit knüpft die Untersuchung an ein in der wissenschaftlichen Lehre und Forschung – disziplinübergreifend – dominantes Feld an:
Die Wechselwirkung zwischen Vermögen und politischem Einfluss ist sowohl in der rechts- als auch der politikwissenschaftlichen Literatur seit jeher ein wiederkehrender Klassiker der Betrachtung. Bereits in Platons „Der Staat“ wird ausgeführt, dass es der staatlichen Struktur abträglich sei, zu großen Reichtum zuzulassen. In der Verfassungsentwicklung war die Bedeutung von Vermögen für den politischen Einfluss zunächst im Wege des Zensuswahlrechts institutionalisiert.
Österreichische Milliardäre leisten nicht nur einen überwiegenden Anteil der Parteispenden an die Österreichische Volkspartei, sondern finanzieren über ihre
Interessenvertretungen gleichermaßen Lobbyinggruppen und „Think Tanks“, die deren Ideen zusätzlich in die öffentliche Debatte einbringen. Manche Milliardäre kaufen sich sogar in Tageszeitungen ein, wie etwa René Benko bei der Kronen Zeitung, obwohl ein solches Investment in keinerlei Zusammenhang mit ihrer sonstigen geschäftlichen Tätigkeit steht. Ein solches Verhalten von Ultrareichen (Ultra High Net Worth Individuals – UHNWI) wurde auch bereits in anderen Staaten beobachtet und beschrieben.
Hinzu kommt, dass Vermögen in Österreich besonders ungleich verteilt ist. So besitzen die reichsten 335 Österreicherinnen und Österreicher laut Zahlen der Österreichischen Nationalbank ein Drittel des gesamten Finanzvermögens:

Schätzungen der Europäischen Zentralbank ergeben ein noch drastischeres Bild: Demnach besitzt das reichste Ein-Prozent der österreichischen Bevölkerung 50% des gesamten inländischen Vermögens.
Zu vergleichbaren Ergebnissen im Hinblick auf die Größe der im Fokus der Untersuchung stehenden Personengruppe gelangt die Boston Consulting Group in
ihrem „Global Wealth Report“. Demnach kommt in Österreich eine Anzahl von rund 400 Personen auf ein Vermögen von jeweils mehr als 100 Mio. US-Dollar:

Diese Statistiken machen klar, dass die vorliegende Untersuchung einen sehr eingeschränkten zu untersuchenden Bereich erfasst. Zwar existieren leider keine behördlichen Aufzeichnungen über das Vermögen der österreichischen Bevölkerung mehr. Solche Aufzeichnungen wären für die gegenständlichen Zwecke zwar nützlich, aber nicht ausreichend, als dass auf Grund der verschiedenen Möglichkeiten zur Strukturierung von Vermögen auf verschiedene Rechtsträger wie insbesondere Privatstiftungen oder Unternehmen bzw über Auslandsverbindungen jedenfalls eine umfassendere Betrachtung des einzelnen Personen zurechenbaren Vermögens stattzufinden hat und solche Vermögen innerhalb des Untersuchungszeitraumes auch schwanken können. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass es
sich hier um Personen handeln könnte, die ihr Vermögen gegenüber den Behörden bewusst nicht offenlegen möchten.
Die letzte öffentlich verfügbare Liste der Vermögen von Privatstiftungen stammt etwa aus dem Jahr 2004 – neuere Angaben zum Vermögen der einzelnen Privatstiftungen gibt es nicht. In dieser Liste werden die folgenden Privatstiftungen mit einem Vermögen von mehr als 1 Mrd. Euro geführt:

Das Stiftungsvermögen der rund 3.000 österreichischen Privatstiftungen wurde 2014 auf 50-60 Mrd. Euro geschätzt.
Die neueste Forbes-Liste, die am 4. Oktober 2023 veröffentlicht wurde, enthält elf Österreicher (nur Männer) als Dollar-Milliardäre:

Die Oesterreichische Nationalbank hat in ihrem letzten Household Finance and Consumption Survey (der jedoch nur bis zur 95. Perzentile reicht) festgestellt, dass 5% der Haushalte (nicht zu verwechseln mit der Bevölkerung) über Vermögen von rund 1,05 Million Euro oder mehr verfügen, was mit den Werten in der Credit Suisse/UBS-Erhebung vergleichbar ist:

Es erscheint auf Grund dieser Angaben und der verfügbaren statistischen Daten als gesichert, dass die für den Untersuchungsgegenstand maßgebliche Personengruppe deutlich weniger als 100 Personen umfasst. Dies ergibt sich insbesondere daraus, dass die untersuchungsgegenständliche Grenze mit einem zurechenbaren Vermögen von einer Milliarde Euro bewusst hoch angesetzt wurde und somit 99,999% der österreichischen Bevölkerung von vornherein nicht von der Untersuchung betroffen sein können.
Durch die besonders hohe Wertgrenze wird gleichzeitig dem Umstand Rechnung getragen, dass Vermögen zwar jedenfalls rechtlich bestimmbar ist, es den vorlagepflichtigen Organen faktisch auf Grund der mangelnden Datenlage vielfach unmöglich sein wird, das zurechenbare Vermögen im Einzelfall exakt festzustellen. Vor dem Hintergrund, dass Zweck der Untersuchung politische und nicht rechtliche Kontrolle ist, ist dies aber ohnehin nicht erforderlich. Es hat lediglich
ausreichendes Tatsachensubstrat für die Annahme, dass der betroffenen Person ein Vermögen von einer Milliarde Euro oder mehr zuzurechnen ist, vorzuliegen, da in einem solchen Fall eine Relevanz für die Untersuchung nicht mehr ausgeschlossen werden kann. Zudem wäre ein solches Vorgehen nicht mit den Grundsätzen der Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit vereinbar, müssen die vorlagepflichtigen Stellen ihren Vorlagepflichten doch binnen kurzer Frist entsprechen. Ein für eine Vorlage ausreichendes Tatsachensubstrat kann entweder in der Existenz von entsprechenden Schätzungen oder Vergleichswerten oder auch in Eigenangaben der Betroffenen in Interviews oder ähnlichem liegen. In Fällen von Abgrenzungsproblemen anhand des Vermögenskriteriums haben das vorlagepflichtige Organ und der Untersuchungsausschuss in einen wechselseitigen Kommunikationsprozess einzutreten, der seinen Ausgangspunkt bei einer substantiellen, auf den Einzelfall bezogenen Begründung für die Verneinung der Untersuchungsgegenständlichkeit eines bestimmten Sachverhalts durch das vorlagepflichtige Organ nimmt. Dafür wird es zweckmäßig sein, bereits im Grundsätzlichen Beweisbeschluss des Untersuchungsausschusses die zuständigen Organe zu verpflichten, Erhebungen im Hinblick auf zurechenbare Vermögenswerte durchzuführen. Dies sollte insbesondere durch Auswertung der Meldungen gemäß Schenkungsmeldegesetz 2008, in Abgabenbescheide bei Unternehmens- und Liegenschaftstransaktionen, Mitteilungen gemäß FM-GWG und der Gebührenbescheide der Bezirksgerichte bei Verlassenschaften und Grundbuchsangelegenheiten sowie verfügbarer Informationen etwa im Rahmen des GMSG oder KontRegG erfolgen, da darin wesentliche Vermögensbestandteile abgebildet sind, die Grundlage für entsprechende Schätzungen bilden können. Ohne ein solches Erhebungsersuchen müsste der hinreichende Umfang des grundsätzlichen Beweisbeschlusses angezweifelt werden, da dieser bereits die erforderlichen Grundlagen für die Untersuchung zu schaffen hat und die Frage allfälliger weiterer in die untersuchungsrelevante Personengruppe einzubeziehender Personen dafür entscheidend ist.
Tatsächlich existiert bereits jetzt eine Reihe an Schätzungen der Vermögensstände von österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die eine weitgehende
Kongruenz aufweisen und ebenfalls deutlich weniger als 100 potentiell von der Untersuchung betroffene Personen ergeben. Das Forbes-Magazin veröffentlicht jährlich eine Liste der reichsten Menschen, darunter auch jener aus Österreich. Das Wirtschaftsmagazin Trend gibt jedes Jahr eine Liste der reichsten Österreicherinnen und Österreicher heraus. Das „Vermögen Magazin“ führt eine vergleichbare Liste.
Die verlangenden Abgeordneten legen Wert darauf, festzuhalten, dass von den genannten Personen wohl nur einige tatsächlich versucht haben, eine Bevorzugung durch die Bundesverwaltung zu erlangen oder tatsächlich erhalten haben. Der sogar überwiegende Teil der genannten Personen wird gleichermaßen wie alle anderen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ihren gesetzlichen Pflichten ordnungsgemäß nachgekommen sein. Wie bereits ausgeführt sind gegenteilige Beispiele jedoch in der vergangenen Zeit übermäßig dokumentiert und dargestellt worden, was sich insbesondere aus den Enthüllungen des früheren Generalsekretärs und ÖBAG-Chefs Thomas Schmid ergab. Es ist gleichzeitig eine alte Weisheit, dass Vermögen auch verpflichtet und Personen, die eine besondere gesellschaftliche Stellung genießen, sich ein höheres Maß an Kritik und Überprüfung gefallen lassen müssen als andere Personen, und insbesondere dann, wenn sie selbst auch die Öffentlichkeit suchen. Es ist Sinn und Zweck einer Untersuchung auch jene Sachverhalte festzustellen, die die Annahme der verlangenden Abgeordneten, es bestehe eine Zwei-Klassen-Verwaltung, widerlegen.
Um eine zielgerichtete Untersuchung zu ermöglichen und nicht jede vermögende Person unter Generalverdacht zu stellen, wird die untersuchungsrelevante Personengruppe zusätzlich durch das Kriterium der Nähe zur ÖVP eingeschränkt: Es sind somit nur jene Personen mit einem zurechenbaren Vermögen von zumindest einer Milliarde Euro von der Untersuchung erfasst, um deren Unterstützung gleichzeitig auch von der ÖVP geworben wurde oder die der ÖVP entsprechende Unterstützung haben zukommen lassen. Dies trifft auffälligerweise jedoch ohnehin für die meisten Milliardäre zu.
Ein Abgleich der genannten Personen sowohl mit den Spenderlisten des „Projekts Ballhausplatz“ sowie mit den tatsächlich an den Rechnungshof von der ÖVP gemeldeten Spenden an die ÖVP ergibt, dass von den 49 bekannten österreichischen Milliardären 23 auch der ÖVP nahe stehen. Die Gruppe, die vom zu untersuchenden Vollziehungshandeln betroffen ist, weißt somit einen hohen Grad an Kohärenz auf.
Zu den Personen mit einem zurechenbaren Vermögen von über einer Milliarde Euro und ÖVP-Nähe im Sinne des Untersuchungsgegenstandes und im Untersuchungszeitraum zählen demnach ua Frank Albert, Christian Baha, Martin Bartenstein, René Benko, Markus Braun, Wolfgang Leitner, Julius Meinl V., Peter Mitterbauer, Klaus Ortner, Ronny Pecik, Stefan Pierer, Franz Rauch, Gerd Alexander Schütz, Frank Stronach und Siegfried Wolf.
Die Einschränkung auf einen sehr kleinen Personenkreis als Objekt des zu untersuchenden Verwaltungshandelns dient dem vorrangigen Ziel, den Untersuchungsgegenstand konkret abzugrenzen und den vorlagepflichtigen Organen die Beurteilung zu ermöglichen, welche Informationen jedenfalls abstrakt für die Untersuchung von Relevanz sein können. Auf diese Art wird außerdem ausgeschlossen, dass der Untersuchungsausschuss selbständig die Untersuchung auf weitere Bereiche ausweiten kann. Der Untersuchungsausschuss verfügt über keinerlei Ermessensspielraum in Hinblick auf den Umfang der Untersuchung, sondern lediglich darüber, auf welche Art er Beweise innerhalb der Grenzen des Untersuchungsgegenstandes erheben will (vgl auch Konrath/Neugebauer/Posnik, aaO, 218).
Gleichzeitig muss der Untersuchungsausschuss innerhalb des Untersuchungsgegenstandes im Sinne seines Selbstinformationsrechts keine Einschränkungen dulden. Daher sind mittelbar auch etwa Unternehmen von der Untersuchung betroffen, die ÖVP-nahen Milliardären zuzurechnen sind. Ein Blick in öffentlich verfügbare Datenbanken ergibt eine größere Zahl an (juristischen) Personen, die somit ebenfalls untersuchungsrelevant sind. Es handelt sich dabei ua um folgende Beispiele:
1. René Benko
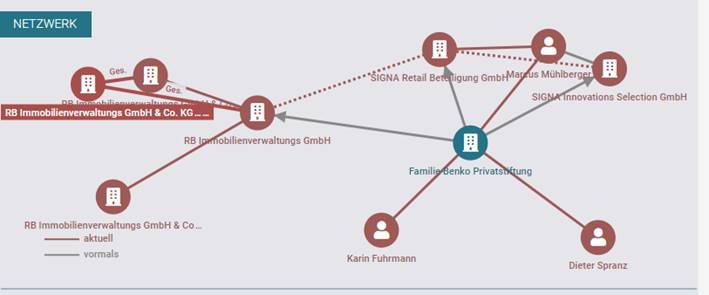
2. Franz Rauch

3. Stefan Pierer

4. Wolfram Senger-Weiss
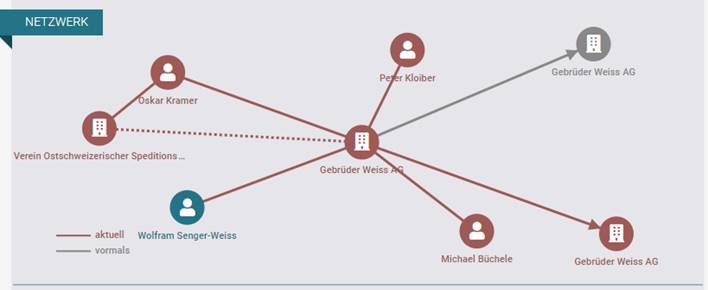
5. Klaus Ortner

6. Siegfried Wolf
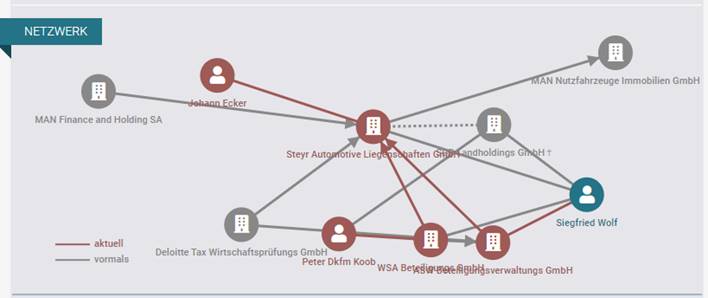
Durch die dem Untersuchungsgegenstand beigefügten, vom Untersuchungsausschuss zu klärenden Fragen sowie die Beweisthemen wird der zu untersuchende Vorgang zusätzlich konkretisiert. Es soll demnach nicht jegliches Verwaltungshandeln auf eine mögliche bevorzugte Behandlung von Milliardären untersucht werden, sondern die Untersuchung hat sich auf bestimmte, vorgegebene Bereiche zu konzentrieren, in denen bereits Anhaltspunkte für eine solche bevorzugte Behandlung bestehen und somit in eindeutigem Zusammenhang zum Untersuchungsgegenstand stehen. Dies soll dem Untersuchungsausschuss gleichzeitig einen Arbeitsplan vorgeben und ihm ermöglichen, seinen Auftrag in der ihm gesetzlich vorgegebenen Zeit zu erfüllen.
Diesen Verwaltungsbereichen ist der Umstand gemeinsam, dass sie besonders dazu geeignet sind, für die Gruppe der Milliardäre von persönlichem Interesse und Wert zu sein, bzw für solche Einflussnahmen anfällig sind. Dieser Befund ergibt sich aus den im Teil zum untersuchungsauslösenden Sachverhalt beschriebenen Umständen, da entsprechende Einflussnahme(versuche) in diesen Bereichen bereits dokumentiert wurden. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Berichte des Ibiza-Untersuchungsausschusses und des ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschusses verwiesen.
Verwaltungsbereiche ist dabei vorrangig organisatorisch zu verstehen (siehe sogleich die Ausführungen zum Begriff „Bundesorgane“ des Untersuchungsgegenstandes). Es sind insbesondere die Zentralstellen der Bundesministerien und somit die politische Führungsebene der Ressorts sowie die Leitungsebene staatsnaher Unternehmen angesprochen. Dies schließt gleichzeitig nicht aus, dass auch nachgeordnete Dienststellen betroffen sein können, da bereits Sachverhalte bekannt sind, wo Milliardäre gleichzeitig sowohl bei der zuständigen Behörde (dem zuständigen Finanzamt) als auch in der Zentralstelle in ihrer Sache intervenierten, ohne dass dies den unterschiedlichen Verwaltungsebenen zunächst bekannt war.
Zu den im Untersuchungsgegenstand verwendeten Begriffen:
Allgemein wird vorausgeschickt, dass die im Untersuchungsgegenstand verwendeten Begriffe autonom anhand dieses Verlangens auszulegen sind, da es sich bei einem Untersuchungsausschuss um ein Instrument der politischen Kontrolle handelt.
Legaldefinitionen und Rechtsprechung zu denselben, im Untersuchungsgegenstand verwendeten Begriffen sind daher insoweit unbeachtlich, als nicht ausdrücklich darauf verwiesen wird.
- Vollziehung
Ein Untersuchungsausschuss des Nationalrates kann nur einen Vorgang im Bereich der Vollziehung des Bundes überprüfen. Der Ausschussbericht (AB 439 BlGNR XXV. GP, 3) führt dazu aus, dass zur Verwaltung des Bundes nach Rechtsprechung und Lehre sowohl die hoheitliche als auch die nicht-hoheitliche Besorgung von Verwaltungsaufgaben sowie die Privatwirtschaftsverwaltung des Bundes zähle. Daher kann auch informelles staatliches Handeln Gegenstand der Untersuchung sein (Pabel, Die Kontrollfunktion des Parlaments, 2009, 85) sowie auch gesetzesvorbereitende Tätigkeit der Verwaltung (Pürgy, Die gesetzesvorbereitende Tätigkeit der Verwaltung als Kontrollgegenstand parlamentarischer Untersuchungsausschüsse, ZfV 2021, 101). Das Untersuchungsrecht erstreckt sich somit grundsätzlich auf jede Art der „Verwaltung“ im verfassungsrechtlichen Sinn. Während der Verfassungsgerichtshof in VfSlg 19.992/2015 und 19.993/2015 noch festhielt, dass ausgegliederte Unternehmen nicht vorlagepflichtig sind, da es sich bei ihren Tätigkeiten nicht mehr um Verwaltung handle, hat der Verfassungsgerichtshof in Abkehr von dieser Judikatur nunmehr solche Unternehmen in den Bereich der Verwaltung miteinbezogen (VfGH 5.10.2023, G 265/2022, Rz 43ff). Dementsprechend ist insbesondere die COFAG genauso wie die ABBAG und die weiteren konkret in den Beweisthemen genannten Rechtsträger im grundsätzlichen Beweisbeschluss des Geschäftsordnungsausschusses zur Aktenvorlage zu verpflichten, um den Untersuchungsausschuss mit dem notwendigen Umfang an Informationen auszustatten, die er zur Erfüllung seines Kontrollauftrags benötigt.
- Bundesorgane
Der Begriff Bundesorgane umfasst auch die jeweiligen Organwalterinnen und -walter und diesen unterstellte Personen. Privates Verhalten ist nicht erfasst, sofern es keinerlei Bezug zur dienstlichen Tätigkeit hat (vgl Konrath/Posnik, aaO, 9; Wimmer,
Staatlichkeit und Kontrolle, in: Fuchs ua [Hrsg], Staatliche Aufgaben, private Akteure, 3. Band [2019] 136). Die Abgrenzung von privatem zu dienstlichem Handeln hat in der Vergangenheit immer wieder zu Diskussionen geführt. Der Maßstab, nach dem diese Abgrenzung vorzunehmen ist, kann jedoch kein anderer sein als jener, der auf Grund der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes für die Vorlagen von Akten und Unterlagen an einen Untersuchungsausschuss anzulegen ist. Somit ist (im Sinne der abstrakten Relevanz) sämtliches Verhalten von Organwalterinnen und Organwaltern sowie öffentlichen Bediensteten als dienstlich anzusehen, solange nicht zweifellos gesichert ist, dass es privat ist.
Vom Begriff Bundesorgane iSd Untersuchungsgegenstandes sind auf Grund des Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes vom 5.10.2023, G 265/2022, ebenfalls ausgegliederte Rechtsträger erfasst, die Verwaltung des Bundes im Sinne des Art 20 Abs 1 B VG ausüben, selbst wenn sie in private Rechtsform gekleidet sind. Gleichermaßen sind Beliehene erfasst.
Die mittelbare Bundesverwaltung ist aus Effizienzgründen nicht umfasst. Unbeschadet davon bleibt eine allfällige Verpflichtung zur Vorlage von Akten und Unterlagen bestehen, selbst wenn diese Organe keinen Gegenstand der Untersuchung bilden.
- „in Zusammenhang mit“
Diese Formulierung deckt im Gegensatz zu Verwaltungshandeln „betreffend“ die genannten Personen, das konkret auf die Erledigung einer ihrer Angelegenheiten gerichtet ist, auch solche Informationen ab, die aus welchen Gründen auch immer lediglich in den Bereich der Vollziehung gelangt sind. Es kann sich sowohl um einen sachlichen, personellen, organisatorischen oder zeitlichen Zusammenhang handeln.
Vollziehung in Zusammenhang mit ÖVP-nahen Milliardären liegt somit im Sinne des Untersuchungsgegenstands bereits dann vor, wenn ein gewisser Sachverhalt, der die Interessenssphäre von ÖVP-nahen Milliardären berührt, in den Bereich, die Verfügbarkeit oder die Wahrnehmung der Verwaltung gelangt ist. So sind auch ohne
Zutun auf Verwaltungsseite in den Bereich der Verwaltung gelangte Eingaben und dergleichen erfasst, was insbesondere auch Korrespondenzen jeglicher Art mit Bezug zur Bundesverwaltung umfasst, die etwa von den genannten Personen gesendet wurden, selbst wenn eine Antwort oder Kenntnisnahme durch Amtsträger nicht ersichtlich wäre.
Gleichermaßen liegt ein untersuchungsrelevanter Sachverhalt dann vor, wenn dieser einen Bezug zu ÖVP-nahen Milliardären aufweist, ein Handeln auf Verwaltungsseite jedoch nicht vorhanden war oder dokumentiert ist. Dies umfasst insbesondere Fälle der Untätigkeit der Verwaltung, obwohl sich diese Kenntnis über den Sachverhalt hätte verschaffen können. Dies ist etwa zur Überprüfung der Einhaltung des Offizialprinzips erforderlich.
Die Formulierung „in Zusammenhang mit“ stellt gleichzeitig klar, dass eine Vorlage von Akten und Unterlagen lediglich zu Vergleichszwecken ohne eigenen Bezug zu untersuchungsrelevanten Sachverhalten nicht zulässig ist (vgl VfGH 25.8.2022, UA7-45/2022, Rz 207).
- Personen
Es handelt sich dabei um natürliche Personen. Es ist das Verwaltungshandeln ihnen gegenüber, das im Fokus der Untersuchung steht und zwar unabhängig davon, ob dies auf deren Initiative oder gar ohne deren Wissen und Zutun erfolgt.
Zwar bestehen auch juristische Personen, die über ein Vermögen von einer Milliarde Euro oder mehr verfügen oder derart zu bewerten sind, diese sind nach der Intention der Untersuchung jedoch nur dann untersuchungsrelevant, wenn sie auch inländischen natürlichen Personen zuzurechnen sind und somit deren Vermögen auf über eine Milliarde Euro erhöhen. Dies bedeutet, dass auch Akten und Unterlagen zu solchen juristischen Personen dem Untersuchungsausschuss vorzulegen sind, sofern dies nach Maßgabe des Zwecks und des Ziels des in Frage stehenden Verwaltungshandelns mit einer der besagten natürlichen Personen in Zusammenhang gebracht werden kann. Es sind somit insbesondere solche Konstellationen
erfasst, in denen besagte natürliche Personen für eine juristische Person oder in deren Angelegenheiten bei der Verwaltung einschreiten. Als Beispiel für einen solchen Sachverhalt können die Interventionen von René Benko zu Gunsten der Signa in deren Steuerverfahren genauso gelten wie die Interventionen von Sigi Wolf zu Gunsten der Aufhebung von US-Sanktionen gegen ein von ihm gemanagtes Unternehmen. Auch abstraktes Einschreiten durch die Genannten genügt, sofern ein ausreichender Zusammenhang besteht. Dieser ist allenfalls im Wege ergänzender Beweisanforderungen zu begründen, da der Fortgang der Untersuchung insofern nicht vorweggenommen werden kann.
- Vermögen
Vermögen ist umfassend als alle geldwerten materiellen und immateriellen Rechte, Eigentum, geldwerten Ansprüche (auch wenn diese nicht realisiert sind) und jedenfalls als alle wirtschaftlichen Aktiva zu verstehen. Sitz und örtliche Zuständigkeit sind unerheblich, wodurch insbesondere auch Auslandsvermögen erfasst ist.
- Zurechnung
Um die Durchführung eines Ermittlungsverfahrens im Hinblick auf das Vermögen einer Person überflüssig zu machen – zumal dies vielfach rechtlich, jedenfalls in den vorgegebenen Fristen aber faktisch unmöglich ist –, ist Vermögen immer dann einer Person zuzurechnen, wenn entsprechendes Tatsachensubstrat für die Annahme vorliegt, dass die jeweilige Person wirtschaftlich durch dieses verpflichtet oder berechtigt wird, sei es auch nur mittelbar. Entscheidend ist somit eine informierte Wertung über das Vorliegen eines die Wertgrenze erfüllenden Vermögens zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb des Untersuchungszeitraums auf Grund entsprechender Tatsachen. Solche Tatsachen können in der Nennung der jeweiligen Person in Vermögensverzeichnissen, Wissen des vorlagepflichtigen Organs über den Wert von Vermögensbestandteilen, Eigenangaben der jeweiligen Personen oder unwidersprochenen öffentlichen Zuschreibungen eines solchen Vermögens liegen. In diesem Verlangen sind bereits jene Personen genannt, bei denen ein solches
Tatsachensubstrat jedenfalls vorliegt. Um auch Verschleierungskonstruktionen zu erfassen (vgl die Berichterstattung zu Tarnfirmen des Sigi Wolf auf Zypern oder die Transaktionen von René Benkos Privatstiftung), sind Personen, deren bisher bekanntes, zurechenbares Vermögen unter einer Milliarde Euro liegt, auch dann von der Untersuchung erfasst, wenn die Art der Konstruktion und der dadurch mutmaßlich verschleierten Vermögenswerte diese über die relevante Betragsgrenze heben würde.
Bei Vorliegen einer tatsächlichen Verfügungsberechtigung über Vermögenswerte in der erforderlichen Höhe ist die Zurechenbarkeit jedenfalls gegeben. Die Verfügungsberechtigung ist aber nicht zwingend erforderlich, um auch informelle Konstellationen der Beherrschung sowie Treuhandkonstruktionen und dergleichen zu erfassen. Maßgeblich ist die Eigenschaft als wirtschaftlicher Nutznießer bzw Nutznießerin.
Bei Personenmehrheiten, denen das Vermögen zuzurechnen wäre, wird dieses nicht nach Köpfen geteilt, sondern einheitlich betrachtet, wodurch jeder der beteiligten Personen das gesamte Vermögen zuzurechnen ist. Damit wird insbesondere Konstellationen Rechnung getragen, in denen ein vormals einheitliches Vermögen durch Aufteilung oder Erbfolge nunmehr auf mehrere Personen verteilt wurde. Gleichzeitig wird dem Umstand Rechnung getragen, dass im Wege der Privatautonomie unterschiedlichste Einvernehmens-, Mitwirkungs- oder Beteiligungskonstellationen vereinbart werden können und diese nicht zuerst zu erforschen sein sollen.
- Unterstützung
Unterstützung ist jegliche unentgeltliche oder entgeltliche Zuwendung von Ressourcen, seien sie finanziell, organisatorisch, personell oder anderer Art. Entgeltliche Zuwendungen werden einbezogen, um Konstellationen zu erfassen, in denen ein Fremdvergleich allenfalls eine versteckte Zuwendung an die Partei ergeben könnte.
- Österreichische Volkspartei
Die politische Partei ÖVP ist von diesem Begriff nicht nur als Verband umfasst, sondern es sind vielmehr auch deren Teilorganisationen sowie nahestehenden Organisationen im Sinne des Parteiengesetzes, Wahlwerberinnen und -werber, Mandatarinnen und Mandatare sowie Funktionärinnen und Funktionäre der Partei umfasst. Tatbildlich ist in diesem Zusammenhang somit im Gegensatz zum zu untersuchenden Verwaltungshandeln auch eine Unterstützung auf lokaler oder regionaler Ebene.
- Werben
Diese Formulierung umschreibt die (passive) Situation des (versuchten) Anwerbens der jeweiligen Personen zur Unterstützung der ÖVP in diesem Fall durch Vertreterinnen bzw Vertreter der Partei, wobei davon auszugehen ist, dass solche Anwerbeversuche ein entsprechendes Naheverhältnis zur Partei logisch voraussetzen.
- Bevorzugte Behandlung
Das Vorliegen einer Bevorzugung ist eine Wertungsfrage, die schlussendlich dem Untersuchungsausschuss obliegt. Mit der Abgrenzung von Sachverhalten anhand dieses Kriteriums ist daher zurückhaltend umzugehen. Als Angabe des Zwecks der Untersuchung kann es jedoch dazu dienen, die für die Nicht-Vorlage von Akten und Unterlagen erforderliche Gewissheit der mangelnden Relevanz herzustellen. Kommt einer Behörde bei der Behandlung eines ansonsten untersuchungsgegenständlichen Sachverhalts keinerlei Ermessen weder in inhaltlicher noch prozeduraler Hinsicht zu und steht dies gesichert fest, vermag dies eine Vorlagepflicht auszuschließen. Dabei ist etwa an Sachverhalte zu denken, die jeder Person gleichermaßen ohne die Erfüllung weiterer Voraussetzungen zustehen.
Zur Einordnung in den Bereich der Vollziehung des Bundes:
Gegenstand der Untersuchung ist im vorliegenden Fall die Vollziehung durch Bundesorgane. Zum Begriff der Bundesorgane darf einerseits auf die entsprechenden
Ausführungen an anderer Stelle dieses Verlangens verwiesen werden. Andererseits ergibt sich zwar bereits aus Art 53 Abs 2 B VG, dass Untersuchungsgegenstand nur die Vollziehung sein kann und nicht etwa die Gesetzgebung oder Rechtsprechung. Durch die ausdrückliche Nennung der Vollziehung im Untersuchungsgegenstand wird dies dennoch nochmals verdeutlicht.
Zur Abgrenzung von Verwaltung zum Handeln Privater, insbesondere den im Untersuchungsgegenstand genannten Personen, ist außerdem auszuführen, dass diese zwar nicht selbst Gegenstand der Untersuchung sind, das Verhalten der Verwaltung ihnen gegenüber und ihr eigenes Einwirken auf die Verwaltung ist es aber sehr wohl. Die Erforschung ihres privaten Bereichs ist solange zulässig, als nicht ausgeschlossen werden kann, dass daraus Erkenntnisse für die Untersuchung zu gewinnen sind (vgl zur Diskussion in Deutschland mit selbem Ergebnis Teubner, Untersuchungs- und Eingriffsrechte privatgerichteter Untersuchungsausschüsse [2009] 11ff). Ein solcher Eingriff wird durch das besondere, von der Bundesverfassung eingeräumte Interesse an der Kontrolle der Vollziehung gerechtfertigt. Es obliegt den vorlagepflichtigen Stellen, im Einzelfall abzuwägen und ggf zu begründen, ob eine Relevanz für die Untersuchung von privaten Informationen von Vornherein ausgeschlossen werden kann oder nicht.
Die dem Untersuchungsausschuss von der Bundesverfassung eingeräumten, der Wirksamkeit seines Kontrollauftrags dienenden, besonderen Informationsrechte würden ins Leere laufen, könnten private Umstände nicht einmal mittelbar erforscht werden, obwohl diese Folgen im Bereich der Vollziehung des Bundes haben. Aus diesem Grund kann der verfassungsrechtlichen Vorlagepflicht des Art 53 Abs 3 B-VG gegenüber dem Untersuchungsausschuss auch keine Geheimhaltungsverpflichtung gegenüber Privaten entgegengesetzt werden (vgl dazu bereits VfSlg 19973/2015). Davon zu unterscheiden ist die Frage der eigenständigen Mitwirkungspflicht Privater an den Beweiserhebungen eines Untersuchungsausschusses (vgl dazu einerseits VfSlg 19993/2015 bzw andererseits § 288 Abs 1 und 3 StGB).
Dass Private mittelbar vom Gegenstand der Untersuchung betroffen sein können, hat der Verfassungsgesetzgeber durch die Erlassung des Art 138b Abs 1 Z 7 und die
Schaffung des dazugehörigen Beschwerdeverfahrens im VfGG überdies ausdrücklich anerkannt. Schließlich wäre ein solches Verfahren zum Schutz von Persönlichkeitsrechten ansonsten von vornherein obsolet.
Eine solche Auslegung entspricht auch dem spezifischen Verständnis parlamentarischer Kontrolle als Informationsgewinnung zur Geltendmachung politischer Verantwortung (vgl auch Konrath/Neugebauer/Posnik, aaO, 218).
Zur Abgeschlossenheit:
Der Ausschussbericht (AB 439 BlgNR XXV. GP, 4) führt aus, dass ein Vorgang jedenfalls dann als „abgeschlossen“ angesehen werden könne, wenn sich die Untersuchung auf einen zeitlich klar abgegrenzten Bereich in der Vergangenheit bezieht. Das Erfordernis der Abgeschlossenheit schließe nicht aus, dass damit in Verbindung stehende Handlungen noch offen sind. Dies ergibt sich bereits daraus, dass anderenfalls die Ausnahme des Art 53 Abs 4 B-VG von der Vorlageverpflichtung an einen Untersuchungsausschuss überflüssig wäre.
Als maßgeblicher Beginn der Untersuchung wird im vorliegenden Fall der 18. Dezember 2017 und somit die Angelobung von Sebastian Kurz als Bundeskanzler bestimmt. Auf Grund der bislang bekannten Umstände wird angenommen, dass (spätestens) ab diesem Zeitpunkt Milliardäre in völlig neuem Ausmaß Einfluss auf das Verwaltungshandeln ausüben konnten. In diesem Zusammenhang darf auf die Ausführungen zu den untersuchungsauslösenden Sachverhalten verwiesen werden.
Das Ende des Untersuchungszeitraumes wird mit 23. November 2023 und somit dem Tag vor der Einbringung des gegenständlichen Verlangens festgelegt. Es ist mangels erst durch die Tätigkeit des Untersuchungsausschusses zu gewinnender Kenntnis des zu untersuchenden Vorgangs nicht möglich, ein früheres Enddatum festzulegen. Dies schadet der Gesetzmäßigkeit des Untersuchungsgegenstandes jedoch in keiner Weise, als durch die Festlegung eines ausdrücklichen Enddatums das Erfordernis der Abgeschlossenheit jedenfalls erfüllt ist (vgl VfGH 14.9.2018, UA1/2018, 86; VfSlg
20304/2018, 179ff; Konrath/Neugebauer/Posnik, aaO, 218; Konrath/Posnik, aaO, 12).
Zu den Beweisthemen:
Zu den einzelnen Beweisthemen ist folgendes auszuführen, wobei hier insbesondere der Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegenstand in der spezifischen Ausrichtung des zu untersuchenden Verwaltungshandelns auf die im Untersuchungsgegenstand genannte Personengruppe maßgeblich ist:
1. COFAG
Im Zuge des ersten Beweisthemas soll untersucht werden, ob insbesondere im Wege der COFAG Fördermittel der öffentlichen Hand an Personen zugeflossen sind, die über ein hohes Vermögen verfügen und der ÖVP nahestehen. Zweck und Grund der Förderung ist dabei unerheblich. Im Vordergrund stehen die Förderungen der COFAG an ÖVP-nahe Milliardäre und diesen zuzurechnende Unternehmen, die Untersuchung ist jedoch nicht darauf beschränkt und erfasst auch andere Förderinstrumente. Als Förderungen sind dabei alle ohne entsprechende Gegenleistung gewährten Vorteile zu verstehen. Geschäfte mit entsprechenden Gegenleistungen bilden einen Teil des zweiten Beweisthemas.
Folgende Fragen sind im Rahmen dieses Beweisthemas zu klären:
• Welche Motive haben die Verwaltung bei der COFAG geleitet?
• Wer hat die Ausgestaltung der COFAG-Förderungen bestimmt?
• In welchem Ausmaß haben die im Untersuchungsgegenstand genannten Personen von COFAG-Förderungen profitiert?
• Welche Handlungen in Zusammenhang mit den im Untersuchungsgegenstand genannten Personen wurden von Organen bzw Bediensteten der COFAG oder vom Bundesministerium für Finanzen im Zusammenhang mit der COFAG und diesen Personen gesetzt?
• Wurde von der COFAG in Zusammenhang mit Förderungen an die im Untersuchungsgegenstand genannten Personen „ein Auge zugedrückt“, insbesondere bei der Rückforderung von Zahlungen in Folge der Insolvenz von Kika/Leiner?
• In welchem Ausmaß erhielten die im Untersuchungsgegenstand genannten Personen Subventionen aus öffentlichen Mitteln?
2. Informationsweitergabe und Interventionen
Bereits im Ibiza-Untersuchungsausschuss wurden eine Reihe von Veranstaltungen etwa im Bundeskanzleramt und im Bundesministerium für Finanzen thematisiert, die offenbar der besonderen Kontaktpflege zu Milliardärinnen und deren Vertreterinnen bzw Vertreter gedient haben sollen. Es ist im Bericht des Ibiza-Untersuchungsausschuss daher ua nachzulesen, wie durch die Einrichtung der Stabstelle Think Austria ein institutionalisierter Zugang für Spenderinnen und Spender der Volkspartei zum Wissen der Bundesverwaltung errichtet wurde, dessen Ausmaß jedoch nicht vollständig beleuchtet werden konnte, da der Ausschuss vorzeitig beendet wurde.
Gleichermaßen wurden in den vergangenen beiden Untersuchungsausschüssen eine Reihe von Postenbesetzungen in staatsnahen Unternehmen kritisiert, da sie möglichen Mitbewerberinnen und -bewerber dieser Unternehmen bzw deren Vertreterinnen und Vertreter einen Zugang zu Betriebsgeheimnissen verschafften. Regelmäßig gestreift wurden auch Auslandsreisen, etwa im Zuge von Wirtschaftsdelegationen und dabei insbesondere die Teilnahme von René Benko an Staatsbesuchen im Ausland.
Neben den zu den untersuchungsauslösenden Sachverhalten bereits gemachten Ausführungen, die eine Bevorzugung von ÖVP-nahen Milliardären in Verwaltungsabläufen vermuten lassen, ist der erforderliche Zusammenhang dieses Beweisthemas mit dem Untersuchungsgegenstand dadurch hergestellt, dass ausdrücklich auf eine Bevorzugung der im Untersuchungsgegenstand genannten Personengruppe abgestellt wird. Eine Untersuchung anderer, nicht im Untersuchungsgegenstand genannter Personen anhand dieses Beweisthemas ist
somit ausgeschlossen. Es wird der Vollständigkeit halber jedoch neuerlich darauf hingewiesen, dass dies die Untersuchung mittelbarer Bevorzugung (etwa zu Gunsten Dritter auf Wunsch von Milliardären) nicht behindert.
In diesem Beweisthema sind auch Vorwürfe der Bestechlichkeit bzw des Amtsmissbrauchs gegenüber Amtsträgern des Bundes abzuhandeln, sofern auf der Gegenseite eine im Untersuchungsgegenstand genannte Person involviert ist (etwa in dem diese durch pflichtwidriges Verhalten begünstigt wird, selbst der Bestechung beschuldigt ist oder ansonsten in einem zurechenbaren Austauschverhältnis zu den vorgeworfenen Handlungen stand). Zu diesem Zweck wird für die Beweisaufnahme des Untersuchungsausschusses auch wieder zweckmäßig sein, die Korrespondenzen mit den im Untersuchungsgegenstand genannten Personen einerseits und Vertreterinnen und Vertreter der Bundesverwaltung andererseits vorlegen oder ggf. auswerten zu lassen.
Ebenfalls Teil dieses Beweisthemas – in Abgrenzung zu Beweisthema 4 – sind synallagmatische Verhältnisse mit ÖVP-nahen Milliardären zuzurechnenden Unternehmen, wie insbesondere Werk- und Dienstleistungsverträge.
Im Rahmen dieses Beweisthemas sind daher folgende Fragen zu klären:
• Wurde der Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz gegenüber den im Untersuchungsgegenstand genannten Personen eingehalten?
• Wurden die im Untersuchungsgegenstand genannten Personen bevorzugt in Regierungstätigkeiten eingebunden?
• Ließen sich Amtsträger von im Untersuchungsgegenstand genannten Personen Vorteile anbieten oder haben diese sogar angenommen und was war die gewünschte Gegenleistung im Bereich der Vollziehung?
• Erhielten die im Untersuchungsgegenstand genannten Personen Steuerbegünstigungen oder Steuernachlässe, etwa im Zuge von Abgabenprüfungen?
• Wurden Projekte von im Untersuchungsgegenstand genannten Personen aus Förderprogrammen des Bundes unterstützt und wenn ja, in welcher Höhe?
• Erhielten die im Untersuchungsgegenstand genannten Personen privilegierten Zugang zu Organen der Vollziehung und allenfalls sogar besondere (im Sinne zB von beschleunigte) Verfahren für sich oder von ihnen benannte Dritte und aus welchem Grund bzw auf Veranlassung von wem innerhalb der Verwaltung?
• Intervenierte die politische Führungsebene der Bundesministerien in Verwaltungsverfahren und -abläufe betreffend die im Untersuchungsgegenstand genannten Personen?
3. Kooperationen staatsnaher Unternehmen mit ÖVP-nahen Milliardären
Staatliche und staatsnahe Unternehmen kooperieren in einer Vielzahl von Fällen mit Unternehmen von ÖVP-nahen Milliardären. Insbesondere im Immobilienbereich sind durch die BIG bzw ARE entsprechende Kooperationen dokumentiert, über deren Hintergründe gerade angesichts der tiefen Involvierung der politischen Führungsebene der Verwaltung Zweifel bestehen. Die Konstruktionen sind dabei regelmäßig so gewählt, dass im Rahmen von Joint Ventures dem Bund keine Entscheidungsbefugnisse (mittelbar über die staatlichen Unternehmen) zukommt. Auch hier ist für den Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegenstand wiederum maßgeblich, dass sich die Kooperation auf Unternehmen bezieht, die als Teil des Vermögens von ÖVP-nahen Milliardären zuzurechnen sind. Die geplante Privatisierung der Post AG durch die ÖVP-Regierungsmitglieder ist daher nicht untersuchungsgegenständlich, sofern als Käufer nicht eine im Untersuchungsgegenstand genannte Person Interesse bekundete. Sehr wohl umfasst wäre auf Grund des Kaufinteresses der Signa jedoch die geplante Privatisierung der ARE.
In diesem Zusammenhang sind insbesondere auch die ÖBAG und die ABBAG sowie die FIMBAG von besonderem Interesse für die Aufklärung. Gerade im Rahmen dieser Gesellschaften wurden enorme Vermögenswerte der Republik verwaltet, ohne dass bislang eine entsprechende parlamentarische Kontrolle stattgefunden hat. Die
entsprechenden Investitionen und Transaktionen sowie Rechtsbeziehungen dieser Unternehmen (mittelbar) mit den im Untersuchungsgegenstand genannten Personen, deren Einbeziehung in entsprechende Planungen sowie in die Entscheidungsfindung etwa im Zuge des Investment Committee der ÖBAG bilden daher den Gegenstand des zweiten Beweisthemas.
Folgende Fragen sind im Rahmen dieses Beweisthemas zu klären:
• Welche Informationen wurden den im Untersuchungsgegenstand genannten Personen zur Verfügung gestellt (etwa durch Bestellung in Organe von staatsnahen Unternehmungen) und ermöglichten diese Informationen ihnen den Erhalt oder Ausbau ihres Vermögens?
• Von welchen Unternehmungen des Bundes wurde mit Unternehmen von im Untersuchungsgegenstand genannten Personen zusammengearbeitet und aus welchen Gründen, insbesondere durch die BIG/ARE und den „Österreich-Fonds“ der ÖBAG?
• In welchem Ausmaß und aus welchen Gründen wurden Unternehmen, die den im Untersuchungsgegenstand genannten Personen zuzurechnen sind, von Bundesorganen – allenfalls im Wege der Bundesbeschaffung GmbH – beauftragt?
• In welchem Ausmaß arbeiteten Stiftungen und Fonds des Bundes wie der Österreichische Integrationsfonds oder der Österreichische Fonds zur Stärkung und Förderung von Frauen und Mädchen mit den im Untersuchungsgegenstand genannten Personen zusammen?
4. Staatliche Aufsicht
In Unterscheidung zum zweiten Beweisthema dient das vierte Beweisthema – wiederum im Hinblick auf die Bevorzugung der im Untersuchungsgegenstand genannten Personen – der über- und nachprüfenden Tätigkeit von Bundesorganen. Dies umfasst
insbesondere die Ausübung der staatlichen Aufsicht durch die jeweiligen Aufsichtsbehörden in Zusammenhang mit möglicherweise bereits unter Beweisthema 1 behandelten Sachverhalten.
Dieses Beweisthema dient somit der Überprüfung der Effektivität der eingerichteten Kontrollmechanismen bis hin zur Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs im Zuge allfälliger Strafverfahren. Auch hier kommt es wieder darauf an, dass die Vorgangsweise der Verwaltungsorgane in Zusammenhang mit den Handlungen oder Vermögen von ÖVP-nahen Milliardären steht, wobei die jeweiligen Verfahren gesamtheitlich zu betrachten sind. Es dürfen einzelne Teile der jeweiligen Verfahren nicht abgesondert oder losgelöst werden, sofern es sich jeweils um ein einheitliches Verfahren handelt, da nur auf diese Art dem Untersuchungszweck entsprochen werden kann (gerade in solchen Verfahren ist eine mögliche Bevorzugung der im Untersuchungsgegenstand genannten Personen im Vergleich zu den weiteren am selben Verfahren beteiligten Personen zu untersuchen). So ist insbesondere die Art der Führung von Strafverfahren gegen (allenfalls ua) die im Untersuchungsgegenstand genannten Personen sowie das ihnen zurechenbare Vermögen (einschließlich der ihnen zuzurechnenden Unternehmen) Gegenstand dieses Beweisthemas sowie allfällige Maßnahmen, die von höheren Verwaltungsebenen im Zuge der Dienst- und Fachaufsicht im Hinblick auf diese Verfahren getroffen wurden. Es ist daher auch der gesamte Aktenbestand des jeweiligen Verfahrens dem Ausschuss vorzulegen.
Folgende Fragen sind im Rahmen dieses Beweisthemas zu klären:
• Wurden Aufsichtsbehörden im Zusammenhang mit den im Untersuchungsgegenstand genannten Personen tätig und mit welchen Ergebnissen?
• Wurde durch Leitungsorgane im Wege von Weisungen oder informell auf Aufsichts- oder Strafverfahren, von denen die im Untersuchungsgenstand genannten Personen (wenn auch nicht alleine) betroffen waren, eingewirkt und wenn ja, auf welche Art?
Zum Datenschutz:
Festgehalten wird, dass in diesem Verlangen lediglich am Tag der Einbringung dieses Verlangens öffentlich verfügbare Daten verarbeitet werden, an denen somit kein Geheimhaltungsinteresse bestehen kann.
*****
Präsident Ing. Norbert Hofer: Bitte, Frau Abgeordnete. (Abg. Greiner – in Richtung Abg. Tanja Graf –: Du bist schon aufgerufen! – Abg. Leichtfried: Geht schon! – Abg. Ragger: The floors is yours!)
Abgeordnete Tanja Graf (ÖVP): Herr Präsident! Geschätzter Minister! Liebe Kollegen und Kolleginnen! Liebe Zuschauer vor den Bildschirmen und hier auf der Galerie! Mein Kollege Loacker hat eben erklärt, was Nachtschwerarbeit bedeutet, welche Personengruppe es betrifft. Es betrifft die Personengruppe, die in einer überwiegenden Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr in der Früh in den Unternehmen tätig ist.
Wir wissen: In Österreich haben wir eine Industrie, in der sehr ausgeprägt Schichtarbeit geleistet wird. Die Arbeitnehmer, die wirklich fleißig Schichtarbeit verrichten, bekommen mit diesem Gesetz eine Sonderruhezeit, ein Sonderruhegeld, um – wie schon gesagt – einen eigenen Bereich in der Pension zu haben.
Stellen wir uns einmal das Bild, das Herr Loacker eben gezeichnet hat, vor: dass es gegenüber anderen Unternehmen unfair ist, die keine Schichtarbeit haben. Wenn wir in Österreich keine Schichtarbeit hätten, würden einige Produkte nicht zeitgerecht da sein oder einige Produkte gar nicht in der Größenordnung, wie wir sie brauchen, produziert werden. Ich sehe es schon positiv, dass Mitarbeiter, die gerne in der Schichtarbeit arbeiten, ein Sonderruhegeld bekommen.
Es hat schon einen Grund, warum dieser Nachtschwerarbeitsbeitrag von 3,8 Prozent nächstes Jahr eingefroren wird: Aufgrund dessen, wo wir derzeit im europäischen Vergleich bei den Lohnnebenkosten stehen, wollen wir in Österreich keine Lohnnebenkostenerhöhung haben. Daher ist es legitim, diesen Betrag einzufrieren. Er wird für ein Jahr eingefroren, das heißt also nicht, dass das ein Dauerrecht sein soll.
Wir werden keine Erhöhung der Lohnnebenkosten machen – ganz im Gegenteil: Unser Bundesminister Martin Kocher setzt sich laufend für die Senkung der Lohnnebenkosten ein. Mit 1. Jänner 2024 werden die Arbeitslosenversicherungsbeiträge um 0,1 Prozent gesenkt. Davon profitieren nicht nur die Unternehmer, sondern auch alle Arbeitnehmer mit der Reduktion der Arbeitslosenversicherungsbeiträge um 0,05 Prozent. Das ist eine Entlastung im Gesamtbereich von 100 Millionen Euro für unsere Arbeitnehmer und unsere Arbeitgeber. Ich glaube, wir sollten den Standort Österreich schon absichern und nicht Lohnnebenkosten verursachen.
Was noch Kollegen Loacker betrifft: Ich bin ganz erstaunt, dass er sich für eine Erhöhung der Lohnnebenkosten einsetzt, obwohl sich die NEOS immer wieder für eine liberale Wirtschaft einsetzen. (Abg. Michael Hammer: Das ist eine linke Partei! Die neue Linke! – Abg. Meinl-Reisinger: Na geh! Tja, das haben wir gesehen in den letzten drei Tagen ... die neue Linke ...! Eine mutige Ansage!) Irgendwie läuft da momentan ein bisschen etwas verkehrt bei euch. – Danke. (Beifall bei der ÖVP.)
13.56
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Dietmar Keck. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Dietmar Keck (SPÖ): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Meine Damen und Herren! Ich habe mir gestern die Reden der Abgeordneten vom
3. Juli 1981 sehr intensiv durchgelesen, denn an diesem Tag wurde das Nachtschwerarbeitsgesetz im Hohen Haus diskutiert. Es waren in diesem Haus drei Parteien: die SPÖ, die ÖVP und die Freiheitliche Partei, die in ihren Reden darum gerittert haben, wer dieses Gesetz erfunden hat, wer es eingebracht hat, denn es ist notwendig, für die Menschen, die in der Nacht arbeiten und dabei auch noch Schwerarbeit leisten, etwas zu tun. Das ist auch vollkommen richtig. Dieses Gesetz haben wir schon viele Jahrzehnte und man kann damit Menschen, die diese intensive, schwere Tätigkeit wirklich lange machen, vorzeitig in Pension gehen lassen, ohne dass sie irgendwelche Nachteile dadurch haben.
Jetzt zu Kollegen Loacker, weil er die Kosten so bekrittelt hat: Es gibt viele Kollegen, und ich kenne auch viele, die 19 Jahre lang Nachtschwerarbeit machen, aber das Reglement mit der Dauer von 20 Jahren der Lebensarbeitszeit nicht erfüllen, weil sie dann den Job wechseln, und diese Regelungen des Nachtschwerarbeitsgesetzes dann nicht in Anspruch nehmen können, obwohl zum Beispiel 19 Jahre Beiträge eingezahlt wurden. Ich kenne viele Kollegen, die diese Art der Tätigkeit nur 14 Jahre – das ist die zweite Regelung in diesem Gesetz –ausgeübt haben, 14 Jahre lang wurden Beiträge einbezahlt, aber sie können diese Bestimmungen nicht in Anspruch nehmen, weil sie die 15 Jahre nicht erfüllen. Ich denke, auch da haben wir eine Senkung der Kosten drinnen.
Gleichzeitig wissen wir auch, dass es Unternehmen gibt, die versuchen, das Reglement der Nachtschwerarbeit zu umgehen, wenn eine Verteuerung kommt. Wir haben zum Beispiel viele Fälle erlebt, bei denen es um Lärm geht: Dazu gibt es einen Passus, dass Menschen Nachtschwerarbeit verrichten, wenn der Pegel bei über 85 dB liegt. Es gibt Unternehmen, die dann versuchen, den Pegel auf 84,9 dB herabzusenken, damit sie sich die Beiträge ersparen.
Ich denke, die Variante, die wir jetzt gewählt haben – dass wir diese Beiträge für die Unternehmen nicht erhöhen –, dient den Arbeitnehmern genauso wie den Arbeitgebern, da auch viele im öffentlichen Dienst arbeiten – denken wir an die Krankenschwestern, die OP-Schwestern, die vom Nachtschwerarbeitsgesetz
umfasst sind. Es fallen viele in das Gesetz hinein, denen wirklich damit geholfen ist, dass es das gibt. (Beifall bei der SPÖ.)
Abschließend muss ich auch sagen, dass es notwendig wäre, über eine Novellierung dieses Gesetzes nachzudenken, denn viele Erschwernisse haben sich ja im Zeitraum dieser 40 Jahre verändert, und da sollte man schauen, dieses auf einen neueren, moderneren Stand zu bringen. (Beifall bei der SPÖ.)
13.59
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt Frau Dr. Dagmar Belakowitsch. – Bitte, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete Dr. Dagmar Belakowitsch (FPÖ): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Sehr geehrte Damen und Herren! Ja, selbstverständlich werden wir dieser Novelle unsere Zustimmung geben. Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass darauf geschaut wird, dass die Lohnnebenkosten nicht noch unnötig ansteigen. Ich meine, wir haben ja schon eine Steuerquote von 43 Prozent.
Ich glaube, wir sollten das aber gleichzeitig auch zum Anlass nehmen, einmal darüber nachzudenken, wie man auch weiter Lohnnebenkosten senken kann. Da gäbe es ganz viele Ideen, ganz viele Ansätze. Das wäre natürlich Aufgabe der Bundesregierung, auch des Finanzministers – jetzt ist leider Gottes die Budgetberatung schon zu Ende gegangen. Meine Damen und Herren, das wäre ein ganz wesentlicher Beitrag, den wir leisten könnten, um unseren Wohlstand, der ja doch ein bisschen gelitten hat, weiter aufzubauen und auch unsere Wirtschaft ein bisschen anzukurbeln. Das hätten wir ganz, ganz dringend notwendig.
Ein Punkt, den ich im Zuge einer solchen Debatte schon noch einmal ansprechen möchte: Leistung muss sich auch lohnen! – Dazu, meine Damen und Herren der Bundesregierung und Abgeordneten der Bundesregierung, mein Appell: Bitte denken Sie noch einmal darüber nach – die Langzeitversicherung war ein guter
Beitrag –, jenen Personen, die tatsächlich 45 Jahre in das System eingezahlt haben, die dieses System erhalten haben, auch tatsächlich abschlagsfrei eine Pensionierung zu ermöglichen!
Das haben Sie mit einem Federstrich weggewischt, und jetzt steht der Herr Klubobmann da und sagt: Alle sollen länger arbeiten! – Denen, die länger arbeiten, wird immer noch mehr und immer noch mehr aufgebrummt – ich glaube, davon müssen wir endlich wegkommen, sodass die Leistungsträger auch tatsächlich entlastet werden –, während jene, die es sich im sozialen Bett gemütlich gemacht haben, kaum dazu motiviert werden, von dort herauszukommen und auch ihren Beitrag zu leisten. Da würde ich Sie wirklich bitten: Denken Sie darüber nach! Handeln Sie im Interesse der arbeitenden Bevölkerung! (Beifall bei der FPÖ.)
14.01
Präsident Ing. Norbert Hofer: Ich darf Herrn Bundesminister Gerhard Karner bei uns im Hohen Haus begrüßen und bitte nun Frau Abgeordnete Bettina Zopf ans Rednerpult. – Bitte schön.
Abgeordnete Bettina Zopf (ÖVP): Herr Präsident! Geschätzte Herren Minister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuseherinnen und Zuseher auf der Galerie und zu Hause vor den Fernsehbildschirmen! Das Nachtschwerarbeitsgesetz wurde schon von meinen Vorrednern ausführlich erklärt und es wurde genau dargestellt, worum es geht. Ich muss natürlich jetzt auch ganz klar sagen, ich finde es toll, dass wir hier über vier Parteien hinweg eine Einigung haben, aber es haben sich natürlich diese vier Parteien in der Vergangenheit mit diesem Thema auch schon auseinandergesetzt. Es wurde auch in den vergangenen Jahren immer so gemacht: Um die Wirtschaft nicht zu belasten und um den Standort nicht zu gefährden, hat man einfach die Erhöhung ausgesetzt, und der Bund hat Mittel in die Hand genommen, um das zu unterstützen. Das ist auch der richtige Weg, dass wir das machen, dass wir Österreich stärken.
Heute bin ich gefragt worden, wie denn das ausschaut, warum denn manchmal die Opposition kein Verständnis für die Regierung hat. Das ist heute wieder ein praktisches Beispiel: Alle, die sich in der Regierung mit dem Thema schon auseinandergesetzt haben und das tatsächlich auch in der Regierung durchführen mussten, machen mussten, haben natürlich auch Verständnis für diese Themen. Für Themen hat man immer nur dann kein Verständnis, wenn man es selber in der Regierung nicht durchgeführt hat. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Loacker: Willst du sagen, wir sind deppert? Willst du das sagen? Reiß dich zusammen!)
Herr Kollege Loacker, ich muss auch eines dazusagen (Abg. Loacker: Reiß dich zusammen, ich sag’s da! – Heiterkeit bei Abgeordneten der SPÖ): Man muss natürlich schon auch unterscheiden: Ist es ein Versicherungsprinzip oder ist es ein Bankenprinzip? (Abg. Loacker: Eben! Es ist ein Versicherungsprinzip! Das ist es! Das verstehst du nicht! – Ruf bei der ÖVP: Na! – Abg. Loacker: ... Beiträge reinkommen!) – Versicherungsprinzip heißt, dass ich auch unterschiedliche Maßnahmen setzen kann, und wenn das Versicherungsprinzip nicht reicht, dann muss man die Mittel von woanders hernehmen, um den Standort der Wirtschaft zu stärken und zu unterstützen, Herr Kollege Loacker! Das ist uns trotzdem ganz einfach wichtig.
Ich freue mich, dass wir bei diesem Tagesordnungspunkt über vier Parteien hinweg eine Einigung haben. – Danke. (Beifall bei der ÖVP.)
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
Wünscht die Frau Berichterstatterin ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall.
Wir gelangen daher zur Abstimmung über den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 2284 der Beilagen.
Ich ersuche jene Damen und Herren, die für diesen Gesetzentwurf sind, um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist mehrheitlich angenommen.
Wir kommen zur dritten Lesung.
Ich bitte jene Damen und Herren, die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, um ein diesbezügliches Zeichen. – Auch das ist die Mehrheit. Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung angenommen.
Bericht des Ausschusses für innere Angelegenheiten über die Regierungsvorlage (2177 d.B.): Bundesgesetz zur Unterstützung von Rettungs- und Zivilschutzorganisationen (Rettungs- und Zivilschutzorganisationen-Unterstützungsgesetz) (2287 d.B.)
Präsident Ing. Norbert Hofer: Wir gelangen zum 19. Punkt der Tagesordnung. Ich darf hier auch unsere Zuhörer recht herzlich begrüßen.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet .
Zu Wort gelangt nun Abgeordneter Mag. Andreas Hanger. – Bitte, Herr Abgeordneter. (Abg. Hanger begibt sich aus den hinteren Bankreihen zum Redner:innenpult. – Abg. Köchl: Die Einsatzkräfte sind schneller wie du! – Abg. Meinl-Reisinger: Schnell wie die Feuerwehr? Bitte nicht!)
Abgeordneter Mag. Andreas Hanger (ÖVP): Danke, Herr Präsident, vor allem auch für die zeitliche Überbrückung! Jetzt habe ich ja fast eine Schnelligkeit wie unsere Einsatzkräfte gebraucht. – Herr Bundesminister! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte gar nicht verheimlichen, dass ich momentan eine sehr große Freude habe, weil mich dieses Gesetz, das jetzt zur Beschlussfassung vorliegt, in den letzten Wochen
und Monaten doch sehr, sehr intensiv beschäftigt hat und wir auch schon eine intensive Beratung im Innenausschuss hatten, und es ja derzeit so aussieht, dass wir hier ein Einvernehmen zwischen allen Parlamentsparteien herstellen können.
Ich halte das auch für wichtig, weil es in unserem Rettungs- und Zivilschutzorganisationen-Unterstützungsgesetz darum geht, genau diese Strukturen zu stärken.
Es freut mich sehr, dass ich auch Vertreter der Einsatzorganisationen hier heute bei uns im Hohen Haus begrüßen darf: Es ist das Rote Kreuz da, es ist der Arbeiter-Samariter-Bund da, es sind die Malteser da, es sind die Johanniter da, und es sind auch unsere Sonderrettungsdienste da, und das war uns ein besonderes Anliegen – die Sonderrettungsdienste: die Bergrettung, die Höhlenrettung und die Wasserrettung. Ich darf die Damen und Herren, die heute zu uns gekommen sind, auch herzlich begrüßen. Ich glaube, sie verdienen sich durchaus auch einmal einen Applaus. (Beifall bei ÖVP, SPÖ und Grünen, bei Abgeordneten der FPÖ sowie der Abg. Meinl-Reisinger.)
Es ist insofern bemerkenswert, weil wir wissen, dass wir uns bei den Herausforderungen, die wir in unserer Republik haben, und natürlich auch bei Naturkatastrophen, die auf uns – vielleicht sogar in einem erhöhten Ausmaß – in der Zukunft zukommen werden, Gott sei Dank auf euch, auf Sie verlassen können. Das ist enorm wichtig und wertvoll. Das sind besonders auch unsere Sonderrettungsdienste – ich habe es schon gesagt: Bergrettung, Höhlenrettung, Wasserrettung – und die Einsatzorganisationen, die ausschließlich ehrenamtlich und freiwillig organisiert sind. Die meisten unserer Rettungsdienstträger machen das ja in einer Mischform, weil es dort natürlich auch gut ausgebildete hauptberufliche Mitarbeiter braucht.
Und das möchte ich schon einleitend auch feststellen: Wir können in unserer Republik schon stolz darauf sein, dass wir eines der besten Systeme haben, wenn es um die notfallmedizinische Versorgung unserer Bevölkerung geht, wenn es darum geht, im Katastrophenfall für unsere Bevölkerung da zu sein.
(Beifall bei der ÖVP sowie der Abgeordneten Maurer und Stögmüller.) – Da darf man wirklich applaudieren.
Die Genese des Gesetzes hat in etwa vor zwei Jahren begonnen, als wir uns dazu entschlossen haben, unsere Feuerwehren zu unterstützen. Diese möchte ich schon auch erwähnen: Unsere Feuerwehren sind natürlich auch ein Leuchtturm in der Ehrenamtlichkeit, und wir haben unseren Feuerwehren 20 Millionen Euro zusätzlich aus Bundesmitteln zur Verfügung gestellt. Dann kamen – natürlich berechtigt – die anderen Rettungsdienste und haben gesagt: Na ja, da gibt es aber auch noch andere Organisationen.
Wir haben uns dann auf den Weg gemacht, ein, glaube ich, wirklich sehr gutes Gesetz auf den Weg zu bringen. Es war notwendig, zwischen den Einsatzorganisationen einen Verteilungsschlüssel zu finden, und dieser wurde dann im Einvernehmen gemacht. Ich bedanke mich sehr dafür, für diese gemeinsame Stellungnahme, in der alle sieben Rettungsdienstträger gesagt haben: Ja, das ist ein Verteilungsschlüssel, den wir mittragen können. – Wir alle gemeinsam wissen, wenn es um Verteilungssituationen geht, dann ist das halt immer auch eine Herausforderung.
Ein Punkt, den ich ganz explizit noch anführen möchte, ist folgender – und das war mir lange Zeit auch nicht bewusst –: Wir adressieren jetzt mit diesem Gesetz alle Einsatzorganisationen, die auf der Länderebene zum Katastrophenschutz verpflichtet werden können.
Das muss man ganz ehrlich sagen: Wir haben auf der einen Seite Organisationen, die ehrenamtlich, freiwillig agieren, aber wenn es zum Einsatz kommt, dann ist eigentlich Schluss mit der Freiwilligkeit, dann gibt es sogar einen gesetzlichen Auftrag. Dafür möchte ich mich explizit bedanken, weil natürlich diese Krisensituationen auch Strukturen brauchen, mit denen wir schlagkräftig sind.
Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, mich beim Herrn Bundesminister zu bedanken. Er hat diese Idee sehr stark mitgetragen, vor allem auch die Idee, das
Ehrenamt und die Freiwilligkeit mit diesem Gesetz zu unterstützen. Es geht ja darum, dass wir nicht den laufenden Betrieb finanzieren, das passiert über die Länder, es geht darum, dass wir die Resilienz der Einsatzorganisationen stärken, dass wir uns noch besser auf Krisensituationen in der Zukunft vorbereiten.
Ich darf da wirklich dir, Herr Bundesminister, herzlich dafür danken – vor allem auch dafür, die Ehrenamtlichkeit, die Freiwilligkeit hervorzustreichen, weil das, glaube ich, schon auch in der Grunderzählung enorm wichtig ist. Wir brauchen auch zukünftig in unserer Republik – vielleicht noch viel mehr als momentan – das Engagement, die Eigenverantwortung, die Dinge auch selber in die Hand zu nehmen und nicht nur darauf zu warten, was staatliche Einrichtungen machen.
Ich halte das in der Grundausrichtung der Republik für unglaublich wichtig. Ihr seid da Vorbild für dieses Denken, für dieses Handeln, die Dinge eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen! Ich darf mich sehr herzlich dafür bedanken, dass das jetzt gelungen ist! Und ja, ich freue mich sehr, wenn es wirklich gelingt, dass alle Fraktionen diesem Gesetz zustimmen. – Vielen Dank. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
14.08
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt Abgeordneter Klaus Köchl. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Klaus Köchl (SPÖ): Geschätzter Herr Präsident! Herr Minister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich im Namen der SPÖ-Fraktion bei allen freiwilligen Helferinnen und Helfern in Österreich, die sich tagtäglich dafür einsetzen, dass wir uns in diesem Land sicher fühlen können, herzlichst bedanken. (Beifall bei der SPÖ sowie des Abg. Schallmeiner.)
Das ist keine Selbstverständlichkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass sich Leute freiwillig in ein Amt stellen, in dem sie große Verantwortung tragen müssen, für das sie eine gute Ausbildung haben müssen und für das sie vor allem
viel Freizeit opfern, die wahrscheinlich in der Familie abgeht. – Trotzdem sind Sie es, die das für uns machen. Ohne Freiwilligkeit würde Österreich, würde dieses Land nicht so gut dastehen, wie es heute dasteht. (Beifall bei der SPÖ.)
Erfreulich bei diesem Gesetz ist, dass die Organisationen – der Arbeiter-Samariter-Bund, der Bergrettungsdienst, die Höhlenrettung, das Rote Kreuz, die Wasserrettung, die Malteser und die Johanniter – bereit waren, bei diesem Gesetz mitzuarbeiten und gemeinsam etwas ausgearbeitet haben, um sicherzustellen, dass die Leute, die freiwillig im Einsatz sind, bestens ausgerüstet sind. Das wird mit diesem Gesetz ermöglicht.
Das findet in Abstimmung mit den Ländern statt – es geht um 18 Millionen Euro –, und da möchten wir uns wünschen, Herr Minister, dass es eine gute Zusammenarbeit und einen guten Entwurf gibt, alle Bundesländer in Österreich so auszustatten, dass es mit den Organisationen letztendlich passt.
Ich bin auch sehr stolz darauf, dass die Dachorganisationen 2 Millionen Euro zur Verfügung gestellt bekommen, worüber sie selbst entscheiden können. Sie wissen selbst am besten, wie sie dieses Geld einsetzen. Ich bin davon überzeugt, dass sie das sicher fachmännisch und sehr sozial machen werden.
Letztendlich freut es mich auch, dass der Zivilschutz 2 Millionen Euro bekommt. Der Zivilschutz ist zum Beispiel bei uns in Kärnten – das kann ich auch als Bürgermeister von Liebenfels sagen – eine der wichtigsten Einrichtungen, die man sich vorstellen kann. Ich möchte mir nicht ausmalen, was wäre, wenn der Zivilschutz in Kärnten nicht Woche für Woche, Monat für Monat aufklären würde, was zu tun ist, wenn es einen Blackout gibt, bei einer Katastrophe – die es immer öfter in unserem Land gibt –, bei Extremwetterlagen, bei der Ausbreitung übertragbarerer Krankheiten, bei einer Gefährdung der Infrastruktur. Da ist der Zivilschutz einer, der die Haushalte aufklärt, der die Menschen sicher dabei macht, wie man dann vorzugehen hat, und das funktioniert ausgezeichnet.
Ich darf mich noch einmal bei allen Freiwilligen und auch hier im Hohen Haus bei den Nationalrätinnen und Nationalräten bedanken, dass dieses Gesetz beschlossen werden kann. (Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordneten der ÖVP.)
14.12
Präsident Ing. Norbert Hofer: Nächster Redner ist Abgeordneter Maximilian Linder. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Maximilian Linder (FPÖ): Herr Präsident! Herr Minister! Geschätzte Kolleginnen, geschätzte Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren auf der Galerie! Das Gesetz, das heute hier beschlossen wird, wird selbstverständlich auch von uns Freiheitlichen unterstützt und mitgetragen.
Ich habe es als Bürgermeister 2016 selbst erlebt, was es bedeutet, wenn innerhalb von sechs Tagen zweimal 40 Häuser mit allem Drum und Dran verschüttet werden. Wir haben es voriges Jahr miterlebt, dass in Treffen und in Arriach Unwetter ganz, ganz grauslich gewütet haben. Man weiß dann auch als Verantwortlicher, wie wichtig es ist, dass man jederzeit Rettungsorganisationen an seiner Seite hat.
Es sind nicht nur das Bundesheer und die Feuerwehr, die ja wirklich den Hauptteil – sage ich jetzt einmal –tragen, sondern auch ganz viele andere Organisationen, wie sie heute schon genannt wurden: das Rote Kreuz, der Samariterbund, die Kriseninterventionsarbeit machen, weil die Leute traumatisiert sind, weil sie einfach geschockt sind, die Wasser- und Bergrettung bei den Evakuierungsarbeiten, beim Bergen der Menschen, die Hundebrigade beim Suchen von Vermissten in solchen Einsatzfällen.
Es ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich, und ich glaube, dass sich viele dieser kleineren Organisationen ganz schwertun, entweder beim Sammeln Geld zu bekommen oder Feste zu organisieren; eine große Feuerwehr tut sich da manchmal ein bisschen leichter. Deswegen, denke ich, ist es ganz wichtig, dass
auf diese Art auch diese Vereine und diese Hilfsorganisationen unterstützt werden.
Einen kleinen Kritikpunkt haben wir Freiheitliche: dass die Evaluierung des Gesetzes erst in vier Jahren stattfindet, also 2028. Ich glaube, dass gerade dann, wenn ein Gesetz neu eingeführt wird, sehr schnell Fehler und Probleme auftreten und dass man vielleicht schon nach zwei, höchstens nach drei Jahren eine Evaluierung machen sollte. Vielleicht lässt sich da noch irgendetwas machen, wenigstens dass man es einmal in einem Ausschuss behandelt und schaut, wo Probleme sind.
Auf alle Fälle werden wir dem Gesetz zustimmen. – Allen Freiwilligenorganisationen auch von uns Freiheitlichen ein herzliches Dankeschön für die Arbeit. (Beifall bei der FPÖ und bei Abgeordneten der ÖVP.)
14.14
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt Herr Abgeordneter David Stögmüller. – Bitte schön, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter David Stögmüller (Grüne): Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Minister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sie alle kennen sie: Rotes Kreuz, Samariterbund, Johanniter, Malteser. Wir kennen aber genauso die Bergrettung, die Wasserrettung, die Höhlenrettung. Sie alle haben eines gemeinsam, sie verlassen sich auf ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vier von zehn Österreicher:innen sind ehrenamtlich aktiv, und von denen arbeitet jede:r Zweite in einer der Einsatzorganisationen auch aktiv mit.
Ich selbst komme vom Roten Kreuz, aber ich möchte Ihnen heute eine Organisation vorstellen, die ich im Sommer besucht habe und die mir wahnsinnig imponiert hat, die meiner Meinung nach immer viel zu wenig Aufmerksamkeit
bekommt. Das ist die Wasserrettung. Ich habe eine Wasserrettung in Oberösterreich besichtigt, jene in Traunkirchen –am wunderschönen Traunsee –, und ich darf Ihnen ein paar Fakten berichten.
Allein im Jahr 2022 verzeichnete die Wasserrettung in Oberösterreich 245 Alarmeinsätze, 87 Personenrettungen, dazu kommen 1 350 Schwimmausbildungen mit Schüler:innen und 4 100 Stunden Jugendarbeit – verrichtet von 550 Mitarbeiter:innen in insgesamt 23 Dienststellen. Dafür kann man einmal Danke sagen. (Beifall bei den Grünen sowie bei Abgeordneten von ÖVP, SPÖ und NEOS.)
Eine Sache ist aber ganz besonders: Alle 550 Mitarbeiter:innen sind ehrenamtlich engagiert. In ganz Oberösterreich gibt es keinen einzigen hauptamtlichen Mitarbeiter bei der Wasserrettung – es sind geschätzt 50 000 Stunden freiwillige Arbeit pro Jahr aus Überzeugung. Das ist schon etwas wert.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die 550 Mitarbeiter:innen verrichten nicht nur alle diese Arbeit ohne Bezahlung, sie bleiben bis jetzt auch auf einem großen Teil der Kosten sitzen. So wurde mir zum Beispiel erzählt, dass 70 Prozent der Taucherausrüstung – Grundausstattung für die Wasserrettung, no na net – in der Traunkirchner Ortsstelle eigenfinanziert werden muss, Anschaffungen eigenfinanziert werden müssen, die Personenfahrten selbst finanziert werden müssen. Das ist nur ein kleiner Einblick in eine kleine Organisation, die mit diesen Herausforderungen arbeiten muss.
Es sind aber ehrenamtliche Kräfte, die tagein tagaus für Österreich arbeiten und tagtäglich mit den Herausforderungen konfrontiert waren. Ich sage waren, weil es Vergangenheit ist. Wir haben uns mit diesem Gesetz, das wir heute beschließen, ganz bewusst der kleinen Organisationen angenommen, um diese zu unterstützen, damit es endlich ein Ende hat, dass sie sich mit diesen Schwierigkeiten auseinandersetzen müssen.
Jährlich nehmen wir mit diesem Gesetz 21 Millionen Euro für die Heldinnen und Helden im Rettungs- und Katastrophenschutzwesen mit dem Ziel in die Hand,
die zuvor genannten Herausforderungen auch zu meistern: Wartung und Ersatz veralteter Ausrüstung, Beschaffung neuer Einsatzfahrzeuge, Ausbildung der nächsten Generation ehrenamtlicher Helfer:innen und Aufstockung der Vorsorgemittel für Katastrophenfälle.
Vergessen wird leider oft: Eine immer relevantere Rolle haben – Herr Minister, Sie wissen es – die Kämpfe gegen die Auswirkungen der Klimakatastrophe. Da sind die Einsatzorganisationen, die Menschen direkt an der Front. Besonderes Augenmerk legen wir auf die Rettungsorganisationen mit vielen Ehrenamtlichen, die ohne die unermüdliche Leistung ihrer vielen Ehrenamtlichen nicht auskommen. 18 der 21,5 Millionen Euro werden konkret nach der Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen, den Einsätzen und anderen Kriterien verteilt.
Zum Abschluss: Ich weiß, mit Kollegen Hanger habe ich eine besondere Vergangenheit, und wir werden im nächsten Untersuchungsausschuss auch wieder zusammenkommen, aber ich möchte mich auch besonders bei ihm als Ehrenamtssprecher bedanken. Es hat gut funktioniert, wir haben hier eine gemeinsame Lösung gefunden. Ich glaube, wir haben einen großartigen Meilenstein in der ehrenamtlichen Arbeit gesetzt. An alle Ehrenamtlichensprecher:innen aller Fraktionen und besonders den Tausenden ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, den Held:innen an jedem Tag: vielen herzlichen Dank! – Vielen Dank. (Beifall bei den Grünen sowie bei Abgeordneten von ÖVP, SPÖ und NEOS.)
14.18
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt nun Frau Abgeordnete Dr. Stephanie Krisper. – Bitte, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete Dr. Stephanie Krisper (NEOS): Herr Präsident! Herr Minister! Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Hilfsorganisationen, die heute vor Ort sind! Wir schließen uns dem Dank der anderen Parteien an: Wir danken allen, die in diesen Hilfsorganisationen tätig
sind, ehrenamtlich viele Stunden investieren, um gerade dann, wenn es durch Naturkatastrophen oder andere Notstände Not am Mann und an der Frau gibt, einzuspringen.
Wir stimmen heute auch inhaltlich zu, aber mit einer Mahnung. Es bräuchte auch da ernsthafte Reformen, nämlich zweierlei: Einerseits müsste unserer Meinung nach glasklar werden, wo die Zuständigkeiten liegen. Da bräuchte es eine Kompetenzentflechtung bei Bund, Land und Gemeinden. Das wäre nötig.
Zudem wäre auch in diesem Bereich Transparenz wichtig, denn der Bund finanziert quer und weiß zu wenig, was das Ergebnis ist. Die Qualitätserfordernisse sind nicht klar, und ich denke, es hätten alle etwas davon, weil natürlich Organisationen, die Großartiges leisten, dann auch entsprechend klar bemessen werden würden. Klar wäre auch, wann sie noch mehr Unterstützung bräuchten, und andere wüssten, wo sie nachbessern müssten.
Wir bedauern auch, dass die Evaluierungsphase eine so lange ist und hoffen, dass man vielleicht doch davor schon ein Ergebnis sehen kann. Insgesamt stimmen wir aber natürlich zu und bedanken uns noch einmal sehr herzlich für die großartige ehrenamtliche Arbeit. (Beifall bei den NEOS sowie der Abgeordneten Gödl, Lindner und Stögmüller.)
14.20
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu einer Stellungnahme hat sich nun Herr Bundesminister Karner zu Wort gemeldet. – Bitte, Herr Bundesminister.
Bundesminister für Inneres Mag. Gerhard Karner: Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzte Damen und Herren Abgeordnete! Vor allem Vertreter der Blaulicht- beziehungsweise Rettungsorganisationen hier als Gäste im Hohen Haus! Es freut mich, dass Sie heute hier sind bei diesem, so wie es aussieht, einstimmigen Beschluss für unsere Rettungsorganisationen. Ich möchte mich auch bei meinen Vorrednerinnen und Vorrednern bedanken, denn wenn man
Abgeordnetem Hanger zugehört hat, dann spürt man, welch Vereinsmeier er ist und mit welcher Freude er mit vielen anderen dieses Gesetz diskutiert und vorbereitet hat. Wenn man aber auch den beiden Bürgermeistern Köchl und Linder zugehört hat, dann merkt man, dass sie tagtäglich mit Ehrenamtlichen arbeiten und wissen, was wir an unseren Ehrenamtlichen haben; oder auch Abgeordneter Stögmüller, der ein flammendes Plädoyer für die Wasserrettung hielt – ich möchte mich wirklich bedanken.
Ich möchte mich bei Ihnen, den Rettungsorganisationen, die Sie heute stellvertretend für alle Hundertausenden Ehrenamtlichen hier sind, im Namen der Bundesregierung für das, was sie tagtäglich mit großer Freude, mit unglaublich viel Herz und mit unglaublich viel Engagement tun, bedanken – vielen herzlichen Dank dafür. (Beifall bei ÖVP, SPÖ und Grünen.)
Es wurde zum Teil schon angesprochen: Ja, dieser Bundesregierung ist die Unterstützung unserer Freiwilligen enorm wichtig, daher ist das auch ein wesentlicher Teil des Regierungsprogrammes. Wir haben im letzten Jahr für die freiwilligen Feuerwehren ein Zusatzpaket mit rund 20 Millionen Euro jährlich geschnürt. Das wird für die freiwilligen Feuerwehren auch ausgegeben, weil es notwendig ist, weil die Herausforderungen intensiver und größer werden – es wurde angesprochen: beispielsweise durch die zunehmende Anzahl an Waldbränden.
Es waren zu Recht auch die Rettungsorganisationen, die gesagt haben: Auch in unserem Bereich werden die Herausforderungen mehr!, und daher kam es zu diesen Gesprächen, zu diesen Verhandlungen. Es ist jetzt eben vorgeschlagen, bis Ende 2028 pro Jahr 22 Millionen Euro auszuschütten: 18 Millionen Euro jährlich über die Bundesländer für Einsatzfahrzeuge, Einsatzmittel, Ausrüstung, 2 Millionen Euro für die Dachverbände – auch ein ganz wichtiger Punkt, damit bundesländerübergreifend koordinierende Arbeit unterstützt und finanziert werden kann –, und 2 Millionen Euro für den Zivilschutz – auch mehrmals zu Recht angesprochen: ganz wichtig im Bereich der Blackoutvorsorge oder auch für die sehr bekannte Kindersicherheitsolympiade, die mit vielen
Freiwilligen der Zivilschutzverbände in den Bundesländern, in den Bezirken immer wieder durchgeführt wird; auch dafür ein großes Dankeschön. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
Insgesamt bedeutet das 110 Millionen Euro für Rettungs- und Zivilschutzorganisationen in fünf Jahren. Das ist gut investiertes Geld, das ist richtig investiertes Geld. Ich bedanke mich nochmals im Namen der Bundesregierung, im Namen der österreichischen Bevölkerung bei Ihnen allen, die Sie tagtäglich ehrenamtlich für uns tätig sind und damit für die Sicherheit in diesem Land da sind. – Vielen herzlichen Dank. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
14.23
Präsident Ing. Norbert Hofer: Nächste Rednerin ist Frau Abgeordnete Eva-Maria Himmelbauer. – Bitte, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete Eva-Maria Himmelbauer, BSc (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bundesminister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Werte Zuseherinnen und Zuseher! Ein herzliches Willkommen den Einsatzorganisationen, Rettungsorganisationen! Dieses Jahr 2023 war wie auch die vorangegangenen Jahre sowohl in Österreich als auch in der Welt ereignisreich, wenn nicht sogar herausfordernd.
Angesichts dieser Ereignisse und Entwicklungen müssen wir uns bewusst machen, dass ein Leben in Frieden, Freiheit und Sicherheit keine Selbstverständlichkeit ist. Ich bin dankbar, dass wir trotz aller Herausforderungen nach wie vor ein Leben führen können, das vielen anderen Menschen in der Welt nicht vergönnt ist. Wir können auch stolz darauf sein, dass wir eine starke Zivilgesellschaft haben – Menschen, die sich in vielen Lebensbereichen, in Vereinen und oft ehrenamtlich engagieren und damit den Kitt unserer Gesellschaft darstellen.
26 Prozent der österreichischen Bevölkerung leisten Freiwilligenarbeit. Schaut man sich das Ranking der Ehrenamtsbereiche an, so stehen bereits an zweiter Stelle Katastrophenhilfe und Rettungsdienst.
Wir diskutieren das Rettungs- und Zivilschutzorganisationen-Unterstützungsgesetz, ein Gesetz, das die Krisenvorsorge in Österreich stärkt, das jene Organisationen finanziell stärkt, die im Katastrophenfall herangezogen werden, und das nicht zuletzt unseren großen Dank für den bedeutsamen Einsatz, den haupt- und ehrenamtliche Mitglieder tagtäglich leisten, ausdrückt. Mit diesem Gesetz stellen wir sicher, dass 22 Millionen Euro jährlich an die österreichweit und in den Bundesländern zur Katastrophenhilfe verpflichteten Einsatzorganisationen sowie an den Zivilschutz gehen, um im Katastrophenfall bestmöglich gerüstet zu sein und Resilienz zu stärken – das kann der Ankauf von Notunterkünften sein, der Ausbau von Lagern für Notfallverpflegung, Feldküchen, Wasseraufbereitungsanlagen, die Sicherstellung von medizinischer, psychosozialer Betreuungsleistung, von Fahrzeugen, Gerätschaften und Ausrüstungen.
Erwähnenswert ist, dass zum einen bei der Gesetzwerdung sehr eng mit den Rettungsorganisationen zusammengearbeitet wurde und beispielsweise der Verteilungsschlüssel, wie die Mittel an die Organisationen verteilt werden, auf deren Vorschlag basiert: 18 Millionen Euro an die Länderorganisationen anhand von Umsatzzahlen, Zahlen zu freiwilligen Ehrenamtlichen und deren Einsatzzahlen, 2 Millionen Euro an deren Dachorganisationen und 2 Millionen Euro an den Österreichischen Zivilschutzverband.
An dieser Stelle ebenfalls ein herzlicher Dank an die Zivilschutzorganisationen, die einen wertvollen Beitrag in der Aufklärung, Prävention und Information der Bevölkerung leisten. (Beifall bei der ÖVP sowie des Abg. Lindner.)
Zum anderen möchte ich erwähnen, dass wir mit diesem Gesetz auch die Interoperabilität aller finanzierten Geräte, Ausrüstungen und vielem mehr voraussetzen. Eine Katastrophe macht selten Halt vor Bundesländergrenzen,
umso mehr ist es unsere Zielsetzung, die Zusammenarbeit über Bundesländergrenzen hinaus in den Fokus zu rücken.
Das Rettungs- und Zivilschutzorganisationen-Unterstützungsgesetz reiht sich in einen Maßnahmenmix ein, um das ehrenamtliche Engagement zu unterstützen und zu stärken. Neben diesem Gesetz haben wir bereits das Freiwilligengesetz im Sommer 2023 beschlossen, wir haben im vergangenen Jahr, im Sommer 2022, das Katastrophenfondsgesetz für die Feuerwehren beschlossen und wir werden im kommenden Dezember auch das Gemeinnützigkeitsreformgesetz auf den Weg bringen, weil es uns wichtig ist, das Ehrenamt in Österreich zu stärken und all jenen Danke zu sagen, die tagtäglich im Einsatz sind. (Beifall bei der ÖVP, bei Abgeordneten der Grünen sowie des Abg. Köchl.)
14.27
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Mario Lindner. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Mario Lindner (SPÖ): Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Vertreterinnen und Vertreter der Einsatz- beziehungsweise Rettungsorganisationen! Vorweg mein ganz großer Dank an alle Ehren- und Hauptamtlichen und, weil es noch nicht erwähnt wurde, an alle Zivildiener aller Organisationen für euren großartigen Einsatz. (Beifall bei der SPÖ, bei Abgeordneten der Grünen sowie des Abg. Strasser.)
Es sei mir gestattet, besonders Danke meinen eigenen Sanis aus dem Bezirk Liezen, aber insbesondere meiner eigenen Ortsstelle Altenmarkt-Großreifling auszurichten. Und weil ich gerade bei Großreifling bin: Großreifling war eine Ortsstelle, die über 40 Jahre 365 Tage im Jahr 24 Stunden pro Tag rein ehrenamtlich geführt wurde, und das war eine riesengroße Leistung. – Danke dafür! (Beifall bei der SPÖ sowie des Abg. Schallmeiner.)
Danke an die Bundesrettungsorganisationen für den Vorschlag. Rettungsdienst ist ja Aufgabe der Bundesländer und der Gemeinden und der Bund kommt jetzt seiner Verpflichtung quasi auch nach, die Rettungsorganisationen zu unterstützen: insgesamt mit 22 Millionen Euro für die Rettungsorganisationen und speziell für den Katastrophenschutz.
Es sei mir aber auch erlaubt, zu sagen – wir haben gestern einen Antrag hier im Parlament bei der Debatte zum Budget eingebracht –, dass man die Mittel nicht bei 22 Millionen Euro belässt, sondern auf 30 Millionen Euro erhöht, um mit den 8 Millionen Euro zusätzlich die Bundesländer beziehungsweise die Einwohner:innenzahl zu berücksichtigen. Dieser Antrag wurde leider abgelehnt.
Ich darf mich auch dem kleinen Kritikpunkt betreffend den Evaluierungszeitraum anschließen, denn dieser ist auch uns zu lange. Wir würden uns wünschen, dass er kürzer wird, um schneller zu sehen, ob die Mittel auch wirklich wirken. (Beifall bei der SPÖ.)
Ich möchte das an einem Beispiel aufzeigen: Es macht nämlich einen Unterschied, aus welcher Region man kommt. Fährt man einen Einsatz bei zum Beispiel meiner Ortsstelle, dann ist man circa 3 Stunden unterwegs, weil die nächsten Krankenhäuser halt doch etwas weiter entfernt sind.
In der gleichen Zeit fahren zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen aus Graz vielleicht drei Einsätze. Daher ist es uns total wichtig, dass man speziell strukturschwache Regionen in dieser Frage unterstützt. (Beifall bei der SPÖ.)
Weil wir generell bei den Sanis sind, ist auch die Frage, was zu tun ist. Wir diskutieren im Gesundheitsausschuss unter anderem auch das Sanitätergesetz Neu beziehungsweise die neue Ausbildung, und eines ist ja zum Beispiel unverständlich – Kollegin Krisper hat es angesprochen –: Ich komme aus einer Region Steiermark-Oberösterreich-Niederösterreich, wo Notfallsanitäter:innen bei mir in der Steiermark ganz etwas anderes machen dürfen, als sie in
Oberösterreich oder in Niederösterreich machen dürfen. Das ist schon unerklärlich.
Oder – was im Bereich der Sanitäter wichtig ist –: dass wir endlich verwirklichen, dass das Gesundheitsberuferegister auch Sanis umfasst. Das wäre wegen der Datenlage wichtig. Generell sollten die Arbeitsbedingungen, die Rahmenbedingungen beziehungsweise die Entlohnung für Sanitäter:innen verbessert werden. Ich erinnere an den Berufsschutz oder – weil es der vorige Tagesordnungspunkt war – das Nachtschwerarbeitsgesetz: Bringen wir die Sanitäterinnen und Sanitäter endlich auch – analog zu den Feuerwehren – in die Nachtschwerarbeit! (Beifall bei der SPÖ.)
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Rettungsdienst ist ein Dreieck: der Rettungsdienst, der bodengebundene Notarztdienst und die Flugrettung beziehungsweise der Notarzthubschrauber. Es ist uns in diesem Zusammenhang wichtig, den Rettungsdienst zu stärken. Ich bleibe beim Beispiel meiner Region. Wenn es nämlich dort zu einen Einsatz kommt, dann ist der rettungstechnische Dienst einer kompletten Region ausgeräumt, weil wir nur ein Fahrzeug zur Verfügung haben. Darum ist uns auch wichtig, dass wir die strukturschwachen Regionen stärken.
Wir müssen schauen, dass wir wirklich in jeder Region in Österreich die Hilfsfrist einhalten. Wenn ich an den Herbst und den Winter denke, wenn der Hubschrauber vielleicht nicht rund um die Uhr fliegen kann: Da ist uns wichtig, dass der bodengebundene Notarzt gestärkt wird. In diesem Zusammenhang darf ich daran erinnern, dass es uns wichtig ist, dass wir endlich in den Steirischen Eisenwurzen einen bodengebundenen Notarztdienst bekommen. (Beifall bei Abgeordneten der SPÖ.)
Auch wenn das System Brüche und Schwierigkeiten hat, möchte ich mich zum Schluss wirklich bei den Ehrenamtlichen, bei den Hauptamtlichen und bei den
Zivildienern dafür bedanken, dass sie das System aufrechterhalten – mein Respekt, meine Anerkennung, mein Dank. (Beifall bei der SPÖ.)
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
Wünscht der Herr Berichterstatter ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall.
Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 2177 der Beilagen.
Ich ersuche jene Damen und Herren, die für diesen Gesetzentwurf sind, um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist einstimmig angenommen.
Wir kommen zur dritten Lesung.
Ich bitte jene Damen und Herren, die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, um ein diesbezügliches Zeichen. – Das ist einstimmig. Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung angenommen.
Bericht des Ausschusses für innere Angelegenheiten über die Regierungsvorlage (2202 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Meldegesetz 1991, das Personenstandsgesetz 2013 und das Namensänderungsgesetz geändert werden (2288 d.B.)
Präsident Ing. Norbert Hofer: Wir gelangen nun zum 20. Punkt der Tagesordnung.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Christian Oxonitsch. – Bitte schön, Herr Abgeordneter.
14.33
Abgeordneter Christian Oxonitsch (SPÖ): Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Dieser Gesetzentwurf hat ja eine zentrale Zielsetzung, nämlich auf der einen Seite EU-Vorgaben im Bereich der Digitalisierung Rechnung zu tragen und auf der anderen Seite eine Verwaltungsvereinfachung zu bringen. Tatsache ist aber, dass es durch diesen Gesetzentwurf in der derzeit vorliegenden Form – es soll zwar noch einen Abänderungsantrag geben, aber der wird sicherlich auch nicht dazu führen, ganz im Gegenteil – zu keiner Verwaltungsvereinfachung kommen wird.
Unserer Ansicht nach geht auch der Abänderungsantrag nicht weit genug, nämlich nicht weit genug, damit jenes Bundesland, das die Hauptlast dieses Gesetzes zu tragen hat – das ist in diesem Bereich eindeutig die Stadt Wien – und jetzt zwar ein bisschen mehr Zeit für die Vorbereitung gewinnt, in die Lage versetzt wird, mit den entsprechenden Ressourcen und Unterstützungen dieses Gesetz tatsächlich auch sinnvoll zu exekutieren.
Es ist auch den Einwendungen zu diesem Gesetzentwurf, gerade auch seitens der Stadt Wien, nicht entsprechend Rechnung getragen worden. Worum geht es? – In erster Linie natürlich ganz zentral um subsidiär Schutzberechtigte und deren Eintragung ins Personenstandsregister. Da hat man explizit verlangt, dass man diesen Begriff doch auch so in den Gesetzentwurf hineingibt, um den standesamtlichen Behörden die entsprechende Rechtssicherheit zu geben, wer von diesem Gesetz umfasst ist und welche Personenstandsdaten unter welchen Voraussetzungen eingetragen werden sollen. Leider hat man auch diesem Bereich nicht Rechnung getragen.
Man hat ein bisschen den Eindruck, man hat zuerst einmal den Gesetzentwurf gemacht, dann hat man Einwände gehabt, und jetzt hat man noch versucht, mit dem Abänderungsantrag ein bisschen husch, pfusch eine Lösung zu finden,
aber eine wirklich grundlegende, die dazu führt, dass es zu einer Verwaltungsvereinfachung und auch zu Rechtssicherheit in der Behörde kommt, ist das nicht.
Daher, meine sehr verehrten Damen und Herren: So sehr wir es durchaus begrüßen, dass auch subsidiär Schutzberechtigte im Personenstandsregister entsprechend erfasst werden – ein ganz wichtiger und gar nicht unwesentlicher Schritt –, aber man hätte den Gesetzentwurf ordentlich machen sollen, dann hätten wir ihm zustimmen können. So können wir es nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. (Beifall bei der SPÖ.)
14.35
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gemeldet ist Mag. Faika El-Nagashi. – Bitte schön, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete Mag. Faika El-Nagashi (Grüne): Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Sehr geehrte Damen und Herren! Wir schaffen mit diesem Gesetzentwurf heute die wichtigste Veränderung und Verbesserung für subsidiär Schutzberechtigte und andere Schutzberechtigte in den letzten zehn Jahren.
Mit der Erweiterung des Personenkreises beim Zugang zur Nachbeurkundung um eine weitere Gruppe von in Österreich Schutzberechtigten schaffen wir eine bedeutende Vereinfachung deren Lebens, deren Alltags hier in Österreich und auch eine Verbesserung von Integrationsperspektiven. Behördenwege, die bislang die Vorlage einer Geburtsurkunde verlangten, waren bislang für viele Geflüchtete gar nicht möglich oder mit sehr vielen und sehr großen Schwierigkeiten verbunden. Dabei geht es um Wege wie die Geburtsbeurkundung von in Österreich geborenen Kindern sowie Anträge auf die Familienbeihilfe, im Bereich des Aufenthaltsrechts oder bei der Einbürgerung. Mit dieser Änderung kann nun ein viel größerer Kreis von Geflüchteten – bislang
waren das nur anerkannte Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention – die Ausstellung einer Geburtsurkunde über die in Afghanistan, in Somalia oder im Irak erfolgte Geburt bei einem Standesamt in Österreich beantragen.
Das ist ein großer Schritt, das ist eine sehr wesentliche Verbesserung, ebenso wie die anderen Verbesserungen in diesem Bereich, die wir über die letzten Jahre geschafft haben: Reformen in der Grundversorgung, die Berücksichtigung des Kindeswohls im Asylverfahren, die ausgezeichnete Rechtsberatung über die BBU oder auch Verbesserungen im Staatsbürgerschaftsrecht für staatenlos in Österreich geborene Kinder. Vor allem gibt es mit grüner Regierungsbeteiligung in den letzten 20 Jahren keine Verschärfungen im Asylrecht, und auch der heutige Gesetzentwurf ist ein Beitrag dazu. – Vielen Dank. (Beifall bei den Grünen sowie der Abg. Kaufmann.)
14.37
Präsident Ing. Norbert Hofer: Nächster Redner ist Herr Ing. Manfred Hofinger. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Ing. Manfred Hofinger (ÖVP): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich darf eine weitere Besuchergruppe, die Ortsbauernobmänner aus dem Bezirk Rohrbach mit Bezirksobmann Martin Mairhofer, recht herzlich in unserem Haus begrüßen. (Beifall bei ÖVP und FPÖ, bei Abgeordneten der SPÖ sowie der Abgeordneten Fischer und Schallmeiner.)
Die Digitalisierung hält immer mehr Einzug in der Verwaltung, und daher ändern wir heute das Meldegesetz und das Namensänderungsgesetz mit zahlreichen Maßnahmen, die zur Vereinfachung bei den Behörden und bei den Menschen führen sollen. Wir nützen auch die Umsetzung der EU-Single-Digital-Gateway-Verordnung, um zusätzliche Verbesserungen in dieser Gesetzesmaterie zu erwirken.
Worum geht es tatsächlich? – Es geht darum, dass sich alle EU-Bürger bei einem Wohnungswechsel online ab- oder anmelden können. Das bringt natürlich vor allem für junge Menschen, die eher öfter den Wohnort wechseln, eine Erleichterung.
Es geht weiters um die Zuordnung der Kinder, das ist bei der Familienbeihilfe wichtig, und auch um eine Lebensbestätigung bei ausländischen Pensionisten, um die Pensionen zu erhalten.
Dazu bringe ich einen Abänderungsantrag ein:
Abänderungsantrag
der Abgeordneten Dr. Christian Stocker, Mag. Georg Bürstmayr, Kolleginnen und Kollegen
Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen:
Die im Titel bezeichnete Regierungsvorlage wird wie folgt geändert:
1. Art. 2 Z 5 (§ 35 Abs. 2 Z 3 PStG 2013) lautet:
„5. § 35 Abs. 2 Z 3 lautet:
„3. eine Person, die Flüchtling im Sinne der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, und des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974, ist, wenn sie ihren Wohnsitz, mangels eines solchen ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat oder eine Person, deren Beziehungen zu ihrem Heimatstaat aus vergleichbar schwerwiegenden Gründen abgebrochen sind, wenn sie ihren Wohnsitz, mangels eines solchen ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat und eine Eintragung beantragt.““
2. In Art. 2 Z 10 (§ 38 Abs. 2a PStG 2013) entfällt die Wendung „ , wobei ein Doppelname durch einen Bindestrich zwischen dessen einzelnen Teilen zu trennen ist“.
3. In Art. 2 Z 20 (§ 72 Abs. 12 PStG 2013) wird das Zitat „§ 35 Abs. 2 Z 3 und Abs. 5“ durch das Zitat „§ 35 Abs. 5“ ersetzt und folgender Satz angefügt:
„§ 35 Abs. 2 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/202X tritt mit 1. September 2024 in Kraft.“
4. In Art. 3 Z 2 (§ 11 Abs. 11 NÄG) wird die Wortfolge „Ablauf des Tages der Kundmachung“ durch die Wendung „1. September 2024“ ersetzt.
*****
Das ist der Abänderungsantrag.
Ich möchte abschließend noch festhalten, dass diese Verwaltungsvereinfachungen zum Wohle unserer Bürger sind. – In diesem Sinne: Herzlichen Dank. (Beifall bei der ÖVP.)
14.40
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Abänderungsantrag
der Abgeordneten Dr. Christian Stocker, Mag. Georg Bürstmayr,
Kolleginnen und Kollegen,
zum Gesetzentwurf im Bericht des Ausschusses für innere Angelegenheiten (2288 d.B.) über die Regierungsvorlage (2202 d.B.) betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Meldegesetz 1991, das Personenstandsgesetz 2013 und das Namensänderungsgesetz geändert werden (TOP 20).
Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen:
Die im Titel bezeichnete Regierungsvorlage wird wie folgt geändert:
1. Art. 2 Z 5 (§ 35 Abs. 2 Z 3 PStG 2013) lautet:
„5. § 35 Abs. 2 Z 3 lautet:
„3. eine Person, die Flüchtling im Sinne der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, und des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974, ist, wenn sie ihren Wohnsitz, mangels eines solchen ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat oder eine Person, deren Beziehungen zu ihrem Heimatstaat aus vergleichbar schwerwiegenden Gründen abgebrochen sind, wenn sie ihren Wohnsitz, mangels eines solchen ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat und eine Eintragung beantragt.““
2. In Art. 2 Z 10 (§ 38 Abs. 2a PStG 2013) entfällt die Wendung „ , wobei ein Doppelname durch einen Bindestrich zwischen dessen einzelnen Teilen zu trennen ist“.
3. In Art. 2 Z 20 (§ 72 Abs. 12 PStG 2013) wird das Zitat „§ 35 Abs. 2 Z 3 und Abs. 5“ durch das Zitat „§ 35 Abs. 5“ ersetzt und folgender Satz angefügt:
„§ 35 Abs. 2 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/202X tritt mit 1. September 2024 in Kraft.“
4. In Art. 3 Z 2 (§ 11 Abs. 11 NÄG) wird die Wortfolge „Ablauf des Tages der Kundmachung“ durch die Wendung „1. September 2024“ ersetzt.
Begründung
Zu Z 1 (§ 35 Abs. 2 Z 3 PStG 2013):
Personen, die nicht die Voraussetzungen der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, und des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974, (im Folgenden: Genfer Flüchtlingskonvention)
erfüllen, aber deren Beziehungen zu ihrem Heimatstaat aus vergleichbar schwerwiegenden Gründen abgebrochen sind, sind in der Regel nur vorübergehend bzw. befristet im Bundesgebiet aufhältig. Vor diesem Hintergrund ist es sachgerecht, dass diese Personengruppe nicht gemäß § 35 Abs. 3 verpflichtet wird, die Personenstandsbehörde über im Ausland eingetretene Personenstandsfälle zu informieren. Sofern diese Personen jedoch einen Eintrag im Zentralen Personenstandsregister (ZPR) bzw. eine Beurkundung ihres im Ausland eingetretenen Personenstandsfalles erwirken möchten, steht ihnen ein diesbezügliches formloses Antragsrecht zu.
Unter den in dieser Ziffer definierten Personengruppen sind jedenfalls Personen zu verstehen, denen der Status des Asylberechtigten bzw. des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt wurde, unabhängig davon, ob ihnen dieser Status originär oder abgeleitet zukommt. Die Beziehungen zum Heimatstaat sind etwa auch bei LGBTIQ+ Personen abgebrochen, die in ihrem Heimatstaat aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität systematisch diskriminiert bzw. verfolgt werden.
Ein Teilaspekt dieser Diskriminierung bzw. Verfolgung kann es auch sein, dass solchen Personen die Eintragung von Personenstandsfällen, die mit ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität in Zusammenhang stehen, im Heimatstaat verweigert wird.
Zu Z 2 (§ 38 Abs. 2a PStG 2013):
Vor dem Hintergrund, dass es im Namensrecht anderer Staaten sehr wohl die Möglichkeit gibt, Doppelnamen zu führen, ohne dass diese durch einen Bindestrich zu trennen sind, wird vorgeschlagen, von der bisherigen Formulierung in der Regierungsvorlage abzuweichen.
Zu Z 3 und 4 (§ 72 Abs. 12 PStG 2013 und § 11 Abs. 11 NÄG):
Die Erweiterung des § 35 Abs. 2 Z 3 PStG 2013 sowie des § 1 Abs. 1 Z 3 NÄG um jene Personengruppe, die zwar keine Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention sind, deren Beziehungen zu ihrem Heimatstaat jedoch aus
vergleichbar schwerwiegenden Gründen abgebrochen sind, bedarf einer Vorbereitungsphase. Zum einen muss für den damit einhergehenden Mehraufwand Vorsorge getroffen werden und zum anderen ist es auch notwendig, entsprechende Informationen zu erstellen und diese den Bediensteten der vollziehenden Behörden näher zu bringen.
*****
Präsident Ing. Norbert Hofer: Der Abänderungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht. Er steht somit auch in Verhandlung.
Zu Wort gelangt nun Frau Mag.a Ulrike Fischer. – Bitte, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete Mag. Ulrike Fischer (Grüne): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Minister! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe nicht einmal ein Onlinekonto und ich versuche immer, alles persönlich zu erledigen, weil ich mir denke, es ist wichtig, dass es eine Bank, eine Post gibt, dass man überall hingehen kann.
Nur: Wir stehen alle vor Situationen, in denen auf einmal die Post, die Bank schon zu haben oder auch das Meldeamt zu hat. Man muss sich aber ummelden, und nach dem Meldegesetz ist man verpflichtet, sich innerhalb von drei Tagen umzumelden. Was jetzt gilt – und das ist sehr gut so –, nämlich auch für alle EU-Bürger: Man kann seinen Wohnsitz online ummelden. Im Sinne der Digitalisierung wird unser aller Leben erleichtert. Man muss nicht blöd irgendwohin rennen. Im Sinne der Bürgerfreundlichkeit spart uns das allen Zeit.
Ich will uns heute auch Zeit sparen und sage daher: eine effiziente, transparente Verwaltungsmodernisierung, dafür sage ich Danke. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
Wünscht der Herr Berichterstatter ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf in 2202 der Beilagen.
Hiezu haben die Abgeordneten Dr. Christian Stocker, Mag. Georg Bürstmayr, Kolleginnen und Kollegen einen Abänderungsantrag eingebracht.
Ich werde daher zunächst über die vom erwähnten Abänderungsantrag betroffenen Teile und schließlich über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes abstimmen lassen.
Die Abgeordneten Dr. Christian Stocker, Mag. Georg Bürstmayr, Kolleginnen und Kollegen haben einen Abänderungsantrag betreffend die Artikel 2 und 3 eingebracht.
Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist mehrheitlich angenommen.
Wir kommen zur Abstimmung über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang in der Fassung der Regierungsvorlage.
Wer hiefür ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. – Auch das ist mehrheitlich angenommen.
Wir kommen zur dritten Lesung.
Ich bitte jene Damen und Herren, die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, um ein diesbezügliches Zeichen. – Das ist die Mehrheit. Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung angenommen.
21. Punkt
Bericht des Ausschusses für innere Angelegenheiten über die Regierungsvorlage (2272 d.B.): Vereinbarung zwischen dem Bund und dem Land Wien gemäß Artikel 15a B-VG, mit der die Verrechnung der Differenzbeträge zwischen den Kostenhöchstsätzen der Grundversorgungsvereinbarung – Art. 15a B-VG und den tatsächlich entstandenen Kosten für sämtliche in organisierten Unterkünften untergebrachten Personen inklusive der Unterbringung, Versorgung und Betreuung von vulnerablen Personengruppen ermöglicht werden soll (Realkostenverrechnungsvereinbarung Bund – Wien) (2289 d.B.)
Präsident Ing. Norbert Hofer: Wir kommen zum 21. Punkt der Tagesordnung.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Christian Lausch. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Christian Lausch (FPÖ): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Österreich hat eine lange Geschichte im Umgang mit Kriegsflüchtlingen oder Flüchtlingen, die in Not sind. Erst vor kurzer Zeit gab es 80 000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, 1991 27 000 Kriegsflüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien, 1956 170 000 Ungarnflüchtlinge, und, und, und. Es ist eine lange Geschichte. Wer Hilfe brauchte, dem wurde in Österreich immer geholfen.
Nur: Bei dieser Realkostenverrechnungsvereinbarung zwischen dem Bund und Wien geht es um eine jährliche Budgetbelastung von 75 Millionen Euro Mehraufwand. Was dem Bundesland Wien zugutekommt: dass die Grundversorgungsquartiere rückwirkend mit Jänner die Teuerung ausgeglichen kriegen. Meine geschätzten Damen und Herren, das geht aus unserer Sicht, aus der Sicht der Freiheitlichen, gar nicht. Solange die österreichische Bevölkerung
unter dieser massiven Teuerung und den hohen Energiekosten leidet, werden wir einem solchen Antrag nicht die Zustimmung geben. Das kann es einfach nicht sein.
Man muss einmal verstehen: Wenn die Leute ihr sauer verdientes Geld dem Finanzminister abtreten müssen, und das nicht zu knapp – die Steuerquote in Österreich ist jedem hier im Haus Sitzenden bekannt –, dann muss man sagen, es kann nicht sein, dass man da Geld in die Hand nimmt, nur weil Wien schon so viel Geld für die Grundversorgung und die Quartiere in die Hand nimmt, dass der Bund immens zuschießt.
Wie gesagt – ich lebe selbst auf dem Land –, man kann nur sagen, Wien ist schon lange nicht mehr lebenswert. Wir haben im Weinviertel einen Zuzug von 25 Prozent, und den haben wir nur, weil circa 15 bis 20 Prozent der Wiener Wien verlassen und aufs Land ziehen, weil sie es einfach nicht mehr aushalten.
Kümmern Sie sich erst einmal um die Österreicherinnen und Österreicher! Schauen Sie, dass das Leben in Österreich wieder lebenswert und leistbar wird! Dann können wir natürlich über alles andere reden.
In erster Linie denke ich, dass diese 75 Millionen Euro den Österreicherinnen und Österreichern zugutekommen sollten, die auch die Steuern zahlen, und nicht für eine Erhöhung und einen Teuerungsausgleich bezüglich der Grundversorgungsquartiere in Wien verwendet werden sollen. Unsere Zustimmung gibt es da nicht. – Danke schön. (Beifall bei der FPÖ.)
14.46
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt Mag. Ernst Gödl. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Mag. Ernst Gödl (ÖVP): Herr Präsident! Meine geschätzten Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Liebe Kolleginnen und Kollegen im Hohen Haus! Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer und
Zuseherinnen und Zuseher zu Hause! Seit es die Zweite Republik gibt, seit Beginn, seit den Vierziger-, Fünfzigerjahren, gibt es Jahr für Jahr Menschen, die nach Österreich flüchten.
Mein Kollege Herr Lausch hat es gerade angesprochen: Die höchste Zahl an geflüchteten Menschen, die in Österreich Zuflucht gesucht haben, gab es 1956 mit über 170 000 Menschen aus der unmittelbaren Nachbarschaft. Das Jahr mit der geringsten Zahl war übrigens am Beginn der Siebzigerjahre mit etwa 1 500. Dann hat sich das in den Jahren darauf wieder kontinuierlich gesteigert, je nach Krisen in der unmittelbaren Umgebung gab es erhöhte Zahlen von Flüchtlingen, die in Österreich Zuflucht gesucht haben.
Im Jahr 2004 hat dann der Bund mit den Ländern eine sogenannte 15a-Vereinbarung abgeschlossen und damit vereinbart, dass die Unterbringung, die Verpflegung und auch die Krankenversicherung zwischen Bund und Ländern aufgeteilt werden. Das soll heißen, dass in der Zeit der Grundversorgung, also des Status, in dem Asylwerber im Verfahren sind, die Länder für die Unterbringung und Verpflegung zuständig sein sollen. Es wurde auch vereinbart, dass es dazu eine Kostenaufteilung zwischen Bund und Ländern geben soll.
Das hat in den letzten Jahren auch prinzipiell gut funktioniert. In den Jahren, in denen es hohe Antragszahlen im Bereich des Asylwesens gegeben hat, hat es immer wieder Engpässe gegeben, und ganz besonders herausfordernd war natürlich das Vorjahr. Warum? – Weil zu den Asylsuchenden aus verschiedensten Regionen der Welt mit dem Ukrainekrieg eine neue Gruppe dazugekommen ist, die auch Unterkunft und Verpflegung benötigt hat. Der Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine hatte zur Folge, dass über 80 000 Menschen in Österreich Zuflucht gesucht und gefunden haben. Dadurch sind die Zahlen von Personen in der Grundversorgung sehr hoch.
Im heurigen Jahr war es so: Mit Beginn des Jahres waren 93 000 Menschen in der Grundversorgung. Das ist jetzt bis Oktober kontinuierlich zurückgegangen. Etwa 80 000 sind es nach wie vor, davon 44 000 Menschen aus der Ukraine,
etwa 18 000 Asylwerber, die im Verfahren sind, und dazu noch etwa 10 000 Menschen, die als subsidiär Schutzberechtigte eingestuft sind.
Aufgrund dieser veränderten Verhältnisse und aufgrund der Inflation, die natürlich auch bei den Quartiergebern zu Buche schlägt – es gibt ja öffentliche Quartiere, organisierte Quartiere, aber auch viele private Quartiergeberinnen und Quartiergeber –, war jetzt die Frage, wie das finanziert werden kann. Wir hatten ja in der ursprünglichen Vereinbarung Tageshöchstsätze, die von den Bundesländern anzuwenden sind, und es hat sich im letzten Jahr gezeigt, dass aufgrund der genannten Faktoren ein Nachbesserungsbedarf besteht.
Der Herr Bundesminister hat sich darüber verständigt, dass wir jetzt einen Versuch der Realkostenverrechnung mit jenem Bundesland starten, das am meisten Menschen in der Unterbringung hat, nämlich mit Wien. Dazu dient diese heutige 15a-Vereinbarung.
Ich denke, es ist schon unsere Pflicht, die Grundversorgung, wenn Menschen bei uns sind, so sicherzustellen, dass sie menschenwürdig untergebracht werden können, dass sie eine Verpflegung erhalten. Ich glaube, das ist das Mindeste, das wir bieten sollten.
Es ist auch gut und richtig, dass wir uns an den realen Kosten orientieren, dass diese Vereinbarung mit Wien jetzt umgesetzt wird, teilweise auch rückwirkend gelebt werden soll, damit jeder – der Bund und die Länder –, quasi gleichmäßig ihre finanziellen Aufgaben erfüllen.
Das ändert übrigens überhaupt nichts daran, dass wir uns nach wie vor stark dafür einsetzen, dass die illegale Migration zurückgedrängt wird. In den Budgetreden haben wir schon darauf hingewiesen, dass unserem Herrn Bundesminister Karner gemeinsam mit unserem Bundeskanzler da vieles gelungen ist. Die Asylzahlen sind ja wieder stark rückläufig, man sieht das auch an der Summe der in der Grundversorgung befindlichen Asylwerber.
Das war harte Knochenarbeit in den letzten Monaten, mit vielen verschiedenen Maßnahmen. In der Budgetdebatte habe ich schon die Maßnahme erwähnt, dass die Visafreiheit in Serbien hinsichtlich Indien und Tunesien beendet wurde und schon dadurch viele Asylwerber nicht mehr zu uns kommen. Es sind viele Maßnahmen, die langsam auch greifen.
Trotzdem ist es das Gebot der Stunde, die Grundversorgung sicherzustellen und das Ganze auf ein Realkostenmodell zu stellen. Dazu bekennen wir uns und dazu gibt es eben diese 15a-Vereinbarung mit der Stadt Wien. Diese steht jetzt eben zur Beschlussfassung an, und ich würde wirklich darum bitten, dass wir hier gemeinsam zustimmen. – Danke. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
14.51
Präsident Ing. Norbert Hofer: Nächster Redner ist Herr Abgeordneter Dietmar Keck. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Dietmar Keck (SPÖ): Herr Präsident! Herr Minister! Wir beschließen jetzt eine 15a-Vereinbarung zwischen dem Bund und Wien. Diese Vereinbarung wird befristet abgeschlossen, nämlich bis zum 30. Juni 2026, und dann wird man schauen, ob man sie weiter verlängert oder auslaufen lässt.
Was sagt diese 15a-Vereinbarung, meine Damen und Herren? – Um das Angebot an Unterkünften im Rahmen der Grundversorgung weiterhin und nachhaltig sicherstellen zu können, soll es dem Land Wien, auf das jetzt etwa 35 Prozent bis 45 Prozent der Grundversorgten entfallen, ermöglicht werden, berechtigte Kosten anteilig abgegolten zu bekommen.
Ziel der Vereinbarung ist die Bewältigung der Herausforderungen im Bereich der Grundversorgung für sämtliche in organisierten Unterkünften und in Einrichtungen für Pflege und Betreuung oder für Behindertenhilfe untergebrachten vulnerablen Personen sowie für hilfs- und schutzbedürftige Fremde.
Konkret geht es um die Abgeltung jener Differenzbeträge, die sich aus den verrechneten Kostenhöchstsätzen, aus der Grundversorgungsvereinbarung und den tatsächlich entstandenen Kosten inklusive aller Steuern und Abgaben ergeben. Die Differenzbeträge zwischen den Realkosten und den Kostenhöchstsätzen in Erfüllung von 100 Prozent der Betreuungsquote des Landes Wien sollen zwischen dem Bund und dem Land Wien im Verhältnis 6 : 4 aufgeteilt werden. Die Differenzbeträge bei Übererfüllung der Quote trägt der Bund laut Vereinbarung zur Gänze.
Wien hat ja mit Stand 6. Juni 2023 seine Quote zu 180 Prozent bis 195 Prozent übererfüllt. Umgekehrt soll sich Wien zu 40 Prozent an den Unterbringungs- und Versorgungskosten der Bundesbetreuung in Höhe des anteiligen Bevölkerungsschlüssels beteiligen.
Wir glauben, dass das eine gute Vereinbarung ist. Daher werden wir dieser zustimmen. (Beifall bei der SPÖ.)
14.53
Präsident Ing. Norbert Hofer: Nächster Redner: Mag. Georg Bürstmayr. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Mag. Georg Bürstmayr (Grüne): Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Bundesministerin! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Hohes Haus! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich freue mich über dieses Pilotprojekt, das zwischen dem Bund und dem Land Wien ausgehandelt worden ist. Es ist in seinen Grundzügen ja schon erläutert worden.
Besonders freut mich, dass es quasi über die Parteigrenzen hinweg zustande gekommen ist, denn Wien gilt im Allgemeinen als sozialdemokratische, als rote Hochburg und das Bundesministerium für Inneres seit 20 Jahren doch als Hochburg der Österreichischen Volkspartei. Obwohl diese zwei Parteien des
Öfteren nicht so gut miteinander können, haben sie sich in diesem Fall aus einem sehr guten sachlichen Grund auf eine vernünftige Lösung geeinigt.
Der sachliche Grund liegt schlicht darin, dass Österreich seit 2004 unionsrechtlich verpflichtet ist, Asylwerberinnen und Asylwerbern, Geflüchteten Unterkunft und Verpflegung zu gewährleisten. Dafür gibt es eine verbindliche Richtlinie. In der praktischen Umsetzung hat man sich bislang der sogenannten Tageshöchstsätze bedient, und Höchstsätze haben es an sich, dass sie eine fixe Summe beschreiben, die irgendwann einmal veraltet ist, besonders in Zeiten von ein- bis zweistelliger Inflation.
Infolgedessen ist aber Folgendes passiert, Herr Kollege Lausch (Abg. Lausch: Ja?): Es haben in den Bundesländern immer mehr Grundversorgungseinrichtungen zugesperrt, weil sie das Geld nicht gehabt haben, um sie weiterzuführen. Das hat dazu geführt, dass Geflüchtete in großer Zahl in die Grundversorgung des Bundes aufgenommen werden und dort viel zu lange verbleiben mussten.
In der Versorgung von Geflüchteten – Herr Kollege Lausch, wenn Sie sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hätten, dann wüssten Sie das – ist nichts so teuer wie die Unterbringung dieser Menschen in der Grundversorgung des Bundes. Andreas Achrainer von der BBU leistet hervorragende Arbeit, hat aber alle Hände voll zu tun, um genügend Quartierplätze aufzustellen, weil in der Vergangenheit in den Bundesländern immer wieder Quartiere zugesperrt wurden.
Wenn dieses Projekt funktioniert, und ich bin da sehr optimistisch, dann wird das beispielgebend sein, Schule machen. (Abg. Lausch: Andere Bundesländer dann auch!) Dann kann es zu einer neuen Vereinbarung zwischen Bund und Ländern kommen, nach dem Motto: Was es wiegt, das hat’s!, und dazu, dass Menschen aus der teuren Grundversorgung des Bundes in die deutlich günstigere Grundversorgung des Landes, wie man so sagt, überstellt werden können.
Unterm Strich könnte uns diese ganze Geschichte sogar einen erheblichen Batzen Brocken Geld sparen. – Danke fürs Zuhören. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
14.56
Präsident Ing. Norbert Hofer: Ich begrüße Frau Bundesministerin Dr.in Raab herzlich in unserem Haus.
Ich darf nun Herrn Bundesminister Karner um seine Stellungnahme bitten. – Bitte schön.
Bundesminister für Inneres Mag. Gerhard Karner: Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzte Damen und Herren Abgeordnete! Auch mir ist es ein Anliegen, kurz zu diesem Pilotprojekt beziehungsweise zu dieser Vereinbarung Stellung zu nehmen. Bevor ich aber auf das Pilotprojekt selbst eingehe, möchte ich noch einmal kurz skizzieren, warum es zu diesem Pilotprojekt kam, was die Gründe dafür waren.
Zunächst ist zu sagen – Abgeordneter Gödl hat es angesprochen –, dass wir im letzten Jahr in vielen Bereichen über die Grenze der Belastbarkeit angelangt waren. Sie wissen es, insbesondere diejenigen von Ihnen, die in den Regionen zu Hause sind, dass wir in vielen Bundesländern, in vielen Bezirken, in vielen Gemeinden intensive Diskussionen bis hin zu Streit hatten, wenn es darum ging, Asylwerber unterzubringen.
Ich möchte aber gerade an dieser Stelle noch einmal sagen, dass in diesem letzten Jahr, wie schon angesprochen wurde, auch vieles gelungen ist: Es wurden fast 100 000 Menschen aus der Ukraine, vor allem Frauen und Kinder, registriert. Aktuell sind noch über 60 000 in Österreich, davon werden über 40 000 vom Bund beziehungsweise von den Ländern versorgt. Das ist gelungen, weil Bund, Länder und Gemeinden an einem Strang gezogen haben. Die gute Nachricht kommt oft zu kurz, aber mir ist es wichtig, mich bei
den Ländern und Gemeinden dafür zu bedanken, dass das gelungen ist. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
Ein weiterer wesentlicher Grund dafür, dass wir das dann entwickelt haben, war, dass es am 22. November, also fast am Tag genau vor einem Jahr, einen Beschluss der Landesflüchtlingsreferent:innen gab, einer Konferenz, bei der fast alle hier im Haus vertretenen Parteien, mit Ausnahme der NEOS, vertreten sind. Da gab es einen einstimmigen Beschluss darüber, dass es eine Abrechnung der tatsächlichen Kosten für Kinder, Jugendliche und Personen mit Behinderung geben soll.
Der dritte wesentliche Grund war eine Empfehlung des Rechnungshofes, der in dieser Hinsicht natürlich zu Recht sehr gerne zitiert wird, Herr Abgeordneter, wonach eine pauschale Abgeltung in diesem Bereich – wobei die Kostensätze in diesem Bereich Kinder, Jugendliche, Personen mit Behinderung, 95 Euro, seit Jahren unverändert waren – nicht zielführend ist. (Präsident Sobotka übernimmt den Vorsitz.)
Wir haben ja, glaube ich, vor eineinhalb Jahren für organisierte und private Quartiere die Kostensätze erhöht, aber jene für Kinder, Jugendliche und Behinderte eben nicht; und es gibt wie gesagt die Empfehlung des Rechnungshofes, in Richtung Realkosten zu gehen.
Daher haben wir dieses Pilotprojekt gemeinsam mit der Stadt Wien und auch mit Einbindung von EY entwickelt, um einen Schritt vorwärts zu machen. Das ist kein einfaches Unterfangen, weil es natürlich in der Organisation der Unterbringung zwischen den einzelnen Bundesländern große Unterschiede gibt.
Es ist ein Riesenunterschied zwischen der Stadt Wien und dem weiten flachen Land, wo es ja in erster Linie private Quartiere gibt, die für die Unterbringung sorgen. Damit wir eben ins Tun kommen, haben wir dieses Pilotprojekt auf den Weg gebracht, mit dem Ziel, klare Regeln zu haben: Was kann man verrechnen? Was darf verrechnet werden? – Es gibt auch eine klare und
strikte Kontrolle. Der Rechnungshof wird eingebunden, auch das ist vereinbart, genauso wie die reale Kostenverrechnung; auch schon rückwirkend in diesem Jahr. Das Projekt ist auf vier Jahre angelegt.
Wir erwarten uns weniger Bürokratie, mehr Transparenz und eine gerechte Finanzierung, denn die Kosten – auch das sei hier klar gesagt – gibt es ja jetzt schon. Damit die Kosten aber auch gerecht verteilt werden und vor allem transparent sind – ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt in dieser Frage, auch das ist mir besonders wichtig –, haben wir dieses Pilotprojekt auf den Weg gebracht.
Was mir aber noch wichtig ist – und das möchte ich an dieser Stelle auch sagen –, ist, dass dadurch eine engmaschige Betreuung und strikte Kontrolle möglich sind, dass beispielsweise auch Kosten für einen Sicherheitsdienst verrechnet werden können. Wir wissen, wenn 16-, 17-, 18-jährige Burschen auf engem Raum sind, dann müssen sie auch engmaschig betreut werden. Da gibt es oft Sorgen in der Bevölkerung. Auch dafür werden diese Mittel verwendet.
Wie gesagt, das macht Sinn, das auch zu tun. Deutschkurse, engmaschige Aufsicht, organisierte Tagesstruktur – all das sind Dinge, die letztendlich damit den realen Kosten entsprechend auch verrechnet werden können. Das halte ich für richtig, das halte ich für notwendig, weil es ein pragmatischer, vernünftiger, realitätsnaher Ansatz ist, diese Unterbringung für Kinder, für Jugendliche, für behinderte Menschen auch zu gewährleisten. In diesem Sinne vielen herzlichen Dank meinen Gesprächspartnern in dieser Frage. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
Ich bedanke mich auch für die Zustimmung. Vielleicht kann ich Sie, Herr Abgeordneter Lausch, auch noch dazu bewegen, zuzustimmen. Ich habe versucht, Ihnen zu erklären, warum es wichtig wäre, dass man das tut. Nach den Erfahrungen des Pilotprojektes ergeht dann natürlich auch das Angebot an alle anderen Bundesländer. In diesem Sinne bitte ich um breite Zustimmung zu
diesem wichtigen Pilotprojekt. (Beifall und Bravoruf bei der ÖVP sowie Beifall bei Abgeordneten der Grünen.)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
Wünscht die Berichterstatterin ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall.
Wir kommen somit zur Abstimmung über den Antrag des Ausschusses für innere Angelegenheiten, den Abschluss der gegenständlichen Vereinbarung gemäß Artikel 15a Bundes-Verfassungsgesetz in 2272 der Beilagen zu genehmigen.
Wer für den Abschluss dieser Vereinbarung ist, den bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen. – Das ist mit Mehrheit angenommen.
Bericht des Verfassungsausschusses über den Antrag 3292/A der Abgeordneten Mag. (FH) Kurt Egger, Mag. Eva Blimlinger, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die Förderung des qualitätsvollen Journalismus in Medien des Print- und Online-Bereichs erlassen wird und das Presseförderungsgesetz 2004 sowie das KommAustria-Gesetz geändert werden (2012 d.B.)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Wir kommen zum 22. Punkt der Tagesordnung.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Ich darf Frau Bundesminister Raab herzlich begrüßen und den Herrn Bundesminister für Inneres verabschieden.
Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Brandstötter. – Bitte.
15.03
Abgeordnete Henrike Brandstötter (NEOS): Herr Präsident! Frau Bundesminister! Herr Bundesminister! Kolleginnen und Kollegen! Nicht alle schlechten Nachrichten sind gute Nachrichten, manchmal sind Bad News einfach nur Bad News. Die schlechte Nachricht ist, dass rund 50 Prozent der Bevölkerung Leitmedien nicht mehr vertrauen, speziell Nachrichten nicht mehr vertrauen. Die anderen 50 Prozent sind unentschlossen oder trauen den Inhalten einfach nicht.
Das sind schlechte Werte und schlechte Nachrichten, denn Leitmedien spielen eine sehr große Rolle in unserer Demokratie, sie stabilisieren die Demokratie. Je genauer man fragt, desto entmutigender werden die Zahlen auch. Nur mehr 40 Prozent der Bürgerinnen und Bürger halten Nachrichten für unabhängig von Unternehmen und unabhängig von kommerziellen Interessen. Fast 60 Prozent unterstellen Nachrichtenmedien, dass sie politische Eigeninteressen haben, die über dem Wohl der Gesellschaft stehen. Immer mehr Menschen finden, dass Medien Vielfalt nicht abbilden. In anderen Worten: Die Menschen fühlen sich nicht gehört – und wer sich nicht gehört fühlt, der reagiert auch mit Misstrauen.
Zuletzt: Misstrauen wird besonders dort gesteigert, wo Politik besonders polarisierend arbeitet, wo extrem gestritten wird, wo wir auftreten, wie wir auftreten. Das werden wir dann auch sehen, wenn heute diese beiden Untersuchungsausschüsse eingesetzt werden, bei denen es nur darum geht, zu polarisieren und mit Schmutz zu werfen.
Wenn es darum geht, die klassischen Medien abzuwerten, muss man sagen: Die Feinde sitzen auch hier im Haus – allen voran die FPÖ, knapp dahinter die ÖVP. Ihr diskreditiert Medien, ihr unterwandert das Vertrauen in Medien. Bei der FPÖ ist ganz klar, worum es geht. (Abg. Stefan: Das ist nicht notwendig!) Ihr habt ein sehr großes Angebot: FPÖ-TV, rechtsextreme Plattformen wie auf1.tv oder auch den „Attersee Report“. (Abg. Stefan: Haben Sie den schon einmal gelesen? Haben
Sie den echt schon einmal gelesen?!) Ihr habt es geschafft, wirklich einen Bypass rund um klassische Medien zu legen. Ihr braucht klassische Medien nicht mehr. Das hat auch Herbert Kickl kürzlich bewiesen, als er als einziger Parteichef die Einladung zum „Bürgerforum“ von Puls 4 ausgeschlagen hat: Es sei ein linker Sender, da ginge man nicht hin. (Abg. Stefan: ... könnts ja alle hintanzen!)
Weshalb aber unterwandert die ÖVP das Vertrauen in die Medien? Ihr wollt sie ja gar nicht wirklich diskreditieren, ihr wollt sie beherrschen – und das macht den großen Unterschied. Die ÖVP möchte, dass die Medien das schreiben, was die ÖVP möchte, dass die Medien schreiben. Ihr wollt sie unterjochen und nichts anderes. Das zeigt auch ganz deutlich der Umgang mit dem Medienreformpaket. (Beifall bei den NEOS. – Ruf bei der ÖVP: Mein Gott!)
To make a tragische story short: Uns wurde keine Idee, keine Vision formuliert, wo man denn eigentlich in Österreich hinmöchte, wie man es schafft, einen pluralistischen, vielfältigen Medienmarkt zu gestalten, wie man auch Medienfreiheit sicherstellt. Stattdessen wurden hinter verschlossenen Türen die Gießkannen befüllt, damit alle Medien ein bisschen etwas bekommen, aber alle zu wenig, damit man ja auch noch weiterhin schön von den Inseraten der öffentlichen Hand abhängig ist und immer weiß, bei wem man Danke sagen muss – nämlich bei der ÖVP. (Beifall bei den NEOS.)
Über eine dieser Förderungen stimmen wir heute auch ab. Es ist die Qualitätsjournalismusförderung, die mit 20 Millionen Euro jährlich Qualität sicherstellen soll. Von Anfang an war unsere Kritik an dieser Förderung, dass Qualität an sich eigentlich gar kein Marker ist. Qualitätskriterien sind optional. Man kriegt extra Geld, wenn man Qualität sicherstellt. Man bekommt 10 Prozent extra Förderung, wenn man ein Redaktionsstatut hat, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte; 10 Prozent mehr, wenn man ein Fehlermanagementsystem einführt; 10 Prozent mehr, wenn man ein Qualitätssicherungssystem einführt; 10 Prozent mehr für Frauenförderungspläne. Also mir würde einfallen, dass der eine oder andere Punkt da eigentlich obligatorisch und nicht optional sein sollte.
Jetzt hat man diese Qualitätsjournalismusförderung nach Brüssel zur Notifizierung geschickt. Die EU-Kommission muss dieser Förderung zustimmen, denn sie greift in den Markt ein. Es ist spannend, was die Bundesregierung in ihr Ansuchen an die Kommission geschrieben hat, nämlich – ich zitiere –:
Der österreichische Medienmarkt durchläuft einen grundlegenden Strukturwandel. Die tiefgreifendste Veränderung ist die massive Verschiebung von den Printmedien hin zu überwiegend kostenlos zugänglichen Nachrichtenportalen und/oder zum Internet im Allgemeinen. – Zitatende.
An anderer Stelle:
Ferner scheint die Bereitschaft der Menschen, für Inhalte zu bezahlen, die auf den Onlineportalen traditioneller Tages- und Wochenzeitungen angeboten werden, begrenzt zu sein. So haben 2022 nur 13,5 Prozent der Menschen, die online Nachrichten lesen, auch dafür bezahlt. – Zitatende.
Bravo! Sie haben eigentlich das Problem definiert, das Sie selber verursacht haben. Ich habe vor eineinhalb Jahren damit begonnen, zu thematisieren, was es denn bedeutet, wenn der ORF, bestens mit GIS-Gebühren ausgestattet, kostenlos Nachrichten anbietet. Das ist zwar für den einzelnen User im Augenblick angenehm, denn wer will nicht gratis Nachrichten haben, on the long run bedeutet das aber, dass all die anderen Medien ein großes Problem bekommen, dass wir sie jetzt auf der anderen Seite mit 20 Millionen Euro pro Jahr unterstützen müssen. Das ist nicht das, was ich mir unter einer nachhaltigen Medienpolitik vorstelle. (Beifall bei den NEOS. – Zwischenruf des Abg. Zorba.– Abg. Lopatka: ... schwach!)
Ich weiß noch ganz genau: Da haben Sie bei der ÖVP getobt, auch die SPÖ hat getobt, und dann steht schwarz auf weiß in einem Schreiben an die EU-Kommission: 2022 waren nur 13,5 Prozent der Menschen, die online Nachrichten lesen, bereit, dafür auch zu bezahlen. – So etwas kommt von so etwas.
Wir stimmen dieser Förderung heute zu. Wir freuen uns auch über die Erhöhung des Budgets für den Presserat, das haben wir immer gefordert. Das alles wird Sie aber nicht aus der Pflicht entlassen, damit aufzuhören, Medien an die Kandare zu nehmen, und da einmal eine Ernsthaftigkeit an den Tag zu legen. Sie wissen ja überhaupt nicht, wohin das eigentlich führt, was passiert, wenn Menschen den Medien immer weniger vertrauen – und Sie (in Richtung ÖVP) befeuern das Ganze noch. (Beifall bei den NEOS.)
15.09
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Egger. – Bitte. (Abg. Haubner: Jawohl!)
Abgeordneter Mag. (FH) Kurt Egger (ÖVP): Herr Präsident! Frau Bundesministerin! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Werte Zuseherinnen und Zuseher auf der Galerie, aber auch vor den Fernsehgeräten zu Hause! Gut Ding braucht Weile! Das ist glaube ich eine gute Zusammenfassung des Werdens dieses Qualitäts-Journalismus-Förderungs-Gesetzes. Man muss sagen, es hat jetzt schon eine Zeit lang gedauert, bis es tatsächlich beschlossen werden kann, wie es heute vorliegt. Es war uns immer ein großes Anliegen, den Medienstandort zu stärken, die Medienvielfalt zu unterstützen und die digitale Transformation zu begleiten. Das stellen wir mit diesem Gesetz jetzt dar, um einen Anreiz für hochwertigen und hochkarätigen Journalismus zu schaffen.
Wer in diesem Land keinen besonderen Wert darauf legt, sieht man heute sehr deutlich: Erstens sind die Reihen der FPÖ sehr dünn besetzt, und zweitens hat es niemand der Mühe wert gefunden, sich auf die Rednerliste setzen zu lassen, weil Fakenews, Echokammern und FPÖ-TV ihr eigenes Programm sind und Qualitätsjournalismus nicht wirklich unterstützenswert erscheint. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
Wir wissen sehr genau, in welch wirtschaftlich schwierigen Zeiten Medienhäuser und Medienunternehmer sind, daher war es uns ein großes Anliegen, in Zeiten
von steigenden Lohnkosten, höheren Energiekosten und explodierenden Papierkosten eine entsprechende Unterstützung auf den Weg zu bringen. Es geht darum, journalistische Arbeitsplätze sowohl im Printbereich als auch im Onlinebereich –das ist eine Neuerung – und vielfältige Inhalte abzusichern. Kollegin Brandstötter hat bereits die unterschiedlichen Kriterien angesprochen, die dort formuliert sind: Redaktionsstatut, Fehlermanagementsysteme, Frauenförderungssysteme, Qualitätssicherung, regionale und internationale Berichterstattung, Förderung der Aus- und Weiterbildung, aber auch Medienkompetenzförderung zum Beispiel in den Schulen durch Zurverfügungstellung von kostenfreien Abos.
Ich bin sehr froh, dass wir jetzt mit einem Abänderungsantrag auch noch eine breite Mehrheit zustande bringen. Ich war zwar jetzt bei Kollegin Brandstötter nicht mehr ganz sicher, ob sie nach dem, was sie vorhin gesagt hat, tatsächlich noch mitgeht, aber ich verstehe ja, dass man das eine oder andere kritisch betrachten muss.
Außerdem ist es uns gelungen, beim Presserat eine über 50-prozentige Erhöhung zustande zu bringen.
Zum Abschluss möchte ich mich besonders bei unserer Bundesministerin Susanne Raab bedanken, die da mit sehr viel Engagement dahinter war, aber auch beim Koalitionspartner, bei Eva Blimlinger, und auch bei den beiden Vertretern der SPÖ, beginnend mit Jörg Leichtfried und am Ende mit Muna Duzdar, aber auch bei Henrike Brandstötter, dass sie diese für den Medienstandort wichtige Förderleistung unterstützen. (Beifall bei ÖVP und Grünen. – Abg. Haubner: Gute Rede!)
15.13
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordnete Duzdar. – Bitte sehr, Frau Abgeordnete.
15.13
Abgeordnete Mag. Muna Duzdar (SPÖ): Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Ministerin! Ja, wir beschließen heute das Qualitäts-Journalismus-Förderungs-Gesetz, und wir vonseiten der Sozialdemokratie werden heute mitstimmen. Uns war es ein besonderes Anliegen, die Förderung für den Presserat zu erhöhen. Allen voran hat sich auch mein Kollege Jörg Leichtfried sehr stark dafür eingesetzt, und es freut mich, zu sehen, dass es gelungen ist, die Förderung für den Presserat maßgeblich zu erhöhen.
Wir vonseiten der Sozialdemokratie sind auch der Meinung, dass das Gesetz grundsätzlich in die richtige Richtung geht, wobei man dazusagen muss, dass es auf Vorschlägen aufbaut, die bereits unter sozialdemokratischer Kanzlerschaft vorgelegen sind, allen voran auch auf Vorschläge des geschätzten Medienministers Thomas Drozda.
Man geht mit diesem Gesetz tatsächlich einen Schritt weg vom Gießkannenprinzip. Die Förderung orientiert sich nicht mehr an der Menge bedruckten Papiers, sondern die Höhe der Förderung orientiert sich nunmehr an verschiedenen Qualitätskriterien, wie der Anzahl der beschäftigten Journalistinnen und Journalisten, am Redaktionsstatut, an Frauenförderplänen und Qualitätssicherungssystemen. Das ist auch der Grund, weshalb wir heute mitstimmen werden.
Trotz unserer Zustimmung möchte ich es mir aber nicht nehmen lassen, einige Kritikpunkte anzubringen, denn auch dieses Gesetz hat Schwächen, die ich vorbringen möchte.
Erstens halten wir es für falsch, dass nur textbasierte Medien gefördert werden. Das ist unserer Meinung nach innovationshemmend und stellt sich auch gegen hochwertigen Audio- und Videojournalismus. Zudem übersieht es, dass das Medienkonsumverhalten sehr unterschiedlich und verschieden ist: Es gibt Menschen mit Sehschwächen, es gibt Menschen, die Beiträge lieber hören, und es geht auch da um Inklusion. Die Vorstellung, dass nur Print für Qualität steht,
ist völlig realitätsfern und allen Menschen, die zum Beispiel im privaten Rundfunk tätig sind, gegenüber auch nicht besonders wertschätzend.
Zweitens: In Zeiten von grassierenden Fakenews braucht es unserer Meinung nach strengere Förderkriterien. (Beifall bei der SPÖ.) Da hätte man den Presserat als Qualitätskriterium aufwerten müssen, nämlich nach dem Motto: Voraussetzung dafür, dass man eine Förderung bekommt, ist die Anerkennung des Presserats. Das ist unterblieben.
Das Dritte ist: Wenn wir Qualität fördern wollen, dann müssen wir auch die Leute fördern, die dahinter stehen, nämlich die Journalisten und Journalistinnen. (Beifall bei der SPÖ.) Was da passiert ist, ist, dass die Definition von hauptberuflich tätigen Journalisten im Gesetz völlig aufgeweicht wurde. Nicht einmal die redaktionelle Tätigkeit ist mehr eine Voraussetzung dafür. Da wäre unseres Erachtens mehr Präzision nötig und natürlich und selbstverständlich ein Bekenntnis zu fairen Gehältern für Angestellte sowie für freie Journalistinnen und Journalisten. Das ist eben auch unterblieben. – So gesehen gibt es noch sehr viel zu tun, um den Medienstandort Österreich nachhaltig zu stärken und krisenresistent zu machen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die österreichischen Medien kämpfen derzeit um ihr wirtschaftliches Überleben. Kündigungen von Journalistinnen und Journalisten stehen aktuell auf der Tagesordnung. Ich bin daher sehr froh, dass der Verband Österreichischer Zeitungen nun doch nicht mehr aus dem Journalistenkollektivvertrag aussteigen will, aber – das muss ich Ihnen schon irgendwie vorhalten –, dass es so weit kommen musste, hat meines Erachtens die Regierung zu verantworten, denn Sie haben in Wirklichkeit einfach viel zu spät auf die Krise der Medienbranche reagiert. In Zeiten der Inflation, wenn eben Druck- und Papierpreise in die Höhe schießen, hätte man einfach schneller reagieren müssen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Gesetz ist unseres Erachtens zweifelsfrei ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber klar muss sein, dass
nun viele weitere folgen müssen, wenn man wirklich den Medienstandort Österreich stärken möchte. – Danke sehr. (Beifall bei der SPÖ.)
15.18
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Blimlinger. – Bitte.
Abgeordnete Mag. Eva Blimlinger (Grüne): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Bundesministerin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren auf der Galerie und vor den Bildschirmen, welche Bildschirme auch immer das sind! Für uns ist das heute tatsächlich ein Meilenstein, was die Presseförderung, was die Medienförderung in Österreich betrifft. Das ist ein absoluter Paradigmenwechsel weg von bedrucktem Papier hin zu Arbeitsplätzen. Darum geht es sozusagen dem Grunde nach, um den Medienstandort Österreich zu stärken und auch die Medienunternehmen zu stärken.
Wir haben im Kern definiert, dass journalistische Arbeitsplätze nach dem Kollektivvertrag entlohnt werden, und so macht es natürlich auch Sinn, dass sich die Sozialpartner wieder auf einen Kollektivvertrag verstanden haben, denn sonst wäre es mit der jetzt angedachten Förderung ein bisschen schwierig geworden. Daran sieht man schon, dass der Rahmen ein außerordentlich guter ist.
Der Kern ist die Förderung journalistischer Arbeitsplätze in Print- und Onlinemedien; Kollege Kurt Egger hat das schon ausgeführt. Auch da gibt es einen Paradigmenwechsel, den wir ausweiten, um den Entwicklungen im Medienbereich weg von bedrucktem Papier hin zu Onlinemedien Rechnung zu tragen.
Es ist natürlich ein Add-on-Modell, und das erachten wir als absolut richtig, weil es große Unterschiede in den Redaktionen gibt. Man kann also zusätzlich zu
dieser Kernförderung der journalistischen Arbeitsplätze Förderungen bekommen. Schon erwähnt wurde das Redaktionsstatut: Es gibt sehr viele sogenannte oder vielleicht wirkliche Qualitätszeitungen, die kein Redaktionsstatut haben. Man könnte sich wundern, wie wenige Zeitungen eines haben. Das ist auch ein Ansporn, Redaktionsstatute aufzusetzen.
Selbstverständlich wird auch die Frauenförderung unterstützt.
Es ist erstmals so, dass bei einem so großen Fördervorhaben – dotiert mit 20 Millionen Euro – auch Monatszeitungen und Straßenzeitungen mit umfasst sind. Das ist ein Punkt, der uns wichtig war. Es wird schwierig werden, aber ich denke, wir werden da eine gute Lösung finden.
Auch die Förderung von Fehlermanagementsystemen gibt es.
All das sind Möglichkeiten, um diesem Medienunternehmen, diesem Medium, das diese Zeitungen oder diese Onlineveröffentlichungen macht, zusätzlich zur Grundförderung Fördergelder zu gewähren.
Wichtig war uns auch, dass es – und das steht ja immer wieder zur Diskussion, da gab es auch von meinen Vorrednern, Vorrednerinnen durchaus eine Perspektive – verschärfte Ausschlussgründe hinsichtlich Hetze, Rassismus, Homophobie und Demokratiegefährdung gibt. Es ist eine Gratwanderung, das einzuschätzen, zwischen einerseits Pressefreiheit und andererseits sozusagen einer tatsächlichen Gefährdung, einer Demokratiegefährdung. Wir wissen, es gibt manche, die das unterschiedlich sehen, aber da wird es ganz strenge Regelungen geben.
Was uns sehr wichtig ist, ist – es hat einige Zeit gedauert, bis die EU zugestimmt hat –, die Förderung rückwirkend für 2022 auszuzahlen.
Deswegen bringe ich einen Abänderungsantrag der Abgeordneten Kurt Egger, Muna Duzdar, Eva Blimlinger, Henrike Brandstötter, Kolleginnen und Kollegen zum Bericht des Verfassungsausschusses über den Antrag 3292/A der
Abgeordneten Egger, Blimlinger, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die Förderung des qualitätsvollen Journalismus in Medien des Print- und Onlinebereichs erlassen wird und das Presseförderungsgesetz 2004 sowie das KommAustria-Gesetz geändert werden, 2012 der Beilagen ein.
Abschließend will ich zu dem Gesetzentwurf sagen, dass er wie viele Gesetzentwürfe ein erster, aber ein sehr großer Schritt ist. Ich möchte mich für die außerordentlich gute Zusammenarbeit mit der Frau Bundesministerin und mit Abgeordnetem Egger, dem Mediensprecher der ÖVP, und seinen Vorgänger:innen in der ÖVP sehr herzlich bedanken, und freue mich, dass die beiden Kolleginnen Vorrednerinnen der SPÖ und der NEOS da zustimmen werden und wir einen gemeinsamen Weg für eine neue Sicherung des Medienstandorts gefunden haben.
Im Übrigen bin ich der Meinung: Bring them home now! – Danke. (Beifall bei den Grünen sowie des Abg. Egger.)
15.23
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Abänderungsantrag
der Abgeordneten Kurt Egger, Muna Duzdar, Eva Blimlinger, Henrike Brandstötter
Kolleginnen und Kollegen,
zum Bericht des Verfassungsausschusses über den Antrag 3292/A der Abgeordneten Mag. (FH) Kurt Egger, Mag. Eva Blimlinger, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die Förderung des qualitätsvollen Journalismus in Medien des Print- und Online-Bereichs erlassen wird und das Presseförderungsgesetz 2004 sowie das KommAustria-Gesetz geändert werden (2012 d.B.) – TOP 22
Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen:
Die oben bezeichnete Gesetzesentwurf in der Fassung des Ausschussberichtes wird wie folgt geändert:
Artikel 1 (Bundesgesetz über die Förderung des qualitätsvollen Journalismus in Medien des Print- und Online-Bereichs) wird wie folgt geändert:
1. § 3 Abs. 1 Z 5 lautet:
„5. Förderung von repräsentativen Selbstkontrolleinrichtungen im Print- und Online-Bereich sowie von Presseclubs: 292 500 Euro, wovon
a) 230 000 Euro für die Förderung der Selbstkontrolle und
b) 62 500 Euro für die Förderung von Presseclubs
vorzusehen sind sowie“
2. In § 9 Abs. 4 Z 2 wird nach dem Wort „entsprechen“ die Wortfolge „ und nicht auf Gewinn gerichtet sind (Abs. 2)“ eingefügt.
3. In § 14 Abs. 1 erster und vierter Satz wird jeweils die Zahl „187 500“ durch die Zahl „230 000“ ersetzt.
4. In § 24 Abs. 1 lautet der erste Satz:
„Dieses Bundesgesetz tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.“
5. § 24 Abs. 2 und 3 lauten wie folgt:
„(2) Die Förderrichtlinien gemäß § 18 für die Beobachtungszeiträume der Jahre 2022 und 2023 sind bis spätestens 15. Februar 2024 zu veröffentlichen, wobei diesfalls das Erfordernis der Befassung des Fachbeirats gemäß § 19 Abs. 2 Z 1 entfällt. Die Ernennung der Mitglieder des Fachbeirats (§ 19 Abs. 3) hat bis 1. März 2024 zu erfolgen.
(3) Für die den Beobachtungszeitraum des Jahres 2022 (§ 21) betreffenden Ansuchen gilt § 20 mit der Maßgabe, dass diese Ansuchen bis 1. März 2024 einzubringen sind.
Ansuchen für den Beobachtungszeitraum des Jahres 2022, die vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes noch auf der Grundlage von Abschnitt IV des PresseFG 2004 eingebracht wurden, sind als Ansuchen nach dem 4. bis 6. Abschnitt dieses Bundesgesetzes zu beurteilen, wobei die KommAustria allfällige zusätzliche für die Prüfung der Förderwürdigkeit erforderliche Unterlagen anfordern kann. Die Auszahlung von gewährten Förderungen für den Beobachtungszeitraum des Jahres 2022 hat in einem Gesamtbetrag spätestens bis zum 30. April 2024 zu erfolgen. Bereits nach dem Abschnitt IV des PresseFG 2004 für diesen Beobachtungszeitraum ausbezahlte Fördermittel sind hierbei entsprechend zu berücksichtigen.“
Artikel 2 (Änderung des Presseförderungsgesetzes 2004) wird wie folgt geändert:
1. In Z 11 wird im ersten Satz des Abs. 12 das Datum „1. Juli 2023“ durch das Datum „1. Jänner 2024“ ersetzt.
Artikel 3 (Änderung des KommAustria-Gesetzes) wird wie folgt geändert:
1. In Z 4 wird im ersten Satz des § 44 Abs. 33 das Datum „1. Juli 2023“ durch das Datum „1. Jänner 2024“ ersetzt.
2. In Z 5 wird im Text des § 45 Abs. 19 die Wortfolge „Kalenderjahr 2023 per 1. August“ durch die Wortfolge „Kalenderjahr 2024 per 1. Februar“ und die Wortfolge „ein zusätzlicher Betrag in der Höhe von 358 000 Euro“ durch die Wortfolge „ein zusätzlicher Betrag in der Höhe von 100 000 Euro“ ersetzt.
Begründung
Zu den Artikeln 1 bis 3:
Die Änderungen ergeben sich aus der Tatsache, dass der Nichtuntersagungs- bzw. Genehmigungsbeschluss der Europäischen Kommission erst später als geplant vorgelegen ist. Insofern waren die jeweiligen im Gesetz festgelegten Termine für die erstmalige Gewährung im Weg der Übergangsbestimmungen zu adaptieren. Die Änderungen in § 9 Abs. 4 Z 2 QJF-G zur Bezugnahme auf § 9 Abs. 2 dienen in
Entsprechung mit der bisherigen Rechtslage der Klarstellung, dass in den genannten Fällen nur nicht auf Gewinn gerichtete Einrichtungen als Förderwerber in Frage kommen. Die Änderungen in § 45 Abs. 19 resultieren aus dem späteren Inkrafttreten des Gesetzesvorhabens. Der zusätzlich zur Verfügung zu stellende Betrag in der Höhe von EUR 100 000 deckt die Vorbereitungs- und Einmalkosten ab. Ansonsten hat die von der Europäischen Kommission am 20. November 2023 übermittelte Entscheidung vom 17.11.2023, C (2023) 7817 final keinen weiteren Änderungsbedarf auf der Ebene der gesetzlichen Regelungen ergeben.
*****
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Der Abänderungsantrag ist ausreichend unterstützt, ordnungsgemäß eingebracht und steht mit in Verhandlung.
Zu Wort gemeldet ist Frau Bundesministerin Raab. – Bitte sehr.
Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien im Bundeskanzleramt MMag. Dr. Susanne Raab: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Tatsächlich, und das haben die Vorrednerinnen und Vorredner angesprochen, hat sich die Situation für Medien in ganz Europa in den letzten Jahren verändert. Das ist natürlich primär aufgrund der Digitalisierung passiert, aufgrund des Abflusses von Werbegeldern an internationale Konzerne und schlichtweg aufgrund der Tatsache, dass 2015 noch fast jeder Dritte täglich ein Printerzeugnis erworben hat – mittlerweile ist es nur mehr fast jeder Fünfte.
Wir wollen eine vielfältige Medienlandschaft; wir wollen das, weil wir davon überzeugt sind, dass Qualitätsjournalismus einen Mehrwert für die Demokratie hat. Dementsprechend ist es unsere Aufgabe, dass wir eine breite Medienvielfalt sicherstellen. Gerade bei der jüngeren Generation, bei den Jugendlichen, ist es uns wichtig, dass diese nicht zu Social Media, Fakenews und Propaganda greifen,
sondern dass sie zu qualitätsvollen Medien greifen. Dementsprechend müssen wir diese auch sichern.
Für uns als Regierung und auch für mich als Medienministerin ist das heute wirklich ein guter Tag, denn wir haben es geschafft, die jahrzehntelang bestehende alte Presseförderung zu transformieren. Wir werden künftig in Journalistinnen und Journalisten investieren, und ja, wir werden künftig in jene investieren, die gute Arbeitsbedingungen vorfinden, die kollektivvertraglich oder kollektivvertragsähnlich angestellt sind. Wir werden in jene Medien investieren beziehungsweise jene unterstützen, die beispielsweise Auslandskorrespondenten haben, bei denen es Fehlermanagementsysteme, Qualitätssicherungssysteme und natürlich auch Frauenförderungspläne gibt.
Diese sogenannten Qualitätskriterien sind die Basis der neuen Förderung. Darüber hinaus werden wir natürlich auch im Volumen ordentlich steigern, denn das ist in Anbetracht der schwierigen Situation am österreichischen, aber auch am europäischen Medienmarkt generell notwendig. Wir werden die bestehende Presseförderung nahezu versechsfachen, sehr geehrte Damen und Herren. (Beifall bei Abgeordneten von ÖVP und Grünen.)
Wir haben bereits in den letzten Jahren die Presseförderung um die sogenannte Digital-Transformationsförderung erweitert, mit der wir jährlich 20 Millionen Euro ausschütten. Mit der neuen Qualitätsjournalismusförderung werden wir neuerlich jährlich 20 Millionen Euro investieren. So kommen wir von einem ursprünglichen Volumen – das wir als Regierung übernehmen durften – der alten Presseförderung von in etwa 8 Millionen Euro auf nunmehr über 47 Millionen Euro. Das ist und das wird natürlich auch eine Erleichterung für die vielen Medien in Österreich sein, die qualitätsvollen Journalismus betreiben.
Wir werden natürlich auch in Medienkompetenz investieren, denn wir wollen, dass die Schülerinnen und Schüler einen kompetenten Umgang mit der Vielzahl an Medien und dem Informationsfluss, der auf sie hereinprasselt, erlernen. Wir
werden auch die Selbstkontrolle der Medien unterstützen, weil wir das für sinnvoll erachten. Das Budget des sogenannten Presserates wird im Vergleich zum Letztentwurf auf 230 000 Euro erhöht.
Wir wollen mit der neuen Qualitätsjournalismusförderung die Journalistin und den Journalisten in den Vordergrund rücken. Ich bin sehr dankbar und auch froh, dass es in monatelangen Konsultationen gelungen ist, die Notifikation von der Europäischen Kommission zu erhalten, und dass es zeitnah gelingen konnte – dank guter Abstimmung mit Ihnen, auch mit den Oppositionsparteien –, diese Förderung zu beschließen, sodass es möglich sein wird, diese Förderung auch noch für das Jahr 2022 auszubezahlen. – Vielen Dank. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
15.27
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Ich darf bekannt geben, dass das von mindestens 46 Abgeordneten unterstützte Verlangen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses gemäß § 33 Abs. 1 der Geschäftsordnung betreffend „Aufklärung, ob öffentliche Gelder im Bereich der Vollziehung des Bundes aus sachfremden Motiven zweckwidrig verwendet wurden (‚Rot-Blauer Machtmissbrauch-Untersuchungsausschuss‘)“ eingebracht wurde.
Dieses wird gemäß § 33 Abs. 2 der Geschäftsordnung an alle Abgeordneten verteilt.
Die Zuweisung des gegenständlichen Verlangens an den Geschäftsordnungsausschuss erfolgt gemäß § 33 Abs. 6 der Geschäftsordnung am Schluss dieser Sitzung.
Das Verlangen hat folgenden Gesamtwortlaut:
Verlangen
auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses
gemäß § 33 Abs. 1 zweiter Satz GOG-NR
der Abgeordneten Mag. Andreas Hanger, Kolleginnen und Kollegen
betreffend Aufklärung, ob öffentliche Gelder im Bereich der Vollziehung des Bundes aus sachfremden Motiven zweckwidrig verwendet wurden („ROT-BLAUER Machtmissbrauch-Untersuchungsausschuss“)
Die österreichische Bundespolitik steht seit längerer Zeit in der Kritik, wonach das Handeln vieler Spitzenpolitikerinnen und -politiker auf Bundesebene überwiegend den Interessen von Parteien und ihren Mitgliedern diene und nicht dem Interesse der Allgemeinheit. Im Besonderen lautet der Vorwurf, dass bei der Vergabe von Inseraten oder bei der Beauftragung von Gutachten, Studien und Umfragen nicht Rechtsrichtigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit, sondern das Naheverhältnis zu einer politischen Partei die ausschlaggebende Rolle gespielt habe.
Die unterzeichneten Abgeordneten verlangen daher gemäß Art. 53 Abs. 1 zweiter Satz B-VG sowie § 33 Abs. 1 zweiter Satz GOG-NR die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses mit folgendem
Untersuchungsgegenstand:
1. Untersucht werden soll,
ob Mitglieder der Bundesregierung und Staatssekretärinnen bzw. -sekretäre, die mit der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ) oder mit der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ), sowie diesen Organen in den jeweiligen Bundesministerien unterstellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf deren Geheiß oder mit deren Wissen
im Zusammenhang mit
- Inseratenschaltungen und Medienkooperationsvereinbarungen;
- Umfragen, Gutachten und Studien,
- Beauftragung von Werbeagenturen sowie
Betrauung von Personen mit der Leitung oder stellvertretenden Leitung von Organisationseinheiten in der Bundesverwaltung (insbesondere Sektionen, Gruppen und Abteilungen) samt Staatsanwaltschaften und ausgegliederten Rechtsträgern
im Zeitraum vom 11. Jänner 2007 bis zum Ende der XXVI GP. (7. Jänner 2020).
aus sachfremden Motiven
gehandelt haben.
2. Vom Untersuchungsgegenstand ist auch die Tätigkeit von ausgegliederten Rechtsträgern erfasst, soweit sie der mittelbaren oder unmittelbaren Ingerenz von Mitgliedern der Bundesregierung und Staatssekretärinnen bzw. -sekretären, die mit der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ) oder mit der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) verbunden sind, unterlagen.
3. Ebenfalls vom Untersuchungsgegenstand erfasst ist staatsanwaltliches Handeln, das die erwähnten Handlungen im Zeitraum von 11. Jänner 2007 bis zum Ende der XXVI GP. (7. Jänner 2020) zum Gegenstand hatte.
4. Schließlich ist vom Untersuchungsgegenstand die Frage erfasst, ob durch die erwähnten Handlungen im Zeitraum von 11. Jänner 2007 bis zum Ende der XXVI GP. (7. Jänner 2020) gesetzliche Bestimmungen umgangen oder verletzt wurden sowie ob dem Bund oder anderen Rechtsträgern dadurch Schaden entstanden ist.
5. Schließlich ist vom Untersuchungsgegenstand erfasst, ob durch die Bundesvollziehung, ausgenommen die Rechtsprechung, insbesondere durch die COVID-Finanzierungsagentur des Bundes (COFAG), natürliche oder juristische Personen, die die SPÖ oder die FPÖ – etwa durch Spenden – unterstützt haben oder diesen Parteien sonst nahe stehen oder standen bzw. verbunden sind oder waren, zwischen
18. Dezember 2017 und 23. November 2023 aus unsachlichen Gründen bevorzugt behandelt wurden.
Der Untersuchungsausschuss hat diesbezüglich folgende Fragen zu klären:
1. Welche Motive haben die Verwaltung bei der COFAG geleitet?
2. Wer hat die Ausgestaltung der COFAG-Förderungen bestimmt?
3. In welchem Ausmaß haben Personen und Unternehmen von COFAG-Förderungen profitiert?
4. Welche Handlungen in Zusammenhang mit den im Untersuchungsgegenstand genannten Personen und Unternehmen wurden von Organen bzw Bediensteten der COFAG oder vom Bundesministerium für Finanzen im Zusammenhang mit der COFAG und diesen Personen und Unternehmen gesetzt?
5. Wurde von der COFAG in Zusammenhang mit Förderungen an die im Untersuchungsgegenstand genannten Personen und Unternehmen "ein Auge zugedrückt"?
6. In welchem Ausmaß erhielten die im Untersuchungsgegenstand genannten Personen und Unternehmen Subventionen aus öffentlichen Mitteln?
Dabei insbesondere:
a. Erhielten die im Untersuchungsgegenstand genannten Personen und Unternehmen Steuerbegünstigungen oder Steuernachlässe, etwa im Zuge von Abgabenprüfungen?
b. Wurden Projekte von im Untersuchungsgegenstand genannten Personen und Unternehmen aus Förderprogrammen des Bundes unterstützt und wenn ja, in welcher Höhe?
c. In welchem Ausmaß arbeiteten Stiftungen und Fonds des Bundes mit den im Untersuchungsgegenstand genannten Personen und Unternehmen zusammen?
7. Wurde der Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz gegenüber den im Untersuchungsgegenstand genannten Personen und Unternehmen eingehalten?
Dabei insbesondere:
a. Erhielten die im Untersuchungsgegenstand genannten Personen und Unternehmen privilegierten Zugang zu Organen der Vollziehung und allenfalls sogar besondere (im Sinne zB von beschleunigte) Verfahren für sich oder von ihnen benannte Dritte und aus welchem Grund bzw auf Veranlassung von wem innerhalb der Verwaltung?
b. Intervenierte die politische Führungsebene der Bundesministerien in Verwaltungsverfahren und -ablaufe betreffend die im Untersuchungsgegenstand genannten Personen und Unternehmen?
c. Wurden Aufsichtsbehörden im Zusammenhang mit den im Untersuchungsgegenstand genannten Personen und Unternehmen tätig und mit welchen Ergebnissen?
d. Wurde durch Leitungsorgane im Wege von Weisungen oder informell auf Aufsichts- oder Strafverfahren, von denen die im Untersuchungsgenstand genannten Personen und Unternehmen (wenn auch nicht alleine) betroffen waren, eingewirkt und wenn Ja, auf welche Art?
e. Ließen sich Amtsträger von im Untersuchungsgegenstand genannten Personen und Unternehmen Vorteile anbieten oder haben diese sogar angenommen und was war die gewünschte Gegenleistung im Bereich der Vollziehung?
8. Wurden die im Untersuchungsgegenstand genannten Personen und Unternehmen bevorzugt in Regierungstätigkeiten eingebunden?
Dabei insbesondere:
a. Welche Informationen wurden den im Untersuchungsgegenstand genannten Personen und Unternehmen zur Verfügung gestellt (etwa durch Bestellung in Organe
von staatsnahen Unternehmungen) und ermöglichten diese Informationen ihnen den Erhalt oder Ausbau ihres Vermögens?
b. Von welchen Unternehmungen des Bundes wurde mit Unternehmen, die den im Untersuchungsgegenstand genannten Personen und Unternehmen zuzurechnen sind, zusammengearbeitet und aus welchen Gründen?
c. In welchem Ausmaß und aus welchen Gründen wurden Unternehmen, die den im Untersuchungsgegenstand genannten Personen und Unternehmen zuzurechnen sind, von Bundesorganen beauftragt?
Beweisthemen und inhaltliche
Gliederung
des Untersuchungsgegenstandes
1. Inseratenschaltungen und Medienkooperationsvereinbarungen:
Aufklärung über den Abschluss von Inseratengeschäften sowie den Abschluss und den Abruf aus Medienkooperationsvereinbarungen aus sachfremden Motiven, über die damit in Zusammenhang stehende mögliche Umgehung oder Verletzung von Rechtsvorschriften und über die dem Bund oder anderen Rechtsträgern dadurch entstandenen Kosten. Insbesondere soll untersucht werden:
a. Die Höhe der jährlich vorgesehenen Mittel für Inserate und Medienkooperationsvereinbarungen und deren Herkunft sowie das Vorliegen von Informationen über die Bewertung der Preisakzeptanz.
b. Die Messung des Erfolges von Kampagnen, die seitens der im Untersuchungsgegenstand genannten Organe und Personen in Auftrag gegeben wurden.
c. Die Ausnutzung aller Rabatte und Boni bei der Schaltung von Inseraten und dem Abschluss von Medienkooperationen durch die im Untersuchungsgegenstand genannten Organe und Personen.
d. Der Versuch der Beeinflussung der Berichterstattung (z.B. in Zeitungen, Zeitschriften, Magazinen sowie sonstigen Druckwerken oder elektronischen Medien)
durch die (möglicherweise zu überhöhten Preisen erfolgte) Schaltung von Inseraten oder durch den Abschluss von Medienkooperationen durch die im Untersuchungsgegenstand genannten Organe oder diesen unterstellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
e. Der Versuch der Erlangung einer „eigentümerähnlichen Funktion“ in Medienunternehmen mittels der im Untersuchungsgegenstand erwähnten Handlungen durch die (möglicherweise zu überhöhten Preisen erfolgte) Schaltung von Inseraten oder durch den Abschluss von Medienkooperationsvereinbarungen oder aus anderen Formen der Zusammenarbeit zwischen Medien und der im Untersuchungsgegenstand genannten Personen und Parteien; insbesondere durch die Zahlung überhöhter Rechnungen durch den Bund.
f. Das Vorliegen von „Kickback-Zahlungen“ zugunsten der im Untersuchungsgegentand genannten politischen Parteien, deren Vorfeld- oder Teilorganisationen, diesen politischen Parteien zurechenbarer oder mit politischen Parteien befreundeter Organisationen im Wege der Schaltung von Inseraten und dem Abschluss von Medienkooperationsvereinbarungen oder aus anderen Formen der Zusammenarbeit zwischen Medien und der im Untersuchungsgegenstand genannten Personen und Parteien; insbesondere durch die Zahlung überhöhter Rechnungen durch den Bund.
2. Umfragen, Gutachten und Studien:
Aufklärung über die Beauftragung von Umfragen, Gutachten und Studien und die Verwendung der Ergebnisse dieser durch die im Untersuchungsgegenstand bezeichneten Organe und Personen:
a. Die Einflussnahme auf Vergabeverfahren zu Gunsten politischen Parteien nahestehender Unternehmen und Personen u.a. mit dem mutmaßlichen Ziel der (indirekten) Partei- oder Wahlkampffinanzierung.
b. Die Umgehung von Vergabevorschriften (z.B. durch das „Maßschneidern“ von Ausschreibungsunterlagen), wodurch den im Untersuchungsgegenstand genannten politischen Parteien unmittelbar oder mittelbar nahestehende Unternehmen und
Personen bevorzugt und andere Unternehmen oder Personen entgegen dem Bestbieterprinzip übergangen wurden und allfällige dadurch verursachte Schäden für den Bund.
c. Die Beauftragung von Unternehmen oder Personen, die auch für die im Untersuchungsgegenstand genannten politischen Parteien tätig sind oder waren oder die den im Untersuchungsgegenstand genannten politischen Parteien nahestehen.
d. Die Ausschreibung sowie die Vergabe von Umfragen, Gutachten, Studien und Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der „Sonntagsfrage“ oder im Zusammenhang mit der Untermauerung politischer Forderungen oder Ideen.
e. Abschluss von Beratungsverträgen mit ehemaligen und aktuellen Kabinettsmitarbeitern, Politikern und deren Angehörigen, die den im Untersuchungsgegenstand genannten politischen Parteien nahestehen oder standen.
3. Beauftragung von Werbeagenturen
a. Die Einflussnahme auf Vergabeverfahren zu Gunsten politischen Parteien nahestehender Unternehmen und Personen u.a. mit dem mutmaßlichen Ziel der (indirekten) Partei- oder Wahlkampffinanzierung.
b. Die Umgehung von Vergabevorschriften (z.B. durch das „Maßschneidern“ von Ausschreibungsunterlagen), wodurch den im Untersuchungsgegenstand genannten politischen Parteien unmittelbar oder mittelbar nahestehende Unternehmen und Personen bevorzugt und andere Unternehmen oder Personen entgegen dem Bestbieterprinzip übergangen wurden und allfällige dadurch verursachte Schäden für den Bund.
c. Die Beauftragung von Unternehmen oder Personen, die auch für die im Untersuchungsgegenstand genannten politischen Parteien tätig sind oder waren oder die den im Untersuchungsgegenstand genannten politischen Parteien nahestehen.
4. Betrauung von Personen mit der Leitung oder stellvertretenden Leitung von Organisationseinheiten in der Bundesverwaltung (insbesondere Sektionen, Gruppen und Abteilungen) samt Staatsanwaltschaften und ausgegliederten Rechtsträgern
Aufklärung über die allfällige Einflussnahme auf die Betrauung sowie Bestellung mit Führungs- und Leitungsfunktionen sowie von Mitgliedern von Aufsichts- und Kontrollgremien aus sachfremden Motiven, über die damit in Zusammenhang stehende mögliche Umgehung oder Verletzung von Rechtsvorschriften und über die dem Bund oder anderen Rechtsträgern dadurch entstandenen Kosten. Insbesondere soll untersucht werden:
a. Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen für Planstellen- und Arbeitsplatzbesetzungen sowie der Bestimmungen des Ausschreibungsgesetzes und hinsichtlich Staatsanwältinnen und Staatsanwälten des Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz sowie der Bestimmungen für die Betrauung bzw. Bestellung von Führungskräften (z.B. Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer) und von Mitgliedern von Aufsichts- und Kontrollgremien von Stiftungen, Fonds und Anstalten im Sinne des Art. 126b Abs. 1 B-VG sowie von Unternehmungen gemäß Art. 126b Abs. 2 B-VG.
b. Berücksichtigung der fachlichen und persönlichen Qualifikationserfordernisse bei der Besetzung von Arbeitsplätzen mit Personen, insbesondere mit (ehemaligen) Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Kabinetten bzw. Büros von Staatssekretären.
c. Sachfremde Einflussnahme auf Stellenausschreibungstexte, insbesondere im Hinblick auf das „Maßschneidern“ zu Gunsten parteipolitisch genehmer Bewerberinnen und Bewerber, auf die Zusammensetzung der Begutachtungs- bzw. Bewertungskommissionen sowie auf die Gutachten und Besetzungsempfehlungen der Begutachtungs- bzw. Bewertungskommissionen.
d. Politische Interventionen von (ehemaligen) oder für (ehemalige) Politikerinnen und Politiker, von (ehemaligen) oder für (ehemalige) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kabinetten und Büros von Staatsekretären sowie Personen, die politischen Parteien nahestehen.
e. Grundlagen und Begründungen von Organisationsreformen und deren Auswirkungen auf die Personalstruktur in den einzelnen Bundesministerien (Zentralstellen und nachgeordnete Dienststellen).
f. Inhalt und Status staatsanwaltschaftlicher Handlungen, insbesondere von Ermittlungshandlungen, im Zusammenhang mit der Einflussnahme auf die Betrauung sowie Bestellung von Führungs- und Leitungsfunktionen in Bundesministerien, nachgeordneten Dienststellen, Unternehmungen sowie von Mitgliedern von Aufsichts- und Kontrollgremien gegen Mitglieder der Bundesregierung und Staatssekretäre oder gegen diesen unterstellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
g. Beauftragungen von Gutachten und Studien sowie Vergabe von Beratungsdienstleistungen durch die Staatsanwaltschaften und Oberstaatsanwaltschaften im Zusammenhang mit Punkt 3.f.
5. Inhalt und Status staatsanwaltschaftlichen Handelns im Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegenstand
6. Beauftragung von Gutachten und Studien sowie Vergabe von Beratungsdienstleistungen durch die Staatsanwaltschaften und Oberstaatsanwaltschaften betreffend Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegenstand.
7. COFAG
Aufklärung über das Verhalten der Organe und Bediensteten der COVID Finanzierungsagentur des Bundes ("COFAG") sowie der diesbzgl zuständigen Personen im Bundesministerium für Finanzen gegenüber den im Untersuchungsgenstand genannten Personen und Unternehmen sowie die Gewährung geldwerter Vorteile aus öffentlichen Haushalten in deren Einflussbereich.
Informationsweitergabe und Interventionen
Aufklärung über Vorwürfe der unmittelbaren oder mittelbaren Weitergabe interner Verwaltungsinformationen an im Untersuchungsgegenstand genannte Personen sowie Einflussnahme auf Verwaltungsverfahren im Interesse der im Untersuchungsgegenstand genannten Personen und Unternehmen.
Kooperationen staatsnaher Unternehmen
Aufklärung über Kooperationen, Joint Ventures, gemeinsame Beteiligungen und/oderSyndizierungen zwischen staatlichen und staatsnahen Unternehmen und im Untersuchungsgegenstand genannten Personen bzw den ihnen zurechenbaren Unternehmen und genannten Unternehmen
Staatliche Aufsicht
Aufklärung über die Bemühungen von Behörden bei der staatlichen Aufsicht und der Führung von Strafverfahren jeglicher Art in Zusammenhang mit den Handlungen oder dem Vermögen von im Untersuchungsgegenstand genannten Personen und Unternehmen einschließlich von Finanzstrafverfahren, nicht jedoch Verwaltungsstrafverfahren in Zuständigkeit der Gemeinden, Bezirksverwaltungsbehörden oder Landeshauptleute,
Begründung
SPÖ
Der Vorwurf der Beeinflussung der Berichterstattung in Boulevardzeitungen durch Inseratenschaltungen erfordert eine gründliche Untersuchung, um den Urheber solcher potentiellen Machenschaften zu ermitteln. Die Verdachtsmomente lassen sich auf Aktivitäten der SPÖ zurückführen.
Die Enthüllungen bezüglich des „Beinschab-Österreich-Tools“ im Bundesministerium für Finanzen sind äußerst beunruhigend, weil sie alarmierende Anzeichen für mögliche Manipulationen von Umfragen und Studien aufzeigen sowie eine mögliche Einflussnahme auf die Berichterstattung in Boulevardzeitungen. Besonders bemerkenswert ist die Rolle der SPÖ und des ehemaligen Bundeskanzlers Christian Kern in diesem Kontext.
Während ihrer Beschuldigteneinvernahme berichtete Sabine Beinschab von Absprachen zwischen der Karmasin Motivforschung, der SPÖ und der Tageszeitung Heute, bei denen die Wünsche der SPÖ hinsichtlich Umfrageergebnisse im Vordergrund standen. 1 Anlässlich einer Vernehmung führte Sabine Beinschab aus,
dass während der Zusammenarbeit zwischen der SPÖ und Sabine Karmasin in den Jahren 2009 bis 2013 auch Angebote an das Bundeskanzleramt und an Heute gemacht wurden.2 Sabine Beinschab erklärte ausdrücklich, warum sie auf das „Beinschab-Österreich-Tool“ während ihrer Einvernahme hinweist und die Verbindung zwischen Sophie Karmasin, Heute und der SPÖ betont: „Ich will das deswegen darstellen, weil es sich aus meiner Sicht um dasselbe System handelt, das auch im vorliegenden Fall zur Anwendung kam.“3
Aus der parlamentarischen Antwort 11717/AB (XXVII. GP) geht hervor, dass im Jahr 2010, nachdem Einvernehmen zwischen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern des Kabinetts des damaligen Bundeskanzlers erzielt worden war, der Büroleiter von Staatssekretär Josef Ostermayer die Sophie Karmasin Market Intelligence GesmbH mit der Durchführung der Studie „Gerechte Steuern 2010“ beauftragte. Es wurden dabei keine Vergleichsangebote eingeholt. Die Fragestellungen bezogen sich unter anderem auf die „Wahrnehmung der Parteien“, und gemäß den Aktendokumenten erfolgte eine Überprüfung der Fragebögen durch den Büroleiter des Staatssekretärs Josef Ostermayer. 4
Es besteht der Verdacht, dass weitere Werbeagenturen und Meinungsforschungsinstitute mit Nähe zur SPÖ in die Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Beinschab-Tool verwickelt waren und Sophie Karmasin möglicherweise von weiteren von der SPÖ geführten Ministerien zur Nutzung des Beinschab-Tools beauftragt wurde.
Bundeskanzler a.D. Christian Kern bestätigte in einem ZIB2 Interview die Aussagen von Sabine Beinschab, als ursprüngliche Erfindung seiner Partei und hielt dazu fest: „Natürlich hat die SPÖ da eine Verantwortung […] Und es ist natürlich auch eine Erbsünde der SPÖ […].“5
Am 26. September 2023 gelangte ein Strategiepapier des Meinungsforschungsinstituts SORA6 für den Nationalratswahlkampf 2024 für die SPÖ an die Öffentlichkeit. Der Österreichische Rundfunk (ORF) hat in weiterer Folge die jahrelange Zusammenarbeit mit dem betreffenden Institut beendet. Die Zusammenarbeit umfasste im Zuge der Wahlberichterstattung die Wahlforschung,
Hochrechnungen und Analysen.7 Die sich aufdrängende Verbindung zwischen SORA und der SPÖ in Verbindung mit dem ORF induziert, dass durch die Nähe zur SPÖ eine potenzielle Manipulation der Datenerfassung durch SORA im Sinne der SPÖ erfolgte.
Daraus resultierend könnten auch Kooperationen mit anderen öffentlichen Rechtsträgern und Ministerien in Zweifel gezogen werden, insbesondere hinsichtlich der Frage, ob die vom SORA-Institut bereitgestellten Daten einem parteipolitischen Kalkül der SPÖ unterlagen. Es stellt sich die Frage, ob diese Vorgehensweise bereits in Zeiten, in denen Bundesministerien von der SPÖ nahestehenden Personen geleitet wurden, Anwendung fand, weshalb geklärt werden muss, ob SORA Aufträge von Bundesministerien erhalten hat, die von der SPÖ nahestehenden Personen geleitet wurden bzw. ob Kick-Back Zahlungen an die SPÖ erfolgten.
Die Fraktion christlicher Gewerkschafter Wien formulierte ebenfalls Vorbehalte hinsichtlich einer fortgesetzten Kooperation der Arbeiterkammer mit SORA. Schließlich kooperiert die Arbeiterkammer regelmäßig mit SORA bei der Erstellung von Studien. Angesichts der erkennbaren Nähe sowohl der Arbeiterkammer als auch der SPÖ zu SORA könnten mögliche Rückvergütungen und Fragen zur Objektivität der Studienergebnisse nicht außer Acht gelassen werden.8
Schließlich ist auffällig, dass SORA 2011 Insolvenz ankündigen musste, aber in weiterer Folge bestehen konnte. Insofern stellt sich auch hier die Frage, ob damals von der SPÖ nahestehenden Personen geführte Bundesministerien Aufträge und Studien vorzugsweise an SORA vergeben haben, um den Fortbestand dieses – der SPÖ nahestehenden – Meinungsforschungsinstituts zu ermöglichen. Im Jahr 2011, in dem Jahr, als der Weiterbestand von SORA fraglich war, erhielt SORA in Wiener Neustadt unter dem damaligen der SPÖ nahestehenden Bürgermeister Bernhard Müller von der städtischen Tochtergesellschaft WNSKS den Auftrag, eine Meinungsumfrage durchzuführen; gleichzeitig beauftragte die SPÖ-Niederösterreich dasselbe Institut für kommunalpolitische Fragen. SORA koppelte beide Umfragen miteinander. Ob somit die Umfragen für die SPÖ von der Stadtverwaltung bezahlt wurden, kann nicht ausgeschlossen werden.9
Die SPÖ beschreibt in ihrem Fraktionsbericht zum Untersuchungsausschuss 4/US XXVII. GP detailliert, wie das „Beinschab-Tool“ im Zusammenhang mit Inseraten funktioniert: „Veröffentlicht wurden die Umfragen dann bei der Mediengruppe ÖSTERREICH. Als Gegenleistung inserierte das Ministerium dann in der Zeitung. […] Zuerst beauftragte das Finanzministerium die Studie bei Sabine Beinschabs Marktforschungsinstitut Research Affairs. Beinschab führte diese dann tatsächlich auch durch, rechnete aber rund 15.000 Euro zu viel beim Finanzministerium ab. Mit diesen 15.000 Euro wurden zusätzliche Fragen im Auftrag der ÖVP abgegolten, wie etwa zu den Auswirkungen des Antritts der Liste Pilz bei den Nationalratswahlen, der sogenannten „Silberstein-Affäre“ sowie zur Mobilisierung unentschlossener Wähler*innen.“ 10 Diese Ausführung erweckt den Anschein, als würde die SPÖ aus ihren eigenen Erfahrungen berichten.
Im Hinblick darauf, dass Sabine Beinschab in ihrer Beschuldigtenvernehmung von einem System berichtete, dass bereits 2009 von der SPÖ etabliert wurde, ist nicht auszuschließen, dass auch andere Systeme im Zusammenhang der Beeinflussung der Vergabe von Aufträgen und insbesondere über Buchungen von Inseraten zu einem früheren Zeitpunkt zur Anwendung gekommen sind.
In Erinnerung gerufen sei, dass bei einer Nationalratswahl die kritische Berichterstattung über den Spitzenkandidaten einer Großpartei damit sanktioniert wurde, dass Interviews mit dieser Tageszeitung ausgeschlossen, die Teilnahme an einer TV-Diskussionen verweigert und dort keine Wahlkampfinserate geschalten wurden.
Josef Kalina, ehemalige Redakteur der „Kronen Zeitung“, SPÖ Kommunikationsleiter, Bundesgeschäftsführer und Mitglied des Bundesrates, gründete am 16.10.2008 die Werbeagentur Unique Public Relations GmbH. Im Jahr 2014 folgte die Gründung des Meinungsforschungsinstituts Unique Research GmbH, bei dem er ebenfalls seit 2014 als Geschäftsführer fungiert. Die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage (3528/AB XXV.GP) aus dem Jahr 2015 vom SPÖ-Minister Rudolf Hundstorfer legt dar, dass die Unique Public Relations GmbH mit dem Sozialministerium einen Werkvertrag von 75.912 EUR für die „Strategische Medienkommunikation des Sozialministeriums unter besonderer Berücksichtigung
sozialer Medien“11 abgeschlossen hat. Die Unique Research GmbH hat mehrere österreichische Zeitungen wie Heute oder das Profil als Auftraggebern.
Es ist von entscheidender Bedeutung zu klären, ob unter der Leitung von Sozialminister Hundstorfer oder anderen der SPÖ nahestehenden Mitgliedern der Bundesregierung oder Staatssekretärinnen bzw. Staatssekretären ähnliche Mechanismen wie das „Beinschab-Tool“ zum Einsatz kamen, diesmal jedoch unter der Beteiligung von Josef Kalina.
Das Verfahren gegen Werner Faymann und Josef Ostermayer in der Inseratenaffäre mit der AZ 32 St 41/11x und die Einstellung des Verfahrens sind bereits medial bekannt. Über den Vorwurf, Werner Faymann habe sich in seiner Zeit als Infrastrukturminister mit teuren Inseratenkampagnen die Gunst des Zeitungsboulevards erkauft und die Rechnungen dafür von ÖBB und ASFINAG bezahlen lassen, sowie über die Einstellung des Verfahrens, haben diverse Medien berichtet. So wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Bundeskanzler Werner Faymann und gegen Josef Ostermayer, an den nach Angaben von Sabine Beinschab ab 2009 auch Angebote zur Meinungsforschung gelegt wurden, geführt.12
Es besteht die Möglichkeit, dass das von Sabine Beinschab beschriebene System auch im Zusammenhang mit dem gegen Werner Faymann und Josef Ostermayer laufenden Verfahren wegen Inseratenvergaben steht. Eine Verbindung kann insbesondere deshalb angenommen werden, da die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft bereits im Dezember 2021 im Akt AZ 17 St 5/19d zum Sachverhalt Beinschab-Österreich-Tool die Beischaffung des Aktes 32 St 41/11x von der Staatsanwaltschaft Wien verfügt hat. 13 Daher ist es von größter Wichtigkeit, sowohl das Verfahren der gesamten Inseratenaffäre (2007 bis 2013) als auch die Einstellung des Verfahrens im Lichte der neuen Anschuldigungen von Sabine Beinschab und der damit verbundenen Ermittlungen eingehend zu untersuchen.
In derselben Causa wurde Thomas Schremser, der ehemalige Ressortleiter der Kronen Zeitung, laut Falter am 6. Juli 2023 von der WKStA vorgeladen. „Es geht um Inseratendeals, politische Intervention und Verflechtungen“, berichtet der Falter.
Thomas Schremser schied 2014 aus der Kronen Zeitung aus, weil er das „korrupte System einfach nicht mehr ertragen“ konnte. 14 In der Sendung „Scheuba fragt nach“ im Falter Radio gewährt Thomas Schremser einen konkreten Einblick in die enge Beziehung zwischen Werner Faymann und der Kronen Zeitung. So berichtet er über ein System der Medienkorruption seitens Werner Faymann. Angeblich besuchte er täglich die Kronen Zeitung und traf sich mit dem „alten“ Dichand, den Faymann angeblich „Onkel“ nannte. Das System sei eingerichtet worden, als Werner Faymann als Wiener Wohnbau-Stadtrat durch Interventionen mit Inseratengeldern negative Berichterstattungen über „Wiener Wohnen“ verhindert haben soll. Im Interview wird Werner Faymann auch als „Schutzpatron der Kronen Zeitung“ bezeichnet. Dieses System soll auch später von Werner Faymann als „Inseratenkanzler“ fortgesetzt worden sein. 15
Der Verdacht einer Inseratenpolitik, die seitens der der SPÖ nahestehenden Mitglieder der Bundesregierung betrieben wurde, zum Zweck einer verdeckten Parteifinanzierung mit Hilfe von Organisationen mit Nähe zur SPÖ liegt nahe und bedarf einer gründlichen Untersuchung.
Die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage (9879/AB XXIV. GP) durch das Bundeskanzleramt aus dem Jahr 2012 erhärtet diesen Verdacht. So wurden seit dem Jahr 2007 Vorfeldorganisationen oder Organisationen, die der SPÖ nahestehen, wie beispielsweise der Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs (ARBÖ), der Pensionistenverband Österreichs (PVÖ), der Verband Sozialistischer Studentinnen in Österreich (VSStÖ) 16 und die Sozialistische Jugend17, mit zahlreichen Inseraten seitens des Bundeskanzleramtes bzw. seitens der Bundesministerien, die von der SPÖ nahestehenden Mitgliedern der Bundesregierung geleitet wurden, bedacht. Es stellt sich also die Frage, ob möglicherweise weitere Vorfeldorganisationen oder Organisationen, die der SPÖ nahestehen, aus sachfremden Motiven mit Inseraten von der SPÖ nahestehenden Mitgliedern der Bundesregierung bzw. von – von diesen geleiteten – Bundesministerien bedacht wurden.
Auch die Vergabe von externen Dienstleistungen muss untersucht werden. Schon im ersten Jahr der Regierung Werner Faymann I wurden 32 Millionen EUR für durch
externe Berater durchgeführte Studien ausgegeben. Es besteht die Befürchtung, dass die Beauftragungen parteipolitisch motiviert waren und dass die Ergebnisse der Studien von den auftraggebenden Ministerien zurückgehalten wurden, weil nicht das parteipolitisch erwünschte Ergebnis herausgekommen ist.
So hat das Verkehrsministerium als damaliger Spitzenreiter 5,7 Millionen EUR für Studien ausgegeben. Darunter finden sich Studien wie eine Genderstudie, „Frauen in nationalen und internationalen Luftfahrtorganisationen“, oder eine Studie zum „Gender Budgeting“. Der damalige Abgeordnete des Nationalrates Gerald Grosz äußerte den Verdacht der illegalen Parteifinanzierung: „Das eine oder andere Beratungsunternehmen dürfte als zwischengeschaltetes Unternehmen fungiert haben, um Steuergeld reinzuwaschen und in die Parteikassen von SPÖ […] fließen zu lassen“.18 Ebenso wird „Geld für die Bestätigung bekannter Tatsachen ausgegeben“, wie die Grüne Frauensprecherin Brigid Weinzinger im Jahr 2010 Kritik an einer IFES-Umfrage verkünden ließ.19 Der Umstand, dass gerade das Institut für empirische Sozialforschung (IFES) mit Studien beauftragt wird, deren Ergebnisse nicht neu waren oder deren Fragestellung mit den inhaltlichen Schwerpunkten des Institutes nicht übereinstimmten, wurde auch von der BZÖ Bildungssprecherin Ursula Haubner kritisiert. Haubner unterstellt dem IFES, ein SPÖ-Umfrageinstitut zu sein, und dass „im Vergleich zur Marktwirtschaft offensichtlich überhöhte Preise mit Ministeriumsgeldern querfinanziert“ 20 worden zu sein.
Explizit wird dabei die „teuerste Elternbefragung aller Zeiten“ 21 angesprochen, die vom von einem der SPÖ nahestehenden Mitglied der Bundesregierung geführten Unterrichtsministerium mit 182.000 EUR finanziert wurde und nicht vom eigenen Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung des österreichischen Schulwesens (BIFIE), das in diesem Aufgabenbereich wohl eher die notwendige Expertise gehabt hätte.22 Das IFES wurde nicht nur von der SPÖ-nahestehenden Mitgliedern der Bundesregierung bzw. von diesen geleiteten Ministerien mit hohen Auftragssummen bedacht, sondern auch mit Meinungsumfragen in Wahlkampfzeiten. So wurde das vom Standard als „Meinungsforschungsinstitut“ titulierte IFES von der SPÖ im Wahlkampf 2006 beauftragt; es lieferte im
Gegensatz zu anderen Meinungsforschungsinstituten wohlwollende Erkenntnisse betreffend den Spitzenkandidaten der SPÖ Alfred Gusenbauer.23
Es ist daher zu untersuchen, ob Studien zur Parteifinanzierung bzw. für Kickbackzahlungen unter Beteiligung von der SPÖ nahestehenden Agenturen dienten und welche SPÖ nahen Agenturen durch Ministeriumsbeauftragungen profitierten.
Im Untersuchungsausschuss 4/US XXVII. GP wurden Unterlagen vorgelegt, die den Verdacht nahelegten, dass Studien, die von Bundesministerien in Auftrag gegeben wurden, die von der SPÖ nahestehenden Mitgliedern der SPÖ geleitet wurden, nicht primär dazu dienten, die Regierungsarbeit durch externe Expertise und objektive Analysen zu unterstützen, sondern SPÖ-Teilverbände mit Steuergeld zu fördern.
Im Jahr 2015 wurde beispielsweise eine Förderung in Höhe von 80.000 EUR vom Bundeskanzleramt für die Studie „Trendmonitoring“ der Paul Lazarsfeld Gesellschaft beantragt.24 Diese Studie untersuchte politische Themen wie Parteimitgliedschaft, Parteipräferenzen und Wahlbeteiligung. Die Initiatoren sowie die „Strategischen Kooperationspartner“ der Studie waren die Arbeiterkammer Wien, der ÖGB und der SPÖ-Pensionistenverband.25 Obwohl die Fachabteilung gegen die Förderung Stellung bezog, wurde sie aufgrund wiederholter Interventionen seitens der Studieninitiatorinnen bzw. -initiatoren vom Bundeskanzleramt bewilligt. Das Bundeskanzleramt leistete eine Zahlung von 40.000 EUR, und ein Jahr später zahlte das Arbeitsministerium unter der Leitung von Alois Stöger weitere 40.000 EUR. 26
Der Untersuchungsausschuss 4/US XXVII. GP wollte diesen Sachverhalten nachgeben. Jedoch wurde die Aufklärung, insbesondere seitens der SPÖ-Fraktion und des Verfahrensrichters Wolfgang Pöschl, verhindert. Wolfgang Pöschl meinte: „Wenn es darum geht – schlampig gesagt –, Sünden der SPÖ aufzudecken, dann würde ich meinen, dass das nicht vom Untersuchungsgegenstand gedeckt ist.“ 27
Ein weiterer Rahmenvertrag warf erneut Fragen auf. Im Jahr 2017 wurde ein Rahmenvertrag in Höhe von 54.000 EUR zwischen dem Bundeskanzleramt und Karl
Krammer, einem ehemaligen Kabinettchef von Bundeskanzler Vranitzky, abgeschlossen. Die Teilabrechnung, welche dem Untersuchungsausschuss 4/US XXVII. GP vorlag, enthielt folgende Auskunft: „Die pauschal mit 3 Beratungstagen ausgewiesenen einzelnen Beratungsleistungen wurden an rund 20 Tagen des Monats erbracht und beziehen sich auf alle drei im Vertragsgegenstand festgehaltenen Beratungsfelder Regierungskommunikation, Medienpolitik und Europapolitik.“28 Bemerkenswert erscheint jedoch, dass im Januar 2017 an insgesamt 20 Tagen Beratungen stattgefunden haben sollen, obwohl der Vertrag mit Karl Krammer erst am 27. Januar 2017 unterzeichnet wurde. Der Untersuchungsausschuss 4/US XXVII. GP konnte leider keine Erkenntnisse zur Nachvollziehbarkeit der erbrachten Beratungsleistungen erlangen. Die von Karl Krammer vorgelegte Aufstellung enthält keinerlei Angaben darüber, wer, wann, über welche Themen und von wem beraten wurde. Die Bestätigung der Rechnung erfolgte durch den Kabinettchef des Bundeskanzlers, der sich auf folgende Formulierung zurückzog: „Und wenn die Leistungen nicht erbracht worden wären, hätte er es nicht sachlich richtig bestätigt.“29
Eine weitere Aktenlieferung aus dem Bundeskanzleramt im Rahmen des Untersuchungsausschusses 4/US XXVII GP hat zu erheblicher Verwirrung geführt und erfordert daher eine umfassende Aufklärung hinsichtlich möglicher parteipolitischer Bevorzugungen. Inmitten des Wahlkampfsommers 2017 wurde die Vergabeabteilung des Bundeskanzleramtes auf Anweisung der Ressortleitung beauftragt, ein Konzept für eine „ganzheitliche Lösung der gegenwärtigen Migrationskrise“ zu erstellen. Die Vergabe wurde an das Unternehmen Switxboard vergeben, das von dem Migrationsberater Kilian Kleinschmidt geleitet wurde. Erstaunlicherweise wurde der Auftrag in einem äußerst kurzen Zeitraum umgesetzt. Der Werkvertrag wurde am 2. August 2017 unterzeichnet, am 18. August 2017 wurde ein Zwischenbericht vorgelegt, und bereits am 15. September 2017 wurde der Endbericht präsentiert. Besonders bemerkenswert ist, dass der Bericht mit beeindruckenden 229 Seiten (abgesehen von einem zweiseitigen Vorwort) in englischer Sprache verfasst wurde, obwohl im Vertrag die Verwendung der Deutschen Sprache festgelegt war. Zudem blieb der Autor des Berichts unbekannt.30 Die Kosten betrugen 93.600 EUR, was von der Leiterin der Vergabeabteilung im Bundeskanzleramt bei ihrer Befragung vor dem
Untersuchungsausschuss 4/US XXVII. GP bestätigt wurde.31 Das Konzept schien aber tatsächlich nicht für das Bundeskanzleramt bestimmt gewesen zu sein, sondern, wie der damalige SPÖ-Parteiobmann und Bundeskanzler Christian Kern bestätigte, für die SPÖ. In einem Interview mit der Tageszeitung Die Presse vom 7. November 2017 erklärte Christian Kern, dass der „Entwicklungshelfer Kilian Kleinschmidt“ ein Migrationskonzept für die SPÖ ausarbeitete.32
Der Verfahrensrichter im Untersuchungsausschuss 4/US XXVI GP. Wolfang Pöschl wollte auf diesen Sachverhalt gerichtete Fragen zulassen, wenn nicht die Vorsitzende-Stellvertreterin Selma Yildirim bei ihm nicht interveniert hätte. Schlussendlich bestätigte Wolfgang Pöschl die Unzulässigkeit der Fragen mit der Begründung: „Es geht in diesem Ausschuss ausschließlich um die Österreichische Volkspartei.“33
Die Beauftragung von SPÖ-nahen Werbeagenturen durch Bundesministerien, die von der SPÖ nahestehenden Mitgliedern der Bundesregierung geleitet wurden, erwecken den Verdacht von Kickbackzahlungen. Das Bundeskanzleramt unter der Leitung von Werner Faymann und von Kanzleramtsministerin für Frauenangelegenheiten und Öffentlichen Dienst Gabriele Heinisch-Hosek finanzierte die der SPÖ nahestehende Werbeagentur Echo Medienhaus. Die Nähe dieser Werbeagentur zur SPÖ ergibt sich aus der ehemaligen Eigentümerin, dem „Verband Wiener Arbeiterheime (VWA)“, die in den Medien als „mächtigste politische Unternehmensholding Österreichs“ und Verwalterin des „Imperiums der Wiener SPÖ“ 34 bezeichnet wurde. Demnach soll die Kanzleramtsministerin Gabriele Heinisch-Hosek dem Echo Medienhaus für den „Galaabend 100 Jahre Frauentag“ mit 79.198 EUR mitfinanziert haben und weitere Agenturrabatten für Inseratenschaltungen gewährt haben. 35
Eine weitere der SPÖ nahestehende Werbeagentur, die heraussticht, ist die Leykam Medien AG. Die SPÖ-Steiermark ist über die Spectro gemeinnützige Gesellschaft für wissenschaftliche Forschung GmbH an dieser Beteiligungsgesellschaft beteiligt, und der ehemalige SPÖ-Abgeordnete zum Nationalrat Maximilian Lercher war Vorstand bzw. Geschäftsführer dieser Gesellschaften. 36 Es bedarf daher einer Untersuchung, ob die Leykam Medien AG aufgrund dieser Umstände von Bundesministerien, die von der SPÖ nahestehenden Mitgliedern der Bundesregierung geleitet
wurden, Aufträge erhalten hat und ob diese Verbindung für eine verdeckte Parteifinanzierung ausgenützt wurde.
Nachbesetzungen von SPÖ-nahen Parteimitgliedern in SPÖ-geführten Ministerien wurde inflationär betrieben. Viele Beispiele im Zusammenhang mit Postenbesetzungen sorgten für Kopfschütteln, an dem sogar der Steuerzahler zu Kassa geboten wurde. Zum Beispiel wurde Im Jahr 2011 wurde Ursula Zechner von der SPÖ-Verkehrsministerin Bures zur Sektionschefin ernannt, obwohl ein anderer Kandidat von der Begutachtungskommission besser bewertet wurde. Die Republik Österreich musste daraufhin mehr als 317.368 EUR Entschädigung an den besseren Kandidaten zahlen.37
Im Jahr 2013 wurde mit Nachdruck der Sektionschefin Zechner der ehemalige Personalchef des Telekommunikationsunternehmens Orange, Johannes Gungl, von der damaligen Verkehrsministerin Doris Bures (SPÖ) zum RTR-Chef bestellt. Laut dem Kurier wird Zechner eine langjährige Freundschaft mit Gungl nachgesagt. Auch das Ausschreibungsverfahren sorgte für Verwunderung, da die Anforderungskriterien und das Ausschreibungsverfahren dem Kurier zufolge nicht den Vorgaben des Ausschreibungsgesetzes entsprachen und sich stark auf einen Bewerber mit umfassender Personalerfahrung konzentrierten.38
FPÖ
Die von der FPÖ nahestehenden Mitgliedern der Bundesregierung geführten Bundesministerien bedachten im Zeitraum von 2017 bis 2019 der FPÖ nahestehende Medien durch Inseratenschaltungen. So wurden für Inserate in den Zeitschriften „Wochenblick“, „alles roger?“, „Zur Zeit“, „unzensuriert“ und „Info Direkt“ eine Gesamtsumme von über 116.000 EUR ausgegeben. 39
Laut einem Bericht des Profils erhielt die Zeitschrift „Wochenblick“, deren früherer FPÖ-Gemeinderat Norbert Geroldinger Geschäftsführer war, insgesamt 74.490 EUR vom Innen- und Verkehrsministerium für Inserate. Die Zeitschrift „alles roger?“, deren Verlagsleiter FPÖ-Politiker Peter Westenthaler war, erhielt vom Verkehrs- und
Sportministerium 22.580 EUR. In der von FPÖ-Funktionär Andreas Mölzer herausgegebenen Zeitschrift „Zur Zeit“ wurden Inserate vom Verteidigungs- und Verkehrsministerium geschaltet, wofür insgesamt 8.710 EUR aufgewendet wurden. Das Verkehrsministerium inserierte ebenfalls in der Zeitschrift „unzensuriert“ und zahlte hierfür 7.200 EUR. Die Geschäftsführung dieser Zeitschrift liegt in den Händen von Dipl.-Ing. Walter Asperl, der auch Mitarbeiter des FPÖ-Parlamentsklubs ist. Des Weiteren soll, wie das Profil berichtete, die FPÖ-nahe Zeitschrift „Info-Direkt“ von Regierungsinseraten in Höhe von 3.060 EUR profitiert haben. 40
Im Jahr 2015 wurde medial bekannt, dass der aktuelle FPÖ-Parteiobmann Herbert Kickl Beteiligungen an der Werbeagentur „Ideen.schmiede“ hatte und in den Jahren 2005, 2006, 2008 und 2009 Nächtigungskosten für Kickl bezahlt habe.41 Demnach soll die Firma ein eigenes Spesen-Abrechnungskonto für Kickl geführt haben.42 Die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen des Verdachts der „Untreue, Bilanzfälschung und Betrugs“.43 Schon 2013 wurde medial bekannt, dass seit 2009 vom Land Kärnten, unter anderem vom damaligen FPÖ stellvertretenden Landeshauptmann Uwe Scheuch, insgesamt 1,1 Mio EUR an die der FPÖ nahestehenden Werbeagenturen „ideen.schmiede Werbeagentur GmbH“ und der „Textacy Werbeagnetur GmbH“ geflossen sind. Auch soll Herbert Kickl die Hälfte des Hauses, indem das Unternehmen „Ideen.schmiede“ seinen Firmensitz hat, gehört haben.44 Der Verdacht der illegalen Parteienfinanzierung stand im Raum.45 Der Verdacht erhärtet sich, nachdem die Signs Werbeagentur, die frühere „Ideen.schmiede“, ein Puma Logo für eine Polizei-Truppe für den damaligen Innenminister Herbert Kickl im Jahr 2018 „kostenfrei“ entwickelte.46 Im Jahr 2015 stellte die Partei „Die Grüne“ eine Dringliche Anfrage (6523/J) an den Justizminister im Nationalrat, um die konkreten Tatbestände und den Stand der Strafverfahren rund um die Vorwürfe gegen FPÖ und Ideen.schmiede-Causa zu erfragen. Der Vorwurf der Grünen lautete: „Betrug, Bestechung, Beweismittelunterdrückung, geheime Geldkoffer. Die Liste der Korruptionsfälle unter freiheitlicher Regierungsbeteiligung sei lange, so wie jene von Freiheitlichen, die sich persönlich mit Steuergeld bereichert hätten“47 in einem „System Strache“. Der damalige Abgeordnete zum Nationalrat Peter Pilz
bekräftigte den Vorwurf mit: „Seit mehr als einem Jahrzehnt ist die FPÖ die Schlüsselpartei der Korruption in Österreich“.48
Es gilt daher zu klären, ob die Werbeagentur „Ideen.schmiede“ vom Innenministerium oder nachgeordneten Dienststellen, unter der Anweisung oder im Wissen vom damaligen Innenminister Herbert Kickl, Werbeaufträge erhielten und somit Herbert Kickl indirekt an diesen mitverdiente bzw. die FPÖ verdeckt finanziert wurde.
Eine weitere Werbeagentur, die der FPÖ zuzuordnen ist, wirft den Verdacht auf illegale Parteienfinanzierung auf. Die Outsell GmbH, deren Mehrheitseigner der FPÖ-Bezirksrat Andreas Bussek ist, der zudem Mitglied im Vorstand der Freiheitlichen Wirtschaft Wien ist, erhielt vom Verkehrsministerium unter Norbert Hofer einen Werbeauftrag in Höhe von 132.000 EUR für eine Kampagne.
Zu dieser Angelegenheit äußerte sich der damalige SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda wie folgt: „Offenbar gibt es für FPÖ-geführte Ministerien nur ein Kriterium für die Vergabe von Aufträgen, nämlich die Zugehörigkeit zur FPÖ. Denn die Auftragsvergabe nach FPÖ-Nähe hat in der FPÖ mittlerweile schon System“.49
Daniela Pisoiu, Senior Resercher am Österreichischen Institut für Internationale Politik, wurde vom FPÖ Landesverteidigungsminister Mario Kunasek mit einer Studie zum „Extremismus und Terrorismus im Westbalkan“ beauftragt. Dieser Auftrag wurde mit einem Budget von 36.000 EUR dotiert und wurde direkt an Daniela Pisoiu vergeben, nicht an das Österreichische Institut für Internationale Politik.50 Beim Studium des Textes „Aus der Angst Kapitel schlagen: der Aufstieg rechtspopulistischer Bewegungen in Westeuropa“51 fallen positive Aussagen zur FPÖ und ihren Standpunkten betreffend Flüchtlingspolitik auf. Es wäre daher zu untersuchen, nach welchen Kriterien Daniela Pisoiu Aufträge von Bundesministerien erhielt, die von der FPÖ zuzurechnenden Mitgliedern der Bundesregierung geleitet wurden, und ob sich dadurch Kickback-Zahlung an die FPÖ oder dieser nahestehenden Organisationen oder Personen ergaben.
In der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage (3688/AB, XXVI.GP) betreffend die Auftragsvergaben von Studien während der Amtszeit von Beate Hartinger-Klein wurde ein Betrag von 93.868,75 EUR für Studien von Einzelpersonen ausgegeben. Die Zuordnung der genannten Beträge zu den entsprechenden Personen ist jedoch nicht transparent nachvollziehbar, weshalb auch in diesem Fall mögliche Kickback-Zahlungen im Raum stehen.52
Im von Herbert Kickl geführten Innenministerium wurden erstaunlicherweise lediglich fünf Studien in Auftrag gegeben. Gemäß der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage (3682/AB XXVI.GP) gab es eine Studie mit dem Titel „Datenauswertung/Publikationen im Rahmen der 2. BAK Integritätsstudie‚ Einstellungen zu Korruption‘“, bei der der Auftragnehmer als Frank Heber angegeben ist.53 Es ist jedoch nicht klar ersichtlich, wer dieser Auftragnehmer genau ist und welche Qualifikationen er für die Durchführung der Studie mitbrachte. Diese mangelnde Transparenz wirft Fragen auf und lässt Raum für Vermutungen betreffend die mögliche Vertuschung von Daten und Informationen.
Als die FPÖ im Zuge ihrer Regierungsbeteiligung im Jahr 2017 begann die politischen Kabinette der Ministerien zu besetzen, wurde eine erstaunlich hohe Anzahl an deutschnationalen Burschenschaftern und Mitarbeitern mit Berührungspunkten zum Rechtsextremismus registriert. Beispielsweise waren alle Kabinettchefs FPÖ-geführter Ressorts Mitglied einer Burschenschaft. Der Einzug gefährlichen Gedankenguts in die politischen Leitzentralen der Ressorts wurde damals von breiter medialer Berichterstattung begleitet: So beleuchtete die Presse am 4. Jänner 201854 die Vorbeschäftigung von Alexander Höferl, damals frisch-bestellter Kommunikationschef von Innenminister Herbert Kickl. Zuvor war er als Chefredakteur von ‚unzensuriert.at‘ tätig – eine Seite die der Verfassungsschutz als „extrem fremdenfeindlich und teilweise antisemitisch“ qualifizierte. Zeitgleich deckte der Falter55 auf, dass im Infrastrukturministerium die Durchwahl mit dem bekannten Nazicode 8818 zu Norbert Hofers Referenten für Öffentlichkeitsarbeit, Herwig Götschober, führte. Götschober (Obmann der Burschenschaft Bruna Sudetia, auf welcher im Februar 2018 eine Razzia aufgrund verdächtiger Liedertexte stattfand56), gelte als „bekanntes
Gesicht in der österreichischen rechtsextremen Szene“. Kurz nach der Razzia betreffend diese Burschenschaft – zuvor flog die Liederbuchaffäre der Burschenschaft Germania Wiener Neustadt auf – kam es zur rechtswidrigen Hausdurchsuchung im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, samt auffällig umfangreicher Durchsuchung von Ermittlungsakten im Extremismusreferat (durch eine Spezialeinsatzgruppe unter der Leitung eines FPÖ-Gemeinderats). Dass Kickls Kabinettchef Reinhard Teufel (Burschenschaft Brixia) den Kontakt des Leiters der Einsatzgruppe an jenem Tag zugeschickt bekam57, als Herbert Kickls Generalsekretär Peter Goldgruber das sogenannte BVT-Konvolut bei der WKStA zur Anzeige brachte, lässt weitere Fragen über die Hintergründe der illegalen BVT-Durchsuchung ungelöst.
Im Infrastrukturministerium bestellte Norbert Hofer Rene Schimanek zu seinem Kabinettchef, der laut Falter-Artikel in Jugendzeiten an der Seite von Neonazi Gottfried Küssel demonstrierte und Wehrsportübungen praktizierte. Letzteres ist auch über den Burschenschafter Andreas Reichhardt bekannt, den Norbert Hofer 2018 zum Generalsekretär des Infrastrukturministeriums beförderte. Reichhardt hat sich später im öffentlichen Dienst etabliert und ist aktuell Sektionschef für Telekommunikation, Post und Bergbau. Den Sprung zum Beamten schaffte auch der Burschenschafter Arndt Praxmarer, der zu seiner Zeit in Norbert Hofers Kabinett ein deutsches Gasthaus eines bekannten Neonazis auf Facebook likte58 und heute im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft tätig ist.
Insgesamt lässt sich ein erhebliches Netzwerk an deutschnationalen Burschenschaftern mit rechtsextremen Berührungspunkten erkennen. Medial sowie durch das Mauthausen Komitee Österreich oder das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes wurden bereits zahlreiche „Einzelfälle“ und deren Verbindungen aufgezeigt und dokumentiert. Die Vernetzung dieser Personen hinein in die öffentliche Verwaltung bzw. die staatlichen Institutionen fordert jedenfalls tiefgreifendere Aufklärung.
Voraussetzungen gemäß Art. 53 Abs. 2 B-VG:
Gemäß Art. 53 Abs. 2 B-VG ist Gegenstand der Untersuchung eines Untersuchungsausschusses ein bestimmter abgeschlossener Vorgang im Bereich der Vollziehung des Bundes, wobei alle Tätigkeiten von Organen des Bundes, durch die der Bund, unabhängig von der Höhe der Beteiligung, wirtschaftliche Beteiligungs- und Aufsichtsrechte wahrnimmt, eingeschlossen sind.
Zusammengefasst müssen folglich drei Elemente vorliegen: Erstens muss es sich um einen Vorgang im Bereich der Vollziehung des Bundes handeln. Zweitens muss der Vorgang bestimmt und drittens abgeschlossen sein.
Der Begriff „Vollziehung“ fasst die Staatsgewalten „Verwaltung“ und „Gerichtsbarkeit“ zusammen, wobei nach Art. 53 Abs. 2 zweiter Satz B-VG die Überprüfung der Rechtsprechung ausgeschlossen ist. Die Kontrolle durch Untersuchungsausschüsse erstreckt sich auf jede Art der Verwaltung im verfassungsrechtlichen Sinn und umfasst Hoheits- und Privatwirtschaftsverwaltung, nicht-hoheitliche Verwaltungstätigkeit und auch informelles Verwaltungshandeln. Die Ausübung von Aufsichts- oder Bestellungsrechten durch Organe des Bundes gegenüber ausgegliederten Rechtsträgern ist ebenfalls Verwaltungstätigkeit und unterliegt der Kontrolle eines Untersuchungsausschusses.
Wie sich aus der Formulierung dieses Untersuchungsgegenstandes zweifelsfrei ergibt, ist ausschließlich Gegenstand der Untersuchung das Handeln von Organen der Vollziehung des Bundes („Mitglieder der Bundesregierung und Staatssekretäre sowie diesen in den jeweiligen Bundesministerien unterstellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“; davon sind selbstverständlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ministerkabinette umfasst). Die Rechtsprechung soll nicht untersucht werden. Staatsanwaltschaftliches Handeln ist im umschriebenen Ausmaß erfasst. Staatsanwälte sind nur formal der Gerichtbarkeit zugeordnet. Sie sind nicht rechtsprechend tätig (VfSlg. 19.350/2011), weshalb ihr Handeln weisungsgebundenes Vollzugshandeln auf Bundesebene im Sinn des Art. 53 Abs. 2 B-VG darstellt und somit von einem Untersuchungsausschuss des Nationalrates untersucht werden kann.
Der Untersuchungsgegenstand muss des Weiteren einen bestimmbaren und abgrenzbaren Vorgang inhaltlich zusammenhängender Sachverhalte bilden. Mehrere Sachverhalte, die einen einheitlichen untersuchbaren Vorgang bilden sollen, müssen somit inhaltlich, personell oder zeitlich in einem Zusammenhang stehen; sie müssen eine inhaltliche Klammer aufweisen. Ein Untersuchungsgegenstand ist dann bestimmt, wenn der zu untersuchende Vorgang konkret, abgegrenzt und im Prüfungsauftrag hinreichend konkretisiert ist. Kriterien können die Benennung des maßgeblichen Anlasses, der maßgeblichen Akteure, der betroffenen Zeiträume und der Zielrichtung der Untersuchung sein.
Durch die genaue Bezeichnung der zu untersuchenden Sachverhalte bzw. Handlungen (Inseratenschaltungen und Medienkooperationsvereinbarungen; Umfragen, Gutachten und Studien sowie Beauftragung von Werbeagenturen) sowie jener Organe bzw. Personen, deren Handeln untersucht werden soll, ist der Untersuchungsgegenstand genau bestimmt und vom restlichen (Vollzugs-) Handeln dieser Organe klar abgegrenzt. Die zu untersuchenden Vorgänge hängen deshalb inhaltlich zusammen, weil geklärt werden soll, ob bezüglich des näher umschriebenen Vollzugshandelns sachfremde – insbesondere parteipolitische – Motive und nicht die durch die Rechtsordnung vorgegebenen Maßstäbe das Handeln der beschriebenen Organe des Bundes bestimmt haben. Im Besonderen ist dabei an Art. 126b B-VG zu denken, der für die Überprüfung der gesamten Staatswirtschaft des Bundes durch den Rechnungshof als Maßstab die ziffernmäßige Richtigkeit, die Übereinstimmung mit den bestehenden Vorschriften, die Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit normiert. Darüber hinaus ist z.B. auf das Vergabegesetz, unterschiedliche Transparenzvorschriften sowie Rechnungshofempfehlungen zu verweisen.
1 Beschuldigteneinvernahme Beinschab vom 20/21.10.2022 (Dok. Nr. 408443, Lieferant BMJ, OStA-Wien), 73 von 219.
2 Beschuldigteneinvernahme Beinschab vom 09.02.2022 (Dok. Nr. 408444, Lieferant BMJ, OStA-Wien), 7ff von 124.
3 Beschuldigteneinvernahme Beinschab vom 20/21.10.2022 (Dok. Nr. 408443, Lieferant BMJ, OStA-Wien), 73 von 219.
4 11717/AB XXVII.
5 www.youtube.com/watch?v=g6lGiTWuSaQ (abgerufen am 19.01.2023).
6 SORA Ogris & Hofinger GmbH.
7 Der Standard vom 27.09.2023: „Versehentlich veröffentlichtes SPÖ-Papier katapultiert Sora aus dem ORF“.
8 APA 28.09.2023: „Verbindung von SORA zur Arbeiterkammer“
9 NÖ Nachrichten vom 30.05.2011: „Beschluss gegen SORA“
10 Fraktionsbericht SPÖ zum ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss, 13.
11 3528/AB XXV. GP.
12 BV Beinschab vom 9. Februar 2022, 7 ff.
13 Anordnungs- und Bewilligungsbogen AZ 17 St 5/19d, 1167ff.
14 Falter 19.07.2023: „Jetzt watschen wir den Minister 3-4 Tage ab und dann inserieren sie wieder und dann sind wir wieder Freunde“.
15 Falter Radio 6.6.2023, ab Minute 16:00, „Scheuba fragt nach….bei Thomas Schrems - #83
16 9879/AB XXIV. GP.
17 9846/AB XXV.GP, 9864/AB XXV.GP.
18 Der Standard vom 05.02.2009: „Rot-Schwarz noch teurer als Schwarz-Blau“
19 APA 15.10.2007: „IFES-Umfrage: Kritik von Grüne und ÖVP“
20 Die Presse 12.02.2010: FES: „SPÖ-Umfrageinstitut wird quersubventioniert“.
21 Die Presse 12.02.2010: FES: „SPÖ-Umfrageinstitut wird quersubventioniert“.
22 Die Presse 12.02.2010: FES: „SPÖ-Umfrageinstitut wird quersubventioniert“.
23 Der Standard 28.09.2006: Gallup und Fessel: Schüssel gewonnen, IFES: Gusenbauer menschlicher.
24 Kanzleiweisung BKA-180.840/0102-I/8/2015 (Dok. Nr. 181565, Lieferant BKA), 31 von 364.
25 633/KOMM XXVII. GP (Befragung Siegfried Lindenmayr), 7.
26 Zahlungen an angefragte Vereine 2014 bis 2021 (Dok. Nr. 489544, Lieferant Rechnungshof); 656/KOMM XXVII. GP (Befragung Mag.a Nicole Bayer), 14f.
27 632/KOMM XXVII. GP (Befragung Dr.in Helga Luczensky), 18.
28 Beratervertrag mit Karl Krammer (Dok. Nr. 181098, Lieferant BKA), 36 von 41.
29 632/KOMM XXVII. GP (Befragung Dr.in Helga Luczensky), 42ff.
30 Finale Version des Aktionsplan AFCO (Dok. Nr. 181210, Lieferant BKA), 17ff von 257.
31 632/KOMM XXVII. GP (Befragung Dr.in Helga Luczensky), 25.
32 Die Presse vom 05.11.2017: „So verblödet kann man ja nicht sein“.
33 656/KOMM XXVII. GP (Befragung Mag.a Nicole Bayer), 25.
34 Profil 28.08.10: Wahl 2010. Genossenschaftswesen: Wie die Gemeinde Wien die SPÖ Wien alimentiert.
35 Die Presse 06.11.2013: SPÖ-Agentur der SPÖ-Minister.
36 Wiener Zeitung 20.10.2019: „Causa Lercher als neue Belastung für die SPÖ“.
37 ORF.at 19.03.2018: Diskriminierung: 317.368 Euro Entschädigung
38 Kurier 14.04.2013: Polit-Intrigen um Job des Telekom-Regulators
39 893/AB XXVI. GP, 2181/AB XXVI. GP, 821/AB XXVI. GP, 1437/AB XXVI. GP, 2623/AB XXVI. GP, 2192/AB XXVI. GP, 2623/AB XXVI. GP, 2807/AB XXVI. GP, Profil 07.07.2019: „Schalten und walten“.
40 Profil 07.07.2019: „Schalten und walten“.
41 Ö1 Feiertagsjournal 15.08.2015: "Ideen.Schmiede": Neue Unterlagen sollen Kickl-Beteiligung belegen.
42 Kurier 15.08.2015: „Ideenschmiede: Kickl hatte eigenes Konto“.
43 ZiB 2 14.08.2015 Neue Details zur Causa Parteienfinanzierung und Kickl.
44 Der Standard 06.08.2018: FPÖ-nahe Agentur schenkte Ministerium Puma-Logo.
45 DerStandard 23.08.2013: „Land Kärnten zahlte 1,1 Mio Euro an FPÖ-nahe Werbeagentur“.
46 Der Standard 06.08.2018: FPÖ-nahe Agentur schenkte Ministerium Puma-Logo.
47 Parlamentskorrespondenz NR. 978 VOM 23.09.2015.
48 aaO
49 Profil 12.03.2019: Werbe- und PR-Ausgaben unter Schwarz-Blau gestiegen.
50 3695/AB XXVI.GP.
51 Pisoiu, D. & Ahmed, R. (2015): Aus der Angst Kapitel schlagen: der Aufstieg rechtspopulistischer Bewegungen in Westeuropa. OSZE-Jahrbuch, 181-194.
52 3688/AB XXVI.GP.
53 3682/AB XXVI.GP.
54 Die Presse vom 04.01.2018, „Kritik an Besetzung der FPÖ-Kabinette“.
55 Falter Nr.1-2/2018 vom 10.01.2018, „‘Heil dir‘ im Ministerium!“
56 Wiener Zeitung Nr. 38 vom 23.02.2018, „Ermittlungen gegen ’Bruna Sudetia’“
57 Der Standard vom 19.06.2020, „Heikle blaue Chats zur BVT-Affäre“
58 Mauthausen Komitee Österreich, „Die FPÖ und der Rechtsextremismus. Viele Einzelfälle = Ein Muster“ (3. Ausgabe 02.08.2019)
*****
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Leichtfried. – Bitte sehr.
Abgeordneter Mag. Jörg Leichtfried (SPÖ): Herr Präsident! Frau Bundesministerin! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich glaube, nein, ich glaube es nicht, ich bin überzeugt davon, dass das allgemein gültige Prinzip der Medienpolitik sein muss: Es braucht mehr und nicht weniger Qualitätsjournalismus.
Ich sage offen: Das, was wir heute beschließen – Frau Kollegin Duzdar hat es schon gesagt, wir werden es unterstützen –, ist ein Schritt in diese Richtung, ein nicht unwichtiger Schritt in diese Richtung. (Beifall bei der SPÖ.)
Ich möchte aber eines anmerken, weil das heute noch nicht erwähnt worden ist – ich erwähne es gerne, weil es mir wichtig ist –: Was von Ihrer Medienpolitik im Laufe der Geschichte übrig bleiben wird, wird nicht dieser Gesetzesvorschlag sein, es wird das Faktum sein, dass Sie es zu verantworten haben, dass die älteste Tageszeitung der Welt, die „Wiener Zeitung“, zu Grabe getragen wurde. Das wird es sein, was von Ihrer Medienpolitik überbleibt! Frau Bundesministerin,
ich sage Ihnen offen: Das war ein großer Fehler, das war wirklich ein großer Fehler. (Beifall bei der SPÖ.)
Aber nun zum Gesetz selbst:
Es ist, und ich habe das schon gesagt, grundsätzlich eine Verbesserung, insbesondere was beispielsweise die digitalen Medien betrifft. Wir haben da – ich darf mich auch bei Kollegen Egger und bei Kollegin Blimlinger bedanken – lange darüber verhandelt und meines Erachtens relativ gute Ergebnisse erreicht, nämlich insbesondere, dass die Mindestzeichenanzahl heruntergesetzt wurde. (Ruf bei der FPÖ: Ihr habts eh Zickzack!) Ich glaube, das war ein guter Schritt.
Ich finde es auch sehr wichtig – eigentlich entscheidend wichtig –, dass demokratiefeindliche Medien von der Förderung ausgeschlossen werden können, aber ich muss sagen, dass bei einer rechtskräftigen Verurteilung nach dem Verbotsgesetz dieses Aussetzen höchstens ein Jahr betragen kann, ist meines Erachtens – da schließe ich mich dem Österreichischen Rechtsanwaltskammertag an – eine unangemessen harmlose Relation für so etwas. Das hätte durchaus stärker sanktioniert werden können. (Beifall bei der SPÖ.)
Was ich nicht verstehe, ist, dass Sie den notwendigen Fachbeirat allein durch die Regierung besetzen lassen wollen. Das ist etwas, was nicht unbedingt zur Objektivität beiträgt. Es fehlt auch der Fokus auf Innovation, der Fokus auf neue Angebote, aber vielleicht gelingt es ja noch in den letzten Monaten dieser Regierung, da noch etwas zu verbessern. Wir würden das auf jeden Fall unterstützen.
Geschätzte Damen und Herren, gerade in Zeiten von Fakenews, von Echokammern ist seriöser Journalismus, investigativer Journalismus notwendiger denn je (Beifall bei der SPÖ), und deshalb unterstützen wir auch diesen Schritt. Es braucht mehr Qualitätsjournalismus und größere Medienvielfalt. – Herzlichen Dank. (Beifall bei der SPÖ.)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
Wünscht der Herr Berichterstatter ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall.
Dann kommen wir zur Abstimmung über den Gesetzentwurf in 2012 der Beilagen.
Hiezu haben die Abgeordneten Kurt Egger, Muna Duzdar, Eva Blimlinger, Henrike Brandstötter, Kolleginnen und Kollegen einen Abänderungsantrag eingebracht.
Ich werde daher zunächst über die vom erwähnten Abänderungsantrag betroffenen Teile und schließlich über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes abstimmen lassen.
Die Abgeordneten Egger, Duzdar, Blimlinger, Brandstötter, Kolleginnen und Kollegen haben einen Abänderungsantrag betreffend die Artikel 1, 2 und 3 eingebracht.
Wer diesbezüglich seine Zustimmung erteilt, darf ich bitten, das zu tun. – Das ist mit Mehrheit angenommen.
Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang in der Fassung des Ausschussberichts.
Wer gibt dafür ein Zeichen? – Das ist das gleiche Stimmverhalten: mit Mehrheit angenommen.
Wir kommen sogleich zur dritten Lesung.
Wer das auch in dritter Lesung tut, wird ebenfalls um ein Zeichen gebeten. – Das ist das gleiche Stimmverhalten. Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung angenommen.
23. Punkt
Bericht des Verfassungsausschusses über den Antrag 3537/A der Abgeordneten Mag. Martin Engelberg, Mag. Eva Blimlinger, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über den Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus und das Bundesgesetz über die Einrichtung des Fonds zur Instandsetzung der jüdischen Friedhöfe in Österreich geändert werden (2301 d.B.)
24. Punkt
Bericht und Antrag des Verfassungsausschusses über den Entwurf einer Änderung des Bundesgesetzes über die Rückgabe von Kunstgegenständen und sonstigem beweglichem Kulturgut aus den österreichischen Bundesmuseen und Sammlungen und aus dem sonstigen Bundeseigentum (Kunstrückgabegesetz – KRG) (2302 d.B.)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Wir kommen zu den Tagesordnungspunkten 23 und 24, über welche die Debatten unter einem durchgeführt werden.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Engelberg. Bei ihm steht das Wort. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Mag. Martin Engelberg (ÖVP): Herr Präsident! Frau Ministerin! Hohes Haus! Ich habe wirklich die große Freude und Genugtuung, über die Reform des Nationalfonds, der seit über 25 Jahren hervorragende Arbeit leistet, zu berichten. Tatsache ist, dass es immer weniger Überlebende gibt, auch Großprojekte abgeschlossen sind und es jetzt darum ging, den Nationalfonds für die Zukunft auszurichten. Wir haben schon vor mehreren Jahren, auch auf
Initiative des Herrn Nationalratspräsidenten, damit begonnen, das unter Einbindung aller Fraktionen, der Entscheidungsträger aus dem Kuratorium und so weiter zu diskutieren.
Was sind die Eckpunkte in aller Kürze? – Der erste ist eine Unterstützung der Gedenkdiener, die den Gedenkdienst im Ausland leisten, was ein tolles Projekt ist, bei dem wir aber immer vor der Herausforderung standen, dass die Entschädigung, die die Gedenkdiener bekommen, bei Weitem nicht ausreicht, dass sie in Städten wie London, New York ihren Dienst verrichten können. Das heißt, in Zukunft wird es vom Nationalfonds eine zusätzliche individuelle Unterstützung geben. Das wird den Gedenkdienst sichtbarer machen und auch an den Nationalfonds anbinden, was diesem wirklich auch sehr guttut.
Der nächste Punkt ist ein sehr umfassendes Schüler- und Jugendaustauschprogramm, das wir ins Leben rufen; das gibt es zum Beispiel in Deutschland schon seit Jahrzehnten sehr erfolgreich. Das ist eigentlich auch die beste Möglichkeit zur Aufarbeitung des Nationalsozialismus, auch der Bekämpfung des Antisemitismus und von Vorurteilen – jetzt mehr denn je.
Dann haben wir auch eine Erweiterung des Komitees des Nationalfonds vorgesehen, das ja die eingereichten Projekte und Anträge im Nationalfonds prüft. Die Projekte und die Umsetzung werden immer komplexer, und da geht es jetzt um eine zeitgemäße wissenschaftliche Prüfung der Projekte. Meine Kollegin Eva Blimlinger wird darüber in ihrer Wortmeldung vielleicht auch noch ein bisschen mehr erzählen.
Wichtig war uns auch, dass wir mit einem Zweiervorstand und daher einem Vieraugenprinzip eine zeitgemäße Führungsstruktur im Nationalfonds eingeführt haben, was auch den Richtlinien für die Public Corporate Governance entspricht, und daher setzen wir das um. Die Besetzung des zweiten Vorstandes wird sehr transparent durchgeführt; die Bestellung erfolgt dann im Hauptausschuss.
Außerdem geht es darum, den Archivbestand besser zu nutzen, eine jährliche Konferenz zu machen und auch eine Plattform zu bieten, auf der ein Austausch mit allen Institutionen stattfinden kann, die mit der Gedenkarbeit befasst sind.
Ich denke, es ist ein großer Wurf gelungen. Ich glaube, wir haben da in diesen drei Jahren sehr viel Zeit und Energie investiert. Ich möchte mich wirklich bei allen Parteien, die hier im Parlament vertreten sind, sehr bedanken. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass nicht nur alle zustimmen, sondern letztlich haben sich auch alle aktiv an diesem Prozess beteiligt – ein Dankeschön dafür!
Ich möchte aber doch auch allen voran dem Herrn Nationalratspräsidenten für seine Initiative, für sein Engagement in dieser Sache danken. Ich glaube, dass es schon auch einmal ganz wichtig ist, gerade auch in diesen Tagen dir dafür Dank und Anerkennung auszusprechen, lieber Herr Präsident. (Beifall bei Abgeordneten der ÖVP.)
Ich möchte aber darüber hinaus nicht versäumen, auch den befassten Klubreferenten in allen Klubs zu danken, die da sehr, sehr viel Arbeit beigetragen haben, auch den Mitarbeitern im Büro des Nationalratspräsidenten und last but not least – weil die oft sozusagen im Hintergrund arbeiten und gar nicht gewürdigt werden – den Mitarbeitern des RLW, des Rechts-, Legislativ- und Wissenschaftlichen Dienstes der Parlamentsdirektion, die da auch immer ganz wichtige Tipps geben und ein Auge darauf gehabt haben. (Beifall bei der SPÖ sowie des Abg. Stögmüller.)
Und jetzt komme ich zum formalen Ende: Ich bringe den Abänderungsantrag der Abgeordneten Mag. Martin Engelberg, Sabine Schatz, Mag. Eva Blimlinger, Dr. Nikolaus Scherak, Kolleginnen und Kollegen ein und erlaube mir, diesen in den Grundzügen zu erläutern. Darin geht es noch einmal um die Behebung redaktioneller Versehen, darüber hinaus wird jetzt auch die Opfergruppe der Roma und Sinti in dem Antrag ausdrücklich erwähnt. Außerdem wurden die
Mittel für den Friedhofsfonds von 1 Million Euro jetzt auf 1,2 Millionen Euro erhöht.
Vielen Dank. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
15.38
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Abänderungsantrag
der Abgeordneten Martin Engelberg, Sabine Schatz, Eva Blimlinger, Nikolaus Scherak,
Kolleginnen und Kollegen
zum Bericht des Verfassungsausschusses über den Antrag 3537/A der Abgeordneten Martin Engelberg, Eva Blimlinger, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über den Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus und das Bundesgesetz über die Einrichtung des Fonds zur Instandsetzung der jüdischen Friedhöfe in Österreich geändert werden (2301 d.B.) – TOP 23
Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen:
Der eingangs bezeichnete Gesetzesentwurf in der Fassung des Ausschussberichts wird wie folgt geändert:
1. In Artikel 1 Z 1 lautet § 2 Abs. 4 Z 4:
„4. im Wege bestehender Institutionen die Durchführung von Projekten, die es Schülern und Lehrlingen ermöglichen, die Lebenssituation der Nachkommen von Opfern des Nationalsozialismus, wie z.B. Roma und Sinti, näherzubringen.“
2. In Artikel 1 Z 2 wird in § 2 Abs. 6 die Wendung „wieder-kehrenden“ durch das Wort „wiederkehrenden“ ersetzt.
3. In Artikel 1 Z 4 lautet § 2a Abs. 1 Z 7 lit. e:
„e) die Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Organisationen und Einrichtungen, die im Bereich der Erforschung des und der Verbreitung von Wissen um den Nationalsozialismus, seine Nachgeschichte und Folgen und das Schicksal seiner Opfer sowie der Wahrung des Andenkens an die Opfer und diesbezüglicher Präventionsarbeit tätig sind, sowie mit Einrichtungen des primären, sekundären und tertiären Bildungsbereiches;“
4. In Artikel 1 Z 6 wird in § 2a Abs. 7 die Wortfolge „alle im Bundesgebiet tätigen Organisationen und Einrichtungen“ durch die Wortfolge „jedenfalls alle im Bundesgebiet tätigen Organisationen und Einrichtungen“ ersetzt.
5. (Verfassungsbestimmung) In Artikel 1 Z 12 lautet § 5 Abs. 2:
„(2) Das Komitee legt seine Geschäftsordnung fest, die insbesondere die Einberufung, den Ablauf, die mögliche Teilnahme Dritter und die Protokollierung von Sitzungen, die Möglichkeit, Sitzungen als Telefon- oder Videokonferenz abzuhalten sowie die Möglichkeit der Stimmrechtsübertragung zu regeln hat. Das Komitee ist in Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder beschlussfähig und entscheidet mit Zweidrittelmehrheit; eine Stimmenthaltung ist nicht zulässig.“
6. (Verfassungsbestimmung) In Artikel 1 Z 12 lautet § 5 Abs. 3 zweiter Satz:
„Es nimmt alle auf der seitens des Fonds eingerichteten Internetplattform eingebrachten Anträge auf Unterstützung entgegen und legt sie nach Prüfung derselben dem Kuratorium vor.“
7. In Artikel 1 Z 13 lautet § 6 Abs. 4 zweiter Satz:
„Mitglieder des Vorstandes dürfen eine dieser Funktionen auch in den letzten vier Jahren nicht ausgeübt haben.“
8. In Artikel 1 Z 13 wird in § 6 Abs. 5 die Wendung „Unter-nehmer“ durch das Wort „Unternehmer“ ersetzt.
9. In Artikel 1 Z 15 wird in § 8 Abs. 7 die Wendung „; § 3 Abs. 1;“ durch die Wendung „, § 3 Abs. 1,“ ersetzt.
10. Artikel 2 Z 1 lautet:
„1. § 2 Abs. 1 erster Satz lautet:
„Der Bund wendet dem Fonds zur Durchführung seiner Aufgaben jährlich einen Betrag in Höhe von 1,2 Millionen Euro zu.““
11. In Artikel 2 Z 5 wird in § 7 die Wendung „§ 2 Abs. 1“ durch die Wendung „§ 2 Abs. 1 erster Satz“ ersetzt.
Begründung:
Zu Z 1: Durch die beispielsweise Nennung einer Opfergruppe im Gesetz soll im Zusammenhang mit sogenannten „Outreach-Programmen“ das Ziel dieser Bestimmung klarer zum Ausdruck kommen; ebenso soll eine Gleichbehandlung aller Opfergruppen damit sichergestellt sein.
Zu Z 2, 3, 7, 8, 9 und 11: Es handelt sich um legistische Anpassungen.
Zu Z 4: Mit dieser Änderung soll klargestellt werden, dass die Teilnahme an der jährlichen Konferenz des Nationalfonds jedenfalls allen im Bundesgebiet tätigen Organisationen und Einrichtungen offensteht, dass darüber hinaus aber auch Organisation und Einrichtungen aus dem Ausland daran teilnehmen können.
Zu Z 5: Das Komitee legt eine Geschäftsordnung fest, die insbesondere die Einberufung, den Ablauf, die mögliche Teilnahme Dritter, die Protokollierung von Sitzungen, die Möglichkeit, Sitzungen als Telefon- oder Videokonferenz abzuhalten, sowie die Möglichkeit der Stimmrechtsübertragung zu regeln hat. Beschlüsse sollen vom Komitee nur dann gefasst werden können, wenn zumindest die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Ein gültiger Beschluss setzt die Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder voraus, wobei eine Stimmenthaltung nicht vorgesehen ist.
Zu Z 6: Um einen möglichen Widerspruch zwischen dem ersten und dem zweiten Satz dieser Bestimmung auszuschließen, soll die Verpflichtung des Komitees, alle eingebrachten Anträge dem Kuratorium vorzulegen, unmissverständlich formuliert werden.
Zu Z 10: Die Erhöhung der jährlichen Fördersumme trägt dem Umstand Rechnung, dass im Zuge der Sanierung von jüdischen Friedhöfen Umsatzsteuer zu leisten ist.
*****
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Der Abänderungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht, ausreichend unterstützt und steht somit mit in Verhandlung.
Zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Leichtfried. – Bitte sehr, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Mag. Jörg Leichtfried (SPÖ): Herr Präsident! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich kann Kollegen Engelberg zustimmen: Dieses Gesetz ist notwendiger denn je, und es ist auch notwendiger denn je, da geeint voranzuschreiten, was wir hoffentlich tun.
Antisemitismus ist leider tief in der österreichischen Gesellschaft verwurzelt, darüber brauchen wir uns nicht hinwegzuschwindeln. Die Zahl der Übergriffe hat zugenommen – massiv zugenommen! –, und diese sind nicht nur aufs Schärfste zu verurteilen, sondern das, was ich dazu sage, ist, dass jeder Angriff auf unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger ein Angriff auf uns ist, und gegen diese Angriffe haben wir uns auch gemeinsam zu wehren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. (Beifall bei der SPÖ, bei Abgeordneten der Grünen sowie der Abgeordneten Steinacker.)
Dieses Gesetz spiegelt auch den gemeinsamen Kampf für eine offene und freie Gesellschaft wider. Dieser Kampf ist notwendiger denn je, und ich bin froh, dass es gelingt, da etwas Gemeinsames hervorzubringen.
Ich bin auch froh – Kollege Engelberg, Sie haben es erwähnt –, dass diese Ausdehnung auf Roma und Sinti gelungen ist, ich glaube, das war auch ganz wesentlich; ich bin froh, dass im Bereich Jugendarbeit, Jugendaustausch das so gelungen ist, wie es gelungen ist; und ich bin froh, dass die Frage der Gedenkdienerinnen und Gedenkdiener so einvernehmlich geklärt worden ist. (Beifall bei der SPÖ.) Insgesamt, geschätzte Damen und Herren, ist das eine gute Entscheidung.
Ich möchte zum Schluss aber auch anbringen, dass der Weg, wie es dazu gekommen ist, wahrscheinlich verbesserbar ist, dass es eigentlich bei derartigen Fragen üblich ist, von Anfang an die Zusammenarbeit zu suchen. Es ist uns am Ende auch gelungen, diese Zusammenarbeit zu finden, das war gut so, aber vielleicht könnte das eine Anregung für uns alle sein – mit diesem Appell möchte ich enden –, die letzten Monate, die uns in dieser Legislaturperiode noch bleiben, dazu zu verwenden, wieder mit den Usancen des Hauses richtig umzugehen, wieder zu versuchen, Gemeinsames zu erreichen und die Dinge vielleicht auch mit etwas weniger Streit bis zum Gesetzestext zu bringen. (Rufe bei der ÖVP: Oh! Ah! Na! – Abg. Eßl – erheitert –: Na das sagt der Richtige! Kannst gleich anfangen!) Ich glaube, das wäre insgesamt sehr vernünftig, geschätzte Damen und Herren.
Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit in diesem Fall, und ich glaube, es ist etwas Gutes herausgekommen. (Beifall bei SPÖ und Grünen sowie des Abg. Engelberg.)
15.41
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Stefan. – Bitte sehr.
15.41
Abgeordneter Mag. Harald Stefan (FPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Wir unterstützen diesen Antrag auch, wir halten das für sinnvoll und auch notwendig in unserer Gesellschaft, dass diese Maßnahmen gesetzt werden. Uns ist es auch besonders wichtig, dass die jüdischen Friedhöfe gepflegt werden, instand gesetzt werden, wir sind also dafür.
Ich muss allerdings schon auch ein bisschen auf das eingehen, was mein Vorredner gesagt hat: Es war doch erstaunlich, dass am Anfang der Verhandlungen, im Begutachtungsverfahren, ganz scharfe Kritik geübt wurde, was bei diesem Thema in Österreich eher unüblich ist, nämlich von den Widerstandskämpfern, von der Kultusgemeinde, von der Bischofskonferenz. Es ist offenbar am Anfang nicht wirklich rundgelaufen, und so gesehen, glaube ich, hätte man das besser machen können. Letztendlich ist aber alles ausdiskutiert worden.
Für uns gibt es zwei Kritikpunkte, die geblieben sind. Der eine ist die Frage, dass wir es nicht für notwendig erachten, dass es zwei Vorstände gibt. Es gab bis jetzt auch ein Vieraugenprinzip, durch den Präsidenten des Nationalrates zusammen mit der Generalsekretärin, das ist also aus unserer Sicht nicht notwendig.
Das Zweite, was uns ein bisschen schmerzt, ist, dass es jetzt eine Sonderregelung für Zivildiener gibt, die im Rahmen des Gedenkdienstes im Ausland arbeiten. Diese kriegen zusätzlich 400 Euro. Damit werden sie nicht allen anderen Zivildienern gleichgestellt, die im Ausland tätig sind – die bekommen das nämlich nicht. Zudem gibt es in Österreich in Wahrheit gerade im Pflege- und Sozialdienst zu wenige Zivildiener. In Niederösterreich etwa haben wir jetzt festgestellt, dass dort Plätze fehlen. Da dann noch so einen zusätzlichen finanziellen Anreiz zu schaffen finden wir daher nicht richtig. In Wahrheit kann kein junger Mann, der nicht sowieso unterstützenden familiären Hintergrund hat, so einen Dienst im
Ausland machen. Da wird es gar nicht auf diese 400 Euro ankommen, denn er braucht sowieso die familiäre Unterstützung. – Das ist der einzige Wermutstropfen.
Das führt aber wie gesagt nicht dazu, dass wir insgesamt gegen diesen Antrag sind. Es ist, wie schon gesagt worden ist, tatsächlich der importierte Antisemitismus, der jetzt sichtbar wird, der schon länger vorhanden ist, der schon länger bekannt ist, vor dem man nur aus eigener Verblendung die Augen verschlossen hat, und es ist jetzt besonders wichtig, dass man da aktiv ist. (Beifall bei der FPÖ.)
15.44
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Blimlinger. – Bitte.
Abgeordnete Mag. Eva Blimlinger (Grüne): Sehr geehrter Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren auf der Galerie und vor den Bildschirmen! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Vielleicht ein kurzer Hinweis: Es ist schon eine schöne Geschichte, dass wir im Rahmen des Nationalfonds keine Minister oder Ministerinnen, Staatssekretäre oder Staatssekretärinnen begrüßen – es ist unser Fonds. Es ist unser Nationalfonds, den wir 1995 hier im Parlament gegründet haben.
Auch damals war es der letzte Tagesordnungspunkt, aber damals waren nicht alle Parteien dabei, um zuzustimmen. Umso mehr freue ich mich, dass das diesmal gelungen ist. Es ist vielleicht etwas holprig gewesen, aber umso besser, wenn wir dann zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen.
Vielleicht nur als Erinnerung an 1995: Die Gründung des Nationalfonds stand letztlich im Zusammenhang mit dem sogenannten Döllersheimer Ländchen. Das ist jenes Gebiet am Truppenübungsplatz Allentsteig, bei dem es auch um Entschädigungen ging. Man hat das dann in den Nationalfonds integriert, und
letztlich war die Idee des Nationalfonds, dass man damit, mit einer letzten Gestezahlung, dieses Thema abschließt. Mitnichten, kann ich nur sagen, denn ab 1997/1998 ist es mit Klagen losgegangen, und zum Nationalfonds sind durch zusätzliche Fonds wie den Entschädigungsfonds et cetera wirklich große Aufgaben hinzugekommen.
Nun sind wir in der Situation – Martin Engelberg hat das schon gesagt –, dass diese ursprünglichen Aufgaben, nämlich die Gestezahlung an überlebende Opfer des Nationalsozialismus, immer mehr in den Hintergrund rücken und daher die Zukunft des für Österreich so wichtigen Nationalfonds abzusichern ist. (Beifall bei den Grünen sowie des Abg. Engelberg.) Da geht es im Wesentlichen darum, neue Projekte oder Projekte, die ohnehin schon im Ansatz da sind, besonders zu unterstützen.
Was uns wirklich ein besonderes Anliegen war, ist – das haben wir jetzt endlich im Gesetz und das ist wirklich ein Meilenstein für die Sintize und Romnia –, endlich ein Mahnmal für diese so lange vergessene Opfergruppe zu bekommen. (Beifall bei den Grünen sowie der Abgeordneten Engelberg und Steinacker.)
Seit Jahren gibt es Diskussionen, auch Kämpfe, alles Mögliche drum herum, umso notwendiger ist es, dieses Mahnmal, dieses Denkmal zu errichten. Wir werden in Zukunft auch, vergleichbar mit dem Friedhofsfonds, den wir ja auch ein bisschen verändert haben, indem nur mehr ein Viertel von der Kultusgemeinde zu zahlen ist, betreffend die Gräber der Romnia und Sintize in den Fällen unterstützen, in denen es keine Nachkommen gibt, weil diese zum Beispiel in Auschwitz ermordet worden sind. Es ist also wirklich ein Meilenstein, der da gesetzt wurde.
Lassen Sie mich am Ende noch einen Punkt erwähnen, denn das führt mich zu meinem Abänderungsantrag: Es wird auch eine Novelle des Kunstrückgabegesetzes geben, mit der es möglich wird, Einsicht in die Akten, Einsicht in die Personendaten im Nationalfonds zu nehmen, um die Rückgabe von Kunstwerken an die Erben und Erbinnen zu erleichtern.
In diesem Sinne bringe ich folgenden Abänderungsantrag ein:
Abänderungsantrag
der Abgeordneten Mag. Martin Engelberg, Mag. Eva Blimlinger, Kolleginnen und Kollegen
zum Bericht und Antrag des Verfassungsausschusses über den Entwurf einer Änderung des Bundesgesetzes über die Rückgabe von Kunstgegenständen und sonstigem beweglichem Kulturgut aus den österreichischen Bundesmuseen und Sammlungen und aus dem sonstigen Bundeseigentum (Kunstrückgabegesetz) (2302 d.B.)
Der Nationalrat wolle beschließen:
Der dem Bericht und Antrag (2302 d.B.) angeschlossene Gesetzentwurf wird wie folgt geändert:
Der Titel vor und nach der Promulgationsklausel lautet jeweils:
„Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Rückgabe von Kunstgegenständen und sonstigem beweglichem Kulturgut aus den österreichischen Bundesmuseen und Sammlungen und aus dem sonstigen Bundeseigentum (Kunstrückgabegesetz – KRG) geändert wird“
Begründung:
Ein redaktionelles Versehen wird behoben.
*****
Im Übrigen bin ich der Meinung: Bring them home now! (Beifall bei den Grünen sowie bei Abgeordneten der ÖVP.)
15.49
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Der Abänderungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht, ausreichend unterstützt und steht mit in Verhandlung.
Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Scherak. – Bitte sehr.
Abgeordneter Dr. Nikolaus Scherak, MA (NEOS): Herr Präsident! Hohes Haus! Wir haben nicht nur aufgrund unserer historischen Verantwortung, sondern auch aufgrund des momentan immer intensiver aufkeimenden Antisemitismus eine besondere Verantwortung, uns mit der Zukunft des Nationalfonds auseinanderzusetzen und ihm eine gute Zukunft zu bescheren.
Was ein wenig schade ist und in dem ganzen Prozess irritiert hat, ist: Wenn man sich den Antrag zu dieser Gesetzesinitiative anschaut, sieht man darauf nur die Namen von zwei Regierungsabgeordneten. Das ist deswegen schade, weil es eigentlich immer gute Praxis war, dass man alle Gesetzesinitiativen zum Nationalfonds, so gut das geht, und auch die Beschlussfassungen gemeinsam macht. Weil das eine so sensible Materie ist, glaube ich, war das eine sehr gute Praxis. Insofern habe ich die Vorgangsweise hier nicht ganz verstanden und würde auch appellieren, dass man, wenn man das in Zukunft noch einmal machen muss, von Anfang an versucht, gemeinsam Lösungen zu finden. (Beifall bei den NEOS und bei Abgeordneten der SPÖ.)
Es ist nämlich so: Wenn man gemeinsam Projekte umsetzen will, dann hilft es ganz grundsätzlich, wenn man von Anfang an auf Augenhöhe miteinander redet, wenn man auf Augenhöhe miteinander verhandelt, weil es halt in der Natur der Sache liegt, weil es der Demokratie systemimmanent ist, dass man es für Kompromisse schaffen muss, dass unterschiedliche Positionen zusammenkommen, nur dann ist es auch ein Kompromiss. Ich bin froh, dass wir es jetzt am Ende geschafft haben, hier einen Kompromiss zustande zu bringen. Das ist das Wesentliche und das Positive an der ganzen Sache.
Wir haben gehört, dass wir jetzt dem Nationalfonds neue Aufgaben zuordnen. Es wird in Zukunft die Möglichkeit geben, einen Austausch von Schüler:innen und von Lehrlingen zwischen Österreich und Israel zu machen, und es wurde durch die Verhandlungen auch gesichert, dass das von einer Organisation durchgeführt wird, die das kann, nämlich der OeAD, und nicht, wie ursprünglich vorgesehen, von einer in Zukunft zu gründenden Organisation.
Wir haben es im Zuge der Verhandlungen auch geschafft, dass gewisse neue Aufgaben, die dem Nationalfonds zugeordnet werden, nicht von einem neuen wissenschaftlichen Beirat wahrgenommen werden sollen, sondern von einem Gremium, das es schon gibt, vom Komitee, und das halte ich auch für einen guten Weg.
Darüber hinaus haben wir es geschafft – Kollege Engelberg hat es schon angesprochen, andere auch –, dass in Zukunft, wenn Gedenkdiener ihren Gedenkdienst, der so wichtig ist und der einen so wichtigen Beitrag fürs Erinnern leistet, in einem Land leisten, in dem die Lebenshaltungskosten massiv höher sind, sie auch entsprechende Unterstützung bekommen.
Es wird in Zukunft einen Zweiervorstand geben, wie wir schon gehört haben, der auch das Vieraugenprinzip neu gestalten wird. Das gab es auch bis jetzt schon, weil die Geschäftsführerin mit dem Herrn Präsidenten bis jetzt auch schon ein Vieraugenprinzip praktiziert hat, aber es wird ein neues Vieraugenprinzip geben, und das halte ich auch für einen guten Weg.
In dem Zusammenhang freue ich mich, dass diesem neuen Zweiervorstand die jetzige Generalsekretärin Hannah Lessing angehören wird und sie ihre großartige Arbeit, die sie die letzten Jahre gemacht hat, auch weiterführen kann.
Bei zukünftigen Bestellungen für diesen Vorstand – darauf haben wir uns am Schluss geeinigt – wird es einen umfassenden Prozess geben: Es wird eine öffentliche Ausschreibung geben, danach Hearings im Kuratorium, und am Schluss wird der Hauptausschuss des Parlaments, also wir als Parlament, mit
einer Zweidrittelmehrheit entscheiden, wer dann bei diesem Zweiervorstand dabei ist.
Ich glaube, dass wir uns für die Zukunft insgesamt überlegen sollten, wenn wir gemeinsam positive Dinge für dieses Land vorantreiben wollen, ob es nicht vielleicht sinnvoller ist, ein bisschen früher aufeinander zuzugehen und zu versuchen, gemeinsame Lösungen und Kompromisse zu schaffen.
Es freut mich besonders, dass wir es jetzt schaffen, hier einen einstimmigen Beschluss zustande zu bringen, weil ich glaube, in Zeiten des Hasses, in Zeiten des Terrors gegenüber Jüdinnen und Juden ist das dringender notwendig denn je. (Beifall bei den NEOS sowie bei Abgeordneten von ÖVP, SPÖ und Grünen.)
15.53
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordnete Steinacker. – Bitte sehr.
Abgeordnete Mag. Michaela Steinacker (ÖVP): Herr Präsident! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Werte Mitbürgerinnen und Mitbürger! Bevor ich zu meiner Rede zum Thema der Novelle des Nationalfondsgesetzes komme, möchte ich für meine Kollegin Carina Reiter sehr herzlich die Perchtengruppe aus Altenmarkt begrüßen, die heute hier im Parlament ist und am 5.12. wahrscheinlich anderes zu tun hat. Herzlich willkommen! (Beifall bei Abgeordneten von ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grünen und NEOS.)
In Zeiten des aufkeimenden, viel zu häufig und verstärkt auftretenden Antisemitismus, in Zeiten eines Terrorangriffs der Hamas auf Israel, in Zeiten, in denen wir uns besinnen müssen, gegen Antisemitismus aufzutreten, ist es, glaube ich, ganz genau richtig, dass wir dieses Gesetz zum Nationalfonds in die Zukunft bringen. Es sind ganz wichtige Themen neu geordnet, Schwerpunkte gesetzt worden. Ich glaube, wir können mit Fug und Recht stolz und froh sein, dass wir heute dieses Gesetz einstimmig beschließen werden, auch wenn der
Weg ein bisschen länger war und vielleicht von Kolleginnen und Kollegen, die etwas später eingebunden waren, auch als etwas holprig und sperrig bezeichnet wurde. Ich glaube, die Sache an und für sich eint uns, die Dinge, die jetzt miteinander beschlossen werden, sind ganz wichtig.
Ganz wichtig ist, dass zukünftig die nächsten Generationen, nämlich die Schülerinnen und Schüler, Informationen bekommen, dass mit ihnen die Zeit des Holocausts, des Nationalsozialismus aufgearbeitet wird, dass sie wissen, worum es geht, wovor man achtsam sein muss, dass Vorurteile unterbunden werden und dass durch Schüler- und Studentenaustausche, die es geben wird, neue Freundschaften entstehen – Freundschaften, die helfen, Frieden in der Welt zu sichern.
In Zukunft wird der Fonds als Schwerpunkt, wie auch schon von Vorrednern gesagt, auch einen Fokus auf die Roma und Sinti, die ja auch Opfer von Verbrechen im Nationalsozialismus gewesen sind, legen: mit den Beiträgen zur Grabgebühr, aber auch mit der zukünftigen Gedenkstätte, die geplant werden soll. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger und richtiger Fokus.
Das Kuratorium wird zukünftig über Vorschlag des Komitees inhaltliche Schwerpunkte setzen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger auch Strategiepunkt in der Ausrichtung des Nationalfonds. Da kann man natürlich in die Zukunft arbeiten und auch wissenschaftliche Projekte umsetzen.
Ich denke, es ist der heutigen Zeit angemessen, dass man moderne Corporate Governance mit zwei gleichberechtigten gesamtverantwortlichen Vorstandsmitgliedern abbildet – ein Zeichen der Zeit, notwendig und umgesetzt.
Die Verbreitung von Wissen um den Nationalsozialismus, um dessen Folgen, um die Schicksale der Opfer und die Wahrung des Andenkens sind die wichtigen Punkte, die hier umgesetzt werden. Dazu wird es einer Information der Öffentlichkeit bedürfen. Ich denke, dass die Abhaltung von Konferenzen auf nationaler
und internationaler Ebene zur Verbreitung all dieser wesentlichen Informationen ein ganz wichtiger Punkt ist.
Ich bin allen Verhandlern dankbar, auch dankbar für den guten Abschluss und bedanke mich schon im Vorhinein für die einstimmige Annahme. – Danke schön. (Beifall bei der ÖVP.)
15.56
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Schatz. – Bitte sehr.
Abgeordnete Sabine Schatz (SPÖ): Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Mit der Gründung des Nationalfonds 1995 haben wir einen wichtigen gemeinsamen Schritt in unserer gemeinsamen historischen Verantwortung den Opfern des Nationalsozialismus gegenüber gesetzt. Eine der wesentlichen Aufgaben ist die Leistung von Gestezahlungen an NS-Opfer: Rund 30 000 NS-Opfer wurden bisher anerkannt und Gestezahlungen in der Höhe von immerhin 158 Millionen Euro geleistet. Dabei stand und steht immer im Mittelpunkt, alle Opfer des Nationalsozialismus zu berücksichtigen, vor allem auch jene, die lange nicht als solche anerkannt waren. Das ist wichtig und einzigartig und zeichnet den Nationalfonds aus. (Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordneten der NEOS.)
Heute diskutieren wir einen Antrag der Regierungsparteien, der den Nationalfonds in die Zukunft bringen soll. Es ist schon öfters angemerkt worden, dass das Zustandekommen dieses Antrages nicht sehr glücklich abgelaufen ist. Das ist auch schon mehrfach kritisiert worden, vor allem, weil es eigentlich immer Konsens und Usance war, dass wir Anträge zum Nationalfonds gemeinsam auf den Weg bringen, weil es ja Sinn macht, wenn wir gemeinsam hier diese Zusammenarbeit im Konsens widerspiegeln, und ich ersuche wirklich dringend, dass wir zukünftig wieder zu dieser Usance zurückkehren und künftig
Dinge, die Materien des Nationalfonds betreffen, wieder gemeinsam ausarbeiten und gemeinsam auf den Weg bringen. (Beifall bei der SPÖ.)
Im Rahmen der Begutachtung der Gesetzesnovelle hat es auch sehr viele kritische Stellungnahmen gegeben. Es waren schwierige Verhandlungen, aber es gibt jetzt einen Kompromiss, den wir so auch mittragen können und mittragen werden.
Ganz besonders wichtig ist uns die weitere Förderung der wissenschaftlichen und künstlerischen Aufarbeitung des Nationalsozialismus, von Rassismus und Antisemitismus. Das bleibt ganz klar eine wesentliche und zentrale Aufgabe des Nationalfonds. Insbesondere wenn wir uns die aktuellen Entwicklungen anschauen – es ist ja schon mehrfach angesprochen worden –, vor allem den zunehmenden Antisemitismus, antisemitische Übergriffe, so zeigt sich einmal mehr, wie wichtig dieser Schwerpunkt des Nationalfonds ist. (Beifall bei der SPÖ sowie des Abg. Engelberg.)
Neu im Nationalfonds wird sein, dass es Förderungen für Gedenkdienstleistende gibt. Das sehen wir als sehr wichtig an, und wir fordern ja auch schon seit Jahren, dass die Aufwandsentschädigungen für Gedenkdienerinnen und Gedenkdiener entsprechend angehoben werden. Ich habe das auch im Ausschuss gesagt: Uns hätte die Lösung besser gefallen, das im zuständigen Sozialministerium mit einer Erhöhung der Aufwandsentschädigungen abzudecken, wir können aber auch mit dieser Vorgehensweise gut leben.
Neu ist eben auch der Jugendaustausch zwischen Österreich und Israel, da ist es uns ganz besonders wichtig gewesen, dass mit dem heutigen Abänderungsantrag noch einmal speziell darauf hingewiesen wird, dass alle Opfergruppen des Nationalsozialismus umfasst sind und wir wirklich auf der Seite aller Opfergruppen stehen. Das wird mit diesem Abänderungsantrag, den wir heute einbringen, auch abgedeckt.
Insgesamt bin ich froh, dass wir trotz der schwierigen Voraussetzungen, trotz der schwierigen Verhandlungen gemeinsam einen Kompromiss verabschieden können, in dem wir uns alle wiederfinden. Ich glaube, dass das ein wichtiges, der Zeit angemessenes Zeichen ist, das wir heute setzen.
Ich möchte meinen Redebeitrag aber auch nutzen, um dem gesamten Team, das im Nationalfonds beschäftigt ist, mit Hannah Lessing als Geschäftsführerin an der Spitze, aber auch allen, die sich in den unterschiedlichen Gremien einbringen, meinen herzlichen Dank für die wichtige und wertvolle Arbeit, die sie im Nationalfonds leisten, auszusprechen. – Wirklich herzlichen Dank dafür. (Beifall bei der SPÖ sowie bei Abgeordneten von ÖVP und NEOS.)
Weil ich auch die letzte Rednerin der sozusagen normalen Tagesordnung bin, bevor wir zur kurzen Debatte kommen, möchte ich damit enden, womit Kollege Hintner begonnen hat, nämlich indem ich auf die morgen beginnenden 16 Tage gegen Gewalt hinweise. Ich möchte wirklich auch noch einmal an dieser Stelle Danke sagen, dass wir als Parlament ein gemeinsames Zeichen im Sinne von Orange the World setzen.
Sehr geehrte Damen und Herren, angesichts von 26 Femiziden, von mehr als 40 Mordversuchen und Fällen schwerer Gewalt, angesichts von 14 589 Annäherungs- und Betretungsverboten alleine im letzten Jahr muss uns allen klar sein, Gewaltschutz betrifft uns alle, und zwar 365 Tage im Jahr und nicht nur die 16 Tage, in denen wir uns vor allem als Parlament dafür einsetzen müssen. – Vielen Dank. (Beifall bei SPÖ und ÖVP sowie der Abg. Disoski.)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet.
Ich darf mich als Vorsitzender des Kuratoriums und auch des Nationalfonds ganz herzlich bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben, dass wir dieses Gesetz mit einem gemeinsamen Beschluss verabschieden können. Es ist so wichtig für die Arbeit des Nationalfonds, dass alle hinter dieser für Österreich doch so entscheidenden Arbeit des Nationalfonds stehen und wir damit nach
außen auch ein wirklich geeintes und ein einigendes Zeichen des österreichischen Nationalrates geben. – Herzlichen Dank.
*****
Die Debatte ist geschlossen.
Wünscht der Berichterstatter ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall.
Dann kommen wir zur Abstimmung, die ich über jeden Ausschussantrag getrennt vornehmen werde.
Wir gelangen nun zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 23: Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über den Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus und das Bundesgesetz über die Einrichtung des Fonds zur Instandsetzung der jüdischen Friedhöfe in Österreich geändert werden, in 2301 der Beilagen.
Hiezu haben die Abgeordneten Engelberg, Schatz, Blimlinger, Scherak, Kolleginnen und Kollegen einen Abänderungsantrag eingebracht.
Ich werde daher zunächst über die vom erwähnten Abänderungsantrag betroffenen Teile und schließlich über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes abstimmen lassen.
Da der vorliegende Gesetzentwurf sowie der erwähnte Abänderungsantrag Verfassungsbestimmungen enthalten, stelle ich zunächst im Sinne des § 82 Abs. 2 Z 1 der Geschäftsordnung die für die Abstimmung erforderliche Anwesenheit der verfassungsmäßig vorgesehenen Zahl der Abgeordneten fest. – Das ist der Fall.
Die Abgeordneten Engelberg, Schatz, Blimlinger, Scherak, Kolleginnen und Kollegen haben einen Abänderungsantrag betreffend Artikel 1 und 2 eingebracht.
Wer dafür ist, den bitte ich um ein entsprechendes Zeichen. – Das ist einstimmig angenommen.
Wir kommen nun zur Abstimmung über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang in der Fassung des Ausschussberichtes.
Wer auch dafür die Zustimmung gibt, soll das bitte mittels Zeichen tun. – Auch das ist einstimmig angenommen.
Wir kommen sogleich zur dritten Lesung.
Wer auch in dritter Lesung dem vorliegenden Gesetzentwurf die Zustimmung erteilt, den darf ich um ein Zeichen bitten. – Das ist auch in dritter Lesung einstimmig angenommen.
Wir kommen nun zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 24: Entwurf betreffend Kunstrückgabegesetz in 2302 der Beilagen.
Hiezu haben die Abgeordneten Engelberg, Blimlinger, Kolleginnen und Kollegen wiederum einen Abänderungseintrag eingebracht.
Ich werde daher zunächst über die vom Abänderungsantrag betroffenen Teile und schließlich über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes abstimmen lassen.
Abänderungsantrag der Kollegen Engelberg, Blimlinger, Kolleginnen und Kollegen betreffend den Titel:
Wer dafür ist, den darf ich um ein entsprechendes Zeichen bitten. – Das ist einstimmig angenommen.
Wir kommen zur Abstimmung über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang in der Fassung des Ausschussberichtes.
Wer ist dafür? – Auch dafür ist die einstimmige Zustimmung gegeben.
Auch in dritter Lesung darf ich um ein Zeichen bitten. – Das ist auch in dritter Lesung einstimmig angenommen. – Vielen, vielen herzlichen Dank.
Die Tagesordnung ist erschöpft.
Kurze Debatte über ein Verlangen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Wir kommen nun zur kurzen Debatte über das Verlangen 6/US auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses betreffend „Zwei-Klassen-Verwaltung wegen Bevorzugung von Milliardären durch ÖVP-Regierungsmitglieder (COFAG-Untersuchungsausschuss)“.
Dieses Verlangen wurde inzwischen an alle Abgeordneten verteilt.
Wir gehen nun in die Debatte ein.
Im Sinne des § 57a Abs. 1 der Geschäftsordnung beträgt die Redezeit in dieser Debatte 5 Minuten, wobei der Erstredner zur Begründung über eine Redezeit von 10 Minuten verfügt.
Das Wort erhält Herr Abgeordneter Krainer. – Bitte sehr.
Abgeordneter Kai Jan Krainer (SPÖ): Meine sehr geehrten Damen und Herren! „Alle Staatsbürger sind vor dem Gesetz gleich“, so lautet Artikel 7 der österreichischen Bundesverfassung, auf die wir alle angelobt sind. In letzter Zeit mussten wir erfahren, dass das offenbar nicht immer der Fall ist. Während Milliardäre wie Benko oder Wolf exklusive Tipps, wie sie weniger oder keine Steuer zahlen, oder Unterstützungsleistungen aus dem Finanzministerium erhalten, und nicht von irgendwo, sondern direkt aus den Regierungsbüros, haben Tausende Menschen ihren Job bei Kika/Leiner verloren. Während
Konzerne Millionenförderungen über die Cofag erhalten haben, warten noch immer viele Klein- und Mittelbetriebe auf ihr Geld.
Waren das Einzelfälle oder haben wir es mit einer systematischen Bevorzugung zu tun, mit einer Zweiklassenverwaltung, sodass es einen Unterschied macht, ob man der ÖVP nahesteht oder nicht, sodass es einen Unterschied macht, ob man einen Zugang zu Ministerbüros hat, wie wir das leider in den letzten Untersuchungsausschüssen sehen mussten? Deswegen bringen wir heute ein Verlangen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses betreffend „Zwei-Klassen-Verwaltung wegen Bevorzugung von Milliardären durch ÖVP-Regierungsmitglieder“ ein.
Es ist auch erst jetzt möglich, sich das umfassend anzusehen, da der Verwaltungsgerichtshof vor wenigen Wochen ein Erkenntnis auf den Tisch gelegt hat, in dem er gesagt hat: Ja, die Art und Weise, wie die Bundesregierung aus ÖVP und Grünen versucht hat, die Cofag der parlamentarischen Kontrolle zu entziehen, geht nicht, das bleibt staatliche Verwaltung, auch wenn die ÖVP und die Grünen versuchen, das vor der Öffentlichkeit und vor der parlamentarischen Kontrolle zu verstecken.
Deswegen ist es auch erst jetzt möglich, überhaupt zu sehen, wie die Cofag agiert hat, ob nach sachfremden Motiven vorgegangen wurde, ob Einzelne bevorzugt wurden oder ob alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Der Rechnungshof sowie Wirtschaftsforscher haben bereits von massiven Überförderungen gesprochen. Das heißt, dass es laut Rechnungshof einzelne Unternehmen gibt, die viel zu viel Geld bekommen haben, und dass es da nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Wir wollen uns das ergebnisoffen ansehen. (Beifall bei der SPÖ.)
Dieser Untersuchungsausschuss soll im Wesentlichen vier Beweisthemen haben, also vier große Themenblöcke umfassen. Es geht immer um die Bevorzugung von Milliardären. Ehrlich gesagt geht es natürlich in erster Linie um Benko und um Wolf, weil wir da auch die entsprechenden Infos haben.
Das Erste, was wir uns ansehen wollen, ist die Cofag, nämlich dort, wo wir bisher nicht reingekommen sind – was da passiert ist. Das Zweite sind Informationsweitergabe und Interventionen. (Abgeordnete der ÖVP halten Tafeln mit der Titelseite der aktuellen Ausgabe des Magazins „News“, auf der unter der Überschrift „Der gekaufte Altkanzler“ ein Foto Alfred Gusenbauers zu sehen ist, in die Höhe.) – Ich habe leider meine Brille nicht mit (in Richtung ÖVP), deswegen kann ich das nicht sehen, was Sie da hochhalten. (Heiterkeit bei Abgeordneten der ÖVP. – Abg. Michael Hammer: Weil Sie verblendet sind! – Weitere Zwischenrufe bei der ÖVP. – Zwischenruf der Abg. Meinl-Reisinger.) Ich kann Ihnen sagen, es geht da natürlich um die Frage (Rufe bei der ÖVP: Alfred Gusenbauer!), ob es zu Interventionen zugunsten dieser Milliardäre – Wolf, Benko – gekommen ist (Abg. Michael Hammer: Gusenbauer, der gekaufte Kanzler!), dass sie weniger Steuer zahlen oder keine Steuer zahlen.
Der dritte Teil sind die Kooperationen mit staatsnahen Unternehmen. Da geht es vor allem zum Beispiel um die Frage, wieso Benko (Abg. Michael Hammer: Da müssen Sie den Gusenbauer fragen!) durch die Kooperation mit der BIG beziehungsweise mit der ARE Millionengeschäfte gemacht hat und diese von der ÖVP unterstützt wurden.
Das Vierte ist die staatliche Aufsicht, nämlich ob die Kontrolle dieser Geschäfte et cetera auch ordentlich erfolgt ist oder ob die ÖVP bei ihr Nahestehenden einfach weggesehen hat.
Das ist der Untersuchungsgegenstand, denn das Ziel dieses Untersuchungsausschusses ist es, den Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz auch wirklich durchzusetzen und umzusetzen und zu gewährleisten, dass dieser gilt (Beifall bei der SPÖ) – und ich würde hoffen, dass das alle 183 Abgeordneten in diesem Haus wollen, dass alle vor dem Gesetz gleich sind und nicht manche einen Spezialweg oder einen VIP-Service bekommen.
Noch zwei Anmerkungen: Das Erste ist, dass wir die Zeit, bis der Untersuchungsausschuss beginnen kann, nützen sollten, um endlich die Liveübertragung von
Untersuchungsausschüssen zu ermöglichen, denn die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes haben das Recht, sich bei den wesentlichen Auskunftspersonen selber live ein Bild machen zu können. (Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordneten der FPÖ.)
Im Übrigen, Herr Nochpräsident Sobotka, wollte ich nur noch anmerken, dass ich noch immer der Meinung bin, dass Sie nicht geeignet sind, Ihr Amt als Nationalratspräsident auszufüllen, und würde Sie ersuchen, für eine untadelige Person aus den Reihen der ÖVP Platz zu machen. – Vielen Dank. (Beifall bei der SPÖ.)
16.11
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Hanger. Ich darf darauf aufmerksam machen, dass alle folgenden Redner nur 5 Minuten Redezeit haben. (Abg. Hafenecker: Schade!) – Bitte sehr.
Abgeordneter Mag. Andreas Hanger (ÖVP): Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Hohes Haus! Ich darf mich in meinem Debattenbeitrag mit zwei Verlangen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses auseinandersetzen (Abg. Scherak: Eigentlich nicht! – Abg. Belakowitsch: Nein! Eigentlich nein!), wie ja bereits medial bekannt ist. (Abg. Scherak: Eigentlich nicht, der Geschäftsordnung folgend!) – Herr Kollege Scherak, ganz ruhig bleiben! Ich werde mich in erster Linie natürlich ohnedies mit dem beschäftigen (Abg. Scherak: Nein, ich sage es dem Präsidenten, gar nicht dir, denn er muss ...! – Abg. Matznetter: Weil der muss den Ruf zur Sache machen!), was die SPÖ und die FPÖ gemeinsam einbringen. (Abg. Belakowitsch: Ausschließlich, Herr Kollege!) – Danke dafür, dass Sie sich wieder beruhigt haben. (Abg. Leichtfried: Das ist typisch Hanger! – Ruf bei der SPÖ: Die ist in einem Zustand, die ÖVP!)
Zum Untersuchungsausschuss, den die SPÖ und die FPÖ einbringen, darf ich festhalten: Ein Cofag-Untersuchungsausschuss wird von unserer Seite grundsätzlich begrüßt, weil wir ja absolut davon überzeugt sind, dass die Cofag-
Finanzierungsagentur gute Arbeit geleistet hat und ein ganz wesentlicher Beitrag dafür war, dass Österreich gut durch die Krise gekommen ist. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Meinl-Reisinger: Geh bitte! Wo? Wo sind wir gut durch die Krise gekommen?)
Was ich beim Untersuchungsgegenstand aber schon sehr bemängeln muss – und wir hatten ja nur sehr kurze Zeit, um ihn eingehend zu analysieren –, ist, dass er aus unserer Sicht nach einer Erstprüfung wiederum, wie schon beim letzten Mal, verfassungswidrig ist, weil er nur eine bestimmte Gruppe adressiert und aus unserer Sicht damit der Gleichheitsgrundsatz verletzt wird. Wir brauchen die Breite. Wir bekennen uns dazu, dass die Cofag natürlich im Sinne eines Untersuchungsausschusses durchleuchtet wird, allerdings wollen wir haben, dass das gesamte Spektrum der Cofag untersucht wird.
Deshalb darf ich darüber informieren, dass wir in unserem Verlangen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses – und damit ist jetzt, glaube ich, der Zusammenhang sehr gut dargestellt – jedenfalls den Untersuchungsgegenstand der SPÖ und der FPÖ übernehmen und wir jedenfalls diesen Untersuchungsgegenstand erweitern auf alle Fördersituationen, die von der Cofag abgewickelt worden sind. Wir schauen uns auch ganz genau an, was SPÖ-nahe – Stichwort Leykam – Unternehmen bekommen haben, was vielleicht auch FPÖ-nahe Unternehmen bekommen haben. (Abg. Meinl-Reisinger: Es geht nur noch ums Dreckwerfen! Nur noch ums Dreckwerfen! – Ruf: Ums Dreckschleudern!) Wenn, dann muss es natürlich für alle sein – diesen Grundsatz halte ich in aller Entschiedenheit fest. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Meinl-Reisinger: Es ist ja unglaublich! Hier, hier, hier – nur noch ums Dreckwerfen! Wir haben so viele Probleme in Österreich!)
Zum Zweiten, und da lasse ich mir jetzt das Wort auch nicht nehmen, dahin gehend, dass ich festhalte, dass wir einen eigenen Untersuchungsgegenstand einbringen, und zwar mit dem Titel: SPÖ-FPÖ-„Rot-blauer-Machtmissbrauch-Untersuchungsausschuss“. (Heiterkeit der Abg. Belakowitsch.) Diesen setzen wir
ein, dieses Recht haben wir, und es gibt jede Menge Themen, die dort aufgearbeitet werden müssen. (Abg. Kassegger: Wir müssen noch ergänzen: NEOS ...!)
Ich darf festhalten: die Causa Gusenbauer. (Abg. Heinisch-Hosek: Das ist keine Causa! Was soll das?) Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Die Kanzlerschaft Gusenbauer endet am 2. Dezember 2008. Er schließt drei Wochen später einen Beratungsvertrag mit der Signa-Gruppe ab. (Abg. Heinisch-Hosek: Na und?) Dieser Beratungsvertrag hat ein Volumen von 280 000 oder 240 000 Euro pro Jahr (Abg. Heinisch-Hosek: Na und?) – für eine Woche Arbeit. Und Sie wollen noch ernsthaft behaupten, Sie sind der Vertreter des kleinen Mannes?! – Das können Sie gerne nachlesen. (Beifall bei der ÖVP.)
Es gibt Honorarnoten (Abg. Heinisch-Hosek: Können Sie zur Cofag ...?) über Millionenhonorare, die Herr Dr. Gusenbauer an die Signa-Gruppe legt. Spannend ist nur der zeitliche Zusammenhang: Die Kanzlerschaft endet – und drei Wochen später berät er die Signa-Gruppe mit 100 000 Euro an Honoraren. Wir werden uns sehr genau anschauen, ob da ein Zusammenhang besteht – der ja nahezu auf dem Tisch liegt. Ich sage deshalb: Dieser Rot-blaue-Machtmissbrauch-Untersuchungsausschusses ist dringend notwendig! (Beifall bei der ÖVP.)
Ich sage Ihnen auch ganz offen, wir werden uns auch die FPÖ-Ministerien ganz genau anschauen. Wir werden uns dort ganz genau anschauen: Wie war denn die Inseratenvergabe? Wie sind dort Personalentscheidungen gefallen? Wie wurden Werbeagenturen beauftragt? – Wir freuen uns schon auf die Akten, die dann in das Parlament geliefert werden (Abg. Kollross: Und was hat das mit der Cofag zu tun?), denn mit Regierungsverantwortung hat die FPÖ in der Vergangenheit noch nie umgehen können. (Abg. Meinl-Reisinger: Ihr müsst doch irgendwann wieder zusammenarbeiten! Das ist doch unglaublich, was ihr aufführt!)
Abschließend möchte ich schon noch festhalten, auch in dieser Schärfe eingebracht, denn ich sage das auch in aller Deutlichkeit und Offenheit dazu, wir wehren uns gegen diese monatelange, wochenlange Kampagne (Ruf: Genau!), die
gegen uns geführt wird, und wir bringen diesen Untersuchungsgegenstand ein, damit wir natürlich auch das rote System und das blaue System entsprechend beleuchten. Für uns ist dieses gemeinsame Einbringen ja ganz interessant.
Zur Geschäftsordnung abschließend noch ein paar Gedanken: Wir bekennen uns auch sehr klar zur öffentlichen Übertragung der Untersuchungsausschüsse, weil wir die Hoffnung hätten, dass sich insbesondere Herr Kollege Krainer und andere dort auch vernünftig benehmen werden. Wir sind jederzeit zu Gesprächen darüber bereit – wir müssen zwischen politisch Exponierten und politisch Nichtexponierten unterscheiden, das gehört geklärt –, aber funktionieren wird das nur dann, wenn es insgesamt zu einer Reform der Geschäftsordnung kommt. (Ruf bei der SPÖ: Aha?)
Wir brauchen die Stärkung der Persönlichkeitsrechte. Es kann ja nicht so sein, dass einzelne Personen da an den Pranger gestellt werden, vorverurteilt werden, Unterlagen immer sofort den Medien zugespielt werden. Wie da agiert wird, so geht es nicht. Wenn eine Gesamtreform des Untersuchungsausschusses kommt (Abg. Kollross: Die Redezeit wär eigentlich schon aus, Präsident!), dann diskutieren wir natürlich auch sehr gerne über die Liveübertragung. – Vielen Dank. (Beifall bei der ÖVP. – Ruf bei der SPÖ: Sie können machen, was Sie wollen, von der Cofag können Sie nicht ablenken!)
16.17
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Matznetter. – Bitte.
Abgeordneter Dr. Christoph Matznetter (SPÖ): Herr Nochpräsident! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Vor allem aber meine Damen und Herren, die Sie uns um diese Zeit noch zuschauen! (Abg. Michael Hammer: Jetzt drehen die Letzten ab!) Ich glaube, das Schauspiel konnten Sie jetzt selbst erleben, als Abgeordneter Hanger hier gestanden ist. In jedem normalen Parlament der Welt ist es natürlich so, dass eine Regierung von einer Mehrheit
getragen wird und es das vornehmste Recht und das wichtigste Recht des Parlaments, der Opposition als Minderheit ist, die Kontrolle dieser Regierungsmacht auszuüben. (Abg. Hanger: Sie wollen uns das Recht absprechen?!)
Dafür gibt es diese Möglichkeit des Verlangens, von dem jetzt Gebrauch gemacht wurde, um rund um einen der dubiosesten Vorgänge der Republik, nämlich die Cofag und den mit Millionen begünstigenden Bereich des Bundesministeriums für Finanzen für Aufklärung zu sorgen. (Die Abgeordneten Hanger und Lopatka halten neuerlich Tafeln mit der Titelseite der aktuellen Ausgabe des Magazins „News“, auf der unter der Überschrift „Der gekaufte Altkanzler“ ein Foto Alfred Gusenbauers zu sehen ist, in die Höhe.) Wenn Sie dann in den Saal hineinschauen, meine geschätzten Damen und Herren, dann sehen Sie, es ist nicht die Opposition, die Taferln hoch hält – die das üblicherweise tut –, nein, diese Regierungspartei ÖVP ist dermaßen am Ende, dass sie nur noch versuchen kann, eine Art Rechter-Rand-Extremopposition zu mimen. (Beifall bei der SPÖ. – Heiterkeit bei Abgeordneten der ÖVP.)
Das ist ja absurd! Sie sind ja nicht einmal in der Lage, einen formell richtigen Antrag zu stellen. Sie sehen in Ihrem Verlangen einen Untersuchungszeitraum vor, der am 7. Jänner 2020 endet. (Abg. Hanger: Nein, ...!) Da gab es zwar schon den Virus in Wuhan, aber noch keine Cofag, Herr Kollege Hanger! (Abg. Stocker: Herr Kollege, sinnerfassend lesen!) Daraufhin haben Sie einfach hintendran geschrieben, im Zeitraum danach wollen Sie etwas anschauen, nämlich die Cofag.
Das Beste, meine Damen und Herren, ist: Es handelt sich um eine Art Selbstkontrolle, die Sie hier vornehmen wollen (Heiterkeit bei der SPÖ – Abg. Hanger: Nein, wir sind das Parlament!), denn in der Cofag war ja bekanntlich ausschließlich eine von Ihnen ausgesuchte Führung, die dort in einem abgeschotteten Raum ohne parlamentarische Kontrolle entgegen all unseren Warnungen die Milliarden verschoben hat. – Na, ist das gut!?
Und da wollen Sie einen Machtmissbrauch jener untersuchen, die nicht einmal – zum Glück, das war mein Ratschlag, gehen wir da nicht hinein – im Aufsichtsorgan saßen?! (Abg. Hanger hält eine Tafel mit der Titelseite der aktuellen Ausgabe des Magazins „News“, auf der unter der Überschrift „Der gekaufte Altkanzler“ ein Foto Alfred Gusenbauers zu sehen ist, in die Höhe.) Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen! In welchem Zustand seid ihr, bitte? Das ist ja unglaublich! Das ist unfassbar! (Beifall bei der SPÖ. – Abg. Michael Hammer: Mach dir keine Sorgen!)
Offenbar haben da welche mit Trump und seinem Team gearbeitet, denn in dem Moment, in dem es unangenehm wird, wie der Frage, wieso sich ein Sigi Wolf auf der Raststätte mit dem Vorstand seines Finanzamtes trifft, in dem die Millionen weniger zu zahlen sind - - (Abg. Hanger: War der Gusenbauer auch dabei?) Na, was soll man sonst machen? Und wenn man feststellt, dass im Bereich Benko – und jetzt bleiben wir gleich bei Benko! – die Millionen, und zwar 15 Millionen Euro Steuergeld, nicht eingehoben worden sind, weil man gefälligerweise im Finanzministerium dafür gesorgt hat, dass der Akt woanders hinkommt, dann ist er zum Anschauen. (Abg. Hanger: Das stimmt ganz einfach nicht! – Zwischenruf des Abg. Stocker.)
Kollegen Hanger stört dabei eines: Man würde feststellen, wem der notwendige moralische und ethische Grundsatz zum Regieren fehlt. (Abg. Hanger: Reden wir drüber! Reden wir drüber!) Ich sage es Ihnen jetzt schon, Herr Kollege Hanger: Es ist die Österreichische Volkspartei. (Abg. Hanger – neuerlich die Tafel mit der Titelseite der aktuellen Ausgabe des Magazins „News“, auf der unter der Überschrift „Der gekaufte Altkanzler“ ein Foto Alfred Gusenbauers zu sehen ist, in die Höhe haltend –: Reden wir! Ja, reden wir!) Und nur, weil Sie versuchen, auf alle anderen irgendetwas zu werfen, glauben Sie, für sich etwas zu gewinnen. (Rufe bei der ÖVP: Ja, ja!) Nur, Herr Kollege Hanger, das schadet der Demokratie insgesamt, denn damit erwecken Sie den Eindruck, alle wären so wie Sie. (Abg. Michael Hammer: So seid ihr! – Abg. Wöginger: Ihr habt nicht einmal die Parteistimmen
auszählen können! Das schadet der Demokratie! Ihr habt nicht einmal eure Parteistimmen auszählen können! 600 Stimmen habt ihr nicht zählen können!)
Ich sage es Ihnen, Herr Wöginger, die Sie immer Paladin zum Verteidigen waren: Wir sind zum Glück nicht so wie Sie. (Abg. Michael Hammer: Es will keiner Sozi sein!) Und das werden wir hier feststellen lassen. (Beifall bei der SPÖ. – Abg. Wöginger: Na wunderbar!)
16.22
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Hafenecker. – Bitte sehr, Herr Abgeordneter. (Abg. Michael Hammer: Da hat euch der Krainer einitheatert!)
Abgeordneter Christian Hafenecker, MA (FPÖ): Herr Präsident! Hohes Haus! Die Einsetzung dieses Untersuchungsausschusses ist eine Notwendigkeit und auch die Konsequenz aus dem, was wir im ÖVP-Korruptionsausschuss gesehen haben. Leider Gottes ist er zu früh abgedreht worden, aber nichtsdestotrotz war gerade die Cofag ein Thema, dem wir uns widmen wollten, dem wir uns auch widmen können: Auf der einen Seite gibt es den Rechnungshofbericht, auf der anderen Seite gibt es das VfGH-Urteil. Sie sind mit Ihrem Konstrukt nicht auf der Basis der Verfassung gestanden. Da wollen wir natürlich nachschauen, wo Sie an Ihre Freunde Steuergelder ausgeleitet haben.
Ich glaube, das ist ein Symbol dafür, wie der tiefe Staat Marke ÖVP funktioniert. Genau deswegen muss man da genauer hinschauen. Natürlich ist ein Herr Benko, Kika/Leiner, genauso Thema wie ein Herr Wolf. Die grundsätzliche Frage ist: Können es sich gut betuchte ÖVPler leisten, auf der einen Seite kleine Scheine bei Ihnen einzuwerfen, auf der anderen Seite große Scheine zurückzubekommen? Das wird das Thema sein, wie Ihr Familienverständnis ganz offensichtlich ist, das wir entsprechend bearbeiten müssen und wo es wirklich darum geht, auch den Steuerzahlern dazu Aufklärung zu bringen.
Es macht irgendwie den Eindruck, dass in dieser Bundesregierung – die Grünen machen ja mit – das Denken vorherrscht, dass man sagt: Wir können es uns ja richten, wir machen das mit unseren Freunden, mit dem tiefen Staat, Innenministerium, Justizministerium, Finanzministerium. Das reicht schon genug dazu aus, um eben diesem tiefen Staat entsprechend zum Betrieb zu verhelfen.
Interessant ist die Reaktion der ÖVP, denn die ÖVP sagt ja immer, sie wird von der restlichen Welt verfolgt. Ich habe mir heute extra die Zeit genommen, bei der Pressekonferenz des Kollegen Hanger dabei zu sein. Eines ist spannend (Abg. Maurer schaut auf ihr Smartphone) – Frau Maurer, vielleicht schauen Sie kurz her, vielleicht haben Sie kurz Zeit –, denn was Kollege Hanger über Sie gesagt hat, war spannend. Er ist heute von einem Journalisten gefragt worden: Wie wird denn der Untersuchungsausschuss ablaufen? – also Ihrer, den Sie eingebracht haben, der Schlumpfuntersuchungsausschuss oder wie der heißt. (Ruf bei der ÖVP: Die Schlümpfe sind ...!) Da haben Sie gesagt: Wie immer: vier gegen eins. Das heißt, Sie hängen den eigenen Koalitionspartner hinaus und teilen schon mit - - (Ruf bei der ÖVP: Das sind eure Sorgen?) – Da kann jeder nachschauen, der es möchte. Das haben Sie genau so gesagt: vier gegen eins. Das heißt, Sie befinden sich anscheinend gar nicht mehr in einer aufrechten Koalition. Sie wissen schon, dass Sie am Ende des Tages sogar Minderheitsrechte brauchen, weil Sie wissen, dass Sie demnächst eine Minderheit sein werden; auch das haben Sie schon verstanden. Das finde ich gut und interessant. (Beifall bei der FPÖ.)
Nur: Das, was Sie machen, ist, das wichtigste Instrument des Nationalrates dazu zu missbrauchen, um beleidigt zu spielen, denn nichts anderes ist der Fall, Kollege Hanger. Sie spielen beleidigt. (Heiterkeit und Zwischenrufe bei der ÖVP.)
Wenn ich mir Ihren Antrag anschaue – Sie können gleich genug lachen, ich sage Ihnen ein paar Dinge –, dann wird es noch umso bunter, abgesehen davon, dass ich jetzt endlich verstehe, warum Sie Deutschschulungen vorantreiben wollen,
warum es mehr Deutschkurse geben soll. Ihr Antrag strotzt von Rechtschreib- und Fallfehlern, dass die Tür nicht zugeht. – Erstens einmal.
Aber das ist ja noch das geringere Problem. Dann haben Sie vorher beim Antrag, den Sie geleakt haben, in dem die Grünen noch drinnen gestanden sind, mit Copy-and-paste die Grünen irgendwie herausgestrichen. Deswegen haben Sie ein paar so komische Löcher in Ihrem Text drinnen. Weil Ihnen keine eigenen Fragen eingefallen sind, haben Sie 1 : 1 die Fragen von Kollegen Krainer und von mir in Ihren Text hinüberkopiert, klagen insgesamt übrigens die Bundespolitik an, also sich selbst. (Ruf bei der FPÖ: Ist das jetzt ein Plagiat?)
Jetzt kann ich natürlich verstehen, dass so etwas peinlich ist, auch für eine noch staatstragende Partei wie die ÖVP. Ich meine, Sie stellen ja noch den Bundeskanzler. Hinter mir sitzt gerade der eigentlich rücktrittsreife Präsident Sobotka und offensichtlich geniert sich sogar der für Ihren Antrag. Schauen Sie einmal Ihren Antrag durch und schauen Sie, wer unterschrieben hat! Präsident Sobotka hat Anstand, der hat den Blödsinn nicht unterschrieben, der fehlt auf dieser Liste. Das zeigt, wie tiefgründig Sie arbeiten, wie beleidigt Sie sind.
Ich sage Ihnen eines: Stellen Sie sich doch einmal der Realität und entschuldigen Sie sich bei den Steuerzahlern dafür, was Sie angestellt haben! Das wäre doch einmal ein erster Schritt zur Besserung. (Beifall bei der FPÖ.)
Was tun Sie stattdessen? – Sie gehen her, benutzen das wichtigste parlamentarische Gremium dafür, um beleidigt zu spielen. (Widerspruch bei der ÖVP.) Kollege Hanger, mir tut es leid – ich weiß nicht, wer Ihnen das angeschafft hat –, dass Sie überhaupt so hervortreten müssen, dass Sie das sagen müssen. (Abg. Michael Hammer: Seht ein, dass die Geschichte danebengeht!)
Übrigens noch eines, weil Sie da „rot-blauer Machtmissbrauch“ schreiben (Abg. Michael Hammer: Sumpf!): Selbst das haben Sie nicht hingebracht (Abg. Hanger: Genau! Du hast es schon gelesen! Sehr brav!), das zumindest einmal zeitlich richtig zu erfassen, denn: Wo sind denn die rot-blauen Schnittmengen? Können
Sie mir das genau sagen? Also in dem Zeitraum, den Sie anstreben, von 2007 nicht. (Abg. Krainer: 83 bis 86!) Das heißt, wenn, dann empfehle ich Ihnen eines: Gründen Sie eine Historikerkommission! Es gab tatsächlich einmal die Regierung Sinowatz-Steger. (Abg. Lopatka: Eben! Da hat es schon angefangen!) Da könnte man nachschauen, aber das haben Sie auch nicht geschafft, dass Sie das hineinschreiben. (Beifall bei der FPÖ. – Abg. Michael Hammer: Ein Flop-U-Ausschuss wird das!)
16.27
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordnete Tomaselli. – Bitte sehr, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete Mag. Nina Tomaselli (Grüne): Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuseherinnen und Zuseher! Ich bin recht froh, dass ich die Krawattenparty hier einmal kurz unterbrechen kann. (Beifall bei Grünen und SPÖ sowie bei Abgeordneten der NEOS.)
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn wir über U-Ausschüsse reden – und das tun wir heute bei dieser Kurzdebatte –, dann komme ich nicht umhin, dass wir auch über die Person Wolfgang Sobotka sprechen müssen. Der Präsident stand und steht ja nicht nur in der Kritik, weil er Teil vieler Ermittlungen ist, sondern auch wegen des unpräsidialen Verhaltens, das er als Vorsitzender in den letzten beiden U-Ausschüssen hingelegt hat. Falls sich die Zuseherinnen und Zuseher zu Hause fragen: Wieso sitzt er immer noch da, wenn so viele etwas dagegen haben? – Wie im Nationalrat gilt auch im U-Ausschuss, dass von Gesetzes wegen nur Wolfgang Sobotka selbst Sobotka eine Rote Karte zeigen kann.
Einmal mehr, Herr Präsident Wolfgang Sobotka, stehen Sie vor der Entscheidung: Wollen Sie Aufklärung ermöglichen oder wollen Sie der Aufklärung im Wege stehen? Wenn Sie nicht verhindern wollen, dass da draußen bei den Bürgerinnen
und Bürgern der Eindruck vermittelt wird, dass sich jemand, der zum wiederholten Mal selbst im Zentrum parlamentarischer Aufklärungsarbeit steht, einfach mitten hineinsetzen kann, dann nehmen Sie bitte Ihren Hut! (Beifall bei Grünen, SPÖ, FPÖ und NEOS.)
Die Frage aber, die sich alle im U-Ausschuss tätigen Abgeordneten meiner Meinung nach stellen müssen, ist schon, wie sie ihre Rolle anlegen wollen. Wie die heutigen Pressekonferenzen gezeigt haben, bedeutet das nichts Gutes für das Ansehen des höchsten Kontrollgremiums dieses Hauses, denn der U-Ausschuss ist meiner Meinung nach keine Bühne für einen Hobbysheriff mit rauchendem Colt (Heiterkeit und Ah-Rufe bei der ÖVP), ein U-Ausschuss ist aber bitte auch kein Gremium, in dem man vor lauter Verzweiflung über die eigene unrühmliche Rolle wild um sich schlägt. (Abg. Michael Hammer: Man kann auch Amateursheriff sagen!)
Sehr geehrte Damen und Herren! Kontrolle ist eine der beiden Grundaufgaben im Parlament. Das gibt uns die österreichische Verfassung vor, auf die wir alle angelobt sind. Aufklärung kann deshalb nie etwas Parteitaktisches sein.
Wir Grüne nehmen den Kontrollauftrag des Parlaments sehr ernst und wir werden uns auch wie in den vergangenen U-Ausschüssen an keinen unsachlichen Streitereien oder Beleidigungen beteiligen. Wir werden durch penibelste Aufklärungsarbeit alles dafür tun, dass Licht ins Dunkel kommt. (Beifall bei den Grünen.)
Zum eingebrachten Verlangen, das wir jetzt diskutieren, muss ich sagen, ich finde ja, dass der Titel „Cofag-Untersuchungsausschuss“ eher Verwirrung stiftet, denn beim ersten Durchsehen spielt das ja allerhöchstens eine Nebenrolle, aber gut. Wofür wir jedenfalls sorgen wollen, ist, dass René Benko eine Hauptrolle in diesem U-Ausschuss spielen wird, denn das ist auch das, was wir gefordert haben.
Eines muss ich nämlich schon sagen: Bei all der Aufregung rund um Sobotka ist diese Woche untergegangen, dass der angebliche Milliardär oder jetzt eben nicht mehr Milliardär laut deutschen Medienberichten klammheimlich Vermögenswerte nach Luxemburg transferiert hat. Und ich kann Ihnen sagen, es kann nicht sein, dass bei einer möglichen Pleite schon wieder die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler die Blöden sein werden! (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der SPÖ.)
Deshalb fragen sich auch viele Österreicherinnen und Österreicher zu Recht: Gab es da irgendeine Art der Spezialbehandlung seitens der Politik, die dieses Luftschlössergeschäft von René Benko begünstigt hat? Der Verdacht ist nicht aus der Luft gegriffen. Denken Sie an das geradezu Wohlfühlprogramm des Finanzministeriums oder die für Benko hochprofitablen Millionendeals zwischen der republikeigenen Bundesimmobiliengesellschaft und der Signa oder aber überlegen Sie, warum es eigentlich der türkis-blauen Bundesregierung so ein Anliegen war, dass gerade Benko Kika/Leiner übernommen hat – also Grund genug!
Meiner Meinung nach ist es eben wichtig, dass man sich nicht allein über Benko und sein Geschäftsgebaren empört. Das hilft der Republik nicht weiter. Die Österreicher:innen wollen Antworten, wir wollen Antworten und wir werden in diesem Untersuchungsausschuss Antworten finden. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der SPÖ. – Abg. Hafenecker: War eine gute Rede!)
16.32
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Scherak. – Bitte.
Abgeordneter Dr. Nikolaus Scherak, MA (NEOS): Wir erleben eine massive Vertrauenskrise in die Politik in Österreich, und, sehr geehrte Zuseherinnen und
Zuseher, ich darf mich vorneweg gleich einmal für das Bild, das Ihre Volksvertreter hier und heute abgeben, entschuldigen. Ich erachte das als unerträglich. (Beifall bei den NEOS.)
Diese Vertrauenskrise, die wir erleben, ist jetzt nicht irgendwie etwas Neues, sondern es ist eine Krise, die sich über die letzten Jahre und Jahrzehnte durch diverse Affären aufgebaut hat. Sie erinnern sich alle an die Telekom-Affäre, die Buwog-Affäre, die Hypo Alpe-Adria, die BVT-Affäre, das Beinschab-Tool der ÖVP. Das Problem ist nur: Sie lernen aus diesen Affären und diesen Skandalen gar nichts, und die Vertrauenskrise wird immer und immer größer.
Bei solch einer Vertrauenskrise hilft es auch nicht, wenn der Inhaber des zweithöchsten Amtes im Staat, der Nationalratspräsident, immer wieder mit Vorwürfen konfrontiert ist und nicht dazu bereit ist, Schaden von diesem Amt abzuwenden und die Konsequenzen zu ziehen. Herr Präsident, ganz ehrlich, es hilft auch nicht, wenn man sich im Vorfeld zweier neuer Untersuchungsausschüsse, wo man zumindest in einem davon auch im Untersuchungsgegenstand eine wesentliche Rolle spielt, hinstellt und sagt: Selbstverständlich werde ich den Vorsitz führen! Ein bisschen ein Gefühl für Befangenheit sollte man dann doch auch haben. (Beifall bei den NEOS sowie bei Abgeordneten von SPÖ und FPÖ.)
Es ist aber leider nicht nur der Herr Nationalratspräsident, der diese Vertrauenskrise weiter befeuert, es sind auch drei Parteien hier im Haus, nämlich ÖVP, FPÖ und SPÖ, die offensichtlich nicht daran interessiert sind, diese Vertrauenskrise zu beenden. Aber nicht nur das, Sie machen es auch noch schlimmer. Sie befeuern die Vertrauenskrise, indem Sie, anstatt endlich Reformen anzugehen, sich gegenseitig mit Dreck bewerfen, sich gegenseitig mit Schlamm bewerfen und irgendwelche Taferln hochhalten – und das Vertrauen in die Politik wird immer weniger und weniger. (Beifall bei den NEOS.)
Das Schlimmste daran ist – und das geht an ÖVP und SPÖ, an die ehemaligen staatstragenden Parteien –: Sie sehen offensichtlich nicht einmal, was Sie damit
machen. Sie checken es, glaube ich, nicht. Schauen Sie sich einmal in Europa um: Der Aufstieg der Populistinnen und Populisten, insbesondere der Rechtspopulisten, ist unaufhaltsam. Das liegt insbesondere daran, dass staatstragende Parteien, ehemalige staatstragende Parteien wie ÖVP und SPÖ, nichts Besseres zu tun haben, als sich gegenseitig mit Dreck zu bewerfen (Beifall bei den NEOS sowie bei Abgeordneten von FPÖ und Grünen – Bravoruf der Abg. Meinl-Reisinger), Politik in der Art und Weise der FPÖ zu machen. Profitieren tun einzig und allein die Freiheitlichen, aber Sie machen nichts dagegen, Sie machen immer weiter.
Sie wissen vor allem, was zu tun wäre. Wir kennen die Missstände in diesem Land. Wir wissen, dass die ÖVP ein Korruptionsproblem hat. Wir wissen auch, dass SPÖ und FPÖ über Jahrzehnte fleißig daran mitgearbeitet haben, dass die Sümpfe nicht trockengelegt werden – und ganz ehrlich, Sie haben es sich in diesem System auch sehr gemütlich gemacht.
Herr Kollege Hanger, noch ein Wort zu Ihnen, weil Sie gerade gesagt haben, dass Sie dafür Sorge tragen werden, dass alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die von der Cofag Förderungen bekommen haben, untersucht werden: Die Unternehmerinnen und Unternehmer, die fleißigen Unternehmerinnen und Unternehmer werden sich bedanken! Weil Sie nicht in der Lage waren, sinnvoll Förderungen auszubezahlen, werden jetzt alle von Ihnen in die Öffentlichkeit gezerrt und an den Pranger gestellt. Der Wirtschaftsbund wird es Ihnen danken, ich sage es Ihnen. (Beifall bei den NEOS. – Bravoruf der Abg. Meinl-Reisinger.)
Sie wissen seit den letzten Untersuchungsausschüssen, was zu tun wäre. Sie vergessen nur immer, dass zu der Aufklärung nach dem Untersuchungsausschuss auch die Reformen danach gehören.
Sie wissen und wir alle hier wissen, dass es endlich einen unabhängigen Bundesstaatsanwalt braucht, damit Interventionen gar nicht mehr möglich sind. Sie wissen auch, dass es ein Informationsfreiheitsgesetz braucht, damit so Dinge wie die Umfragen im Finanzministerium ans Tageslicht kommen.
Insofern hier auch mein Appell an die SPÖ: Verhandeln Sie hier ordentlich und bringen Sie sich bei der Zweidrittelmehrheit ein, dann geht hier etwas weiter! (Abg. Stögmüller– Beifall spendend –: Richtig!)
Wir wissen auch alle, dass mit dieser Inseratenkorruption Schluss sein muss. Das Einfachste wäre, wenn man einen Deckel auf die Regierungsinserate draufgibt. (Zwischenruf bei der ÖVP.)
Wir wissen, dass öffentliche Hearings für Spitzenfunktionen notwendig wären und dass es notwendig wäre, dass endlich die Menschen einen Job bekommen, die etwas können, und nicht diejenigen, die irgendjemanden kennen.
Wir wissen auch, dass wir ein Korruptionsstrafrecht brauchen würden, mit dem wirklich verhindert wird, dass Kandidatinnen und Kandidaten für ein politisches Amt drei Monate vor dem Wahltag weiterhin bestochen werden können.
Wir wissen auch, dass es ein Parteiengesetz braucht, das diesen Umgehungskonstruktionen, um über den Seniorenbund oder irgendwelche anderen Vorfeldorganisationen illegale Parteienfinanzierung weiterhin zu ermöglichen, Einhalt gebietet. Dieses Parteiengesetz wäre endlich notwendig.
Ich sage Ihnen etwas, sehr geehrte Damen und Herren von ÖVP, FPÖ und SPÖ: Hören Sie auf, sich gegenseitig mit Dreck und Schlamm zu bewerfen und arbeiten Sie für die Menschen in diesem Land! (Beifall bei den NEOS und bei Abgeordneten der Grünen.)
16.36
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Ich darf bekannt geben, dass in der heutigen Sitzung die Selbständigen Anträge 3738/A(E) bis 3778/A eingebracht worden sind.
Zuweisung von Verlangen auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka Gemäß § 33 Abs. 6 der Geschäftsordnung weise ich das Verlangen 6/US „auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses betreffend Zwei-Klassen-Verwaltung wegen Bevorzugung von Milliardären durch ÖVP-Regierungsmitglieder (COFAG-Untersuchungsausschuss)“ dem Geschäftsordnungsausschuss zu.
Ebenfalls gemäß § 33 Abs. 6 der Geschäftsordnung weise ich das Verlangen 7/US „auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses betreffend Aufklärung, ob öffentliche Gelder im Bereich der Vollziehung des Bundes aus sachfremden Motiven zweckwidrig verwendet wurden (,ROT-BLAUER Machtmissbrauch-Untersuchungsausschuss‘)“ dem Geschäftsordnungsausschuss zu.
*****
Die nächste Sitzung des Nationalrates, die geschäftsordnungsmäßige Mitteilungen und Zuweisungen betreffen wird, berufe ich für 16.38 Uhr ein. Das ist gleich im Anschluss an diese Sitzung.
Diese Sitzung ist geschlossen.
Schluss der Sitzung: 16.38 Uhr
|
Impressum: Parlamentsdirektion 1017 Wien
|