
Plenarsitzung
des Nationalrates
245. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich
Donnerstag, 14. Dezember 2023
XXVII. Gesetzgebungsperiode
Nationalratssaal

Plenarsitzung
des Nationalrates
245. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich
Donnerstag, 14. Dezember 2023
XXVII. Gesetzgebungsperiode
Nationalratssaal
Stenographisches Protokoll
245. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich
XXVII. Gesetzgebungsperiode Donnerstag, 14. Dezember 2023
Dauer der Sitzung
Donnerstag, 14. Dezember 2023: 9.05 – 18.52 Uhr
*****
Tagesordnung
1. Punkt: Bericht über das Volksbegehren „BARGELD-Zahlung: Obergrenze NEIN!“
2. Punkt: Bundesgesetz, mit dem ein Finanzausgleichsgesetz 2024 erlassen wird sowie das Finanzausgleichsgesetz 2017, das Umweltförderungsgesetz, das Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz, das Transparenzdatenbankgesetz 2012 und das Bildungsinvestitionsgesetz geändert werden
3. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Transparenzdatenbankgesetz 2012 geändert wird
4. Punkt: Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG über die Etablierung einer gebietskörperschaftenübergreifenden Transparenzdatenbank
5. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988, das Umgründungssteuergesetz, die Bundesabgabenordnung, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das
Kommunalsteuergesetz 1993 und das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert werden (Start-Up-Förderungsgesetz)
6. Punkt: Bundesgesetz,
mit dem das Bundesgesetz zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung
für Unternehmensgruppen erlassen wird
und die Bundesabgabenordnung sowie das Unternehmensgesetzbuch geändert
werden (Mindestbesteuerungsreformgesetz – MinBestRefG)
7. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988, die Bundesabgabenordnung, das Gebührengesetz 1957, das Privathochschulgesetz, das Fachhochschulgesetz und das IST-Austria-Gesetz geändert werden (Gemeinnützigkeitsreformgesetz 2023 – GemRefG 2023)
8. Punkt: Bericht über den Antrag 3777/A der Abgeordneten Karlheinz Kopf, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Umsatzsteuergesetz 1994, das Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992, das Elektrizitätsabgabegesetz, das Erdgasabgabegesetz, das Kohleabgabegesetz und die Bundesabgabenordnung geändert werden
9. Punkt: Bericht und Antrag über den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über die Einrichtung einer Bundeswettbewerbsbehörde (Wettbewerbsgesetz – WettbG) geändert wird
10. Punkt: Bericht über den Antrag 3738/A(E) der Abgeordneten Eva-Maria Himmelbauer, BSc, Süleyman Zorba, Kolleginnen und Kollegen betreffend die Sicherstellung des reibungslosen Breitbandausbaus
11. Punkt: Bundesgesetz über die höhere berufliche Bildung (HBB-Gesetz)
12. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Emissionsschutzgesetz für Kesselanlagen geändert wird
13. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, das Arbeitsmarktservicegesetz und das Ausbildungspflichtgesetz geändert werden
14. Punkt: Bericht über den Antrag 3774/A der Abgeordneten Tanja Graf, Hermann Weratschnig, MBA MSc, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Ausländerbeschäftigungsgesetz und das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz geändert werden
15. Punkt: Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die Förderung von Bildungsmaßnahmen im Bereich Basisbildung sowie von Bildungsmaßnahmen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses für die Jahre 2024 bis 2028
16. Punkt: Bericht über den Antrag 3641/A(E) der Abgeordneten Eva Maria Holzleitner, BSc, Kolleginnen und Kollegen betreffend Wiederverleihung des Staatspreises Erwachsenenbildung
17. Punkt: Bericht über den Antrag 3717/A(E) der Abgeordneten Mag. Martina Künsberg Sarre, Mag. Dr. Rudolf Taschner, Mag. Sibylle Hamann, Kolleginnen und Kollegen betreffend Prävention vor Extremismen
18. Punkt: Sammelbericht über die Petitionen Nr. 106 und 112 bis 115
*****
Inhalt
Personalien
Verhinderungen ........................................................................................................... 22
Ordnungsrufe ................................................................................................... 139, 139
Geschäftsbehandlung
Antrag des
Abgeordneten Dr. Nikolaus Scherak, MA, Kolleginnen und
Kollegen, dem Justizausschuss zur Berichterstattung über den
Antrag 361/A(E)
der Abgeordneten Dr. Johannes Margreiter, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Unabhängiger
Bundesstaatsanwalt“ gemäß § 43 Abs. 1 GOG
eine Frist bis 31. Jänner 2024 zu setzen –Ablehnung
.................................. 69, 392
Redezeitbeschränkung nach Beratung in der Präsidialkonferenz gemäß § 57 Abs. 5 GOG ............................................................................................................................... 70
Fragestunde (24.)
Inneres .......................................................................................................................... 23
Dr. Christian Stocker (304/M); Petra Steger, Michel Reimon, MBA
Ing. Reinhold Einwallner (301/M)
Mag. Hannes
Amesbauer, BA (311/M); Maximilian Köllner, MA,
Mag. Ernst Gödl
Eva-Maria Himmelbauer, BSc (305/M); Christian Ries, Katharina Kucharowits
Sabine Schatz (302/M); Mag. Romana Deckenbacher
Mag. Faika El-Nagashi (320/M); Mario Lindner
Dr. Helmut Brandstätter (316/M); Andreas Minnich
Christian Oxonitsch (303/M); Martina Diesner-Wais, Mag. Yannick Shetty, Mag. Nina Tomaselli
Ing. Manfred Hofinger (307/M); Dr. Stephanie Krisper
Bundesregierung
Vertretungsschreiben ................................................................................................. 22
Ausschüsse
Zuweisungen ................................................................................................................ 69
Verhandlungen
1. Punkt: Bericht des Finanzausschusses über das Volksbegehren (2080 d.B.) „BARGELD-Zahlung: Obergrenze NEIN!“ (2374 d.B.) ................................................................. 70
Redner:innen:
Peter Haubner ............................................................................................................... 71
Andreas Kollross ........................................................................................................... 74
Peter Wurm ................................................................................................................... 80
Mag. Nina Tomaselli ..................................................................................................... 83
Mag. Gerald Loacker .................................................................................................... 85
Dr. Susanne Fürst ......................................................................................................... 86
Mag. Ulrike Fischer ....................................................................................................... 89
MMMag. Dr. Axel Kassegger ....................................................................................... 90
Mag. Hannes Amesbauer, BA ...................................................................................... 92
Dr. Dagmar Belakowitsch ............................................................................................ 94
Kai Jan Krainer ............................................................................................................. 97
Entschließungsantrag der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Sicherung der Bargeldversorgung und der Annahmepflicht von Bargeld“ – Ablehnung 77, 98
Kenntnisnahme des Ausschussberichtes 2374 d.B. ............................................... 98
Gemeinsame Beratung über
2. Punkt: Bericht des Finanzausschusses über die Regierungsvorlage (2305 d.B.): Bundesgesetz, mit dem ein Finanzausgleichsgesetz 2024 erlassen wird sowie das Finanzausgleichsgesetz 2017, das Umweltförderungsgesetz, das Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz, das Transparenzdatenbankgesetz 2012 und das Bildungsinvestitionsgesetz geändert werden (2375 d.B.) ................................. .... 99
3. Punkt: Bericht des Finanzausschusses über die Regierungsvorlage (2306 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Transparenzdatenbankgesetz 2012 geändert wird (2376 d.B.) ...... 99
4. Punkt: Bericht des Finanzausschusses über die Regierungsvorlage (2314 d.B.): Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG über die Etablierung einer gebietskörperschaftenübergreifenden Transparenzdatenbank (2377 d.B.) ........................................................................... 99
Redner:innen:
Maximilian Linder ......................................................................................................... 99
August Wöginger ........................................................................................................ 108
Mag. Gerald Loacker .................................................................................................. 115
Maximilian Lercher ..................................................................................................... 126
Dr. Elisabeth Götze ..................................................................................................... 128
Bundesminister Dr. Magnus Brunner, LL.M. ............................................................. 131
Angela Baumgartner .................................................................................................. 136
Alois Stöger, diplômé .................................................................................................. 138
Ing. Manfred Hofinger ................................................................................................ 140
Andreas Kollross ......................................................................................................... 147
Ing. Klaus Lindinger, BSc ............................................................................................ 150
Christoph Stark ........................................................................................................... 152
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Maximilian Linder, Kolleginnen und Kollegen
betreffend „Sofortentlastung: Nein zu ORF-Zwangssteuer
und CO2-Strafsteuer!“ – Ablehnung ............................................................ 104,
287
Entschließungsantrag der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Reform des Finanzausgleichs und echte Transparenz für die Transparenzdatenbank“ – Ablehnung .......................................................... 118, 287
Annahme der beiden Gesetzentwürfe in 2375 und 2376 d.B. ........................... 285
Genehmigung der Vereinbarung in 2377 d.B. ....................................................... 285
Gemeinsame Beratung über
5. Punkt: Bericht des Finanzausschusses über die Regierungsvorlage (2321 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988, das Umgründungssteuergesetz, die Bundesabgabenordnung, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Kommunalsteuergesetz 1993 und das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert werden (Start-Up-Förderungsgesetz) (2378 d.B.) ...................................................................................................................................... 155
6. Punkt: Bericht des Finanzausschusses über
die Regierungsvorlage (2322 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz zur
Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung für
Unternehmensgruppen erlassen wird und die Bundesabgabenordnung sowie
das Unternehmensgesetzbuch geändert werden
(Mindestbesteuerungsreformgesetz –
MinBestRefG) (2379 d.B.) ........................................................................................ 155
Redner:innen:
Mag. Selma Yildirim ................................................................................................... 155
Karlheinz Kopf ............................................................................................................ 157
Mag. Gerald Loacker .................................................................................................. 170
Mag. Gerhard Kaniak ................................................................................................. 179
Mag. Verena Nussbaum ............................................................................................. 181
Dr. Elisabeth Götze ..................................................................................................... 183
Bundesminister Dr. Magnus Brunner, LL.M. ............................................................. 185
Gabriel Obernosterer ................................................................................................. 188
Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA ...................................................................................... 190
Mag. Dr. Rudolf Taschner .......................................................................................... 192
Dr. Josef Smolle .......................................................................................................... 194
Mag. Gerhard Kaniak (tatsächliche Berichtigung) .................................................. 196
Annahme der beiden Gesetzentwürfe in 2378 und 2379 d.B. ........................... 288
7. Punkt: Bericht des Finanzausschusses über die Regierungsvorlage (2319 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988, die Bundesabgabenordnung, das Gebührengesetz 1957, das Privathochschulgesetz, das Fachhochschulgesetz und das IST-Austria-Gesetz geändert werden (Gemeinnützigkeitsreformgesetz 2023 – GemRefG 2023) (2380 d.B.) .................................................. 197
Redner:innen:
Dr. Christoph Matznetter .......................................................................................... 197
Mag. Andreas Hanger ................................................................................................ 200
Maximilian Linder ....................................................................................................... 203
Mag. Eva Blimlinger .................................................................................................... 204
Mag. Martina Künsberg Sarre ................................................................................... 206
Bundesminister Dr. Magnus Brunner, LL.M. ............................................................. 208
Mag. Dr. Maria Theresia Niss, MBA .......................................................................... 212
Annahme des Gesetzentwurfes in 2380 d.B. ........................................................ 291
Gemeinsame Beratung über
8. Punkt: Bericht des Finanzausschusses über
den Antrag 3777/A der Abgeordneten Karlheinz Kopf,
Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA, Kolleginnen
und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Umsatzsteuerge-
setz 1994, das Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992, das Elektrizitätsabgabegesetz, das Erdgasabgabegesetz, das Kohleabgabegesetz und die Bundesabgabenordnung geändert werden (2381 d.B.) ............................................................................................................................. 218
9. Punkt: Bericht und Antrag des Finanzausschusses
über den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz
über die Einrichtung
einer Bundeswettbewerbsbehörde (Wettbewerbsgesetz –
WettbG) geändert wird (2382 d.B.) ........................................................................ 219
Redner:innen:
Kai Jan Krainer ........................................................................................................... 219
Karlheinz Kopf ............................................................................................................ 222
Michael Bernhard ....................................................................................................... 224
MMMag. Dr. Axel Kassegger ..................................................................................... 226
Dr. Elisabeth Götze ..................................................................................................... 229
Franz Leonhard Eßl .................................................................................................... 231
Mag. Christian Ragger ................................................................................................ 236
Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA ...................................................................................... 238
Maximilian Lercher ..................................................................................................... 240
Mag. Klaus Fürlinger .................................................................................................. 243
Entschließungsantrag der Abgeordneten Philip Kucher, Kolleginnen und Kollegen betreffend „temporäres Aussetzen der CO2-Steuer für die Dauer der Energiepreiskrise“ – Ablehnung 242, 245
Annahme der beiden Gesetzentwürfe in 2381 und 2382 d.B. ........................... 244
10. Punkt: Bericht des Ausschusses für Forschung, Innovation und Digitalisierung über den Antrag 3738/A(E) der Abgeordneten Eva-Maria Himmelbauer, BSc, Süleyman Zorba, Kolleginnen und Kollegen betreffend die Sicherstellung des reibungslosen Breitbandausbaus (2333 d.B.) .................................................................................................................. 247
Redner:innen:
Douglas Hoyos-Trauttmansdorff .............................................................................. 247
Eva-Maria Himmelbauer, BSc .................................................................................... 249
Mag. Dr. Petra Oberrauner ........................................................................................ 252
Dipl.-Ing. Gerhard Deimek ......................................................................................... 254
Süleyman Zorba .......................................................................................................... 256
Staatssekretär Florian Tursky, MBA MSc ................................................................. 257
Joachim Schnabel ....................................................................................................... 259
Melanie Erasim, MSc .................................................................................................. 262
Christian Oxonitsch .................................................................................................... 263
MMag. Michaela Schmidt .......................................................................................... 265
Annahme der dem schriftlichen Ausschussbericht 2333 d.B. beigedruckten Entschließung betreffend „die Sicherstellung des reibungslosen Breitbandausbaus“ (352/E) 267
Gemeinsame Beratung über
11. Punkt: Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie und Energie über die Regierungsvorlage (2312 d.B.): Bundesgesetz über die höhere berufliche Bildung (HBB-Gesetz) (2348 d.B.) .................................................................................................................. 267
12. Punkt: Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie und Energie über die Regierungsvorlage (2246 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Emissionsschutzgesetz für Kesselanlagen geändert wird (2347 d.B.) ............................................................... 267
Redner:innen:
Martina Kaufmann, MMSc BA .................................................................................. 268
Dr. Christoph Matznetter .......................................................................................... 270
Maximilian Linder ....................................................................................................... 272
Mag. Eva Blimlinger .................................................................................................... 274
Mag. Yannick Shetty .................................................................................................. 275
Bundesminister Mag. Dr. Martin Kocher .................................................................. 276
Dipl.-Ing. Andrea Holzner .......................................................................................... 278
Mag. Dr. Petra Oberrauner ........................................................................................ 279
Ing. Martin Litschauer ................................................................................................ 281
Laurenz Pöttinger ....................................................................................................... 282
Mag. (FH) Kurt Egger .................................................................................................. 284
Annahme der beiden Gesetzentwürfe in 2348 und 2347 d.B. ........................... 285
Gemeinsame Beratung über
13. Punkt: Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über die Regierungsvorlage (2307 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, das Arbeitsmarktservicegesetz und das Ausbildungspflichtgesetz geändert werden (2394 d.B.) ............................................................................................................................. 292
14. Punkt: Bericht
des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 3774/A
der Abgeordneten Tanja Graf, Hermann Weratschnig, MBA MSc, Kolleginnen und Kollegen
betreffend ein Bundesgesetz, mit
dem das Ausländerbeschäftigungsgesetz und das Niederlassungs- und
Aufenthaltsgesetz geändert werden (2395 d.B.) ................................................................................... 292
Redner:innen:
Alois Stöger, diplômé .................................................................................................. 293
Mag. Markus Koza ..................................................................................................... 294
Dr. Dagmar Belakowitsch .......................................................................................... 297
Rebecca Kirchbaumer ................................................................................................ 299
Michael Seemayer ...................................................................................................... 301
Mag. Gerald Loacker .................................................................................................. 305
Bundesminister Mag. Dr. Martin Kocher .................................................................. 307
Peter Wurm ................................................................................................................. 309
Hermann Weratschnig, MBA MSc ............................................................................ 313
Kira Grünberg ............................................................................................................. 315
Fiona Fiedler, BEd ....................................................................................................... 317
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Josef Muchitsch, Kolleginnen und Kollegen
betreffend „Personalaufstockung beim Arbeitsmarktservice
und der Arbeitsinspektion“ – Ablehnung ..................................................... 303,
321
Entschließungsantrag der Abgeordneten Fiona Fiedler, BEd, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Stichtagsregelung bei Arbeitsunfähigkeit“ – Ablehnung ...... 319, 322
Annahme der beiden Gesetzentwürfe in 2394 und 2395 d.B. ........................... 321
Gemeinsame Beratung über
15. Punkt: Bericht
des Unterrichtsausschusses über die Regierungsvorlage (2311 d.B.):
Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund
und den Ländern über die Förderung von Bildungsmaßnahmen
im Bereich Basisbildung sowie von
Bildungsmaßnahmen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses
für die Jahre 2024 bis 2028 (2330 d.B.) ........................................................................................................ 322
16. Punkt: Bericht des Unterrichtsausschusses über den Antrag 3641/A(E) der Abgeordneten Eva Maria Holzleitner, BSc, Kolleginnen und Kollegen betreffend Wiederverleihung des Staatspreises Erwachsenenbildung (2331 d.B.) .................................................... 323
Redner:innen:
Hermann Brückl, MA .................................................................................................. 323
Mag. Romana Deckenbacher .................................................................................... 325
Katharina Kucharowits .............................................................................................. 327
Mag. Sibylle Hamann ................................................................................................. 328
Mag. Martina Künsberg Sarre ................................................................................... 330
Bundesminister Dr. Martin Polaschek ...................................................................... 331
Ing. Johann Weber ..................................................................................................... 333
Mag. Andrea Kuntzl ................................................................................................... 334
MMag. Dr. Agnes Totter, BEd .................................................................................... 335
Genehmigung der Vereinbarung in 2330 d.B. ....................................................... 338
Annahme der dem schriftlichen Ausschussbericht 2331 d.B. beigedruckten Entschließung betreffend „Wiederverleihung des Staatspreises Erwachsenenbildung“ (353/E) 338
17. Punkt: Bericht
des Unterrichtsausschusses über den Antrag 3717/A(E) der Abgeordneten
Mag. Martina Künsberg Sarre, Mag. Dr. Rudolf
Taschner, Mag. Sibylle Hamann, Kolleginnen und Kollegen betreffend
Prävention vor Extremismen (2332 d.B.) .......................................................................................... 338
Redner:innen:
Hermann Brückl, MA .................................................................................................. 339
Mag. Dr. Rudolf Taschner .......................................................................................... 345
Christian Oxonitsch .................................................................................................... 348
Mag. Faika El-Nagashi ............................................................................................... 354
Mag. Martina Künsberg Sarre ................................................................................... 356
Nico Marchetti ............................................................................................................ 358
Bundesminister Dr. Martin Polaschek ...................................................................... 360
Sabine Schatz ............................................................................................................. 362
Dipl.-Kffr. (FH) Elisabeth Pfurtscheller ...................................................................... 364
Entschließungsantrag der Abgeordneten Hermann Brückl, MA, Kolleginnen und Kollegen betreffend „9-Punkte Plan als Antwort auf das zunehmende Gewalt- und Konfliktpotenzial an Schulen“ – Ablehnung .................................................................................... 341, 369
Entschließungsantrag der Abgeordneten Christian Oxonitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Kinder und Jugendliche durch politische Krisen begleiten und Demokratiebildung ausbauen“ – Ablehnung .................................................................................. 351, 369
Entschließungsantrag der Abgeordneten Dipl.-Kffr. (FH) Elisabeth Pfurtscheller,
Mag. Meri Disoski, Eva Maria Holzleitner, BSc, Henrike
Brandstötter, Kolleginnen und Kollegen betreffend „die
strafrechtliche Verfolgung
von sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt durch Hamas-Terroristen“ – Annahme (355/E) .............................................................................................................. 366, 369
Annahme der dem schriftlichen Ausschussbericht 2332 d.B. beigedruckten Entschließung betreffend „Prävention von Extremismus“ (354/E) .............................................. 369
18. Punkt: Sammelbericht des Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen über die Petitionen Nr. 106 und 112 bis 115 (2339 d.B.) ................................................... 370
Redner:innen:
Nikolaus Prinz ............................................................................................................. 370
Petra Wimmer ............................................................................................................ 371
Christian Ries .............................................................................................................. 373
Mag. Ulrike Fischer ..................................................................................................... 374
Mag. Yannick Shetty .................................................................................................. 376
Dipl.-Ing. Andrea Holzner .......................................................................................... 378
Robert Laimer ............................................................................................................. 379
Christian Lausch ......................................................................................................... 381
Hermann Weratschnig, MBA MSc ............................................................................ 382
Hans Stefan Hintner ................................................................................................... 385
Peter Schmiedlechner ................................................................................................ 387
Mag. Friedrich Ofenauer ............................................................................................ 388
Andreas Minnich ........................................................................................................ 390
Christoph Zarits .......................................................................................................... 390
Kenntnisnahme des Ausschussberichtes 2339 d.B. hinsichtlich der Petitionen 106 und 112 bis 115............................................................................................................................... 392
Eingebracht wurden
Bericht .......................................................................................................................... 69
Ill-1073: Tätigkeitsbericht der Ombudsstelle für Studierende; BM f. Bildung, Wissenschaft und Forschung
Anträge der Abgeordneten
Petra Wimmer, Kolleginnen und Kollegen betreffend erweiterter Beobachtungszeitraum für das Erfordernis der Erwerbstätigkeit beim einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld (3802/A)(E)
Petra Bayr, MA MLS, Kolleginnen und Kollegen betreffend Initiative zur Erweiterung des Römer Statuts, um genderbasierte Apartheid zu verbieten (3803/A)(E)
Petra Bayr, MA MLS, Kolleginnen und Kollegen betreffend Initiative zur Erweiterung des Römer Statuts, um genderbasierte Apartheid zu verbieten (3804/A)(E)
Christian Oxonitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Kinder und Jugendliche durch politische Krisen begleiten und Demokratiebildung ausbauen“ (3805/A)(E)
Mag. Muna Duzdar, Kolleginnen und Kollegen betreffend „ORF-Finanzierung sozial gestalten“ (3806/A)(E)
Anfragen der Abgeordneten
Gabriele Heinisch-Hosek, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport betreffend Publikumskampagne „Auch anders“ (17091/J)
Christian Oxonitsch, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Dubiose Vorgänge rund um das ICMPD (17092/J)
Rudolf Silvan, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie betreffend eines möglichen Bergbauprojekts nahe der österreichischen Grenze in der tschechischen Gemeinde Novè Hrady (17093/J)
Rudolf Silvan, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend eines möglichen Bergbauprojekts nahe der österreichischen Grenze in der tschechischen Gemeinde Novè Hrady (17094/J)
Douglas Hoyos-Trauttmansdorff, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend Mehr Details zum Projekt Digitale Kompetenzoffensive (17095/J)
Dr. Stephanie Krisper, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Im Agressionskrieg Russlands gegen die Ukraine kämpfende Österreicher (17096/J)
Michael Bernhard, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend Warten auf die Familienbeihilfe (17097/J)
Fiona Fiedler, BEd, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend Sicherstellung guter Durchimpfungsraten in Österreich (17098/J)
Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend Folgeanfrage: Einnahmen aus Prüfungen der Wirtschaftskammern (2013-2022) (17099/J)
Mag. Hannes Amesbauer, BA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Kriminalität im Burgenland 2023 (17100/J)
Mag. Hannes Amesbauer, BA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Kriminalität in Kärnten 2023 (17101/J)
Mag. Hannes Amesbauer, BA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Kriminalität in Niederösterreich 2023 (17102/J)
Mag. Hannes Amesbauer, BA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Kriminalität in Oberösterreich 2023 (17103/J)
Mag. Hannes Amesbauer, BA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Kriminalität in Salzburg 2023 (17104/J)
Mag. Hannes Amesbauer, BA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Kriminalität in der Steiermark 2023 (17105/J)
Mag. Hannes Amesbauer, BA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Kriminalität in Tirol 2023 (17106/J)
Mag. Hannes Amesbauer, BA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Kriminalität in Vorarlberg 2023 (17107/J)
Mag. Hannes Amesbauer, BA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Kriminalität in Wien 2023 (17108/J)
Mag. Hannes Amesbauer, BA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Kriminalität in Österreich 2023 (17109/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport betreffend Insider-Deals: Wer finanziert die ÖVP-Parteiunternehmen? (17110/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten betreffend Insider-Deals: Wer finanziert die ÖVP-Parteiunternehmen? (17111/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundeskanzler betreffend Insider-Deals: Wer finanziert die ÖVP-Parteiunternehmen? (17112/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend Insider-Deals: Wer finanziert die ÖVP-Parteiunternehmen? (17113/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen
und Kollegen an den Bundesminister für
Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft betreffend
Insider-Deals: Wer finanziert die ÖVP-Parteiunternehmen? (17114/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie betreffend Insider-Deals: Wer finanziert die ÖVP-Parteiunternehmen? (17115/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien betreffend Insider-Deals: Wer finanziert die ÖVP-Parteiunternehmen? (17116/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für EU und Verfassung betreffend Insider-Deals: Wer finanziert die ÖVP-Parteiunternehmen? (17117/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen
und Kollegen an den Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung
betreffend Insider-Deals: Wer finanziert die
ÖVP-Parteiunternehmen? (17118/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend Insider-Deals: Wer finanziert die ÖVP-Parteiunternehmen? (17119/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend Insider-Deals: Wer finanziert die ÖVP-Parteiunternehmen? (17120/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend Insider-Deals: Wer finanziert die ÖVP-Parteiunternehmen? (17121/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Landesverteidigung betreffend Insider-Deals: Wer finanziert die ÖVP-Parteiunternehmen? (17122/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen
und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Insider-Deals:
Wer finanziert die ÖVP-Parteiunternehmen?
(17123/J)
Thomas Spalt, Kolleginnen
und Kollegen an den Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen
Dienst und Sport betreffend Marketingverträge
des Kunsthistorischen Museums (17124/J)
Thomas Spalt, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport betreffend LGBTIQ-Agenda des Kunsthistorischen Museums (17125/J)
Thomas Spalt, Kolleginnen
und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend „Ciao
ohne au!“ – Inserate des BMF in der Kleinen Zeitung
vom 14. Februar 2023 (17126/J)
Peter Schmiedlechner, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft betreffend Freihandelsabkommen Mercosur würde „Bauernsterben“ befeuern und Lebensmittelsouveränität unseres Landes gefährden! (17127/J)
Peter Schmiedlechner, Kolleginnen und Kollegen
an den Bundesminister
für Arbeit und Wirtschaft betreffend Freihandelsabkommen Mercosur
würde „Bauernsterben“ befeuern und
Lebensmittelsouveränität unseres Landes gefährden! (17128/J)
Peter Schmiedlechner, Kolleginnen
und Kollegen an den Bundesminister
für Finanzen betreffend Freihandelsabkommen Mercosur würde „Bauernsterben“
befeuern und Lebensmittelsouveränität unseres Landes gefährden!
(17129/J)
Peter Schmiedlechner, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten betreffend Freihandelsabkommen Mercosur würde „Bauernsterben“ befeuern und Lebensmittelsouveränität unseres Landes gefährden! (17130/J)
Mag. Gerald Hauser, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend Sind weitere Corona-Maßnahmen sinnvoll? (17131/J)
Mag. Gerald Hauser, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend Kosten der Philippinen-Reise von Staatssekretärin Kraus-Winkler (17132/J)
Mag. Philipp Schrangl, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend SIGNA, TPA und der Bundesrevisionsverband für gemeinnützige Bauvereinigungen (17133/J)
Mag. Hannes Amesbauer, BA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Was wurde eigentlich aus dem Projekt „Zielland Österreich“? (17134/J)
Mag. Hannes Amesbauer,
BA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres
betreffend Kriminalitätsbelastungszahlen Fremdenkriminalität
im Jahr 2023 (17135/J)
Mag. Hannes Amesbauer, BA, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie betreffend Wurde Langenwang beim Regionalexpress ignoriert? (17136/J)
Christian Ries, Kolleginnen
und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege
und Konsumentenschutz betreffend Ärger wegen Eintrag
in einer Bonitätsdatenbank (17137/J)
Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend HG Wien beurteilt Klauseln zur Servicegebühr bei Ö-Ticket als gesetzwidrig (17138/J)
Mag. Dr. Martin Graf, Kolleginnen
und Kollegen an den Bundesminister für europäische und
internationale Angelegenheiten betreffend Befreiung des österreichischen
Staatsbürgers Christian Weber, welcher im Iran gekidnappt
und verschleppt wurde und als politischer Gefangener und Geisel gehalten wird
(17139/J)
Mag. Dr. Martin Graf, Kolleginnen
und Kollegen an den Bundesminister für europäische und internationale
Angelegenheiten betreffend Befreiung
des österreichischen Staatsbürgers Herbert Fritz, welcher in
Afghanistan gekidnappt und verschleppt wurde und als politischer
Gefangener und Geisel festgehalten wird (17140/J)
Christian Hafenecker, MA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Videoaufzeichnungen der Polizei bei Veranstaltung des Freiheitlichen Bildungsinstituts (17141/J)
Christian Hafenecker, MA, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien betreffend Was geschieht mit bereits bezahlter ORF-Haushaltsabgabe bei Todesfall? (17142/J)
Dipl.-Ing. Gerhard Deimek, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie betreffend Eisenbahnverkehr auf der Ennstalstrecke (17143/J)
Mag. Gerhard Kaniak, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend COVID-19 Datenplattform nicht mehr öffentlich zugänglich (17144/J)
Walter Rauch, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie betreffend Planen Sie die Einführung des Straftatbestandes „Ökozid“? (17145/J)
Mag. Christian Ragger, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie betreffend Teilnahme einer über 40-köpfigen Abordnung an der Klimakonferenz 2023 (COP28) in Dubai (17146/J)
Mag. Christian Ragger, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend Bearbeitungsstau in Bezirksgericht sorgt für Skandal (17147/J)
Christian Lausch, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend Überstundenkontingente in Justizanstalten, Generaldirektion und Kabinett (17148/J)
Christian Lausch, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend Einsatz von Suchtmittel- und Mobiltelefonspürhunden in Justizanstalten (17149/J)
Christian Lausch, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend Häftling der Justizanstalt Stein aus Spital entflohen (17150/J)
Christian Lausch, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend Drogen in den Justizanstalten (17151/J)
Mag. Yannick Shetty, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend Förderung von einem Freiwilligendienst im Ausland (17152/J)
Dr. Nikolaus Scherak,
MA, Kolleginnen und Kollegen an
die Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien
betreffend „Stabsstelle Zollamt“
im ÖIF (17153/J)
Beginn der Sitzung: 9.05 Uhr
Vorsitzende: Präsident Mag. Wolfgang Sobotka, Zweite Präsidentin Doris Bures, Dritter Präsident Ing. Norbert Hofer.
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten! Ich darf Sie herzlich zur 245. Sitzung des Nationalrates begrüßen, die damit eröffnet ist.
Als verhindert gemeldet sind heute die Abgeordneten Mag. Bettina Rausch-Amon, Julia Elisabeth Herr, Klaus Köchl, Petra Tanzler, MMag. DDr. Hubert Fuchs, Wolfgang Zanger, Heike Grebien, Bedrana Ribo, MA, Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer und Mag. Julia Seidl.
Ich darf auch die Damen und
Herren auf der Journalistengalerie und auf der Besuchergalerie herzlich begrüßen,
ebenso die Damen und Herren, die
uns zu Hause vor den Bildschirmen folgen.
Vertretung von Mitgliedern der Bundesregierung
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Für den heutigen Sitzungstag hat das Bundeskanzleramt über die Vertretung von Mitgliedern der Bundesregierung folgende Mitteilung gemacht:
Bundesminister für
europäische und internationale Angelegenheiten Mag. Alexander Schallenberg,
LL.M. wird durch Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Regionen
und Wasserwirtschaft Mag. Norbert Totschnig, MSc, Bundesministerin
für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation
und Technologie Leonore Gewessler, BA durch Bundesminister
für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz Johannes Rauch
vertreten.
Ferner wird die Vertretung von Mitgliedern der Bundesregierung, welche sich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union aufhalten, wie folgt bekannt gegeben:
Bundeskanzler Karl Nehammer, MSc wird durch Staatssekretärin im Bundeskanzleramt Claudia Plakolm vertreten.
*****
Wie üblich wird die Sitzung auf ORF 2 bis 13 Uhr,
auf ORF III bis 19.15 Uhr und anschließend in der TVthek
übertragen. Auch private Sender übertragen
unsere Sitzung zum Teil.
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Wir kommen zur Fragestunde.
Ich darf den Herrn Bundesminister recht herzlich begrüßen.
Die Fragestellungen durch die Damen und Herren werden von beiden Rednerpulten aus vorgenommen, der Herr Bundesminister wird vom zentralen Rednerpult aus antworten.
Sie kennen die Vereinbarungen: 1 Minute die Frage, 2 Minuten die erste Antwort, 1 Minute die zweite Antwort.
Inneres
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Ich darf zur 1. Anfrage kommen, die Herr Abgeordneter Stocker stellt. – Bitte sehr.
Abgeordneter
Dr. Christian Stocker (ÖVP): Sehr
geehrter Herr Präsident! Herr Bundesminister! Die Situation der illegalen
Migration ist eine, die ganz
Europa und insbesondere auch Österreich beschäftigt. Wir haben im
vergangenen Jahr gesehen, dass die
illegale Migration mit sehr hohen Antragszahlen
im Asylwesen verbunden war. Österreich hat ja auf europäischer Ebene, aber natürlich auch auf nationaler und auf bilateraler Ebene eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, die dazu geführt haben, dass die Flüchtlingszahlen, die Zahlen der illegalen Migration drastisch gesunken sind.
Auf europäischer Ebene
wurde eine neue Regelung beschlossen, und ich würde Sie bitten, dass Sie
die für Österreich wesentlichen Neuerungen, die in
dieser europäischen Regelung enthalten sind, kurz darstellen.
*****
Die schriftlich eingebrachte Anfrage, 304/M, hat folgenden Wortlaut:
„Welche der neuen Regelungen bei der Einigung der EU-Innenminister auf den Asyl- und Migrationspakt sind aus Ihrer Sicht für Österreich wesentlich?“
*****
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister
für Inneres Mag. Gerhard Karner: Sehr
geehrter Herr Präsident! Geschätzte Damen und Herren Abgeordnete!
Auch ich darf Ihnen allen
einen schönen guten Morgen wünschen.
In diesem Asyl- und Migrationspakt, der am 9. Juni vom
Rat der Innenminister beschlossen wurde, ist eine Vielzahl an Regelungen
enthalten, die jetzt
auch diskutiert werden. Aus meiner Sicht sind drei Punkte in diesem Asyl- und
Migrationspakt essenziell, aber ich möchte vorher noch kurz darauf hinweisen, dass
Voraussetzung für den Beschluss dieses Asyl- und Migrationspaktes am
9. Juni der Beschluss der Staats- und Regierungschefs am 9. Februar war, bei
dem man sich erstmals zu einem gemeinsamen EU-Außengrenzschutz
bekannt hat und gesagt hat: Ja, das ist eine Aufgabe für alle Länder der Europäischen
Union. – Das war die Voraussetzung dafür.
Daher hat der Beschluss vom
9. Juni das klare Ziel: erster Punkt: funktionierender robuster
EU-Außengrenzschutz; zweiter Punkt – aus meiner Sicht
zentral –: schnelle Verfahren an der EU-Außengrenze vor allem
für jene, die praktisch keine Chance auf Asyl haben; und der dritte Punkt,
der auch
intensiv und heftig diskutiert
wurde – da hat es auch eine Sitzungsunterbrechung gegeben –:
die Zusammenarbeit mit sogenannten sicheren Drittstaaten.
Das sind aus meiner Sicht jene
Bereiche, die in diesem Asyl- und Migrationspakt essenziell sind, und dieser
wird derzeit im sogenannten Trilog – Trilog heißt,
das wissen Sie, Verhandlungen zwischen der Kommission, dem Vorsitz und dem
Parlament – behandelt, in dem wir darauf drängen und das
zuletzt bestärkt haben, dass dieser Pakt, dieses Paket, das
durch die Innenministerinnen und Innenminister beschlossen wurde, nicht
aufgeweicht wird.
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zusatzfrage? – Keine Zusatzfrage von Abgeordnetem Stocker.
Die nächste Frage stellt Abgeordnete Steger. – Bitte sehr.
Abgeordnete Petra Steger (FPÖ): Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Minister! Sie haben einen wesentlichen Aspekt bei diesem Asyl- und Migrationspakt ausgelassen, nämlich die Krisenverordnung.
Mit Ihrer Enthaltung, mit Ihrem Umfaller haben Sie mit
diesem Pakt wieder einmal – genauso wie die Europäische
Union – bewiesen, dass Sie nicht Teil der Lösung, sondern Teil
des Problems sind, denn der notwendige Systemwechsel findet damit
jedenfalls nicht statt – ganz im Gegenteil: Unter dieser Krisenverordnung
verlangt die EU von den EU-Mitgliedstaaten einen sogenannten verbindlichen
Solidaritätsmechanismus, was nichts anderes bedeutet als eine
Zwangsverteilung von Migranten, sodass wir in Zukunft eben nur
noch die Wahl haben, entweder Migranten aufzunehmen oder für jeden, den
wir nicht aufnehmen, Summen zu zahlen – als Nettozahlerstaat, muss
ich dazusagen.
Sie, die ÖVP und viele
Ihrer Politiker, haben diese verpflichtende Verteilung oder die alternativen
Zahlungen in der Vergangenheit mehrfach als absolutes
No-Go bezeichnet, angefangen beim ehemaligen Bundeskanzler Kurz über Bundesministerin
Edtstadler bis zu Bundeskanzler Nehammer.
Herr Bundesminister, selbst Sie
haben auch noch im Mai dieses Jahres
gesagt – ich zitiere –: „Wir werden einer
Pflichtquote bei der Verteilung von Flüchtlingen nicht zustimmen, denn
Österreich hat bereits mehr als
genug geleistet.“ – Beim EU-Innenministerrat sind Sie dann
umgefallen.
(Ruf bei der ÖVP: Frage!)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Frau Abgeordnete, Sie haben 1 Minute. Sie müssen bitte zur Frage kommen.
Abgeordnete
Petra Steger (fortsetzend): Das
heißt, dass man Ihnen kein
Wort glauben kann.
Daher meine Frage: Warum sind Sie trotz jahrelanger gegenteiliger Versprechen umgefallen, haben sich bei der Abstimmung enthalten und so dieser zwangsweisen Flüchtlingsverteilung den Weg geebnet? (Abg. Baumgartner: ... Fragestellung!)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Bitte, Herr Bundesminister.
Bundesminister für Inneres Mag. Gerhard Karner: Nur eine kleine Korrektur: Ich habe mich nicht enthalten, sondern ich habe diesem Asyl- und Migrationspakt entsprechend zugestimmt, weil ich es für einen notwendigen, wichtigen Schritt halte, dass wir in diesem Bereich vorankommen.
Sie kennen die aktuellen Zahlen, Frau Abgeordnete, und
wissen, dass wir
auf europäischer Ebene in diesem Jahr eine Steigerung von 25 Prozent
an Asylanträgen hatten, dass über 2 500 Menschen im
Mittelmeer ertrunken sind,
weil sie sich in der Hoffnung auf ein besseres Leben auf den Weg gemacht haben.
Daher müssen wir Fortschritte machen. Jede Regelung, die jetzt getroffen wird,
muss und wird besser sein als die jetzige. Das ist das klare Ziel.
Sie haben die verpflichtende
Verteilung angesprochen: Ja, gegen diese haben wir uns ganz klar ausgesprochen.
Ich halte das für den völlig falschen Schritt,
weil man damit Menschen Hoffnungen macht, in ihnen Hoffnungen weckt, dass sie,
wenn sie es bis Europa schaffen, dann auch innerhalb Europas verteilt werden.
Das halte ich für den falschen Schritt, da bin ich völlig Ihrer
Meinung. Zudem würde Österreich sogar davon profitieren, wenn wir
verteilen
würden, weil Österreich im Vergleich zu anderen Ländern über
Gebühr belastet ist.
Daher: Verteilung: falscher Schritt. Ich habe diesem weiteren Schritt zugestimmt.
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Die nächste Frage stellt Abgeordneter Ramon. – Bitte. (Ruf bei der SPÖ: Reimon!)
Abgeordneter Michel Reimon, MBA (Grüne): Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Ich bin ein bisschen entspannter, aber deswegen ist mir das Thema nicht weniger wichtig.
Ich möchte das Thema aus
Sicht der Menschenrechte und des Völkerrechts noch ein bisschen besser
erklärt haben: Inwiefern wird diese neue Screening-Verordnung
garantieren, dass die Einhaltung des Unionsrechts und des Völkerrechts in
Zukunft systematisch überwacht und evaluiert wird, insbesondere der
Grundsatz der Nichtzurückweisung, das Wohl des Kindes, das Recht
auf Gesundheitsversorgung, die einschlägigen Vorschriften über die
Inhaftierung und die Verfahrensgarantien für die Betroffenen?
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Bitte, Herr Bundesminister.
Bundesminister
für Inneres Mag. Gerhard Karner: Herr
Abgeordneter, Sie haben die sogenannte Screening-Verordnung angesprochen, die
ja Teil des Asyl-
und Migrationspaktes ist, der derzeit wie gesagt im Trilog zwischen Parlament,
Kommission und Vorsitz verhandelt wird. Gerade in diesem Bereich
wird sehr intensiv verhandelt. Sie haben einige wichtige Punkte angesprochen.
Warum die
Screening-Verordnung? – Das Ziel der Screening-Verordnung
ist ja, möglichst rasch Klarheit zu haben: Wer ist die Person? Welches
Verfahren benötigt diese Person? Kommt
sie in ein Asylverfahren? Wir sind uns ja einig, denke ich, dass
Asylverfahren möglichst rasch gestartet und dann auch möglichst rasch
durchgeführt werden sollen. Das ist auch Teil dieser Screening-Verordnung.
Da gibt es derzeit noch – da kann ich dem Ergebnis nicht vorgreifen – intensive
Diskussionen darüber, wie die Punkte, die Sie angesprochen haben,
gewährleistet werden können.
Ich glaube, es braucht einen
vernünftigen Mix zwischen dem, was notwendig ist, welche Daten zu erheben
sind und durch wen sie zu erheben sind. Das
darf aber nicht über Gebühr sein, sonst haben wir wiederum eine
Verlängerung des Verfahrens. Diese Punkte werden jetzt intensiv in diesem
Trilog
diskutiert.
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Die nächste Frage stellt Abgeordneter Einwallner. – Bitte sehr.
Abgeordneter
Ing. Reinhold Einwallner (SPÖ): Guten
Morgen, Herr Bundesminister! Herr Bundesminister, seit gut 20 Jahren
trägt die ÖVP die Verantwortung im Asyl- und Migrationsbereich.
Sie haben im Juni in einem
„ZIB 2“-Interview davon gesprochen, dass das
österreichische Asylsystem versagt hat und kaputt ist. Man kann Ihnen
anrechnen, dass Sie der erste Innenminister sind, der das Versagen der ÖVP
in diesem Bereich öffentlich zugegeben hat.
Darum stelle ich Ihnen folgende Frage:
„Herr Minister, welche Maßnahmen werden Sie setzen, um das kaputte Asylsystem, von dem Sie im Juni in der ZIB 2 gesprochen haben und das in Ihrer Ressortverantwortung liegt, zu reparieren?“
(Beifall bei der SPÖ.)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Bitte, Herr Bundesminister.
Bundesminister
für Inneres Mag. Gerhard Karner: Herr
Abgeordneter, vielen Dank für die Frage. Ich kann mich sehr gut an dieses
Interview in der
„ZIB 2“ erinnern. Viele können sich an dieses Interview
in der „ZIB 2“ erinnern, ich weiß das. (Abg. Einwallner:
Gott sei Dank!) Sie haben mir nur nicht ganz
genau zugehört, denn ich habe nicht vom kaputten Asylsystem gesprochen,
sondern sehr oft vom kaputten Schengensystem, und das nicht nur einmal.
Ich glaube, ich habe es sogar fünfmal erwähnt, weil ich danach
gefragt wurde.
Das Schengensystem ist ein
europäisches System, wie Sie wissen, Herr Abgeordneter. Ich gehe einmal
davon aus, dass sich die Frage auf das Asylsystem bezieht und nicht auf
das Schengensystem. (Abg. Einwallner: Ich habe
vom österreichischen Asylsystem gesprochen!) Daher schlage ich vor,
dass wir über das Asylsystem, für das ich in Österreich die
Verantwortung trage, sprechen. Wir haben zuvor sehr intensiv
diskutierte Fragen besprochen, nämlich was auf europäischer Ebene im
Asylsystem passieren muss, Stichwort Asyl-
und Migrationspakt. Ich konzentriere mich jetzt aber auf die nationale Ebene.
Ich gehe davon aus, dass das Ihre Frage wahrscheinlich beinhaltet oder meint,
denn man könnte es vermischen.
Österreich betreffend: Was
ist notwendig im Asylsystem? – Vernünftige, ordentliche
Kontrollen. Diese haben wir im letzten Jahr deutlich verstärkt, indem
wir Grenzpunkt- und auch Grenzraumkontrollen eingeführt haben. Wir haben
auch die Verfahren deutlich beschleunigt – das ist ebenfalls wichtig
für
ein vernünftiges, funktionierendes Asylsystem –, beispielsweise
die Schnellverfahren. Allein von Jänner bis Oktober dieses Jahres
wurden 7 200 sogenannte schnelle Verfahren für jene
Asylwerber, für die es aufgrund ihrer Landeszugehörigkeit
praktisch keine Chance auf Asyl gibt, durchgeführt.
Es wurde national ein Bündel an Maßnahmen gesetzt, um das System zu verbessern, weil wir im letzten Jahr gesehen haben, dass das österreichische Asyl-
system
über die Grenze der Belastbarkeit gekommen ist und Maßnahmen notwendig
waren, damit wir das Asylsystem für jene zur Verfügung stellen
können, die das System tatsächlich brauchen. Das haben wir, indem wir
vielen Menschen, vor allem Frauen und Kindern, aus der Ukraine geholfen haben
und nach wie vor helfen.
Präsident
Mag. Wolfgang Sobotka: Zusatzfrage, Herr
Abgeordneter? –
Bitte. (Abg. Kickl: Das hat aber nichts mit Asyl zu tun! –
Ruf bei der SPÖ: Die Frage wurde nicht beantwortet!)
Abgeordneter
Ing. Reinhold Einwallner (SPÖ): Na
ja, eine Zusatzfrage erübrigt sich eigentlich, Herr Präsident, weil
die Frage ja nicht wirklich beantwortet wurde. Also nehme ich zur
Kenntnis, dass der Herr Innenminister und die ÖVP offenbar keine
Lösungsvorschläge zu diesem Thema haben, und
ich habe daher keine Zusatzfrage. (Beifall bei der SPÖ.)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Die nächste Frage stellt Herr Abgeordneter Amesbauer. – Bitte.
Abgeordneter
Mag. Hannes Amesbauer, BA (FPÖ): Guten
Morgen, Herr Bundesminister! Wir alle wissen ja, dass unter Ihrer
Verantwortung, unter der türkis-grünen Bundesregierung ein
Missmanagement im Migrationsbereich vorherrscht. Mit
112 272 Asylanträgen im Jahr 2022 haben wir sogar ein
absolutes Rekordjahr gesehen. Auch heuer geht die Zahl der Asylanträge
in Österreich wieder durch die Decke. Mit über 50 000 Asylanträgen
heuer in Österreich ist das die dritthöchste Zahl an
Asylanträgen in den letzten 50 Jahren. Das muss man sich einmal auf
der Zunge zergehen lassen.
Die ÖVP spricht ja immer wieder von einer Asylbremse, die es, wie die
Zahlen ja beweisen, nicht gibt.
Meine Frage, Herr Bundesminister:
„Wie gedenken Sie Österreich und speziell das
Burgenland, das schon jetzt das ‚Lampedusa Mitteleuropas‘ genannt
wird, nach dem massiven Versagen
der Europäischen Union endlich vor dem Massenzustrom illegaler Migranten
zu schützen?“
(Abg. Zarits: Das ist ein Wahnsinn, die Frage!)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Bitte, Herr Bundesminister.
Bundesminister
für Inneres Mag. Gerhard Karner: Vielen
Dank für die Frage. Herr Abgeordneter, ich habe diesen Begriff noch nie so
gehört, erstmals
jetzt durch Ihre Worte. (Abg. Michael Hammer: Das hat ihm der Kickl
aufgeschrieben! – Abg. Kickl: Das ist aber gut!) Ich
halte diesen Begriff für nicht sehr zielführend, weil er den
Schleppern genau den Anreiz bieten würde (Zwischenruf bei der
ÖVP – Abg. Kickl: Traiskirchen könnte man auch
nehmen!) und man
ihnen so sagen würde: Hier hat man die Möglichkeit, zu
schleppen. – Daher würde ich Sie einfach bitten, Herr
Sicherheitssprecher, diesen Begriff so nicht
zu verwenden; ich halte das nicht für zielführend. (Abg. Michael Hammer:
Sie sind ja eine Sicherheitsrisikopartei!)
Sie haben aber recht – und darauf habe ich sehr,
sehr oft hingewiesen –:
Von den 112 000 Asylanträgen sind allein 75 000 in zwei
Bezirken im Burgenland gestellt worden, und zwar in den Bezirken Neusiedl
am See und Oberpullendorf – Sie wissen das. Daher haben wir im
letzten Jahr – ich wiederhole es – Maßnahmen
ergriffen, um diese Zahlen deutlich zu senken.
Ja, die Zahlen – auch da gebe ich Ihnen recht – sind mit
54 000 Anträgen von Jänner bis Oktober nach wie vor sehr, sehr
hoch.
Wir sehen aber auch, dass wir
im Gegensatz zum europäischen Trend
einen deutlichen Rückgang bei den Anträgen und auch bei den
Aufgriffen haben, von Jänner bis Oktober um 42 Prozent, und jetzt im
Oktober nochmals
einen deutlichen Rückgang um fast 50 Prozent. Also: nach wie vor
hoch, das
wiederhole ich. Das ist kein Grund zum Jubeln, das ist ein Auftrag,
in
dieser Richtung hart weiterzuarbeiten, und das ist unser Ziel. (Abg. Kickl:
Wie, das wäre die Frage gewesen!)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zusatzfrage, Herr Abgeordneter? – Bitte.
Abgeordneter
Mag. Hannes Amesbauer, BA (FPÖ): Ja,
eine Zusatzfrage:
Wie stellen Sie sich das konkret vor? Sie sagen immer wieder, Sie werden weiterhin
auf der Asylbremse stehen – wir sehen die Asylbremse überhaupt
nicht. In Wahrheit bräuchten wir bei diesen Zahlen einen völligen
Asylstopp, ein Aussetzen der Asylanträge.
Meine konkrete Frage wäre – Sie verweisen ja gerne auf
die EU, teilweise zu Recht, darauf, dass der Außengrenzschutz
nicht wirklich funktioniert –: Welche Maßnahmen setzen Sie
in Ihrem Wirkungsbereich auf nationalstaatlicher
Ebene, um der Situation Herr zu werden?
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Bitte, Herr Bundesminister.
Bundesminister
für Inneres Mag. Gerhard Karner: Auch
da haben Sie völlig recht mit dem, was Sie angesprochen haben, dass es da
ein Bündel an Maßnahmen braucht, zunächst auf
europäischer Ebene – das haben wir vorhin schon diskutiert oder
besprochen –, aber natürlich auch auf nationaler Ebene,
wo wir auch Maßnahmen gesetzt haben: mit den Grenzpunktkontrollen, mit
den Kontrollen direkt an der Grenze, und den Grenzraumkontrollen, das ist die
sogenannte Schleierfahndung, wie das im internationalen Sprachgebrauch auch
heißt. Beispielsweise gibt es auch die sogenannte Operation Fox, bei der
wir gemeinsam mit den ungarischen Kollegen auf ungarischem Boden sozusagen
Grenzkontrollen oder Grenzraumkontrollen durchführen.
Durch diese Maßnahmen ist es gelungen, die Routen der Schlepper massiv zu stören, und das war ein wesentlicher Punkt. Warum? – Die Asylantragszahlen und die Aufgriffszahlen sind in Österreich zurückgegangen, während sie
überall in den Nachbarländern – Deutschland, Italien – und in vielen anderen Ländern gestiegen sind, weil wir die Routen der Schlepper gestört haben. Das ist das klare Ziel bei diesen Maßnahmen.
Ich kann wiederholen: Wir haben auch die Verfahren deutlich beschleunigt. Auch das führt dazu, dass sich viele sehr rasch dem Verfahren entziehen und damit zurückkehren oder weiterreisen, sodass es insgesamt eine hohe, aber geringere Belastung als im letzten Jahr gibt.
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Die nächste Zusatzfrage stellt Abgeordneter Köllner. – Bitte sehr.
Abgeordneter
Maximilian Köllner, MA (SPÖ): Sehr
geehrter Herr Bundesminister! Über Begrifflichkeiten kann man
natürlich streiten. Ich würde aber
sehr wohl auch sagen, dass das Burgenland nach wie vor der Hotspot der internationalen
Schlepperkriminalität ist; Sie haben es selber angesprochen.
Der Bezirk Neusiedl am See und der Bezirk Oberpullendorf sind besonders betroffen.
Aufgrund Ihrer Zuständigkeit als Innenminister ist die burgenländische Bevölkerung
auch auf Ihre Taten angewiesen, aber sie ist es gleichzeitig leid, dass man
immer nur Worte hört und keine Taten sieht.
Wie wollen Sie also ganz
konkret und auch vor dem Hintergrund, dass
Ihr ungarischer Parteifreund Orbán immer wieder Schlepper auch
freilässt (Abg. Michael Hammer: Das ist dem Kickl sein Freund!),
die Schlepperkriminalität bekämpfen? Gibt es auch im Rahmen Ihres
Schengenstreits eine Einigung bezüglich Asylverfahrenszentren an den
EU-Außengrenzen? (Beifall bei der SPÖ.)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Bitte, Herr Bundesminister.
Bundesminister für Inneres Mag. Gerhard Karner: Herr Abgeordneter, Sie kommen ja aus dem Burgenland. Ich habe die Szenerie schon beschrieben, wie sie vor allem im letzten Jahr war, mit zum Teil dramatischen Zuständen in manchen Bezirken, in manchen Gemeinden – Deutschkreuz –; viele Gemeinden
waren
über Gebühr belastet. Wir sehen aber auch, dass es aktuell, in den
letzten Wochen, einen deutlichen Rückgang gibt.
Da bitte ich wirklich, dass wir an dieser
Stelle – und das möchte ich ausdrücklich tun –
vor allem den Kolleginnen und Kollegen der Landespolizeidirektion Burgenland,
vom Landespolizeidirektor bis hin zu all seinen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, ein großes Danke aussprechen. (Beifall bei Abgeordneten
der ÖVP.)
Was da im letzten Jahr und in diesen Tagen an Arbeit geleistet wird, ist sensationell. Das bitte ich Sie einfach mitzunehmen und, wenn Sie in diesen Tagen vor Weihnachten Gelegenheit dazu haben, die Polizei zu besuchen, diesen Dank an die Bediensteten weiterzugeben, denn sie haben sich diesen Dank redlich verdient. (Beifall bei Abgeordneten der ÖVP.)
Einen Satz noch: Ich glaube, das ist das Ziel, und es zeigt
sich – das wissen Sie auch, Herr
Abgeordneter, denn Sie kommen aus dem Burgenland –, dass
in den letzten Wochen die Aufgriffe Gott sei Dank deutlich
zurückgegangen sind. Es gab viele Tage, an denen wir null Aufgriffe
hatten, weil die Schlepperrouten sich völlig verändert
haben. – Vielen Dank.
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Die nächste Zusatzfrage stellt Abgeordneter Gödl. – Bitte.
Abgeordneter
Mag. Ernst Gödl (ÖVP): Herr
Bundesminister! Im Vergleich zum Vorjahr gehen heuer die Asylantragszahlen
tatsächlich stark zurück, also
die Asylbremse wirkt. Das hat vielerlei Gründe, einer davon ist, dass
beispielsweise unter einem Innenminister Kickl, der hier in der ersten
Reihe sitzt,
die Asylverfahren viele Mal so lange gedauert haben, über 21 Monate,
jetzt dauern sie nur mehr kurz, dreieinhalb Monate. (Zwischenruf der
Abg. Steger.)
Es gibt viele Gründe.
Einer der Gründe – den haben Sie schon
angesprochen – ist die Operation Fox. Die ist meines Wissens jetzt
ungefähr seit einem
Jahr im Einsatz. (Zwischenruf des Abg. Kickl.) In diesem
Zusammenhang wäre meine Frage an Sie, Herr Minister: Können Sie
eine Art Jahresbilanz legen?
Was hat diese Aktion gebracht? (Abg. Shetty: Was für eine
kritische Frage! – Abg. Scherak: Das wird eine kurze Antwort!)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Bitte, Herr Bundesminister.
Bundesminister
für Inneres Mag. Gerhard Karner: Sehr
gerne. – Die Operation Fox hat die Tätigkeit im
Dezember 2022 aufgenommen, nach diesen dramatisch hohen
Antragszahlen und Aufgriffszahlen vor allem im September, Oktober und
November des letzten Jahres. Daher haben wir Maßnahmen gesetzt. Die
Operation Fox war eine zentrale und wichtige, nämlich bereits vor der
österreichischen Staatsgrenze die Kontrollen zu intensivieren und zu
verstärken.
Wir haben mit dieser
Maßnahme – bei der aktuell knapp 40 Polizistinnen und
Polizisten von uns in Ungarn stationiert sind beziehungsweise aktuell
dort tätig sind – insgesamt 188 Schlepper gemeinsam mit
den ungarischen Kollegen aufgegriffen und damit, was ich gesagt habe, die
Routen der Schlepper massiv gestört – die Schlepper
reagieren sehr, sehr rasch auf derartige Maßnahmen –,
sodass sich die Schlepper andere Routen suchen und Österreich in vielen
Fällen umgehen, andere Länder wählen – was für
Europa nicht erfreulich ist; für Österreich aber ist es gut, dass die
Antragszahlen bei
uns zurückgegangen sind, wenngleich, ich wiederhole es noch einmal, auf
sehr hohem Niveau.
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Die nächste Anfrage stellt Abgeordneter Bürstmayr. – Bitte.
Abgeordneter Mag. Georg Bürstmayr (Grüne): Sehr geehrter Herr Bundesminister! Meine Frage:
„Bis wann soll das im Strategischen Maßnahmenplan gegen den Fachkräftemangel formulierte Ziel, das Verfahren zur Erteilung einer Rot-Weiß-Rot-Karte samt Familienzusammenführung vollständig zu digitalisieren, gänzlich vollzogen worden sein?“
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Bitte, Herr Bundesminister.
Bundesminister
für Inneres Mag. Gerhard Karner: Vielleicht
zu Beginn der Antwort eine Klarstellung – es ist mir wichtig, das zu
betonen, weil wir jetzt sehr viel über den Kampf gegen Schlepper,
über den Kampf gegen illegale Zuwanderung gesprochen
haben –: Es ist mir besonders wichtig, legale Zuwanderung
über die sogenannte Rot-Weiß-Rot-Karte, die natürlich
möglich sein
muss und bei der es auch klare Regeln geben muss, und den Kampf gegen die
illegale Zuwanderung auseinanderzuhalten.
Das wird in der öffentlichen Diskussion leider immer wieder vermischt, was dazu führt, dass Menschen Hoffnungen gemacht werden, die wir nicht erfüllen können – also klare Trennung: legale Zuwanderung und Kampf gegen illegale Zuwanderung.
Was die Rot-Weiß-Rot-Karte
und die Digitalisierung betrifft, so haben
wir mit der Datenbankanwendung für Niederlassung und Aufenthalt bereits
einen großen Digitalisierungsschritt vollzogen. Im Jahr 2022 wurden
alle Behörden an die bundesweite Datenbank angeschlossen, und die Botschaften
sind seit Beginn 2023 angebunden. Im nächsten Schritt erfolgt die Anbindung
des AMS.
Der Strategische Maßnahmenplan, den Sie in Ihrer Frage
angesprochen haben, wurde vor Kurzem, nämlich am 1. Dezember, im
Ministerrat beschlossen.
Wir sind auf einem guten Weg, auch diesen Teil mit der Rot-Weiß-Rot-Karte
zu digitalisieren. Staatssekretär Florian Tursky ist ja in diesem Bereich
sehr
initiativ und sehr fleißig, daher gehe ich davon aus, dass das auch bald
kommen wird.
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zusatzfrage? – Bitte.
Abgeordneter
Mag. Georg Bürstmayr (Grüne): Da
man sich von Digitalisierung im Allgemeinen Verwaltungsvereinfachung und
Ersparnis erhofft: Wie
hoch ist denn die geschätzte Summe der Einsparungen, die sich durch diese
digitalisierte Antragstellung für Ihr Ministerium ergibt?
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Bitte, Herr Bundesminister.
Bundesminister
für Inneres Mag. Gerhard Karner: Das
würde ich als Kaffeesudlesen bezeichnen, wenn ich jetzt schon
einschätzen könnte, wie viel
wir uns ersparen. Wir ersparen uns durch schnellere Verfahren sicherlich Zeit,
aber mittelfristig natürlich auch Geld.
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Die nächste Anfrage stellt Frau Abgeordnete Krisper. – Bitte.
Abgeordnete
Dr. Stephanie Krisper (NEOS): Sehr
geehrter Herr Innenminister! Österreich arbeitet ja unter den
ÖVP-Innenministern schon seit vielen
Jahren sehr intensiv gerade mit Staaten zusammen, die sich sehr unsolidarisch
in Sachen Asyl benehmen, nämlich zum Beispiel mit Griechenland und Ungarn.
Beide Länder behandeln Asylwerber derart schlecht – Ungarn ist
ja schon mehrfach verurteilt worden, weil es dort nicht einmal
möglich ist, einen Asylantrag zu stellen –,
sodass die Menschen natürlich weiterziehen, auch insbesondere zu uns.
Ich habe Ministerin Edtstadler einmal auf diese Thematik
angesprochen,
in einem Ausschuss vor dem Sommer, und sie hat gemeint, sie ist nicht meiner
Meinung, dass man deswegen bei der Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren
anregen sollte, denn das käme – Zitat – einer
Kriegserklärung gleich. Sie würde aber mit dem Vis-à-vis, mit
Ihren Amtskolleg:innen dieser Länder, sehr wohl ins Gespräch gehen.
Dementsprechend frage ich auch Sie, bei welchen Amtskolleg:innen wiederum aus Staaten, die bereits mehrmals – eben wie Griechenland und Ungarn – aufgrund von Rechtsbrüchen vom EuGH oder dem EGMR verurteilt wurden, Sie jeweils wann einen gesetzeskonformen Umgang im Sinne auch der Interessen Österreichs mit Asylwerber:innen gefordert haben.
*****
Die schriftlich eingebrachte Anfrage, 315/M, hat folgenden Wortlaut:
„Bei welchen Amtskolleg:innen aus Staaten, die bereits mehrmals aufgrund von Rechtsbrüchen durch den EuGH oder den EGMR verurteilt wurden – wie Griechenland und Ungarn – haben Sie jeweils wann einen gesetzeskonformen Umgang mit Asylwerber:innen eingefordert?“
*****
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Bitte, Herr Bundesminister.
Bundesminister für Inneres Mag. Gerhard Karner: Frau Abgeordnete, Sie haben es angesprochen: dass ich in intensivem Kontakt und immer wieder in intensivem Kontakt mit den Nachbarländern bin, aber natürlich auch auf europäischer Ebene bei den Ratssitzungen, bei denen wir diese Themen – Asyl und Migration – intensivst besprechen.
Vor wenigen Tagen tagte das sogenannte Forum Salzburg in
Slowenien, wenige Wochen davor
beispielsweise gab es ein Treffen mit meinen Amtskollegen
der Visegrádstaaten, mit Deutschland, wo wir all diese
Themen – und es sind vielfältige Themen, wie: Welche Fortschritte
machen wir im Asyl- und Migrationspakt?, Was ist notwendig, dass wir Schengen
funktionierend machen?, Wie können wir den Außengrenzschutz
verbessern? – bilateral, also zwischen den einzelnen
Ländern, multilateral, also auf unterschiedlichsten Ebenen, ansprechen und
auch immer wieder diskutieren.
Eines möchte ich an dieser
Stelle auch sehr klar sagen – da werden viele Dinge auch der
Öffentlichkeit präsentiert und öffentlich diskutiert, andere Dinge selbstverständlich
nicht, weil das auch eine Vertrauensbasis darstellt, die bei solchen
Gesprächen notwendig ist –: Bei diesen Gesprächen, bei
diesen
Treffen sehe ich mich nicht als Oberschiedsrichter – für mich
ist die Kommission die Hüterin der Verträge, auch das sei klar
angesprochen –, sondern als jemand, der die Interessen
Österreichs, die nationalen Interessen Österreichs, bei diesen
Treffen auch zu vertreten hat. Das ist meine Aufgabe und das
tue ich.
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zusatzfrage? – Bitte.
Abgeordnete
Dr. Stephanie Krisper (NEOS): Ich
wusste, ich muss keine vorbereiten, weil ich meine erste Frage wiederholen
muss. Ich würde schon
bitten, dass Sie mir darauf antworten, ob Sie zur Frage des Umgangs mit Asylwerbern im Sinne des Interesses Österreichs
auch in bilaterale Gespräche
gehen (kurz ohne Mikrofon weitersprechend) ..., auch dies
wäre möglich, wahrlich, aber zumindest bilateral. (Bundesminister Karner:
Entschuldigung, ich habe
Sie akustisch nicht verstanden!)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Ich muss immer die Mikros umschalten, darum bitte ich immer um ein bisschen Zeit, bis wir so weit sind.
Frau Abgeordnete, stellen Sie die Frage bitte noch einmal.
Abgeordnete
Dr. Stephanie Krisper (NEOS) (fortsetzend):
Ich wiederhole einfach meine Frage: ob Sie zum Thema Umgang mit Asylwerbern
im Sinne des Interesses Österreichs – dass dieser
rechtsstaatlich werden sollte – mit den entsprechenden
rechtsbrechenden Staaten ins Gespräch kommen. Es wäre
wichtig, es auch medial zu tun und zumindest hier zu bestätigen.
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Bitte, Herr
Bundesminister.
Bundesminister
für Inneres Mag. Gerhard Karner: Wenn
es Ihre Meinung ist, dass das medial zu tun ist, mag das sein. Ich halte es
für vernünftig, dass
man unter guten Nachbarn, unter guten Partnern die Dinge offen und ehrlich
anspricht und auch deutlich anspricht. Vor allem geht es mir darum,
unsere Interessen, die Interessen Österreichs, in diesem Bereich zu
vertreten. Das tue ich sehr klar, manches öffentlich, manches im
Vieraugengespräch. – Vielen Dank.
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Die nächste Anfrage stellt Abgeordnete Himmelbauer. – Bitte.
Abgeordnete Eva-Maria Himmelbauer, BSc (ÖVP): Die Steigerung der Rückkehr und die Verbesserung der Kooperation, der Zusammenarbeit mit Herkunftsstaaten gehört zu den Schwerpunkten des Bundesministeriums und von Ihnen als Innenminister. Erfolgreich kann man da die Vereinbarung beispielsweise mit Marokko oder auch Indien nennen.
Meine Frage:
„Im vergangenen Jahr konnten mehr als 12 000 Außerlandesbringungen durchgeführt werden, können Sie für das heurige Jahr aktuelle Zahlen nennen?“
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Bitte, Herr Bundesminister.
Bundesminister
für Inneres Mag. Gerhard Karner: Die
Statistik wurde, glaube ich, vor Kurzem durch das Innenministerium auch
veröffentlicht. Was
die Außerlandesbringungen betrifft: Es
waren insgesamt 10 478 Außerlandesbringungen.
Das ist eine Steigerung von 24,7 Prozent gegenüber
dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. 52 Prozent der angeordneten
Ausreisen erfolgten selbstständig, nämlich 5 496, und bei
48 Prozent, die außer
Landes gebracht wurden, erfolgte dies zwangsweise. Das ist wiederum eine Steigerung bei den Abschiebungen von 34,7 Prozent.
Da die Zahlen
sehr hoch waren, war es auch notwendig, mehr Menschen außer Landes
zu bringen.
Bei 45,2 Prozent der zwangsweisen Außerlandesbringungen lag auch eine strafrechtliche Verurteilung vor. Bis Ende Oktober erfolgten 42 Charterrückführungen in 13 Zieldestinationen, der größte Teil innerhalb Europas und ein anderer Teil eben in viele andere Staaten dieser Welt. Das ist das Ergebnis dieser Statistik.
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zusatzfrage? – Nein, keine Zusatzfrage.
Die nächste Frage stellt Herr Abgeordneter Ries. – Bitte.
Abgeordneter
Christian Ries (FPÖ): Herr
Bundesminister! Laut einer Anfragebeantwortung aus Ihrem Hause wurden im
Zeitraum von Januar bis September dieses Jahres 3 489 Personen
außer Landes gebracht. Ein
Großteil davon sind Bürger aus EU-Staaten. Abgeschoben werden
hauptsächlich Personen aus Osteuropa, die aber durch die Bank gar keine
Asylwerber
sind. Von den 3 489 durchgeführten Abschiebungen betrafen
1 032 slowakische Staatsbürger, dem gegenüber steht ein
slowakischer Asylantrag. Auf den
Plätzen folgen dann Ungarn, Polen und Rumänien.
Im selben Zeitraum haben 14 000 Syrer hier in Österreich einen Asylantrag gestellt, abgeschoben wurden ganze 25. Circa 6 000 Marokkaner haben Asyl begehrt, abgeschoben wurde kein einziger. (Zwischenruf des Abg. Lukas Hammer.)
Werter Herr Bundesminister, warum unternehmen Sie keinerlei Anstrengungen, nicht nur illegal aufhältige EU-Bürger, sondern auch illegal eingereiste und abgelehnte Asylwerber außer Landes zu bringen? (Beifall bei der FPÖ.)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Inneres Mag. Gerhard Karner: Sie haben die Statistik Jänner bis September gebracht, ich habe davor schon die Statistik Jänner bis Oktober skizziert (Zwischenruf der Abg. Belakowitsch), was die Außerlandesbringungen
betrifft.
Ich sehe das völlig wertfrei: Sie haben völlig recht, der
Großteil wird Richtung europäische Staaten außer Landes
gebracht. Sie wissen auch, dass wir in manche Staaten gar nicht abschieben
können. (Abg. Belakowitsch: Unternehmen Sie was dagegen!) Ich
habe das ja zuletzt auch immer wieder
bei den Europäischen Räten angesprochen, dass wir mittelfristig auch
darüber diskutieren sollten (Abg. Belakowitsch: ..., dann
brauchen Sie sie nachher
nicht abschieben!): Wie können wir beispielsweise wieder Richtung
Syrien, in die Region um Damaskus Menschen zurückbringen? (Abg. Kickl:
Schaut nach Abschiebebremse aus!) Wie diskutieren wir auch
Afghanistan – Taliban, beispielsweise, gibt es nicht die
Möglichkeit, die auch zurückzubringen? Die sind möglicherweise dort sicherer als hier. (Abg.
Belakowitsch: Na, gar nicht reinlassen!) Das
sind aber Diskussionen, die auf europäischer Ebene geführt werden
müssen.
Ich weiß, Sie sind ein
Experte, Sie kennen sich da aus, aber andere Möglichkeiten gibt
es rechtlich einfach nicht. Wir tun alles Menschenmögliche
(Abg. Kassegger: Null!), um möglichst viele außer
Landes zu bringen (Ruf bei der FPÖ: Aber nicht sehr erfolgreich!), vor
allem natürlich diejenigen, die straffällig geworden sind.
Ich denke, die Zahlen sprechen wertfrei für sich (Abg. Belakowitsch:
Ja, die sprechen für sich! Leider!), und auf diesem Weg müssen
wir auch weiterarbeiten und werden wir auch sehr intensiv weiterarbeiten. (Beifall
bei der ÖVP.)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Die nächste Frage stellt Abgeordnete Kucharowits. – Bitte.
Abgeordnete Katharina
Kucharowits (SPÖ): Herr
Bundesminister! Sie haben mir diese Woche eine parlamentarische Anfrage zum
Thema „Abschiebungen
von Kurd:innen in die Türkei“ beantwortet. Darin sagen Sie, es
gäbe keine genauen Statistiken zu
Abschiebungen von Kurd:innen in die Türkei. Gleichzeitig behaupten
Sie aber in derselben Beantwortung, dass jede Abschiebung einer
Einzelfallprüfung unterzogen werden würde.
Wie erklären Sie dann, dass
Sie angeblich keine Statistiken führen? (Beifall
bei der SPÖ.)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister
für Inneres Mag. Gerhard Karner: Also
ich denke, dass das Innenministerium sehr viele, sehr umfangreiche Statistiken
führt, und Sie haben natürlich völlig recht, dass jedes
Asylverfahren auch im Einzelfall geprüft
werden muss. Das ist ja der große Unterschied beispielsweise zur
Vertriebenenrichtlinie, die auf europäischer Ebene aufgrund des
Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine eingeführt wurde, bei der es
keine Einzelfallprüfung gibt.
In diesen Fällen gibt es
eben klarerweise die Einzelfallprüfungen, und klarerweise gibt es auch sehr viele umfangreiche Statistiken,
die auch auf der Homepage
des Innenministeriums einsehbar sind. Ich habe jetzt auch Teile dieser
Statistik – mit den Rückflügen, mit den
Außerlandesbringungen – präsentiert. Auch
über die Nationalitäten gibt es umfangreichste Statistiken, aber aus
Schutz für den Einzelnen wird natürlich nicht auf den
Einzelfall – und ich gehe davon
aus, dass Sie das meinen –, aus Schutz für den Einzelnen kann
in dieser Befragung nicht auf den einzelnen Fall eingegangen werden; ich
nehme an,
dass Sie diesen Fall meinen. (Abg. Kucharowits – auf dem
Weg zu ihrem Sitzplatz in Richtung Bundesminister Karner –: Da
gibt’s Statistiken, die Sie mit Passwort versehen!)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Die nächste Anfrage stellt Frau Abgeordnete Schatz. – Bitte.
Abgeordnete
Sabine Schatz (SPÖ): Guten Morgen,
Herr Bundesminister!
Ich gehe weg von dem Themenkomplex Asyl und gehe zu einem anderen aktuell
brennenden Thema: Seit dem Terroranschlag der Hamas auf Israel und
dem Konflikt im Nahen Osten vernehmen wir auch in Österreich einen
massiven Anstieg von antisemitischen, aber auch antimuslimischen
Tatbeständen. –
Herr Bundesminister, was machen Sie, um dem entgegenzuwirken?
*****
Die schriftlich eingebrachte Anfrage, 302/M, hat folgenden Wortlaut:
„Mit dem
Terrorangriff der Hamas auf Israel und den militärischen
Gegenschlägen auf den Gazastreifen sind in Österreich die Meldungen
von antisemitischen, aber
auch von antimuslimischen Tatbeständen massiv in die Höhe
gegangen – wie gedenken Sie darauf zu reagieren?“
*****
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister
für Inneres Mag. Gerhard Karner: Ja,
Frau Abgeordnete, Sie haben völlig recht, seit dem 7. Oktober,
seit diesem abscheulichen Angriff
der Hamas auf die israelische Bevölkerung, hat sich in der Tat auf der
ganzen Welt, in Europa, aber auch in Österreich einiges verändert und
diese antisemitischen Vorfälle haben massiv zugenommen.
Was haben wir in
Österreich getan? – Unmittelbar danach haben wir die sichtbare,
aber auch die verdeckte Präsenz erhöht und waren und sind vor allem
in engster Abstimmung mit der Israelitischen Kultusgemeinde, mit dem Präsidenten,
mit den Sicherheitsverantwortlichen – vor allem durch die Landespolizeidirektion
Wien, aber auch durch die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst.
Auch ich persönlich halte intensiven Kontakt mit dem Präsidenten der
IKG in Wien, aber auch in Graz und Salzburg, auch mit Elie Rosen.
Ich glaube, es ist ganz
wichtig, dass wir so eine Situation – und das war
so, ist aktuell nicht mehr so –, in der jüdische Kinder nur zu
11 Prozent in Schule und Kindergarten gegangen sind, weil sie Sorgen und
Ängste hatten, nicht tolerieren können! Da muss man alles
Menschenmögliche unternehmen, dass sie das wieder tun können.
Durch intensivste Maßnahmen – ich habe es gesagt: polizeiliche Präsenz sichtbar erhöhen, was ein Sicherheitsgefühl gibt, obwohl die verdeckte Präsenz oft erfolgreicher ist, um die Sicherheit zu gewährleisten – haben wir viele Bereiche
verändert, beispielsweise haben wir auch die Terrorwarnstufe von 3 auf 4 erhöht – also ein umfangreiches Maßnahmenpaket, das notwendig war und ist, weil wir sehen, dass sich die Bedrohungslage seit dem 7. Oktober weltweit, in Europa, aber auch in Österreich verändert hat.
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zusatzfrage, Frau Abgeordnete?
Abgeordnete
Sabine Schatz (SPÖ): Sie und auch
der Direktor der DSN verweisen immer auf die zusätzlichen Gefahren im
Extremismusbereich, im Themenbereich Rechtsextremismus. Es gibt im
nächsten Jahr den Rechtsextremismusbericht mit zwei Jahren
Verzögerung nach den Ausschreibungspannen, wir warten aber
auch seit zweieinhalb Jahren – nach dem Beschluss hier im Hohen
Haus – auf den Nationalen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus,
in dem ja auch spezielle Maßnahmen gegen Antisemitismus vorgesehen sein sollen.
Ich wollte fragen, Herr Bundesminister: Können wir noch in dieser Legislaturperiode mit diesem Aktionsplan rechnen?
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister
für Inneres Mag. Gerhard Karner: Was
den Rechtsextremismusbericht und Ausschreibungspannen betrifft, Frau
Abgeordnete, würde ich das so nicht sehen, weil wir
dafür verantwortlich sind und auch dem Parlament zu Recht
Rechenschaft schuldig sind, dass Ausschreibungen korrekt durchgeführt
werden. Darauf haben wir, das Innenministerium, klarerweise bestanden, und
daher kam es zu einer neuerlichen Ausschreibung, weil
die erste Phase nicht so durchgeführt worden war, dass es eben
rechtskonform gewesen wäre. Daher haben wir – leider, sage
ich – diese Zeitverzögerung. Sie haben recht,
dieser Rechtsextremismusbericht wird im nächsten Jahr auch entsprechend
vorgelegt werden.
Ich gehe davon aus, dass wir auch im Nationalen Aktionsplan,
wo wir ja
schon viele Schritte gesetzt haben, weitere Schritte gegen Rechtsextremismus
setzen werden.
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Die nächste Zusatzfrage stellt Abgeordnete Deckenbacher. – Bitte.
Abgeordnete Mag.
Romana Deckenbacher (ÖVP): Guten
Morgen, Herr Minister! Kollegin Schatz hat es schon angesprochen,
antisemitische, rassistische Vorfälle nehmen seit dem
Terrorangriff der Hamas weltweit, aber auch in Österreich zu. Es wurde vor
einigen Tagen auch ein konkreter Anschlagsplan eines
16-Jährigen gestoppt, der sich dem
Islamischen Staat anschließen wollte. Die Kolleginnen und
Kollegen des Staatsschutzes und des Nachrichtendienstes
leisten da ungemein wertvolle und wichtige Arbeit.
Gibt es weitere strukturelle Änderungen, die Sie setzen, um diesen Herausforderungen auch gerecht zu werden?
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister
für Inneres Mag. Gerhard Karner: Zunächst
gilt mein Dank der DSN, der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, die
vor ziemlich
genau zwei Jahren ihre Arbeit aufgenommen hat. Diese ist besonders in diesem
Jahr in unterschiedlichen Bereichen, vor allem im Bereich des islamistischen Extremismus,
Gott sei Dank sehr, sehr erfolgreich.
Frau Abgeordnete, Sie haben es angesprochen: Ich erinnere an
die Regenbogenparade, bei der drei junge Männer – 14, 17
und 20 Jahre – festgenommen wurden. Ich erinnere an
den Hauptbahnhof, wo es eine Festnahme und auch eine Gefährdungsszenerie
gab. Zuletzt wurde vor wenigen Tagen in
Steyr ein 16-jähriger österreichischer Staatsbürger mit
türkischem Migrationshintergrund festgenommen, weil er konkrete
Anschlagsplanungen hegte.
Daher an dieser Stelle mein Dank für diese exzellente Arbeit, auch für die wiedergewonnene internationale Vernetzung, die besonders in diesem Bereich ganz entscheidend ist, weil es auch aufgrund von internationalen Hinweisen zu der einen oder anderen Festnahme, die ich skizziert habe, kam. Daher werden wir diesen Weg auch weitergehen und diese Form des
Staatsschutzes, wie wir sie in der Direktion haben, auch auf Länderebene mit den sogenannten Landesämtern für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung weiterentwickeln.
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Die nächste Anfrage stellt Abgeordneter Herbert. – Bitte sehr.
Abgeordneter
Werner Herbert (FPÖ): Herr
Präsident! Herr Bundesminister! In jüngster Vergangenheit ist es
wieder verstärkt vorgekommen, dass die Arbeit und das
Einschreiten der Polizei, insbesondere im Zusammenhang mit dem Vorgehen gegen
die sogenannten Klimakleber, die ja die Bevölkerung mit
ihren Maßnahmen in einer unzumutbaren Art und Weise terrorisieren,
negativ und abschätzig, teilweise auch verfälscht dargestellt wurden.
Daher meine Frage:
„Wie werden Sie künftig den Schutz der Persönlichkeitsrechte von Exekutivbeamten in Bezug auf unangemessene oder diskriminierende Veröffentlichungen in sozialen Medien sicherstellen?“
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister
für Inneres Mag. Gerhard Karner: Herr
Abgeordneter, ich möchte Ihre Frage nutzen, um mich bei Ihnen,
nämlich nicht nur bei
Ihnen, sondern bei der gesamten Personalvertretung im Bereich der Polizei, im
Bereich des Innenministeriums, wirklich bei allen Fraktionen zu bedanken,
weil wir besonders in diesem Jahr sehr intensive und sehr konstruktive
Gespräche in vielen Bereichen hatten. Es ging darum, dass wir die
Personaloffensive gestartet und intensiviert haben und auch
fortsetzen werden, wobei es Diskussionen in unterschiedlichsten Bereichen gab.
Der persönliche
Schutz der Kolleginnen und Kollegen ist allen in der
Personalvertretung – das ist auch ihre zentrale Aufgabe –
ein zentrales und wesentliches Anliegen.
Sie haben völlig recht, es
ist notwendig, dass wir die Kolleginnen und Kollegen noch besser schützen
und sie auf ihre Rechte hinweisen. Das wird in
vielen Bereichen getan, wir haben beispielsweise das sogenannte E-Learning-Tool
Recht am eigenen Bild ins Leben gerufen, und da bitte ich auch
die Personalvertretung, dass sie mitmacht und aufzeigt, was da notwendig ist.
Ich möchte aber auch auf
ein Beispiel hinweisen, das ich sehr gerne erwähne, weil es sehr
effektiv ist, nämlich auf die sogenannten Körperkameras, von denen es
aktuell 370 gibt, die vor allem in Wien im Einsatz sind
und österreichweit ausgerollt werden. Bis Ende nächsten,
spätestens Anfang übernächsten Jahres werden zusätzlich
3 000 solcher Körperkameras angeschafft, um zum Eigenschutz der
Kolleginnen und Kollegen mitfilmen zu können, weil mittlerweile sehr oft
durch Smartphonevideos sehr rasch
verkürzte Sequenzen dargestellt werden, in denen der Beamte, die Beamtin
möglicherweise in ein völlig verzerrtes oder gar falsches Bild
gerückt wird.
Ich glaube, all das sind ganz entscheidende Maßnahmen, damit unsere Kolleginnen und Kollegen für die so schwierige Arbeit – Sie haben es angesprochen: Klimakleberdemos, Hamas-verherrlichende Aktionen, die es zum Teil gegeben hat, ganz schwierige, sensible Situationen im Bereich der Demonstrationen und Kundgebungen – das richtige Handwerkszeug haben, um für die Sicherheit der Menschen zu sorgen.
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zusatzfrage, Herr Abgeordneter?
Abgeordneter Werner Herbert (FPÖ): Ich darf mich eingangs für das Lob und die Wertschätzung der Personalvertretung bedanken.
Meine Zusatzfrage geht in eine ähnliche Richtung, allerdings in ein anderes Segment, nämlich: Auch in den sogenannten Qualitätsmedien findet man immer wieder interessante Artikel, so gelesen am 9.12. in der Zeitschrift „Österreich“, in der unter dem Titel „Hilferuf an ÖVP-Sobotkas Büro“ ein Artikel über
das Ableben des ehemaligen Sektionschefs Pilnacek dargestellt
wurde,
in dem auch festgestellt wurde, dass Fremdverschulden laut Obduktion ausgeschlossen
wird.
Interessant an diesem Artikel ist aber, dass der Akt beim Geheimdienstchef liegt. Daher würde mich interessieren: Warum ist das so und was sind die Umstände dafür, dass die DSN in diese Sache eingebunden wurde?
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Bitte, Herr Bundesminister.
Bundesminister
für Inneres Mag. Gerhard Karner: Ich
würde Sie bitten, die Frage etwas zu präzisieren, aber ich gehe davon
aus und weiß, dass die Direktion für Staatsschutz und
Nachrichtendienst auch in der Öffentlichkeitsarbeit
nach bestem Wissen und Gewissen ihre Aufgabe macht und es natürlich auch
Geheimdienstinformationen sind, mit denen besonders sensibel umgegangen werden
muss; und das tut die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst.
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Eine Zusatzfrage ist noch eingemeldet. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Werner Herbert (FPÖ): Ich darf noch einmal vertiefend nachfragen: Es ist ungewöhnlich, dass beim Ableben eines Sektionschefs, wie es in der Öffentlichkeit dargestellt wird, gleich der Staatsschutz auf den Plan gerufen wird. Warum ist das so?
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister
für Inneres Mag. Gerhard Karner: Ich
gehe davon aus, und das wissen Sie ja, da Sie ein erfahrener Polizist sind,
dass in bestimmten Fällen
auch die entsprechenden Stellen eingebunden werden und dass das auch in dem von
Ihnen genannten konkreten Fall so war.
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Die nächste Anfrage stellt Frau Abgeordnete El-Nagashi. – Bitte, Frau
Abgeordnete.
Abgeordnete Mag.
Faika El-Nagashi (Grüne): Guten
Morgen, Herr Innenminister! Wir müssen nun über Rassismus und
insbesondere über antimuslimischen Rassismus sprechen. Wir
wissen nicht zuletzt durch den Hatecrime-Lagebericht, dass Religion eines
der häufigsten, nämlich eines der drei häufigsten Vorurteilsmotive
bei Hassverbrechen ist, und zwar sowohl gegen Christen und Christinnen als auch
gegen Musliminnen und Muslime und gegen
Jüdinnen und Juden.
Im Lichte dessen muss ich noch einmal die Frage, die Kollegin Schatz auch schon angesprochen hat, stellen:
„Wie beurteilen Sie die Anstiege von gewaltsamen
Hassverbrechen seit
dem 7. Oktober im Bereich des Anti-Semitismus und Anti-Muslimischen Rassismus?“
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister
für Inneres Mag. Gerhard Karner: Wenn
Sie mich nach meiner Einschätzung und nach meiner Beurteilung fragen, dann
sage ich, dass
das natürlich besorgniserregend und auf das Schärfste zu verurteilen
ist und auch entsprechende Maßnahmen zu ergreifen sind. Das haben wir ja
in
vielen Bereichen auch getan.
Ich halte es zum Beispiel
auch für sehr sinnvoll, dass gerade der Bundeskanzler – ich
bedanke mich diesbezüglich auch bei ihm – nach dem
7. Oktober das Gespräch mit den Religionsgemeinschaften gesucht hat,
um da wirklich einen Ausgleich zu finden, dass versucht wurde, in dieser
Stimmung, die seit
dem 7. Oktober in manchen Bereichen herrscht – Sie kennen die
Bilder von manchen Kundgebungen, bei denen bewusst versucht wurde,
aufzuheizen –, einen Ausgleich herbeizuführen, um
dagegenzuhalten und nicht etwas aufkommen zu lassen, was wir leider in anderen
europäischen
Ländern sehen mussten.
Wenn ich bedenke, dass nach dem
7. Oktober bei Kundgebungen in Berlin über 60 Polizisten
verletzt wurden, es verletzte Demonstranten gab, so sehe
ich, dass wir das in Österreich Gott sei Dank nicht gehabt haben, weil man
hier durch die Exekutive, durch die Politik, durch die Glaubensgemeinschaften wirklich
versucht hat – man hat es nicht nur versucht, sondern man hat es
getan –, da einen möglichst guten Ausgleich zu finden.
Ja, das Thema Hatecrime, Hassverbrechen, ist
ein wichtiger Punkt, und
Sie wissen, dass wir da ja auch gemäß dem Regierungsprogramm Akzente
setzen wollen und auch werden und dass seit dem 1.11.2020 systematisch Vorurteilsmotive
aufgelistet werden, um da klar anzusprechen, was sie sind, nämlich dass
aus rassistischen oder aus Glaubensgründen Menschen verurteilt
werden und Hassverbrechen begangen werden.
Präsident
Mag. Wolfgang Sobotka: Zusatzfrage? –
Bitte, Frau Abgeordnete
El-Nagashi.
Abgeordnete Mag. Faika El-Nagashi (Grüne): Sie haben die Maßnahmen angesprochen; ich möchte noch einmal den antimuslimischen Rassismus ansprechen. Wir sehen zwischen dem Hatecrime-Lagebericht 2021 und jenem über das Jahr 2022 einen Anstieg von Hassverbrechen um 7 Prozent, aufgeschlüsselt in neun Kategorien – wie gesagt, Religion ist das dritthäufigste Motiv.
Welche Maßnahmen setzen Sie konkret, um Hassverbrechen zu bekämpfen, insbesondere im Bereich des antimuslimischen Rassismus?
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Bitte, Herr Bundesminister.
Bundesminister für Inneres Mag. Gerhard
Karner: Also ich meine,
dass da bereits unterschiedlichste Maßnahmen gesetzt wurden. Ich kann nur
wiederholen, dass wir in einem intensiven Dialog mit den Glaubensgemeinschaften
sind, mit den unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften.
Auch die Radikalisierung über das Internet, sage ich einmal, ist ein
Punkt, der uns
besonders beschäftigt, daher haben wir auch einen
Aktionsplan im Bereich Fakenews, Deepfakes gemeinsam mit der Justizministerin
auf den
Weg gebracht. Das alles sind laufende Maßnahmen.
Auch in der
Prävention tun wir sehr viel. Ich darf da hervorheben, dass ich zuletzt
gemeinsam mit dem Bildungsminister ein Projekt vorgestellt habe,
bei dem wir auch über den Staatsschutz in die Schulen gehen, bei dem wir
auch Jugendlichen bewusst machen, was sie da tun – vielen
Jugendlichen ist manchmal nämlich gar nicht bewusst, dass sie, wenn sie
gewisse Sharepics, oder wie man das nennt, teilen und weiterschicken, damit auch
ein Hassverbrechen begehen.
Ich glaube also, es
ist wirklich vieles von vielen zu tun – nicht nur im polizeilichen,
auch im Bildungsbereich, an unterschiedlichsten Stellen, und auch
wir als Politik sind gefordert, da Akzente zu setzen.
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Die nächste Zusatzfrage stellt Herr Abgeordnete Lindner. – Bitte.
Abgeordneter
Mario Lindner (SPÖ): Guten Morgen, Herr Bundesminister! Die letzten Jahre haben ja insgesamt eine massive
Welle an Hasskriminalität
in Österreich verursacht. Von den 6 779 Anzeigen im
Jahr 2022 waren Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung,
ihrer Hautfarbe, ihrer Weltanschauung, ihrer Religion oder auch ihres
sozialen Status betroffen. Wir
wissen, dass die Zahlen seit dem Bericht von Quartal zu Quartal steigen. Die
Dunkelziffer dürfte um ein Zehnfaches höher sein – das
sagt zumindest
eine Studie aus Deutschland.
Seit Jahren fordern die Zivilgesellschaft und Expertinnen
und Experten von der Bundesregierung einen Nationalen Aktionsplan gegen
Hasskriminalität,
die Regierung bleibt aber untätig.
Welche konkreten neuen Schritte werden Sie in dieser Legislaturperiode noch setzen, um sowohl der Hasskriminalität entgegenzutreten als auch die massive Dunkelziffer der nicht angezeigten Hatecrimes zu senken?
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Bitte, Herr Bundesminister.
Bundesminister für Inneres Mag. Gerhard
Karner: Herr Abgeordneter, es ist schade, dass Sie das, was da geschehen
ist – und es ist viel passiert, aber
es sind weitere Maßnahmen notwendig –, so sehen, dass
Sie das als Untätigkeit bezeichnen. Es obliegt aber Ihnen, das so zu
beurteilen.
Ich möchte als nur ein
Beispiel einen polizeilichen Bereich herausgreifen,
den ich auch in diesem Zusammenhang für besonders wichtig halte,
nämlich die sogenannte Kriminaldienstreform. Das mag aus Ihrer Sicht jetzt
damit nicht unmittelbar etwas zu tun haben, aber Sie wissen auch, Herr
Abgeordneter, dass gerade diese Steigerungen sehr intensiv mit den Delikten,
mit den Aktionen
in sozialen Netzwerken zu tun haben – sprich: Cybercrimedelikte,
Hassverbrechen im Netz, Hatecrime. Es gibt – Sie erinnern sich
sicher an diesen tragischen Fall Kellermayr –
unterschiedlichste Bereiche. Diese Delikte finden vor allem auch im Netz statt,
daher müssen wir auch im Netz verstärkt polizeiliche Maßnahmen
setzen.
Die Kriminaldienstreform hat als eines ihrer Ziele, die Expertinnen und Experten beziehungsweise die Polizei in diesem Bereich
stärker und intensiver auszubilden und dass wir stärker in
die Regionen kommen. Wir haben exzellente Expertise im Bundeskriminalamt, zum
Teil auch in einzelnen Bezirken,
aber das muss jetzt strukturiert werden, damit, wenn so etwas passiert, die Bevölkerung
einerseits sehr rasch und direkt – wenn Sie so wollen –
zur
nächsten Polizeiinspektion gehen kann und dass dann mit den Experten in
den Landeskriminalämtern beziehungsweise in den neu zu schaffenden sogenannten Assistenzdienststellen
auch Maßnahmen ergriffen werden können, damit man das sehr
rasch wieder abstellen kann.
Diese
Ermittlungen sind schwierig genug, weil sie international stattfinden, aber da
bitte ich einfach darum – vielleicht haben Sie einmal
Gelegenheit –,
dass wir das auch intensiver erläutern. Wenn Sie aber sagen, dass wir
untätig waren, muss ich Ihnen entgegenhalten, dass auch in diesem Bereich
sehr
vieles passiert ist.
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Die nächste Anfrage stellt Herr Abgeordneter Brandstätter. – Bitte.
Abgeordneter
Dr. Helmut Brandstätter (NEOS): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Das Verwirrspiel um Schengen
geht weiter. Sie haben heute wieder vom kaputten Schengensystem gesprochen;
gleichzeitig haben
Sie vor wenigen Tagen gesagt, es soll ein Schengen light, ein Schengen air oder
so etwas für Rumänien und Bulgarien geben. Gleichzeitig weiß
ich,
dass der Schaden für Österreich immer größer wird und auch
österreichische Unternehmen bei Ihnen vorstellig werden, weil sie wissen,
wie sehr uns
das schadet – unseren Unternehmen, die dort ja viel investiert
haben, aber auch den Menschen hier, die Pflegerinnen und Pfleger brauchen.
Da sich
überhaupt niemand mehr auskennt, ist mir jetzt auch wieder eine Frage ganz
klar eingefallen, nämlich: Haben Sie die Bedingungen, die Sie jetzt
stellen, auch bei der Zustimmung zu Kroatien gestellt, beziehungsweise welche
Bedingungen haben Sie eigentlich bei Kroatien gestellt und welche Bedingungen haben
Sie den Ungarn gestellt, dass sie bei Schengen bleiben dürfen, obwohl
sie sich nicht daran halten?
*****
Die schriftlich eingebrachte Anfrage, 316/M, hat folgenden Wortlaut:
„Welche Bedingungen wurden für die Schengen-Aufnahme von Kroatien gestellt?“
*****
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Bitte, Herr Bundesminister.
Bundesminister für Inneres Mag. Gerhard Karner: Das waren jetzt drei Fragen. Ich werde trotzdem versuchen (Abg. Brandstätter: Danke!), diese drei Fragen für Sie als eine zu interpretieren (Abg. Brandstätter: Danke!) und daraus eine Antwort zu skizzieren. (Abg. Brandstätter: Na, nicht interpretieren, beantworten!) Ich werde versuchen, auf drei gestellte Fragen eine Antwort zu geben. (Abg. Brandstätter: Gut!)
Aus meiner Sicht ist eine Schengenerweiterung ein zweistufiges
Verfahren. Warum ein zweistufiges Verfahren? – Zunächst
gibt es den Statusbericht durch die zuständige EU-Kommission, die
feststellt, welchen Status ein Land im Zusammenhang mit einer möglichen
Schengenerweiterung hat – erste Stufe. Die zweite Stufe umfasst eine
Beratung und Schlussfolgerung auch im Rat –
das ist vorgesehen –, einen einstimmigen Beschluss im Rat der
Innenminister darüber, ob ein Land zu Schengen dazukommt oder nicht.
Faktum ist auch –
das möchte ich jetzt auch noch sagen, weil ich gesagt
habe, dass Schengen kaputt ist –, und ich glaube, Sie
stimmen mit mir da vollkommen überein und Sie sehen das
wahrscheinlich auch so: Wir haben derzeit in elf europäischen Ländern
des Schengenraums Grenzkontrollen, das heißt, 70 Prozent der
europäischen Bevölkerung in diesen Ländern haben derzeit Binnenkontrollen, und das beschreibt den Zustand
für Schengen wohl leider –
ich sage das bewusst dazu:
leider! – am besten. (Abg. Stöger: Dann machts es
net!) – Das wird gemacht – weil ich diesen Zwischenruf
gehört habe –,
weil es eben notwendig ist; nicht aus Jux und Tollerei, sondern weil die Zahlen
so aussehen, wie sie aussehen.
Wir haben zu Beginn sehr intensiv über das Asyl- und Migrationsthema diskutiert. Wir haben seit dem 7. Oktober sehr intensiv darüber diskutiert, wie wir auch Radikalisierte wieder in ihre Länder zurückbringen. Es ist aus Sicherheitsgründen einfach notwendig, dass wir die Kontrollen durchführen.
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zusatzfrage? – Bitte.
Abgeordneter Dr. Helmut Brandstätter
(NEOS): Na ja, Entschuldigung! Moment! Es
wurde ja gar keine Frage beantwortet, weil die ganz konkrete Frage
war: Welche Bedingungen wurden an Kroatien gestellt? Wenn Schengen kaputt ist,
warum hat man dann Kroatien hereingelassen? Und gibt es eigentlich
im Innenministerium Berechnungen, wie groß der Schaden für
österreichische Unternehmen bereits ist?
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Bitte, Herr Bundesminister.
Bundesminister für Inneres Mag. Gerhard Karner: Das sind wieder zwei Fragen, und ich werde wieder versuchen, auf beide eine Antwort zu formulieren.
Zweistufiges
Verfahren – erstens: Statusbericht der Kommission; zweitens: Beratungen
der Innenminister. Bei diesen Beratungen im letzten Jahr war
klar, dass der Großteil der illegalen Migration über die sogenannte
Westbalkanroute – das heißt Rumänien, Bulgarien,
Ungarn –, also über diesen Bereich
und nicht direkt über den Süden kommt.
Die Situation hat sich jetzt in
vielen Bereichen geändert: Wir sehen,
dass der Druck aus dem Süden stärker wird, weil die Schlepper eben
ihre
Routen geändert haben.
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Ich darf darauf aufmerksam machen, dass nach
§ 95 Abs. 1 der Geschäftsordnung jede Frage nur aus einer
Frage
bestehen darf. Ich war ein bisschen tolerant, ich würde aber bitten, dass
man wieder auf dieses Regime zurückkommt.
Die nächste Zusatzfrage stellt Herr Abgeordneter Minnich. – Bitte.
Abgeordneter
Andreas Minnich (ÖVP): Guten
Morgen, Herr Bundesminister! Sie haben in den Medien mehrmals betont, dass das Schengensystem so nicht
mehr funktioniert. Was muss Ihrer Ansicht nach getan werden oder
gemacht werden, damit das Schengensystem wieder funktionstüchtig gemacht wird?
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Bitte, Herr Bundesminister.
Bundesminister
für Inneres Mag. Gerhard Karner: Die
Reisefreiheit war und ist eine der großen Errungenschaften dieser
Europäischen Union. Aufgrund
der Situation, der Sicherheitssituation in den einzelnen Mitgliedsländern,
hat sich das eben leider dramatisch verändert, und in vielen Ländern
mussten wieder Binnengrenzkontrollen eingeführt werden.
Wir haben diese schon seit längerer Zeit Richtung
Ungarn und Slowenien
und haben zuletzt, weil Deutschland Richtung Österreich, Richtung
Tschechien und Richtung Polen kontrolliert, auch in Österreich die
Grenzpunktkontrollen an den Grenzen zur Slowakei und zu
Tschechien wieder eingeführt – leider –, weil es
einfach notwendig ist, weil wir darauf reagieren müssen und nicht
zur Ausweichroute für Schlepper werden dürfen.
Was ist notwendig, damit das wieder
funktioniert? – Das ist völlig klar – und ich
glaube, da sind wir uns Gott sei Dank einig, ich kenne dazu Stellungnahmen
von allen Parteien aus diesem Haus –: ein robuster oder besser
gesagt ein funktionierender Außengrenzschutz, im Zuge dessen an der
Außengrenze festgestellt werden kann, wer das Recht hat, legal
nach Europa zu reisen, und wer eben nicht. Wenn es diesen gibt, ist es auch
wieder möglich, sich innerhalb dieses Raumes frei zu bewegen.
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Die nächste Frage stellt Abgeordneter Gerstl. – Bitte.
Abgeordneter Mag. Wolfgang Gerstl (ÖVP): Herr Bundesminister! Ich habe mir die Entwicklung der Gesamtkriminalität in den letzten zehn Jahren angesehen. Dabei ist mir besonders aufgefallen, dass es in der Zeit des einzigen Innenministers der Zweiten Republik, der wegen Gefährdung verfassungsmäßiger Einrichtungen vom Bundespräsidenten entlassen wurde, nämlich unter
Innenminister Kickl (Abg. Amesbauer: Das steht aber nicht in der Begründung! Was reden Sie schon wieder für einen Topfen in aller Früh?), die höchste Zahl an Tatverdächtigen, nämlich 2018/19 fast 600 000, gab.
Kommen wir aber in die Jetztzeit: Jetzt ist es so, dass die Gesamtkriminalität niedriger als in den ersten fünf Jahren der letzten Zehnjahresperiode ist; der Wert liegt unter 500 000. Es fällt dabei besonders auf, dass die Eigentumskriminalität rückgängig ist, die organisierte Kriminalität rückläufig ist, dass aber die Gewaltkriminalität und vor allem die Wirtschaftskriminalität steigen, dass besonders die Internetkriminalität ganz stark steigt, insbesondere Cybercrime mit 44,5 Prozent.
„Was wurde getan, um neue Kriminalitätsformen bekämpfen zu können?“
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Bitte, Herr Bundesminister.
Bundesminister für Inneres Mag. Gerhard Karner: Ja, Sie haben völlig recht. Eine der großen Herausforderungen in der inneren Sicherheit ist der Bereich Cybercrime und Cybersecurity, das heißt auf der einen Seite die Kriminalität im Internet, auf der anderen Seite das Thema Netzsicherheit: Wie sicher sind unsere Netze, vor allem im Bereich der kritischen Infrastruktur?
Im Bereich Cybercrime liegen mittlerweile Zahlen
vor – Sie haben einige auch in Ihrer Frage genannt –, und
die für mich eindrucksvollste Zahl ist leider: 100 Betrugsdelikte im
Netz pro Tag. Es gibt zwar Gott sei Dank kaum mehr Banküberfälle, aber
ähnliche Überfälle gibt es leider nach wie vor, sie
finden eben im Netz statt und praktisch jede und jeder von uns ist mittlerweile
betroffen.
Es wird nicht jeder direkt zum
Opfer, weil man sich eben zu schützen
weiß, weil man vorsichtig ist und nicht jedes Mail oder jedes SMS
öffnet. Ich bitte wirklich alle, da immer wieder Vorsicht walten zu
lassen und das nicht
zu tun, wenn solche Mails, solche SMS scheinbar von der Bank, von der Polizei kommen. Die Polizei würde nie über ein Mail oder ein SMS jemanden auffordern, etwas zu zahlen. Daher bitte ich darum, da vorsichtig zu sein.
Was haben wir
getan? – Wir haben die Kriminaldienstreform in Umsetzung gebracht
und 38 sogenannte Kriminalassistenzdienststellen geschaffen –
ich habe es schon bei der Anfrage zuvor kurz skizziert –, mit denen
wir in die Regionen hinausgehen und gerade die Expertise im Cyberbereich, zu
Cybercrime intensivieren, vergrößern, verstärken wollen.
Es gibt eine strukturierte
Ausbildung in diesem Bereich. Wir haben schon sehr viele gute Experten, aber
wir werden da massiv aufrüsten müssen, sodass wir in den
nächsten vier Jahren rund 700 zusätzliche Arbeitsplätze in
den Regionen – bewusst in den
Regionen, vom Neusiedler See bis zum Bodensee – für Cybercrime-Ermittler
in den Kriminaldienstgruppen schaffen werden. Wir werden in den
Landeskriminalämtern in den einzelnen Bundesländern sogenannte
Cybercrime-Training-Center einrichten, wir schaffen eine Grundausbildung
für alle Kolleginnen und Kollegen und eine Spezialausbildung für
bestimmte Bereiche. Es sind also umfangreiche Maßnahmen
notwendig, weil es einfach der Bereich ist, der in der Kriminalstatistik am
stärksten steigt.
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zusatzfrage? – Nein.
Dann stellt die nächste Frage Abgeordneter Oxonitsch. – Bitte.
Abgeordneter
Christian Oxonitsch (SPÖ): Sehr
geehrter Herr Bundesminister! In den letzten Tagen hat es ja durchaus einiges
an zumindest medialer Verwirrung rund um das Thema der Arbeitspflicht
gegeben. Es hat ja schon mehrere negative Stellungnahmen zu diesem Thema
gegeben. Das, was jetzt unter
dem Motto grünes Licht präsentiert wurde, erweckt den Eindruck, als
ob das Innenministerium die Möglichkeit zu irgendeiner Genehmigung
der zumindest medial kolportierten Lösung hätte. Da es ja
bisher schon einige negative
Stellungnahmen – auch aus Ihrem Ministerium – gegeben hat, würde mich interessieren:
„Welche veränderten Parameter haben dazu
geführt, dass die Prüfung der von Ihnen
medial propagierten ‚Arbeitspflicht‘ für Asylsuchende, die
bereits
mehrfach als rechtlich problematisch eingeschätzt wurde, nun ein positives
Ergebnis gebracht hat?“
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Bitte, Herr Bundesminister.
Bundesminister
für Inneres Mag. Gerhard Karner: Da
muss man kurz auf den September dieses Jahres zurückblicken, als es eine
Landesflüchtlingsreferent:innenkonferenz in Kärnten in Faak am
See gegeben hat, bei
der die Flüchtlingsreferentinnen und -referenten über einen
Antrag – ich denke – des Bundeslandes
Oberösterreich beraten haben. Ich halte es prinzipiell für sinnvoll,
über dieses Thema nachzudenken, dass nämlich jene, die in Österreich Schutz und Hilfe bekommen, unserem
Land auch etwas zurückgeben sollen. Dieses Thema wurde
bei der Landesflüchtlingsreferent:innenkonferenz sehr intensiv beraten,
und nach dieser Beratung gab es einen einhelligen Beschluss
darüber – einhellig, das heißt
von allen im Parlament vertretenen Parteien außer den NEOS, die nicht
Teil der Landesflüchtlingsreferent:innenkonferenz sind –, das
Innenministerium aufzufordern, zu ersuchen – mit welchem Begriff
auch immer Sie das in einem föderalen
Staat bezeichnen wollen –, etwas dazu zu erstellen, wie es möglich wird, Asylwerber
dazu zu verpflichten, dem Staat, der ihnen hilft – im Konkreten
Österreich –, auch etwas zurückzugeben.
Das war ein einhelliger Beschluss aller dort Vertretenen, und dieser Aufgabe kommt das Innenministerium natürlich nach. Da hat es dann eben ein Ergebnis gegeben, das ich bei der Landesflüchtlingsreferent:innenkonferenz zunächst mündlich präsentiert habe, das dann auch noch schriftlich
ausgefolgt
wird, damit die einzelnen Bundesländer diese Punkte in
ihrer Verantwortung, im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch umsetzen
können. Ein Vorschlag ist beispielsweise die Kürzung des
Taschengeldes, wenn
jemand nicht bereit ist, unterstützende Arbeit aufzunehmen. Es gibt unterschiedlichste
Maßnahmen, und es liegt jetzt wiederum in der Verantwortung der
Bundesländer – das war das Ersuchen –,
solche Maßnahmen in ihrem Wirkungsbereich auch konkret umzusetzen.
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Den Schlusssatz bitte!
Bundesminister
für Inneres Mag. Gerhard Karner
(fortsetzend): Auch Sie wissen, davon bin ich überzeugt,
dass die gesamte Materie Asyl und Grundversorgung eine sehr komplexe
ist, die in einer 15a-Vereinbarung festgelegt ist und dass dementsprechend neun
Länder und auch der Bund dabei sind.
Wir haben da die rechtliche Expertise, um die wir gebeten wurden, geliefert.
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zusatzfrage, Herr Abgeordneter?
Abgeordneter
Christian Oxonitsch (SPÖ): Danke
für die Information. Man sollte nicht vergessen, dass bei dieser
Flüchtlingsreferentenkonferenz, glaube
ich, nur fünf Länder anwesend waren, aber sei’s drum, ein
Beschluss ist ein Beschluss. Es wundert mich nur, dass die Länder
nicht wissen, dass sie das eigentlich bisher auch schon hätten umsetzen
können, weil das ja nichts Neues ist. Also insofern: Wozu das grüne
Licht?
Meine konkrete Zusatzfrage bezieht sich aber auf den
Menschenrechtsbefund, der von der Liga für Menschenrechte präsentiert
worden ist. Eine der Anmerkungen dazu betrifft die Situation der unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlinge in diesem Bereich: Es gibt ja die
Initiative Gemeinsam für Kinderrechte, die sich um Beratung betreffend Obsorge
bemüht, und eine der Anmerkungen war, dass diese Initiative keinen Zutritt
zu den Bundeseinrichtungen bekommt, um ihre Beratungstätigkeit bei
Kindern und Jugendlichen hinsichtlich der Obsorge durchführen zu
können. Haben Sie vor, daran
etwas zu ändern?
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Bitte, Herr Bundesminister.
Bundesminister für Inneres Mag. Gerhard
Karner: Zunächst: Sie haben recht,
dass nicht alle Bundesländer anwesend waren, aber das habe ich auch
nicht gesagt; ich habe gesagt, alle Parteien waren bei dieser
Flüchtlingsreferent:innenkonferenz anwesend – nur um das
klarzustellen. Wien war nicht dabei, da haben Sie recht, aber den Vorsitz hat
beispielsweise Kärnten. Es wurde intensiv beraten, und daher habe ich
das gemacht.
Was die Obsorge ab dem ersten
Tag betrifft: Sie wissen, dass das nicht unmittelbar
in meine direkte Zuständigkeit fällt, aber das Thema unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge ist eines, das uns – auch wieder
in diesem komplexen System der Grundversorgung – intensiv fordert.
Dazu haben wir uns wiederum bei der letzten Konferenz beraten und
beschlossen, dass wir die Tagsätze erhöhen, die ja die längste
Zeit nicht erhöht wurden, nämlich von 95 Euro
auf – so der Vorschlag, glaube ich – etwa um die
120 Euro. Das wird also erhöht, damit wir die Versorgung
unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge besserstellen können.
Obsorge ab dem ersten Tag – ich weiß, dass es diese Initiative gibt – ist eine Angelegenheit, die im Justizministerium liegt und über die dort beraten werden muss. (Abg. Oxonitsch: Zum Zutritt gibt’s nichts? Die Frage war zum Zutritt! – Abg. Krainer: So kann man Fragen auch nicht beantworten!)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Eine Zusatzfrage stellt Abgeordnete Diesner-Wais. – Bitte.
Abgeordnete
Martina Diesner-Wais (ÖVP): Sehr
geehrter Herr Bundesminister, ich komme wieder zum Thema Arbeitspflicht
für Asylsuchende zurück:
Die Ausdehnung des Einsatzes von Asylwerbern für gemeinnützige Arbeit
ist in der Landesflüchtlingsreferentenkonferenz schon diskutiert worden,
aber auch medial. Die Länder, wie Sie schon gesagt haben, waren dort
vertreten.
Jetzt ist meine Frage: Wie sehen die derzeitige Situation in den Bundesländern und deren Vorhaben für die Umsetzung aus? Gibt es da schon etwas Näheres?
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister
für Inneres Mag. Gerhard Karner: Derzeit
ist mir bekannt, dass in dieser Frage unter dem Titel Arbeitspflicht für
Asylsuchende – oder
wenn jemand nicht bereit ist, gemeinnützige Arbeit zu
erledigen – beispielsweise die Kürzung des Taschengeldes
sozusagen die Sanktionsmöglichkeit ist,
die die Bundesländer haben und die einzelne Bundesländer in Zukunft
auch anwenden werden, wenn ich die Berichte oder das, was von der
Konferenz mitgeteilt wurde, richtig sehe. Das wird möglicherweise in
Vorarlberg und möglicherweise in Oberösterreich der Fall sein,
auch Salzburg prüft da. Andere Bundesländer haben das bisher
abgelehnt. Letztendlich aber liegt es wie gesagt in der Verantwortung und in
der Möglichkeit der einzelnen Bundesländer,
solche Schritte zu setzen. Ich glaube, das ist auch ein positives Zeichen
für den lebendigen Föderalismus.
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zur nächsten Zusatzfrage ist Herr Abgeordneter Shetty zu Wort gemeldet. – Bitte.
Abgeordneter
Mag. Yannick Shetty (NEOS): Guten
Morgen, Herr Bundesminister! Vielleicht einleitend: Wir NEOS sind ja der
Meinung, dass es einen straffen Rahmen für alle, die zu uns kommen, braucht.
Das ist im Sinne
derer, die zu uns kommen – der Zugewanderten –, aber auch
im Sinne unserer Gesellschaft. Wir fordern daher für alle Asylwerberinnen
und Asylwerber ein verpflichtendes Integrationsjahr. Es
beinhaltet verpflichtende Deutsch-, Werte- und Orientierungskurse. Das
heißt aber auch, dass man sie zur Verfügung stellen muss, was
derzeit ab Tag eins leider nicht der Fall ist. – Also fördern
und fordern, aber halt wirklich.
Jetzt muss ich schon noch
einmal zu dieser Forderung zurückkommen,
die ja nicht, wie Sie es geschildert haben, von der
Flüchtlingsreferentenkonferenz aufgestellt wurde, sondern von Ihrer
Partei, der ÖVP. Sie fordern eine Arbeitspflicht, also quasi
Zwangsarbeit für alle Asylwerberinnen und Asylwerber (Zwischenrufe
bei der ÖVP), gleichzeitig aber verhängt die ÖVP seit Jahren
ein Arbeitsverbot für alle Asylwerberinnen und Asylwerber. Das führt
zu
der Situation, dass eine gut ausgebildete Pflegekraft nicht als Pflegerin
tätig sein darf, aber Sie wollen, dass sie zum Rasenmähen
verpflichtet werden kann.
Deswegen ist meine konkrete Frage: Können Sie bitte konkret – und zwar auch für alle außerhalb der ÖVP verständlich – erklären, wie Sie diesen Widerspruch auflösen können?
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister
für Inneres Mag. Gerhard Karner: Ich
habe das bei einer Frage davor schon gesagt: Ich halte es für absolut
notwendig, dass wir klar
zwischen legaler Zuwanderung, natürlich verbunden mit dem Arbeitsmarkt,
und Kampf gegen illegale Zuwanderung trennen. Wenn wir den Zugang zum
Arbeitsmarkt über die Hintertür zulassen, werden wir noch mehr
Menschen animieren, über den oft so todbringenden Weg – beispielsweise
über das Mittelmeer – nach Europa und nach Österreich zu
kommen. Das halte ich für falsch. Wir brauchen die klare und strikte
Trennung zwischen legaler Zuwanderung – der
Rot-Weiß-Rot-Karte, die wir brauchen, das ist beispielsweise im
Pflegebereich notwendig, Sie haben es angesprochen – und
dem Kampf gegen illegale Zuwanderung. – Erster Punkt.
Zweiter Punkt: Während des Verfahrens halte ich es
für sinnvoll, dass Asylwerber – sie bekommen ja auch
Unterkunft und etwas zu essen, werden
versorgt – dem Staat, in dem sie sind, auch etwas zurückgeben.
Daher gibt es den Vorschlag der Kürzung des Taschengeldes – die
Möglichkeit, dass
die Bundesländer das tun.
Wenn jemand dann asylberechtigt
ist, müssen wir sehr intensiv und sehr rasch in die Integration
gehen – da bin ich völlig bei Ihnen. Das Ziel muss aber sein,
die Verfahren rasch durchzuführen, während des Verfahrens möglicherweise dem
Land, von dem man unterstützt wird, eine Gegenleistung zu geben und
dann, wenn es die Asylberechtigung gibt, die Menschen rasch
in den Arbeitsmarkt zu integrieren, damit sie auch die Möglichkeit haben,
sich selbst zu versorgen. (Beifall bei der ÖVP.)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Die nächste Zusatzfrage stellt Abgeordnete Tomaselli. – Bitte.
Abgeordnete
Mag. Nina Tomaselli (Grüne): Herr
Minister! Kollege Shetty
hat es ja bereits ausgeführt: Die Diskussion, die um die
Beschäftigung von Geflüchteten
in Asylverfahren entbrannt ist, stammt ja nicht von der Landesflüchtlingsreferent:innenkonferenz,
sondern aus Vorarlberg, angestoßen von der dortigen ÖVP.
Tatsächlich – ich glaube, da sind wir uns einig –
ist Arbeit, Teilhabe am gesellschaftlichen und sozialen Leben, einer der
Schlüssel überhaupt zur Integration. Sie haben ja auch selber gesagt,
dass alles, was Asylberechtigte in den Arbeitsmarkt und nicht in das
Sozialsystem bringt, unterstützenswert sei und helfe. Da ist es aber
schon fraglich, wie so ein Zwangsprogramm dem tatsächlich Rechnung
tragen würde.
2016 musste leider das höchst erfolgreiche Programm der Nachbarschaftshilfe der Caritas Vorarlberg aufgrund eines Gesetzeskonfliktes eingestellt werden. In diesem Projekt geht es um gemeinnützige Arbeit, aber es ist ein Projekt auf Augenhöhe, bei dem vor allem die Integration und die Begegnung im Vordergrund stehen.
Jetzt wollte ich Sie fragen:
Unterstützen Sie das einstimmig befürwortete Vorhaben des Vorarlberger
Landtages, gemeinsam mit der Vorarlberger Caritas
das langjährig bewährte Programm der Nachbarschaftshilfe für
Asylwerber:innen wieder einzuführen?
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister
für Inneres Mag. Gerhard Karner: Frau
Abgeordnete, ich muss nur noch eine Korrektur mitteilen: Ich habe gesagt, dass
alle im Parlament vertretenen Parteien außer den NEOS bei der
Landesflüchtlingsreferent:innenkonferenz dabei waren, aber die
Grünen waren auch nicht dabei, weil sie
nicht mehr Teil der Landesflüchtlingsreferent:innenkonferenz sind.
Der Beschluss, diesen Vorschlag vom Innenministerium zu
prüfen, geht auf einen Beschluss der Landesflüchtlingsreferent:innenkonferenz –
ich glaube, es
war am 20. September – zurück. Vorarlberg hat neben
Oberösterreich dieses Thema als Erstes aufgegriffen. Wenn es in Vorarlberg
ein sinnvolles Projekt gibt, bei dem sich alle Parteien einig
sind, dann begrüße ich das natürlich, aber es ist nicht meine
Aufgabe, dieses Projekt durchzuführen. (Beifall
bei Abgeordneten der ÖVP.)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Die nächste Anfrage stellt Abgeordneter Hofinger. – Bitte.
Abgeordneter Ing. Manfred Hofinger (ÖVP): Herr Bundesminister, wir sehen, dass die illegale Migration in Europa eine große Herausforderung darstellt, aber im Gegensatz zu Österreich steigt die Zahl der Asylanträge in Deutschland und Spanien oder auch in Italien und Frankreich.
Meine Frage dazu lautet: Welche Maßnahmen hat Österreich da ergriffen, dass bei uns die Zahlen nicht steigen?
*****
Die schriftlich eingebrachte Anfrage, 307/M, hat folgenden Wortlaut:
„Welche Maßnahmen hat Österreich gesetzt, dass in unserem Land die Asylzahlen sinken während sie in Europa steigen?“
*****
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister
für Inneres Mag. Gerhard Karner: Wir
haben es heute schon kurz skizziert, aber ich wiederhole es, weil es wichtig
ist: Faktum ist –
das möchte ich an dieser Stelle auch sagen –, dass wir nach wie
vor hohe Asylantragszahlen haben – von Jänner bis Oktober waren
es
knapp 54 000 –, aber es sind deutlich weniger als
beispielsweise im letzten
Jahr: Im Oktober hatten wir 9 893 Asylanträge, im
Oktober 2022 waren es fast doppelt so viele – ein Rückgang
von 46 Prozent. Von Jänner bis Oktober
hatten wir einen Rückgang von 42 Prozent.
Was haben wir
getan? – Grenzpunkt- und Grenzraumkontrollen. Was war das Ziel
dahinter – Operation Fox, sie wurde heute schon kurz
erwähnt –? –
Das Ziel dahinter war, die Routen der Schlepper zu stören. Wir müssen
das Geschäft der Schlepper kaputtmachen. Wir müssen versuchen,
die großen
Fische und nicht nur die kleinen Fische zu fangen. Das war ein wesentlicher
Punkt, dass sich da einiges geändert hat.
Ein wesentlicher Punkt war
auch – das wurde heute noch nicht erwähnt –, dass
die Visapolitik in manchen Ländern geändert wurde, beispielsweise in
Serbien. Im letzten Jahr durften indische und tunesische Staatsbürger
visumsfrei nach Serbien einreisen. Bundeskanzler Karl Nehammer hat da massiv
Druck auf Serbien gemacht, er hat sich auch mit dem Regierungschef getroffen.
Er wurde dafür vielfach kritisiert, aber – und das ist das
Entscheidende –
es hat Erfolg gebracht: Serbien hat die Visapolitik für Tunesien und
Indien geändert, sodass es im heurigen Jahr praktisch überhaupt
keine Asylanträge
aus diesen Ländern mehr gibt. Im letzten Jahr hatten wir aus Indien und
Tunesien noch 13 000, jetzt sind es, glaube ich, 200 bis
300 – also eine deutliche Reduktion, weil sich da die
Visapolitik geändert hat.
Wir haben die Verfahren in
vielen Bereichen deutlich beschleunigt, und wir haben vor allem die
Schnellverfahren an der Grenze intensiver gemacht,
denn wenn potenzielle Asylwerber oder jene, die aus wirtschaftlichen
Gründen nach Europa kommen, sehen, sie haben keine Chance auf einen
positiven
Bescheid, dann ziehen sie sehr rasch weiter oder kehren in ihre Heimat zurück. (Beifall bei Abgeordneten der ÖVP.)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Eine Zusatzfrage stellt Frau Abgeordnete Krisper. – Bitte.
Abgeordnete
Dr. Stephanie Krisper (NEOS): Sehr
geehrter Herr Innenminister, wer über die Situation bei Asylverfahren
redlich informieren möchte,
müsste ergänzend zu den Asylantragstellungen ja auch immer ein
Phänomen thematisieren, nämlich die Verfahrenseinstellungen.
Dementsprechend ist meine Frage: Wie viele Asylverfahrenseinstellungen gab es
in diesem Jahr bis jetzt
im Verhältnis zur Anzahl der gestellten Asylanträge?
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Herr Bundesminister, bitte.
Bundesminister für Inneres Mag. Gerhard Karner: Ich hoffe, ich habe die Zahl richtig im Kopf: Ich glaube, es waren in diesem Jahr an die 26 000 Verfahrenseinstellungen – zwischen 20 000 und 30 000, ich glaube, das ist ziemlich die richtige Zahl.
Zur Erklärung, auch für jene, die über das Fernsehen
dabei sind: Verfahren werden dann
eingestellt, wenn sich Asylwerber selbst freiwillig dem Verfahren entziehen.
Wenn sie zu den sogenannten Asylgesprächen nicht bereit sind –
ich glaube, sie heißen anders, also die Aufnahmegespräche oder die
inhaltlichen Gespräche, nämlich zum Asylgrund, warum sie um
Asyl ansuchen –, wenn sie sich diesem Verfahren entziehen, wird das
Verfahren nach drei Tagen eingestellt und damit auch negativ beschieden. Das
ist auch eine sehr hohe Zahl an negativen Asylbescheiden, die in diesem Jahr
schon erstellt wurden,
weil eben viele weiterziehen und viele in andere Länder ziehen wollen,
weil sie die Hoffnung haben, dort irgendwo
am Schwarzarbeitsmarkt unterzukommen.
Präsident
Mag. Wolfgang Sobotka: Ich danke. (Beifall
bei der ÖVP.) – Da alle Anfragen zum Aufruf gelangt
sind, darf ich die Fragestunde für beendet
erklären und darf mich beim Herrn Bundesminister für Inneres recht
herzlich bedanken.
Einlauf und Zuweisungen
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Hinsichtlich der eingelangten Verhandlungsgegenstände und deren Zuweisungen verweise ich gemäß § 23 Abs. 4 der Geschäftsordnung auf die im Sitzungssaal verteilte Mitteilung.
Die schriftliche Mitteilung hat folgenden Wortlaut:
A. Eingelangte Verhandlungsgegenstände:
Schriftliche Anfragen: 17091/J bis 17153/J
B. Zuweisungen in dieser Sitzung:
zur Enderledigung im Sinne des § 28b GOG (vorbehaltlich der endgültigen Entscheidung des Ausschusses):
Wissenschaftsausschuss:
Tätigkeitsbericht der Ombudsstelle für Studierende, vorgelegt vom Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung (III-1073 d.B.)
*****
Fristsetzungsantrag
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Vor Eingang in die Tagesordnung teile ich mit, dass Abgeordneter Scherak beantragt hat, dem Justizausschuss zur Berichterstattung über den Antrag 361/A(E) der Abgeordneten Margreiter, Kolleginnen und Kollegen eine Frist bis zum 31.1.2024 zu setzen.
Der gegenständliche Antrag wird gemäß der Geschäftsordnung nach Beendigung der Verhandlungen in dieser Sitzung zur Abstimmung gebracht.
Behandlung der Tagesordnung
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Es ist vorgeschlagen, die Debatten über die Punkte 2 bis 4, 5 und 6, 8 und 9, 11 und 12, 13 und 14 sowie 15 und 16 der Tagesordnung jeweils zusammenzufassen.
Wird dagegen ein Einwand erhoben? – Das ist nicht der Fall.
Redezeitbeschränkung
Präsident
Mag. Wolfgang Sobotka: Zwischen den
Mitgliedern der Präsidialkonferenz wurde Konsens über die Dauer
der Debatten erzielt. Dementsprechend haben wir eine Tagesblockzeit
von 8 „Wiener Stunden“ vereinbart. Die Redezeiten ergeben sich
wie folgt: 156 Minuten für die ÖVP, 108 für
die SPÖ, 88 für die FPÖ, 80 für die Grünen sowie
64 Minuten für die NEOS.
Gemäß § 57
Abs. 7 der Geschäftsordnung beträgt die Redezeit für die
gesamte Tagesordnung für jene Abgeordneten, die keinem Klub
angehören,
je 32 Minuten. Deren Redezeit wird auf 5 Minuten je Debatte beschränkt.
Wer damit einverstanden ist,
den bitte ich um ein entsprechendes Zeichen. (Abg. Reimon: Wie viel
hat die FPÖ? – Ruf: 88!) – FPÖ: 88!
(Abg. Reimon –
erheitert –: 88? – Ruf: Jessas! – Heiterkeit
des Abg. Wurm. – Abg. Kassegger:
Das ist aber echt witzig, oder?) – Das ist einstimmig
angenommen.
Wir gehen in die Tagesordnung ein.
Bericht des Finanzausschusses über das Volksbegehren (2080 d.B.) „BARGELD-Zahlung: Obergrenze NEIN!“ (2374 d.B.)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Wir gelangen zum 1. Punkt der Tagesordnung.
Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Haubner. – Bitte sehr.
10.22
Abgeordneter
Peter Haubner (ÖVP): Guten
Morgen, Herr Präsident! Guten Morgen, Herr Minister! Einen
wunderschönen guten Morgen den Kolleginnen und Kollegen und den
Damen und Herren auf der Galerie! Ich möchte im Namen meines Kollegen
Laurenz Pöttinger besonders die Freiwillige Feuerwehr Grieskirchen bei uns
begrüßen. – Herzlich willkommen im Hohen
Haus! (Allgemeiner Beifall.) Ich danke auch für Ihren
tagtäglichen Einsatz, noch einmal herzlich willkommen!
Wir beschäftigen uns heute mit dem Volksbegehren zum
Thema Bargeld (Bundesminister Brunner – auf dem
Weg zu seinem Sitzplatz –: Entschuldigung, guten Morgen!) –
Guten Morgen, Herr Finanzminister! –, das knapp über
120 000 Österreicherinnen und Österreicher unterschrieben haben.
Dass dieses Thema, nämlich die Beibehaltung des Bargeldes, die
österreichische Bevölkerung sehr bewegt, haben wir ja schon
aufgrund eines anderen Volksbegehrens, das wir vor Kurzem hier im Hause
behandelt haben und das von 530 000 Österreicherinnen und
Österreichern unterschrieben worden
ist, gesehen, und diese Volksbegehren werden ja auch hier bei uns im Hohen Haus
behandelt.
Ich möchte den Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern
des Volksbegehrens recht herzlich für ihren Beitrag danken und
möchte ihnen auch versichern, dass es von unserer Seite nicht vorgesehen
ist, das Bargeld abzuschaffen;
ganz im Gegenteil, wir sind massive Verfechter des Bargeldes, und dies aus mehreren
stichhaltigen Gründen.
Für mich persönlich ist die persönliche Freiheit ein sehr hohes Gut, und Bargeld ist persönliche Freiheit. Ohne Bargeld gibt es keine persönliche Freiheit, meine Damen und Herren, und darum wird auch das Bargeld erhalten bleiben. (Beifall bei Abgeordneten der ÖVP.)
Bargeld ist bei der Ausübung der Grundrechte von essenzieller Bedeutung, Bargeld ermöglicht ja natürlich auch die soziale Eingliederung. Wir wissen, dass
in Europa 13 Millionen Menschen kein Konto
haben, das heißt, es ist
für das tägliche Leben eben total wichtig, dass es Bargeld gibt, um
die soziale Eingliederung zu schaffen.
Darum gibt es auch auf
europäischer Ebene kein definitives - - (Abg.
Wurm: Achtung, aufpassen, Kollege Haubner!) – Kollege
Wurm, auf europäischer Ebene gibt es ein definitives Bekenntnis zum
Bargeld (Abg. Belakowitsch:
Ja, aber nur definitiv, genau! – Abg. Kassegger: Ja, aber nur
bis zum Betrag von 3,70 Euro!), und es ist auch da
nicht an die Abschaffung des Bargeldes gedacht.
Aber (Abg. Belakowitsch:
Aber! – Abg. Kassegger: Niemand hat die Absicht,
eine Mauer zu ...!) als gelernte Europäer wissen wir zwei Dinge:
zum einen, dass es gut ist, wenn wir das gleiche Ansinnen haben wie die
europäische
Ebene (Abg. Belakowitsch: Das haben wir aber nicht!), und zum
anderen, dass es große Sicherheit gibt, wenn wir uns auch auf nationaler
Ebene klar zum
Bargeld bekennen; und das tun wir auch, meine Damen und Herren! (Beifall bei
der ÖVP. – Abg. Kassegger:
Ja, dann stimmt dagegen, gegen die Abschaffung!)
Dass das Bargeld hohe Akzeptanz hat, beweisen die Zahlen (Abg. Belakowitsch: Das brauchen Sie uns ja nicht erzählen!): Die Zahl der im Umlauf befindlichen Banknoten ist seit dem Jahr 2002, seit der Einführung des Euro, kontinuierlich gestiegen, und es ist nach wie vor das am häufigsten verwendete Zahlungsmittel.
Die Vorteile des Bargeldes liegen ja auf der Hand: Es ist
günstig, es ist schnell und es ist verlässlich. Allen, die alles nur
digital haben wollen, kann man
ganz klar sagen: Bargeldzahlungen sind eben die sicherste Zahlungsart, und es
kann alles in einem erledigt werden. Jeder hat schon die Erfahrung gemacht, dass,
wenn er zum Beispiel im Taxi sitzt und das Gerät nicht funktioniert, es
gut ist, wenn man Bargeld zur Hand hat, sodass man seine Rechnung begleichen
kann.
Persönlich kann ich auch sagen: Ich bin nicht für eine Obergrenze, ganz einfach deshalb, weil sie, wenn sie einmal eingeführt ist, dann wahrscheinlich permanent abgesenkt werden wird (Abg. Belakowitsch: Ah wirklich?! – Abg. Wurm: Peter, komm zu uns! – Abg. Kassegger: Richtig!), und damit ist uns auch nicht geholfen.
Das Bargeld ist das beste
Mittel zum Umgang mit den eigenen Finanzen. (Abg. Belakowitsch: Also
in der EU nicht zustimmen! – Abg. Kassegger: ... der Herr
Finanzminister dazu!) Ich glaube, es ist besser, wenn man dem Kind
Taschengeld gibt, nicht eine
Kreditkarte – bei Taschengeld merkt man rechtzeitig, dass
man nur das ausgeben kann, was man in seiner Tasche hat, meine Damen und
Herren! (Beifall bei der ÖVP. – Zwischenruf des Abg. Matznetter.)
Es ist aber auch Vorsicht
geboten, wenn gleichzeitig mit dem Bargeld immer wieder der digitale Euro
ins Rennen geschickt wird, eine Währung, die zurzeit
keiner nachfragt, die keiner braucht und die eigentlich keine Probleme
löst, sondern mehr davon schafft. Die digitale Einführung bringt
wahrscheinlich
mehr Probleme, als sie löst. Und wenn man in der letzten Sitzung des
Finanzausschusses dem Herrn Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank zugehört
hat, hat man gehört: Er hat als funktionierendes Land einer digitalen
Währung China genannt – da schrillen bei mir alle Alarmglocken.
Deshalb ist hier höchste Vorsicht geboten.
Ich sage: Bargeld: ja; digitaler Euro: Seien wir vorsichtig! Setzen wir auf Bewährtes, setzen wir also auf Bargeld, meine Damen und Herren! (Abg. Belakowitsch: Nicht Vorsicht! Wir lehnen es ab!)
Lassen Sie mich abschließend noch einmal festhalten:
Bargeld ist ein essenzieller Beitrag zur persönlichen Freiheit, und
deshalb werden wir es auch nicht abschaffen. – Danke. (Beifall
bei der ÖVP sowie des Abg. Wurm. – Abg. Kassegger:
Jetzt kennen wir uns aber nicht mehr aus! Sind wir jetzt dafür oder
dagegen? –
Abg. Belakowitsch: Was ist jetzt? Sind wir jetzt vorsichtig oder lehnen
wir es ab? – Abg. Gerstl – in Richtung FPÖ –: Brauchts euch nicht mehr zu Wort melden!)
10.28
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Kollross. – Bitte.
Abgeordneter Andreas Kollross (SPÖ): Herr Präsident! Herr Minister! Kolleginnen
und Kollegen! Werte Zuseherinnen und Zuseher! Vor allem aber auch werte
Initiatorinnen und Initiatoren beziehungsweise Unterstützerinnen und
Unterstützer des Volksbegehrens! Danke für diese Initiative, weil sie
mir die Möglichkeit gibt, noch einmal zu einem anderen Thema Stellung
zu beziehen, das nach meinem Verständnis ein viel dringenderes ist.
Es geht nach meinem
Verständnis nämlich weniger darum, dass wir über Bargeld in die
Verfassung diskutieren, sondern es geht vielmehr darum, dass wir
über eine Bargeldversorgung in unserer Republik diskutieren.
(Beifall bei der SPÖ.)
Wir haben mittlerweile das
Problem, dass wir in vielen Gemeinden nicht einmal mehr einen Bankomaten haben!
Zuerst verschwindet die Bankfiliale, und
sehr schnell verschwindet dann auch der Bankomat. Mittlerweile gibt es in
Österreich in 317 Gemeinden keinen Bankomaten mehr und somit
keinen Zugang zum eigenen Bargeld. In manchen Gemeinden gibt es ihn noch,
weil die Bankomatbetreiber, die Banken, hergehen und sagen: Liebe Gemeinde,
wenn du dazuzahlst, dann sind wir gerne bereit, dass wir einen Bankomaten
aufstellen!
Ich glaube, wir alle hier herinnen sind uns einig, dass es
wohl nicht Aufgabe der Gemeinden und Städte ist, für die
Bargeldversorgung ihrer Bürgerinnen
und Bürger zu sorgen, sondern es ist doch wohl Aufgabe der Banken, da
ihrem Versorgungsauftrag gerecht zu werden! (Beifall bei der SPÖ.)
Viele Gemeinden haben sich aber
natürlich darauf eingelassen – verständlicherweise,
weil sie die Möglichkeit der Nutzung eines Bankomaten ihren Bürgerinnen
und Bürgern anbieten wollen – und sind heuer vor dem Sommer vor
die Situation gestellt worden, dass die Betreiber ihnen gesagt haben:
Die 3 000, 4 000 oder 5 000 Euro, die ihr bisher bezahlt
habt, gelten nicht mehr, ab jetzt müsst ihr 20 000, 25 000,
35 000 Euro im Jahr zahlen, wenn ihr in
eurer Gemeinde noch einen Bankomaten haben wollt!
Das, meine sehr geehrten Damen
und Herren, ist unanständig! Das ist schlicht und einfach unanständig
(Beifall bei der SPÖ), denn die Banken haben
voriges Jahr 10,2 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Das Ergebnis ist: Der Gewinn
wird privatisiert, und der Rest und die Aufgaben werden sozialisiert. So kann
es wohl nicht sein! (Beifall bei der SPÖ.)
Herr Minister, ich freue mich ja, dass Sie hier sind, denn Sie haben ja dann das Problem irgendwie aufgegriffen und haben gesagt: Jetzt machen wir einen Bankengipfel! – Dann haben Sie sich zu einem Kaffeeplauscherl getroffen, haben sich mit den Banken getroffen und haben gesagt: Und jetzt ist alles anders!
Jetzt frage ich Sie ganz konkret: Gibt es seit Ihrem Treffen um einen Bankomaten mehr in unserer Republik? Gibt es eine Gemeinde weniger, die für einen Bankomaten, den sie bisher gehabt hat, jetzt zahlen muss? – Ich sage Ihnen das Ergebnis Ihres Gipfels: Jetzt haben die Gemeinden neue Vorschreibungen bekommen, und jetzt sind es halt nicht 35 000 Euro, sondern 17 000 Euro, die die Gemeinden und Städte jetzt zahlen müssen, wenn sie noch einen Bankomaten haben wollen! Das ist das Ergebnis Ihres Kommunalgipfels, Ihres Gipfels mit den Gemeinden. Na gratuliere, danke! Das ist ein Bombenverhandlungserfolg! (Heiterkeit bei Abgeordneten der SPÖ.) Sie kann man verhandeln lassen, Herr Minister! (Beifall bei der SPÖ.)
Deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielleicht noch eine Anmerkung zur ÖVP: Ihr wart ja zugegebenermaßen lange Zeit durchaus eine Par-
tei für den
ländlichen Raum, aber das habt ihr abgelegt. Ihr seid mittlerweile nur mehr
eine Partei für Landwirtschaft und Folklore und schaut zu, wie in
Wirklichkeit die Infrastruktureinrichtungen in dieser Republik –
eine
nach der anderen – verschwinden. (Beifall bei der
SPÖ. – Abg. Lercher: Aber er hat die Seilbahnen
vergessen! – Abg. Leichtfried: Seilbahnen!)
Deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, bringe ich abschließend folgenden Antrag ein:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Sicherung der Bargeldversorgung und der Annahmepflicht von Bargeld“
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Finanzen und die Bundesministerin für Justiz werden aufgefordert, dass
1. eine wohnortnahe
Versorgung mit Bargeld durch die Geschäftsbanken, bzw. soweit diese das
nicht leisten können, durch die Oesterreichische Nationalbank, durch
Bankomaten sichergestellt wird;“ (Abg. Hörl: ... wir
wieder
in die Staatswirtschaft? Die DDR lässt grüßen!)
„2. die bestehende
Annahmeverpflichtung durchgesetzt wird oder gegebenenfalls eine
Gesetzesänderung dem Parlament vorzulegen ist, wodurch
die Annahmeverpflichtung in der Praxis durchgesetzt werden kann und die
nachvollziehbaren Ausnahmen klargestellt werden;
3. zu prüfen, welche
Legitimations- und Sorgfaltspflichten notwendig
sind, um den Missbrauch, vor allem durch die organisierte Kriminalität, zu
verhindern;
4. Datenschutz unabhängig von der Bezahlform für alle Bürger:innen gewährleistet sein muss.“
*****
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir brauchen einen
Bankomaten pro Gemeinde, wir brauchen ein Bargeldversorgungsgesetz! –
Danke schön.
(Beifall bei der SPÖ.)
10.33
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Kai Jan Krainer,
Genossinnen und Genossen
betreffend Sicherung der Bargeldversorgung und der Annahmepflicht von Bargeld
eingebracht im Zuge der Debatte Bericht des
Finanzausschusses über das Volksbegehren (2080 d.B.)
"BARGELD-Zahlung: Obergrenze NEIN!" (2374 d.B.)
(Top 1)
Das Volksbegehren wirft wichtige Fragen auf.
1. Bargeldversorgung
Die Bargeldversorgung (Bankfilialdichte bzw. Bankomatdichte) ist in Österreich noch deutlich besser als in vergleichbaren Staaten. Jene Länder, die über eine unzureichende Bargeldversorgung verfügen, verpflichten entweder ihre Geschäftsbanken, Bargeldinfrastruktur (Bankomaten) (wieder) aufzubauen, oder ihre Notenbanken, die Bargeldversorgung in unterversorgten Gebieten (durch Bankomaten) herzustellen. In Österreich entstehen leider auch bereits erste Lücken bei der Versorgung mit Bargeld (Bankomaten) – vor allem im ländlichen Raum. Österreich sollte rechtzeitig diese Lücken schließen und das Entstehen weiterer Lücken verhindern.
Der Nationalrat fordert eine
wohnortnahe Versorgung mit Bargeld durch Bankomaten. Dies soll durch eine
Verpflichtung der Geschäftsbanken erreicht werden.
Wenn die Geschäftsbanken (Markt) dies nicht leisten können, muss die
Oesterreichische Nationalbank (Staat) die wohnortnahe Versorgung mit
Bargeld durch Bankomaten sicherstellen.
2. Annahmepflicht
In § 61 Abs. 2 Nationalbankgesetz ist die unbeschränkte Annahmeverpflichtung von Eurobanknoten gesetzlich verankert. Trotzdem gibt es in der Praxis nachvollziehbare Einschränkungen dieser Annahmepflicht (z.B. aus Sicherheitsgründen im Gelegenheitsverkehr) und andererseits auch weniger nachvollziehbare Einschränkungen (z.B. bei Sportveranstaltungen oder Konzerten).
Der Nationalrat fordert die Bundesregierung auf, die bestehende Annahmeverpflichtung durchzusetzen oder gegebenenfalls eine Gesetzesänderung dem Parlament vorzulegen, wodurch die Annahmeverpflichtung in der Praxis durchgesetzt werden kann und die nachvollziehbaren Ausnahmen klargestellt werden.
3. Geldwäsche
Die geltenden Geldwäschebestimmungen, die erhöhte Sorgfaltspflichten und Legitimationspflichten vorsehen, sind auf Grund der organisierten Kriminalität im Bereich des Drogenhandels eingeführt worden. In der Zwischenzeit wurden sie um die Bereiche Terrorismusfinanzierung, Steuerhinterziehung etc. erweitert. Eine uneingeschränkte Bargeldzahlung darf derartige Schutzbestimmungen nicht aushebeln.
Der Nationalrat spricht sich dafür aus, zu prüfen, welche Legitimations- und Sorgfaltspflichten notwendig sind, um den Missbrauch, vor allem durch die organisierte Kriminalität, zu verhindern.
4. Datenschutz
Als Argument für uneingeschränkte Bargeldzahlung wird immer wieder auf den mangelnden Datenschutz hingewiesen.
Der Nationalrat vertritt die Auffassung, dass Datenschutz unabhängig von der Bezahlform für alle Bürger:innen gewährleistet sein muss.
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher nachstehenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Finanzen und die Bundesministerin für Justiz werden aufgefordert, dass
1. eine wohnortnahe Versorgung mit Bargeld durch die Geschäftsbanken, bzw. soweit diese das nicht leisten können, durch die Oesterreichische Nationalbank, durch Bankomaten sichergestellt wird;
2. die bestehende Annahmeverpflichtung durchgesetzt wird oder gegebenenfalls eine Gesetzesänderung dem Parlament vorzulegen ist, wodurch die Annahmeverpflichtung in der Praxis durchgesetzt werden kann und die nachvollziehbaren Ausnahmen klargestellt werden;
3. zu prüfen ist, welche Legitimations- und Sorgfaltspflichten notwendig sind, um den Missbrauch, vor allem durch die organisierte Kriminalität, zu verhindern;
4. Datenschutz unabhängig von der Bezahlform für alle Bürger:innen gewährleistet sein muss.“
*****
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Der Entschließungsantrag ist ausreichend unterstützt, ordnungsgemäß eingebracht und steht somit mit in Verhandlung.
Abgeordneter Wurm ist als Nächster an der Reihe. – Bitte sehr, Herr Abgeordneter.
10.34
Abgeordneter
Peter Wurm (FPÖ): Schönen
guten Morgen! Herr Präsident! Herr Minister! Hohes Haus! Werte Zuseher!
Zuerst einmal möchte ich mich bei
über 121 000 Österreicherinnen und Österreichern, die
dieses Volksbegehren unterschrieben haben, bedanken. Es ist die letzten Jahre
fast ein halbes
Dutzend an Volksbegehren zum Thema Bargeld unterwegs, das bisher erfolgreichste
erhielt 530 000 Unterschriften. Man sieht also, dass das Thema
Bargeld die Bevölkerung bewegt.
Ich bin dann immer wieder verblüfft, wenn ich hier
zuhöre, wie sich die ÖVP oder auch die Sozialdemokratie immer in
schönen Worten für das Bargeld äußert. Die
Realität, liebe Zuseher, ist leider eine andere, nämlich: Dann, wenn Beschlüsse – sowohl in den
Ausschüssen als auch hier im Plenum –
zu fassen sind, bleiben wir Freiheitliche seit Jahren immer alleine
übrig, wenn es um einen effektiven Schutz des Bargeldes für die
Bevölkerung geht. Das
ist leider die Realität. Wir werden nicht aufhören, dafür zu
kämpfen (Abg. Kucher: Ihr habt ja das Bargeld im Kofferraum!),
und irgendwann haben wir entweder als Partei die Mehrheit oder
wir können auch eine andere Partei mitnehmen, damit endlich dieser
Mehrheitsbeschluss für die Sicherung des Bargelds gefasst wird.
Vielleicht jetzt noch einmal zum heute vorliegenden
Volksbegehren ganz konkret: Dieses hat sich mit dem Thema
Bargeldobergrenzen beschäftigt.
Dazu muss man vielleicht auch noch einmal aufklären: Da geht es nicht
darum, dass irgendein Krimineller mit Bargeld herumläuft, sondern da geht
es darum, dass Ihnen, liebe Bürger, wenn Sie sich über
Jahre 10 000 Euro, 12 000 Euro erspart haben, jetzt die
Europäische Union unter Mithilfe von ÖVP, Sozialdemokratie,
Grünen und NEOS verbieten wird, dieses eigene, ehrlich verdiente,
versteuerte Bargeld auszugeben. (Abg. Loacker: Auch das in
Sporttaschen!) – Das ist einfach die Realität, die Sie
erwartet.
Eines ist natürlich ganz klar, liebe Bevölkerung:
Zwischen 6. und 9. Juni finden die Europawahlen, die Wahlen zum
Europäischen Parlament statt, und
alle diese vier Parteien versuchen jetzt, ein bissl Sand in Ihre Augen zu
streuen und zu sagen: Nein, alles ist super, und es ist nicht
so. – Sie werden dann
nach den europäischen Wahlen die böse Überraschung erleben, wenn
dann die Realität eintritt.
Ich persönlich und wir als Freiheitliche haben seit
Jahren die Wahrheit erzählt. Im Frühling war ich in Straßburg
und habe dort die Ehre gehabt, mit dem Vizepräsidenten Karas –
ehemals ÖVP oder noch ÖVP, weiß ich nicht –
informell zu sprechen, und der ÖVP-Karas hat mir schon gesagt, dass auf
europäischer Ebene bereits vereinbart ist: Die Bargeldobergrenze
kommt. – Parallel dazu stellt die ÖVP sich hin und sagt: Es
wird niemals eine Obergrenze
geben, das werden wir verhindern! – Bundeskanzler Nehammer
sagt das sowieso.
Also - - Falotten darf man nicht sagen, Herr
Präsident? Nein? – Gut, dann sage ich nicht Falotten, aber:
Diese Unehrlichkeit, die hier betreffend dieses
Thema seit Jahren an den Tag gelegt wird, ist kaum noch erträglich.
Ich zeige es Ihnen noch einmal (zwei mehrseitige
Schriftstücke in die Höhe haltend), weil es immer ganz
prägnant ist. Es gibt zwei EU-Verordnungen (Abg. Lukas Hammer: Es
gibt mehr EU-Verordnungen! Es gibt viele!): Die eine ist jene zum digitalen
Euro und die andere ist jene zum Bargeld. So, das ist jene zum Bargeld, die ist
halb so dick wie jene zum digitalen Euro. Daran sehen Sie schon, wohin die
Reise geht. Das können Sie nachlesen, bezüglich der EU-Verordnung
liegt alles schon auf dem Tisch, das wird man nach dem 6. beziehungsweise 9. Juni
dann in Brüssel wie gewohnt einfach durchwinken. (Abg. Lukas Hammer:
Lies die Seiten! Nicht nur schauen, wie viele Seiten!)
Kollege Haubner, Bundeskanzler
Nehammer, der gehört ja zu euch, noch, hat ja im Sommer angekündigt,
es wird – er hat plötzlich das Bargeld entdeckt –
diesen großen Bargeldgipfel geben. Ich habe Anfragen gemacht: Der
Finanzminister ist nicht involviert, der Sozial- und
Konsumentenschutzminister
Rauch sowieso nicht. Ich habe mich erkundigt: Okay, was ist da passiert bei
dieser Taskforce oder bei diesem Gipfel? – Den hat es natürlich
überhaupt noch nicht gegeben, da passiert auch nichts. Es ist eine reine
PR-Maschinerie,
die da losläuft.
Ich kann daher nur noch einmal
sagen: Geschätzte Bevölkerung, glauben Sie bitte diesen vier Parteien
kein Wort! Was das Bargeld betrifft, sind die
einzige verlässliche Quelle die Freiheitlichen. (Beifall bei der
FPÖ. – Heiterkeit bei den Grünen sowie bei Abgeordneten
von ÖVP, SPÖ und NEOS. – Abg. Michael Hammer: Genau,
ihr braucht das Bargeld in euren Taschen!)
Ja, es ist nachweislich so, und
wenn es um das Bargeld geht und wenn Sie das Bargeld erhalten wollen, werden
Sie nicht darum herumkommen, bei
den kommenden Wahlen das Kreuz bei der FPÖ zu machen. (Abg. Schallmeiner:
Sporttaschenlobbyistenkompetenz!) Alle anderen vier Parteien werden
Ihnen Ihr Bargeld, ob jetzt 10 Euro, 20 Euro oder 100 Euro,
über kurz oder lang wegnehmen, und wir steuern natürlich eins zu eins
in Richtung China:
digitale Überwachung und Kontrolle durch den Staat. Genau in diese
Richtung steuern wir, das ist sehr einfach nachzuvollziehen.
Deshalb bin ich ja schon
gespannt, was der Finanzminister sagt. Der wird wieder sagen: Nein, passiert
alles nicht! – Die Realität, geschätzte Zuseher, können Sie nachlesen
(neuerlich die beiden Schriftstücke in die Höhe haltend), es
ist relativ einfach im Internet zu finden. Dahin geht die Reise: Bargeld wird
zuerst zurückgedrängt und dann abgeschafft, und Sie landen im
digitalen Geld, was bedeutet, dass der Staat Ihnen sofort den Hebel zudrehen
kann.
Das werden wir Freiheitliche verhindern. Ich wiederhole es: Freiheitliche Partei, Festung Österreich, Volkskanzler Herbert Kickl! (Beifall bei der FPÖ.)
10.39
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordnete Tomaselli. – Bitte.
10.39
Abgeordnete Mag. Nina Tomaselli (Grüne): Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher! Was man feststellen kann: Bargeld bleibt. Und übrigens: Es gibt überhaupt keine Diskussion zur Abschaffung von Bargeld, weder in Europa noch in Österreich. (Abg. Amesbauer: Aber über eine Obergrenze!) Viele verwechseln – bewusst oder unbewusst – die Schaffung von Obergrenzen für die Barzahlung mit der Abschaffung des Bargelds. Das stimmt natürlich nicht und das dient einzig und allein zur Verunsicherung der Österreicherinnen und Österreicher. (Beifall bei den Grünen. – Abg. Belakowitsch: Haben Sie gesehen, was das Volksbegehren fordert? Haben Sie das gelesen?)
Dass es hier um Verunsicherung
geht, sieht man schon daran, dass bei diesem Tagesordnungspunkt nicht
ein freiheitlicher Abgeordneter, nicht zwei, nicht drei, sondern gleich vier
eingemeldet sind. (Abg. Kassegger: Fünf, fünf!) –
Kollege Kassegger sagt, es sind fünf gemeldet. (Abg. Amesbauer: Weil
es wichtig ist! – Abg. Kassegger: Weil es uns wichtig ist!) Das
wissen wir: Das politische Lebenselixier der FPÖ ist die Verunsicherung,
und genau das will sie bei diesem Thema betreiben. (Beifall bei den
Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
Bargeld wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen, das ist gar keine Frage. Es gibt auch von der EU-Kommission – und dort sehen wir übrigens die Zuständigkeit für den Euro, für die Zahlungsmittel – Bestrebungen einerseits zur Absicherung des Bargeldes und andererseits auch zur Stärkung eines digitalen Euro. Das ist sehr, sehr wichtig, denn der große Unterschied eines digitalen Euro zu der Ihnen bekannten Karte ist jener, dass die Oberhand über den digitalen Euro die Zentralbank und nicht irgendein privater Konzern hat. (Abg. Amesbauer: Das ist ein billiger Vorwand! – Abg. Kassegger: Scheinargument!)
Kollege Wurm, ich habe ganz genau zugehört, was Sie zur
Bargeldobergrenze gesagt haben: Bürgerinnen und Bürger
draußen, hören Sie zu, da geht es
nicht um Kriminelle, da geht es um Ihre Ersparnisse, um die 10 000,
12 000 Euro,
die Sie angespart
haben! – Liebe Zuseherinnen und Zuseher, bitte bewahren
Sie nicht so viel in bar daheim auf.
Ich erkläre Ihnen jetzt,
wie das mit der Bargeldobergrenze gemeint ist: Bargeldobergrenzen sind vor
allem dazu da, um Kriminalität und Geldwäsche zu verhindern. Nehmen
wir ein praktisches Beispiel: Theoretisch macht
ein Parteichef den Kofferraum eines Autos auf (Ruf bei den Grünen:
Theoretisch! – Abg. Brandstätter: Wer war das?) und
da liegt eine schwarze Sporttasche
mit Stapel voller Bargeld drinnen. (Heiterkeit bei den Grünen.) Es
ist sichtbar, dass es mehrere Zehntausend Euro sind.
Eine Bargeldobergrenze
führt dazu, dass dieser Parteichef (Abg. Brandstätter: Wer
war das?) – ich nenne keine Namen, das ist ja nur ein
theoretisches Beispiel, es ist natürlich nicht praktisch –,
obwohl er jetzt stapelweise
Bargeld hat, dieses Bargeld nicht so leicht in den Verkehr bringen kann, um es
waschen zu können. Genau dafür ist die Bargeldobergrenze da, Herr
Kollege Wurm. (Beifall bei den Grünen. – Abg. Belakowitsch:
Eben nicht! – Abg. Kassegger: Das ist ein Blödsinn! – Ruf bei
den Grünen: Da fühlt sich jemand angesprochen! –
Abg. Stögmüller: ... Goldobergrenze! ... legt jetzt
alles in Gold an! – Zwischenruf des Abg. Wurm.) –
Ich gebe Ihnen vollkommen recht.
Für den Fall, dass Sie es nicht gemerkt haben, liebe
Zuseherinnen und Zuseher: So theoretisch war mein Beispiel gar nicht. Bei der
FPÖ sitzen tatsächlich die Expertinnen und Experten
für Bargeld, vor allem für den Transport via Sporttasche. Ich sage
Ihnen da draußen noch einmal: Die Freiheit, zu zahlen, wie Sie
wollen, wird bleiben, das ist mit den bestehenden gesetzlichen Rahmenbedingungen
im Übrigen auch so gewährleistet. (Beifall bei den Grünen
und bei Abgeordneten der ÖVP.)
10.43
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gelangt Abgeordneter Loacker. – Bitte, Herr Abgeordneter.
10.43
Abgeordneter
Mag. Gerald Loacker (NEOS): Herr
Präsident! Sehr geehrter Herr Finanzminister! Da teilen alle aus und in
Wirklichkeit fliegen die Steine
durchs Glashaus, dass es nur so kracht.
Beginnen wir bei denen mit den vier oder fünf Rednern
auf der Liste: Zu Recht prangert Kollege Wurm den digitalen Euro an. Das ist
eine gefährliche Geschichte für Ihre Privatsphäre. Man muss sich
überlegen: Woher kommt denn diese Idee? – Von der
Europäischen Zentralbank. Dort bilden immer fünf nationale
Nationalbankchefs das Direktorium. Als diese Sache mit dem digitalen Euro
beschlossen wurde, war dort auch der Österreicher Robert Holzmann
vertreten, der auf einem FPÖ-Ticket in die Nationalbank gekommen ist. (Beifall
bei den NEOS. – Oh-Rufe bei ÖVP und Grünen. –
Abg. Stögmüller: Ich bin entsetzt!) Wir
verdanken den Freiheitlichen und ihrem Repräsentanten diesen digitalen
Euro. Danke für nichts! – So viel einmal dazu. (Beifall bei
den NEOS
sowie bei Abgeordneten von ÖVP und Grünen.)
Auf der anderen Seite befinden
sich die Grünen, die Bargeld immer mit Kriminalität in
Verbindung bringen. (Oh-Rufe bei den Grünen.) Sie sind daher
für Obergrenzen, sehen aber nicht, dass man sich, wenn man heute eine
Obergrenze von 10 000 Euro einführt – und darum geht
es ja in concreto – und wir
ein paar Jahre lang eine solch hohe Inflation haben, wie wir sie die letzten
zwei Jahre hatten, in 15 Jahren um die 10 000 Euro nicht einmal
mehr ein gescheites Fahrrad kaufen kann. So schaut es nämlich
aus! Und darum geht es Ihnen: Sie wollen schon das Bargeld
abschaffen, nur eben indirekt mit einer Obergrenze, die dann nicht indexiert wird.
(Abg. Stögmüller: Für die FPÖ ist das so! – Abg. Maurer: Das ist ein
mittelgutes Argument! – Abg. Wurm: Also habe
ich doch recht gehabt!)
Ich komme zu den Nächsten – den Sozialisten kann man keinen Vorwurf machen, die können nicht rechnen (Heiterkeit bei Abgeordneten der ÖVP – Beifall des Abg. Amesbauer) –: Zahlungsverkehr kostet immer Geld, ob Sie eine Kreditkarte haben, ob Sie eine Debitkarte haben, ob Sie ein Bankkonto haben
oder ob Sie Bargeld verwenden.
Jede Form des Zahlungsverkehrs kostet
Geld, und so kosten auch Bankomaten Geld, denn diese technischen Geräte
muss jemand aufstellen, diese technischen Geräte muss jemand warten, die
muss jemand befüllen. Wenn der Bankomat an einem Ort steht, an dem es
keine Bankfiliale gibt, müssen sicherheitshalber zwei Leute hinfahren, um
ihn zu befüllen, das müssen sie versichern, das alles muss jemand
bezahlen.
Unter Minister Stöger kam dann die grandiose Idee:
Wir schaffen die Bankomatgebühren ab! – Jetzt kann ich mit
einer Karte der Z-Sparkasse bei der R-Bank abheben und muss keinen Cent
Gebühr zahlen. (Abg. Stögmüller:
Ja, zum Glück! – Zwischenrufe der Abgeordneten Leichtfried
und Lercher.) Natürlich rentiert sich dieses Geschäft
nicht und die Bank sagt: Dann betreibe ich
den Bankomaten halt nicht! Dass es weniger Bankomaten gibt, ist eine Schuld der
SPÖ (Bravoruf bei der ÖVP), sie hat das verursacht. (Beifall
bei den
NEOS und bei Abgeordneten der ÖVP.)
An die geschätzten Zuschauerinnen und Zuschauer: Wenn
Ihnen Bargeld wichtig ist, gibt es ein gutes Mittel, sich für Bargeld
einzusetzen: Verwenden Sie es,
so oft Sie können! Das ist der beste Schutz für das Bargeld. (Beifall
bei den NEOS und bei Abgeordneten der ÖVP. – Abg. Obernosterer:
Ja, genau! So ist es!)
10.46
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Fürst. – Bitte sehr.
Abgeordnete Dr. Susanne Fürst (FPÖ): Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Finanzminister! Sehr geehrte Damen und Herren! Eine Frage, Herr Finanzminister: Können Sie bitte Bundeskanzler Nehammer daran erinnern, dass er uns im Sommer ganz fix – mehrmals auch in peinlichen Videos – versprochen hat, dass es im September einen Bargeldgipfel geben würde? Ich glaube, er hat es vergessen.
Sehr geehrte Damen und Herren! In den letzten Wochen und
Monaten lesen wir in den Schlagzeilen sehr, sehr häufig
zwei Arten von Meldungen. Die eine Art betrifft den akuten
Finanzbedarf der EU: Die EU braucht dringend Geld!, die andere: Die EU plant
mit der EZB, der Europäischen Zentralbank, die Einführung
des digitalen Euro. Diese zwei Themen haben angeblich nichts miteinander zu
tun; der digitale Euro dient ja nur der Bequemlichkeit der Bürger, der
Digitalisierung, der Gebührenfreiheit und so weiter. Die Wahrheit ist: A
stimmt: Die EU, Brüssel braucht dringend
Geld. Und B: Der digitale Euro eignet sich in Wahrheit vorzüglich als
Geldbeschaffungsmethode für Brüssel.
Die EU gibt unser Steuergeld, das Steuergeld der
Europäer aus, sie wirft es mit Händen beim Fenster hinaus. Es gibt
den Mehrjährigen Finanzrahmen
von 2021 bis 2027, der umfasst 1 200 Milliarden Euro, das reicht aber
nicht aus. Dann gibt es noch den schuldenfinanzierten Coronaaufbaufonds, der
hier eigentlich vertragsrechtswidrig eingesetzt wurde, mit 800 Milliarden Euro.
Das reicht der EU-Kommission auch nicht aus, man meldete einen Mehrbedarf von 65 Milliarden
Euro an. Warum? – Wegen der gestiegenen Zinsen für den
aufgenommenen Fonds, natürlich wegen des Migrationsmanagements und wegen Technologieprogrammen,
heißt es. Und was wiegt am schwersten? – Natürlich
die Ukrainehilfen. Sie wurden jetzt einmal
mit 17 Milliarden Euro budgetiert, aber man weiß schon, für die
nächsten Jahre muss man schon 50 Milliarden Euro bereitstellen. Es
heißt, das sei zur Deckung des unmittelbaren Bedarfs der
Ukraine, für den Wiederaufbau, die Modernisierung auf dem Weg in die
EU. All das ist von uns zu bezahlen – was auch wirklich realistisch
ist, da die USA ja schon ausgestiegen sind.
Die EU hat bisher keine Steuerhoheit, das soll sich ja ändern, man plant schon Unternehmensabgaben, man will eine höhere Beteiligung am Emissionshandelssystem und man möchte die Verschuldensregelungen weiter aufheben.
Sie braucht aber kurzfristig
Geld. Und so treibt man die Einführung des digitalen Euro voran. Wie
hängt das damit zusammen? – Ganz eng, denn man kann
sich dank des digitalen Euro auf Knopfdruck auch am Geld der EU-Bürger
bedienen. Es kommt zu einer schrittweisen Verdrängung des Bargelds.
Erst einmal ist wieder die Obergrenze im Gespräch, die
EU-Kommission möchte noch großzügig eine Bargeldobergrenze von
10 000 Euro, das links-grüne
EU-Parlament sagt dazu natürlich: Nein, 7 000 Euro sind bitte
genug an Freiheit für die EU-Bürger! Man ist schon in der
zweijährigen sogenannten Vorbereitungsphase, es soll jetzt schon die
Anwendung des digitalen Euro getestet werden.
Laut EZB soll der digitale Euro den Anforderungen in Bezug auf das Nutzungserlebnis, den Datenschutz, die finanzielle Inklusion und den ökologischen Fußabdruck gerecht werden. – Da muss man schon hellhörig werden.
Das heißt, die
Möglichkeiten sind ja dann mit dem digitalen Euro unendlich. Du willst
zweimal im Jahr mit dem Flugzeug verreisen? – Na sicher nicht! Das
zweite Mal wird nicht freigegeben und du fährst mit dem Zug. Du
möchtest dir ein Verbrennerauto kaufen? – Na sicher nicht! Das
wird nicht freigegeben,
aber natürlich, wenn du ein E-Auto kaufst, dann ist das kein Problem.
Also wie gesagt: Die Möglichkeiten sind dann
unendlich, wenn wir das einmal aufgeben. Ein ehemaliges hohes
EZB-Vorstandsmitglied sagte wortwörtlich: Der digitale Euro
ist „so unattraktiv wie alkoholfreier Wein“. Es gibt keinerlei
relevante Vorteile gegenüber dem bestehenden elektronischen Zahlungsverkehr. Wir
haben das ja alles. Das heißt, das Motiv für die Einführung ist
ein ganz anderes. Wenn man es uns offiziell einfach mit der großen Bequemlichkeit und
Gebührenfreiheit schmackhaft machen will, dass wir dann nur mehr mit der
App am Handy den gesamten Zahlungsverkehr abwickeln können
und nicht mehr mit lästigem Bargeld zahlen müssen, dann kann man nur
sagen: Ja, wir haben jederzeit Zugriff mit der App – aber nicht nur
wir, sondern
auch die Europäische Zentralbank. (Beifall bei der FPÖ.)
10.51
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordnete Fischer. – Bitte.
Abgeordnete Mag. Ulrike Fischer
(Grüne): Herr Vorsitzender! Sehr
geehrter Herr Minister! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte mich
zuerst einmal
bei allen Bürgerinnen und Bürgern herzlich bedanken, die sich immer
wieder dafür einsetzen, dass ihre Anliegen als Volksbegehren hier in
den Nationalrat kommen.
Natürlich ist Bargeld ein
wichtiges Thema. Zahlen ist ein wichtiges Thema. Ich habe drei
Töchter – meine kleinste ist neun und meine größte
ist 19.
Wenn ich zu meiner neunjährigen Tochter sage: Schau, da hast du das Taschengeld
mittels Visa-Karte!, wird das nicht funktionieren. Wenn ich auf der anderen
Seite meiner 19-jährigen Tochter sage: Da hast du Bargeld, geh
doch was zahlen!, dann wird sie sagen: Geh, Mama, ich zahle alles mit der Karte
und mit dem Handy! Das heißt, was wichtig ist, ist die Wahlfreiheit, und
diese Wahlfreiheit erhalten wir. Es wird Bargeld nicht abgeschafft. Wir
erhalten Bargeld, und das ist gut so. (Beifall bei den Grünen und bei
Abgeordneten
der ÖVP.)
Ja, Österreich ist ein
bissel altmodisch. (Abg. Belakowitsch: Was hat das mit altmodisch
zu tun?) In Österreich werden 50 Prozent aller
Transaktionen – also:
ich kaufe etwas – mit Bargeld gemacht. (Abg. Belakowitsch:
Na grandios! Willkommen in der Zukunft!) Ich war jetzt gerade in
Brünn – hören Sie bitte zu, Frau
Kollegin – und war in einem Supermarkt, und in diesem Supermarkt
konnte man nur mit Karte bezahlen. Das ist ärgerlich. Natürlich,
für Geschäfte des täglichen Lebens muss es die
Möglichkeit geben, sowohl in bar als auch mit Karte zu bezahlen.
Ich möchte noch einen wesentlichen Punkt sachlich beitragen: Ein Professor, der sich in Salzburg mit dem Thema beschäftigt hat, sagt, § 907a ABGB regelt in
Österreich bereits eine Annahmepflicht. Wir haben eine gesetzliche Annahmepflicht
in Österreich. (Abg. Wurm: Falsch, haben wir nicht! –
Abg. Belakowitsch: Haben wir ja gar nicht!) – Ja,
dann führen Sie die Gespräche mit
dem Professor in Salzburg (Abg. Wurm: Wer ist das?), der
wörtlich sagt: „Zum einen sei der Zwang zur Annahme von Bargeld
bereits in § 907a ABGB (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch
[...]) geregelt. ‚Selbstverständlich gibt es in Österreich
[...] eine Annahmepflicht‘“ – so der Salzburger
Professor Johannes Flume.
Auch OGH-Urteile weisen in die gleiche Richtung, aber natürlich müssen wir uns auf europäischer Ebene dafür einsetzen (Aha-Rufe bei der FPÖ), dass es neben dem digitalen Euro eine entsprechende Bargeldannahmeverpflichtung gibt, und da ist allen voran natürlich unser Herr Finanzminister gefordert. – Danke für Ihren Einsatz. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
10.54
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Kassegger. – Bitte.
Abgeordneter
MMMag. Dr. Axel Kassegger (FPÖ):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Finanzminister! Ja, wenn
man die Dinge zu Ende denkt –
und das versuche ich jetzt; Klubobmann Kickl hat ja gestern auch schon gesagt,
dass es vielen Parteien, ÖVP, SPÖ, Grünen vor allem, an der
Fähigkeit fehlt,
die Dinge zu Ende zu denken –,
dann muss man sagen: Selbstverständlich
ist diese Bargeldbegrenzung ein Schritt auf einem Weg, an dessen Ende
steht, dass es kein Bargeld mehr gibt und ein digitales Konto für eine
Person,
das heißt, auf einem Weg, an dessen Ende jeder von uns eine Nummer ist
und wir dann einen Systemadministrator haben, der das Konto verwaltet und
der dann unser aller soziales Verhalten
beurteilt und Zahlungen freigibt oder nicht. (Abg. Lercher: Was
tut denn der Orbán?)
Wenn Sie dann bei der falschen
Demo waren, wenn Sie das falsche Wort sagen, wenn Sie ungeimpft sind und
ähnliche Dinge – da kann man sich ja viele,
viele Sachen aus dem täglichen Leben vorstellen, bei denen einem dann das
Schaudern kommt –, dann wird die Zahlung nicht funktionieren, dann
ist nichts mehr mit bequem mit der Uhr zahlen, sondern dann gibt es eine Fehlermeldung.
Das ist das, wo Sie hinwollen.
Das ist legitim, weil das Ihrem
Gesellschaftsbild entspricht – ich zeige
jetzt vor allem auf die Grünen, aber auch auf die linke Seite (Richtung
SPÖ weisend) –, Sie wollen eine Gesellschaft, in der der
Staat, von dem Sie vorgeblich sagen, er kümmert sich um die Menschen, die
Menschen – das ist die andere Seite der
Medaille – aber von der Wiege bis zur Bahre kontrolliert, und das
ist überhaupt nicht das freiheitliche Menschenbild. Wir wollen einen
Staat,
der sich auf seine Kernaufgaben beschränkt und sonst die Menschen in Ruhe
lässt, auch in ihrer Privatsphäre. (Beifall bei der FPÖ.)
Wir wollen keinen solchen
Staat. Die technischen Möglichkeiten, die wir
heute haben, sind ja groß. Ich würde sagen, die Stasi hätte
eine Riesenfreude mit den technischen Möglichkeiten, die es heute gibt.
Man stelle sich das vor: Telefone (Abg. Lercher: Telefon hat es
aber bei der Stasi auch schon gegeben!), elektronische Gesundheitsakte,
Smartmeter – da sind wir im Übrigen auch der Meinung, es sollte
eine Opt-out-Möglichkeit für Menschen geben, die
sagen: Wir wollen das nicht! Zugegeben, die Smartmeter sind ein wichtiges
Instrument für eine erfolgreiche Energiewende, aber man muss den Menschen,
die sagen, sie wollen das nicht, diese Freiheit geben, und man muss auch
allen Menschen die Freiheit geben, dass ihnen Bargeld – und Bargeld
ist Freiheit – zur Verfügung steht. All die Argumente mit
der Kriminalitätsbekämpfung sind, bitte, Scheinargumente.
Das lassen wir so nicht gelten. Noch einmal: Das ist der erste Schritt in eine
vollkommen falsche Richtung.
Sie können uns jetzt Sand in die Augen streuen und sagen: Nein, nein, das wird immer erhalten bleiben!, aber es ist ein Schritt in die Richtung, und der Endpunkt dieses Weges ist ein digitales Konto, der totale Überwachungsstaat. China ist genannt worden – da gehen wir hin. (Abg. Lercher: Die Taliban reichen eh!)
Wir Freiheitliche wollen dort
auf keinen Fall hingehen. Es ist dieses Thema: Bargeld ist Freiheit!, nur
vermeintlich ein nebensächliches, aber nein, das ist es
nicht, da geht es um des Pudels Kern. Das ist ein ganz wichtiges Thema,
und deswegen melden sich auch fünf Freiheitliche hier zu Wort (Abg. Wurm:
Genau!): weil das für uns als Freiheitliche Partei ein wichtiges Thema
ist. Bargeld ist Freiheit, und der Erhalt dieser Freiheit ist uns ein ganz
ernstes Anliegen. (Beifall bei der FPÖ.)
Ich habe noch etwas vergessen, nämlich die Schüler des Bundesgymnasiums und Bundesrealgymnasiums Porcia aus Spittal an der Drau mit Frau Klassenvorstand Elisabeth Dieringer-Granza zu begrüßen. – Herzlich willkommen. (Beifall bei der FPÖ und bei Abgeordneten von ÖVP, SPÖ, Grünen und NEOS. – Abg. Leichtfried: Wie kann man das vergessen? – Rufe bei der ÖVP: Das ist die, die jetzt angeklagt wird, oder? Die Coronaleugnerin! Genau, da sind wir wieder beim Thema! Die alle angesteckt hat im Landtag, eine sehr vorbildliche Frau!)
10.58
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Amesbauer. – Bitte.
Abgeordneter Mag. Hannes Amesbauer, BA
(FPÖ): Herr Präsident! Herr
Finanzminister! Geschätzte Damen und Herren! Liebe Zuseher! Bargeld ist
Freiheit, und wer das Bargeld abschafft, schafft die Freiheit ab. (Beifall
bei Abgeordneten der FPÖ.) Dass sich die Freiheitliche Partei,
die die Freiheit in ihrem Namen trägt, für diese Freiheit des
Bürgers einsetzt, zeigt auch, dass
wir als einzige Partei hier mehrere Redner, nämlich fünf Redner,
aufbieten und uns für dieses berechtigte Anliegen einsetzen, das im aktuellen
Volksbegehren Thema ist, aber auch schon in vorigen Volksbegehren
immer wieder von den Bürgern unterstützt wurde.
Man sollte schon auch auf die Bürger hören und sich einmal überlegen, was eine Welt ohne Bargeld bedeuten würde: Wir hätten einerseits die totale Überwachung, den gläsernen Bürger: Jedes Seidel Bier, das ich mir irgendwo kaufe,
wird nachvollzogen!, wir haben andererseits die Situation bei Cyberattacken, Cyberangriffen,
also Ihr Kriminalitätsargument können Sie kübeln, das ist nur ein
Vorwand, um das Bargeld abzuschaffen. Wir haben natürlich
auch das Problem, dass man, wenn Schadensereignisse wie Stromausfälle,
Blackouts, Systemausfälle eintreten, keinen Zugang mehr zum Geld hat.
Also: Das Bargeld muss erhalten bleiben. (Präsidentin Bures
übernimmt den Vorsitz.)
Wenn man schon einmal in
skandinavischen Ländern war, vor allem
in Schweden – dort war ich schon öfters –, dann
weiß man: Dort ist die Barzahlung de facto unmöglich. Dort ist
das Bargeld auch nicht verboten
oder abgeschafft, aber man kann de facto nicht mehr bar zahlen, quasi nirgends
im gesamten Land, das wird nicht mehr angenommen.
Man hat aber angesichts des Krieges in der Ukraine gesehen, dass auch in Schweden die Nachfrage der Bevölkerung nach Bargeld jetzt wieder steigt, also das sieht man schon: In Krisensituationen verlassen sich die Leute auf das Vertraute.
Ich muss sagen, ich bin einer,
der immer wieder gerne mit der Kreditkarte zahlt – ich zahle aber
auch genauso gerne bar, so wie es mir gerade passt. Das ist
das, worum es geht: Wahlfreiheit für die Bürger – und
nicht eine staatliche Vorschrift von den Eurokraten, die über die
Menschen drüberfahren!
Mit diesem digitalen Euro, der
angesprochen wurde, ist es ja das Gleiche: Wer hat denn den gefordert? Welcher
Bürger hat denn das verlangt? Wer
braucht denn das, und wohin geht denn die Reise beim digitalen Euro in Wirklichkeit? –
Da bewegen wir uns dann in Richtung Sozialkreditsystem, wie
es das in China schon gibt, bei dem ein Bonus-Malus-System geschaffen wird, mit
dem der Bürger für Wohlverhalten belohnt und für Fehlverhalten
bestraft wird.
Zur SPÖ: Euer Antrag
betreffend die Bankomaten – okay, ja, das haben auch wir in unserem
Programm, dass der Zugang zu Bargeld natürlich niederschwellig erhalten
bleiben muss, da habt ihr völlig recht. Was ich aber bei der SPÖ
nicht verstehe – gleich wie bei den Grünen –, ist,
dass ihr so begeistert seid
von diesen Bargeldobergrenzen. Das Volksbegehren richtet sich ja explizit gegen
jegliche Obergrenzen, und warum gerade die Sozialisten und die Grünen
so für Obergrenzen schwärmen, kann ich nicht nachvollziehen.
Man muss ja eines wissen:
Freiheit stirbt stückweise, und diese Bargeldabschaffung ist eine
Salamitaktik. Zuerst wird der 500-Euro-Schein abgeschafft –
da kann man sagen, na ja, den hat man ja kaum –, und dann wird die
jetzt diskutierte Bargeldobergrenze von 7 000 oder
10 000 Euro eingeführt. Klar hat
man 7 000 oder 10 000 Euro im Regelfall nicht in bar mit, aber
es kann durchaus Situationen geben – zum Beispiel beim
Gebrauchtwagenkauf –, bei denen
das der Fall ist.
Das gebe ich Ihnen also mit auf die Reise:
Ist einmal eine Obergrenze eingezogen, kann diese immer weiter nach unten
herabgesetzt werden, bis am
Ende des Tages nichts mehr übrig bleibt. Das wollen wir nicht! Wir stehen
zu diesem Volksbegehren, und wir stehen zur Freiheit der Bürger. Wir stehen zu der
uneingeschränkten Möglichkeit und dem Recht, in Österreich bar
zu zahlen. (Beifall bei der FPÖ.)
11.02
Präsidentin
Doris Bures: Nun ist Frau Abgeordnete
Dagmar Belakowitsch
zu Wort gemeldet. – Bitte.
Abgeordnete Dr. Dagmar Belakowitsch
(FPÖ): Frau
Präsidentin! Herr Bundesminister! Sehr geehrte Damen und Herren, die
Sie dieser Debatte hier folgen!
Es geht um das Volksbegehren Bargeld-Zahlung: Obergrenze – Nein, und
offensichtlich haben das viele hier im Saal gar nicht verstanden,
zumindest
jene aus der linken Reichshälfte, die stets argumentieren, das Bargeld
bleibe ja,
es werde nur eine Obergrenze eingezogen. – Genau darum
geht es eben:
Wir wollen keine Obergrenze!
Meine Damen und
Herren, ich mache eine kurze Zeitreise mit Ihnen allen. Heute vor zwei Jahren
befand sich Österreich im Lockdown für Ungeimpfte. All
jene, die damals ungeimpft und auch nicht genesen waren, können sich
sicherlich noch sehr gut daran erinnern, ich kann es jedenfalls. Das war die
Zeit vor Weihnachten, und man durfte als Ungeimpfter und nicht
Genesener – als jemand, der keinen grünen Pass
hatte – nicht einkaufen gehen. Man war
aus den Geschäften ausgesperrt, das war ein bisschen kompliziert, das
musste noch kontrolliert werden.
Stellen Sie sich aber vor, es hätte damals schon den digitalen Euro gegeben: Sie hätten überhaupt keine Chance gehabt, in ein Geschäft, ich sage jetzt einmal, unter Anführungszeichen, „illegal“ hineinzugehen, das wäre denkunmöglich gewesen! Genau das ist auch das Ziel hinter diesem digitalen Euro: den Überwachungsstaat über Europa zu legen und genau zu kontrollieren, welcher Bürger wann wo einkauft! (Ruf bei der ÖVP: Geh!)
Dann gnade Ihnen Gott, wenn Sie sich nicht sozial konform verhalten haben, Sie vielleicht nicht geimpft sind, möglicherweise auf einer Demonstration waren, auf der Sie nicht hätten sein sollen, oder sonst etwas gemacht haben, das der Regierung nicht gefällt, dann dürfen Sie schon nicht mehr ins Geschäft hinein.
Das kann man ganz schön weiterspinnen,
Kollegin Fürst hat das schon ausgeführt: Die Flugreise wird abgedreht,
weil vielleicht umweltschädlich –
was weiß man schon –, aber das geht noch viel, viel weiter.
Vielleicht ist es dann irgendwann einmal so weit, dass Sie an der
Supermarktkasse stehen und vielleicht noch Brot kaufen dürfen und Milch
auch noch, aber bei der Schokolade heißt es dann: Nein, nein, so weit
sind wir nicht; Sie nicht mehr! (Ruf bei
der ÖVP: Um Gottes willen!)
Das ist genau das
Thema, und das haben die Österreicher erkannt. Sie, meine Damen und
Herren, die Sie da jetzt den Kopf schütteln – auch bei
der ÖVP –, waren genauso dabei, als den Österreichern die
Freiheit genommen wurde (Abg. Schmuckenschlager: Das war
aber 38!): die Freiheit, darüber
zu entscheiden, was sie mit ihrem Körper machen! Genau da waren Sie dabei,
genau das war es. (Zwischenruf des Abg. Obernosterer.)
Dieser digitale
Euro ist deswegen so gefährlich, weil es nicht um die Bankomatkartenzahlung
geht, wie es sie derzeit gibt, nein: Beim digitalen Euro, meine Damen und
Herren, geht es um reine Überwachung und Kontrolle!
(Ruf bei der ÖVP: So wie es der Herbert Kickl will!)
Wenn Sie alle
hier jetzt nervös werden: Ich weiß schon, dass Ihnen das Spaß
gemacht hat, die Österreicher einzusperren. Sie haben das mit einer
Leichtigkeit hier beschlossen, Sie haben die Kinder aus den Schulen
ausgesperrt, Sie haben die Leute aus
den Geschäften ausgesperrt, Sie haben bis zur Impfpflicht
alles durchgezogen. (Zwischenruf der Abg. Voglauer.)
Österreich
war da tatsächlich - - (Abg. Jeitler-Cincelli: Jetzt
haben Sie gerade der „Kronen Zeitung“ gesagt, Sie wollen mehr
Respekt in diesem Haus haben,
mehr Wertschätzung – das haben Sie gerade ...!) –
Ich frage mich ja nur, was das mit Respekt zu tun hat, irgendein sinnloser Zwischenruf.
(Zwischenrufe
bei der ÖVP.) – Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen die
Nervosität. (Ruf bei der ÖVP: ... Verfolgungswahn ist ja
krankhaft!)
Sie alle können sich erinnern, was vor
zwei Jahren in diesem Land los war. Sie alle wissen, dass diese Regierung aus
ÖVP und Grünen mit Unterstützung der SPÖ
dieses Land in einen Dauerlockdown geschickt hat. Sie können sich
erinnern, dass es in diesem Land möglich war, dass vier Parteien hier
nahezu geschlossen eine Impfpflicht eingeführt haben – eine
Impfpflicht mit einem Impfstoff, dessen Folgen wir tatsächlich heute
noch überall haben
und sehen! (Zwischenruf des Abg. Matznetter.)
Diese vier Parteien werden offensichtlich nicht klüger, sondern ganz im Gegenteil, jetzt soll auch noch der digitale Euro kommen, damit man Sie weiterhin knechten kann, damit man Ihnen weiterhin Ihre Freiheit nehmen kann und damit man Sie in Ihrem Handeln beschränken kann.
Wir
Freiheitliche, wir werden uns mit aller Kraft dagegenstemmen und wir werden
uns auch nicht scheuen, uns da mit Brüssel anzulegen, das kann ich
Ihnen versichern. (Beifall bei der FPÖ. – Abg. Michael Hammer:
Die reden aber nicht einmal mit euch! – Weitere Zwischenrufe bei der
ÖVP.)
Es wird daher dringend notwendig
sein – und da können Sie noch so schreien –: Es wird
der Volkskanzler Herbert Kickl sein, der sich gemeinsam mit der Freiheitlichen
Partei auch mit Brüssel anlegt, um die Freiheit der Österreicherinnen
und Österreicher zu erhalten. (Beifall bei der FPÖ. – Abg.
Leichtfried:
Das war wohl die sinnloseste Rede ...!)
11.07
Präsidentin Doris Bures: Nun ist Herr Abgeordneter Kai Jan Krainer zu Wort gemeldet. – Bitte.
Abgeordneter Kai Jan Krainer (SPÖ): Mehrere Redner der Freiheitlichen haben jetzt die Frage gestellt, wieso die Sozialdemokraten über Bargeldobergrenzen nachdenken. (Abg. Amesbauer: Ja, ich habe das gefragt!) Das tun ja gar nicht wir, das gibt es in ganz Europa.
Wenn man den
Experten zum Thema Bargeld, die wir im Hearing hatten, genau zugehört hat,
dann weiß man, dass es einen Bereich gibt, in dem Bargeld
eine große Rolle spielt, und das ist das ganze Drogengeschäft. Ja,
wir sind für Bargeld und für die Freiheit, mit Bargeld zu
zahlen – aber wir sind nicht
für die Freiheit von Drogengeld. (Ruf bei der
FPÖ: ... Drogen kaufen ... auch mit Bitcoins!)
Ich stelle mir aber die Frage, wieso die Freiheitlichen sich so vehement gegen Bargeldobergrenzen aussprechen; ich fürchte, das könnte sehr stark damit zu tun haben, dass ja bekannt ist, dass die Vorsitzenden der Freiheitlichen gerne Sporttaschen voll mit Bargeld – ich weiß nicht, was das war, Bestechungsgelder, Schmiergelder – haben. (Beifall bei der SPÖ sowie bei Abgeordneten von ÖVP und Grünen.)
Ich sage Ihnen eines: Freiheit, mit Bargeld zu bezahlen, ja, aber nein zur Freiheit, dass FPÖ-Parteivorsitzende Schmiergelder in Sporttaschen im Kofferraum spazieren führen! (Abg. Amesbauer: Was ist mit den Sozialisten in Brüssel?)
Darüber sollten Sie auch einmal
nachdenken, dass Sie in Wahrheit genau
das schützen wollen – wir sicher nicht! (Beifall bei der
SPÖ und bei Abgeordneten der Grünen. – Zwischenruf des
Abg. Kassegger.)
11.08
Präsidentin Doris Bures: Zu Wort ist dazu nun niemand mehr gemeldet. Damit ist die Debatte geschlossen.
Wünscht die Frau
Berichterstatterin ein Schlusswort? – Das ist nicht der
Fall.
Wir kommen damit zur Abstimmung über den Antrag des Finanzausschusses, seinen Bericht 2374 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen.
Wer sich dafür ausspricht, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. – Dieser Bericht ist einstimmig zur Kenntnis genommen.
Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Sicherung der Bargeldversorgung und der Annahmepflicht von Bargeld“.
Wer spricht sich für diesen Entschließungsantrag aus? – Das ist die Minderheit, abgelehnt.
2. Punkt
Bericht des
Finanzausschusses über die Regierungsvorlage (2305 d.B.):
Bundesgesetz, mit dem ein Finanzausgleichsgesetz 2024 erlassen wird sowie das
Finanzausgleichsgesetz 2017, das Umweltförderungsgesetz, das
Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz, das Transparenzdatenbankgesetz 2012 und das
Bildungsinvestitionsgesetz geändert werden (2375 d.B.)
3. Punkt
Bericht des Finanzausschusses über die Regierungsvorlage (2306 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Transparenzdatenbankgesetz 2012 geändert wird (2376 d.B.)
4. Punkt
Bericht des Finanzausschusses über die Regierungsvorlage (2314 d.B.): Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG über die Etablierung einer gebietskörperschaftenübergreifenden Transparenzdatenbank (2377 d.B.)
Präsidentin Doris Bures: Wir gelangen zu den Punkten 2 bis 4 der Tagesordnung, über welche die Debatten unter einem durchgeführt werden.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Erster Redner: Herr Abgeordneter Maximilian Linder. – Bitte.
Abgeordneter
Maximilian Linder (FPÖ): Sehr
geehrte Frau Präsident! Herr Minister! Geschätzte Kolleginnen,
geschätzte Kollegen! Sehr geehrte Zuhörerinnen und
Zuhörer auf der Galerie und zu Hause! Das Finanzausgleichsgesetz war sehr
lange in Verhandlung und wurde zu guter Letzt mit großem Pomp
fast gefeiert. Wir von den Freiheitlichen sehen das Ganze aus Sicht der Gemeinden
sehr kritisch.
Ein Punkt ist zum Beispiel der
Zukunftsfonds, jährlich mit 1,1 Milliarden Euro gestützt oder
befüllt und in erster Linie für Kinderbetreuung, Elementarpädagogik,
Wohnen, Klima und Umwelt gedacht. (Abg. Maurer: Da geht es um
Zukunft, das ist natürlich schlimm!) Die Richtlinien dazu werden von
den Ländern erlassen. Damit
Sie, liebe Bürger, das auch verstehen: Dieser Finanzausgleich,
dieses Geld, steht den Gemeinden zu. Faktum ist (Abg. Kollross: Sie
kriegen es nicht!), dass plötzlich die Länder eine Richtlinie
erlassen,
wir uns anstellen und Bitte sagen müssen, damit wir das Geld bekommen.
Immer wieder erleben wir
Gemeinden es, dass neue Projekte gefordert werden, neue Ziele gesetzt werden
und es eine Anschubfinanzierung gibt, und dann
wir Gemeinden mitfinanzieren müssen und schauen müssen, dass wir das
Geld irgendwo aufbringen, um diese Projekte dauerhaft abzusichern. Alle haben
Ideen dazu, was die Gemeinden tun sollen und was die Gemeinden investieren
sollen. Die Endfinanzierung beziehungsweise die dauerhafte Finanzierung
fehlt uns aber dann.
Ein schönes Beispiel ist
das Thema Communitynurse, ein sehr gutes Projekt, das in den Gemeinden sehr gut
angenommen wird, ein Pilotprojekt, das zu 100 Prozent vom Bund finanziert
wird. Wir Gemeinden haben die Organisation zu tragen und sehr viel Arbeit
damit. Jetzt aber wissen wir: Das Projekt
läuft aus, und plötzlich wird der Bund nur noch zwei Drittel
finanzieren, ein Drittel davon
müssen wir Gemeinden finanzieren. Das ist etwas, wofür wir eigentlich gar
nicht zuständig sind; wir haben aber ein Drittel zu finanzieren.
Beim vorherigen Tagesordnungspunkt wurde heute die
Bargeldversorgung diskutiert. Wie selbstverständlich verlangt der
Gouverneur der Nationalbank
in jeder Gemeinde einen Bankomaten, aber die Gemeinden haben den mitzufinanzieren.
Wir haben den mitzufinanzieren. Dass wir die Bargeldversorgung finanzieren,
Kollege Kollross, ist unser Problem. Das wird uns, ohne mit der Wimper zu
zucken, aufgedrückt, und es wird gesagt: Ihr müsst es
machen! –
Das hat System, bitte. Herr Minister, das wissen Sie ganz genau. Immer
wieder fehlt uns Gemeinden die dauerhafte Basisfinanzierung für solche Projekte. Jeder hat Ideen, wir sollen sie finanzieren.
Ein weiteres schönes Beispiel ist die
Siedlungswasserwirtschaft. Es wird ganz groß verkauft: Die Zuschüsse
für die Siedlungswasserwirtschaft durch
den Landwirtschaftsminister werden von 80 auf 100 Millionen Euro pro Jahr
erhöht. Zusätzlich kommen einmalig 100 Millionen Euro dazu. Das
hört sich sehr gut an. Faktum ist, dass der Landwirtschaftsminister
verpflichtet ist, diese Projekte mitzufinanzieren, nur war dieser Fonds bis
jetzt dauerhaft unterdotiert. Es kommt zu jahrelangen Rückstellungen der
Förderungsauszahlungen. Wir kommen nicht zu dem Geld, wir müssen bei
der Umsetzung der Projekte auf das Geld warten. Jetzt holt man das
Versäumnis nach und rühmt sich damit,
was man für die Gemeinden tut. – Nein, das ist eine
Verpflichtung, der ihr schon längst nachkommen müsst und die ihr
schon längst erfüllen müsst.
Ich bringe auch ein kleines Beispiel aus Kärnten zu den
Folgen des Finanzausgleichs. Für mich ist nämlich bis heute noch
unerklärlich, wie der Gemeindebund und der Städtebund diesem
Finanzausgleich zustimmen konnten.
(Ruf bei der ÖVP: Die FPÖ hat auch ...!)
In meiner Gemeinde, in der ich Bürgermeister bin, haben
wir ein Budget von rund 4 Millionen Euro. (Abg. Hörl: Bisschen
sparen!) Seit 18 Jahren schaffen wir es, das Budget
auszugleichen. Von 2023 auf 2024 steigen unsere Umlagenbelastungen um 18 Prozent. Das ist ein Mehrbetrag von
180 000 Euro. (Zwischenruf der Abg. Götze.)
Das ist nicht Geld, über das wir mitentscheiden. Das wird uns vom Land und
vom Bund aufgedrückt. Wir sind verantwortlich
dafür. Im Gegenzug steigen unsere Ertragsanteile an den Steuern um
0,6 Prozent mit dem Ergebnis, dass wir nach 18 Jahren erstmals
Abgangsgemeinde sind.
Deshalb ist mir
unerklärlich, wie der Finanzausgleich die Zustimmung
von Gemeindebund und Städtebund bekommen konnte, und noch unerklärlicher,
dass Städtebund und Gemeindebund plötzlich in Kärnten gemeinsam
mit der Gewerkschaft dazu aufrufen, gegen den Finanzausgleich und gegen das
Land Kärnten zu demonstrieren – das ist ein Kärntner
Thema, das ich trotzdem zum Besten geben will – und es dann
plötzlich eine Jubelmeldung gibt und
es heißt: Na ja, ihr kriegt 11 600 Euro zum Verkehrsverbund
dazu, und ihr kriegt beim Bildungsfonds 15 Millionen Euro.
Auch da dasselbe: Der
Bildungsfonds wurde ausgeräumt, weil das Land Kärnten neue Gesetze
gemacht hat und plötzlich ganz viele Kindergartengruppen gebraucht wurden.
Man war nicht in der Lage, diesen Bildungsfonds zu dotieren. Das heißt,
die Gemeinden hätten investieren müssen, hätten etwas tun
müssen und kriegen das Geld vom Bund nicht.
Wir sehen bei all diesen Dingen, dass man zwar Ideen hat, was man tun kann, aber nicht in der Lage ist, das Geld dafür zu stellen. Die restlichen Maßnahmen dieser Einigung – es ist auch ganz interessant, es wurde ja plötzlich die Einigung zwischen dem Land Kärnten und dem Städtebund und dem Gemeindebund verkündet – sind einzig und allein Maßnahmen zum Ziel der Mehrbelastung der Bevölkerung: zusätzliche Steuern in Form von Leerstandsabgaben und Infrastrukturabgaben. Wir sollen die Zweitwohnsitzabgaben erhöhen, wir sollen Terminalabgaben einführen, wir sollen die Vergnügungsabgabe für die Veranstaltungen erhöhen.
Ich glaube, meine Damen und
Herren, es ist anscheinend wirklich das Ziel
von Bund und Land, die Gemeinden auszuhungern, damit wir neue Steuern einführen
müssen, damit wir die Bürger noch mehr belasten müssen und den
Bürgern noch mehr Geld aus der Tasche ziehen müssen.
Dieselbe Vorgangsweise macht der Staat auch beim ORF. Der ORF ist nicht in der Lage, zu sparen, ist nicht in der Lage, sein Budget in den Griff zu bekommen. Dann geht man ganz einfach her und stellt die Finanzierung des ORF um und macht eine ORF-Haushaltsabgabe. Das heißt, anstelle zu sparen, belastet man die Österreicher:innen.
Deshalb bringe folgenden Entschließungsantrag ein:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Maximilian Linder, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Sofortentlastung: Nein zu ORF-Zwangssteuer und CO2-Strafsteuer!“
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, mit welcher die Einführung der ORF-Steuer oder ORF-Haushaltsabgabe revidiert wird. Ferner wird die Bundesregierung aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, mit welcher die CO2-Abgabe durch das Außerkrafttreten des Nationalen Emissionszertifikatehandelsgesetzes 2022 abgeschafft wird.“
*****
Bezeichnend für diese
Vorgangsweise und für diese Bundesregierung ist, dass es das Ziel ist, die
österreichischen Bürger mit neuen Abgaben und neuen
Steuern zu belasten, damit das Geld dann woanders ausgegeben werden kann.
Deshalb bringe ich einen zweiten Entschließungsantrag ein:
Entschließungsantrag
der Abgeordnete Maximilian
Linder, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Veto gegen Eröffnung
von EU-Beitrittsgesprächen mit der Ukraine sowie gegen
neue Milliardenzahlungen an das Selenski-Regime“
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, die von der Europäischen Kommission geforderte Aufstockung des Mehrjährigen Finanzrahmens, inklusive der geplanten Fazilität für die Kriegspartei Ukraine in Höhe von 50 Milliarden Euro, abzulehnen und diesem Vorschlag mit einem Veto Österreichs zu begegnen.
Darüber hinaus wird die Bundesregierung aufgefordert, sich im Rahmen der Institutionen der Europäischen Union gegen die Eröffnung von EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine auszusprechen, sowie eine Beendigung der Sanktionen gegen die Russische Föderation einzufordern.“
*****
Meine Damen und Herren, wir Freiheitliche stehen
dafür, dass in erster Linie unsere Bürger zu gelten haben und dann
erst alle anderen. Deshalb
ist es höchste Zeit für einen Volkskanzler Herbert Kickl. (Beifall
bei der FPÖ.)
11.19
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
des Abgeordneten Linder
und weiterer Abgeordneter
betreffend Sofortentlastung: Nein zu ORF-Zwangssteuer und CO2-Strafsteuer!
eingebracht in der 245. Sitzung des Nationalrates im Zuge
der Debatte zum Bericht des Finanzausschusses über die Regierungsvorlage
(2305 d.B.): Bundesgesetz,
mit dem ein Finanzausgleichsgesetz 2024 erlassen wird sowie das
Finanzausgleichsgesetz 2017, das Umweltförderungsgesetz, das Wohn-
und Heizkostenzuschussgesetz, das Transparenzdatenbankgesetz 2012 und das
Bildungsinvestitionsgesetz geändert werden (2375 d.B.) (TOP 2).
Der Finanzausgleich ist den Erläuterungen zur
Regierungsvorlage zufolge als Gesamtkompromiss zu verstehen, „der nur als
Summe aller Regelungen der finanziellen Beziehungen zwischen den
Gebietskörperschaften verstanden werden kann und mit dem
alle offenen Punkte der abgelaufenen Finanzausgleichsperiode erledigt
sind“. Die neue ORF-Zwangssteuer und die CO2-Strafsteuer werden
dabei jedoch ausklammert, obwohl sie eine massive Mehrbelastung der
Bevölkerung
zugunsten des Bundes bedeuten. Vor diesem Hintergrund gilt es der Kritik der Österreicherinnen und Österreicher Ausdruck zu verleihen.
Nein zur ORF-Zwangssteuer
Die Bundesregierung von ÖVP und Grünen
wäre in Zeiten der Teuerung gefordert, die Anliegen der Bevölkerung
ernst zu nehmen. Die Bezieher kleiner Einkommen
und in zunehmendem Maße auch der Mittelstand geraten unter immer
stärkeren finanziellen Druck. Viele
Menschen können sich das Leben nicht mehr leisten
und müssen bereits bei Grundbedürfnissen wie Wohnen, Heizen,
Essen und Trinken massive Abstriche machen. Statt die Menschen zu entlasten,
sollen jedoch ab
dem 1.1.2024 alle Haushalte Monat für Monat netto 15,30 Euro an den ORF
überweisen. In der Steiermark (4,79 Euro), Burgenland (4,59 Euro),
Kärnten
(4,18 Euro) und Tirol (3,26 Euro) kommt noch eine ebenfalls monatliche
Länderabgabe dazu. Insgesamt fallen durch die ORF-Zwangssteuer Kosten
von bis zu
rund 20 Euro pro Monat an.
Künftig müssen außerdem rund 525.000
zusätzliche Haushalte für den ORF zahlen. Ferner werden auch rund
100.000 Unternehmen ab 2024 zur Kasse gebeten.
Eine saftige Erhöhung kommt auch auf 206.000 Haushalte zu, die bisher zwar
GIS, aber nur den deutlich geringeren Radiobeitrag zahlten. Für diese
Personen verdoppelt sich nun sogar der Beitrag von 6,31 Euro auf
mindestens 15,30 Euro im Monat. In Summe nimmt der ORF damit mindestens
rund 60 Millionen Euro
mehr im Jahr ein. Laut manchen Schätzungen könnten die
Jahreseinnahmen des ORF durch die Haushaltsabgabe sogar auf bis zu 800
Millionen Euro steigen – das
wären dann sogar mehr als 100 Millionen Euro mehr als derzeit!
Die notwendige Motivation zu Reformen und
Objektivität entsteht beim ORF durch die geplante Haushaltsabgabe an
keiner Stelle. Wenn jeder Österreicher ohnehin zwangsweise
für den ORF bezahlen muss, hat man in den gut dotierten Chefetagen
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks keinerlei Grund, für eine faire
und
vor allem konkurrenzfähige Berichterstattung zu sorgen, die auch der
verfassungsmäßig verankerten Unparteilichkeit gerecht wird.
Es braucht daher anstelle
eines aufgeblähten Rundfunks einen verschlankten „Grundfunk“,
der den grundlegenden Bildungsauftrag wahrnimmt. Gerade weil Millionen Österreicher
einer ungewissen Zukunft in Zeiten von Teuerung, Krieg und Inflation
entgegenblicken, darf es unter keinen Umständen zu einer weiteren
Steuer-Mehrbelastung für die Bürger in Form einer ORF-Haushaltsabgabe
kommen.
Nein zur CO2-Strafsteuer
Als ob damit die heimische
Bevölkerung nicht schon genug belastet wäre,
hat die Bundesregierung von ÖVP und Grünen mit der sogenannten
„ökosozialen“ Steuerreform bewiesen, dass sie vor weiteren
enormen Belastungen für die Österreicherinnen und Österreicher
nicht zurückschreckt. Anstatt in den Markt einzugreifen, um die Menschen
zu entlasten, wird aus ideologischen
Gründen zusätzlich verteuert.
Bis Mitte Dezember 2023 muss ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner im Bundesgesetzblatt kundmachen, wie hoch die CO2-Bepreisung 2024 ausfallen wird. Noch im Oktober betonte er vollmundig: „Ich bin ganz klar gegen neue Steuern“. 1 Dem erteilte jedoch ÖVP-Jugendstaatsekretärin Claudia Plakolm eine Absage: Die stufenweise Erhöhung des CO2-Preises sei entschieden. 2
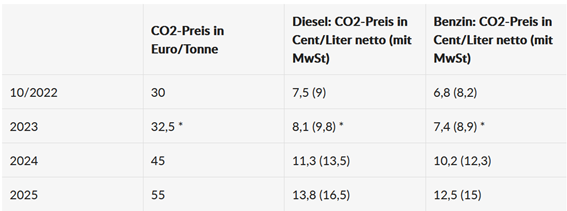
Quelle: https://www.oeamtc.at/thema/verkehr/mineraloelsteuer-co2-bepreisung-17914742
Medienberichten zufolge ist
mit einem Anstieg des Preises pro Tonne CO2 von derzeit 32,5 auf
künftig 45 Euro zu rechnen. 3 Das bedeutet eine massive
Verteuerung
an den Zapfsäulen. Der Preis pro Liter Diesel steigt inklusive Mehrwertsteuer auf 13,5 Cent,
der von Benzin auf 12,3 Cent.
Bis 2025 soll der CO2-Preis weiter auf 55 Euro pro Tonne steigen. Über die Höhe des vermeintlich kompensierenden Klimabonus wird erst Mitte des Jahres 2024 entschieden. „Die […] CO2-Abgabe in Österreich wird – trotz Klimabonus – die Inflation zusätzlich treiben“, ist WIFO-Chef Felbermayr überzeugt: „Ja, sie wird weitergegeben werden und die Preise nochmal in die Höhe treiben.“ 4
So werden sich die Kosten für das Heizen und die Mobilität weiter massiv erhöhen und in Folge viele Menschen vor enorme finanzielle Probleme stellen. Wohnen, Heizen und Autofahren drohen so nahezu unleistbar zu werden.
Statt die Bevölkerung weiter zu belasten und damit die Inflation in die Höhe zu treiben, braucht es eine Sofortentlastung. Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, mit welcher die Einführung der ORF-Steuer oder ORF-Haushaltsabgabe revidiert wird. Ferner wird die Bundesregierung aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, mit welcher die CO2-Abgabe durch das Außerkrafttreten des Nationalen Emissionszertifikatehandelsgesetzes 2022 abgeschafft wird.“
1 https://www.puls24.at/news/politik/brunner-praesentiert-budget-knapp-21-milliarden-neue-schulden/310770
2 https://www.kleinezeitung.at/politik/innenpolitik/6324663/Claudia-Plakolm_OeVP-will-trotz-Kritik-an-hoeherer-COBepreisung
3 https://kurier.at/politik/inland/neuer-co2-preis-ab-2024-wird-sprit-um-mehr-als-12-cent-pro-liter-verteuern/402662015;
https://bauernzeitung.at/
preise-fuer-treibstoffe-steigen-ab-2024-wegen-co2-steuer/
4 APA0155/17.02.2022
* Für
die steigende zusätzliche CO2-Bepreisung gibt es einen sogenannten
"Preisstabilitätsmechanismus". Steigen die Preise für
fossile Energie für private Haushalte deutlich, dann steigt die
zusätzliche CO2-Bepreisung trotzdem, aber nicht in vollem Umfang. Sinken
diese Preise wiederum deutlich, dann ist
sogar eine Verdoppelung der Steigerung geplant. Trotz der ungebremsten Teuerung
seit 2022 wurden die Spritpreise auch 2023 aus ideologischen Gründen um knapp
einen Cent verteuert.
*****
Präsidentin
Doris Bures: Der
Entschließungsantrag betreffend Einführung der ORF-Steuer oder
ORF-Haushaltsabgabe ist ausreichend unterstützt und
steht daher auch mit in Verhandlung.
Der Entschließungsantrag betreffend EU-Beitrittsgespräche mit der Ukraine ist in keinem inhaltlichen Zusammenhang zum heutigen Tagesordnungspunkt.
Ich weise darauf hin, dass wir erst in der letzten Präsidialsitzung darüber diskutiert haben, dass dieser inhaltliche Zusammenhang herzustellen ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann das selbstverständlich als Selbständiger Antrag auch eingebracht werden. Dieser Antrag wird nicht zugelassen.
Nächster Redner ist Herr Klubobmann August Wöginger. – Bitte.
Abgeordneter
August Wöginger (ÖVP): Frau
Präsidentin! Herr Bundesminister! Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Zum Ersten, Frau Präsidentin,
danke ich Ihnen, dass das, was wir in der Präsidialkonferenz einhellig
besprochen haben, auch zur Umsetzung gebracht wird. Wir sollten uns auch ernst
nehmen, indem wir Unselbständige Entschließungsanträge zu
Themenbereichen einbringen, mit denen sie in einem Zusammenhang stehen. Danke
für
diese korrekte Vorsitzführung. (Beifall bei der ÖVP sowie bei
Abgeordneten von SPÖ und Grünen.)
Zum Zweiten: Man müsste gleich mehrere
tatsächliche Berichtigungen
machen. Kollege Linder ist Bürgermeister und ich schätze ihn an und
für sich sehr; aber, Herr Kollege Linder, Sie sagen aber immer nur einen
Teil
der Wahrheit, so wie es halt in die Kickl-Doktrin passt.
Wie ist das wirklich mit der Haushaltsabgabe für den
ORF? – Es gibt drei Millionen GIS-Gebührenzahlerinnen
und -zahler. Das ist der derzeitige
Stand. Für die GIS-Gebühr hat man über 22 Euro pro Monat
bezahlt. Jetzt bezahlen diejenigen, die immer ordentlich ihre Abgaben geleistet
haben, nicht mehr 22 Euro, sondern gut 15 Euro. Das
heißt, das ist eine Senkung dieser Gebühr, es wird weniger für
drei Millionen GIS-Gebührenzahlerinnen und -zahler.
Das ist die Wahrheit.
Das könnte man unter tatsächlicher Berichtigung laufen lassen, aber ich habe es in meine Rede eingebaut. Bleiben Sie bei der Wahrheit, Herr Kollege Linder, wie wir es eigentlich auch von Ihnen gewohnt sind! (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
Nun aber zum Finanzausgleich: Der Finanzausgleich ist
eigentlich ein riesiges Werk, eine Vereinbarung zwischen dem Bund,
den Bundesländern,
dem Städte- und dem Gemeindebund. All diese Teilnehmer, die über
Monate die Verhandlungen führen, unterschreiben dieses Paktum auch. Wir
beschließen heute das Finanzausgleichsgesetz. Es muss dem natürlich
auch eine 15a-Vereinbarung zugrunde liegen, weil die Grundlagen dieses
Gesetzes auch in allen
neun Bundesländern abgesegnet und beschlossen werden müssen.
Jetzt kommt die nächste Krux der Freiheitlichen Partei: Die regieren in drei Bundesländern. (Abg. Kollross: Mit euch!) – Na, das ist ja auch kein Problem, um
Gottes Willen. (Heiterkeit und Widerspruch bei der SPÖ.) – Ja warum sollten wir nicht? Ihr habt ja auch schon mit den Freiheitlichen regiert. Also tu nicht so! Ich kann mich noch gut erinnern: Im Burgenland hat es eine rot-blaue Koalition gegeben. Im Übrigen: Die Ersten, die eine rot-blaue Koalition ins Leben gerufen haben, waren von der SPÖ (Beifall bei Abgeordneten der ÖVP), zuerst unter Kreisky – von der FPÖ geduldet –, und dann hat es ja mit Sinowatz eine rot-blaue Koalition gegeben. (Abg. Scherak: Die waren aber ein bisschen anders damals!) Also wenn demokratische Wahlen ein derartiges Ergebnis ermöglichen, was ist dann bitte für demokratisch gesinnte Menschen das Problem, wenn man derartige Koalitionen macht?! Wir haben sie in Oberösterreich, Niederösterreich und Salzburg.
Herr Kollege Linder, Sie haben jahrelang in Kärnten den
Landeshauptmann gestellt. Dort hat es zuständige Landesrätinnen
und Landesräte Ihrer Partei gegeben. Die waren auch für
Kinderbetreuung, Wohnen, Umweltschutzmaßnahmen zuständig. Die
Landesräte und Landesrätinnen von der FPÖ, die jetzt tätig
sind, verwalten auch diese Landesbudgets, und sie müssen
dem auch zustimmen.
Im Übrigen: Auch Ihre Abgeordneten, mit denen Sie in
den Landesparteivorständen zusammensitzen und über die Strategie
der FPÖ beraten, werden in den Landtagen
die Zustimmung geben. Sonst kann dieses Paktum nicht zur Gänze
in Kraft treten. Also eines geht nicht, meine Damen und Herren von der
FPÖ: hier die Kritik aussprechen und in den eigenen Bundesländern, wo
Sie mitregieren, zustimmen. Da passt etwas nicht zusammen, und daher kann
man
nicht so argumentieren. (Beifall bei der ÖVP sowie der Abg. Götze.)
Zum Zweiten verstehe ich eines auch nicht. Wenn man sich den
letzten Finanzausgleich aus dem Jahr 2016 hernimmt, dann sieht man:
Damals hat es zusätzliche 300 Millionen Euro –
insbesondere für den Bereich Pflege, Gesundheit – gegeben.
Es ist damals abgefeiert worden, dass zusätzliche 300 Millionen Euro
in diesem Finanzausgleich beinhaltet waren. Wir haben jetzt in diesem
Finanzausgleich zusätzlich 2,4 Milliarden Euro pro Jahr für
Länder
und Gemeinden. Das ist frisches Geld, das ist wirklich neues Geld, das da dazukommt.
Ich möchte auch noch kurz erläutern, wo es
hinkommt. Das ist acht Mal so viel wie das, was vor sieben Jahren abgeschlossen
wurde. Jetzt wissen wir –
das ist richtig –, dass natürlich auch die Gemeinden unter den
explodierenden Kosten, vor allem im Spitalsbereich, in der Pflegefinanzierung,
leiden.
Wir helfen da aber, obwohl wir eigentlich gar nicht zuständig sind. Wir
halten die Verfassung schon ein und bekennen uns zu einem föderalen Staat.
Es ist
nun einmal so, dass wir für den Pflegebereich eigentlich laut Verfassung
nicht zuständig sind, für die Spitalsfinanzierung, bei der wir unsere
Anteile zu
leisten haben, schon.
Daher möchte ich den Fonds im Finanzausgleich kurz
erläutern: nächstes Jahr Spitalsfinanzierung: plus 550 Millionen
Euro. Die Gesundheitsreform –
und es ist eine Reform, die hier gestern abgesegnet wurde –, durch
die es zusätzliche Kassenarztstellen, eine Entlastung im ambulanten
Bereich gibt, hilft den Bundesländern und damit auch den Gemeinden am
meisten, weil wir auch
in die Sozialversicherung hineininvestieren. Die ersten
100 Kassenarztstellen, um die man sich auch in manchen Bereichen der
Sozialversicherung so gesorgt
hat, sind jetzt ausgeschrieben. Das heißt, wir setzen das um, was wir versprochen
haben. Bundeskanzler Nehammer hat für heuer noch 100 Kassenarztstellen
angekündigt. Sie sind jetzt von der ÖGK ausgeschrieben worden, und die
Finanzierung ist in diesem Haus beschlossen worden. (Beifall bei der
ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
Zur Pflege: Das ist überhaupt mein Leibthema als
Sozialsprecher, der ich bereits seit 14 Jahren sein darf. Wir haben
1,1 Milliarden Euro im Pflegefonds.
Der Pflegefonds ist ein gutes Instrument. Das haben wir unter dem damaligen
Minister Hundstorfer gemeinsam mit der SPÖ verabschiedet. Ich kann
mich noch gut an die Gespräche erinnern. Da war irgendwo auch eine gewisse
Skepsis da: Na, wird sich dieser Fonds gut entwickeln? Wie wird das
ausschauen? – Er hat sich gut entwickelt. Wir haben heuer, im Jahr 2023,
455 Millionen Euro im Pflegefonds, nächstes Jahr 1,1 Milliarden Euro, und es ist festgelegt, dass in den nächsten Jahren dieser Pflegefonds um rund 4,5 Prozent infolge der Inflationsprognose plus 2 Prozent separat aufgestockt wird. Das ist gestern auch beschlossen worden.
Wir haben die 24-Stunden-Betreuung, bei der wir im Bereich der selbstständigen Tätigkeit von 550 Euro auf 800 Euro Unterstützungsleistung für Menschen, die eine 24-Stunden-Betreuung benötigen, aufgestockt haben.
Der Gehaltsbonus: Für alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die in Gesundheits- und
Pflegeberufen tätig sind, kommt ein Bonus von rund 2 000 Euro brutto
pro Jahr dazu. Das ist für das Pflegepersonal im Durchschnitt ein
15. Gehalt, weil wir diese Arbeit schätzen, respektieren und sie auch
anerkennen wollen,
und weil das, was in den Spitälern und im Pflegebereich, auch im mobilen
Bereich, geleistet wird, wirklich eine herausfordernde Tätigkeit
ist – ein Danke auch an diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (Beifall
bei der ÖVP sowie der
Abg. Maurer.)
Wir haben einen Ausbildungsbonus von 600 Euro eingeführt. Das ist alles zu zwei Dritteln vom Bund, zu einem Drittel vom Land finanziert. Zu diesen 600 Euro Ausbildungsbonus gibt es auch eine Einigung mit allen Referent:innen auf der Landesebene.
Wir haben
Arbeitsbedingungen verbessert. Es gibt analog zum Bundesdienst
jetzt die sechste Urlaubswoche ab dem 43. Lebensjahr in allen
Pflegebereichen, egal wie lang man in seinem Beruf schon tätig ist.
Zu den Communitynurses, weil sie
angesprochen wurden, Herr Kollege Linder: Die
sind eine positive Ergänzung zu den Strukturen, die wir bereits haben.
Und es stimmt nicht: Wir vom Bund
haben um über 150 Millionen Euro den Pflegefonds
zusätzlich aufgestockt, sodass für diese Maßnahmen den
Ländern und Gemeinden keine Mehrkosten entstehen. Das ist ein Nuller. Dort
entstehen keine Mehrkosten. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten
der Grünen. – Zwischenruf des Abg. Linder.) Wir haben extra diese Gelder dazugegeben, damit bei der Verlängerung der Einrichtung der Communitynurses keine zusätzlichen Kosten auf die Gemeinden abgewälzt werden können.
Zum Schluss möchte ich noch
auf den Zukunftsfonds eingehen. Der ist überhaupt ein neues Instrument,
das wir im Finanzausgleich haben: 1,1 Milliarden Euro für
Kinderbetreuung. Wir setzen um. Der Bundeskanzler hat angekündigt,
4,5 Milliarden Euro bis zum Jahr 2030 zusätzlich vom Bund in die
Kinderbetreuung investieren zu wollen. Warum? – Weil es notwendig
ist. Wir müssen den Ausbau bei den unter dreijährigen Kindern
vorantreiben. (Abg. Kollross: Können wir nicht schnell ein
Bundesland aufhetzen?) Wir
können nicht auf der einen Seite sagen, alle, die arbeitsfähig sind
und arbeiten können, sollen auch in die Arbeit gehen, und auf der anderen
Seite fehlen
die Kinderbetreuungsplätze. Daher gibt es da einen Schub in Richtung
Kinderbetreuung: 500 Millionen Euro. Die Hälfte davon muss
zu den Gemeinden, 250 Millionen Euro müssen in die
Gemeindekassen fließen, das ist paktiert, das ist von den Stakeholdern unterschrieben.
(Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
Das Zweite ist: 300 Millionen Euro für Wohnen und Sanieren. Wir wollen die Renovierungsquoten bei öffentlichen Gebäuden auf 3 Prozent erhöhen: Wohnraum schaffen, weniger Versiegelung!
Entweder ein Land verwendet 3 Prozent der Wohnbaufördermittel für Sanierungen, oder die Anzahl der Wohnungen bei Sanierungen und Nachverdichtung muss größer sein als der Anteil der Wohnungen durch Versiegelung. Das ist eine sinnvolle Maßnahme, weil wir so der Versiegelung entgegentreten – die Ortskernbelebung kennen wir als Kommunalpolitiker, ich durfte auch ein paar Jahre Vizebürgermeister sein – und auch wieder mehr in den Bereich Sanierung geben. 300 Millionen Euro sind dafür vorgesehen.
Zu Umweltschutz und Klimaschutz: die Erhöhung des Erneuerbarenanteils. Wenn man unter 50 Prozent Anteil ist, dann muss man 1 Prozent steigern, wenn man über 50 Prozent ist, sind das 0,5 Prozent.
Ich möchte auch den Heizkesseltausch erwähnen, der da mit im Gepäck ist: Ja, das ist eine sehr großzügige Förderung, aber wir haben uns bewusst dazu entschieden, Raus aus Öl und Gas mit bis zu 75 Prozent Förderanteil auch kräftig zu unterstützen. 50 Prozent wird der Bund übernehmen, und wenn die Länder das, was sie bisher bezahlt haben, auch weiterhin bezahlen, dann wird diese 50-prozentige Förderung auch ausgeschüttet. Das ist vereinbart.
Daher ist der Weg frei und offen auch für all jene, die noch
Ölheizungen und Gasthermen haben, diese zu wechseln und auf
erneuerbare Heizungsmethoden umzusteigen. Das ist eine sinnvolle
Maßnahme, mit der wir auch im Bereich des Klimaschutzes in die Zukunft
blicken. (Beifall bei der ÖVP sowie der
Abg. Maurer.)
Meine Damen und Herren, man kann vieles differenziert
betrachten. Man kann natürlich auch hier Kritik üben, nobody is
perfect, aber eines möchte ich festhalten: Dieser Finanzausgleich kann
sich sehen lassen. Es ist ein Projekt mit über 12,9 Milliarden Euro
für die Finanzausgleichsperiode. Wir decken damit die wesentlichsten
Bereiche ab, die wichtig für die Menschen in diesem Lande sind, und
die auf der kommunalen Ebene betreut werden. Das muss
man einmal sagen. Die Kindergärten stehen ja nicht neben dem Stephansdom
oder neben den Landhäusern, sie stehen in unseren Kommunen, in unseren Städten.
Dorthin muss das Geld auch kommen, das ist auch Auftrag an die Länder,
dafür zu sorgen – und sie tun es ja auch. Sie tun es ja auch,
damit
diese Gelder dorthin kommen, wo sie hingehören, nämlich zu unseren Bürgermeisterinnen
und Bürgermeistern, zu den Menschen in unseren Gemeinden. (Beifall bei der
ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
11.32
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Gerald Loacker. – Bitte. (Abg. Lercher – erheitert –: Gerald fehlt die Bankomatsteuer im Finanzausgleich! – Heiterkeit des Abgeordneten Lindner.)
11.32
Abgeordneter Mag. Gerald Loacker (NEOS): Frau Vorsitzende! Sehr geehrter Herr
Bundesminister! Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer! Sie können die
Zwischenrufe nicht hören, die da kommen, aber ich finde das lustig, wenn
schon mein Auftritt zu Zwischenrufen begeistert. (Abg. Leichtfried:
Da würde ich mich nicht wundern!)
Herr Klubobmann Wöginger hat weit ausgeführt, was dieser Finanzausgleich alles umfasst. Das ist ein kompliziertes Paket, wie der Bund die Steuereinnahmen an die Länder und an die Gemeinden weitergibt. Eigentlich ist es ein intransparentes Netz von Transfers, das sich da über Jahrzehnte entwickelt hat. Selbst Experten tun sich schwer, das bis in das kleinste Detail zu durchschauen.
Für die nächsten vier Jahre ist vorgesehen, 146 Milliarden Euro auf diesem Weg an die Länder und Gemeinden in Form der Ertragsanteile zu verteilen. Von diesen 146 Milliarden Euro entfallen 4,6 Milliarden auf den Zukunftsfonds. Also das so gelobte neue Konzept, bei dem endlich einmal zumindest angeschaut wird, ob die Länder mit dem Geld das machen, was sie mit dem Geld machen sollen, macht 4,6 Milliarden von 146 Milliarden Euro aus. Das kann man eigentlich vernachlässigen.
Die Länder, denen man auf
die Finger schauen soll, haben schon via Peter
Kaiser ausrichten lassen: Ja, aber bitte, ob wir die Ziele einhalten oder
nicht, darf keine Rolle spielen! Wenn wir sie nicht einhalten, wird es keine
Konsequenzen haben!
Da komme ich zu einem Punkt, bei dem mir die Beteiligten,
die das auf Bundesebene verteidigen müssen, ehrlich leidtun, denn ein
Finanzausgleich, das muss man fairerweise sagen, ist kein Spaß. Da kommen
neun Landeshauptleute, jeder mit einem Ego so groß wie ein
Zeppelinflugschiff (Heiterkeit des Abg. Schwarz), und da muss man
sich dann denen gegenüber mehr oder weniger alleine durchsetzen. Das ist
keine einfache Aufgabe. Trotzdem:
Das sind schwierige Aufgaben in der Politik, und für die wird man bezahlt.
Was wir uns gewünscht hätten – ich
komme jetzt dazu, das auszuführen –, ist: dass Ziele an
Konsequenzen geknüpft sind. Wenn die Länder Gelder für
die Kinderbetreuung bekommen – und das ist gut –, dann
wollen wir auch sehen, dass diese für die Kinderbetreuung eingesetzt
werden. Wenn die Länder das nicht tun, dann muss das Konsequenzen haben.
Noch besser wäre es aber, wenn die Länder und
Gemeinden Steuerautonomie hätten: wenn sie auf die
Ertragssteuern individuell einen Aufschlag einheben könnten und dann ihre
eigenen Aufgaben selbst finanzieren und
nicht alle paar Jahre beim Finanzminister als Erpresser aufschlagen und diesen
wie eine Zitrone auspressen. Das darf nicht das Ergebnis sein.
Wenn Länder und Gemeinden ihre Gelder für ihre
Aufgaben selbst einheben würden, dann würde das insbesondere die
Gemeinden stärken. Jetzt ist
der Bürgermeister oft Bittsteller bei der Landesregierung, damit er
überhaupt Geld bekommt. Da können ein paar – Kollege
Kollross – ein Lied davon
singen: Wenn man in einem Bundesland die falsche Farbe hat, dann ist das kein
Spaß. Wenn man als roter Bürgermeister beim schwarzen Landeshauptmann – oder
mit umgekehrten Farbenspiel – auftanzen muss und Geld für seine
Gemeinde braucht, dann ist das schwierig. Steuerautonomie für die Gemeinden würde
die Position der Gemeinden gegenüber den Ländern massiv stärken.
Davon hätten dann insbesondere immer die etwas, die zu den
Minderheitsparteien im jeweiligen Bundesland gehören.
Was wir auch vermissen, ist eine Transparenzdatenbank, die
funktioniert. Jetzt wird das auf die Länder ausgeweitet, aber da
gehören natürlich die Gemeinden erfasst. Wir haben einen
Föderalismus, in dem zu oft die Linke nicht weiß, was die Rechte
tut, und manchmal die Linke auch gar nicht will,
dass die Rechte weiß, was sie den ganzen Tag so macht.
Das ist ja immer Ihr Steuergeld, das da verteilt wird, nicht? Ich singe ja selber auch in einem Chor, und der Chor bekommt Förderungen. Da muss man sich manchmal fragen: Entschuldigung, wieso bekommen wir eine Förderung?
Der Chor funktioniert gut, wir haben das gut
im Griff. Aber klar, es wäre
ja unverantwortlich, wenn man Geld, das einem zusteht, nicht beansprucht. Da
ist ja der Vereinsvorstand auch in der Verpflichtung, das zu tun.
Das ist Ihr Steuergeld, das ausgegeben wird. Immer wenn Sie
eine Förderung bekommen, denken Sie daran, Sie haben sich das
eigentlich selbst bezahlt.
Noch effizienter wäre es, wir würden uns dieses Zirkelspiel sparen, dass
man 100 Euro Förderung bekommt, für die man vorher 150 Euro
Steuern gezahlt hat. Da sind nämlich 50 Euro dazwischen, die irgendwo
in der Finanzverwaltung aufgehen. (Beifall bei den NEOS.)
Damit wir uns auch das Theater mit dem Finanzausgleich sparen, und die Länder und Gemeinden ihre Steuerautonomie bekommen, bringe ich nachstehenden Entschließungsantrag ein. Es wird ja oft die Eleganz der Verfassung gelobt. Mit dieser Eleganz kann die Geschäftsordnung des Nationalrates nicht mithalten, deswegen muss ich Ihnen jetzt den Text vorlesen.
Ich bringe folgenden Entschließungsantrag ein:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Reform des Finanzausgleichs und echte Transparenz für die Transparenzdatenbank“
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Finanzen, wird aufgefordert,
1. für mehr Aufgabenorientierung im Finanzausgleich und mehr Steuerautonomie für Österreichs Länder und Gemeinden zu sorgen,
2. die Voraussetzungen für einen vollständigen Überblick über alle von österreichischen Gebietskörperschaften angebotenen und ausgezahlten Förderungen
im
Rahmen einer gebietsübergreifenden Transparenzdatenbank als Grundlage für
einen effizienten und zielgerichteten Einsatz von Steuermitteln
zu schaffen,
3. sowie alle ausgezahlten Förderungen an Unternehmen,
Vereine und Non-Profit-Unternehmen oberhalb einer Bagatellgrenze
öffentlich einsehbar
zu machen.“
*****
Das ist ein großes Ziel, aber wer alle seine Ziele erreicht hat, hat sie sich zu niedrig gesteckt. Daher sind wir Freunde von großen Zielen. Herr Finanzminister, wir freuen uns, wenn Sie große Ziele in Angriff nehmen. (Beifall bei den NEOS.)
11.38
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
des Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen
betreffend Reform des Finanzausgleichs und echte Transparenz für die Transparenzdatenbank
eingebracht im Zuge der Debatte in der 245. Sitzung des
Nationalrats über Bericht des Finanzausschusses über die
Regierungsvorlage (2305 d.B.): Bundesgesetz,
mit dem ein Finanzausgleichsgesetz 2024 erlassen wird sowie das
Finanzausgleichsgesetz 2017, das Umweltförderungsgesetz, das Wohn-
und Heizkostenzuschussgesetz, das Transparenzdatenbankgesetz 2012 und das
Bildungsinvestitionsgesetz geändert werden (2375 d.B.) –
TOP 2
Mit dem neuen
Finanzausgleich haben Bund und Länder eine Riesenchance verspielt, endlich
veraltete Strukturen aufzubrechen und Österreich zukunftsfit zu machen.
Anstatt das intransparente und selbst von Expert:innen kaum überblickbare
Netz von Transfers und Zahlungen zu entwirren und endlich für
mehr Aufabenorientierung und Abgabenautonomie bei Ländern und Gemeinden
zu sorgen, wurde das bestehende System einfach um weitere fünf Jahre verlängert. "Grundlegende
Reformen wurden erneut nach hinten verschoben, wie etwa die Grundsteuerreform,
die Transferentflechtung oder die Finanzierbarkeit
der kommunalen Daseinsvorsorge oder Finanzierungslösungen für
Investitionen in Klimaschutz und Klimawandelanpassung", merkt auch das KDZ
in seinem
Blog kritisch an (https://www.kdz.eu/de/aktuelles/blog).
FAG 2024 - eine verpasste Chance
Insgesamt rund 146 Mrd. EUR
wird der Bund laut Strategiebericht des Finanzministeriums in den Jahren
2024-27 wie gehabt über Ertragsanteile an Länder und Gemeinden
überweisen, rd. 12,5 Mrd. an zusätzlichen Mitteln über den neuen
Finanzausgleich. Aber nur ein Bruchteil dieser Mittel, nämlich 4,6
Mrd. EUR, soll
2024-27 über den sogenannten Zukunftsfonds gezielt in wichtige Zukunftsausgaben -
Kinderbetreuung, Klimainvestitionen, thermische Sanierung - fließen.
Positiv ist, dass die Mittel für die Kinderbetreuung zu 50% direkt an die
Gemeinden
fließen, was für mehr Planungssicherheit bei den Gemeinden sorgt. Zu
kurz gekommen ist allerdings auch beim Zukunftsfonds die
Aufgabenorientierung, nämlich
dass die Mittel nach konkretem Bedarf, im Falle der Kinderbetreuung zB nach
Anzahl der in der Gemeinde gemeldeten Kleinkinder, verteilt werden. Stattdessen
wird
das Geld - wie ganz generell beim Finanzausgleich - nach Bevölkerungszahl
und Größe der Gemeinde verteilt. Dabei wäre es gerade
angesichts der derzeitigen Herausforderungen (mehr Aufgaben, Inflation)
"umso wichtiger, die Mittel möglichst effizient zu verteilen.
Das bedeutet Aufgabenorientierung und Wirkungsbezug statt Gießkanne und
Aufrechterhaltung ineffizienter Strukturen" (KDZ:
https://www.kdz.eu/de/aktuelles/blog).

Steuerautonomie auf der langen Bank - Zu viel Macht für die Länder, zu wenig Autonomie für die Gemeinden
Auch auf einen Ausbau der
Steuerautonomie von Ländern und Gemeinden wurde beim aktuellen
Finanzausgleich verzichtet. Die Landeshauptleute bekommen weiterhin
die Steuermillionen überwiesen, ohne im Gegenzug Verantwortung für
Einnahmen und Ausgaben übernehmen zu müssen. Den Gemeinden wiederum
fehlt das eigene Aufkommen, das sie in ihrer Gemeindeautonomie auch
gegenüber den Ländern stärken würde. Tatsächlich ist
in nur wenigen Ländern der Anteil
der Steuern, die von Gemeinden und Ländern eingehoben werden, derart
gering wie in Österreich (siehe Grafik).
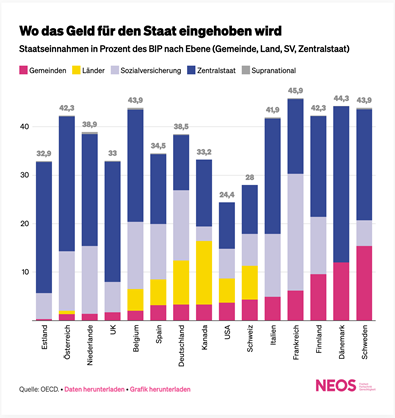
Dabei gilt: Steuern, die man selbst festlegen und verantworten muss, werden meist besser überlegt und begründet werden, die Mittel dann wieder effizienter eingesetzt (https://www.derstandard.at/story/1345164958871/steuerautonomie-wuerde-effizienz-steigern). NEOS fordert aus diesem Grund, dass Teile des Einkommenssteuertarife innerhalb einer gewissen Bandbreite jeweils von Ländern und Gemeinden festgelegt werden können und Gemeinden zudem über eine Grundsteuerreform endlich zu einem angemessenen eigenem Steueraufkommen kommen.
Der
"Transferzirkus" des Österreichischen Finanzausgleichs mit
seiner fehlenden Bündelung von Aufgaben-, Ausgaben- und
Einnahmenverantwortung und die kaum vorhandene Steuerautonomie der Länder
und Gemeinden und kosten Österreichs Steuerzahlerinnen Jahr für Jahr
unnötig viel Geld und stehen nicht nur einer Entlastung im Weg, sondern
reduzieren zudem Finanzierungsspielräume
für Zukunftsinvestitionen.
Österreich: Föderalismus-Kaiser und Förderweltmeister
Bereits vor der Covid-Krise
gab Österreich viel (Steuer-)Geld für staatliche Förderungen
aus. Seit Ausbruch der Covid-Krise ist das Volumen der Förderungen aber
regelrecht explodiert: In den Jahren 2020 und 2021 verzeichneten
die Förderunge (Subventionen i.w.S. laut VGR) einen massiven Anstieg um
nahezu
15 Mrd. EUR bzw. 76 % im Vergleich zum Vorkrisenniveau. Nicht zuletzt
aufgrund der Anti-Teuerungssubventionen der Folgejahre scheinen sich die Subventionen
auf deutlich höherem Niveau zu stabilisieren als es noch vor den
Krisenjahren üblich war.
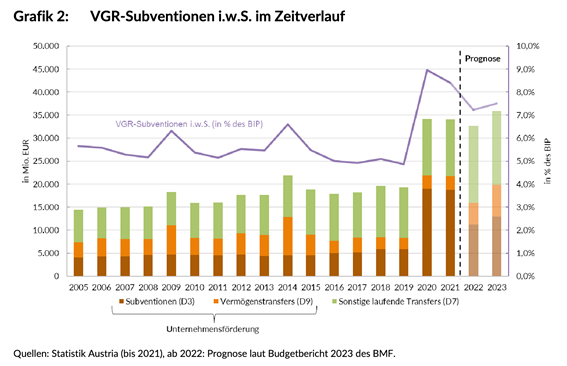
Quelle: BD Analyse zum Förderbericht 2021
Dabei gehörte man bereits vor der Krise zu den eher förderfreudigen EU-Ländern: Während man im Jahr 2019 noch Platz 6 der EU-weit höchsten Fördersummen (als Prozent des BIPs) belegte, katapultierte die Koste-was-es-wolle Politik der Bundesregierung Österreich auf Platz 2 (2020), bzw. Platz 4 (2021). (Budget-
dienst, Analyse zum
Förderbericht 2021). Auch im internationalen Vergleich ist Österreich
also ein Förder-Schlaraffenland. Der unliebsame Nebeneffekt: Eine
hohe Staatsverschuldung trotz hoher Abgabenquote.
Förderpolitik ist
grundsätzlich keine schlechte Sache. Der Staat greift dort ein, wo der
Markt allein nicht die gesellschaftlich wünschenswerten Ergebnisse
produzieren würde. Das macht auch eine soziale Marktwirtschaft aus.
Problematisch
wird es dann, wenn der Überblick über geförderte Zwecke oder
eingesetzte Mittel verloren geht, Doppelförderungen auf der Tagesordnung
stehen, Förderpolitik mit Klientelpolitik verwechselt wird
oder einmal aufgesetzte Förderungen nie wieder abgeschafft werden
(https://www.agenda-austria.at/publikationen/
der-staat-foerdert-alle/).
Aber gerade Österreichs föderale Struktur, wo die rechte Hand nicht weiß, was die die linke macht, führt zu einem regelrechten Förderdschungel. Denn von der Bürgermeisterin, über die Landeshauptfrau, bis hin zur Ministerin will jede besonders großzügig sein - somit stehen Doppel- und Mehrfachförderungen, inklusive Überförderung udn Wettbewerbsverzerrungen in Österreich auf der Tagesordnung.
Schluss mit Blindflug - mehr Vollständigkeit und Transparenz für die Transparenzdatenbank
Eine
gebietskörperschaftübergreifende Transparenzdatenbank, wie sie heute
beschlossen werden soll, wäre so gesehen absolut zu
begrüßen und könnte
dazu beitragen, einen vollständigen, transparenten und öffentlich
einsehbaren Überblick über sämtliche von den verschiedensten
Gebietskörperschaften angebotenen und ausgezahlten Förderleistungen
zu bieten. Allerdings wird die neue gebietskörperschaftsübergreifende
Transparenzdatenbank ( siehe:https://
www.parlament.gv.at/gegenstand/XXVII/I/2314 ) diesem Anspruch nicht gerecht.
Die darin nun gesetzlich
geregelte Verpflichtung von Bund und Ländern,
nicht nur Leistungsangebot, sondern auch getätigte Förderzahlungen
nach einheitlichen Kriterien einzumelden, ist ein großer Schritt in
die richtige Richtung. Es
fehlt allerdings nach wie vor die sowohl von Rechnungshof (Bericht des
Rechnungshof 2021/ 11,
Transparenzdatenbank – Kosten und Nutzen, Ziele und Zielerreichung; Follow–up–Überprüfung)
als auch vom Budgetdienst des Parlaments (siehe: Analyse des Budgetdienst
– Novelle zum Transparenzdatenbankgesetz 2012 (626 d.B.))
eingemahnte gesetzlich verpflichtende Einmeldung von Leistungsangebot und
Zahlungen der Gemeinden. Damit ist die Vollständigkeit der Datenbasis -
zB für die angekündigte gesamtstaatliche Förderstrategie - nach
wie vor
nicht gegeben.
Für 2022 belaufen sich laut Eurostat die Zahlungen der Gemeinden für Transfers und Subventionen auf rd. 7,2 Mrd. € oder 19,3% der Gesamtausgaben der Gemeinden. Nicht alle dieser Zahlungen sind tatsächlich Förderungen, weil in dieser Summe auch die Landesumlage und der Gemeindebeitrag zur Krankenanstaltenfinanzierung enthalten ist. Der wesentliche Punkt ist aber: Wir wissen im Grunde nicht, wie viel die Gemeinden für FÖrderungen ausgeben, und auch nicht, welche Mittel in welche Förderschienen fließen.
Intransparenz droht daher
gerade bei den für die Bevölkerung und Zivilgesellschaft sehr
wesentlichen Gemeindeförderungen auch in Zukunft auf der Tagesordnung zu stehen.
Im Falle der Landeshauptstädte, allen voran Wien, die Förderungen
sowohl als Länder als auch als Gemeinden anbieten und auszahlen
können, verhindert eine umfassende Einmeldung der Gemeinden die notwendige
Transparenz. Allein in der Gemeinderatssitzung vom 18.10.2023 beschloss der
Wiener Gemeinderat Förderungen in Höhe von 68 Mio. € (und der
Wiener Gemeinderat tagt 10mal im Jahr), die nicht in der TDB stehen werden.
Hier muss also die heute
zu beschließenden Regelungen umgehend nachgeschärft werden.
Echte Transparenz bei allen Förderungen
In einem weiteren Schritt
muss eine öffentliche Abfrage aller (oberhalb einer Bagetellgrenze)
geleisteten und ausgezahlten Förderungen an Unternehmen, Vereine
und Non-Profit-Organisationen ermöglicht werden. Im Jahr 2022 wurden von
der
Bundesregierung - wie von der Öffentlichkeit, NEOS und anderen Oppositionsparteien
gefordert - die von der Cofag ausgezahlten Covid-Förderungen für eine
personenbezogene Abfrage öffentlich zugänglich gemacht. Man wollte
über
die Möglichkeit einer öffentliche personenbezogene Abfrage mehr Transparenz
und Kontrolle über den Ensatz öffentlicher Mittel schaffen
(https://www.parlament.gv.at/gegenstand/XXVII/A/2734). Ebenso können
Förderungen im Zusammehang mit der Energiekrise und des Aufbau-
und Resilienzplans personenbezogen öffentlich eingesehen
werden (https://transparenzportal.gv.at/tdb/tp/berichte/). Im Sinne echter
Transparenz sollen über die Transparenzdatenbank in Zukunft alle an
Unternehmen, Vereine und Non-Profit-Organisationen gezahlten Förderungen
öffentlich
einsehbar sein, um eine umfassende Transparenz über den Einsatz von
Steuermitteln zu gewährleisten.
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
"Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Finanzen, wird aufgefordert,
1. für mehr Aufgabenorientierung im Finanzausgleich und mehr Steuerautonomie für Österreichs Länder und Gemeinden zu sorgen,
2. die Voraussetzungen für einen vollständigen Überblick über alle von österreichischen Gebietskörperschaften angebotenen und ausgezahlten Förderungen im Rahmen einer gebietsübergreifenden Transparenzdatenbank als Grundlage für einen effizienten und zielgerichteten Einsatz von Steuermitteln zu schaffen,
3. sowie alle ausgezahlten Förderungen an Unternehmen, Vereine und Non-Profit-Unternehmen oberhalb einer Bagatellgrenze öffentlich einsehbar zu machen."
*****
Präsidentin Doris Bures: Der Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht und steht daher auch mit in Verhandlung.
Nächster Redner: Herr Abgeordneter Maximilian Lercher. – Bitte.
Abgeordneter Maximilian Lercher
(SPÖ): Sehr geehrte Frau
Präsidentin! Herr Minister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen!
Bevor ich mit meiner
Rede beginne, darf ich im Auftrag meiner Kollegin Becher die 6c des BRG Franklinstraße
aus Wien-Floridsdorf recht herzlich begrüßen. (Beifall bei der
SPÖ sowie bei Abgeordneten von ÖVP und Grünen.)
Also bei aller
Wertschätzung für dich, lieber Gerald Loacker: Ich habe
unzählige Gespräche über alle Parteifarben hinweg mit
Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern geführt, aber niemand,
auch nicht ein Einziger hat gesagt, die Steuerautonomie würde ihre Probleme
lösen. Im Gegenteil, ich glaube,
es würde zu einer Verschärfung und zu einem Standortnachteil in
Österreich, aber zu keinem Vorteil für unsere Städte und
Gemeinden führen. (Beifall
bei Abgeordneten der SPÖ. – Abg. Loacker: Es ist
bequemer ...?)
Ehrlicherweise, gleich am Beginn: Natürlich ist mit
diesem Finanzausgleich etwas gelungen. Es wäre, glaube ich, gelogen, wenn
man sagt, da ist nichts Gelungenes. Es
ist definitiv besser als nichts. Die Sozialdemokratie wird diesem aus unserer
Sicht Minimalkompromiss auch zustimmen. Nichtsdestotrotz, glaube
ich, muss man auch betonen: Löst es die Herausforderungen auf der kommunalen
Ebene? – Nein. Löst es die Drucksituation für unsere
Gemeinden? –
Nein, und das weiß die ÖVP.
Geschätzter Herr
Finanzminister, Sie und auch viele in Ihrer Fraktion wissen ganz genau: Es wird
in Zukunft noch ein Gemeindepaket brauchen, weil unglaublich viele
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister mit diesem vorhandenen Werk
die nächsten zwei Jahre nicht überstehen werden. Diese Drucksituation
müssen wir auflösen, wenn uns die Demokratie und die
Städte und Gemeinden am Herzen liegen, denn die sind in Wahrheit das Kraftwerk
unserer Demokratie. Die Gemeinden und Städte haben in der Coronakrise, bei
allen Krisen, die hier behandelt wurden, Maßgebliches geleistet, Verantwortung
und Aufgaben übernommen, aber sie bekommen leider nicht
die notwendigen Mittel, die sie in Zukunft brauchen, um zu bestehen. (Beifall
bei der SPÖ.)
Was sind die
Fakten? – Die eigene BMF-Prognose weist sinkende Ertragsanteile
für 2023 aus, erst 2024 soll eine Steigerung kommen. Das heißt, 2024
werden die Ertragsanteile der Gemeinden knapp über dem Niveau von
2022 liegen. Das KDZ, ein renommiertes Institut, prognostiziert: Wenn wir
nicht gegensteuern, wird jede zweite Gemeinde und Stadt in Österreich Abgangsgemeinde
werden. – Das können wir nicht wollen!
Ich meine, die ÖVP ist die Partei der
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Ihr habt auch unglaublich gute
Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker. Die erwarten sich
aber auch von euch, dass ihr liefert. (Zwischenruf der Abg. Baumgartner.) Es ist für mich
völlig unverständlich, dass ihr bis dato ignoriert,
dass wir weitere Gelder auf kommunaler Ebene brauchen – wir werden
das hier beschließen –, weil die Gemeinden damit nicht
auskommen werden. Und
wenn die damit nicht auskommen, bedeutet das eines: Sie müssen im Ermessensspielraum
sparen, das bedeutet bei den Vereinen vor Ort, bei jenen,
die sich bemühen – bei den Sportvereinen, bei den Bildungsvereinen,
bei den Kindervereinen, bei den Jugendvereinen. Dort, wo es direkt um das
Zusammenleben geht, bei den kleinsten Einheiten wird dann gespart werden, und
das können wir nicht zulassen, meine sehr verehrten Damen und
Herren! (Beifall bei der SPÖ.)
Wenn Kollege Wöginger von Verfassung und
verfassungsmäßigen Aufgaben spricht, steht dort auch die
Gemeindeautonomie drinnen. Die Gemeindeautonomie ist ein hohes Gut in
unserer Republik. Das bedeutet für mich, dass es denen auch zusteht, dass
sie die Mittel bekommen, die sie brauchen,
um zu wirtschaften. Wenn es darum geht, Aufgaben auf die kommunale Ebene zu
übertragen, dann geht alles schnell, aber wenn es darum geht, dass
wir sie finanziell so ausstatten, dass sie überleben können, dann
geht es nicht.
Das ist die Kritik am Zukunftsfonds. Ja, da gibt es Mittel,
aber viele Städte
und Gemeinden brauchen keine Kofinanzierung mehr, da geht es um
den laufenden Haushalt. Da geht es nicht mehr darum, dass man diskutiert: Was
werde ich bauen, was werde ich investieren, wo bekomme ich eine Förderung? Es
geht darum, den laufenden Haushalt zu bestreiten. Wenn sie das nicht
können, dann bricht uns die wichtigste demokratische Ebene in diesem
Land weg. Und wenn das passiert, trägt die ÖVP die Verantwortung.
Deswegen hoffe ich, Herr Finanzminister, dass eingelenkt wird. In nächster Zukunft werden wir hier wieder stehen und ganz, ganz sicher darüber diskutieren, was wir den Gemeinden nicht alles geben müssen, damit sie die Zukunft gut überstehen. Und es wäre richtig und gut, das zu beschließen. – Vielen Dank. (Beifall bei der SPÖ.)
11.43
Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Elisabeth Götze. – Bitte.
Abgeordnete Dr. Elisabeth Götze (Grüne): Frau Vorsitzende! Sehr geehrter Herr Minister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuseherinnen und Zuseher! Wir diskutieren hier über die Gemeinden, nicht nur heute, sondern immer wieder, auch während Corona, auch während der vergangenen Jahre immer wieder. Und immer wieder haben wir es geschafft, die Gemeinden gut zu unterstützen. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
Auch das diesjährige Budget ist ein wichtiger Schritt
und eine wichtige Unterstützung für die Gemeinden. Ganz
grundsätzlich einen Schritt zurück
zum Budget: Das Budget ist ein absolutes Zukunftsbudget, mit dem wir in eine
bessere Zukunft investieren. (Abg. Einwallner: Da runzelt sogar der
Finanzminister die Stirn, wenn er hier steht! Da runzelt sogar der
Finanzminister die Stirn! Es ist unfassbar!) Ein Teil davon ist der
Finanzausgleich, von dem wir heute sprechen. Der Finanzausgleich –
es wurde schon gesagt – bedeutet die Aufteilung der
Steuereinnahmen auf Bund, Länder und Gemeinden. Ein Teil davon ist der
Zukunftsfonds, auf den ich mich jetzt konzentrieren möchte, der speziell
für Gemeinden ist und der mehr Geld als bisher bedeutet. (Abg. Kollross: Wenn
er dort ankommt!) Das möchte ich schon ganz deutlich sagen: mehr Geld
als bisher! (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
Es ist ein Verfassungsgesetz, weil auch die Länder und die Gemeinden zustimmen müssen, zugestimmt haben beziehungsweise zustimmen.
Ganz grundsätzlich gehen wir mit dem Budget und auch
mit dem Zukunftsfonds doch einige wichtige strukturelle Reformen an. Ich
möchte mit der ökosozialen Steuerreform anfangen, die
wirklich eine Umsteuerung bedeutet. Die CO2-Bepreisung
beispielsweise bedeutet, dass wir gewisse Einnahmen aus Bereichen generieren,
die klimaschädlich sind. Ich möchte aber auch
sagen: Es sind Einnahmen, die nicht irgendwo versickern, sondern die unmittelbar
an die Bürgerinnen und Bürger in Form des Klimabonus zurückgegeben werden.
(Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP. –
Abg. Kollross: Herr Minister, wo steht denn das im
Finanzausgleich? – Abg. Hoyos-Trauttmansdorff: Verwaltungstechnisch
eine großartige Konzeption!)
Wir haben auch die Abschaffung der kalten Progression beschlossen. Auch das bedeutet, dass wir weniger Einnahmen haben und mehr Geld bei den Bürgerinnen und Bürgern bleibt. Das ist also ebenso eine wichtige strukturelle Reform.
Dann gibt es eben den Finanzausgleich. Auch da gab es mit
dem Zukunftsfonds eine strukturelle Reform, da erstmals nicht nur Gelder an die
Gemeinden
gehen, sondern diese mit gewissen Zielen verbunden sind. Ich habe jetzt vernommen,
die Ziele sind zu vage oder es macht keinen Sinn, Ziele zu formulieren, weil
die Gemeinden einfach mehr Geld brauchen. Ich habe auch von Kollegen Loacker,
ich sehe ihn jetzt nicht - - Von Kollegen Lercher – Entschuldigung
(Abg. Kollross: Das ist aber eine Beleidigung! Das lässt er sich
aber nicht gefallen!), ist er noch hier?; ja, da hinten (Abg. Loacker:
Der ist im Doskozil-Lager,
der muss hinten sitzen! – Abg. Kollross: Da seid ihr beide
beleidigt worden!) – habe ich gehört, die Gemeinden wollen
das Geld nicht einnehmen, sondern nur ausgeben. Ja, das ist schon ein Zugang,
aber dann ist es doch legitim, zu sagen: Wenn ihr Gelder wollt, dann
möchten wir wenigstens sagen, wofür.
Ich habe schon gesagt: zukunftsgerichtet, in zukunftsgerichtete Bereiche.
Das sind drei Bereiche: nämlich die
Elementarpädagogik, bei der wir wissen – das haben schon meine
Vorrednerinnen und Vorredner, aber ich glaube,
es waren eh nur Männer, gesagt –, da gibt es Nachholbedarf, da
gibt
es Ausbaubedarf. Ich möchte auch sagen, da ist ganz klar definiert, wie
viel Geld die Gemeinden unmittelbar bekommen: nämlich 250 Millionen
Euro im kommenden Jahr und steigend in den nächsten Jahren. Ich glaube,
das ist eine gute Nachricht für die Gemeinden. Das ist wirklich in der
Elementarpädagogik zu verwenden.
Der zweite Bereich: Sanierung, Wohnraum, wie zum Beispiel Wohnraummobilisierung, aber überhaupt auch leistbaren Wohnraum zu schaffen, zu sanieren und so weiter.
Im Bereich Umwelt und Klima muss der Anteil der erneuerbaren
Energien ausgebaut werden. Das tun die Gemeinden zum Teil schon, aber wir
schaffen dafür zusätzliche Anreize. Das sind übrigens
auch Dinge, die sich dann wieder rechnen, denn wenn eine Gemeinde in
PV-Anlagen investiert, wird die Energie,
die sie sozusagen verwenden muss, günstiger.
Noch einmal zu den Zielen: Es
sind Ziele, messbare Ziele im Finanzausgleich formuliert. Ja, sie sind
nicht unmittelbar mit Sanktionen verknüpft – ich sage
einmal: noch nicht. Vielleicht wird das in Zukunft auch einmal so sein, aber zunächst ist es doch schon gut, zu sagen: Das sind die Ziele, und wir als Bürgerinnen und Bürger haben den Anspruch, zu sagen: Sind die Ziele in meiner Gemeinde oder in meinem Bundesland erreicht worden oder eben nicht? – Evaluierung 2026 und 2028.
Dann möchte ich noch einen
Punkt erwähnen, der uns mit diesem neuen Finanzausgleich gelungen
ist. Wir setzen eine wichtige Forderung des Rechnungshofes um: dass
auch alle Förderungen in die Transparenzdatenbank eingemeldet werden. Wir
schaffen also auch da mehr Transparenz für das, was an Förderungen
passiert. Dadurch vermeiden wir Doppel- oder Mehrfachförderungen,
können messen, ob die richtigen Förderungen auch dort ankommen, wo
sie ankommen sollen, und damit erreichen wir einen effizienten Einsatz der Mittel.
Ich glaube, es sind wirklich gute Perspektiven für die
Zukunft, und ich bitte im Sinne der Gemeinden um Zustimmung. –
Danke. (Beifall bei den Grünen
und bei Abgeordneten der ÖVP.)
11.48
Präsidentin Doris Bures: Nun hat sich Herr Finanzminister Magnus Brunner gemeldet. – Bitte, Herr Minister.
Bundesminister für Finanzen Dr. Magnus
Brunner, LL.M.: Sehr geehrte
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Sehr geehrte Zuschauerinnen
und Zuschauer! Vielleicht nur zu Beginn einen kurzen Satz, weil das Wort
Finanzausgleich doch etwas technisch klingt: Worum
geht es? – Es geht darum, wie die Steuereinnahmen geregelt werden,
wie die Steuereinnahmen an die Länder, an die Gemeinden verteilt werden.
Es
sind Steuergelder, die überwiegend, zum großen Teil natürlich
vom Bund eingehoben werden. Es geht darum, wie diese Steuergelder dann auf
die einzelnen Gebietskörperschaften, also an den Bund, die
Länder, Städte und Gemeinden gerecht verteilt werden,
nämlich so, dass die Aufgaben auch
entsprechend erledigt werden können. Das war ein wichtiger Zugang, den wir auch in den Finanzausgleichsverhandlungen im letzten Jahr gehabt haben.
Da es um viel Geld geht,
verwundert es natürlich wenig, dass es intensive Verhandlungen waren.
Es hat über ein Jahr gedauert und es wurden 100 Sitzungen abgehalten,
nämlich auf technischer und auf politischer Ebene, und zwar mit den
Bundesländern, mit den Städten und Gemeinden. In diesem Falle
haben diese intensiven Verhandlungen zu einem Abschluss geführt, der aus
meiner Sicht für beide Seiten entsprechend fair ist.
Ich möchte mich wirklich
an dieser Stelle bei allen Verhandlern, Verhandlerinnen bedanken, denn
verhandeln bedeutet ja auch immer, dass man gegenseitig aufeinander
zugeht, dass man Schritte aufeinander zu macht. Man kann nicht immer
100 Prozent aller ursprünglichen Forderungen durchsetzen, aber
ich glaube, dass das im gesamtstaatlichen Sinne ein sehr gutes Ergebnis ist. (Beifall
bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
Ich glaube, genau das erwarten
sich die Österreicherinnen und Österreicher von der Politik: dass man
am Schluss zu einem Ergebnis kommt, das für alle Seiten akzeptabel
ist, das für alle Seiten am Ende des Tages ein gutes ist.
Diese Zusammenarbeit über die Gebietskörperschaften und auch
über die Parteigrenzen hinweg hat man in diesem Finanzausgleich und
in diesen Verhandlungen im letzten Jahr gesehen. Das ist genau das, was
die Menschen erwarten.
Dieser Finanzausgleich spricht zum ersten Mal Themen an, die in der Vergangenheit – Klubobmann Wöginger hat es erwähnt – vielleicht zu kurz gekommen sind. Vor sieben Jahren war der letzte Finanzausgleich, der verhandelt worden ist. Normalerweise passiert das alle fünf Jahre, aber aufgrund der Coronapandemie hat man das um zwei Jahre verlängert.
In der Vergangenheit war es
immer so, dass man lange verhandelt hat und
am Ende des Tages über die Größenordnung dessen gesprochen hat,
was den
Ländern, Städten und Gemeinden einfach zusätzlich zur
Verfügung gestellt wird. Das war dieses Mal nicht der Fall.
Deswegen waren vielleicht die Verhandlungen auch etwas intensiver –
weil man sich dieses Mal wirklich über Inhalte unterhalten
hat, über Ziele unterhalten hat, über Reformen unterhalten hat, aber
auch die Herausforderungen der Zukunft, insbesondere den
demografischen Wandel entsprechend adressiert hat. Und gerade was den
demografischen Wandel betrifft, sind wir natürlich alle auf allen
Ebenen angehalten, entsprechend Verbesserungen zu erwirken.
Wir müssen verstärkt in die Gesundheit, in die Pflege und in die Kinderbetreuung investieren. Alleine im Gesundheits- und im Pflegebereich haben wir für die Länder und Gemeinden für die nächsten Jahre 14 Milliarden Euro an zusätzlichem Geld vorgesehen.
Insgesamt erhalten die Länder und Gemeinden zusätzlich 2,4 Milliarden Euro pro Jahr! Nur zum Vergleich: Letztes Mal, bei der letzten Finanzausgleichsverhandlung vor sieben Jahren, waren es 300 Millionen Euro zusätzlich.
Also dieser Paradigmenwechsel,
den wir mit diesem neuen Finanzausgleich einleiten, ist, glaube ich,
für alle relativ offensichtlich. Das ist ein Paradigmenwechsel: auf
der einen Seite eben besonders im Pflege- und Gesundheitsbereich die
Verknüpfung von zusätzlichem Geld mit Reformen und dann
eben die Schaffung eines ganz neuen Instruments, des Zukunftsfonds, den wir mit
1,1 Milliarden Euro pro Jahr dotiert haben. Insbesondere wird den
Herausforderungen im Bereich der Kinderbetreuung, der Elementarpädagogik
Rechnung getragen, aber natürlich wird auch dem Umweltgedanken,
unter anderem durch Sanierungen, Rechnung getragen. Das ist, glaube ich, gerade
auch für die Gemeinden ein sehr, sehr gutes Ergebnis.
Vielleicht noch zwei Sätze
zum Thema Sanktionen und Zielerreichung: Kollege Loacker hat, wenn ich das
richtig verstanden habe, davon gesprochen,
dass die „Eleganz der Verfassung“ hier im Parlament nicht ganz
abgebildet wird. – Die Eleganz der Verfassung sieht aber eben auch
keine Sanktionen vor.
Das ist aber auch die Grundvoraussetzung, also sind wir
einen anderen
Weg gegangen. Wir haben es an Ziele geknüpft, die, ja, nicht sanktioniert
werden, aber wir haben Anreize gesetzt: Auf der einen Seite können
dann,
wenn die Ziele erreicht werden, die Mittel von den Ländern, Städten
und Gemeinden für andere Projekte entsprechend verwendet werden. Das
ist
natürlich ein Anreiz, den Länder, Städte und Gemeinden da haben.
Wir haben auch zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt, insbesondere für strukturschwache Gemeinden. Beispielsweise haben wir die Mittel bei strukturschwachen Gemeinden verdoppelt, was natürlich auch ein großer Teil des Finanzausgleichs ist; wir haben den Personennahverkehr entsprechend unterstützt, die Schülertransporte – also da geht es jetzt schon ums Detail.
Ja, Kollege Loacker, das ist natürlich ein sehr komplexes System, da haben Sie schon recht. Umso wichtiger ist es, dass eben die Länder, Städte und Gemeinden auch entsprechend eingebunden werden.
Was die Anreize betrifft und
die Frage, ob die Ziele erreicht werden oder nicht: Da sind auf der einen Seite
die Anreize, aber andererseits natürlich auch
die Bevölkerung, die selbstverständlich schauen wird, ob im eigenen
Bundesland, in der Gemeinde, in der Stadt die Ziele auch entsprechend erreicht
werden. Außerdem gibt es auch den Rechnungshof, der da
selbstverständlich
auch entsprechend hinschauen wird.
Was mir auch noch wichtig ist, weil das von Herrn Abgeordneten Lercher dargestellt worden ist: Das stimmt schon, das nächste Jahr, 2024, wird für die Gemeinden eine besondere Herausforderung sein. Genau deswegen haben wir einen Vorgriff auf die Ertragsanteile der nächsten Jahre für 2024 gemacht (Abg. Kollross: Müssen sie ja wieder zurückzahlen! – Abg. Lercher: Das werden wir ihnen schenken!), damit für die Länder im nächsten Jahr, in dem insbesondere die Grunderwerbsteuer beispielsweise zurückgehen wird, eine Vorwegmöglichkeit (Abg. Kollross: Ist aber nur ein Darlehen!) für die späteren Jahre, für
nächstes Jahr auch gegeben wird, damit diese Herausforderung eben adressiert wird.
Ein wichtiges Thema im
Finanzausgleich – das kommt immer etwas zu kurz, Abgeordnete
Götze hat das angesprochen – ist die Transparenz. Das waren auch
schwierige Verhandlungen mit den Gebietskörperschaften, das gebe ich zu,
aber auch da haben wir einen durchaus großen Fortschritt erzielt. Es
gibt ja seit 2013 die Transparenzdatenbank, das Transparenzportal, anhand
dessen sich die Bürgerinnen und Bürger auch einen Überblick
über die vielfältige Förderlandschaft, die wir in
Österreich haben, verschaffen können.
Mit diesem Finanzausgleich wird diese Datenbank nun auch gebietskörperschaftenübergreifend ausgebaut. Also erstmals in der Geschichte, seit es die Transparenzdatenbank gibt, verpflichten sich auch die Länder, ihre Förderungen in die Datenbank entsprechend einzumelden. Dadurch wird es in Zukunft einfacher möglich sein, beispielsweise Doppelförderungen aufzuspüren. Mit dieser verpflichtenden Einmeldung erfolgt nämlich auch eine verbindliche Zusage, dass vor Inangriffnahme einer neuen Maßnahme eine Abfrage in der Transparenzdatenbank zu erfolgen hat.
Das ist unsere Pflicht. Da geht
es um Steuergeld der Österreicherinnen und Österreicher, und mit
diesem Steuergeld müssen wir sorgsam umgehen. Es
kann nicht sein, dass wir einfach zusätzliche Mittel verschieben und zur
Verfügung stellen, sondern diese zusätzlichen Mittel müssen
auch mit mehr Transparenz, mit Zielen und mit Reformen verknüpft werden.
Ich glaube, der Finanzausgleich zeigt, dass das möglich ist.
An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an alle Verhandler, parteiübergreifend, gebietskörperschaftenübergreifend! Es ist ein gutes Ergebnis für die Länder, für die Gemeinden, aber auch für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
11.57
Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Angela Baumgartner. – Bitte.
Abgeordnete Angela Baumgartner
(ÖVP): Frau Präsidentin! Sehr
geehrter Herr Bundesminister! Im Namen meines Kollegen Reinhold Lopatka darf
ich
den Seniorenbund aus Greinbach bei Hartberg recht herzlich begrüßen!
(Allgemeiner Beifall.)
Mit dem Finanzausgleich legen
wir unter anderem den Grundstein für weitreichende Investitionen in die
Pflege und in den Gesundheitsbereich. Mit diesen Mitteln können wir nicht
nur die Qualität heben, sondern auch
die Quantität erhöhen.
Konkret werden 300 Millionen Euro zur Stärkung des niedergelassenen Bereichs zur Verfügung gestellt. Der Schwerpunkt liegt zum Beispiel bei den Hausärztinnen und Hausärzten, bei den Gynäkologinnen und Gynäkologen, bei den Kinderärztinnen und Kinderärzten und generell bei der Versorgung in Ordinationen, Primärversorgungseinrichtungen und Gruppenpraxen.
Es sollen, das ist auch ganz
wichtig, 100 neue Kassenstellen geschaffen werden. Durch diese
Maßnahmen soll, und das ist mir ganz besonders wichtig, der ambulante
Bereich entlastet werden. Zusätzlich gibt es mehr als 550 Millionen
Euro für die Länder für die Reform im
Spitalsbereich – auch ein ganz
wichtiger Aspekt.
Auch im Finanzausgleich enthalten sind jährlich 2,4 Milliarden Euro, die den Ländern, Städten und Gemeinden für die Finanzausgleichsperiode 2024 bis 2028 zur Verfügung stehen. Unser Klubobmann August Wöginger hat es schon gesagt: Das ist wirklich frisches Geld und es ist achtmal so viel wie in der letzten Finanzausgleichsperiode.
Ein wesentlicher Teil der Mittel, nämlich 1,1 Milliarden Euro pro Jahr, wird durch den Zukunftsfonds für die Bereiche Kinderbetreuung, Wohnen, Pflege und Betreuung sowie Klima- und Umweltschutz bereitgestellt.
Erstmals werden für eine gezielte Förderung Gelder im Rahmen des Finanzausgleiches an konkrete Ziele geknüpft.
Das unterstreicht unser Versprechen zur Kinderbetreuungsoffensive, die Bundeskanzler Karl Nehammer bereits im September angekündigt hat. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
Die Kinderbetreuungsoffensive
ist nicht nur eine finanzielle Investition, sondern ein Versprechen an die
Zukunft. Um eine flächendeckende und hochwertige Versorgung zu
gewährleisten, werden insgesamt bis 2030 4,5 Milliarden Euro in den
Ausbau der Kinderbetreuung investiert. Als Bürgermeisterin
weiß ich sehr gut, wie wichtig eine Kinderbetreuung ist, bei der sich die
Eltern sicher sein können, dass die Kinder ordentlich und professionell
versorgt
sind und dass sie mit gutem Gewissen ihren Beruf ausüben können, und
auch, wie wichtig eine ordentliche Gesundheitsvorsorge in den ländlichen
Regionen ist.
Herr Kollege Lercher oder Herr
Kollege Kollross von der SPÖ, ich weiß, wie wichtig die Gelder
für die Gemeinden sind. Ich bin seit 2014 Bürgermeisterin und
habe heuer meinen zehnten Voranschlag erstellt, und auch ich bin im Minus, aber
wir sparen nicht bei den Vereinen, wir erhöhen nicht die Gebühren
für die Bürger, wir stellen halt Projekte, die geplant waren, ein
Jahr nach hinten. (Zwischenruf des Abg. Kollross.)
Ich denke, dass wir die letzten
Jahre von der Bundesregierung nicht im Stich gelassen wurden, haben wir
doch 2 Milliarden Euro bekommen, und ich glaube auch nicht, dass uns die
Bundesregierung oder der Herr Finanzminister in Zukunft im Stich lassen wird,
wir werden weiterverhandeln.
In Wahrheit, Herr Bürgermeister, ist der Rechnungsabschluss eigentlich das, worauf es ankommt, das, was dann im neuen Jahr rauskommt – der Voranschlag ist ein Zahlenspiel. (Abg. Schroll: Sonst habt ihr eh keine Probleme!) Ja, wir sind im Minus, aber wir werden das schon schaffen, ich bin überzeugt davon, ebenso davon, dass uns niemand im Stich lassen wird. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen. – Zwischenruf des Abg. Kollross.)
Ich bin überzeugt, mit diesem Finanzausgleich werden
wir die kommenden Herausforderungen bewältigen. – Danke
schön. (Beifall bei der ÖVP
und bei Abgeordneten der Grünen. – Abg. Kollross:
Für den Herrn Minister ist das Budget eh ein Zahlenspiel! Da können wir
eh beschließen, was wir wollen!)
12.02
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Alois Stöger. – Bitte.
Abgeordneter Alois Stöger, diplômé (SPÖ): Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ganz besonders begrüße ich die SPÖ-Frauen aus der Gemeinde Wiener Neustadt: Herzlich willkommen bei uns im Parlament! (Beifall bei der SPÖ sowie bei Abgeordneten von ÖVP, FPÖ, Grünen und NEOS.)
Sehr gut, dass die Frauen hier
sind, denn wir diskutieren jetzt den Finanzausgleich, und, liebe Frauen,
bei dem Finanzausgleich zahlt ihr drauf. (Abg. Michael Hammer: So
ein Blödsinn!) Ihr zahlt deswegen drauf, weil das Geld nicht mit
Rechtsanspruch in die Gemeinden kommt. Ich kann euch sagen, was in
meinem Bezirk, in Urfahr-Umgebung, vorgestern stattgefunden hat. Da sitzen die
Gemeindevertreter im Sozialhilfeverband und sagen (Abg. Lindinger:
Da redet einer, der in den Gemeinden nicht aktiv ist und sich in den Kommunen
nicht auskennt!): Wir müssen die Rücklagen vom Sozialhilfeverband
auflösen,
damit wir das Gemeindebudget ausgleichen können. (Abg. Michael Hammer:
Da haben deine Genossen im Vorstand auch zugestimmt!) – Haben
sie nicht.
Was bedeutet es, Rücklagen im Sozialhilfeverband aufzulösen? – Das bedeutet ganz maßgeblich, dass das Seniorenheim Engerwitzdorf nicht gebaut werden kann (Abg. Michael Hammer: So ein Blödsinn!) und dass wir dafür keine Rücklagen haben. (Abg. Michael Hammer: Ist ja ein Blödsinn! Ist ja ein Blödsinn!)
Präsidentin Doris Bures: Entschuldigung, Herr Abgeordneter Stöger! – Ich erteile jetzt Herrn Abgeordneten Michael Hammer für seinen Zwischenruf: Das ist „ein Blödsinn“!, einen Ordnungsruf. (Beifall bei der SPÖ. – Abg. Michael Hammer: Ist aber einer! Ich bin in diesem Vorstand und weiß, was geplant ist – er nicht!) Und ich ersuche Sie, das auch in Zukunft zu unterlassen.
*****
Bitte, Herr Abgeordneter Stöger.
Abgeordneter Alois Stöger,
diplômé (fortsetzend):
Und das ganz Entscheidende ist: Es wird dann um ein oder zwei Jahre oder
vielleicht fünf Jahre später
gebaut werden. (Abg. Michael Hammer: Ist ja nicht wahr!) Das
bedeutet, liebe Frauen, das sage ich ganz deutlich, dass ihr die Pflege der
Menschen,
die sonst im Alten- und Pflegeheim wären, zu Hause selbst machen
müsst. (Abg. Michael Hammer: So ein Blödsinn!) Und das
bedeutet auch in anderen Bereichen - -
Präsidentin Doris Bures: Ich erteile Herrn Abgeordneten Hammer abermals einen Ordnungsruf und ersuche Sie noch einmal, sich in Ihrer Ausdrucksweise zu mäßigen. (Heiterkeit bei der ÖVP. – Abg. Heinisch-Hosek: Hahaha! – Abg. Holzleitner: Der lacht noch darüber! Schämen sollten Sie sich!)
*****
Abgeordneter
Alois Stöger, diplômé (fortsetzend): Das bedeutet in den Gemeinden einen
Druck bei Essen auf Rädern, das bedeutet einen Druck bei der
Schulausspeisung, das bedeutet – auch das gibt es –, dass
eine Gemeinde vom Land vorgeschrieben bekommt, weil sie kein Geld mehr hat,
dass sie in der
Nacht nicht mehr Schnee räumen darf, weil sie dann ja
Nachtüberstunden zahlen müsste. (Abg. Schnabel: Das kann
das Land nicht vorschreiben!) Das heißt, sie
dürfen erst ab 6 Uhr Schnee räumen. Das bedeutet weiters, dass man kein Geld für Jugendzentren hat, das bedeutet, dass Kultur- und Sportvereine nichts bekommen. (Abg. Schnabel: Was hat das mit dem Finanzausgleich zu tun? – Abg. Holzleitner: Weil es die Gemeinden spüren! Das müssten Sie als Bürgermeister wissen!)
Herr Bundesminister, ich habe eine Frage: Wie viel aus diesem Zukunftsfonds – ich finde das ja super – bekommt meine Gemeinde mit Rechtsanspruch? Können Sie mir das sagen?
Und jetzt bin ich bei der Demokratie. Wenn wir die unterste Ebene in unserer Republik, die Bürgermeister:innen in den Gemeinden, die dort eine gute Arbeit machen, zu Bittstellern machen, dann bekommen wir ein Demokratieproblem. (Beifall bei der SPÖ.) Ich sage es noch einmal: Die meisten Bürgermeister:innen in Österreich sind von der ÖVP (Abg. Michael Hammer: Gott sei Dank!), die machen keine schlechte Arbeit, ich streite das ja gar nicht ab, aber wenn man die zu Bittstellern, zu Handlangern von irgendjemandem macht, dann haben wir ein Demokratieproblem, deshalb dürfen wir das nicht tun.
Abschließend, Herr Bundesminister: Es ist besser als nichts, aber was wir brauchen, das sind endlich klar ausfinanzierte Gemeinden. Und was wir überhaupt nicht mehr zulassen dürfen, ist, dass die Länder Landesumlagen von den Gemeinden verlangen dürfen, das geht nicht. (Beifall bei der SPÖ.)
12.06
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Manfred Hofinger. – Bitte.
Abgeordneter Ing. Manfred Hofinger (ÖVP): Geschätzte Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zu Herrn Kollegen Stöger möchte ich schon etwas sagen: Man merkt an seinen Ausführungen, dass er in der Gemeindepolitik nicht verhaftet ist. Das muss man schon einmal ganz ehrlich sagen. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
Wir diskutieren hier eines der
größten Reformprojekte für den ländlichen Raum, für
die Städte, für die Bürger dieser Gegenden sozusagen, für
alle Österreicherinnen und Österreicher. Es beinhaltet drei
große Projekte:
die Pensionsreform, die Gesundheits- und Pflegereform sowie den Ausbau
der Kinderbetreuung.
Betreffend Gesundheitsreform
möchte ich – weil es für uns im ländlichen Raum
besonders wichtig ist – die Stärkung des niedergelassenen
Bereiches anführen, ebenso die Spitalsfinanzierung, die für
uns Gemeinden besonders wichtig ist, da wir auch bei der Spitalsfinanzierung mitzahlen.
Zur Pflegereform:
Die 24-Stunden-Pflege wird weiter unterstützt, aber auch der Pflegefonds
wird auf 1,1 Milliarden Euro aufgefüllt. Diese zwei Punkte,
Gesundheit und
Pflege, sind die großen Kostenfaktoren in den Gemeinden, und genau in
diesen Bereichen werden wir Unterstützung erhalten, um Spielraum für
andere
Projekte zu bekommen. (Beifall bei der ÖVP.)
Neben diesen drei großen
Bereichen Gesundheitsreform, Pflegereform und Ausbau der
Kindergartenbetreuung möchte ich noch andere Punkte ansprechen, weil
dieser Finanzausgleich so umfassend ist: die Unterstützung bei der
Sicherung von Eisenbahnkreuzungen und beim Schülergelegenheitsverkehr. Beim
Schülergelegenheitsverkehr – vor allem im ländlichen Raum
ist das ein ganz wichtiger Punkt für unsere Familien und
Kinder – werden wir
die Mittel um 15 Millionen Euro auf 115 beziehungsweise insgesamt auf 120 Millionen
Euro aufstocken. Aber auch die Strukturfondsmittel für den kurzfristigen
Finanzbedarf der Gemeinden werden wir von 60 auf 120 Millionen Euro
aufstocken, und es wird einen Vorschuss an die Gemeinden auf deren
Ertragsanteile in der Höhe von 300 Millionen Euro geben.
Insgesamt ist das Finanzausgleichsgesetz ein sehr umfassendes Werk, mit dem über 36 Milliarden Euro bewegt werden und wir eine Steigerung von 2,4 Milliarden Euro plus den Zukunftsfonds mit 1,1 Milliarden Euro haben.
Warum ist das so
wichtig? – Weil die Gemeinden aus mehreren Gründen einen hohen
Finanzbedarf haben: Die Reformen im Spitalsbereich, im Pflegebereich kosten
viel Geld und die Kosten steigen sehr, sehr stark an, aber genauso machen die
Personalkosten und auch die hohen Zinsen den Gemeinden
zu schaffen. Daher ist es umso wichtiger, dass wir dieses
Finanzausgleichsgesetz beschließen, weil wir dadurch klar
Planungssicherheit haben und Stabilität
in die Gemeinden hineinbringen.
Ich möchte mich bei dir, Herr Finanzminister Magnus Brunner, und bei deinem Kabinett recht herzlich dafür bedanken, dass wir dieses große, umfassende Werk zustande bekommen haben, aber natürlich auch beim Gemeindebund, beim Städtebund und bei den Verhandlern der einzelnen Länder.
Ich möchte mich dafür
bedanken, dass es in den vergangenen Jahren immer wieder
Unterstützungspakete für die Gemeinden gegeben hat, aber
möchte auch darauf hinweisen – wie Sie selber angeführt
haben –, dass das Jahr 2024 das große
Herausforderungsjahr für die Gemeinden sein wird und sie, wenn es
notwendig sein sollte, auch noch Unterstützung brauchen.
(Abg. Lercher: Ah ja!)
Ich möchte einen Abänderungsantrag einbringen, und zwar:
Abänderungsantrag
der Abgeordneten Gabriel Obernosterer, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA, Kolleginnen und Kollegen
zum Bericht des Finanzausschusses
über die Regierungsvorlage (2305 d.B.): Bundesgesetz, mit dem ein
Finanzausgleichsgesetz 2024 erlassen wird sowie das
Finanzausgleichsgesetz 2017, das Umweltförderungsgesetz, das Wohn-
und Heizkostenzuschussgesetz, das Transparenzdatenbankgesetz 2012 und
das Bildungsinvestitionsgesetz geändert werden (2375 d.B.) –
Top 2
Ich möchte ihn in den Grundzügen erläutern.
Es ist so, dass im Zuge der Finanzausgleichsverhandlungen eines
festgeschrieben wurde: dass wir eine gebietskörperschaftenübergreifende
Transparenzdatenbank einführen, in die Gebietskörperschaften,
auch Länder, einmelden werden, und es ermöglicht
wird, diese Transparenzdatenbank zu befüllen.
Des Weiteren möchte ich in diesem Zusammenhang
erläutern, dass die Entschädigungen von NS-Opfern in der
Transparenzdatenbank nicht eingepflegt
werden sollten. – Das ist der Abänderungsantrag.
*****
Ich möchte fortfahren. Den Dank an den Bundesminister habe ich schon angeführt.
Etwas macht mich aber schon ein wenig stutzig und da
möchte ich auf die
FPÖ verweisen: Kollege Linder hat die Nadel im Heuhaufen beim
FAG 2024 bis 2028 gefunden. Es ist absolut unverständlich für
mich, da Sie in drei Bundesländern in der Regierung sind, den
Finanzbedarf der Gemeinden genau kennen und hier nicht mitstimmen. Das ist
fast unglaublich. Die Menschen in Österreich sollen sich wirklich selber
ein Bild machen. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der
Grünen.)
Im Gegensatz zur FPÖ glauben wir an Österreich. Wir glauben an den föderalistischen Staat Österreich – in diesem Sinne: herzlichen Dank. (Beifall bei ÖVP und Grünen. – Abg. Deimek: Das glaube ich eher nicht!)
12.12
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Abänderungsantrag
der Abgeordneten Gabriel Obernosterer, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA
Kolleginnen und Kollegen
zum Bericht des Finanzausschusses über die Regierungsvorlage (2305 d.B.): Bundesgesetz, mit dem ein Finanzausgleichsgesetz 2024 erlassen wird sowie das Finanzausgleichsgesetz 2017, das Umweltförderungsgesetz, das Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz, das Transparenzdatenbankgesetz 2012 und das Bildungsinvestitionsgesetz geändert werden (2375 d.B.) – Top 2
Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen:
Die eingangs bezeichnete Regierungsvorlage wird in Artikel 5 (Änderung des Transparenzdatenbank-gesetzes 2012) wie folgt geändert:
1. Nach Z 5 wird folgende Z 5a eingefügt:
„5a. Dem § 1 wird folgender Abs. 4 angefügt:
„(4) Dieses
Bundesgesetz gilt für alle Organe des Bundes. Es gilt weiters für vom
Bund mit der Abwicklung von Leistungen betraute Rechtsträger, soweit die
Leistung
der Gesetzgebung des Bundes unterliegt.““
2. In Z 12 wird in § 4a Abs. 1 Z 2, Abs. 2 Z 2 und Abs. 4 jeweils das Wort „verschiedenen“ durch das Wort „betrauten“ ersetzt.
3. In Z 14 wird in § 8 Abs. 1 Z 6 und Abs. 9 jeweils das Wort „Wiedergutmachungen“ durch das Wort „Entschädigungen“ ersetzt.
4. In Z 22 wird in § 21 Abs. 1 Z 6 das Wort „verschiedenen“ durch das Wort „betrauten“ ersetzt.
5. Nach Z 22 wird folgende Z 22a eingefügt:
„22a. In § 23
Abs. 2 wird im zweiten Satz nach der Wortfolge „Leistungen im Sinne des
§ 4 Abs. 1 Z 1 lit. f“ die Wortfolge „sowie
Entschädigungen gemäß § 8
Abs. 1 Z 6“ eingefügt.“
6. Nach Z 25 wird folgende Z 25a eingefügt:
„25a. In § 25 Abs. 2 wird im ersten Satz nach der Wortfolge „für die Mitteilung von Sachleistungen im Sinne des § 4 Abs. 1 Z 1 lit. f“ die Wortfolge „sowie von Entschädigungen gemäß § 8 Abs. 1 Z 6“ eingefügt.“
7. Z 28 lautet:
„28. § 29 Abs. 1 Z 4 entfällt.“
8. Z 38 lautet:
„38. In § 43 wird folgender Abs. 15 angefügt:
„(15) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/202x treten in Kraft:
1. das
Inhaltsverzeichnis, § 1 Abs. 1 Z 6, Abs. 2 und Abs. 4, § 4 Abs. 1,
§ 4a,
§ 6 Abs. 2, § 15 Abs. 1 und 2, § 20 Abs. 2, § 28 sowie
§ 32 Abs. 9 mit Ablauf des Tages, an dem die Vereinbarung gemäß
Art. 15a B-VG zwischen dem Bund
und den Ländern über eine Transparenzdatenbank, BGBl. I Nr. 73/2013,
außer Kraft tritt; zugleich treten § 1 Abs. 1 Z 2, § 4 Abs. 3
und 4, § 20 Abs. 2 Z 3
und 4 sowie § 29 Abs. 1 Z 4 außer Kraft;
2. §
1 Abs. 1 Z 4, § 2, § 4 Abs. 2, § 8, § 11, § 16, §
21 Abs. 1, § 23 Abs. 2,
§ 25 Abs. 1 bis 2, § 30, § 32 Abs. 1 und 6, § 35,
§ 36, § 39g Abs. 1 und 4 sowie
§ 42 Abs. 1 mit Ablauf des Tages der Kundmachung; zugleich tritt § 1
Abs. 1 Z 5 außer Kraft.“ .“
Begründung
Zu Z 1 und 7 (§ 1 Abs. 4, § 29 Abs. 1):
Anlässlich der Überführung von
Definitionen, insbesondere jener der Landesleistungen, aus der derzeit
geltenden Vereinbarung nach Art. 15a B-VG über eine Transparenzdatenbank,
BGBl. I Nr. 73/2013, in das Transparenzdatenbankgesetz 2012 soll der
Geltungsbereich des Transparenzdatenbankgesetzes in § 1 Abs. 4
aufgenommen werden. Klargestellt werden soll in diesem Sinne, dass
das Transparenzdatenbankgesetz 2012 einerseits als ein Selbstbindungsgesetz des
Bundes die Organe des Bundes, nicht aber jene der Länder oder Gemeinden,
bindet. Da es sich bei der Transparenz im Förderungswesen andererseits um
eine Annexmaterie zu jener Materie handelt, der eine konkrete Leistung zuzuordnen ist, soll
zudem klargestellt werden, dass das Transparenzdatenbankgesetz 2012
außenwirksam nur dann normative Anordnungen treffen kann, wenn dem
Bund die Kompetenz zur Gesetzgebung der Leistung zukommt. Anlässlich
dieser Klarstellung können die in § 29 Abs. 1 Z 4 enthaltenen
Ausnahmen zur Mitteilungspflicht entfallen.
Zu Z 2 und 4 (§ 4a Abs. 1, 2 und 4, § 21 Abs. 1):
Wird eine Leistung von einem vom Bund oder einem Land
verschiedenen Rechtsträger abgewickelt, soll klargestellt werden,
dass diese Leistung als Bundesleistung gilt, wenn die Betrauung
des Rechtsträgers durch den Bund erfolgt, bzw. diese Leistung als
Landesleistung gilt, wenn die Betrauung des Rechtsträgers durch
ein Land erfolgt.
Zu Z 3, 5 und 6 (§ 8 Abs. 1 und Abs. 9, § 23 Abs. 2, § 25 Abs. 2):
Entschädigungen werden aus staatlicher Verantwortung
gegenüber Personen, die Unrecht oder Schaden erlitten haben, geleistet und
weisen – im Unterschied
zu direkten Förderungen - in der Regel symbolischen Charakter auf. Aus
diesem Grund sollen personenbezogene Daten zu Entschädigungen nicht mehr
verpflichtend in die Transparenzdatenbank übermittelt werden müssen.
Zu Z 8 (§ 43 Abs. 15):
Infolge der obigen Änderungen ist die Inkrafttretensbestimmung anzupassen.
*****
Präsidentin Doris Bures: Der Abänderungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht, wurde an die Abgeordneten verteilt und steht daher mit in Verhandlung.
Herr Abgeordneter Andreas Kollross, Sie haben das Wort.
12.12
Abgeordneter Andreas Kollross (SPÖ): Frau Präsidentin! Herr Minister,
wir haben es abgewartet! Werte Kolleginnen und Kollegen! Werte Zuseherinnen und
Zuseher! Der Finanzausgleich, über den wir gerade diskutieren, kurz
zusammengefasst: Der Bund muss zahlen, die Bundesländer haben
es sich gerichtet und für die Städte und Gemeinden ist es eine
Mogelpackung. (Beifall bei der SPÖ.)
Meine sehr geehrten Damen und
Herren, ich verstehe ja, dass es vonseiten der Grünen nicht viel
Verständnis – das hört man aus den Reden
heraus –
gibt, denn das kann man ja irgendwo unter der Rubrik einordnen: Denn sie wissen
nicht, was Sie tun.
Dass aber ihr von der ÖVP so tut, als ob es kein Problem in den Gemeinden gäbe, das verstehe ich überhaupt nicht. In euren Reihen sitzen unheimlich viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, noch viel mehr sind bei euch in der Partei. Die werden ja auch zu euch kommen und sagen: Das geht sich hinten und vorne nicht mehr aus.
Kollege Lercher hat es eh schon
gesagt. 50 Prozent aller Gemeinden werden voraussichtlich nächstes
Jahr Abgangsgemeinden. Was heißt das? – Das
heißt, dass sie weniger einnehmen, als sie ausgeben. Das ist ein Angriff
auf die Gemeindeautonomie, das ist aber auch ein Angriff auf das soziale, wirtschaftliche,
kulturelle und gesellschaftliche Leben in unserer Republik. (Beifall
bei der SPÖ.)
Machen wir doch den Test! Da sitzen eh die ganzen
ÖVP-Bürgermeister aufgefädelt. Wie viele von euch
können das Budget noch ausgleichen? Zeigt
einmal der Reihe nach auf! – Schweigen im Walde. (Abg. Hörl
hebt die Hand.) – Einer, gratuliere! Du bist schon gar nicht
mehr Bürgermeister, du bist Seilbahnschaffner. (Allgemeine Heiterkeit. –
Zwischenruf der Abg. Heinisch-Hosek. – Zwischenruf
bei der ÖVP.) Einer kann das Budget noch ausgleichen.
Herr Finanzminister, das ist
Ihr Ergebnis – gemeinsam mit den Bundesländern, mit dem
Gemeindebund, mit dem Städtebund. Das kann doch nicht euer
Ernst sein! Wir beschließen heute ein Gesetz und das Ergebnis ist, dass
die Gemeinden und Städte auf die Leich’ gehen, dass
50 Prozent ihren Haushalt
nicht mehr ausgleichen können?! Das ist das Ergebnis Ihres
Finanzausgleichs?! – Das kann es ja wohl nicht sein! Das kann ja
wohl auch nicht in eurem Sinne
sein. (Zwischenruf der Abg. Baumgartner.)
Wenn Sie von den
300 Millionen Euro als Vorauszahlung reden, dann sagen Sie aber auch dazu:
Es ist eine kreditfinanzierte Vorauszahlung. – In den Jahren 2025,
2026, 2027 müssen sie das wieder zurückzahlen. Wenn man sich die Entwicklung
in den Gemeinden anschaut, dann weiß man, dass wir für die
Folgejahre alle – (in Richtung Bundesminister Brunner) Sie
wissen das wahrscheinlich auch, (in Richtung ÖVP) ihr wisst es
auch, (in Richtung Grüne) ob ihr
es wisst, weiß ich nicht – eine Mittelfristige Finanzplanung
machen müssen.
Das heißt, wir sehen nicht nur, dass wir nächstes Jahr, 2024, lauter Abgangsgemeinden haben, wir sehen es ja auch für 2025, 2026, 2027 und folgende. Es wird ja nicht besser.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, es wird ja nicht besser! Es werden noch mehr Abgangsgemeinden dazukommen.
Ich schicke jetzt eine letzte Geschichte hintennach: Ich war
ja immer der Meinung, man muss den vertikalen Schlüssel verändern,
also die Verteilung der Steuergelder und wie groß der Anteil ist, den die
Gemeinden bekommen.
Man hat sich für etwas anderes entschieden – okay. Man hat
jetzt diesen Zukunftsfonds, wegen dem ihr euch jetzt abfeiert, mit
1,1 Milliarden Euro geschaffen – okay. Das Problem ist nur,
Herr Finanzminister – ihr wisst das auch –: Das Geld
kommt nicht bei den Gemeinden an. Das versickert in visionslosen Landesbudgets,
meine sehr geehrten Damen und Herren! (Beifall
bei der SPÖ.)
Ich habe es mir für meine
Gemeinde ausgerechnet. Das gilt für eure Gemeinden genauso. Der
Zukunftsfonds würde bedeuten: 121 Euro pro Einwohnerin
und Einwohner, die jede einzelne Gemeinde mehr bekommen würde. Mit dem
könnten die Gemeinden die Budgets wieder ausgleichen. Wie viel kommt
da an? – Bestenfalls ein Drittel; zwei Drittel nähen sich die
Bundesländer ganz einfach ein. Das ist euer Ergebnis des Finanzausgleichs.
Deshalb: Ja, wir werden
zustimmen, weil es besser ist als nichts, aber ja,
es braucht zusätzliche Hilfen, und ja, wir müssten dafür sorgen,
dass die 121 Euro pro Bürgerin und Bürger aus dem Zukunftsfonds
wirklich bei den Städten und Gemeinden ankommen, denn das
Leben – das soziale und
das kulturelle Leben – in unserer Republik geschieht in den
Städten und Gemeinden. (Beifall bei der SPÖ.)
(In Richtung Abg. Baumgartner:) Frau Bürgermeisterin, da kannst du schon herauskommen und sagen, du wirst dort nicht einsparen, du wirst dort nicht einsparen. Das lässt die Gemeindeordnung gar nicht zu. Abgangsgemeinde heißt, dass du alle Ausgaben, die nicht zwingend sind, reduzieren musst (Zwischenruf der Abg. Baumgartner), das heißt Förderung von Vereinen, das heißt alle möglichen anderen Dinge; und es heißt vor allen Dingen noch eines: Den Gemeinden fehlt jegliches Geld für Investitionen. (Abg. Baumgartner: Aber die Vereine brauchen ...!)
Ihr wollt eine Wirtschaftspartei sein?! (Abg. Schnabel:
Genau zuhören, Herr Kollross!) Ihr wisst doch ganz genau, dass die
Städte und Gemeinden die größten wirtschaftlichen Auftraggeber
sind. Wenn es 50 Prozent Abgangsgemeinden gibt, heißt das,
50 Prozent der Gemeinden investieren nicht mehr! Das ist euer Ergebnis des
Finanzausgleichs. Ihr wollt eine Wirtschaftspartei sein?!
Lernt einmal etwas darüber! (Beifall bei der SPÖ. – Abg.
Baumgartner:
Warum stimmt ihr dann zu?)
12.18
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Klaus Lindinger. – Bitte.
12.18
Abgeordneter Ing. Klaus Lindinger, BSc (ÖVP): Frau Präsidentin! Geschätzter Herr Finanzminister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuseherinnen und Zuseher hier im Hohen Haus und vor den Bildschirmen! Ich darf kurz auf Kollegen Kollross eingehen, denn er behauptet, wir unterstützen die Gemeinden nicht. Ich frage dich, Herr Kollege Kollross: Kannst du ausgleichen? (Abg. Kollross: Ja!) – Dann zahle bitte den Gemeinden, die nicht ausgleichen können, die 121 Euro, dann kannst du auch einen Beitrag dazu leisten. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Kollross: Das hat mit Arbeitsplätzen zu tun! Kommunalsteuern ...!)
Diese Bundesregierung, diese Koalition hat in den letzten
Jahren bewiesen (Abg. Kollross: ... wahrscheinlich ...
diese Gemeinden finanzieren, heast!) – Herr Kollege Kollross,
jetzt passen Sie einmal auf (Abg. Matznetter: Sie müssen einmal
aufpassen!), denn das ist die Wahrheit, dass die Gemeinden
bestmöglich unterstützt werden! Da hat es die kommunalen
Investitionsgesetze und -programme gegeben, mit denen die regionale Wirtschaft
unterstützt wird. Da hat es die Einmalzahlungen an die Gemeinden gegeben,
damit sie finanziell entsprechend unterstützt werden und damit die
Liquidität in den Gemeinden gegeben
ist. (Abg. Linder: Das stimmt ja nicht!) Das beschließen
wir auch hier mit diesem Finanzausgleichsgesetz, sodass es 300 Millionen
Euro zusätzlich im
Jahr 2024 für die Gemeinden gibt.
Ich sage nicht, dass es einfach wird; es ist eine
Herausforderung, aber eines ist klar: Die Gemeinden sind in den meisten
Ländern keine Bittsteller. Bittsteller sind sie im Burgenland (Abg.
Holzleitner: Und in Oberösterreich! Geh bitte!), wo Doskozil
die Gemeinden und die Bürgermeister zu Bittstellern macht.
(Beifall bei der ÖVP.)
Eines darf ich zu Kollegen Stöger schon auch noch sagen, wenn er hier herauskommt und wohlwissend die Unwahrheit sagt: Er sitzt nicht im SHV-Vorstand, Kollege Hammer sitzt im Vorstand. Dort ist ein einstimmiger Beschluss gefasst worden, bei dem Ihre beiden SPÖ-Bürgermeisterkollegen zugestimmt haben. Es wird kein Heimbau verschoben. Es gibt auch die Heimplätze, es
fehlt keiner. Es geht lediglich um einen Sanierungsvorschlag. Kollege Stöger aber stellt sich hier heraus, hat von der Kommunalpolitik wirklich null Ahnung und behauptet Dinge, die einfach nicht stimmen. (Abg. Einwallner: Das ist ja unglaublich! – Weitere Zwischenrufe bei der SPÖ.) Das funktioniert nicht, Herr Kollege Stöger. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
Der Finanzausgleich – und es ist
wirklich ein guter Finanzausgleich (Zwischenruf bei der
ÖVP – Abg. Matznetter: Zum Glück sind die
Bürger:innen ... als Sie,
Herr Ing. Lindinger!) – sichert strukturelle
Maßnahmen im Bereich der Gesundheit, strukturelle Maßnahmen und
Verbesserungen im Bereich der Pflege (Zwischenruf der Abg. Kucharowits)
und hat einen riesengroßen Zukunftsfonds, der heute schon mehrmals
erläutert worden ist. Die Kinderbetreuung ist drin,
der Bereich des Wohnens ist drin, die Umwelt und das Klima sind drin. Ein kleiner
Bereich, der vielleicht für viele nicht wichtig ist, ist der sogenannte
Strukturfonds für finanzschwache Gemeinden, der von 60 Millionen auf
120 Millionen Euro aufgestockt wird. Das ist die Unterstützung
für jene Gemeinden,
die es gar nicht so einfach haben.
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Einen
Bereich darf ich auch noch hervorheben, weil er für unsere
Jüngsten ganz, ganz wichtig ist. Das ist der Bereich des
Schülergelegenheitsverkehrs, der Transport, für den es zusätzlich 15 Millionen
Euro gibt, damit wir sicherstellen können, dass die Kinder auch abgeholt
und in die Schule gebracht werden, meine Damen und Herren.
(Beifall bei Abgeordneten von ÖVP und Grünen.)
Abschließend darf ich noch auf einen Punkt eingehen. Die FPÖ stimmt bei diesem Tagesordnungspunkt nicht zu. (Abg. Wurm: Logisch, ja!) Obwohl in drei Bundesländern in Verantwortung, von denen die Zustimmung vorliegt, sagen die Abgeordneten der Freiheitlichen Partei hier herinnen: Dem stimmen wir nicht zu!
Welchen
Stellenwert dieser Finanzausgleich für die Freiheitlichen hat, hat
sich hier herinnen einmal mehr gezeigt. Bei der vorigen Debatte, bei der es um
das Bargeld ging, waren es fünf Redner – übrigens hat die
ÖVP es ganz
klar ins Regierungsprogramm geschrieben, dass wir zum Bargeld stehen und das
Bargeld absichern (Abg. Deimek: Das ist ja nichts wert!) –,
und bei dieser
Debatte meldet sich ein Einziger zu Wort (Zwischenrufe bei der FPÖ), weil ihr in den Gemeinden anscheinend nicht das
Sagen habt. (Abg. Kaniak: ... bissl
mehr als 88 Minuten Redezeit! In der nächsten GP schaut’s
besser aus!) Das ist die Wertigkeit des Finanzausgleichs für die Freiheitliche
Partei, meine sehr
geehrten Damen und Herren. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten
der Grünen. – Zwischenruf des Abg. Deimek.)
Wir als Volkspartei, als Bürgermeisterpartei stehen dazu, dass dieser Finanzausgleich ein guter ist, ein historischer, der die Gemeinden unterstützt, der den Menschen in den Gemeinden zugutekommt. Deshalb noch einmal die Aufforderung: Stimmt diesem Finanzausgleich zu! Das haben sich die Menschen in Österreich verdient. (Beifall bei der ÖVP sowie der Abg. Fischer.)
12.22
Präsidentin Doris Bures: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Christoph Stark. – Bitte.
Abgeordneter Christoph Stark (ÖVP): Frau Ministerin! Herr
Finanzminister! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Liebe Zuhörer:innen
hier im Saal!
(Abg. Wöginger – erheitert –: Frau
Ministerin?) Sie haben gerade turbulente Reden zu einem sehr komplexen Thema
erlebt, das über viele Wochen und Monate viele Menschen, viele Expertinnen
und Experten beschäftigt hat. Heute erleben wir quasi den Sukkus aus all diesen Verhandlungen zum Thema Finanzausgleich.
Wenn Sie unter anderem Kollegen Kollross
zugehört haben – und da meine ich Sie, liebe Zuhörerinnen
und Zuhörer hier im Saal und zu Hause –, dann
müssen Sie wirklich den Eindruck haben, es wird doch bald die Welt
untergehen: So kann es ja doch nicht weitergehen! Mit diesem Finanzausgleich
können
wir wohl alle nicht mehr wirtschaften! Die Gemeinden gehen grosso modo und
flächendeckend zugrunde! – Geschätzte Damen und Herren,
ich kann Sie
auf der Galerie und auch die Kollegen hier im Saal beruhigen: Es wird
nicht so sein. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Wurm: Sondern?)
Es wird deswegen nicht so sein, weil der
bisherige Finanzausgleich im Rahmen von 300 Millionen Euro jetzt auf
2,4 Milliarden Euro aufgestockt wurde.
(Ruf bei der SPÖ: 1,2!) Jetzt rechne ich einmal damit, dass hier im
Saal lauter Menschen sitzen, die über das Volksschuleinmaleins
hinausgekommen sind. 2,4 Milliarden Euro sind doch deutlich mehr als
300 Millionen Euro, da werden Sie mir vermutlich alle recht geben, auch
die Kollegen von der SPÖ.
Mit diesen 2,4 Milliarden Euro wird so
viel ermöglicht, was bisher nicht möglich war (Abg. Kollross: Warum
gibt es dann so viele Abgangsgemeinden? Das verstehe ich
nicht!), und all das, Herr Kollege, mit der Zustimmung von Städtebund
(Abg. Kollross: Erklären Sie das!), Gemeindebund und
Ländern, nämlich
auch SPÖ-geführten Ländern (Ruf bei der SPÖ: Aber das
kann er nicht erklären! – Abg. Kollross: Warum gibt es
50 Prozent Abgangsgemeinden?) und ÖVP-geführten Ländern,
die in Summe am Ende gesagt haben: Ja, es ist ein gutes Paket, und wir
unterschreiben dieses Paktum! (Beifall bei der ÖVP und
bei Abgeordneten der Grünen.)
Ich erinnere mich an die Zeit während
Corona (Zwischenruf bei der SPÖ), da kam auch der Vorwurf: Um
Gottes willen, die Bundesregierung und das Parlament lassen die
Gemeinden im Stich! Das kann doch nicht sein, die Gemeinden gehen
zugrunde! – Und was ist passiert, liebe Kolleginnen und Kollegen? –
Zwei Mal je 1 Milliarde Euro an die Gemeinden, um genau die Investitionen
zu stützen, um den Motor der Gemeinden am Laufen zu halten. Es ist gelungen, dank
einer verantwortungsvollen Politik, und das wird auch jetzt wieder passieren. (Beifall
bei der ÖVP sowie der Abg. Fischer.)
Ich verhehle nicht, dass es für viele Gemeinden angesichts von Teuerung, Energiekosten, Personalkosten und vielen anderen Dingen im kommenden
Jahr schwierig wird, gar keine Frage.
Auch ich hatte große Mühe, mit meinen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern ein Budget zustande zu bringen. Ich
und viele, viele andere, wir vertrauen aber darauf, wenn das Jahr ins Land
zieht und wir erkennen und auch im Finanzministerium der Herr Finanzminister
erkennt: Liebe Leute, das wird zu eng, das geht sich nicht aus!, dass eine
verantwortungsvolle Politik dann auch die nötigen Entscheidungen
trifft, um zu verhindern, dass bei den Gemeinden etwas Gröberes passiert.
Und das wird passieren, darauf vertraue ich, weil der Finanzminister
dafür Sorge tragen wird. (Beifall bei der ÖVP sowie der
Abgeordneten Disoski und Fischer.)
Noch einmal zurück zu Ihnen, liebe
Zuhörerinnen und Zuhörer: In Kürze wird eine Abstimmung
über dieses gesamte Paket Finanzausgleich erfolgen.
Ich bin gespannt, wer sich hier vom Sitz erheben wird, um diesem gesamten Pakt,
diesen 2,4 Milliarden Euro für Pflege, für Gesundheit, Gemeinden, Zukunftsfonds
et cetera, zuzustimmen, und wer dieser Entscheidung nicht zustimmen wird.
(Abg. Deimek: Das ist ja nichts Neues! Wenn man im Croquis nachschaut,
kann man es lesen!)
Die, die zustimmen werden, tragen
Verantwortung für Österreich, egal in welcher Rolle, ob in einer
Regierungsfraktion oder in der Opposition. Es wird
sich zeigen, wer Verantwortung tragen kann und wird. – Danke
schön. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
12.28
Präsidentin Doris Bures: Mir liegt dazu nun keine Wortmeldung mehr vor. Damit schließe ich die Debatte.
Wünscht der Herr Berichterstatter ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall.
Mir liegt jetzt noch kein fertiges
Abstimmungscroquis vor, weil der Abänderungsantrag relativ spät
eingebracht wurde und die Parlamentsdirektion mit dem Croquis noch nicht fertig
ist. Ich kann einmal kurz nachfragen, wie lange
es dauert. – Das Croquis braucht noch 5 bis 10 Minuten. Wir
können die Abstimmung nach den Tagesordnungspunkten 8 und 9 (Rufe
bei der
ÖVP: 5 bis 6!), nein, 5 bis 6 machen. Ich verlege die Abstimmung auf den Abstimmungsblock nach TOP 5 und 6. Die Abstimmung wird verlegt.
Ich fahre in der Tagesordnung fort.
Bericht des Finanzausschusses über die Regierungsvorlage (2321 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988, das Umgründungssteuergesetz, die Bundesabgabenordnung, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Kommunalsteuergesetz 1993 und das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert werden (Start-Up-Förderungsgesetz) (2378 d.B.)
6. Punkt
Bericht des Finanzausschusses über die Regierungsvorlage (2322 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung für Unternehmensgruppen erlassen wird und die Bundesabgabenordnung sowie das Unternehmensgesetzbuch geändert werden (Mindestbesteuerungsreformgesetz – MinBestRefG) (2379 d.B.)
Präsidentin Doris Bures: Wir gelangen zu den Punkten 5 und 6, über welche die Debatten unter einem durchgeführt werden.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Erste Rednerin: Frau Abgeordnete Selma Yildirim. – Bitte.
Abgeordnete Mag. Selma Yildirim (SPÖ): Frau Präsidentin! Herr Minister! Hohes Haus! Sehr geehrte Damen und Herren! Dringend benötigte hoch qualifizierte Mitarbeiter:innen sollten mit einer angemessenen Entlohnung und guter Behandlung an Unternehmen gebunden werden. Die Beteiligung am
Unternehmenserfolg ist
grundsätzlich gut – darum geht es in diesem vorliegenden Start-Up-Förderungsgesetz –,
und es klingt verlockend und ist auch
jetzt schon möglich.
Mit dieser Vorlage, über die wir jetzt diskutieren,
ändern sich unter anderem folgende Punkte: Der Arbeitgeber kann Anteile
seines Unternehmens an einzelne dringend benötigte hochqualifizierte
Mitarbeiter:innen übertragen. Der Betriebsrat muss bei der Entscheidung
nicht mehr eingebunden werden.
(Abg. Loacker: Wenn ich was verschenke, muss ich nicht fragen!) Die
Mitarbeiter werden zwar wirtschaftliche Eigentümer, können aber zwei
Jahre lang
nicht darüber verfügen. Wird das Dienstverhältnis vorzeitig
beendet, haben Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer womöglich gar keinen Profit
und in Wirklichkeit einen Verlust. Daher sollten Mitarbeiter:innen, um sie an
ein Unternehmen zu binden und sie am Unternehmenserfolg teilhaben zu lassen, unserer
Ansicht nach an erster Stelle gut behandelt und angemessen entlohnt
werden. (Beifall bei der SPÖ.)
In diesem Gesetzentwurf, sehr geehrte Damen und Herren, sind
zu viele Widersprüche und Unklarheiten enthalten. (Abg. Loacker:
Auch in Ihrer Rede sind zu viele Widersprüche!) Eine Abgrenzung zu den
Dienstverträgen – wann
ist man selbstständig, unselbstständig – verschwimmt. (Abg.
Loacker: Um Gottes willen!) Hinzu kommen verfassungsrechtliche
Bedenken, die auch Sie in
den Stellungnahmen verschiedener Proponenten bekommen haben, und aufgrund
dieser vielen Widersprüche und Bedenken werden wir dem Gesetzentwurf
in dieser Fassung nicht zustimmen. (Abg. Loacker: Bei welcher Kammer
ist der dann Mitglied, wenn das so schwer ist?)
Zustimmen werden wir hingegen dem sogenannten Mindestbesteuerungsreformgesetz, und zwar weil eine 15-prozentige Besteuerung für internationale Multikonzerne endlich umgesetzt wird. (Beifall bei der SPÖ.)
Bei dieser Mindestbesteuerung
geht es um jene internationalen Multikonzerne, die weltweit Rekordumsätze
erzielen, Rekordgewinne erzielen, aber kaum
bis gar keine Steuern zahlen, es geht um diese Konzerne, die ihre Gewinne mit
durchwegs kreativen Tricksereien in Steuersümpfen verstecken –
höchste
Zeit, dass diese Steuersümpfe trockengelegt werden!
Das ist ein erster, wenn auch – zugegeben –
ein kleiner Schritt (Abg. Wurm – erheitert –: 15 Prozent
ist wenig!), um in die richtige Richtung zu gehen,
daher wird die SPÖ dieser Regierungsvorlage zustimmen. (Beifall bei der
SPÖ.)
12.32
Präsidentin
Doris Bures: Nun ist Herr Abgeordneter
Karlheinz Kopf zu
Wort gemeldet. – Bitte.
Abgeordneter Karlheinz Kopf (ÖVP): Frau Präsidentin! Herr Bundesminister!
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen hier im Saal! Sehr geehrte Damen
und Herren Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuseher vor den
Empfangsgeräten! Wir behandeln mehrere Themen unter diesen zwei
Tagesordnungspunkten:
zum einen – Frau Kollegin Yildirim ist schon darauf
eingegangen – das Start-Up-Förderungsgesetz. Österreich
ist Gott sei Dank ein Land mit vielen Unternehmerinnen und Unternehmern,
mit vielen Unternehmen, und jedes Jahr kommen durch Neugründungen
etwa 35 000 dazu. Das ist für den Lebenszyklus
von Unternehmen genauso wichtig, wie es sonst auch in der Gesellschaft wichtig
ist, Nachwuchs zu bekommen.
Es gibt eine Reihe von Förderungen – auch ab
dem ersten Tag – für neugegründete Unternehmen, und
eine besondere Rolle nehmen bei den Gründern die sogenannten Start-ups
ein, also Unternehmen, die besonders neuartige Geschäftsideen kreieren,
die auch ein hohes Wachstumspotenzial haben und die damit auch große
Zukunftschancen haben, aber natürlich oft in Risikobereiche hineingehen.
Das ist sehr wünschenswert und es ist auch lobenswert und sinnvoll, dass
wir das entsprechend unterstützen und dies auch im Rahmen
eines eigenen Gesetzes tun. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten
der Grünen.)
Es ist aber schon eine ganz spezielle Art von Unternehmen,
wie gesagt: Risiko, innovativ. – Und ja, Frau Kollegin Yildirim,
selbstverständlich sollen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
Unternehmen gut behandelt und auch angemessen entlohnt werden, aber in diesen
Unternehmen ist es ganz besonders interessant, wichtige Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter auch durchaus zu Mitunternehmerinnen, Mitunternehmern zu machen,
und dieser Gesetzentwurf bietet die Möglichkeit dazu.
Selbstverständlich sollen die Firmen die Möglichkeit
haben, da selektiv vorzugehen, das jenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
anzubieten, die sie langfristig halten wollen. Es ist auch
völlig sinnvoll und klug, diese
Partnerschaft natürlich an den Verbleib
im Unternehmen zu binden, weil es ja nicht Sinn und Zweck dieser Idee
ist, viele Gesellschafterinnen und Gesellschafter außerhalb solcher
Start-up-Unternehmen zu haben. Also die Start-up-Szene ist mit diesem
Gesetzentwurf sehr, sehr zufrieden, hat ihn auch sehr, sehr gelobt. Ich glaube,
trotz Ihrer Kritik, wir tun damit etwas Gutes. (Beifall bei der
ÖVP und bei Abgeordneten
der Grünen.)
Zweiter Punkt, und da bin ich völlig d’accord mit
Ihnen: Die globale Mindestbesteuerung, also dieses Mindestbesteuerungsreformgesetz,
ist notwendig.
Es gibt nach wie vor Unternehmen, die versuchen, ihre Steuerleistung so zu optimieren,
dass sie ihre Steuerpflicht in Länder mit niedriger oder ganz niedriger Besteuerung
auslagern, denn letzten Endes ist niemand von uns daran interessiert,
Hochsteuerländer zu haben. Österreich ist ein Hochsteuerland,
allerdings wird mit diesen Steuern auch das Gemeinwesen finanziert, werden
die Sozialleistungen finanziert, und das ist schon okay so.
Es soll aber nicht so sein, dass sich einzelne Länder
und einzelne Firmen
quasi aus dieser Verantwortung des gemeinschaftlichen Finanzierens stehlen
können. Deswegen ist es sinnvoll, dass bei multinationalen Unternehmen – es geht
ohnehin nur um ganz große – dieser Steuerflucht oder diesen
Gewinnverlagerungen ein Stück weit ein Riegel vorgeschoben wird, und
das ist selbstverständlich in Ordnung.
Eines sei vielleicht noch
gesagt: Mindestbesteuerungsreformgesetz, das klingt sehr sperrig. Das ist ein
Riesengesetzeswerk, hinter dem eine Reihe,
eine Vielzahl diffiziler Detailarbeit und in diesem Zusammenhang auch viel an
Kompetenz steckt. – Einen herzlichen Dank an die Steuersektion im
Finanzministerium, an Herrn Prof. Mayr, herzlichen Dank auch an deine
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ein ganz tolles Werk, sehr komplex und
nicht einfach. (Beifall bei der ÖVP sowie des Abg. Schwarz.)
Noch zwei Punkte: Ich bringe noch einen Abänderungsantrag der Abgeordneten Kopf, Schwarz zum Start-Up-Förderungsgesetz ein:
Um diesen in den Grundzügen
auch zu erläutern: Was steckt dahinter? – Zum einen eine Verlängerung
der Steuer-, SV- und Kommunalsteuerfreiheit
für Einmalzahlungen, also Mitarbeiterprämien; zuvor
Teuerungsprämien, die wir schon aus der Coronazeit kennen.
Was steckt hinter dieser
Verlängerung? – Sie alle bekommen im Augenblick mit, dass Kollektivvertragsverhandlungen
laufen, dass diese für beide Seiten
sehr, sehr schwierig sind – für die Arbeitgeberseite angesichts
der zurückliegend hohen Inflation besonders schwierig, weil diese mit
Forderungen konfrontiert ist, die natürlich im Wettbewerb da
oder dort ganz, ganz schwer in der unternehmerischen Gebarung
unterzubringen sind. Da ist ein Instrument –
das jetzt in der einen oder anderen Kollektivvertragsverhandlung auch schon
genutzt wurde –, die Möglichkeit, eine Kombination zu machen:
aus nachhaltiger Erhöhung durch einen Erhöhungsprozentsatz
und auf der anderen Seite da oder dort auch – im Einvernehmen
zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebervertretung – mit
Einmalzahlungen zu operieren.
Deswegen macht es natürlich Sinn, diese bisher gelebte Steuer-
und SV-Freiheit auch für das Jahr 2024 fortzusetzen. Ich denke, das
ist ganz, ganz wichtig
für bereits abgeschlossene, für laufende, aber auch noch kommende
KV-Verhandlungen: einfach als Möglichkeit, die man hoffentlich auch da
oder dort gut nützt, um für beide Seiten ein gutes Ergebnis zustande
bringen
zu können.
Der zweite Punkt im Abänderungsantrag ist eine sozialversicherungsrechtliche Regelung. Dabei geht es um das bewährte Preisregime für erstattungsfähige Arzneimittel. Das soll mit dieser zweiten großen Änderung in diesem Abänderungsantrag fortgeschrieben werden. Es gibt größtes Einvernehmen, auch in der Sozialversicherung zwischen den dort agierenden Playern, mit dem Sozialministerium soll diese besondere Form der Preisregelung fortgeschrieben werden.
*****
Das sind die wesentlichen Punkte in diesem Abänderungsantrag. Er wird ob seiner Länge ohnedies auch schriftlich im Saal verteilt werden.
Ich darf Sie also bitten, diesen beiden Gesetzesmaterien
inklusive der Änderungen zuzustimmen. Ich denke, die Start-up-Szene
hat es sich verdient,
eine solche sehr fortschrittliche Regelung zu bekommen. Der Steuerflucht und
Gewinnverlagerung soll durchaus ein Riegel vorgeschoben werden, oder zumindest
sollen Unternehmen, die das tun wollen, einen Beitrag, auch zur Finanzierung
des Gemeinwesens, leisten.
Die beiden letztgenannten Dinge im Abänderungsantrag habe ich schon erläutert. Ich bitte Sie um Zustimmung und danke für die Aufmerksamkeit. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
12.40
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Abänderungsantrag
der Abgeordneten Karlheinz Kopf, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA
Kolleginnen und Kollegen
zum Gesetzentwurf im Bericht des Finanzausschusses 2378
der Beilagen über die Regierungsvorlage 2321 der Beilagen betreffend ein
Bundesgesetz, mit dem
das Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988, das Umgründungssteuergesetz,
die Bundesabgabenordnung, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das
Kommunalsteuergesetz 1993 und das Familienlastenausgleichsgesetz 1967
geändert werden (Start-Up-Förderungsgesetz) –
Top 5
Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen:
Die oben zitierte Regierungsvorlage (2321 d. B.) in der Fassung des Ausschussberichts (2378 d. B.) wird wie folgt geändert:
1. Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988) wird wie folgt geändert:
Ziffer 6 lautet:
„6. In § 124b werden folgende Ziffern 445 bis 447 angefügt:
„445. § 41 Abs. 1 Z 17, § 41 Abs. 4, § 42 Abs. 1 Z 3 und § 67a, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xx/2023, sind erstmalig für Anteile anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2023 abgegeben werden, wenn
– die Einkommensteuer veranlagt wird, bei der Veranlagung für das Kalenderjahr 2024,
– die Einkommensteuer (Lohnsteuer) durch Abzug eingehoben oder durch Veranlagung festgesetzt wird, für Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 31. Dezember 2023 enden.
446. § 33 Abs. 3 Z 1 und Abs. 3a Z 1 lit. b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2023 ist für Kalendermonate ab Jänner 2024 anzuwenden.
447. a) Zulagen und Bonuszahlungen, die der Arbeitgeber im Kalenderjahr 2024 gewährt (Mitarbeiterprämie), sind bis 3 000 Euro pro Jahr steuerfrei, wenn die Zahlung aufgrund einer lohngestaltenden Vorschrift gemäß § 68 Abs. 5 Z 5 oder 6 erfolgt. Kann im Falle des § 68 Abs. 5 Z 5 oder 6 keine Betriebsvereinbarung abgeschlossen werden, weil ein Betriebsrat nicht gebildet ist, ist von einer
Verpflichtung des Arbeitgebers auszugehen, wenn eine vertragliche Vereinbarung für alle Arbeitnehmer vorliegt.
Es muss sich dabei um zusätzliche Zahlungen handeln,
die üblicherweise bisher
nicht gewährt wurden. Sie erhöhen nicht das Jahressechstel
gemäß § 67 Abs. 2 und werden nicht auf das Jahressechstel
angerechnet.
b) Mitarbeiterprämien
sind beim Arbeitnehmer im Kalenderjahr 2024 insgesamt bis zu einem Betrag von 3
000 Euro pro Kalenderjahr steuerfrei. Werden im Kalenderjahr 2024 sowohl eine
Gewinnbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Z 35 als auch eine
Mitarbeiterprämie ausbezahlt, sind diese nur insoweit steuerfrei,
als sie insgesamt den Betrag von 3 000 Euro pro Jahr nicht übersteigen.
Werden im Kalenderjahr mehr als 3 000 Euro steuerfrei berücksichtigt, ist
der Steuerpflichtige gemäß § 41 Abs. 1 zu veranlagen.
c) Soweit Zulagen und Bonuszahlungen nicht durch lit. a erfasst werden oder 3 000 Euro übersteigen (lit. b), sind sie nach dem Tarif zu versteuern.““
2. Art. 5 (Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) wird wie folgt geändert:
a) Die Z 1 erhält die Bezeichnung „1c“ und folgende Z 1 bis 1b werden vorangestellt:
»1. § 18a Abs. 2 Z 3 entfällt.
1a. Im § 30a Abs. 1 wird der Punkt am Ende der Z 38 durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 39 angefügt:
„39. über die Abgabe von parallel importierten Heilmitteln; in diesen Richtlinien, die für die Apotheker/Apothekerinnen (§ 348a) sowie die Hausapotheken führenden Ärzte und Ärztinnen verbindlich sind, soll bestimmt werden, inwieweit parallel importierte Arzneispezialitäten für Rechnung der Sozialversicherungsträger abgegeben werden können; durch die Richtlinien darf der Heilzweck nicht gefährdet werden; die Richtlinien sind vom Dachverband im übertragenen Wirkungsbereich zu erlassen; bei der Erlassung unterliegt der Dachverband
den Weisungen des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz.“
1b. § 49 Abs. 3 Z 30 lautet:
„30. steuerfreie Zulagen und Bonuszahlungen nach § 124b Z 350 lit. a, steuerfreie Teuerungsprämien nach § 124b Z 408 lit. a und b sowie steuerfreie Mitarbeiterprämien nach § 124b Z 447 EStG 1988;“«
b) Die Z 2 wird durch folgende Z 2 bis 10 ersetzt:
»2. § 54b Abs. 2 lautet:
„(2) Bei
gleichzeitiger Ausübung mehrerer die Pflichtversicherung nach diesem oder
einem anderen Bundesgesetz begründenden Erwerbstätigkeiten ist die
Beitragsübernahme durch den Bund für den jeweiligen
Kalendermonat grundsätzlich mit dem Ausmaß nach Abs. 1 begrenzt. Die
versicherte Person hat Beitragsteile,
die infolge dieser Begrenzung nicht durch die Beitragsübernahme gedeckt
sind und auch sonst nicht entrichtet wurden, auf Grund der Vorschreibung durch
den zuständigen Versicherungsträger nachzuentrichten. Das Nähere
über den für die Vorschreibung der Nachentrichtung zuständigen
Versicherungsträger sowie
die Nachentrichtung in Teilbeträgen bei Vorliegen
berücksichtigungswürdiger Umstände im Sinne des § 107
Abs. 3 ist in den Richtlinien nach § 30a
Abs. 1 Z 33 festzulegen. Aus verwaltungsökonomischen Gründen kann
darin lediglich eine stichprobenartige Kontrolle bei gleichzeitiger
Ausübung mehrerer Erwerbstätigkeiten vorgesehen werden.“
3. Im § 350 Abs. 1 Z 2 lit. c entfällt das Wort „und“.
4. Im § 350 Abs. 1 wird der Punkt am Ende der Z 3 durch die Wort- und Zeichenfolge „, und“ ersetzt und folgende Z 4 angefügt:
„4. Erfüllung der Vorgaben der Richtlinien über die Abgabe von parallel importierten Heilmitteln (§ 30a Abs. 1 Z 39).“
5. Im § 351c Abs. 15 erster Satz entfällt das Wort „letztmalig“.
6. Im § 351c wird nach dem Abs. 16 folgender Abs. 17 angefügt:
„(17) Im Jahr 2025 ist das in Abs. 15 vorgesehene Verfahren
zu den Stichtagen 1. Februar 2025, 30. Juni 2025 und 1. Oktober 2025
erneut durchzuführen. Abs. 16
ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die am 1. Februar 2025 geltende
Rezeptgebühr zu berücksichtigen ist.“
7. Im § 443 Abs. 1 entfällt der zweite Satz.
8. § 705 Abs. 3 lautet:
„(3) § 351c Abs. 10 tritt mit 31. Dezember 2025 außer Kraft. § 351c Abs. 10 in der am 30. April 2017 geltenden Fassung tritt mit 1. Jänner 2026 in Kraft. Für Verfahren, in denen die Antragstellung durch das vertriebsberechtigte Unternehmen oder die Einleitung des Verfahrens durch den Dachverband vor dem 1. Jänner 2026 erfolgt, ist § 351c Abs. 10 in der am 31. Dezember 2025 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.“
9. In § 791 Abs. 1 wird vor dem Ausdruck „135 Abs. 1 Z 2“ der Ausdruck „49 Abs. 3 Z 11 lit. d, Z 16, Z 16a und Abs. 9 Z 2,“ eingefügt.
10. § 792 lautet:
„Schlussbestimmungen zu Art. 5 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2023
§ 792. (1) Es treten in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2023 in Kraft:
1. mit
dem auf die Kundmachung folgenden Tag die §§ 351c Abs. 15 und 17
sowie 705 Abs. 3;
2. mit 1. Jänner 2024 die §§ 49 Abs. 3 Z 30, 50a samt Überschrift und 443 Abs. 1.
(2) Die §§ 30a Abs. 1 Z 38 und 39 sowie 350
Abs. 1 Z 2 lit. c und Z 3 und 4
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2023 treten mit 1. Jänner
2024 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2025 außer Kraft.
(3) § 18a Abs. 2 Z 3 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft.
(4) Sofern die Preise
für die vom § 351c Abs. 17 erfassten Arzneispezialitäten
bis 1. Oktober 2025 innerhalb des Preisbandes gesenkt werden, sind
Streichungen für diese Arzneispezialitäten nach § 351f Abs. 1
aus gesundheitsökonomischen Gründen bis 31. Dezember 2025
ausgeschlossen.“«
3. Artikel 6 (Änderung des Kommunalsteuergesetzes 1993) wird wie folgt geändert:
a) Die bisherige Novellierungsanordnung (Änderung des § 5 Abs. 2) erhält die Bezifferung „1.“.
b) Es wird folgende Z 2 angefügt:
„2. In § 16 wird folgender Abs. 20 angefügt:
„(20) Steuerfreie Zulagen und Bonuszahlungen gemäß § 124b Z 447 EStG 1988 (Mitarbeiterprämie) sind von der Kommunalsteuer befreit.““
4. Artikel 7 (Änderung des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967) wird wie folgt geändert:
a) Z 1 lautet:
„1. In § 41 Abs. 4 wird am Ende der lit. h der Punkt durch einen Beistrich ersetzt; folgende lit. i und j werden angefügt:
„i) der gemäß § 67a Abs. 4 Z 2 des Einkommensteuergesetzes 1988 (Start-Up-Mitarbeiterbeteiligung) mit einem festen Satz zu versteuernde geldwerte Vorteil
j) die in § 124b Z 447 lit. a des Einkommensteuergesetzes 1988 genannten Zulagen und Bonuszahlungen (Mitarbeiterprämie).““
b) Z 2 lautet:
„2. In § 55 wird folgender Abs. 64 angefügt:
„(64) § 41 Abs. 4 lit. i und j in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2023 tritt mit dem der Kundmachung des
genannten Bundesgesetzes folgenden Tag
in Kraft und ist erstmalig ab dem Kalenderjahr 2024 anzuwenden.““
Begründung
Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988):
Zu § 124b Z 447
Im Oktober 2023 stieg der Verbraucherpreisindex, der als Maßstab für die allgemeine Preisentwicklung bzw. für die Inflation in Österreich fungiert, um 5,4% gegenüber dem Vorjahresniveau. Laut Statistik Austria ist das weniger als die Hälfte der Inflationsrate vom Jänner 2023 und der niedrigste Wert seit Jänner 2022. Dennoch stellt die Preisentwicklung eine nach wie vor besondere Herausforderung für die Österreicherinnen und Österreicher dar. Trotz wirksamer Maßnahmen zur Gegensteuerung und objektiv nachweisbarer Erfolge bei der Teuerungsbekämpfung sind die Menschen nach wie vor mit hohen Lebenshaltungskosten belastet.
Mit der vorgeschlagenen Änderung soll – in modifizierter Form – die mit dem Teuerungs-Entlastungspaket, BGBl. I Nr. 93/2022 erstmals für die Jahre 2022 und 2023 vorgesehene und von den Betrieben breitflächig in Anspruch genommene Möglichkeit, den Beschäftigten zusätzlichen Arbeitslohn aufgrund der Teuerung steuerfrei zu gewähren, aufgegriffen und verlängert werden.
§ 124b Z 447 in der vorgeschlagenen Fassung
knüpft in materieller Hinsicht an § 124b Z 408 EStG 1988 idF des
Teuerungsentlastungs-Pakets, BGBl. I Nr. 93/2022, an. Für das Kalenderjahr
2024 soll eine eigens geschaffene Regelung einer „Mitarbeiterprämie“
vorgesehen werden, die den Beschäftigten von Betrieben in der
nach wie vor hohen Inflation als zusätzliche steuerliche
Unterstützungsleistung dienen soll. Wird in einem Kollektivvertrag
für 2024 die Bezeichnung „Teuerungsprämie“ statt
„Mitarbeiterprämie“ verwendet, so soll dies - bei Vorliegen
der übrigen Voraussetzungen - für die Steuerbefreiung nicht
schädlich sein.
Gewährt der Arbeitgeber im Kalenderjahr 2024 Zulagen und Bonuszahlungen (Mitarbeiterprämien), sollen diese bis zu 3 000 Euro pro Jahr unter folgenden Voraussetzungen steuerfrei sein:
- Die
Zahlung muss aufgrund einer lohngestaltenden Vorschrift gemäß §
68 Abs. 5 Z 5 oder 6, d.h. aufgrund eines Kollektivvertrages, erfolgen. Im
Unterschied
zur Regelung des § 124b Z 408 soll für die Anwendung der Steuerbefreiung
erforderlich sein, dass die
„Mitarbeiterprämie“ im vollen Umfang im Rahmen einer
kollektivvertraglichen oder betrieblichen Vereinbarung, die aufgrund besonderer
kollektivvertraglicher Ermächtigung abgeschlossen worden ist, ausbezahlt
wird. Bei Fehlen eines kollektivvertragsfähigen Vertragsteiles auf
Arbeitgeberseite, kann die Zahlung auch aufgrund einer
Betriebsvereinbarung erfolgen. Bei Fehlen eines Betriebsrates
kann die Zahlung aufgrund einer entsprechenden kollektivvertraglichen
Ermächtigung und einer vertraglichen Vereinbarung des
Arbeitgebers für sämtliche Arbeitnehmer erfolgen.
- Es
muss es sich ferner um eine „zusätzliche Zahlung“ handeln,
d.h. um eine Zahlung, die üblicherweise bisher nicht gewährt
wurde. Als steuerfreie Zahlungen sollen daher Zahlungen etwa aufgrund
von Leistungsvereinbarungen, regelmäßig wiederkehrenden
„Bonuszahlungen“ oder „außerordentlichen Gehaltserhöhungen“
nicht in Betracht kommen. In den Kalenderjahren 2022
und 2023 gewährte Teuerungsprämien stellen hingegen keine Zahlungen
dar, welche bisher üblicherweise gewährt wurden und stehen daher
einer
steuerfreien Mitarbeiterprämie nicht im Wege (lit. a). Wird für das
Kalenderjahr 2024 kollektivvertraglich vorgesehen, dass als
Interessensausgleich für eine geringere Erhöhung der
Ist-Monatslöhne eine Mitarbeiterprämie gezahlt
wird, dann ist dies – wenn es sich
dabei nicht um bereits bezahlte Löhne handelt – bei Vorliegen
der übrigen Voraussetzungen ebenfalls nicht schädlich
für die Steuerbefreiung.
- Eine Mitarbeiterprämie soll – unter den vorgenannten Voraussetzungen der lit. a – im Ausmaß von insgesamt 3 000 Euro im Kalenderjahr 2024 beim Arbeit-
nehmer steuerfrei
bleiben. Werden im Kalenderjahr 2024 sowohl eine Mitarbeiterprämie
ausbezahlt als auch eine Gewinnbeteiligung (§ 3 Abs. 1 Z 35) gewährt, kann
insgesamt nur ein Betrag von 3 000 Euro steuerfrei bleiben, andernfalls
kommt der Pflichtveranlagungstatbestand des § 41 Abs. 1
zum Tragen (lit. b).
- Klargestellt wird abschließend, dass nicht unter lit. a fallende Zulagen und Bonuszahlungen nach dem Tarif zu versteuern sind (lit. c).
Zu Art. 5 (Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes):
Zu Art. 5 Z 1 (§§ 18a ASVG):
Nach § 18a Abs. 2 Z 3 ASVG ist derzeit die Selbstversicherung in der Pensionsversicherung für die Pflege eines behinderten Kindes für Zeiten einer Teilpflichtversicherung nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. a bis c oder g ASVG ausgeschlossen. Diese Teilpflichtversicherungen in der Pensionsversicherung betreffen Zeiten des Bezuges von Wochen- und Krankengeld, von Arbeitslosengeld und anderen Leistungen aufgrund arbeitsrechtlicher Materien sowie Kindererziehungszeiten. Ebenso ist die genannte Selbstversicherung für entsprechende Ersatzzeiten aufgrund dieser Leistungsbezüge und infolge Kindererziehung ausgeschlossen (diese Ersatzzeiten gelten nur mehr für Personen, die vor 1955 geboren sind).
In der korrespondierenden
Regelung für die Pflege naher Angehöriger nach § 18b ASVG ist keine derartige Einschränkung der
Selbstversicherung bei der Pflege
naher Angehöriger vorgesehen, d. h. diese Selbstversicherung bleibt
auch bei Bezug einer der genannten Leistungen bzw. bei Teilpflichtversicherung
aufgrund Kindererziehung bestehen und erhöht damit die Gutschrift im
Pensionskonto.
Aus Gründen des Gleichklangs der beiden Regelungen soll daher auch in § 18a ASVG die Ausnahme von der Selbstversicherung bei den erwähnten Leistungsbezügen bzw. bei Teilpflichtversicherung aufgrund Kindererziehung aufgehoben werden.
Zu Art. 5 Z 1a, 3, 4 und 10 (§§ 30a Abs. 1 Z
39, 350 Abs. 1 Z 2 lit. c und Z 4
sowie 792 Abs. 2 ASVG):
Um dem in der Sozialversicherung geltenden Ökonomiegebot Rechnung zu tragen und den aus der Abgabe von parallel importierten Heilmitteln resultierenden finanziellen Nachteilen für die Krankenversicherungsträger zu begegnen, wird eine gesetzliche Grundlage für die Erlassung von Richtlinien über die Abgabe solcher Heilmittel durch den Dachverband der Sozialversicherungsträger geschaffen. Da die Auswirkungen der Richtlinien evaluiert werden sollen, werden die Bestimmungen vorläufig auf zwei Jahre befristet.
Zu Art. 5 Z 1b (§ 49 Abs. 3 Z 30 ASVG):
Die steuerfreie
Mitarbeiterprämie nach § 124b Z 447 EStG 1988 soll auch von der
Beitragspflicht nach dem ASVG befreit werden und gilt daher nicht als Entgelt
nach § 49 ASVG.
Zu Art. 5 Z 2 (§ 54b Abs. 2 ASVG):
Es soll verhindert werden,
dass die Beitragsvorschreibung bei Vorliegen mehrerer die Pflichtversicherung
begründender Erwerbstätigkeiten unverhältnismäßigen
Verwaltungsaufwand verursacht. Den Versicherungsträgern soll daher die
Möglichkeit eingeräumt werden eine stichprobenartige Kontrolle
vorzusehen, wenn
dies aus verwaltungsökonomischen Gründen geboten ist.
Zu Art. 5 Z 5 und 6 (§ 351c Abs. 15 und 17 und 792 Abs. 4 ASVG):
Wie in den Jahren 2017,
2019, 2021 und 2023 soll auch im Jahr 2025 ein Preisband für
wirkstoffgleiche Arzneispezialitäten festgelegt werden, um nach
wie vor bestehende Preisunterschiede zwischen wirkstoffgleichen
Arzneispezialitäten zu reduzieren.
Zu Art. 5 Z 7 (§ 443 Abs. 1 ASVG):
Im Sinne der Verwaltungsvereinfachung soll die Verpflichtung der Österreichischen Gesundheitskasse entfallen, Jahresvoranschlag und rollierende Gebarungsvorschaurechnung auch je Bundesland zu erstellen.
Zu Art. 5 Z 8 (§ 705 Abs. 3 ASVG):
Die mit Bundesgesetz BGBl. I Nr. 49/2017 eingeführte und bis 31. Dezember 2023 in Kraft stehende Regelung zur Preisbildung von Generika und Biosimilars (Nachfolgeprodukte von Biopharmazeutika) soll um 2 Jahre bis zum Ablauf des 31. Dezember 2025 verlängert werden.
Zu Art. 5 Z 9 und 10 (§§ 791 Abs. 1 und 792 ASVG):
Die Schlussbestimmungen werden redaktionell richtiggestellt.
Zu Artikel 6 (Änderung des Kommunalsteuergesetzes 1993):
Die Mitarbeiterprämie soll – neben der Befreiung von der Einkommensteuer – auch von der Kommunalsteuer befreit werden.
Zu Artikel 7 (Änderung des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967):
Die von der Einkommensteuer befreite Mitarbeiterprämie soll nicht zur Beitragsgrundlage zur Berechnung des Dienstgeberbeitrages gehören.
*****
Präsidentin Doris Bures: Herr Abgeordneter Kopf hat diesen Abänderungsantrag natürlich ordnungsgemäß eingebracht, er steht daher mit in Verhandlung. (Abg. Kopf – erheitert –: Danke für „natürlich“!)
Der nächste Redner ist Herr Abgeordneter Gerald Loacker. – Bitte.
Abgeordneter Mag. Gerald Loacker (NEOS): Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Was da an Regelungen für die Mitarbeiterbeteiligung an Unternehmen vorgelegt wird, ist gut. Es ist besser als das, was wir bisher hatten, denn bisher war es de facto nichts. Es könnte aber schon viel besser sein, denn die Deutschen lösen gerade eine Regelung ab, die
jetzt schon
weiter ist als die unsrige, und gehen noch weiter. Das ist halt
zu wenig ambitioniert, und da haben auch zu viele mitgefuhrwerkt.
Gesellschaftsrechtlich –
darauf wird meine Kollegin Henrike Brandstötter morgen noch im Detail eingehen –
hat die Notariatskammer ihre
Pflöcke eingeschlagen, damit alles für die neue Flexco möglichst
kompliziert wird.
Was die Arbeitnehmer angeht,
hat die Arbeiterkammer möglichst viel hineingewürgt, damit es
möglichst kompliziert wird, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am
Unternehmen zu beteiligen – anders als Kollegin Yildirim, die Angst
hat: Um Gottes Willen, was passiert denn da? Wichtig ist, dass
man die Mitarbeiter gut behandelt, aber nicht, dass man sie am Unternehmen
beteiligt.
Entschuldigung, denken Sie doch
einmal nach: Kein Unternehmer
behandelt seine Mitarbeiter schlecht und gibt ihnen dann eine Unternehmensbeteiligung.
Ich meine, in welcher Welt bitte? (Beifall bei den NEOS.)
In Wirklichkeit sprechen wir hier von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, um die es auf dem Arbeitsmarkt ein richtiges Griss gibt. Es geht
dabei um die Leistungsträger in den Unternehmen. Die Chefs
möchten, oft auch weil vielleicht die Liquidität in der
Wachstumsphase des Unternehmens nicht reicht, diese Arbeitskräfte am
Unternehmen beteiligen. Das sind attraktive Chancen. Da geht es nicht darum,
dass man einen Verlust macht, sondern es geht eben darum,
dass man sich unternehmerisch an den Chancen, die der Eigentümer
wahrnimmt, beteiligt. Eigentlich ist es ja immer Ihre Fraktion, die behauptet,
die Unternehmer würden so unverschämt hohe Gewinne machen.
Sie müssten ein Interesse daran haben, dass möglichst viele
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an diesem unverschämt
hohen Erfolg beteiligt sind und auch etwas davon haben. (Beifall bei den
NEOS sowie des Abg. Taschner. – Zwischenruf der
Abg. Yildirim.)
Weil das alles noch viel
großzügiger sein könnte, als es hier vorgesehen ist, bringe ich
einen Abänderungsantrag ein, der relativ umfangreich ist und
daher auch einer Verteilung zugeführt wird.
Uns geht es um mehrere Kritikpunkte: Der eine ist, dass die Besteuerung dieser Unternehmensanteile sehr kompliziert gefasst ist. Das hätte man auch einfacher machen können, indem man einfach Kapitalertragsteuer sagt, weil es ja um Kapitalanteile geht; 27,5 Prozent, und dann ist es einfach und klar.
Die Voraussetzungen dafür,
wie lange die Arbeitnehmerin, der Arbeitnehmer in dem Unternehmen gewesen sein
muss und wie lange er, sie die Anteile halten muss, hätte man
noch ein bisschen kürzer fassen können. Wenn
man das kürzer fasst, dann wäre auch ein Anliegen von Frau Yildirim
ausgeräumt, nämlich dass jemand möglicherweise um seine
Beteiligung umfallen könnte.
Die Mitarbeiterzahlen, für die das maximal möglich ist, sind niedrig gesetzt, das Unternehmen darf nämlich maximal 100 Mitarbeiter haben und maximal 40 Millionen Euro Umsatz machen. Wir können uns das viel sportlicher vorstellen: die Mitarbeiterzahl höher ansetzen und auch die Umsatzgrenze höher ansetzen, damit mehr Erwerbstätige in den Genuss kommen, solche Unternehmensbeteiligungen zu bekommen, und damit auch mehr Unternehmen die Möglichkeit eröffnet wird, das zu nützen.
*****
Diese Punkte umfasst unser Abänderungsantrag.
Wie gesagt, das geht in die richtige Richtung, aber es wäre auch ein bisschen sportlicher gegangen. (Beifall bei den NEOS.)
12.44
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Abänderungsantrag
der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen
zum TOP 5 Bericht des Finanzausschusses über die
Regierungsvorlage (2321 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das
Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988, das
Umgründungssteuergesetz, die Bundesabgabenordnung, das Allgemeine
Sozialversicherungsgesetz, das Kommunalsteuergesetz 1993 und
das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert werden
(Start-Up-Förderungsgesetz)
Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen:
Der dem eingangs bezeichneten Ausschussbericht angeschlossene Gesetzesentwurf wird wie folgt geändert:
I. Artikel 1 Z4 lautet: "Nach § 67 wird folgender § 67a samt Überschrift eingefügt:
„Start‑Up-Mitarbeiterbeteiligung
§ 67a. (1) Bei Start-Up-Mitarbeiterbeteiligungen (Abs. 2) gilt der geldwerte Vorteil (§ 15 Abs. 2 Z 1) aus der unentgeltlichen Abgabe von Kapitalanteilen (Beteiligungen) nicht im Zeitpunkt der Abgabe der Anteile, sondern erst bei Veräußerung oder dem Eintritt sonstiger Umstände (Abs. 3) als zugeflossen.
(2) Eine Start‑Up-Mitarbeiterbeteiligung liegt unter folgenden Voraussetzungen vor:
1. Der Arbeitgeber oder ein Gesellschafter des Arbeitgebers gewährt einem oder mehreren Arbeitnehmern aus sachlichen, betriebsbezogenen Gründen unentgeltlich Anteile am Unternehmen des Arbeitgebers, wobei die Abgabe gegen eine Gegenleistung bis zur Höhe des Nennwerts für die Anwendung dieser Bestimmung als unentgeltliche Abgabe gilt.
2. Das
Unternehmen des Arbeitgebers erfüllt bezogen auf das dem Zeitpunkt
der Abgabe der Anteile vorangegangene Wirtschaftsjahr folgende Voraussetzungen:
a) Im Jahresdurchschnitt werden nicht mehr als 500 Arbeitnehmer beschäftigt.
b) Die
Umsatzerlöse (§ 189a Z 5 UGB) betragen nicht mehr als
100 Millionen Euro.
c) Das Unternehmen ist nicht vollständig in einen Konzernabschluss einzubeziehen.
d) Die Anteile am
Kapital oder den Stimmrechten am Unternehmen werden
nicht zu mehr als 25% durch Unternehmen gehalten, die in einen Konzernabschluss
einzubeziehen sind.
Der Wert gemäß lit. b ist bei Vorliegen eines nicht zwölf Kalendermonate umfassenden Wirtschaftsjahres zu aliquotieren.
3. Der Arbeitnehmer hält im Zeitpunkt der Abgabe der Anteile weder unmittelbar noch mittelbar eine Beteiligung am Unternehmen des Arbeitgebers von 10% oder mehr am Kapital und hat auch davor zu keinem Zeitpunkt 10% oder mehr gehalten. Übersteigt durch die Abgabe der Anteile die Beteiligung am Unternehmen des Arbeitgebers 10% des Kapitals, liegt eine Start‑Up-Mitarbeiterbeteiligung insoweit vor, als die Anteile diese Grenze nicht übersteigen.
4. Der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber vereinbaren schriftlich, dass eine Veräußerung oder Übertragung durch den Arbeitnehmer unter Lebenden nur mit Zustimmung des Arbeitgebers möglich ist (Vinkulierung).
5. Der Arbeitnehmer
erklärt dem Arbeitgeber bei Erhalt der Anteile schriftlich, die Regelung
in Anspruch zu nehmen (Option zur Start‑Up-Mitarbeiterbeteiligung) und
diese Erklärung sowie die Höhe der Beteiligung werden
in das Lohnkonto aufgenommen; in diesem Fall sind die Befreiungen
gemäß § 3
Abs. 1 Z 15 lit. b und c nicht anwendbar und für Zwecke des § 20 Abs.
1 Z 7 ist das Entgelt mit den Anschaffungskosten des Arbeitgebers für die
Kapitalanteile zu bemessen.
(3) Der geldwerte Vorteil (§ 15 Abs. 2 Z 1) aus der unentgeltlichen Abgabe gilt als zugeflossen:
1. soweit der Arbeitnehmer die Anteile veräußert, wobei die Rückübertragung der Anteile an den Arbeitgeber insbesondere in Zusammenhang mit der Beendigung des Dienstverhältnisses als Veräußerung gilt;
2. bei Beendigung des
Dienstverhältnisses; dies gilt nicht für Anteile, die kein Stimmrecht
und kein generelles Recht auf Anfechtung oder Nichtigerklärung von
Gesellschafterbeschlüssen vorsehen und deren Inhaber entweder individuell
im Firmenbuch eingetragen oder in einem Anteilsbuch oder vergleichbaren Verzeichnis
erfasst werden (insbesondere Unternehmenswert-Anteile gemäß § 9
des Flexible Kapitalgesellschafts-Gesetzes – FlexKapGG,
BGBl. I Nr. xx/2023), wenn der Arbeitgeber bei Beendigung des Dienstverhältnisses
am Lohnzettel des Arbeitnehmers erklärt, dass der Zufluss
erst nach Maßgabe der Z 1 und 3 bis 5 erfolgen soll. Der Arbeitgeber hat
in
den Fällen der Z 1 und 3 den späteren Zufluss nach Beendigung des
Dienstverhältnisses dem Finanzamt Österreich mitzuteilen und haftet
dabei für die Entrichtung der Einkommensteuer;
3. soweit die
Vinkulierung (Abs. 2 Z 5) aufgehoben wird und im Kalenderjahr
der Aufhebung keine Veräußerung (Z 1) oder Beendigung des
Dienstverhältnisses (Z 2) stattfindet;
4. im Falle der Liquidation des Arbeitgebers oder des Todes des Arbeitnehmers;
5. wenn der
Arbeitgeber die Pflichten gemäß § 76 bis § 79, § 84
und § 87
nicht mehr wahrnimmt.
(4) Für die Besteuerung der Einkünfte gilt Folgendes:
1. Der geldwerte Vorteil aus der unentgeltlichen Abgabe bemisst sich
– im Falle der Veräußerung nach dem Veräußerungserlös, wobei Anpassungen des Veräußerungserlöses in Folgejahren als rückwirkendes Ereignis gemäß § 295a BAO gelten;
– in allen anderen Fällen nach dem gemeinen Wert in dem nach Abs. 3 maßgeblichen Zeitpunkt; der gemeine Wert gilt in weiterer Folge als Anschaffungskosten
und ist um Zahlungen gemäß Abs. 2 Z 1 zu vermindern.
2. Der geldwerte Vorteil ist als Einkunft aus Kapitalvermögen im Sinne des § 27 a Abs. 1 Z 2 mit einem festen Satz von 27,5% zu erfassen, wenn das Dienstverhältnis zumindest ein Jahr gedauert hat. Im Fall des Todes des Arbeitnehmers sind diese Fristen nicht maßgeblich. Soweit der feste Satz auf den geldwerten Vorteil nicht anzuwenden ist, hat die steuerliche Erfassung nach § 67 Abs. 10 zu erfolgen.
3. Gewinnausschüttungen während der in Z 2 genannten Frist von drei Jahren gelten als Bezüge im Sinne des § 67 Abs. 10, soweit sie den Anspruch übersteigen, der sich aus dem quotenmäßigen Anteil am Kapital ergeben würde.
4. Die
Abgabe von Anteilen durch den Gesellschafter des Arbeitgebers stellt beim
Arbeitnehmer unmittelbar einen Vorteil aus dem Dienstverhältnis von
dritter Seite dar und die Anteile gelten nicht als in das Unternehmen des
Arbeitgebers eingelegt und von diesem abgegeben. Beim abgebenden Gesellschafter erhöhen
die Anschaffungskosten (Buchwerte) der abgegebenen Anteile die
Anschaffungskosten (Buchwerte) der bestehenden Anteile; empfangene Zahlungen
gemäß Abs. 2 Z 1 senken die Anschaffungskosten (Buchwerte) der
bestehenden Anteile.
(5) Die auf die Start‑Up-Mitarbeiterbeteiligung entfallenden
Sozialversicherungsbeiträge (§ 50a ASVG) sind beim Steuerabzug
vom Arbeitslohn vor Anwendung
des Lohnsteuertarifs (§ 66) vom Arbeitslohn abzuziehen. § 67 Abs. 12
ist nicht anzuwenden.“
Begründung
Ad I.
Mitarbeiterbeteiligung hat
sich international als probates Mittel erwiesen, um die besten Köpfe zu
gewinnen, zu halten und zu Bestleistungen zu motivieren.
Flexible und modernere Gesellschaftsstrukturen sind ein wichtiges Instrument,
insbesondere für neue Unternehmen wie für internationale
Investoren. Einer der
größten Vorteile der Übertragung von Geschäftsanteilen an
Mitarbeiter:innen ist eine engere Bindung von Talenten ans Unternehmen.
Mitarbeiter:innen die einen
Anteil am Unternehmen besitzen, identifizieren sich oft stärker mit dem
Unternehmen und sind daher eher geneigt, längerfristig zu bleiben.
Die Möglichkeiten
der Mitarbeiterbeteiligung in Österreich entsprechen aktuell jedoch nicht
international gängigen Modellen. Ganz im Gegenteil: Die bestehenden
Möglichkeiten
sind schwer verständlich und eine teure Ausarbeitung durch große
Anwaltskanzleien ist für solche Konstruktionen nötig. Dazu kommt die
sogenannte "dry income"-Problematik: Die Steuerpflicht wird im
Erwerbszeitpunkt der Beteiligung begründet, sodass Arbeitnehmer eine
erhebliche Steuerbelastung treffen kann, ohne dass
ihm liquide Mittel zufließen.
Die eingelangten
Stellungnahmen zur neuen Form der Mitarbeiterbeteiligung zeigen, dass der
für Startups zuständige Wirtschaftsminister Kocher, der Rat für
Forschung und Technologieentwicklung sowie zahlreiche Vertreter von
Unternehmer:innen bzw. Investor:innen noch einiges an Verbesserungsbedarf
sehen. Kritisiert
wird, dass der getroffene Kompromiss unnötig komplex sei und nicht
internationalen Standards entspricht.
Hauptkritikpunkte im Überblick
1. Besteuerung: Der Mischsteuersatz ist unnötig kompliziert und entspricht nicht internationalen Standards. Es wäre sachgerechter, einheitlich den Steuersatz der KESt von 27,5 % anzuwenden.
2. Voraussetzungen für Arbeitnehmer (Steuervorteil nur, wenn die Dauer des Dienstverhältnisses mindestens 2 Jahre ist und Anteile 3 Jahre gehalten wurden): International üblicher wären kürzere Fristen, damit Branchen mit schnellerem Time-to-Exit sowie später eintretende Mitarbeiter nicht benachteiligt werden.
3. Voraussetzungen des
Unternehmens (max. 10 Jahre alt, 100 Arbeitnehmer und 40 Mio. EUR Umsatz): Es
wird völlig ignoriert, dass in manchen Branchen
die Entwicklung länger dauert (z. B. Life Science). Die Schwellenwerte
sind viel zu niedrig, da z.B. auch Scale-ups eine attraktive
Mitarbeiterbeteiligung brauchen. In der eigenen Problemanalyse
(WFA) steht, dass "bestehende Steuerbefreiungen für
Mitarbeiterbeteiligungen den Herausforderungen von Start-Ups und von kleinen
und mittleren Unternehmen (KMU) nicht hinreichend Rechnung tragen
können" und dennoch wurden die Schwellenwerte unterhalb der
gängigen Definition für KMU von 249 Mitarbeiter angesetzt.
Das vorliegende Gesetz
entspricht weder den Erwartungen des Wirtschaftsministers Kocher,
noch denen von Wirtschaftsexperten sowie Branchenvertreter:innen und ist in der
Ausgestaltung im internationalen Vergleich auch wenig attraktiv.
Die vorgeschlagenen Änderungen sind an die Stellungnahmen aus dem Begutachtungsverfahren
angelehnt und dienen der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts
Österreich.
Quellen
• Start-Up-Förderungsgesetz: https://www.parlament.gv.at/dokument/XXVII/ME/275/fnameorig_1566816.html
• Stellungnahme
BM Kocher: https://www.parlament.gv.at/dokument/XXVII/SNME/251009/
imfname_1575370.pdf
• Stellungnahme Rat für Forschung und Technologieentwicklung: https://www.parlament.gv.at/PtWeb/api/s3serv/file/f4d9cb95-83fa-49b3-a51d-6820afa65dd2
• Stellungnahme
Austrian StartUps: https://www.parlament.gv.at/PtWeb/api/s3serv/file/7e024606-
c167-4ca2-bb35-9ac64801850e
• Stellungnahme Invest Austria https://www.parlament.gv.at/PtWeb/api/s3serv/file/cff364e0-5338-42fc-a900-d7e90d866390
• Stellungnahme
Speedinvest: https://www.parlament.gv.at/PtWeb/api/s3serv/file/6ba749f8-
1a80-4d88-ae71-76d53b7282ee
• DE Zukunftsfinanzierungsgesetz: https://dip.bundestag.de/drucksache/gesetz-zur-finanzierung-von-zukunftssichernden-investitionen-zukunftsfinanzierungsgesetz-zufing/271145?term=Gesetz%20zur%20Finanzierung%20von%20zukunftssichernden%20Investitionen%20(Zukunftsfinanzierungsgesetz%20-%20ZuFinG)&rows=25&pos=3
*****
Präsidentin Doris Bures: Auch dieser Abänderungsantrag wurde in seinen Grundzügen erläutert, wird verteilt und steht daher mit in Verhandlung.
Nächster Redner: Herr Abgeordneter Gerhard Kaniak. – Bitte.
Abgeordneter Mag. Gerhard Kaniak (FPÖ): Frau Präsident! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher! Dem Start-Up-Förderungsgesetz wird meine Fraktion zustimmen. Auch wenn es vielleicht das eine oder andere Verbesserungspotenzial gäbe, halten wir es für einen Schritt in die richtige Richtung.
Worauf ich aber in meinem Redebeitrag vielmehr eingehen
muss, ist der soeben eingebrachte Abänderungsantrag der Kollegen Kopf und
Schwarz, weil er
ein klassisches Beispiel dafür ist, wie diese Bundesregierung arbeitet.
Hier wird tagesaktuell ein fünfseitiger Abänderungsantrag
eingebracht, der nicht nur
die hier zur Debatte stehenden Materien behandelt, sondern in den eine Novelle
im ASVG einfach mit hineingeschmuggelt wird – wie mit einem
trojanischen Pferd – und der ohne Debatte einfach durchgewunken
werden soll. Offensichtlich hat keiner von denen, die sich bisher zu Wort
gemeldet haben – wahrscheinlich auch nicht Herr Bundesminister
Brunner –, irgendeine Ahnung, was da beschlossen werden soll. (Abg.
Reiter: Hauptsache, wir wissen das! – Zwischenruf des
Abg. Schmuckenschlager.)
Ich werde Ihnen erklären, was hier beschlossen wird. Es
wird nämlich eine Richtlinie in § 30a Abs. 1 ASVG beschlossen,
mit der die Kostenerstattung für
parallel nach Österreich importierte Arzneimittel geregelt werden soll. Im
Endeffekt geht es darum, dass Parallelimporte nach Österreich weiter
verhindert werden sollen beziehungsweise der Kostenersatz dafür
eingeschränkt werden soll.
Was bedeutet das? – Wir sprechen davon, dass es
um Originalpräparate,
meist patentgeschützte, der Hersteller geht, die über andere
Vertriebswege als die offiziellen Primärvertriebswege der Hersteller nach
Österreich kommen und zugelassen werden, das heißt,
Versorgungswege, die eine Versorgung der österreichischen Patienten
absichern, die in vielen Fällen eine schnellere und verlässlichere
Verfügbarkeit der Präparate für die Patienten bedeuten. Aus rein
ökonomischen Gründen – vonseiten der Sozialversicherung
offensichtlich lobbyiert – wird eine Gesetzesnovelle durchgebracht,
und es sollen Einschränkungen in vollkommener Intransparenz stattfinden.
Man muss dazu auch wissen, dass es sich dabei um Verträge zwischen der Sozialversicherung und den Pharmaherstellern handelt, die völlig intransparent sind, die wettbewerbseinschränkend sind und die in weiterer Folge die Versorgungssicherheit der österreichischen Patienten gefährden. Aus ökonomischen Gründen wird ein Gefälligkeitsdienst für die Sozialversicherung geleistet. Das sollen die Abgeordneten hier beschließen.
Dem werden wir definitiv nicht zustimmen. Ich stelle das
Verlangen auf getrennte Abstimmung über Art. 5 Z 1a, 3 und 4 und
habe dieses Verlangen auch schriftlich eingebracht. (Heiterkeit bei
Abgeordneten von ÖVP, Grünen und NEOS. –
Abg. Kaniak: – auf dem Weg zu seinem Sitzplatz –:
Ich bin auch sprachlos über das Verhalten! – Beifall der
Abgeordneten Ragger
und Reifenberger.)
12.47
Präsidentin Doris Bures: Nächste Wortmeldung: Frau Abgeordnete Verena Nussbaum. – Bitte.
Abgeordnete Mag. Verena Nussbaum (SPÖ): Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Hohes Haus! Werte Zuseherinnen und Zuseher! Auch ich werde auf den Abänderungsantrag, den Kollege Kopf eingebracht hat, eingehen.
Nur ganz kurz zu den
Mitarbeiterprämien: Ja, es ist gut und schön und wird natürlich
begrüßt, wenn Arbeitgeber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
eine Prämie auszahlen wollen, aber zu Ihrer Anmerkung, Kollege Kopf, es
könnte auch bei Kollektivvertragsverhandlungen zu Einmalzahlungen kommen,
möchte ich schon sehr definitiv sagen: Zum Glück konnten bisher
Einmalzahlungen bei Kollektivvertragsverhandlungen erfolgreich abgewendet
werden, denn dort haben sie definitiv nichts zu suchen. (Beifall bei der
SPÖ.)
Wir haben gestern im Plenum zu den Berichten des
Gesundheitsausschusses einige Gesetze zur Sicherstellung der
Medikamentenversorgung in Österreich beschlossen. Im Zuge dieser
Debatte wurde von einem Redner – ich glaube, es war Kollege
Loacker – das Auslaufen der Regelung zum Preisband
mit 31.12. dieses Jahres erwähnt. Offensichtlich ist dadurch die Regierung
aufgewacht und draufgekommen, dass sie noch handeln sollte, um ein
völliges Chaos bei der Finanzierung von Medikamenten und bei der
Medikamentenversorgung in Österreich zu vermeiden.
Siehe da, heute wurde ein
Abänderungsantrag eingebracht, demzufolge
die Preisbandregelung auf zwei Jahre verlängert werden soll. Da frage ich
mich schon: Hat die Regierung ein Jahr lang geschlafen und gar nichts gemacht? (Beifall
bei der SPÖ.) 1 Minute vor 12! 1 Minute vor 12 kommt man
drauf, dass man jetzt noch handeln muss? Also das ist wirklich ein Skandal. (Neuerlicher Beifall
bei der SPÖ.)
Wo bitte bleibt denn die Pharma-Standortgarantie, wo bleibt denn ein Plan zur Arzneimittelversorgung? Wir als Sozialdemokratie fordern: Wer in Europa verkaufen will, muss auch in Europa produzieren!
Das ist aber noch nicht alles
an Änderungen, und das muss man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen:
Heute – nämlich schon heute! – reparieren wir ein
Gesetz, das wir gestern beschlossen haben. Der Bund übernimmt in Zukunft
die Pensionsversicherungsbeiträge von Pensionisten und Pensionistinnen,
wenn sie bis zu 1 000 Euro dazuverdienen. Dass es sich dabei aber
auch um mehrere Beschäftigungsverhältnisse handeln könnte, wurde
einfach
vergessen – einfach Pfusch. (Beifall bei der SPÖ.)
Es gibt noch eine weitere
Regelung – diese wurde erst vor circa einem halben Jahr
beschlossen –, die jetzt mit dem Abänderungsantrag repariert
werden
soll. Wir haben schon immer auf diesen Missstand hingewiesen, jetzt
wird er einfach geändert beziehungsweise beseitigt. In Zukunft wird es
nämlich auch möglich sein, bei der
Pflege eines behinderten Kindes bei der Sozialversicherung eine
Selbstversicherung abzuschließen.
In diesem Fall muss ich sagen: Lieber Herr Bundesminister als Vertreter der Regierung, es sollte Ihnen in der Zwischenzeit wirklich peinlich sein, so schlecht zu arbeiten, dass man ständig etwas reparieren muss! Das sind einfach nur Husch-pfusch-Aktionen in letzter Sekunde – Sie können es einfach nicht. (Beifall bei der SPÖ. – Abg. Eßl: Da waren die Zeiten der SPÖ-Regierung ...!)
12.51
Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Elisabeth Götze. – Bitte.
Abgeordnete Dr. Elisabeth Götze (Grüne): Frau Vorsitzende! Noch einmal: Sehr geehrter Herr Minister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Ich spreche zum Start-up-Paket und möchte erklären, warum mir das ein so großes Anliegen ist und in den letzten Jahren auch war und warum ich mich dafür wirklich intensiv eingesetzt habe.
In Österreich haben wir
pro Jahr circa 40 000 Neugründungen – das ist die
Zahl vom letzten Jahr: knapp unter 40 000, und die hat gegenüber der
Zahl
vor 1996 massiv zugenommen, da waren es unter 15 000. Das heißt, wir
haben eine Zunahme der Unternehmensgründungen. Das ist grundsätzlich
etwas Erfreuliches, denn ja, wir brauchen junge Unternehmen mit innovativen
Produkten, innovativen Dienstleistungen, um unsere heutigen Probleme zu
lösen,
und dafür stehen diese Unternehmen.
Gerade für junge
Unternehmen ist es jedoch schwierig, attraktive Mitarbeiter, gescheite
Köpfe zu bekommen, weil diese natürlich auf einem kompetitiven Arbeitsmarkt
hohe Gehälter verlangen, und das können sich viele Unternehmen
nicht leisten. Das heißt, was wir machen, ist: Wir fördern Jungunternehmen,
Unternehmensgründungen, aber das Wachstum ist dann relativ schwierig, wenn
man sich beispielsweise die attraktiven Mitarbeiter:innen
nicht leisten kann, und wir sehen auch im internationalen Vergleich, dass wir
da Aufholbedarf haben.
Es gibt ein paar Modelle, wie
man Mitarbeiter:innen beteiligen kann, um grundsätzlich Anreize zu
schaffen. Das eine ist die Gewinnbeteiligung – das kann
jedes Unternehmen machen, bis zu 3 000 Euro sogar
steuerfrei –, und das andere ist, indem man Anteile
übergibt. Da stellt sich jetzt aber ein Problem,
denn wenn ich als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter Anteile bekomme, muss ich die
nach geltendem Steuerrecht sofort versteuern, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt ja gar kein Geld bekomme – ich habe ja nur einen fiktiven Anteil.
Das wird in der
Start-up-Branche intensiv diskutiert, das ist die sogenannte Dry-Income-Problematik,
und dafür schaffen wir jetzt eine Lösung. (Beifall bei
den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
Wir schaffen eine Lösung dahin gehend, dass wir für eine neue Rechtsform – diese werden wir morgen diskutieren und hoffentlich beschließen – sogenannte Unternehmenswertanteile schaffen, und die können unter bestimmten Umständen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden, nämlich für Unternehmen, die nicht allzu groß sind – wir wollen damit also nicht Riesenkonzerne fördern –, und auch nur – das ist vielleicht die Antwort auf Kollegen Loacker; ausweiten kann man es später noch immer, aber zunächst geht es einmal wirklich um die Jungunternehmen – während eines bestimmten Zeitraums ab Unternehmensgründung (Abg. Loacker: Ob du dann noch da bist, wenn wir das später erweitern sollten?!), nämlich zehn Jahre. Zehn Jahre ab Unternehmensgründung können diese Unternehmenswertanteile ausgegeben werden.
Das Ziel ist folgendes: Diese
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen,
wenn sie das wollen, Anteile, sind damit auch – das finde ich sehr
interessant – am Bilanzgewinn beteiligt, und die
Unternehmenswertanteile selbst werden erst zu dem Zeitpunkt
besteuert, wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sie
verkauft – ich denke, das ist legitim, denn dann hat man ja Geld
dafür erhalten und dann muss man es versteuern – oder auch wenn
er beziehungsweise sie das Unternehmen verlässt und damit diese
Bindung an
das Unternehmen aufgibt. Zu diesem Zeitpunkt findet also im Normalfall die
Besteuerung statt.
Vielleicht noch zu einem Punkt,
der mir sehr wichtig ist, weil er auch gekommen ist: fair bezahlen. Auch ich
bin absolut für faire Bezahlung, und natürlich
bleiben alle kollektivvertraglichen Rechte unbenommen. Der Mitarbeiter, die
Mitarbeiterin muss also selbstverständlich als Minimum kollektivvertraglich bezahlt werden – oder auch darüber hinaus –, und das ist wirklich ein Add-on.
Das ist etwas, was viele – gerade
junge – Mitarbeiter:innen auch suchen: sich am Unternehmen zu
beteiligen und damit auch am Erfolg beteiligt zu sein. Dort,
wo man sich reinhaut, wo man sich einbringt, möchte man auch etwas davon
haben. Ich glaube, damit haben wir nach internationalem Vorbild wirklich
einen wichtigen, riesigen Schritt gemacht in die Richtung, ein
attraktiver Standort für Start-ups zu sein. – Danke. (Beifall
bei Grünen und ÖVP.)
12.56
Präsidentin Doris Bures: Nun hat sich Herr Bundesminister Magnus Brunner zu Wort gemeldet. – Bitte, Herr Minister.
Bundesminister für Finanzen Dr. Magnus
Brunner, LL.M.: Werte Frau
Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Sehr geehrte
Zuseherinnen und Zuseher! Ja, wir haben in der jüngeren Vergangenheit
zahlreiche Maßnahmen gesetzt, um den heimischen Standort auch insgesamt
zu stärken – ich denke an die ökosoziale
Steuerreform, ich denke an die Konjunkturpakete, die wir auf den Weg
gebracht haben (Heiterkeit des Abg. Lercher),
weil es für den österreichischen Wirtschaftsstandort natürlich
auch ganz zentral ist, dass wir international wettbewerbsfähig bleiben. (Präsident
Hofer übernimmt den Vorsitz.)
Ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor in Österreich sind
eigentlich schon längst die heute bereits öfters genannten Start-ups
geworden. Im Vorjahr haben
Start-ups hierzulande Investitionen in der Höhe von rund 1 Milliarde
Euro ausgelöst. Sie sind also auf der einen Seite ein wirklich
wichtiger Wirtschaftsfaktor, und auf der anderen Seite leisten sie
auch einen ganz wesentlichen Beitrag, wenn es um Digitalisierung, um die
digitale Transformation, auch um
die ökologische Transformation unserer Wirtschaft, aber auch der
Gesellschaft insgesamt geht.
Diese Start-up-Szene wächst. Sie wächst auf jeden
Fall, sie könnte aber
natürlich noch stärker wachsen – und genau deswegen haben
wir dieses Paket, das hoffentlich heute auch beschlossen wird, jetzt
präsentiert.
Wir haben uns auch intensiv sozusagen mit der Szene, mit der
Branche auseinandergesetzt – ich war vor ein paar Tagen bei
einem Start-up, um auch
die Auswirkungen ganz konkret auf einzelne Unternehmen zu
besprechen – und haben ein Gesetzespaket erarbeitet, das durchaus
auch die größten Herausforderungen, die es gibt –
also wenn es um den Cashflow geht, wenn es auch um Liquidität
geht –, entsprechend aufgreift.
Am Ende des Tages ist ein Start-up-Paket herausgekommen, das sich aufgrund der unterschiedlichen Zuständigkeiten in zwei Teile aufteilt: Am Freitag diskutieren Sie hier mit der Justizministerin die flexible Kapitalgesellschaft – eine ganz wesentliche gesellschaftsrechtliche Verbesserung, die auch auf die speziellen Bedürfnisse der Start-ups verstärkt eingeht –, und in der heutigen Diskussion geht es um den abgabenrechtlichen Teil des Paketes.
Ein von Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern doch
häufig geäußerter Wunsch war immer, eben Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter verstärkt
ans Unternehmen zu binden, sie auch entsprechend am Unternehmenserfolg
teilhaben zu lassen. Diesbezüglich haben wir eine Lösung erarbeitet,
mit der die Besteuerung der Unternehmensanteile aufgeschoben und durch eine
Pauschalregelung ersetzt wird – es geht also um diese berühmte
Dry-Income-Problematik, die hiermit beendet beziehungsweise verbessert wird.
Mit diesem Paket stärken wir auch den
Wirtschaftsstandort Österreich insgesamt, verbessern auch das Umfeld
für junge Unternehmen und können gleichzeitig – das ist
eigentlich der dritte Punkt – junge Talente besser
in Österreich halten, als das bisher möglich war.
Beim zweiten Gesetzesvorhaben,
beim Mindestbesteuerungsreformgesetz – dem zweiten Gesetzentwurf, den Sie in diesem Zusammenhang heute
hoffentlich beschließen werden –, beschäftigt uns diese
globale Mindestbesteuerung für Unternehmen natürlich schon
länger, schon seit einiger
Zeit. Deshalb ist es eigentlich umso erfreulicher, dass wir jetzt auch endlich
zu einer Einigung gekommen sind und diese neue Regelung nun auch Teil
des österreichischen Steuerrechts wird.
Worum geht es da ganz
konkret? – Es geht eigentlich schon darum, die Steuergerechtigkeit
international auszubauen und auch für faire Wettbewerbsbedingungen
zwischen den Unternehmen zu sorgen. Es ist natürlich eine Frage der
Gerechtigkeit, dass die heute bereits erwähnten Digitalgiganten nicht nur
auf der einen Seite wirtschaftliche Vorteile aus ihren Tätigkeiten in ganz
Europa ziehen, sondern auf der anderen Seite eben auch entsprechende Steuerabgaben
zu leisten haben. Was für heimische Unternehmen gilt, soll natürlich
auch für internationale Multikonzerne gelten. (Beifall bei
der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
Mit der Einführung dieser globalen Mindestbesteuerung sorgen wir für mehr Gerechtigkeit. Dadurch wird ein weltweit gültiges Mindestniveau bei der Besteuerung von Unternehmen geschaffen, und zwar unabhängig davon, wo auf der Welt diese Unternehmen angesiedelt sind.
Es ist mir auch wichtig, Folgendes zu betonen:
Österreich war schon seit
vielen Jahren Vorreiter, wenn es darum gegangen ist, für eine global faire
Besteuerung zu sorgen – ich denke dabei an die
EU-Ratspräsidentschaft im
zweiten Halbjahr 2018, als sich Österreich bereits massiv für
eine Digitalkonzernsteuer auf EU-Ebene eingesetzt hat. Wir haben dann mit
Wirksamkeit ab 2020 in Österreich eigenständig ja auch
eine nationale Digitalkonzernsteuer für Onlinewerbung umgesetzt und
sind dadurch in diesem Bereich
zu einem Vorreiter auf internationaler Ebene geworden. (Beifall bei der
ÖVP sowie der Abgeordneten Rössler und Schwarz.)
Diese österreichischen
Initiativen haben jedenfalls – und das hat man in letzter Zeit auch
schon gemerkt – gerade auf OECD-Ebene eine gewisse Dynamik hineingebracht.
Es wurde ein Gremium eingerichtet, dem mittlerweile 140 Staaten
weltweit angehören und in dem – das möchte ich besonders
hervorheben, Abgeordneter Kopf hat es bereits erwähnt – unsere Sektion
Steuerpolitik und Steuerrecht eine ganz zentrale Rolle eingenommen und diesen
Prozess auch international weiter fortgeführt, unterstützt und
vorangetrieben hat, angeführt von Herrn
Prof. Mayr – dafür auch von meiner Seite herzlichen
Dank an dich und deine Kollegen und Kolleginnen. (Beifall bei der
ÖVP sowie des Abg. Schwarz.)
Österreich hat also in
diesem Gremium die grundlegende Arbeit vorangetrieben. 140 Staaten
weltweit haben ihre Zustimmung zur globalen Steuerreform gegeben. Das ist doch
eigentlich ein Meilenstein in der globalen Steuerpolitik, und diesen
Meilenstein setzen wir heute hoffentlich auf nationaler Ebene
in nationales Recht um.
Es geht also um zwei sehr wichtige – äußerst wichtige – Gesetzesvorhaben: auf der einen Seite um das Start-up-Paket zur Stärkung des Standorts insgesamt und auf der zweiten Seite um mehr steuerliche Fairness und vor allem faire Wettbewerbsfähigkeit für unseren Standort. (Beifall bei der ÖVP sowie der Abgeordneten Rössler und Schwarz.)
13.02
Präsident Ing. Norbert Hofer: Nächster Redner ist Abgeordneter Gabriel Obernosterer. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Gabriel Obernosterer
(ÖVP): Herr Präsident! Herr
Finanzminister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr verehrten Damen und
Herren
auf der Galerie und zu Hause vor den Fernsehgeräten! Ich glaube, eine
Gruppe aus Schladming ist gerade angekommen: Die Mitglieder des Rotary-Clubs
aus Schladming haben gerade Platz genommen und ich darf sie im Auftrag meiner
Kollegin natürlich recht herzlich hier im Hohen Haus begrüßen. (Beifall
bei der ÖVP sowie bei Abgeordneten von SPÖ, Grünen und NEOS.)
Der Herr Finanzminister hat
beide Gesetzespunkte, die wir jetzt beschließen, wirklich noch einmal
tiefgehend erklärt und ich möchte nicht viel davon wiederholen. (Abg.
Reifenberger: ... der Rede, danke!) Ein bisschen stolzer
könnte man aber eigentlich schon sein.
Es ist nämlich wirklich so, dass Österreich – und im
Speziellen Sie, Herr Finanzminister, als Verantwortlicher bei
den Verhandlungen, gemeinsam mit Sektionschef Mayr – bei diesem
Gesetzentwurf, mit dem die globalen
Konzerne weltweit mit mindestens 15 Prozent besteuert
werden, federführend war. Da ist Österreich vorangegangen.
Wer schon länger in diesem
Haus ist, weiß auch, wie lange wir uns schon damit auseinandersetzen. In dieser globalen Welt
versuchen Großkonzerne natürlich, in Billiglohnländern
zu produzieren und ihre Gewinne in Niedrigsteuerländern –
und nicht dort, wo sie verkaufen, in diesem Fall in
Österreich –
zu versteuern.
Ich kann mich an die
Anfänge der Verhandlungen erinnern. Nur ein bisschen Geschichte:
Angefangen zu verhandeln hat man mit 5 Prozent. Wir sagten, wir müssen
schauen, dass wir eine globale Mindestbesteuerung von 5 Prozent
bekommen. Der Abschluss war bei 15 Prozent, und 140 Länder,
die G20, alle haben dabei mitgemacht – da kann ich wirklich nur
gratulieren.
Warum spreche ich als Vorsitzender des Budgetausschusses
jetzt
noch zu diesem Thema? – Wir beschließen hier im Haus nicht
alle Tage einen Gesetzentwurf, der die Österreicher nichts kostet und das
Budget nicht
belastet, mit dem sogar Geld hereinkommt, aber nicht von uns
Österreichern, sondern von Konzernen, die in Österreich eigentlich
etwas verkaufen,
was in Österreich aber nicht richtig versteuert wird, und das wird jetzt
damit geregelt. Als Vorsitzender des Budgetausschusses bin ich froh, dass
wir auch einmal irgendwo ein bisschen Geld hereinbekommen – weil die
Ausgaben sonst
immer nur nach oben gehen –, dass da auch einmal ein bisschen etwas möglich ist.
Wie gesagt, Herr Sektionschef Mayr, Herr Finanzminister, ich
meine,
das hat wieder einmal gezeigt, dass Österreich auch Vorreiter sein kann.
Unsere Budgetpolitik wird im eigenen Land nämlich nicht
sehr gewürdigt. In Deutschland bekommen Sie (in Richtung Bundesminister
Brunner) einen
Preis für Ihre ordentliche Budgetpolitik, in Österreich sieht man
das – zumindest vonseiten der Opposition – nicht so. (Abg.
Scherak: Von der eigenen Partei überreicht!) – In
Deutschland haben wir keine eigene Partei, muss ich auch noch dazusagen. Der
deutsche Finanzminister ist, glaube ich, von der Ideologie
her nicht so weit weg von euch (in Richtung NEOS) und ist ein Fan von
unserem Finanzminister. Sie tauschen sich auch regelmäßig aus. Der
deutsche Finanzminister wäre glücklich, wenn er solche Dinge zustande
brächte, wie sie unser Finanzminister mit unseren Beschlüssen hier
erreicht. (Beifall bei
der ÖVP.)
Das heißt, wir beschließen einen Gesetzentwurf,
mit dem wir Geld hereinbekommen und der die Österreicher nichts
kostet. – Danke vielmals. (Beifall bei
der ÖVP sowie der Abgeordneten Rössler und Schwarz.)
13.06
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt Mag. Dr. Jakob Schwarz. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter
Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA (Grüne):
Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Minister! Hohes Haus! Liebe
Zuseherinnen und Zuseher! Es gibt Probleme, die zwar allgemein von fast allen
als Problem anerkannt werden, die prinzipiell auch technisch
lösbar sind, bei denen es aber trotzdem kaum Aussichten darauf gibt, sie
zu lösen. Ein solches Thema ist der Klimawandel. Ein einzelner
Staat hat kein Interesse oder wenig Interesse daran, seine Emissionen zu
senken, wenn alle anderen Staaten nicht mitmachen. Um
dieses Problem in den Griff zu bekommen, gibt es die internationalen Klimaverhandlungen, die aktuell stattgefunden haben und erfolgreich abgeschlossen wurden – vielen Dank an alle Verhandlerinnen und Verhandler. (Beifall bei Abgeordneten von Grünen und ÖVP.)
Ein anderes solches Problem ist der internationale Steuerwettbewerb.
Wenn ein Staat seine Steuersätze senkt, erreicht er damit typischerweise
mehr Steuereinnahmen und nicht weniger, und deshalb gibt es sozusagen
einen Anreiz, sie zu senken. Die Lösung dieses Problems hat, wie das auch
schon von Vorrednern angesprochen wurde, lange Zeit eigentlich als
Träumerei gegolten. Insofern ist die Tatsache, dass wir heute hier, in
einer der letzten Sitzungen vor Weihnachten, eine globale Mindeststeuer
national umsetzen können, schon in einer gewissen Art und Weise ein
steuerpolitisches Weihnachtswunder.
(Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
Wenn man sich das ein bisschen anschaut, dann sieht man,
dass es insbesondere US-amerikanischen Techkonzernen gelungen ist, über
die Verrechnung
von Lizenzgebühren – in diesem Bereich geht das besonders
einfach – und über viele verschiedene
Tochterunternehmen – das ist mitunter gar nicht so einfach; man
spricht da beispielsweise von der Praxis eines Double Irish
with a Dutch Sandwich, bei der man zwei irische Unternehmen, eines davon mit
Sitz in einer Steueroase, und zusätzlich noch ein Tochterunternehmen in
Holland gebraucht hat – die Steuersätze auf effektiv unter
0,05 Promille zu senken. (Abg. Loacker: Steueroasen ...
sonst überall ...!) Das ist beispielsweise
Apple 2014 gelungen; Apple war damals und ist auch heute noch nach Marktkapitalisierung
das größten Unternehmen der Welt.
Die EU-Kommission ist dann zum
Teil eh schon eingeschritten, aber auch
heute geht in Österreich durch solche Praktiken noch immer ein
Steuervolumen von geschätzt 1,3 Milliarden Euro jährlich
verloren. Da sich größere Konzerne leichter damit tun, so
etwas zu machen und ihre Gewinne zu verschieben, als kleine Unternehmen, gibt
es da natürlich eine gewisse Ungleichbehandlung zwischen
Unternehmen. Letztlich fehlt das Geld aber natürlich im
Staatsbudget – und irgendwie zahlen es dann immer die, die wenig
oder
mittel verdienen, weil der Staat entweder Leistungen kürzen oder andere
Steuern, denen man weniger leicht ausweichen kann, erhöhen muss.
Die Mindeststeuer, die wir
heute hier national umsetzen, ist auch sehr
schlau designt. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich auch sehr herzlich
bei der Steuersektion und bei Prof. Mayr, der da sozusagen bestimmend mitgewirkt hat,
bedanken. Es ist nämlich nicht so, wie man sich das als
Laie typischerweise vorstellen würde. Ich hätte es mir so
vorgestellt: Man macht eine Vereinbarung und zwingt jeden Staat dazu, seine
effektiven Steuersätze einfach auf 15 Prozent zu
erhöhen. – Stattdessen dreht man
dieses Dilemma des Steuerwettbewerbs quasi um und erlaubt den Sitzstaaten der
Mutterkonzerne, Gewinne, die bei den Töchtern in Niedrigsteuerländern beispielsweise
zu niedrig besteuert wurden, im Sitzland
des Mutterkonzerns ergänzend zu besteuern. Das nennt sich
Primär-Ergänzungssteuer.
Damit haben die Niedrigsteuerländer plötzlich
einen Anreiz, von sich aus ihre effektiven Steuersätze anzuheben, das
machen sie über nationale Ergänzungssteuern. Insofern ist in
diesem Fall sozusagen dieses Gefangenendilemma und damit auch das Problem des Steuerwettbewerbs sehr geschickt aufgelöst worden. – Vielen Dank. (Beifall
bei den Grünen und bei Abgeordneten
der ÖVP.)
13.10
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gemeldet ist nun Mag. Dr. Rudolf Taschner. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Mag. Dr. Rudolf Taschner (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Nun komme ich dazu, über dieses Mindestbesteuerungsreformgesetz zu sprechen. Ich möchte nur zwei Fußnoten unterbringen.
Die eine Fußnote betrifft
die Tatsache – Herr Bundesminister, Sie haben davon
gesprochen –, dass dadurch Gerechtigkeit herrscht. – Das
ist der eine
Punkt.
Der andere Punkt, den ich sehe,
ist, dass der Staat gegenüber diesen großen Konzernen wieder zu
seiner Macht zurückfinden kann. Das ist ja sehr
wichtig. Ich bin als alter Anhänger von Hobbes der Meinung, dass es keine
Macht auf Erden geben soll, die über die Macht des Staates geht. Diese
großen Konzerne sind unter Umständen gar nicht dieser Ansicht, die
ich da vertrete, und ich finde, man sollte ihnen schon
erklären, dass die Macht des Staates doch größer ist.
Wenn aber ein Staat selbst
kleiner als dieser Konzern ist, müssen sich
die Staaten zusammenfinden, und es ist gut, dass sich 140 Staaten für
diese Mindestbesteuerung zusammengefunden haben. Ich glaube, dass es auch
ein
gutes Zeichen ist, dass wir sehen, dass staatliches Denken doch über das
Konzerndenken hinausgehen sollte – auch in der Machtfrage.
Der nächste Punkt ist
folgender: Kollege Obernosterer hat gesagt, man hat mit 5 Prozent
begonnen, jetzt ist man bei 15 Prozent. Manche wollen natürlich
25 Prozent haben, aber wenn wir 25 Prozent verhandelt hätten,
hätten wir nicht 140 Staaten gehabt, sondern vielleicht 14 oder nicht
einmal die, also sind
wir doch mit den 15 Prozent ganz glücklich.
Ich möchte sagen: Dass
diese Verhandlungen so gelungen sind, liegt auch – wie schon gesagt
worden ist – an der Fähigkeit der österreichischen
Beamten.
Man darf nicht vergessen, die Beamten sind die Sehnen und die Knochen des
Staates, und das zu sehen und zu würdigen, glaube ich, sollten wir uns
auch in Erinnerung rufen. (Zwischenruf des Abg. Loacker.)
Herr Prof. Mayr, in dieser Hinsicht sind Sie ein paradigmatischer Beamter besten Sinnes, wie es in Österreich schon ewig Tradition hat, also insofern meine höchste Gratulation – und auch dem Herrn Finanzminister, dass Sie diesen Mann
so gut beschäftigen konnten, wirkliche Gratulation dafür. (Beifall
bei
der ÖVP.)
Warum aber nicht 25 Prozent? – Kollege Kopf hat gesagt: Ein Hochsteuerland sind wir. – Ich möchte über Steuern sprechen, und da gibt es ein gewisses Problem. Hans Karl Schneider, ein großer deutscher Ökonom, hat, glaube ich, gesagt: Wenn man mehr als die Hälfte seines Einkommens dem Staat zur Verfügung stellt, dann denkt man mehr darüber nach, wie man Steuern sparen kann, bevor man Geld verdient. – Das wäre natürlich gefährlich.
Man muss sich schon überlegen: 15 Prozent, das ist ganz gut, bei 30 Prozent wird man dann schon ein bisschen nervös. Es ist auch ein gutes Zeichen, dass wir bei den Steuerreformen und auch mit der Abschaffung der kalten Progression dafür gesorgt haben, dass die Steuerlast nicht mehr so groß ist.
15 Prozent bei den
Konzernen – da ist ja im Vergleich zu dem, was wir an Einkommensteuer
zahlen, ein großer Unterschied. Dass wir die Steuerlast
senken, könnte dazu führen, dass wir doch mehr einnehmen, weil dann
die Leute mehr an das Geldverdienen denken, und zum Schluss bekommen wir doch
mehr.
Vielleicht ist das also ein kleiner Hinweis darauf, dass wir in zukünftigen Zeiten, wenn wir dann wieder eine größere Produktivität haben, auch mit einem niedrigeren Steuersatz glücklichere Österreicherinnen und Österreicher schaffen. – Vielen herzlichen Dank. (Beifall bei der ÖVP.)
13.13
Präsident Ing. Norbert Hofer: Nächster Redner ist Herr Dr. Josef Smolle. – Bitte schön, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Dr. Josef Smolle (ÖVP): Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich gehe auf den Abänderungsantrag ein, der die Preisgestaltung bei den Arzneimitteln betrifft.
Wie kommt denn ein Arzneimittel
auf den Markt und wie läuft es dann mit dem Preis? (Abg. Loacker:
Wie kommt das in den Finanzausschuss?) – Zuerst gibt
es einen Originalanbieter, das ist die Firma, die das entwickelt hat, die Geld
in die Forschung investiert hat. Die kommt dann mit einem neuen Medikament auf
den Markt, mit einem meistens vertretbaren, aber doch hohen Preis.
Wenn der Patentschutz ausgelaufen
ist – meistens nach einigen Jahren (Abg. Loacker: ... den Abänderungsantrag schon ...?) –, dann kommen Konkurrenzanbieter mit
Generika oder Biosimilars. Da führen wir eine Regelung weiter, die dann zu
einer Preisreduktion führen muss. Kommt das erste Konkurrenzpräparat,
gehen die Preise deutlich hinunter, ebenso beim zweiten und beim dritten
Konkurrenzpräparat, bis man dann bei einem gewissen Preisniveau angekommen
ist, das weniger als die Hälfte des Ausgangspreises oder sogar nur ein
Drittel des Ausgangspreises ausmacht – eine an und für
sich wirklich sehr vernünftige Regelung.
Wenn man einmal in diesem
Bereich ist und das realisiert hat, dann gilt ein sogenanntes Preisband
von 20 Prozent. Das heißt, alle Anbieter, die sich
bei maximal 20 Prozent über dem Billigstanbieter befinden, bleiben im
Erstattungskodex der Sozialversicherung und werden nicht hinausgeworfen.
Das hat den Vorteil, dass wir uns nicht von einem einzelnen Billigstanbieter
abhängig machen, sondern durchaus mehreren Anbietern, auch aus
Österreich und aus Europa, eine Chance geben, auf dem Markt zu
bleiben. Das dient der Arzneimittelsicherheit.
Diese Abstufungen werden nach
zwei Arzneimittelgruppen differenziert. Da gibt es einmal die eher einfachen
chemischen Wirkstoffe, da nennt man die Konkurrenzpräparate dann Generika,
da wird stark abgestuft, und dann gibt es komplexe Moleküle, sogenannte
Biologika, schwieriger nachzubauen,
und da sind die Abschläge etwas geringer. Dass man so differenziert, ist
sehr vernünftig.
Ich sage nur dazu: Die Biologika sind neue Substanzen aus
den letzten
15 bis 20 Jahren, die einen ungeheuren Durchbruch gebracht haben, und bei
vielen Erkrankungen, bei denen ich jahrzehntelang erlebt habe, dass sie
fast unweigerlich tödlich verlaufen sind, können nun viele gute
Lebensjahre in hoher Qualität, oft auch Heilungen, bewerkstelligt werden.
Man kann jetzt darüber diskutieren: Sind diese
Abschläge zu hoch, sind sie zu niedrig? Macht man nur geringe
Abschläge, könnte man sagen: Nein, zu
gering, wir könnten uns ja mehr Geld ersparen!, macht man aber die
Abschläge zu hoch, dann kann es passieren, dass gar keine
Konkurrenzanbieter
kommen, man am Originalpreis hängenbleibt und für die Allgemeinheit
überhaupt keine Kostenreduktion hat.
Man hat hier jetzt ein ausgewogenes Modell, das wir so
fortführen werden. Das ist wirklich auch im Interesse der
Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln.
Ich bitte um Zustimmung. – Danke schön. (Beifall bei der
ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
13.17
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu einer tatsächlichen Berichtigung hat sich Herr Mag. Gerhard Kaniak zu Wort gemeldet. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter
Mag. Gerhard Kaniak (FPÖ): Herr
Präsident! (Abg. Hanger: Jetzt kommt
der Lobbyist!) Abgeordneter
Smolle hat gerade ausgeführt, dass der
in Verhandlung stehende Abänderungsantrag die Preisbandregelung
betreffe.
Ich berichtige tatsächlich: Es handelt sich um eine
unter § 30a Abs. 1 neu eingeführte Richtlinie
betreffend Parallelimporte – und nicht betreffend
Generika oder Biosimilars. (Beifall bei der FPÖ. –
Zwischenrufe bei der ÖVP.)
13.17
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort ist dazu nun niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
Ist seitens der Berichterstattung ein Schlusswort
gewünscht? – Das ist
nicht der Fall.
Meine Damen und Herren! Da
umfangreiche Abänderungs- beziehungsweise Zusatzanträge sowie
Verlangen auf getrennte Abstimmung vorliegen
und eine kurze Unterbrechung der Sitzung zur Vorbereitung der Abstimmungen
nicht ausreicht, verlege ich die Abstimmung zu den
Tagesordnungspunkten 5 und 6 bis nach der Abstimmung
über die Tagesordnungspunkte 8 und 9.
Die Abstimmungen über die
Punkte 2 bis 4 der Tagesordnung werden
ebenfalls mitverlegt.
Wir fahren in der Erledigung der Tagesordnung fort.
Bericht des Finanzausschusses über die Regierungsvorlage
(2319 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988,
das Körperschaftsteuergesetz 1988, die Bundesabgabenordnung, das
Gebührengesetz 1957, das Privathochschulgesetz, das
Fachhochschulgesetz
und das IST-Austria-Gesetz geändert werden (Gemeinnützigkeitsreformgesetz 2023 –
GemRefG 2023) (2380 d.B.)
Präsident Ing. Norbert Hofer: Wir kommen zum 7. Punkt der Tagesordnung.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Zu Wort gemeldet ist Herr Dr. Christoph Matznetter. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter
Dr. Christoph Matznetter (SPÖ):
Herr Präsident! Herr Finanzminister! Geschätzte Kolleginnen und
Kollegen! Vor allem sehr geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer,
sowohl jene im Saal als auch jene, die sich
die Übertragung anschauen! Vor rund vier Jahren – da haben wir
noch nicht hier getagt, sondern noch im Großen Redoutensaal –,
kurz vor der Bildung der Regierung Kurz/Kogler, habe ich vor allem meine
Freunde von der grünen Fraktion recht harsch kritisiert, dass sie
vorsichtig sein müssen und eher Nein
als Ja sagen müssen.
Viele meiner persönlichen Freundinnen und Freunde, die zum Teil auch Funktionärinnen und Funktionäre der Grünen sind, haben mich damals gefragt: Warum kritisierst du die Grünen so? – Ich habe gesagt: weil sie in dieser Koalition – damals mit Sebastian Kurz – in eine Falle geraten, in der sie am Ende alles an ihrer politischen Seele verkaufen müssen.
Leider habe ich recht behalten, denn die Kolleginnen und
Kollegen der
grünen Fraktion werden bei diesem Tagesordnungspunkt in ein paar Minuten
aufstehen. Sie werden darüber hinwegsehen, dass sie dringend gemahnt
worden sind, dieser Orbanisierung (Abg. Hörl: Hallo,
hallo! – Abg. Hanger: Geh bitte!) in unserem
Gesetzessystem Einhalt zu gebieten. (Abg. Niss: Entschuldigung, das
ist ...!) Ich erinnere an die Kritik, die allein Greenpeace genannt
hat,
gebeten hat, gefleht hat, vor dem Finanzausschuss: Ändert das ab! (Zwischenruf
der Abg. Reiter.)
Aber nein! Es wird jetzt
ein System geschaffen, bei dem Verwaltungsbeamte
unter der Weisungskette des einzelnen Ministers darüber entscheiden, ob
zum Beispiel ziviler Protest noch stattfinden kann oder nicht. (Abg. Taschner:
Hahaha! – Abg. Hanger: Geh bitte! –
Ruf bei der ÖVP: Überleg dir einmal was Gscheites!) Wenn
Greenpeace etwas an einer Hausfassade aufhängt und wiederholt Verwaltungsstrafen
stattfinden, was passiert dann? Das habt ihr euch nicht überlegt im Zusammenhang mit dem Aufstehen hier. Darüber habt
ihr nicht nachgedacht. (Abg. Schwarz: Da hätten wir schon
nachgedacht! – Abg. Weratschnig: Bitte nachlesen, Herr
Kollege!)
Das ist ja noch der geringste Fall, ihr könntet es ja
auch absichtlich gemacht haben. (Abg. Reiter: Lest es!) Spätestens
aber, als die Protestierer von der Südautobahn in Untersuchungshaft
genommen wurden, als dann eine Weisung – rechtswidrig, denn sonst
hätte das Gericht ja nicht sofort die Enthaftung beschlossen (Abg. Reiter:
Sie sind nicht am aktuellen Stand!) –, als vom Ministerium der
Alma Zadić die Weisung kam, das in Rechtskraft erwachsen zu lassen,
hättet ihr schon hellhörig werden müssen. Dass der
Mafiaparagraf, 278 StGB, angewendet werden soll: Da hätten alle
Alarmglocken bei euch läuten
müssen. (Abg. Bürstmayr: 278a, Herr Kollege!) Schon die
Tierschützer wurden jahrelang in Wiener Neustadt in einen ruinösen
Prozess geschickt. Ihr
hättet erkennen müssen, was passiert. (Abg. Tomaselli: Ja,
wer hat ... Paragrafen beschlossen? ... Paragrafen ...
beschlossen!)
Ich weiß schon, die alte Steigerungsform
Feind – Todfeind – Parteifreund gehört eigentlich
durch Feind – Todfeind – Koalitionspartner ersetzt. Aber:
Nein
zu sagen hättet ihr in den vier Jahren lernen können (Abg. Tomaselli:
Ja, ja, ja!); einfach Nein sagen!
Ich weiß, dass es schwierig ist. Ich war von Anfang an
bei den Scheinverhandlungen mit Wolfgang Schüssel 2002 dabei
(Abg. Schwarz: Nein sagen habt ihr gut gelernt, ja! Sonst gar nichts!),
bei allen Regierungsverhandlungen. Man
muss diese Menschen mit ihren Vorhaben stoppen! (Ruf bei den
Grünen: ... eine Vergangenheitsbewältigung, oder was?) Und
ihr habt versagt, weil ihr diesem Gesetz die Zustimmung gebt.
Der Abänderungsantrag ändert gar nichts daran.
Welche Absurdität: Die Behörde, die sagt: Du fällst nicht
mehr rein!, entscheidet selbst über die aufschiebende Wirkung,
weil es voraussichtlich keine Aussicht hat? – Bitte, wo sind wir
denn in einem Rechtsstaat? (Zwischenruf des Abg. Scherak.) Wieso
schafft
ihr nicht ordentliche Verhältnisse? Wieso lasst ihr es zu, dass
Verwaltungsstrafen Grundlage für die Frage der Gemeinnützigkeit sind?
(Abg. Reiter: Lesen Sie einmal ordentlich nach!) Das habt ihr
euch entweder nicht überlegt – das ist die netteste
Form – oder ihr habt es endgültig abgegeben. Das täte mir
doppelt leid, denn dann hätte ich nämlich mit meinen mahnenden
Worten von vor vier Jahren im Großen Redoutensaal noch mehr recht gehabt.
Ich hoffe auf eine Auferstehung der Grünen. (Abg. Wurm:
Haha, ... eure Wähler!) Einfach Nein sagen –
möglicherweise müsst ihr es dann beenden, aber die
GP ist sowieso zu Ende. Zieht die Konsequenz, bleibt heute sitzen! (Beifall
bei der SPÖ. – Abg. Bürstmayr: Das grenzt ja
an ...! Lern einmal ein Gesetz lesen, bitte!)
13.23
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gemeldet ist nun Mag. Andreas Hanger. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Mag. Andreas Hanger
(ÖVP): Herr Präsident! Herr
Bundesfinanzminister! Werte Kolleginnen
und Kollegen! Hohes Haus! Herr Kollege Matznetter, nur eine
ganz kurze Replik: Das, was Sie hier ausgeführt haben, hat mit der
Realität gar nichts zu tun (Ruf bei der ÖVP: Das ist eh normal!),
da wir
dieses Gesetz ja über Wochen intensiv verhandelt haben. (Beifall bei
der ÖVP
und bei Abgeordneten der Grünen.)
Ich will mich aber gar nicht
näher mit Ihnen beschäftigen, sondern ich will
mich mit dem Gesetz an und für sich beschäftigen und möchte es
einleitend einmal in die große Diskussion einordnen, die wir jetzt
über viele Wochen
und Monate geführt haben.
Wir haben in Österreich
die Situation, dass wir drei Millionen ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter haben. Das ist ein Wert, das ist ein Schatz,
der nicht hoch genug einzuschätzen ist, und das sage ich hoffentlich
fraktionsübergreifend.
Wir haben bei uns in
Österreich mit immerhin 250 000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern den Sektor der Gemeinnützigkeit, der in unserer Republik
eine unglaublich wichtige Arbeit macht. Die Intention all dessen, was wir in
den letzten Wochen und Monaten getan haben, war, genau diesen Sektor, genau die
freiwillige, ehrenamtliche Arbeit in Österreich zu stärken.
Wir haben ein
Freiwilligengesetz auf den Weg gebracht, das unter anderem das freiwillige
soziale Jahr stärkt; wir loben einen Staatspreis für Freiwilligkeit
aus; wir haben die Freiwilligeninfrastruktur auf Bundes- und Landesebene gestärkt;
wir haben in der letzten Parlamentssitzung ein Gesetz auf den
Weg gebracht, mit dem wir unsere Rettungsdienstorganisationen massiv stärken –
alle sieben sind übrigens zur Stunde zusammengekommen und
haben dieses Gesetz noch einmal erörtert, auch stark getragen vom ehrenamtlichen
Engagement. Und wir haben – das ist wahrscheinlich das
größte
Paket – ein Gemeinnützigkeitsreformgesetz auf den Weg gebracht.
Die Intention dieses Gesetzes
war und ist, den gemeinnützigen Sektor mit seinen hauptberuflichen und
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
zu stärken. Wie machen wir das? – Indem wir indirekte
Unterstützung geben: Wir weiten die Spendenabzugsfähigkeit aus.
Ich sage es ganz offen: Wir
haben lange verhandelt. Ich kann mich an die Gespräche mit Frau Kollegin
Blimlinger noch sehr gut erinnern. Wir haben auf Basis des Regierungsprogramms
begonnen, dieses Thema zu diskutieren,
weil schon im Regierungsprogramm verankert ist: Wir überlegen, wir
evaluieren eine „Ausweitung der Spendenabsetzbarkeit“. Und ich bin
schon sehr stolz,
dass am Ende des Tages ein großer Wurf herausgekommen ist, nämlich
dass wir die Spendenabsetzbarkeit auf alle gemeinnützigen Träger
ausweiten – auf
alle. – Frau Kollegin Blimlinger, ich stehe nicht an,
und ich möchte es auch tun, zu sagen: Es war immer deine Intention und
deine Idee, es in einer Breite
zu machen, die wirklich Kraft im Sektor hat – und das gelingt jetzt.
Darauf können wir gemeinsam schon sehr stolz sein. (Beifall bei
der ÖVP und bei Abgeordneten von Grünen und NEOS.)
Es sind viele Detailfragen
diskutiert worden, denn man hat eine politische Idee, wir müssen uns aber
natürlich auch die Vollziehung überlegen. Wir haben
sehr gut überlegt, wie wir das System so gestalten, dass es nicht missbrauchsanfällig
ist. Es ist ein für den gemeinnützigen Sektor großzügiges
System, aber wir brauchen auch einen Rahmen, in dem es sich bewegt.
Der zweite Punkt, den ich ansprechen will, hat mich
persönlich sehr beschäftigt: Wir haben jetzt im Gesetz auch eine
sogenannte kleine und große Freiwilligenpauschale verankert. Ich
sage es Ihnen ganz offen: Das war auch für mich persönlich ein Thema,
das gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil
der Grundsatz gilt: Ehrenamt muss immer Ehrenamt bleiben, denn wenn wir Ehrenamt
zu bezahlen beginnen, dann wird es irgendwann einmal schwierig.
Wir verändern dann das Ehrenamt im Wesen.
Es gab aber hier im Parlament im Zuge eines
Freiwilligenprozesses auch die Aussage: Wenn durch das Ehrenamt
Aufwände entstehen, sollen diese Aufwände abgegolten
werden! – Das gelingt uns jetzt auf eine aus meiner Sicht sehr
ausgewogene Weise im Rahmen einer kleinen Freiwilligenpauschale –
wir
reden von 100 Euro Aufwandsersatz pro Monat –, aber auch einer
großen Freiwilligenpauschale: 250 Euro pro Monat,
einkommensteuerfrei und sozialversicherungsfrei, zum Beispiel für
mildtätige Organisationen, für Menschen, die intensiv im
Katastropheneinsatz tätig sind, für Übungsleiter; wir meinen
damit auch Kapellmeister, Chorleiter und so weiter, aber immer mit einer Grenze
von 250 Euro und immer als Aufwandsersatz gedacht. Das ist schon auch
ein wichtiger Schritt. (Beifall bei der ÖVP sowie der Abg. Blimlinger.) –
Danke sehr.
Ich möchte mich abschließend, weil es für
mich schon ein großer Wurf ist
und wir uns über Monate intensiv damit auseinandergesetzt haben,
wirklich auch bedanken; in allererster Linie natürlich bei den Experten,
die eingebunden waren – da war viel Fachwissen notwendig. (In
Richtung Galerie:) Günther Lutschinger ist, glaube ich, heute
hier, ich möchte aber
auch Stefan Wallner nennen, den Geschäftsführer vom Bündnis
für Gemeinnützigkeit, Peter Kaiser vom Roten Kreuz und viele
andere – es
gibt ja auch diesen Spendenbeirat.
Ich möchte mich noch einmal explizit beim Koalitionspartner,
bei Kollegin Blimlinger für sehr, sehr konstruktive, allerdings
auch sehr, sehr
lange Gespräche bedanken, die wir jetzt, glaube ich, wirklich in einem
sehr ausgewogenen Gesetzespaket formuliert haben. Ich möchte mich aber
auch beim Finanzministerium bedanken, bei dir natürlich, Herr
Finanzminister, zu allererst, aber auch bei deinen Fachsektionen –
Prof. Mayr wurde heute
schon mehrmals im Zusammenhang mit der vorliegenden Gesetzesmaterie gelobt –;
auch da war unglaublich viel Fachwissen notwendig, um dieses
Gesetz auch in der Vollziehung auf den Weg zu bringen. Ich möchte mich,
Herr Finanzminister, auch bei deinem Kabinett bedanken, insbesondere bei Lilly
Kunz. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten viel Zeit gemeinsam verbracht,
und ich glaube, dass wir wirklich ein gutes Gesetz auf den Weg
bringen. – Danke sehr. (Beifall bei der ÖVP und bei
Abgeordneten der Grünen.)
13.28
Präsident
Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gemeldet ist
Abgeordneter
Maximilian Linder. – Bitte schön, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Maximilian Linder
(FPÖ): Sehr geehrter Herr
Präsident! Herr Minister! Geschätzte Kolleginnen, geschätzte
Kollegen! Sehr geehrte Zuhörerinnen, sehr geehrte Zuhörer! Das
Gemeinnützigkeitsreformgesetz findet absolut unsere Zustimmung, wir werden
voll dahinterstehen. Es wurde
von Kollegen Hanger schon sehr viel erwähnt und hervorgehoben: zum einen
die Ausweitung der Spendenbegünstigten beziehungsweise die Erleichterung
für
die Spendenbegünstigung, auch bei Bildung und Sport. Der Zugang zur
Spendenbegünstigung wird vereinfacht.
In diesem Zusammenhang ist es
mir schon sehr wichtig, anzumerken, dass vonseiten der Freiheitlichen Partei,
speziell von unserer Sportsprecherin Petra Steger, schon unzählige
Anträge zu diesem Thema eingebracht wurden,
die leider immer wieder von den Regierungsparteien schubladisiert wurden, vertagt
wurden, wodurch man bisher eigentlich viel an möglichen Spenden
verloren hat beziehungsweise die Möglichkeit, spenden zu lukrieren, nicht
umgesetzt werden konnte.
Zum Thema der
einkommensteuerfreien Freiwilligenpauschale: Auch das, glaube ich –
und da spreche ich jetzt als Bürgermeister aus der Praxis –,
ist ein
ganz, ganz wichtiger Bereich, und ich darf vielleicht ein kleines Beispiel
nennen: In einer Nachbargemeinde hat ein Traditionschor, in dem auch ganz viele
junge Sänger mitwirken, plötzlich den Chorleiter verloren, da dieser
verstorben
ist. Dann bestand die Schwierigkeit, wo sie einen Chorleiter finden.
In der kleinen Gemeinde war niemand zu finden, im Bezirk war niemand zu
finden – und dann wird jemand Chorleiter, der aber viele Kilometer
anreisen muss, viel Zeit aufwenden muss, um diesen Chor
weiterzuführen. In einem solchen Fall ist es wirklich möglich, mit
dieser kleinen Freiwilligenpauschale drüberzuhelfen und zu
ermöglichen, dass der Chor bestehen bleibt und somit die jungen Leute auch
die Bindung an das Dorf erleben.
In Summe ist es ein sehr gutes Gesetz. Es geht bei dieser
steuerfreien Pauschale wirklich nicht darum, ein steuerfreies Einkommen zu
bekommen, sondern
darum, das Freiwilligenamt zu unterstützen. Wir freuen uns, dass damit eine langjährige
Forderung von uns Freiheitlichen umgesetzt wurde. – Danke. (Beifall
bei der FPÖ.)
13.31
Präsident
Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt Frau
Abgeordnete
Mag.a Eva Blimlinger. – Bitte schön, Frau
Abgeordnete.
Abgeordnete Mag. Eva Blimlinger
(Grüne): Sehr geehrter Herr
Präsident! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Sehr geehrte Damen und
Herren vor den Bildschirmen und auch auf der Galerie! Es freut mich
außerordentlich, dass wir heute hier ein Gesetz beschließen
werden, das wirklich eine ganz grundlegende Wende in der Berücksichtigung
des gemeinnützigen Sektors bedeutet. Sehr oft wird ja auf die
Dualität Staat –
privat Bezug genommen, ohne dass dabei dieser Bereich des Gemeinnützigen
überhaupt einbezogen wird. Das ist einfach der dritte Sektor, der immer
stärker wächst und natürlich auch volkswirtschaftlich gesehen
ganz zentral ist.
Österreich ist ein Land
der Vereine. Die Österreicher und Österreicherinnen lieben
Vereine: Es gibt ungefähr 125 000 Vereine und ungefähr vier
Millionen Mitglieder – oder 3,8 Millionen, das variiert,
ganz genau wissen wir
es ja nicht. Österreich hat damit die höchste Vereinsdichte in ganz
Europa. Jeder
ist gern ein Vereinsmeier, ein Funktionär, eine
Funktionärin. Ein Verein
ist in Österreich relativ einfach zu gründen: Man muss auf den
sogenannten Nichtuntersagungsbescheid warten – ein Relikt aus dem
Jahr 1848;
auch diesbezüglich könnten wir uns einmal verständigen,
tätig zu werden.
Bis dato war es so –
Kollege Hanger hat es schon angesprochen –,
dass es höchst kompliziert war, wie Spendenabsetzbarkeit zustande kommt.
Im Bereich Kunst und Kultur – und das hat mich besonders motiviert
und
eben immer sehr für eine große Lösung eingenommen –
war es zum Beispiel so, dass nur Spenden an jene gemeinnützigen
Organisationen absetzbar waren, die schon eine staatliche
Förderung bekommen haben, wobei die, die keine bekommen haben, sie natürlich
zum Teil notwendiger gebraucht hätten.
Man wollte allerdings nicht, dass das Finanzamt darüber entscheidet, was
Kunst und Kultur ist, und hat daher diese Lösung gefunden.
Zu den Anmerkungen von Herrn
Kollegen Matznetter betreffend Weisungsgebundenheit: Ja, so ist es eben in
einem funktionierenden Rechtsstaat. Ich
bin froh, dass es eine Weisungsbindung gibt, und ich kann mir kaum vorstellen,
dass dem Finanzamt in Einzelfällen eine Weisung erteilt wird, zu sagen:
Der oder die darf nicht spendenbegünstigt sein. – Was da
gesprochen wird, ist einfach kompletter Unsinn. (Beifall bei Grünen und
ÖVP.)
Es gibt dieses schon
erwähnte Freiwilligenpauschale, und dabei geht es darum: Natürlich
muss Ehrenamt bleiben, aber es muss auch klar sein, dass man,
wenn man ohnedies selber schon die Arbeit investiert, dann nicht auch noch
zusätzliche Kosten wie zum Beispiel Reisekosten tragen muss, weil man
als Ehrenamtlicher wo teilnehmen will.
Insgesamt sind es rund 3,7 Millionen Menschen, die sich freiwillig engagieren, und es entsteht dadurch eine Bruttowertschöpfung von ungefähr 11,5 Milliarden Euro.
Mit diesem heutigen Gesetz – für das ich sehr inständig um breite Zustimmung bitte, weil es wirklich ein absoluter Meilenstein für diesen dritten Sektor ist –
gibt es in Zukunft Rechtssicherheit, und es
ist zum ersten Mal so, dass zwar nicht die Gemeinnützigkeit, aber die
Spendenabsetzbarkeit per Bescheid festgestellt wird. Es
gibt – wie Sie sehen, wenn Sie den Abänderungsantrag lesen, Kollege
Matznetter – auch die aufschiebende Wirkung. Es ist also alles ganz
in Ordnung und aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht ist alles wirklich
super.
An dieser Stelle möchte ich mich wirklich bedanken – wir haben das nahezu drei Jahre lang verhandelt. Es war ein bisschen eine Folge von Corona, als Kollege Hanger und ich schon den Non-Profit-, also den NPO-Fonds verhandelt haben. Damals haben eigentlich alle gesagt: Wovon redet ihr da? Warum brauchen die Geld? Die Vereine, wer ist das überhaupt, wie geht das überhaupt? Und eine Folge dieses NPO-Fonds ist sozusagen jetzt der Beschluss dieses Gesetzes, über den ich mich besonders freue.
Mein Dank geht an Andreas Hanger und insbesondere an Lilly Kunz aus dem Finanzministerium. Sie waren diejenigen, die immer wieder neue Versuche gemacht haben, und ich glaube, wir haben das mit all denen, die schon erwähnt worden sind, wirklich wunderbar geschafft. Herzlichen Dank!
Im Übrigen bin ich der Meinung: Bring them home now! (Beifall
bei Grünen
und ÖVP.)
13.36
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt Frau Mag.a Martina Künsberg Sarre. – Bitte schön, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete
Mag. Martina Künsberg Sarre (NEOS):
Herr Präsident! Herr Minister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Für
die Bildung ist ja nicht oft ein guter Tag – man kann sich nicht
sehr oft über Maßnahmen in diesem
Bereich freuen –, aber heute ist, glaube ich, ein sehr erfreulicher
Tag. Die Ausweitung der Spendenbegünstigung auch auf den Schulbereich,
auf Schulinitiativen ist wirklich ein großer Wurf, und ich finde das
sehr, sehr großartig.
Wir NEOS haben uns seit vielen Jahren für die Spendenbegünstigung eingesetzt, waren da auch in gutem Kontakt – das möchte ich auch erwähnen – mit Kollegen Hanger. Auch vielen Dank!
Warum ist die Ausweitung der
Spendenbegünstigung auf den Schulbereich so wichtig? – Weil,
wie wir ja gestern von unserem Bildungsminister auch eindrucksvoll
dargestellt bekommen haben, aus dem System relativ wenig Innovation kommt
und wir NEOS sehr, sehr stark davon überzeugt sind, dass
Bildungsinnovationen natürlich ganz, ganz stark von externen Initiativen,
von Vereinen, von Stiftungen getrieben werden. Deswegen erwarten wir uns
künftig auch deutlich mehr an Initiativen und Innovationen, die in den
Schulbereich kommen werden. Das ist sehr, sehr positiv, und wir glauben
auch,
dass es wichtig ist, dass sich mehr Leute beteiligen, wenn es um den wichtigen
Bereich Kinder und Jugendliche geht.
Ich möchte mich an dieser
Stelle sehr, sehr herzlich bei allen Bildungsinitiativen, die es bereits gibt,
bedanken – ohne Sie, ohne euch wäre all das, was bereits jetzt
in vielen Bereichen geht, nicht möglich (Beifall bei den NEOS und bei
Abgeordneten der ÖVP), wie etwa in der Chancenfairness –,
und ich freue
mich auf alle, die dieses Gesetz abgewartet haben und jetzt etwas Neues beginnen werden, etwas Neues aufsetzen werden. Das wird
sehr, sehr gut werden.
Was wir schade finden, ist, dass die freien Schulen im Gegensatz zu den konfessionellen Schulen nicht bedacht sind. Das ist schade, und man wird sich vielleicht überlegen können, ob man diese in einem weiteren Schritt, wenn man das Gesetz einmal novelliert, dann auch mitnimmt.
Was wir sehr, sehr kritisch sehen – und deswegen
beantragen wir in zweiter Lesung getrennte Abstimmung –, ist
dieses Freiwilligenpauschale, das Sie
jetzt einziehen, weil wir eben glauben, dass es die kleineren Vereine
gegenüber den großen benachteiligen wird. Die können sich das
wahrscheinlich
nicht so locker leisten wie große, die auch staatliche Unterstützung
bekommen. Deswegen sind wir da sehr, sehr dagegen. – Danke. (Beifall
bei den NEOS.)
13.39
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt nun Herr Bundesminister Dr. Magnus Brunner. – Bitte, Herr Bundesminister.
Bundesminister für Finanzen Dr. Magnus
Brunner, LL.M.: Sehr geehrter
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Sehr geehrte
Zuseherinnen und Zuseher! Das ist heute wirklich ein spezieller Tag im Parlament –
das wird eigentlich zu wenig gewürdigt und kommt fast zu
kurz –:
Es ist heute ein historischer Finanzausgleich beschlossen worden. Es ist ein
riesiges Start-up-Paket beschlossen worden. Die globale Mindestbesteuerung ist umgesetzt
worden. Und jetzt folgt noch einmal ein riesengroßes Paket (Abg. Belakowitsch:
Da muss es ja ganz super toll laufen im Land!), bei dem
es um das Ehrenamt, um die Gemeinnützigkeit und um die Spendenabsetzbarkeit geht.
Wir haben in Österreich
die Situation, dass rund 3,3 Millionen Menschen
ehrenamtlich, freiwillig tätig sind. Ich als Finanzminister kann das
entsprechend nüchtern in trockenen
Zahlen ausdrücken: Dieser sogenannte dritte Sektor,
wie er oft genannt wird, also die Arbeit im gemeinnützigen, auch im
freiwilligen Bereich, von Freiwilligenorganisationen trägt in
Österreich rund 10,3 Milliarden Euro zur Wertschöpfung bei. Das
entspricht etwa 4 Prozent unseres BIPs. Das ist doch gewaltig! Die
Leistungen, die damit für unsere Gesellschaft insgesamt erbracht
werden, sind eigentlich sprichwörtlich unbezahlbar, wenn man ehrlich ist.
Der Bundesregierung ist es daher ein besonderes Anliegen, dieses freiwillige
Engagement bestmöglich zu unterstützen.
Ich möchte
mich wirklich ganz speziell bei Abgeordnetem Hanger und bei Abgeordneter
Blimlinger, die das intensiv verhandelt haben, bedanken. Sie haben gemeinsam
mit meinem Haus, mit den Expertinnen und Experten im Finanzministerium,
aber auch mit all den Organisationen verhandelt. Sie sind
relativ häufig in unserem Haus ein- und ausgegangen, um das ganz konkret,
mit großer Wertschätzung zu verhandeln. Bei all den beteiligten
Personen
möchte ich mich ganz herzlich bedanken. (Beifall bei der ÖVP sowie der Abgeordneten Disoski und Fischer.)
Wir haben ja in
diesem Bereich in den letzten Monaten und Jahren bereits einiges auf den Weg
gebracht. Abgeordneter Hanger hat es erwähnt, wir haben im Vorjahr weiters
beispielsweise das Katastrophenfondsgesetz novelliert,
den Feuerwehren zusätzlich 20 Millionen Euro zur Verfügung
gestellt,
oder eben, wie Herr Abgeordneter Hanger erwähnt hat, das
Freiwilligengesetz beschlossen, das im Juli in Kraft getreten ist. Wir haben in
der letzten Plenarsitzung beispielsweise das Rettungs- und
Zivilschutzorganisationen-Unterstützungsgesetz auf den Weg gebracht.
Es sind in den letzten Wochen
und Monaten also wirklich viele Dinge passiert. Das heute ist sozusagen der
Höhepunkt dieser umfassenden Bemühungen.
Wir wissen natürlich alle, dass die gemeinnützige Arbeit selbstverständlich eine der tragenden Säulen unserer Gesellschaft ist, und umso mehr und umso erfreulicher ist es natürlich, dass das heute wirklich eines der umfassendsten Gemeinnützigkeitspakete der österreichischen Geschichte ist, wenn man ehrlich ist. Ich will nicht übertreiben, aber heute ist wirklich – auch in diesem Zusammenhang – ein besonderer Tag. Dass es eines der umfassendsten Pakete ist, das sagen ja nicht wir, sondern das sagt beispielsweise das Bündnis für Gemeinnützigkeit, also die Organisationen selber, die davon betroffen sind.
Das Spendenaufkommen – um ein paar
Zahlen einzuwerfen, um zu veranschaulichen, wie wichtig das
ist – betrug im Vorjahr rund 1,1 Milliarden Euro.
Das ist auf jeden Fall ein Rekordwert und auch angesichts der doch schwierigen Situation,
der Herausforderungen der letzten Jahre, bemerkenswert. Mit
der Spendenabsetzbarkeit setzen wir durchaus ein wichtiges Zeichen der Anerkennung,
der Förderung auch des privaten Engagements, und – und das
kommt dazu – die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ersparen sich
dank dieses neuen Pakets jährlich über 100 Millionen Euro.
Wir haben uns gemeinsam mit Vertreterinnen und
Vertretern des Gemeinnützigkeitsbereiches um diese umfassende Reform
bemüht, mit der wir auf der
einen Seite den Kreis der Begünstigten erweitern, aber auch die
Voraussetzungen für den Zugang insgesamt erleichtern.
Man hat in der Vergangenheit die Situation
gehabt, dass die Abzugsfähigkeit schrittweise um einzelne Zwecke erweitert
worden ist. Das jetzt ist
aber ein ganz anderer Zugang, weil wir nunmehr generell an die
Gemeinnützigkeit anknüpfen, und dadurch können, und auch
das ist eine Zahl, die, glaube ich, wichtig ist, potenziell rund
45 000 zusätzliche Organisationen in den Kreis
der begünstigten Organisationen aufgenommen werden.
Es wurde von den Damen und Herren Abgeordneten
erwähnt: Der gesamte Bildungsbereich ist jetzt auch erfasst. Das
soll, das haben wir ja im Ausschuss bereits diskutiert, natürlich nicht
die notwendigen staatlichen Investitionen in die Bildung ersetzen. Es geht rein
darum, zusätzliches Engagement auch finanziell zu honorieren
und zusätzlich möglichst viel – das hat die Abgeordnete
der NEOS vorhin gesagt – an Innovationen zu ermöglichen.
(Beifall bei der ÖVP.)
Der gesamte Bereich des Sports ist nunmehr
umfasst, und ich verstehe die Kritik nicht ganz. Ich bin Mitglied eines
mittelgroßen Tennisklubs, also selbstverständlich wird der davon
profitieren. Es geht nicht nur um die Großen, sondern selbstverständlich
profitieren auch kleine Vereine entsprechend.
Für den Sport auf der einen Seite und die Kunst und
Kultur – das wurde angesprochen – auf der anderen
Seite ergeben sich zusätzliche Möglichkeiten,
die durch dieses Gesetz zum Tragen kommen.
Vielleicht auch noch ein kurzer
Satz zum Freiwilligenpauschale, um das es vorhin schon gegangen ist:
Zusätzlich zur Ausweitung der Begünstigung werden in Zukunft auch
Zahlungen von gemeinnützigen Organisationen an ihre freiwilligen Helfer
steuerfrei sein. Es wird ein kleines und eine großes Freiwilligenpauschale geben.
Da geht es nicht darum, irgendwelche Lohnzahlungen
zu umgehen, ganz im Gegenteil, es geht ausschließlich darum, ehrenamtliche Arbeit zu erleichtern, weil, und auch das wurde bereits erwähnt, Ehrenamt natürlich Ehrenamt bleiben muss. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
Noch drei
Sätze zum Missbrauch, weil das in der Diskussion oft gekommen ist: Wir
müssen neben der Ausweitung und neben dem vereinfachten Zugang auch
besser vor Missbrauch schützen. Es geht natürlich um das
Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, und daher braucht es auch klare
Regeln, was die Voraussetzungen für die Absetzbarkeit betrifft. Da geht
es um Vertrauensschutz für die Spenderinnen und Spender, der
natürlich gewahrt werden muss.
Organisationen, deren Verhalten einfach nicht im Einklang mit der österreichischen Rechtsordnung steht, werden von dieser Spendenbegünstigung Gott sei Dank ausgeschlossen.
Wir haben uns die kritischen Rückmeldungen selbstverständlich ganz genau angeschaut, vor allem die sachlich begründeten Rückmeldungen, insbesondere, das haben wir schon diskutiert, die von Prof. Mayer betreffend die aufschiebende Wirkung – also der andere Prof. Mayer, nicht Sektionschef Prof. Mayr –, und auch entsprechende Änderungen vorgenommen, weil wir solch sachliche Kritik selbstverständlich ernst nehmen. Rechtssicherheit ist gerade in diesem Zusammenhang ganz entscheidend.
Klar aber ist auf der anderen Seite, dass die Möglichkeit zur Absetzung nur bestehen kann, wenn es um Organisationen geht, die sich im Rahmen des demokratischen Rechtsstaates bewegen, und damit wird, wie ich vorhin erwähnt habe, auch das Vertrauen der Spenderinnen und Spender geschützt.
Sehr geehrte Damen und Herren! Berechnungen
haben ergeben, dass aufgrund der Maßnahmen das Spendenvolumen um rund
250 Millionen Euro pro
Jahr steigen wird. Für die gemeinnützigen Organisationen in Österreich, die natürlich gegenwärtig die Teuerung spüren, bedeutet dieses Gemeinnützigenpaket eine massive Erleichterung.
Noch einmal: Das ist ein historischer Tag für die Republik. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
13.48
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt nun Frau Mag.a Dr.in Maria Theresia Niss. – Bitte schön, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete Mag. Dr. Maria Theresia Niss, MBA (ÖVP): Herr Präsident! Sehr geschätzter Herr Minister! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher! Als letzte Rednerin zu diesem Thema darf ich meine ganz besondere Freude über den heutigen Beschluss des Gemeinnützigkeitspakets ausdrücken. Ein solches fordern wir ja mittlerweile seit Jahren. Das nun vorliegende ist das größte Paket seit dem Gemeinnützigkeitspaket unter Bundesminister Pröll.
Es kommt zu einer massiven Ausweitung der
Spendenabsetzbarkeit, in Zukunft sind alle Bereiche erfasst, die die
Allgemeinheit fördern, und das umfasst
auch, wie heute schon öfters angesprochen, die Bereiche Bildung, Sport
oder auch Demokratie, denn, und das ist ganz interessant zu wissen, früher
konnte man zwar eine Schule in Indonesien fördern, weil das dem Thema Mildtätigkeit
unterworfen werden konnte, aber nicht eine Schule in Favoriten
oder im Zillertal. Gerade im Bereich der Bildung ist es eine Investition
in die Chancengerechtigkeit, denn diese Spenden werden vor allem an Schulen
fließen, die beispielsweise aufgrund eines hohen Migrantenanteils vor
Herausforderungen stehen.
Wir finden es besonders schade, dass die
SPÖ da heute nicht mitgeht. Herr Kollege Matznetter, Sie hören
mir zwar jetzt nicht zu, aber Ihre Rede war
etwas diffus, wenn ich das so sagen kann (Abg. Zarits: Erbärmlich!),
Sie haben sich
überhaupt nicht auf das Thema konzentriert. (Abg. Zarits: Erbärmlich!) Ich verstehe das natürlich auch, weil das eigentlich ziemlich peinlich ist. (Beifall und Bravoruf bei der ÖVP. – Abg. Haubner: Das stimmt!)
Die Reformen beziehen sich aber nicht nur auf die Ausweitung auf zusätzliche Bereiche, sondern auch darauf, dass in Zukunft Vereine oder Stiftungen nicht eine dreijährige Wartefrist haben, sondern bereits nach einem Jahr berechtigt sind, die Spendenabsetzbarkeit zu beantragen, und es wird außerdem die Bürokratie reduziert – wichtige Schritte, um gute, mutige und innovative Initiativen zu unterstützen.
Auch die fixe Schranke von 500 000 Euro in einem
Zeitraum von fünf Jahren wird aufgehoben, und das ist gut so, denn, meine
Damen und Herren,
im Bereich Bildung werden momentan rund 35 Millionen Euro gespendet und da
ist Luft nach oben. Rund 42 Prozent der Österreicher und
Österreicherinnen würden nach einer Umfrage Bildungszwecke
unter der Voraussetzung, dass das eben steuerlich absetzbar ist, mit Spenden
unterstützen.
Ein wesentliches Thema, das wir mit der Novelle auch
reformieren, ist die erleichterte Gründung eines Endowments bei
wissenschaftlichen Einrichtungen. Ein Endowment ist ein langfristiger
Vermögensaufbau, aus dessen Erträgen mittelfristig
Ausbildung oder auch Forschung finanziert werden sollen. Damit dieser
Vermögensaufbau auch gelingt, müssen Vermögen und Erlöse
vorerst einmal investiert und in eine Rücklage gestellt werden. Da
erhöhen wir die Prozentsätze für die Rücklage vor allem
auch in den ersten Jahren.
Meine Damen und Herren, ich möchte mich ganz, ganz
herzlich bei allen bedanken, die so
stark für dieses Thema gekämpft haben, allen voran bei Andreas
Hanger, bei Eva Blimlinger, aber auch beim Herrn Finanzminister –
wie gesagt, das wurde auch bei früheren Finanzministern schon
gefordert –, vor allem natürlich auch bei seinem
Haus – Lilly Kunz wurde schon erwähnt, Sektionschef Mayr wurde
schon erwähnt –, aber auch bei der gesamten Community,
Günther Lutschinger darf ich hier stellvertretend für alle ebenfalls
erwähnen.
Herzlichen Dank! Ich glaube, es ist uns ein ganz, ganz
großes Paket
gelungen.
Ganz am Ende darf ich noch den schon erwähnten Abänderungsantrag einbringen:
Abänderungsantrag
der Abgeordneten Karlheinz Kopf, Mag. Dr. Jakob
Schwarz, BA, Kolleginnen und Kollegen zur Regierungsvorlage 2319 der
Beilagen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das
Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988,
die Bundesabgabenordnung, das Gebührengesetz 1957, das
Privathochschulgesetz, das Fachhochschulgesetz und das IST-Austria-Gesetz
geändert werden (Gemeinnützigkeitsreformgesetz 2023 –
GemRefG 2023) – Top 7
Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen:
Die oben zitierte Regierungsvorlage (2319 d. B.) wird wie folgt geändert:
Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988) wird wie folgt geändert:
1. In Z 1 lit. d (§ 3 Abs. 1
Z 42) wird die Wortfolge „im Zweifel“ durch das
Wort „insoweit“ ersetzt.
2. Z 2 (§§ 4a und 4b) wird wie folgt geändert:
„a) § 4a Abs. 3 Z 2 lautet:
„2. Körperschaften des öffentlichen Rechts im Sinne des § 1 Abs. 3 Z 2 KStG 1988;“
b) § 4a Abs. 5 wird wie folgt geändert:
„aa) In Z 3 wird das Wort „führenden“ durch das Wort „führende“ ersetzt.
bb) Die bisherige Z 5
erhält die Bezeichnung „6.“ und es wird folgende
Z 5 eingefügt:
„5. Erfolgt ein Widerruf
wegen Wegfalls der Voraussetzung des Abs. 4, kommt der Beschwerde auf
Antrag aufschiebende Wirkung zu. Die aufschiebende Wirkung ist nicht zu bewilligen,
wenn die Beschwerde keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat. Bleibt die
Beschwerde ohne Erfolg, ist der Einrichtung
ein Zuschlag zur Körperschaftsteuer in Höhe von 20% der ab dem
in Z 4 genannten Tag zugewendeten Beträge vorzuschreiben; die
Einrichtung
ist verpflichtet, diese Zuwendungen zu dokumentieren.““
c) In § 4b
Abs. 1 Z 2 wird der Verweis 㤠18 Abs. 1
Z 8 lit. a bis c“ durch
den Verweis „§ 18 Abs. 1 Z 8“
ersetzt.““
3. In Z 7 lit. c (§ 124b) wird in Z 441 lit. d der Verweis „§ 4a Abs. 5 Z 2 und 4“ durch den Verweis „§ 4a Abs. 5 Z 1 und 2“ ersetzt.
*****
Danke. (Beifall bei der ÖVP.)
13.53
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Abänderungsantrag
der Abgeordneten Karlheinz Kopf, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA
Kolleginnen und Kollegen
zur Regierungsvorlage 2319 der Beilagen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988, die Bundesabgabenordnung, das Gebührengesetz 1957, das Privathochschulgesetz, das Fachhochschulgesetz und das IST-Austria-Gesetz geändert werden (Gemeinnützigkeitsreformgesetz 2023 – GemRefG 2023) - Top 7
Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen:
Die oben zitierte Regierungsvorlage (2319 d. B.) wird wie folgt geändert:
Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988) wird wie folgt geändert:
1. In Z 1 lit. d (§ 3
Abs. 1 Z 42) wird die Wortfolge „im Zweifel“ durch das
Wort „insoweit“ ersetzt.
2. Z 2 (§§ 4a und 4b) wird wie folgt geändert:
„a) § 4a Abs. 3 Z 2 lautet:
„2. Körperschaften des öffentlichen Rechts im Sinne des § 1 Abs. 3 Z 2 KStG 1988;“
b) § 4a Abs. 5 wird wie folgt geändert:
„aa) In Z 3 wird das Wort „führenden“ durch das Wort „führende“ ersetzt.
bb) Die bisherige Z 5 erhält die Bezeichnung „6.“ und es wird folgende Z 5 eingefügt:
„5. Erfolgt ein
Widerruf wegen Wegfalls der Voraussetzung des Abs. 4, kommt
der Beschwerde auf Antrag aufschiebende Wirkung zu. Die aufschiebende Wirkung
ist nicht zu bewilligen, wenn die Beschwerde keine hinreichende Aussicht auf
Erfolg hat. Bleibt die Beschwerde ohne Erfolg, ist der Einrichtung ein Zuschlag
zur Körperschaftsteuer in Höhe von 20% der ab dem in Z 4 genannten Tag zugewendeten
Beträge vorzuschreiben; die Einrichtung ist verpflichtet, diese
Zuwendungen zu dokumentieren.““
c) In § 4b Abs. 1 Z 2 wird der Verweis „§ 18 Abs. 1 Z 8 lit. a bis c“ durch den Verweis „§ 18 Abs. 1 Z 8“ ersetzt.““
3. In Z 7 lit. c (§ 124b) wird in Z 441 lit. d der Verweis „§ 4a Abs. 5 Z 2 und 4“ durch den Verweis „§ 4a Abs. 5 Z 1 und 2“ ersetzt.
Begründung
Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988):
Zu Z 1 (§ 3 Abs. 1 Z 42)
Es soll eine Klarstellung erfolgen.
Zu Z 2 lit. a, lit. b sublit. aa sowie lit. c und Z 4 lit. a (§ 4a Abs. 3 Z 2 und Abs. 5 Z 3, § 4b Abs. 1 Z 2, § 124b Z 441 lit. d)
Es sollen Redaktionsversehen beseitigt werden.
Zu Z 2 lit. b sublit. bb (§ 4a Abs. 5 Z 5)
Mit der Regelung soll die Effizienz des Rechtsschutzes
verbessert werden: Erfolgt ein Widerruf wegen Wegfalls der Voraussetzung des
Abs. 4, soll der Beschwerde
auf Antrag aufschiebende Wirkung zukommen. Somit bleibt die
Spendenbegünstigung während des Rechtsmittelverfahrens aufrecht
und die Einrichtung
wird weiterhin auf der Liste der spendenbegünstigten Einrichtungen
ausgewiesen. Eine aufschiebende Wirkung soll aber nicht möglich sein, wenn
der Widerruf aufgrund des Unterbleibens einer fristgerechten Meldung
gemäß § 4a Abs. 5 Z 1 oder 2
erfolgt. Zudem soll die aufschiebende Wirkung mit Bescheid nicht zu bewilligen
sein, wenn die Beschwerde keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat.
Bleibt die Beschwerde der Einrichtung ohne Erfolg und
wird somit die Spendenbegünstigung aberkannt, soll der Einrichtung
– wie auch im Falle des § 18
Abs. 8 Z 4 lit. b – ein Zuschlag zur Körperschaftsteuer in Höhe
von 20% der ab
dem Tag des Widerrufs zugewendeten Beträge vorzuschreiben sein. Mit dieser
Regelung soll in pauschaler und verwaltungsökonomischer Weise ein
Ausgleich für
die Steuerminderung aufgrund der von den Spendern geltend gemachten
Beträge erfolgen. Durch die aufschiebende Wirkung verbleibt die
Einrichtung (vorerst)
auf der Liste und die Spenderinnen und Spender können weiter auf die
Abzugsfähigkeit ihrer Spende vertrauen. Die – nur im Falle einer
endgültigen Aberkennung der Spendenbegünstigung –
eintretende Nachversteuerung gleicht diesen
Vorteil aus und sorgt damit
dafür, dass nicht allein durch das Ergreifen eines Rechtsmittels stets ein
Vorteil besteht, sodass eine Gleichbehandlung mit anderen Einrichtungen, die
die Voraussetzungen auch nicht erfüllen und denen daher
die Spendenbegünstigung nicht zuerkannt wird, sichergestellt ist. Die
Einrichtung soll verpflichtet werden, die ab dem Tag des Widerrufsbescheids bis
zur Streichung
von der Liste erhaltenen Zuwendungen, die der Bemessungsgrundlage des Zuschlags
zugrunde zu legen sind, zu dokumentieren.
*****
Präsident Ing. Norbert Hofer: Der Abänderungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht und steht somit auch in Verhandlung.
Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
Wünscht die Frau Berichterstatterin ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall.
Meine Damen und Herren, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Parlamentsdirektion arbeiten mit Hochdruck an der Vorbereitung der Abstimmungsvorgänge, aber da wir insgesamt zahlreiche Abänderungs-beziehungsweise Zusatzanträge und Verlangen auf getrennte Abstimmung haben, und zwar zu mehreren Punkten der Tagesordnung, wird auch hier eine kurze Unterbrechung der Sitzung nicht ausreichen.
Ich verlege daher
die Abstimmung über Tagesordnungspunkt 7 bis nach den
Abstimmungen über die Tagesordnungspunkte 8 und 9 und fahre in
der Erledigung der Tagesordnung fort.
Bericht des Finanzausschusses über den Antrag 3777/A der Abgeordneten Karlheinz Kopf, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Umsatzsteuergesetz 1994, das Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992, das Elektrizitätsabgabegesetz, das
Erdgasabgabegesetz, das Kohleabgabegesetz und die Bundesabgabenordnung geändert werden (2381 d.B.)
9. Punkt
Bericht und Antrag des
Finanzausschusses über den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das
Bundesgesetz über die Einrichtung einer Bundeswettbewerbsbehörde
(Wettbewerbsgesetz – WettbG) geändert
wird (2382 d.B.)
Präsident Ing. Norbert Hofer: Wir kommen nun zu den Punkten 8 und 9 der Tagesordnung, über welche die Debatten unter einem durchgeführt werden.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde wieder verzichtet.
Zu Wort gelangt Abgeordneter Kai Jan Krainer. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter
Kai Jan Krainer (SPÖ): Herr
Präsident! Meine sehr geehrte Damen und Herren! Es gibt ja das ganze Jahr
und eigentlich schon das letzte Jahr
ein wesentliches Thema und das ist die Teuerung. Gemessen wird der Erfolg der
Arbeit der Bundesregierung am Ende ja nicht daran, ob man am meisten Steuergeld
ausgegeben hat, sondern daran, ob man die Teuerung, die Inflation erfolgreich
bekämpft hat oder nicht.
Das Zeugnis, das diese Zahlen ausstellen, ist: Die Bundesregierung
hat die schlechteste Teuerungspolitik in ganz Europa gemacht. (Abg. Michael Hammer:
Falsch! – Abg. Jeitler-Cincelli: Das stimmt nicht! Das stimmt
einfach nicht!
Nein!) Kein einziges Land in Westeuropa hat eine derart hohe Teuerung wie
wir. Wir Sozialdemokraten haben sehr frühzeitig, vor mehr als zwei Jahren
bereits, gesagt, worum es geht, nämlich im ersten Schritt um die hohen
Energiepreise – die haben Sie aber nicht bekämpft.
Sie haben ganz viel Geld ausgegeben, haben jedem in
Österreich 500 Euro gegeben, damit er sich einmal die
höheren Energiepreise leisten kann. Das Geld
ist dann zu den Energiekonzernen gewandert. Dann hat der Finanzminister vor
einem Jahr gemeint, er holt es sich, 2 bis 4 Milliarden Euro von dem
Geld
holt er sich. Geholt hat er sich 240 Millionen. Ein Vielfaches ist an die
Aktionäre ausgeschüttet worden, das Geld ist bereits weg –
das ist unser Steuergeld.
Das Problem ist, die Energiepreise sind weiter gestiegen. Sie haben die Inflation angeheizt. Die Einmalhilfen sind vorbei, aber die hohen Energiepreise sind geblieben und das Geld ist nicht bei uns, sondern das Geld ist bei irgendwelchen Aktionären von Energiekonzernen. Da kann man nur sagen: Gratuliere, so schlecht kann man es ja wirklich normalerweise nicht machen, nicht einmal, wenn man sich bemüht!
Im Bereich der Mieten haben wir frühzeitig gesagt, wir
müssen die Mietanstiege verhindern. Sie haben es nicht getan.
Jetzt, da die Mieten um 20, um 22 Prozent gestiegen sind, sagen Sie: Na in
den nächsten Jahren werden
wir das deckeln! – Das ist alles viel zu spät und viel zu
wenig.
Im Bereich der Lebensmittel, als wir gesagt haben, man kann
die Preise, indem man die Umsatzsteuer auf Lebensmittel senkt oder gar für
eine gewisse
Zeit streicht, sofort um 10 Prozent senken, haben Sie Folgendes gesagt:
Erstens einmal wäre das schlechte Politik, weil das Politik mit der
Gießkanne wäre,
weil auch Personen mit einem höheren Einkommen dann einen Vorteil davon
hätten. Bei all Ihren Maßnahmen haben Personen mit hohen Einkommen
immer Vorteile gehabt, aber wenn die SPÖ etwas vorschlägt, darf das
nicht der Fall sein.
Das Zweite, was Sie gesagt
haben, ist, dass die Senkung der Umsatzsteuer
nicht weitergegeben wird, sondern dass sich die Konzerne das einstecken werden.
Das haben Sie gesagt, und Sie haben gesagt, das kann man ja alles
nicht kontrollieren. Jetzt kommen Sie mit einer Maßnahme, mit einer
Förderungsmaßnahme bei der Fotovoltaik – da schauen
wir uns an, wie da
die Wirkung ist. Das Erste: Ist das Gießkanne? – Nein, ist es
nicht, weil 90 Prozent der Förderung zu den Allerreichsten in
diesem Land gehen. Das stört
Sie nicht – 90 Prozent für die Reichsten, für die obersten 10 Prozent, und da haben Sie überhaupt kein Problem, aber wenn 90 Prozent in die untere Hälfte fließen wie bei den Lebensmitteln, da haben Sie ein Problem. Sie machen also offenbar nur Politik für die, die sehr, sehr viel Geld haben, und für die breite Masse haben Sie nichts übrig. (Beifall bei der SPÖ.)
Zum Thema der Weitergabe, ob
das weitergegeben wird oder nicht, wie
das kontrolliert wird, haben wir vor einem Monat die Frage gestellt:
Wieso macht das nicht die Bundeswettbewerbsbehörde? Minister Kocher hat
gesagt, das machen die Bezirksverwaltungsbehörden. Ob er die darauf
vorbereitet hat, ob das kontrolliert ist, ob es eine Markterhebung
gibt? – Nichts ist passiert. Jetzt, Wochen später, greifen Sie
unseren Vorschlag auf und sagen, okay, stimmt, die
Bundeswettbewerbsbehörde kann das besser.
Wissen Sie, wann die Bundeswettbewerbsbehörde überhaupt erst eine Rechtsgrundlage hat, um das zu machen? – Nächste Woche darf sie erst anfangen – zehn Tage vor Jahresende, wenn dann nämlich die Senkung der Umsatzsteuer auf Fotovoltaikanlagen in Kraft treten soll, darf die Behörde überhaupt erst zu arbeiten beginnen. Dilettantischer kann man es gar nicht machen. (Beifall bei der SPÖ.)
Das ist purer Dilettantismus. Ich muss den Schüler:innen des Europagymnasiums Baumgartenberg, die auf Einladung meines Kollegen Schroll hier sind, auch sagen: Bitte kein Beispiel an dem nehmen, wie das diese Bundesregierung macht! Die macht das leider wirklich dilettantisch. (Abg. Jeitler-Cincelli: Herzlich willkommen!)
Wenn man auf die Sozialdemokratie hört, dann
weiß man, wie man es
besser macht. – Vielen Dank. (Beifall bei der
SPÖ.)
14.00
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Karlheinz Kopf. – Bitte, Herr Abgeordneter.
14.00
Abgeordneter Karlheinz Kopf (ÖVP): Herr Präsident! Herr Bundesminister!
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Zunächst gleich einmal zu den
Ausführungen von Herrn - - – Nein! Vorher
begrüße ich gerne auf Wunsch von Herrn Kollegen Hammer eine Gruppe
des Bundesverwaltungsgerichtes
der Außenstelle Linz. Herzlich willkommen bei uns im Hohen Haus! (Allgemeiner
Beifall.)
Herr Kollege Krainer! Es ist
schon interessant; wir führen immer ähnliche Diskussionen. Du
kritisierst immer die Bundesregierung für die Unterlassung aller
möglichen aus deiner Sicht sinnvollen, manche davon aus unserer Sicht
nicht sehr sinnvollen Maßnahmen, wie man die Inflation hätte
dämpfen können. Du hast die Energiekosten als einen wesentlichen
Kosten- und Preistreiber genannt. Wenn ich mir anschaue, dass bei der
Fernwärme beispielsweise, und die gibt es halt hauptsächlich in Wien,
der Preis jetzt doch um 86 Prozent
höher ist als noch im Jahre 2021, dann würde ich einfach
vorschlagen, zuerst einmal vor der eigenen Tür zu kehren, bevor man den
anderen gute Ratschläge gibt. (Beifall bei der ÖVP. –
Abg. Krainer: Normalerweise habe ich Sie als seriös erlebt! Und
derartig unseriöse Vergleiche sind an und für sich Ihrer
nicht würdig!)
Und ein zweiter Punkt: Zur
Umsatzsteuerbefreiung für PV-Anlagen, die in diesem Gesetz oder in einem
dieser beiden verankert ist: Bitte auch da auf dem Boden der Seriosität
bleiben! Das eine sind die Energiekosten, die die Menschen in ihrer
Haushaltsführung belasten. Und das da sind Fördermaßnahmen.
Generell: Fördermaßnahmen der Regierung auf ihre Verteilungswirkung
zu überprüfen ist selbstverständlich in Ordnung. Das ist
wichtig. Da ist man immer ein bisschen im Zwiespalt zwischen
möglichst großer Einfachheit einer Fördermaßnahme;
das heißt dann aber halt, sie hat auch eine gewisse Streuung und ist
nicht immer ganz treffsicher. Es geht oft auch um Schnelligkeit.
Oder man macht sie sehr treffsicher auf
Einkommen und so weiter abgestellt,
dann wird sie halt bürokratisch. Wo das aber nicht so zutrifft, ist die Umsatzsteuerbefreiung bei den PV-Anlagen. Das ist keine Maßnahme, die von der Verteilungswirkung und von einem sozialen Gedanken getrieben ist, sondern von einem umweltpolitischen Gedanken. (Beifall bei der ÖVP.)
Da geht es schlicht und einfach
darum, dass möglichst viele Menschen – Klammer
auf – die es sich leisten können – Klammer
zu – Fotovoltaikanlagen
auf ihre Dächer, an ihre Hauswände montieren, montieren lassen, um
eben möglichst viel Strom aus der erneuerbaren Energiequelle Sonne zu
gewinnen.
Da geht es nicht in erster Linie darum, die soziale Verteilungswirkung zu beachten,
sondern dass das überhaupt geschieht. Das soll ein Anreiz dazu sein,
und deswegen werden natürlich Förderungen ausgeschüttet, damit
es sich eben für die Menschen rentiert. Also das mit der Verteilungswirkung
oder Betrachtung der Verteilungswirkung von sozialen Maßnahmen in
einen Topf zu werfen, das ist schlicht und einfach nicht gerechtfertigt. Und
lieber Jan, das wird in dem Fall auch deinem intellektuellen Anspruch nicht
gerecht, dass du das vorhin angesprochen hast. (Beifall bei
der ÖVP.)
Ein Punkt noch zur Inflationsbekämpfung beziehungsweise
zur Vermeidung von Inflationseffekten nach
oben: Wir verlängern mit einem Abänderungsantrag,
den mein Kollege Eßl dann noch formell einbringen wird, auch die Senkung
der Erdgasabgabe und der Elektrizitätsabgabe auf das europäische
Mindestmaß, a) um die Entlastung, die wir damit schon vor
Jahren geschaffen haben, für die Menschen in der preislichen Auswirkung
beizubehalten, aber vor allem
auch, um jetzt nicht zur Unzeit, da die Maßnahme auslaufen würde,
einen inflationstreibenden Effekt in die andere Richtung zu bekommen, wenn
wir ausgerechnet jetzt diese Abgabensenkung auslaufen ließen. Also
selbstverständlich achten wir sehr gut und sehr genau darauf, welche
Maßnahmen, welche politischen und steuerpolitischen
Maßnahmen letzten Endes welche Wirkung auf die Inflation haben. Da
ist es geboten, das entsprechend
zu verlängern, was da auch geschieht.
Eines noch, zurück noch einmal zur Umsatzsteuerbefreiung bei den PV-Anlagen: Eine Änderung des Wettbewerbsgesetzes, die da auch mit abgestimmt werden wird, dient ja dann genau dazu, dass die Weitergabe dieser Mehrwertsteuerbefreiung von den Herstellern oder von den Installierenden an die Konsumenten und Konsumentinnen auch tatsächlich stattfindet; deswegen die Änderung im Wettbewerbsgesetz. Bitte um Zustimmung zu all diesen Materien! – Herzlichen Dank. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
14.06
Präsident
Ing. Norbert Hofer: Nächster Redner
ist Herr Abgeordneter
Michael Bernhard. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter
Michael Bernhard (NEOS): Herr
Präsident! Geschätzter Herr Minister! Werte Kolleginnen und Kollegen!
Für uns NEOS ist ein zentrales Element, dass wir Wirtschaft und
Umwelt verbinden wollen. Der Tagesordnungspunkt ist wirklich bestens
dafür geeignet, dass man zeigt, wie es
diese Bundesregierung falsch macht.
Ich möchte das etwas ausführen, und zwar den
Umstand, dass Fotovoltaik für viele nicht leistbar ist. Das hat aus
unserer Sicht zwei Ursachen. Die erste Ursache ist: Arbeit ist auf der
unternehmerischen Seite zu teuer. Die Lohnnebenkosten führen dazu, dass
die Installation einer Fotovoltaikanlage teurer wird, als sie wäre, gäbe
es günstigere Lohnnebenkosten. Und andererseits wird Einkommen zu hoch
besteuert. – Herr Kollege Schwarz, da müssen
Sie zuhören. Ich glaube, der Argumentation können Sie schon
folgen. – Einkommen wird zu hoch besteuert, was dazu
führt, dass Menschen zu wenig
netto rausbekommen, um sich aus eigener Kraft leichter eine Fotovoltaikanlage
leisten zu können.
Sie senken jetzt nicht die Lohnnebenkosten in einem
relevanten Ausmaß
und Sie senken auch nicht die Besteuerung von Einkommen in einem ausreichenden
Ausmaß und versuchen, dieses Problem, das Sie nicht lösen, durch
eine
Umsatzsteuerbefreiung von Fotovoltaikanlagen in den Griff zu bekommen. Das ist aber, wenn man eine Wirtschaft haben möchte, in der umweltwirksame Maßnahmen den Vorrang haben, langfristig einfach nicht treffsicher. Aus unserer Sicht wäre es wesentlich sinnvoller, die Besteuerung von Einkommen und die Lohnnebenkosten zu senken. Dann wird es auch leistbarer umzusteigen. Durch die hohen Gaskosten und die hohen Stromkosten gibt es ja am Markt Anreize genug.
Ein anderer Punkt, und da gebe ich Kollegen Krainer durchaus
recht: Es ist
ja keine Lappalie, die wir heute beschließen. Es sind in etwa
650 Millionen Euro, die diese Maßnahme kosten wird, und die
schütten wir ganz frei, unabhängig von jedem weiteren Umstand
aus. Man muss sich ja nur eine Fotovoltaikanlage kaufen. Jetzt ist das bei
der ÖVP sozusagen eine langjährige Tradition, dass man auf
seine Klientel schaut. Bei den Grünen hat es uns schon ein bisschen
überrascht, dass sie in letzter Zeit tatsächlich nur noch Politik
für Wohlhabende auf Kosten derjenigen, die aus der Mitte heraus die
Steuern bezahlen, machen.
Was wir heute und auch in den nächsten Tagen
diskutieren werden, ist ja
nichts anderes, als dass diejenigen, die schon Eigentum haben, belohnt werden
und alle anderen dafür bezahlen müssen. Besitze ich Eigentum, dann
wird
mir die Wärmepumpe gefördert. Besitze ich Eigentum, dann wird mir die
Fotovoltaikanlage gefördert. Besitze ich ausreichend Einkommen, dann
profitiere ich von all diesen Maßnahmen, die ich
natürlich mit meinen Steuern mitfinanziere. Aber der Mittelstand, der
nicht im gleichen Ausmaß Eigentum
hat, muss dafür löhnen. Dass das ÖVP-Politik ist, ist mit freiem
Auge erkennbar.
Die Grünen sollten spätestens dann wachsam werden,
wenn Karlheinz
Kopf hier herauskommt und sich quasi feurig freut, dass umweltpolitische
Maßnahmen gesetzt werden. Dann muss wirklich Gefahr in Verzug sein,
denn
gerade wenn Wirtschaftskammerfunktionäre, die ja weiter an der fossilen
Energie festhalten wollen, sich über umweltpolitische Maßnahmen
freuen, dann
kann es nicht wirklich richtig sein.
Aus unserer Sicht ganz klar: Umwelt und Wirtschaft
verbinden heißt Steuern senken, damit wir Wirtschaft und Haushalte
transformieren können,
anstatt weiter Fördermillionen auszuschütten. – Vielen
Dank. (Beifall bei
den NEOS.)
14.09
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt MMMag. Dr. Axel Kassegger. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter MMMag. Dr. Axel Kassegger
(FPÖ): Herr Präsident! Sehr
geehrter Herr Bundesminister! Ich finde es erheiternd, dass die
wirtschaftsliberale
Partei NEOS sich jetzt Sorgen um die Umverteilung und um die ach so große
Benachteiligung der Nichtbesitzenden
macht. (Abg. Bernhard: Steuersenkungen!)
Das passt irgendwie, für mich zumindest, von der Logik her nicht in das Profil einer wirtschaftsliberalen Partei, die sich das Leistungsprinzip auf ihre Fahnen heftet, aber soll so sein. (Abg. Scherak: Das ist nur, weil du besitzend bist, Axel! – Abg. Krainer: Man kann die eigenen Vorurteile manchmal auch ... überdenken!)
Ich bin auch – in negativem Sinne – darüber amüsiert, dass sich die Kollegen Kopf und Krainer offensichtlich wechselseitig vorwerfen, wer jetzt noch schlechter performt.
Herr Krainer sagt, der Bund
performe schlecht, und Kollege Kopf sagt, Wien sei aber noch viel
schlechter – derartige Feststellungen, oder wie auch immer
man das bezeichnen mag, helfen den Menschen in Österreich aber
überhaupt nicht!
Die Umsatzsteuerbefreiung für Fotovoltaikanlagen ist ja im Übrigen etwas, das die Deutschen schon längst haben – und wir befinden uns ja in einem gemeinsamen Wirtschaftsraum mit den Deutschen –, und wo wir de facto nachziehen, und es ist eine Forderung der Freiheitlichen Partei, insoweit ist es
wenig verwunderlich, dass wir dem Ganzen natürlich zustimmen. (Ruf bei der FPÖ: Danke, Magnus!)
Ich möchte aber auch die
von Kollegen Krainer gestellte Frage noch einmal aufwerfen und eine
ebenfalls langjährige Forderung der Freiheitlichen Partei wiederholen:
Warum geht eine Umsatzsteuerbefreiung bei Lebensmitteln,
bei Grundnahrungsmitteln nicht, aber bei Fotovoltaik schon? Da fehlt mir jetzt
das logische Verständnis, also das sollte man doch auch auf diesen Bereich
ausdehnen können.
Ganz grundsätzlich ist die
Förderung von Fotovoltaik eine gute Sache. Wir wissen aber, dass es
in der Abwicklung massivste Probleme im Ablauf gibt,
mit den Fördercalls et cetera. Es ist alles schön und gut, dass man
diese Ansprüche hat, aber wenn man dann bei den Fördercalls
nicht zum Zug kommt
und monatelang warten muss und so weiter – also da gibt es
erhebliche Mängel im Ablauf. – Das ist das eine.
Das andere ist, dass unser
Standpunkt lautet, man muss Energiepolitik und
die Energiewende natürlich systemisch als Ganzes betrachten. Was Sie
machen, ist eine massive Förderung. Wir werden morgen auch wieder einen Gesetzentwurf
beschließen – oder besser gesagt: Sie werden ihn
beschließen –, mit dem die maximale Investitionsförderung
für innovative Fotovoltaikanlagen
auf 45 Prozent der Investitionskosten erhöht wird.
Sie fördern also die Erzeugung hochvolatiler Energie
und vergessen dabei vollkommen den Ausbau der Netze. Es kommt damit zur
Situation – und erklären Sie mir bitte jetzt nicht, dass das
effizient und effektiv wäre –, dass produzierter Strom
sozusagen weggeschmissen werden muss, also dass er nicht ins Netz geht. Es gibt
diese Fälle, in denen die Netzbetreiber sagen: Deinen
Strom speise ich einfach nicht ein! Natürlich kollabieren damit die Investitionsrechnungen
für all jene, die sich derartige Fotovoltaikanlagen angeschafft
haben, weil die Erlösseite dann vollkommen unplanbar ist.
Ihre Lösung für das Thema, das ist jetzt meine Vermutung, wird dann sein: Dann schütten wir halt wieder Geld ins System hinein und beschließen eine weitere Förderung, um das zu kompensieren – und dann wundern Sie sich über Inflationsentwicklungen! Das geht sich ja von der Logik auch nicht aus.
Ich möchte noch zwei Sätze zum zweiten hier
diskutierten Tagesordnungspunkt sagen, dem Antrag betreffend die
Bundeswettbewerbsbehörde. Wir sind
auch da dafür, und wir sind überhaupt dafür, die
Bundeswettbewerbsbehörde, die unseres Erachtens hervorragende Arbeit
leistet, auch entsprechend
mit Aufgabenbereichen und mit Ressourcen auszustatten. Da gibt es also eine
klare Zustimmung der Freiheitlichen Partei.
Ich möchte aber auch den aus unserer Sicht sehr
erhellenden, aus Sicht der Regierung und der Regierenden eigentlich
desaströsen Bericht der Bundeswettbewerbsbehörde betreffend den
Strommarkt in Österreich in Erinnerung rufen. Die stellen fest: Den Markt
gibt es eigentlich nicht, sondern es gibt
ein Oligopol von Landesenergieversorgern und dem Verbund, die wechselseitig die
Kunden diskriminieren und so weiter und so fort. Das geht zum Schaden und zulasten
des „berühmten“ – unter
Anführungszeichen – Endkunden, also des Haushaltes, aber
auch der Unternehmen, die das Ganze zu bezahlen haben. Auch da zeigt sich also
ein Geldkarussellspiel.
Kollege Krainer hat es ja auch schon gesagt: Wo bleibt das Geld, das wir zu bezahlen haben? – Bei den Aktionären der Energiekonzerne! Wer sind diese Aktionäre? – Zu 80, 85 Prozent wieder Sie beziehungsweise die Landesfinanzreferenten. (Abg. Krainer: Bei der OMV gerade mal ein Drittel!)
Sie hätten natürlich die Möglichkeit, hier auch diese Oligopolstrukturen aufzulockern und ein bisschen mehr Markt auch in den Strombereich in Österreich zu bringen.
Sie hätten natürlich auch die Möglichkeit, wenn der Wille besteht, die Meritorder abzuschaffen und andere Modelle einzuführen. Die Spanier können es, wir
können es offensichtlich
nicht. Warum können wir es nicht? – Weil der politische Wille
nicht da ist. Es ist auch der politische Wille nicht da, in diesem Oligopol
irgendetwas zu verändern, und das geht zulasten der Endkunden, der Stromkunden,
die nach wie vor zu hohe Preise zahlen, und zum Wohle, zur Freude der
Aktionäre – und das sind wie gesagt dann ja wieder Sie.
Auch in diesem Bereich also ein relatives Versagen dieser Bundesregierung. (Beifall
bei der FPÖ.)
14.15
Präsident
Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gemeldet ist
Frau Dr.in Elisabeth
Götze. – Bitte, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete Dr. Elisabeth Götze
(Grüne): Herr Vorsitzender! Sehr
geehrter Herr Minister! Hohes Haus! Auch ich spreche zu diesem
Tagesordnungspunkt, fokussiere aber auf den Teil, der mir persönlich
sehr wichtig ist, nämlich
das Funktionieren des Wettbewerbs. Es ist ja schon interessant, ich habe ein
bisschen zurückgeblickt: Es ist eigentlich eine ganz kleine
Gesetzesänderung, zwei kleine Abänderungen im
Wettbewerbsrecht, und trotzdem mit sehr großer Wirkung im Vergleich zu
dem, was wir auch bisher alles an großen Projekten umgesetzt haben:
830 Ausschusssitzungen in dieser Legislaturperiode, 90 reguläre
Plenarsitzungen und viele Sondersitzungen.
In diesem Fall ist es eigentlich nur ein kleiner technischer Punkt, den wir hier diskutieren, aber doch mit sehr großer Wirkung, und zwar sind es Änderungen im Wettbewerbsrecht. Der Anlass ist vor allem der bisher diskutierte Entfall der Umsatzsteuer auf Fotovoltaikanlagen ab 1. Jänner. Hintergrund ist, dass wir da die Bürokratie abschaffen wollen, das heißt, was es bisher an Förderungen gegeben hat, wird jetzt in eine automatische Begünstigung durch den Entfall der Umsatzsteuer übertragen, also quasi null Bürokratie. (Beifall bei den Grünen sowie des Abg. Prinz.)
Nur um ein Gefühl für die Größenordnung zu bekommen: Im vergangenen Jahr gab es mehr als 100 000 Förderanträge von Haushalten, also das ist wirklich viel Aufwand, den wir somit ersparen wollen.
Wir wollen uns aber nicht nur
den Aufwand ersparen, sondern gleichzeitig sichergehen, dass die
günstigeren Preise weitergegeben werden, und jetzt kommt die BWB ins
Spiel: Die Bundeswettbewerbsbehörde ist dafür zuständig,
zu sorgen, dass der Wettbewerb funktioniert, dass also niedrigere Preise ohne
Umsatzsteuer tatsächlich weitergegeben werden, und dafür statten wir
sie mit erweiterten Kompetenzen aus. Sie kann nämlich bei dieser Branchenuntersuchung,
die sie machen kann, zukünftig auch Einschau in die Unternehmen nehmen.
Bisher ist das noch nicht möglich, nun bekommt sie diese Kompetenzen. Ich
glaube, das ist wirklich wichtig und das ist ein Gamechanger, mit dem
wir sichergehen können, dass die günstigen Preise bei den Haushalten
ankommen. (Beifall bei den Grünen.)
Ja, Deutschland hat mit einer kürzlich beschlossenen Novelle des Wettbewerbsrechts seiner Wettbewerbsbehörde ebenfalls zusätzliche Kompetenzen übertragen, und wir werden auch nach Deutschland schauen. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.
Vielleicht schaut heute auch jener Herr zu, der mir eine
E-Mail geschrieben hat, warum ich denn in meiner Rede zu dieser Untergliederung
des Budgets so begeistert darüber gewesen sei, dass die
Bundeswettbewerbsbehörde substanziell mehr Personal bekommt: Ich bin
wirklich davon überzeugt, dass ein funktionierendes Wettbewerbsrecht und
ausreichend Personal für diese Behörde ganz wichtige Voraussetzungen für fairen Wettbewerb und faire
Preise
sind. Ich glaube, zu diesem Ziel trägt auch diese Novelle jetzt
bei, ich bitte um Zustimmung. – Danke. (Beifall bei den
Grünen und bei Abgeordneten
der ÖVP.)
14.18
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Franz Leonhard Eßl. – Bitte, Herr Abgeordneter.
14.18
Abgeordneter Franz Leonhard Eßl
(ÖVP): Herr Präsident! Geschätzter Herr Finanzminister! Meine
Damen und Herren! Hohes Haus! Die Energiewende ist ein Ziel dieser
Bundesregierung, und daher fördern wir auch die Erzeugung erneuerbarer
Energie. Die Förderung soll nicht nur effizient, sondern auch
unbürokratisch und bürgernah sein, deshalb haben wir bereits im November in einer
Sitzung eine Änderung des Umsatzsteuergesetzes beschlossen, wonach
bei kleineren PV-Anlagen 0 Prozent Mehrwertsteuer anfallen. Das
heißt, es ist kein Antrag nötig, kein Bewilligungsverfahren
nötig, kein Abrechnungsverfahren nötig: Der Anlagenbetreiber
bekommt eine Rechnung
mit dem Nettobetrag und dazu 0 Prozent Mehrwertsteuer.
Es muss aber natürlich auch sichergestellt werden, dass keine Doppelförderung passieren kann. Deshalb kann ein Anlagenbetreiber diese unbürokratische Förderung nur in Anspruch nehmen, wenn er nicht gleichzeitig einen Antrag auf Förderung nach dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz stellt oder diesen schon vorher gestellt hat.
Allerdings soll diese
unbürokratische Art der Förderung mit 0 Prozent Mehrwertsteuer
auch bei einer Anlagenerweiterung genutzt werden können. Dies gilt
allerdings immer nur, wenn die Anlage danach nicht 35 Kilowatt
Peak überschreitet. Für größere Anlagen – das
sei klargestellt – kann man nach wie vor einen Antrag auf
Förderung nach dem EAG stellen.
Zudem stellen wir sicher – wie das hier in der Diskussion schon eingeworfen wurde –, dass die Wettbewerbsbehörde in der Lage sein muss, darauf zu achten, dass diese 0 Prozent dann nicht zu einem Aufschlag beim Nettopreis führen.
Diese Regelung setzt effiziente Anreize. Auch diese
Regierung setzt
effiziente Anreize zum Bau von PV-Anlagen und zum Umstieg auf erneuerbare
Energie. Mit dem heutigen Beschluss schaffen wir für viele auch einen
unbürokratischen Zugang zur Förderung. Wir liegen da gut und sollten
diesen Weg weitergehen.
Es gibt aber – da
gebe ich Kollegen Kassegger auch recht – mittlerweile
für viele den Zugang zum Netz nicht mehr in dem Ausmaß, wie sie
bereit wären, Anlagen zu errichten. Es gibt mittlerweile auch ganze
Bezirke, wo keine Leistungskapazitäten mehr vorhanden sind. Daher das
dringende Ersuchen vor allem in Richtung der Frau Infrastrukturministerin,
Schwerpunkte zu setzen, was den Netzausbau und die
Verstärkung der Netze betrifft. Das ist notwendig, um die
Energiewende weiter vorantreiben zu können. (Beifall
bei der ÖVP sowie des Abg. Schwarz.)
Wir diskutieren auch den
Themenbereich Besteuerung von Energie. In diesem Zusammenhang darf ich einen
Abänderungsantrag einbringen, bei dem es
darum geht, die Senkung der Elektrizitäts- und Erdgasabgabe als Preisdämpfungsmaßnahme
um ein Jahr zu verlängern.
Ich bringe hier also folgenden Abänderungsantrag ein und ersuche um ein bisschen Geduld, weil ich ihn wortwörtlich verlesen muss:
Abänderungsantrag
der Abgeordneten Karlheinz
Kopf, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA, Kolleginnen und Kollegen zum Antrag
3777/A der Abgeordneten Karlheinz Kopf,
Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz,
mit dem das Umsatzsteuergesetz 1994, das Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992,
das Elektrizitätsabgabegesetz, das Erdgasabgabegesetz, das Kohleabgabegesetz
und die Bundesabgabenordnung geändert werden
(2381 d. B.) – Top 8
Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen:
Der oben zitierte Antrag in der Fassung des Ausschussberichts (2381 d. B.) wird wie folgt geändert:
1. Artikel 3 (Änderung des Elektrizitätsabgabegesetzes) wird wie folgt geändert:
a) Nach Z 2 wird folgende Z 2a eingefügt:
„2a. In § 7
Abs. 11 und 12 wird jeweils der Ausdruck „1. Jänner 2024“
durch
den Ausdruck „1. Jänner 2025“ ersetzt.“
b) Z 3 (§ 7 Abs. 15) lautet:
„3. Dem § 7 wird folgender Abs. 15 angefügt:
„(15) § 5 Abs. 4
und § 7 Abs. 11 und 12, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBI. I Nr. xx/202x, treten mit 1. Jänner 2024 in Kraft.
§ 5 Abs. 4
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xx/202x ist erstmalig
auf Abgabenerklärungen anzuwenden, die einen Veranlagungszeitraum
betreffen, der nach dem 31. Dezember 2022 endet.““
2. Artikel 4 (Änderung des Erdgasabgabegesetzes) wird wie folgt geändert:
a) Nach Z 1 wird folgende Z 1a eingefügt:
„1a. In § 8 Abs. 6 wird der Ausdruck „1. Jänner 2024“ durch den Ausdruck „1. Jänner 2025“ ersetzt.“
b) Z 2 (§ 8 Abs. 9) lautet:
„2. Dem § 8 wird folgender Abs. 9 angefügt:
„(9) § 6
Abs. 4 und § 8 Abs. 6, jeweils in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xx/202x, treten mit 1. Jänner 2024 in
Kraft. § 6 Abs. 4 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xx/202x ist erstmalig auf
Abgabenerklärungen anzuwenden, die einen Veranlagungszeitraum betreffen,
der nach dem 31. Dezember 2022 endet.““
*****
So weit der Abänderungsantrag. Ich bitte, den Anträgen zuzustimmen. (Beifall bei der ÖVP.)
14.25
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Abänderungsantrag
der Abgeordneten Karlheinz Kopf, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA
Kolleginnen und Kollegen
zum Antrag 3777/A der Abgeordneten Karlheinz Kopf, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA, Kolleginnen und Kollegen, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Umsatzsteuergesetz 1994, das Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992, das Elektrizitätsabgabegesetz, das Erdgasabgabegesetz, das Kohleabgabegesetz und die Bundesabgabenordnung geändert werden (2381 d. B.) –Top 8
Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen:
Der oben zitierte Antrag in der Fassung des Ausschussberichts (2381 d. B.) wird wie folgt geändert:
1. Artikel 3 (Änderung des Elektrizitätsabgabegesetzes) wird wie folgt geändert:
a) Nach Z 2 wird folgende Z 2a eingefügt:
„2a. In § 7 Abs. 11 und 12 wird jeweils der Ausdruck „1. Jänner 2024“ durch den Ausdruck „1. Jänner 2025“ ersetzt.“
b) Z 3 (§ 7 Abs. 15) lautet:
„3. Dem § 7 wird folgender Abs. 15 angefügt:
„(15) § 5 Abs. 4 und § 7 Abs. 11 und 12,
jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr. xx/202x, treten mit 1.
Jänner 2024 in Kraft. § 5 Abs. 4 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr. xx/202x ist erstmalig auf
Abgabenerklärungen anzuwenden, die einen Veranlagungszeitraum
betreffen, der nach dem
31. Dezember 2022 endet.““
2. Artikel 4 (Änderung des Erdgasabgabegesetzes) wird wie folgt geändert:
a) Nach Z 1 wird folgende Z 1a eingefügt:
„1a. In § 8 Abs. 6 wird der Ausdruck „1. Jänner 2024“ durch den Ausdruck „1. Jänner 2025“ ersetzt.“
b) Z 2 (§ 8 Abs. 9) lautet:
„2. Dem § 8 wird folgender Abs. 9 angefügt:
„(9) § 6 Abs. 4
und § 8 Abs. 6, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBI. I Nr. xx/202x, treten mit 1. Jänner 2024 in Kraft. § 6 Abs. 4
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xx/202x ist erstmalig auf
Abgabenerklärungen anzuwenden, die einen Veranlagungszeitraum betreffen,
der nach dem 31. Dezember 2022 endet.““
Begründung
Nach wie vor hohe Erdgas- und Elektrizitätspreise
für Endverbraucher(innen) sowie eine Inflation in Österreich, die
immer noch hoch über dem langjährigen Durchschnitt früherer
Jahre liegt, machen weitere Preisdämpfungsmaßnahmen erforderlich.
Dementsprechend soll die Senkung der Elektrizitäts- und Erdgasabgabe auf
das
in der Europäischen Union zulässige Mindestbesteuerungsniveau
gemäß EU-Energiebesteuerungsrichtlinie (Richtlinie 2003/96/EG
zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur
Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom, ABI. Nr. L 283 vom
31. 10.2003, S. 51, zuletzt geändert
durch den Durchführungsbeschluss (EU) 20 18/552 zur Aktualisierung der in
der Richtlinie 2003/96/EG angeführten Bezugnahmen auf die Codes der Kombinierten Nomenklatur
für bestimmte Erzeugnisse, ABI. Nr. L 91 vom 9.4.2018, S. 27) um ein Jahr verlängert
werden.
*****
Präsident Ing. Norbert Hofer: Der Abänderungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht. Er steht somit auch in Verhandlung.
Zu Wort gelangt nun Mag. Christian Ragger. – Bitte, Herr Abgeordneter.
14.26
Abgeordneter
Mag. Christian Ragger (FPÖ): Sehr
geehrter Herr Präsident! Geschätzter Herr Minister! Ich
möchte sozusagen in die Tiefe der Fotovoltaik einsteigen. Ich habe
früher auch mit Kollegen Schwarz darüber geredet.
Im Grunde ist es einmal ein wichtiger erster Schritt gewesen, dass
man – neben anderen Möglichkeiten und auch der
Landesförderung – auch in dieser
Richtung versucht, ein autonomeres Wohnen zu ermöglichen.
Eine der wesentlichen Voraussetzungen wird es auch in
Zukunft sein, autarkes Wohnen einfach zu unterstützen. In diesem Bereich
haben die Fotovoltaik
und vor allem dieser Investitionszuschuss eine gute Wirkung gezeigt.
Das war natürlich mit Anfangsproblemen verbunden, weil man ja auf der
einen Seite die Förderung des Bundesfinanzministers hat, auf der anderen
Seite
muss man diese Energie aber natürlich wegbringen.
Das ist ja das Kernproblem: dass nämlich die Netze
derzeit schwerst gefährdet sind und im Grunde genommen nicht in den Ausbau
miteinbezogen worden
sind. Denn was hilft es, für einen Privaten die schönste
Förderung zu bekommen, wenn auf der anderen Seite die Netze das nicht
aushalten? (Abg. Lukas Hammer: Warst du nicht einmal dafür
zuständig? Landesregierung!)
Ich war in keiner Weise für irgendein Netz
zuständig, lieber Kollege, denn
das ist letztendlich noch immer eine Kompetenz der jeweiligen Energieversorger.
Das ist das kleine Einmaleins der Information. (Beifall bei der FPÖ. –
Abg.
Lukas Hammer: Landesenergieversorgung!) – Sei
nicht so forsch! Ich tue dir ja eh nichts, keine Sorge. (Heiterkeit des Abg.
Lercher.) Ich sage sogar dazu, dass
das positiv ist.
Was aber jetzt natürlich mit zu berücksichtigen
ist: Man hat ja beihilfenrechtlich eine Regelung aufgemacht, die das in der
Krise erlaubt hat. Es gibt jetzt
diese Übergangsfrist, dass man diese Investitionszuschüsse auf den
Entfall der Umsatzsteuer umstellt. Man muss auch, wenn man Schritt A setzt,
auch
Schritt B machen.
Jetzt bin ich nicht beim Netz,
sondern wenn man heute als autonomer Betreiber Energie produziert, dann hat man
zwei Möglichkeiten: Entweder man
speist sie ins Netz ein oder man behält sie für sich. Daher muss der
zweite Schritt sein, dass man diesen Umsatzsteuerentfall auch auf die Batterie
wird umlegen müssen, weil das letztendlich auch damit verbunden ist. Denn
was ist am Ende des Tages die Intention des Gesetzgebers? – Die
Autonomie
des Hauses und diese Investition zu ermöglichen.
Das ist unsere Überlegung.
Deswegen haben die Freiheitlichen auch gesagt: Wir sind dafür, dass wir
diesen Investitionszuschuss heute umstellen und die Umstellung auf den Entfall
der Umsatzsteuer durchführen. Der nächste Schritt muss aber sein,
dass man, so wie es damals gefördert worden ist – um nämlich auch
eine Eigenversorgung ins Leben zu rufen –, letztendlich auch
den zweiten Schritt im Umsatzsteuergesetz macht und den Stromspeicher mitnimmt.
Wenn das der Fall ist, dann sind wir zufrieden. Dann ist das ein weiterer Schritt,
den wir umzusetzen haben. (Abg. Eßl: Das ist dabei! Das ist
inkludiert!)
Zweiter Punkt: die
Wettbewerbsbehörde: Die Wettbewerbsbehörde muss – na no,
na net! – letztendlich auch stärker unterstützt werden. Da
ist es in erster Linie so, dass es ja irgendwann einmal eine Wohltat
wäre, wenn
man alle Energieversorger – sowohl die Landes- als auch die
Bundesenergieversorger – einmal der Kontrolle durch die
Wettbewerbsbehörde unterzieht.
Denn wenn wir uns heute die Energiepreisentwicklungen der
einzelnen Unternehmen anschauen, dann sehen wir sehr deutlich, dass wir in
Österreich
wirklich auf einer Insel der Seligen sind – nämlich für
die Energiebetreiber, die letztendlich im geschützten Bereich agieren, ob
das jetzt die Wien Energie ist, ob das die Kelag ist, ob
das die Tiwag ist oder ob das die Vorarlberger sind. Egal wer, jeder kocht sein
eigenes Süppchen und ist weitgehend
der Kontrolle entzogen.
Da wünsche ich mir, dass die Wettbewerbsbehörde
noch viel tiefer hineingeht, weil das im Grunde genommen ja auch ein
wesentlicher Bereich ist,
der die Inflation in den letzten Jahren in Österreich in die Höhe
getrieben hat. – Danke. (Beifall bei der FPÖ.)
14.30
Präsident
Ing. Norbert Hofer: Nächster Redner
ist Mag. Dr. Jakob
Schwarz. – Bitte schön, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA (Grüne): Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Minister! Hohes Haus! Liebe Zuseherinnen und Zuseher! Ich habe eine kleine Quizfrage: Kann man etwas verlängern, das gar nicht existiert?
Sie haben doch sicher schon einmal gehört, dass die Bundesregierung keinen einzigen Preis gesenkt hat. Zumindest ist das eine Geschichte, die die Sozialdemokratie sehr gerne verbreitet, aber mitunter auch die Freiheitlichen, und deshalb würde ich vermuten, das ist vielleicht auch Ihnen schon untergekommen.
Sehr spannend ist in diesem Zusammenhang
der jetzige Tagesordnungspunkt, weil wir jetzt eine preissenkende
Maßnahme verlängern, nämlich das Absenken der
Energieabgaben auf das europarechtlich zulässige Minimum. Diese
Maßnahme muss natürlich schon existiert haben, wenn man sie jetzt um
ein Jahr verlängert. Das heißt, die Regierung setzt preissenkende
Maßnahmen, und sogar einige davon. (Beifall bei den Grünen und
bei Abgeordneten
der ÖVP.)
Die nächste Verlängerung einer preissenkenden Maßnahme steht schon morgen an, jene der Strompreisbremse, die Ihnen allen die Strompreise deckelt, nämlich bei 10 Cent pro Kilowattstunde.
Diese beiden Verlängerungen haben eine Auswirkung auf
die Inflation, die relativ groß ist, nämlich jeweils
0,3 Prozentpunkte. Das heißt, in Summe kann
die prognostizierte Inflation um 0,6 Prozentpunkte nach unten korrigiert werden.
Das ist schon einmal eine gute Sache. Allein durch diese Senkung der Energieabgaben spart man sich im Schnitt als
Haushalt in Österreich
über 100 Euro im Jahr. (Beifall bei den Grünen und bei
Abgeordneten der ÖVP.)
Ich möchte auch noch ganz kurz auf die PV-USt-Senkung,
die ja nicht
jetzt beschlossen wird, sondern schon im letzten Plenum beschlossen worden
ist – das nur zur Aufklärung, falls irgendjemand verwirrt
worden wäre –, eingehen.
Was aber durchaus ein Thema ist – Kai Jan Krainer hat es in seiner Rede angesprochen –: dass man natürlich Maßnahmen, die man setzt, ob es zur Inflationsbekämpfung ist oder auch jetzt bei den PV-USt-Senkungen, nicht danach beurteilen soll, wie viel Geld man dafür ausgibt, sondern danach, welche Wirkung damit erzielt wird. Da bemisst Kai Jan Krainer unsere Maßnahmen gegen die Teuerung immer sehr gerne daran, ob der VPI, also die Inflation, sinkt oder nicht.
Das ist schon auch eine interessante Kenngröße,
aber viel interessanter für uns und auch für die Bundesregierung ist
ja: Können sich die Menschen aufgrund unserer Maßnahmen
das Leben noch leisten, auch wenn die Preise steigen? Da zeigen der Budgetdienst und auch viele andere Untersuchungen:
Ja. Es ist sogar so, dass die Kaufkraft, die genau das ermittelt, in den
letzten Jahren gestiegen ist. (Beifall bei Grünen und ÖVP.)
Das heißt, wenn man die inflationsbekämpfenden
und die anderen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Teuerungskrise an der
Wirkung bemisst, dann
war das ein Erfolg.
Zweiter Punkt – das war auch ein Tipp, glaube ich,
an die Schülerinnen
und Schüler, die anwesend waren, sie sollen sich nichts von der
Bundesregierung abschauen, denn einerseits werden Maßnahmen wie
USt-Senkungen bei
den Lebensmitteln abgelehnt, andererseits werden sie dann bei den PV-Anlagen
aber erst recht beschlossen –: Diese zwei Dinge haben überhaupt
nichts miteinander zu tun. Bei der USt-Senkung auf Lebensmittel ist es der
Sozialdemokratie darum gegangen, die Preise auf Lebensmittel zu
senken – und dann
ist das eine schlechte Idee. In diesem Fall gibt es viele, viele Ziele, die
damit erreicht werden sollen, aber jedenfalls ist das Hauptziel, die
Anzahl der installierten PV-Anlagen zu erhöhen und diese
Installationen zu beschleunigen. (Beifall bei den Grünen und bei
Abgeordneten der ÖVP.)
Insofern sind das ähnlich klingende Maßnahmen,
aber zwei ganz unterschiedliche Ziele, und deshalb braucht es auch eine
unterschiedliche Behandlung. – Vielen Dank. (Beifall bei den
Grünen und bei Abgeordneten
der ÖVP.)
14.33
Präsident Ing. Norbert Hofer: Nächster Redner: Abgeordneter Max Lercher. – Bitte schön, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter
Maximilian Lercher (SPÖ): Herr
Präsident! Sehr geehrter
Herr Minister! Kolleginnen und Kollegen! Kollege Schwarz, bei allem Respekt:
Wenn alles so erfolgreich und so preissenkend ist, was ihr gemacht habt: Warum
kann ein Großteil der Menschen in Österreich sein Leben fast nicht
mehr bestreiten? (Beifall bei der SPÖ. – Abg. Schwarz:
Weil ihr uns das Russengas ...!)
Das ist doch die Frage: Warum gibt es so viele Menschen, die
von Monat zu Monat immer stärker unter Druck kommen? (Neuerlicher Zwischenruf
des Abg. Schwarz.) Da hat Kollege Krainer doch das vollkommen
Richtige gefragt: Wo ist die Verteilungswirkung? (Zwischenruf der Abg. Jeitler-Cincelli.)
Na, wenn
man in den Hörl investiert, wird man nicht so einen Effekt haben, wie wenn
man in die breite Masse investiert. (Beifall bei der SPÖ.)
Die Argumentation ist ja
hanebüchen. Bei den Fotovoltaikanlagen ist alles an Steuerstreichungen
möglich, wenn es aber um die Grundnahrungsmittel geht, bei denen die
gleichen Argumente gebracht werden, ist gar nichts möglich. Da
fehlt die Verteilungswirkung und das ist keine nachhaltige Politik. (Beifall
bei
der SPÖ.)
Wenn wir schon bei den
preisdämpfenden Maßnahmen sind, möchte ich eines erwähnen:
dass diese Bundesregierung es noch geschafft hat, bei der
höchsten Teuerungskrise, bei der höchsten westeuropäischen
Inflation noch preistreibende Maßnahmen zu setzen, nämlich die CO2-Bepreisung.
Ihr
schafft es ja sogar, bei explodierenden Energiekosten eine Maßnahme zu
setzen, die keinen Lenkungseffekt besitzt und durch die die Menschen in den
ländlichen Regionen doppelt belastet werden. Eine
alleinerziehende Mutter in einer Landgemeinde, die auf ein Auto angewiesen ist,
wenn sie zum Kindergarten fahren muss, wenn sie die Kinder zu den
Vereinen bringt, wird belastet, weil sie keine Alternative hat. Das macht ihr
mit euren Maßnahmen, geschätzte Bundesregierung. (Beifall bei der
SPÖ.)
Das ist auch der Grund: Wenn
man Preise senken will, dann machen wir heute doch die Prüfung! Nehmen wir
gemeinsam einen Entschließungsantrag
von Philip Kucher – der Name steht bekanntlich für
Qualität (Heiterkeit bei Abgeordneten der ÖVP) –
an:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Philip Kucher, Kolleginnen und Kollegen betreffend „temporäres Aussetzen der CO2-Steuer für die Dauer der Energiepreiskrise“ (Abg. Holzleitner: Das unterschreibe ich!)
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, die CO2-Steuer temporär auszusetzen bis die Energiepreise auf ein vernünftiges Niveau zurückgeführt werden können.“
*****
Wenn ihr Preise senken wollt, tut es jetzt! – Vielen Dank. (Beifall bei der SPÖ.)
14.36
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Philip Kucher,
Genossinnen und Genossen
betreffend temporäres Aussetzen der CO2-Steuer für die Dauer der Energiepreiskrise
eingebracht in der Sitzung
des Nationalrats am 14. Dezember 2023 im Zuge
der Debatte zu TOP 8 Bericht des Finanzausschusses über den Antrag 3777/A
der Abgeordneten Karlheinz Kopf, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA, Kolleginnen und
Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Umsatzsteuergesetz 1994, das
Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992, das Elektrizitätsabgabegesetz, das Erdgasabgabegesetz,
das Kohleabgabegesetz und die Bundesabgabenordnung geändert werden (2381 d.B.)
Die Bundesregierung hat Österreich zum Inflationseuropameister gemacht. Es gibt heute kein einziges Land in Westeuropa mit einer höheren Teuerung als Österreich. Alle Warnungen der Oppositionsparteien wurden in den Wind geschlagen. Man war nicht bereit, regulatorisch in die Preise einzugreifen, sodass die Preise wie in anderen Länder wieder sinken, statt weiter zu steigen.
Wenn es allerdings darum geht Maßnahmen zu setzen, die preiserhöhend wirken, ist die österreichische Bundesregierung nicht so zimperlich.
Von der nationalen CO2-Bepreisung erwartete sich die
Bundesregierung eine Reduktion der Triebhausgasemissionen. Auf Grund der
Energiepreisschocks in den vergangenen Jahren sind die Preise aber um ein
Vielfaches dessen gestiegen, was als CO2-Preis eine Lenkung herbeiführen
hätte sollen. Diese Energiepreisschocks
hatten daher tatsächlich Auswirkungen auf die CO2-Emissionen, haben aber
gleichzeitig dazu beigetragen, dass die Menschen in diesem Land sich die
Lebenshaltungskosten (vor allem Energie und Wohnen) nicht mehr leisten
können und die Wirtschaft in eine Rezession schlittert. Die
Energiepreise befinden sich nach wie
vor deutlich über Vorkrisen-Niveau, dennoch hält die Bundesregierung
an der Verteuerung vieler Energieträger fest und ignoriert die
bereits bestehende Belastung für Menschen und Wirtschaft.
Aus diesem Grund stellen die unterfertigten Abgeordneten nachstehenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, die CO2-Steuer temporär auszusetzen bis die Energiepreise auf ein vernünftiges Niveau zurückgeführt werden können.“
*****
Präsident Ing. Norbert Hofer: Der Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht und steht somit auch in Verhandlung.
Zu Wort gelangt Mag. Klaus Fürlinger. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter
Mag. Klaus Fürlinger (ÖVP):
Hohes Präsidium! Herr Bundesminister! Wir sind gerade wieder Zeugen
einer SPÖ-Rede geworden, die ausschließlich darauf ausgelegt
war, das Land krank- und die Menschen armzureden, was sie einfach nicht
sind. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten
der Grünen.)
Herr Kollege Lercher, wenn man Ihnen zuhört und dann weggeht, denkt man sich, wir werden gleich alle in eine Massendepression verfallen. (Abg. Krainer: Der Bundeskanzler will die Psychopharmaka verteilen!) Gleichzeitig veröffentlicht Eurostat eine Statistik, laut der im europäischen Raum die Österreicher die
glücklichsten Menschen in ihrem Land sind. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Lercher: Die roten Länder! ...!)
Da frage ich mich, wie das mit dem zusammenpasst, was Sie
und Ihre Genossen hier Woche für Woche völlig faktenfrei daherreden,
oder wie es Vizekanzler Kogler schön gesagt hat,
„ungetrübt“ durch die „Faktenlage“ stellen Sie
sich hier heraus, jammern dieses Land in einer Tour krank, reden von Massenarmut. – Ich
darf Ihnen sagen: Dieselbe Eurostat-Studie sagt, dass wir 2,3 Prozent
deprimierte Personen, wie das so schön in der Fachsprache heißt,
haben. Auch diesen 2,3 Prozent werden wir noch helfen, weil diese Bundesregierung
allen hilft. Diesem Land geht es gut, viel besser, als Sie hier
in Ihren Reden sagen. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der
Grünen.)
14.38
Präsident
Ing. Norbert Hofer: Zu Wort ist dazu nun
niemand mehr
gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
Wünscht die Frau Berichterstatterin ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall.
Wir gelangen zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 8: Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Umsatzsteuergesetz, das Kraftfahrzeugsteuergesetz, das Elektrizitätsabgabegesetz sowie weitere Gesetze geändert werden, in 2381 der Beilagen.
Hiezu haben die Abgeordneten Karlheinz Kopf, Mag. Dr. Jakob Schwarz, Kolleginnen und Kollegen einen Zusatz- beziehungsweise Abänderungsantrag eingebracht.
Weiters liegt ein Verlangen auf getrennte Abstimmung des Abgeordneten Kai Jan Krainer vor.
Ich werde daher zunächst über die von dem erwähnten Zusatz- beziehungsweise Abänderungsantrag sowie von dem Verlangen auf getrennte Abstimmung
betroffenen Teile – der Systematik des Gesetzentwurfes folgend – und schließlich über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes abstimmen lassen.
Wir gelangen zur getrennten Abstimmung über Artikel 1 in der Fassung des Ausschussberichtes.
Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist mehrheitlich angenommen.
Die Abgeordneten Karlheinz Kopf, Mag. Dr. Jakob Schwarz, Kolleginnen und Kollegen haben einen Zusatz- beziehungsweise Abänderungsantrag betreffend Artikel 3 und 4 eingebracht.
Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist ebenfalls mehrheitlich angenommen.
Wir kommen schließlich zur Abstimmung über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang in der Fassung des Ausschussberichtes.
Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist mehrheitlich angenommen.
Wir kommen zur dritten Lesung.
Ich bitte jene Damen und
Herren, die dem Gesetzentwurf auch in dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen,
um ein diesbezügliches Zeichen. – Das ist
die Mehrheit. Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung angenommen.
Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag
der Abgeordneten Philip Kucher, Kolleginnen und Kollegen (Abg. Michael Hammer:
Depressionsantrag!) betreffend „temporäres Aussetzen der
CO2-Steuer für die
Dauer der Energiepreiskrise“. (Zwischenruf der Abg. Voglauer.)
Ich bitte jene Damen und
Herren, die für diesen Entschließungsantrag sind,
um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist die Minderheit.
Der Antrag
ist abgelehnt.
Wir gelangen zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 9: Entwurf betreffend Wettbewerbsgesetz, samt Titel und Eingang in 2382 der Beilagen.
Ich ersuche jene Damen und Herren, die für diesen Gesetzentwurf sind, um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist mehrheitlich angenommen.
Wir kommen zur dritten Lesung.
Ich bitte jene Damen und
Herren, die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter Lesung ihre
Zustimmung erteilen, um ein diesbezügliches Zeichen. –
Das ist die Mehrheit. Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter
Lesung angenommen.
*****
Meine Damen und Herren! Ein
ehemaliger Unterrichtsminister und Bundeskanzler hat einmal gemeint, die Dinge wären sehr kompliziert geworden.
Das
trifft auch auf unsere Abstimmung zu. Wir müssen die
Abstimmungen betreffend die
Punkte 2 bis 7 der Tagesordnung leider noch einmal verschieben.
Herr Bundesminister, ich nehme
an, Sie werden dann wahrscheinlich bei der Abstimmung nicht mehr hier sein. Wir
werden die Abstimmung um zwei Tagesordnungspunkte nach hinten verschieben. Oder
Sie bleiben hier? Oder wir schicken ein Foto? Wie es Ihnen recht ist, Herr
Bundesminister. Es wird
aber noch ein bissel dauern. (Bundesminister Brunner: Ich komme
wieder!) Ich muss aufgrund der eingebrachten Abänderungs-
beziehungsweise Zusatzanträge
und dem Verlangen auf getrennte Abstimmung, auf namentliche Abstimmung (Abg. Wöginger: Namentliche?) – eine namentliche gibt es nicht, gut,
wenigstens das bleibt uns erspart – die Abstimmungen
über die Tagesordnungspunkte 2
bis 7 bis nach der Abstimmung über die Tagesordnungspunkte 11 und 12 verlegen.
Ich fahre in der Erledigung der Tagesordnung fort.
Bericht des Ausschusses für Forschung, Innovation und Digitalisierung über den Antrag 3738/A(E) der Abgeordneten Eva-Maria Himmelbauer, BSc, Süleyman Zorba, Kolleginnen und Kollegen betreffend die Sicherstellung des reibungslosen Breitbandausbaus (2333 d.B.)
Präsident Ing. Norbert Hofer: Wir kommen nun zum 10. Punkt der Tagesordnung.
Es wurde auf eine mündliche Berichterstattung verzichtet.
Zu Wort gelangt nun Abgeordneter Hoyos-Trauttmansdorff. – Bitte schön, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Douglas Hoyos-Trauttmansdorff
(NEOS): Herr Präsident! Hohes Haus!
Herr Staatssekretär! Herr Bundesminister! Diese Regierung ist jetzt
seit vier Jahren im Amt, und der Ausbau der Netze, insbesondere der Breitbandausbau,
ist natürlich ein Thema, was nicht nur seitdem, sondern schon
davor eines war, das wir hier im Haus regelmäßig besprochen und
diskutiert haben.
In diesen vier Jahren wurde
sehr, sehr viel Geld ausgegeben, nur sehen
wir leider, dass der Breitbandausbau trotzdem stockt und wir nach wie vor nicht
wirklich weiterkommen, insbesondere wenn wir uns den Schnitt in Europa
anschauen. Da sind wir nach wie vor abgehängt. Dafür gibt es viele
Gründe, die teilweise auch hausgemacht sind. Wir sehen aber auch, dass das
viele
Geld – alleine im Jahr 2022 über 900 Millionen Euro,
also Milliarden, die da in
den letzten Jahren investiert wurden – nicht so ankommt, wie wir uns das wünschen.
Was macht die Bundesregierung? – Anstatt dass sie jetzt
einmal beginnt,
darüber nachzudenken, ob die Varianten und die Art und Weise, wie man
dieses Geld investiert, richtig sind, wird weiter Geld hineingeschossen, wird
weiter
Geld ausgegeben – und es kommt
nach wie vor nicht an. Es gibt Berichte,
die von Ihrem Haus, also dem Haus, in dem Sie ansässig sind, vom
BMF, beim Wifo in Auftrag gegeben wurden, und das Wifo vernichtet
die aktuelle
Strategie der Bundesregierung und sagt sogar, der ursprünglich vorgelegte
Evaluierungsplan ist nach Sichtung mit dem Breitbandbüro als stark
überarbeitungsbedürftige Basis für die Evaluierung
vorausgesetzt. Wenn wir weiterschauen, steht da, dass der Evaluierungsplan
wenig durchdacht ist.
Das ist genau das Problem. Dieses Papier zeigt ganz klar, dass der
Weg der falsche ist.
Es ist aber nicht nur die
Statistik, es ist nicht nur die Evidenz von Studien, die Sie beauftragen, die
sagen, das ist der falsche Weg, sondern es sind auch die Unternehmen, die
diesen Breitbandausbau vorantreiben sollen (Abg. Schnabel: Es gibt
mehr als diese drei Unternehmen!), die sagen: Bitte, Herr Minister,
schütten Sie nicht in derselben Art und Weise weiter Geld
hinein, sondern
schauen wir darauf, wie das System funktioniert! – Genau das passiert
aber nicht, dass darüber nachgedacht wird, sondern man versucht weiter, da
einfach Geld hineinzuschießen. (Beifall bei den NEOS.)
Sehr geehrte Damen und Herren, gerade Sie auf der
Zuschauergalerie!
Viele von Ihnen werden zu Hause sitzen und sich denken, das Internet ist bei
mir nicht schnell genug. Sie werden sich im ersten Moment denken: Ja, die
Bundesregierung schmeißt da weiter Hunderte Millionen Euro rein!, aber
das Internet wird bei Ihnen trotzdem nicht schneller werden. Warum wird
es nicht schneller? – Weil wir wahnsinnig viel Bürokratie auf
dem Weg haben, wahnsinnig viele Hürden.
Es gibt einen Punkt, bei dem die Europäische Union absolut recht hat, nämlich dass man diese Hürden abbauen sollte. (Zwischenruf des Abg. Prinz.) Genau deswegen gibt es auf europäischer Ebene die Bewegung und den Versuch, eine Gigabit-Infrastrukturverordnung auf den Weg zu bringen.
Einer der zentralen Teile dieser
Gigabit-Infrastrukturverordnung ist, dass man versucht, die Bauhürden
abzubauen. In Österreich ist das ein Riesenthema, es gibt
neun Bauordnungen. Was macht der Staatssekretär, anstatt dass wir da
mitgehen und versuchen, zum positiven Beispiel zu werden? – Er
rühmt
sich dafür, dagegen zu arbeiten. Er rühmt sich dafür, da nicht
mitzumachen – was ja absurd ist.
Der Grund dafür, dass das so ist, ist ganz
einfach – das, liebe Damen und Herren, ist leider der Stand, den wir
in dieser Republik haben –: Es geht nicht darum, dass Sie
schnelleres Internet haben, es geht um Eigeninteressen der Parteien. (Abg.
Schnabel: Na bitte!) Das Eigeninteresse der Partei liegt immer auf
der Gemeindeebene, weil sich der Bürgermeister nicht hineinpfuschen lassen
will. Dann müssen Sie sich überlegen, wo der Herr Staatssekretär
bald
sein will. Er will Bürgermeister in Innsbruck sein. Das ist der Grund,
warum im Infrastrukturausbau beim Breitband nichts weitergeht. (Beifall bei
den
NEOS. – Abg. Strasser: Das ist aber ein billiger
Schmäh! Die Schmähs der NEOS werden immer billiger!)
14.45
Präsident
Ing. Norbert Hofer: Ich darf Herrn
Staatssekretär Tursky
offiziell im Parlament willkommen heißen.
Zu Wort gelangt nun Eva-Maria Himmelbauer. – Bitte, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete
Eva-Maria Himmelbauer, BSc (ÖVP):
Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Staatssekretär! Werte Kolleginnen
und Kollegen! Werte Zuseherinnen
und Zuseher! Sie haben gerade eine sehr zynische Sicht der NEOS auf das Thema
Breitband gehört. Ich glaube, es ist ein Resümee, das so in der
Praxis
absolut nicht zutreffend ist, denn: Wenn ich mir die Zahlen anschaue, dann sehe
ich, in Österreich ist vor allem in den letzten Jahren tatsächlich
sehr viel
passiert, wenn es um den Breitbandinfrastrukturausbau geht.
Am Anfang der Legislaturperiode standen wir bei
13 Prozent an Gigabitanschlüssen in Österreich. Heute
stehen wir bei 69 Prozent der Haushalte, die einen Zugang zu einer
gigabitfähigen Leitung haben. Die Verfügbarkeit hat
sich somit sehr positiv entwickelt. Wir, die Bundesregierung, wollen bis 2030
sicherstellen, dass alle Haushalte einen gigabitfähigen Zugang haben
können, wenn sie ihn brauchen. Deswegen investieren wir auch
weiterhin dort in den Ausbau von Glasfaserinfrastruktur, wo der Markt eben
nicht ausbaut, gerade im ländlichen Raum.
Erst im November wurden 375 Millionen Euro für den
Ausbau von offenen Netzen in unterversorgten Gebieten ausgeschrieben. An
den Kollegen von
den NEOS: Gerade für dieses System wurde durch Studien dargelegt, dass es
eine gute Investition ist, weil es eben in ländlichen Regionen mit
offenen
Netzen den Wettbewerb vor Ort fördert und eine gute Ausbaualternative ist.
(Beifall bei Abgeordneten der ÖVP sowie des Abg. Zorba.) Das
heißt: Netze, die allen Internetanbietern offenstehen und somit den
Konsumenten auch mehr Wahlfreiheit bieten.
Die Telekommunikationsunternehmen selbst bauen aber auch
privatwirtschaftlich aus, ohne Förderung. Das begrüßen
wir, denn letzten Endes bedeutet
das, dass Förderungen und somit Steuergelder eingespart werden.
Was aber diskutieren wir heute? – In vielen
Gesprächen mit Gemeinden, Ländern, Konsumenten,
Telekommunikationsunternehmen und Infrastrukturgesellschaften haben sich
einige Baustellen gezeigt, die den Ausbau, egal ob privatwirtschaftlich oder
auch im geförderten Bereich, behindern. Aus
diesen Themen ist nun dieser diskutierte Entschließungsantrag entstanden:
eine Sammlung an Problemstellungen, denen wir in Gesprächen, aber in weiterer Folge
natürlich auch mit Lösungen begegnen wollen.
Ein Punkt ist das Thema
Überbauung beziehungsweise Mitverlegen. Wir haben die Rückmeldung aus
dem Markt bekommen, dass Initiativen oder Aussagen, wir wollen
mitverlegen, teilweise auch zu Verzögerungen von bis zu zwei, drei Jahren
in den Bauarbeiten führen, zu erhöhten Kosten und mit erhöhtem administrativen
Aufwand. Mitverlegung soll tatsächlich möglich sein – das
ist auch die Zielsetzung –, aber wir müssen auch darauf
schauen, dass
die Projekte weiterhin wirtschaftlich sind und dass es nicht zu Bauverzögerungen
kommt. Gute Gespräche gibt es in diesem Zusammenhang mit der
RTR, um Lösungen und Leitlinien aufzustellen.
Ein zweiter Bereich: Wir setzen
Förderungen in Bereichen, in denen der Markt nicht ausbaut und es
unterversorgte Gebiete gibt. Da sind natürlich neue Marktteilnehmer in
Österreich aktiv geworden, haben Ausbaugebiete angekündigt, die
eigenwirtschaftlich ausgebaut werden sollen. Das führt dazu,
dass sich unsere Förderlandkarte ändert und vielleicht Projekte,
Initiativen, die in förderbaren Gebieten geplant gewesen wären, nicht
mehr realisiert oder umgesetzt werden können. Natürlich soll das auch
dort, wo privatwirtschaftlich ausgebaut wird, stattfinden können. Wir
wollen bloß Mechanismen haben,
dass dieser Ausbau am Ende des Tages auch tatsächlich stattfindet, weil es
uns wichtig ist, dass diese Regionen tatsächlich versorgt werden und diese
ländlichen Gebiete auch über schnellen, leistbaren
Internetzugang verfügen.
Ein weiterer Punkt betrifft geförderte Ausbaugebiete. Was nicht stattfinden kann, ist, dass Ausbaugebiete blockiert werden, weil es fehlende Sanktionen gibt, wenn in einem Fördergebiet nicht ausgebaut wird und dann einfach Zeit verstreicht. Auch das ist nicht förderlich.
Der letzte Punkt,
den ich aus diesem Entschließungsantrag ansprechen möchte, ist die
Entwicklung, die Nachfragesteigerung von breitbandigen Angeboten. Wir haben
in Österreich aus unserer Historie heraus einen hohen Mobilfunkanteil,
auch beim Internet zu Hause sind die sogenannten Cubes immer noch
sehr beliebt. Das führt aber dazu, dass wir in Bereichen der Take-up-Rate,
also
da, wo es um die Anschlussquote geht, hinterherhinken, gerade beim Glasfaseranschluss,
da liegen wir bei circa 20 Prozent. Ich habe schon am Anfang gesagt:
69 Prozent sind anschlussfähig, 20 Prozent nutzen ihn tatsächlich.
Das führt auch dazu, dass wir in Indizes, dem Desi-Index beispielsweise,
auch im Bereich der Konnektivität eher hinten liegen.
Mit diesem Punkt
wollen wir auch das Thema adressieren, wie wir mehr Informationen nach
draußen transportieren können: was die Sichtbarkeit
von Anwendungen im Breitbandbereich und auch das Thema Wertsteigerungen
betrifft, wenn es um das eigene Haus oder das Grundstück geht, und vieles, vieles
mehr.
Insgesamt ist es ein Entschließungsantrag,
mit dem wir den Breitbandausbau fördern wollen, weil es eine
Investition in die Zukunft ist. Ich hoffe, dass wir
diesen Antrag gemeinsam unterstützen können und dass wir diese
Hürden auch abbauen können. – Danke schön. (Beifall
bei der ÖVP und bei Abgeordneten
der Grünen.)
14.51
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt Frau Mag.a Dr.in Petra Oberrauner. – Bitte, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete Mag. Dr. Petra Oberrauner
(SPÖ): Herr
Präsident! Herr Staatssekretär! Geschätzte Kolleginnen und
Kollegen! Geschätzte Besucher
und geschätzte Damen und Herren, die von zu Hause zusehen! Die Sicherstellung
des reibungslosen Breitbandausbaus muss ein Anliegen der Regierung sein. Das
ist vollkommen klar. Das muss als kritische Infrastruktur wirklich
funktionieren und vor allem rasch funktionieren.
Die
Digitalisierung und damit die Abhängigkeit von solchen Infrastrukturen
schreitet voran, und zwar in jedem Bereich: in der Schule, in der Durchsetzung
der Bürgerrechte, Digitales Amt zum Beispiel, oder in der Wirtschaft. Das
Tempo hat zugenommen, und entsprechend müssen wir auch weiterhin und schneller
die Verlegung von Glasfaserleitungen forcieren. (Beifall bei
der SPÖ.)
Warum ist das
wichtig? – Es ist für die Lebensqualität der Menschen wichtig, damit
sie am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Es ist aber
auch wichtig für öffentliche und kommerzielle Dienstleistungen. Es
ist wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen und
Forschungseinrichtungen und es ist wichtig für die Städte und
Gemeinden, die als Voraussetzung für einen guten Standort
existenziell eine gute und funktionierende Internetanbindung brauchen.
In diesem
Zusammenhang wäre es selbstverständlich gewesen, letztere einzubinden,
und zwar umfassend: in die Planung, in die Umsetzung, in den Bedarf. Die
Städte und Gemeinden wissen genau, worum es geht. 70 Prozent der
Kosten sind Grabekosten. Wir hätten uns da doch ziemlich viel Geld
ersparen können, wenn wir sie als Partner eingebunden hätten. Sie
würden auch
die Nutzer garantieren, weil sie genau wissen, wo die Nutzer sind. Das
können wir, sage ich einmal, auf Bundesebene, glaube ich, nicht
beurteilen.
Eine strategische
Planung auf Bundesebene gemeinsam mit den Städten und Gemeinden, die
betroffen sind, hätte die Umsetzung deutlich beschleunigt
und diese Vergabe von einzelnen Zellen an viele Förderwerber unnötig
gemacht, die das System dann irgendwie zersprageln.
Das Problem der
Städte und Gemeinden, dass sie keinen Ausbaupartner finden, hätte
sich dann auch relativiert, weil Unternehmen strategisch Dinge vorbereiten und
dann blockieren und die Gemeinden und die Städte dann
keine Umsetzer bekommen.
Aus dieser Sicht möchte ich sagen, der
Antrag adressiert einige Themen, und wir werden ihn auch unterstützen. Was
uns fehlt, ist aber, dass die Regierung
die Städte und Gemeinden nicht nur besser informiert, sondern auch in die
um-
fassende Planung einbindet und ihnen auch die finanziellen Unterstützungen bereitstellt, damit sie den Ausbau auch selbstständig vorantreiben können – dann wären wir jetzt schon fertig. – Danke. (Beifall bei der SPÖ.)
14.54
Präsident Ing. Norbert Hofer: Der nächste Redner ist Dipl.-Ing. Gerhard Deimek. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Dipl.-Ing. Gerhard Deimek
(FPÖ): Herr
Präsident! Herr Staatssekretär! Der Tagesordnungspunkt
heißt Sicherstellung des reibungslosen Breitbandausbaus. Das
ist ja grundsätzlich ein sehr sinnvolles Unterfangen, denn die
Digitalisierung schreitet voran, der Datenverbrauch steigt und
so weiter. Jetzt wird in diesem Antrag die Regierung aufgefordert, zu
prüfen, ob man oder wie man die Zusammenarbeit bei Überbauung
verbessern kann,
wie man sicherstellen kann, dass ein nicht erfolgter Ausbau in gefährdeten
Gebieten trotzdem stattfindet, und wie man die Nachfrage stärken
kann.
Das sind durchaus alles positive Dinge.
Was ich mich
wieder einmal frage, ist: Alles das ist ja nicht neu. Das ist ja bekannt.
Das ist den Leuten bekannt, das ist den Gemeinden bekannt, das
ist der Bundesregierung bekannt. Warum wählt man diesen Weg? Ich gehe
jetzt nicht auf den Text ein und breite mich mit technischen
Fachausdrücken
aus, ich bringe einfach ein Beispiel.
Wir haben in
einem Gebiet einen marktbeherrschenden Anbieter, egal wie wir den jetzt nennen
wollen, und dann kommt eine andere Firma und möchte
dort – im eigenwirtschaftlichen Gebiet – ausbauen. Dann
kommt dieser marktbeherrschende Anbieter und sagt: Moment, du hast ja die
Verpflichtung,
dass ich dort mit hineingehe, dass ich in den Bau mit hineingehe –
der sogenannte strategische Überbau. Im Endeffekt haben
beide – unter Anführungszeichen – einen
„geteilten Markt“, haben beide eine niedrigere Rentabilität,
und
im Endeffekt baut keiner. Das heißt, der, der bewusst draufgeht,
provoziert Stillstand, provoziert Rückzug, und den
Open-Access-Ausbau, wie es so schön heißt, können wir uns
irgendwohin schmieren. Die Leute, die gerne
einen Breitbandanschluss wollen, bekommen keinen.
Das Zweite ist:
Es sind heute schon die Gemeinden geschimpft worden: Ja, die
blockieren! – Was soll man denn in einer Gemeinde machen? Man
möchte
einen Straßenzug neu asphaltieren oder sanieren und bittet vorher alle,
die irgendwelche Dinge in der Straße verlegen wollen, das zu tun.
Keiner meldet sich, dann wird saniert, und kaum ist die letzte
Asphaltdecke drauf, kommt irgendein Open-Access-Ausbauer und sagt: Ich
würde da gerne hineingehen. Wer zahlt denn der Gemeinde das,
wenn nach ein paar Jahren die Firma vielleicht pleitegeht, wenn Garantien nicht
eingehalten werden können,
wenn die Straßen ausschauen wie eine Mondlandschaft, aber nicht mehr wie
eine ordentliche Gemeindestraße?
Diese
Missstände sind alle bekannt. So, und was machen wir jetzt? Die Regierung
könnte ein Lösungskonzept anbieten. Herr Staatssekretär, Sie
sind geschimpft worden, weil Sie als Bürgermeister kandidieren. Das kann
schon sein, aber bevor Sie noch als Bürgermeister irgendwohin gehen,
wäre es halt geschickt gewesen, wenn Sie vorher noch ein fertiges
Lösungskonzept angeboten hätten. Das haben Sie leider nicht gemacht.
Jetzt fordern wir als Nationalrat Sie dazu auf. Ich weiß nicht, ob Sie in dieser Periode, in Ihrer Schaffensperiode noch dazu kommen werden. Geschickter wäre es gewesen, mehr zu tun und sich weniger vom Nationalrat zu irgendetwas auffordern zu lassen. Das wäre Lösungskompetenz. Nach Innsbruck gehen ist halt nur der halbe Spaß. (Beifall bei der FPÖ.)
14.58
Präsident
Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt Herr
Abgeordneter
Süleyman Zorba. – Bitte, Herr Abgeordneter.
14.58
Abgeordneter Süleyman Zorba (Grüne): Herr Präsident! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Herr Staatssekretär! Die Digitalisierung und die Verfügbarkeit von Breitband sind essenziell für eine moderne Gesellschaft und heute auch gar nicht mehr wegzudenken. Wir arbeiten im Homeoffice, nutzen digitale Unterhaltungsangebote, unsere Unternehmen sind Teil dieser vernetzten Wirtschaft. Das soll auch in Zukunft so bleiben, denn unabhängig von ihrem Standort soll es ihnen auch ermöglicht werden, ihre Geschäfte abwickeln zu können. Eine gut ausgebaute Infrastruktur ist hierfür ein Schlüssel.
Auch die Zahlen belegen das: Im Zeitraum von
2012 bis 2021 gingen
rund 10 Prozent des Wirtschaftswachstums allein auf die zunehmende Anwendung
von Breitbandanschlüssen zurück. In Summe macht das in diesem
Zeitraum rund 39 Millionen Euro aus.
Ich weiß nicht, ob Kollege Hoyos nicht
viel unterwegs ist, aber es gibt, glaube ich, derzeit keine Region, wo nicht
Bagger auffahren, um Glasfaserkabeln
zu verbuddeln, oder wo keine Projekte in Planung sind. (Abg. Hoyos-Trauttmansdorff:
Doch, bei mir!) Das ist aber auch kein Zufall. (Abg. Lausch: Der
Hoyos
wohnt im Park!) In dieser Legislaturperiode wurden Fördergelder von
über 1 Milliarde Euro auf den
Weg gebracht, um Österreich bis 2030 flächendeckend
mit gigabitfähigen Netzen auszustatten. Diese Investitionen zahlen
sich eben auch aus. Durch den Boost in den letzten Jahren wurden auch erhebliche Fortschritte
gemacht. Kollegin Himmelbauer hat es schon angesprochen: von 13 Prozent
auf 69 Prozent gigabitfähiger Anschlüsse. (Beifall bei den
Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
In der Praxis gibt es natürlich Probleme, die wurden
auch schon angesprochen. Mit dem vorliegenden Antrag wollen wir eben an
Lösungen arbeiten,
damit da der Ablauf reibungsloser funktioniert. So muss zum Beispiel zur Beschleunigung
des Breitbandausbaus sichergestellt werden, dass die Abstimmung beziehungsweise die Zusammenarbeit zwischen den
verschiedenen Marktteilnehmern besser funktioniert. (Präsident
Sobotka übernimmt den Vorsitz.)
Der Kollege hat ein gutes
Beispiel gebracht: Wenn die Straße zugemacht wird, soll nicht drei Monate
später der Nächste kommen und die Straße wieder aufreißen;
die Gespräche und die Zusammenarbeit bei Mitverlegungen sollen besser
funktionieren. Außerdem soll der Ausbau auch an Orten erfolgen
und forciert werden, wo der freie Markt nicht funktioniert, wo blinde Flecken
entstehen. Auch darauf soll forciert weiter hingeschaut werden. Durch
diese verbesserte Absprache spart man Ressourcen, Geld und Zeit.
Auch die Gemeinden sollen
aktiver miteinbezogen werden. Zu dem Zeitpunkt, zu dem eine Förderung
für eine Region bestätigt wird, soll diese Region beziehungsweise
die Gemeinde oder der Bürgermeister proaktiv informiert
werden – und nicht erst, wenn der Marktteilnehmer vorhat,
auszubauen. Darüber
hinaus soll geprüft werden, wie man die Nachfrage und die Entwicklung
dieser Angebote weiter verstärken kann.
Wir haben jetzt schon ein solides Netz, das stetig
ausgebaut wird, damit
auch der letzte blinde Fleck Österreichs beseitigt wird und die Menschen
auch dort Zugang zu gigabitfähigen Anschlüssen bekommen. Wir
müssen
weiter dranbleiben, und mit diesem Antrag möchten wir den Prozess optimieren. –
Danke schön. (Beifall bei Grünen und ÖVP.)
15.01
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gelangt Herr Staatssekretär Tursky. Bei ihm steht das Wort. – Bitte.
Staatssekretär
im Bundesministerium für Finanzen Florian Tursky, MBA MSc: Ich möchte mit etwas vielleicht
Ungewöhnlichem beginnen. Man kann
nämlich durchaus auch einen Fehler zugeben. Wir haben in den frühen
2000ern, was den Glasfaserausbau betrifft, eindeutig Fehler gemacht. (Abg.
Lukas Hammer: Das war Schwarz-Blau!)
Wir haben nämlich damals
nicht erkannt – auch aufgrund der damaligen Marktsituation, und
das betrifft, glaube ich, alle Parteien –, dass Glasfaser zur Daseinsvorsorge
gehört, dass ein Glasfasernetz genauso wie der Kanal, das Stromnetz
und das Straßennetz entscheidend sein wird für einen Wettbewerbsvorteil, den
wir in den Regionen brauchen, und dass es notwendig sein wird, nicht nur die
großen Ballungsgebiete an die Glasfaser anzuschließen, sondern
auch den ländlichen Raum, um eine Wettbewerbsgleichheit der Regionen in
Österreich zu erzielen. (Beifall bei Abgeordneten von ÖVP
und Grünen.)
Was ist dann
passiert? – Dann hatten wir die Situation, dass wir seit den
frühen 1990er-Jahren in Österreich ein liberalisiertes Mobilfunknetz
hatten, das
ein absoluter Vorteil für die
Bürgerinnen und Bürger war. Und dann mit dem Ausbau von
LTE, von 4G war schlussendlich auch schnelles mobiles Internet
da, und das mit einer Ausbreitung, die wir derzeit im 5G-Bereich sehen,
nämlich von 95 Prozent aller Haushalte.
Was hatte das zur
Folge? – Das hatte zur Folge, dass die Notwendigkeit
von schnellerem Internet zu Hause insbesondere in der Zeit vor der Pandemie so
nicht gesehen wurde.
Was aber diese Bundesregierung
und auch die Bundesregierung davor gemacht haben, war, darauf zu reagieren, und
zwar mit der ersten und mit der
zweiten Breitbandmilliarde, weil man gesehen hat: Es kann nicht ewig so weitergehen,
dass man alles der Privatwirtschaft überlässt und dass am Ende
des Tages die Privatwirtschaft nur dort ausbaut, wo es sich im Moment auszahlt,
und dadurch viele weiße Flecken in Österreich übrig bleiben.
Was in den letzten Jahren, seit Ende 2019, gelungen
ist, ist wirklich historisch: Wir konnten die Gigabitabdeckung in
Österreich von 13 Prozent auf
69 Prozent erhöhen. Das heißt, wir haben 56 Prozent aller
österreichischen Haushalte an eine gigabitfähige Internetversorgung
herangeführt.
Was sich aber grundlegend
verändert hat in diesen vier Jahren, sind die Rahmenbedingungen. Vor
vier Jahren waren wir alle narrisch froh, wenn irgendjemand ausgebaut hat. Wir
waren alle narrisch froh, wenn sich irgendjemand für ein Projekt zur
Verfügung gestellt hat. Selbst wenn es gefördert wurde, war
es oft schwierig, Leute zu finden, weil die Nachfrage in der Bevölkerung
nicht da war. Jetzt hat sich diese Situation Gott sei Dank endlich komplett
verändert. Das bedeutet aber auch, dass wir die Rahmenbedingungen
leicht anpassen müssen. Das bedeutet, dass wir uns anschauen müssen,
wer aller verlegt. Das bedeutet, dass wir ganz konkret auch
die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister informieren müssen, wer
verlegt. Das war früher alltäglich.
Mittlerweile haben wir aber das
Problem, dass wir dafür gar nicht die rechtliche Grundlage haben. Aus
diesem Grund begrüße ich diese Initiative sehr. Ich
danke den Regierungsparteien für diese Initiative. Ich danke insgesamt
allen Digitalisierungs- und Breitbandsprechern für die gute
Zusammenarbeit.
Abschließend: Herr Abgeordneter Hoyos! Innsbruck hat eine Gigabitabdeckung von 98 Prozent, da habe ich nicht mehr viel zu tun. – Vielen herzlichen Dank! (Beifall bei Abgeordneten von ÖVP und Grünen. – Abg. Zorba: Danke!)
15.05
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Schnabel. – Bitte sehr.
Abgeordneter
Joachim Schnabel (ÖVP): Herr
Präsident! Geschätzter Herr Staatssekretär! Geschätzter
Herr Minister! Hohes Haus! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Liebe
junge Zuseher oben auf der Zuschauergalerie! Gerade
zu diesem Tagesordnungspunkt möchte ich euch ganz besonders
begrüßen. Ihr seid eine Generation, die mit digitalen
Endgeräten aufgewachsen ist, ihr
seid Digital Natives, und für eure Generation, für euch bauen wir
diese zukunftsfähige Glasfaserinfrastruktur. Herzlich willkommen hier
im Hohen Haus!
(Beifall bei ÖVP und Grünen
sowie bei Abgeordneten von SPÖ und NEOS.)
Der Herr Staatssekretär und auch meine Kollegin, Frau
Himmelbauer, haben schon umfassend ausgeführt, worum es in diesem
Tagesordnungspunkt geht und auch was in den letzten Jahren erfolgreich gelungen
ist. Ich kann das vielleicht jetzt zusammenfassen, und zwar nicht nur
in Zahlen, sondern vielleicht auch im Erzählen, wie es sich in der Praxis
darstellt, wenn man als Region,
als Gemeinde in den Glasfaserausbau geht.
Wir haben gehört, am Anfang der Legislaturperiode waren 13 Prozent der Haushalte an das Breitbandnetz angeschlossen, zurzeit sind es 69 Prozent. Es ist also ein wirklicher High-Speed-Ausbau, der mit beiden Breitbandmilliardenpaketen mittlerweile gelungen ist. Da gilt es aber weiter vorzuarbeiten.
Was ist notwendig, damit wir überhaupt zu den Haushalten einen Glasfaseranschluss hinbekommen? – Wir, die Region Südweststeiermark, 44 Gemeinden, haben uns dazu entschlossen, gemeinschaftlich einen Masterplan zu erstellen, wie dieser Ausbauplan funktionieren kann. Bei einer Kostenanalyse ist herausgekommen, wir hätten, Faktenlage 2020, 413 Millionen Euro benötigt, um diesen Ausbau flächendeckend zu bewerkstelligen.
Da haben wir eine etwas andere Erfahrung als Frau Kollegin
Oberrauner:
Die Gemeinden können einen Breitbandausbau in Einzelorganisation nicht
stemmen. Es braucht den Verbund, es braucht einen größeren
Zusammenschluss zwischen den Ländern, den Gemeinden und dem
Bund, um diesen Ausbau in diesem Ausmaß wirklich flächendeckend
umsetzen zu können.
(Beifall bei Abgeordneten der ÖVP sowie des Abg. Zorba.)
Was ist uns wichtig und weshalb
gibt es diesen Entschließungsantrag? Wir haben jetzt beim letzten, beim dritten
Fördercall gesehen, dass viele zusätzliche, viele neue Player am
Markt sind, die diesen Glasfaserausbau machen können und auch
wollen. Wir haben uns jahrelang gewünscht, dass da privates Kapital
eingesetzt wird, und das ist mittlerweile vorhanden. Was haben wir
aber gesehen? – Dass es da unterschiedliche Prüfanalysen aus
der Vergangenheit gibt, dass allein die wirtschaftliche Prüfung, ob
ein Anbieter befähigt
ist, eine Region großflächig auszubauen, aus unserer Sicht nicht reicht. Es gehört im Zuge der Erstellung der Förderlandkarte genauso eine fachliche und technische Prüfung gemacht, damit ein flächendeckender Ausbau, auch in zeitlichem Kontext gesehen, funktioniert.
Was braucht es dazu aus unserer
Sicht? – Es braucht Sanktionen für die,
die sagen: Wir bauen selbst aus!, und es braucht Sanktionen für die, die
eine Förderung erhalten haben, aber dann nicht ausbauen.
Jetzt kommen wir zurück zu den Gemeinden, denn es sind vor allem die Bürgermeister:innen und die Gemeinderäte, die in Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern stehen und dafür werben, dass es zu einem Glasfaserausbau kommt. Deswegen müssen auch – und das steht auch hier in diesem Entschließungsantrag – entsprechende Kommunikationsformen mit den Gemeinden und den Bürgermeistern gefunden werden, um diesen Glasfaserausbau entsprechend umzusetzen.
Abschließend: Für
die Steiermark, aber auch für die Bundesländer
Kärnten und Burgenland wird es im nächsten Jahr einen Fördercall
in der Höhe von 120 Millionen Euro geben, 90 Millionen davon
sind für die Steiermark vorgesehen. – Danke, Herr
Staatssekretär, dafür, dass das im Zuge des dritten Fördercalls
so funktioniert hat, dass wir hier diese Rahmenbedingungen
so abgeändert haben.
Uns Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in den
Regionen ist es wichtig, dass die dementsprechenden Rahmenbedingungen zeitnah,
in nächster Zeit aufgestellt werden, denn wir wollen keine digitale Kluft
zwischen dem urbanen und dem ländlichen Raum haben, wir wollen
Smartvillages und
Smartcities! – Danke. (Beifall bei der ÖVP und bei
Abgeordneten der Grünen.)
15.09
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gelangt Frau Abgeordnete Erasim. – Bitte sehr.
15.09
Abgeordnete
Melanie Erasim, MSc (SPÖ): Herr
Präsident! Herr Staatssekretär! Herr Bundesminister! Sehr geehrte
Zuseherinnen und Zuseher! Ich denke,
ich muss da schon etwas zurechtrücken, denn wenn man meinen Vorredner:innen
seitens der Regierungsfraktionen zugehört hat, würde man ja glauben,
dass hier wirklich etwas beschlossen wird, also eine Maßnahme, eine
Initiative – ganz das Gegenteil
ist der Fall: Sie geben sich selbst Hausaufgaben in Form
von Entschließungsanträgen, innerhalb der Regierung
miteinander zu reden. Als Bürgerin würde ich es eigentlich als
selbstverständlich erachten, dass Sie
Ihre Arbeit machen und sich nicht hier selbst Hausaufgaben mittels Entschließungsanträgen
geben. (Beifall bei der SPÖ.)
Natürlich muss ich all dem, was über den
Breitbandausbau gesagt wurde,
der Wichtigkeit eines reibungslosen Breitbandausbaus zustimmen. Ich würde
sogar noch viel weiter gehen und behaupten, dass eine leistungsfähige
Kommunikationsinfrastruktur in Zukunft eine der wichtigsten Lebensadern überhaupt
sein wird. Bei vielen wichtigen Lebensadern haben wir es als Sozialdemokratie
durch kluge politische Entscheidungen in der Vergangenheit geschafft,
zur absoluten Weltspitze zu gehören. Das haben wir beim Zugang zu
Trinkwasser geschafft, aber zum Beispiel auch in puncto Bahnland Österreich.
Beim Breitbandausbau sieht das leider noch anders aus,
da gehören wir alles andere als zur Weltspitze, und da jetzt mit Entschließungsanträgen
zu arbeiten ist, so finde ich, nicht das adäquate Mittel, wiewohl wir dem
Antrag zustimmen werden.
Viel wichtiger wäre, die Frage zu stellen: Was ist mit
den Mitteln aus dem Recoveryfund? Was wird von dort abgeholt? Holt
Österreich alles ab,
was es abzuholen gibt, um hier finanziell bestmöglich aufgestellt zu sein?
(Beifall bei der SPÖ.)
Dieser Nichtantrag – für mich ist ja das ein Nichtantrag –
ist symptomatisch
für die Mut- und Visionslosigkeit dieser Bundesregierung. Der
gestrige Auftritt von Bundesminister Polaschek, der ja auch für Forschung
zuständig ist,
war eine Chuzpe sondergleichen. So etwas Unambitioniertes habe ich schon lange nicht gesehen, aber ich nehme zur Kenntnis, dass das anscheinend jetzt bis zu den nächsten Wahlen so weitergehen wird.
Anstatt sich um wichtige Themen zu kümmern, werden
tolle Anträge wie
zum Beispiel von den Kolleginnen Oberrauner und Kucharowits wieder und wieder
und wieder vertagt, wichtige Themen wie der Antrag betreffend „Bereitstellung
von höheren finanziellen Mitteln für die
KI-Grundlagenforschung“. Warum treten Sie hier nicht in Gespräche
mit uns ein? Die Hände sind gereicht, die Anträge liegen auf dem
Tisch. Die dringend notwendigen Bildungsreformen sind anscheinend genauso
verschlafen worden wie die Regelung
des Umganges mit künstlicher Intelligenz. Werden Sie bitte munter, bevor
es zu spät ist! – Danke schön. (Beifall bei der
SPÖ.)
15.13
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Oxonitsch. – Bitte.
Abgeordneter
Christian Oxonitsch (SPÖ): Sehr
geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Staatssekretär! Sehr
geehrter Herr Minister! Ich kann ja
fast nahtlos anschließen. Ich glaube, wir sind uns alle einig
darüber – und das ist ja aus allen Redebeiträgen auch
hervorgegangen –, wie wichtig und wesentlich der
Breitbandausbau ist. Da freue ich mich natürlich auch über das
Bekenntnis zur Daseinsvorsorge, also durchaus auch ein bisschen über
die Selbstkritik, die es gegeben hat, denn gerade von unserer Seite
wurde ja immer wieder ganz klar formuliert, dass das nicht nur der
Privatwirtschaft überlassen
werden kann. Da hat es schon zahlreiche Initiativen gegeben, aber gut, man kann
auch gescheiter werden. Ich glaube, das ist immer ein Anspruch, den wir
letztendlich hier haben, aber ich tue mir ein bisschen schwer, zu glauben, dass
dieses Bekenntnis, dieses Engagement die
Grundlage war, dass man gesagt
hat, da brauchen wir diesen Antrag.
Warum gibt es diesen Antrag?
Machen wir uns doch nichts vor: Man ist vor einer Ausschusssitzung gestanden,
hat eine Tagesordnung gehabt und hat festgestellt: Ups, wir vertagen
alles, wir haben noch keine eigene Initiative eingebracht. Wer bastelt
schnell was? – Das war der einzige Grund, warum
es den Antrag gibt. (Beifall bei der SPÖ.)
Man kann es sich ja anschauen.
Gestern hat ein Kollege von der ÖVP gesagt, ich bin ja noch nicht so lange
hier, aber zumindest in den einigen Monaten,
muss ich sagen, habe ich so einen Antrag eigentlich noch nicht erlebt, bei dem
man dann noch die Formfehler schnell ausbessern muss, damit man ihn
überhaupt noch irgendwie hineinbringt. Da ist noch handschriftlich
ausgebessert worden. Druckfehler können passieren, kein Problem, aber wir
sehen es
auch an der heutigen Tagesordnung: Es ist die einzige Initiative, die es aus
dem Bereich Innovation, Forschung, Digitalisierung gibt. Also das kann ja nicht
wahr sein. (Beifall bei der SPÖ.)
Noch einmal: Wir befinden uns
im Bereich Forschung, Innovation, Digitalisierung. Und dann fordert man in
einem Antrag die Bundesregierung auf,
„zu prüfen, [...] wie Gemeinden zum Zeitpunkt einer
Förderzusage automatisch informiert werden können, um die Entwicklung
der Projekte zu beschleunigen“. – Also ein Briefkuvert
und E-Mail gibt es schon. Ich weiß nicht, was man da jetzt noch
Besonderes entwickeln muss. (Staatssekretär Tursky: Datenschutz gibt
es aber auch!) – Genau, auf das habe ich jetzt gewartet. Jetzt
baut man seit fünf Jahren Breitband aus, und nach fünf Jahren kommt
man drauf:
Boah, wenn wir denen jetzt etwas sagen wollen, dann müssen wir es uns
datenschutzrechtlich anschauen. Also von Ambition kann man da nicht
sprechen.
Dieser Antrag (Abg. Krainer: Ist peinlich!)
wird trotz alledem inhaltlich von
uns beurteilt. Man kann nicht dagegen sein, wir stimmen ihm sogar zu. Da gehen
wir einen anderen Weg als die Regierung, die schaut sich nämlich unsere
Anträge gar nicht an und vertagt einfach. Wir gehen den Weg und sagen:
Okay, die Intention passt – auch wenn ich nicht verstehe, warum man
fünf Jahre
braucht, um auf solche Ideen zu kommen, die sich in diesem Antrag wiederfinden. Es ist peinlich, aber sei’s drum. – Danke. (Beifall bei der SPÖ.)
15.15
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Schmidt. – Bitte.
Abgeordnete MMag. Michaela Schmidt
(SPÖ): Sehr geehrter Herr
Präsident! Herr Staatssekretär! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Werte
Zuseherinnen und Zuseher! Ich möchte die Gelegenheit auch
noch nutzen und das Ganze in einen breiteren Kontext stellen, weil es, wie mein
Kollege schon gesagt
hat, eigentlich um die Fragestellung im Bereich Forschung, Innovation und Digitalisierung
geht. Der Breitbandausbau ist halt das Einzige, was es hier ins
Plenum geschafft hat.
Es ist unbestritten, dass
Österreich bei der Forschungsquote im europäischen Spitzenfeld liegt.
Seit mehr als zehn Jahren erfüllen wir das bekannte
3-Prozent-Ziel. Ich glaube, es ist überparteilicher Konsens, dass das gut,
wichtig und notwendig ist, weil Digitalisierung, Forschung und Innovation
österreichische Unternehmen und natürlich auch gut bezahlte
Arbeitsplätze sichern.
Das Problem ist allerdings,
dass Österreich zwar überdurchschnittlich
hohe Forschungsausgaben hat, die Wirksamkeit dieser Ausgaben – das
ist heute auch schon erwähnt worden – aber weiterhin zu
wünschen übrig lässt. Der nachhinkende Breitbandausbau ist eine
der Ursachen dafür, warum wir da nicht weiterkommen, warum wir immer noch
das selbst auferlegte Ziel, Innovationleader zu werden, nicht erfüllen.
Damit sich das wirklich ändert, brauchen wir vor allem
in drei Bereichen endlich größere Maßnahmen. Zuallererst, und
das ist das, was hier diskutiert
wurde, müssen wir beim Glasfaserausbau endlich in die Gänge kommen.
Das ist die Basis für Digitalisierung, die Basis für KI. Ohne das
wird es nicht
gehen. Österreich war im Vorjahr mit knapp 45 Prozent in Bezug auf
die Glasfaserkabelnetzabdeckung noch immer unter den europäischen
Schlusslichtern. (Abg. Himmelbauer: 69 Prozent der
Haushalte!) – Das ist der Breitbandausbau, nicht der
Glasfaserausbau! Aber wir können ja den Unterschied
noch diskutieren. (Beifall bei der SPÖ.)
Zweitens muss die Bundesregierung – auch das ist
kurz erwähnt worden – beim Thema künstliche Intelligenz
endlich etwas tun, denn auch da sind wir –
da darf ich den Ausschussexperten Klaus Schuch zitieren – zweifellos
mehr „Mitläufer“ als Vorreiter. Das zeigt auch der Blick
auf die Zahlen: Bei den finanziellen Mitteln für die
KI-Grundlagenforschung können wir mit den
anderen europäischen Ländern schlichtweg nicht mithalten. Zum
Vergleich: In Schweden werden in diesen Bereich 500 Millionen Euro
investiert, in den Niederlanden waren es 2 Milliarden Euro. Und wie schaut
es in Österreich aus? – Heuer geben wir 7 Millionen Euro
für die KI-Grundlagenforschung aus.
Das ist ungefähr so viel, wie Uganda und Mexiko dafür ausgeben. Das
ist eindeutig zu wenig.
Der dritte Bereich, der noch nicht angesprochen wurde, aber
der einer
der Gründe ist, warum wir bei den Innovationrankings immer abfallen, ist
der Frauenanteil, der Digital Gendergap, den wir endlich schließen
müssen.
Der Frauenanteil im Bereich Forschung und Wissenschaft ist immer noch sehr
niedrig. Im IKT-Bereich liegt er bei rund 20 Prozent und er war in den Vorjahren sogar
rückläufig. Dieser niedrige Frauenanteil ist nicht nur
gesellschaftlich problematisch, er bringt uns auch in diesen Innovationrankings
immer
den - - (Abg. Schnabel: Wir haben aufgeholt, von acht auf
sechs!) Der Frauenanteil in der IKT-Branche war in den Vorjahren
rückläufig – rückläufig! (Beifall
bei der SPÖ. – Weiterer Zwischenruf des Abg. Schnabel.)
Ich weiß nicht, welche Zahlen Sie anschauen, laut meinen Zahlen ist er rückläufig. Das ist natürlich nicht nur ein gesellschaftspolitisches Problem, sondern es ist vor allen Dingen auch ein Problem für die Unternehmen, es ist ein Problem für die Wirtschaft. Hier darf ich die Wirtschaftskammer Österreich zitieren,
die ausgerechnet hat, dass durch diesen niedrigen Anteil die Fachkräfte in
der IT fehlen und dadurch ein Wertschöpfungsverlust von knapp
5 Milliarden Euro entsteht.
Trotzdem werden wir natürlich diesem
Entschließungsantrag betreffend „die Sicherstellung des
reibungslosen Breitbandausbaus“, mit dem es zu kleinen Verbesserungen
kommen soll, zustimmen. Wir würden den Vertreter:innen der
Regierungsparteien aber gleichzeitig dringend dazu raten, unsere im Ausschuss
immer wieder vertagten Anträge zu den Themen KI und
Digital Gendergap nicht mehr weiter zu vertagen, sondern ihnen endlich zuzustimmen. –
Vielen Dank. (Beifall bei der SPÖ.)
15.20
Präsident
Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort ist dazu
niemand mehr
gemeldet. Die Debatte ist damit geschlossen.
Wünscht die Berichterstatterin ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall.
Wir kommen nun zur Abstimmung
über die dem Ausschussbericht 2333 der Beilagen angeschlossene Entschließung
betreffend „die Sicherstellung
des reibungslosen Breitbandausbaus“.
Wer dafür ist, den darf ich um ein dementsprechendes Zeichen ersuchen. – Das ist mit Mehrheit angenommen. (352/E)
Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie und Energie über die Regierungsvorlage (2312 d.B.): Bundesgesetz über die höhere berufliche Bildung (HBB-Gesetz) (2348 d.B.)
12. Punkt
Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie und Energie über die Regierungsvorlage (2246 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Emissionsschutzgesetz für Kesselanlagen geändert wird (2347 d.B.)
Präsident
Mag. Wolfgang Sobotka: Wir kommen nun zu
den Punkten 11 und 12 der Tagesordnung, über welche die Debatten
unter einem durchgeführt
werden.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Kaufmann. Bei ihr steht das Wort. – Frau Abgeordnete, bitte sehr.
Abgeordnete
Martina Kaufmann, MMSc BA (ÖVP):
Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Werte Kolleginnen und
Kollegen hier im Hohen Haus! Liebe Zuseherinnen und Zuseher auf der
Besuchergalerie und zu Hause! In Österreich sind wir stolz auf
unsere berufliche Ausbildung – zu Recht, denn unsere berufliche
Ausbildung, die Lehre, wird in vielen Ländern kopiert. In Österreich
haben 1,6 Millionen Menschen eine Lehre absolviert. 108 000 junge
Menschen befinden sich aktuell in solch einer Lehrlingsausbildung. Das ist
insofern wichtig, als die Lehre das Fundament unserer Fachkräfteausbildung
in Österreich ist, aber nicht nur das alleine, sondern auch unseres
gesamten Wirtschaftssystems. So stellen wir sicher, dass
wir in Zukunft gut ausgebildete Fachkräfte für unsere Unternehmen
haben. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
Mit dem vorliegenden HBB-Gesetz, dem Bundesgesetz über
die höhere berufliche Bildung, ermöglichen wir es Menschen in Lehrberufen,
bei denen es heute noch nicht möglich ist, eine
Befähigungsprüfung oder eine Meisterprüfung im
Anschluss draufzusetzen und damit die Karriereleiter weiter hinaufzusteigen.
Wir schaffen also Ausbildungen und ermöglichen jenen, bei denen das heute
wie gesagt noch nicht so eindeutig möglich ist, diese
auch zu absolvieren.
Geben Sie mir kurz die Gelegenheit, ein Beispiel zu geben – was heißt das ganz konkret? – Wenn man zum Beispiel heute den Lehrberuf als Einzelhandelskauffrau oder -mann macht, dann hat man wahrscheinlich mit 18 die LAP und ist
ausgelernt, wie das so schön in Österreich heißt, und hat keine Weiterbildungsmöglichkeit. Das Gesetz gibt die Grundlage dafür, dass es möglich ist, zum Beispiel eine Regionalmanagerausbildung draufzusetzen. Damit hat man in seinem Beruf die Möglichkeit, direkt eine Ausbildung weiterzumachen.
Sehr geehrte Damen und Herren,
das ist ein richtiger Paradigmenwechsel, den wir herbeiführen, weil wir
die Berufsausbildung stärken, klare Karrieremöglichkeiten in
dieser Berufsausbildung eröffnen und nicht vorgeben, dass es notwendig
ist, weiter auf eine Universität oder auf eine Fachhochschule
zu gehen; das ist möglich, definitiv. Es ist auch wichtig und richtig so,
dass es diese Durchlässigkeit in unserem Bildungssystem gibt. Es ist aber
auch
eine klare Aufwertung und ein Bekenntnis zu unserer Lehre in Österreich
und zu den Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Lehre. (Beifall bei der
ÖVP.)
Was haben die Unternehmerinnen und Unternehmer davon? – Sie haben davon, dass sie gut ausgebildete Fachkräfte haben, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine international anerkannte Ausbildung haben, somit auch an Ausschreibungen teilnehmen können, aber natürlich auch insgesamt wettbewerbsfähig sind, weil sie nachweisen können, dass sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem bestimmten Level im NQR haben.
Hinsichtlich der
Meisterprüfung haben wir es schon vor einiger Zeit geschafft, dass
diese in der beruflichen Ausbildung auf dem gleichen Level wie der Bachelor in
der schulischen und universitären Ausbildung ist. Auch die HBB
wird auf der gleichen Ebene des Bachelors sein. Damit haben wir eine gleichwertige
Ausbildung, aber eine nicht gleichartige Ausbildung. So gelingt es uns
wirklich, den Paradigmenwechsel zu schaffen, sodass man die Karriereleiter in
seinem Beruf hinaufsteigen kann.
Sehr geehrte Damen und Herren, es ist ein langer Weg, der in
einzelnen Verhandlungen hinter uns liegt, und ich möchte das an dieser
Stelle mit einem großen Danke zum Ausdruck bringen. Viele Stakeholder
waren in den
letzten Jahren involviert, haben mitgearbeitet. Rudi Lichtmannecker von der
Wirtschaftskammer – er ist heute mit dabei, er sitzt auf der
Galerie –
hat das vorangetrieben, weil er genau weiß, wie wichtig es für junge
Menschen ist, eine gute Ausbildungsperspektive zu haben, aber natürlich
auch für
uns Unternehmerinnen und Unternehmer. Natürlich haben sich auch alle Sozialpartner,
die involviert waren, wirklich ins Zeug gelegt, um eine gute Ausbildung, eine
gute Perspektive zu schaffen.
Danke auch an das Unterrichtsministerium, das
Wirtschaftsministerium mit Alex Hölbl, an alle, die das mitverhandelt
haben, nicht zuletzt natürlich auch an
den Koalitionspartner, an Süleyman Zorba und Eva Blimlinger. Ich
weiß, wir haben hart über gewisse einzelne Punkte diskutiert,
aber ich glaube, wir haben am Ende des Tages ein wirklich
herausragendes Gesetz herausgebracht, bei dem wir erst in Zukunft sehen werden,
welche gute Ausbildungen es geben
wird.
Ein gutes Beispiel dafür, was möglich sein wird, kommt aus dem Bereich des Klimaschutzes: Die Rauchfangkehrer sind schon mit einigen Ideen vorangegangen. Es wird möglich sein, nach der Lehrlingsausbildung zum Rauchfangkehrer noch den Energieeffizienztechniker als HBB draufzusetzen und vielleicht erst später den Rauchfangkehrermeister zu machen.
Ich glaube, in genau solchen Bereichen ist es besonders
wichtig, dass wir neue Ausbildungen schaffen, denn – und davon bin
ich überzeugt, werte Kolleginnen und Kollegen –: Bildungspolitik
und Wirtschaftspolitik sind Zukunftspolitik und da haben wir für die
Zukunft vieles und Gutes zu gestalten. –
Danke. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
15.26
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Matznetter. – Bitte sehr.
Abgeordneter Dr. Christoph Matznetter (SPÖ): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Zuhörerinnen und Zuhörer!
Zuseher und Zuseherinnen! Ich kann den ersten Teil zu den beiden Gesetzesvorschlägen relativ kurz machen. Kollegin Kaufmann hat uns das HBB-G ja schon in extenso dargelegt. Es stimmt, wir dürfen die Lehrausbildung keinesfalls als bildungspolitische Sackgasse belassen, sondern es muss für die jungen Leute die Chance geben, danach jede Form höherer Ausbildung in Anspruch zu nehmen. In diesem Sinn werden wir diesem Gesetz zustimmen.
Das zweite Gesetz –
das sind hauptsächlich Umsetzungsvorschriften
der Europäischen Union, was die Emissionen der Kesselanlagen
betrifft – findet ebenfalls unsere Zustimmung.
Was ich mehr bedauere, Herr
Bundesminister, ist, dass wir als Land in einer Situation sind, in
der wir noch viel dringendere und viel wichtigere Tätigkeiten der
Regierung und des Gesetzgebers bräuchten. Wir beklagen uns seit
bald eineinhalb Jahren, dass wir die höchste Inflation in Westeuropa
haben. (Abg. Meinl-Reisinger: Auch der
„Economist“ ...!) Jetzt haben wir drei Quartale Rezession hinter
uns, ich fürchte, wir werden ins vierte hineinrutschen. Sie haben bisher
immer gesagt: Aber zum Glück ist die Arbeitslosigkeit nicht gestiegen. – Diese
Haltung ist leider nicht mehr sachgerecht.
Wenn man den Befürchtungen, was die Pleitewelle betrifft, glaubt, steht uns nicht nur bevor, dass wir die schlechteste Performance während der Inflation, eine schrumpfende Wirtschaft und eine Pleitewelle haben, sondern dann auch eine weiter ansteigende Arbeitslosigkeit.
Ich glaube, dass das ein Mix an Problemen in der
Wirtschaftspolitik ist, der
mehr als das HBB-G und das Kesselanlagenemissionsgesetz erfordert. Ich glaube,
dass rigide Maßnahmen notwendig wären. Wir haben heute schon
einen Teil im Zuge der Debatte über Umsatzsteueränderungen für
PV-Anlagen diskutiert. Es sind zum Teil absurde Positionen der
Regierungsparteien
genannt worden wie: Wir wollten die Preise bei Grundnahrungsmitteln senken, das
konnten wir nicht machen, aber wir können es bei PV-Anlagen machen,
denn dort ist es ja eine Förderung. – Also das ist zumindest einmal, was das intellektuelle Niveau betrifft, hinterfragenswert.
Wir haben festgestellt, man könnte mit einer Fülle
von Maßnahmen handeln. Man könnte ordnungspolitisch eingreifen. Wir
könnten schon lang eingefrorene Mieten haben. Wir hätten einen
Finanzausgleich machen können, bei
dem wir den Gemeinden, die verhindern wollen, dass sie wegen der Knappheit der
Gelder ihre Gebühren erhöhen müssen, gesagt hätten: Du
kriegst
zusätzliche Mittel, wenn du eine Abgangsgemeinde bist und die
Gebühren
nicht erhöhst. (Zwischenruf der Abg. Baumgartner.)
Wir hätten im Bereich der Energiepreise eingreifen können. Schauen Sie sich das Beispiel auf der Iberischen Halbinsel an! Wir hätten bei den Sparbuchzinsen eingreifen können. Schauen Sie sich Frankreich an (Abg. Egger: Das ist ja die Rede vom Lercher von vorhin!), wo man bis 30 000 Euro Einlage einen garantierten vernünftigen Zinssatz zulasten der Bankguthaben bekommt!
All das, Kollege Egger, hätten wir machen können.
Und was ist gekommen? – Niente. (Zwischenruf bei der ÖVP.)
Wir lassen Österreich in die Richtung weiterlaufen: höchste
Inflation in Westeuropa, drei Quartale Rezession, ansteigende Arbeitslosigkeit.
Ehrlich gesagt: Zum Glück zwingt uns die Verfassung zu Neuwahlen, denn mit
dieser Regierung wird das alles nichts mehr. – Danke. (Beifall
bei der SPÖ. – Ruf bei der ÖVP: So ein Populismus,
Herr Matznetter!)
15.30
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Maximilian Linder. – Bitte.
Abgeordneter Maximilian Linder (FPÖ): Herr Präsident! Herr Minister! Geschätzte Kolleginnen! Geschätzte Kollegen! Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer! Der Änderung des Emissionsschutzgesetzes für Kesselanlagen werden wir zustimmen, aber auch dem Gesetzentwurf für höhere Bildung.
Der Fachkräftemangel ist,
glaube ich, jedem von uns sehr bekannt, und wir wissen, wie schwierig es
ist, heute gute Handwerker zu bekommen, Leute zu bekommen, die bereit sind, in
den Firmen handwerkliche Arbeiten zu machen. Leider hat das Handwerk ein sehr
negativ behaftetes Image. Viele Menschen glauben, ihren Kindern muss
es besser gehen, die müssen in die Schule gehen, die müssen
studieren, auch wenn sie oft dafür nicht geeignet oder
noch nicht reif genug sind. Viele Eltern haben dann ein Aha-Erlebnis, wenn ihre
Kinder ein Studium oder eine Schule abbrechen, einen handwerklichen Beruf erlernen
und dort plötzlich aufblühen und zeigen, dass auch das sehr wohl
Chancen bietet.
Mit dieser Ausbildung und der
Möglichkeit, sich da weiterzubilden, wird
das, glaube ich, noch verstärkt und diese Möglichkeit wirklich noch
unterstützt. Zum einen schafft es berufliche Aufstiegsmöglichkeiten,
zum anderen
auch gesellschaftliche Anerkennung, wenn man einen Abschluss hat, wenn
man eine zusätzliche Prüfung hat und sich weiterentwickeln kann.
Ein kleiner Wermutstropfen ist für uns, dass die Prüfungsgebühren nach wie vor selber zu bezahlen sind. Wir haben es gerade jetzt bei der Meisterprüfung gesehen: Es hat sehr, sehr lange gedauert. Wir Freiheitliche haben die Forderungen sehr lange einbringen müssen, damit endlich auch die Prüfungsgebühren vom Staat übernommen und getragen werden. Ich bin der Meinung, dass das auch in diesem Fall so geregelt gehört, dass die Prüfungsgebühren nicht vom Ausgebildeten zu zahlen sind.
Grundsätzlich gibt es unsere Zustimmung zu diesem
Gesetzentwurf, wir würden uns aber sehr freuen, wenn sehr bald auch die
Gebühren übernommen
werden. (Ruf bei der ÖVP – in Richtung
FPÖ –: Hallo?! – Rufe bei der SPÖ –
in Richtung FPÖ –:
Hallo?! Applaus! – Beifall bei der FPÖ. –
Zwischenrufe bei der ÖVP.)
15.32
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Blimlinger. – Bitte.
15.32
Abgeordnete
Mag. Eva Blimlinger (Grüne): Sehr
geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Es freut mich,
dass ich heute zu einem
zweiten Lieblingsgesetz sprechen kann. Das erste war Spendenbegünstigung,
das zweite ist das HBB-Gesetz – höhere berufliche Bildung. Es
ist ja in Österreich die Situation so, dass wir eine private und eine
berufsbezogene Weiterbildung haben. Im privaten Bereich ist es im Wesentlichen
die Erwachsenenbildung, und da sind die Volkshochschulen sozusagen an der
Spitze der Trägerschaft, und im beruflichen sind es BFI, Wifi et cetera.
Bis dato gab es keine formalisierte Situation. Das HBB-Gesetz ist – wie meine Kollegin Kaufmann schon gesagt hat – tatsächlich ein grundlegender Paradigmenwechsel, nämlich hin zu diesen formalisierten Abschlüssen und auch zur Einreihung in den sogenannten Nationalen Qualifikationsrahmen. Das ist sozusagen ein ganz wichtiger Schritt, weil diese beiden Teile, die höhere hochschulische Bildung – das ist der andere Teil, den wir ja schon vor eineinhalb Jahren beschlossen haben – und die höhere berufliche Bildung, nun gleichberechtigt nebeneinander stehen.
Es sind nicht nur die Lehrlinge, die dann alle
Möglichkeiten der Weiterbildung haben
sollen, sondern auch jene, die vielleicht nicht einmal einen Lehrabschluss, aber
schon eine jahrelange berufliche Praxis haben, die es vielleicht während
der Pubertät oder in jüngeren Jahren nicht so recht geschafft
haben, die Abbrecher waren, die aber dann zu einem späteren Zeitpunkt sehr
gerne eine Weiterbildung machen wollen. Mit diesem Gesetz schaffen
wir die Möglichkeit, dass das passiert. Das heißt, dass die
Zugänge zu formalisierter Weiterbildung festgesetzt werden, und das
ist tatsächlich eine absolute Neuerung und – wie ich
meine – ein ganz wesentlicher Punkt nicht nur für die
österreichische Wirtschaft, sondern tatsächlich für die gesamte
österreichische Gesellschaft.
Was mir in diesem Zusammenhang wichtig ist, ist, dass diese Qualifikationen zum Teil neu entwickelt und natürlich auch immer weiter evaluiert und
begleitet werden und dass man schaut, wie sich die Entwicklung der beruflichen Situation natürlich auch in diesen Weiterbildungssituationen widerspiegelt.
Das heißt: Ich bitte
wirklich um eine breite Zustimmung, weil ich denke, dass man damit
ungefähr 3,5 Millionen Österreicherinnen und Österreichern,
die in diese Gruppe fallen würden, die Möglichkeit zu beruflichem
Erfolg, zur beruflichen Weiterbildung, zu Qualifikationen bietet und ihnen
damit
tatsächlich ein besseres Leben ermöglicht.
In diesem Sinne bin ich im Übrigen leider immer noch der Meinung: Bring them home now! (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
15.35
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Da bin ich auch Ihrer Meinung.
Abgeordneter Shetty ist der Nächste. – Bitte sehr, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Mag. Yannick Shetty (NEOS): Herr Präsident! Sehr geehrter Herr
Minister! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuseherinnen!
Liebe Zuseher! Ich spreche zum Tagesordnungspunkt Änderung des Bundesgesetzes
über die höhere berufliche Bildung. Ich möchte vielleicht
eingangs
sagen, dass wir NEOS als Bildungspartei ja immer klar gesagt haben, dass die berufliche
und die akademische Bildung gleichrangig sind. Sie sind nicht gleichartig, aber
sie sind gleichwertig, und deswegen begrüßen wir auch, dass
wir das heute so beschließen, weil da dieser Leitgedanke fortgesetzt
wird, dass kein Abschluss ohne Anschluss stattfinden soll, und dass es jetzt
auch möglich sein wird, im Anschluss an die Lehrabschlussprüfung
weitere Bildungsabschlüsse zu machen, auch dann, wenn kein
Meisterabschluss vorliegt. – Das ist gut, und deswegen stimmen wir
diesem Gesetzentwurf auch zu.
(Beifall bei den NEOS.)
Ich möchte an dieser
Stelle aber auch etwas sagen: Ich werde nie müde, zu betonen, dass
Lehrlinge, dass junge Menschen, die eine Lehre machen, Berufsschülerinnen
und Berufsschüler in unserem System immer noch als Schüler und
Schülerinnen zweiter Klasse behandelt werden, und das ist unfair. Es ist
gesellschaftlich gesehen auch dumm, weil wir wissen, wenn wir durch eine andere
Brille auf diese Thematik schauen, dass der Fachkräftemangel von
heute der Lehrlingsmangel von gestern war. Wir brauchen deswegen dringend mehr
junge Menschen, die eine Lehre machen, und nicht weniger. Deswegen sollten
wir beispielsweise auch über andere Maßnahmen diskutieren.
Liebe Regierungsfraktionen,
vielleicht nehmen Sie das ja auch als Anlass, um beispielsweise
Berufsorientierung stärker in den Mittelschulen zu verankern,
aber auch grundsätzlich in der Unterstufe. Es sollte so sein, dass jeder
junge Mensch im Alter von 14, 15 Jahren sich einmal umfassend damit
befasst hat, welche Möglichkeiten denn die Arbeitswelt bietet, welche
Ausbildungsmöglichkeiten es gibt, und nicht starr nur eine Sache
reingehämmert bekommt, weshalb sehr viele dann nur über Umwege
in die Lehre kommen – zuerst die HAK machen, die HTL
machen, abbrechen und dann in die Lehre gehen. Das sollten wir verhindern, weil
das doch auch verlorene Lebenszeit ist.
Wir sollten deswegen die Lehre zur Priorität machen.
Ich glaube, heute ist wieder ein guter Anlass, das zu
betonen. – Vielen Dank. (Beifall bei den NEOS
sowie des Abg. Schallmeiner.)
15.38
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesminister Kocher, den ich auch herzlich begrüße; ich habe das zuerst übersehen, Entschuldigung. – Bitte.
Bundesminister
für Arbeit und Wirtschaft Mag. Dr. Martin Kocher: Herr Präsident! Werte Abgeordnete!
Sehr geehrte Damen und Herren! Hohes Haus!
Ich möchte in aller gebotenen Kürze doch ein paar Worte zur
höheren beruflichen Bildung sagen, weil ich glaube, dass da im
Berufsbildungsbereich
die größte Reform seit etwa 30 Jahren passiert, und ich mich
sehr freue, dass die grundsätzlichen Ziele unterstützt werden.
Es gibt derzeit 108 000 Lehrlinge in
Österreich. Etwa 40 Prozent eines Altersjahrgangs gehen in die Lehre,
103 000 davon in die betriebliche Lehre. Wir werden auf der ganzen Welt um
diese duale Ausbildung beneidet. Es gibt
wenige Staaten, die ähnliche Systeme haben. Wir haben mit den verschiedensten
Ländern der Welt Abkommen geschlossen, die wir im Aufbau von
dualen Ausbildungssystemen unterstützen – von den USA bis nach
Indonesien.
Bisher war es eben so, dass im Bereich der Berufsbildung
für viele der
etwa 230 Lehrberufe nach dem Abschluss der Lehre keine weiteren
anerkannten Qualifizierungsschritte mehr möglich waren. Es gibt
ungefähr 120 Meister-
und Befähigungsprüfungen. Das
heißt, für viele gab es keine Möglichkeit mehr, sich im Rahmen des Qualifikationsrahmens formell
anerkannt weiterzubilden.
Mit dem Gesetz, das heute beschlossen wird, wird genau diese
Möglichkeit geschaffen. Es wird in bewährter Art und Weise den
Sozialpartnern, den Ministerien die Befüllung der Inhalte in Verordnungen überantwortet.
Damit können eben – wie schon genannt – zum Beispiel
Dachdecker:innen zu Energieeffizienztechniker:innen weitergebildet werden oder
Rauchfangkehrerinnen und Rauchfangkehrer auch in diesem Bereich
weitergebildet
werden. Ich halte das für eine sehr gute Möglichkeit. Die Lehre ist
keine Sackgasse, sie ist eine der besten Ausbildungsformen.
Ich bedanke mich bei dieser Gelegenheit bei allen, die
mitgearbeitet haben:
bei den Sozialpartnern, beim Bildungsressort, bei allen Institutionen.
Wir brauchen in den nächsten Jahren eine Befüllung dieser
Inhalte – qualitätsgesichert, zertifiziert –,
um eben neue Chancen für viele junge Menschen,
die diese Chancen nutzen werden, aufzuzeigen. Und wir brauchen die
Fachkräfte aufgrund der Demografie noch viel stärker als in den
letzten Jahren. Ich
glaube, es wird eine Blütezeit der Lehre und der Berufsausbildung werden. Vielen Dank für die Unterstützung. (Beifall bei der ÖVP sowie der Abg. Maurer.)
15.40
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Holzner. – Bitte.
Abgeordnete
Dipl.-Ing. Andrea Holzner (ÖVP):
Herr Präsident! Sehr geehrter Minister! Geschätzte Kolleginnen und
Kollegen! Werte Zuseherinnen
und Zuseher! Der Herr Arbeitsminister hat es schon gesagt: Mit diesem Gesetz
zur höheren beruflichen Bildung stehen wir vor der größten
Innovation im Bildungssystem seit der Einführung der
Fachhochschulen vor 30 Jahren.
Die Bundesregierung hat bereits im Regierungsprogramm
bekundet, das Ansehen der Lehre und der berufspraktischen Ausbildung zu heben.
Einige Schritte wurden schon umgesetzt: die Einführung des Meistertitels,
der Entfall der Gebühren für die Meisterprüfung.
Heute, mit diesem Gesetz zur höheren beruflichen
Bildung, kurz HBB genannt, sprechen wir die rund 1,6 Millionen
Österreicher:innen an, die eine abgeschlossene Lehre als
höchsten Bildungsabschluss aufweisen, und die
rund 870 000 Personen, die nach einem Pflichtschulabschluss eine
mehrjährige berufliche Erfahrung
erworben haben. Bildung ermächtigt, die eigene Persönlichkeit
zu entwickeln, Bildung ermächtigt, die eigenen Talente zu entfalten, und
Bildung ermächtigt eine ganze Gesellschaft, die sich stellenden Herausforderungen
zu bewältigen.
Wie und worauf bereiten nun HBB-Qualifikationen vor? – HBB-Qualifikationen bereiten berufstätige Personen auf Leitungsaufgaben und spezialisierte fachliche Tätigkeiten in den Unternehmen vor. Und ganz wichtig: Sie werden transparent im Nationalen Qualifikationsrahmen eingestuft. Diese Qualifikationen sind dann im nationalen, europäischen und teilweise auch im internationalen Kontext vergleichbar.
Ein paar Beispiele wurden schon von Kollegin Kaufmann und dem Herrn Arbeitsminister genannt: zum Beispiel aufbauend auf einen Servicetechniker die HBB-Qualifikation technischer Projektleiter oder für einen Rauchfangkehrer die Qualifikation zum Energieeffizienzberater, zur Energieeffizienzberaterin.
Mitarbeiter mit Fachpraxis sollen sich also das Know-how zum
Beispiel für
die Bewältigung der digitalen und ökologischen Transformation
aneignen und entsprechende Karrierewege einschlagen können. Diese
HBB-Qualifikationen bis zum höheren Fachdiplom werden in die
Stufen fünf bis sieben eingeteilt.
Wieder ein Beispiel: Der Meister ist im Nationalen
Qualifikationsrahmen
auf Stufe sechs wie ein Bachelor eingestuft. Das heißt, ein Meister auf
fachpraktischer Ebene ist gleichwertig
einem Bachelor auf der akademischen Ebene.
Ich glaube, es wird ein einstimmiger Beschluss. Ich freue
mich darauf. Nun heißt es, die Ärmel für die Entwicklung dieser
praxisorientierten Angebote aufzukrempeln (Beifall bei der ÖVP
sowie der Abgeordneten Litschauer und Maurer), denn der
Bedarf an höher qualifizierten Fachkräften mit Leitungsmanagementfähigkeiten
und Schlüsselqualifikationen ist hoch. Packen wir
es an! – Vielen Dank. (Beifall bei der ÖVP sowie der Abg. Maurer.)
15.43
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Oberrauner. – Bitte.
Abgeordnete
Mag. Dr. Petra Oberrauner (SPÖ):
Herr Präsident! Herr Minister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Geschätzte
Zuseherinnen und Zuseher! Das vorliegende Gesetz wird Personen mit
Lehrabschluss und mehrjähriger Bildungserfahrung neue Bildungschancen und
Bildungswege eröffnen. Somit ist eine durchgängige
Weiterbildungsperspektive geschaffen, und das ist sicher eine wichtige
Maßnahme, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.
Meine Fraktion wird diesem Gesetz deshalb zustimmen.
Insgesamt kann man jedoch – jetzt kommen wir zur
aktuellen Situation – Folgendes feststellen: Die Regierung hat
nicht genug getan, um die gewaltigen Herausforderungen wirtschaftlicher Natur
zu bewältigen. Die Zeit drängt, aber es gibt immer noch keine
Strategie und keinen durchgehenden Plan, wie
sich Wirtschaft und Gesellschaft weiterentwickeln sollen, wie man die Menschen
schützen kann und wie man in die Preisgestaltung eingreift.
Das Gegenteil ist leider der Fall: Nach vier Jahren
Türkis-Grün haben wir eine schrumpfende Wirtschaft in
Österreich, die höchste Inflation in Westeuropa, die Arbeitslosigkeit
ist im November um 6,5 Prozent gestiegen, die Insolvenzen sind in
Österreich um 59,7 Prozent angestiegen und damit ist Österreich Spitzenreiter.
(Abg. Michael Hammer: Wieder die depressive Grundstimmung! Der Ogris
hat gute Arbeit geleistet, die Depression ist schon verinnerlicht bei
euch! – Weiterer Ruf bei der ÖVP: In der Statistik!)
Ich möchte gerne Kollegen Fürlinger fragen, wo er
da das Glück in Österreich findet, von dem er redet. Wir haben das
nämlich auch gecheckt: Unter
den ersten zehn glücklichsten Ländern Europas befindet sich
Österreich nicht.
Das Zweite, was ich sagen möchte, ist: Wir haben Ihnen
wirklich immer wieder die Hand gereicht und Sie gebeten, Dinge umzusetzen, die
diese Situation entschärfen. Nur weil Sie glauben, es geht Ihnen
gut, geht es den Menschen noch lange nicht gut. Die sind wahrscheinlich auch
unter Ihrer Wahrnehmungsgrenze. Wir brauchen aber ein Einfrieren der
Mieten bis 2025 und eine Begrenzung des Mietanstieges auf maximal
2 Prozent im Jahr, auch für
kleinere Unternehmen, die für ihre Geschäftsraummieten genauso hohe
Preise zahlen. Das ist alles ungebremst. Das kann Ihnen ja nicht wurscht sein!
Wir brauchen ein sofortiges temporäres Aussetzen der
Mehrwertsteuer auf Lebensmittel für den täglichen Bedarf unter
Einsetzung einer Kontrollkommission, die schaut, ob das wirklich mit
rechten Dingen zugeht – in sozialpartnerschaftlich guter
Manier. Warum ist das ein Problem für Sie? Ich verstehe
nicht, was Sie dagegen haben können.
Die Regulierung des Energiemarktes und die Einführung einer befristeten Übergewinnsteuer für alle Konzerne wären wichtig, denn dann können wir aus diesen Einnahmen wieder sozial gestaffelt und zielgerichtet jene Menschen unterstützen, die sich das einfach nicht mehr leisten können.
Das sind keine Forderungen, die ideologisch begründet
sind. Das sind die Forderungen, die der jetzigen Situation entsprechen.
Ich glaube, da wäre es dringend notwendig, einen Schulterschluss
zu machen (Beifall bei der SPÖ) – für die Menschen
in diesem Land und nicht gegen eine Partei, die halt irgendwelche guten
Vorschläge bringt. Wir sind offen für Kooperation – auch
wenn wir uns Dinge zehnmal anschauen und nicht immer zufrieden
sind –, damit
wir hier weiterkommen. Ich bitte Sie von der Regierung wirklich, wenigstens im
letzten Jahr einmal die Menschen in den Fokus zu setzen und Ihr Ego
zu überwinden. (Beifall bei der SPÖ. – Zwischenruf der
Abg. Scheucher-Pichler.)
15.47
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Litschauer. – Bitte.
Abgeordneter Ing. Martin Litschauer (Grüne): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Minister! Ich möchte mich jetzt kurz mit dem Emissionsschutzgesetz für Kesselanlagen beschäftigen. Worum geht es im Prinzip? – Es ist eine EU-Vorgabe, und wir wollen die Emissionen aus diesen großen Kesseln, die Dampf erzeugen, reduzieren und auch senken. Das ist ganz wichtig.
Raus aus Gas ist ganz wichtig,
denn Gas in Heizungen zu verheizen, die
weniger als 100 Grad Celsius Temperatur erzeugen, vernichtet Erdgas, das
wir für die Industrie brauchen. Wir sehen, in sehr vielen Bereichen ist es
einfach auch notwendig, Gas einzusetzen, und trotzdem müssen wir
uns überlegen, wie wir rauskommen. Deswegen wollte ich dieses Beispiel
auch kurz heranziehen, um zu zeigen, dass auch in der Industrie einiges
möglich ist, und zwar nicht nur die Kesselanlagen besser zu machen und die
Emissionen
zu reduzieren, denn unsere Fachkräfte, von denen jetzt auch sehr viel geredet worden ist, sind sehr innovativ.
Da wurde zum Beispiel im
Jänner zu Dampf ohne Gas das Forschungsprojekt Ahead vorgestellt. Worum
geht es da? – Da geht es um eine Hochtemperaturwärmepumpe,
die dann ohne Gas arbeiten kann und Dampf erzeugt, Dampf mit bis zu
260 Grad Celsius, und das kann Erdgas dann direkt ersetzen.
Damit wollte ich nur unterstreichen, dass wir mit innovativer Technik aus
Österreich auch aus Erdgas aussteigen können.
Das ist auch vom BMK unterstützt, und ich denke, diese
Forschungs- und Innovationsprojekte sind da ganz notwendig, denn in sehr vielen
Bereichen – ich habe das auch im Waldviertel gesehen –
müssen wir die Dampferzeugung
aus Erdgas ersetzen. Ich bin sehr froh, dass Österreich da ganz innovativ
ist und im Bereich Wärmepumpenentwicklung auch weiter voranschreitet. Es
braucht nicht nur Feuerungsanlagen, die kann man auch direkt ersetzen. Ich
denke, das muss dann eigentlich überhaupt der bessere Weg in Zukunft
sein. – Danke. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten
der ÖVP.)
15.49
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Pöttinger. – Bitte.
Abgeordneter
Laurenz Pöttinger (ÖVP): Herr
Präsident! Geschätzter Herr Minister! Liebe Kolleginnen und Kollegen
und liebe Zuseherinnen und Zuseher! Zum HBB-Gesetz ist schon vieles gesagt
worden: Es ermöglicht eine noch breitere Palette an Angeboten für die
höhere Bildung nach der Lehre.
Das ist richtig und wichtig. Die höhere berufliche Bildung wird als
gleichwertige Alternative zur hochschulischen, akademischen Bildung in
Österreich gesetzlich verankert. Dieser Rahmen ist wichtig, wir
haben es schon von den Vorrednerinnen und Vorrednern gehört.
Ich kann eine Empfehlung
abgeben: Besuchen Sie im Internet die Seite
der WKO, geben Sie höhere berufliche Bildung ein, dann werden Sie sehr gut
und ausführlich darüber informiert! Es ist wichtig, dass man sich
auch
die Beispiele dazu ansieht.
Nun aber noch einige Worte zu
meinen Vorrednerinnen und Vorrednern: Herr Kollege Linder, Einspruch, euer
Ehren! Handwerk hat kein schlechtes
Image, Handwerk hat goldenen Boden. Sie alle wissen, wenn Sie einen tollen und
guten Handwerker bekommen, haben Sie eine Freude. Es ist eine Freude,
wie manche Jugendliche diesen Beruf erlernen. Das sind tolle und wirklich motivierte
junge Menschen, die diesen Beruf ergreifen. (Beifall bei der ÖVP.)
Ich habe selbst zwei junge Frauen in meinem Betrieb, die diesen Beruf im Bereich
Schmiedetechnik und Metalltechnik erlernen. – Sie können gerne
zu mir kommen und sich das ansehen: Diese sind motiviert, gut drauf und haben
wirklich eine Freude bei der Arbeit.
Frau Kollegin Oberrauner, Sie
haben gesagt, die Regierung hat viel falsch gemacht, was die Wirtschaft
betrifft. Das widerspiegelt aber zum Beispiel die GfK-Studie, die gemacht
wurde, absolut nicht. GfK ist die fünftgrößte Institution in
diesem Bereich, die erforscht, wie hoch die Kaufkraft ist. Das ist ein in Deutschland
beheimatetes Unternehmen und es hat herausgefunden, dass
wir bei der Kaufkraft unter 42 Ländern von Platz neun auf Platz
sieben gestiegen sind, und wir haben Länder wie Deutschland und Norwegen
hinter uns gelassen. (Beifall bei der ÖVP sowie der Abgeordneten
Lukas Hammer und Maurer.)
Also: Diese Regierung hat nicht viel falsch gemacht,
sondern sie hat viel
ganz richtig gemacht. Wir lassen uns das Land nicht krankjammern. (Beifall
bei der ÖVP sowie der Abgeordneten Lukas Hammer und Maurer.)
15.52
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Egger. – Bitte, Herr Abgeordneter.
15.52
Abgeordneter Mag. (FH) Kurt Egger
(ÖVP): Herr Präsident! Herr
Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Werte
Zuseherinnen und Zuseher im Saal und zu Hause via Livestream!
Ein bisschen verwundert bin ich schon, dass man es als SPÖ selbst bei
einem sehr positiven Thema, wie es die
höhere berufliche Bildung ist, anscheinend nicht schafft, die dauerdepressive
Stimmung abzulegen. Sora scheint großartige Arbeit dahin gehend geleistet zu haben,
dass man versucht, alles schlechtzureden, was einem in den Weg kommt, es madig
zu machen, die Bundesregierung anzupatzen und für
eine schlechte Stimmung in diesem Land zu sorgen. Ich glaube, das ist einer
ehemals staatstragenden Partei nicht würdig und es tut auch der Stimmung im Land
nicht besonders gut.
Ich möchte aber die
Gelegenheit nutzen, um mich bei 30 000 Unternehmerinnen und
Unternehmern zu bedanken, die in ihren Betrieben 108 000 Lehrlinge
ausbilden, wie es Martina Kaufmann schon formuliert hat. Damit geben sie dieser Jugend eine Zukunft, ermöglichen ihr
einen Weg ins Erwachsenenleben
und tragen dafür Sorge, dass sie in Zukunft gut ausgebildete
Mitarbeiter haben, denn sie werden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
brauchen. Die demografische Entwicklung in diesem Land sagt für 2040
voraus, dass zu den bereits 200 000 offenen Stellen zusätzlich
350 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebraucht werden, und diese
müssen gut ausgebildet werden. Dieses
Gesetz bildet dazu eine gute Grundlage. (Zwischenruf des Abg. Loacker.)
Ich danke allen, die dieses Gesetz auf den Weg gebracht haben. Es gibt heute sogar eine einstimmige Beschlussfassung – das ist ja nicht ganz üblich in diesem Haus, sagt aber auch viel über dieses Gesetz aus. – Danke schön. (Beifall bei der ÖVP.)
15.54
Präsident
Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort ist dazu
niemand mehr
gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
Wünscht die Berichterstattung ein Schlusswort? – Das scheint auch nicht der Fall zu sein.
Dann kommen wir zur Abstimmung,
die ich über jeden Ausschussantrag
getrennt vornehme.
Wir gelangen zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 11: Entwurf betreffend HBB-Gesetz samt Titel und Eingang in 2348 der Beilagen.
Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen. – Das ist jetzt einstimmig angenommen.
Wir kommen sogleich zur dritten Lesung.
Wer das auch in dritter Lesung
tut, den bitte ich um ein Zeichen. – Ebenfalls einstimmig
angenommen. Der Gesetzentwurf ist daher auch in dritter
Lesung einstimmig angenommen.
Tagesordnungspunkt 12:
Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Emissionsschutzgesetz für
Kesselanlagen geändert wird, samt Titel und
Eingang in 2246 der Beilagen.
Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen. – Das ist einstimmig angenommen.
Wir kommen zur dritten Lesung.
Auch in dritter Lesung das gleiche Stimmverhalten. Der Gesetzentwurf ist in dritter Lesung angenommen.
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Wir kommen nun zur verlegten Abstimmung über die Tagesordnungspunkte 2 bis 7, die ich ebenfalls über jeden Ausschussantrag getrennt vornehme.
Wir gelangen zur Abstimmung
über Tagesordnungspunkt 2: Entwurf betreffend ein
Bundesgesetz, mit dem ein Finanzausgleichsgesetz 2024 erlassen wird
sowie das Finanzausgleichsgesetz 2017, das Umweltförderungsgesetz,
das Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz sowie weitere Gesetze geändert
werden, in 2305 der Beilagen.
Hiezu haben die Abgeordneten Obernosterer, Schwarz, Kolleginnen und Kollegen einen Zusatz- beziehungsweise Abänderungsantrag eingebracht.
Weiters liegt ein Verlangen auf getrennte Abstimmung des Abgeordneten Krainer vor.
Ich werde daher zunächst über die vom erwähnten Zusatz- beziehungsweise Abänderungsantrag betroffenen Teile unter Berücksichtigung des Verlangens auf getrennte Abstimmung und schließlich über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes abstimmen lassen.
Wir gelangen zur getrennten Abstimmung über den Zusatz- beziehungsweise Abänderungsantrag der Abgeordneten Obernosterer, Schwarz, Kolleginnen und Kollegen betreffend Artikel 5, Änderung der Ziffer 14 sowie Einfügung einer neuen Ziffer 22a.
Wer dafür ist, den bitte
ich um ein dementsprechendes Zeichen. – Das ist
mit Mehrheit angenommen.
Die Abgeordneten Gabriel
Obernosterer und Jakob Schwarz, Kolleginnen und Kollegen haben einen Zusatz-
beziehungsweise Abänderungsantrag betreffend Artikel 5,
Einfügung neuer Ziffern 5a und 25a sowie Änderungen
der Ziffern 12, 22, 28 und 38 eingebracht.
Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist mit Mehrheit angenommen.
Wir kommen schließlich zur Abstimmung über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang in der Fassung der Regierungsvorlage.
Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist die Mehrheit, angenommen.
Wir kommen sogleich zur dritten Lesung.
Wer auch in dritter Lesung dem Gesetzentwurf die Zustimmung erteilt, möge das mit einem Zeichen tun. – Das ist das gleiche Stimmverhalten. Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung angenommen.
Wir kommen nun zur Abstimmung über den Entschließungsantrag
der Abgeordneten Linder, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Sofortentlastung:
Nein
zu ORF-Zwangssteuer und C02-Strafsteuer!“.
Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen. – Das ist die Minderheit, abgelehnt.
Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag
des Abgeordneten Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Reform des
Finanzausgleichs
und echte Transparenz für die Transparenzdatenbank“.
Wer dafür ist, der wird um ein Zeichen gebeten. – Das ist die Minderheit, abgelehnt.
Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 3: Entwurf
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Transparenzdatenbankgesetz
geändert wird, samt Titel und
Eingang in 2306 der Beilagen.
Da der vorliegende Gesetzentwurf Verfassungsbestimmungen enthält, stelle ich zunächst im Sinne des § 82 Abs. 2 Z 1 der Geschäftsordnung die für die Abstimmung erforderliche Anwesenheit der verfassungsmäßig vorgesehenen Anzahl der Abgeordneten fest – die ist gegeben.
Ich bitte nun jene Damen und Herren, die dem vorliegenden Gesetzentwurf zustimmen, um ein bejahendes Zeichen. – Das ist einstimmig angenommen, daher ist die verfassungsmäßige Feststellung der Zweidrittelmehrheit nicht notwendig.
Wir kommen sogleich zur dritten Lesung.
Wer tut das auch in dritter Lesung? – Das ist das gleiche Stimmverhalten. Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung einstimmig angenommen.
Wir gelangen nun zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 4: Antrag des Finanzausschusses, den Abschluss der Vereinbarung gemäß Artikel 15a Bundes-Verfassungsgesetz über die Etablierung einer gebietskörperschaftenübergreifenden Transparenzdatenbank in 2314 der Beilagen zu genehmigen.
Wer dafür ist, den bitte ich um ein dementsprechendes
Zeichen. – Das
ist die Mehrheit, angenommen.
Wir kommen zur Abstimmung, die über jeden Ausschussantrag getrennt vorgenommen wird.
Wir gelangen zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 5: Entwurf betreffend Start-Up-Förderungsgesetz in 2378 der Beilagen.
Hiezu liegen ein Abänderungsantrag der Abgeordneten
Loacker, Kolleginnen und Kollegen sowie ein Zusatz- beziehungsweise
Abänderungsantrag
der Abgeordneten Kopf und Schwarz vor.
Weiters liegen Verlangen auf getrennte Abstimmung der Abgeordneten Krainer und Kaniak vor.
Ich werde daher wiederum über die von den erwähnten Zusatz- beziehungsweise Abänderungsanträgen sowie von den Verlangen auf getrennte Abstimmung betroffenen Teile – der Systematik des Gesetzentwurfes folgend – und schließlich über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes abstimmen lassen.
Die Abgeordneten Loacker, Kolleginnen und Kollegen haben einen Abänderungsantrag betreffend Art. 1 Z 4 eingebracht.
Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen. – Der Antrag ist abgelehnt.
Wir kommen sogleich zur Abstimmung über diesen Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung des Ausschussberichtes.
Ich ersuche die Damen und Herren, die diesem Teil in der Fassung des Ausschussberichtes zustimmen, um ein dementsprechendes Zeichen. – Das ist die Mehrheit, angenommen.
Die Abgeordneten Kopf und Schwarz, Kolleginnen und Kollegen haben einen Abänderungsantrag betreffend Art. 1 Z 6 § 124b Z 445 eingebracht.
Wer dafür ist, den darf ich um ein Zeichen bitten. – Das ist die Mehrheit, angenommen.
Wir gelangen zur getrennten Abstimmung über den
Abänderungsantrag der Abgeordneten Kopf, Schwarz, Kolleginnen und Kollegen
betreffend
Art. 1 § 124b Z 446 und Z 447.
Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen. – Das ist einstimmig angenommen.
Die Abgeordneten Kopf, Schwarz, Kolleginnen und Kollegen haben einen Zusatz- beziehungsweise Abänderungsantrag betreffend Einfügung einer neuen Ziffer 1 sowie Umnummerierung der alten Ziffer 1 in Artikel 5 eingebracht.
Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist mit Mehrheit angenommen.
Wir gelangen zur getrennten Abstimmung über den
Zusatzantrag der Abgeordneten Kopf, Schwarz, Kolleginnen und Kollegen
betreffend Einfügung
einer neuen Ziffer 1a in Artikel 5.
Wer dafür ist, den darf ich um ein Zeichen bitten. – Das ist die Mehrheit, angenommen.
Wir kommen zur getrennten Abstimmung über den Zusatzantrag der Abgeordneten Kopf, Schwarz, Kolleginnen und Kollegen betreffend Einfügung einer neuen Ziffer 1b in Artikel 5.
Wer dafür ist, den bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen. – Das ist einstimmig angenommen.
Die Abgeordneten Kopf, Schwarz, Kolleginnen und Kollegen haben einen Abänderungsantrag betreffend Art. 5 Z 2 eingebracht.
Wer dafür ist, den bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen. – Das ist mit Mehrheit angenommen.
Wir kommen zur getrennten
Abstimmung über den Zusatzantrag der Abgeordneten Kopf, Schwarz,
Kolleginnen und Kollegen betreffend Einfügung
neuer Ziffern 3 und 4 in Artikel 5.
Wer dafür ist, wird um ein Zeichen gebeten. – Das ist die Mehrheit, angenommen.
Die Abgeordneten Kopf, Schwarz, Kolleginnen und Kollegen haben einen
Zusatz- beziehungsweise Abänderungsantrag betreffend Artikel 5,
Einfügung
neuer Ziffern 5 bis 10, sowie Artikel 6 und Artikel 7
eingebracht.
Wer dafür ist, den bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen. – Das ist die Mehrheit, angenommen.
Schließlich kommen wir zur Abstimmung über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang in der Fassung des Ausschussberichtes.
Wer dafür ist, den bitte
ich um ein dementsprechendes Zeichen. – Das ist
die Mehrheit.
Wir kommen zur dritten Lesung.
Wer tut das auch in dritter Lesung? – Ebenfalls das gleiche Stimmverhalten. Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung mit Mehrheit angenommen.
Wir kommen zur Abstimmung
über Tagesordnungspunkt 6: Entwurf betreffend
Mindestbesteuerungsreformgesetz samt Titel und Eingang in 2379 der
Beilagen.
Wer dafür ist, wird um ein Zeichen gebeten. – Das ist einstimmig angenommen.
Wir kommen sogleich zur dritten Lesung.
In der dritten Lesung gibt es das gleiche Stimmverhalten: einstimmig angenommen.
Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 7 betreffend Gemeinnützigkeitsreformgesetz 2023 in 2319 der Beilagen.
Hiezu haben die Abgeordneten Karlheinz Kopf, Jakob Schwarz, Kolleginnen und Kollegen einen Abänderungsantrag eingebracht.
Weiters liegt ein Verlangen auf getrennte Abstimmung des Abgeordneten Loacker vor.
Ich werde daher zunächst
über die vom erwähnten Abänderungsantrag sowie vom
erwähnten Verlangen auf getrennte Abstimmung betroffenen Teile
und schließlich über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile
des Gesetzentwurfes abstimmen lassen.
Wir kommen somit zur getrennten
Abstimmung über den Abänderungsantrag der Abgeordneten Kopf, Schwarz,
Kolleginnen und Kollegen betreffend
Art. 1 Z 1 lit. d.
Wer dafür ist, den bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen. – Das ist die Mehrheit, angenommen.
Die Abgeordneten Kopf, Schwarz, Kolleginnen und Kollegen haben einen Abänderungsantrag betreffend Art. 1 Z 2 und 7 eingebracht.
Wer dafür ist, wird um ein Zeichen gebeten. – Das ist die Mehrheit, angenommen.
Wir kommen zur Abstimmung über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang in der Fassung der Regierungsvorlage.
Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen. – Das ist nunmehr einstimmig.
Wir kommen sogleich zur dritten Lesung.
Wer gibt auch in dritter Lesung dem Gesetzentwurf die
Zustimmung? – Das ist mit Mehrheit angenommen. Der Gesetzentwurf ist
somit in dritter Lesung
mit Mehrheit angenommen.
Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales über die Regierungsvorlage (2307 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, das Arbeitsmarktservicegesetz und das Ausbildungspflichtgesetz geändert werden (2394 d.B.)
14. Punkt
Bericht des
Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 3774/A
der Abgeordneten Tanja Graf, Hermann Weratschnig, MBA MSc, Kolleginnen
und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Ausländerbeschäftigungsgesetz
und das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz geändert werden
(2395 d.B.)
Präsident
Mag. Wolfgang Sobotka: Wir gelangen nun
zu den Punkten 13 und 14 der Tagesordnung, über welche die Debatten
unter einem durchgeführt
werden.
Ich darf mich beim Bundesminister für Finanzen für seine Anwesenheit herzlich bedanken.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Stöger. Bei ihm steht das Wort. – Herr Abgeordneter, ich bitte Sie ans Pult.
Abgeordneter Alois Stöger,
diplômé (SPÖ): Herr
Präsident! Herr Bundesminister! Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Wir haben jetzt wieder
eine Serie von Themen aus dem Sozialausschuss zu diskutieren. Über die
positiven Themen wird Abgeordneter Seemayer berichten; für die
Themen,
bei denen wir intensive Diskussionen gehabt haben, bin ich zuständig.
Dabei geht es um die Fragen, wie wir mit dem
Ausländerbeschäftigungsgesetz umgehen, welche Berufe auf
die Mangelberufsliste kommen und welche Personen dazu einen Arbeitsmarktzugang
in Österreich haben sollen.
Ganz konkret – ich habe im Ausschuss danach gefragt –: Man möchte Schülerinnen und Schüler – hört zu! (Abg. Steinacker: Aufpassen!, sagt der Herr Lehrer!) –, man möchte Schülerinnen und Schüler von außerhalb der Europäischen Union für Österreich anwerben – Schülerinnen und Schüler!
Dann habe ich die Frage
gestellt – die kommen aus Moldawien, möglicherweise aus
asiatischen Ländern nach Österreich –: Und wovon sollen
diese
Schülerinnen und Schüler für Sozialberufe leben? –
Auf diese Frage habe ich keine Antwort bekommen, weil Schülerinnen und
Schüler kein Einkommen haben, wenn sie –
möglicherweise in anderen Ländern – angeworben werden.
Wenn sie schon hier sind, dann brauchen sie einen Aufenthaltstitel,
dann sollen sie bitte in die Schule gehen, die in Österreich
verfügbar ist – dann haben wir kein Problem –, aber
die Anwerbung von außerhalb, die Zusage,
dass man ihnen eine Rot-Weiß-Rot-Karte gibt, und sie dann mit keinem
Einkommen zu versehen, das kann sich nicht ausgehen und das ist nicht die
Art von Politik, die wir unterstützen wollen. (Beifall
bei der SPÖ.)
Zum Zweiten: Ich bin ja ein Vertreter davon, dass man den
öffentlichen Verkehr stärkt, dass man diesbezüglich bessere
Maßnahmen setzt und vor allem,
dass man Menschen, die im öffentlichen Verkehr tätig sind, auch
vernünftig bezahlt. – Jetzt hat man das Problem, dass es
keine Busfahrer gibt, und hat
das Problem, dass man keine Menschen bekommt, die auch Lokführer werden.
Da will man mit der Rot-Weiß-Rot-Karte diese Personengruppen –
ich
sage es noch einmal: von außerhalb der Europäischen
Union – nach Österreich holen. Wisst ihr, wo die Grenzen der
Europäischen Union liegen? – Die
liegen mittlerweile weit im Osten, und von dort wollen Sie Menschen für
den österreichischen Arbeitsmarkt holen, um in dem Bereich, das sage ich
ganz deutlich, Menschen unter Druck zu bringen.
Ich sage das sehr, sehr deutlich. Wenn man bei einem
400-Millionen-Menschen-Arbeitsmarkt keine geeigneten Kräfte für den
öffentlichen Verkehr findet,
dann liegt es nicht daran, dass wir die in Österreich nicht haben, sondern
es liegt an den Arbeitsbedingungen dieser Menschen. (Beifall und
Bravoruf bei
der SPÖ.)
Da muss man etwas anderes ändern! Da muss man die
Arbeitsbedingungen ändern, da muss man die Rahmenbedingungen
verändern. Was wir hier für
ein geeignetes Personal brauchen, das sind geeignete Ausbildungsmaßnahmen
und ist ein geeignetes Einkommen dafür – und das werden wir
machen.
Wir stimmen einem Öffiausbau mit Lohn- und Sozialdumping nicht zu. (Beifall und Bravorufe bei der SPÖ.)
16.09
Präsident
Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet
ist Abgeordneter
Koza. – Bitte.
Abgeordneter Mag. Markus Koza (Grüne): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Minister! Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher! Ja, heute ist ein sehr wichtiger Tag für Menschen (Abg. Belakowitsch: Aus aller Herren Länder!) mit Behinderung.
Wir machen heute
für Jugendliche mit Behinderungen den Weg für mehr Inklusion am
Arbeitsmarkt frei. Wir durchbrechen heute den Automatismus von Sonderschule,
Werkstatt und Sozialhilfe, den bislang so viele Menschen
mit Behinderungen erleben mussten. Das, was wir heute beschließen,
bedeutet tatsächlich einen Paradigmenwechsel in der gesellschaftlichen
Achtung
von Menschen mit Behinderungen und einen Paradigmenwechsel im Umgang mit
Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt.
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Bis jetzt war es so, dass Jugendliche – unter 25-Jährige –, die sich beim AMS vormerken ließen, eine verpflichtende Überprüfung ihrer Arbeitsfähigkeit bei der Pensionsversicherungsanstalt durchführen lassen mussten, sobald ein Zweifel an der Arbeitsfähigkeit bestanden hat. Diese Überprüfung ist nur nach medizinischen Kriterien erfolgt und hat meistens oder sehr häufig damit geendet, dass sie arbeitsunfähig geschrieben wurden.
Dadurch haben sie
den Zugang zu sämtlichen Arbeitsintegrationsleistungen des AMS verloren.
Zusätzlich war es auch so, dass Menschen mit Behinderung,
die einen arbeitslosenversicherungspflichtigen Job hatten und diesen
dann verloren haben, die beispielsweise gerne eine Leistung des AMS in Anspruch genommen hätten, diese nicht erhalten
haben – auch sie wurden
quasi automatisch arbeitsunfähig geschrieben und waren damit nicht
mehr im AMS-System.
Meine sehr
geehrten Damen und Herren, das ändern wir heute. (Beifall
bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.) Ab nächstem
Jahr, ab 1. Jänner 2024, wird für Jugendliche –
für junge Menschen unter 25 – mit Behinderung die
Überprüfung der Arbeitsfähigkeit ausgesetzt beziehungsweise abgeschafft.
Die Betroffenen erhalten damit Zugang zu den Leistungen
des Arbeitsmarktservice und des Sozialministeriumservice. (Beifall bei den
Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
Anstelle des automatischen Abschiebens in eine Werkstatt beziehungsweise in die Sozialhilfe wird künftig die Zusammenarbeit von AMS und Sozialministeriumservice gefördert beziehungsweise wird das dahin gehend zusammenge-
führt, dass für Jugendliche mit
Behinderungen ein Perspektivenplan erstellt wird, und zwar mit
ihnen gemeinsam, der die Möglichkeiten zur Arbeitsmarktintegration
für die Betroffenen aufzeigt. Dabei werden bewährte Programme wie das
Jugendcoaching, Ausbildungsfit, Teilqualifizierungslehren oder auch
verlängerte Lehren zur Anwendung kommen, es können aber
genauso auch bereits bestehende Qualifizierungsprogramme in den
Werkstätten in Anspruch genommen werden.
Bei der Beurteilung der Arbeitsfähigkeit
wird nicht mehr nach rein medizinischen Kriterien vorgegangen, sondern es wird
künftig darauf geachtet, welche Fähigkeiten der junge Mensch hat,
welche Potenziale ausgebaut werden können, und vor allem, welche
Maßnahmen zur Unterstützung notwendig sind, damit
die Arbeitsmarktintegration auch bestmöglich erfolgen kann.
Dafür stehen dem Arbeitsministerium, dem
AMS mit den zuletzt im Rahmen des Budgets zusätzlich beschlossenen 50 Millionen
Euro an Arbeitsmarktgeldern für Menschen in
Langzeitarbeitslosigkeit und mit Behinderung auch die entsprechenden budgetären
Mittel zur Verfügung. Wichtig ist auch, dass Menschen mit
Behinderung, die bereits im Arbeitsmarkt waren, wenn sie in die
Arbeitslosigkeit kommen, künftig alle Leistungen des Arbeitsmarktservice
zur Verfügung stehen. (Beifall bei den Grünen sowie der
Abgeordneten Grünberg und Deckenbacher.)
Der heutige Beschluss, meine sehr geehrten
Damen und Herren, ist ein wichtiger, ganz zentraler Schritt zu einer weiteren
Inklusion am Arbeitsmarkt. Natürlich werden weitere folgen müssen und
wir werden auch dranbleiben. Wir bitten aber auch um breite
Zustimmung für diesen Paradigmenwechsel. – Danke. (Beifall
bei den Grünen sowie der Abgeordneten Kirchbaumer
und Scheucher-Pichler.)
16.14
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Belakowitsch. – Bitte.
16.14
Abgeordnete Dr. Dagmar Belakowitsch (FPÖ): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Sehr geehrte Damen und Herren! Zu dem, was mein Vorredner gesagt hat: Ja, dass es für junge Menschen, junge Erwachsene mit besonderen Bedürfnissen jetzt besser wird, das ist natürlich begrüßenswert. Das war es dann aber auch schon wieder mit den positiven Punkten, die Sie hier beschließen.
Interessant ist
auch, Herr Kollege Koza, dass Sie kein Sterbenswörtchen
zur Erleichterung beim Zugang zur Rot-Weiß-Rot-Karte gesagt haben. (Abg.
Koza: Wir haben auch einen zweiten Sprecher!) Wahrscheinlich
genieren Sie sich selber für diese Rot-Weiß-Rot-Karte, weil das
jetzt nämlich ein Hereinlassen von Menschen aus aller Herren Länder bedeutet,
ohne dass es irgendwelche Qualifikationen geben muss. Das ist in Wahrheit das
Öffnen des österreichischen Marktes, des Arbeitsmarktes für
die ganze Welt. (Abg. Koza: ... Millionen an Lokführern,
wir warten ...!) Das ist nicht mehr positiv, Herr Bundesminister,
und es verwundert mich jetzt irgendwie, dass Sie das immer noch so machen und
so handhaben.
In den letzten
Jahren hat es in Österreich zig Scheinfirmen gegeben. Dagegen haben
Sie auch sehr wenig unternommen: Die Finanzpolizei hat aufgedeckt, Sie haben es
erfahren, dann wurden die Firmen zwar geschlossen, aber es erfolgte kein Entzug
der Gewerbeberechtigung. An derselben Adresse ist wenige Monate später die
nächste Scheinfirma zu finden – und all diese Scheinfirmen
kosten Geld: Sie haben Förderungen, Kurzarbeitsförderungen,
AMS-Förderungen
bekommen! –, und dann wird die nächste Scheinfirma aufgedeckt.
Sie sind der Verwalter dieser Scheinfirmen. Wir wissen – und
das wissen Sie
noch besser als wir –, dass weit über 80 Prozent dieser
Scheinfirmen, die alle unser Sozialsystem, vorwiegend eben das AMS, betrogen
haben, nicht
von österreichischen Staatsbürgern gegründet worden sind.
Was machen Sie
jetzt? – Ihre Antwort darauf ist: Kommt alle rein, der österreichische
Arbeitsmarkt möchte Sie alle gerne haben!, und das vor dem Hintergrund
einer massiv steigenden Arbeitslosigkeit. Das verleugnen Sie ja schon die längste
Zeit. Sie machen eine reine Vogel-Strauß-Politik. (Ruf bei den
Grünen: Es geht um den öffentlichen Verkehr! Öffentlicher
Verkehr!)
Sie fördern
Firmen wie diese: Ich habe vor wenigen Tagen eine interessante Anfragebeantwortung
von Ihnen bekommen – genau am 12. Dezember
haben Sie mir die geschickt, oder an dem Tag habe ich sie bekommen, Sie haben
sie wahrscheinlich schon früher abgeschickt –, in der es um die
Media
Data Vertriebs- und Verlags GmbH geht. Auch die wurde gefördert. Das ist
zwar ein österreichisches Unternehmen, aber ich bringe das, damit Sie als
Zuseher ein bisschen ein Gespür dafür bekommen, wie
der Herr Bundesminister da agiert.
Für diese
Firma gibt es eine große Förderung: „Seit 1. Jänner
2020“ – lautet Ihre Anfragebeantwortung – „wurden
an die Media Data Vertriebs- und Verlags GmbH € 254.105,65
an AMS Förderungen [...] ausbezahlt.“ Das inkludiert auch die
Kurzarbeitsförderung. (Abg. Koza: Was hat das mit
Lokführern
zu tun? Öffentlicher Verkehr ...!) Und was ist jetzt? „Am
26. September 2023 wurden durch die Media Data Vertriebs- und Verlags
GmbH 31 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ beim AMS
„zur Kündigung angemeldet.“ (Bundesminister Kocher:
Das kann passieren!)
„Das kann
passieren“, sagt der Herr Bundesminister. Wir fördern diese
Firma, und das ist ja nicht irgendein Unternehmen, Herr Bundesminister. Meine
Damen und Herren, ich kläre Sie jetzt auf: Diese Media Data Vertriebs-
und Verlags GmbH steht im Eigentum des „Volksblatt“, und das
„Volksblatt“ ist die Parteizeitung der ÖVP
Oberösterreich.
„Das kann passieren“! – Diese Firma bekam in den letzten paar Jahren Förderungen im sechsstelligen Bereich und meldet aus Dankbarkeit 31 Mitarbeiter beim AMS an. „Das kann passieren!“ – Ja, da haben Sie recht.
Die Arbeitslosigkeit steigt, Herr
Bundesminister, und in Zeiten, in denen die Arbeitslosigkeit steigt, ist
es ein völlig falsches Signal, die Kriterien für die
Rot-Weiß-Rot-Karte hinunterzuschrauben. Sie hätten sie strenger
machen müssen. (Beifall bei der FPÖ.)
16.18
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Kirchbaumer. – Bitte.
Abgeordnete Rebecca Kirchbaumer
(ÖVP): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuseherinnen
und Zuseher hier
bei uns auf der Galerie und auch zu Hause vor den Bildschirmen! Wenn man den
Kollegen von der Opposition, Kollegin Belakowitsch und auch Kollegen
Stöger, so zuhört (Abg. Wurm: Titanic! Titanic!), dann
bekommt man den Eindruck, dass es absolut in die falsche Richtung geht. Da
heißt es, dass wir Sozialdumping betreiben. – Wir
haben eine Sozialpartnerschaft. Wir haben einen Kollektivvertrag und der
ist einzuhalten. Der wird eingehalten und der hat
auch eingehalten zu werden.
Grundsätzlich
stellt sich für mich schon die Frage, ob man da nicht Äpfel mit Birnen
vertauscht. Die Kurzarbeit, die Kollegin Belakowitsch gerade erwähnt
hat, war ein Instrument, damit Menschen in Beschäftigung bleiben
können, damit Mitarbeiter:innen ihre Beschäftigung, ihren
Arbeitsplatz behalten
können. Damit hat sich kein einziges Unternehmen bereichern können. (Abg.
Belakowitsch: Darf ich sie Ihnen geben, die Antwort?)
Um es einmal für die Bevölkerung zu
skizzieren, für diejenigen, die vielleicht keine Unternehmer
sind und Kollegin Belakowitsch gerade nicht folgen konnten: Wenn man
einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin in die Kurzarbeit schickt,
dann arbeitet der Mitarbeiter während dieser Zeit nicht im Unternehmen,
sondern bekommt Geld vom AMS. (Abg. Stöger: Das stimmt nicht!)
Ich verstehe jetzt noch nicht ganz, warum man Profiteur davon ist,
wenn ein Mitarbeiter nicht im eigenen Unternehmen arbeitet, also nicht vor Ort
ist.
Es war ein gutes Instrument,
ein wichtiges Instrument, dass wir die Arbeitsplätze in Österreich
haben erhalten können, dass die Menschen ihren Arbeitsplatz haben behalten
können. Das war weder Sozialdumping noch eine Bereicherung für Unternehmerinnen
und Unternehmer. Ich bitte wirklich inständig, mit
dieser Falschaussage aufzuhören, denn sonst erkläre ich Ihnen ganz
gerne noch einmal bilateral, wie das genau funktioniert hat, wenn Sie es nicht
verstanden haben. (Abg. Belakowitsch: Ich habe ja gar nicht
behauptet, dass sich
wer bereichert hat!) – Das haben Sie jetzt mehrfach behauptet
(Abg. Belakowitsch: Nein, schade, dass Sie nicht zugehört haben!),
und immer wieder wird behauptet, dass sich Unternehmen an der
Kurzarbeit bereichert haben. Das möchte ich vehement
zurückweisen, weil es einfach nicht stimmt. (Beifall
bei Abgeordneten der ÖVP. – Abg. Belakowitsch: Schade,
dass Sie nicht zugehört haben!)
Zum Thema: Es geht heute darum,
dass wir versuchen, mit einem Instrument – der
Rot-Weiß-Rot-Karte – unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zu entlasten. Ich möchte ein plakatives Beispiel bringen: Wenn ein
Busfahrer 40 Stunden fährt, der Kollege krank ist und der dritte Bus
nicht besetzt werden kann, weil man keine Mitarbeiter hat, was ist das Resultat
daraus? (Abg.
Wurm: Wo kommt denn der Busfahrer her, Rebecca? Wo kommt der her?
Äthiopien, oder? – Abg. Belakowitsch: Kambodscha!) –
Der Mitarbeiter macht Überstunden und versucht, mit
Gemeinschaftlichkeit diese Linie abzudecken.
Wenn wir mehr Mitarbeiter:innen
rekrutieren können, entlasten wir auch dadurch unsere Buslenker:innen
(Abg. Belakowitsch: Hoffentlich liegt dann
kein Schnee!) – wir veranstalten kein Sozialdumping, sondern wir
entlasten unsere Mitarbeiter:innen.
Es gibt Schlagzeilen vom 3. August 2022: „Personalmangel im Tiroler Busverkehr“. – Am 15. Oktober 2022: „Beim Personalmangel kratzt man an der kritischen Grenze“; „Ganz Tirol mangelt es an Busfahrern“; „Viele Linienbusausfälle durch Fahrermangel“.
Was bedeutet es für den
Einzelnen zu Hause (Abg. Wurm: Dass die Regierung am Ende
ist, Rebecca, wenn ihr keine Busfahrer mehr habt!), dass wir Linien
ausfallen lassen müssen, dass der öffentliche Verkehr nicht mehr funktioniert, dass
Pendlerinnen und Pendler (Abg. Belakowitsch: Dann schaffts halt die Pendlerpauschale
nicht ab!), die von A nach B zu ihrer Arbeit fahren müssen,
nicht mehr rechtzeitig zur Arbeitsstätte kommen, weil der Bus
ausfällt, dass die Schüler:innen nicht in die Schule kommen, weil der
Bus ausfällt?
Wenn wir am Arbeitsmarkt keine
Mitarbeiter:innen finden, müssen wir uns so behelfen, dass wir versuchen,
Arbeitskräfte aus Drittstaaten zu finden,
die selbstverständlich den Kriterien der Rot-Weiß-Rot-Karte
unterliegen. (Abg. Belakowitsch: Gibt ja keine mehr!) –
Selbstverständlich gibt es diese Richtlinien, ich kann sie Ihnen
gerne mailen und Sie können Sie gerne lesen, wenn Sie lesen und verstehen
können. (Abg. Belakowitsch: Wir können sie jetzt aber
auch den Zuhörern hier erzählen, diese Kriterien!)
Es ist wirklich beschämend, wie man hier ein Bashing
gegen alle Maßnahmen, gegen die Bundesregierung, gegen die
Unternehmerschaft und auch –
das sage ich abschließend – gegen unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter macht, denn die wollen wir auch entlasten, und
das ist ein wichtiger
Punkt. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
16.23
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Seemayer. – Bitte.
Abgeordneter Michael Seemayer (SPÖ): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Zu
Beginn darf ich den Bundesjugendsekretär des DGBs mit
der Delegation der Österreichischen Gewerkschaftsjugend auf der Galerie begrüßen –
herzlich willkommen bei uns! (Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordneten
der ÖVP.)
Kollegin Kirchbaumer, eines
muss ich schon richtigstellen: Die Kurzarbeitsabwicklung ist, glaube ich,
nicht recht geläufig, denn wenn man Mitarbeiter
in Kurzarbeit hat, dann kriegen die Mitarbeiter weiterhin Lohn oder Gehalt vom
Unternehmen, und das Unternehmen bekommt eine Kurzarbeitsbeihilfe
vom AMS. Es ist also eine Kurzarbeitsbeihilfe für die Unternehmen, damit
sie die Löhne und Gehälter weiter bezahlen können. –
So dürfte es richtig sein.
(Beifall bei der SPÖ.)
Wo ich Ihnen recht gebe: Wenn man die Kurzarbeit richtig anwendet, dann kann man sich nicht bereichern – wenn man sie falsch anwendet, schon. (Heiterkeit bei der SPÖ. – Zwischenruf des Abg. Lindner.)
Ich werde jetzt aber kurz auf TOP 13 eingehen, bei dem sehr wohl eine sinnvolle Maßnahme, die die Situation von jungen Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt verbessert, umgesetzt wird.
Personen bis zum vollendeten
25. Lebensjahr können künftig nicht mehr verpflichtet werden, an
einer Untersuchung der Arbeitsfähigkeit teilzunehmen. Diese Jugendlichen
beziehungsweise jungen Erwachsenen werden
künftig vom AMS betreut und können somit auch die Leistungen
entsprechend in Anspruch nehmen. Das verbessert nicht nur ihre finanzielle
Situation,
sondern bringt auch mehr Chancengleichheit, wenn es um den Zugang zum Arbeitsmarkt geht. Das ist natürlich gut und
wir werden dem auch zustimmen.
Diese Verbesserung bringt aber
auch ein Mehr an Arbeit und Aufwand für die Beschäftigten beim AMS.
Es ist nicht nur diese Maßnahme, die ein Mehr
an Aufgaben und Arbeit für die Beschäftigten beim AMS bringt, sondern
auch die Integration von zugewanderten Menschen in den Arbeitsmarkt
bedeutet mehr Arbeit. Auch die verstärkte überregionale Vermittlung
von Arbeitssuchenden, die das AMS in den Zielvorgaben hat, bedeutet mehr
Arbeit, und nicht zuletzt stellen Beratung und Integration von Menschen mit
Behinderung und Langzeitarbeitslosen eine immer größere
Herausforderung dar.
Daher braucht es mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen am Arbeitsmarkt nicht weniger, sondern mehr Personal für das AMS. (Beifall bei der SPÖ.)
Ähnlich gelagert ist auch die Personalsituation beim Arbeitsinspektorat. Da erreichen wir die Richtwerte der ILO, der Internationalen Arbeitsorganisation, bei Weitem nicht mehr. Für eine industrielle Marktwirtschaft, wie wir es sind, sieht das ILO-Übereinkommen ein Aufsichtsorgan pro 100 000 Beschäftigten vor. Das bedeutet, dass wir, nur um diesen Wert zu erreichen, 35 neue Arbeitsinspektorinnen und Arbeitsinspektoren brauchen würden. Wenn man vorausschauend die steigenden Beschäftigtenzahlen und die notwendigen Nachbesetzungen berücksichtigt, dann brauchen wir 50 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Arbeitsinspektoraten.
Daher bringe ich folgenden Entschließungsantrag ein:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Josef Muchitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Personalaufstockung beim Arbeitsmarktservice und der Arbeitsinspektion“
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Der Bundesminister
für Arbeit und Wirtschaft wird aufgefordert, den Personalabbau im AMS
sofort zu stoppen und statt dessen, eine Personaloffensive
für mehr qualifiziertes Beratungs- und Betreuungspersonal im AMS zu starten
und auch das Personal in den Arbeitsinspektionen um zumindest 50 zusätzliche Mitarbeiter:innen
aufzustocken.“
*****
Danke. (Beifall bei der SPÖ.)
16.27
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Josef Muchitsch,
Genossinnen und Genossen
betreffend Personalaufstockung beim Arbeitsmarktservice und der Arbeitsinspektion
eingebracht im Zuge der
Debatte zum TOP 13.) Bericht des Ausschusses für
Arbeit und Soziales über die Regierungsvorlage (2307 d.B.):
Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, das
Arbeitsmarktservicegesetz
und das Ausbildungspflichtgesetz geändert werden (2394 d.B.)
Durch die vorliegende
Gesetzesnovelle zum ALVG dürfen Menschen im Alter
unter 25 Jahren nicht mehr als arbeitsunfähig klassifiziert werden. Diese
Menschen mit besonderem Betreuungsbedarf fallen zukünftig auch in die
Zuständigkeit
des AMS. Für diese Personen ist jedoch mit einem weit höheren
Betreuungsbedarf zu
rechnen. Trotzdem ist für das Jahr 2024 wieder der Abbau von Personal beim
AMS vorgesehen, obwohl die Personalressourcen bisher schon nicht gereicht
hatten
und obwohl der Anteil an Arbeitssuchenden, die besonders intensive Betreuung
benötigen steigt.
Weitere neue Aufgaben des
AMS umfassen etwa die Integration von zugewanderten Menschen in den
Arbeitsmarkt und die verstärkte überregionale Vermittlung
von Arbeitssuchenden, die der Arbeitsminister dem AMS in seinen
arbeitsmarktpolitischen Zielvorgaben
aufgetragen hat. Zudem stellen die Beratung und Integration
von Menschen mit Behinderungen und Langzeitarbeitslosen eine immer
größer werdende Herausforderung dar. Um all diese Aufgaben gut
bewältigen zu können,
ist eine Abkehr von den beabsichtigten Personalkürzungen und eine bessere
personelle Ausstattung des AMS unbedingt erforderlich.
Auch in der
Arbeitsinspektion wächst die Personallücke weiter. Die Internationale
Arbeitsorganisation (ILO) legt im Übereinkommen Nr. 81, Artikel 10,
als Richtwert
für industrielle Marktwirtschaften eine Aufsichtsbeamt:in pro 10.000
Beschäftigte
fest. Dieser ILO-Richtwert wurde bundesweit gesehen durch die
Untätigkeit
der Bundesregierung nicht erreicht!
Alleine um das
Mindestmaß wieder zu erreichen, benötigen wir dringend 35 Arbeitsinspektor:innen
zusätzlich. Wegen der stetig steigenden Zahl der Arbeitnehmer:innen sollte
jedoch vorausschauend die Erhöhung des Personalstandes um mindestens
50 Arbeitsinspektor:innen und die uneingeschränkte Nachbesetzung
für ausscheidende Arbeitsinspektor:innen erfolgen.
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher nachfolgenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Der Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft wird aufgefordert, den Personalabbau im AMS sofort zu stoppen und statt dessen, eine Personaloffensive für mehr qualifiziertes Beratungs- und Betreuungspersonal im AMS zu starten und auch das Personal in den Arbeitsinspektionen um zumindest 50 zusätzliche Mitarbeiter:innen aufzustocken.“
*****
Präsident
Mag. Wolfgang Sobotka: Der Entschließungsantrag
ist ordnungsgemäß eingebracht, ausreichend unterstützt und
steht somit mit in
Verhandlung.
Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Wurm. – Entschuldigung, ich habe einen übersprungen. Wie konnte ich?
Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Loacker. – Bitte.
Abgeordneter Mag. Gerald Loacker (NEOS): Herr Präsident! Sehr geehrter Herr
Bundesminister! Zum Antrag, den Kollege Seemayer gerade vorgetragen
hat: Da müssen ja die Zuschauerinnen und Zuschauer den Eindruck bekommen,
beim AMS seien keine Leute. Ich kann Sie aber beruhigen: Es sind ein
Drittel mehr Mitarbeiter als 2008 bei ungefähr der gleichen
Arbeitslosigkeit – ein Drittel mehr Mitarbeiter!
Wenn Sie sich fragen: Welche
Digitalisierung hat im AMS stattgefunden, welche Prozesse haben sie
automatisiert?, und denken: Die müssten doch mit
gleich vielen Mitarbeitern mehr Arbeitssuchende betreuen können!, muss ich
sagen: Das können sie nicht.
Nun zur Frage der
Beschäftigung von Mitarbeitern aus Drittstaaten im Personenverkehr
und im Güterverkehr – praktisch Rot-Weiß-Rot-Karte
für
einen Busfahrer, auf Deutsch gesprochen –: Wir finden das
gut – anders, als die SPÖ das sieht. Warum finden wir das gut?
(Abg. Belakowitsch: ... Vorarlberg!) – Es gibt
die österreichischen Busfahrer nicht. (Beifall der Abgeordneten Jeitler-Cincelli
und Kirchbaumer.) Wenn ein Unternehmen die bekommen
würde, dann würde es sie sofort nehmen. (Abg. Hörl: ...
Deutsch! Es gibt auch keine Kellner!)
Versetzen Sie sich in die Lage,
Sie hätten ein Unternehmen – das ist für
einen Sozialisten schwer (Abg. Kucharowits: Wirklich, so
lächerlich!), aber versetzen Sie sich in die Lage –,
Sie hätten ein Busunternehmen und Sie hätten Bewerber. Dann nehmen
Sie doch lieber die, die Deutsch können und die in Krupping-Neusiedl jedes
Eck kennen, wenn sie mit dem Bus durchkurven, als jemanden, der
aus einem Drittland kommt und dem Sie zuerst einmal sagen müssen, wo Krems
ist, wo Sankt Pölten ist und wo Scheibbs ist. Es ist total logisch. Diese
Leute bekommen die Rot-Weiß-Rot-Karte nur, weil es hier
keine gibt, die den Job machen. (Beifall bei NEOS, ÖVP und Grünen
sowie Bravoruf des Abg. Hörl.)
Dass man jetzt diese Ausnahme
extra ins Gesetz zimmern muss, zeigt aber
auch, dass das Rot-Weiß-Rot-Karte-Verfahren zu kompliziert und zu
restriktiv
ist. (Abg. Meinl-Reisinger: Wäre super, wenn ... in der Regierung wären!) Es gehen in den nächsten Jahren jedes Jahr ungefähr 100 000 Leute in Pension, und ungefähr 80 000 rücken auf den Arbeitsmarkt nach. Uns fehlen die Leute überall! Sie fehlen in der Gastronomie, sie fehlen im Tourismus, sie fehlen im Verkehr. (Abg. Meinl-Reisinger: In der Schischule!) Schauen Sie sich an der Tankstelle in Ihrer Nachbarschaft um! Schauen Sie sich in der Bäckerei in Ihrer Nachbarschaft um: Jeder nimmt Leute. Komm rein, sag mir, wie viele Stunden du arbeiten willst und um welche Uhrzeit! – Wir haben vorne und hinten zu wenig Personal. (Beifall bei den NEOS sowie bei Abgeordneten von ÖVP und Grünen.)
Vielleicht war es vor 30 Jahren richtig, dass Sie sich so schützend vor die Arbeiterschaft gestellt haben, weil Sie Angst haben mussten, dass Ausländer den Menschen die Arbeitsplätze wegnehmen. Ich glaube, es war damals schon falsch – aber mögen Sie damals recht gehabt haben. Heute liegen Sie ganz sicher falsch! (Beifall bei den NEOS sowie bei Abgeordneten von ÖVP und Grünen.)
16.30
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesminister Kocher. – (In Richtung Abg. Wurm:) Du darfst noch einmal warten, Herr Abgeordneter.
Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft Mag. Dr. Martin Kocher: Das tut mir leid, Sie kommen gleich dran! – Herr Präsident! Sehr geehrte Abgeordnete! Wertes Hohes Haus! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich würde gerne zu Tagesordnungspunkt 13 sprechen, weil die Inklusion von Menschen mit Behinderung ein ganz wichtiges Anliegen ist und ich auf sehr große Unterstützung hoffe.
Davor aber ganz kurz zur Debatte: Ich finde es immer schwierig, wenn Unternehmen, die Kurzarbeitsbeihilfen bezogen haben, generell skandalisiert werden. Das ist eine Maßnahme gewesen, die viele Arbeitsplätze gesichert hat, und es ist natürlich so, dass auch in den nächsten Jahren in dem einen
oder anderen Fall bei einem Unternehmen, das Kurzarbeitsbeihilfen bezogen hat, ein Konkurs erfolgen wird. Das ist in der Marktwirtschaft so. Das ist nicht erfreulich, aber es ist in der Marktwirtschaft so.
Und wenn von der FPÖ die
verschiedenen Aspekte wie Scheinfirmen, qualifizierte Zuwanderung und
Kurzarbeit in einen Topf geworfen werden, dann zeigt das, welche
wirtschaftliche Kompetenz dort vorhanden ist. Ich hoffe
sehr, dass alle, die zuhören, das auch einschätzen können. (Beifall
bei der ÖVP sowie bei Abgeordneten von Grünen und
NEOS. – Abg. Belakowitsch: Ja, das
glaube ich schon!)
Noch kurz zu den
Beschäftigten im Verkehrswesen, im öffentlichen Verkehr: Wenn es so
wäre, dass die Schwierigkeit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden,
nur daran liegt, dass die Arbeitsbedingungen in diesem Bereich so schlecht
wären, dann wäre das ja zum Beispiel auch ein Vorwurf an die
Stadt Wien – diese hat zu wenige Straßenbahnfahrerinnen und
-fahrer, hat zu wenige Busfahrerinnen und Busfahrer. (Abg. Loacker: Die
gehen alle in Frühpension! Alle weg!) Es ist tatsächlich so,
dass wir in diesem Bereich insgesamt eine große Knappheit haben und
einfach Arbeitskräfte brauchen. Ich glaube, das
kann jeder nachvollziehen, der gelegentlich – weil es zu wenig
Arbeits-
und Fachkräfte gibt – länger auf die Bahn, den Bus oder
die Tram warten muss.
Jetzt aber zu dem Thema, das mir wirklich am Herzen liegt: Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt. Wie war das bisher? – Bisher war es so, dass in vielen Fällen, in fast allen Fällen, im Alter von 15 durch die Pensionsversicherungsanstalt eine Arbeitsunfähigkeit festgestellt wurde. Das hat die jungen Menschen mit Behinderungen von Angeboten des AMS ausgeschlossen, sowohl von Qualifizierungsangeboten als auch von anderen Angeboten, wie zum Beispiel eben von finanziellen Unterstützungen, die es im Rahmen des Arbeitslosenversicherungsgesetzes gibt.
Das wird jetzt anders. Jetzt soll zusätzlich zu bestehenden Angeboten die Möglichkeit geboten werden, auch die AMS-Angebote zu nutzen. Das schafft die
Chance auf Inklusion, das ist ein
Paradigmenwechsel im Rahmen der Arbeitsmarktinklusion, und ich
hoffe sehr, dass es uns gelingt, damit gemeinsam – und das ist
wichtig: AMS, Sozialministeriumservice und die Bundesländer, die
für die Werkstätten, für die tagesstrukturellen Einrichtungen
zuständig sind, gemeinsam – möglichst vielen jungen
Menschen den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern, Chancen zu bieten und
damit mehr Inklusion am Arbeitsmarkt sicherzustellen.
Das ist wie gesagt ein Paradigmenwechsel. Es ist sicher nicht der letzte Schritt, der notwendig ist, aber ich bitte um breite Unterstützung dieses Vorhabens im Sinne eines inklusiven Arbeitsmarkts. – Vielen Dank. (Beifall bei der ÖVP sowie bei Abgeordneten von Grünen und NEOS.)
16.34
Präsident
Mag. Wolfgang Sobotka: Jetzt ist
Abgeordneter Wurm an der
Reihe. – Bitte sehr, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Peter Wurm (FPÖ): Herr Präsident! Herr Minister! Hohes Haus!
Werte Zuseher! Hinsichtlich des TOPs, der die Behinderten betrifft: Da
sind wir natürlich dafür, kein Thema. Der wesentlich spannendere Teil
unserer heutigen Diskussion, Herr Minister, ist der zweite Teil.
Vielleicht muss man das noch
ein bisschen aufdröseln. Es ist halt – wir haben es in den
letzten Tagen ja auch in anderen Bereichen gesehen – leider Gottes
dieses Land wirklich am Ende. (Zwischenruf des Abg. Kopf.) Wir
haben
überall Baustellen, Problemstellungen; auch am Arbeitsmarkt, Herr Minister.
Ich darf daran erinnern: Das, was Sie jetzt vorlegen, ist im Prinzip der
Offenbarungseid, dass man am Arbeitsmarkt komplett versagt hat.
Aktuell, im November – ich darf das noch einmal sagen –, ist die Arbeitslosigkeit in Österreich um 7 Prozent gestiegen, um 2 Prozent bei Inländern und um 14 Prozent bei Ausländern; Tendenz weiterhin stark steigend, wie wir wissen. Es
gibt laufend Konkurse von Unternehmen. Vor allem Klein- und Mittelbetriebe haben Probleme, weil eben die ÖVP ihren Job nicht macht und diese Betriebe nicht mehr schützt.
Das heißt, die Aussichten
sind sehr, sehr schlecht. Die Arbeitslosigkeit –
und der Minister weiß das – wird jetzt über den Winter
und auch ins Frühjahr hinein sehr stark zunehmen. Wir sprechen bereits von
mehr als 350 000 Menschen. Ich mache einen Rückblick auf die
Dreißigerjahre des letzten Jahrhunderts. Wenn Sie sich an die Krisenjahre
der Dreißigerjahre erinnern: Da waren es in Österreich
knapp 300 000 Arbeitslose – damit man sich einmal
ungefähr das Verhältnis vorstellen kann. Das ist eine
Riesenzahl an Arbeitslosen. (Zwischenruf des Abg. Hörl.)
Dann wiederhole ich noch
einmal – ich habe es auch gestern gesagt –: Sie haben
mittlerweile 50 000 Ukrainer im Land, Sie haben aktuell in der
Bundesversorgung 80 000 Asylwerber und Sie haben 200 000 in
der Mindestsicherung – damit man die Dimensionen einmal sieht. Auf
der anderen Seite haben
Sie – oder der Minister will das – eben heute diese
berühmte Rot-Weiß-Rot-Card mit der Mangelberufsliste vorgestellt.
Diese können Sie online
abrufen, wenn es Sie interessiert. Das sind jetzt bundesweit 120 Berufe
und in den Bundesländern noch einmal 80. Da wäre es gescheiter, eine
Liste zu machen, welche Berufe in Österreich keine Mangelberufe sind, denn
da haben Sie alles drinnen, vom Journalisten über den Diplomingenieur
Maschinenbau bis zum Intendanten, alles, was es nur irgendwie
gibt, ist da
drinnen.
Auch eine interessante Zahl – wir haben auch
darauf hingewiesen –: Der höchste Anstieg der Arbeitslosigkeit
im November 2023 in Österreich betrifft die Gruppe der Akademiker.
Die Gruppe der Menschen mit akademischer Ausbildung verzeichnete im
November eine Steigerung der Arbeitslosigkeit von 16 Prozent. Auch
darauf haben wir immer wieder hingewiesen –
dieser Akademisierungswahn, der noch vor zehn Jahren vorgeherrscht hat, ich
kann mich erinnern, scheint sich jetzt auch in der Arbeitslosenstatistik wiederzufinden. Das kann man sich alles anschauen.
Warum sind wir da so kritisch? – Wir haben Ihnen
damals schon das Märchen nicht geglaubt: Wir gehen in die Europäische
Union und alles wird super!
Der portugiesische Koch kommt nach Tirol und arbeitet als Kellner oder sonst
was! – Das hat sich alles nicht bewahrheitet (Abg. Hörl:
Koch bleibt Koch!),
das heißt, die Europäische Union und auch die Ostöffnung
des Arbeitsmarktes hat unsere Probleme nicht gelöst.
Dann kam die nächste Märchenstunde, Sie von dieser
berühmten Einheitspartei waren immer alle vier dabei. Auch die
Sozialdemokratie hat Arbeiter und Angestellte in Österreich verraten, die
ÖVP sowieso, aber auch NEOS und Grüne. Nächstes
Märchen: Jetzt kommt die Zuwanderung, und damit kommen der Atomwissenschaftler,
der Gehirnchirurg und so weiter. (Abg. Loacker: Wir reden von
Busfahrern!) – Was ist gekommen? (Abg. Disoski:
Bus-Fahrer!) – Unqualifizierte Zuwanderung –
über eine halbe Million, die
jetzt das System belasten! Also: wieder ein Märchen, das sich nicht
bewahrheitet hat. Wir haben es prophezeit, wir haben recht behalten.
Jetzt kommen Sie mit dem nächsten Vorschlag daher und
die ÖVP verteidigt
ihn. Wo ist denn Kollege Karlheinz Kopf? Er sucht ja jetzt schon weltweit
Mitarbeiter und sagt das noch ganz stolz. (Abg. Kopf: Ja!) Das
ist ja ein Offenbarungseid, wenn man heute keinen Busfahrer mehr findet. Da ist
ja viel schiefgegangen. Gestern war Bildungspolitik ein von den NEOS eingebrachtes Thema.
Bitte schön, das ist ja nur mehr das Ende der Fahnenstange! (Abg. Hörl:
Wenige Leute ...!)
Was dazukommt, Kollege
Hörl: Wir sind bankrott. Wie heute Nachmittag, bitte schön, beim
Thema Gemeinde gehört – da hat die SPÖ, da habt ihr ja
recht gehabt –: 50 Prozent der Gemeinden schaffen kein Budget
mehr, mit allen Auswirkungen. Trotzdem stimmt ihr aber wieder zu, liebe
Sozialdemokratie,
ihr seid immer dabei! (Zwischenruf des Abg.
Lercher.) Ihr kennt das Problem,
stimmt aber immer zu.
(Abg. Stöger – erheitert –: Habt ihr nicht
zugestimmt,
oder wie?)
Also: Dieses Land ist leider Gottes, weil viele dramatische Fehlentscheidungen passiert sind, komplett am Ende – finanziell, am Arbeitsmarkt, wirtschaftlich. (Zwischenruf des Abg. Hörl.)
Ich erkläre es den
Zuschauern noch einmal: Diese Regierung aus ÖVP und Grünen will
uns jetzt, unter Beihilfe der anderen beiden Parteien, erklären,
dass der Busfahrer im Tiroler Mittelgebirge aus Äthiopien kommt. Das hat
Frau Kollegin Rebecca Kirchbaumer uns zu erklären versucht. Also: Im
Mittelgebirge fährt jetzt der Busfahrer aus Äthiopien. Sie
suchen jetzt überall, in den Ländern der Dritten Welt, weltweit,
Busfahrer für Tirol.
Gut, das kann man zur Kenntnis nehmen. Wir hätten ja eigentlich einen für den Arbeitsmarkt zuständigen Minister. – Herr Minister, wie erklären Sie das?
Jetzt darf ich zum
Abschluss – es gäbe ja viele Dinge zu
erzählen – noch
auf Folgendes zu sprechen kommen: Es war im Ausschuss recht lustig. Die Frau
Kollegin hat ja den Minister gefragt: Was ist falsch gelaufen? Der Minister
hat gesagt – Herr Minister, es ist ja mehr oder weniger eine
öffentliche Sitzung gewesen –, wenn er eine Zeitmaschine
hätte (Heiterkeit bei Abgeordneten
der SPÖ) – die Kollegen, die dabei waren, lachen jetzt
schon –, dann würde er sich 25 Jahre zurückbeamen und
die Familienpolitik in Österreich anders machen, damit wir
dieses Problem demografisch lösen. – Das waren Ihre Worte, Herr
Minister. Wir haben ja gestern die aktuellen Zahlen von den Fraktionen gesehen.
Die will ich jetzt gar nicht mehr aufwärmen. (Abg. Hörl: Wir
sind die Besten!)
Sie haben die Familienpolitik der einheimischen
Bevölkerung zerstört, sodass sich keiner mehr Kinder hat leisten
können – Punkt, aus, Amen. Deshalb
haben wir so wenige. (Zwischenrufe der Abgeordneten Heinisch-Hosek
und Greiner.)
Und das Zweite, was Sie falsch gemacht haben: Sie haben jetzt über Jahrzehnte Hunderttausende unqualifizierte Menschen ins Land geholt, die uns am Arbeitsmarkt nicht helfen, uns aber Milliarden Euro an Kosten verursachen – Milliarden, die hier in Österreich fehlen. – Danke. (Beifall bei der FPÖ. – Abg. Heinisch-Hosek: Treten Sie ab! – Abg. Greiner: Es gibt auch andere Unqualifizierte! – Abg. Heinisch-Hosek: Die gerade weggehen vom Pult!)
16.41
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Weratschnig. – Bitte.
Abgeordneter
Hermann Weratschnig, MBA MSc (Grüne):
Sehr geehrter
Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Minister! Wenn es nach der FPÖ
ginge, dann sind wahrscheinlich sogar nationale Grenzen zu weit gegriffen. Dann
gibt
es neun Bundesländer mit Landesgrenzen, jeder kriegt ein Gartenwerkzeug
und es gibt ein paar Gartenzwerge, die das Land bestellen. Busfahrer braucht
es keinen mehr, denn über die Landesgrenze kommt man ohnedies nicht mehr
hinaus. Das findet alles innerhalb der Landesgrenze statt, und die Wirtschaft funktioniert
und der Arbeitsmarkt funktioniert. – Also diese Begrifflichkeit von
Wirtschaft, von Arbeitsmarkt, die ist ja völlig jenseitig! So funktioniert das gesamte
System nicht. (Beifall bei Abgeordneten von Grünen und ÖVP.)
Wenn es um die Buslenkerinnen und Buslenker geht, sei an
dieser Stelle
einmal gesagt, dass in Österreich 1 100 Unternehmen mit circa
15 000 Beschäftigten und 9 000 Bussen, die
tagtäglich betrieben werden, arbeiten, davon 240 Unternehmen
im Linienbusverkehr. Öffentlicher Verkehr, dieses Werkl muss laufen, und
es läuft auch gut – aber es kommt an seine Grenzen. Und
was fordern wir zu Recht? – Dass
wir den öffentlichen Verkehr ausbauen. Es braucht dafür mehr
Ressourcen und es braucht natürlich auch mehr Personal. Auch mit
den bestehenden Ressourcen findet man nicht das Auslangen, deshalb wird es da
Pakete brauchen, und es ist richtig, es wird – wie
die SPÖ und wie auch Herr Stöger gesagt hat – auch
Sozialpakete brauchen.
Was die Länder betrifft,
so blicke ich da jetzt nach Vorarlberg, nach Wien
und nach Tirol. In Tirol hat der dortige SPÖ-Landesrat René
Zumtobel ein Sozialpaket geschnürt – völlig richtig
gemacht! –, mit dem man sehr klar auch die Arbeitsbedingungen
verbessert, indem man geteilte Dienste nicht mehr zulässt, indem man
Öffitickets auch für die Busfahrer:innen und für die Angestellten und für
die Beschäftigten bereitstellt. Also alles Dinge, die notwendig sind, und
trotzdem befinden wir uns auch in Tirol in der Situation, dass ein eklatanter Personalmangel
besteht, auch trotz der Tatsache, dass die Arbeitsbedingungen wesentlich
verbessert worden sind.
Es wird also mehrere
Maßnahmen brauchen, und eine der Maßnahmen ist natürlich eine
gezielte Arbeitsmigration für den öffentlichen Verkehr (Abg. Hörl:
Für alle!), eine gezielte Aktion im Bereich der
Rot-Weiß-Rot-Karte (Abg.
Hörl: Für alle!), in der Mangelberufsliste. Das ist,
glaube ich, ein wichtiger Schritt und wird von uns auch unterstützt. (Beifall
bei Abgeordneten von Grünen
und ÖVP.)
Natürlich braucht es da faire Bedingungen und die Einhaltung der strengen Regeln gegen Lohndumping, die wir in Österreich auch haben. Ja, selbstverständlich wird das auch eingehalten, ganz gleich woher, aus welchem Land jemand nach Österreich kommt. Und es braucht auch ein gutes Betriebsklima und vor allem auch Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten. (Abg. Wurm: Das ist dem Äthiopier sicher wichtig!) Es braucht auch ein gutes Arbeitsklima und vor allem auch Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten. (Abg. Wurm: Das Betriebsklima ist dem Äthiopier sicher wichtig!)
Weil wir bei den besseren Bedingungen sind, auch ein ganz
kritischer
Punkt: Es braucht in allen Bundesländern – da sind auch die
Verkehrsverbünde und auch die Busunternehmen gefragt, das wissen sie
auch – bessere Bedingungen, auch was die
Frauenbeschäftigung im Bereich des öffentlichen Busverkehrs
betrifft. Auch da ist viel zu tun, auch das wissen wir. (Beifall bei
den Grünen.)
Auch für all jene, die bei uns beschäftigt sind, gilt in gleicher Weise: faire Bedingungen, Aufrechterhaltung der strengen Regeln betreffend Lohndumping. Da bin ich ganz derselben Meinung wie die Gewerkschaft.
Was die Fachkräfte
betrifft: Die Buslenkerei ist ein Ganzjahresbetrieb, das ist natürlich
kein Saisonbetrieb, und dementsprechend müssen wir auch die Bedingungen
dafür schaffen – was auch Bestrebungen betreffend Personalunterkünfte
umfasst –, dass hier jemand das ganze Jahr auch sein Auslangen
findet und ein gutes Leben führen kann. Das gilt auch im Bereich des
öffentlichen Verkehrs.
Wir müssen den öffentlichen Verkehr mit allen
Takten und zukünftigen Verkehren unterstützen und die
vorhandenen Mitarbeiter:innen entlasten, denn –
Frau Abgeordnete Rebecca Kirchbaumer hat das ganz gut gesagt – der
eklatante Personalmangel führt nämlich derzeit auch dazu, dass das
bestehende Personal mehr Überstunden machen muss, weniger
Möglichkeiten für den Zeitausgleich hat (Abg. Hörl:
Das ist auch in der Gastronomie so!), weniger Möglichkeiten hat,
auf Urlaub zu gehen, dass auch ein gewisser Druck entsteht, ja nicht krank zu
werden. All diese Dinge belasten ein Arbeitsverhältnis, und deshalb muss
man, glaube ich, auch im Sinne des Arbeitnehmer:innenschutzes und der
Arbeitnehmer:innen sagen, dass sie da einfach Unterstützung brauchen – und
diese Unterstützung gewährleisten wir mit dem heutigen Beschluss. –
Danke. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
16.46
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Grünberg. – Bitte.
Abgeordnete Kira Grünberg (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzter Herr Minister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuseherinnen und Zuseher! Von den Buslenkerinnen und Buslenkern komme ich jetzt wieder zum Thema der Menschen mit Behinderungen.
Das Recht auf Arbeit ist
ein Menschenrecht. Arbeiten zu gehen ist für einige wenige
vielleicht einfach nur ein Mittel zum Zweck, um Geld zu verdienen, doch die
meisten sehen Arbeit als etwas Sinnstiftendes, Erfüllendes, etwas, das
sie gerne machen und wofür sie auch wertgeschätzt werden. Die Arbeit
kann das Selbstbewusstsein stärken, und man kann bei der Arbeit auch
Freunde
fürs Leben finden. Im Großen und Ganzen ist Arbeit durchaus etwas
Positives, und man leistet dabei auch einen Beitrag zu unserer Gesellschaft.
Junge Menschen mit Behinderung haben nun lange darum kämpfen müssen, überhaupt arbeiten gehen zu können, denn bis jetzt wurden sie oft bereits im jungen Alter von nur 15 Jahren verpflichtet, an einer Untersuchung zur Feststellung der Arbeitsfähigkeit teilzunehmen – oft leider mit dem Resultat, als arbeitsunfähig eingestuft zu werden, und damit wurde ihnen der Weg zum Arbeitsmarkt und auch viele weitere beruflichen Chancen verbaut.
Wir sollten nicht vergessen, auch Menschen mit Behinderungen
haben das Recht auf Arbeit. Wie mein Kollege Koza und auch der Bundesminister
schon gesagt haben, findet mit dem Gesetz, das heute vorliegt, ein Paradigmenwechsel statt,
was die Inklusion für Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt
betrifft: Ab dem 1.1. des nächsten Jahres kann die Feststellung
der Arbeitsfähigkeit beziehungsweise Arbeitsunfähigkeit
frühestens im 25. Lebensjahr stattfinden. Damit erhalten alle
Betroffenen den Zugang zu
den Leistungen des Arbeitsmarktservice und somit auch mehr Chancen in ihrer beruflichen Karriere. (Beifall bei der ÖVP
und bei Abgeordneten der Grünen.)
Sie können somit an den Schulungs- und
Qualifizierungsmaßnahmen des AMS teilnehmen und werden bei der
Arbeitssuche unterstützt. Es kommt zu
einer Gleichstellung von Menschen ohne Behinderungen und Menschen mit
Behinderungen. Diese benötigen manchmal etwas mehr Zeit, um ihre
Talente und Fähigkeiten zu erkennen und voll entfalten zu
können – und diese Zeit bekommen sie nun. Ich bin mir sicher,
dass unsere Arbeitswelt
davon profitieren wird und extrem bereichert wird, wenn junge Menschen mit
Behinderungen ihre Chance bekommen.
Mein besonderer Dank gilt nun auch noch unserem
Arbeitsminister
Martin Kocher, der für dieses Thema auf Anhieb ein offenes Ohr hatte und
die Umsetzung konsequent vorangetrieben hat. – Vielen Dank. (Beifall
bei
der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
16.49
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Als letzte Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Fiedler. – Bitte.
Abgeordnete
Fiona Fiedler, BEd (NEOS): Herr
Präsident! Sehr geehrter Herr Minister! Werte Kolleginnen und Kollegen!
Liebe Zuseherinnen und
Zuseher! (Die Begrüßung auch in Gebärdensprache
ausführend:) Liebe gehörlose Menschen! Es wurde schon mehrfach
erwähnt, dass es diese Regierungsvorlage, die wir nun
besprechen, betreffend Arbeitsunfähigkeit
schafft, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Istzustand zu
erreichen – deswegen haben wir im Ausschuss auch zugestimmt.
Bisher war es so, dass Menschen mit Behinderungen nach der
Pflichtschule meistens von der PVA auf Arbeitsunfähigkeit
überprüft worden sind.
So eine Arbeitsunfähigkeitsfeststellung macht es für diese Menschen
nahezu unmöglich, am Ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Der Weg
führt
dann in eine Tagesstruktur, wo man mit einem Taschengeld abgespeist wird,
keinen Urlaubsanspruch hat und auch sozialversicherungsrechtlich
nicht abgesichert ist.
Dass diese Prüfung auf Arbeitsunfähigkeit jetzt
erst mit 25 erfolgen soll, begrüßen wir ausdrücklich, das
möchte ich festhalten. Allerdings hat Kollege
Koza von einer Abschaffung und von einem Paradigmenwechsel gesprochen. Soweit
wir das in dieser Vorlage gesehen haben, ist das nur ein Verschieben bis zum
25. Lebensjahr, dann läuft alles wieder wie gehabt.
In den Abschlussbemerkungen der
Vereinten Nationen im Zuge der Staatenprüfung wurde auch angemerkt,
dass man vom medizinischen Modell hin
zum menschenrechtlichen Modell kommen muss, was diese Einschätzungen betrifft. Ein Paradigmenwechsel in dieser Angelegenheit wäre die komplette Abschaffung der Arbeitsfähigkeitsbeurteilung, einfach zu schauen, wo die Talente der Menschen liegen, zu schauen, was sie können – glauben Sie mir, jeder Mensch hat Talente –, und sie danach einer Arbeit zuzuweisen.
Es gibt aber auch noch einen
zweiten Kritikpunkt an dieser Novellierung. Es hat sich ein Bürger bei uns
gemeldet. Er hat uns freundlicherweise erlaubt,
sein Beispiel hier zu bringen. Es geht um den 19-jährigen Sohn dieses
Bürgers, der fatalerweise vor dem 1.1.2023 seine
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bekommen hat. Und da stellt man
sich die Frage: Warum fällt jemand, der am 31.12.2022 diese Bescheinigung
bekommen hat, raus, wenn der, der
sie am 1.1.2023 bekommen hat, drinnen ist?
Ihre Antwort war, beim neuen
Gesetz handle es sich um eine grundlegende Systemumstellung, die leider
eine Stichtagsregelung unumgänglich macht. Sie
haben davon gesprochen, dass das noch nicht der letzte Schritt war. Ich nehme
Sie da wirklich beim Wort. Wir sehen das aber trotzdem anders, das muss
besser gehen, und deshalb bringen wir auch folgenden Entschließungsantrag
ein:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Fiona Fiedler, BEd, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Stichtagsregelung bei Arbeitsunfähigkeit“
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung,
insbesondere der Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft, wird
aufgefordert, ein Konzept zu erarbeiten und dem Nationalrat vorzulegen, das auch jene Jugendliche und junge
Erwachsene unter 25 von
der vorgelegten Novellierung der Arbeitsunfähigkeitsprüfung
profitieren lässt, die ihren Bescheid vor dem Stichtag 1.1.2023
ausgestellt bekommen
haben.“
*****
Es ist absolut notwendig, dass wir diesen Antrag mit
breiter Mehrheit annehmen und eine Verbesserung gegenüber der
Stichtagslösung schaffen, damit wirklich alle Menschen unter 25
von der angestrebten Änderung profitieren. Das wäre der
Paradigmenwechsel, auf den wir alle warten, weil Inklusion nicht
karitativ ist, sondern ein Menschenrecht. Ich glaube, wir verzichten auf
wertvolle Arbeitskräfte, wenn wir diesem Antrag nicht mit breiter Mehrheit
zustimmen. – (Den Dank auch in Gebärdensprache
ausführend:) Danke.
(Beifall bei den NEOS.)
16.54
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Fiona Fiedler, Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen
betreffend Stichtagsregelung bei Arbeitsunfähigkeit
eingebracht im Zuge der
Debatte in der 245. Sitzung des Nationalrats über den Bericht des
Ausschusses für Arbeit und Soziales über die Regierungsvorlage
(2307 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz
1977, das Arbeitsmarktservicegesetz und das Ausbildungspflichtgesetz
geändert werden (2394 d.B.) – TOP 13
Mit einer Regierungsvorlage
(2307 d.B., 1), die am 7. Dezember 2023 im Sozialausschuss angenommen
wurde, plant das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft eine
Änderung der Arbeitsunfähigkeitsprüfung. Zukünftig soll die
Prüfung auf Arbeitsfähigkeit erst mit dem 25. Lebensjahr erfolgen.
Bisher war es üblich,
diese Prüfung bereits im Jugendalter durchzuführen, was zur Folge
hatte, dass Jugendliche und junge
Erwachsene mit Behinderungen frühzeitig vom (ersten) Arbeitsmarkt
ausgeschlossen wurden und ein späterer Einstieg somit enorm erschwert
wurde.
Die geplante Änderung geht hier einen Schritt in die
richtige Richtung (2), jedoch ist in der Regierungsvorlage eine
Übergangsregelung mit Stichtag gewählt. Dort heißt
es bei der Änderung des ASVG:
"Dem § 81 wird folgender Abs. 17 angefügt:
„(17) Gutachten des Kompetenzzentrums Begutachtung der Pensionsversicherungsanstalt zur
Beurteilung der Erwerbsfähigkeit gemäß
§ 252 Abs. 2 Z 3 ASVG sind, sofern
sie nicht vom AMS
angeordnet wurden, für Personen bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres außer Acht zu lassen.
Gutachten, die nach dem 1. Jänner 2023 vom Arbeitsmarktservice angeordnet wurden, sind bis zur
Vollendung des 25. Lebensjahres unbeachtlich.“"
Das Problem, das sich aus der Regelung ergibt, ist, dass
Personen, die vor
dem 1.1.2023 eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erhalten haben und
jünger als 25 sind, nicht von der Novellierung profitieren und die
Arbeitsunfähigkeit somit bestehen bleibt. Diese Handhabe kann
nicht im Sinne des Artikel 27 der UN-BRK (3) sein. Sinnvoller wäre es,
alle Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen für Menschen unter
25, unabhängig von einem Stichtag, für nichtig zu erklären - und
somit eine Diskriminierung bei diesen Fällen zu verhindern.
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
"Die Bundesregierung,
insbesondere der Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft, wird aufgefordert, ein Konzept zu erarbeiten und
dem Nationalrat vorzulegen,
das auch jene Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 von der vorgelegten
Novellierung der Arbeitsunfähigkeitsprüfung profitieren
lässt, die ihren Bescheid
vor dem Stichtag 1.1.2023 ausgestellt bekommen haben."
1. https://www.parlament.gv.at/gegenstand/XXVII/I/2307
2. https://www.behindertenrat.at/2023/06/ams-angebote-bei-arbeitsunfaehigkeit-fuer-unter-25-jaehrige/
*****
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Der Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht, ausreichend unterstützt und steht auch mit in Verhandlung.
Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
Ist seitens der Berichterstattung ein Schlusswort gewünscht? – Das ist nicht der Fall.
Somit kommen wir zu den Abstimmungen, die ich über jeden Ausschussantrag getrennt vornehme.
Wir gelangen zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 13: Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz, das Arbeitsmarktservicegesetz und das Ausbildungspflichtgesetz geändert werden samt Titel und Eingang in 2307 der Beilagen.
Wer dafür ist, den bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen. – Das ist einstimmig angenommen.
Wir kommen sogleich zur dritten Lesung.
Wer das auch in dritter Lesung tut, möge das bekunden. – Auch in dritter Lesung: einstimmig angenommen.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Muchitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Personalaufstockung beim Arbeitsmarktservice und der Arbeitsinspektion“.
Ich bitte die Damen und Herren, die dafür sind, um ein dementsprechendes Zeichen. – Das ist die Minderheit, abgelehnt.
Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Fiedler, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Stichtagsregelung bei Arbeitsunfähigkeit“.
Wer dafür ist, den bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen. – Das ist die Minderheit, abgelehnt.
Wir kommen zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 14: Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Ausländerbeschäftigungsgesetz und das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz geändert werden samt Titel und Eingang in 2395 der Beilagen.
Wer dafür ist, den bitte
ich um ein dementsprechendes Zeichen. – Das ist
die Mehrheit, angenommen.
Wir kommen zur dritten Lesung.
Wer das auch in dritter Lesung
tut, möge das bekunden. – Das ist auch in dritter Lesung das
gleiche Stimmverhalten. Der Gesetzentwurf ist somit auch in
dritter Lesung mit Mehrheit angenommen.
Bericht des Unterrichtsausschusses über die Regierungsvorlage (2311 d.B.): Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die Förderung von Bildungsmaßnahmen im Bereich Basisbildung sowie von Bildungsmaßnahmen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses für die Jahre 2024 bis 2028 (2330 d.B.)
16. Punkt
Bericht des Unterrichtsausschusses über den Antrag 3641/A(E) der Abgeordneten Eva Maria Holzleitner, BSc, Kolleginnen und Kollegen betreffend Wiederverleihung des Staatspreises Erwachsenenbildung (2331 d.B.)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Wir kommen zu den Punkten 15 und 16 der Tagesordnung, über welche die Debatten wieder unter einem durchgeführt werden.
Ich begrüße den Herrn Bildungsminister und bedanke mich beim Herrn Wirtschaftsminister.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Brückl. – Bitte.
Abgeordneter Hermann Brückl, MA
(FPÖ): Herr Präsident! Sehr
geehrter Herr Bundesminister! Hohes Haus! Es geht bei diesem Tagesordnungspunkt
unter anderem um eine Artikel-15a-Vereinbarung zwischen dem Bund und den
Ländern, mit der im Zeitraum von 2024 bis 2028 insgesamt 117,2 Millionen Euro Steuermittel
zur Verfügung gestellt werden sollen, um Lehrgänge für
Erwachsene, die den Pflichtschulabschluss nachholen, beziehungsweise
Lehrgänge im Bereich der Vermittlung von Grundkompetenzen zu finanzieren.
Grundsätzlich darf ich
sagen, dass diese Vereinbarung erstmals im
Jahr 2011 geschlossen wurde. Wir Freiheitliche haben damals auch
mitgestimmt, es gab damals einen einstimmigen Beschluss. Wir haben aber damals
schon darauf hingewiesen, dass wir als FPÖ es als unbedingt notwendig empfinden, dass
es da eine Kontrolle gibt, dass es eine laufende Evaluierung im Sinne dessen
gibt: Was bringt dieses Programm?, Kommen diese Menschen tatsächlich am
Arbeitsmarkt unter?, Was ist der Erfolg insgesamt?, und so weiter.
Am Ende des Tages
verlängern wir diese 15a-Vereinbarung zum dritten Mal. Wir stopfen sehr,
sehr viel Geld hinein, aber wir wissen am Ende nicht, was es
bringt. Was ist der Erfolg? – Wir wissen es nicht. Man tut ganz
einfach so weiter wie bisher – ähnlich wie wir das von den
Pisa-Testungen kennen, worüber
wir gestern schon gesprochen haben. Man erhält ein Ergebnis, man
schaut es sich an, aber man reagiert nicht darauf, und genau das ist auch da
wiederum der Fall.
Da verpufft wirklich sehr, sehr
viel Geld in einem System, in einem Parallelsystem nämlich, muss man
fast sagen, das man neben einem grundsätzlich
wirklich guten Bildungssystem, das heruntergewirtschaftet ist – das
darf man
so festhalten –, als zweite Schiene aufbaut.
Diese Parallelstrukturen sind
aus unserer Sicht ganz einfach nicht notwendig. Wir geben in Österreich
sehr, sehr viel Geld für Bildung aus. Im weltweiten Vergleich
liegt Österreich, was die Pro-Kopf-Ausgaben je Schüler betrifft,
ganz, ganz weit vorne, gleichzeitig aber ernten wir nicht den Erfolg, den
wir gerne hätten, weil die Visionen fehlen, weil die Vorstellungen fehlen,
weil der Weitblick einfach nicht gegeben ist.
Es ist am Ende des Tages eine
Loch-auf-Loch-zu-Politik ohne Strategie,
ohne Weitblick. Im Grunde genommen ist das auch sinnbildlich für diese
Regierung, der es einfach am notwendigen Weitblick fehlt.
Es kracht und knarrt in unserem ganzen Bildungssystem. Wir
brauchen
eine Generalsanierung, das muss man so sagen. Wir brauchen eine Generalsanierung
und keine kosmetischen Korrekturen, und zwar insgesamt bei den Lehrplänen,
die wir unbedingt erneuern müssen, neu schreiben müssen, genauso wie
in der Bürokratie, in der Besoldung. Wir müssen mehr Wert auf die
Sprache vor allem eben schon in den elementaren Bildungseinrichtungen legen.
Das ist unbedingt notwendig. (Präsidentin Bures übernimmt
den Vorsitz.)
Es geht darum, dass wir Bildung und Leistung in diesem Land
so verknüpfen, dass unsere Kinder am Ende des Tages wissen, was sie zu tun
haben,
dass sie auch eine Perspektive haben und dass sie positiv in die Zukunft gehen
können. (Beifall bei der FPÖ.)
17.00
Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Romana Deckenbacher. – Bitte.
Abgeordnete Mag. Romana Deckenbacher
(ÖVP): Frau Präsidentin! Herr
Bundesminister! Hohes Haus! Sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher und
Besucherinnen und Besucher hier bei uns! Die Piaac-Studie aus dem
Jahr 2013 – das ist eine internationale Studie, die alle zehn
Jahre stattfindet und über Grundkompetenzen von Erwachsenen Bescheid geben
und Aussagen darüber treffen soll – sagt aus, dass eine
Vielzahl von Personen in Österreich leider nicht über
ausreichende Alltagskompetenzen – das heißt, Lesen, Schreiben,
Rechnen, aber auch digitale Grundkompetenzen – verfügt, um
angemessen am sozialen Leben, aber auch erfolgreich am
Arbeitsmarkt teilhaben zu können. Jede und jeder Einzelne von ihnen
ist einer zu viel! (Beifall bei der ÖVP
sowie bei Abgeordneten von SPÖ und Grünen.)
Bildung ist der Schlüssel
zum Erfolg und zur persönlichen und beruflichen Entfaltung und, ja,
trägt natürlich auch zu einem besseren, aber vor allem zu
einem selbstbestimmten Leben bei. So ist es wichtig, dass auch Menschen mit
geringer Basisbildung die Möglichkeit bekommen, den Pflichtschulabschluss nachzuholen
beziehungsweise durch Teilnahme an Programmen in
der Erwachsenenbildung Bildungslücken zu schließen.
Bereits im Jahr 2012 wurde
ein österreichweit einheitliches Förderprogramm von Bund und
Ländern beschlossen. Mehrmals wurde diese Vereinbarung seither
verlängert, und sie soll auch in Zukunft weitergeführt werden.
Für diese Fortführung des Förderprogramms werden für den
Zeitraum 2024
bis 2028 circa 117,2 Millionen Euro an Fördermitteln aufgebracht, aufgeteilt zwischen Bund und Ländern. Die Mittel des Bundes für diese 15a-Vereinbarung werden ab 2024 sogar jährlich um rund 30 Prozent erhöht.
Mit diesen Investitionen sollen
weitere 23 000 Personen die Möglichkeit bekommen,
Basisbildungsangebote in Anspruch zu nehmen, und weiteren 11 000 Personen,
die über keinen Pflichtschulabschluss verfügen, soll
es ermöglicht werden, diesen nachzuholen.
Diese Programme sind für
Personen ab dem vollendeten 15. Lebensjahr, und es sollen dort Grundlagen
der schriftlichen und mündlichen Kommunikation
der deutschen Sprache gelehrt werden, aber auch mathematische sowie digitale
Kompetenzen sollen erweitert werden.
Es ist ein klares Ziel, dass es dadurch weniger Personen mit Mindestqualifikation geben soll und mehr Personen einen Platz am Arbeitsmarkt bekommen, denn uns darf niemand verloren gehen! (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
Bildung ist somit auch im Erwachsenenalter für jeden und jede zugänglich. Sie trägt immer zur persönlichen Entwicklung, aber auch zum gesellschaftlichen Wohl bei.
Diese 15a-Vereinbarung wird Jugendlichen ohne positiven Bildungsabschluss sowie geringqualifizierten Erwachsenen in ganz Österreich das kostenlose Nachholen von Bildungsabschlüssen ermöglichen.
Das ist ein ganz wesentlicher Schritt, einerseits natürlich um Menschen Perspektiven zu geben, aber andererseits natürlich auch um dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken, denn wir geben Menschen Zukunft für unsere Zukunft. – Danke. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
17.04
Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Katharina Kucharowits. – Bitte.
17.04
Abgeordnete Katharina Kucharowits
(SPÖ): Frau Präsidentin!
Werter Herr Bundesminister! Geschätzte Kollegen und Kolleginnen! Liebe
Zuseherinnen und Zuseher! Menschen, die schlecht oder gar nicht lesen oder auch
schreiben können, haben es mit Sicherheit sehr, sehr schwer im Leben –
nämlich jene, die einfach noch nicht die Chance bekommen haben. Da gibt es
dann oftmals
auch das Phänomen, das Ganze zu verstecken, auch ein bisschen zu verheimlichen,
zu überspielen, und man ist natürlich in vielen, vielen Lebenslagen
und Situationen total abhängig von allen anderen. Auch das Phänomen
des Sich-dafür-Schämens kommt noch ganz, ganz verstärkt hinzu.
Ich bin der Meinung, niemand
soll sich, darf sich und muss sich dafür schämen, wenn er oder sie
nicht ausreichend oder gar nicht lesen oder schreiben
kann. (Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordneten der Grünen.)
Das Gegenteil ist der Fall: Wir
haben eine Verantwortung als Gesellschaft, aber vor allem als Politik, diese
Scham, diese Tabuzone endlich wegzubekommen und Angebote auf die
Füße zu bekommen, um eben allen Menschen zu
ermöglichen – wurscht, in welcher Lebenslage sie stecken, und
egal,
wie alt sie sind –, lesen und schreiben zu lernen. Warum ist das so
wichtig? – Kollegin Deckenbacher ist schon darauf eingegangen: weil
es halt total schwierig ist, wenn man über diese Schlüsselkompetenzen
nicht verfügt. Sie hat
auch die Studie erwähnt: Eine Million Menschen in Österreich sind
nach dieser Studie davon betroffen.
Wenn man in diesen Schlüsselkompetenzen nicht ausreichend bewandert
ist, tut man sich halt total schwer, am sozialen Leben
teilzuhaben – das ist das eine –, aber auch einen Job zu
finden oder im Job zu bleiben – das ist
das andere. Das ist einfach ungemein schwer.
Viele von dieser einen Million Menschen haben auch keinen
Pflichtschulabschluss, das muss man auch einmal in dieser Form sagen.
Deshalb ist
es ganz, ganz dringend notwendig, dem wirklich entgegenzuwirken und ein Angebot
auf die Füße zu bekommen.
Bereits 2012 gab es die
Initiative Erwachsenenbildung. Sie ist damals eingeführt worden.
Heute, geschätzte Kollegen und Kolleginnen, beschließen wir mittels
der 15a-Vereinbarung mehr als 170 Millionen Euro. Das finanzieren
der Bund, die Bundesländer, und Teile davon kommen auch aus dem
Europäischen Sozialfonds. Mit diesen 170 Millionen Euro sollen
rund 23 000 Menschen im Bereich der Basisbildung einfach
unterstützt und fit gemacht werden, und 11 000 Menschen sollen
die Möglichkeit haben, ihren Pflichtschulabschluss nachzuholen.
Das ist ganz, ganz wichtig, um eben selbstbestimmt leben zu können und im
Leben bestehen zu können. Deshalb ist das heute ein
ganz, ganz wichtiger und guter Beschluss.
Lassen Sie mich aber abschließend auch noch zum Staatspreis für Erwachsenenbildung kommen: Seit der ÖVP-FPÖ-Regierung ist der irgendwie abgeschafft worden. Er war nicht mehr da, warum auch immer, das ist offen gesagt unklar.
Kollegin Holzleitner hat das Thema aber wieder auf die Agenda gebracht, und es ist gelungen – wir werden das heute gemeinsam beschließen –, den Staatspreis für Erwachsenenbildung wieder einzuführen. (Beifall bei der SPÖ sowie bei Abgeordneten von ÖVP und Grünen.) Dieser wird alle zwei Jahre vergeben werden. Deswegen sage ich an dieser Stelle: Danke für den gemeinsamen Beschluss! (Beifall bei der SPÖ.)
17.07
Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Sibylle Hamann. – Bitte.
Abgeordnete Mag. Sibylle Hamann
(Grüne): Liebe Frau
Präsidentin! Lieber Herr Bundesminister! Auch ich freue mich sehr
über dieses Thema und über diese 15a-Vereinbarung, die wir heute
diskutieren. Ich kann gleich an die Worte meiner Vorrednerin anschließen.
Warum ist es denn überhaupt notwendig,
dass wir Angebote für das kostenlose Nachholen eines
Pflichtschulabschlusses
oder für den Erwerb von Basisbildung haben? – Das ist einfach so, weil Biografien oft nicht so geradlinig verlaufen, wie wir es uns vielleicht manchmal wünschen.
Es gibt manchmal Brüche in
unserem Leben. Das können Krisen sein, das
können Fluchterfahrungen sein, das können auch Krankheiten oder
schwierige familiäre Umstände sein. Manchmal hat man von Anfang an
schon einen schlechten Start und bricht die Schule ab, manchmal gibt es
Ereignisse, die einen erst später aus der Bahn werfen. Wir brauchen in
unserer Gesellschaft
aber alle Menschen, auch die Menschen, die Krisen durchlaufen haben, und wir
brauchen jedes einzelne Talent und jedes Potenzial, das noch schlummert,
weil wir alle Ressourcen heben müssen. (Beifall bei den Grünen
sowie bei Abgeordneten von ÖVP und SPÖ.)
Wir brauchen jeden Einzelnen
dieser Menschen auf dem Arbeitsmarkt,
aber auch als vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft. Wir müssen die
Menschen mit Programmen dort abholen, wo sie stehen. Kollegin Deckenbacher hat einige
der Inhalte, die in diesen Basisbildungsangeboten enthalten sind, bereits
erwähnt. Ich möchte vielleicht noch einige Punkte herausgreifen,
die aus unserer Sicht besonders wichtig sind. Basisbildungsprogramme sind
grundsätzlich für alle Menschen da, die in Österreich
leben – unabhängig zum Beispiel auch vom
Aufenthaltsstatus. Das heißt, sie sind auch für Asylwerbende da. Aus
unserer Sicht ist das Integration ab Tag eins und entspricht genau unserem
grünen Zugang. (Beifall bei den Grünen.)
Basisbildungsangebote brauchen auch einen ganzheitlichen
Zugang zur Person. Sie müssen sich auf vielfältige, vielleicht auch
schwierige Lebensverhältnisse einstellen. Sehr oft muss man da
Kinderbetreuung oder die Pflege von Angehörigen mitdenken oder auch manche
Elemente einer Ausbildung
in der Erstsprache anbieten. Kommunikation und Persönlichkeitsbildung sind
ganz wesentliche Elemente, auch die sind wichtig.
Ein letzter Punkt: Es geht meistens doch um noch junge Leute, die diese Angebote in Anspruch nehmen. Da gibt es jetzt in dieser Neufassung der Vereinbarung eine Neuerung: Die haben künftig in der Steuerungsgruppe, von der diese Bildungsprogramme entworfen werden, eine Stimme, eine beratende Stimme. Die Bundesjugendvertretung wird in diesem Gremium neben den Sozialpartnern vertreten sein. Wir finden es extrem wichtig, dass auch Jugendliche ihre Lebenswirklichkeit, ihre Bedürfnisse, ihre Perspektiven in die Konzeption einfließen lassen können. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
Das heißt, auch ich freue mich sehr über diese neue,
wesentlich ausgeweitete Vereinbarung, und ich freue mich ebenso auch
über die Wiederverleihung des Staatspreises für
Erwachsenenbildung.– Danke schön.
(Beifall bei Grünen und
ÖVP.)
17.11
Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Martina Künsberg Sarre. – Bitte sehr.
Abgeordnete
Mag. Martina Künsberg Sarre (NEOS):
Frau Präsidentin!
Herr Minister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuschauerinnen und
Zuschauer! Auch wir stimmen dieser 15a-Vereinbarung zu. Wir finden
das natürlich gut, und es sind wichtige Maßnahmen, die da
beschlossen werden.
Wir wissen aus verschiedenen Studien, dass circa eine
Million Menschen
in Österreich nicht über ausreichende Kompetenzen in Lesen, Schreiben
und Rechnen verfügen, und das sind natürlich nicht nur Zugewanderte,
sondern ganz deutlich auch andere, hier geborene und schon lange
in Österreich befindliche Menschen. Das ist natürlich schwierig. Wenn
man nicht
über die Mindestvoraussetzungen in den Grundkompetenzen verfügt, kann
man am gesellschaftlichen Leben nicht teilnehmen, man kann nicht Teil des Arbeitsmarktes
werden und man kann auch nicht für sich persönlich
gute Entscheidungen treffen.
Wir unterstützen diese Maßnahmen. Der Anspruch muss natürlich sein, dass die Zahl der Menschen, die als Erwachsene nicht lesen, schreiben und rechnen können, verringert wird, dass vor allem aber auch in den Schulen die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die mit 15 Jahren aus der Pflichtschule rausgehen und von denen jeder vierte eben nicht sinnerfassend lesen kann, verringert wird.
Das ist ein Drama: Leute, die neun Jahre in der Schule
waren und dann rauskommen und einfachste Texte nicht lesen
können – das ist ein Totalversagen der Schule oder der
Bildungspolitik. – Herr Minister, auch da
sind Sie gefordert, die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die nicht
lesen können, nicht gut lesen können, zu minimieren. Ich freue mich
sehr auf Ihre Vorschläge dazu, die Sie uns sicherlich in
Kürze mitteilen werden. – Danke. (Beifall bei
den NEOS.)
17.13
Präsidentin Doris Bures: Ja, und jetzt gelangt Herr Bundesminister Martin Polaschek zu Wort. – Bitte.
Bundesminister
für Bildung, Wissenschaft und Forschung Dr. Martin Polaschek: Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten
Damen und Herren! Es ist bereits
von verschiedenen Seiten angesprochen worden, welch wichtige Funktion diese
Artikel-15a-Vereinbarung hat, und es ist auch bereits angesprochen worden, dass
es leider Menschen gibt, die aus dem Bildungssystem kommen und die Grundkompetenzen aus verschiedensten Gründen
nicht haben oder irgendwann einmal auch wieder verlernt haben.
Es ist ja so, dass Lesen, Schreiben und Rechnen Kulturtechniken sind, die man,
wenn man sie längere Zeit nicht verwendet und längere Zeit nicht
übt, auch wieder vergessen kann. Es muss aber natürlich unser Ziel
sein, dass die jungen Menschen, die aus dem Schulsystem hinausgehen,
diese Qualifikationen haben und diese Qualifikationen
auch behalten.
Deshalb sind wir auch bereits
tätig geworden. Deshalb steht ja dieses Schuljahr auch unter dem Motto
Lesekompetenz. Wir haben bereits verschiedene Maßnahmen auf Schiene
gebracht, und in den nächsten Monaten werden weitere Maßnahmen
folgen, um gerade das Lesen vermehrt im Schulbereich zu verankern und vor allem
auch die Jüngeren noch mehr zum Lesen zu motivieren. Das wird
natürlich auch über dieses Jahr hinausgehen, denn Lesen ist die
erste Grundkompetenz, die man braucht, um später sowohl schulisch als auch
im gesellschaftlichen Leben den Anschluss zu behalten und beruflichen Erfolg
zu haben.
Wir brauchen trotzdem dieses
Sicherheitsnetz, denn wir haben keine Garantie dafür, dass Menschen da
nicht, aus welchen Gründen auch immer, hinausfallen. Deshalb
danke ich Ihnen allen sehr, dass Sie dieses Netz gemeinsam mit uns nun wieder
einmal knüpfen. Die Budgetmittel steigen auf insgesamt
114,2 Millionen Euro für den Bund – da kommen noch
55,6 Millionen Euro durch den Europäischen Sozialfonds
dazu – und 58,6 Millionen Euro
für die Länder, sodass insgesamt – es wurde bereits
gesagt – Mittel in Höhe
von fast 173 Millionen Euro zur Verfügung stehen.
Wir werden dadurch die
Möglichkeit haben, Menschen, die es wirklich
für sich, für ihr berufliches Fortkommen brauchen, zu unterstützen,
damit sie sich auch in der Gesellschaft sicher bewegen können. Gerade auch
in Anbetracht dessen, dass wir einen Fachkräftemangel haben, leisten wir
damit einen wichtigen Beitrag dazu, dass diese Menschen am Arbeitsmarkt
entsprechend vermittelt werden können und die Möglichkeit haben,
zumindest zu
einem kleinen Wohlstand zu kommen.
Ich danke Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten, deshalb sehr für die breite Unterstützung dieser so wichtigen Maßnahme. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
17.16
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Johann Weber. – Bitte.
17.16
Abgeordneter Ing. Johann Weber
(ÖVP): Frau Präsidentin! Herr
Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Geschätzte Damen
und Herren auf
der Galerie – ein paar sind ja noch hier – und vor allem
zu Hause vor
den Bildschirmen! Ich habe schon öfter gesagt: Bildung schafft Chancen,
Bildung schafft Perspektiven, Bildung schafft einfach Zukunft. Bildung bedeutet
für eine Person einen ungeheuren Mehrwert und auch für die
Gesellschaft – das haben auch schon meine Vorrednerinnen und
Vorredner gesagt –, und das
gleich in mehrfacher Hinsicht. Bildung öffnet nämlich auch die Augen
und ermöglicht einen ganz anderen Blick auf die Dinge des Lebens. Bildung
hilft, Vorurteile und Vorbehalte gegenüber anderen abzubauen. Bildung
erleichtert somit indirekt das Zusammenleben und stärkt den
gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ausbildung und Bildung stärken aber
auch das wirtschaftliche Zusammenleben in der Gesellschaft, denn wer gut
ausgebildet ist, kann sich und seine Fähigkeiten in die Gemeinschaft
einbringen und die Türen zum Wohlstand öffnen.
Bildung – darauf
möchte ich ganz besonders hinweisen – ist das einzige krisenfeste
Kapital. Das kann einem niemand mehr wegnehmen, und man hat
es selber in der Hand, es entsprechend auszubauen, zu vermehren.
Mit dem vorliegenden
Gesetzentwurf wird genau dem Rechnung getragen. Wir wollen vorerst bis 2028
Bildungsmaßnahmen im Bereich Basisbildung
sowie Bildungsmaßnahmen zum Nachholen des
Pflichtschulabschlusses – was auch schon angesprochen worden
ist – besonders fördern. So sollen auch
in den nächsten Jahren – gerade in Zeiten des
Fachkräftemangels, wie man immer wieder hört – Potenziale
für den Arbeitsmarkt mobilisiert und
ein individueller sozialer und wirtschaftlicher Aufstieg für viele
Menschen ermöglicht werden.
Deswegen werden künftig die Mittel des Bundes für die 15a-Vereinbarung Erwachsenenbildung auf mindestens 11,7 Millionen Euro erhöht, was eine
Steigerung von 30 Prozent bedeutet. Somit steigen die jährlich der Erwachsenenbildung zur Verfügung stehenden Beträge von Bund, Ländern und dem Europäischen Sozialfonds von rund 28 Millionen Euro auf rund 35 Millionen Euro, das ist ein Plus von 7 Millionen Euro. Diese Gelder, geschätzte Damen und Herren, sind sehr gut eingesetzt, denn sie geben Menschen – ich komme damit wieder zum Beginn meiner Rede – Chancen, Perspektiven und Zukunft. – Danke. (Beifall bei der ÖVP.)
17.19
Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Andrea Kuntzl. – Bitte.
Abgeordnete Mag. Andrea Kuntzl
(SPÖ): Frau Präsidentin! Herr
Bundesminister! Sehr geehrte Damen und Herren! In dieser Debatte ist von meinen
Vorredner:innen schon sehr viel Richtiges gesagt worden. Es gibt in diesem
Punkt erfreulicherweise eigentlich einen sehr breiten Konsens hier im Haus. Es
ist ein unerträglicher Zustand – das sehen wir, glaube ich,
alle so –, dass ungefähr eine Million Menschen in unserem Land
nicht über die allernotwendigsten Grundkompetenzen verfügen, und
daher ist es unsere größte Verpflichtung, etwas dagegen zu tun und
Angebote auf die Beine zu stellen, um diesen Menschen unter die Arme zu greifen
und damit zu einer Selbstermächtigung beizutragen.
Wir verlieren viel zu viele
junge Menschen auf dem Weg zum Pflichtschulabschluss, aber es ist
offensichtlich auch so, dass viel zu viele junge Menschen die Schule
verlassen, ohne über die Grundkompetenzen in ausreichendem Ausmaß
zu verfügen. Es ist daher sehr wichtig, dass da eben die entsprechenden
Angebote kommen, dass wir das heute beschließen
und diese Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden.
Der Grundsatz, der für uns
in der Bildungspolitik seit vielen, vielen Jahren gilt, nämlich kein Kind
zurückzulassen, muss nämlich erweitert werden:
keinen Menschen zurücklassen! Auch die ein bisschen älter gewordenen
Kinder, die Jugendlichen und Erwachsenen, die über diese notwendigen
Fähigkeiten nicht verfügen und diese Qualifikation
später erwerben wollen, verdienen eine Chance und unsere
Unterstützung dabei. (Beifall bei der SPÖ sowie
des Abg. Taschner.)
Aus diesem Grund sind wir sehr gerne dabei, unterstützen dieses Vorhaben und werden heute dafürstimmen.
Der zweite Punkt, den wir jetzt diskutieren, ist die
Wiederverleihung des Österreichischen Staatspreises für
Erwachsenenbildung. Da ist aus unserer Sicht gar nicht einsichtig, warum der in
den letzten Jahren nicht vergeben wurde. Kollegin Holzleitner hat jetzt die
Initiative ergriffen, dass dieser Preis wieder verliehen werden soll, um
innovative, wichtige Projekte vor den Vorhang zu
holen, eine entsprechende Wertschätzung auszusprechen und Motivation zu wecken.
Wir sind sehr froh, dass es zu diesem Antrag Zustimmung geben
wird. (Beifall bei der SPÖ sowie des Abg. Taschner.)
17.21
Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Agnes Totter. – Bitte.
Abgeordnete
MMag. Dr. Agnes Totter, BEd (ÖVP):
Frau Präsidentin! Ich
darf zuallererst einige Grüße ausrichten: Im Namen meiner Kollegen
Fritz Ofenauer und Christoph Zarits begrüße ich eine Abordnung des
NÖAAB aus Sankt Pölten. – Herzlich willkommen! (Beifall bei ÖVP, SPÖ und Grünen
sowie bei Abgeordneten der FPÖ.)
Im Namen meines Kollegen Hans Stefan Hintner
begrüße ich außerdem
eine Delegation der Unicredit NÖ-Süd/Burgenland, bei der auch der
Bruder meines Kollegen, Mag. Herbert Hintner, dabei ist. –
Herzlich willkommen! (Beifall bei der ÖVP sowie bei
Abgeordneten von SPÖ und Grünen.)
Sehr geehrter Herr
Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Geschätzte
Damen und Herren auf der Galerie und vor den Bildschirmen!
Wer über zu wenig Bildung und Qualifikation verfügt, kann am
gesellschaftlichen Leben gar nicht oder nur eingeschränkt teilnehmen und
bringt sich auch
um die Chance, ein selbstbestimmtes und wirtschaftlich unabhängiges Leben
zu führen.
Als ausgebildete Pädagogin
und im Bildungsbereich Tätige bin ich mit dem Bildungswesen in
Österreich bestens vertraut. Zugleich bin ich auch Abgeordnete meiner
lebenswerten Region Südoststeiermark, und mittlerweile sprechen mich
dort auch viele Unternehmer an und teilen mir mit, dass sie
nur schwer qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden. Sie
können dadurch Aufträge nicht annehmen, und das schwächt durch
nicht generierte Wertschöpfung und dadurch verlorene Kaufkraft
die gesamte Region.
Gleichzeitig gibt es leider
noch immer zu viele Menschen, die – aus welchen Gründen
auch immer – über keinen Pflichtschulabschluss verfügen
und denen wir eine höhere Qualifikation ermöglichen müssen. Mit
den aus
diesem Gesetzentwurf resultierenden Maßnahmen fördern wir das
Erlangen von Pflichtschulabschlüssen und ermöglichen so eine
Höherqualifikation, um
in den Arbeitsmarkt einsteigen zu können. Konkret wird es bis 2028
zusätzliche Förderungen für Bildungsmaßnahmen im Bereich
der Basisbildung sowie
für Bildungsmaßnahmen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses
geben. (Beifall bei der ÖVP.)
Zählt man die Beträge von Bund, Ländern und
dem Europäischen Sozialfonds zusammen, so steigen die jährlich
für die Erwachsenenbildung zur Verfügung stehenden Mittel
von rund 28 Millionen Euro auf 35 Millionen Euro. Dass der Bund nun
die genannten Maßnahmen setzt, ist richtig und wichtig,
denn von SPÖ-Bildungsministerinnen verschuldete Versäumnisse in der
Bildungspolitik müssen dringend behoben und ausgeglichen werden.
(Beifall bei der ÖVP.)
Aus den Fehlern der
Vergangenheit müssen wir lernen und erkennen, dass sich eine Investition in die schulische
Basisbildung – und diese erfolgt in erster
Linie in der Volksschule – jedenfalls lohnt. (Zwischenruf
der Abg. Kucharowits.)
Gerade in der Grundstufe I,
der Volksschule, werden die so wesentlichen Grundkompetenzen vermittelt.
Häufig müssen auch Versäumnisse im Elternhaus ausgeglichen
werden. Daraus resultierend können die Entwicklungsunterschiede der
Kinder im Schuleingangsbereich bis zu fünf Jahre betragen. Für die Kolleginnen und Kollegen in den Volksschulen ist
es eine wirkliche Herausforderung, diese Unterschiede auszugleichen
und alle Kinder bestens zu fördern. – Ich danke
ihnen für diese großartige Arbeit! (Beifall bei
der ÖVP sowie des Abg. Schwarz.)
Dank gebührt auch unserem Herrn Minister Polaschek für seine Bereitschaft, auf diesen so sensiblen Bereich gut zu achten, denn da sind zusätzliche Ressourcen dringend notwendig.
Geschätzte Damen und
Herren! Die administrative Unterstützung an den Pflichtschulen ist
ein Meilenstein, und sie ist eine Unterstützung nicht nur für
Schulleitungen, sondern auch für alle Lehrkräfte und somit eine
große Unterstützung für die gesamte Schule. In diesem
Bereich müssen wir dranbleiben, denn eine flächendeckende
Umsetzung der administrativen Assistenz
ist wichtiger denn je.
Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern und auch allen Lehrkräften ein gesegnetes Weihnachtsfest und erholsame, wirklich verdiente Ferien und bedanke mich bei allen Pädagoginnen und Pädagogen an unseren Pflichtschulen für die wertvolle Arbeit. – Herzlichen Dank. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
17.26
Präsidentin
Doris Bures: Zu Wort ist dazu nun
niemand mehr gemeldet.
Die Debatte ist damit geschlossen.
Wird seitens der Berichterstattung ein Schlusswort gewünscht? – Das ist nicht der Fall.
Wir kommen zu den Abstimmungen, die ich über jeden Ausschussantrag getrennt vornehme.
Wir kommen zur Abstimmung
über Tagesordnungspunkt 15: Antrag des
Unterrichtsausschusses, den Abschluss der Vereinbarung gemäß
Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die
Förderung von Bildungsmaßnahmen im Bereich Basisbildung sowie
von Bildungsmaßnahmen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses
für die Jahre 2024 bis 2028
in 2311 der Beilagen zu genehmigen.
Wer sich dafür ausspricht,
den bitte ich um ein Zeichen. – Das ist mit
Mehrheit angenommen.
Wir kommen zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 16, die dem Ausschussbericht 2331 der Beilagen angeschlossene Entschließung betreffend „Wiederverleihung des Staatspreises Erwachsenenbildung“.
Wer spricht sich dafür aus? – Auch das ist mit Mehrheit angenommen. (353/E)
Bericht des Unterrichtsausschusses über den Antrag 3717/A(E) der
Abgeordneten Mag. Martina Künsberg Sarre,
Mag. Dr. Rudolf Taschner,
Mag. Sibylle Hamann, Kolleginnen und Kollegen betreffend Prävention
vor Extremismen (2332 d.B.)
Präsidentin Doris Bures: Wir gelangen zum 17. Punkt der Tagesordnung.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Herr Abgeordneter Hermann Brückl, ich erteile Ihnen das Wort.
17.28
Abgeordneter Hermann Brückl, MA
(FPÖ): Frau Präsidentin! Sehr
geehrter Herr Bundesminister! Hohes Haus! Es geht bei diesem Tagesordnungspunkt
um
einen Entschließungsantrag, in dem der Bildungsminister ersucht wird,
„in seinem Wirkungsbereich Maßnahmen zu ergreifen“, um
wirksam Antisemitismus zu bekämpfen „sowie Extremismus von
linker, von rechter oder von islamistischer Seite präventiv“
entgegenzuwirken.
Das ist eine Präambel, die
wir selbstverständlich auch unterstützen können, aber in diesem
Entschließungsantrag finden sich Punkte, mit denen wir einfach
nicht einverstanden sind. Wir haben im Vorfeld Gespräche geführt, und
das waren auch sehr konstruktive, gute Gespräche, wir haben aber von
Anfang an klargestellt, dass wir ganz einfach nicht wollen, dass wir mit einem
solchen Antrag wieder dafür eintreten, schulfremde Personen,
schulfremde Institutionen in die Schulen zu holen. Es gibt gut
ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen an den
Schulen, und das ist einfach eine Maßnahme, die nicht notwendig ist,
daher haben wir uns schlussendlich auch dazu entschlossen, bei diesem Antrag
nicht mitzugehen.
Ich möchte aber auch
betonen, dass es ja bereits im 2022 einen ähnlich lautenden Entschließungsantrag
gegeben hat, der auch angenommen wurde. In diesem Antrag ist unter anderem die
Rede von einem „Ausbau der Angebote der Demokratiewerkstatt“
und einer bundesweiten Initiative, „um das Interesse an
Demokratiebildung zu stärken“. Es geht darum, „das Vertrauen
in die Demokratie zu stärken“, und um die „Aufbereitung von
Materialien für Schulen sowie Lerninhalte“ und so
weiter.
Da frage ich mich jetzt: Was bitte sehr ist denn aus diesem
Antrag geworden? Das verhält sich ja genau so, wie ich es heute bereits in
meiner vorigen
Rede gesagt habe: Man beschließt etwas, aber man kontrolliert es nicht,
man verfolgt es nicht, und das verschwindet einfach in einer Schreibtischlade.
Daher bringt uns dieser Antrag aus unserer Sicht nicht weiter. Wir haben da als Freiheitliche ganz einfach einen anderen Zugang. Wir fordern hier konkrete Maßnahmen, einen ganz konkreten Plan und einen ganz konkreten Katalog, den wir hier auch vorlegen, weil an unseren Schulen – das wissen wir ja alle – tatsächlich zum Teil erschütternde Zustände herrschen.
Weil das so ist und es an unseren Schulen teilweise wirklich so schlimm ist, hat zum Beispiel die Stadt Wien vor Kurzem ein neues Antigewaltpaket vorgestellt. Eine Tageszeitung berichtet darüber und schreibt: „Pädagogen schlagen Alarm. In Wiens Schulen regiert die Angst. [...] Österreich ist ein tolerantes Land. Doch das wird mitunter schamlos ausgenutzt. Religiöse und gewaltverherrlichende Ideologien finden immer öfter den Weg in die Klassenzimmer.“ Dann geht es so weiter: Die Gewaltspirale dreht sich, Suspendierungen. Es gibt Anzeigen. „Lehrer berichten von immer heftigeren Attacken gegen die Pädagogen und andere Mitschüler.“
Also das, was sich in den Schulen abspielt, ist teilweise wirklich dramatisch. Es ist erschütternd. Daher wollen wir, dass man hier konkrete Maßnahmen einleitet. Wir bringen daher einen Entschließungsantrag ein, einen Neunpunkteplan als Antwort auf dieses zunehmende Gewalt- und Konfliktpotenzial an unseren Schulen.
Dieser Antrag
umfasst neun Punkte. Im ersten Bereich geht es um die Prävention, da
geht es um die Konfliktprävention. Da geht es darum, dass wir
in den Schulen Gruppenbildungsprozesse einführen. Da geht es darum, dass
wir den Lehrern die notwendige Ausbildung
geben. Da geht es auch darum, dass
wir einfach dieses Selbstbildnis der gewaltfreien Schule stärken.
Im zweiten Teil geht es dann um die Stärkung der Resilienz. Es geht darum, die Konfliktresilienz zu stärken.
Im dritten Teil geht es um Eskalation und Deeskalation beziehungsweise darum, dass falsches Handeln auch tatsächlich Konsequenzen haben muss. Das ist
etwas, das wir heute nicht haben. Die Lehrer sind ja vielfach machtlos, etwas zu tun, wenn ein Schüler völlig aus der Rolle fällt. Die Lehrer sind nahezu machtlos, da etwas zu tun. Das ist es, was wir ändern wollen. Das fordern wir hier ein: dass man einfach auch so weit geht, dass man Konsequenzen ziehen kann.
Ich darf daher folgenden Antrag einbringen:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Hermann Brückl, MA, Kolleginnen und Kollegen betreffend „9-Punkte Plan als Antwort auf das zunehmende Gewalt- und Konfliktpotenzial an Schulen“
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die
Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft
und Forschung wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage
zuzuleiten, die die Umsetzung der dargestellten Maßnahmen
des 9-Punkte-Programms gegen das Konflikt- und Gewaltpotenzial an Schulen
beinhaltet.“
*****
Ich ersuche hier um Ihre Zustimmung. (Beifall bei der FPÖ.)
17.32
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Hermann Brückl, MA
und weiterer Abgeordneter
betreffend 9-Punkte Plan als Antwort auf das zunehmende Gewalt- und Konfliktpotenzial an Schulen
eingebracht in der 245. Sitzung des
Nationalrates, XXVII. GP, am 14. Dezember 2023 im Zuge der Debatte zu
TOP 17, Bericht des Unterrichtsausschusses über den Antrag 3717/A(E) der
Abgeordneten Mag. Martina Künsberg Sarre,
Mag. Dr. Rudolf Taschner, Mag. Sibylle Hamann, Kolleginnen und Kollegen betreffend Prävention
vor Extremismen (2332 d.B.)
Das österreichische Schulwesen sieht sich insgesamt mit neuen und größeren Herausforderungen im Bereich der Gewalt- und Konfliktprävention konfrontiert. Sie sind das Ergebnis eines längerfristigen Prozesses dem nun gegengesteuert werden muss.
Im Wissen um die Dringlichkeit der Problemlage hat die türkis-blaue Bundesregierung bereits 2019 einen Maßnahmenkatalog erarbeitet, der aber vom ÖVP-geführten Bildungsministerium bis heute nicht umgesetzt wurde. Prävention, Konflikt-Resilienz und Eskalation sind die Eckpfeiler des 9-Punkte-Programms.
Prävention
1. Gruppenbildungs-Prozesse in Neuklassen: Am Beginn der
jeweiligen Bildungsübergänge werden in neu eingerichteten
Klassen der Sekundarstufe 1
und 2 Gruppenbildungs-Maßnahmen vorgesehen. Diese werden auf Basis eines Konzepts
durchgeführt.
2. Verbesserte Ausbildung von Lehrkräften, insbesondere der Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger: Im Rahmen der Ausbildung der Pädagoginnen und Pädagogen wird ein stärkerer Fokus auf die Bewältigung von Konfliktsituationen gelegt. Derzeit sind entsprechende Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen nicht standardisiert vorgesehen. Bestehende Modelle (z.B. wie jenes des Programms Teach for Austria) sollen in die Aus-, Fort- und Weiterbildung verbindlich und standardisiert Eingang finden.
3. Stärkung des Selbstbildes „Gewaltfreie Schule“: Durch verstärkte Anwendung von Verhaltensvereinbarungen soll das gewaltfreie Selbstbild von Schulen gefördert und forciert werden.
Konflikt-Resilienz
4. Abkühlphase: Schülerinnen und Schüler, die einmalig ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen, es sich hier aber um keine regelmäßige Verhaltensauffälligkeit handelt, sollen ihre Klasse vorübergehend – für ein paar Stunden bzw. einen Halbtag – verlassen und die Möglichkeit zur Beruhigung geschaffen werden.
5. Plattform für betroffene Lehrkräfte sowie
Schülerinnen und Schüler: Abseits aller bestehenden Weisungsketten
wird von Seiten des Ministeriums eine anonyme Online-Plattform
eingerichtet. Dadurch soll eine unbürokratische Ansprechstelle
für Notsituationen geschaffen werden. Ein zügigeres Eingreifen der
jeweils zuständigen Stellen soll dadurch ermöglicht werden.
6. Qualifizierung von Lehrkräften zu Streitschlichterinnen bzw. Streitschlichtern: Im Rahmen der Pädagogischen Hochschulen werden Ausbildungsformate zur Streitschlichtung und Deeskalation eingeführt. Lehrerinnen und Lehrern sollen die Möglichkeit haben, sich dafür ausbilden zu lassen. Solche eigens ausgebildeten Lehrkräfte sollen an ihren jeweiligen Schulstandorten im Bedarfsfall deeskalierend einwirken.
7. Schulmanagement – Direktionen und Schulaufsicht: Um das Wissen über bereits jetzt bestehende schuldisziplinarische Maßnahmen auf allen Ebenen der Schulaufsicht zu stärken werden umfangreiche Informations- und Schulungsmaßnahmen vorbereitet und durchgeführt.
Eskalation
8. Verbindliche Einrichtung von
„Auszeit-Gruppen“ für (dauerhaft oder regelmäßig)
aggressive und auffällige Schülerinnen und Schüler:
Schülerinnen und Schüler, die durch massive
disziplinarische Verfehlungen den Unterricht in der Klasse bzw. an der Schule
behindern, sollen verbindlich und unverzüglich einer
Auszeit-Gruppe zugewiesen werden können. Die entsprechenden Regelungen
für die allenfalls zügige Anwendung des Verfahrens werden
präzisiert
Eine
Auszeit-Gruppe an einem Schulstandort bewegt sich im Ausmaß von 5 bis
maximal 8 Schülerinnen bzw. Schüler. Diese Gruppen sollen
möglichst außerhalb
der Schule in geeigneten (bereits bestehenden) Einrichtungen betreut werden. Im
Fall einer geringeren Anzahl sollen auch regionale oder individuelle
Lösungen angewandt werden können. Eigens geschultes
Personal zur Leitung der Gruppen wird zum Einsatz kommen.
Ziel der Auszeit-Gruppe ist es, eine
möglichst rasche Rückkehr der betreffenden Schülerinnen und Schüler in die Regelklasse zu
ermöglichen. Sie stellen deshalb ein dynamisches Modell dar, das strikt an
den jeweiligen Problemlagen ausgerichtet ist. Die Zuweisung in
eine Auszeit-Gruppe kann bedeuten, dass eine Schülerin oder ein
Schüler lediglich ein, zweimal in der Woche an entsprechenden Maßnahmen der
Auszeit-Gruppen teilnimmt, ansonsten jedoch in der Regelklasse verbleibt. Es
wird jedoch auch Fälle geben, in denen es notwendig erscheint,
dass zunächst die gesamte Unterrichtszeit in der Auszeit-Gruppe verbracht
wird und erst nach einigen Wochen eine schrittweise - und gut begleitete -
Rückkehr in
die Klasse erfolgt.
Auszeit-Gruppe sollen bei Vorliegen entsprechender Fälle in der Primarstufe und Sekundarstufe I verbindlich eingerichtet werden.
9. Klarere, Regeln für die zügige und permanente Wegweisung von aggressiven und verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern: Im Fall von nicht mehr schulpflichtigen Schülerinnen und Schülern, die durch sehr aggressives Verhalten die Arbeit in einer Klasse oder der ganzen Schule stören, sollen die Bestimmungen für den Schulausschluss präzisiert werden. Der zügige(re) Ausschluss auf Basis klarer(er) Regeln soll ermöglicht werden.
Damit diese
Schülerinnen und Schüler nicht einfach ohne jegliche Ausbildung
verbleiben, wird (in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Arbeit,
Familie und Jugend und dem Bundesministerium für Soziales, Gesundheit,
Pflege und Konsumentenschutz aufgrund des Ausbildungspflichtgesetzes) konkret
durch das AMS bzw. das Sozialministeriumsservice (SMS) und seinen Koordinierungsstellen in den Bundesländern ein Perspektiven- und Betreuungsplan erarbeitet.
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die
Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft
und Forschung wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage
zuzuleiten, die die Umsetzung der dargestellten Maßnahmen des
9-Punkte-Programms gegen das Konflikt- und Gewaltpotenzial an Schulen
beinhaltet.“
*****
Präsidentin Doris Bures: Der Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht und steht daher auch mit in Verhandlung.
Zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Rudolf Taschner. – Bitte.
Abgeordneter
Mag. Dr. Rudolf Taschner (ÖVP):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Hohes Haus! Sehr geehrte Frau
Kollegin Künsberg Sarre! Ich möchte mich
in zweifacher Weise bedanken. Sie haben die Initiative zu diesem Antrag ergriffen.
Das ist von Ihnen ausgegangen, und es hat wirklich breite Zustimmung gegeben.
Es hat auch eine prinzipielle Zustimmung vonseiten der Freiheitlichen
Partei gegeben – also ich bin allen Gruppen dankbar. Dass
es da noch gewisse Differenzen gibt, müssen wir halt zur Kenntnis nehmen.
Die Probleme, die Herr Kollege Brückl aufgezeigt
hat, sind ja auch ernst
zu nehmen. Insofern ist auch sein Antrag sicherlich zu erwägen, wenn man
auch – wie soll ich sagen? – darüber nachdenken
muss. Man muss halt immer nachdenken. (Zwischenruf des Abg. Brückl.)
Ich danke Ihnen
auch aus persönlichen Gründen, nämlich weil ich damit die
Gelegenheit habe, über dieses Thema zu sprechen, das mir als
außerordentlich wichtig erscheint, weil es von grundsätzlicher Natur
ist. Hegel hat ja das eigenartige Wort gesagt: „Die Eule der Minerva
beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug.“ Man
weiß ja nicht ganz genau, was
das bedeuten soll: „Die Eule der Minerva beginnt erst mit der
einbrechenden Dämmerung ihren Flug.“
Ja, das ist das
Grau in Grau. Da beginnt erst das Denken, sagt Hegel, denn vorher hat man
Schwarz und Weiß, und wenn man Schwarz und Weiß hat, dann hat man
zwei Seiten. Man weiß genau, auf welcher Seite man ist, ohne
dass man darüber nachgedacht hat. Das ist etwas Gefährliches. In der
Schule sollte eigentlich gelehrt werden, dass man da nicht stehen bleiben darf.
Es gibt
natürlich Schwarz und Weiß. Ich habe mich bei der gestrigen
Diskussion anlässlich des Dringlichen Antrages so gefreut, dass Herr
Kollege Oxonitsch gesagt hat: Also, ich bin überhaupt nicht
einverstanden; ich bin mit keinem Satz einverstanden, den Herr Taschner
gesagt hat, aber es hat mir
in gewisser Weise gefallen, wie er seine Argumente vorgebracht
hat. – Insofern kann ich ihm das auch wieder zurückgeben. (Zwischenruf
des Abg. Shetty.)
Wir werden
sachlich nicht zusammenkommen, aber wir verstehen, dass wir nicht
zueinanderkommen. Wir können auch darüber sprechen, dass wir nicht zueinanderkommen
und welche Motive uns bewegen. Da gehen wir plötzlich von dem Schwarz und
Weiß, das wir natürlich in Leidenschaft schon vertreten,
dann hinauf in das Grau dieses Denkens, wo die Eule der Minerva ihren Flug beginnt.
Wir schätzen einander und können das sozusagen in einem sinnvollen
Dialog miteinander aushandeln.
Genau das soll in
der Schule gelehrt werden, genau dieser Punkt. Wenn
das nicht gelehrt wird, wenn einfach nur Schwarz und Weiß gelehrt
würde, dann wäre das nicht Schule, wie man sie sich vorstellt. Diese
Schule sollen wir
haben. (Beifall bei der ÖVP.) Um diese Schule zu haben, brauchen
wir eigentlich
keinen neuen Gegenstand – bei Gott
nicht –, sondern in jedem Gegenstand soll diese Art
des Denkens erwogen werden. (Beifall bei der ÖVP sowie
der Abgeordneten Shetty und Hoyos-Trauttmansdorff.)
Es ist ja Russell
gewesen, der gesagt hat: Das Schrecklichste in dieser Welt ist, dass die
Strotzdummen immer von ihrer Sache überzeugt sind und die
Klugen immer voller Zweifel. – Wir müssen den Zweifel in uns
tragen, um selbst, wenn wir von etwas überzeugt sind, immer zu wissen:
Manche sind nicht überzeugt. Ich weiß, dass der andere nicht davon
überzeugt ist, sogar
vom Gegenteil überzeugt ist, und ich akzeptiere das.
Der Extremismus ist es, der das nicht macht. Jeglicher Extremismus akzeptiert nicht, dass jemand anders anders denkt. Genau das muss verhindert werden, egal welcher Art dieser Extremismus ist. (Beifall bei der ÖVP.)
Um das zu erreichen, muss das in jedem Schulfach von jeder Lehrerpersönlichkeit gemacht werden: diese Abkehr von Schwarz und Weiß hin zur Eule der Minerva.
Das sollte ja
auch in der Politik der Fall sein. Nicht umsonst steht Minerva in Form der
Pallas Athene – Athene und Minerva sind dieselbe Göttin, einmal griechisch,
einmal römisch – ja hier beim Parlament. Sie zeigt uns zwar
ihren Rücken – ich weiß nicht, warum –, aber
sie steht jedenfalls auf den Eulen.
Das sind die Eulen der Minerva. Wir hoffen, dass auch hier der Flug beginnt,
denn wir müssen ja dann auch für die Schule in gewisser Hinsicht ein
Vorbild sein, indem wir zeigen, dass wir so denken können, obwohl wir
voll von Leidenschaft sind.
Auch im
Journalismus müsste das der Fall sein. Es kommt mir manchmal
komisch vor, wenn eine Zeitung behauptet, sie sei: „Der Haltung
gewidmet.“ Ich
muss gestehen: Eine Zeitung, die der Haltung gewidmet ist, interessiert mich
nicht. (Abg. Holzleitner: Schade für Sie!) Mich interessiert
nur eine Zeitung, die mich informiert. Der Haltung
gewidmet? – Haltung habe ich selbst,
dafür brauche ich die
Zeitung nicht. (Abg. Holzleitner: Aber informiert
hätte die blaue Seite, die man ja einschränkt!) Das ist lächerlich. Eine Zeitung,
die der Haltung gewidmet ist, ist verfehlt.
Friedrichs, dieser große
Journalist Deutschlands, hat gesagt: Guter Journalismus besteht
darin, dass man sich keiner Sache zu eigen macht, nicht einmal einer guten,
sondern dass man immer zurückgesetzt bleiben kann und immer auch das
andere mit ins Kalkül zieht. – Wir müssen das in der
Politik auch machen können, obwohl es uns sehr schwerfällt,
und mit Recht sehr schwerfällt, weil wir ja von etwas überzeugt
sind – also Leidenschaft, aber nicht
extrem.
Das
Allerschrecklichste ist, wenn diese extreme Leidenschaft noch mit Moral
gespickt wird. Moral ist sehr gefährlich in dieser Hinsicht, denn wenn
man das moralische Argument – das kein Argument ist – ins
Spiel bringt, ist der andere nicht mehr diskussionsfähig, weil er ja dann
unmoralisch ist. Davor müssen wir uns schützen.
Moral, das Gute, ist etwas, das ich mir
selbst in meinem Privaten behalten muss, das ich aber nicht jemand anderem
aufdrängen will. Wir haben zu viel Moralismus, viel zu viel. Das
vergiftet die sinnvolle, objektive Diskussion. Das vergiftet die
Möglichkeit des Flugs der Eule der Minerva, der erst in der einbrechenden Dämmerung
beginnt. (Beifall bei ÖVP und Grünen sowie der
Abg. Meinl-Reisinger.)
17.38
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Christian Oxonitsch. – Bitte.
Abgeordneter
Christian Oxonitsch (SPÖ): Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Gleich vorweg: Ja, wir
stimmen diesem Antrag zu, wenngleich er ehrlich gesagt ein bisschen sehr oft
die Vokabel fortsetzen, „ausgeweitet“, „fortgeführt“ und „intensiviert“ verwendet und man etwas bewerben soll, das es schon gibt. Ich glaube aber, es ist ein wichtiger und wesentlicher Antrag.
Nichtsdestotrotz stellen wir einen eigenen Entschließungsantrag zu diesem Thema, weil es mir – ich habe das ja auch schon in einer Rede vor etwa einem Monat betont – eigentlich ein bisschen um etwas Grundsätzliches geht.
Wir alle wissen, dass die letzten Jahre
für Kinder und Jugendliche unheimlich fordernd waren: von einer Wirtschaftskrise
nach Corona zu einem Krieg
auf europäischem Boden, mit dem Jugendliche konfrontiert werden, mit den
Auswirkungen der Teuerung, mit denen sie konfrontiert werden, und
jetzt natürlich mit dem Nahostkonflikt.
Was war immer wieder die erste Antwort des
Bildungssystems? – Die erste war einmal: Wir werden die Schulen mit
Unterrichtsmaterialien ausstatten. –
Ja, das ist natürlich eine flotte Antwort, das ist mir völlig
klar. Ich wüsste auch keine, die sich rasch umsetzen lässt, aber ich
glaube, gerade wegen dieser
immer wiederkehrenden Herausforderung für das Schulsystem, auf Krisen zu
reagieren, müssen wir eine grundsätzliche Antwort finden. Die kann
nicht nur heißen, ein Maßnahmenpaket nach dem anderen zu
schnüren, sondern wir müssen tatsächlich in die Richtung
arbeiten, dass Jugendliche im Unterricht – ob es das
eigene Fach ist oder nicht – wirklich einen eigenen
Raum – und mit Raum meine ich zeitliche Ressourcen –
bekommen, um Krisen aufarbeiten zu können, und zwar
grundsätzlich und nicht immer nur ad hoc. (Beifall bei der SPÖ
sowie der Abg. Meinl-Reisinger.)
Natürlich war die erste Antwort auf den
Nahostkonflikt – um beim aktuellsten Beispiel zu
bleiben –: Wir werden die Schulen mit zusätzlichen Infomaterialien
ausstatten. (Abg. Meinl-Reisinger: Aber das reicht nicht!) Ich
muss aber sagen, ich habe mich am selben Tag hingesetzt – und da
rede ich jetzt gar
nicht über den Antrag, sondern das gilt grundsätzlich –:
Wenn man Unterrichtsmaterialien und Antisemitismus eingibt, erhält
man 1 400 Einträge, wenn
man Unterrichtsmaterialien und Extremismus eingibt, gibt es 2 000 Einträge. Also die gibt es ja.
Ja, die bereitet man für die Schulen auf, das ist
wichtig. Die Lehre, die wir
daraus ziehen sollten, ist aber einfach, tatsächlich zu überlegen,
wie Kinder und Jugendliche im schulischen Kontext mit diesen Krisen arbeiten
können,
mit ihren Lehrer:innen arbeiten können und wie die Lehrerinnen und Lehrer
oder spezielle Lehrerinnen und Lehrer letztendlich dafür fit gemacht
werden
können, solche Krisen mit den Kindern und Jugendlichen aufzuarbeiten.
Darum geht es in dem Antrag, den ich hiermit auch einbringen
möchte – und
wenn Sie zuhören: es geht nicht nur um ein eigenes Fach; das steht nur als
Beispiel drinnen –:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Christian Oxonitsch, Kolleginnen und
Kollegen
betreffend „Kinder und Jugendliche durch politische Krisen begleiten
und Demokratiebildung ausbauen“
Der Nationalrat möge beschließen:
„Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister
für Bildung, Wissenschaft und Forschung, wird aufgefordert,
unverzüglich ein umfassendes
und nachhaltiges Maßnahmenpaket zur Bewältigung und Verarbeitung von
Krisen an Schulen vorzulegen, basierend auf dem in der AK Wien Vollversammlung verabschiedeten
Antrag ,Nahostkonflikt: Jugend durch politische Krisen begleiten und
Demokratiebildung ausbauen‘. Dieses Paket soll
nicht nur Unterstützungs- und Lernangebote für Pädagog:innen im
Bereich der politischen Bildungsarbeit umfassen, sondern auch einen dauerhaften
Rahmen schaffen, beispielsweise durch die Einführung eines
eigenständigen Unterrichtsfachs ,Politische Bildung‘ in allen
Schultypen, um eine kontinuierliche und professionelle Begleitung von
Schüler:innen durch politische Krisen sicherzustellen.
Zusätzlich ist es dringend erforderlich, kurzfristig ein
Budget bereitzustellen, auf das Schulen zugreifen können, um speziell benötigte Fachkräfte zur professionellen Unterstützung an die Schulen zu holen.“
*****
Ich glaube, es ist – auch für
uns – an der Zeit, gerade aus den vergangenen Jahren zu lernen und
zu fragen: Wie können wir das grundsätzlich angehen, statt immer nur
Ad-hoc-Maßnahmen zu setzen? Ich glaube, die Zeit für
Ad-hoc-Maßnahmen ist vorbei. Wir brauchen eine grundsätzliche
Lösung. –
Danke schön. (Beifall bei der SPÖ.)
17.42
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Christian Oxonitsch,
Genossinnen und Genossen,
betreffend „Kinder und Jugendliche durch politische Krisen begleiten und Demokratiebildung ausbauen“
eingebracht im Zuge der
Debatte zum Bericht des Unterrichtsausschusses über
den Antrag 3717/A(E) der Abgeordneten Mag. Martina Künsberg Sarre,
Mag. Dr. Rudolf Taschner, Mag. Sibylle Hamann, Kolleginnen und Kollegen
betreffend Prävention vor Extremismen (2332 d.B.) (TOP 17)
Globale Krisen wie die Corona-Pandemie sowie derzeit die
Kriege in Nahost und
der Ukraine haben weitreichende demokratiepolitische und psychosoziale
Auswirkungen, die sich auch an Österreichs Schulen bemerkbar machen.
Auch wenn das Vertrauen in öffentliche Institutionen langsam wieder
steigt, wie der aktuelle Demokratie Monitor zeigt1, bleibt es
insgesamt dennoch niedrig und antidemokratische Bewegungen wachsen.
Inzwischen spricht sich jede vierte Person für demokratiepolitische
Einschränkungen aus. Das sind doppelt so viele Menschen
wie 2018.
Obwohl Schulen
grundsätzlich Raum für Demokratiebildung und eine offene Auseinandersetzung
mit aktuellen Krisen dauerhaft bieten könnten, mangelt es im
gegenwärtigen Schulalltag an ausreichenden zeitlichen Ressourcen und
fachlichen Unterstützungen. Dadurch können aktuell soziale
Prozesse und inhaltliche Auseinandersetzungen im Klassenzimmer nicht
angemessen begleitet werden, auch
eine ernstzunehmende Demokratiebildung bleibt auf der Strecke.
Gleichzeitig bedienen sich
antidemokratische Akteur:innen zunehmender Möglichkeiten im Internet,
um mit Falschinformation im Speziellen Jugendliche zu erreichen. Die
Jugendlichen müssen daher lernen, Falschmeldungen zu identifizieren und
Informationen kritisch zu verarbeiten. Ziel politischer Bildung und digitaler Grundbildung
an Schulen muss es somit sein, Medienkompetenz zu vermitteln, Alternativen
aufzuzeigen und die Menschenrechte sowie die Demokratie als gesellschaftliche
Basis zu festigen. Dafür braucht es jetzt dringend kurzfristige Maßnahmen
und Hilfestellungen an Schulen, um Pädagog:innen nicht allein mit
der Aufgabe zu lassen.
In ihrer Vollversammlung am
14.11.2023 hat die Arbeiterkammer Wien einen wegweisenden Antrag
beschlossen. Zur sofortigen, unkomplizierten und professionellen Unterstützung
von Schulen und Lehrkräften im Umgang mit politischen Krisen wird ein
kurzfristiges Maßnahmenpaket gefordert. Gleichzeitig braucht es langfristige Umstrukturierung
und die Schaffung von Räumen, die es Schulen ermöglicht Kinder und Jugendliche professionell und
kontinuierlich durch politische Krisen
zu begleiten.2
Der
Entschließungsantrag (3717/A(E)) der Regierungsfraktionen, der am
23.11.2023 eingebracht wurde und sich mit der Prävention vor Extremismen
befasst, thematisiert zwar die bestehende Problematik. Dennoch
erscheinen die vorgeschlagenen Maßnahmen, nämlich 1.200
zusätzliche Workshops durch den OeAD, zusätzliche Unterrichtsmaterialien
und die Betonung bereits vorhandener schulischer Angebote als
unzureichend, um Lehrkräfte angemessen zu entlasten und nachhaltige Verbesserungen
in der Demokratiebildung zu erwirken. Es braucht
eine umfassendere Herangehensweise, um Schüler:innen effektiv vor den gegenwärtigen Bedrohungen durch Radikalisierung zu schützen.
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat möge beschließen:
„Die Bundesregierung,
insbesondere der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung,
wird aufgefordert, unverzüglich ein umfassendes und nachhaltiges Maßnahmenpaket
zur Bewältigung und Verarbeitung von Krisen an Schulen vorzulegen, basierend
auf dem in der AK Wien Vollversammlung verabschiedeten Antrag
"Nahostkonflikt: Jugend durch politische Krisen begleiten und Demokratiebildung
ausbauen". Dieses Paket soll nicht nur Unterstützungs- und
Lernangebote für Pädagog:innen im Bereich der politischen
Bildungsarbeit umfassen, sondern auch einen dauerhaften Rahmen schaffen,
beispielsweise durch
die Einführung eines eigenständigen Unterrichtsfachs
„Politische Bildung“ in allen Schultypen, um eine kontinuierliche
und professionelle Begleitung von Schüler:innen durch politische
Krisen sicherzustellen. Zusätzlich ist es dringend erforderlich,
kurzfristig ein Budget bereitzustellen, auf das Schulen zugreifen können,
um speziell benötigte Fachkräfte zur professionellen
Unterstützung an die Schulen zu holen.“
1 Sora Demokratie Monitor.2023. Demokratie in stürmischen Zeiten. Erste Ergebnisse Demokratie Monitor
*****
Präsidentin Doris Bures: Der Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht und steht mit in Verhandlung.
Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Faika El-Nagashi. – Bitte.
17.42
Abgeordnete Mag. Faika El-Nagashi (Grüne): Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen und werte Zuseherinnen und Zuseher! Es stimmt mich vorsichtig optimistisch, dass ich den bisherigen Redebeiträgen und auch den Diskussionen im Ausschuss entnommen habe, dass die Fraktionen da grundsätzlich viele Anknüpfungspunkte haben und den Inhalt in der Dringlichkeit, aber auch in der Herangehensweise ähnlich sehen wie wir. Über die Unterschiede können wir noch diskutieren, aber ich glaube, dass sich sehr viele der angesprochenen Maßnahmen in diesem Antrag wiederfinden, aber nicht nur in dem Antrag, sondern in dem, was wir bislang schon machen.
Wir haben bereits
Ende 2020, nach dem Terroranschlag in Wien, einen Schwerpunkt in der
Extremismusprävention gesetzt. Wir haben damals gesagt: Wir werden einen
Zugang finden, ein umfassendes Maßnahmenpaket
schaffen, nicht nur im Bildungsbereich, um jeden Extremismus – ob
politisch oder religiös begründet – zu verhindern und zu
bekämpfen. Dieses Maßnahmenpaket findet sich in verschiedenen
Bereichen wieder, ist budgetär mit 8 Millionen Euro jährlich
ausgestattet und beinhaltet natürlich auch im Bildungsbereich
entsprechende Maßnahmen.
Der Bildungsbereich ist aus vielen Gründen sehr
wichtig – einige davon
sind schon angesprochen worden –, unter anderem deswegen,
weil wir früh ansetzen müssen und werden, weil nämlich auch die
Radikalisierungen
früh ansetzen, und zwar besonders auch in Phasen der Vulnerabilität,
in denen junge Menschen auf der Suche nach Erklärungen, nach Orientierung,
nach
etwas Sinnstiftendem, nach Zukunftsperspektiven sind.
Eine der begleitenden Maßnahmen, die vielleicht in diesem Bereich der Extremismusprävention nicht gleich als logisch erscheinen, ist zum Beispiel das Integrationsjahr, das Menschen näher an die Berufswelt heranführt; zum Beispiel Integrationsmaßnahmen können da Perspektiven schaffen.
Im Bildungsbereich – und da bin ich nicht ganz
mit Ihnen einverstanden,
Kollege Taschner – müssen wir aber natürlich allen, die
dort tätig sind, Werkzeuge in die Hand geben. Die Situation hat sich
verändert, in den Klassenzimmern haben wir nicht die Eulen der
Minerva oder der Athene, sondern die Abbildung von komplexen, globalen
Konflikten. Wir haben die Herausforderungen, die sich in einer ganz
anderen Dimension abbilden, wir haben Social Media, über die
radikalisierende Narrative auf junge Menschen einströmen, aber auch
Influencer, die radikalisieren und natürlich gegen die Erzählungen arbeiten, die
wir mit einem Demokratieverständnis den Schülerinnen und
Schülern näherzubringen versuchen.
Weil die FPÖ das angesprochen hat: Was passiert denn
mit den Maßnahmen, die in den anderen Anträgen erwähnt wurden?
Was passiert mit den Maßnahmen, die wir bereits seit 2020
setzen? – Ja, das haben wir öfters im Ausschuss angesprochen
und bei anderer Gelegenheit auch schon hier
im Plenum erläutert. Wir haben schon mehr als 4 000 Workshops
angeboten, und ja, diese Workshops müssen von Externen angeboten werden.
Was wir sicherstellen, ist eine Qualitätssicherung. Das sind qualifizierte Organisationen mit Expertise in diesem Bereich, die nicht nur Bereiche wie Medienkompetenz oder auch Demokratiebildung abdecken müssen, Diskussionsräume schaffen und begleiten müssen, sondern natürlich auch eine thematische Expertise zu Extremismusprävention haben müssen.
Es haben bereits nahezu 4 000 dieser Workshops
stattgefunden. Es wird in die Lehrkräfteausbildung und -fortbildung als
Thema eingebaut. Auch da gab
es bereits über 400 Veranstaltungen mit etwa 10 000 Teilnehmenden.
Also ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Ansatz, und mit diesem Antrag
stärken
wir die Maßnahmen, die wir in diesem Bereich bereits gesetzt haben. (Beifall
der Abg. Hamann.)
Wie ich aber schon gesagt habe, geht es nicht nur um den Bildungsbereich, sondern auch darum, umfangreiche Maßnahmen zu setzen und das abzufangen,
wo extremistische Ideologien und
Radikalisierungen versuchen, eine Tür aufzumachen oder eine Tür zu
finden, das heißt, Perspektiven zu schaffen, Zugehörigkeit
entstehen zu lassen. Da gibt es auch ganz starke Projekte, die
mit jungen Menschen arbeiten und Themen von Identität und
Zugehörigkeit bearbeiten, Zusammenhalt schaffen, Perspektiven und vor
allem Räume
für Begegnung zu finden versuchen.
Wobei ich Ihnen zustimme, Herr
Kollege Taschner, ist, dass die Politik ein Vorbild sein muss. In dieser
Hinsicht werden wir auch in Bezug auf das kommende Jahr –
ein großes, intensives Wahljahr; weltweit, aber natürlich auch in
Österreich – wieder Aspekte von Demokratiedefiziten haben, die
sich manifestieren werden, die wir jungen Menschen werden erklären
müssen: warum so viele von demokratischer Partizipation ausgeschlossen
sind und – was
die noch größere Herausforderung sein wird – warum auf
der politischen Ebene Diskriminierungserfahrungen, rassistische Themen und
Zugänge immer
wieder gespielt werden. Wir können keinen Fortschritt erzielen, wenn wir
auf der einen Seite versuchen, Extremismus zu bekämpfen, und auf der anderen Seite
die Politik ein schlechtes Beispiel liefert.
Von meiner Seite aus auch noch einmal herzlichen Dank an die Kollegin von den NEOS für diese Initiative und für den gemeinsamen Antrag. (Beifall bei Grünen und NEOS sowie bei Abgeordneten der ÖVP.)
17.47
Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Martina Künsberg Sarre. – Bitte.
Abgeordnete Mag. Martina Künsberg Sarre
(NEOS): Sehr geehrte Frau
Präsidentin! Herr Minister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Auch ich
möchte mich sehr herzlich bei allen meinen Bildungssprecherkollegen
bedanken,
auch bei Herrn Kollegen Brückl, der leider seine Fraktion nicht überzeugen konnte,
da mitzugehen. Trotzdem: Es war, finde ich, eine gute Gelegenheit, zu
zeigen, dass wir relativ schnell zusammenkommen können
und zu sehr, sehr wichtigen Themen eine gemeinsame Meinung beziehungsweise ein gemeinsames Bild haben.
Dieser Antrag, glaube ich, ist sehr wichtig, auch um der Bevölkerung zu zeigen, dass es hier im Parlament nicht nur Opposition und Regierung gibt, die gegeneinander arbeiten, sondern dass es ganz, ganz viele Themen – und das ist ein sehr wichtiges Thema, glaube ich – gibt, bei denen wir uns zusammenraufen können, miteinander reden können.
Ich habe ja auch schon gestern
bei der Dringlichen gesagt, dass das wichtig ist, weil wir diese Dinge nur
gemeinsam schaffen werden. Eine Partei allein
wird es nicht schaffen, diese Themen – Demokratiebildung,
Extremismusprävention – anzugehen, sondern wir werden es
gemeinsam schaffen. Dieser Antrag ist ein erster guter Schritt,
glaube ich, und er gibt Ihnen, Herrn Minister, wieder einige Punkte, die
Sie in Ihrem Ressort umsetzen können.
Kollegin El-Nagashi hat es ja
schon gesagt: Es gibt einiges, das bereits da und am Laufen ist. Es ist, glaube
ich, wichtig, dass diese Dinge intensiviert werden
und gerade auch in der Lehreraus- und -fortbildung etwas passiert.
Es ist nicht
selbstverständlich, dass wir in einer liberalen Demokratie
leben – das sieht man rund um uns herum in einigen Ländern, wo
es meiner Meinung
nach nicht mehr so schön zu leben ist –, das fällt nicht
vom Himmel, sondern dafür müssen wir tagtäglich
kämpfen und einstehen und ganz entschlossen
die Demokratie und unsere Freiheit verteidigen.
Dieses Verständnis für Dialog, dieses
Verständnis, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und man sich
zusammenraufen kann und muss, die Entwicklung dieses
Verständnisses für ein friedvolles Miteinander beginnt in jungen
Jahren, das beginnt in der Schule. Deswegen ist es uns so wichtig gewesen, da auch
im Schulbereich anzusetzen und diese Bereiche noch auszubauen. Dafür
braucht es Raum, Zeit und Geld – das ist wichtig –, denn
ohne das
geht es nicht.
Sie haben auch gesagt, dass es
kein eigenes Fach braucht. – Ja, wenn wir Flächenfächer
einführen, in denen es einen Ethikunterricht für alle gibt und
die Demokratiebildung dort auch abgebildet ist, können wir gerne
darüber reden. Wir versteifen uns ganz sicher nicht nur darauf, aber
es muss selbstverständlich mehr abgebildet sein. Das ist jetzt zu
wenig. Die Möglichkeiten, die die Lehrpläne in den einzelnen
Fächern zulassen, um Demokratiebildung anzubieten, sind sicherlich nicht
so gegeben, wie wir uns das wünschen würden. (Beifall bei den
NEOS.)
Nochmals herzlichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen
und an Sie alle, die hier mitstimmen. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr
schönes Zeichen auch
für Kinder und Jugendliche, dass wir da etwas weitergebracht
haben. – Danke. (Beifall bei den NEOS und bei Abgeordneten der
Grünen.)
17.51
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Nico Marchetti. – Bitte.
Abgeordneter Nico Marchetti (ÖVP): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Geschätzter Herr Minister! Ich möchte zuallererst im Namen meines hochgeschätzten Sitznachbarn Dr. Werner Saxinger eine Gruppe begrüßen, und zwar die pensionierten Ärzte aus Oberösterreich, die heute im Hohen Haus sind. Herzlich willkommen! (Beifall bei Abgeordneten von ÖVP, SPÖ und Grünen sowie des Abg. Rauch.)
Das Thema Extremismusprävention im Bildungsbereich kann
man glaube ich sehr grundsätzlich und sehr konkret diskutieren. Ich
würde das gerne zuerst ein bisschen mit ein paar
grundsätzlichen Gedanken unterfüttern. Wahrscheinlich haben die
meisten von uns diese – ich glaube sehr viral gegangene – Anhörung
im US-Kongress gesehen, in der die drei Eliteunis dazu befragt wurden, was sie
konkret tun würden, wie sie damit umgehen würden, wenn Studierende
bei ihnen zum Völkermord an den Juden aufrufen würden.
Die Antwort war: Das kommt auf den Kontext an.
Natürlich ist das eine tiefergehende Diskussion, aber selbst wenn man es auf den Punkt bringt und so verkürzt, müsste man da einfach sagen: Nein, es ist eben nicht in Ordnung, wenn man zu einem Völkermord an Juden aufruft.
Das ist genau der Punkt, um den
es, glaube ich, geht: Es geht darum, dass man in der Schule Diskurs schafft.
Den braucht man, um Verständnis zu schaffen,
um Meinung zu bilden, zu hinterfragen, aber es braucht auch klare Grenzen, bis
wohin es geht und dass das dann nicht mehr im Rahmen des Diskurses ist,
der an Bildungsinstitutionen stattfinden sollte.
Ich glaube, das war ein gutes Beispiel, wie es nicht geht. Ich hoffe, dass wir es anders machen, ich habe es bis jetzt auch immer so erlebt. Diesen Grundkonsens sollten wir uns auf jeden Fall behalten, besonders wenn es – in Zeiten wie jetzt – schwieriger wird. (Beifall bei der ÖVP.)
Was kann man konkret machen? Da
bedanke ich mich, genauso wie meine Vorrednerinnen und Vorredner, für
die überparteiliche Einigkeit. Ich glaube,
dass es wichtig ist, dass man gerade jetzt, bei dem schwelenden Nahostkonflikt,
wenn es ganz viele Emotionen, auch ganz viele familiäre Hintergründe
gibt, die das von der Sachlichkeit hin zur Emotionalität bringen, sagt,
dass man den Schulen Hilfestellungen gibt, denn die brauchen sie. Da finde ich
sehr, sehr gut, dass es eine Initiative der DSN gemeinsam mit dem Innenministerium,
dem Bildungsministerium und auch den Bundesländern gibt, dass
man da sagt, dass man den Lehrkräften ganz gezielt und konkret Hilfe zur
Verfügung stellt, wenn es solche Konflikte in den Klassenzimmern
gibt.
Das wird schon umfassend in Anspruch genommen; ab
Jänner wird es
noch mehr ausgerollt, noch qualitätsgesicherter gemacht. Ich glaube, es
ist wirklich wichtig, dass man die Lehrkräfte da nicht alleine lässt,
denn
das sind keine einfachen Probleme, die sie da mit ihren Schülerinnen und
Schülern diskutieren müssen. (Beifall bei der ÖVP sowie der
Abg. Hamann.)
Das ist eine Akutmaßnahme; ich glaube, es braucht
auch viele – die sind auch im Antrag erwähnt –, die
laufend passieren müssen. Die sind natürlich absolut
uneingeschränkt zu unterstützen. Es ist wichtig, dass wir diesen
Grundkonsens und diese konkreten Maßnahmen gemeinsam vertreten, damit
eben der Extremismus in der Schule keine Chance hat. In der Gesellschaft greift
er leider trotz der Maßnahmen in der Schule eh schon um sich; es soll
zumindest
die Schule ein Ort sein, wo wir als Gesellschaft etwas dagegen tun können.
(Beifall bei der ÖVP sowie der Abgeordneten Hamann und
El-Nagashi.)
17.54
Präsidentin Doris Bures: Nun hat sich Herr Bundesminister Martin Polaschek zu Wort gemeldet. – Bitte, Herr Minister.
Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung Dr. Martin Polaschek: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte nur kurz noch ein paar Dinge ergänzen, wenn Sie gestatten.
Zum einen habe ich eine kleine
Ergänzung zu Herrn Abgeordneten Oxonitsch: Sie haben angesprochen, dass es
sehr viele Materialien im Internet gibt,
die man abrufen kann. – Ja, das ist richtig. Weil sehr rasch
große Nachfrage eingemeldet wurde, haben wir uns aber bemüht,
über die sogenannte Eduthek des Bundes neue Materialien
übersichtlich und strukturiert zur Verfügung zu stellen, die
Lehrerinnen und Lehrer, aber natürlich auch andere Interessierte, etwa
auch Eltern, abrufen können, weil man eben, wenn man es einfach nur über eine Suchmaschine holt, untergeht.
Wir haben wie gesagt aktuelle neue Materialien über
die Eduthek ins Netz gestellt. Das darf ich nur ergänzend anmerken.
Wir haben auch rasch reagiert, indem wir in jeder
Bildungsdirektion Ansprechpersonen eingesetzt haben, die die Lehrerinnen
und Lehrer rasch und
kurzfristig unterstützen können.
Weil das Thema mit den
Lehrplänen angesprochen worden ist: Ja, die Lehrpläne haben immer
wieder eine lange Vorlaufzeit. Gerade deshalb habe ich ja
auch das System der Lehrplanänderungen umgedreht. Wir haben ab jetzt die
Möglichkeit, Lehrpläne punktuell und kurzfristig anzupassen, falls es
konkrete neue Herausforderungen gibt.
Damit darf ich auch noch einmal
auf das Thema kommen: Auf Basis dieser Erfahrungen, die wir in den letzten
etwas mehr als zwei Monaten leider gemacht haben, müssen wir die gesamte
Arbeit zum Thema Antisemitismus in den Schulen völlig neu denken. Wir
müssen uns darüber Gedanken machen, ob die Art und Weise, wie wir es
unterrichten, wie wir es den jungen Menschen nahebringen, richtig ist. Ich habe
bereits eine eigene Arbeitsgruppe mit Expertinnen und Experten dazu
eingesetzt, mit Personen aus der Praxis, die
sich intensiv darüber Gedanken machen, wie wir uns mit dem Thema Antisemitismus
künftig in den Schulen neu auseinandersetzen.
Das betrifft auch das Thema
Demokratiebildung. Ja, wir werden darüber nachdenken müssen, wie wir
den jungen Menschen Demokratie auf eine andere Art und Weise nahebringen. Ich
glaube, das, wie wir es bisher gemacht
haben – das sehen wir leider gerade –, reicht nicht aus.
Wir werden da etwas Neues finden müssen und wir sind bereits an der
Arbeit.
Deshalb danke ich Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, auch
sehr für das Signal, das Sie mit diesem
wichtigen Antrag setzen, denn das ist ein klares
Signal an alle Menschen in unserem Land und vor allem auch in den
Schulbereich hinein, dass uns allen, als Staat und auch uns als Menschen, die
politische Verantwortung haben, dieses Thema wichtig ist. – Deshalb:
Vielen Dank dafür. (Beifall bei der ÖVP sowie der Abgeordneten Hamann
und El-Nagashi.)
17.57
Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Sabine Schatz. – Bitte.
17.57
Abgeordnete
Sabine Schatz (SPÖ): Frau
Präsidentin! Herr Bundesminister! Sehr geehrte Damen und Herren! Nicht
erst seit dem Terroranschlag der Hamas
auf Israel, seit dem Konflikt im Nahen Osten, nicht erst seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine müssen wir
feststellen, dass Extremisten immer wieder probieren, vor allem auf
jüngere Zielgruppen konkret zuzugehen und zu versuchen, sie für ihre
Ziele, für ihre Ideologien anzuwerben und zu gewinnen. Das
gelingt ihnen über die sozialen Medien immer leichter und
immer intensiver.
Dass sich das auch auf den Schulalltag auswirkt, ist, glaube ich, nicht länger überraschend. Wir haben Kontakt zu Lehrer:innen, die uns berichten, dass Israel beispielsweise auf Wandkarten, auf Landkarten herausgeschnitten, übermalt, überklebt wird. Das ist tatsächlich Realität an Österreichs Schulen. Es ist wichtig, dass wir mit diesem Antrag auch ein konkretes Zeichen dagegen setzen und dagegen vorgehen. (Beifall bei der SPÖ sowie der Abg. Disoski.)
Es sind aber dieser Antrag und dieses Maßnahmenpaket,
das sozusagen
darin enthalten ist – Kollege Oxonitsch hat schon darauf
hingewiesen –, ein etwas Mehr von dem, was es ohnehin schon gibt,
eine Intensivierung,
eine Ausweitung der Programme, der Maßnahmen, die ohnehin schon vorhanden
sind, aber neue, zusätzliche Initiativen, die jetzt in die Extremismusprävention
verstärkt eingreifen, die Lehrerinnen und Lehrern entsprechend unter die
Arme greifen, suchen wir in diesem Antrag vergeblich. Sie haben
es gerade selbst gesagt, Herr Minister, dass wir viele Dinge neu werden denken
und neu aufsetzen müssen, um da konkret auch entsprechend entgegenzuwirken.
Anfang November haben Sie unter anderem auch mit dem Innenminister das
neue Projekt vorgestellt – Kollege Marchetti hat schon darauf
hingewiesen –, im Rahmen dessen ausgebildete Polizistinnen und
Polizisten an Schulen kommen, um dort in der Präventionsarbeit gegen
Extremismus aktiv zu werden. Das
ist wichtig. Wir brauchen aber unbedingt auch zusätzliche Ressourcen und
Zeit
für Schulsozialarbeit. Wir brauchen Sozialarbeiterinnen und
Sozialarbeiter,
die kontinuierlich an den Schulen sind und dort auch ihre Tätigkeit
entsprechend wahrnehmen können.
Eines ist mir besonders wichtig,
Herr Minister: Keine einzige Initiative und Maßnahme für
Schülerinnen und Schüler darf daran scheitern, dass sich diese die
Maßnahme nicht leisten können, dass die Finanzierung nicht sichergestellt ist.
(Beifall bei der SPÖ.) Sie müssen wirklich die Mittel
dafür sicherstellen und aufstellen,
damit gerade in der Extremismusprävention keine Schülerin
und kein Schüler zurückgelassen wird. (Beifall bei der
SPÖ.)
Wir wissen alle, dass es mit dem
einen oder anderen oder auch mehreren zusätzlichen Workshops, so wie
es jetzt vorgesehen ist, nicht getan sein wird –
das wird nicht ausreichen –; wir wissen aber auch alle, dass im
Regelschulbetrieb wenig Platz für zusätzliche Workshops, für
zusätzliche Maßnahmen bleibt. Deswegen ist es auch so wichtig, dass
wir diesen Antrag, den Kollege Oxonitsch eingebracht hat, entsprechend
unterstützen. Wir brauchen an den Schulen
mehr Zeit, wir brauchen mehr Raum für politische Bildung, wir brauchen
unbedingt Zeit und Raum und Ressourcen für Demokratiebildung und die
Förderung von Medienkompetenz bei den Kids. Das ist jetzt essenziell
wichtig.
Abschließend noch zum
Entschließungsantrag betreffend „die strafrechtliche Verfolgung
von sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt
durch Hamas-Terroristen“, den Kollegin Pfurtscheller dann gleich nach mir
einbringen wird: Es ist ganz, ganz wichtig, sehr geehrte Damen und
Herren: Sexuelle Gewalt und Vergewaltigung sind eine brutale Kriegswaffe, die
wir gemeinsam jetzt hoffentlich aufs Allerschärfste verurteilen. (Beifall
bei
der SPÖ sowie bei Abgeordneten von ÖVP, Grünen und NEOS.)
Wir werden uns gemeinsam mit den betroffenen Mädchen
und Frauen in den Kriegsgebieten solidarisch zeigen und wir werden hier
gemeinsam ein
starkes Zeichen setzen. – Danke dafür. (Beifall bei der
SPÖ und bei Abgeordneten der Grünen.)
18.01
Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Elisabeth Pfurtscheller. – Bitte.
Abgeordnete Dipl.-Kffr. (FH) Elisabeth
Pfurtscheller (ÖVP): Sehr
geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Minister! Geschätzte
Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuseher auf der Galerie und vor den
Bildschirmen! Ich freue mich natürlich sehr, dass der Unterrichtsausschuss
wirklich parteiübergreifend
und in großer Einstimmigkeit Extremismus auf der einen Seite
natürlich verurteilt, aber eben auch Maßnahmen im schulischen
Bereich einleiten will,
um Extremismus bestmöglich zu bekämpfen beziehungsweise um sehr viel
Präventionsarbeit durchzuführen.
Ein Teil dieser
Präventionsarbeit kann und soll auch sein, jungen Menschen
vor Augen zu führen, was die Folgen von Extremismus sein können, der
immer gerade auch Frauen und Mädchen ganz besonders trifft. Wichtig ist
aber
in dem Zusammenhang auch, glaube ich, dass die jungen Menschen sehen, dass solche Taten auch geahndet werden, dass die
Extremisten, egal aus welchem Bereich sie kommen, vom Recht verfolgt
werden und dass die Taten dann auch Folgen haben.
Der Entschließungsantrag zu diesem Tagesordnungspunkt
befasst sich ja
unter anderem eben auch mit dem Krieg im Nahen Osten und den Auswirkungen der
dortigen schrecklichen Ereignisse auf die Radikalisierungsgefahren in den
Schulen. Am 7. Oktober, wir wissen es alle, wurde Israel
brutal und heimtückisch von den Hamas-Terroristen überfallen. Neben
den steigenden Opferzahlen und den
Meldungen über Geiselnahmen hat man dann
auch immer mehr schreckliche Nachrichten über Frauen gehört,
die im Rahmen dieses Überfalls
vergewaltigt worden sind, die anderen Arten von sexuellen
und geschlechtsspezifischen Handlungen ausgesetzt waren. Bilder von
Frauen mit blutverschmierter Kleidung, die bespuckt worden sind, die
vorgeführt worden sind, gingen um die Welt.
Kollegin Schatz hat es schon gesagt: Vergewaltigung ist eine Kriegswaffe. Sie ist rechtswidrig, sie ist besonders grausam und sie ist ein gezieltes Mittel des Terrors und eine Taktik, die weitreichende soziale und psychische Belastungen sowie generationenübergreifende Traumata nach sich zieht.
So etwas kann aber geahndet
werden, und zwar laut dem Römischen
Statut des Internationalen Strafgerichtshofes.
Deswegen darf ich den folgenden Antrag einbringen:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Dipl.-Kffr. (FH) Elisabeth Pfurtscheller, Mag. Meri Disoski, Eva Maria Holzleitner, BSc, Henrike Brandstötter, Kolleginnen und Kollegen betreffend „die strafrechtliche Verfolgung von sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt durch Hamas-Terroristen“
eingebracht im Zuge der Debatte zum Bericht des Unterrichtsausschusses über den Antrag 3717/A(E) der Abgeordneten Mag. Martina Künsberg Sarre, Mag. Dr. Rudolf Taschner, Mag. Sibylle Hamann, Kolleginnen und Kollegen betreffend Prävention vor Extremismen (2332 d.B.) – TOP 17
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung, insbesondere die
Bundesministerin für Justiz,
der Bundesminister für Inneres, der Bundesminister für
europäische und internationale Angelegenheiten, die Bundesministerin
für Landesverteidigung, die Bundesministerin für
Frauen, Familie, Integration und Medien und der Bundesminister für
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz werden dazu aufgefordert,
sich auf allen Ebenen für eine rasche, unabhängige und koordinierte
Untersuchung, gendersensible Aufarbeitung und strafrechtliche Verfolgung aller
in Israel und Gaza durch die Hamas und andere Terrororganisationen
begangene sexuelle und geschlechterspezifische Gewalt sowie für die
psychotherapeutische und medizinische Unterstützung von Opfern wie auch Zeuginnen und Zeugen einzusetzen.“
*****
Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen für die
große und breite Unterstützung und freue mich, dass wir ein so
eindeutiges Zeichen setzen können. –
Danke schön. (Beifall bei ÖVP und Grünen sowie bei
Abgeordneten
von SPÖ und NEOS.)
18.06
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Elisabeth Pfurtscheller, Meri Disoski, Eva-Maria Holzleitner und Henrike Brandstötter, Kolleginnen und Kollegen
betreffend die strafrechtliche Verfolgung von sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt durch Hamas-Terroristen
eigebracht im Zuge der Debatte zu Bericht des
Unterrichtsausschusses über den Antrag 3717/A(E) der Abgeordneten
Mag. Martina Künsberg Sarre,
Mag. Dr. Rudolf Taschner, Mag. Sibylle Hamann, Kolleginnen und Kollegen
betreffend Prävention vor Extremismen (2332 d.B.) – TOP 17
Begründung
Der behandelte Entschließungsantrag betreffend Prävention vor Extremismen befasst sich unter anderem mit dem Krieg im Nahen Osten und den Auswirkungen der dortigen schrecklichen Ereignisse auf Radikalisierungsgefahren in Schulen. Auslöser war insbesondere auch schwerste sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt:
Am 7. Oktober 2023
überfielen Hamas-Terroristen Israel brutal und heimtückisch. Sie
überfielen Dörfer, töteten wahllos Frauen, Kinder, Männer
auf grausame
Weise und nahmen auch zahlreiche Geiseln. Allein am 7. Oktober 2023 waren mehr
als 1.200 Todesopfer auf israelischer Seite zu und, 1.590 Verletzte zu
beklagen.
Rund 240 israelische Geiseln wurden durch die Hamas-Terroristen nach
Gaza verschleppt.
Gleichzeitig mit den steigenden Todesopferzahlen und Geiselmeldungen häuften sich auch die Meldungen über Frauen, welche im Rahmen dieses Terroraktes Folter, Vergewaltigungen und anderen Arten sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt waren. Bilder von Frauen und Mädchen in blutverschmierter Kleidung gingen um die Welt.
Vergewaltigung als Kriegswaffe ist eine rechtswidrige, besonders grausame und weitverbreitete Kriegstaktik, sie ist ebenso ein gezieltes Mittel des Terrors. Es ist eine Taktik, welche in der Regel zu weitreichenden sozialen und psychischen Belastungen sowie generationenübergreifenden Traumata führt.
Laut dem im Jahr 2002 in Österreich in Kraft getretenen Römer Statut des Internationalen Strafgerichtshofs sind solche Gewalttaten je nach Kontext als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen strafbar. In Österreich wurde das Römer Statut 2015 und 2016 durch entsprechende Novellen in das österreichische Strafgesetzbuch (XXV. Abschnitt) umgesetzt
Wie relevant Opferanerkennung, Hilfsprogramme und die systematische
Aufarbeitung sexueller und geschlechtsspezifischer Kriegsverbrechen ist,
zeigt nicht zuletzt die Geschichte: Im Jugoslawienkrieg wurden 20.000 - 60.000
bosnische Frauen
Opfer geplanter, systematischer Massenvergewaltigungen und folgender,
ungewollter Schwangerschaften. Die Aufarbeitung der Verbrechen dauert bis heute
an.
Es liegt an uns, aus der Geschichte und den Schicksalen zu lernen und sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt auch in Kriegszeiten weitreichend zu bekämpfen ungeachtet dessen, von wem sie begangen werden. Denn auch wenn die physischen Wunden heilen, können diese Taten – vor allem so sie nicht aufgearbeitet werden und keine strafrechtlichen Folgen für die Täterinnen und Täter nach sich ziehen– langfristig Schmerz, Leid und Trauer verursachen.
Davor gilt es, Frauen und Mädchen zu schützen und auch für Männer und Buben maßgeschneiderte Hilfsprogramme anzubieten. Eine umfassende Aufarbeitung der Tatensamt individueller strafrechtlicher Verfolgung ist ein wesentlicher Teil der Heilung individueller und gesellschaftlicher Traumata sowie des Versöhnungsprozesses.
Bereits am 8. März 2022 hat sich der Nationalrat mit
der Annahme des Antrages Unterstützung von Frauen und Kindern als
besondere Leidtragende des Krieges in
der Ukraine (782/UEA) dafür ausgesprochen, Frauen und Mädchen, welche
vor den Kriegshandlungen in der Ukraine flüchten mussten, in besonderer
Weise zu unterstützen. Ebenso wurde seitens des Parlaments ein
Entschließungsantrag im
Juni 2022 zum Thema Ahndung von sexueller und geschlechterspezifischer
Gewalt im Ukrainekrieg angenommen. In Anlehnung an diese Anträge gilt es
nun, einen besonderen Fokus auf Personen zu legen, welche Opfer von sexueller
und geschlechtsspezifischer Gewalt geworden sind und die Verantwortlichen auch
strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen.
Das österreichische Parlament und die
unterzeichneten Abgeordneten wollen dieses Zeichen auch im Zusammenhang mit dem
brutalen Terror der Hamas gegen
Israel setzen.
Die unterfertigenden Abgeordneten stellen daher folgenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung, insbesondere die Bundesministerin für Justiz, der Bundesminister für Inneres, der Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten, die Bundesministerin für Landesverteidigung, die Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien und der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz werden dazu aufgefordert, sich auf allen Ebenen für eine rasche, unabhängige und koordinierte Untersuchung, gendersensible Aufarbeitung und strafrechtliche Verfolgung aller in Israel und Gaza durch
die Hamas und andere Terrororganisationen begangene sexuelle und geschlechterspezifische Gewalt sowie für die psychotherapeutische und medizinische Unterstützung von Opfern wie auch Zeuginnen und Zeugen einzusetzen.“
*****
Präsidentin Doris Bures: Der Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht und steht daher auch mit in Verhandlung.
Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
Wünscht die Frau Berichterstatterin ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall.
Damit kommen wir zur Abstimmung über die dem Ausschussbericht 2332 der Beilagen angeschlossenen Entschließung.
Wer sich dafür ausspricht, den bitte ich um ein Zeichen der
Zustimmung. –
Das ist einstimmig angenommen. (354/E)
Wir kommen zur Abstimmung
über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Hermann
Brückl, Kolleginnen und Kollegen betreffend „9-Punkte Plan
als Antwort auf das zunehmende Gewalt- und Konfliktpotenzial an Schulen“.
Wer spricht sich dafür aus? – Das ist die Minderheit, abgelehnt.
Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Christian Oxonitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Kinder und Jugendliche durch politische Krisen begleiten und Demokratiebildung ausbauen“.
Wer spricht sich dafür aus? – Das ist die Minderheit, abgelehnt.
Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Elisabeth Pfurtscheller, Meri Disoski, Eva-Maria Holzleitner, Henrike Brandstötter, Kolleginnen und Kollegen betreffend „die strafrechtliche Verfolgung von sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt durch Hamas-Terroristen“.
Wer ist für diesen Entschließungsantrag? – Dieser ist einstimmig angenommen. (355/E)
Sammelbericht des
Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen
über die Petitionen Nr. 106 und 112 bis 115 (2339 d.B.)
Präsidentin Doris Bures: Wir gelangen nun zum 18. Punkt unserer heutigen Tagesordnung.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Erster Redner: Herr Abgeordneter Nikolaus Prinz. – Bitte.
Abgeordneter Nikolaus Prinz (ÖVP): Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! In gebotener Kürze zur letzten Petitionsausschusssitzung am 30.11.:
Die Sitzung war ja an sich sehr
konstruktiv, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Parlamentsdirektion
beziehungsweise den Klubreferent:innen gut vorbereitet. Bei einer
vernünftigen Vorsitzführung durch den Obmann
geht man die Punkte sozusagen flott durch. Festhalten darf ich, dass wir drei
Ausschusszuweisungen vorgenommen haben – durchaus jede sinnvoll.
Das digitale Klimaticket gibt es ja eigentlich schon, aber man darf immer
über Verbesserungen nachdenken. Was ich beim Klimaticket toll finde, ist,
dass
es in Zukunft auch Zivildienern oder Wehrdienern kostenlos zur Verfügung steht.
Das ist eine tolle Sache.
Lärmschutzmaßnahmen entlang der Südbahnstrecke im Bereich Neunkirchen werden im Verkehrsausschuss weiter erörtert.
Ein ganz wichtiges Thema ist ein kleines niedliches Tier: Es nennt sich Wombat und ist offensichtlich in Australien vom Aussterben bedroht. Da gibt es von
einigen Kolleginnen und Kollegen die Überlegung, man möge
doch eventuell in Schönbrunn das vielleicht vom Aussterben bedrohte Tier
in Zukunft
züchten. Das werden wir in einer der nächsten Sitzungen im
Umweltausschuss besprechen. Schauen wir einmal, was dabei herauskommt!
Zu den zwei Kenntnisnahmen ist
nur so viel zu sagen: Die Finanzierung von ORF Sport plus ist gesichert, da
besteht also derzeit keine Gefahr der Einstellung.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
Betreffend die Petition „Fachholschulentwicklungs- und Finanzierungsplan neu verhandeln!“ ist zu sagen, dass im Budget für die nächsten Jahre entsprechende Mittel für die Fachhochschulen vorgesehen sind. Das ist also auch sehr positiv.
In diesem Sinne danke ich für die Aufmerksamkeit. (Beifall
bei der ÖVP und
bei Abgeordneten der Grünen.)
18.09
Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Petra Wimmer. – Bitte.
Abgeordnete Petra Wimmer (SPÖ): Ja, das Interesse der Bürgerinnen und Bürger an der Mitgestaltung in unserem Land ist groß, das zeigt auch die Vielzahl der Bürgerinitiativen und Petitionen, mit denen wir uns im Ausschuss beschäftigt haben. Die verschiedensten Themen, Anliegen werden hier in Form gegossen und von uns dann begutachtet. An dieser Stelle möchte ich allen Bürgerinnen und Bürgern, die diese Gelegenheit nutzen und diese Form der Bürgerbeteiligung so lebendig halten, herzlich Danke sagen.
Schade ist es, dass diese Initiativen von Regierungsseite
leider oft nicht so wertgeschätzt werden, wie sie es verdient
hätten. Der optimale Ablauf wäre,
dass wir die Petitionen und Bürgerinitiativen in den Ausschuss bekommen,
dass dann die Stellungnahmen eingeholt werden und wir dann diese Anliegen
in den Fachausschüssen weiterdiskutieren können. Das ist ganz, ganz
selten der Fall. In den meisten Fällen werden sie zur Kenntnis genommen
und dann
leider nicht mehr weiter bearbeitet. In der letzten Ausschusssitzung war es so,
dass erfreulicherweise doch einige Initiativen den Weg in jene Ausschüsse gefunden
haben, in denen sie dann weiter behandelt werden.
Leider nicht zugewiesen wurde die Petition
„Fachhochschulentwicklungs- und Finanzierungsplan neu verhandeln!“
von meinen Kolleginnen Eva Maria Holzleitner und Andrea Kuntzl. Warum wurde sie
eingebracht? – Aus gutem Grund: Der vorliegende
Fachhochschulentwicklungs- und Finanzierungsplan wurde nämlich von den Fachhochschulen zurückgewiesen.
Es gab lautstarke Kritik aus den Bundesländern, von den
Sozialpartnern, vom
Rat für Forschungs- und Technologieentwicklung und der
Österreichischen Hochschülerschaft.
Warum wurde der Plan so stark kritisiert? – Weil
er keine neuen Studienplätze vorsieht, und das trotz
Fachkräftemangels. Das zeigt auch eine aktuelle Anfragebeantwortung des
Bildungsministers. Die bestätigt nämlich, dass im
FH-Studium Soziale Arbeit tatsächlich keine zusätzlichen
Studienplätze geschaffen werden, und das, obwohl wir einen eklatanten
Mangel an Sozialpädagog:innen und Sozialarbeiter:innen haben. Es ist
unverständlich, warum da nicht mehr Plätze geschaffen
werden, denn an Bewerber:innen mangelt es nicht. In Wien gibt es
1 099 Bewerbungen auf 314 Anfängerplätze. Also man sieht,
es wäre Bedarf da, die Zahl der Studienplätze auszubauen. Warum das
nicht gemacht wird, entzieht sich leider unserer Kenntnis, es ergibt keinen Sinn.
Auch wenn weitere finanzielle Mittel im Budget vorhanden
sind, werden die angekündigten oder veranschlagten Mittel nicht
ausreichen, weil diese bereits durch die Teuerung aufgefressen
werden. Somit wird eine Weiterentwicklung von Forschung, Lehre oder eine
Internationalisierung unmöglich gemacht. Die angewandte
Forschung wird eingeschränkt. Es ist also insgesamt
ein Rückschritt für Österreich.
All diese Themen wären es wert gewesen, im Wissenschaftsausschuss diskutiert zu werden. Die Regierungsfraktionen haben das anders gesehen – ja, eine vertane Chance. (Beifall bei Abgeordneten der SPÖ.)
18.13
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Christian Ries. – Bitte.
Abgeordneter
Christian Ries (FPÖ): Frau
Präsidentin! Werte Kollegen
des Hohen Hauses! Der Sammelbericht des Ausschusses für Petitionen und
Bürgerinitiativen ist dieses Mal einigermaßen kurz geraten, und das
liegt erfreulicherweise daran, dass es diesmal doch einige Petitionen in die
zuständigen Fachausschüsse geschafft haben. Wir werten das einmal
als positives Zeichen und hoffen, dass die Regierungsfraktionen auch in anderen
Ausschüssen das Mauern endlich beenden werden.
Unter anderem ist die Petition des Kollegen Schmiedlechner zur Errichtung einer Lärmschutzwand entlang der Südbahnstrecke bei Neunkirchen dem Verkehrsausschuss zugewiesen worden. In diesem Zusammenhang hat Kollegin Fischer von den Grünen ganz etwas Interessantes gesagt, wenn ich sie richtig verstanden habe, nämlich dass man Lärmschutzwände auch mit PV-Anlagen bestücken könnte. Dem stehen wir einmal vorsichtig positiv gegenüber.
Werte Damen und Herren, an Österreichs Straßen
gibt es laut Asfinag 5 Quadratkilometer oder anders gesagt
1 400 Kilometer Lärmschutzwände –
eine riesige Fläche, die jetzt schon vorhanden ist und teilweise ungenutzt
ist. Und auch wir sind der Meinung, diese sollte man besser, wirtschaftlicher
nutzen.
Interessant ist in diesem
Zusammenhang eine neue Petition meiner Kollegen Lausch und Schmiedlechner,
deren Titel lautet: „Photovoltaikanlagen
auf Dächern öffentlicher Gebäude installieren statt auf
Ackerflächen!“. Wie es der Titel schon sagt, soll heimisches
Ackerland der Landwirtschaft erhalten bleiben und nicht mit PV-Anlagen
bestückt werden, denn wohin das
führt, das sehen wir im Burgenland: Da gibt es bereits über
2 000 Hektar Ackerland, die mit PV-Anlagen bestückt
sind –wohlgemerkt natürlich von der
Energie Burgenland, an der das Land beteiligt ist. Private bekommen derzeit
bei uns im Burgenland praktisch keine Genehmigung.
Ja, aber so ist das halt bei
uns im Burgenland: Von der Energie über die Pflege, über die Jagd bis
zur Feuerwehr, überall hält das Regime Doskozil die
Hand darüber – ein Hauch von DDR 30 Jahre nach dem
Mauerfall, just dort,
wo viele DDR-Bürger den Weg in die Freiheit gefunden haben.
Werte Damen und Herren, wir ersuchen wirklich die
Bürgerinnen und Bürger, dieser Petition zuzustimmen, denn neben
Lärmschutzwänden gibt es
noch viele öffentliche Gebäude, die wir besser ausnützen
könnten, wodurch es möglich wäre, Ackerland zu sparen. Es gibt
große Flächen auf Schulen,
Ämtern, Kasernen, Feuerwehrhäusern und vieles mehr. Diese
Flächen haben für uns den absoluten Vorrang, Acker- und Grünland
sollen weiterhin der Produktion von Lebensmitteln erhalten
bleiben. – Danke. (Beifall bei der FPÖ.)
18.16
Präsidentin
Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau
Abgeordnete Ulrike
Fischer. – Bitte.
Abgeordnete Mag. Ulrike Fischer
(Grüne): Frau Vorsitzende! Sehr
geehrte Damen und Herren! Der Ausschuss für Petitionen und
Bürgerinitiativen darf
auch diesmal im Plenum nicht fehlen, und zwar mit einem Sammelbericht. Kollege
Ries vor mir hat es schon angesprochen: Wir haben in der letzten Sitzung des Ausschusses
für Petitionen und Bürgerinitiativen ein paar Petitionen den
zuständigen Fachausschüssen zugewiesen, bei denen es vor allem
um Umweltanliegen, um Verkehrsanliegen geht.
Was sich in diesem Ausschuss
immer wieder zeigt: Während wir im Nationalrat Themen oft auf einer Metaebene diskutieren, schauen wir uns im Ausschuss
für Petitionen und Bürgerinitiativen die Basis an: die Basis
unserer Gemeindearbeit, die Basis unserer Bezirksarbeit, die Basis dessen,
wie Zukunft funktionieren kann. Zukunft kann dann funktionieren, wenn
wir eine funktionierende Infrastruktur haben, wenn wir einen funktionierenden
öffentlichen Verkehr haben, wenn wir nicht unter Lärm
leiden, wenn wir Geschäfte vor Ort haben, in die wir einkaufen gehen
können, wenn es Poststellen gibt, wenn
es Polizei gibt. Das heißt, in Wirklichkeit sind die im Ausschuss
für Petitionen und Bürgerinitiativen behandelten Anliegen ein Abbild
der Probleme unserer Gesellschaft. Ich finde es sehr wichtig, dass
wir uns diesen Themen widmen und dass wir genau in diesen Ausschuss die
Wahlkreisarbeit hineintragen. Ich bedanke mich hier für das
Engagement von allen engagierten Abgeordneten. Danke für euer
Engagement! Danke! (Beifall bei den Grünen und
bei Abgeordneten der ÖVP.)
Keiner von uns will vor einer
verschlossenen Post stehen oder die Polizei nicht mehr vorfinden, und deswegen
ist es wichtig, dass Bürger und Bürgerinnen
auch die Möglichkeit haben, sich an Petitionen und Bürgerinitiativen
zu beteiligen. Ich bin gefragt worden: Wie macht man das? – Das
ist ganz einfach:
Gebt in eine Suchmaschine Parlament und Petitionen ein, dann kommt ihr auf die
entsprechende Seite! Dann gebt ihr ein: Verhandlungsgegenstand,
dann seht ihr, wie weit die Verhandlung fortgeschritten ist. Dann könnt
ihr euch anschauen, ob eure Gemeinde da schon etwas gemacht hat oder nicht.
Wenn man sich die Themen anschaut, dann reichen sie querbeet
von Bankomat, Postschließung, Lärmschutz bis Baumhaftung. Es handelt
sich um viele Angelegenheiten, wo man sagen kann: Na ja, wenn das Problem nicht
in meiner Gemeinde ist, dann finde ich das eigentlich lächerlich, aber
wenn es mich
in der Gemeinde direkt betrifft, dass die
Post zu ist, dass die Bahn zu laut ist, dass die Autobahn zu laut ist,
dass es keine Fotovoltaik gibt, dann bin ich betroffen und dann will ich mich
dafür einsetzen. Und das ist eine Möglichkeit der Ausübung von
direkter Demokratie.
Weil ich immer wieder gefragt
werde, möchte ich das auch hier ansprechen: Unser Parlament ist
offen. Sie können sich über das Internet registrieren oder
Sie können einfach mit einem Lichtbildausweis vorbeikommen. Dann
können Sie sogar an unseren Sitzungen teilnehmen, wenn Sie sich drei
Werktage vorher anmelden. Das heißt, wir haben ein offenes
Parlament, der Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen steht
Ihnen zur Verfügung.
Zum Abschluss möchte ich noch sagen, ich freue mich sehr, dass auch für meine Gemeinde, für Sankt Andrä-Wördern, im Zusammenhang mit der Postschließung eine gute Lösung in Aussicht ist: Wir werden in Kooperation mit der Post wahrscheinlich einen geeigneten Postpartner finden. Auch dazu hat es eine Petition gegeben.
Und die zweite Sache, Kollege Ries hat es angesprochen: Lärmschutz kann tatsächlich mit Fotovoltaik funktionieren. Auch da braucht es eine Stärkung.
Ich möchte mich für die Aufmerksamkeit bedanken und wünsche eine geruhsame Zeit in der Weihnachtszeit. – Danke. (Beifall bei Grünen und ÖVP.)
18.20
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner ist Herr Abgeordneter Yannick Shetty. – Bitte.
Abgeordneter
Mag. Yannick Shetty (NEOS): Frau
Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Liebe
Zuseherinnen, liebe Zuseher!
Zuerst die positive Nachricht: Zwei Jahre nach Einführung des Klimatickets
gibt es das Klimaticket jetzt digital am Handy. Zwei Jahre hat das gebraucht.
Das ist zwar positiv – bitte verstehen Sie mich nicht falsch; ich
glaube, es ist schon durchgeklungen –, es ist jedoch schon etwas
absurd, 2021 ein Produkt wie das Klimaticket auf den Markt zu bringen und
es im Jahr 2023 nicht zustande zu bringen, es digital am Handy, in der
Wallet – es ist im Übrigen
noch immer nicht in der Wallet verfügbar –, verfügbar zu
machen.
Ich glaube schon, dass es da um etwas Grundsätzliches
geht – jetzt will ich es nicht größer machen, als es
ist –: Es ist gut, dass es das Klimaticket jetzt
digital gibt, aber es geht schon um etwas Grundsätzlicheres. Wenn
solche selbstverständlichen Dinge nicht funktionieren, ohne dass es Druck
gibt, wie zum Beispiel – deswegen spreche ich ja auch
hier – eine Petition im Petitionsausschuss, viele Anträge dazu,
wenn sich viele Menschen beschwert haben, dass es eben ohne diesen Druck nicht
funktioniert, dass so etwas
Banales tatsächlich umgesetzt wird, dann zweifeln schon viele Menschen an
der Fähigkeit der Behörden und in diesem Fall an der Regierung. (Beifall
bei
den NEOS. – Abg. Lukas Hammer: Großartig!)
Hey, es geht darum – ich wiederhole es noch einmal –,
ein Klimaticket, also das, was beispielsweise bei den Wiener Linien oder
anderen Verkehrsbetrieben selbstverständlich schon seit Jahren
funktioniert – oder wenn man einen Flug bucht oder wenn man ein
Ticket bucht –, am Handy verfügbar zu
machen!
Das ist deswegen so tragisch, weil es ja darum geht, dass
man ein Signal aussendet – ein Signal, dass die Staatlichkeit,
dass Behörden solch einfache
Dinge nicht zustande bringen. Wenn man es nicht schafft, ein Klimaticket zu digitalisieren,
wie soll man dann die großen Dinge schaffen? Wie soll man
dann beispielsweise eine große Bildungsreform schaffen? (Beifall bei
den NEOS. – Abg. Lukas Hammer: Sie haben keine Ahnung, wie so
ein Klimaticket funktioniert! Das ist das Problem!) Ja, das wirft
natürlich auch die Fragen auf, die wir in dieser Plenarwoche schon
mehrfach diskutiert haben: Wo bleiben die großen Reformen? Wir
können nachvollziehen, warum es so ist, weil wir in unterschiedlichen
Fragen ja sehen, wie langsam die Dinge gehen.
Da möchte ich auch noch
auf eine andere Petition zu sprechen kommen, die heute nicht Teil des
Sammelberichts ist, aber über 20 000 Unterschriften erreicht
hat, die wir NEOS initiiert haben, nämlich dass Psychotherapie endlich eine Kassenleistung wird, dass ein
gebrochener Haxen gleich behandelt
wird wie eine gebrochene Seele – natürlich nicht mit den
gleichen Methoden –,
finanziell gleich behandelt wird, dass es da
keine Diskriminierung mehr
gibt. Wir weisen schon so lange darauf hin, und gerade die Pandemie hat die
Situation noch einmal so verschärft.
Sie als Bundesregierung, als
Regierungsfraktionen, die – und da will ich
jetzt gar nicht werten – scharfe Maßnahmen auch gegen junge
Menschen verhängt haben, die ihnen immer noch nachhängen,
wären es gerade jenen
jungen Menschen schuldig, dass Sie die psychische Gesundheit endlich ernst
nehmen und Psychotherapie endlich als Kassenleistung ermöglichen.
(Beifall bei den NEOS.)
Also gut, dass im Kleinen – Klimaticket – etwas weitergegangen ist, es wird Zeit, dass sich auch bei den großen Dingen, bei der Psychotherapie endlich etwas bewegt. (Beifall bei den NEOS.)
18.23
Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin ist Frau Abgeordnete Andrea Holzner. – Bitte.
Abgeordnete Dipl.-Ing. Andrea Holzner
(ÖVP): Frau Präsidentin! Sehr
geehrte Kolleginnen und Kollegen! Damen und Herren! Ich glaube, Kollege Shetty
hat versäumt, was wir in diesen drei dicht gedrängten Plenartagen an
Reformvorhaben für die Menschen, die in Österreich leben,
für unsere Bürgerinnen und Bürger auf den Weg
bringen. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
Kollegin Wimmer! Petitionen, deren Anliegen erfüllt
sind, behandeln wir nicht weiter. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu
können, dass im Finanzierungs-
und Entwicklungsplan für Fachhochschulen das Budget 2024 um
25 Prozent erhöht wurde, dass jeder Studienplatz wie gefordert mit
10 Euro gefördert wird – und das bereits ab
Juni –, dass 1 050 FH-Studienplätze bis zum
Wintersemester 2025/26 neu geschaffen werden und wir den erfolgreichen Weg
des bedarfsorientierten Ausbaus der Fachhochschulen fortsetzen.
Zur Petition „Digitales Klimaticket jetzt!“: Ich
freue mich sehr, dass das Klimaticket seit 27.11. digital ist. Einfach die App
von ÖBB, Westbahn, Wiener Linien herunterladen, Klimaticket anzeigen und
abrufen. Weitere Apps
werden von den Verkehrsverbünden demnächst folgen.
Was ich auch erwähnen möchte: Junge Menschen in
Österreich erhalten
ab 2024 zu ihrem 18. Geburtstag das österreichweit gültige
Klimaticket kostenlos. Sie können dann ein Jahr lang gratis
Öffis nutzen. Sie haben ab
dem 18. Geburtstag drei Jahre Zeit, das kostenlose Klimaticket in Anspruch
zu nehmen. So macht CO2-Einsparen
Spaß. Und nicht umsonst sind die Österreicher laut
Eurostat die glücklichsten EU-Bürger.
Es gibt zum Glück in diesem Land Bürger, die
leistungsbereit sind, die gerne arbeiten, die sich ehrenamtlich
betätigen. Auch wir als Parlament arbeiten unbeirrt weiter. Wir
übernehmen in diesen Krisenjahren Verantwortung und leiten das Land nach
bestem Wissen und Gewissen durch diese Krisenjahre; ich
denke, durchaus erfolgreich. – Vielen Dank. (Beifall bei der
ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
18.25
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner ist Herr Abgeordneter Robert Laimer. – Bitte.
Abgeordneter Robert Laimer (SPÖ): Geschätzte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Hohes Haus! Die Petition „Retten wir den Sport! Keine Einstellung von ORF Sport plus auf Kosten unserer Sportvereine“ behandelt ein wichtiges, ein breites Gesellschaftsthema.
Dieser ORF-Kanal, der Sport in seiner Vielfalt zeigt, wird nunmehr doch befristet bis 2026 weitergeführt und ausgestrahlt. Sportarten, mit denen nicht Millionen oder gar Milliarden zu verdienen sind, fristen oftmals ein Schattendasein. Konzerne, Ölscheichs, andere Heilsbringer stellen sich ohnehin via Champions League, Fußball-WM, Sommer-, Winterolympiaden ins Rampenlicht,
um ihre schmutzigen Geschäfte teilweise einer Imagepolitur zu unterziehen. Ihr Sponsoring wird von Welt- und Europaverbänden auch willfährig unterstützt.
Der Begriff Randsportarten,
meine Damen und Herren, zeugt von einer Mentalität, jene Sportarten
zu ignorieren, mit denen nicht das große Geld zu verdienen ist.
Breitensport ist nicht nur mit einem gesellschaftlichen Mehrwert verbunden,
Breitensport hat seine Wurzeln im Arbeitersport des 19. Jahrhunderts.
Denken wir zum Beispiel an die nicht kommerziellen Arbeiterolympiaden im
20. Jahrhundert in unserer Ersten Republik vor Beginn des
Faschismus!
Dabei ist es heute wichtig, besonders wichtig, auch Genderbarrieren, wie zum Beispiel im Frauenfußball, abzubauen.
Gerade im Breitensport braucht
es ehrenamtliche Funktionäre, die Kinder an den Sport heranführen und
dabei auch die soziale Kompetenz im Nachwuchsbereich fördern.
Dafür kann man nicht oft genug Danke sagen.
(Beifall bei der SPÖ.)
Aber auch im Erwachsenenamateursport sind viele helfende Hände und Köpfe nötig, um die notwendigen Strukturen zu erhalten. Die ehrenamtlichen Funktionäre müssen ohnehin jedem Cent nachlaufen.
Leider ist es den Regierungsparteien nicht wert, die nachhaltige Weiterentwicklung des ORF-Kanals Sport plus im Sportausschuss zu diskutieren und zu debattieren. Ihre Kenntnisnahme der Petition zeugt nur davon, das Thema vom Tisch haben zu wollen.
Die Einstellung von ORF Sport plus wäre nicht nur ein
Schlag ins Gesicht
aller Sportbegeisterten gewesen, sondern auch ein Ausdruck der Ignoranz gegenüber
sozialen und gesundheitlichen Vorteilen, die der Sport für
unsere Gemeinschaft bietet, und zwar in allen Altersklassen und Lebenslagen.
Schauen wir gemeinsam in die Zukunft: Wenn wir ORF Sport
plus unterstützen, setzen wir nicht nur ein Zeichen für die
Erhaltung der sportlichen Vielfalt und dafür, sie einer breiten
Öffentlichkeit zugänglich zu machen, sondern auch für
die Zukunft unserer Kinder und Enkel. Lassen Sie uns gemeinsam sicherstellen,
dass sie die Chance haben, aus einer breiten Palette von Sportarten
auswählen zu können und sich zu entfalten, um auch neue Sportarten
kennenzulernen, die unsere Gesellschaft reicher machen. – Sport
frei!
(Beifall bei der SPÖ.)
18.29
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner ist Herr Abgeordneter Christian Lausch. – Bitte.
Abgeordneter Christian Lausch (FPÖ): Frau Präsidentin! Hohes Haus! Dieses Mal ist es erfreulich, dass es doch drei Petitionen geschafft haben, einem Fachausschuss zugewiesen zu werden, was ja immer unsere Forderung ist und immer unsere Forderung war.
Es freut mich besonders, dass die Petition Lärmschutz
an der Südbahnstrecke von Peter Schmiedlechner den Weg in den
Verkehrsausschuss gefunden
hat. Man weiß ja, mit Lärmschutz kann man sehr viel anfangen, da
kann man innovativ sein. Da haben wir auch schon einige Ideen gehört, wir
stehen
dem positiv gegenüber, und das freut uns sehr.
Zu ORF Sport plus: Ja, da muss ich meinem Vorredner recht
geben, es heißt immer: Das ist schon vom Tisch, das ist schon
gegessen, diese Petition ist
schon überholt! – das hört man immer –, aber
das sehe ich auch ein bisschen kritisch. Es ist wichtig, dass man Breitensport
im ORF bringt. Man sieht
ja eh, dass Servus-TV schon viel mehr Sportarten wie Champions League und
Formel-1-Rennen überträgt und der ORF immer weniger Spitzensport,
weil zu teuer und nicht leistbar. Darum ist es natürlich wichtig, dass
dieser Sportkanal bleibt.
Man weiß ja, Spitzensport
ist teuer im Übertragen, aber Breitensport ist etwas für die Jugend,
das ist etwas für die Schüler, da kann man natürlich etwas weiterbringen.
(Abg. Hörl: Olympia ...!) Darum hätten wir diese
Petition auch gerne nicht nur zur Kenntnis genommen – aber es ist
halt einmal so. Seien
wir froh, dass wir jetzt, 2024, in ein Wahljahr kommen, dass jetzt die
Regierungsparteien doch die eine oder andere gute Petition der
Oppositionsparteien
in die Fachausschüsse durchlassen, in die diese Petitionen eigentlich
auch gehören.
Darum werden wir dieses Mal mit
ruhigem Gewissen diesem Sammelbericht auch zustimmen, da man sagen muss: Ja,
das ist ein richtiger Weg,
die Fachausschüsse, die zuständig sind, zu beschäftigen;
dafür hat man sie ja eigentlich auch. Man sollte den Petitionsausschuss
nicht immer degradieren, so im Sinne von: Ja, den gibt es halt
auch!, oder, wie es beim letzten Mal vonseiten der ÖVP gefallen ist: Die
meisten Petitionen kommen ja eh von Abgeordneten! –Na no na net! Man
weiß ja, dass das auf der Parlamentshomepage von Bürgern
unterstützt werden kann, und das wird es ja auch sehr,
sehr oft.
Unsere Argumente vom letzten Mal dürften gewirkt
haben, dieses Mal schaut es schon wieder besser aus. Hoffen wir halt, dass der
Petitionsausschuss in
Zukunft mit Zuweisungen an Fachausschüsse aufgewertet wird. –
Danke. (Beifall bei der FPÖ.)
18.32
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Hermann Weratschnig. – Bitte.
Abgeordneter Hermann Weratschnig, MBA MSc
(Grüne): Sehr geehrte Frau
Präsidentin! Werte Abgeordnete! Liebe Zuseherinnen und Zuseher! Zur
Petition Digitales Klimaticket von den NEOS: Ich glaube, ganz entscheidend
wichtig ist, das digitale Klimaticket (eine Tafel, auf der ein Klimaticket
abgebildet ist, in die Höhe haltend) ist da. Das Klimaticket
ist eine Erfolgsgeschichte
(Beifall bei den Grünen sowie der Abgeordneten Berlakovich und Gahr – Zwischenruf bei den NEOS): 266 000 Nutzer:innen, ein Klimaticket für alle neun Bundesländer. (Abg. Bernhard: Das ist digital?)
Herr Abgeordneter Yannick
Shetty, digitales Klimaticket – zur Veranschaulichung habe ich
es heute noch einmal ausgedruckt, damit wir es alle
sehen. (Allgemeine Heiterkeit. – Beifall bei Abgeordneten der
Grünen. – Abg. Meinl-Reisinger –
erheitert –: Ausgedruckt! – Weitere Zwischenrufe bei den
NEOS.)
Das digitale Klimaticket funktioniert (Abg. Meinl-Reisinger: Das ist
wirklich ... Digitalisierung!), es hat eine Zeit
gebraucht – du hast recht. (Abg. Loacker: ... digitales Kaufhaus!)
Es ist mit allen Verkehrsverbünden zu verhandeln, dass es in allen Apps
vorhanden ist. Es ist auch zu klären, dass es zu keinem Missbrauch kommt
(Abg. Hörl: Was steht denn da drauf?), also es sind da ganz
viele technische Schritte notwendig.
Ich habe mich noch einmal
informiert, wie es dazu gekommen ist, dass
das doch einige Zeit gebraucht hat. Auf jeden Fall hat ja jeder auch ohne digitales
Klimaticket das Klimaticket nutzen können, auch in Kartenform; da habe ich
kein Problem. (Heiterkeit bei Abgeordneten der Grünen. – Abg.
Shetty: Ja eh,
aber auch digital!) Ich glaube, die 266 000 Menschen haben
große Freude, dass sie es nutzen können.
Das Klimaticket für
18-Jährige – auch in Richtung NEOS –: Ich glaube,
das
ist ein wichtiger Anreiz, um junge Menschen im öffentlichen Verkehr
zu halten (Abg. Meinl-Reisinger: Ihr blast das Geld raus gerade! Geld
der Steuerzahler! – Zwischenruf des Abg. Hörl), um
den jungen Menschen auch Kosten zu ersparen, nämlich weiter mit dem
öffentlichen Verkehr zu fahren, ihn auch zu nutzen. – Das
zum Ersten. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der
ÖVP. – Abg. Disoski: Bravo!)
Zum Zweiten die Petition „Schutz der Wombats“ von der SPÖ: Ganz interessant, dass das heute noch kein großes Thema war. Kollege Prinz hat es bereits
präsentiert. Ich glaube, wichtig ist
schon auch, zu erklären: 130 Tier- und Pflanzenarten sterben
täglich aus – täglich! 16 Prozent aller Spezies
weltweit
sind bedroht, 4 000 Arten sind akut bedroht, 60 Prozent weniger
Tierarten in den letzten 40 Jahren: Das sind schon sehr dramatische
Zahlen.
Ich verstehe die Argumentation, da auch gewisse Tierarten
herauszunehmen und zu schauen: Können wir da etwas tun? Gibt es da
Möglichkeiten? Es stellt
sich die Frage: Bei welchen Arten haben wir eine Möglichkeit, diverse
Erhaltungszuchten auch hier im Lande zu machen? Ihr kennt es, es gibt die Stellungnahme
vom Tiergarten Schönbrunn (Zwischenrufe bei der ÖVP), dass das
in Österreich nicht so leicht ist, und die Frage ist auch, ob es sinnvoll
ist.
Bei den Wombats gibt es drei Arten (eine Tafel, auf der ein Wombat abgebildet ist, in die Höhe haltend): Es gibt den nördlichen Haarnasenwombat (allgemeine Heiterkeit – Beifall bei Abgeordneten der Grünen – Zwischenrufe bei NEOS und Grünen), es gibt den südlichen Haarnasenwombat und es gibt den Nacktnasenwombat. Er ist ein australischer Beutler (Heiterkeit des Abg. Loacker), der in Australien vom Aussterben bedroht ist – es gibt noch 110 Exemplare.
Ich habe mich selbst in meiner Jugendzeit mit diesen Tieren
befasst. (Zwischenruf des Abg. Stögmüller.) Es gibt zu
diesem Tier auch unterschiedlich gute Studien. (Anhaltende
Heiterkeit bei Abgeordneten von Grünen und NEOS.) Die Besonderheit
vom Wombat – wer es noch nicht weiß, es gibt auch eine Studie
dazu und sogar einen Preis (Abg. Hörl: Der schaut ja aus wie ein
Wolf! – allgemeine Heiterkeit – Ruf: Es gibt immer noch
Wölfe!) – ist vor allem sein würfelförmiger Kot.
Man muss zu den Wombats vielleicht abschließend noch
dazusagen (Zwischenrufe bei ÖVP, NEOS und FPÖ), dass es,
glaube ich, für Österreich, für den Tiergarten Schönbrunn
sehr schwierig ist, denn das Tier gräbt sich zu 80 Prozent seiner
Lebenszeit ein. Das Tier ist sehr nachtaktiv, es braucht wahnsinnig
viel Platz und Lebensraum (Abg. Hörl: So wie der Egger!) und
vor allem braucht es auch eine bestimmte Klimatisierung.
Ich würde abschließend einmal sagen, wichtig im
Artenschutz ist – wir sollten darauf zurückkommen,
glaube ich –: Welche heimischen Tierarten können wir hier in
Österreich fördern? (Abg. Hörl: Rotwild! Hirsche!) Was
tun wir,
um dem Artensterben entgegenzutreten? Da sind natürlich die Themen Landnutzung und Erhaltung der Lebensräume
wichtig. Das Thema Verdrängung
ist im Auge zu behalten, auch das Thema Klimawandel und natürlich
auch die chemische Belastung. Deshalb ein Appell von unserer Seite: heimische
Tierarten, Fauna und Flora schützen und natürlich auch, was die
Tiergärten betrifft, schauen, wo es sinnvolle Erhaltungszuchten
geben kann! – In diesem Sinne: für einen aktiven Artenschutz! (Beifall
bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP. – Ruf
bei den Grünen: Wuh! )
18.37
Präsidentin
Doris Bures: Nächster Redner: Herr
Abgeordneter Hans
Stefan Hintner. – Bitte sehr. (Abg. Loacker: Das ist jetzt
schwer zu übertreffen!)
Abgeordneter Hans Stefan Hintner
(ÖVP): Sehr geehrte Frau
Präsidentin!
Hohes Haus! Wir haben uns beim letzten Mal darüber unterhalten, dass der
Petitionsausschuss vor allem ein Instrument aus der Mitte der
Bevölkerung
sein sollte, er brennende Bürgeranliegen behandelt –
natürlich auch mit Unterstützung der Politik, das ist legitim,
aber eben aus der Mitte der Gesellschaft. Ein solches Anliegen
ist zum Beispiel der Lärmschutz für die Anrainer
der Südbahnstrecke in Neunkirchen. Das ist schon erwähnt worden. Das
kommt in den Verkehrsausschuss, das ist gut so.
Vielleicht darf ich aber auch etwas aus eigener Erfahrung
bemerken: dass auch die physikalischen Gesetze beachtet werden sollten, dass
sich nämlich
Schall wie ein Kegel ausbreitet. Wir haben in der Nähe von Mödling,
in Wiener Neudorf, jetzt die größte Schallschutzwand in
Niederösterreich mit über 13 Metern. Früher haben wir
nichts gehört, jetzt aber hören wir – 6 Kilometer weit weg –, wenn der Wind da ist, den
Verkehrslärm von der Süd-Autobahn.
Die Petition Rettet den Sport, keine Einstellung von ORF
Sport plus ist
auch bereits erörtert worden. Wir sind da auf einem guten Weg. Wie ich vernommen
habe, gibt es bereits Gespräche mit den Sportverbänden, um den Kanal
ORF Sport plus weiterzuentwickeln.
Ebenfalls eine Petition, die mir persönlich ein Anliegen ist, ist die Petition „Rettet den Wienerwald“ – ein besonderes Anliegen eines der Nachfolger des legendären Retters des Wienerwalds Josef Schöffel, nämlich von Wolfgang Gerstl, der sich da wirklich toll einsetzt.
Eine aktuelle Petition, die wir noch nicht behandelt
haben – für mich bemerkenswert –, hat den Titel
„Women’s soccer without boundaries“. Da geht es primär
um den Kampf für die gleiche Bezahlung von Frauen und Männern,
was den Sport betrifft. Da gibt es eine bemerkenswerte Geschichte: Die legendäre
Tennisspielerin Billie Jean King, die in den Sechziger- und Siebzigerjahren so
ziemlich alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt, hat 1973 Bobby Riggs
geschlagen, der damals einer der besten Tennisspieler der Welt war.
Das ist eingegangen in The Battle of the Sexes, und seither – seit
1973 – werden die Damen und Herren bei den US-Open das Preisgeld
betreffend gleich
bezahlt. (Beifall bei der ÖVP.)
Ich habe abschließend noch ein persönliches
Anliegen: Heute gegen 7 Uhr war in den ORF 2-Nachrichten eine
Programmvorschau, in der angekündigt wurde,
was am zweiten Weihnachtstag in Österreich für ein Programm gespielt
wird. Ich habe mir gedacht: Eigentlich heißt doch in Österreich der
zweite Weihnachtstag – den es für mich gar nicht
gibt – Stefanitag.
Lieber ORF, vielleicht könnten wir bei Stefanitag für den 26. und bei Christtag für den 25. Dezember bleiben, das würde auch den Traditionen der österreichischen Feiertage zu Weihnachten entsprechen. (Beifall und Bravorufe bei der ÖVP.)
18.40
Präsidentin Doris Bures: Nun gelangt Herr Abgeordneter Peter Schmiedlechner zu Wort. – Bitte.
18.40
Abgeordneter Peter Schmiedlechner
(FPÖ): Frau Präsident! Sehr
geehrte Zuseher! Zur Petition zum Lärmschutz an der Südbahnstrecke in
Neunkirchen: Gerade in diesem Gebiet ist erkenntlich, dass die Anrainer dieser Südbahnstrecke
in Neunkirchen seit Langem unter dem Lärm leiden und dort kein
Lärmschutz besteht. Das Interessante oder das Seltsame bei der ganzen
Geschichte ist, dass bis zur Stadtgrenze hin ein Lärmschutz besteht. Im
Stadtgebiet ist kein Lärmschutz vorhanden und dann, kaum beginnt die
Gemeinde Ternitz, kaum ist man außerhalb der Stadtgemeinde
Neunkirchen, beginnt der Lärmschutz wieder. Unser Ansinnen und unsere
Aufgabe ist und war, dieses Problem aufzuzeigen. Ich finde es sehr gut, dass
auch die
anderen Parteien es so sehen, dass dort ein Lückenschluss unbedingt notwendig ist.
Ein hoher Lärmpegel
bedeutet gesundheitliche Belastung, Stress, Kopfschmerzen und auch andere,
oft körperliche Manifestationen. Keiner von uns
will das haben. Jeder von uns will auch für seine Familie, für seine
Kinder ein ruhiges Zuhause. Außerdem bedeutet Lärm finanzielle
Kosten durch die Notwendigkeit, dass man oft eine besondere Dämmung oder
besondere Fenster einbauen lassen muss, und er bedeutet leider oft auch
für die Immobilie,
die man dort in der Nähe der Bahn hat, einen Wertverlust.
Das müssen die Anrainer in Neunkirchen seit Jahrzehnten hinnehmen. Sie haben schon mehrere Versuche getätigt, um das zu ändern, um dort etwas zu verbessern. Sie sind leider immer auf taube Ohren gestoßen. Deswegen habe ich die Petition eingebracht, um das Problem hier zu diskutieren und um das Problem in den Nationalrat zu tragen. Gerade aus diesem Grund finde ich es sehr gut, dass die Petition dem Verkehrsausschuss zugewiesen worden ist.
Man muss bei der ganzen Geschichte auch wissen, dass ja jetzt – hoffentlich bald – der Semmeringbasistunnel fertiggestellt wird. Dadurch wird der Zugverkehr noch mehr zunehmen. Dadurch werden aber auch die Züge schneller
fahren. Dadurch wird die Lärmbelastung um ein Wesentliches mehr. Deswegen ist gerade dort jetzt Lärmschutz notwendig.
Das Interessante, wenn man sich die Thematik anschaut, ist,
dass die ÖBB ja nicht untätig ist, sondern dort jetzt eine
Bahnunterführung baut. Für
mich ist dann nur fraglich, warum man nicht gleich auch den Lärmschutz mitmacht,
wenn man dort schon Bautätigkeiten durchführt.
Ich bedanke mich dafür, dass die anderen Parteien das
ähnlich sehen, dass wir dort endlich etwas weiterbringen. (Abg. Schmuckenschlager: ...
kann ja
der Verkehrslandesrat von Niederösterreich machen!) Ich hoffe
natürlich auch, dass Frau Minister Gewessler, anstatt dass sie Millionen
ins Ausland verschenkt
und verbrät, endlich die Probleme, die wir im eigenen Land haben, angeht –
und Probleme gibt es genug, nicht nur den Lärmschutz. Wenn ich sehe, dass
heutzutage jeder zweite Zug ausfällt, dann werden es immer mehr Probleme.
Die Ministerin ist nicht im Land, kümmert sich nicht um die Probleme, geht
ins Ausland und verschenkt dort die Millionen. – Das ist eure
Politik, und mit dieser Politik werden wir nächstes Jahr aufräumen. (Beifall
bei der FPÖ.)
18.44
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Friedrich Ofenauer. – Bitte.
Abgeordneter
Mag. Friedrich Ofenauer (ÖVP): Frau
Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Geschätzte
Zuseherinnen und Zuseher!
Hohes Haus! Ich beziehe mich auch auf die Petition betreffend „Digitales
Klimaticket jetzt!“ (Zwischenruf des Abg. Loacker.)
Man kann natürlich vieles kritisieren – zum
Beispiel, dass die Digitalisierung nicht sofort Einzug gehalten
hat –, man muss aber schon festhalten, dass das Klimaticket
ein großer Wurf der Koalition ist, auf den man zu Recht stolz sein kann
und den wir uns auch nicht schlechtzureden lassen brauchen, meine Damen
und Herren. (Beifall bei ÖVP und Grünen.)
Es steht mittlerweile auch auf der Homepage klimaticket.at, wo es jeder nachlesen kann: Seit 27. November gibt es das Ticket auch in digitaler Form.
Es war aber in jedem Fall ein großer Wurf und das gilt
es auch festzuhalten, denn Mobilität ist ein Motor für unsere
Wohlstandsgesellschaft, meine Damen
und Herren. Sie verbindet Menschen, sie schafft soziale Teilhabe. Sie
ermöglicht Zugang zu Bildung, zu Arbeit
und Freizeit und verbindet auch Stadt und Land.
Wir investieren mit dem Budget 2024 wirklich viel in den öffentlichen Verkehr. Jetzt geht es natürlich auch darum, den öffentlichen Verkehr besser und bequemer zu machen und die Angebote auszubauen – auch vor dem Hintergrund des Klimaschutzes, denn der funktioniert vor allem über eine Verlagerung des Verkehrs hin zum öffentlichen Verkehr, hin zur sogenannten Mobilitätswende.
Mit dem kürzlich beschlossenen Budget bekennen wir uns
zu einer Transformation in Richtung klimafreundliche Mobilität, aber
auch zur Wahlfreiheit bei
der Mobilitätsform. Wichtig ist uns die Wahlfreiheit, denn es hat nicht
jeder die Möglichkeit, auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen. Es
gibt eine erkleckliche Anzahl von Pendlerinnen und Pendlern, die
nicht aus Jux und Tollerei durch die Landschaft fahren, sondern die das
schlicht und ergreifend brauchen, weil
sie zur Arbeit fahren müssen, weil eben das öffentliche
Verkehrsangebot in ihren Bereichen nicht so ausgebaut ist. Sie fahren mit dem
Auto, weil es ihr Arbeitsplatz verlangt. Das kostet Geld, das kostet vor
allem auch Zeit und das betrifft 1,3 Millionen Menschen, die das
Pendlerpauschale beziehen.
Meine Damen und Herren, vonseiten der ÖVP können
wir ganz klar sagen, dass wir uns gegen eine Abschaffung der Pendlerpauschale
aussprechen. (Beifall
bei der ÖVP. – Abg. Prinz – in
Richtung des sich zu seinem Sitzplatz begebenden Abg. Ofenauer –:
Klare Worte!)
18.47
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Andreas Minnich. – Bitte.
18.47
Abgeordneter Andreas Minnich (ÖVP): Frau Präsidentin! Hohes Haus! Sehr geehrte
Zuseher! Im heutigen Sammelbericht des Petitionsausschusses findet
sich eine Petition, die ein digitales Klimaticket fordert.
Mein Vorredner Fritz Ofenauer
hat diese Petition gerade angesprochen,
und auch ich möchte mich bei den Initiatoren dieser Petition herzlich
bedanken. Seit Ende des letzten Monats ist die Forderung umgesetzt. Das
Klimaticket, kombiniert mit dem Klimabonus, ist mit Sicherheit ein
Leuchtturmprojekt dieser Bundesregierung – eine Successstory, um die
wir auch international sehr beneidet werden.
Dieses Paket ist
ökologisch, nachhaltig und sozial. Mit der Digitalisierung dieses Tickets
gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Nutzerfreundlichkeit.
Ich glaube, es ist unumstritten, dass das Klimaticket und der Klimabonus
eine gute Sache sind und auch sehr gut funktionieren. Leider
gibt es aber auch Ausnahmen. Bei den Gemeinden Großmugl und Niederleis
gibt es leider Unschärfen. Bei über 2 000 Gemeinden in
Österreich wird es in
ein paar Fällen auch notwendig sein, sich diese gesondert anzusehen, um
den regionalen Ansprüchen gerecht zu werden.
In Ihre Richtung, sehr geehrte Frau Bundesminister: Wir
sind uns mit Sicherheit einig, dass unsere Gemeinden unsere
wichtigsten Partner sind.
Bitte nehmen wir uns Zeit, schenken wir den Bürgermeistern ein Ohr
für diese Unschärfe und lösen
wir dieses Problem bitte direkt mit den betroffenen
Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. – Vielen Dank. (Beifall
bei der ÖVP.)
18.49
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Christoph Zarits. – Bitte.
Abgeordneter Christoph Zarits (ÖVP): Frau Präsidentin! Meine geschätzten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich wollte als letzter Redner eigentlich die Gelegenheit nutzen, um mich auch zur Petition zu den
Wombats zu äußern. Ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, um mich bei Kollegen Weratschnig ganz herzlich zu bedanken. Ich kann deiner Rede natürlich vollinhaltlich zustimmen. Darum ersparen wir uns heute etwas Zeit.
Ich möchte nun nur ganz kurz etwas zum Klimaticket
sagen. Es war eines
der Leuchtturmprojekte dieser Bundesregierung. Die gute Nachricht: Der Preis
wird im nächsten Jahr auch nicht erhöht, weil wir die
Gebührenbremse eingeführt haben, und Gott sei Dank ist dieses
Klimaticket jetzt auch digital abrufbar. Ich möchte mich bei allen bedanken,
die hier ihren Beitrag
dazu geleistet haben.
Als Sportsprecher der Volkspartei ist es mir auch wichtig,
zu sagen, dass wir natürlich alles darangesetzt haben, dass die Plattform beziehungsweise
der Sender ORF Sport plus in vollem Umfang erhalten bleibt. Es hat intensive
Gespräche mit allen wichtigen Stakeholdern, mit den Verbänden des
Sports gegeben, dass eben der ORF-Sportkanal bis Ende 2026 in dieser Form
bestehen bleibt.
Es werden natürlich auch Gespräche
mit den Verbänden geführt, um parallel zum TV-Programm beziehungsweise
zu ORF Sport plus eine digitale Plattform anzubieten. Wir brauchen
den Platz für den Sport. In ORF Sport plus – das wurde auch von meinen Vorrednern
angesprochen – ist Platz für jene
Sportarten, die sonst in der medialen Berichterstattung nicht so oft
vorkommen, beispielsweise für den Nachwuchssport, den Gesundheitssport und
den Behindertensport. Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit den
Verbänden und vor allem mit der Sport Austria eine Lösung dafür
finden
werden, wie wir diese digitale Plattform über das Jahr 2026 hinaus
weiterentwickeln werden.
Ich danke allen, die beim letzten Mal im
Petitionsausschuss einen sachlichen Beitrag geleistet haben. Es war eine sehr,
sehr gute Diskussion, und ich
freue mich auf den nächsten Petitionsausschuss. (Beifall bei ÖVP
und Grünen.)
18.51
Präsidentin Doris Bures: Zu Wort
ist nun niemand mehr gemeldet. Damit
ist die Debatte geschlossen.
Wünscht der Herr Berichterstatter ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall.
Damit kommen wir zur Abstimmung
über den Antrag des Ausschusses
für Petitionen und Bürgerinitiativen, seinen Bericht 2339 der
Beilagen hinsichtlich der Petitionen 106 und 112 bis 115 zur Kenntnis
zu nehmen.
Wer spricht sich für die Kenntnisnahme aus? – Das ist einstimmig, daher so angenommen.
Die Tagesordnung ist erschöpft.
Präsidentin Doris Bures: Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag des Herrn Abgeordneten Nikolaus Scherak, Kolleginnen und Kollegen, dem Justizausschuss zur Berichterstattung über den Antrag 361/A(E) der Abgeordneten Margreiter, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Unabhängiger Bundesstaatsanwalt“ eine Frist bis 31. Jänner 2024 zu setzen.
Wer für diesen Fristsetzungsantrag ist, den bitte ich um ein Zeichen. – Das ist die Minderheit, abgelehnt.
Präsidentin
Doris Bures: Ich gebe
bekannt, dass in der heutigen Sitzung
die Selbständigen Anträge 3802/A(E) bis 3806/A(E) eingebracht
worden sind.
*****
Die nächste Sitzung des Nationalrates,
die geschäftsordnungsmäßige Mitteilungen und Zuweisungen
betreffen wird, berufe ich für 18.53 Uhr – das ist
gleich im Anschluss an diese Sitzung – ein.
Diese Sitzung ist geschlossen.
Schluss der Sitzung: 18.52 Uhr
|
Impressum: Parlamentsdirektion 1017 Wien |