
Plenarsitzung
des Nationalrates
262. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich
Mittwoch, 15. Mai 2024
XXVII. Gesetzgebungsperiode
Nationalratssaal

Plenarsitzung
des Nationalrates
262. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich
Mittwoch, 15. Mai 2024
XXVII. Gesetzgebungsperiode
Nationalratssaal
Stenographisches Protokoll
262. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich
XXVII. Gesetzgebungsperiode Mittwoch, 15. Mai 2024
Dauer der Sitzung
Mittwoch, 15. Mai 2024: 9.05 – 20.53 Uhr
*****
Tagesordnung
1. Punkt: Erklärung des Präsidenten der Parlamentarischen Versammlung des Europarates Theodoros Rousopoulos gemäß § 19a der Geschäftsordnung des Nationalrates
2. Punkt: Bericht über den Außen- und Europapolitischen Bericht 2022 der Bundesregierung
3. Punkt: Bericht über den Antrag 4000/A(E) der Abgeordneten Hermann Gahr, Mag. Selma Yildirim, Peter Wurm, Hermann Weratschnig, MBA MSc, Dr. Helmut Brandstätter, Kolleginnen und Kollegen betreffend gegenseitige Anerkennung von Fachhochschulabschlüssen zwischen Österreich und Italien zur weiteren Erleichterung für Studierende
4. Punkt: Bericht über den Antrag 4001/A der Abgeordneten Johannes Schmuckenschlager, Dr. Astrid Rössler, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Emissionsgesetz-Luft 2018 geändert wird
5. Punkt: Bericht über den Antrag 4016/A der Abgeordneten Lukas Hammer, Johannes Schmuckenschlager, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Klimabonusgesetz geändert wird
6. Punkt: Bericht des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft betreffend Leistungen der Umweltförderungen im Bereich der Wasserwirtschaft 2017-2019 und 2020-2022 – Evaluierung des Bundes
7. Punkt: Bundesgesetz, mit dem das Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz und das Postmarktgesetz geändert werden
8. Punkt: Bundesgesetz über die Erhöhung der Quote Österreichs beim Internationalen Währungsfonds (IWFQuotenerhöhungsgesetz 2024)
9. Punkt: Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeordnung 1994, das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz und die Bundesabgabenordnung geändert werden (Grace-Period – Gesetz)
10. Punkt: Bericht über den Antrag 4014/A der Abgeordneten Peter Haubner, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Finanzausgleichsgesetz 2024 geändert wird
11. Punkt: Bericht über den Antrag 4015/A der Abgeordneten Peter Haubner, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Nationale Emissionszertifikatehandelsgesetz 2022 geändert wird
*****
Inhalt
Nationalrat
Trauerkundgebung anlässlich des Ablebens des ehemaligen Zweiten Präsidenten des Nationalrates und Bundesministers a. D. Robert Lichal .......................................... 68
Erklärung des Präsidenten Mag. Wolfgang Sobotka anlässlich des Angriffs auf den slowakischen Regierungschef Robert Fico ...................................................................................... 333
Personalien
Verhinderungen ........................................................................................................... 69
Ordnungsrufe .......................................................................................... 149, 164, 284
Geschäftsbehandlung
Wortmeldungen betreffend Wahrung des Respekts gegenüber anderen sowie Wortwahl:
Peter Haubner .......................................................................................................... .. 164
Philip Kucher ............................................................................................................ .. 165
Dr. Nikolaus Scherak, MA ....................................................................................... .. 166
Dr. Dagmar Belakowitsch ....................................................................................... .. 167
Dr. Christian Stocker .................................................................................................. 168
Stellungnahme des Präsidenten Ing. Norbert Hofer ............................................... 169
Antrag der Abgeordneten Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer, dem Ausschuss für Wirtschaft, Industrie und Energie zur Berichterstattung über den Antrag 3582/A(E) der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Verlängerung des Strompreiskosten-Ausgleichsgesetzes 2022“ gemäß § 43 Abs. 1 GOG eine Frist bis 7. Juni 2024 zu setzen – Ablehnung 180, 533
Antrag gemäß § 69 Abs. 3 GOG, das Volksbegehren „Kein NATO-Beitritt“ (2546 d.B.) in erste Lesung zu nehmen – Annahme ..................................................................... 181, 181
Antrag gemäß § 69 Abs. 3 GOG, das Volksbegehren „Essen nicht wegwerfen!“ (2547 d.B.) in erste Lesung zu nehmen – Annahme ........................................................... 181, 181
Antrag gemäß § 69 Abs. 3 GOG, das Volksbegehren „Glyphosat verbieten!“ (2548 d.B.) in erste Lesung zu nehmen – Annahme ..................................................................... 181, 181
Antrag gemäß § 69 Abs. 3 GOG, das Volksbegehren „Nein zu Atomkraft-Greenwashing“ (2549 d.B.) in erste Lesung zu nehmen – Annahme ................................... 181, 182
Redezeitbeschränkung nach Beratung in der Präsidialkonferenz gemäß § 57 Abs. 5 GOG ............................................................................................................................. 182
Aktuelle Stunde (59.)
Thema: „Wieso zahlen in Österreich Milliardäre weniger Steuern als Menschen, die arbeiten gehen, Herr Bundeskanzler?“ ............................................................................... .... 70
Redner:innen:
Kai Jan Krainer ......................................................................................................... .... 70
Staatssekretärin Claudia Plakolm .......................................................................... .... 75
August Wöginger ..................................................................................................... .... 79
MMag. Michaela Schmidt ....................................................................................... .... 83
Dr. Dagmar Belakowitsch ....................................................................................... .... 86
Mag. Nina Tomaselli ................................................................................................ .... 89
Josef Schellhorn ....................................................................................................... .... 92
Mag. Carmen Jeitler-Cincelli, BA ............................................................................ .... 95
Julia Elisabeth Herr .................................................................................................. .... 99
MMMag. Dr. Axel Kassegger .................................................................................. .. 102
Mag. Markus Koza ................................................................................................... .. 105
Mag. Gerald Loacker ................................................................................................ .. 108
Aktuelle Stunde – Aktuelle Europastunde (60.)
Thema: „EU-Wahnsinn stoppen – Festung Europa als Garant für Sicherheit, Wohlstand, Frieden und Freiheit“ ............................................................................................... 111
Redner:innen:
Petra Steger .............................................................................................................. .. 112
Bundesministerin Mag. Karoline Edtstadler .......................................................... .. 118
Dr. Reinhold Lopatka ............................................................................................... .. 124
MEP Mag. Andreas Schieder ................................................................................... .. 128
MEP Harald Vilimsky .................................................................................................. 131
MEP Thomas Waitz .................................................................................................... 134
Dr. Helmut Brandstätter ......................................................................................... .. 137
Mag. Peter Weidinger .............................................................................................. .. 140
Mag. Jörg Leichtfried ............................................................................................... .. 143
Michael Schnedlitz ................................................................................................... .. 146
Dr. Ewa Ernst-Dziedzic ............................................................................................ .. 149
MEP Claudia Gamon, MSc (WU) ............................................................................... 152
MEP Dr. Othmar Karas, MBL-HSG ............................................................................ 155
Eva Maria Holzleitner, BSc ...................................................................................... .. 158
Herbert Kickl ............................................................................................................ .. 160
Mag. Meri Disoski .................................................................................................... .. 169
Mag. Beate Meinl-Reisinger, MES .......................................................................... .. 173
Bundesregierung
Vertretungsschreiben ................................................................................................. 69
Rechnungshof
Verlangen gemäß § 99 Abs. 2 der Geschäftsordnung im Zusammenhang mit dem Antrag 4017/A betreffend Gebarungsüberprüfung ............................................. 534
Ausschüsse
Zuweisungen .............................................................................................................. 176
Verhandlungen
1. Punkt: Erklärung des Präsidenten der Parlamentarischen Versammlung des Europarates Theodoros Rousopoulos gemäß § 19a der Geschäftsordnung des Nationalrates 182
Theodoros Rousopoulos ............................................................................................. 183
Durchführung einer Debatte gemäß § 19a GOG .................................................. 193
Redner:innen:
Dr. Reinhold Lopatka .................................................................................................. 193
Doris Bures .................................................................................................................. 196
Dr. Susanne Fürst ....................................................................................................... 198
Mag. Meri Disoski .................................................................................................... .. 202
Dr. Stephanie Krisper .............................................................................................. .. 204
Theodoros Rousopoulos ............................................................................................. 208
Mag. Carmen Jeitler-Cincelli, BA ............................................................................... 209
Petra Bayr, MA MLS ................................................................................................... 212
Mag. Dr. Martin Graf ............................................................................................... .. 215
Mag. Agnes Sirkka Prammer ................................................................................... .. 218
Dr. Nikolaus Scherak, MA ....................................................................................... .. 221
2. Punkt: Bericht des Außenpolitischen Ausschusses über den Außen- und Europapolitischen Bericht 2022 der Bundesregierung (III-1151/2536 d.B.) ........................................ 224
Redner:innen:
Dr. Susanne Fürst ..................................................................................................... .. 224
Dipl.-Ing. Georg Strasser ......................................................................................... .. 227
Ing. Mag. Volker Reifenberger ................................................................................ .. 229
Christoph Stark (tatsächliche Berichtigung) ........................................................... 232
Petra Bayr, MA MLS ................................................................................................... 233
Petra Steger ................................................................................................................ 237
Dr. Ewa Ernst-Dziedzic ............................................................................................ .. 245
Dr. Helmut Brandstätter ......................................................................................... .. 247
Mag. Martin Engelberg ............................................................................................ .. 252
Dr. Christoph Matznetter ........................................................................................ .. 256
Mag. Faika El-Nagashi ............................................................................................. .. 259
Henrike Brandstötter ............................................................................................... .. 261
Dipl.-Ing. Nikolaus Berlakovich ............................................................................... .. 264
Mag. Muna Duzdar .................................................................................................. .. 267
Mag. Bettina Rausch-Amon .................................................................................... .. 269
Robert Laimer ........................................................................................................... .. 272
Nico Marchetti ......................................................................................................... .. 276
Bundesminister Mag. Alexander Schallenberg, LL.M. ........................................... .. 278
Mag. Jörg Leichtfried ............................................................................................... .. 280
Michael Schnedlitz ................................................................................................... .. 282
Entschließungsantrag der Abgeordneten Katharina Kucharowits, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Neutralität sichern, aktive Friedenspolitik betreiben“ – Ablehnung 235, 284
Entschließungsantrag der Abgeordneten Petra Steger, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Schaffung der Festung Europa und Beendigung der illegalen Migrationsströme“ – Ablehnung 241, 284
Entschließungsantrag der Abgeordneten Douglas Hoyos-Trauttmansdorff, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Vorlage der Österreichischen Sicherheitsstrategie an den Nationalrat“ – Ablehnung ........................................................................................................ 250, 285
Entschließungsantrag der Abgeordneten Henrike Brandstötter, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Vorlage des Entwurfs der Afrikastrategie an den Nationalrat“ – Ablehnung 263, 285
Entschließungsantrag der Abgeordneten Robert Laimer, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Strengere Exportkontrollen für Kriegswaffen und effektive Reglementierung der Rüstungs-Lobbys“ – Ablehnung ...................................................................................... 274, 285
Kenntnisnahme des Berichtes III-1151 d.B. .......................................................... 284
3. Punkt: Bericht des Außenpolitischen Ausschusses über den Antrag 4000/A(E) der Abgeordneten Hermann Gahr, Mag. Selma Yildirim, Peter Wurm, Hermann Weratschnig, MBA MSc, Dr. Helmut Brandstätter, Kolleginnen und Kollegen betreffend gegenseitige Anerkennung von
Fachhochschulabschlüssen zwischen Österreich und Italien zur weiteren Erleichterung für Studierende (2537 d.B.) ............................................ 285
Redner:innen:
Hermann Gahr ......................................................................................................... .. 286
Mag. Selma Yildirim ................................................................................................. .. 290
Peter Wurm .............................................................................................................. .. 291
Hermann Weratschnig, MBA MSc .......................................................................... .. 298
Mag. Martina Künsberg Sarre ................................................................................. .. 300
Entschließungsantrag der Abgeordneten Hermann Gahr, Mag. Selma Yildirim, Peter Wurm, Hermann Weratschnig, MBA MSc, Dr. Helmut Brandstätter, Kolleginnen und Kollegen betreffend „die Bewahrung und Entwicklung der Autonomie Südtirols“ – Annahme (370/E) 288, 301
Entschließungsantrag der Abgeordneten Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft an Hermine Orian“ – Ablehnung 295, 301
Annahme der dem schriftlichen Ausschussbericht 2537 d.B. beigedruckten Entschließung betreffend „gegenseitige Anerkennung von Fachhochschulabschlüssen zwischen Österreich und Italien zur weiteren Erleichterung für Studierende“ (369/E) ....................... 301
4. Punkt: Bericht des Umweltausschusses über den Antrag 4001/A der Abgeordneten Johannes Schmuckenschlager, Dr. Astrid Rössler, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Emissionsgesetz-Luft 2018 geändert wird (2538 d.B.) ............................................................................................................................. 302
Redner:innen:
Dietmar Keck ........................................................................................................... .. 302
Dr. Astrid Rössler ..................................................................................................... .. 304
Johannes Schmuckenschlager ................................................................................ .. 306
Michael Bernhard .................................................................................................... .. 308
Bundesministerin Leonore Gewessler, BA ...................................................... 310, 325
Johann Höfinger ...................................................................................................... .. 313
Ing. Josef Hechenberger .......................................................................................... .. 315
Hermann Weratschnig, MBA MSc .......................................................................... .. 318
Mag. Gerald Hauser ................................................................................................. .. 326
Andreas Ottenschläger ............................................................................................ .. 331
Entschließungsantrag der Abgeordneten Andreas Ottenschläger, Hermann Weratschnig, MBA MSc, Mag. Selma Yildirim, Dr. Johannes Margreiter, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Tiroler Bevölkerung schützen und die Tiroler Landesregierung unterstützen: Gesundheits- und Umweltschutz sowie Versorgungssicherheit in Tirol haben einen höheren Wert als die freie Fahrt für Millionen von Transit-LKW“ – Annahme (371/E) 321, 334
Entschließungsantrag der Abgeordneten Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Tiroler Bevölkerung schützen und die Tiroler Landesregierung unterstützen: Gesundheits- und Umweltschutz sowie Versorgungssicherheit in Tirol haben einen höheren Wert als die freie Fahrt für Millionen von Transit-LKW“ – Ablehnung .................................. 329, 334
Annahme des Gesetzentwurfes in 2538 d.B. ........................................................ 333
5. Punkt: Bericht des Umweltausschusses über den Antrag 4016/A der Abgeordneten Lukas Hammer, Johannes Schmuckenschlager, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Klimabonusgesetz geändert wird (2539 d.B.) ....... 334
Redner:innen:
MMag. Michaela Schmidt ....................................................................................... .. 335
Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA ................................................................................... .. 337
Walter Rauch ........................................................................................................... .. 344
Joachim Schnabel .................................................................................................... .. 350
Michael Bernhard .................................................................................................... .. 352
Bundesministerin Leonore Gewessler, BA .............................................................. .. 356
Johannes Schmuckenschlager ................................................................................ .. 359
Michael Schnedlitz ................................................................................................... .. 361
Ing. Martin Litschauer ............................................................................................. .. 363
Entschließungsantrag der Abgeordneten Walter Rauch, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Abschaffung des Klimabonus für Asylwerber“ – Ablehnung ................... 346, 366
Annahme des Gesetzentwurfes in 2539 d.B. ........................................................ 365
6. Punkt: Bericht des Umweltausschusses über den Bericht des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft betreffend Leistungen der Umweltförderungen im Bereich der Wasserwirtschaft 2017-2019 und 2020-2022 – Evaluierung des Bundes (III-1081/2540 d.B.) ....................................................... 366
Redner:innen:
Ing. Martin Litschauer ............................................................................................. .. 366
Julia Elisabeth Herr .................................................................................................. .. 369
Alois Kainz ................................................................................................................ .. 378
Dipl.-Ing. Nikolaus Berlakovich ............................................................................... .. 379
Julia Elisabeth Herr (tatsächliche Berichtigung) ..................................................... 382
Michael Bernhard .................................................................................................... .. 384
Bundesminister Mag. Norbert Totschnig, MSc ...................................................... .. 386
Robert Laimer ........................................................................................................... .. 390
Martina Diesner-Wais ............................................................................................. .. 392
Elisabeth Feichtinger, BEd BEd ............................................................................... .. 394
Franz Hörl ................................................................................................................. .. 396
Nikolaus Prinz .......................................................................................................... .. 399
Entschließungsantrag der Abgeordneten Julia Elisabeth Herr, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Schutz der heimischen Wasserversorgung“ – Ablehnung .... 373, 403
Kenntnisnahme des Berichtes III-1081 d.B. .......................................................... 403
7. Punkt: Bericht des Finanzausschusses über die Regierungsvorlage (2502 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz und das Postmarktgesetz geändert werden (2541 d.B.) .................................................................................................... 403
Redner:innen:
Franz Leonhard Eßl .................................................................................................. .. 404
Maximilian Lercher .................................................................................................. .. 406
Mag. Ulrike Fischer .................................................................................................. .. 408
Mag. Gerald Loacker ................................................................................................ .. 410
Angela Baumgartner ............................................................................................... .. 411
Annahme des Gesetzentwurfes in 2541 d.B. ........................................................ 412
8. Punkt: Bericht des Finanzausschusses über die Regierungsvorlage (2509 d.B.): Bundesgesetz über die Erhöhung der Quote Österreichs beim Internationalen Währungsfonds (IWFQuotenerhöhungsgesetz 2024) (2542 d.B.) ................................................ 412
Redner:innen:
Mag. Dr. Rudolf Taschner ........................................................................................ .. 413
Petra Bayr, MA MLS ................................................................................................... 416
Kai Jan Krainer (tatsächliche Berichtigung) ............................................................ 417
Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA ................................................................................... .. 418
Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer .................................................................................. .. 419
Annahme des Gesetzentwurfes in 2542 d.B. ........................................................ 420
9. Punkt: Bericht des Finanzausschusses über die Regierungsvorlage (2510 d.B.): Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeordnung 1994, das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz und die Bundesabgabenordnung geändert werden (Grace-Period – Gesetz) (2543 d.B.) 421
Redner:innen:
Dr. Christoph Matznetter ........................................................................................ .. 421
Peter Haubner .......................................................................................................... .. 426
Mag. Selma Yildirim ................................................................................................. .. 428
MMag. DDr. Hubert Fuchs ...................................................................................... .. 430
Dr. Elisabeth Götze .................................................................................................. .. 433
Mag. Gerald Loacker ................................................................................................ .. 435
Gabriel Obernosterer ............................................................................................... .. 435
Maximilian Linder .................................................................................................... .. 438
Peter Wurm .............................................................................................................. .. 440
Michael Bernhard .................................................................................................... .. 449
Entschließungsantrag der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Steuergerechtigkeit für Arbeitnehmer:innen und Pensionist:innen“ – Ablehnung 423, 453
Entschließungsantrag der Abgeordneten Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Recht auf analoge Inanspruchnahme und Teilhabe an den Dienstleistungen der Verwaltung und der Daseinsvorsorge“ – Ablehnung ...................................................... 444, 453
Entschließungsantrag der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Entlastungsversprechen einfach umsetzen: Abschaffung der Kammerumlage 2“ – Ablehnung ........................................................................................................ 450, 453
Annahme des Gesetzentwurfes in 2543 d.B. ........................................................ 453
10. Punkt: Bericht des Finanzausschusses über den Antrag 4014/A der Abgeordneten Peter Haubner, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA, Kolleginnen
und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Finanzausgleichsgesetz 2024 geändert wird (2544 d.B.) .............. 454
Redner:innen:
Philip Kucher ............................................................................................................ .. 454
Andreas Ottenschläger ............................................................................................ .. 459
Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer .................................................................................. .. 461
Maximilian Linder .................................................................................................... .. 464
Kai Jan Krainer ......................................................................................................... .. 465
Mag. Nina Tomaselli ................................................................................................... 472
Christian Oxonitsch .................................................................................................... 474
Ing. Klaus Lindinger, BSc ......................................................................................... .. 478
Mag. Philipp Schrangl .............................................................................................. .. 481
Lukas Brandweiner .................................................................................................. .. 483
Entschließungsantrag der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Recht auf analoges Leben“ – Ablehnung .................................................... 468, 486
Annahme des Gesetzentwurfes in 2544 d.B. ........................................................ 485
11. Punkt: Bericht des Finanzausschusses über den Antrag 4015/A der Abgeordneten Peter Haubner, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Nationale Emissionszertifikatehandelsgesetz 2022 geändert wird (2545 d.B.) ............................................................................................................................. 486
Redner:innen:
MMag. Michaela Schmidt ....................................................................................... .. 487
Peter Haubner .......................................................................................................... .. 488
MMMag. Dr. Axel Kassegger .................................................................................. .. 522
Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA ................................................................................... .. 526
Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer .................................................................................. .. 528
Kai Jan Krainer ......................................................................................................... .. 530
Annahme des Gesetzentwurfes in 2545 d.B. ........................................................ 532
Eingebracht wurden
Volksbegehren .......................................................................................................... 177
2546: Volksbegehren „Kein NATO-Beitritt“
2547: Volksbegehren „Essen nicht wegwerfen!“
2548: Volksbegehren „Glyphosat verbieten!“
2549: Volksbegehren „Nein zu Atomkraft-Greenwashing“
Petitionen ................................................................................................................... 178
Petition betreffend „Barrierefreier Zugang zum Bahnhof in Zirl“ (Ordnungsnummer 143) (überreicht vom Abgeordneten Hermann Gahr)
Petition betreffend „Eigenrechtsfähigkeit der Natur – Anregung auf Abänderung der Bundesverfassung und von Bundesgesetzen“ (Ordnungsnummer 144) (überreicht von der Abgeordneten Dr. Astrid Rössler)
Bürgerinitiative ......................................................................................................... 178
Bürgerinitiative betreffend „Gemeinsam denken – Kindern helfen!“ (Ordnungsnummer 67)
Berichte ...................................................................................................................... 177
Vorlage 154 BA: Monatserfolg Februar 2024 sowie Berichte gemäß § 3 Abs. 2 Kommunalinvestitionsgesetz 2023, § 3 Abs. 4 COVID-19-Fondsgesetz, § 3b Abs. 4 ABBAG-Gesetz und gemäß der Entschließung 275/E des Nationalrates vom 17.11.2022 zur Berichterstattung über den Umsetzungsstand des Aufbau- und Resilienzplans
Vorlage 155 BA: Vorläufiger Gebarungserfolg 2023; BM f. Finanzen
Vorlage 156 BA: Monatserfolg März 2024 sowie COVID-19 Berichterstattung gemäß § 3 Abs. 2 Kommunalinvestitionsgesetz 2023, § 3 Abs. 4 COVID-19 Fondsgesetz und § 3b Abs. 4 ABBAG-Gesetz sowie das Monitoring von Verschuldung und Investitionstätigkeit der Gemeinden; BM f. Finanzen
Vorlage 157 BA: Bericht gemäß § 54 Abs. 12 BHG 2013 über die Genehmigung von Mittelverwendungsüberschreitungen und gemäß § 60 Abs. 3 BHG 2013 über zugestimmte Vorbelastungen im 1. Quartal 2024; BM f. Finanzen
Vorlage 158 BA: Bericht gemäß § 4a Zahlungsbilanzstabilisierungsgesetz über die im 1. Quartal 2024 ergriffenen Maßnahmen; BM f. Finanzen
Vorlage 159 BA: Bericht gemäß Art. 50c Abs. 3 B-VG iVm § 6 der Anlage 2 zum GOG (ESM-Informationsordnung) über die im Rahmen des Europäischen Stabilitätsmechanismus getroffenen Maßnahmen im 1. Quartal 2024; BM f. Finanzen
III-1135: 47. Bericht der Volksanwaltschaft (1. Jänner bis 31. Dezember 2023)
III-1144: Bericht betreffend Social-Media-Accounts von Regierungsmitgliedern – Reihe BUND 2024/13; Rechnungshof
III-1152: 9. Bericht über die Vollziehung der Umweltverträglichkeitsprüfung in Österreich; BM f. Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie
III-1153: Datenschutzbericht 2023; BM f. Justiz
III-1154: Bericht betreffend Administratives Unterstützungspersonal an allgemeinbildenden Pflichtschulen – Reihe BUND 2024/14; Rechnungshof
III-1155: Bericht betreffend Intelligente Messgeräte (Smart Meter) – Einführungsstand 2022 – Reihe BUND 2024/15; Rechnungshof
III-1156: Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für März 2024 – Untergliederung 34 Innovation und Technologie (Forschung); BM f. Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie
III-1157: Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für März 2024 – Untergliederung 41 Mobilität; BM f. Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie
III-1158: Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für März 2024 – Untergliederung 43 Klima, Umwelt und Energie; BM f. Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie
III-1159: Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für das Kalenderjahr 2024 (Jänner bis Februar 2024); BM f. Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
III-1160: Arbeitsbericht der Nationalen Koordinierungsstelle für den Nationalen Qualifikationsrahmen (NKS) für das Jahr 2023; BM f. Bildung, Wissenschaft und Forschung
III-1162: Tätigkeitsbericht 2024 der Energie-Control Austria; BM f. Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie
III-1163: Bericht zum Waldfonds für das Jahr 2023; BM f. Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft
III-1165: Umsetzungsbericht 2023 zur Österreichischen Jugendstrategie; Bundeskanzler
III-1166: Tätigkeitsbericht 2023 der Bundesstelle für Sektenfragen; BM f. Frauen, Familie, Integration und Medien
III-1167: Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für April 2024; BM f. Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport
Anträge der Abgeordneten
Douglas Hoyos-Trauttmansdorff, Kolleginnen und Kollegen betreffend den Präventionsmechanismen um Spionagevorfälle im Bundesministerium für Inneres, im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten sowie im Bundesministerium für Landesverteidigung zu verhindern (4017/A)
Mag. Selma Yildirim, Kolleginnen und Kollegen betreffend Missbrauch des Besitzschutzes (4018/A)(E)
Ing. Reinhold Einwallner, Kolleginnen und Kollegen betreffend Österreich fehlen 4.000 Polizist*innen (4019/A)(E)
Dr. Stephanie Krisper, Kolleginnen und Kollegen betreffend Wohnsitzauflage für Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte (4020/A)(E)
Dr. Stephanie Krisper, Kolleginnen und Kollegen betreffend Ausreichend Ressourcen für die Umsetzung des EU Asyl- und Migrationspakts (4021/A)(E)
Dr. Stephanie Krisper, Kolleginnen und Kollegen betreffend Wohnsitzauflage für Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte (4022/A)(E)
Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem Bundesgesetz über die Kammern der gewerblichen Wirtschaft geändert wird (4023/A)
Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über das Verbot der geologischen Speicherung von Kohlenstoffdioxid geändert wird (4024/A)
Mag. Martina Künsberg Sarre, Kolleginnen und Kollegen betreffend Forschungsstandort im Fokus: Reformen gegen den Abwärtstrend in Österreich (4025/A)(E)
Christian Oxonitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend Integrationsjahr und Integrationsjahr-Jugend reaktivieren, mit ausreichend finanziellen Mitteln budgetieren und österreichweit beginnend mit 1. Juli 2024 umsetzen (4026/A)(E)
Josef Muchitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend Einführung einer Jobgarantie zur Beschäftigungsförderung von Langzeitbeschäftigungslosen (4027/A)(E)
Mag. Verena Nussbaum, Kolleginnen und Kollegen betreffend Schaffung eines Inklusionsfonds zur Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen (4028/A)(E)
Mag. Verena Nussbaum, Kolleginnen und Kollegen betreffend Überarbeitung der Kriterien für die Zusatzeintragung der „Unzumutbarkeit der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel wegen dauerhafter Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung“ (4029/A)(E)
Mag. Christian Drobits, Kolleginnen und Kollegen betreffend Maßnahmen zum Schutz älterer Bankkund:innen vor Mißbrauch im elektronischen Zahlungsverkehr (4030/A)(E)
Mag. Michaela Steinacker, Mag. Eva Blimlinger, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Datenschutzgesetz geändert wird (4031/A)
Katharina Kucharowits, Kolleginnen und Kollegen betreffend Maßnahmenpaket für mehr Geschlechtergerechtigkeit in Entwicklung und Anwendung von Künstlicher Intelligenz (4032/A)(E)
Eva Maria Holzleitner, BSc, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Kindergrundsicherung – Jedes Kind hat das Recht auf ein Aufwachsen ohne finanzielle Sorgen!“ (4033/A)(E)
Petra Bayr, MA MLS, Kolleginnen und Kollegen betreffend Initiative zur Erweiterung des Römer Statuts, um genderbasierte Apartheid zu verbieten (4034/A)(E)
Petra Wimmer, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Recht auf einen ganztägigen Kinderbildungs- und betreuungsplatz“ (4035/A)(E)
Hermann Weratschnig, MBA MSc, Andreas Ottenschläger, Kolleginnen und Kollegen betreffend Rampen an Bahn-Verkehrsstationen (4036/A)(E)
Mag. Selma Yildirim, Kolleginnen und Kollegen betreffend Mehr Transparenz bei Gehaltsangaben in Stelleninseraten (4037/A)(E)
Dipl.-Kffr. (FH) Elisabeth Pfurtscheller, Mag. Meri Disoski, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz und das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz geändert werden (4038/A)
Mag. Christian Drobits, Kolleginnen und Kollegen betreffend Maßnahmen zum Schutz älterer Bankkund:innen vor Mißbrauch im elektronischen Zahlungsverkehr (4039/A)(E)
Mag. Martina Künsberg Sarre, Kolleginnen und Kollegen betreffend Volle Aufmerksamkeit den Kindern, Schulbürokratie endlich abbauen! (4040/A)(E)
Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen betreffend Keine Diskriminierung älterer Menschen – Analoge Antragstellung für Handwerkerbonus sicherstellen! (4041/A)(E)
Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen betreffend Keine Diskriminierung älterer Menschen – Analoge Antragstellung für Handwerkerbonus sicherstellen! (4042/A)(E)
MMMag. Dr. Axel Kassegger, Kolleginnen und Kollegen betreffend Keine Diskriminierung älterer Menschen – Analoge Antragstellung für Handwerkerbonus sicherstellen! (4043/A)(E)
MMMag. Dr. Axel Kassegger, Kolleginnen und Kollegen betreffend Verlängerung des Strompreiskosten-Ausgleichsgesetzes (4044/A)(E)
Katharina Kucharowits, Kolleginnen und Kollegen betreffend Angemessene Vergütung für Kreative im Kontext der KI-Nutzung (4045/A)(E)
Gabriele Heinisch-Hosek, Kolleginnen und Kollegen betreffend AMS-Debakel für mehrfach geringfügig Beschäftigte (4046/A)(E)
Katharina Kucharowits, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Künstliche Intelligenz (KI) an Schulen“ (4047/A)(E)
Petra Tanzler, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Jobticket auch für Bundeslehrerinnen und ‑lehrer“ (4048/A)(E)
Anfragen der Abgeordneten
Dr. Johannes Margreiter, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend Pendlerpauschale (18313/J)
Andreas Kollross, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend Eingehobene Wohnbauförderung in den Jahren 2021 bis 2023 (18314/J)
Mario Lindner, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend „Gefahren durch Off-Label-Verschreibungen von Benzodiazepin-Medikamenten an Minderjährige“ (18315/J)
Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie betreffend Energiekrisenbeitrag-Strom und Energiekrisenbeitrag-Fossile – Wo und wann investieren Österreichs Energieunternehmen? (18316/J)
Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend Energiekrisenbeitrag-Strom und Energiekrisenbeitrag-Fossile – Wo und wann investieren Österreichs Energieunternehmen? (18317/J)
Alois Stöger, diplômé, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend Werbegag „Patientenmilliarde“ (18318/J)
Dr. Stephanie Krisper, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend Missstände im Bundesverwaltungsgericht (18319/J)
Mag. Eva Blimlinger, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Antifaschist:innen im Visier von Ex-BVT-Mitarbeiter Egisto Ott (18320/J)
Dr. Stephanie Krisper, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend Unabhängige und verfassungskonforme Rechtsberatung (18321/J)
Dr. Stephanie Krisper, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Unabhängige und verfassungskonforme Rechtsberatung (18322/J)
Petra Tanzler, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung betreffend „Neue Lehrpläne und Lehrplankommission“ (18323/J)
Rainer Wimmer, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend Folgeanfrage zur Evaluierung der COVID-19 Investitionsprämie (18324/J)
Sabine Schatz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Gewalt gegen obdachlose Personen (18325/J)
Robert Laimer, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Landesverteidigung betreffend „Beschaffungspolitik des Verteidigungsministeriums für EU-Rüstungsgüter“ (18326/J)
Robert Laimer, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Landesverteidigung betreffend „Beschaffung Embraer C-390 und Flugzeugpersonal“ (18327/J)
Alois Schroll, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie betreffend Wie steht es um die Transparenz bei der Fernwärme? (18328/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Landesverteidigung betreffend Quartalsbericht der Reisekosten Q1 2024 im Bundesministerium für Landesverteidigung (18329/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport betreffend Quartalsbericht der Reisekosten Q1 2024 im Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (18330/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft betreffend Quartalsbericht
der Reisekosten Q1 2024 im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft (18331/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend Quartalsbericht der Reisekosten Q1 2024 im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (18332/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundeskanzler betreffend Quartalsbericht der Reisekosten Q1 2024 im Bundeskanzleramt (18333/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend Quartalsbericht der Reisekosten Q1 2024 im Bundesministerium für Finanzen (18334/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend Quartalsbericht der Reisekosten Q1 2024 im Bundesministerium für Justiz (18335/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Quartalsbericht der Reisekosten Q1 2024 im Bundesministerium für Inneres (18336/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten betreffend Quartalsbericht der Reisekosten Q1 2024 im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (18337/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung betreffend Quartalsbericht der Reisekosten Q1 2024 im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (18338/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend Quartalsbericht der Reisekosten Q1 2024 im Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (18339/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie betreffend Quartalsbericht der Reisekosten Q1 2024 im Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (18340/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend Personalkosten und Entbürokratisierung Ihres Kabinetts Q1 2024 (18341/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie betreffend Personalkosten und Entbürokratisierung Ihres Kabinetts Q1 2024 (18342/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundeskanzler betreffend Personalkosten und Entbürokratisierung Ihres Kabinetts Q1 2024 (18343/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport betreffend Personalkosten und Entbürokratisierung Ihres Kabinetts Q1 2024 (18344/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend Personalkosten und Entbürokratisierung Ihres Kabinetts Q1 2024 (18345/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Personalkosten und Entbürokratisierung Ihres Kabinetts Q1 2024 (18346/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten betreffend Personalkosten und Entbürokratisierung Ihres Kabinetts Q1 2024 (18347/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend Personalkosten und Entbürokratisierung Ihres Kabinetts Q1 2024 (18348/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung betreffend Personalkosten und Entbürokratisierung Ihres Kabinetts Q1 2024 (18349/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Landesverteidigung betreffend Personalkosten und Entbürokratisierung Ihres Kabinetts Q1 2024 (18350/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend Personalkosten und Entbürokratisierung Ihres Kabinetts Q1 2024 (18351/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft betreffend Personalkosten und Entbürokratisierung Ihres Kabinetts Q1 2024 (18352/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft betreffend Externe Verträge im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft Q1 2024 (18353/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend Externe Verträge im Bundesministerium für Justiz Q1 2024 (18354/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Externe Verträge im Bundesministerium für Inneres Q1 2024 (18355/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend Externe Verträge im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft Q1 2024 (18356/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport betreffend Externe Verträge im
Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport Q1 2024 (18357/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundeskanzler betreffend Externe Verträge im Bundeskanzleramt Q1 2024 (18358/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung betreffend Externe Verträge im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung Q1 2024 (18359/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend Externe Verträge im Bundesministerium für Finanzen Q1 2024 (18360/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten betreffend Externe Verträge im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten Q1 2024 (18361/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie betreffend Externe Verträge im Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie Q1 2024 (18362/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend Externe Verträge im Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz Q1 2024 (18363/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Landesverteidigung betreffend Externe Verträge im Bundesministerium für Landesverteidigung Q1 2024 (18364/J)
Alois Schroll, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie betreffend Was wurde aus dem Bund-Länder-Dialog? (18365/J)
Mag. Hannes Amesbauer, BA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Straftaten in Kirchen und religiösen Gebäuden sowie auf Friedhöfen in der Steiermark (18366/J)
Mag. Hannes Amesbauer, BA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Besuch des Reumannplatzes in Wien-Favoriten durch den Innenminister und die dadurch entstandenen Personalkosten (18367/J)
Mag. Hannes Amesbauer, BA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Russische Einflussnahme auf politische Entscheidungsträger in Österreich (18368/J)
Mag. Hannes Amesbauer, BA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Wirtschaftsspionage (18369/J)
Ing. Mag. Volker Reifenberger, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Landesverteidigung betreffend Betreuungseinrichtungen für Soldaten in Österreichs Kasernen (18370/J)
Hermann Brückl, MA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport betreffend Ergänzungsstudium für Diplomsportlehrer (18371/J)
Werner Herbert, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport betreffend Werbekampagne Öffentlicher Dienst „Echt Öd“ (18372/J)
Dr. Dagmar Belakowitsch, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend Hygiene Austria LP GmbH-Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung – Aktenzeichen 11 S 8/24y – ja Folgeanfrage zu 17196/AB (18373/J)
Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Herkunft der Täter von Frauenmorden (18374/J)
Dr. Dagmar Belakowitsch, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend Scheinunternehmertum und Nachforderungen im Paketgeschäft: Hoher Druck und wenig Lohn – Folgeanfrage (18375/J)
Dr. Dagmar Belakowitsch, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend Scheinunternehmertum und Nachforderungen im Paketgeschäft: Hoher Druck und wenig Lohn – Folgeanfrage (18376/J)
Dr. Dagmar Belakowitsch, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend Scheinunternehmertum und Nachforderungen im Paketgeschäft: Hoher Druck und wenig Lohn – Folgeanfrage (18377/J)
Dr. Dagmar Belakowitsch, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend Art. 5 § 66a AIVG: Arbeitslosenversicherung für Häftlinge – Folgeanfrage zu Anfragebeantwortung 17193/AB (18378/J)
Mag. Gerald Hauser, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend Blutspenden nach den Corona-Impfungen (18379/J)
Mag. Gerald Hauser, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend RKI-Protokolle und Veröffentlichung der Entscheidungsfindung in Österreich (18380/J)
Petra Steger, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend EU-Schuldenaufnahme (18381/J)
Petra Steger, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für EU und Verfassung betreffend EU-Schuldenaufnahme (18382/J)
Petra Steger, Kolleginnen und Kollegen an den Bundeskanzler betreffend EU-Schuldenaufnahme (18383/J)
Petra Steger, Kolleginnen und Kollegen an den Bundeskanzler betreffend Besuch der Nehammers bei Frankreichs Präsident Macron (18384/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung betreffend Überlastung der Schulen durch Familiennachzug (18385/J)
Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend Unterhaltsvorschüsse und Unterhaltsklagen im Jahr 2023 (18386/J)
Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend Plattform gegen Einsamkeit (18387/J)
Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend Genitalverstümmelungen in Österreich (18388/J)
Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend Familienbeihilfe für im Ausland wohnhafte Kinder 2023 (18389/J)
Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend Gerichtliche Einforderung ausständiger Kirchenbeiträge 2023 (18390/J)
Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend die Asylquartiere in Freistadt (18391/J)
Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend Familienbonus plus für Empfänger mit Kindern im Ausland (18392/J)
Christian Lausch, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend Externe medizinische Behandlung von Häftlingen (18393/J)
Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend AMS-Förderungen für Hanger-Unternehmen Orbis Handels GmbH (18394/J)
Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend Wirtschafts-Förderungen für Hanger-Unternehmen Orbis Handels GmbH (18395/J)
Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend Wirtschafts-Förderungen für Hanger-Unternehmen WHK GmbH (18396/J)
Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend AMS-Förderungen für Hanger-Unternehmen WHK GmbH (18397/J)
Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend Wirtschafts-Förderungen für Hanger-Unternehmen NORWIN Handelsgesellschaft m.b.H. (ILO-ILO) (18398/J)
Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend AMS-Förderungen für Hanger-Unternehmen NORWIN Handelsgesellschaft m.b.H. (ILO-ILO) (18399/J)
Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend AMS-Förderungen für Hanger-Unternehmen Ennstal-Ybbstal Infrastruktur GmbH (18400/J)
Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend Wirtschafts-Förderungen für Hanger-Unternehmen Ennstal-Ybbstal Infrastruktur GmbH (18401/J)
Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend AMS-Förderungen für Hanger-Unternehmen Forsteralm Betriebs GmbH (18402/J)
Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend Wirtschafts-Förderungen für Hanger-Unternehmen Forsteralm Betriebs GmbH (18403/J)
Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend VIE Real Toplagen GmbH – Folgeanfrage (18404/J)
Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend VIE IB Immo Beteiligungen GmbH – Folgeanfrage (18405/J)
Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend Dio Innenausbau und Immobilientreuhand GmbH als Komplementär diverser „Tochterfirmen“ – Folgeanfrage (18406/J)
Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend Marketingberatung Census GmbH – Folgeanfrage (18407/J)
Mag. Gerald Hauser, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie betreffend Flugsicherheit nach der mRNA-Impfung (18408/J)
Petra Bayr, MA MLS, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten betreffend „Strategische Partnerschaft mit den Vereinigten Arabischen Emiraten“ (18409/J)
Thomas Spalt, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien betreffend Geschichtsvergessene Relativierungen im Namen der Kunstfreiheit auf FM4 (18410/J)
Alois Kainz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend Beschäftigung von Menschen mit Behinderung im BMSGPK im 1. Quartal 2024 (18411/J)
Alois Kainz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend Beschäftigung von Menschen mit Behinderung im BMAW im 1. Quartal 2024 (18412/J)
Alois Kainz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten betreffend Beschäftigung von Menschen mit Behinderung im BMEIA im 1. Quartal 2024 (18413/J)
Alois Kainz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung betreffend Beschäftigung von Menschen mit Behinderung im BMBWF im 1. Quartal 2024 (18414/J)
Alois Kainz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Landesverteidigung betreffend Beschäftigung von Menschen mit Behinderung im BMLV im 1. Quartal 2024 (18415/J)
Alois Kainz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien betreffend Beschäftigung von Menschen mit Behinderung im BMFFIM im 1. Quartal 2024 (18416/J)
Alois Kainz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Beschäftigung von Menschen mit Behinderung im BMI im 1. Quartal 2024 (18417/J)
Alois Kainz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend Beschäftigung von Menschen mit Behinderung im BMJ im 1. Quartal 2024 (18418/J)
Alois Kainz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend Beschäftigung von Menschen mit Behinderung im BMF im 1. Quartal 2024 (18419/J)
Alois Kainz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft betreffend Beschäftigung von Menschen mit Behinderung im BML im 1. Quartal 2024 (18420/J)
Alois Kainz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundeskanzler betreffend Beschäftigung von Menschen mit Behinderung im BKA 1. Quartal 2024 (18421/J)
Alois Kainz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport betreffend Beschäftigung von Menschen mit Behinderung im BMKÖS im 1. Quartal 2024 (18422/J)
Alois Kainz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie betreffend Beschäftigung von Menschen mit Behinderung im BMK im 1. Quartal 2024 (18423/J)
Alois Kainz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für EU und Verfassung betreffend Beschäftigung von Menschen mit Behinderung im BMEUV im 1. Quartal 2024 (18424/J)
Mag. Hannes Amesbauer, BA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Familiennachzug von Asylanten in der Steiermark (18425/J)
Mag. Hannes Amesbauer, BA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend Rückforderung von AMS-Bezügen in der Steiermark 2021 bis 2023 (18426/J)
Mag. Hannes Amesbauer, BA, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie betreffend Aktueller Stand beim Semmering-Basistunnel (18427/J)
Fiona Fiedler, BEd, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend Startbonus für Kassenarztstellen (18428/J)
Dr. Johannes Margreiter, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie betreffend ASFINAG-Attacke auf einen Bürgermeister (18429/J)
Christian Hafenecker, MA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Willkürlich verweigerte Medienakkreditierung im BMI (18430/J)
Julia Elisabeth Herr, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie betreffend Klima-relevante Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich (18431/J)
Julia Elisabeth Herr, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für EU und Verfassung betreffend Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich (18432/J)
Sabine Schatz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Waffenbesitz österreichischer Rechtsextremisten und Mitglieder staatsfeindlicher Verbindungen (18433/J)
Mag. Selma Yildirim, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Vorwurf massiver Belästigungen in Tiroler Polizei – statistische Daten (18434/J)
Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend Haben Sie sich von den Deutschen beim AUA-Lufthansa-Deal über den Tisch ziehen lassen, Herr Brunner? (18435/J)
Christian Hafenecker, MA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Versuchter Brandanschlag auf die ehemalige Unzensuriert-Redaktion (18436/J)
Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend Wie sicher ist das
Einlagensicherungssystem des österreichischen Bankensektors tatsächlich? (18437/J)
Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend Wie sicher ist das Einlagensicherungssystem des österreichischen Bankensektors tatsächlich? (18438/J)
Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend 50 Prozent der Mittel aus nationalen Einlagensicherungstöpfen sollen in europäischen Topf (18439/J)
Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend 50 Prozent der Mittel aus nationalen Einlagensicherungstöpfen sollen in europäischen Topf (18440/J)
Mag. (FH) Kurt Egger, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend Unterbringung von Personen mit forensischem Hintergrund in Pflegeheimen (18441/J)
David Stögmüller, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Beschaffungen im DSN und die damit verbundenen Firmen: „msg-Plaut GmbH“, „RISE GmbH“ und „EMV-Tectum GmbH“ (18442/J)
Mag. Martina Künsberg Sarre, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung betreffend Neubau von Bundesschulen - Umsetzungsstand SCHEP 2020 (18443/J)
Ing. Mag. Volker Reifenberger, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Landesverteidigung betreffend Parteipolitische Vereinnahmung des Bundesheeres durch die ÖVP Niederösterreich (18444/J)
Petra Bayr, MA MLS, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend „Internationale Praktiken rund um das Thema Leihmutterschaft“ (18445/J)
Petra Bayr, MA MLS, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten betreffend „Internationale Praktiken rund um das Thema Leihmutterschaft“ (18446/J)
Christian Hafenecker, MA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend Gefährden datensammelnde Behördenfahrzeuge bald die nationale Sicherheit? (18447/J)
Dr. Stephanie Krisper, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend Postenschacher im OeNB-Direktorium (18448/J)
Mag. Eva Blimlinger, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Landesverteidigung betreffend Oberster EU-General Robert Brieger als Facebook-Freund von Holocaustleugnern? (18449/J)
Mag. Eva Blimlinger, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Vorwürfe rund um die Einsatzgruppe gegen Straßenkriminalität Wien (18450/J)
Fiona Fiedler, BEd, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend Gesundheitshotline 1450 - Entlastungspotenzial für das Gesundheitssystem (18451/J)
Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend Arbeiterkammer Vorarlberg leistet sich eigene Vizedirektorin in Brüssel (18452/J)
Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend Wie positioniert sich Österreich zum Digitalen Euro? (18453/J)
Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend Mehr Wettbewerb: Was wurde aus der angekündigten Reform? (18454/J)
Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend KFA Graz führt Beiträge an die Mitarbeiter-Vorsorgekasse falsch ab (18455/J)
Mag. Dr. Petra Oberrauner, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend „Scheinselbständigkeit bekämpfen, Arbeitnehmer*innenrechte stärken, EU-Plattformrichtlinie schnell und konsequent umsetzen!“ (18456/J)
Dr. Stephanie Krisper, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend Wie Österreich zur Geldwäsche einlädt (18457/J)
Dr. Stephanie Krisper, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend Wie Österreich zur Geldwäsche einlädt (18458/J)
Dr. Stephanie Krisper, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Überprüfung der Umsetzung der Grundversorgungsvereinbarung durch die Bundesländer (18459/J)
Julia Elisabeth Herr, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend Folgeanfrage Exportkredite für den fossilen Energiesektor (18460/J)
Dr. Stephanie Krisper, Kolleginnen und Kollegen an den Bundeskanzler betreffend Illegales Online-Glücksspiel: EU-Rechtsbruch durch Malta und Versagen der Bundesregierung (18461/J)
Dr. Stephanie Krisper, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend Illegales Online-Glücksspiel: EU-Rechtsbruch durch Malta und Versagen der Bundesregierung (18462/J)
Dr. Stephanie Krisper, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend Illegales Online-Glücksspiel: EU-Rechtsbruch durch Malta und Versagen der Bundesregierung (18463/J)
Christian Hafenecker, MA, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Landesverteidigung betreffend Unfall mit US-Militärlastern in Salzburg (18464/J)
Christian Hafenecker, MA, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Landesverteidigung betreffend Österreichischer Pinzgauer beim russischen „Tag des Sieges“? (18465/J)
Christian Hafenecker, MA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Ist die AG Fama bei der Ermittlung zum Pilnacek-Ableben involviert? (18466/J)
Christian Hafenecker, MA, Kolleginnen und Kollegen an den Bundeskanzler betreffend Förderung des Buches „Kickl und die Zerstörung Europas“ durch den Zukunftsfonds der Republik Österreich (18467/J)
Dr. Susanne Fürst, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend Bundesstelle für Sektenfragen als säkulare Inquisitionsbehörde (18468/J)
Dr. Susanne Fürst, Kolleginnen und Kollegen an den Bundeskanzler betreffend Bundesstelle für Sektenfragen als säkulare Inquisitionsbehörde (18469/J)
Dr. Susanne Fürst, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien betreffend Bundesstelle für Sektenfragen als säkulare Inquisitionsbehörde (18470/J)
Dr. Susanne Fürst, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für EU und Verfassung betreffend Bundesstelle für Sektenfragen als säkulare Inquisitionsbehörde (18471/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an die Präsidentin des Rechnungshofes betreffend Kontrolle der rechtsmäßigen Verwendung der Bundesjugendförderung (18472/J)
Julia Elisabeth Herr, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten betreffend geheime NATO-Annäherung der österreichischen Bundesregierung (18473/J)
Mag. Martina Künsberg Sarre, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend Ausbildungspflicht und NEETs (18474/J)
MMag. Katharina Werner, Bakk., Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend Maßnahmen gegen Qualzucht (18475/J)
Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Landesverteidigung betreffend Übernahmen von Kabinettsmitarbeit in öffentliche Verwaltung (2023-2024) (18476/J)
Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft betreffend Übernahmen von Kabinettsmitarbeit in öffentliche Verwaltung (2023-2024) (18477/J)
Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport betreffend Übernahmen von Kabinettsmitarbeit in öffentliche Verwaltung (2023-2024) (18478/J)
Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie betreffend Übernahmen von Kabinettsmitarbeit in öffentliche Verwaltung (2023-2024) (18479/J)
Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend Übernahmen von Kabinettsmitarbeit in öffentliche Verwaltung (2023-2024) (18480/J)
Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend Übernahmen von Kabinettsmitarbeit in öffentliche Verwaltung (2023-2024) (18481/J)
Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien betreffend Übernahmen von Kabinettsmitarbeit in öffentliche Verwaltung (2023-2024) (18482/J)
Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend Übernahmen von Kabinettsmitarbeit in öffentliche Verwaltung (2023-2024) (18483/J)
Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für EU und Verfassung betreffend Übernahmen von Kabinettsmitarbeit in öffentliche Verwaltung (2023-2024) (18484/J)
Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten betreffend Übernahmen von Kabinettsmitarbeit in öffentliche Verwaltung (2023-2024) (18485/J)
Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung betreffend Übernahmen von Kabinettsmitarbeit in öffentliche Verwaltung (2023-2024) (18486/J)
Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft betreffend Übernahmen von Kabinettsmitarbeit in öffentliche Verwaltung (2023-2024) (18487/J)
Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen an den Bundeskanzler betreffend Übernahmen von Kabinettsmitarbeit in öffentliche Verwaltung (2023-2024) (18488/J)
Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend Übernahmen von Kabinettsmitarbeit in öffentliche Verwaltung (2023-2024) (18489/J)
Dr. Stephanie Krisper, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Finanzen betreffend Strabag/Deripaska-Deal der RBI (18490/J)
Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundeskanzler betreffend Versickert Bundesjugendförderung im politischen Vorfeld von ÖVP und Grünen? (18491/J)
Petra Bayr, MA MLS, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten betreffend „Mittelallokation im Rahmen der Global Gateway Strategy“ (18492/J)
*****
Michael Seemayer, Kolleginnen und Kollegen an den Präsidenten des Nationalrates betreffend Lehrstellen im Österreichischen Parlament (94/JPR)
Anfragebeantwortungen
des Bundesministers für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Yannick Shetty, Kolleginnen und Kollegen (17294/AB zu 17866/J)
des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abgeordneten Mario Lindner, Kolleginnen und Kollegen (17295/AB zu 17865/J)
der Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien im Bundeskanzleramt auf die Anfrage der Abgeordneten Mario Lindner, Kolleginnen und Kollegen (17296/AB zu 17864/J)
des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Christian Oxonitsch, Kolleginnen und Kollegen (17297/AB zu 17862/J)
des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Maximilian Lercher, Kolleginnen und Kollegen (17298/AB zu 17863/J)
des Bundesministers für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Alois Stöger, diplômé, Kolleginnen und Kollegen (17299/AB zu 17869/J)
des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Stephanie Krisper, Kolleginnen und Kollegen (17300/AB zu 17867/J)
des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Martina Künsberg Sarre, Kolleginnen und Kollegen (17301/AB zu 17868/J)
des Bundesministers für Arbeit und Wirtschaft auf die Anfrage der Abgeordneten Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer, Kolleginnen und Kollegen (17302/AB zu 17870/J)
des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer, Kolleginnen und Kollegen (17303/AB zu 17873/J)
des Bundesministers für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer, Kolleginnen und Kollegen (17304/AB zu 17874/J)
der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Yannick Shetty, Kolleginnen und Kollegen (17305/AB zu 17876/J)
der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer, Kolleginnen und Kollegen (17306/AB zu 17875/J)
des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer, Kolleginnen und Kollegen (17307/AB zu 17872/J)
des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft auf die Anfrage der Abgeordneten Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer, Kolleginnen und Kollegen (17308/AB zu 17871/J)
des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Stephanie Krisper, Kolleginnen und Kollegen (17309/AB zu 18079/J)
des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf die Anfrage der Abgeordneten Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen (17310/AB zu 17936/J)
des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf die Anfrage der Abgeordneten Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen (17311/AB zu 18046/J)
des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf die Anfrage der Abgeordneten Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen (17312/AB zu 18039/J)
des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf die Anfrage der Abgeordneten Rudolf Silvan, Kolleginnen und Kollegen (17313/AB zu 17909/J)
des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf die Anfrage der Abgeordneten Petra Wimmer, Kolleginnen und Kollegen (17314/AB zu 17934/J)
des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf die Anfrage der Abgeordneten Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen (17315/AB zu 18048/J)
des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf die Anfrage der Abgeordneten Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen (17316/AB zu 18047/J)
des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen (17317/AB zu 17926/J)
des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf die Anfrage der Abgeordneten Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen (17318/AB zu 18025/J)
des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf die Anfrage der Abgeordneten Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen (17319/AB zu 18026/J)
des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf die Anfrage der Abgeordneten Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen (17320/AB zu 17938/J)
des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf die Anfrage der Abgeordneten Mario Lindner, Kolleginnen und Kollegen (17321/AB zu 17912/J)
des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf die Anfrage der Abgeordneten Werner Herbert, Kolleginnen und Kollegen (17322/AB zu 17991/J)
des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Gerald Hauser, Kolleginnen und Kollegen (17323/AB zu 18018/J)
des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf die Anfrage der Abgeordneten Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen (17324/AB zu 18042/J)
der Bundesministerin für Landesverteidigung auf die Anfrage der Abgeordneten Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen (17325/AB zu 17948/J)
der Bundesministerin für Landesverteidigung auf die Anfrage der Abgeordneten Thomas Spalt, Kolleginnen und Kollegen (17326/AB zu 17963/J)
der Bundesministerin für Landesverteidigung auf die Anfrage der Abgeordneten Ing. Mag. Volker Reifenberger, Kolleginnen und Kollegen (17327/AB zu 18012/J)
der Bundesministerin für Landesverteidigung auf die Anfrage der Abgeordneten Douglas Hoyos-Trauttmansdorff, Kolleginnen und Kollegen (17328/AB zu 18030/J)
der Bundesministerin für Landesverteidigung auf die Anfrage der Abgeordneten Thomas Spalt, Kolleginnen und Kollegen (17329/AB zu 18034/J)
des Bundesministers für Arbeit und Wirtschaft auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Elisabeth Götze, Kolleginnen und Kollegen (17330/AB zu 17905/J)
des Bundesministers für Arbeit und Wirtschaft auf die Anfrage der Abgeordneten Petra Bayr, MA MLS, Kolleginnen und Kollegen (17331/AB zu 17911/J)
des Bundesministers für Arbeit und Wirtschaft auf die Anfrage der Abgeordneten Douglas Hoyos-Trauttmansdorff, Kolleginnen und Kollegen (17332/AB zu 17915/J)
des Bundesministers für Arbeit und Wirtschaft auf die Anfrage der Abgeordneten Henrike Brandstötter, Kolleginnen und Kollegen (17333/AB zu 17929/J)
des Bundesministers für Arbeit und Wirtschaft auf die Anfrage der Abgeordneten Katharina Kucharowits, Kolleginnen und Kollegen (17334/AB zu 17933/J)
des Bundesministers für Arbeit und Wirtschaft auf die Anfrage der Abgeordneten Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen (17335/AB zu 17947/J)
des Bundesministers für Arbeit und Wirtschaft auf die Anfrage der Abgeordneten Thomas Spalt, Kolleginnen und Kollegen (17336/AB zu 17956/J)
des Bundesministers für Arbeit und Wirtschaft auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Philipp Schrangl, Kolleginnen und Kollegen (17337/AB zu 17965/J)
des Bundesministers für Arbeit und Wirtschaft auf die Anfrage der Abgeordneten Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen (17338/AB zu 17968/J)
des Bundesministers für Arbeit und Wirtschaft auf die Anfrage der Abgeordneten Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen (17339/AB zu 18002/J)
des Bundesministers für Arbeit und Wirtschaft auf die Anfrage der Abgeordneten Christian Ries, Kolleginnen und Kollegen (17340/AB zu 18007/J)
des Bundesministers für Arbeit und Wirtschaft auf die Anfrage der Abgeordneten Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen (17341/AB zu 18043/J)
des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Dr. Martin Graf, Kolleginnen und Kollegen (17342/AB zu 17969/J)
des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen (17343/AB zu 17937/J)
der Bundesministerin für Landesverteidigung auf die Anfrage der Abgeordneten Werner Herbert, Kolleginnen und Kollegen (17344/AB zu 17981/J)
des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten Werner Herbert, Kolleginnen und Kollegen (17345/AB zu 17985/J)
des Bundesministers für Arbeit und Wirtschaft auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Dagmar Belakowitsch, Kolleginnen und Kollegen (17346/AB zu 17935/J)
des Bundesministers für Arbeit und Wirtschaft auf die Anfrage der Abgeordneten Werner Herbert, Kolleginnen und Kollegen (17347/AB zu 17988/J)
des Bundesministers für Arbeit und Wirtschaft auf die Anfrage der Abgeordneten Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen (17348/AB zu 18015/J)
des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf die Anfrage der Abgeordneten Fiona Fiedler, BEd, Kolleginnen und Kollegen (17349/AB zu 17906/J)
des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf die Anfrage der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen (17350/AB zu 17885/J)
des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf die Anfrage der Abgeordneten Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen (17351/AB zu 18022/J)
des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf die Anfrage der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen (17352/AB zu 17899/J)
des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf die Anfrage der Abgeordneten Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen (17353/AB zu 17999/J)
des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten Thomas Spalt, Kolleginnen und Kollegen (17354/AB zu 17951/J)
des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf die Anfrage der Abgeordneten Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen (17355/AB zu 18031/J)
des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf die Anfrage der Abgeordneten Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen (17356/AB zu 18036/J)
des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten Fiona Fiedler, BEd, Kolleginnen und Kollegen (17357/AB zu 17907/J)
des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Hannes Amesbauer, BA, Kolleginnen und Kollegen (17358/AB zu 18014/J)
des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf die Anfrage der Abgeordneten Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen (17359/AB zu 18037/J)
des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf die Anfrage der Abgeordneten Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen (17360/AB zu 18041/J)
des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten Henrike Brandstötter, Kolleginnen und Kollegen (17361/AB zu 17928/J)
des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen (17362/AB zu 17893/J)
des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten Rudolf Silvan, Kolleginnen und Kollegen (17363/AB zu 17908/J)
des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten Douglas Hoyos-Trauttmansdorff, Kolleginnen und Kollegen (17364/AB zu 17923/J)
der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Werner Herbert, Kolleginnen und Kollegen (17365/AB zu 17986/J)
der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Selma Yildirim, Kolleginnen und Kollegen (17366/AB zu 17995/J)
der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Thomas Spalt, Kolleginnen und Kollegen (17367/AB zu 17959/J)
des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft auf die Anfrage der Abgeordneten Douglas Hoyos-Trauttmansdorff, Kolleginnen und Kollegen (17368/AB zu 17924/J)
der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Christian Hafenecker, MA, Kolleginnen und Kollegen (17369/AB zu 17998/J)
der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Harald Stefan, Kolleginnen und Kollegen (17370/AB zu 18020/J)
der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen (17371/AB zu 18001/J)
der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Christian Ries, Kolleginnen und Kollegen (17372/AB zu 18006/J)
des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft auf die Anfrage der Abgeordneten Henrike Brandstötter, Kolleginnen und Kollegen (17373/AB zu 17930/J)
des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft auf die Anfrage der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen (17374/AB zu 17898/J)
der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Harald Stefan, Kolleginnen und Kollegen (17375/AB zu 18021/J)
des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft auf die Anfrage der Abgeordneten Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen (17376/AB zu 17949/J)
der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Douglas Hoyos-Trauttmansdorff, Kolleginnen und Kollegen (17377/AB zu 18027/J)
des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft auf die Anfrage der Abgeordneten Thomas Spalt, Kolleginnen und Kollegen (17378/AB zu 17961/J)
der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen (17379/AB zu 17943/J)
der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Christian Lausch, Kolleginnen und Kollegen (17380/AB zu 18016/J)
des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft auf die Anfrage der Abgeordneten Peter Schmiedlechner, Kolleginnen und Kollegen (17381/AB zu 17967/J)
des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft auf die Anfrage der Abgeordneten Werner Herbert, Kolleginnen und Kollegen (17382/AB zu 17987/J)
des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft auf die Anfrage der Abgeordneten Peter Schmiedlechner, Kolleginnen und Kollegen (17383/AB zu 18044/J)
des Bundesministers für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Douglas Hoyos-Trauttmansdorff, Kolleginnen und Kollegen (17384/AB zu 17925/J)
des Bundesministers für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen (17385/AB zu 17941/J)
des Bundesministers für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Thomas Spalt, Kolleginnen und Kollegen (17386/AB zu 17958/J)
des Bundesministers für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Werner Herbert, Kolleginnen und Kollegen (17387/AB zu 17992/J)
des Bundesministers für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Thomas Spalt, Kolleginnen und Kollegen (17388/AB zu 18033/J)
der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Christian Lausch, Kolleginnen und Kollegen (17389/AB zu 18004/J)
der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Harald Stefan, Kolleginnen und Kollegen (17390/AB zu 18028/J)
des Bundesministers für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen (17391/AB zu 18038/J)
des Bundesministers für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Alois Kainz, Kolleginnen und Kollegen (17392/AB zu 18040/J)
des Bundesministers für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen (17393/AB zu 18003/J)
des Bundesministers für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen (17394/AB zu 18050/J)
des Bundesministers für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Christian Hafenecker, MA, Kolleginnen und Kollegen (17395/AB zu 18051/J)
der Bundesministerin für Landesverteidigung auf die Anfrage der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen (17396/AB zu 17904/J)
der Bundesministerin für Landesverteidigung auf die Anfrage der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen (17397/AB zu 17890/J)
des Bundesministers für Arbeit und Wirtschaft auf die Anfrage der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen (17398/AB zu 17878/J)
des Bundesministers für Arbeit und Wirtschaft auf die Anfrage der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen (17399/AB zu 17892/J)
der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen (17400/AB zu 17888/J)
des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen (17401/AB zu 17879/J)
des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft auf die Anfrage der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen (17402/AB zu 17884/J)
des Bundesministers für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen (17403/AB zu 17881/J)
des Bundesministers für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen (17404/AB zu 17895/J)
des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten auf die Anfrage der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen (17405/AB zu 17880/J)
des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten auf die Anfrage der Abgeordneten Douglas Hoyos-Trauttmansdorff, Kolleginnen und Kollegen (17406/AB zu 17916/J)
des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten auf die Anfrage der Abgeordneten Henrike Brandstötter, Kolleginnen und Kollegen (17407/AB zu 17932/J)
des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten auf die Anfrage der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen (17408/AB zu 17894/J)
des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf die Anfrage der Abgeordneten Douglas Hoyos-Trauttmansdorff, Kolleginnen und Kollegen (17409/AB zu 17919/J)
des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten auf die Anfrage der Abgeordneten Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen (17410/AB zu 17946/J)
des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf die Anfrage der Abgeordneten Thomas Spalt, Kolleginnen und Kollegen (17411/AB zu 17964/J)
des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten auf die Anfrage der Abgeordneten Thomas Spalt, Kolleginnen und Kollegen (17412/AB zu 17955/J)
des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten auf die Anfrage der Abgeordneten Werner Herbert, Kolleginnen und Kollegen (17413/AB zu 17983/J)
des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten auf die Anfrage der Abgeordneten Christian Hafenecker, MA, Kolleginnen und Kollegen (17414/AB zu 17996/J)
der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen (17415/AB zu 17889/J)
der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen (17416/AB zu 17903/J)
des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abgeordneten Katharina Kucharowits, Kolleginnen und Kollegen (17417/AB zu 17913/J)
der Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien im Bundeskanzleramt auf die Anfrage der Abgeordneten Katharina Kucharowits, Kolleginnen und Kollegen (17418/AB zu 17914/J)
der Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien im Bundeskanzleramt auf die Anfrage der Abgeordneten Douglas Hoyos-Trauttmansdorff, Kolleginnen und Kollegen (17419/AB zu 17918/J)
des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abgeordneten Douglas Hoyos-Trauttmansdorff, Kolleginnen und Kollegen (17420/AB zu 17920/J)
der Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien im Bundeskanzleramt auf die Anfrage der Abgeordneten Henrike Brandstötter, Kolleginnen und Kollegen (17421/AB zu 17927/J)
des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abgeordneten Henrike Brandstötter, Kolleginnen und Kollegen (17422/AB zu 17931/J)
des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abgeordneten Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen (17423/AB zu 17939/J)
der Bundesministerin für EU und Verfassung im Bundeskanzleramt auf die Anfrage der Abgeordneten Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen (17424/AB zu 17940/J)
der Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien im Bundeskanzleramt auf die Anfrage der Abgeordneten Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen (17425/AB zu 17944/J)
der Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien im Bundeskanzleramt auf die Anfrage der Abgeordneten Thomas Spalt, Kolleginnen und Kollegen (17426/AB zu 17954/J)
des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abgeordneten Thomas Spalt, Kolleginnen und Kollegen (17427/AB zu 17957/J)
der Bundesministerin für EU und Verfassung im Bundeskanzleramt auf die Anfrage der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen (17428/AB zu 17886/J)
der Bundesministerin für EU und Verfassung im Bundeskanzleramt auf die Anfrage der Abgeordneten Thomas Spalt, Kolleginnen und Kollegen (17429/AB zu 17962/J)
des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen (17430/AB zu 17877/J)
der Bundesministerin für EU und Verfassung im Bundeskanzleramt auf die Anfrage der Abgeordneten Christian Hafenecker, MA, Kolleginnen und Kollegen (17431/AB zu 17997/J)
der Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien im Bundeskanzleramt auf die Anfrage der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen (17432/AB zu 17887/J)
der Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien im Bundeskanzleramt auf die Anfrage der Abgeordneten Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen (17433/AB zu 18005/J)
der Bundesministerin für EU und Verfassung im Bundeskanzleramt auf die Anfrage der Abgeordneten Peter Schmiedlechner, Kolleginnen und Kollegen (17434/AB zu 18045/J)
der Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien im Bundeskanzleramt auf die Anfrage der Abgeordneten Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen (17435/AB zu 18049/J)
des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen (17436/AB zu 17891/J)
der Bundesministerin für EU und Verfassung im Bundeskanzleramt auf die Anfrage der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen (17437/AB zu 17900/J)
der Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien im Bundeskanzleramt auf die Anfrage der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen (17438/AB zu 17901/J)
des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abgeordneten Werner Herbert, Kolleginnen und Kollegen (17439/AB zu 17990/J)
der Bundesministerin für EU und Verfassung im Bundeskanzleramt auf die Anfrage der Abgeordneten Werner Herbert, Kolleginnen und Kollegen (17440/AB zu 17982/J)
der Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien im Bundeskanzleramt auf die Anfrage der Abgeordneten Werner Herbert, Kolleginnen und Kollegen (17441/AB zu 17984/J)
des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Douglas Hoyos-Trauttmansdorff, Kolleginnen und Kollegen (17442/AB zu 17921/J)
des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen (17443/AB zu 17945/J)
des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen (17444/AB zu 17896/J)
des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen (17445/AB zu 17882/J)
des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Thomas Spalt, Kolleginnen und Kollegen (17446/AB zu 17953/J)
des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Hannes Amesbauer, BA, Kolleginnen und Kollegen (17447/AB zu 17993/J)
des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen (17448/AB zu 18000/J)
des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Petra Steger, Kolleginnen und Kollegen (17449/AB zu 18009/J)
des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Werner Herbert, Kolleginnen und Kollegen (17450/AB zu 18011/J)
des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Hannes Amesbauer, BA, Kolleginnen und Kollegen (17451/AB zu 18013/J)
des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen (17452/AB zu 18023/J)
des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen (17453/AB zu 18017/J)
des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen (17454/AB zu 18024/J)
des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Hannes Amesbauer, BA, Kolleginnen und Kollegen (17455/AB zu 18035/J)
des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Christian Ries, Kolleginnen und Kollegen (17456/AB zu 18054/J)
des Bundesministers für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Selma Yildirim, Kolleginnen und Kollegen (17457/AB zu 17994/J)
des Bundesministers für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport auf die Anfrage der Abgeordneten Joachim Schnabel, Kolleginnen und Kollegen (17458/AB zu 17910/J)
des Bundesministers für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport auf die Anfrage der Abgeordneten Thomas Spalt, Kolleginnen und Kollegen (17459/AB zu 17952/J)
des Bundesministers für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport auf die Anfrage der Abgeordneten Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen (17460/AB zu 17942/J)
des Bundesministers für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport auf die Anfrage der Abgeordneten Douglas Hoyos-Trauttmansdorff, Kolleginnen und Kollegen (17461/AB zu 17922/J)
der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Abgeordneten Douglas Hoyos-Trauttmansdorff, Kolleginnen und Kollegen (17462/AB zu 17917/J)
der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Abgeordneten Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen (17463/AB zu 17950/J)
der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Abgeordneten Thomas Spalt, Kolleginnen und Kollegen (17464/AB zu 17960/J)
der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Abgeordneten Peter Schmiedlechner, Kolleginnen und Kollegen (17465/AB zu 17966/J)
der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Abgeordneten Alois Kainz, Kolleginnen und Kollegen (17466/AB zu 18008/J)
der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Abgeordneten Alois Kainz, Kolleginnen und Kollegen (17467/AB zu 18010/J)
der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Abgeordneten Walter Rauch, Kolleginnen und Kollegen (17468/AB zu 18029/J)
der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Abgeordneten Walter Rauch, Kolleginnen und Kollegen (17469/AB zu 18032/J)
der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Abgeordneten Christian Hafenecker, MA, Kolleginnen und Kollegen (17470/AB zu 18052/J)
der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Abgeordneten Christian Hafenecker, MA, Kolleginnen und Kollegen (17471/AB zu 18053/J)
des Bundesministers für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Nikolaus Scherak, MA, Kolleginnen und Kollegen (17472/AB zu 18063/J)
des Bundesministers für Arbeit und Wirtschaft auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Nikolaus Scherak, MA, Kolleginnen und Kollegen (17473/AB zu 18065/J)
der Bundesministerin für Landesverteidigung auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Nikolaus Scherak, MA, Kolleginnen und Kollegen (17474/AB zu 18059/J)
des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen (17475/AB zu 18078/J)
der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Abgeordneten Walter Rauch, Kolleginnen und Kollegen (17476/AB zu 18019/J)
der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Abgeordneten Werner Herbert, Kolleginnen und Kollegen (17477/AB zu 17980/J)
des Bundesministers für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport auf die Anfrage der Abgeordneten Werner Herbert, Kolleginnen und Kollegen (17478/AB zu 17989/J)
des Bundesministers für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport auf die Anfrage der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen (17479/AB zu 17883/J)
des Bundesministers für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport auf die Anfrage der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen (17480/AB zu 17897/J)
des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Hannes Amesbauer, BA, Kolleginnen und Kollegen (17481/AB zu 18073/J)
des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Hannes Amesbauer, BA, Kolleginnen und Kollegen (17482/AB zu 17970/J)
des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Hannes Amesbauer, BA, Kolleginnen und Kollegen (17483/AB zu 18072/J)
des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Nikolaus Scherak, MA, Kolleginnen und Kollegen (17484/AB zu 18064/J)
des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Nikolaus Scherak, MA, Kolleginnen und Kollegen (17485/AB zu 18058/J)
der Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien im Bundeskanzleramt auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Nikolaus Scherak, MA, Kolleginnen und Kollegen (17486/AB zu 18055/J)
der Bundesministerin für EU und Verfassung im Bundeskanzleramt auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Nikolaus Scherak, MA, Kolleginnen und Kollegen (17487/AB zu 18056/J)
des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Nikolaus Scherak, MA, Kolleginnen und Kollegen (17488/AB zu 18067/J)
des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Nikolaus Scherak, MA, Kolleginnen und Kollegen (17489/AB zu 18057/J)
der Bundesministerin für EU und Verfassung im Bundeskanzleramt auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Gerald Hauser, Kolleginnen und Kollegen (17490/AB zu 18077/J)
der Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien im Bundeskanzleramt auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Gerald Hauser, Kolleginnen und Kollegen (17491/AB zu 18076/J)
des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Nikolaus Scherak, MA, Kolleginnen und Kollegen (17492/AB zu 18062/J)
des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Hannes Amesbauer, BA, Kolleginnen und Kollegen (17493/AB zu 18074/J)
der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Nikolaus Scherak, MA, Kolleginnen und Kollegen (17494/AB zu 18061/J)
der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Gerald Hauser, Kolleginnen und Kollegen (17495/AB zu 18071/J)
der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Hannes Amesbauer, BA, Kolleginnen und Kollegen (17496/AB zu 18075/J)
der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Johannes Margreiter, Kolleginnen und Kollegen (17497/AB zu 18069/J)
des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Nikolaus Scherak, MA, Kolleginnen und Kollegen (17498/AB zu 18066/J)
des Bundesministers für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Nikolaus Scherak, MA, Kolleginnen und Kollegen (17499/AB zu 18068/J)
der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Nikolaus Scherak, MA, Kolleginnen und Kollegen (17500/AB zu 18060/J)
der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Abgeordneten Michael Bernhard, Kolleginnen und Kollegen (17501/AB zu 18070/J)
des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf die Anfrage der Abgeordneten Fiona Fiedler, BEd, Kolleginnen und Kollegen (17502/AB zu 18083/J)
der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen (17503/AB zu 17902/J)
des Bundesministers für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Hannes Amesbauer, BA, Kolleginnen und Kollegen (17504/AB zu 18082/J)
des Bundesministers für Arbeit und Wirtschaft auf die Anfrage der Abgeordneten Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen (17505/AB zu 18084/J)
der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Hannes Amesbauer, BA, Kolleginnen und Kollegen (17506/AB zu 18080/J)
des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Hannes Amesbauer, BA, Kolleginnen und Kollegen (17507/AB zu 18081/J)
des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf die Anfrage der Abgeordneten Rudolf Silvan, Kolleginnen und Kollegen (17508/AB zu 18090/J)
des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf die Anfrage der Abgeordneten Philip Kucher, Kolleginnen und Kollegen (17509/AB zu 18085/J)
des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf die Anfrage der Abgeordneten Philip Kucher, Kolleginnen und Kollegen (17510/AB zu 18087/J)
des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf die Anfrage der Abgeordneten Philip Kucher, Kolleginnen und Kollegen (17511/AB zu 18088/J)
des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Christian Oxonitsch, Kolleginnen und Kollegen (17512/AB zu 18089/J)
der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Philip Kucher, Kolleginnen und Kollegen (17513/AB zu 18086/J)
des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen (17514/AB zu 18091/J)
des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Johannes Margreiter, Kolleginnen und Kollegen (17515/AB zu 18098/J)
des Bundesministers für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Stephanie Krisper, Kolleginnen und Kollegen (17516/AB zu 18094/J)
des Bundesministers für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten MMag. Michaela Schmidt, Kolleginnen und Kollegen (17517/AB zu 18101/J)
des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abgeordneten Henrike Brandstötter, Kolleginnen und Kollegen (17518/AB zu 18100/J)
des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten Fiona Fiedler, BEd, Kolleginnen und Kollegen (17519/AB zu 18093/J)
der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Stephanie Krisper, Kolleginnen und Kollegen (17520/AB zu 18095/J)
des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Stephanie Krisper, Kolleginnen und Kollegen (17521/AB zu 18097/J)
des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Stephanie Krisper, Kolleginnen und Kollegen (17522/AB zu 18092/J)
des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Stephanie Krisper, Kolleginnen und Kollegen (17523/AB zu 18096/J)
der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Johannes Margreiter, Kolleginnen und Kollegen (17524/AB zu 18099/J)
des Bundesministers für Arbeit und Wirtschaft auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen (17525/AB zu 18102/J)
der Bundesministerin für Landesverteidigung auf die Anfrage der Abgeordneten Christian Hafenecker, MA, Kolleginnen und Kollegen (17526/AB zu 18116/J)
des Bundesministers für Arbeit und Wirtschaft auf die Anfrage der Abgeordneten Christian Hafenecker, MA, Kolleginnen und Kollegen (17527/AB zu 18107/J)
des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordneten Christian Hafenecker, MA, Kolleginnen und Kollegen (17528/AB zu 18112/J)
des Bundesministers für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Christian Hafenecker, MA, Kolleginnen und Kollegen (17529/AB zu 18114/J)
der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Christian Hafenecker, MA, Kolleginnen und Kollegen (17530/AB zu 18106/J)
des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abgeordneten Christian Hafenecker, MA, Kolleginnen und Kollegen (17531/AB zu 18104/J)
der Bundesministerin für EU und Verfassung im Bundeskanzleramt auf die Anfrage der Abgeordneten Christian Hafenecker, MA, Kolleginnen und Kollegen (17532/AB zu 18115/J)
der Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien im Bundeskanzleramt auf die Anfrage der Abgeordneten Christian Hafenecker, MA, Kolleginnen und Kollegen (17533/AB zu 18117/J)
des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft auf die Anfrage der Abgeordneten Christian Hafenecker, MA, Kolleginnen und Kollegen (17534/AB zu 18113/J)
des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten auf die Anfrage der Abgeordneten Christian Hafenecker, MA, Kolleginnen und Kollegen (17535/AB zu 18111/J)
der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Abgeordneten Christian Hafenecker, MA, Kolleginnen und Kollegen (17536/AB zu 18109/J)
des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Christian Hafenecker, MA, Kolleginnen und Kollegen (17537/AB zu 18105/J)
des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Stephanie Krisper, Kolleginnen und Kollegen (17538/AB zu 18103/J)
des Bundesministers für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport auf die Anfrage der Abgeordneten Christian Hafenecker, MA, Kolleginnen und Kollegen (17539/AB zu 18110/J)
des Bundesministers für Arbeit und Wirtschaft auf die Anfrage der Abgeordneten Philip Kucher, Kolleginnen und Kollegen (17540/AB zu 18126/J)
des Bundesministers für Arbeit und Wirtschaft auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen (17541/AB zu 18119/J)
des Bundesministers für Arbeit und Wirtschaft auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Dr. Petra Oberrauner, Kolleginnen und Kollegen (17542/AB zu 18121/J)
****
des Präsidenten des Nationalrates auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen (87/ABPR zu 88/JPR)
des Präsidenten des Nationalrates auf die Anfrage der Abgeordneten Christian Hafenecker, MA, Kolleginnen und Kollegen (88/ABPR zu 90/JPR)
des Präsidenten des Nationalrates auf die Anfrage der Abgeordneten Christian Oxonitsch, Kolleginnen und Kollegen (89/ABPR zu 87/JPR)
des Präsidenten des Nationalrates auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Hannes Amesbauer, BA, Kolleginnen und Kollegen (90/ABPR zu 89/JPR)
des Präsidenten des Nationalrates auf die Anfrage der Abgeordneten Hermann Brückl, MA, Kolleginnen und Kollegen (91/ABPR zu 91/JPR)
Beginn der Sitzung: 9.05 Uhr
Vorsitzende: Präsident Mag. Wolfgang Sobotka, Zweite Präsidentin Doris Bures, Dritter Präsident Ing. Norbert Hofer.
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete! Die Sitzung ist eröffnet. Ich darf Sie recht herzlich zu unserer 262. Sitzung begrüßen. Ich darf auch die Journalisten und unsere Zuseher:innen auf der Galerie und zu Hause vor den Fernsehbildschirmen begrüßen.
Trauerkundgebung anlässlich des Ablebens des ehemaligen Zweiten Präsidenten des Nationalrates und Bundesministers a. D. Robert Lichal
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Wir kommen, wie wir es in der Präsidiale vereinbart haben, zu einer Trauerkundgebung:
Gestern wurde am Purkersdorfer Friedhof der verstorbene Dr. Robert Lichal zu Grabe getragen. Robert Lichal war in der Zeit von 1976 bis 1994 in der Bundespolitik in den verschiedensten Positionen vertreten. Er war Personalvertreter, er war im Bundesrat, er war im Nationalrat und er war in der XVIII. Gesetzgebungsperiode auch Bundesminister für Landesverteidigung. In dieser Position hat er – Sie werden das vielleicht noch aus den Geschichten kennen – sein Profil – gerade, als es darum gegangen ist, die Draken zu stationieren –, das er vorher schon hatte, innenpolitisch noch nachgeschärft. Er war sicherlich ein Politiker, der hart und konsequent verhandelt hat, der aber auch humorvoll gewesen ist und immer wieder auch den Ausgleich gesucht hat.
Als Zweiter Präsident des Nationalrates – das ist mir nur berichtet worden – hat er stets auf die Würde des Hauses geachtet und einmal sogar einem Kollegen, der keine Krawatte hatte, eine Krawatte geschenkt. Wir haben auch im Shop
Krawatten, aber ich glaube, heute hat sich diese Situation grundsätzlich verändert.
Robert Lichal war sicherlich einer, dem die Politik und insbesondere das Parlament ein großes Anliegen gewesen ist, der die Diskussion nicht nur im innerparteilichen Kreise, sondern auch hier im Parlament stets gesucht hat.
Seinem eigentlichen Wunsch, nicht Jurist, sondern Schauspieler zu werden, konnte er nicht nachkommen. Er hat das in seiner launigen Abschiedsrede angemerkt, in der er gemeint hat, er wäre immer gern am Ring zu Hause gewesen, aber vielleicht doch noch lieber im Burgtheater. Er hat immer wieder auch „König Ottokars Glück und Ende“ zitiert, und zwar: „Es ist ein gutes Land [...] Wo habt Ihr dessengleichen schon gesehn?“ Das heißt, er war auch bis zuletzt stolz auf dieses Österreich.
In diesem Sinne darf ich Sie, Kolleginnen und Kollegen, um eine Minute des Gedenkens ersuchen. (Die Anwesenden erheben sich von ihren Sitzplätzen und verharren einige Zeit in stiller Trauer.) – Danke schön. (Die Anwesenden nehmen ihre Sitzplätze wieder ein.)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Die Amtlichen Protokolle der 259., der 260. und der 261. Sitzung vom 17. April sind in der Parlamentsdirektion aufgelegen und wurden nicht beanstandet.
Für die heutige Sitzung als verhindert gemeldet sind die Abgeordneten Karlheinz Kopf, Rainer Wimmer, Hermann Brückl, MA, Mag. Gerhard Kaniak, Lukas Hammer, Michel Reimon, MBA und David Stögmüller.
Vertretung von Mitgliedern der Bundesregierung
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Für den heutigen Sitzungstag hat das Bundeskanzleramt über die Vertretung von Mitgliedern der Bundesregierung folgende Mitteilung gemacht:
Finanzminister Dr. Magnus Brunner, LL.M. wird durch Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft Mag. Dr. Martin Kocher vertreten.
*****
Ich darf bekannt geben, dass ORF 2 die Sitzung wie üblich bis 13 Uhr überträgt, dann überträgt ORF III bis 19.30 Uhr, und anschließend wird die Sitzung in der TVthek kommentiert übertragen.
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Wir kommen zur Aktuellen Stunde mit dem Thema:
„Wieso zahlen in Österreich Milliardäre weniger Steuern als Menschen, die arbeiten gehen, Herr Bundeskanzler?“
Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Krainer. Er weiß, dass die vorgegebene Redezeit 10 Minuten beträgt. – Bitte sehr, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Kai Jan Krainer (SPÖ): Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben eine Aktuelle Stunde. Wir haben uns natürlich überlegt, welches Thema wir wählen, weil es viele Themen zu diskutieren gäbe.
Etwa das Versagen der Bundesregierung beim Kampf gegen die Teuerung: Seit mittlerweile 18 Monaten haben wir den traurigen Spitzenplatz in Westeuropa, was die Höhe der Inflation betrifft. Wir hätten über das Versagen der Bundesregierung, sich die Übergewinne der Energiekonzerne zu holen, reden können. Wir erinnern uns: Finanzminister Brunner hat – auf Druck der sozialdemokratischen Fraktion – angekündigt, sich da 2 bis 4 Milliarden Euro zu
holen. Was hat er geschafft? – Nicht einmal 10 Prozent; also auch da ein Versagen. Der sogenannte Mietendeckel der Regierung – von dem wir gesagt haben, dass das ein Schmähdeckel ist –: Seit gestern wissen wir alle, die sogenannten freien Mieten sind wieder um 11 Prozent gestiegen – auch da: ein Versagen der Bundesregierung.
Das Versagen der Bundesregierung wäre aber nichts Aktuelles, das ist ja ein Dauerbrenner in der österreichischen Innenpolitik, und deswegen haben wir gesagt: Die Aktuelle Stunde widmen wir den aktuellen Erkenntnissen aus dem Cofag-Untersuchungsausschuss, in dem es um die Frage gegangen ist: Werden Milliardäre in Österreich bevorzugt? – Und das Ergebnis ist: Ja, sie werden bevorzugt, und zwar auf vielerlei Art! (Abg. Zarits: Ist eh nichts herausgekommen!)
Wir haben im Untersuchungsausschuss die Steuerdaten und so weiter der Milliardäre eingesehen und deswegen wissen wir, dass ein Milliardär von 100 Euro, die er verdient, 20 bis 25 Euro – 20 bis 25 Euro! – an Steuern und Abgaben zahlt. Bei jedem, der arbeiten geht – also nicht bei einem Gutverdiener, sondern bei einem Arbeiter, der 1 800 Euro netto verdient – sind über 40 Prozent an Steuern und Abgaben auf diesem Gehalt drauf. Das heißt, jeder Arbeiter, der nicht einmal 2 000 Euro netto verdient, zahlt mehr als 40 Prozent Steuern und Abgaben auf sein Einkommen, aber Milliardäre, die in einem Jahr mehr verdienen als alle anderen – oder zumindest wahrscheinlich alle anderen, die hier sind – in ihrem ganzen Leben, zahlen die Hälfte. Und das sind nicht einmal die, die besonders dreist sind, sondern das ist der Schnitt. Die zahlen die Hälfte! Und die Frage ist: Wieso ist das so in diesem Land und was können wir dagegen tun? (Beifall bei der SPÖ.)
Es gibt drei wesentliche Erkenntnisse, die wir haben. Erstens: Es ist die strukturelle Bevorzugung. Es ist so, dass Milliardäre eine Heerschaar an Steuerberatern haben. Die Finanz hat sich von sich aus, weil die OECD gesagt hat: Österreich, ihr seid besonders schlecht darin, die Superreichen zu besteuern!, sich selber
kontrolliert und hat sich angesehen: Sind wir wirklich so schlecht, wie die OECD sagt? – Herausgekommen ist: Ja, wir sind wirklich so schlecht. Sie haben, sage ich einmal, sich selber kontrolliert, wie sie die 30 Reichsten, die Superreichen in Österreich kontrollieren und wie sie darauf schauen, dass diese ihre Steuern zahlen, und das Ergebnis war: neun Mal positiv, 21 Mal negativ oder nicht beurteilbar, weil sie sie gar nie geprüft hatten, weil sie überhaupt nie hingesehen hatten. Das heißt, quasi jede Matura müsste wiederholt werden, wenn zwei Drittel der Arbeiten negativ sind – und das ist das Ergebnis, das sich die Finanz selber gegeben hat.
Wir haben aber gute Finanzbeamte. Die haben gesagt, wir können es besser, wir brauchen organisatorische Änderungen, wir brauchen mehr Personal, wir müssen die Prüfungsdichte erhöhen, und haben Vorschläge an vier ÖVP-Finanzminister gerichtet, wie man das besser machen kann, dass Milliardäre besser besteuert werden und ihren gerechten Beitrag leisten. Und was haben die ÖVP-Finanzminister gemacht? (Abg. Fürlinger: ... gerechte Beitrag sind 500 bis 700 Millionen Euro ... Kollege, bevor du so viel Schas daherredst!) Sie haben diesen Bericht genommen und in den Safe gesperrt, damit er ja nicht bekannt wird, damit sich ja nichts ändert. Sie schützen die Privilegien der Milliardäre, dass diese möglichst keine Steuern zahlen, nämlich strukturell keine Steuern zahlen. Das muss sich ändern! (Beifall bei der SPÖ.)
Ich sage Ihnen, wenn Sie wollen, dass die ihren gerechten Beitrag zahlen (Abg. Jeitler-Cincelli: Wenn Sie wollen, dass die dableiben, dann sollten Sie es lassen!), wie jeder, der in diesem Land arbeiten geht, wenn Sie das wollen, dann führt kein Weg daran vorbei, dass wir Vermögensteuern einführen. Damit die endlich – nicht mehr zahlen als alle, aber zumindest gleich viel – gleich viel zahlen wie jeder Arbeiter in diesem Land, der mit 2 000 Euro netto nach Hause geht. Das muss doch das politische Ziel von allen hier herinnen sein. Ich verstehe nicht, wieso man sich schützend vor denen stellt (Abg. Steinacker: Vor die! Nicht einmal Deutsch kann er! – Zwischenruf des Abg. Zarits), denen es eh besonders gut im Leben geht, und nicht dafür sorgt, dass die einen fairen Beitrag zahlen. Wieso die
ÖVP das macht, werde ich nie verstehen (Abg. Steinacker: Lies heute mal den „Kurier“-Artikel, dann verstehst, was eine Vermögensteuer bewirkt!), denn ich weiß, dass es auch bei der ÖVP viele gibt, die der Meinung sind: Ja, jemand, dem es besonders gut geht, muss nicht besonders wenig Steuern zahlen, sondern soll einen fairen, einen gerechten Beitrag zahlen. (Beifall bei der SPÖ. – Abg. Steinacker: Unbelehrbar, der Mann, er versteht es nicht!)
Der zweite Bereich ist die individuelle Bevorzugung, bei der sich ÖVP-Kabinette, ÖVP-Minister, ÖVP-Generalsekretäre im Finanzministerium noch persönlich für die Herren Benko, Pierer – Pierer haben wir erwischt, der hat 8 Millionen Euro nachzahlen müssen, gut so (Abg. Steinacker: Wer ist „wir“?); gegen den Willen der ÖVP, die hat ihn noch immer geschützt – oder Wolf einsetzen. (Zwischenruf des Abg. Loacker. – Abg. Steinacker: Wie viele Arbeitsplätze sichert Pierer in Österreich? Wie wichtig ist das Unternehmen in Österreich?)
Es war im Untersuchungsausschuss der zuständige Beamte, der gesagt hat, er versteht nicht, wie man genehmigen konnte, dass alle den Privatjet von Herrn Benko mit 9 Millionen Euro subventionieren, sein Privathaus subventionieren, sein Wochenendhaus subventionieren. Und Sie haben auch noch dafür gesorgt, dass er 1 Million Euro Covid-Förderung für sein Wochenendhaus bekommt (Ruf bei der ÖVP: ... hat der Gusenbauer ...!), weil es ein Hotel ist! Er war halt sein eigener Gast im Hotel. (Zwischenruf des Abg. Hanger.) Diese Konstrukte wurden nicht nur genehmigt (Abg. Steinacker: Organisation Gusenbauer!), sondern dann hat man noch Steuergeld nachgeworfen, und das unter der Verantwortung der ÖVP und unter aktiver Mithilfe von ÖVP-Funktionären. (Beifall bei der SPÖ.)
Da Pierer schon erwähnt wurde: In den Unterlagen sehen wir, dass wir selbst die Putzfrau von seinem Wohnhaus mitsubventionieren. Das kann doch nicht sein, bitte, dass ein Milliardär auch noch quasi seine Putzfrau von uns allen mitfinanzieren lässt. Sie können in den Datenraum gehen und sich die Unterlagen ansehen. (Zwischenruf des Abg. Zarits.) Das kann doch nicht sein! Was macht die ÖVP? – Den Bericht, wie man es besser machen kann, sperren sie in den Safe, kommen in den Untersuchungsausschuss und wissen von nichts; wissen gar
nicht, dass es Milliardäre gibt, wissen nicht, dass wir sie schlecht besteuern, und schauen einfach weg.
Dann schauen wir auch noch zur Cofag, denn das war natürlich auch ein Thema, wieso Konzerne so viel Geld bekommen haben, und zwar gegen das europäische Recht. Das, was wir da herausarbeiten konnten, ist erstens einmal, dass das mit Anlauf war. Externe Berater haben wir auch noch bezahlt. Als die ÖVP und Finanzminister Blümel gemeint haben, die Konzernbetrachtung lassen wir weg, wir wollen Konzernen möglichst viel Geld geben, hat der Rechtsanwalt sofort zurückgeschrieben: Ist das euer Ernst? Das führt ja dazu, dass ein Konzern, der in einer Konzernstruktur ist, 100 Millionen Euro bekommt oder sogar bis zu 100 Millionen Euro, ein anderer nur 5 Millionen Euro. Wenn ihr das macht, müsst ihr das mit der Europäischen Kommission besprechen, weil das sonst gegen das Europarecht ist.
Und was hat die ÖVP gemacht? – Sie hat gegenüber der Kommission diese Zeile einfach rausgelöscht. Sie haben in Wahrheit die Europäische Kommission hintergangen und damit uns alle. Das hat dazu geführt, dass die Konzerne rechtswidrig an mehr als 1 Milliarde Euro an zusätzlichen Förderungen gekommen sind, die nur in Gewinne gelaufen sind. Und wie viel Geld haben Sie jetzt davon zurückgeholt? – Null Euro! Bis heute gibt es noch kein Konzept, wie Sie diese Milliarde zurückholen, denn Sie wollen sie gar nicht zurückholen. Sie haben es doch absichtlich gemacht. Sie haben absichtlich den Konzernen mehr Geld gegeben als die EU eigentlich erlaubt hätte, und Sie tun nichts dafür, dass dieses Geld wieder zurückkommt. Es ist eine Schande, dass wir eine Bundesregierung haben, die so agiert. (Beifall bei der SPÖ.)
Der Bundeskanzler interessiert sich offenbar nicht dafür, aber wenn Sie (in Richtung Staatssekretärin Plakolm) schon hier sind – und ich glaube, Sie haben ja den Wanderpokal Digitalisierung in dieser Bundesregierung gewonnen (Ruf bei der ÖVP: Na, na!) –, dann erklären Sie mir bitte eines: Es gibt staatliche Leistungen wie den Reparaturbonus oder jetzt das Supersparbuch quasi über die Oebfa, die funktionieren, die man sich als Bürger aber nur holen kann, wenn man die
ID Austria hat. Wir wissen, dass die nur ein Drittel der Österreicher überhaupt hat, also zwei Drittel werden von staatlichen Leistungen einfach ausgeschlossen.
Unser Vorschlag ist, dass jemand, der halt kein Digitalexperte ist, jemand, der das nicht will oder nicht kann, genauso Zugang zum Reparaturbonus oder zum Supersparbuch, das Sie selber als Onlinesupersparbuch bewerben, bekommt. Sie diskriminieren da die ältere Generation und sagen: Nein, du musst ein Digitalexperte sein, du musst dir irgendwelche Sachen auf dein Handy runterladen, bei denen du dich nicht auskennst, damit du staatliche Leistungen in Anspruch nehmen kannst!
Das ist eine Diskriminierung von einem Drittel der Bevölkerung. Wir haben heute einen Entschließungsantrag eingebracht: Bitte machen Sie, dass das aufhört, denn auch die ältere Generation hat das Recht auf staatliche Leistungen! – Vielen Dank. (Beifall bei der SPÖ. – Ruf bei der ÖVP: 20 Minuten Unsinn reden ...!)
9.20
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Frau Staatssekretärin Plakolm. – Bitte sehr.
Staatssekretärin im Bundeskanzleramt Claudia Plakolm: Geschätzter Herr Präsident! Sehr geehrte Abgeordnete! Liebe Zuseherinnen und Zuseher der heutigen Nationalratssitzung! Im Rahmen der Aktuellen Stunde der SPÖ darf ich in Vertretung des Bundeskanzlers die Gelegenheit nutzen, um bei dieser Diskussion Fakten auf den Tisch zu legen.
Zunächst einmal kann man, glaube ich, festhalten, dass wir in Österreich definitiv kein Problem mit einer zu geringen Steuerlast haben – ganz im Gegenteil. Wir als Bundesregierung konzentrieren uns darauf, dass die Menschen, die arbeiten gehen, wenn sie eben Leistung erbringen, entsprechend entlastet werden, dass wir die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass Eigentumsschaffung kein
Wunschdenken ist, und dass Österreich weiterhin ein Staat mit entsprechenden Sozialleistungen bleibt. (Beifall bei der ÖVP sowie der Abg. Disoski.)
All das machen und garantieren wir, ohne von neuen Steuern zu fantasieren, die entweder leistungsfeindlich, eigentumsfeindlich oder ineffizient sind; und meistens alle drei Dinge zugleich – deswegen gibt es von uns als Volkspartei ein klares Nein zu Eigentums- und Vermögensteuern. (Beifall bei der ÖVP sowie der Abgeordneten Disoski und Voglauer. – Abg. Stefan: ... Haushaltsabgabe!)
Aufgrund der Ausführungen des Herrn Abgeordneten und auch der vielen weiteren Debatten, die zu diesem Thema geführt werden, möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um einige Dinge richtigzustellen – denn vieles, was da behauptet wurde, ist schlichtweg unwahr. Mit unwahren Zahlen zu agieren scheint für manche dann in Ordnung zu sein, wenn es in die eigene ideologische Erzählung passt. Der Zweck heiligt sozusagen die Mittel. (Beifall bei der ÖVP.)
Die Sozialdemokratische Partei argumentiert oftmals mit einer Studie, mit der die einzige seriöse Quelle, die ETH Zürich, im Nachhinein nichts mehr zu tun haben will, weil die Studie nicht den guten wissenschaftlichen Standards entspricht, oder sie argumentiert auch mit Zahlen von Attac, die von sämtlichen Wirtschaftswissenschaftern in Österreich bereits beim ersten Hinschauen als absolute Fantasiezahlen abgetan wurden. (Abg. Jeitler-Cincelli: Genau!) Zahlreiche Tageszeitungen haben Ihnen, liebe Kollegen von der SPÖ, vorgerechnet, dass diese Zahlen falsch sind. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Herr: Das hat nichts mit der Wortmeldung zu tun! – Abg. Steinacker: Ja lest es einmal nach! Das stimmt nämlich! Nachlesen! – Abg. Herr: Bitte? Das sind Zahlen des Finanzministeriums!)
Meine eindringliche Bitte deswegen: Bleiben wir bei den Fakten! Lassen wir diese Neiddebatte! Wir brauchen in meinen Augen nämlich genau das Gegenteil: eine sachliche Debatte darüber, wie wir die Steuerlast für die Menschen, die tagtäglich aufstehen, arbeiten gehen und Steuern zahlen, senken können – nicht darüber, wie wir die Steuern weiter heben sollen. Wir brauchen eine Debatte
darüber, wie wir die Menschen, die hart arbeiten und sich etwas aufbauen, die etwas leisten wollen, unterstützen können, statt sie noch mehr zu besteuern. (Abg. Belakowitsch: Was erzählen Sie uns für Märchen?!)
Wir haben in Österreich im weltweiten Vergleich betreffend Steuern und Abgaben eine der größten Umverteilungen von Einkommen. Insbesondere Familien profitieren von unseren steuerpolitischen Maßnahmen. Der Familienbonus Plus in Höhe von 2 000 Euro pro Jahr pro Kind sorgt genau dafür, dass die Steuerbelastung von Familien aufgrund dieser Maßnahmen im internationalen Vergleich deutlich unter dem OECD-Schnitt liegt. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
Mit einem Steuersatz von 55 Prozent auf hohe Einkommen haben wir international einen der höchsten Steuersätze. Im Vergleich: Man zahlt in Deutschland 47,5 Prozent und in der Schweiz bis zu 41,5 Prozent. (Abg. Belakowitsch: Ist das jetzt eine Selbstanklage?)
Bei den unteren und mittleren Einkommen hat diese Bundesregierung den Steuersatz noch einmal deutlich gesenkt. Es ist uns ein ganz großer Meilenstein gelungen. Wir haben einer der größten Ungerechtigkeiten im Steuersystem in dieser Legislaturperiode ein Ende gesetzt: der kalten Progression.
Durch die progressive Gestaltung unseres Steuersystems war es früher so, dass der Staat bei jeder Lohnerhöhung zusätzlich profitiert hat. Die Abschaffung der kalten Progression ist jahrzehntelang in fast allen Wahlprogrammen gestanden – auch in Ihrem, liebe SPÖ. Wir als Bundesregierung haben sie abgeschafft, und ich denke, dass vielen noch nicht bewusst ist, welche Auswirkungen dieser Meilenstein hat.
Es bedeutet, vereinfacht gesagt, dass eine Lohnerhöhung auch tatsächlich eine solche bleibt, ohne dass der Staat noch einmal zusätzlich Steuern kassiert. Das ist auch gut so. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an unseren Bundeskanzler, ebenso an den Finanzminister, die beide seit ihrem Amtsantritt sehr
stark für die Abschaffung der kalten Progression gekämpft haben. (Beifall bei der ÖVP sowie der Abgeordneten Götze und Schwarz. – Zwischenruf des Abg. Hafenecker.) Am stärksten profitieren davon gerade junge Menschen, junge Familien, weil sie am Beginn des Erwerbslebens stehen und in dieser Zeit hoffentlich noch einige Lohnerhöhungen vor sich haben.
Geschätzte Damen und Herren! In einem Sozialstaat helfen wir natürlich denjenigen, die in Notlagen sind, die nicht auf die Butterseite des Lebens gefallen sind. Das ist unser Selbstverständnis. (Ruf bei der SPÖ: Ihr schickt sie zum McDonald’s!) Im Rahmen dieses Selbstverständnisses braucht es für ein Gelingen aber auch das, dass diejenigen, die sich mehr anstrengen, die mehr leisten, auch mehr von ihrem Einsatz haben sollen. Wir brauchen Anreize, dass es sich auszahlt, arbeiten zu gehen. Ein Sozialstaat funktioniert nur, wenn es auch Menschen gibt, die arbeiten gehen und Steuern zahlen. (Abg. Silvan: Alle!) Deswegen müssen wir diesen Teil des Versprechens genauso einhalten, sonst wird bald überhaupt niemand mehr Lust haben, arbeiten zu gehen oder mehr zu tun.
Wir sind es in Österreich gewohnt, dass unsere Kinder und Jugendlichen eine kostenlose Ausbildung an Schulen und Universitäten erhalten. Wir sind es gewohnt, dass wir bei Unfällen oder Krankheiten ins Krankenhaus oder zum Arzt gehen können, ohne uns Gedanken über die Rechnung machen zu müssen. Wir sind es gewohnt, dass man, wenn man seinen Job verliert, eine gewisse Zeit von der Gemeinschaft aufgefangen wird. (Abg. Silvan: Entschuldigung?! Man zahlt ja jeden Monat in die Arbeitslosenversicherung ein!) Wir sind es auch gewohnt, dass man sich im Alter selbstverständlich auf eine Pension verlassen kann. Bleiben wir also bitte bei den Fakten!
Wir brauchen definitiv wieder mehr Glauben an ein Leistungsversprechen, mehr Maßnahmen für die Österreicherinnen und Österreicher, damit sie auch sehen – tatsächlich sehen –, dass es sich lohnt, arbeiten zu gehen, weil man sich damit vielleicht eigene vier Wände, einen Urlaub oder andere Dinge leisten kann. Wir
brauchen weniger Neiddebatten und mehr Menschen, die sich etwas schaffen können.
Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, wird nur gehen, wenn wir Menschen motivieren können: zum Beispiel mit 18 steuerfreien Überstunden, wie wir es umgesetzt haben, oder auch – was meiner Meinung nach in ein nächstes Regierungsprogramm gehört – mit einer Steuerentlastung, mit einer Abschaffung der Grunderwerbsteuer (Beifall bei der ÖVP – Abg. Herr: Na genau!) oder mit einem Bonus für all jene, die 40 Stunden oder sogar mehr arbeiten. Auch das muss Teil eines nächsten Regierungsprogramms sein. (Zwischenruf des Abg. Hafenecker.)
Geschätzte Damen und Herren! Wir brauchen mehr, da gebe ich Ihnen recht, aber definitiv nicht mehr Steuern, sondern mehr Anerkennung von Leistung. – Danke schön. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Scherak: Es ist gut, dass die ÖVP nach 36 Jahren auch draufkommt!)
9.27
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Wöginger. – Herr Klubobmann, bitte sehr.
Abgeordneter August Wöginger (ÖVP): Herr Präsident! Frau Staatssekretärin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit der ÖVP wird es keine Vermögen- und Erbschaftssteuer geben, damit das hier gleich zu Beginn klargestellt ist. (Beifall bei der ÖVP. – Zwischenrufe der Abgeordneten Belakowitsch und Hafenecker.)
Beides hat es in Österreich schon gegeben und beides wurde unter der Führung von Sozialdemokraten abgeschafft. Es hat also einmal Rote gegeben, die einen wirtschaftlichen Hausverstand gehabt haben; denken wir an Lacina und auch Gusenbauer. (Abg. Stöger: ÖVP und Hausverstand passt nicht zusammen!) Diese
Menschen sind unter dem Marxisten Babler aber leider verloren gegangen, meine Damen und Herren. (Beifall bei der ÖVP.)
1993 wurde die Vermögensteuer unter Lacina abgeschafft. Er ist 20 Jahre später gefragt worden, ob er heute, 2014, für eine Vermögensteuer wäre. – „Eine Vermögensteuer so wie damals würde ich für völlig falsch halten.“ Dann gibt es die Nachfrage: „Gegen eine Substanzvermögensteuer sind Sie heute eher auch noch?“ – „Nicht nur eher. Sondern ich hielte das für einen absoluten Fehler.“ – Lacina vor zehn Jahren. (Abg. Stöger: Wöginger, Vertreter der Superreichen!)
Es gibt einen gewissen Herrn Matznetter, der schon lange Parlamentarier ist und heute nicht da ist. Er wird schon wissen, warum er bei dieser Debatte heute nicht da ist (Ruf bei der SPÖ: Er ist eh da!), denn Herr Matznetter hat einmal gesagt: „Unsere oberste Priorität ist es, die Bevölkerung angesichts der Teuerungswelle und der sich abschwächenden Konjunktur zu entlasten. Damit stärken wir die Kaufkraft und kurbeln die Wirtschaft an.“ – Schau, schau, das sagt Herr Matznetter. (Ruf bei der SPÖ: Na und? – Zwischenruf der Abg. Heinisch-Hosek.) Dann sagt er: „Weder eine Erhöhung der Grundsteuern noch die Wieder-Einführung der von Ferdinand Lacina abgeschafften Vermögenssteuer sei geplant.“ (Zwischenrufe der Abgeordneten Stöger und Wurm.)
Es gibt also auch jetzt noch Parlamentarier der SPÖ in diesem Haus, die eigentlich nicht zu dem stehen, was Sie fordern, oder die das zumindest auch einmal anders gesagt haben, und sie haben recht, meine Damen und Herren von der SPÖ. Gescheiter wäre es, ihr würdet in eurem Renner-Institut auch einmal Vortragende zulassen, die darüber berichten, was diese Steuern in diesem Lande anrichten würden, und nicht eine marxistische Ideologie verbreiten. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Heinisch-Hosek: Na du hast Sorgen, wirklich!)
Es stimmen schlicht und einfach die Zahlen nicht, die Sie verbreiten. Dieser Chart zeigt das einigermaßen (eine Tafel mit der Überschrift „Vermögensbezogenen Steuern sind höher als in den offiziellen Statistiken ausgewiesen“ und einem Diagramm mit drei Balken in die Höhe haltend – Ruf bei der FPÖ: Kann man nicht
lesen!): Das (auf den linken Balken weisend) ist das, was die OECD-Definition ist – das sind ungefähr 2,5 Milliarden, 2,6 Milliarden Euro –, das (auf den mittleren Balken weisend) ist die Definition laut EU mit 3,6 Milliarden Euro. (Abg. Schmidt: Aber immerhin ist es bunt!) Was ist einfach nicht hineingerechnet? – Die Immobilienertragsteuer und die Grundbuchgebühr. Rechnet man das dazu (auf den rechten Balken weisend), sind wir bei 6 Milliarden Euro und in etwa bei dem Schnitt, bei dem sich auch andere europäische Länder befinden.
Das heißt: Hören Sie auf mit diesen Steuerfantasien! Wir haben Steuern genug in diesem Land. Sie sind leistungsfeindlich, Sie gefährden den Standort und damit auch die Arbeitsplätze (Abg. Scherak: Gut, dass die ÖVP in der Regierung ist!), und Sie gefährden natürlich auch den Wohlstand. Packen Sie daher Ihre kommunistische Mottenkiste mit Ihren Steuerfantasien wieder ein (Zwischenruf des Abg. Matznetter) und lassen Sie die Wirtschaft und die Menschen in diesem Land arbeiten! (Beifall bei der ÖVP.)
Sie sagen auch nicht dazu, woher diese Steuern denn kommen sollen. (Abg. Schmidt: Von den Millionären!) Dann redet Kollege Krainer von den Milliardären. Ja, glaubt ihr wirklich, dass die Milliardäre so dumm wären, dass sie das Kapital und das Geld im Land belassen würden, wenn der Staat sagt: Nein, nein, jetzt greifen wir da ordentlich in die Kassen!?
Was wäre denn dann das Ergebnis daraus? – Dass wir die Steuern, die sie jetzt zahlen, nämlich Hunderte Millionen Euro, dann auch nicht mehr haben, denn es würde einfach den Abfluss des Kapitals aus Österreich bedeuten. Dann wären diese Steuereinnahmen auch nicht da und weitere natürlich nicht zu lukrieren. (Abg. Kickl: Das werden schwierige Verhandlungen!) Diese Milliardäre sind doch keine dummen Menschen. Die wissen, wie sie es anlegen müssten, damit sie nicht in diese Steuerpflicht kommen, aber das lernt ihr auch nicht am Renner-Institut, das ist ja euer Problem. (Beifall bei der ÖVP.)
Das heißt: Woher würden denn dann die Gelder kommen? – Ja natürlich von unseren Familienbetrieben! Mein Nachbar ist ein Tischler mit über
60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Abg. Matznetter: ... ist der Milliardärsvertreter ...! – Abg. Stöger: Das stimmt nicht! Das stimmt nicht!) – übrigens arbeiten in dieser Tischlerei mehr Frauen als Männer –, er hat ein Anlagevermögen von Millionen von Euro stehen. (Abg. Matznetter: Das ist dem Wöginger sein ...!) Habt ihr auch einmal gesagt, wie ihr das dann ausrechnet, wenn der diesen Familienbetrieb an seinen Sohn, an seine Tochter weitergibt, wie das dann ausschauen soll? (Abg. Kucher: Wie machen das die Deutschen?) Was zahlt denn der dann? Diese Betriebe werden vernichtet und damit auch die Arbeitsplätze in der Region. (Abg. Kucher: Völliger Blödsinn!) Diese kleinen und mittelständischen Familienbetriebe sind das Rückgrat unserer Wirtschaft, und ihr sagt: Nein, nein, die sollen zahlen, wenn der Betrieb übergeben wird! (Abg. Herr: In der Schweiz, da gibt’s keinen einzigen Betrieb mehr! Alle weg! In den USA auch! Da gibt’s kein Unternehmen mehr!)
Das Zweite sind unsere Bauernhöfe, unsere Bäuerinnen und Bauern, die ohnedies unter dem Druck, den es gibt, leiden. (Abg. Matznetter: Keine Steuerverantwortung ...!) Heute haben wir auch ein 300-Millionen-Euro-Paket präsentiert, um der Landwirtschaft unter die Arme zu greifen, weil sie es sich auch verdient hat. (Beifall bei der ÖVP.) Wenn der Bauer den Hof übergibt, dann soll der Junge noch einen Haufen Geld zahlen, weil Sie Ihre Steuerfantasien befriedigen wollen? Das kommt mit uns definitiv nicht infrage.
Die, die sich irgendwann einmal Eigentum geschaffen haben, weil sie in der Früh aufstehen, arbeiten gehen, Leistung erbringen, ein ganzes Leben lang die Darlehen zurückzahlen, die sollen dann noch zahlen, wenn sie das Einfamilienhaus samt Grundstück übergeben? Das wird es mit der Volkspartei nicht geben, meine sehr geehrten Damen und Herren! (Beifall und Bravorufe bei der ÖVP.)
Wir stehen für Entlastung, so wie es auch im Österreichplan (ein Exemplar des genannten Plans in die Höhe haltend) steht. (Zwischenruf des Abg. Hafenecker.) Wir wollen die Steuern weiter senken. Wir wollen einen Vollzeitbonus einführen, und wenn jemand Überstunden macht, dann sollen die Überstunden zur Gänze steuerfrei gestellt werden. Das ist unser Plan von Bundeskanzler Karl
Nehammer, dafür steht die Volkspartei. (Beifall und Bravorufe bei der ÖVP. – Zwischenrufe der Abgeordneten Belakowitsch und Kassegger.)
9.33
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Schmidt. – Bitte sehr, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete MMag. Michaela Schmidt (SPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Frau Staatssekretärin! Jedes Steuersystem sollte sich am Grundsatz orientieren, dass die, die mehr haben, auch mehr leisten und beitragen können. Man sollte also annehmen, dass gerade die Superreichen, die so vom österreichischen Staat profitieren, auch bereitwillig ihren fairen Teil dazu beitragen.
Dass dem nicht so ist, hat der Cofag-Untersuchungsausschuss in den letzten Wochen zweifelsohne bewiesen. (Abg. Zarits: In was für einem Ausschuss warst du?) Das Finanzministerium bevorzugt symptomatisch Superreiche und Konzerne, dafür trägt die ÖVP Sorge. (Beifall bei der SPÖ.)
Sie bekämpfen Steuerbetrug ausschließlich in Sonntagsreden. Von Montag bis Freitag behindern Sie die Arbeit der Finanzbeamt:innen in Österreich. (Abg. Zarits: Das gibt’s ja nicht! Das ist ja unverschämt! – Abg. Steinacker: Sag einmal, da stehen wir persönlich dort und verhindern das?) Auf Aufforderung der OECD haben die Beamt:innen im BMF sich selbst überprüft, ob die Superreichen in Österreich tatsächlich ihre Steuern zahlen, und das Ergebnis war in dreierlei Hinsicht ernüchternd. (Abg. Reiter: Haben Sie nicht zugehört?)
Die Finanz hat bei zwei Dritteln aller Superreichen dringenden Handlungsbedarf geortet. 70 Prozent der Privatstiftungen, in denen die Superreichen ihre Vermögen parken, wurden überhaupt noch nie geprüft. Manager mit Multimillionengehältern haben eigene Verlustquellen erfunden, damit sie ja keine Einkommensteuer in Österreich zahlen müssen.
Jetzt würde man doch annehmen, dass nach so einem katastrophalen Bericht aus dem eigenen Ministerium beim ÖVP-Finanzminister Feuer am Dach ist und die Verbesserungsvorschläge der Beamten sofort umgesetzt werden. Aber nein, der Bericht verschwand in der Schublade und überlebte dort vier ÖVP-Finanzminister. Man war ja stattdessen damit beschäftigt – laut Thomas Schmid –, die – unter Anführungszeichen – „Helfer“ der Reichen zu spielen und die Benkos, Wolfs und Pierers dieser Welt dabei zu unterstützen, ihre Steuern noch weiter zu minimieren. – Das ist klassische ÖVP-Finanzpolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall bei der SPÖ.)
Da fragt man sich jetzt als Österreicherin natürlich schon: Wofür zahle ich eigentlich meine Steuern? – In den letzten Jahren offenbar nur, damit einige ÖVP-Großspender noch mehr Geld scheffeln können. (Abg. Weidinger: Hallo, hallo, hallo!) 50 der 100 größten Unternehmen in Österreich haben Covid-Hilfen beantragt. Davon haben 44 Unternehmen Gewinne gemacht. Sie haben 300 Millionen Euro Covid-Hilfen erhalten und gleichzeitig 9 Milliarden Euro Gewinn gescheffelt. Allein die KTM AG hat rund 10 Millionen Euro Coronahilfen erhalten und im selben Zeitraum 240 Millionen Euro Gewinn gemacht. Zum Dank kündigt man jetzt 500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Da hat sich die Parteispende von Eigentümer Stefan Pierer ordentlich gelohnt. – Auch das ist klassische ÖVP-Finanzpolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Beifall bei der SPÖ.)
Nachdem jetzt die Kassen leer geräumt wurden und Sie Superreiche und Konzerne mit Steuergeschenken exklusiv serviciert haben, stellen sich ja jetzt auch einige Kolleg:innen von der ÖVP die Frage, wie man und vor allem wer die Geschenke der letzten Jahre denn jetzt finanzieren soll. Da hat die ÖVP ja jetzt ein paar zündende Ideen:
Frau Edtstadler will den Österreicherinnen und Österreichern die Löhne durch eine Erhöhung auf eine 41-Stunden-Arbeitswoche kürzen. (Abg. Baumgartner: Das hat sie nicht gesagt! – Abg. Steinacker: Sollen wir das jetzt tatsächlich berichtigen oder zitieren Sie richtig?) Herr Brunner will das Pensionsantrittsalter
auf 67 Jahre erhöhen und damit den Pensionist:innen die Pensionen kürzen. (Abg. Zarits: Eine richtige Arbeiterkammerrede!) Ein gesetzlicher Lohn- und Pensionsraub soll also die Steuergeschenke an die ÖVP-Großspender querfinanzieren. – Gratulation! Auch das ist klassische ÖVP-Steuerpolitik. (Beifall bei der SPÖ.)
Diesen Raub, diese Umverteilung von unten nach oben, werden wir als Sozialdemokraten natürlich niemals und unter keinen Umständen zulassen, denn, liebe ÖVP, es ist höchste Zeit, dass wir Superreiche endlich zur Kassa bitten. Sie profitieren von unserem Staat: vom Gesundheitssystem, von der öffentlichen Infrastruktur und auch von den gut ausgebildeten Arbeitskräften.
Die Österreicher:innen haben sich verdient, dass alle – auch die Superreichen – ihren fairen Beitrag leisten müssen. Niemand kann sich seiner Verantwortung entziehen, egal wie reich oder wie einflussreich er ist. In kaum einem anderen EU-Land sind die Steuern auf Arbeit so hoch wie in Österreich – das stimmt –, gleichzeitig ist Österreich ein Steuerparadies für Multimillionäre.
Unter einer von uns geführten Regierung werden wir die Steuern auf Arbeit deshalb spürbar senken und gleichzeitig jene auf Millionenvermögen und Millionenerbschaften erhöhen. Wir werden dafür sorgen, dass 98 Prozent der Österreicher:innen weniger Steuern zahlen. Wir werden die sinnlose Maßnahme der Körperschaftsteuersenkung wieder rückgängig machen. Vor allem aber werden wir den Cofag-Wahnsinn nicht wiederholen, sondern mit dem Steuergeld umsichtiger umgehen und die Förderpolitik effektiver gestalten. (Zwischenruf der Abg. Jeitler-Cincelli.)
So werden wir dafür Sorge tragen, dass die Zeit der Zweiklassenverwaltung der ÖVP endlich beendet wird (Beifall bei der SPÖ), damit zukünftig wieder alle Österreicherinnen und Österreicher vom hart erarbeiteten Steuergeld profitieren und nicht nur einzelne Konzerne und Superreiche. (Abg. Wöginger: So ein Blödsinn!)
Abschließend, Herr Kollege Wöginger, möchte ich Ihnen noch sagen: Abgeordneter Matznetter tritt seit einem halben Jahrhundert – seit einem Vierteljahrhundert (Heiterkeit bei FPÖ und NEOS) – dafür ein, dass wir Millionärssteuern erhöhen. (Abg. Wöginger: Ausschauen tät’ er so! – Abg. Matznetter: Ich habe mit 15 angefangen! – Ruf bei den Grünen: Alter weißer Mann!) Sie wissen das, und Sie stellen hier in dem Wissen, dass wir keine tatsächliche Berichtigung machen können, eine Behauptung auf. (Abg. Wöginger: Doch, das hat er gesagt! Das ist sein Zitat!) Das ist aber in Ordnung, es zeigt sich halt einmal mehr: Sie sind der Anwalt der Millionäre und kein Volksvertreter. (Beifall bei der SPÖ. – Abg. Wöginger: Das ist nur ein Zitat gewesen, nicht mehr!)
9.39
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Belakowitsch. – Bitte.
Abgeordnete Dr. Dagmar Belakowitsch (FPÖ): Herr Präsident! Frau Staatssekretärin! Sehr geehrte Damen und Herren hier herinnen und vor den Fernsehgeräten! Wir diskutieren jetzt gerade aufgrund einer Aktuellen Stunde der SPÖ, und es hat sich leider gezeigt, es geht offensichtlich nur um eine Neiddebatte, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPÖ. Die Frau Staatssekretärin ist stolz darauf, dass wir ein Hochsteuerland sind, Klubobmann Wöginger prahlt hier heraußen, wir haben so viele Steuern wie sonst kein anderes Land. – Ja eh, das ist ja das Problem, das wir in unserer Republik haben. (Beifall bei der FPÖ.)
Die SPÖ versucht, eine Neiddebatte hochzuziehen, und spricht von Milliardären, die angeblich so bevorzugt werden. Wissen Sie, was Sie nicht verstehen, meine Damen und Herren von der SPÖ: Es gibt ein ganz anderes Problem in unserem Land. Das Problem ist nämlich, dass wir in den letzten Jahren einen Wohlstandsverlust erlebt haben und dass sich die Menschen das Leben nicht mehr leisten können, dass sie mit ihrem Einkommen nicht mehr auskommen.
(Zwischenruf der Abg. Reiter.) Das sind die wahren Probleme der österreichischen Bevölkerung.
Ob Herr Benko bevorzugt wurde und ob Herr Benko das politische System ausgenützt hat, sowohl die ÖVP wie auch Herrn Gusenbauer, interessiert die Leute da draußen überhaupt nicht. Außerdem gibt es dafür Gerichte, die das jetzt alles aufklären werden. Ich vertraue da der Justiz. (Beifall bei der FPÖ sowie der Abg. Jeitler-Cincelli.)
Daher, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPÖ: Sprechen wir über die wahren Probleme! Sprechen wir einmal über den Wohlstandsverlust! Da waren Sie dabei, denn: Was sind denn die Ursachen für die Probleme, die es in der Wirtschaft gibt? – Das waren die Coronalockdowns. (Widerspruch der Abg. Reiter.) Bei jedem einzelnen waren Sie von der SPÖ dabei (Heiterkeit bei Abgeordneten der SPÖ), überall haben Sie mitgestimmt.
Nächstes Problem: Was führt zu einer Problematik hinsichtlich Inflation? – Das sind die Sanktionen. Sie waren auch bei allen Sanktionspaketen dabei; 13 Sanktionspakete in den letzten beiden Jahren! (Abg. Schallmeiner: Bingo! – Rufe bei der SPÖ: Bingo! – Weitere Zwischenrufe bei SPÖ und Grünen.) Die Treibstoffpreise, die Energiepreise sind durch die Decke gegangen. Sie waren überall dabei! (Beifall bei der FPÖ.)
Nächstes Problem, der Green Deal: Da sind Sie an vorderster Front dabei. Genau das ist das Problem, das wir jetzt haben, dieser sogenannte Green Deal (Abg. Hörl: Geh, Dagmar!), der zu nichts anderem führt als zu einer Deindustrialisierung unseres Kontinents. (Beifall bei der FPÖ.)
Immer mehr Industriebetriebe verlegen ihren Standort nach Fernost – nach China, nach Indien. – Sie sind überall dabei. Das sind doch die wahren Probleme, die wir in unserem Land haben. Da sehen wir doch den Irrsinn (Abg. Hörl: Dagmar, bleib ruhig!), diese fehlgeleitete Wirtschaftspolitik – überall dabei. Ich nehme die ÖVP nicht aus, denn die stellen den Wirtschaftsminister, die stellen
den Bundeskanzler. Sie (in Richtung SPÖ) aber sind überall dabei – ich habe hier keinen Widerspruch gehört.
Dann bestellen wir uns irgendwelche Solarpanele, alle aus China. Wir fördern damit die chinesische Wirtschaft und vertreiben gleichzeitig unsere Betriebe dorthin. Dort gibt es keine Umweltstandards, dort gibt es keine Sozialstandards. Sie machen genau das Gegenteil dessen, was gemacht gehört würde. (Beifall bei der FPÖ. – Abg. Holzleitner: Deswegen haben wir im Gegensatz zur FPÖ europapolitisch auch ein Programm!)
Frau Kollegin Holzleiter, Sie kommen vielleicht eh noch dran – oder auch nicht, ich weiß es nicht (Abg. Holzleitner: Ja, ja, natürlich, kein Problem!) –, Sie müssen nicht so herumschreien. (Heiterkeit bei Abgeordneten der Grünen.) Wissen Sie, wenn Sie von der SPÖ sich jetzt hierherstellen (Ruf bei der SPÖ: Wer schreit hier?! Sie!) und irgendwelche Neiddebatten vom Zaun brechen (Abg. Holzleitner: Schon klar, die Neiddebatte ist unangenehm, weil Ihr Parteivorsitzender nicht gerne auf Einkommen aus Vermögen besteuert wollen werden würde! Oder?!), dann sage ich Ihnen schon eines (Abg. Holzleitner – in Richtung Abg. Kickl –: Da müssen Sie schmunzeln!): Wenn Sie permanent neue Steuern – Reichensteuern, Erbschaftssteuern; was weiß ich, was noch alles – einführen wollen, wollen Sie einfach nur, dass alle immer nur noch mehr zahlen. (Abg. Holzleitner: Aber Sie müssen eh nicht antworten, wir sind eh nicht im Untersuchungsausschuss!) Das führt dann genau dazu, dass wir noch mehr Unternehmer wegtreiben, weil es sich die großen Unternehmer nämlich richten können. (Abg. Kickl – in Richtung Abg. Holzleitner –: Bei uns muss man kein Armutsgelübde abgeben! Ich weiß nicht, wie das bei euch ist!) Die sind nicht darauf angewiesen (Rufe und Gegenrufe zwischen den Abgeordneten Holzleitner und Kickl), in Österreich zu bleiben – wir aber sind darauf angewiesen, das sind nämlich Investitionen in unserem Land, das sind Arbeitsplätze in unserem Land. (Beifall bei der FPÖ sowie der Abg. Jeitler-Cincelli.) Das sollten Sie sich wirklich einmal alle überlegen und das bedenken.
Jetzt aber noch ein Wort zur ÖVP: Ich muss Ihnen schon sagen, jetzt ist Kollege Wöginger nicht da (Rufe bei der ÖVP: O ja! Dort! Er ist eh da!) – ach so, er steht
verkehrt, Entschuldigung! –, dass es keine Vermögensteuer mit der ÖVP gibt, Herr Kollege Wöginger, ist natürlich auch so eine Geschichte. Erst in den letzten Plenartagen im April haben Sie hier eine Leerstandsabgabe beschlossen, und das ist nichts anderes als eine Reichensteuer (Abg. Wöginger: Wir haben überhaupt keine Leerstandsabgabe beschlossen, wir haben eine Verfassungsänderung beschlossen! Das ist genauso ein Blödsinn!), eine Steuer für Leute, die eine Substanz haben. (Ruf bei der ÖVP: Wir haben keine Steuer beschlossen!)
Im Übrigen: Dass diese Österreichische Volkspartei in den letzten fünf Jahren Steuern gesenkt hat, kann man ja auch nur dann behaupten, wenn man den Kopf in den Sand steckt. (Zwischenrufe bei der ÖVP.) – Na, Herr Kollege, neue Steuern: CO2-Abgabe, eine Inflationsbeschleunigung sondergleichen, die haben Sie eingeführt (Abg. Lindinger: Das ist ja der nächste Blödsinn! Das ist ja ein Wahnsinn!); Haushaltsabgabe – Sie belasten jeden einzelnen Mindestpensionisten mit einer Haushaltsabgabe, egal ob er ORF schaut oder nicht – eingeführt von Ihnen, von Ihrer Medienministerin. In den letzten fünf Jahren sind die Steuern und Abgaben in Österreich massiv gestiegen, und daran hat die ÖVP einen ganz großen Anteil. (Beifall bei der FPÖ. – Abg. Hafenecker: Wo man hinschaut, von der ÖVP nur Trümmer hinterlassen!)
9.45
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Tomaselli. – Bitte.
Abgeordnete Mag. Nina Tomaselli (Grüne): Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuseherinnen und Zuseher! Reiche – das ist auch nichts Neues – spielen ja gerne das Spiel: Tax me if you can! Der springende Punkt dabei ist die Frage, wie sich die Politik verhält. Nimmt sie das so hin oder spielt sie sogar bei diesem Spiel mit?
Im Gegensatz dazu möchte ich sagen, dass eine gerechte Steuerpolitik meiner Meinung nach die Grundlage für eine funktionierende Gesellschaft und für das
Gemeinwohl ist. Nur mit einer gerechten, nachhaltigen, soliden Steuerpolitik können wir starke Ungleichheiten ausgleichen, Umwelt und Klima schützen und für Gleichberechtigung sorgen. (Beifall bei den Grünen.)
Jetzt haben wir aber leider in den vergangenen U-Ausschüssen lernen müssen, dass das Finanzministerium zumindest in der Vergangenheit gerne den roten Teppich für Reiche und Superreiche ausgerollt hat. Stiftungsmillionäre wurden beispielsweise gleich zum Stifterfrühstück ins Finanzministerium eingeladen. Da kann man sich ja fragen, welcher Steuerzahler, welche Steuerzahlerin darf sonst zum Frühstückskipferl im Finanzministerium vorbeischauen?
Da passt es auch irgendwie zusammen, dass wir in diesem Untersuchungsausschuss in den Akten gesehen haben, dass 80 Prozent der Stiftungen überhaupt nie geprüft wurden. Es ist ja irgendwie logisch, dass gerade solche Hütchenspieler, wie Benko einer ist, sich so ein System dann auch gleich zunutze machen – Benko, die Signa ist die größte Wirtschaftspleite der österreichischen Geschichte –, und geholfen hat ihm dabei natürlich auch die Politik. Wer, wenn nicht Benko, muss Anlass für die Politik sein, sich Wege zu überlegen, wie es vermieden werden kann, dass Einzelne ungehörig reicher und reicher werden, indem sie sich über die Regeln aller stellen? Wer, wenn nicht Benko?
Das Problem bei der Signa-Pleite ist nämlich: Geschädigt wurden ja nicht nur reiche Investorinnen, Investoren und Banken, sondern auch der oder die deutsche und österreichische Steuerzahler, Steuerzahlerin sowie zahlreiche kleine Lieferantinnen und Lieferanten. Zum Schutz der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gebe es eigentlich ein Ministerium, das ist das Finanzministerium. Das, was da bei der Signa passiert ist, ist nicht von heute auf morgen passiert, das ging über Jahre, und genau so lange hat im Übrigen auch leider die Finanz weggeschaut.
Wir wissen das schon ziemlich lange, also mindestens seit Oktober 2022: Es gibt einen ehemaligen Generalsekretär im Finanzministerium – Sie kennen ihn alle –,
der sagt, Benko hat ihn bestochen, der sagt, er hat bei Steuerverfahren interveniert. Es gibt zahlreiche Akten und Chats, die das belegen. Es gibt einen Sektionschef, der sich mehrmals mit dem Steuerschuldner Benko getroffen hat. Es gibt ein Steuerverfahren, das unter wirklich ominösesten Umständen in Raketengeschwindigkeit von Wien nach Innsbruck verlegt worden ist, um dort genau so erledigt zu werden, wie Benko sich das immer gewünscht hat.
All diese Informationen sind seit 2022 bekannt und öffentlich und müssten eigentlich auch dem Finanzminister dementsprechend bekannt sein. Wissen Sie was? – Der Finanzminister hat seither nichts getan, das hat er im letzten Untersuchungsausschuss einräumen müssen. Es gibt keine interne Untersuchung, es gibt keine interne Revision, es gibt keine U-Kommission zu all diesen Vorgängen.
Das verstehe ich nicht, denn wenn Thomas Schmid sagt, er hat sich beim Flieger eingemischt, er hat sich beim Tuchlaubenkomplex eingemischt, es sei bei den Medizinzentren getrickst worden: Wer sagt denn bitte, dass das bei anderen Fällen nicht auch der Fall war? (Zwischenruf bei der SPÖ.) Dem muss man doch bitte nachgehen!
Was mich im Untersuchungsausschuss auch gewundert hat, ist – das möchte ich hier ganz offen sagen –, dass es, im Übrigen auch wenn es eben darum geht, die Interessen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zu schützen, nicht einmal möglich ist, einmal eine Zahl zu nennen, wie hoch denn jetzt überhaupt die Steuerzeche von Benko, von Signa ist. Wir, oder die Öffentlichkeit, wissen bisher immer noch nicht: Was schuldet Benko eigentlich uns allen, Ihnen als Steuerzahlerin und Steuerzahler?
Ja, Benko ist ein Hütchenspieler, er war ein Grenzgänger. Viele haben sich von ihm blenden lassen, einige haben mitgespielt. Benko nutzte das System aus, und meiner Meinung nach darf die Politik nicht den Fehler machen, sich nicht für
diese Schlupflöcher zu interessieren. Die Achseln zu zucken und weiterzumachen ist genau die falsche Reaktion. (Beifall bei den Grünen.)
9.50
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Schellhorn. – Bitte.
Abgeordneter Josef Schellhorn (NEOS): Herr Präsident! Frau Staatssekretär! Jetzt zeige ich Ihnen einmal zur Objektivierung eine Darstellung (eine Tafel, auf der unter der Überschrift „Zahlen Superreiche wirklich weniger Steuern?“ zwei Säulendiagramme zu sehen sind), und es ist erstaunlich, dass ich das anhand einer Darstellung von Agenda Austria mache, aber: Das (auf die bei Weitem höchste Säule im ersten Diagramm weisend) ist der Muster-Mateschitz, der zahlt 340 Millionen Euro, und (jeweils auf eine wesentlich niedrigere Säule weisend) das zahlt einer wie ich, und das zahlt ein Millionär. Und das (auf das zweite Säulendiagramm weisend) ist der Ausgleich der gesamten Steuerbelastungen: Hier (im Folgenden auf zwei sich in der Höhe nicht sehr stark unterscheidende Säulen weisend) ist auch wieder Herr Mateschitz – ungefähr gleich wie ein Millionär.
Wenn es um Gerechtigkeit geht, bin ich eher dafür, dass wir über die Zukunft reden, nämlich nicht in Form eines Reichenbashings, eines Bashings. Es werden in die Gesellschaft nämlich zwei Keile hineingetrieben: Das eine ist der Keil von rechts und das andere ist der Keil, der von oben nach unten beziehungsweise von unten nach oben in die Gesellschaft getrieben wird. Wir hören immer wieder vonseiten der SPÖ: die da oben. – Wir, Arbeitende und Angestellte und Unternehmer, arbeiten gemeinsam an einem Projekt, dass wir gemeinsam eine steuerliche Entlastung zustande bringen.
Ich möchte Sie etwas fragen, bevor Sie wieder Namen nennen. Sie nennen nämlich nur immer von einer Seite die Namen, mir hingegen ist das wurscht, ob jemand Benko, Maier oder Huber heißt oder was weiß ich, aber ich nenne nicht einmal Ihre Luxuspensionisten der Oesterreichischen Nationalbank, die Sie noch
immer haben, Luxuspensionisten, die sich angefüttert haben, worüber Sie selber mitbeschlossen haben, die bei Weitem mehr, viel mehr an Pensionen bekommen als der durchschnittliche Pensionist, und da frage ich mich auch: Ist das fair? – Wir nennen aber keine Namen. (Abg. Wurm: Du brauchst keine Namen nennen! Wir haben alle Namen!)
Weiters: Ist es fair, dass von einem Feiertagszuschlag, den ein Unternehmer bezahlt – in der Höhe von 100 Prozent und zu Recht und gerne –, Sie mit der Sozialpartnerschaft diesem Arbeitnehmer nicht die 100 Prozent lassen, sondern ihm 52 Prozent wegnehmen? Ist es von Ihrer Seite fair, dass Sie zum Beispiel den Wohnbauförderungsbeitrag, der den Arbeitnehmern vom Bruttobezug abgezogen wird, nicht zu 100 Prozent weitergeben, sondern ihnen nur 37 Prozent für den Wohnbau zur Verfügung stellen und das andere dann in den Ländern versickert?
Ist es fair, dass die Länder, die neun Bundesländer, und dazu gehören auch sozialdemokratische Bundesländer wie Kärnten und Wien, da dreistellige Millionenbeträge – und zufällig sind die zwei Supergewinner bei den Energiekonzernen die Kelag und die Wien Energie, über 500 Millionen Euro – einstecken und den Bürger:innen, die um eine Betriebskostensenkung beziehungsweise eine Stromkostensenkung ansuchen, dann wieder – wie Bittstellern – ein Kuvert geben? Ist diese Erniedrigung – und ihnen zuerst etwas wegzunehmen – fair? Ist es fair, ihnen Geld wegzunehmen? (Abg. Kucher: Aber ihr wart gegen Markteingriffe! Seid ehrlich! – Abg. Kassegger: Da brauch ich keinen Markteingriff! Ich brauch nur als Eigentümer der Geschäftsführung sagen, sie sollen nicht Wucherpreise für den Strom verlangen!)
Die ÖVP und die SPÖ haben es geschafft, in den letzten 40 Jahren nie eine Steuersenkung zustande zu bringen – nie! –, und ich muss euch noch einmal eines sagen: Die Abschaffung der kalten Progression ist kein Steuergeschenk, sondern das ist die Streichung eines Diebstahls am Steuerzahler (Beifall bei den NEOS sowie des Abg. Lausch) – so schaut es einmal aus –, und ansonsten ist das
gar nichts. Ihr schreit das immer raus, als wäre das jetzt ein Steuergeschenk. (Zwischenruf des Abg. Schnabel.)
Heute ist sowieso ein schlechter Tag. – Du weißt nicht, was heute für ein Tag ist, nicht? – Der 15. Mai, der ist für jeden Unternehmer ein beschissener Tag (Ruf bei der ÖVP: Psch!), weil er die Steuern, die Unternehmenssteuern, Einkommensteuern vorauszahlen muss. Das ist kein guter Tag für einen Unternehmer. Ihr sprecht noch davon, dass die Steuern so schön gerecht verteilt sind. Die sind nicht schön und gerecht verteilt! (Abg. Krainer: Der 15. Mai ist der Tag, an dem der Staatsvertrag unterschrieben wurde! Das ist ein guter Tag! – Ruf bei der ÖVP: Ja, richtig! Ganz genau! – Abg. Kassegger: Ja, auch! Aber auch KöSt-VZ zweites Quartal! Das weißt du aber nicht! – Abg. Kickl: Seit wann kümmert euch der Staatsvertrag was?)
Ja, das weißt du natürlich nicht, welche Belastungen die Unternehmerinnen und Unternehmer am heutigen Tag aber zu leisten haben, um die Finanzierung des Staates zu ermöglichen, die Finanzierung dieser vier F – dieses funktionierenden Staates, wie Kollegin Tomaselli gesagt hat –: Feudalismus, falsch verstandener Föderalismus, falsch verstandener oder üppiger Förderalismus endet in einem Fladeralismus. Die Länder bestehlen die Bürger in diesem Land, und die Landeshauptleute sagen euch, wo die Sache langgeht. Und ihr sagt, ihr seid so brav und steuergerecht. Das stimmt nicht! Das belastet die Menschen in diesem Land!
Würden wir die Mission 40 Prozent, das Programm der NEOS, ernst nehmen – das wäre es: die Steuerbelastung auf 40 Prozent zu drücken –, hätte jeder Bürger in diesem Land 2 130 Euro netto mehr. Das wäre eine steuerliche Entlastung! Warum geht das nicht? – Weil ihr die Länder fördern müsst, weil die Landeshauptleute euch sagen, wo es langgeht.
Das, glaube ich – ich bin sofort fertig, Herr Präsident –, ist der falsche Ansatz. Wir müssen zuerst die Menschen entlasten und dann schauen, wie wir mit dem Geld auskommen – und nicht neue Steuern einführen. (Beifall bei den NEOS.)
9.56
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Jeitler-Cincelli. – Bitte sehr.
Abgeordnete Mag. Carmen Jeitler-Cincelli, BA (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Staatssekretärin! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Als ich den Titel dieser Aktuellen Stunde „Wieso zahlen in Österreich Milliardäre weniger Steuern als Menschen, die arbeiten gehen [...]“? gelesen und mir das einmal so überlegt habe, habe ich gedacht, das ist eigentlich schon sehr polemisch. Schauen wir uns aber an: Um wen geht es da eigentlich? Wer sind diese Milliardäre, von denen wir da sprechen? – Ich habe mir dann die Liste von Forbes angeschaut, weil ich mir gedacht habe: Forbes ist gut, das ist nicht irgendeine Excel-Tabelle oder irgendeine selbstgeschnitzte Studie, sondern das ist etwas, was international Beachtung findet – daher schauen wir einmal auf Forbes!
Was glauben Sie: Wie viele Österreicher sind unter den 1 000 reichsten Menschen der Welt? – Es sind drei. Der Großteil ist aus den USA, sehr, sehr viele Newcomer sind aus Asien und aus Südamerika. Aus Österreich sind genau drei Personen unter den reichsten Menschen der Welt.
Schauen wir uns das jetzt innerhalb Österreichs an, schauen wir uns verschiedene Statistiken an, weil ich mir gedacht habe: Wie viele Leute sind das eigentlich, über die Sie da herziehen und die sozusagen einmal ablegen sollten? Da habe ich gesehen, das sind, je nach Berechnung, zwischen zehn und 15 Menschen inklusive deren Familien. Da geht es um Menschen – und für mich steht der Mensch einmal im Vordergrund –, um zehn bis 15 Menschen, die hier von Ihnen permanent vorgeführt werden und denen jegliche Art von Leistung abgesprochen wird.
Wie definiert sich jetzt dieses Milliardärsdasein? Wonach wird das berechnet? – Es geht um eine Schätzung von Firmenbeteiligungen, es geht um Immobilienbesitz, um Aktien. Das ist eine grobe Schätzung. Man sieht auch, warum
Signa plötzlich ganz schnell wieder rausfallen kann: weil das zum Teil virtuelle Werte sind. Ein Unternehmen ist ja nicht das, was jetzt pseudomäßig der Buchwert ist, denn ich kann nicht am nächsten Tag sagen, ich verkaufe es, und dann ist das Geld auf meinem Konto. So funktioniert das nicht.
Wenn Sie dann ständig auf Einzelne hinhauen – ich will das gar nicht kommentieren, Gfraster gibt es überall, in der Politik gibt es auch nicht so wenige –, dann sollte man sich einmal ansehen – weil Sie diese Frage stellen –: Zahlen die denn keine Steuern? – Das ist natürlich völliger Blödsinn, und meine Kollegen haben Ihnen dazu vorhin auch ausgiebig Zahlen, Daten und Fakten vorgelegt. Natürlich zahlen die Steuern, die zahlen unfassbar viel an Steuern! Und unsere Abgabenquote in Österreich ist generell zu hoch, das ist nämlich unser eigentliches Problem.
Das oberste 1 Prozent der Einkommensbezieher finanziert 25 Prozent des gesamten Steueraufkommens der Republik Österreich. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Krainer: Das ist so falsch! Das ist so falsch!) Insgesamt gibt es, international gesehen, kaum ein Land, in dem mehr umverteilt wird als bei uns. Und das, was Sie hier einfordern, diese Vermögensbesteuerung, haben fast alle aufgegeben, aber – wissen Sie, was? – aus guten Gründen: nicht nur, weil es kompliziert war, technisch komplett ineffizient war, sondern auch, weil es – wozu führt das denn? – zu Kapitalflucht ins Ausland führt. (Abg. Herr: Aber in den USA gibt’s Millionärssteuern!)
Weil Sie vorhin die Leerstandsabgabe erwähnt haben, nur zur Berichtigung: Es war eine Verfassungsänderung, die wir beschlossen haben, keine Leerstandsabgabe. Schauen wir uns aber einmal an: Was leisten denn Millionäre, Milliardäre – es geht bei Ihnen um Milliardäre – für Österreich? – Sie leisten einen wertvollen Beitrag zum Sozialsystem, sie schaffen Zehntausende Arbeitsplätze.
Ich habe mir angeschaut, wer die sind. Wenn man es genau anschaut: Wer sind denn die eigentlich? – Das sind großteils Selfmademilliardäre in erster oder
zweiter Generation. Das ist nicht so, wie Sie das darstellen, als wären das irgendwelche – weiß ich nicht – Erdölerben, die sich jetzt gemütlich auf die faule Haut legen. Sie haben dieses Geld selbst verdient, weil sie hochgradig innovativ waren, weil sie fleißig waren, weil sie angepackt haben, weil sie Chancen genutzt haben. (Beifall bei der ÖVP. – Ruf bei der SPÖ: ... Milliarde Euro verdienen! – Zwischenruf des Abg. Koza.)
Was leisten diese Milliardäre für das Land? – Natürlich zahlen sie Abgaben, sie schaffen Arbeitsplätze, sie schaffen aber auch ganz, ganz viel im sozialen Bereich. Überlegen Sie einmal, was die alles sponsern: im Sport, im Kulturbereich, im karitativen Bereich. Schauen Sie sich einfach die Liste an und schauen Sie, was die alle tun, zusätzlich zu dem, dass sie ohnehin Steuern zahlen! (Zwischenruf der Abg. Erasim.)
Schauen wir uns das an: Dieses Bashing hat ja eine lange Geschichte. Schauen Sie sich die Milliardäre der Vergangenheit in Österreich an! Gehen Sie die Ringstraße entlang: Keines dieser Palais, keiner dieser Prachtbauten würde ohne den Exzellenzanspruch dieser Gruppe existieren. Wir hätten kein Naturhistorisches Museum, Kunsthistorisches Museum, und selbst wenn die Häuser stehen würden, wären keine Exponate drinnen – weil diese Menschen, großteils übrigens mit jüdischen Wurzeln, etwas hinterlassen haben.
Die Eskeles, die Wertheims dieser Welt, und wie sie alle heißen, leicht haben es die in Österreich nie gehabt, das wissen Sie ganz genau! Sie haben trotzdem die Extrameile genommen, sie sind trotzdem den Weg gegangen, und sie haben den Kulturschatz, den wir heute hier haben, hinterlassen. (Zwischenruf des Abg. Stöger.) Das ist das, worauf Sie mitunter hinhauen, weil die Milliardäre von heute wiederum viele, viele Schätze für uns, für die Zukunft hinterlassen. (Beifall bei der ÖVP.)
So, kommen wir jetzt noch zum zweiten Satzteil, Sie sagen: „als Menschen, die arbeiten“. – Diese Menschen haben gearbeitet, und ich will wirklich, dass Sie das wahrnehmen. (Ruf bei der FPÖ: Das interessiert die Wenigverdiener sicher, was Sie
da sagen!) Schauen Sie sich bitte diese Familien an, was die gearbeitet haben! Das sind Riesenunternehmen, auf die wir stolz sein können! Und es ist nicht leicht, sie zu halten. Sie haben es vielleicht gesehen: Der thailändische Mehrheitseigentümer von Red Bull überlegt, den Standort Fuschl in Österreich zu schließen. Ja, wollen wir Unternehmen wie Red Bull verlieren? – Ich will es nicht. Der Wings-for-Life-Run letzte Woche: Sehen Sie, was diese Menschen für uns leisten? (Abg. Herr: Redezeit!) Wir brauchen mehr von diesen Menschen und nicht weniger. (Beifall bei der ÖVP.)
Ich möchte mich heute bei diesen zehn bis 15 Menschen und ihren Familien – vielleicht sieht es der eine oder andere – offiziell im Namen der Volkspartei entschuldigen, dass sie in diesem Land so behandelt werden. – Sie haben das nicht verdient, ich danke Ihnen für Ihr Engagement und ich bitte Sie, zu bleiben. (Beifall bei der ÖVP.)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Den Schlusssatz bitte!
Abgeordnete Mag. Carmen Jeitler-Cincelli, BA (fortsetzend): Wir brauchen eine Signalkultur an Menschen, die es wagen, groß zu träumen, die sagen: Hey, ich brauche einen Standort für das! (Rufe bei der SPÖ: Redezeit! Redezeit!) Und ich will, dass wir eine Kultur schaffen, in der die Leute daran glauben können, dass das bei uns in Österreich möglich ist – damit es mehr werden als drei von 1 000.
Abschließend: Meine Mama hat meinem Bruder und mir, als wir klein waren, immer einen Satz mitgegeben (Abg. Herr: Redezeit, entschuldigen Sie!); Sie hat immer gesagt: Wenn es - -
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Frau Abgeordnete, Sie sind über 1 Minute drüber – ich bitte, zum Schlusssatz zu kommen. (Abg. Belakowitsch: ... spannend, Familiengeschichte!)
Abgeordnete Mag. Carmen Jeitler-Cincelli, BA (fortsetzend): Meine Mama hat immer gesagt: Carmen, wenn es einigen wenigen sehr, sehr gut geht, nur dann kann es uns allen gut gehen! (Ruf bei der SPÖ: Um Himmels willen!)
Ich danke meiner Mama, dass sie uns nicht Neid und Missgunst mitgegeben hat, sondern Respekt und Wertschätzung vor der Leistung von anderen. – Danke, Mama. (Beifall bei der ÖVP sowie des Abg. Loacker. – Ruf bei der SPÖ: Zurück zum Feudalismus, oder?!)
10.02
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordnete Herr. – Bitte.
Abgeordnete Julia Elisabeth Herr (SPÖ): Puh, also nach dieser Rede ist es jetzt fast schwierig, anzuschließen: Die Mama hat immer gesagt, wenn es einigen wenigen gut geht, dann geht es uns allen gut! – Wenn es einigen wenigen gut geht, geht es einigen wenigen gut, aber das bedeutet überhaupt nicht automatisch, dass es allen in diesem Land gut geht. (Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordneten der Grünen.)
Ich darf vielleicht auch gleich eine Zahl bringen, diesbezüglich aufklären: Es gibt in Österreich geschätzt – genau wissen wir es ja nicht, das verhindert die ÖVP – 300 000 Millionäre und Millionärinnen. Also das ist schon eine andere Zahl als die 15, die Sie da zitiert haben. Es gibt in diesem Land sehr viele Millionäre und Millionärinnen (Zwischenruf des Abg. Shetty – Abg. Belakowitsch: Aber es steht „Milliardäre“ drauf!), und – und das ist das Thema, auf das wir hoffentlich zurückkommen können – wir wissen, statistisch, Millionäre zahlen weniger Steuern als ein durchschnittlicher Arbeitnehmer – und das ist der politische Skandal. Darum geht es. (Beifall bei der SPÖ. – Zwischenruf des Abg. Shetty. – Abg. Kickl: Aber da am Zettel steht „Milliardäre“ drauf!)
Jeder normale Mensch, der arbeiten geht – eine Pflegekraft, ein Schlosser, ein Programmierer, eine Lehrerin, eine Polizistin –, jeder, der einen normalen Job in Österreich ausübt, zahlt von 100 Euro, die er verdient, 40 Euro Steuern und Abgaben. Bei einem Millionär, bei einer Millionärin sind das 20 Euro (Abg. Belakowitsch: Wie ist das beim Milliardär ...?) Steuern und Abgaben. – Das sind die
Zahlen des Finanzministeriums, liebe ÖVP-Abgeordnete; Zahlen des Finanzministeriums, vielleicht nehmen Sie die endlich einmal ernst. Diese sind nämlich jetzt durch den Untersuchungsausschuss ans Licht gekommen. Die ÖVP hat es ja eh geschafft, die bis jetzt in der Schublade verschimmeln zu lassen, damit die Öffentlichkeit ja nicht darüber diskutieren kann. Wir bringen es auf die Tagesordnung. (Beifall bei der SPÖ.)
Es läuft einfach etwas schief, wenn das so ist, da haben wir ein Problem mit Gerechtigkeit, und das ist aus ganz vielen verschiedenen Gründen der Fall. Ich kann jetzt – die Zeit ist knapp – nur auf einen eingehen, und zwar: weil Menschen, die sehr viel Geld haben, das zum Beispiel in Stiftungen parken können, in Privatstiftungen.
Wenn wir uns anschauen, wie oft so eine Privatstiftung kontrolliert wird, sehen wir: im Schnitt nie. 70 Prozent der Privatstiftungen werden nie kontrolliert. Da schaut niemand hin. (Abg. Kickl: Sagt das der Gusenbauer? – Abg. Loacker: Aber der Stiftung gehört ein Unternehmen, und das wird kontrolliert!) Wenn jemand von uns eine Steuer abzuführen hat und 50 Cent zu wenig überweist, wird das vom Finanzamt beanstandet – zu Recht –; aber dort, wo es um besonders viel Geld geht, wo wir wissen, dass es Steuerbetrug gibt, und zwar tagtäglich, schauen wir nicht hin?! – Das kann man doch niemandem erklären. (Beifall bei der SPÖ.)
Das ist ganz bewusst so gestaltet. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen zu Hause, damit Sie wissen, wovon wir sprechen: Es gibt in Österreich mehr Privatstiftungen als Fußballvereine. Also da kann man sich dann schon zusammenrechnen, auf wie viel Geld man kommen würde, wenn man dort einmal genau hinschauen würde. Im Übrigen – und das sagen auch nicht wir als SPÖ, das sagt der Rechnungshof – würde eine Person mehr, ein Arbeitnehmer mehr, der dort – in der Kontrolle sozusagen – angestellt wird und sich diese Privatstiftungen genau anschaut, 2 Millionen Euro mehr Budget einbringen. Das sind die Zahlen, von denen wir sprechen.
Das hat aber System. Es kommt nicht von irgendwoher, dass wir alle gemeinsam, die österreichischen Steuerzahler und Steuerzahlerinnen, Herrn Benko ein Flugzeug subventioniert haben. Einem der reichsten Menschen dieser Welt haben wir mit 9 Millionen Euro sein Flugzeug subventioniert. Das Geld hätten wir ins Gesundheitssystem, ins Bildungssystem stecken können, damit hätten wir mehr Ärzte und Ärztinnen, die wir so dringend brauchen, ausbilden können. – Nein, wir geben das Geld unter Führung des ÖVP-Finanzministeriums René Benko. Das klingt wie ein schlechter Witz, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, aber das ist an der Tagesordnung – und das müssen wir unterbinden. (Beifall bei der SPÖ.)
Noch ein Highlight: Kollegin Belakowitsch von der FPÖ stellt sich dann raus und sagt: Das interessiert ja niemanden, dass wir da mit 9 Millionen Euro Steuergeld einen der reichsten Menschen subventionieren; das ist ja in Wirklichkeit jedem wurscht! – Ja, okay, da muss man auch nur zweimal nachdenken, warum die FPÖ solch eine Position bezieht. Ich habe heute wieder in der Zeitung gelesen: „Kickl cashte im Monat 24 000 €“. (Ruf bei den Grünen: Oi, oi, oi, oi, oi!) – Vielleicht will er sie nicht zahlen, die Millionärssteuer, vielleicht will er selber sein Vermögen nicht gerecht besteuern (Beifall bei der SPÖ – Zwischenruf des Abg. Kickl), daher kommt wahrscheinlich diese Position. Der Gagenkaiser Kickl will halt auch den fairen Beitrag offensichtlich nicht zahlen. (Abg. Kickl: Ah ja, ich glaube, ich habe mehr Steuern gezahlt als Sie! – Ruf bei der SPÖ: Dann ladet er uns ein! – Abg. Holzleitner: Das liegt am Alter, Herr Kickl!)
Ich sage Ihnen aber: Als SPÖ sind wir angetreten, um diese Missstände nicht nur zu benennen, sondern auch, um sie zu beheben. Wir werden dafür sorgen, dass Multimillionäre und Konzerne (Abg. Kickl: Schmeißt einmal den Gusenbauer raus, dann kann man weiterreden! – Ruf bei der SPÖ: Der ist nicht da! Der ist schon lange weg! Du sitzt aber noch da!) ihre Millionen nicht mehr in irgendwelche Steuersümpfe stecken können, in irgendwelche Privatstiftungen; wir werden einfordern, dass sie ihren fairen Beitrag leisten, genau wie alle anderen auch. (Abg. Kickl: Der oberste Hütchenspieler ... Benko! – Ruf bei der SPÖ: Du sitzt noch da!)
Kurz und Kickl haben in der schwarz-blauen Koalition im Übrigen die Taskforce abgeschafft, die nachspüren soll, ob die Superreichen Steuerbetrug betreiben. – Ja, Herr Kickl, diese Taskforce haben Sie mit abgeschafft. Wir werden sie wieder einführen (Beifall bei der SPÖ – Abg. Kickl: Ihr werdet gar nichts! – Abg. Belakowitsch: ... Wählerinnen und Wähler ...!), weil es auch eine Frage des Respekts ist: Respekt gegenüber all jenen, die jeden Tag ihre Steuern zahlen, Respekt gegenüber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern (Abg. Kickl: Wenn man das Manifest der Kommunistischen Partei hernimmt, dann steht da drin genau das gleiche Glumpert!); für sie werden wir endlich wieder einen respektvollen Umgang mit Steuergeld einführen – das ist Politik mit Herz und mit Hirn. – Vielen Dank. (Beifall bei der SPÖ.)
10.08
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Kassegger. – Bitte. (Abg. Kickl: Volkskommissarin! – Ruf bei der SPÖ: Bitte? – Abg. Kickl: Volkskommissarin Herr war am Wort!)
Abgeordneter MMMag. Dr. Axel Kassegger (FPÖ): Ja, Politik mit Herz und Hirn, aber mit einem vollkommenen Verlust, was den Bezug zur Realität betrifft. (Abg. Krainer: Sagt der Vorsitzende der Freiheitlichen in Graz!) Das ist ja ein Ideologieinferno bei der SPÖ, seit Herr Babler die Partei übernommen, der ja Marx super findet, der glaubt, wir pushen das Land, indem wir eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich einführen, der die Reichen - - Das war ja sehr interessant: Sie reden in dem Antrag von Milliardären, Kollegin Herr redet aber nur von Millionären. Da gibt es was zu holen. (Abg. Holzleitner: Das ist eine Aktuelle Stunde, kein Antrag!) – Ja, Aktuelle Stunde, ist ja egal. (Abg. Holzleitner: So geht ihr also mit dem Parlament um! – Abg. Leichtfried: Ein bissl Genauigkeit ...!)
Also Sie suchen krampfhaft Leute, denen man noch Eigentum wegnehmen kann, und glauben allen Ernstes, dass das eine nachhaltige Zukunftsperspektive für
unser Land ist. Wachen Sie auf, das ist doch ein vollkommener Irrweg! (Beifall bei der FPÖ.)
Ich weiß nicht, was Sie in der Schule gelernt haben (Abg. Leichtfried: Diese Rede ist gleich lustig wie die Finanzen der FPÖ Graz!), aber der Marxismus hat ja schon in der Geschichte Gelegenheit gehabt, zu beweisen, dass er zu Verarmung und Leid führt und an sich eine unmenschliche Ideologie ist. (Ruf bei der SPÖ: ... Einkommensteuer ...!) Sie entdecken ihn jetzt wieder neu und versuchen, den Österreichern zu verkaufen, dass das die Lösung ist. – Das ist überhaupt nicht die Lösung, sondern ein vollkommen falscher Weg. Ich bin da wirklich besorgt.
Sie reden von den Stiftungen, die sind jetzt auch noch auszusackeln. Kollege Lacina zum Beispiel, das war noch ein anderer Sozialdemokrat: Der hat nämlich in den Neunzigerjahren (Abg. Kickl: Der hat noch ...!) ein gutes Stiftungsmodell für die SPÖ gemacht, das im Übrigen in den letzten Jahren jetzt beschnitten wurde. (Beifall bei der FPÖ und bei Abgeordneten der NEOS.)
Überlegen Sie einmal, wo die Stiftungen ihr Geld parken: Das sind ja in der Mehrzahl Unternehmensbeteiligungen. Dann sagen Sie irgendetwas wie: Wir müssen das Eigenkapital stärken!, und gleichzeitig wollen Sie die Stiftungen vertreiben – das geht sich alles von der Logik her nicht aus.
Dann kommt Kollege Wöginger, wobei ich sage: Wenn jetzt jemand zuschaut, kennt sich der auch nicht mehr aus. Kollege Wöginger erklärt uns, was Sie von der ÖVP alles machen werden, wenn Sie einmal den Kanzler stellen, beziehungsweise sagt auch die Frau Staatssekretärin, was Sie alles machen werden, wenn Sie den Kanzler stellen. Ich weiß nicht, habe ich jetzt in den letzten Jahren etwas übersehen? – Sie sind seit 35 Jahren in der Regierung und sind auf der langen Ebene (Abg. Leichtfried: Kollege Kassegger ...!) für die Politik, die Wirtschaftspolitik verantwortlich, die in vielen Bereichen ja eine vollkommene Fehlpolitik war.
In der Coronapolitik – Kollegin Belakowitsch hat es schon gesagt –: Sie sperren die Unternehmen zu, vollkommen überschießend, und gehen dann mit der
Gießkanne herum und verteilen Milliarden, die wir nicht haben. Der ÖVP-Finanzminister - - (Abg. Leichtfried: Herr Kollege Kassegger, 38 Jahre, nicht 35!) – Unterbrechen Sie mich nicht, Herr Kollege, Sie kommen dann eh noch dran!
Finanzminister Brunner von der ÖVP ist der Rekordbudgetdefizitfinanzminister, und Sie versuchen, den Leuten zu erklären, Sie seien die Wirtschaftspartei; die sind sie ja schon lange nicht mehr. Die Schuldenpolitik, die Sanktionspolitik: Da sind Sie sich ja auch einig.
Die Klimapolitik – Kollegin Belakowitsch hat es auch schon gesagt –, der Irrsinn, der da seitens der Europäischen Union stattfindet, wird von Frau von der Leyen vorangetrieben, und die ist meines Wissens von der Europäischen Volkspartei. Also versuchen Sie nicht, das jetzt den Grünen unterzuschieben! Das ist (in Richtung Abg. Jeitler-Cincelli) Ihre Partei, Kollegin (Beifall bei der FPÖ), die – aus einer Ideologie heraus: Wir wollen die Welt retten! – diese wohlstandsvernichtende Politik betreibt. Kommen Sie doch zurück in die Realität! Machen Sie Politik für die Menschen, für die Österreicher (Abg. Hörl: ... Menschen in Österreich!) und nicht für ideologische Hirngespinste, indem Sie versuchen, die Welt zu retten!
Da gäbe es noch viel zu tun. Machen Sie eine vernünftige Energiepolitik, eine Standortpolitik, die verlässliche, günstige Energie sicherstellt! Machen Sie eine vernünftige Politik, die die Produktivität in unserem Land wieder erhöht! Da muss man bei der Leistungsfähigkeit und bei der Leistungsbereitschaft ansetzen. Da sind wir bei der Bildungspolitik – und die Lösung wird nicht sein: Keiner darf zurückgelassen werden!, was dazu führt, dass wir eine Bildungspolitik haben, die sich nach unten nivelliert; da sehe ich auch überhaupt keinen Unterschied zwischen ÖVP und SPÖ –, das wäre eine vernünftige Politik.
Finger weg vom Eigentum! Eigentum ist Freiheit. (Beifall bei der FPÖ.) Das sage ich (in Richtung SPÖ) in diese Richtung, aber auch (in Richtung ÖVP) zu Ihnen: Finger weg vom Eigentum! Das ist ja das Wesentliche unseres Wirtschaftssystems: die Möglichkeit, Eigentum zu schaffen, zu erhalten und an seine
Liebsten, also seine Kinder, weiterzugeben, ohne dass der gierige Moloch Staat da reingreift und sich wieder etwas holt. – Das ist doch eine vollkommen falsche Politik, die Sie machen beziehungsweise in Aussicht stellen.
Ein letzter Satz noch: Wir haben ja im September Wahlen. Kollege Wöginger hat es schon gesagt: Nach der Wahl werden (in Richtung ÖVP) Sie alles das, was die Frau Staatssekretärin und Kollege Wöginger hier sagen, dann umsetzen. Da frage ich mich: Mit wem? Mit der SPÖ? Das geht sich doch von der Logik her überhaupt nicht aus. Da müssen Sie schon den Leuten reinen Wein einschenken: Was wollen Sie jetzt? Mit der SPÖ geht sich das ja überhaupt nicht aus. (Beifall bei der FPÖ. – Abg. Leichtfried: Es waren 38 Jahre!)
10.13
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Koza. – Bitte sehr.
Abgeordneter Mag. Markus Koza (Grüne): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Staatssekretärin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! „Wieso zahlen in Österreich Milliardäre weniger Steuern als Menschen, die arbeiten gehen, Herr Bundeskanzler?“ – So lautet die Frage der SPÖ, die sie anlässlich der Aktuellen Stunde stellt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Antwort ist einfach ganz simpel: weil die SPÖ gemeinsam mit der ÖVP im Jahr 1993 die Vermögensteuer abgeschafft hat. (Beifall bei den Grünen.)
Das ist richtig. Sie hat 1993 unter einem Bundeskanzler Vranitzky und einem Finanzminister Lacina nicht nur die Vermögensteuer abgeschafft, sie hat auch die Privatstiftungen, die steuerlich privilegiert sind, eingeführt – Privatstiftungen, die insbesondere dazu gedient haben, deutsches Vermögen, deutsches Kapital mit dem Versprechen, dass es hier steuerschonend angelegt werden darf, nach Österreich zu ziehen. Das ist damals gefeiert worden, selbstverständlich unter großem Protest aus Deutschland.
Und nicht nur, dass die Vermögensteuer abgeschafft worden ist und die Privatstiftungen eingeführt worden sind, es ist auch noch das sogenannte Endbesteuerungsgesetz von SPÖ und ÖVP mit Zweidrittelmehrheit eingeführt worden, was es mehr oder weniger vollkommen verunmöglicht, weil wir eine Zweidrittelmehrheit brauchen, eine allgemeine Vermögenssteuer auf große Finanzvermögen einzuführen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das sind leider aktuell die Fakten, und das weiß natürlich auch die SPÖ. (Abg. Herr: Das war 1994!) Das Problem ist: Ich kann mich halt leider daran erinnern, weil ich alt genug dafür bin, wie das damals war. (Abg. Leichtfried: ... das einzig Richtige ...!)
Nichtsdestotrotz ist es aber natürlich vollkommen richtig, wenn die SPÖ, die Arbeiterkammer, der ÖGB, wir und andere auch eine höhere Besteuerung von Vermögen fordern. Wir sind da auch in bester Gesellschaft mit der OECD, mit der Europäischen Kommission, mit dem Währungsfonds, mit der Weltbank, die nämlich sehr intelligente Ideen haben, wenn sie über unsere Steuerstruktur sprechen und Steuerstrukturreformen vorschlagen. Die sagen nämlich: Senkt doch bitte die Steuern auf Arbeit und erhöht im Gegenzug die Steuern auf Umweltverbrauch und auf Vermögen! Das sind sehr sinnvolle Ideen von Organisationen, die wirklich weder Linksaußen, noch besonders marxistisch oder sonst etwas, sondern einfach sehr vernünftig sind. (Beifall bei den Grünen.)
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Den ersten Schritt haben wir ja bereits mit der ökosozialen Steuerreform gesetzt, nämlich die Ökologisierung des Steuersystems mit dem CO2-Preis und mit dem Klimabonus, der einen sozialen Ausgleich schafft. Jetzt müssen einfach in den kommenden Jahren die nächsten Schritte zu einer vernünftigen Steuerstrukturreform gesetzt werden, nämlich in Richtung von vermögensbezogenen Steuern. Trotz Endbesteuerungsgesetz können wir natürlich im Bereich der vermögensbezogenen Steuern schon einiges machen, und das sollten wir auch tun. Das ist nicht nur eine Frage der Steuergerechtigkeit, sondern auch eine Frage der Leistungsfähigkeit, dass nämlich diejenigen, die die breitesten Schultern haben, auch diejenigen sein sollten, die
die größte Last tragen. Vermögenssteuern sind auch konjunkturpolitisch relativ sinnvoll (Abg. Hörl: Reiner Kommunismus!), weil sie die geringsten negativen Auswirkungen auf die Konjunktur, auf die Nachfrage haben.
Vor allem werden uns von OECD, von Weltbank und so weiter immer wieder Erbschafts- und Schenkungssteuern empfohlen, weil die nämlich laut OECD die Vermögenskonzentration verringern, zu mehr Chancengerechtigkeit führen – man höre und staune! – und leichter und effizienter einzuheben sind als andere Vermögenssteuern. Darum gibt es von uns Grünen auch ein ganz klares Bekenntnis zu sozial gerechten und fairen Erbschaftssteuern auf Millionenvermögen. (Beifall bei den Grünen.)
Wenn man sich das anschaut: In Deutschland beispielsweise brachte die Erbschaftssteuer im Jahr 2022 insgesamt 11 Milliarden Euro ein. Wenn man das auf Österreich herunterbricht, zeigt sich: Wir hätten hier ein Potenzial von circa 1 Milliarde Euro. Das könnte man wunderbar verwenden, einerseits um Arbeit weiter zu entlasten, aber andererseits auch um Gelder für Pflege und Klimaschutz zu bekommen.
Reden wir aber nicht nur über Vermögen an sich, reden wir bitte auch über Vermögenseinkünfte, reden wir über Kapitaleinkünfte: Hier herinnen wird immer wieder darüber gesprochen, dass man doch bitte die Lohnnebenkosten senken sollte. – Ja, wir waren immer offen für eine sinnvolle Debatte darüber, dass wir Arbeit entlasten, wenn die Gegenfinanzierung passt und wenn es auch gescheite Maßnahmen sind. Eine Möglichkeit wäre doch zum Beispiel: Warum finanzieren wir unsere Krankenversicherungen nur aus Lohn- und Arbeitseinkommen? Warum verbreitern wir da nicht die Grundlage, die Bemessungsgrundlage, und ziehen auch Einkommen aus Vermietung, aus Verpachtung, Zinseinkommen, Dividendeneinkommen zur Finanzierung unseres Krankenversicherungssystems heran? Diese sind in Wirklichkeit gegenüber Lohneinkommen steuerlich privilegiert, und es wäre nur ein Akt der Fairness, der Gerechtigkeit und für die stabile Finanzierung unserer Gesundheitssysteme. (Beifall bei den Grünen.)
Zuletzt, weil so viel vom Thema Bodenverbrauch die Rede ist: Mit einer ordentlichen, gescheiten, sinnvollen Bodenverbrauchsabgabe könnten wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Diese hat nämlich einen ökologischen Aspekt und einen Vermögensaspekt (Abg. Schroll – in Richtung ÖVP weisend –: Da drüben ist der Regierungspartner!), weil dann nämlich in Wirklichkeit diejenigen, die viel versiegeln, die viel Fläche versiegeln, die viel Grünraum nehmen, sich klimaschädlich verhalten, eine entsprechend höhere Steuer zahlen und andererseits diejenigen, die beispielsweise entsiegeln, dann auch einen entsprechenden Bonus bekommen. (Abg. Schroll – in Richtung ÖVP weisend –: Da drüben sind sie!) Dafür gibt es Beispiele, dafür gibt es auch Modelle, dazu gibt es Studien, das hat beispielsweise die TU vor Kurzem berechnet. Das ist sehr sinnvoll, das kann man sich anschauen, das ist eine wunderbare Kombination von ökologischer Frage und Verteilungsfrage.
Zum Schluss: Trotz Endbesteuerungsgesetz haben wir Handlungsspielräume für vermögensbezogene Steuern, und diese Spielräume gilt es auch zu nutzen, nämlich im Sinne der Steuergerechtigkeit, im Sinne der Chancengerechtigkeit und im Sinne von mehr Fairness in unserem Steuersystem. – Danke. (Beifall bei den Grünen.)
10.19
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Loacker. – Bitte sehr.
Abgeordneter Mag. Gerald Loacker (NEOS): Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Staatssekretärin! Hohes Haus! Wenn Sie Kollegen Koza zuhören, dann bekommen Sie das Gefühl: Eine Steuer noch – eine Steuer noch! – und dann haben wir es geschafft, dann sind wir im Paradies! Wir haben in Österreich die dritthöchste Abgabenquote in der Europäischen Union, aber jetzt brauchen wir noch eine Erbschaftssteuer und eine Vermögensteuer, und dann haben wir es aber, dann ist es schön!
Das ist aber eine Illusion. Koza hat selbst gesagt, in seiner optimistischen Annahme macht er mit Erbschafts- und Vermögensteuern 1 Milliarde Euro, und damit will er die Arbeit entlasten. Wissen Sie, Lohn- und Einkommensteuer miteinander sind ungefähr 40 Milliarden Euro. Wenn das funktionieren würde, was Sie sagen, dann würde die Arbeit also um ein Vierzigstel entlastet – das merken Sie auf Ihrem Lohnzettel gar nicht. Das sehen Sie gar nicht! Das ist eine Illusion, die Ihnen von den Linken vorgemalt wird.
Tatsache ist aber – und damit komme ich zum Thema, das die Roten gewählt haben –, dass jene, die bei uns wirklich viel Geld haben, auch wirklich viel Steuern zahlen. Das oberste Prozent der Lohn- und Einkommensteuerzahler (Abg. Matznetter: Wir reden da vom Vermögen, Herr Kollege!) leistet 16 Prozent des Gesamtaufkommens, und die obersten 10 Prozent der Lohn- und Einkommensteuerzahler (Abg. Matznetter: Können Sie den Unterschied zwischen Lohn und Vermögen ...!) – Kollege Matznetter, Sie kommen ja aus dem Steuerrecht, Sie wissen es ja – bestreiten 51 Prozent, mehr als die Hälfte des Gesamtaufkommens. (Abg. Matznetter: Nein! Sie haben keine Ahnung!) – Ja, das ist Matznetter nicht recht, wenn man mit Zahlen die eigene Schmierage aufdeckt, die Sie uns da in der Aktuellen Stunde geliefert haben. Das hält ja einer sachlichen Betrachtung nicht Stand! (Beifall bei den NEOS und bei Abgeordneten der ÖVP. – Anhaltende Zwischenrufe des Abg. Matznetter.) – Kollege Matznetter, halten Sie einfach einmal für 10 Sekunden die Luft an! Wenn ich für jeden Zwischenruf von Ihnen 1 Euro bekäme, müsste ich nie mehr arbeiten. (Beifall bei den NEOS sowie bei Abgeordneten von ÖVP und FPÖ. – Abg. Leichtfried: Der Kollege Matznetter hat schon ... Jahrhundertrecht!)
Vermögen liegt ja nicht irgendwo auf dem Sparbuch, wie sich die SPÖ das vorstellt, und dann besteuern wir es. (Neuerlicher Zwischenruf des Abg. Matznetter.) Das Vermögen der wirklich reichen Leute in Österreich besteht aus Unternehmensanteilen. Diesen gehört eine Firma oder der Teil einer Firma oder es gehört ihnen ein Hotel (Zwischenruf des Abg. Hörl), und das können Sie nicht einfach so mir nichts, dir nichts wegbesteuern.
Wenn jemand sehr viel Geld hat, kann er sich ja immer überlegen: Was mache ich damit? – Er kann es aufs Sparbuch legen – das wird er in der Regel nicht tun. Er kann sich Unternehmensanteile kaufen. Er kann selbst ein Unternehmen gründen, er kann Immobilien bauen und dann Wohnungen vermieten, und das alles dient dann anderen Leuten, weil er mit seinem Geld etwas macht. (Zwischenruf des Abg. Hörl.) Wir müssen ein Interesse haben, dass Menschen Geld haben, das sie investieren können. Damit ist in der Wirtschaft dann auch etwas los und das schafft Jobs. (Beifall bei den NEOS, bei Abgeordneten der ÖVP sowie des Abg. Amesbauer.)
Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer! Wenn Kollegin Herr herauskommt und sagt, wir haben so und so viele Millionäre in Österreich, dann frage ich mich: Wie stellt sie das fest? (Abg. Herr: Geschätzt!) Wann ist jemand Millionär? Diese Zahlen sind alles Schätzungen, auf die Sie sich beziehen. (Abg. Herr: Habe ich gesagt!) Ich kann Ihnen sagen, wer nicht dabei ist: Da sind die ganzen Roten nicht dabei, die sich einen Kleingarten an der Donau unter den Nagel gerissen haben. (Beifall bei den NEOS sowie bei Abgeordneten von ÖVP und FPÖ.)
Bei Ihren Schätzungen sind auch die Arbeiterkämmerer nicht dabei, die einen Anspruch auf eine Zusatzpension haben. Bewerten Sie das einmal! (Abg. Schroll: Euer Haselsteiner ist dabei!) Rechnen Sie einen Barwert aus, wenn so ein dicker Fisch von der Arbeiterkammer einen Anspruch auf eine Zusatzpension von 5 000 Euro hat! (Abg. Schroll: Der Haselsteiner ist dabei!) Kapitalisieren Sie das einmal, rechnen Sie den Barwert aus! Der ist ein Millionär. (Abg. Leichtfried: Das ist ein Viertel vom ...!) Das sind Ihre Roten, die in der ÖGK arbeiten und eine Zusatzpension bekommen (Zwischenruf des Abg. Matznetter), die in der Nationalbank arbeiten und eine Zusatzpension bekommen. Das sind Ihre Parteifreunde, das sind Millionäre – das bewerten Sie nicht! Sie bewerten nur Unternehmen. (Beifall bei den NEOS, bei Abgeordneten der FPÖ sowie des Abg. Obernosterer.)
Jetzt komme ich noch zu den Stiftungen. Kollegin Herr sagt, Stiftungen werden nicht genug kontrolliert. – Ja, aber der Stiftung gehört etwas. Der Stiftung
gehören Unternehmensanteile. (Zwischenruf des Abg. Matznetter.) Das Unternehmen wird aber ja ständig geprüft. In die Stiftung kommt ja kein Geld, das aus einem Unternehmen käme, das nicht geprüft wird. Sie haben leider keine Ahnung, wie das in Österreich funktioniert. (Abg. Matznetter: Ich habe eine Ahnung!) Sie haben keine Ahnung, wie Wirtschaft funktioniert. (Beifall bei NEOS und ÖVP. – Abg. Herr: Nein, ... Finanzbeamtin sagt, es braucht mehr Kontrollen!)
Dann kommt Kollegin Herr und sagt, es gebe mehr Stiftungen als Fußballvereine. Der sozialdemokratische Finanzminister Lacina hat verstanden, dass es super ist, wenn man ein paar Prozent von verdammt viel Geld bekommt, und hat Leute nach Österreich gelockt, die hier Stiftungen gegründet haben. Er hat deutsches Geld hierhergeholt und hat sich gedacht: Ich nehme mir ein paar Prozent von diesen deutschen Milliarden, das ist besser als viele Prozent Vermögensteuer von nichts! – Das hat Lacina verstanden, ein roter Finanzminister. Das war ein Schüler von Bruno Kreisky, der verstanden hat, wie Wirtschaft funktioniert und das gegründet hat. Sie aber verstehen es nicht mehr. Die Wissensweitergabe innerhalb der SPÖ ist gescheitert, und das ist die Tragödie des heutigen Tages. (Beifall bei NEOS, ÖVP und FPÖ.)
10.24
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Nach dem Geschenk von 11 Sekunden ist die Debatte jetzt geschlossen.
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Wir kommen nunmehr zur Aktuellen Europastunde mit dem Thema:
„EU-Wahnsinn stoppen – Festung Europa als Garant für Sicherheit, Wohlstand, Frieden und Freiheit“
Ich begrüße dazu die Abgeordneten zum Europäischen Parlament, so sie schon alle da sind: Karas, Vilimsky, Gamon, Schieder und Thomas Waitz.
Als Erste ist Frau Abgeordnete Steger zu Wort gemeldet. – Sie wissen, Sie haben 10 Minuten Redezeit.
Abgeordnete Petra Steger (FPÖ): Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Bundesministerin! Sehr geehrte Frau Staatssekretärin! Hohes Haus! „EU-Wahnsinn stoppen – Festung Europa als Garant für Sicherheit, Wohlstand, Frieden und Freiheit“ – das ist der Titel unserer heutigen Aktuellen Europastunde. Genau das trifft es auch auf den Punkt, denn das, was die Europäische Union, sprich die Politiker Europas, machen, den Kurs, den die Europäische Union in den letzten Jahren eingeschlagen hat, den Kurs, den alle anderen Parteien in diesem Haus seit Jahren mittragen, die vielen Fehlentwicklungen, die wir mittlerweile erleben, kann man nur noch als absoluten Wahnsinn bezeichnen. Es ist höchste Zeit, mit den kommenden EU-Wahlen diesem Wahnsinn endlich ein Ende zu setzen. (Beifall bei der FPÖ.)
Die Europäische Union ist mittlerweile nichts anderes als ein Projekt der Entfremdung vom eigentlichen, vom ursprünglichen Zweck, anstatt dass sie sich auf die wesentlichen Dinge konzentriert: auf die Sicherung von Frieden, Freiheit und Wohlstand und, nicht zu vergessen, auf die Sicherung der Festung Europa, auf die Sicherheit. Das wäre die eigentliche Aufgabe der Europäischen Union, doch da versagt sie auf ganzer Linie.
Wir erleben mittlerweile eine Politik auf EU-Ebene, die man nur noch als eine Art Selbstzerstörung und Selbstaufgabe bezeichnen kann, natürlich immer im Namen irgendwelcher moralisch höheren Ziele, und eine Politik gegen die Interessen der Mitgliedstaaten und damit auch gegen die Interessen der eigenen Bevölkerung. Stolz, moralisch erhobenen Hauptes Richtung Abgrund – so kann man Ihre EU-Politik der vergangenen Jahre bezeichnen. (Beifall bei der FPÖ.)
Ich muss sagen, es ist wirklich einzigartig in der Geschichte, dass die Führung eines Staatenbundes zielstrebig auf den Ruin ihrer eigenen Mitgliedstaaten hinarbeitet. Doch genau das tut die Europäische Union. Mit der Sicherheit, der
Wettbewerbsfähigkeit, der Wirtschaft und der Industrie und damit auch dem Wohlstand geht es in Europa stetig bergab. Mit den Asylzahlen, den Schulden und der Kriegstreiberei geht es stetig bergauf.
Alle anderen Parteien in diesem Land – diese Einheitspartei, die wir sehen, die sich früher einmal SPÖ, ÖVP, Grüne und NEOS genannt hat – sind in ihrer blinden EU-Hörigkeit seit Jahren überall vorne mit dabei: bei diesem Ausverkauf Österreichs nach Brüssel, bei diesem Drüberfahren über unsere nationalstaatlichen Interessen, auch bei dieser Kriegstreiberei, die wir seit Jahren erleben, und bei diesem unverantwortlichen Umgang mit österreichischem Steuergeld. (Beifall bei der FPÖ.)
Dank der Zustimmung der anderen Parteien in diesem Land zahlen wir immer mehr und mehr und noch mehr an die Europäische Union. Ja, das können die anderen Parteien! Sie können Schulden machen und unser Geld weg von den Österreichern hin in die ganze Welt umverteilen. Das machen sie sowohl national als auch international, wir gehören zu den Melkkühen Europas. Österreich ist einer der wenigen Nettozahlerstaaten. Unser Beitrag hat sich in den vergangenen 20 Jahren verdoppelt (Abg. Loacker – in Richtung der sehr schnell sprechenden Rednerin –: 480 Wörter pro Minute!), und dabei sind die sonstigen Kosten, die Österreich aufgrund des EU-Versagens entstehen, zum Beispiel in Sachen Asyl und Migration, im Sozialsystem, im Bildungssystem, im Gesundheitssystem, oder die ganzen Zahlungen in alle möglichen Sondertöpfe, die jedes Jahr mehr und mehr werden, noch nicht einmal erfasst – Stichwort Makrofinanzhilfe plus, Friedensfazilität, Coronawiederaufbaufonds, um nur ein paar zu nennen. – Ja, wenn es darum geht, neue Schuldentöpfe zu erfinden, ist die Europäische Union immer besonders kreativ.
Trotz höchstem EU-Budget aller Zeiten mit weit über 1 200 Milliarden Euro ist Schwarz-Grün wieder einmal umgefallen und hat erst kürzlich der nächsten gewaltigen Budgeterhöhung um satte 21 Milliarden Euro zugestimmt, und wieder kostet es Österreich Hunderte Millionen Euro mehr. Das kann ich nur
noch als absolut unverantwortlich und als einen Skandal gegenüber den österreichischen Steuerzahlern bezeichnen. (Beifall bei der FPÖ.)
Ja, das kann die Europäische Union: Sie kann Schulden machen und sie kann Wohlstand vernichten. Die EU sorgt nicht mehr für Wohlstand, sondern diese Politik vernichtet ihn mittlerweile. Zuerst mit Coronalockdowns, seit zwei Jahren mit Sanktionen und schon seit vielen Jahren auch mit einer vertragswidrigen EZB-Geldpolitik. Die EZB kauft massenweise marode Staatsanleihen, überschwemmt den Markt mit Geld und heizt die Inflation so auch immer weiter an.
Wir erleben eine EU, die die Wirtschaft und die Industrie mit Bürokratie, mit Überregulierung und vor allem auch mit einem irrationalen Klimafanatismus zerstört, mit dem wir in Wahrheit nicht das Klima schützen, sondern den Verbrauch nur in Drittstaaten umlagern und die eigene Wettbewerbsfähigkeit zerstören. (Beifall bei der FPÖ.)
Das Aus für den Verbrennungsmotor ist das berühmteste Beispiel für diese politische Selbstzerstörung. Die ganze restliche Welt lacht uns mittlerweile für diese Politik aus.
Stichwort Green Deal, Green Desaster, wie wir es nennen, Lieferkettengesetz, Emissionszertifikatehandel, CO2-Steuer, CO2-Grenzausgleichsmechanismus und, und, und: Die gesamte Politik belastet die Unternehmen immer mehr und mehr und heizt damit auch die Inflation immer weiter an. Die ist ja nicht vom Himmel gefallen, sehr geehrte Damen und Herren! Das war eine Inflation mit Anlauf, für jeden offensichtlich, nur nicht für die anderen Parteien in diesem Land. Die EU ist – gemeinsam mit dieser schwarz-grünen Bundesregierung auf nationaler Ebene, die setzt dem Ganzen auch hier in Österreich noch einmal eins oben drauf – der größte Inflationstreiber. Und alle anderen Parteien in diesem Land sind bei all diesen inflationstreibenden Klimaschutzmaßnahmen seit Jahren überall vorne mit dabei. (Beifall bei der FPÖ.)
Genau deswegen, sehr geehrte Damen und Herren, sind Sie auch alle so unglaubwürdig, wenn Sie jetzt versuchen, sich als Kämpfer gegen die Teuerung aufzuspielen – angefangen von der SPÖ bis hin zur ÖVP mit ihrer von der Leyen mit ihrem Prestigeprojekt, dem Green Deal. Sie alle haben das unterstützt. Das geht sich schlicht und ergreifend nicht aus. Wir dagegen haben immer davor gewarnt, wir nennen die Dinge beim Namen. Wir stehen für eine vernünftige Politik, für einen vernünftigen Umweltschutz mit Hausverstand. Das ist für uns Politik – und nicht diese Buckelei vor der Europäischen Union, die sich der Rest dieses Haus anscheinend mittlerweile zur Berufung erklärt hat. (Beifall bei der FPÖ.)
Doch diese Wohlstandvernichtung ist nicht der einzige Skandal. Wir erleben auf EU-Ebene eine unglaubliche Kriegstreiberei. Ich frage mich ja immer: Was ist aus dem angeblichen Friedensprojekt der Europäischen Union geworden? Statt Friedensverhandlungen, statt Friedenspaketen erleben wir ein Sanktionspaket nach dem anderen, immer mehr Zahlungen, immer mehr Waffenlieferungen, eine immer stärkere Kriegstreiberei, immer extremere Forderungen, ein ständiges Drehen an der Eskalationsspirale! (Abg. Brandstätter: Entschuldigung, wer hat den Krieg begonnen? Wer hat den Krieg begonnen? Wer führt Krieg?) Die EU kämpft in einem Krieg – und das will ich hier auch einmal klar und deutlich sagen –, der nicht unserer ist, Herr Kollege Brandstätter, und der auch auf keinen Fall zu unserem werden darf (Abg. Brandstätter: Wer führt Krieg? Wer führt Krieg? Wer führt Krieg?), auch wenn andere das hier gerne anders hätten oder ihn, wie Sie, offensichtlich zu unserem erklären wollen. (Beifall bei der FPÖ. – Abg. Brandstätter: Ich habe keine Antwort bekommen!)
Wir sagen, Österreich ist neutral und Österreich hat auch neutral zu sein. Das schreibt auch unsere Verfassung vor, auch wenn das für Sie offenbar keine Rolle spielt. (Abg. Brandstätter: Wer führt Krieg? – Putin heißt er! Nur damit Sie es wissen!) Deswegen ist es auch so verwerflich, dass diese Bundesregierung unsere Neutralität seit mehr als zwei Jahren mit Füßen tritt und damit auch unsere Sicherheit gefährdet und unseren Wohlstand vernichtet. (Abg. Höfinger: Ein
völliger Quatsch! So ein Blödsinn! ... so ein Zugang!) Sie sind das einzige Sicherheitsrisiko hier in Österreich, in diesem Land. Das will ich Ihnen auch einmal gesagt haben. (Beifall bei der FPÖ.)
Das Ganze – und das ist das Schäbigste – tun Sie, ohne die eigene Bevölkerung jemals gefragt zu haben, ob ihr das überhaupt recht ist, ob sie überhaupt bereit ist, die Kosten dieser Politik zu tragen. Wir dagegen sagen, es muss endlich Schluss sein mit dieser Eskalationspolitik. (Abg. Ernst-Dziedzic: Wer eskaliert denn?) Jeder Krieg wird schlussendlich mit Friedensverhandlungen beendet. Die einzige Frage, die sich stellt, ist, ob diese früher stattfinden oder später. Und je später sie stattfinden, desto mehr Leid, Zerstörung und Tote wird es geben. (Abg. Höfinger: Das ist ja unglaublich! Schreiben Sie Putin einen Brief!)
Aus diesem Grund sagen wir, es muss endlich Schluss sein, wir wollen keinen Krieg in Europa, wir wollen keine Kriegswirtschaft. Wir sind auch nicht dazu bereit, irgendeine Form der Politik zu akzeptieren, die unseren Staatsinteressen, unserer Wirtschaft und unserer eigenen Bevölkerung schadet, denn im Gegensatz zu den anderen Parteien in diesem Land stehen wir auf der Seite der Österreicherinnen und Österreicher. Und wir sind vor allem eines: Wir sind neutral. (Beifall bei der FPÖ.)
Im Bereich Sicherheit versagt die EU jedoch nicht nur in dieser Frage, sondern bis heute ist sie auch nicht in der Lage, für einen effektiven Außengrenzschutz zu sorgen. Noch immer kommen Millionen illegaler Migranten unkontrolliert nach Europa und damit auch Extremisten, Terroristen und Gefährder. Die Auswirkungen können wir alle mittlerweile in Wien erleben, im 10. Bezirk, wo es fast täglich eine Messerstecherei gibt. Diese EU samt der Bundesregierung schaut zu und tut rein gar nichts gegen diese gewaltige Völkerwanderung, die wir mittlerweile erleben. Seit 2015 sind rund acht Millionen illegale Migranten nach Europa gekommen, alleine im letzten Jahr eine Million. Der Großteil geht nach Österreich oder Deutschland, im letzten Jahr 80 000, im Jahr davor über 110 000. Danke, Schwarz-Grün! Danke für diese Österreichvergessenheit!
Danke, dass Sie nicht für Sicherheit und den Schutz unserer eigenen Bevölkerung sorgen!
Nein, stattdessen stimmen Sie einem Asyl- und Migrationspakt zu, zementieren das bestehende System ein! Statt einem echten Außengrenzschutz, statt einer echten Schubumkehr, statt einer klaren und unmissverständlichen Linie (Abg. Höfinger: Na, der ... war so super!) – No Way –, statt einer Festung Europa haben Sie der Flüchtlingsverteilung, der zwangsweisen Verteilung von Flüchtlingen zugestimmt – angeblich ein absolutes No-Go, jahrelang haben Sie gesagt, dass Sie dem nie zustimmen werden. Und wieder einmal sind Sie umgefallen und wieder einmal haben Sie bewiesen, dass, wenn Sie irgendwo sagen, dass Sie nicht dabei sind, es schon fast eine Garantieerklärung dafür ist, dass Sie schlussendlich ganz vorne mit dabei sind. (Beifall bei der FPÖ.)
Sehr geehrte Damen und Herren! Wir erleben eine Fehlentwicklung nach der anderen in dieser EU-Politik. Die Redezeit reicht leider nicht, um alle anzusprechen. Eines möchte ich noch sagen, das besonders verwerflich ist: Wir erleben ein stückweises Aushöhlen unserer Souveränität und unserer Unabhängigkeit. Immer mehr Kompetenzen werden Richtung Brüssel, Richtung Europäische Union geschoben. Sie glauben, dass alles, was zentralisiert, alles, was in Brüssel ist, alles, was eigentlich weiter weg von der österreichischen Bevölkerung ist, irgendwie demokratischer sein soll. Nein, das ist es nicht! Aus diesem Grund sagen wir: Es reicht! Es muss endlich Schluss sein mit dieser Politik gegen die Interessen der eigenen Bevölkerung. Wir brauchen eine Schubumkehr. Wir brauchen eine Hinwendung zum Volk und eine Abwendung von diesen selbsternannten europäischen Eliten in Brüssel. (Beifall bei der FPÖ sowie des MEPs Vilimsky.)
10.35
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist – und ich darf sie recht herzlich begrüßen – Frau Bundesministerin Edtstadler. – Bitte.
10.36
Bundesministerin für EU und Verfassung im Bundeskanzleramt Mag. Karoline Edtstadler: Herr Präsident! Meine sehr geschätzten Damen und Herren Abgeordnete! Geschätzte Zuseherinnen und Zuseher hier im Hohen Haus, aber auch wo immer Sie sich befinden und diese Sendung anschauen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Hohes Haus! Wenn man dieser Tage durch das Land fährt, dann sieht man ein Plakat, das nicht zufällig mit der Überschrift der heutigen Aktuellen Europastunde, nämlich: „EU-Wahnsinn stoppen“, versehen ist. (Abg. Wurm: Ganz genau! So ist es! – Beifall und Bravorufe bei der FPÖ.) Und unter dieser Überschrift „EU-Wahnsinn stoppen“ finden Sie allerlei Unterstellungen (Abg. Belakowitsch: Was zum Beispiel?), die nichts mit der Europäischen Union zu tun haben, sondern Angst schüren, spalten, Verschwörungstheorien weitererzählen (Abg. Kickl: Na, da sind Sie Expertin!), auch Fakenews weitertragen. (Heiterkeit der Abgeordneten Belakowitsch und Wurm.) Es ist also kein Zufall, dass die FPÖ diese Aktuelle Europastunde unter dieses Motto gestellt hat. (Abg. Amesbauer: Danke, dass Sie für unser Plakat werben! – Abg. Belakowitsch: Wie viele Panzer sind durch Österreich gerollt in den letzten beiden Jahren?)
Ich aber sage Ihnen: Ich freue mich, dass wir hier über Europa sprechen können. Der Europatag ist erst wenige Tage her. In wenigen Wochen finden die Wahlen zum Europäischen Parlament statt, und in Österreich jährt sich das Jubiläum des Endes der Verhandlungen Österreichs über den Beitritt zur EU zum dreißigsten Mal. (Abg. Belakowitsch: Na, super! – Abg. Kickl: Und ich möchte auch Kommissarin werden!) Ja, am 12. Juni 1994 haben 66,6 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher klar für Ja gestimmt, für die Europäische Union. (Abg. Amesbauer: Sie schauen, wie Sie Kommissarin werden!) Und das ist gut so, denn wir haben stark davon profitiert. (Abg. Belakowitsch: Sie vielleicht schon, die Österreicher weniger!)
Und, na ja, wenn man sich das so anschaut, ändert auch die FPÖ momentan offensichtlich ihren Kurs. Haben wir vor Kurzem noch von der „Festung Österreich“ gehört, sind Sie davon abgekommen. Ich gratuliere zu dieser Einsicht. Es ist nicht möglich, österreichische Lösungen für große, große
Herausforderungen herbeizuführen. (Abg. Kickl: Das eine ergänzt das andere!) Es braucht ein geeintes Europa. Deshalb plädiert jetzt auch die FPÖ für eine „Festung Europa“. (Abg. Amesbauer: Das haben wir immer schon gesagt!) Sie haben es auch verstanden: Wer nicht dabei ist, kann nicht mitreden.
Es ist gut so, denn bisher sind von Ihnen nur rein nationale Lösungen gekommen. (Abg. Belakowitsch: Von Ihnen sind nicht einmal die gekommen!) Das sind leere Versprechungen, damit streuen Sie den Menschen Sand in die Augen. Wir brauchen den Blick über den Tellerrand, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wenn wir Freiheit, Sicherheit, Wohlstand und Frieden in der Europäischen Union aufrechterhalten wollen, dann müssen wir zusammenhalten. (Abg. Kickl: Schauspielerin sind Sie auch noch eine schlechte! – Abg. Belakowitsch: Gehen Sie wieder singen!)
Warum die Europäische Union das größte Friedensprojekt aller Zeiten ist, zeigt ein Blick in die unmittelbare Nachbarschaft. Seit 811 Tagen verteidigt die Ukraine ihr Land, seit 811 Tagen verteidigt sie auch unsere europäischen Werte und das Prinzip einer regelbasierten internationalen Ordnung. Hier kommt die Idee der Europäischen Union zum Tragen, die in die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl gemündet hat, um Krieg materiell unmöglich zu machen. Dafür müssen wir auch weiter kämpfen, dass Krieg in der Europäischen Union, aber auch auf europäischem Boden zukünftig unmöglich ist und wir wieder zu Frieden kommen. (Beifall bei der ÖVP.)
Das ist der Grund dafür, dass wir klar an der Seite der Ukraine stehen, dass die Europäische Union hierzu von Anfang an Stellung bezogen hat. Es geht um österreichische Werte, um europäische Werte. Es geht darum, dass wir nicht zulassen werden, dass unsere regelbasierte Ordnung von einem russischen Angreifer ad absurdum geführt wird. Das Recht des Stärkeren darf sich nicht durchsetzen.
Manche aus den Reihen der FPÖ gehen sogar so weit, dass sie sagen: Die Ukraine ist ja selbst schuld! Sie hat Putin mit der Idee provoziert, auch der
Europäischen Union und der Nato angehören zu wollen! Ich sage Ihnen: Das ist absurd! Das würde nämlich bedeuten, dass man einem souveränen Staat die Souveränität abspricht. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
Und wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, hier vielleicht historische Vergleiche ziehen zu wollen, dann sage ich Ihnen: Nein, wir befinden uns nicht im Jahr 1955! Dieser Krieg Putins gegen die Ukraine hat im Jahr 2022 begonnen! (Abg. Hafenecker: Da haben Sie die Krim vergessen!) Deshalb ist es für mich so unverständlich und auch beschämend, dass die FPÖ nicht in der Lage ist, den Aggressor zu benennen. Der Aggressor ist Putin, er kann den Krieg heute stoppen. Wenn die Ukraine allerdings aufhört, zu kämpfen, ist das das Ende der Ukraine und wahrscheinlich noch von sehr viel mehr, und das werden wir nicht zulassen. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen. – Zwischenrufe der Abgeordneten Amesbauer und Belakowitsch.)
Aber halt! Habe ich gesagt, es ist für mich unverständlich, warum die FPÖ nicht in der Lage ist, den Aggressor klar zu benennen? (Abg. Amesbauer: Das haben wir schon tausendmal gesagt! – Abg. Belakowitsch: Haben Sie die Rede vor dem Spiegel geübt? – Abg. Amesbauer: Das ist ein Schauspiel!) – Es ist vielleicht gar nicht so unverständlich, denn diese Partei, die FPÖ, hat einen Freundschaftsvertrag mit der Partei Putins. (Abg. Kassegger: Falsch! Zum hundertsten Mal falsch!) Bei diesen FPÖ-Abgeordneten sind russische Spione aus und ein gegangen. (Abg. Wurm: Na Sdorowje! Na Sdorowje!) Diese FPÖ ist zum Feiern auf den Roten Platz nach Moskau gefahren.
Benennen wir die Dinge, wie sie sind! (Abg. Kickl: Na ja, aber in den russischen Farben aufgebrezelt, das waren schon Sie! – Abg. Amesbauer: Sie sind das Putin-Fangirl! Sie sind das! – Ruf bei der FPÖ: Was für ein Schauspiel!)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Wir haben der Erstrednerin diszipliniert zugehört, ich würde Sie bitten, dass Sie das gleiche Recht für alle anderen auch anwenden. Ich bitte Sie, die Ministerin nicht zu unterbrechen. (Beifall bei der ÖVP
und bei Abgeordneten der Grünen. – Abg. Leichtfried: Ja, die sind halt sehr nervös derzeit! – Abg. Kickl: Sie ist ein Putin-Groupie!)
Bundesministerin für EU und Verfassung im Bundeskanzleramt Mag. Karoline Edtstadler (fortsetzend): Meine sehr geehrten Damen und Herren, benennen wir die Dinge, wie sie sind: Diese FPÖ ist schon lange nicht mehr neutral, diese FPÖ steht auf der Seite Putins. (Beifall bei der ÖVP sowie bei Abgeordneten von SPÖ und Grünen. – Ruf bei der FPÖ: Sie sind das Fangirl Putins! – Abg. Wurm: Na Sdorowje! Na Sdorowje!)
Es muss unser aller Ziel sein, wieder Frieden herzustellen, es muss das Ziel sein, das mit der Ukraine zu tun und nicht auf deren Rücken. Es braucht die Wiederherstellung der Souveränität und der territorialen Integrität der Ukraine. Daher ist klar: Die EU und auch Österreich werden weiterhin an der Seite der Ukraine stehen. Und ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir tun das als neutraler Staat. Wir sind neutral in militärischer Hinsicht (Abg. Kickl: Ja, eh! – Abg. Belakowitsch: Darum lassen wir Panzer durchrollen!), das heißt aber nicht, dass wir eine Gesinnungsneutralität an den Tag legen. Wir liefern keine Waffen (die Abgeordneten Belakowitsch und Wurm: Wir zahlen sie nur! – Abg. Kassegger: Wir liefern Geld, mit dem Waffen gekauft werden!), wir finanzieren auch keine Waffenlieferungen (Präsident Sobotka gibt das Glockenzeichen), aber wir unterstützen die Ukraine selbstverständlich finanziell (Abg. Kassegger: Damit sie sich Waffen kaufen kann! – Ruf bei der FPÖ: Und Munition! – Abg. Amesbauer: Wollen das die Bürger auch?), politisch und auch in humanitärer Hinsicht.
Ihr Titel für diese Aktuelle Europastunde lautet Frieden, Freiheit und Wohlstand sichern. (Abg. Belakowitsch: Genau!) Dafür braucht es natürlich auch den Kampf gegen die illegale Migration. Österreich ist nie davor zurückgeschreckt, den Finger in diese Wunde zu legen. (Oh-Rufe bei der FPÖ. – Abg. Amesbauer: Ihr habt die Wunden aufgerissen!) Wir haben es geschafft, dass das Thema wieder ganz nach oben auf die europäische Agenda gekommen ist.
Erst gestern ist der Migrations- und Asylpakt endgültig formell angenommen worden, nun kann die Europäische Union endlich mit einer Stimme sprechen. (Abg. Kassegger: Schön unparteilich! Gerecht unparteilich!) Was das Entscheidende ist: Österreichische Forderungen sind aufgenommen worden. Es gibt verpflichtende und schnelle Asylverfahren an der EU-Außengrenze. (Abg. Kickl: Nach griechischem, italienischem, spanischem: Nach welchem Recht denn?) Es geht um die Bekämpfung der Sekundärmigration und um eine flexible Solidarität, die keine verpflichtende Verteilung vorsieht.
Diese Reform ist der richtige Schritt in die richtige Richtung. Klar ist aber auch, dass noch viele weitere folgen müssen, um tatsächlich dafür zu sorgen, dass die Durchführung von Asylverfahren in Drittstaaten schnell und reibungslos abgehandelt werden kann, dass die Verfahren, die negativ beschieden werden, auch entsprechend durchgeführt werden und es Rückübernahmeabkommen mit Drittstaaten gibt.
Und all das – diese eine Stimme, mit der Europa spricht – soll letztlich verhindern, dass Menschen sich überhaupt auf den Weg machen. Es soll verhindern, dass sie die gefährliche Reise auf sich nehmen. Es soll ihnen vor Ort Hilfe geboten werden. Ich sage Ihnen, da wird es noch weitere Entlastungen für Österreich geben. Es hat lange gedauert, bis wir dorthin gekommen sind, aber jetzt ist dieser Beschluss gefasst. (Beifall bei der ÖVP.)
Es braucht natürlich noch etwas, damit Frieden, Freiheit und Wohlstand gewährleistet werden können (Abg. Hafenecker: Einen Regierungswechsel in Österreich!), das größte Asset der Europäischen Union: den Binnenmarkt. Diese konkreten Vorteile sehen wir seit über 30 Jahren. Österreich ist ein Exportland: Über 70 Prozent unseres Exportes geht in EU-Mitgliedstaaten; seit unserem Beitritt hat sich diese Quote vervierfacht. (Abg. Kassegger: Und die Quote der Schweiz ebenso! Also! – Abg. Hafenecker: Seit Anbeginn gibt es schwarze Kommissare! Was haben die gemacht?) – Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von der FPÖ, Sie werden diese Fakten nicht bestreiten können. Sie können das nachlesen; wenn Sie rechnen können, dann werden Sie die Auswirkungen sehen.
Je unbürokratischer wir sind, je weniger Hürden es auf diesem Binnenmarkt gibt, desto größer können unser Einfluss und auch unsere Gestaltungsmöglichkeiten auf der internationalen Bühne sein. (Abg. Kickl: Ziehen Sie die Raiffeisen-Bank aus Russland ab! – Ruf bei der FPÖ: Das ist ja ein super Geschäft!) Derzeit trifft wohl noch der Satz zu: Die USA sind innovativ, China ist produktiv und Europa ist regulativ! Das müssen wir ändern. Wir wollen endlich wieder Weltmeister der Innovation werden und nicht Champions der Überregulierung bleiben. Wir müssen jetzt in unseren Wettbewerbsstandort investieren. (Beifall bei der ÖVP.)
Weil es dafür nicht nur schöner Worte, sondern eines konkreten Plans bedarf, habe ich gemeinsam mit Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher einen Zehnpunkteplan erarbeitet, den ich auch auf europäischer Ebene vorgestellt habe. (Abg. Belakowitsch: Den hat das eh nicht interessiert, der wollte nur sein ...!) Ich habe viel Zuspruch dafür bekommen, auch von der Kommission. Und es gibt einen Draghi- und einen Letta-Plan, die Ähnliches vorsehen. Wir müssen einfach gemeinsam die Wirtschaftsinteressen wieder nach vorne stellen und die Hürden abbauen, damit dieser Wohlstand auch für die nächsten Generationen gesichert sein wird. (Zwischenrufe der Abgeordneten Deimek und Steger.)
Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit komme ich auch zum Abschluss: Kritik an der Europäischen Union ist notwendig und auch zulässig. Es ist auch so, dass wir diese Kritik auch immer wieder üben, aber eines sollten wir uns schon klarmachen: Wer ist denn die Europäische Union? – Die Europäische Union sind wir 27 Mitgliedstaaten. Wir sind es, die die Regeln für die Zukunft schaffen, wir sitzen am Tisch und wir wollen gehört werden. (Abg. Belakowitsch: Dann macht es einmal!)
Um besser zu werden, braucht es aber natürlich auch diese Kritik. Ich möchte auch ganz klar sagen: Wenn man die Europäische Union kritisiert, dann ist man nicht notwendigerweise europafeindlich (Abg. Amesbauer: Das sind wir ja auch nicht!) – von einigen Ausnahmen abgesehen. (Abg. Belakowitsch: Die bestimmen Sie, die Ausnahmen!) Man ist daran interessiert, Europa besser zu machen, denn auch die Europäische Union ist selbstverständlich nicht fehlerfrei.
Jetzt geht es darum, die Schwächen in Stärken umzuwandeln und europäische Lösungen zu suchen (Abg. Deimek: Ihr habt es jetzt einmal fünf Jahre schlechter gemacht! Danke, ÖVP!): Das ist das, was diese Bundesregierung macht, das ist das, was unser Bundeskanzler Karl Nehammer macht, das ist das, was auch mir als Europaministerin wichtig ist, was jeden Tag meine Maxime ist – wie auch im Interesse der österreichischen Bevölkerung zu handeln. Und egal, welches Bild Sie von der Europäischen Union im Kopf haben, eines ist schon klar: Es geht nur gemeinsam, es geht nur mit internationalen, europäischen Lösungen. Einsam ist der Holzweg, auf dem die ÖV- - (Ah-Rufe bei der FPÖ), ah, FPÖ (Abg. Kassegger: Freud’scher Versprecher! – Ruf bei der FPÖ: Ui! – Abg. Kickl: Und das am vermeintlichen Höhepunkt! – Heiterkeit bei Abgeordneten der FPÖ) stecken bleibt, wenn sie weiter von „EU-Wahnsinn stoppen!“ (Abg. Belakowitsch: Richtig, richtig, richtig!) spricht, ohne gute Lösungen auf den Weg zu bringen. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen. – Abg. Kickl: So fleißig trainiert!)
Mein sehr geehrten Damen und Herren, dafür kämpfen wir jeden Tag. Ich hoffe auch, dass die Österreicherinnen und Österreicher am 9. Juni von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, denn es ist nicht egal, wie sich die Europäische Union weiterentwickelt. – Vielen Dank. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen. – Abg. Hafenecker: Ganz schlechte Rede! – Abg. Belakowitsch: Das war eine Schülerrede!)
10.47
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Lopatka. – Bitte. (Abg. Leichtfried: Ah, der Spitzenkandidat!)
Abgeordneter Dr. Reinhold Lopatka (ÖVP): Herr Präsident! Frau Bundesministerin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Frau Bundesministerin hat es angesprochen, es ist am 12. Juni 30 Jahre her, dass zwei Drittel der Österreicherinnen und Österreicher gesagt haben: Ja, wir wollen dieser Europäischen Union beitreten!
Und jetzt muss man sich fragen, welches Zeugnis - - (Abg. Belakowitsch: Was würden sie heute sagen?) – Genau, Sie sagen es, Frau Abgeordnete Belakowitsch: War es richtig, der Europäischen Union beizutreten? – Ich sage Ja, Sie sagen Nein. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Wurm: Ich habe dagegengestimmt! – Abg. Belakowitsch: Ich habe auch dagegengestimmt!) – Sie haben dagegengestimmt, das war Ihr gutes Recht, aber damit haben Sie gegen die Interessen von Österreich gestimmt, sage ich Ihnen, gegen die Interessen von Österreich. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Wurm: Fragen Sie einmal einen Schweizer oder Norweger! – Präsident Sobotka gibt das Glockenzeichen.)
Warum? – Ich kann es Ihnen sagen: 6 von 10 Euro, die in unserem Land verdient werden, verdienen wir durch Exporte, und 70 Prozent dieser Exporte gehen in diesen Binnenmarkt. (Abg. Belakowitsch: Und wie viel Prozent ... gehen nach Brüssel? – Abg. Kickl: Und vorher hat es keinen Export gegeben? – Abg. Strasser: Dann sagt es endlich, dass ihr für den Öxit seid! Sagt es! – Präsident Sobotka gibt neuerlich das Glockenzeichen.)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Ich würde bitten, dass man den Redner dementsprechend ausreden lässt und nicht ständig durch Zwischenrufe stört. (Beifall bei Abgeordneten der ÖVP. – Ruf bei der ÖVP: Danke! – Abg. Leichtfried: Die sind halt sehr nervös!) Das ist in diesem Haus nicht angemessen. Wir haben alle Reden so gehandhabt. (Abg. Hafenecker: Der Brandstätter hat auch dazwischengerufen!)
Abgeordneter Dr. Reinhold Lopatka (fortsetzend): 70 Prozent gehen in diesen Markt, meine Damen und Herren, und wir konnten diese Exporte vervierfachen. Das heißt, Europa nützt in diesem Bereich – was unsere Wirtschaft betrifft, was unseren Wohlstand betrifft. Ja, es hat sich gerechnet, dieser Europäischen Union beizutreten. (Abg. Kassegger: Da hätte aber eine Wirtschaftsunion auch gereicht!)
Ein zweiter Bereich, unsere Sicherheit, die enorm wichtig ist: Da geht es darum, dass Europa gemeinsam stark bleibt, denn es gibt diesen Aggressor Putin. (Abg. Hörl: Bravo!) Das haben in Europa mittlerweile alle erkannt, nur die Freiheitliche
Partei noch nicht. (Abg. Hörl: Sehr traurig! Schämts euch!) Und das sage ich Ihnen, das ist der zweite Bereich: Europa schützt uns da auch.
Es ist ganz wesentlich (Abg. Hörl: Traurig!), meine Damen und Herren, und ich sage es Ihnen, vor allem der Freiheitlichen Partei: Gäbe es diese Europäische Union noch nicht, wir müssten sie heute noch gründen – im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger! (Beifall bei der ÖVP sowie bei Abgeordneten von Grünen und NEOS. – Abg. Kickl: ... eine Neugründung!)
Kollege Kickl, Sie sehen das anders. (Abg. Kickl: Ich hab’ ja gar nichts gesagt! – Heiterkeit bei Abgeordneten der FPÖ.) Sie und die AfD sagen ganz deutlich, die Europäische Union sei gescheitert – so steht es im Programm der AfD –, die Zukunft liege bei den Nationalstaaten.
Ich sage Ihnen: Dieser Weg zurück wäre der Holzweg. Das wäre der Weg in die Massenarbeitslosigkeit (Abg. Belakowitsch: Da sind wir eh schon hin unterwegs! – Rufe bei der ÖVP – in Richtung Abg. Belakowitsch –: Geh bitte! – Abg. Strasser: Wirklich schlecht informiert, Frau Kollegin! Schlecht informiert!), das wäre der Weg zum Wohlstandsverlust. Das sage ich Ihnen, das ist der große Unterschied zwischen Ihnen und uns: Sie machen sich immer mehr zum Komplizen von Putin in der EU.
Sie plakatieren das Gegenteil von dem, was Sache ist. Sache ist nämlich – und das können ja nicht einmal Sie leugnen (Abg. Amesbauer: Danke, dass Sie alle unsere Plakate bewerben!) –, Putin hat einen Krieg gestartet, ist in die Ukraine eingebrochen. (Abg. Amesbauer: Wissen wir!) Und Sie plakatieren: Stoppt die Kriegstreiber! Sie plakatieren die Europäische Union, die Ukraine als „Wahnsinn“ und: Stoppt die Kriegstreiber! – Ja geht’s noch? (Beifall bei der ÖVP sowie bei Abgeordneten von Grünen und NEOS.)
Ich weiß nicht, in welcher Welt Sie leben. In welcher Welt leben Sie? (Abg. Kassegger: Ihr ... seit 20 Jahren Putin! Was ist euer Plan?)
Bei jeder Debatte, bei der ich jetzt mit Kollegen Vilimsky unterwegs bin, weigert er sich, auch nur ein Wort dazu zu sagen, was Ihren berühmten Vertrag mit der Partei von Putin betrifft. (Abg. Belakowitsch: Recht hat er!) Der ist von Ihrem Vorgänger Strache – den kennen Sie schon noch, hoffe ich – unterzeichnet worden. In dem Vertrag ist festgehalten, dass eine Aufkündigung nur schriftlich erfolgen kann, ein halbes Jahr vor der Fünfjahresfrist. (Abg. Amesbauer: Glaubst du, das interessiert irgendjemanden?)
Das hätten Sie 2021 machen müssen. Wo ist die schriftliche Aufkündigung? Zeigen Sie sie uns! (Abg. Kassegger: Du liest aber schon die APA-Aussendungen, oder?) Sie haben nach wie vor einen gültigen Freundschaftsvertrag mit der Jedinaja Rossija, mit der Partei Einiges Russland von Putin. (Abg. Kassegger: Nein, haben wir nicht, zum hundertsten Mal! – Abg. Kickl: Meine Güte! Aber nur weiter so! Weiter so! Ihr machts ... alle!) Das ist es. Sie sind die Komplizen von Putin in Europa. Tagtäglich zeigen Sie das. (Beifall bei der ÖVP sowie bei Abgeordneten von Grünen und NEOS.)
Dann geht es um die Europäische Union. Ihr Spitzenkandidat Vilimsky sagt, in der Millisekunde würde er auf diesen roten Knopf drücken, um diesem Wahnsinn, diesem Irrsinn der EU ein Ende zu bereiten. (Zwischenrufe bei der FPÖ.) Ich habe mir gedacht, da gibt es keine Steigerung mehr, da sagt er, das Europäische Parlament sei ein Irrenhaus. – Ja was ist das Nächste? (Abg. Amesbauer: Ist das überhaupt ein echtes Parlament?) – Sicherlich nichts Gutes für die Europäische Union, auch nichts Gutes für Österreich.
Meine Damen und Herren, Reden ist das eine, Tun ist das andere. Hier im Parlament haben Sie zweimal den Antrag eingebracht, Österreich soll die Beitragszahlungen an die EU aussetzen. (Rufe bei der FPÖ: Ja!) Das wäre das Ende der Europäischen Union. (Abg. Kassegger: Wieso? – Abg. Belakowitsch: Warum?) – Warum? (Abg. Kassegger: Sollen die anderen einmal was zahlen!) Wenn keine Beiträge bezahlt werden? Also in welcher Welt leben Sie?
Sie haben hier – meiner Meinung nach war das negativ –, als der Brexit erfolgt ist, den Antrag eingebracht, eine Volksbefragung über den Austritt Österreichs durchzuführen. (Abg. Kickl: Es interessiert Sie nicht, was der Souverän denkt!) Ich sage es Ihnen: Spielen Sie nicht ständig mit dem Wohlstand, mit der Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher! (Abg. Amesbauer: Das machen ja Sie! Das machen ja Sie den ganzen Tag!) Hören Sie mit Ihrem russischen Roulette auf, sofort! (Beifall bei der ÖVP sowie bei Abgeordneten von Grünen und NEOS. – Abg. Deimek: Er hat nichts über Bürokratie gesagt, auch ein Zeichen! – Weitere Zwischenrufe bei der FPÖ.)
10.53
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Schieder. – Bitte.
Mitglied des Europäischen Parlaments Mag. Andreas Schieder (SPÖ): Schönen guten Morgen! Sehr geehrte Damen und Herren! Schön, wieder einmal im österreichischen Parlament zu sein! Sehr geehrte Damen und Herren vor den Bildschirmen! Vor allem freut es mich, auf der Besuchergalerie eine Delegation von Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern aus Amstetten, Scheibbs und Melk herzlich zu begrüßen. (Allgemeiner Beifall.)
Ich danke Ihnen auch: Der Titel dieser Aktuellen Europastunde ist zwar recht eigenartig, aber das Thema Europa, unser europäisches Lebensmodell ist es wert, dass darüber geredet wird – nämlich ein Lebensmodell, das wir schützen müssen, ein Lebensmodell, das auf Frieden aufbaut, das aber auch weiß, ohne Freiheit wird es keinen Frieden geben, und für Freiheit braucht es auch Demokratie, und für eine funktionierende Demokratie braucht es sozialen Zusammenhalt, Steuergerechtigkeit, Arbeitsplätze. (Abg. Kickl: Vor allem muss das zählen, was die Leute wollen!) All diese Fragen sind zentral für uns Sozialdemokraten, wenn es um europäische Politik geht. (Beifall bei der SPÖ.)
Wir haben das auch in ein politisches Konzept zusammengefasst, das im Wesentlichen sagt: Europe first statt made in China! Es geht nämlich darum, dass wir den Rückstand, den Europas Industrie hat, weil in anderen Kontinenten inzwischen massiv investiert wird, wieder aufholen. Investieren heißt, in Zukunftstechnologien zu investieren, in die grünen Technologien zu investieren, in den Kampf gegen den Klimawandel so zu investieren, dass wir europäische Solarpaneele auf europäische Häuser schrauben und diese nicht aus China importieren. (Beifall bei der SPÖ. – Heiterkeit und Bravorufe bei der FPÖ.)
Es geht aber auch um Versorgungssicherheit, denn in den letzten Jahren ist aufgefallen, dass die Österreicherinnen und Österreicher oft nicht mehr die Medikamente bekommen, die ihnen der Arzt verschrieben hat. Warum? – Weil sie nicht mehr in Europa produziert werden. Daher müssen wir auch investieren, damit die Produktion wieder nach Europa zurückkommt und Sicherheit besteht. (Beifall bei der SPÖ. – Abg. Kickl: ... so was Kleingeistiges!)
Es geht um den Industriestandort. Es geht um Chipstechnologien. (Ruf bei der FPÖ: Chipstechnologien? Kelly’s oder was? – Heiterkeit bei Abgeordneten der FPÖ.) Es geht um all diese Fragen, die wir neu definieren müssen, und es geht um die Arbeitsplätze der Zukunft. Es geht um die neuen, sauberen und guten, grünen Arbeitsplätze in Europa und in Österreich.
Dafür müssen wir investieren – viel, viel mehr, als bisher passiert ist. Ich würde sagen, 275 Milliarden bis 300 Milliarden Euro, die da jährlich in Europa investiert werden müssen, sind mindestens notwendig. Wir müssen alle Ressourcen mobilisieren. Wir müssen aber auch auf der rechtlichen Ebene schauen, dass made in Europe bei öffentlichen Ausschreibungen bevorzugt wird. (Beifall bei der SPÖ.)
Was wir nicht zulassen dürfen, ist, dass europäische Technologie von anderen kopiert wird und dann billig, mit Staatssubventionen, von uns gekauft wird. Made in Europe muss bei öffentlichen Ausschreibungen Vorrang haben.
Das ist genau das Gegenteil von dem, was ich zum Beispiel auf freiheitlichen Plakaten immer wieder lese. Aber auch wenn ich Ihnen da so zuhöre: Sie tun ja immer so, als wären Sie für die kleinen Leute. (Abg. Wurm: Ja, eh!) – „Ja, eh!“, sagt er. – Abgesehen von dem, was Herr Kickl sich da nebenbei hat auszahlen lassen, was überhaupt far away von kleinen Leuten ist: Das ist der große Nehmer, nicht der kleine Mann, der da eine Rolle gespielt hat, Herr Kollege, nur damit wir das auch einmal ganz klar sagen. (Beifall bei der SPÖ. – Abg. Kickl: ... Armutszeugnis für Sie! Ich kann ja auch nichts dafür, dass Ihre Leistung Ihrer Partei nichts wert ist, aber verstehen tu ich’s!) – Sie brauchen da jetzt gar nicht herauszubrüllen, denn man kann es auch einfach faktisch untersuchen.
Ich habe mir angeschaut, wofür und wogegen Sie im Europäischen Parlament gestimmt haben. – Gegen die Jugendgarantie, gegen europäische Mindestlöhne, gegen höhere Löhne und mehr Personal in der Pflege, gegen die soziale Absicherung prekär beschäftigter Lieferfahrer, gegen den Fahrplan für ein soziales Europa, gegen mehr Demokratie in den Betrieben, und Sie haben sich auch betreffend einheitliche und faire Steuern für Großkonzerne enthalten. Das ist das wahre Gesicht der FPÖ. (Beifall bei der SPÖ.)
Damit auch die Frauen, die uns zuschauen, genau wissen, wer auf der Seite der Frauen steht und wer nicht (Abg. Belakowitsch: Das wissen die Leute!): Wir haben uns auch angeschaut, wie Herr Vilimsky zum Beispiel bei Frauenthemen abgestimmt hat: Er hat sich enthalten, als es darum ging, die Lohnschere zwischen Mann und Frau zuzumachen (Abg. Belakowitsch: Zuzumachen oder abzuschaffen?), enthalten, als es um die Istanbulkonvention gegangen ist, enthalten, als es um das EU-Gewaltschutzpaket gegangen ist. Und natürlich hat er bei der Klimapolitik auch dagegengestimmt. (Präsident Hofer übernimmt den Vorsitz.)
Die Festung Europa, die Sie propagieren, ist ein schwerer Fehler. Der Öxit, den Sie sich wünschen und den Sie immer wieder fordern, wäre ein schwerer Fehler für die Österreicherinnen und Österreicher. (Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordneten der ÖVP.)
Was wir brauchen, ist ein gemeinsames Arbeiten in Europa für die Österreicherinnen und Österreicher, daher ist meine Bitte an alle Zuschauer: Gehen Sie am 9. Juni zur Europawahl und überlegen Sie sich gut, wen Sie wählen – wählen Sie aber bitte eine demokratische Partei, die für die Zukunft des Landes in Europa arbeitet. – Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. (Beifall bei der SPÖ sowie bei Abgeordneten von ÖVP, Grünen und NEOS.)
10.58
Präsident Ing. Norbert Hofer: Nächster Redner ist Herr Abgeordneter Harald Vilimsky. – Bitte schön.
Mitglied des Europäischen Parlaments Harald Vilimsky (FPÖ): Bei so viel parlamentarischem Topfen, der gerade überall hin und her geworfen wurde, ist es schwierig, eine Rede zu strukturieren. Ich versuche es trotzdem, nachdem da immer wieder diese Putin-Geschichte aufgekommen ist. (Ruf bei der SPÖ: Ja warum denn wohl?)
Wer denn, meine Damen und Herren von der Sozialdemokratie, hat den Boden Moskaus geküsst? – Erinnern wir uns noch daran: Ihr ehemaliger Vorsitzender hat den Boden Moskaus geküsst, und der aktuelle bekennt sich aktiv zum Marxismus. (Abg. Kickl: Die essen ja sogar mit Hammer und Sichel in der Sozialdemokratie!) Das sind sie, die Sozialdemokraten, die jetzt offenbar Kindesweglegung betreiben. (Beifall bei der FPÖ. – Abg. Leichtfried: Da hat einer überhaupt nichts verstanden!) Kommen wir zur ÖVP, die Putin!, Putin!, Putin!, schreien, aber dabei verschweigen, dass sie auch einen Brief aus Brüssel bekommen haben, nämlich von einer Vielzahl von Abgeordneten, die sie, ihren Bundesvorsitzenden, ihren Finanzminister auffordern, dass Raiffeisen International sich aus Russland zurückziehen möge; und über 30 Abgeordnete der ÖVP aus Nationalrat, Bundesrat oder den Landtagen haben irgendeinen Bezug zu Raiffeisen. Sie machen (Abg. Kassegger: Geschäfte! Geschäfte!) die Geschäfte
mit den Russen! Das muss man einmal in aller Deutlichkeit sagen. (Beifall bei der FPÖ.)
Und weil jetzt gleich Herr Brandstätter herauskommen wird und wieder Putin!, Putin!, Putin!, schreien wird: Erinnern wir uns daran, was Herr Haselsteiner gesagt hat, nämlich dass Putin derjenige wäre, der die Europäische Union groß machen könne, der in diese Europäische Union hereingeholt werden müsse. Ein Jahr später zahlt dieser Herr Haselsteiner, der sein Geld mit den Russen gemacht hat, 300 000 Euro in Ihre pinke Parteikassa. Schweigen Sie künftig, Herr Brandstätter! (Beifall bei der FPÖ. – Zwischenrufe der Abgeordneten Lindinger und Weidinger.)
Ich komme auf die Frau Minister zu sprechen: Sie haben ja recht, dass das mit dem „EU-Wahnsinn stoppen“ nicht ganz getroffen war, denn bei all dem, was man hier gehört hat, müsste man darunterschreiben: auch österreichischen Regierungswahnsinn stoppen! So wie hier Dinge in den Raum gestellt werden, so wie Sie dieses Europa mit Ihrem Herrn Lopatka hochjubeln, sind Sie so was von weit weg von jeglicher Faktenbasis. (Beifall bei der FPÖ.)
Erinnern Sie sich doch zurück: Ihre Partei und die Sozialdemokraten waren es, die Österreich in diese Abstimmung hineingelogen haben. (Zwischenruf des Abg. Eßl.) Erinnern Sie sich zurück an die Schlagzeile der „Kronen Zeitung“: D-Mark und Schilling bleiben! – Was ist? Wir haben den weichen Euro. Erinnern Sie sich zurück (Abg. Loacker: ... Chlorhuhn und Blutschokolade habt ihr plakatiert!), bitte, wie Sie geschrieben und versprochen haben: Österreich bleibt der Feinkostladen Europas! – Das wart ihr! Und jetzt habt ihr, meine Herren Europaverehrer, beschlossen, dass Insekten dem Essen beigemengt werden können. Vier Sorten von Insekten, von Würmern und Käfern, die man zermahlt, darf man dem Essen beimengen. (Abg. Weidinger: Mahlzeit! Mahlzeit!)
Danke, liebe ÖVP, dass ihr derart offenkundig die heimische Landwirtschaft verratet, auch „danke“ – unter Anführungszeichen – dafür, dass ihr Österreich in den Mercosur-Pakt hineinführt und in weiterer Konsequenz der heimischen
Landwirtschaft den Garaus bereitet. (Zwischenruf des Abg. Hörl.) Ihr seid das! Seid wenigstens so ehrlich und tut vor Wahlen nicht immer so, als wärt ihr diejenigen, die Österreich schützen. Sie sind an der Spitze der Österreichabschaffer. (Beifall bei der FPÖ.)
Festung Europa und Festung Österreich ist kein Widerspruch in sich. Wenn es gelingt, diesen Kontinent vor illegaler Migration zu schützen, brauchen wir nicht dieses Festungsmodell für Österreich. Faktum ist aber, dass Sie, die Sie schwören, die Außengrenzen schützen zu wollen, nicht einmal in der Lage sind, die österreichischen Grenzen entsprechend zu schützen.
Wir haben acht Millionen Menschen, die seit dem Jahr 2015 nach Europa gekommen sind, ein Gutteil davon illegal aus Arabien und aus Afrika. (Zwischenruf der Abgeordneten Krisper und Ernst-Dziedzic.) Zwei Drittel davon haben keinerlei Schutzwürdigkeit – weder eine der Genfer Konvention entsprechende noch eine subsidiäre noch eine humanitäre. Von den über 480 000 Menschen, die in der Europäischen Union im vergangenen Jahr eine Ausreiseaufforderung erhalten haben, sind vier von fünf einfach hiergeblieben.
Und ja, es ist auch jede Menge Terror nach Europa gekommen: „Charlie Hebdo“, das Bataclan-Theater, dieses Massaker, das dort stattgefunden hat. In Brüssel wurden über 30 Menschen in die Luft gesprengt. Wir haben es in Straßburg am Weihnachtsmarkt erlebt, wir haben es in Wien erlebt, wo einer mit einer Kalaschnikow herumgerannt ist. Wir erleben es täglich mit Messerattentaten und so weiter und so fort.
Ja, wir verfolgen dieses Modell Festung Österreich, wenn es nicht gelingt, diesen Kontinent zu schützen, und ja, wir sind die letzten Rot-Weiß-Rot-Kämpfer in dieser europäischen Irrsinnigkeit, und darauf sind wir stolz. – Danke. (Beifall bei der FPÖ.)
11.04
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt nun Herr Abgeordneter Thomas Waitz. – Bitte schön, Herr Abgeordneter.
11.04
Mitglied des Europäischen Parlaments Thomas Waitz (Grüne): Herr Präsident! Frau Bundesministerin! Hohes Haus! Liebe Bürger und Bürgerinnen! Ich habe mir heute vorgenommen, ein wenig zu dekonstruieren, nämlich das Auseinanderklaffen dessen, was die FPÖ hier in Österreich so sagt und was sie im EU-Parlament so tut, aufzuzeigen.
Es ist ja bereits ausreichend diskutiert worden, dass Sie die Europäische Union in der derzeitigen Form zerstören wollen. Das schreiben Sie auch auf Ihr Plakat. Sie sagen, Sie wollen die EU stoppen. Was wollen Sie denn da stoppen? (Abg. Amesbauer: „EU-Wahnsinn“! Können Sie lesen?) Und für wen tun Sie das? – Wenn man sich die geostrategischen Verhältnisse einmal ansieht, tun Sie Ihrem angeblichen Freund Putin einen großen Gefallen damit, die Europäische Union zu schwächen. Sie behaupten allerdings hier in Österreich, Sie würden das Interesse der Österreicherinnen und Österreicher vertreten. Na, feste Patrioten seid ihr mir: österreichische Interessen an Putins Russland zu verkaufen – ich applaudiere, bravo! (Beifall bei den Grünen.)
Wie aber stimmen Sie denn im Europäischen Parlament tatsächlich ab? Als wir uns mit dem Einfluss Russlands auf die europäische Demokratie beschäftigt haben und diesen zurückweisen wollten und Maßnahmen dagegen unternehmen wollten, haben Sie dagegengestimmt, ganz im Gegensatz zu dem, was Sie hier sagen. Als es darum gegangen ist, dass es vielleicht seltsam ist, dass Ihre Kollegin Le Pen Geld von Putins Russland bekommt, dort Kredite hat, und ob das einen Einfluss auf ihre Entscheidungsfähigkeit ausübt, auch da haben Sie dagegengestimmt.
Ich möchte aber ein paar andere Themen aufgreifen, weil Kollege Vilimsky dankenswerterweise die Landwirtschaft erwähnt hat:
Was tun Sie eigentlich in Brüssel? – Sie verraten die Interessen der österreichischen Landwirtschaft, der österreichischen Bäuerinnen und Bauern. Als es um das Recht von Bauern, Saatgut weiterzugeben, und zwar jenes, das sie selbst
produziert haben, also um die Freiheit der Landwirtschaft ging, da haben Sie gegen die Saatgutverordnung gestimmt, damit nur mehr die vier großen Konzerne den Saatgutmarkt kontrollieren können. Für diese haben Sie gestimmt, für die Bayers, BASFs und Monsantos dieser Welt – danke Ihnen! –, gegen die Freiheit der Landwirtinnen und Landwirte, Saatgut weiterzugeben. (Beifall bei den Grünen.)
Oder als es um die Gentechnikfreiheit Österreichs, die gerade angegriffen wird – das Recht Österreichs, gentechnikfrei zu produzieren und es auch als solches zu bezeichnen –, ging: Auch da haben Sie dagegengestimmt, gegen die sogenannte Opt-out-Regelung, dass Österreich weiterhin seine Produkte gentechnikfrei produzieren darf.
Das ist genau das Gegenteil von dem, was Sie hier in Reden behaupten und was Sie auf Plakate schreiben. Ich kann die Bürger und Bürgerinnen nur dazu aufrufen: Glauben Sie nicht, was man Ihnen vor einer Wahl erzählt – das gilt für alle Parteien –, sondern schauen Sie, was mit Ihren Stimmen im Europäischen Parlament tatsächlich getan wird! Das kann ich Ihnen nur empfehlen. (Beifall bei den Grünen. – Abg. Kickl: Waffen statt -stillstand!)
Um noch ein bisschen weiterzugehen bei diesem Thema Österreichs Landwirtschaft: Österreichs Bäuerinnen und Bauern haben ein Problem mit der Konkurrenz aus der industriellen Landwirtschaft, aus der Massentierhaltung. (Abg. Kickl: Was wird denn dann sein, wenn die Ukraine kommt? – Zwischenruf des Abg. Amesbauer.) Die gute Form der Tierhaltung, die es in Österreich gibt – auch dagegen haben Sie gestimmt. Sie haben dagegengestimmt, dass künftig Förderungen für Massentierhaltungsbetriebe gekürzt werden, und damit sind Sie mitverantwortlich für den Rückgang der Anzahl an landwirtschaftlichen Betrieben, die wir in Österreich haben. Sie verraten die Interessen der österreichischen Landwirtschaft jeden Tag aufs Neue.
Und Mercosur, das Sie auch so gerne in den Mund nehmen: Na, haben Sie zugestimmt, gegen Mercosur aufzutreten? – Haben Sie nicht,
überraschenderweise. (Abg. Hörl: Hört! Hört!) Sie haben sich enthalten, Kollege Vilimsky. Ja, da sehen wir einmal, was Sie tatsächlich tun und was Sie draußen behaupten (Abg. Steger: Wir haben einen ... eingebracht ...!), und damit gefährden Sie den Zusammenhalt in der Europäischen Union. Sie gefährden den Zusammenhalt innerhalb Österreichs. Sie gefährden die demokratischen Grundprinzipien innerhalb der Europäischen Union und in Österreich, und damit gefährden Sie den Wohlstand, den Frieden und die Sicherheit Österreichs.
Es ist zum Fremdschämen, mir Ihre Reden im Parlament anhören zu müssen (Abg. Kickl: Wirklich?), wo wirklich Wahnsinn auftaucht. In unserem Europäischen Parlament suchen wir über alle demokratischen Unterschiede hinweg den Kompromiss – wo Sie übrigens höchst selten dann dabei sind, wenn es um die eigentliche Arbeit geht. Sie sind immer nur da, wenn es ums Große-Reden-Schwingen geht (Abg. Amesbauer: Wie geht’s eigentlich Frau Schilling?), ja, dann sind Sie da, aber wenn es ums Gesetzemachen geht, dann fehlt die FPÖ immer. (Beifall bei den Grünen.) Na klar, wieso soll ich in einer Institution, die ich ohnehin zerstören möchte, mitarbeiten?
Wahnsinn tritt wirklich zutage, wenn Ihre Abgeordneten von der ID, von der FPÖ, von der AfD vorne ans Podium gehen. Dazu kann ich Ihnen zahlreiche Kameraeinstellungen des Europäischen Parlaments empfehlen.
Also ich kann nur an die Bürger und Bürgerinnen appellieren: Bitte schauen Sie sich an, was diese Leute, die Ihnen hier in Österreich ein A erzählen, dann im Europäischen Parlament machen, wie sie tagtäglich die Interessen von Österreichs Wirtschaft, von Österreichs Landwirtschaft, der Demokratie in Österreich verraten – jeden Tag aufs Neue; nicht nur an den Herrn Putin, auch an China und an andere Mächte dieser Welt!
Sie sollten sich schämen dafür! Ich finde, Sie sollten sich schämen dafür. (Beifall bei den Grünen. – Abg. Amesbauer: Schwache Rede, wirklich!)
Es geht nicht darum: Stoppt den EU-Wahnsinn!, sondern mir geht es darum: Stoppt den FPÖ-Wahnsinn im Europäischen Parlament! (Beifall bei den Grünen. – Abg. Kickl: Euch geht’s jetzt um den Erhalt von Schilling!)
11.10
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt nun Herr Abgeordneter Dr. Helmut Brandstätter. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Dr. Helmut Brandstätter (NEOS): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Bundesministerin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuseherinnen und liebe Zuseher! Das hier ist die Europastunde! Zum Teil ist sie ja zu einer Schreistunde verkommen, ich habe gar nicht alles verstanden, aber ich möchte jetzt aus meiner Rede 5 Zukunftsminuten für die nächsten fünf Jahre machen.
Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir uns ansehen, was wir in den nächsten fünf Jahren machen können, und dass wir die Zukunft der nächsten Generationen sicherstellen müssen. Deswegen sagen wir, wir brauchen in künftigen Budgets eine Zukunftsquote, es müssen 25 Prozent des Budgets für die nächsten Generationen, für die Zukunft eingesetzt werden, und da haben wir einige sehr konkrete Ideen. (Beifall bei den NEOS.)
Das beginnt schon mit den Freiheiten. Wir haben die Dienstleistungsverkehrsfreiheit, die Kapitalverkehrsfreiheit, die Personenverkehrsfreiheit und die Warenverkehrsfreiheit. Das sind wichtige Grundlagen für den Binnenmarkt, der ja auch einen ganz wesentlichen Punkt darstellt, auch wenn er noch nicht fertig ist. Da gibt es den großartigen Letta-Report, ja, den müssen wir weitermachen, aber wir wollen eine fünfte Freiheit: Wir wollen Bildung als fünfte Freiheit für die nächsten Generationen, und zwar kombiniert mit einem europäischen Stipendiensystem. Es darf nicht davon abhängen, ob es sich die Eltern leisten können, dass junge Menschen jede Form von Bildung bekommen, sie müssen alle die Chance haben, in einem anderen europäischen Land zu lernen, eine
Lehre zu machen, zu studieren – und wer es sich nicht leisten kann, dem muss es bezahlt werden. Dann ist die Zukunft Europas sicher – ein ganz wichtiger Punkt. (Beifall bei den NEOS.)
Das Zweite, das ich ansprechen möchte, ist die Forschung. Dazu hat die „Financial Times“ vor Kurzem eine Statistik vorgelegt, und zwar über Patente, die weltweit angemeldet wurden, über Advanced Digital Technology, also künftige Digitalprodukte. Im Jahr 2000 lagen die Großen alle ungefähr gleich: bei 3 000, 4 000 Patenten pro Jahr. Wer ist im Moment Nummer eins? – Die USA mit 50 000. Wer ist Nummer zwei? – China mit 30 000. Dann kommt Japan und dann erst Europa. Was heißt das? – Dass wir gemeinsam mehr forschen müssen, dafür mehr Geld einsetzen müssen, und damit ist der Wohlstand der nächsten Generationen gesichert. (Beifall bei den NEOS.)
Der nächste Punkt ist die Energieunion, und das ist auch ganz wesentlich. Da bin ich wirklich sehr froh, um nicht zu sagen, stolz darauf, dass Kollegin Claudia Gamon hier ist. Am Ende dieser Gesetzgebungsperiode ist gefragt worden: Wer sind denn die Abgeordneten, die etwas bewegt haben? Claudia Gamon hat im Bereich Energie etwas bewegt und ist deshalb gewählt worden. – Ich gratuliere dir dazu herzlich, das war sehr wichtig. (Beifall bei den NEOS.)
Das bringt mich gleich zum nächsten Punkt, weil hier so viel geschrien worden ist. Da habe ich gesagt: Warum schreit der Vilimsky so – wie ist das in Brüssel? Darauf hat sie geantwortet: Keine Angst, den triffst du dort eh nie, der ist eh nie da, weil der ja nicht arbeitet. Der beteiligt sich ja nicht an der Gesetzgebung im Europäischen Parlament. – Ich halte das aber für ganz wesentlich. (Abg. Gödl: Das ist ein Skandal!)
Jetzt muss ich schon noch kurz zu Ihnen kommen, Herr Kickl. Wissen Sie, mir ist es gleichgültig, wie viel Sie wirklich verdienen – 10 000, 14 000, 24 000 Euro –, ich bin nicht neidisch. Machen Sie damit, was Sie wollen, aber gefährden Sie nicht die Zukunft der Menschen in Österreich! Ihren 24 000 Euro pro Monat stelle ich gegenüber, dass jede Österreicherin, jeder Österreicher mit 4 000 Euro
pro Jahr von der Europäischen Union profitiert. Und die Menschen brauchen das, jetzt erst recht in Zeiten der Inflation. Die Menschen brauchen die Arbeitsplätze. Das, was Sie wollen, ist eine Vernichtung der Arbeitsplätze: Bei einem Öxit – das, was Sie wollen – gingen 700 000 Arbeitsplätze verloren. Die Inflation würde steigen (Abg. Kickl: Die Welt würde untergehen!), unsere Jungen könnten nicht mehr an Erasmus-Programmen teilnehmen. Sie gefährden die Zukunft der Menschen – hören Sie auf damit, nehmen Sie Ihr Geld, aber nehmen Sie nicht den anderen etwas weg! Dafür würde ich appellieren. (Beifall bei den NEOS und bei Abgeordneten der ÖVP.)
Ich weiß, Sie tun sich schwer mit Zahlen, aber die können Sie nachlesen. (Abg. Kickl: Wie viel verdienen eigentlich Sie?) – Hören Sie einmal zu! – Es gibt natürlich auch heute mehrere gute Bücher wie dieses hier: „Europa muss sich rechnen“ von Gabriel Felbermayr (das genannte Buch in die Höhe haltend); wir haben diese Woche mit ihm wieder ausführlich darüber gesprochen, und er hat als Wirtschaftsforscher - - (Abg. Kickl: Haben Sie dem auch etwas hineingeschrieben so wie dem Egisto?) – Sie haben nichts studiert, er hat Wirtschaft studiert, er ist Professor, also glauben Sie ihm! Sie haben nichts studiert und er kennt sich aus. (Abg. Kickl: Haben Sie dem auch eine Widmung hineingeschrieben wie dem Egisto?) –Horchen Sie zu, wenn ich etwas erkläre! – Professor Felbermayr erklärt Ihnen das: Den 4 000 Euro stehen 114 Euro gegenüber, die wir einzahlen. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied.
Deswegen werden wir in den nächsten fünf Jahren mit Herz, Hirn und Verstand und ohne Hetze in Europa arbeiten. Was werden wir machen? – Wir werden auch die Ideen der Bürgerinnen und Bürger aufnehmen. Auch das haben wir uns angesehen: Dieser Zukunftskonvent, Frau Bundesministerin, ist ja leider nicht weitergegangen, aber da sind schon sehr viele Ideen aufgetaucht, die sich eigentlich ein bisschen wie das NEOS-Programm lesen: Die Menschen wollen mehr Demokratie, sie wollen Mehrheitsabstimmungen, weil das die einzige Chance ist, dass wir uns international behaupten können. Sie wollen natürlich
eine Verstärkung des Binnenmarkts, aber sie wollen auch Verteidigung, sie wollen, dass wir das absichern.
Deswegen appelliere ich auch: Sagen wir nicht: Ja, Europa, aber - -, wie ich es von der ÖVP höre, das ist zu wenig, sondern sagen wir: Ja, Europa! (Präsident Hofer gibt das Glockenzeichen.)
Eine Bitte noch zum Schluss – letzter Satz, Herr Präsident –: Ich glaube, ganz wesentlich für das Verständnis von Europa wäre, dass wir öfter Europastunden haben sollten, in denen wir erklären, wie sich europäische Gesetzgebung auf Österreich auswirkt. Dann werden wir auch mehr Verständnis, noch mehr Verständnis für die Europäische Union in Österreich bekommen, und ich freue mich, dass auch ich dann wieder hier sein darf. – Danke schön. (Beifall bei den NEOS und bei Abgeordneten der ÖVP.)
11.15
Präsident Ing. Norbert Hofer: Nächster Redner ist Herr Abgeordneter Mag. Peter Weidinger. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Mag. Peter Weidinger (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzte Damen und Herren! Europa ist unsere Zukunft! Unser Motto ist: Europa verbessern und es nicht zerstören! Es ist eine linke Mehrheit im Europaparlament, die uns ein Mehr an Bürokratie und Regulierung gebracht hat. Jetzt können wir das ändern: Schon ab morgen, dem 16. Mai, gibt es die Möglichkeit, mittels Briefwahl von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.
Die Festung, von der die FPÖ spricht, gibt keine Sicherheit, sondern bedeutet Abschottung von und für Österreich. Die österreichische Wirtschaft verdient 6 von 10 Euro im Export. Wir brauchen die internationalen Märkte, um Arbeitsplätze und Wohlstand zu Hause zu sichern. Wer sich abschottet, vernichtet unseren Wohlstand und unsere Arbeitsplätze. (Beifall bei der ÖVP.)
Unser Weg bedeutet, vieles besser zu machen, um die globale Wettbewerbsfähigkeit Österreichs und Europas zu erhöhen. Das bedingt einen massiven Bürokratieabbau, das heißt, das Ermöglichen und nicht das Verhindern in den Mittelpunkt einer gemeinsamen europäischen Politik zu stellen, und das technologieoffen, das heißt, nicht die Grundfesten der Europäischen Union zu gefährden, sondern sie klug weiterzuentwickeln, damit wir Demokratie, Rechtsstaat, Freiheitsrechte und Frieden sichern.
Das schaffen wir, indem wir erstens auf Innovation und Forschung setzen, zweitens die Lebensmittelversorgungssicherheit mit unseren Bäuerinnen und Bauern sicherstellen, drittens den Binnenmarkt verwirklichen und damit eine Medikamentenversorgungssicherheit schaffen und auch unsere Mikroelektronikabhängigkeit senken und viertens einen Klimaschutz mit Hausverstand machen und selbstverständlich den Anspruch erheben, immer besser werden zu wollen.
Das Motto der Union lautet: „In Vielfalt vereint“. Für mich bedeutet das, dass die Talente aller Menschen zu entfesseln sind, um Spitzenleistungen in Kultur, in Sport, in Wissenschaft, in Wirtschaft und in der Gesellschaft zu erreichen. Wir machen die Welt nur besser, indem wir besser werden.
Ja, es gibt in Österreich auch das weitverbreitete Jammern und Sudern, das ist aber nicht zu verwechseln mit dem Zum-Ausdruck-Bringen der berechtigten Sorgen und Nöte der Österreicherinnen und Österreicher. Die FPÖ stellt an den Stammtischen ihre Megafone auf, um das Jammern und Tschentschen voll aufzudrehen (Abg. Kassegger: Die Mikrofone, nicht die Megafone!), dabei überhören Sie aber, worum es den Österreichern wirklich geht: keine Bevormundung aus Brüssel, nicht das Einreißen des gemeinsamen Hauses Europa, sondern das proaktive Weiterentwickeln und das Achten auf unsere Identität, indem sich Europa auf die großen Fragen konzentriert und den Regionen ihre Freiheit und ihre Gestaltungsspielräume lässt. (Beifall bei Abgeordneten der ÖVP.)
Wichtige Schritte dafür sind ein robuster Außengrenzschutz und der Migrations- und Asylpakt, der jetzt im Europäischen Parlament beschlossen wurde und der den Weg für Asylverfahren an den Außengrenzen der Union frei macht. Gleichzeitig bleiben wir offen für internationale Fachkräfte, die unsere Wirtschaft als Motor für den Sozialstaat so dringend benötigt. Europa macht 3 Prozent der Erdfläche aus, 6 Prozent der Weltbevölkerung, 15 Prozent der Weltwirtschaftsleistung. Gleichzeitig investieren wir 50 Prozent an Sozialausgaben in Österreich.
Wir haben die Verantwortung und die Aufgabe, dieses Anspruchsdenken, das politisch immer wieder gefördert wird, dass es heißt: Darf es noch ein bisschen mehr an Regulierung und an Leistung vom Staat sein?, zu beenden, liebe Österreicherinnen und Österreicher. Für uns stehen die Leistungsbereitschaft, die Entlastung, die Verantwortung unseren Kindern gegenüber im Vordergrund, und so gestalten wir unsere Zukunft.
Mein Heimatbundesland Kärnten hat seit dem EU-Beitritt 2 Milliarden Euro netto mehr an Geld erhalten – durch die Zusammenarbeit in Europa, durch das Zusammenwachsen der Regionen. Und weil wir uns nicht mehr auf nationalstaatliche Grenzen reduzieren, setzen wir gemeinsame Projekte wie die Baltisch-Adriatische Achse um, womit wir die Adria mit der Ostsee verbinden und neue Wege schaffen. In Österreich sind die Koralmbahn und der Semmeringbasistunnel ein Teil davon. Damit rücken zwei Landeshauptstädte in ihrer Entfernung 45 Minuten aneinander, und das ist ein Turbo für die Wirtschaft. (Beifall bei Abgeordneten der ÖVP.)
Was heißt das konkret? – Nennen wir sie Larissa: Sie ist 17 Jahre alt und wird jetzt in Klagenfurt maturieren. Sie stammt aus Pörtschach und will Ärztin werden; gleichzeitig ist sie leidenschaftliches Mitglied der Landjugend. Dank der neuen Zugverbindung ab Dezember 2025 – kofinanziert mit Mitteln der Europäischen Union – kann sie ihr Studium in Graz in Angriff nehmen und versäumt abends zu Hause in Kärnten keine Probe der Landjugend mehr.
Ein gemeinsames Europa gibt allen Bürgerinnen und Bürgern von Österreich den besten Bestandsschutz unserer Grundwerte Demokratie, Freiheit, Frieden, Rechtsstaatlichkeit und damit die Chance, eine Karriere nach dem European Way of Life auch umzusetzen.
Spielen Sie bei der Europawahl nicht russisches Roulette, sondern wählen Sie ein besseres Europa mit Reinhold Lopatka und der Österreichischen Volkspartei! (Beifall bei der ÖVP.)
11.20
Präsident Ing. Norbert Hofer: Nächster Redner ist Abgeordneter Mag. Jörg Leichtfried. – Bitte, Herr Abgeordneter. (Abg. Belakowitsch: Ah, der darf auch noch reden?)
Abgeordneter Mag. Jörg Leichtfried (SPÖ): Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Herr Kollege Weidinger, zur linken Mehrheit im Europäischen Parlament: Die stärkste Fraktion ist die Europäische Volkspartei. (Abg. Kickl: Man muss nicht alles wissen! – Zwischenruf der Abg. Belakowitsch.) Das brauchen Sie sich aber nicht mehr zu merken, denn damit wird es nach der Wahl eh vorbei sein, Herr Weidinger. (Beifall bei der SPÖ. – Abg. Kickl: Aber die sehen sich selber, glaube ich, ...!)
Worüber wir uns aber wahrscheinlich einig sind, ist Folgendes: Die Europäische Union ist eine Demokratie, ein demokratisches System, und da muss man nicht und braucht man nicht mit allem einverstanden zu sein, das ist vollkommen klar. Mehrheiten beschließen etwas, andere Teile sind dagegen. Da kann ich etwas, das gerade heute aktuell geworden ist, auch ganz klar sagen: Wenn ein Herr Schlegelmilch von der Europäischen Kommission meint, mit dem Mercosur-Abkommen ist es nicht vorbei, dann sage ich ihm eines: Da wird es den massiven Widerstand der europäischen Sozialdemokratie und der SPÖ geben, weil es für uns mit dem Mercosur-Abkommen vorbei ist (Beifall bei der SPÖ), und da
brauchen wir keinen Bürokraten aus der Kommission, der erzählt, wie es weitergehen soll.
Wichtig in dieser Debatte ist aber schon, dass klar herausgestrichen wird, welche Haltung man bei europapolitischen Entscheidungen hat. Es geht nicht um Plakate, es geht um das, was man im Europäischen Parlament tut, und da ist schon ganz interessant, welche Position die Freiheitliche Partei dort eigentlich ständig einnimmt. Sie tut nämlich das Gegenteil von dem, was sie immer plakatiert und immer behauptet.
Was ist bei der Frage der Mindestlöhne passiert? Was ist bei Schutz vor Arbeitslosigkeit passiert? Was ist beim gerechtfertigten Schutz von Journalistinnen und Journalisten passiert? Was ist mit dem Recht auf eine gesunde Umwelt, weniger Plastikmüll? Was ist mit der Klimawende? (Zwischenruf der Abg. Steger.) Bei all diesen Themen war die FPÖ im Europäischen Parlament entweder dagegen oder hat sich enthalten. Die FPÖ steht da immer auf der falschen Seite der Geschichte! (Beifall bei der SPÖ.)
Sie steht nicht für die Menschen, die jeden Tag in der Früh aufstehen und hart arbeiten, sie steht für die Menschen, die ihr Geld für sich arbeiten lassen! Das ist die Politik der FPÖ im Europäischen Parlament. Das wollen Sie mit Ihren Plakaten verschleiern, aber das wird Ihnen nicht gelingen! Nie und nimmer wird Ihnen das gelingen, das sind nämlich Ablenkungen (Abg. Belakowitsch: Genau! Plastiksackerl!), die Sie da versuchen. (Abg. Kassegger: Dinge zu Ende denken!)
Dann reden Sie über Festungen. (Abg. Belakowitsch: O ja! Es geht ...!) Wissen Sie, was noch mit jeder Festung in der Menschheitsgeschichte passiert ist? – Sie ist zu einer Ruine geworden. Es geht aber nicht um Festungen, sondern es geht darum, wie man insgesamt zur Europäischen Union steht, wie man zu diesem Zukunftsprojekt steht, wie man zur Einbindung Österreichs in der Europäischen Union, zu den Auswirkungen unserer Mitgliedschaft steht. Da hat sich eines als ganz klar herausgestellt: Das Einzige, das die FPÖ wirklich möchte – das sie wirklich möchte! –, ist der Austritt Österreichs aus der Europäischen Union.
Dafür treten Sie an: Dafür machen Sie Ihren Wahlkampf, dafür propagieren Sie das, was Sie propagieren – und das wäre schlecht für Österreich. Das wäre schlecht für unseren Arbeitsmarkt, das wäre schlecht für unsere Wirtschaft, das wäre schlecht für die Menschen in Österreich. Das, was Sie vorhaben, dient nicht unserem Lande, das dient Ihren Interessen, von denen heute eh schon geschildert wurde, wo sie herkommen: Das dient einzig und allein Herrn Putin.
Ich kann das belegen: 2016 gab es einen Entschließungsantrag der FPÖ zum EU-Austritts-Volksbegehren. Oder Herr Vilimsky, der da ganz rechts im Eck sitzt (Abg. Kickl: Neben Herrn Karas!), sagt: Es wäre ratsam, ein Referendum über Österreichs Austritt einzuleiten. Oder: „Es war ein fataler Fehler, Teil dieser EU zu werden.“ Oder was sagt Herr Kickl? Na, Herr Kickl, was sagen Sie? (Abg. Kickl: Lesen Sie es vor! – Zwischenruf der Abg. Steger.) Herr Kickl: Es wäre unverantwortlich, zu sagen, es gibt keinen EU-Austritt. (Abg. Kickl: Das ist ja gescheit! – Abg. Kassegger: Als Möglichkeit! – Abg. Kickl: Das ist ja gescheit! Das ist ja gescheit!)
Das ist das, was Sie wollen. Gebt es einfach zu, seid einfach ehrlich! (Abg. Kickl: Wenn Sie sich das Recht nehmen lassen, dann sollten Sie sich ... setzen und ihr Mandat zurücklegen!)
Einer von euch hat einmal plakatiert: „Einfach ehrlich, einfach Jörg“. Das war damals falsch – heute würde es vielleicht passen –, aber sagen Sie einfach einmal die Wahrheit: Sie wollen, dass Österreich aus der Europäischen Union austritt, und wahrscheinlich wollen Sie auch, dass Österreich dann der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit beitritt. Das habt ihr wahrscheinlich heimlich vor. Weiß jemand, was das ist? – Das ist die neue Sicherheitsorganisation Russlands und seiner Verbündeten. Das ist das, was Sie wirklich wollen. Und sparen Sie sich auch Ihren Neutralitätsschmäh, den nimmt Ihnen nämlich überhaupt niemand ab! Die FPÖ ist nicht neutral, die FPÖ ist auf der Seite Russlands, geschätzte Damen und Herren! (Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordneten der ÖVP. – Heiterkeit des Abg. Wurm.)
Wir als Sozialdemokraten stellen uns gegen den Rechtsruck und gegen die Spaltung Europas. (Abg. Loacker: Ich glaube, ... 5 Minuten!) Wir treten für ein soziales, demokratisches Europa ein, wir wollen ein gerechtes Europa. (Präsident Hofer gibt das Glockenzeichen.) Wir wollen Europapolitik mit Herz und Hirn. – Danke schön. (Beifall bei der SPÖ. – Abg. Kickl: Wieso macht ihr es dann nicht?)
11.26
Präsident Ing. Norbert Hofer: Nächster Redner ist Herr Abgeordneter Michael Schnedlitz. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Michael Schnedlitz (FPÖ): Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich weiß nicht, ob Sie es wissen: Heute ist der letzte Tag der Eisheiligen, und wenn alle Scheinheiligen gleich mitgehen, dann wird es ziemlich schnell ziemlich leer hier herinnen! (Beifall bei der FPÖ. – Hallo-Rufe bei der SPÖ.)
Frau Minister Edtstadler hier neben mir hat gerade gesagt, die Freiheitlichen, das sind die bösen, bösen Putin-Freunde. – Jetzt weiß ich nicht – vielleicht können Sie mir helfen (ein Foto, auf dem Karoline Edtstadler und Wladimir Putin zu sehen sind, in die Höhe haltend) –, wer da auf diesem Bild drauf ist, aufgetakelt in den Nationalfarben Russlands (Ruf bei der FPÖ: Die Sweet Caroline!), Seite an Seite mit Putin. Vielleicht können Sie mir helfen, vielleicht wissen Sie es. (Zwischenbemerkung von Bundesministerin Edtstadler. – Abg. Heinisch-Hosek: Zerreiß das, bitte! – Abg. Ernst-Dziedzic: Was heißt aufgetakelt? – Weitere Rufe: Aufgetakelt! – Ruf bei der SPÖ: Herr Präsident ...! – Abg. Holzleitner: ... das entspricht nicht der Würde des Hauses! – Weitere Zwischenrufe bei SPÖ und Grünen.) Sind das Sie, Frau Minister? Ah, sind das Sie? Für wie blöd halten Sie die Menschen, und was glauben Sie, für wie dumm Sie die Menschen draußen verkaufen können, sehr geehrte Damen und Herren? (Beifall bei der FPÖ. – Ruf bei der SPÖ: Herr Präsident ...!)
Das, was Sie machen – wieder alle eingehängt, die Einheitspartei: die Schwarzen, die Grünen, die Roten, die NEOS –, ist Antiösterreichpolitik, das ist Politik gegen
die Österreicher. Sie alle rutschen gemeinsam – das ist Ihr System – auf den Knien nach Brüssel. Dort lassen Sie sich am Nasenring durch die Manege ziehen, holen sich vom System Ihre Schulterklopfer ab und glauben, Sie sind super. (Abg. Leichtfried: Gibt es da einen Präsidenten auch?)
Wissen Sie, auf wen Sie dabei vergessen? – Auf die Leute draußen, auf die Österreicherinnen und auf die Österreicher! (Beifall bei der FPÖ.) Die müssen dann den hohen Preis dafür bezahlen, dass Sie sich gemeinsam mit dem System in Brüssel verhabern und dass Sie sich Ihre Schulterklopfer abholen. (Zwischenruf des Abg. Schnabel.)
Ich bin auch dankbar für Ihre Nabelschau, die Sie hier herinnen zum Besten geben, weil Sie hier herinnen dasselbe machen wie in Brüssel: Sie vertreten jegliche Interessen, nur nicht die Interessen Österreichs. Sie vertreten die Interessen der Pharmaindustrie, Sie vertreten die Interessen der Kriegstreiber, Sie vertreten die Interessen der Illegalen und Schlepper, und jeden, der da nicht mitmacht – übersetzt: Kickl, Vilimsky, die Freiheitlichen und Millionen von Leuten draußen –, beschimpfen Sie dann. Die werden dann von Ihnen als Schwurbler und als Aluhutträger beschimpft. (Abg. Hörl: Nein, nein, nein!) Wenn man sich nicht zwangsimpfen lässt – das kam von der Frau Minister neben mir –, wird man als Illegaler bezeichnet. Das haben die Menschen nicht vergessen, und Sie werden die Rechnung dafür bekommen, das verspreche ich Ihnen. (Beifall bei der FPÖ.) Die Menschen werden als Schwurbler, als Aluhutträger, als Putin-Versteher, als Rechtsextreme beschimpft. (Ruf bei der ÖVP: Ja, genau!) Das ist Ihr Betriebssystem, mit dem Sie arbeiten.
Ich gebe Ihnen aber eine Antwort darauf: Immer her mit den Beschimpfungen, immer her mit den Angriffen! Beschimpfen Sie uns ruhig als Aluhutträger und als Schwurbler, wir machen trotzdem nicht bei dreckigen Deals mit der Pharmaindustrie mit – Stichwort von der Leyen. Immer her mit den Angriffen! Wenn es die Wähler so wollen, werden wir Freiheitliche dafür sorgen, dass so etwas wie bei Corona nie wieder – aber auch nie wieder! – passiert, egal wie sehr Sie uns dafür auch beschimpfen. (Beifall bei der FPÖ. – Zwischenruf des Abg. Schnabel.)
Beschimpfen und verunglimpfen Sie uns ruhig als Russlandspione oder Putin-Versteher, wir bleiben dabei: Neutralität! Wir stehen in der Mitte, während Sie sich hinter Amerika einhängen, hinter der Nato, hinter Schelensky (Abg. Ernst-Dziedzic: Selenskyj!), während Sie weiter an der Eskalationsschraube drehen. Das tun wir nicht, weil wir Putin-Freunde und Putin-Versteher sind – ich habe es Ihnen schon öfter erklärt –, nein, sehr geehrte Damen und Herren; wir sind aber auch keine Schelensky-Versteher und keine Amerikaversteher. (Abg. Ernst-Dziedzic: Selenskyj!) Wir Freiheitliche sind Österreichversteher, weil es nicht sein kann, dass die österreichische Bevölkerung den hohen Preis für Kriegstreiberei und Sanktionen bezahlen muss. (Beifall bei der FPÖ.)
Beschimpfen Sie uns ruhig als Rechtsextreme – nur weil Sie sich alle um die Illegalen kümmern, während wir uns um die Österreicher kümmern. (Zwischenruf der Abg. Scharzenberger.)
Ja, wir stehen dazu: eine Festung als Schutzschild und als Schutz für die Menschen vor Übergriffen und vor all dem, was Sie verursacht haben und weswegen sich sehr viele in der Nacht nicht mehr alleine auf die Straße gehen trauen – vor allem Frauen und Kinder. Beschimpfen Sie uns ruhig, wir halten das alles aus.
Wir sind auch keine Antieuropäer. Wir und unsere Wähler sind die einzigen echten Europäer (Abg. Gerstl: Mir kommt das Grauen!), weil uns unser Kontinent nicht egal ist, während Sie Europa in den Untergang führen, sehr geehrte Damen und Herren. (Beifall bei der FPÖ. – Zwischenrufe der Abgeordneten Greiner und Schnabel.)
Genau zu diesem Untergang sagen wir Stopp: Schluss mit diesem Wahnsinn! Stopp zu Korruption! Stopp zum Ausverkauf österreichischer Interessen! (Anhaltende Rufe und Gegenrufe zwischen Abgeordneten von ÖVP und FPÖ.) Stopp zu Ihrem abgehobenen System, in dem Sie und die Eliten glauben, Sie stehen da oben und da unten steht der Pöbel, das Volk, das man als Untertanen behandeln kann!
Auch die Menschen und die Wähler werden bei der nächsten Wahl die Stopptaste drücken, weil die Leute durchschaut haben, dass sie sich das von Ihnen nicht länger gefallen lassen müssen. (Abg. Schnabel: Und sehr erfolgreich in Graz!) Bei der nächsten Wahl erhalten Sie die gerechte Rechnung. (Beifall bei der FPÖ.)
11.31
Präsident Ing. Norbert Hofer: Sehr geehrter Herr Abgeordneter, für den eingangs erwähnten Vorwurf der Scheinheiligkeit habe ich Ihnen einen Ordnungsruf zu erteilen. (Abg. Leichtfried: Radio Moskau wird immer nervöser!)
*****
Zu Wort gemeldet ist nun Frau Dr. Ewa Ernst-Dziedzic. – Bitte schön, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete Dr. Ewa Ernst-Dziedzic (Grüne): Herr Präsident! Frau Ministerin! Werte Kollegen und Kolleginnen und werte Gäste! Ja, tatsächlich ist das berechtigt, denn hier eine Ministerin als „aufgetakelt“ zu bezeichnen, zeugt ja von Ihrem Niveau. (Beifall bei den Grünen sowie bei Abgeordneten von ÖVP, SPÖ und NEOS. – Abg. Reifenberger: Ah geh, hör auf!)
Heute hat Gudenus ja schon unseren Präsidenten als „homo“ bezeichnet. – Das ist das Niveau, auf dem die Freiheitlichen hier im Parlament tatsächlich Zeugnis ablegen, welches Geistes Kinder sie sind. (Beifall bei Abgeordneten der Grünen. – Abg. Schnedlitz: Wenn jemand Ungeimpfte als Illegale bezeichnet hat, dann hat er es verdient! – Zwischenruf des Abg. Hauser.) Tatsächlich – ich gebe Kollegen Tom Waitz recht – sollte die Aktuelle Europastunde umbenannt werden in: FPÖ-Wahnsinn stoppen.
Wieso? – Das ist durch Fakten belegbar, sehr geehrte Damen und Herren: FPÖ-Wahnsinn stoppen deshalb, weil man nicht nur Autokraten wie Putin – das
haben wir heute öfter gehört – die Mauer macht und der Freundschaftsvertrag mit der Putin-Partei weiterhin aufrecht ist, sondern weil Sie auch nicht im Interesse der österreichischen Bevölkerung agieren, sondern Ihre Entscheidungen anscheinend auf Grundlage dieses Freundschaftsvertrages treffen. Das ist ein Sicherheitsrisiko für uns alle in Österreich. (Beifall bei den Grünen sowie des Abg. Matznetter.)
Wir wissen, dass die FPÖ konsequent auf der falschen Seite der Geschichte steht – und da auch an der Seite des Aggressors. Die FPÖ hat aber auch keine Lösungen, meine Damen und Herren, sondern verbreitet hier kontinuierlich die propagandistischen Narrative aus Russland. Auch das ist mit Fakten belegbar. (Zwischenruf des Abg. Hafenecker.)
Die FPÖ ist auch keine Friedenspartei, meine verehrten Damen und Herren. Sie unterstützt nämlich keinen Frieden – für die Ukraine beispielsweise –, der auf der Basis von Völkerrecht, auf der Basis der UN-Charta steht, sondern sie will einen faulen Kompromiss. Wozu braucht es einen faulen Kompromiss, der nicht nur Österreich und Europa schadet? – Damit Putin tatsächlich auch noch ein Einfallstor mehr nach Europa hat.
Diese Scheuklappenpolitik im reinen Eigeninteresse der FPÖ ist ja nicht nur inakzeptabel, sie ist ja nicht nur ein Sicherheitsrisiko, sondern sie ist tatsächlich eine Bedrohung für die Sicherheit, für den Frieden, für unsere Freiheit in Europa.
Wir werden alle – und Sie merken es ja schon, dass Sie hier ziemlich alleine dastehen (Abg. Amesbauer: Weil ihr System seid! Wir sind gegen das System ...!) – hier im österreichischen Parlament nicht müde, aufzuzeigen, wofür Sie stehen und für wen Sie arbeiten, liebe FPÖ.
Von wegen, aus der Geschichte zu lernen: Diese Fähigkeit spreche ich Ihnen ab. Sie wissen, Mauern hat man schon einmal gebaut, Festungen hat man schon bauen wollen. 1989 ist das beste Beispiel dafür, dass wir in Europa eines Besseren belehrt worden sind. (Beifall bei den Grünen.) Nach 1989 ist genau
dieser europäische Gedanke zu einem tragenden geworden, da er Frieden und Freiheit und Sicherheit garantieren möchte – und genau das möchten Sie zerstören! (Zwischenrufe der Abgeordneten Belakowitsch und Schrangl.)
Natürlich sind wir solidarisch mit der Ukraine, weil die Ukraine nämlich genau diese europäischen Werte (Abg. Belakowitsch: Welche Werte?), genau diese Sicherheit an unseren Außengrenzen verteidigt, während Sie weiterhin Putin die Räuberleiter machen. (Beifall bei den Grünen.) Wir sehen, wohin Sie wollen!
Sie kriegen vielleicht mit, was gerade in Georgien passiert. Dort wird mit viel Gewalt, auch Polizeigewalt, die Bevölkerung, die für Frieden, Freiheit, Sicherheit und Demokratie auf die Straße geht, brutal abgedrängt, im Sinne der russischen Interessen. (Abg. Amesbauer: Da sind auch wir schuld, oder wie?) Ich frage Sie hier nochmals und in aller Klarheit: Ist es das, was die FPÖ für Österreich möchte? Ist es das, was Sie hier in Österreich möchten? Polizeigewalt gegen friedliche Protestierende für Demokratie – im Interesse Ihres Freundschaftsvertrages? Das ist die Wahrheit. (Beifall bei den Grünen. – Abg. Schnedlitz: Haben wir alles erlebt während Corona! Ihr wart dabei! Das alles haben wir erlebt! – Abg. Hafenecker: Sie haben die Kinder zu Hause eingesperrt und nicht zur Schule gelassen! – Weitere Zwischenrufe bei der FPÖ.)
Das Motto der EU lautet, wie wir wissen: „In Vielfalt geeint“, und das ist Ihnen mit Ihrem nationalen Einheitsbrei wahrscheinlich ein Dorn im Auge. (Abg. Schnedlitz: Da brauche ich nirgends anders hinzuschauen! Ihr seid schlimmer als Putin!) Wir werden aber nicht müde, diese Europäische Union bei aller Kritik, die berechtigt ist, bei allen Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, weiterhin im Sinne des Friedens, der Freiheit und der Sicherheit zu verteidigen. (Beifall bei den Grünen sowie der Abg. Steinacker. – Zwischenrufe bei der FPÖ.)
Wir werden nicht müde und wir werden nicht aufhören (Abg. Kassegger: Realitätsfremde Schlagworte, die Sie da produzieren! – Ruf bei der FPÖ: Ihr seid das Letzte! – Rufe und Gegenrufe zwischen Abgeordneten von FPÖ und ÖVP) aufzuzeigen, dass wir, wenn wir das nicht tun, dieses Europa den Totengräbern
überlassen. Ihr permanentes Gegröle hier – wie im Bierzelt! – zeugt ja nicht nur von Ihrem Niveau (Beifall bei den Grünen sowie bei Abgeordneten von ÖVP, SPÖ und NEOS), sondern auch davon, dass Sie wie in Georgien, wie in Belarus, wie in Russland nicht imstande sind, Meinungsvielfalt zuzulassen (Präsident Hofer gibt das Glockenzeichen), dass Sie es nicht aushalten, in einer Demokratie tatsächlich die anderen Meinungen stehen zu lassen (anhaltende Zwischenrufe bei der FPÖ) – und das ist ein Sicherheitsrisiko für uns alle. (Beifall bei den Grünen sowie bei Abgeordneten von SPÖ und NEOS. – Abg. Schnedlitz: Ihr seid die Zensurpartei! – Präsident Hofer gibt das Glockenzeichen.)
Meine verehrten Damen und Herren! (Abg. Belakowitsch: Euer Vizekanzler hat gesagt ...!) Es bleibt nicht die Zeit, auf den Freundschaftsvertrag und darauf, dass man schon 2008 angefangen hat, sich an Moskau anzunähern, einzugehen. Es bleibt nicht die Zeit, auf den Knicks unserer Außenministerin einzugehen (Präsident Hofer gibt das Glockenzeichen), die Sie nominiert haben.
Präsident Ing. Norbert Hofer: Frau Abgeordnete, den Schlusssatz bitte!
Abgeordnete Dr. Ewa Ernst-Dziedzic (fortsetzend): Es bleibt aber Zeit, zu sagen, dass wir dieses Europa bei allen Herausforderungen nicht den Zerstörern von Europa – wie Ihnen – überlassen werden. (Beifall bei den Grünen sowie bei Abgeordneten von ÖVP, SPÖ und NEOS.)
11.37
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Claudia Gamon. – Bitte schön, Frau Abgeordnete.
Mitglied des Europäischen Parlaments Claudia Gamon, MSc (WU) (NEOS): Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Frau Ministerin! Bei der Anreise nach Wien habe ich einen Podcast zu den Protesten in Georgien gehört, und ein Mann hat da gesagt: I would rather die than be a slave to Russia.
In Tbilissi wird gerade ein Kampf um die Seele Europas und um die Zukunft Europas geführt. Die liberale, westliche Weltordnung ist für diese Menschen ein Hoffnungsschimmer, den sie brauchen, um täglich für eine Zukunft in Europa, eine Zukunft ohne Russland, eine Zukunft mit Freiheit und Demokratie auf die Straße zu gehen.
Die Debatten, die wir hier vor fünf Jahren anlässlich der letzten EU-Wahl geführt haben, wirken in Anbetracht des Überlebenskampfes für die liberale Demokratie, in dem wir uns jetzt befinden, lächerlich.
Werte Zuseherinnen und Zuseher, gehen Sie zur EU-Wahl! (Abg. Kickl: Bitte! Bitte gehen Sie zur EU-Wahl!) Ihre Stimme wird einen Unterschied dahin gehend machen, ob das EU-Parlament in den nächsten fünf Jahren überhaupt noch eine arbeitsfähige Mehrheit haben wird oder nicht.
Wir wurden als EU-Abgeordnete in den letzten Jahren oft gefragt, was zum Teufel wir eigentlich machen. Diese Gelegenheit nutze ich jetzt gerade gerne. Ich war als Abgeordnete mittendrin bei vielen Verhandlungen: zur Energiewende, zu Energiespeichern, zur Infrastruktur, zur Dekarbonisierung der Gasnetze, zum Emissionszertifikatehandel, zu nachhaltigem Fliegen, zur Reform des Strommarktes und zu vielem mehr. Ich kann für viele meiner Kolleg:innen in der ÖVP, der SPÖ und bei den Grünen sprechen und sagen: Wir arbeiten im EU-Parlament an Sachfragen.
Jene, denen man diese Frage eigentlich stellen muss, sitzen hier bei der FPÖ. (Abg. Wurm: Aha, jetzt kommtʼs!) Was habt ihr eigentlich die letzten fünf Jahre für Europa gemacht? (Beifall bei NEOS und Grünen sowie bei Abgeordneten der ÖVP. – Rufe bei NEOS und Grünen: Champagner!)
Eure Fraktion im EU-Parlament hat das einzige Ziel, jeglichen sinnvollen Kompromiss zu verhindern, Lösungen zu blockieren, wichtige Reformen zunichte zu machen. (Abg. Hafenecker: Von Ihnen habe ich überhaupt nichts gehört!) Ich bin in etlichen Verhandlungsrunden zu wichtigen Gesetzen gesessen, wo kein einziger
Vertreter Ihrer Fraktion anwesend war oder in irgendeiner Art und Weise mitgearbeitet hat.
Während andere wirklich an echten Lösungen für die Zukunft Europas arbeiten, schwierige Kompromisse zimmern, andere von wichtigen Dingen überzeugen, tut die FPÖ das, was sie immer schon getan hat – verhindern, blockieren, zu allem, was wichtig wäre, Nein sagen –, weil sie ja auch überhaupt kein Interesse daran hat, dass irgendetwas besser wird. (Beifall bei den NEOS sowie des Abg. Schallmeiner.)
Ohne Probleme existiert die FPÖ ja gar nicht mehr. Es ist ja Ihre Raison d’Être, dass alles immer schlimmer wird, alles immer schlechter wird. Das ist das Einzige, worauf Ihre Partei aufbaut.
Und in dieser Europastunde fordert die FPÖ eine Festung Europa. Was soll denn das überhaupt sein? Eine Festung ist ja sonst auch etwas, das gesichert ist und im Ernstfall verteidigt werden kann. Ist die FPÖ jetzt für eine gemeinsame EU-Verteidigung? Wollen Sie eine EU-Armee? Wollen Sie ein stärkeres Europa? – No na net, nein, nein, das will die FPÖ ja gar nicht. (Beifall bei den NEOS. – Abg. Meinl-Reisinger: Na eine Festung musst verteidigen!)
Was Sie wollen, ist ein schwaches Europa, das keine Entscheidungen treffen kann; was Sie wollen, ist ein Europa, das sich gegenüber Russland zum Beispiel nicht verteidigen kann; das sich für seine Bürgerinnen und Bürger niemals weiterentwickeln wird. Was die FPÖ will, ist eine Hüpfburg Europa (Heiterkeit und Beifall der Abg. Meinl-Reisinger), wo uns Russland auf der Nase herumtanzen kann. (Abg. Kickl: Beeindruckend, was die Kollegin alles weiß, was wir wollen und was wir nicht wollen!) Und bevor auch nur irgendjemand diese Hüpfburg Europa betreten kann, haben die Freunde Putins Österreich dieses so oder so längst an russische Spione verscherbelt. – Willkommen im Europa der FPÖ! Viel Spaß dabei! (Beifall bei den NEOS.)
Liebe Bürgerinnen und Bürger, bitte gehen Sie zur EU-Wahl (Abg. Wurm: Ja, bitte! – Abg. Belakowitsch: Ja, bitte gehen Sie!), Ihre Stimme macht einen Unterschied! Ihre Stimme macht einen Unterschied! (Abg. Wurm: Genau!) Wenn es keine brauchbare Mehrheit von Demokratinnen und Demokraten im EU-Parlament gibt, wird sich nichts weiterbewegen, die FPÖ wird kein einziges der Probleme, die wir in Europa haben, lösen. (Abg. Kassegger: Also die anderen sind die brauchbare Mehrheit! Und Sie schwafeln was von liberaler Demokratie! Die braucht aber die Mehrheit!)
Es war mir persönlich eine Ehre, fünf Jahre im EU-Parlament arbeiten zu dürfen, Europa mitgestalten zu dürfen (Ruf bei der ÖVP: Die 5 Minuten sind vorbei! – Abg. Belakowitsch: Reden Sie weiter, das ist so gut! – Abg. Kassegger: Sie widersprechen sich in einem Satz selbst!), und ich möchte an dieser Stelle auch noch ein bisschen meiner Redezeit dafür verwenden, um Othmar Karas zu danken (Ah-Rufe bei der FPÖ), ihm für seine vielen Jahre im Dienste Europas zu danken. (Beifall bei NEOS, ÖVP, SPÖ und Grünen.) Ich glaube, das zu sagen ist besonders in diesem Haus, wo er seine politische Arbeit begonnen hat, wichtig. – Danke, Othmar. – Vive l’Europe! (Beifall bei den NEOS sowie der Abg. Fischer. – Abg. Wurm: Danke, Othmar! – Abg. Belakowitsch: Danke! – MEP Gamon begibt sich zu MEP Karas und küsst diesen auf beide Wangen. – Oh-Rufe bei der FPÖ. – Abg. Kickl: Bussi, Bussi! – Abg. Wurm: Die Bussi-Bussi-Gesellschaft Europas! Na, bitte geniert euch! – Abg. Disoski: Seid einmal leise! Das gibt es ja nicht!)
11.41
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gemeldet ist nun Abgeordneter Dr. Othmar Karas. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Mitglied des Europäischen Parlaments Dr. Othmar Karas, MBL-HSG (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuseher:innen auf der Galerie und vor den Bildschirmen! (Unruhe im Saal. – Abg. Leichtfried: Geh gebts einmal Ruhe!) Der heutige Tag ist für Österreich und für die
Österreicherinnen und Österreicher der Tag des Friedens in Freiheit. Beides ist keine Selbstverständlichkeit, sondern wird von innen und von außen bedroht. Deshalb schmerzt mich besonders das von der FPÖ gewählte Thema fast körperlich. Allein die Behauptung, eine Festung Europa wäre ein Garant für Wohlstand und Freiheit, ist an Absurdität kaum zu überbieten. (Beifall bei ÖVP, SPÖ, Grünen und NEOS.)
Österreich, ein Land, dessen Wohlstand auf den Schultern der Bürgerinnen und Bürger und der Betriebe aufbaut, ein Land, das allein im vergangenen Jahr mehr als 200 Milliarden Euro an Waren exportiert hat, Österreich, ein Land, in dem fast 5 Prozent des BIP durch den Tourismus erwirtschaftet werden, ein Land, das global für seine Kultur, Kunst, atemberaubende Landschaft und seine Innovationskraft steht, Österreich, ein Land, das in den kommenden Jahren Hunderttausende neue Arbeitskräfte benötigt, ein Land, das erst durch den Beitritt zur Europäischen Union und die Erweiterung der Europäischen Union vom Rand ins Zentrum gerückt ist, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FPÖ! Eine Festung Europa (Abg. Amesbauer: Hat die Mikl-Leitner auch einmal gefordert!) führt lediglich zu einer Schwächung des Standortes Österreich und Europa und schadet somit allen Österreicherinnen und Österreichern. (Beifall bei ÖVP, SPÖ, Grünen und NEOS.)
Als ich 1983, am 19. Mai, in diesem Hause erstmals angelobt wurde, habe ich begonnen, für das europäische Projekt zu werben, zwölf Jahre später sind wir der Europäischen Union beigetreten. Seit 30 Jahren erleben wir die Erfolge, ja, auch die Enttäuschungen und die Niederlagen, aber in Summe den Aufschwung, den unser Österreich durch die Mitgliedschaft in der Europäischen Union erlebt hat – und trotzdem sitzt hier eine Fraktion, die am liebsten ins letzte Jahrhundert zurück möchte, und das am besten mit dem Schilling.
Wir wissen aber alle ganz genau, was die FPÖ mit einem mangelnden Umgangston – wie wir das heute schon gegenüber unserer Ministerin gehört haben –, aber auch mit diesem Thema bezwecken will: Sie zündeln mit dem Öxit, Sie
erinnern an den Brexit, Sie wollen die europäische Demokratie und die Europäische Union und damit uns als Gemeinschaft schwächen (Abg. Kassegger: Von was redet der?) und Sie spielen mit den Ängsten und Sorgen unserer Bürgerinnen und Bürger. (Beifall bei ÖVP und Grünen. – Abg. Kickl: Na Sie nicht?!)
Das halte ich für unverantwortlich, da wir das aus der Geschichte kennen: Jene, denen es schlecht geht, die unzufrieden sind, die das Vertrauen verloren haben (Abg. Belakowitsch: Warum ist das so, wenn das alles so super ist?), sind für die einfachen Botschaften empfänglicher. (Abg. Kickl: So komplex sind Ihre Botschaften auch nicht!) Dabei sind all jene, die behaupten, die Herausforderungen lassen sich einfach lösen, einfach Blender.
Wir müssen aufmerksam bleiben. Wir dürfen als EU nicht zögern, sondern müssen handeln, sonst werden wir zwischen den Großmächten und in einer neuen geopolitischen Weltordnung zerrieben. Auch um diese Richtungsentscheidung geht es am 9. Juni bei der Europawahl.
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Nach 25 Jahren im Europäischen Parlament ist es auch für mich heute meine letzte Europastunde in diesem Haus. (Abg. Belakowitsch: Gott sei Dank! – Rufe bei der ÖVP – in Richtung Abg. Belakowitsch –: Niveaulos! – Abg. Stefan – in Richtung ÖVP –: So niveaulos werdet ihr nie! Das habt ihr noch nie gesagt! – Abg. Holzleitner: Widerlich! Wirklich widerlich!) Ich durfte beide Seiten kennenlernen. (Rufe und Gegenrufe zwischen Abgeordneten von ÖVP und FPÖ. – Abg. Leichtfried: Gebt endlich einmal Ruhe!) In diesem Haus, meine Damen und Herren, beschließen wir Gesetze für neun Millionen Bürgerinnen und Bürger, im Europäischen Parlament machen wir Regeln für 450 Millionen Europäerinnen und Europäer. Beide Häuser haben eines gemeinsam: Sie sind die Bürgerkammern, das Herzstück der Demokratie. Wir sind ausschließlich den Bürgerinnen und Bürgern und unserem Gewissen verpflichtet (Abg. Belakowitsch: Richtig!) – vergessen wir das nie, seien wir uns dieser Verantwortung endlich verstärkt bewusst! (Anhaltender Beifall bei ÖVP, SPÖ, Grünen und NEOS.)
11.47
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt Frau Abgeordnete Eva Maria Holzleitner. – Bitte, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete Eva Maria Holzleitner, BSc (SPÖ): Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Ministerin! Werte Zuseherinnen und Zuseher! Während der Rede von Kollegin Ewa Ernst-Dziedzic hat Kollege Schnedlitz reingerufen: Sie sind schlimmer als Putin! – Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen! Schlimmer als Putin heißt, man vergleicht mit einem Kriegsverbrecher, der Frauen in seinem eigenen Land gefährdet, indem er Männer, die an der Front und zuvor im Gefängnis waren, begnadigt; das heißt, einen Mann gleichzusetzen mit einer demokratischen Partei, mit einer demokratischen Kollegin, einen Mann, der sexualisierte Gewalt durch seine Soldaten anordnet; das heißt, jemanden mit jemandem zu vergleichen, der als Kriegsverbrecher ein souveränes Land angegriffen hat und Kinder verschleppen lässt. – Herr Kollege Schnedlitz, sind Sie noch bei Sinnen? (Anhaltender Beifall bei SPÖ, ÖVP, Grünen und NEOS. – Rufe bei der SPÖ: Nein!)
Ein derartiger Vergleich ist an Widerwärtigkeit kaum zu überbieten (Abg. Kickl: Dann merken Sie sich das für Ihre NS-Vergleiche! Wir werden Sie an diesen Maßstäben messen!) und zeigt, an welchem Scheideweg sich die Europäische Union bei dieser Wahl auch tatsächlich befindet: Können wir weiterhin gute Fortschritte für die Menschen vorantreiben oder verzwergt man sich à la manière der FPÖ?
Wir haben schon gehört, wo Sie überall dagegen waren oder keine Position dazu bezogen haben. Egal ob Entgelttransparenz, Quoten für Vorstands- und Aufsichtsratspositionen, all das sind wesentliche gleichstellungspolitische Maßnahmen, die in Zukunft auch Frauen tatsächlich fördern werden.
Die FPÖ stellt sich auch ganz klar gegen eine Sozialunion, in der es darum geht, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht mehr Spielball unfairer Arbeitsbedingungen sind. (Abg. Kassegger: Und die SPÖ ist dafür!) Es geht um
Praktikantinnen, es geht um Paketboten, es geht ehrlicherweise auch um Erntehelferinnen und Erntehelfer, die nicht mehr Spielball von irgendwelchen unterschiedlichen, unfairen Arbeitsbedingungen sein dürfen. (Beifall bei der SPÖ sowie der Abgeordneten Disoski und Fischer.)
Wir wollen eine Wirtschaftsunion, in der Großkonzerne tatsächlichen ihren Beitrag leisten, und zwar den, den sie auch leisten müssen, und der ist größer als jener vom Würstlstandl ums Eck. (Abg. Kickl: Der Babler war ja auch immer ein glühender Europäer!) Wir wollen eine demokratische Union, nicht wie die FPÖ, die ständig nur Hass und Hetze sät, die denunziert, die sich gegen das System stellt. (Abg. Amesbauer: Denunzieren tut die Frau Schilling!)
Herr Kollege Amesbauer! Das System ist Demokratie, das System ist Parlamentarismus, das System ist Rechtsstaat – all das wollen Sie offenbar nicht. (Beifall bei SPÖ, ÖVP, Grünen und NEOS.)
Aber die Auseinandersetzungen zu diesen Themen sind Ihnen halt einfach unangenehm. Unangenehm ist alles, was irgendwie demokratisch ist. Unangenehm ist auch ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Unangenehm ist kritischer Journalismus. (Zwischenruf bei der FPÖ.) All das wundert mich aber nicht; das zeigt Ihr Parteivorsitzender ja tagtäglich, indem er sich all diesen Auseinandersetzungen, egal ob in der „Zeit im Bild“, in Interviews oder im Untersuchungsausschuss, wirklich nicht stellen möchte. (Ruf bei der SPÖ: Er gibt lieber sein Geld aus!)
All das, Herr Kollege Kickl, können Sie durchaus ausräumen. Sie sind als nächster Redner eingemeldet. Wie schaut es aus mit Treuhandverträgen? Wie schaut es aus mit Verträgen mit Russland? Legen Sie doch einmal offen, was tatsächlich Sache ist! Machen Sie reinen Tisch! (Beifall bei SPÖ, ÖVP und Grünen.)
Sie verlangen das immer von anderen: die reine Weste. Aber diese reine Weste haben Sie doch selber nicht, und das wissen Sie, deshalb schweigen Sie auch (Zwischenruf der Abg. Meinl-Reisinger – Abg. Leichtfried: Der ist einfach zu feig!) zu
all den Vorhalten, die jetzt am Tisch liegen. (Abg. Kassegger: Zuerst sind wir zu laut, jetzt schweigen wir, ...!) Das ist wirklich beschämend.
Die FPÖ steht niemals für Transparenz und auch nicht für Ehrlichkeit, denn all das, was wir hier in dieser Europastunde von der FPÖ gehört haben, spricht ja für einen Öxit. Aber auch das, den Austritt aus der Europäischen Union, sprechen Sie nicht an (Zwischenruf der Abg. Belakowitsch – Abg. Meinl-Reisinger: Weil die Leute das eh nicht wollen! – Abg. Wurm: Sind ja erst 40 Prozent, die das wollen, ...!), denn für die Wahrheit sind Sie doch tatsächlich zu feig. Genau diese Feigheit zeigt sich einfach in vielen Ihrer Ausführungen und Positionierungen. (Abg. Kassegger: Also, da waren jetzt auch drei oder vier Beschimpfungen drinnen, Frau Kollegin! Wer im Glashaus sitzt! Gut formuliert, aber Beschimpfungen!)
Für uns ist klar: Die FPÖ ist alles andere als ein Bündnispartner für Demokratie, Parlamentarismus und Rechtsstaatlichkeit. Wer wirtschaftlich, sozial und menschlich Köpfchen hat, der weiß: Die Zukunft kann nur in einer solidarischen Union tatsächlich gelebt werden. (Beifall bei SPÖ und Grünen sowie bei Abgeordneten der ÖVP.)
11.52
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt nun Herr Klubobmann Herbert Kickl. – Bitte, Herr Klubobmann. (Zwischenruf des Abg. Leichtfried.)
Abgeordneter Herbert Kickl (FPÖ): Herr Präsident! Hohes Haus! Frau Bundesminister für Verfassungsbruch (Abg. Meinl-Reisinger: Oida!), Entrechtung, Diskriminierung und Verfolgung von eigenen Staatsbürgern! (Unruhe im Saal. – Abg. Meinl-Reisinger: ... so stehen lassen? – Abg. Steinacker: Geh bitte! Herr Präsident, so geht das nicht! Eine Titulierung einer Bundesministerin in diesem Ton geht so nicht! Herr Präsident, das geht nicht! Die Ministerin bricht nicht die Verfassung! – Rufe bei ÖVP, SPÖ und Grünen: Ordnungsruf, Herr Präsident!) – Na ja, dieser Schandfleck wird Ihnen bleiben. Das ist ein Faktum. (Beifall bei der FPÖ.)
Vor allem aber: Liebe Zuseher, liebe Wählerinnen und Wähler! Ich wende mich heute - - (Abg. Meinl-Reisinger: Zur Geschäftsordnung!) – Bitte! Na, sehen Sie! (Zwischenruf der Abg. Steinacker. – Ruf bei der SPÖ – in Richtung Präsident Hofer –: Mach einmal deine Arbeit! – Ruf bei der ÖVP: Treten Sie zurück!)
Präsident Ing. Norbert Hofer: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bitte um Ruhe! Zur Geschäftsordnung - - (Abg. Leichtfried: ... wenn der Präsident seine Arbeit macht! – Abg. Steinacker: Das ist doch ein Ordnungsruf! Das geht doch nicht, bitte! Was soll das? Da kann man nicht so lang ...!)
Ich bitte um Ruhe und darum, zuzuhören! – Bitte, setzen Sie fort!
Abgeordneter Herbert Kickl (fortsetzend): Es bestätigt sich einmal mehr, dass die Wahrheit wehtut. (Beifall bei der FPÖ. – Neuerliche Zwischenrufe bei ÖVP, SPÖ und Grünen.)
Wissen Sie, ich wende mich heute an die Wählerinnen und Wähler, weil beim Großteil von Ihnen hier herinnen ohnehin Hopfen und Malz verloren ist. (Abg. Hanger: In allererster Linie bei dir, das sag ich dir auch! – Weitere Zwischenrufe bei ÖVP, SPÖ und Grünen.) Ich wende mich deshalb an die Wählerinnen und Wähler (Abg. Voglauer: Was denn? Nein, wir wollen Ihnen nicht zuhören!), weil sie und nur sie es in der Hand haben, in diesem Land die notwendige und längst überfällige Wende zum Guten herbeizuführen. Das haben die Wähler in der Hand, und das ist dasjenige, wovor Sie sich am allermeisten fürchten.
Sie vonseiten der Einheitspartei wollen etwas ganz anderes (neuerlicher Zwischenruf der Abg. Voglauer): Sie wollen in diesem Land weitermachen wie bisher, koste es, was es wolle, auf Kosten der österreichischen Bevölkerung, auf ihrem Rücken und zu ihrem Nachteil, auch im Bereich des Asyls. (Beifall bei der FPÖ.)
Jetzt möchte ich die Bevölkerung nur einladen, ein gemeinsames Gedankenexperiment zu machen. (Abg. Voglauer: Nein, mit Ihnen nicht! Mit Ihnen machen wir keine Experimente! Das geht immer schlecht aus!) Denken Sie bitte in diesen Sekunden an Ihre eigenen vier Wände, an Ihre Wohnung, an Ihr Haus und dann
stellen Sie sich bitte folgende Fragen: Wer von Ihnen würde denn bei dieser Wohnung oder bei diesem Haus die eigene Wohnungstür das ganze Jahr über unversperrt lassen oder überhaupt darauf verzichten, ein Schloss einzubauen? Wer würde das tun? (Abg. Zarits: Das ist ein Vergleich!)
Wer von Ihnen würde jeden Fremden in sein Wohnzimmer, sein Schlafzimmer, seine Küche, sein Bad hineinlassen? Wer würde sagen: Kommt nur herein, bitte, und richtet euch ein!? (Neuerlicher Zwischenruf des Abg. Zarits.) Die einzige Voraussetzung ist, dass ihr Asyl sagen müsst, und es muss euch bei uns oder bei Ihnen in der Wohnung besser gefallen als dort, wo ihr herkommt.
Wer von Ihnen würde dann die Eindringlinge dazu auffordern: Ja, bitte nehmt euch nur alles, was ihr braucht!? Wir haben zwar selber zu wenig, wir müssen Schulden machen (Abg. Leichtfried: Sagt einer, der 24 000 Euro verdient!), um über die Runden zu kommen, aber bedient euch bitte nur! Ihr müsst natürlich überhaupt nichts zahlen, für euch ist alles gratis! Bildung, Sprache, Integration, Gesundheit, das alles kostet euch nichts! (Abg. Ernst-Dziedzic: Schlechte Rede! – Ruf bei den Grünen: Sehr schlecht!)
Wer von Ihnen würde denn diesen Eindringlingen anbieten: Ihr braucht euch natürlich auch nicht bei der Hausarbeit zu beteiligen!? (Abg. Leichtfried: Wahrscheinlich hast du eh noch nie Hausarbeit gemacht!) Wo kommen wir denn da hin? Die Leistungen sind alle umsonst, aber dafür kriegt ihr ein Taschengeld! An die Hausordnung braucht ihr euch auch nicht zu halten, denn ihr habt ja euer eigenes Wertesystem, und wir sind so tolerant, dass wir das alles anerkennen! (Beifall bei der FPÖ.)
Wer würde, wenn sich dann irgendjemand auch noch an einem Familienmitglied vergreift, sagen: Ja, liebe Eindringlinge, ihr habt überhaupt nichts zu befürchten!? Keine Sorge, wir drücken beide Augen zu! Wenn ihr das gemacht habt, dann seid ihr nämlich erst recht davor geschützt, delogiert zu werden, denn wir können nicht die Verantwortung dafür übernehmen, dass ihr dann den rauen Sitten der Gegenden, aus denen ihr herkommt, ausgesetzt werdet! Das ist doch der
Fortschritt! Wenn ihr lange genug bleibt, dann braucht ihr vorher gar nicht zu arbeiten, sondern dann bekommt ihr die Mindestsicherung auch so, und dann holen wir die restlichen Familienmitglieder nach, und am Ende werdet ihr dann automatisch gleichberechtigte und vollwertige Familienmitglieder! (Beifall bei der FPÖ.)
Meine Damen und Herren, kein Mensch würde das so sagen. Kein Mensch würde das bei sich selber zu Hause so machen, zumindest keiner, von dem ich sage, dass er alle Tassen im Schrank hat, zumindest kein Mensch, der einen Funken von Verantwortungsbewusstsein für die eigene Bevölkerung hat. Das ist doch vollkommen klar.
Sehen Sie, das ist aber der springende Punkt: Trotzdem macht es die Einheitspartei genau so, wie ich es beschrieben habe. Sie macht es natürlich nicht mit ihren eigenen Wohnungen – aber wo! –, sie macht es aber mit der Wohnung Österreich, mit dem Haus Österreich. Sie macht es mit dem, was der Familie Österreich gehört. Zwangsbeglückung auf Kosten der eigenen Bevölkerung nennt man so etwas. (Beifall bei der FPÖ. – Abg. Steinacker: Die Zeit ist abgelaufen!)
Rot, Schwarz, Grün, NEOS: Alle sind sie mit dabei. Sie machen es in Österreich so und sie machen es in Europa so, in ihrer unglaublichen Abgehobenheit, in ihrer Überheblichkeit und ihrem Wahn der Alternativlosigkeit, von dem sie regelrecht besessen sind. Sie machen es nicht erst seit Jahren, sondern sie machen es seit Jahrzehnten, und das Ganze ist dann für die vornehmen Herrschaften des Systems ein Ausdruck der Humanität, des Fortschritts, der Toleranz und der Modernität. Na gute Nacht, europäische Werte, kann ich da nur sagen!
Ausbaden muss das Ganze die europäische Bevölkerung, sie zahlt den Preis dafür. Die Leute da draußen zahlen den Preis. Nicht Sie hier herinnen in Ihren privilegierten Zuständen und Umständen (Zwischenruf der Abg. Totter), sondern die Leute draußen zahlen den Preis. Sie spüren das am eigenen Leib.
Jeder kennt die Folgen. (Beifall bei der FPÖ. – Rufe bei der ÖVP: Redezeit! – Abg. Leichtfried: Schaut der Herr Präsident auf die Redezeit?)
Wer das nicht mehr ausbaden, ertragen und hinnehmen will, hat nur eine Wahl, und diese Wahl heißt, die Freiheitliche Partei und mit ihr die Festung Österreich und die Festung Europa zu unterstützen. (Präsident Hofer gibt das Glockenzeichen.) Das ist nichts Schlechtes. (Abg. Meinl-Reisinger: Ihr seid ja nicht einmal bereit für eine Festung, ...!) Das ist etwas Gutes, denn es schützt die Freiheit, die Sicherheit, die Identität und den Wohlstand. Wir sind bereit – aber wir sind auch die Einzigen hier herinnen! (Beifall bei der FPÖ sowie Bravoruf des Abg. Kassegger. – Abg. Strasser: Das ist ja auch bezeichnend, dass Sie die Einzigen sind!)
11.58
Präsident Ing. Norbert Hofer: Sehr geehrter Herr Klubobmann Kickl! Für die eingangs gewählte Bezeichnung des Ministeriums habe ich einen Ordnungsruf zu erteilen.
*****
Zur Geschäftsbehandlung. – Bitte schön.
*****
Abgeordneter Peter Haubner (ÖVP) (zur Geschäftsbehandlung): Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätztes Hohes Haus! Danke für die Erteilung des Ordnungsrufes. Das ist das Mindeste für diese Tonalität, für diese Begrüßung. (Abg. Leichtfried: Da braucht man nicht Danke sagen! Das ist seine Arbeit! – Abg. Greiner: Das ist die Arbeit vom Präsidenten!) Das, was hier herinnen abläuft, ist absolut inakzeptabel. (Beifall bei ÖVP, SPÖ, Grünen und NEOS.)
Es gibt so etwas wie Respekt vor einer Person. Es gibt so etwas wie Respekt vor dem Parlament. Es gibt so etwas wie Respekt vor der Regierung. Das scheint hier abhandengekommen zu sein, und das ist für uns absolut inakzeptabel. (Abg. Steger: Wegen Ihrer Politik ist das abhandengekommen!) Ich möchte das ausnahmsweise hier so zur Kenntnis bringen. – Danke. (Beifall bei der ÖVP sowie bei Abgeordneten von SPÖ, Grünen und NEOS.)
11.59
Präsident Ing. Norbert Hofer: Herr Klubobmann Kucher, zur Geschäftsbehandlung. – Bitte. (Abg. Hafenecker: Wo war der Respekt vor den Ungeimpften? – Abg. Steinacker: Geh bitte, jetzt, also!)
Abgeordneter Philip Kucher (SPÖ) (zur Geschäftsbehandlung): Herr Präsident! Ich glaube, uns allen ist aufgrund der heutigen Zeitungsberichte bewusst, dass Herbert Kickl sehr nervös ist (Ruf bei der FPÖ: Geschäftsordnung!), weil er erklären muss, dass anscheinend nicht nur Strache in die Kassen gegriffen hat, sondern dass auch er sich ordentlich mit Geld aus den FPÖ-Kassen hat bedienen lassen. (Abg. Kassegger: Was hat das mit der Geschäftsordnung zu tun?)
Ich darf nur noch einmal dazusagen: Es gibt Grundformen des Respekts, wie wir hier miteinander umgehen. Wenn Othmar Karas – und man kann anderer Meinung sein über alle Parteigrenzen hinweg – heute hier heraußen steht und seine letzte Rede hält (Ruf bei der FPÖ: Na, Gott sei Dank!) und darauf hinweist, dass es die letzte Rede ist (Abg. Steinacker – in Richtung FPÖ –: Geh bitte, jetzt halt doch ... Mund!), und es dann Zwischenrufe gibt so à la: Ja „Gott sei Dank!“, wenn eine Juristin als Ministerin – und man muss auch nicht immer ihrer Meinung sein – ihrer Arbeit nachgeht und hier dann von Verfassungsbruch die Rede ist, dann sind das Mechanismen im Umgang miteinander, angesichts derer wir alle einen Schritt zurück machen und fragen sollten, ob das einer gewissen Form von Respekt entspricht, die wir hier auch der Öffentlichkeit gegenüber leben sollten. Wir kennen Herbert Kickl, der mit Fahndungslisten Menschen verfolgen möchte,
die anderer Meinung sind, aber wir müssen wirklich alle einen Schritt zurück machen. (Beifall bei SPÖ, ÖVP, Grünen und NEOS.)
Herr Präsident, ich weiß, dass es für Sie persönlich ganz schwierig ist (Zwischenrufe bei der ÖVP sowie der Abg. Belakowitsch), weil Sie die Brutalität ja auch am eigenen Leibe erfahren haben, wie Herbert Kickl Sie in einer extrem unappetitlichen Art und Weise abmontiert hat. Ich darf Sie aber umso mehr bitten, dass Sie hier als Präsident durchgreifen und versuchen, Herbert Kickl ins Gebet zu nehmen. Das ist eine Art und Weise des Umgangs, die wir hier in diesem Haus nicht leben sollten.
Und ich darf dich, Herbert, wirklich bitten – bei allem Verständnis, dass du nach den Enthüllungen rund um deine Gagen (Abg. Kickl: Eines kann ich dir sagen: Jeder Euro ist verdient!) sehr nervös bist –, dass du dich etwas mäßigst und grundlegende Formen des Respekts wieder lebst. (Beifall bei SPÖ, ÖVP und Grünen.)
12.01
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zur Geschäftsbehandlung. – Bitte schön.
Abgeordneter Dr. Nikolaus Scherak, MA (NEOS) (zur Geschäftsbehandlung): Die unsägliche Bezeichnung der Frau Bundesministerin ist ja schon angesprochen worden. Wir haben an und für sich Regeln hier im Hohen Haus, die darauf abzielen, dass man Namen nicht verunglimpft. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass sich das auch auf entsprechende Titel und Institutionen in diesem Land beziehen muss. Ich glaube, wenn wir damit beginnen, dass wir Minister:innen und Ministerien in einer Art und Weise verunglimpfen, dass wir diese Institutionen kaputtschießen – und das ist das einzige Ziel dahinter –, dann haben wir ein ganz massives, ernsthaftes Problem. Wenn wir als Parlament, als das Haus der Demokratie, uns nicht an die einfachsten Regeln halten – dass wir so miteinander umgehen, dass wir unsere Namen oder die Ämter, für die die Personen stehen, nicht verunglimpfen –, dann, glaube ich, müssen wir ernsthaft darüber nachdenken, wie wir in Zukunft miteinander umgehen.
Ich würde Sie bitten, dass wir das auch in der nächsten Präsidiale diskutieren, weil ich glaube, es muss klar sein: Wenn wir die Regel haben, dass wir keine Namen verunglimpfen, dann werden selbstverständlich auch nicht die Ämter, für die die Personen zuständig sind, verunglimpft. (Beifall bei NEOS, ÖVP, SPÖ und Grünen. – Zwischenrufe bei ÖVP, SPÖ und FPÖ.)
12.02
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zur Geschäftsbehandlung, Frau Abgeordnete Belakowitsch. – Bitte schön.
Abgeordnete Dr. Dagmar Belakowitsch (FPÖ) (zur Geschäftsbehandlung): Ich finde es jetzt besonders interessant, dass alle hier herinnen Respekt einfordern. Ich möchte nur daran erinnern, in den letzten Jahren gab es überhaupt keinen Respekt gegenüber der Bevölkerung. Es gab keinen Respekt gegenüber Personen, die sich nicht impfen ließen. (Beifall bei der FPÖ. – Unruhe im Saal.) Es gab eine Bundesregierung, da war der Verfassungsbruch an der Tagesordnung – natürlich mit Unterstützung aller, die sich jetzt auch hier echauffieren. (Zwischenrufe bei SPÖ und Grünen sowie der Abg. Meinl-Reisinger.) Wir haben eine Verfassungsministerin, die sich dazu nicht geäußert hat (Zwischenruf des Abg. Scherak), sondern den Verfassungsbruch auch noch eingefordert hat.
Im Übrigen möchte ich festhalten: Zu sagen, die Ministerin hat Verfassungsbruch begangen, ist nicht (Abg. Disoski: Zur Geschäftsordnung!) eine Verunglimpfung des Amtes, das ist maximal, wenn es eine wäre, eine Verunglimpfung der Taten. Bei der Ministerin, die Leute als illegal im Land bezeichnet hat, ist das eine Tatsache. (Beifall bei der FPÖ. – Zwischenbemerkung von Bundesministerin Edtstadler.)
Präsident Ing. Norbert Hofer: Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gab jetzt auch einen Antrag zur Geschäftsordnung; Herr Doktor, dafür bin ich sehr dankbar.
Ich habe mir diese Debatte sehr genau angehört, als ich übernommen habe. Mir sind diesmal viele Dinge aufgefallen, und ich bin sehr dafür, dass wir für die nächste Sitzung in der Präsidiale zusammentragen, welche Wörter hier gefallen sind. Es ist gefallen: „feig“, „sind Sie noch bei Sinnen?“ (Abg. Maurer: Also bitte!) und viele, viele andere Dinge, die mir aufgefallen sind. (Zwischenrufe bei SPÖ und Grünen.) – Nein, es ist nicht eines. Ich habe ja nicht gesagt, von wem das gefallen ist, Herr Kollege.
Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir das zusammensammeln, in der nächsten Präsidiale besprechen, weil ich ja auch glaube, dass es bei einigen Wörtern Ordnungsrufe gibt, die vielleicht gar nicht mehr zeitgemäß sind (Abg. Leichtfried: Aber man hätte den Herrn Kickl unterbrechen können, wie das andere Präsidenten tun!), und bei anderen Wörtern vielleicht diese Ordnungsrufe auch treffender wären. Wenn es darum geht, dass Institutionen nicht anders benannt und Namen nicht verunglimpft werden sollen, bin ich sehr dafür; und ich bin auch dafür, dann festzulegen, für welche Institutionen das gelten soll, ob vielleicht auch Parteinamen oder andere Dinge davon betroffen sein sollen. (Zwischenruf der Abg. Meinl-Reisinger.) Schauen wir uns das bitte in Ruhe an und versuchen wir jetzt bitte, die Sitzung, die Debatte so durchzuführen, dass die Menschen in Österreich davon am meisten haben.
Herr Generalsekretär, Herr Abgeordneter, bitte schön. (Ruf bei der SPÖ: Diese Einsicht ... ein bissl spät! – Abg. Greiner: Das ist doch keine Einsicht!)
Abgeordneter Dr. Christian Stocker (ÖVP) (zur Geschäftsbehandlung): Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! Wenn hier von Verfassungsbruch gesprochen wird, dann glaube ich, dass wir uns wenig darüber unterhalten müssen, ob das eine akzeptable Formulierung ist. (Beifall bei der ÖVP.) Wenn einem Regierungsmitglied Verfassungsbruch vorgeworfen wird, dann ist das strafrechtlich relevant – und gerade, wenn es die eigene Aufgabe betrifft, auch besonders schwerwiegend. (Abg. Kassegger: Absichtlich, wissentlich!) Daher
glaube ich, dass man über diese Wortwahl nicht groß diskutieren muss, weil sie vollkommen indiskutabel ist. (Beifall bei ÖVP, SPÖ und Grünen.)
12.06
Präsident Ing. Norbert Hofer: Herr Abgeordneter, darüber werden wir zu diskutieren haben – und ich schlage vor, dass wir das in der nächsten Präsidiale tun und uns einmal in Ruhe über Begrifflichkeiten unterhalten, aber jetzt die Debatte so fortführen, dass die Menschen, die hier zusehen, auch etwas davon haben und sehen, wofür die Parteien stehen. (Abg. Leichtfried: Ja, vielleicht hätten Sie schneller eingreifen sollen, Herr Präsident!) – Herr Abgeordneter, ich habe Ihre Wortmeldung und Ihren Zwischenruf sehr gut gehört, und auch über diesen werden wir wahrscheinlich in der nächsten Präsidialkonferenz sprechen.
*****
So, wir setzen fort: Zu Wort gelangt Mag. Meri Disoski. – Bitte schön, Frau Abgeordnete. (Abg. Martin Graf: Das ist jetzt sicher wieder eine sanfte Rede, geküsst von der Realität! – Ruf bei der FPÖ: Von Respekt getragen! – Abg. Martin Graf: Voller Respekt getragen, ausgewogen, ohne Untergriffe!)
Abgeordnete Mag. Meri Disoski (Grüne): Herr Präsident! Frau Bundesministerin! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuseherinnen und Zuseher hier im Hohen Haus! (Ruf bei der FPÖ: Von Respekt getragen! – Abg. Martin Graf: Voller Respekt getragen, ausgewogen, ohne Untergriffe!) – Habts ihr’s dann bald? Hältst du das aus, einmal zuzuhören, Kollege von der FPÖ? (Ruf bei der FPÖ: Schwierig, aber versuchen wir’s!) – Bist du dann so weit? Da, wo ich herkomme, aus Gramatneusiedl in Niederösterreich, da gehört es dazu, dass man einander zuhört; bei euch offensichtlich nicht (Abg. Kassegger: Das war jetzt auch nicht sehr respektvoll!), aber jetzt haben wir’s, gut.
Herr Klubobmann Kickl, wenn Sie sich hier rausstellen und die höchsten Institutionen unserer Republik, unserer Demokratie auf eine derartige Art und
Weise verunglimpfen und auch die FPÖ das heute während der ganzen Sitzung macht, dann frage ich mich wirklich: Wieso wollen Sie eigentlich Kanzler werden, wenn Sie auf die demokratischen Institutionen und die höchsten Repräsentant:innen pfeifen? (Abg. Kickl: ... zu clever, als dass Sie das nicht verstehen!) Wieso wollen Sie das? Wieso? (Beifall bei den Grünen.) Wieso wollen Sie das? Volkskanzler oder Volkskassierer? (Abg. Belakowitsch: Wollen Sie reden oder fragen? ... keine Fragestunde!) – Das ist, was bei mir heute ein bisschen stehen bleibt. (Abg. Kickl: Neid ist ja noch immer die höchste Form der Anerkennung!)
Herr Präsident, wenn Sie angesichts tatsächlich sexistischer Bemerkungen über die Bundesministerin nicht sofort zur Ordnung rufen, wenn Sie hier eine Bemerkung über das Ministerium für Verfassungsbruch nicht sofort mit einem Ordnungsruf belegen (Zwischenruf der Abg. Belakowitsch), dann frage ich mich schon auch: Wie objektiv ist diese Vorsitzführung? Und ja, das werden wir als Grüne auch sehr gerne bei der nächsten Präsidiale thematisieren. (Beifall bei Grünen und ÖVP sowie des Abg. Kucher.)
Tatsächlich ist ja das Schauspiel, das die FPÖ heute hier zum Besten gibt, sehr eindrucksvoll und zeigt, was dann passiert, wenn rechte und rechtsextreme Parteien in Regierungsverantwortung kommen. Sie haben das heute wieder sehr demonstrativ, sehr ausführlich und sehr eindringlich gezeigt. (Abg. Martin Graf: Und wenn Europa ... Schilling ...!) Sie pfeifen auf die Rechtsstaatlichkeit (Abg. Kassegger: Das ist ja absurd! Sie haben gepfiffen!), Sie pfeifen auf die demokratischen Werte und Institutionen.
Was machen Sie noch? – Sie geben vor, Politik für die kleinen Leute zu machen. Was Sie aber machen, sobald Sie in der Regierung sind: Sozialabbau eiskalt, ohne mit der Wimper zu zucken. Schauen Sie nach Italien! Sie fahren Frontalangriffe auf die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit. Finanzskandale und Postenschacherei sind bei Ihnen an der Tagesordnung. Schauen wir mit großem Interesse in die Steiermark, was dort passiert: Es gibt Korruptionsermittlungen. In Wien gibt es Kontakte zu russischen Oligarchen. Auch gegen Ihren Spitzenkandidaten, gegen Herrn Vilimsky, wird wegen Veruntreuung ermittelt. (Abg. Kickl: Und gegen die
Frau Schilling?) Dort, wo Rechte regieren, werden Frauenrechte frontal angegriffen, Minderheitenrechte mit Füßen getreten. Sie schränken die Meinungsfreiheit ein (Abg. Kickl: Zu Frauenrechten hätte die Frau Schilling auch was zu sagen!) und Sie diffamieren Medien als Lügenpresse. All das passiert, wenn Rechte und Rechtsextreme regieren. (Abg. Belakowitsch: Was Sie alles wissen!)
Die FPÖ und die ihr nationalistisch Gleichgesinnten möchten damit, mit all dem, was ich jetzt aufgezählt habe, nichts weniger erreichen, als die Gesellschaft zu spalten und die EU zu schwächen. Wissen Sie, wer sich darüber besonders freut, Kolleginnen und Kollegen von der FPÖ? – Darüber freut sich besonders Wladimir Putin. Der lacht sich im Kreml in sein faschistoides Fäustchen, weil seine willfährigen Handlanger seine Interessen in Europa auf Zuruf vertreten, seine Lügenpropaganda in unsere europäischen Parlamente – auch ins österreichische – tragen, seinen brutalen Angriffskrieg auf die Ukraine verteidigen und Stimmung gegen Sanktionen machen, die Russlands Kriegsmaschinerie bremsen sollen. (Zwischenrufe bei der FPÖ.) Dafür stehen Sie, all das machen Sie. Wir haben im Untersuchungsausschuss zum rot-blauen Machtmissbrauch sehr, sehr viele Belege für den blauen Kuschelkurs mit Putin gefunden.
Dass die FPÖ nach wie vor einen aufrechten Freundschaftsvertrag mit Putins Partei hat, spricht ja bitte Bände. Wenn es so ist, dass dieser Vertag tatsächlich gekündigt ist, dann legen Sie doch bitte diese Kündigung vor! Ich habe sie nie gesehen. Vielleicht ist sie in Ihrem Archiv irgendwo verschwunden. Bitte belegen Sie es doch, wenn Sie sagen, dass Sie mit Putin nicht weiter im Bett liegen, dass Sie dieses brandgefährliche Gspusi nicht nach wie vor haben. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP. – Abg. Kickl: Eure Sorgen hätte ich gern!)
Der Titel dieser Stunde ist ja absurd: „Festung Europa“. In der blauen Logik würde eine Festung „Sicherheit, Wohlstand, Frieden und Freiheit“ mit sich bringen. Aber wissen Sie was? – Raus aus Öl und Gas: Das ist entscheidend für die Sicherheit von Europa, weil wir uns mit dem Umstieg auf saubere, sichere und leistbare Energie unabhängig von schmutzigen, von fossilen Energieimporten
machen (Abg. Kickl: Und wovon machen wir uns abhängig?), von den Despoten, wie Putin, die Energie als Kriegswaffe gegen uns einsetzen und damit unsere europäische Sicherheitsarchitektur zerstören. Das sehen wir.
Ich sehe auch, die nervösen Zwischenrufe bei der FPÖ zeigen: Da habe ich einen Nerv getroffen. Das, was ihr wollt, führt ganz sicher nicht zu mehr Sicherheit, zu mehr Wohlstand. Ihre hetzerische, rassistische Politik bedroht unsere Gesundheitsversorgung. (Abg. Kassegger: Das ist eine einzige Beschimpfung! Sie reden was von Respekt und beschimpfen uns 5 Minuten lang! Was soll das?) Wer soll denn unsere Kranken pflegen? Wer soll denn unsere Seniorinnen und Senioren pflegen, wenn keiner mehr da ist? Wer soll denn im Tourismus arbeiten? Wer soll denn das umsetzen, was in den Auftragsbüchern steht, wenn niemand mehr da ist, weil wir eine Festung Europa gebaut haben? (Abg. Kickl: Die Flüchtlinge sind nur bedingt geeignet!) Wer soll denn das machen? Sagen Sie das bitte jedes Mal dazu!
Festung Europa ist Wohlstand zerstörend. Das schafft keinen Wohlstand. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
Sehr geehrte Damen und Herren, die Sie heute zuschauen, am 9. Juni stehen wir vor einer Richtungsentscheidung. Wir alle haben gemeinsam eine Wahl: Lassen wir uns von den Rechten und von den Rechtsextremen zurück ins finstere Mittelalter katapultieren, wo hetzerische Sündenbockpolitik, das Recht des Stärkeren, Willfährigkeit und Korruption regieren, wo unsere demokratischen Prinzipien mit Füßen getreten werden und unsere gesellschaftliche Vielfalt in Europa diffamiert wird? Wollen wir das? Oder steuern wir das Schiff Europa in eine helle, lebenswerte Zukunft, die ein sicheres, gutes Leben für uns alle und für die nachfolgenden Generationen auf einem lebenswerten Planeten verspricht?
Ich weiß, welche Zukunft ich mir für Österreich, für unsere Kinder und Kindeskinder wünsche. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP. – Abg. Kickl: Da bleibt von Österreich nichts über, wenn ...!)
12.12
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt nun Frau Klubvorsitzende Mag. Beate Meinl-Reisinger. – Bitte schön.
Abgeordnete Mag. Beate Meinl-Reisinger, MES (NEOS): Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Mitglieder der Bundesregierung! Werte Kolleginnen und Kollegen aus Brüssel! Liebe Kolleginnen und Kollegen hier! Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer! Lassen Sie mich kurz ein paar Worte zu dem Stil dieser Diskussion sagen! Ich glaube wirklich, dass das die Menschen nicht wollen: diese Art der Aggressivität, diese Art der Verhaltensauffälligkeit, dieses ständige gegenseitige Runtermachen. Werte FPÖ, Sie sind da immer mittendrin statt nur dabei, wie ein Haufen pubertierender Kinder ständig hereinrufend und andere abwertend. Das wollen die Menschen nicht. (Beifall bei NEOS und Grünen sowie bei Abgeordneten der ÖVP.)
Wer keinen Respekt voreinander, vor den demokratischen Institutionen, vor unserer Republik hat, der hat keinen Respekt vor den Menschen, und das spüren die Menschen sehr wohl.
Jetzt möchte ich auch gleich weiter auf Sie eingehen, nämlich auf das, was Sie heute hier abliefern. Ich finde, das ist sehr symbolisch für Europa an sich und für die Frage, was auf dem Spiel steht. Schauen Sie, Europa ist ein Projekt, das auf den Trümmern und den blutigen Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs, des Ersten Weltkriegs, der Erlebnisse und Erfahrungen mit Nationalismus aufgebaut wurde. Hunderttausende, Millionen Tote: Auf diesen blutigen Schlachtfeldern ist dieses gemeinsame europäische Projekt entstanden – mit einem ganz klaren Bekenntnis dazu, dass wir zusammenarbeiten, dass wir uns an einen Verhandlungstisch setzen, dass wir nicht mit Bomben, Granaten und Panzern Politik machen, sondern Kompromisse schließen, dass wir kompromissfähig sind. Das ist der Kern des europäischen Gedankens.
Das ist genau das, was Sie – wie Sie heute gezeigt haben – nicht wollen. (Abg. Kassegger: O ja, wir wollen das! Sie wollen es nicht!) Sie wollen nicht Kompromisse
schließen, Sie wollen nicht zusammenarbeiten. Sie sind der Geist, der stets verneint, der das alles zerschießen will.
Da braucht man nur auf Ihre Plakate zu schauen, die wirklich eigenartig sind. Da stehen ein bisschen viele Themen auf einmal, und ich frage mich wirklich: Sind da bei euch Leute zusammengesessen und haben sich gedacht: Das ist wirklich eine super Idee! Klatschen wir einmal von den Verschwörungstheorien, die in Europa so existieren, eine nach der anderen auf ein Plakat, vom angeblichen Coronawahnsinn und den bösen Spritzen bis hin zu Windrädern als Merkmalen des Ökokommunismus!
Ich bin da letzthin an so einem Plakat vorbeigelaufen. Das ist ja besonders perfide: Da zeigt man Herrn Selenskyj – so heißt er übrigens – und Frau von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin, die sich scheinbar küssen. Das ist ja die Geschichte, die gerne in den sozialen Medien oder in Ihrem Telegram-Channel erzählt wird: Die haben ja ein Verhältnis! Die haben ja ein Pantscherl! – Das sind krudeste Verschwörungstheorien, bei denen sich jeder an den Kopf greift (Abg. Wurm: Das hat die Schilling behauptet!) und sich denkt: Bitte, wer glaubt denn so einen Holler? – Das klatscht ihr einfach so auf ein Plakat.
Dazu muss ich sagen: Da muss ich nicht einmal wissen, ob ihr noch einen aufrechten Vertrag mit Putins Partei habt. Jeder, der sehen will, sieht. Ihr macht mit diesem Plakat genau das, was aus Putin’schen Trollfabriken in Sankt Petersburg tausendfach, millionenfach Tag für Tag unsere sozialen Medien überschwemmt. (Abg. Amesbauer: Das ist echt fad!) Ihr macht seine Propaganda, ihr seid die Handlanger dieses Regimes, die Handlanger Putins in Österreich. Ich frage mich wirklich: Was kriegt ihr eigentlich dafür bezahlt? (Beifall bei den NEOS sowie bei Abgeordneten von ÖVP, SPÖ und Grünen.)
Ich möchte auch noch das aufgreifen, was meine Kollegin Claudia Gamon gesagt hat, weil es natürlich sinnbildlich für den Widerspruch ist: Ihr redet von einer Festung und seid nicht bereit, eine selbstbewusste Verteidigungsunion zu schaffen. (Abg. Amesbauer: Mit der Nato?)
In einer Zeit, in der die Menschen sagen, sie haben Angst davor, dass sich Krieg wieder durchsetzt, dass Putin, wenn er sich in der Ukraine weiter durchsetzt, weitermacht, dass ihre Kinder nicht in Frieden und Freiheit leben, ist es notwendig, uns zusammenzutun, uns gemeinsam zu schützen, die Menschen in Europa zu schützen. Dazu seid ihr nicht bereit. Eure Festung ist eine Hüpfburg – da hat Frau Gamon völlig recht. (Beifall bei den NEOS sowie bei Abgeordneten von ÖVP und Grünen.)
Schauen wir also jetzt mit Selbstbewusstsein auf die Zukunft Europas! Wir sind jemand. Wollen wir weiter Spielball sein oder selbstbewusster Akteur? Wollen wir weiter zuschauen, wie uns China und die USA um die Ohren fahren? Wollen wir ernsthaft so wenig selbstbewusst sein, dass wir sagen, wir verfallen wieder in unseren Nationalismus und zerfallen wieder in Nationalstaaten, und glauben, dann stärker zu sein? – Das ist doch abenteuerlich. Das wollen die Menschen ja auch nicht. Deshalb redet ihr da nur so ein bisschen verklausuliert vom Öxit, weil ihr in Wirklichkeit ja eh wisst: Die Menschen wollen es nicht. Also zündelt ihr halt herum, bis die Stimmungslage da ist. Nicht einmal da seid ihr ehrlich.
Selbstbewusstsein ist gefragt. Haben wir schon alles geschafft? – Nein.
Haben wir schon viel weitergebracht? – Ja.
Ist die Europäische Union ein Erfolgsprojekt? (Rufe bei der FPÖ: Nein!) – Wissen Sie, es klingt komisch, das zu sagen (Abg. Belakowitsch: Ach so!): Es ist zu früh, das zu sagen.
Wir haben den Stift der Geschichtsschreibung selber in der Hand, und wir – alle, die gewillt sind, daran zu arbeiten – werden in den nächsten Jahren mitbestimmen, ob die Geschichte ein Erfolgsprojekt ist, das Wohlstand, Freiheit und Frieden für alle Menschen in Europa garantiert. Ich garantiere, wir werden hart daran arbeiten, Österreich und die Europäische Union stärker zu machen. (Beifall bei den NEOS sowie des Abg. Schallmeiner.)
Last, but not least (Präsident Hofer gibt das Glockenzeichen): Die, die diesen Stift der Geschichtsschreibung schon in der Hand hatten, sind jene Abgeordneten Österreichs, die in den letzten Jahren in Brüssel ihren Job gemacht haben, die dort nicht nur Champagnerpartys gefeiert haben, sondern dort gearbeitet haben. Ihnen – parteiübergreifend – gilt mein Dank, ganz besonders natürlich unserer Claudia Gamon, aber auch allen anderen Abgeordneten – Othmar Karas, den Abgeordneten der SPÖ, der Grünen –, die in den letzten Jahren in Brüssel hart für Österreich gearbeitet haben. (Abg. Amesbauer: Einheitspartei! – Präsident Hofer gibt neuerlich das Glockenzeichen.) Danke im Sinne unseres Hauses und danke im Sinne der Menschen in Österreich. (Beifall bei NEOS und Grünen sowie bei Abgeordneten von ÖVP und SPÖ.)
12.18
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort ist dazu nun niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
Präsident Ing. Norbert Hofer: Hinsichtlich der eingelangten Verhandlungsgegenstände und deren Zuweisungen verweise ich gemäß § 23 Abs. 4 der Geschäftsordnung auf die im Sitzungssaal verteilte Mitteilung.
Die schriftliche Mitteilung hat folgenden Wortlaut:
A. Eingelangte Verhandlungsgegenstände:
1. Schriftliche Anfragen: 18313/J bis 18492/J
Schriftliche Anfragen an den Präsidenten des Nationalrates:
2. Anfragebeantwortungen: 17294/AB bis 17542/AB
Anfragebeantwortungen (Präsident des Nationalrates):
3. Volksbegehren:
Volksbegehren "Kein NATO-Beitritt" (2546 d.B.)
Volksbegehren "Essen nicht wegwerfen!" (2547 d.B.)
Volksbegehren "Glyphosat verbieten!" (2548 d.B.)
Volksbegehren "Nein zu Atomkraft-Greenwashing" (2549 d.B.)
B. Zuweisungen:
1. Zuweisungen seit der letzten Sitzung gemäß §§ 31d Abs. 5a, 32a Abs. 4, 74d Abs. 2, 74f Abs. 3, 80 Abs. 1, 100 Abs. 4, 100b Abs. 1 und 100c Abs. 1:
Budgetausschuss:
Monatserfolg Februar 2024 sowie Berichte gemäß § 3 Abs. 2 Kommunalinvestitionsgesetz 2023, § 3 Abs. 4 COVID-19-Fondsgesetz, § 3b Abs. 4 ABBAG-Gesetz und gemäß der Entschließung 275/E des Nationalrates vom 17.11.2022 zur Berichterstattung über den Umsetzungsstand des Aufbau- und Resilienzplans (Vorlage 154 BA)
Vorläufiger Gebarungserfolg 2023, vorgelegt vom Bundesminister für Finanzen (Vorlage 155 BA)
Monatserfolg März 2024 sowie COVID-19 Berichterstattung gemäß § 3 Abs. 2 Kommunalinvestitionsgesetz 2023, § 3 Abs. 4 COVID-19 Fondsgesetz und § 3b Abs. 4 ABBAG-Gesetz sowie das Monitoring von Verschuldung und Investitionstätigkeit der Gemeinden, vorgelegt vom Bundesminister für Finanzen (Vorlage 156 BA)
Bericht des Bundesministers für Finanzen gemäß § 54 Abs. 12 BHG 2013 über die Genehmigung von Mittelverwendungsüberschreitungen und gemäß § 60 Abs. 3 BHG 2013 über zugestimmte Vorbelastungen im 1. Quartal 2024 (Vorlage 157 BA)
Bericht des Bundesministers für Finanzen gemäß § 4a Zahlungsbilanzstabilisierungsgesetz über die im 1. Quartal 2024 ergriffenen Maßnahmen (Vorlage 158 BA)
Bericht des Bundesministers für Finanzen gemäß Art. 50c Abs. 3 B-VG iVm § 6 der Anlage 2 zum GOG (ESM-Informationsordnung) über die im Rahmen des Europäischen Stabilitätsmechanismus getroffenen Maßnahmen im 1. Quartal 2024 (Vorlage 159 BA)
Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen:
Petition betreffend "Barrierefreier Zugang zum Bahnhof in Zirl", überreicht vom Abgeordneten Hermann Gahr (143/PET)
Petition betreffend "Eigenrechtsfähigkeit der Natur – Anregung auf Abänderung der Bundesverfassung und von Bundesgesetzen", überreicht von der Abgeordneten Dr. Astrid Rössler (144/PET)
Bürgerinitiative betreffend "Gemeinsam denken – Kindern helfen!" (67/BI)
2. Zuweisungen in dieser Sitzung:
a) zur Vorberatung:
Rechnungshofausschuss:
Bericht des Rechnungshofes betreffend Social-Media-Accounts von Regierungsmitgliedern – Reihe BUND 2024/13 (III-1144 d.B.)
Bericht des Rechnungshofes betreffend Administratives Unterstützungspersonal an allgemeinbildenden Pflichtschulen – Reihe BUND 2024/14 (III-1154 d.B.)
Bericht des Rechnungshofes betreffend Intelligente Messgeräte (Smart Meter) – Einführungsstand 2022 – Reihe BUND 2024/15 (III-1155 d.B.)
Volksanwaltschaftsausschuss:
47. Bericht der Volksanwaltschaft (1. Jänner bis 31. Dezember 2023) (III-1135 d.B.)
b) zur Enderledigung im Sinne des § 28b GOG (vorbehaltlich der endgültigen Entscheidung des Ausschusses):
Ausschuss für Familie und Jugend:
Umsetzungsbericht 2023 zur Österreichischen Jugendstrategie, vorgelegt vom Bundeskanzler (III-1165 d.B.)
Tätigkeitsbericht 2023 der Bundesstelle für Sektenfragen, vorgelegt von der Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien (III-1166 d.B.)
Ausschuss für Forschung, Innovation und Digitalisierung:
Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für März 2024 – Untergliederung 34 Innovation und Technologie (Forschung), vorgelegt von der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (III-1156 d.B.)
Gesundheitsausschuss:
Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für das Kalenderjahr 2024 (Jänner bis Februar 2024), vorgelegt vom Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (III-1159 d.B.)
Justizausschuss:
Datenschutzbericht 2023, vorgelegt von der Bundesministerin für Justiz (III-1153 d.B.)
Kulturausschuss:
Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für April 2024, vorgelegt vom Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (III-1167 d.B.)
Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft:
Bericht zum Waldfonds für das Jahr 2023, vorgelegt vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft (III-1163 d.B.)
Umweltausschuss:
9. Bericht der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie gemäß § 44 UVP-G 2000 über die Vollziehung der Umweltverträglichkeitsprüfung in Österreich (III-1152 d.B.)
Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für März 2024 – Untergliederung 43 Klima, Umwelt und Energie, vorgelegt von der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (III-1158 d.B.)
Unterrichtsausschuss:
Bericht des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung betreffend Arbeitsbericht der Nationalen Koordinierungsstelle für den Nationalen Qualifikationsrahmen (NKS) für das Jahr 2023 (III-1160 d.B.)
Verkehrsausschuss:
Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für März 2024 – Untergliederung 41 Mobilität, vorgelegt von der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (III-1157 d.B.)
Ausschuss für Wirtschaft, Industrie und Energie:
Tätigkeitsbericht 2024 der Energie-Control Austria, vorgelegt von der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (III-1162 d.B.)
*****
Fristsetzungsantrag
Präsident Ing. Norbert Hofer: Vor Eingang in die Tagesordnung teile ich mit, dass Frau Abgeordnete Doppelbauer beantragt hat, dem Ausschuss für
Wirtschaft, Industrie und Energie zur Berichterstattung über den Antrag 3582/A(E) eine Frist bis 7. Juni 2024 zu setzen.
Der gegenständliche Antrag wird gemäß der Geschäftsordnung nach Beendigung der Verhandlungen in dieser Sitzung zur Abstimmung gebracht.
Anträge gemäß § 69 Abs. 3 GOG-NR
Präsident Ing. Norbert Hofer: Wir kommen nun zu vier Anträgen betreffend die Durchführung erster Lesungen von Volksbegehren.
Es liegt mir ein Antrag gemäß § 69 Abs. 3 der Geschäftsordnung vor, das Volksbegehren Kein Nato-Beitritt, 2546 der Beilagen, in erste Lesung zu nehmen.
Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem Antrag zustimmen, um ein entsprechendes Zeichen. – Das ist einstimmig angenommen.
Weiters liegt mir ein Antrag gemäß § 69 Abs. 3 der Geschäftsordnung vor, das Volksbegehren Essen nicht wegwerfen, 2547 der Beilagen, in erste Lesung zu nehmen.
Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. – Auch das ist einstimmig angenommen.
Es liegt mir ein Antrag gemäß § 69 Abs. 3 der Geschäftsordnung vor, das Volksbegehren Glyphosat verbieten, 2548 der Beilagen, in erste Lesung zu nehmen.
Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist einstimmig angenommen.
Es liegt mir ein weiterer Antrag gemäß § 69 Abs. 3 der Geschäftsordnung vor, das Volksbegehren Nein zu Atomkraft-Greenwashing, 2549 der Beilagen, in erste Lesung zu nehmen.
Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. – Auch das ist einstimmig angenommen.
Redezeitbeschränkung
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zwischen den Mitgliedern der Präsidialkonferenz wurde Konsens über die Dauer der Debatten erzielt. Demgemäß wurde eine Tagesblockzeit von 7,5 „Wiener Stunden“ vereinbart, sodass sich folgende Redezeiten ergeben: ÖVP 146, SPÖ 101, FPÖ 83, Grüne 75 sowie NEOS 60 Minuten.
Gemäß § 57 Abs. 7 der Geschäftsordnung beträgt die Redezeit für die gesamte Tagesordnung von jenen Mandataren, die keinem Klub angehören, je 30 Minuten. Darüber hinaus wird deren Redezeit auf 5 Minuten je Debatte beschränkt.
Wir kommen sogleich zur Abstimmung über die eben dargestellten Redezeiten.
Wer diesem Vorschlag beitritt, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist einstimmig angenommen.
Weiters lege ich nach Beratungen in der Präsidialkonferenz gemäß § 19a der Geschäftsordnung für Tagesordnungspunkt 1 folgende Dauer und Form der Debatte fest: eine Rednerrunde nach Klubgröße zu je 5 Minuten; Präsident Rousopoulos repliziert im Rahmen der Debatte kurz auf die Redebeiträge; im Anschluss an die Replik des Präsidenten eine zweite Rednerrunde zu je 5 Minuten.
Wir gehen in die Tagesordnung ein.
Erklärung des Präsidenten der Parlamentarischen Versammlung des Europarates Theodoros Rousopoulos gemäß § 19a der Geschäftsordnung des Nationalrates
Präsident Ing. Norbert Hofer: Ich darf den Herrn Außenminister sehr herzlich hier im Plenum willkommen heißen.
Wir gelangen zum 1. Punkt der Tagesordnung.
Ich darf Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie bei den Empfangsgeräten, die Sie am Pult liegen haben, nachdem Sie die Kopfhörer angesteckt haben, links die Lautstärke regeln können, rechts können Sie zwischen den Sprachen Deutsch oder Englisch umschalten.
Herr Präsident, ich darf Sie sehr herzlich in unserem Parlament begrüßen. Ich bedanke mich für Ihr Kommen. (Allgemeiner Beifall.)
Ihre Erklärung samt der anschließenden Debatte wird auch live im Fernsehen übertragen werden.
Ich darf Sie nun, Herr Präsident, um Ihre Ausführungen bitten.
Präsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarates Theodoros Rousopoulos (in Übersetzung durch einen Simultandolmetscher): Herr Präsident Sobotka! Geschätzte Abgeordnete! Meine Damen und Herren! Eingangs gilt mein aufrichtiger Dank Ihnen allen. Danke, dass ich heute vor Ihnen, vor den geschätzten Mitgliedern des Nationalrates, in meiner Eigenschaft als Präsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarates sprechen kann!
Als ich in dieses ikonische Parlamentsgebäude eintrat, hatte ich den Eindruck, als würde ich das antike Griechenland betreten: Ich trat erstens in den Tempel der Demokratie ein, und zweitens wurde dieses Gebäude im klassizistischen Stil erbaut. Theophil Hansen verließ Dänemark, fuhr mit seinem Bruder nach Athen und erschuf in der griechischen Hauptstadt viele ikonische Gebäude, zum Beispiel die öffentliche Bibliothek, aber auch die Akademie Athens.
Kurz danach reiste er als Gast von Franz Joseph nach Wien und schuf die besten Werke seiner Karriere. Dieses Gebäude, in dem ich heute die Ehre habe, vor Ihnen zu sprechen, zählt dazu.
Nicht oft können ausländische Gäste vor dem Parlament sprechen, und ich schätze diese Ehre außerordentlich. Es ist dies eine Bestätigung des unerschütterlichen Bekenntnisses Österreichs zu den Werten und Prinzipien des Europarates. Es handelt sich hierbei um Menschenrechte, Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit.
Geschätzter Herr Präsident! Geschätzte Abgeordnete des österreichischen Parlaments! Die Ereignisse in Europa und darüber hinaus zeigen leider, dass diese Werte, die die Eckpfeiler der europäischen Identität darstellen, nicht als etwas betrachtet werden können, das man als selbstverständlich sieht. Sie brauchen unsere Entschlossenheit, unsere kollektive Weisheit, unseren Mut und auch unsere Solidarität. Deshalb ist gerade diese Einladung für mich heute so wichtig.
Die Versammlung, die ich heute vertrete, bietet auf europäischer Ebene eine einzigartige Plattform für den interparlamentarischen Dialog, für die parlamentarische Diplomatie. Sie bringt 612 Abgeordnete aus 46 Mitgliedstaaten und weitere Parlamentsabgeordnete, die als Beobachter beziehungsweise als Partner für Demokratie fungieren, zusammen. Es sind Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die das gesamt Spektrum des politischen Lebens abdecken. Sie vertreten die Oppositionsparteien, die Parteien an der Macht, die Linke, die Rechte und die Mitte.
Österreich war und ist seit dem Beitritt am 16. April 1956 immer schon ein Schlüsselpartner der PV, der Parlamentarischen Versammlung, gewesen und bleibt das auch in Zukunft.
Viele Vertreterinnen und Vertreter sehe ich auch heute hier: PVER-Delegationsleiter, mein guter Freund Reinhold Lopatka, der mit Weisheit seine Arbeit in der Versammlung verrichtet.
Petra Bayr: Die unermüdliche Vorsitzende des Ausschusses zur Wahl der Richterinnen und Richter des EGMR. Sie ist ein extrem aktives, engagiertes Mitglied des Gleichstellungsausschusses.
Stefan Schennach: Seine Erfahrung und seine Entschlossenheit bei Wahlbeobachtungsmissionen im Rahmen des PV-Monitorings erwiesen sich immer als außerordentlich wertvoll.
Andrea Eder-Gitschthaler befasst sich derzeit damit, das Bewusstsein betreffend die Notwendigkeit, Diskriminierung gegenüber älteren Menschen zu bekämpfen, zu schärfen.
Stephanie Krisper ist Mitglied unseres Migrationsausschusses. Sie befasst sich mit der Menschenrechtssituation an einigen sehr heiklen europäischen Grenzübertrittspunkten.
Martin Graf ist Vizepräsident der Konservativen.
Ich möchte alle österreichischen Mitglieder der Versammlung hier nennen: Doris Bures, Christian Buchmann, Franz Leonhard Eßl, Carmen Jeitler-Cincelli, Axel Kassegger, Agnes Sirkka Prammer. Ihnen allen zolle ich Lob. Herzlichen Dank für Ihre engagierte Arbeit im Rahmen der PVER, der Parlamentarischen Versammlung des Europarates! – Danke schön. (Beifall bei ÖVP, SPÖ, Grünen und NEOS.)
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Österreich gab uns zwei großartige und erfolgreiche Präsidenten der Parlamentarischen Versammlung, Peter Schieder und Karl Czernetz, aber auch den Generalsekretär des Europarates Walter Schwimmer, ehemaliges Mitglied der PV. Wir erinnern uns in Straßburg noch gut an sie.
Das österreichische Parlament kann also stolz darauf sein, wie es in Straßburg vertreten ist. Ihre Mitglieder sind Vorbilder an politischer Weisheit, Intelligenz, Verantwortung und Integrität. Sie sind ein Vorbild für andere Delegationen.
In diesem Jahr, liebe Kolleginnen und Kollegen, begehen wir den 75. Jahrestag des Europarates. Diese Organisation wurde nach dem Zweiten Weltkrieg als einzigartiges Friedensprojekt mit einem ganz klar gefassten Ziel gegründet, nämlich einen neuen Krieg in Europa zu verhindern. Die europäischen Länder kamen kollektiv überein, demokratische Sicherheit aufzubauen, und zwar auf der Grundlage des Bekenntnisses jedes Mitgliedstaats zur Rechtsstaatlichkeit, zu Menschenrechten und zu Demokratie.
Ein halbes Jahrhundert später, nach dem Ende des Kalten Krieges, brachte dieses Projekt Europa schließlich zusammen. Trotz Herausforderungen und trotz der Rückschläge, vor denen wir heute stehen, dürfen wir das nicht vergessen. Wir können mit Stolz sagen, dass dieser Traum der politischen Titanen aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg nach wie vor eine Erfolgsgeschichte ist.
Die Werte, die der Europarat verkörpert, bleiben unser Kompass und sind auch Teil unserer europäischen DNA. Sie sind Teil des Gefüges unseres politischen, sozialen und kulturellen Lebens. Sie haben so viel Relevanz wie in der Vergangenheit, und ich bin überzeugt davon, dass diese Werte die einzige Möglichkeit darstellen, durch die raue See und die Stürme des 21. Jahrhunderts zu navigieren.
Die umfängliche Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine begann am 24. Februar 2022. Das war ein eklatanter Angriff auf dieses Friedensprojekt und eine existentielle Bedrohung dieser gemeinsamen Werte.
Unsere Organisation war die erste und bislang einzige internationale Organisation, die den Beschluss fasste, die Russische Föderation als unmittelbare und direkte Folge dieses Krieges auszuschließen. Dabei solidarisierten wir uns nicht nur mit unserem Mitgliedstaat Ukraine, sondern auch mit allen anderen
Mitgliedstaaten und auch mit den Bürgerinnen und Bürgern Europas und darüber hinaus. Sie verlassen sich ganz auf die internationale Gemeinschaft, um demokratische Stabilität ihrer Institutionen und Gesellschaften hochzuhalten.
Wir dürfen nicht vergessen, dass diese eklatante Aggression der Russischen Föderation nicht nur ein Angriff auf unsere Werte und Institutionen darstellt. In ganz Europa erleben wir die wachsenden Anzeichen demokratischer Rückschritte, und das sollte für uns ein Weckruf sein, das sollte alarmierend sein.
Diese Anzeichen sind durch die allmähliche Aushöhlung der Grundfreiheiten gekennzeichnet. Ich spreche dabei zum Beispiel über die Meinungsäußerungsfreiheit, ich spreche da auch über die Schwächung des Systems der Kontrolle, der Checks and Balances.
Ich spreche über die Ausbreitung von Desinformation, Hassrhetorik und ich spreche auch über offene und weniger offene Versuche, Menschen, die andere Meinungen haben, mundtot zu machen, zum Beispiel auch Medienschaffende oder Vertreter und Vertreterinnen politischer Positionen. Unsere Bürger vertrauen ihren Institutionen weniger, sie sind politikmüde geworden, und das sollte für uns besorgniserregend sein. Ich möchte nun meine Ansichten kurz erläutern.
Meine Damen und Herren! Seit 1981 bin ich Teil des öffentlichen Lebens meines Landes. Ich war früher Journalist, ich war Abgeordneter im Parlament, war Minister, arbeitete als Universitätsprofessor, und ich war Teil wichtiger historischer Augenblicke unserer Zeit und habe dadurch Erfahrungen sammeln können.
In vielen Fällen erlebte ich Hoffnung, aber auch Enttäuschung. Als ich zum Beispiel die Rüstungskontrollvereinbarung zwischen den USA und der Sowjetunion erlebte, erlebte ich etwas sehr optimistisch Stimmendes, nämlich das wechselseitige Verständnis. Dann traf ich Michail Gorbatschow im Kreml. Ich traf jenen Mann, der den Lauf der Geschichte ändern konnte und dies auch tat. Was mich faszinierte, war seine Vision.
Dann erlebte ich, wie die Berliner Mauer fiel, und ich hörte dem Architekten der deutschen Wiedervereinigung, Helmut Kohl, zu. Ich weiß, dass er natürlich Schwierigkeiten überwinden musste, um das Trennende in seinem Land zu überwinden. Er setzte sich durch, daher bin ich doch recht hoffnungsvoll gewesen, was die Zukunft betrifft.
Ich traf dann auch Margaret Thatcher in Paris mit François Mitterand und George Bush senior. Sie sprachen über den weltweiten Frieden. Ich meinte damals, dass diese Zeit der Trennung vorüber sei, und ich möchte darüber noch kurz sprechen.
Vor 34 Jahren, ein Jahr nach dem Fall der Berliner Mauer, kamen am 21. November 1990 die Spitzenvertreter aller Länder Europas – aus dem Osten und dem Westen – und auch Vertreter der USA und Kanadas in Paris als Vertreterinnen und Vertreter von Ländern zusammen, die einen gemeinsamen Nenner haben, nämlich Freiheit, Demokratie, aber auch das Bekenntnis zu den Prinzipien der guten nachbarschaftlichen Beziehungen.
Sie traten auch für die Achtung der Unverletzlichkeit der Grenzen und die Souveränität der Staaten ein. Sie bekannten sich zu friedlicher Konfliktbeilegung und Zusammenarbeit, sie bekannten sich also zu vielen, vielen Dingen, Commitment hieß das Zauberwort. Die 34 Verantwortlichen der damaligen KSZE unterzeichneten die Charta von Paris für ein Neues Europa. Es ist dies ein Dokument, das wir heute etwas selbstgefällig als historisch bezeichnen.
Ich sprach dann auch mit Nelson Mandela, der bewies, dass sich Beharrlichkeit und Geduld durchsetzen, um Gleichstellung zu verwirklichen, dass dies die einzige Möglichkeit ist, eine bessere Welt zu gestalten. Als ich mit ihm sprach, glaubte ich wiederum an die Vision der Demokratie. Dann brachen aber erneut Spannungen aus: Ich spreche von dem Krieg in Jugoslawien, ich spreche über neue Spannungen auf dem Balkan, die laufenden Konflikte im Nahen Osten und ich erwähne da auch den Arabischen Frühling. Es war eigentlich gar kein Frühling, sondern ein neuer Winter, der viele Konflikte nach Europa brachte,
zum Beispiel auch neue Migrationsströme und Millionen Flüchtender, die entweder Asyl oder ein besseres Leben anstreben.
Ich spreche natürlich aber auch von den Reaktionen auf diese Migranten beziehungsweise auch vom Phänomen der Menschenhändler, dieser Menschen, die andere als Sklaven betrachten. Wir müssen aber die legalen Migrationsmechanismen einhalten. Wir dürfen unsere Menschlichkeit nicht verlieren. Wir dürfen aber natürlich auch die Tragödien nicht vergessen, hervorgerufen durch Kriege, Armut und die Klimakrise.
Meine Dissertation behandelte die ethnische Identität der Griechen in Venedig des 17. Jahrhunderts. Ich befasste mich da mit Besonderheiten in kultureller Hinsicht, aber auch mit Fragen der nationalen Identität. Ich verstehe daher sehr gut, dass es doch in vielen Teilen Europas einige Sorgen gibt, nämlich betreffend die Änderung oder die mögliche Änderung nationaler Identitäten.
Wir wissen aber aus historischen Gründen, dass unsere Welt immer schon Bevölkerungsbewegungen verzeichnete, sowohl in Europa als auch in den USA. Man darf natürlich die aktuellen Probleme nicht ignorieren. Wir müssen zusammenarbeiten – und zwar fußend auf dem gemeinsamen Verständnis –, um Lösungen zu finden, die für alle von Nutzen sind. Ich spreche über jene, die anderswo bessere Chancen suchen, und ich spreche auch über jene, die sich manchmal richtigerweise und manchmal auch übertriebene Sorgen machen.
Nun, wir stehen auch in unserer europäischen Familie vor vielen Trennungen und Spaltungen. Verstärkt wurde dies durch die Finanzkrise des Jahres 2008. Das hat natürlich Narben hinterlassen, das hat Spaltungen hervorgerufen und führte dazu, dass sich immer mehr Menschen Sorgen um die Vision eines gemeinsamen Europas machen. Wir wären aber unwürdige Nachfahren der großen politischen Führer, wenn wir es nicht immer wieder versuchten.
Die Frustration ist ein Teil, ein integrierender Bestandteil von Bemühungen, wenn man sich aber nicht bemüht, dann führt das zu Idiotie, wie das die Griechen nannten. Das englische Wort idiot und das deutsche Wort Idiot stammen vom griechischen Wort idiotes ab. Es beschreibt in der alten Demokratie jemand Privaten, jemand, der sich nicht für das Gemeinwohl interessierte und nicht an den Entscheidungen der Agora oder an öffentlichen Angelegenheiten teilnahm.
Wir müssen aber Teilhabe an den Tag legen. Diese Bemühungen, die wir entfaltet haben, führten zum Beispiel im vergangenen Jahr zum 4. Gipfeltreffen des Europarates in Reykjavik. Auf diesem Gipfeltreffen haben die Staats- und Regierungschefs, zum Beispiel auch Präsident Alexander Van der Bellen, gemeinsam ihren Willen zur Unterstützung der Prinzipien der Demokratie und auch zur Unterstützung der Ukraine, solange dies eben notwendig ist, bekräftigt.
Wir brauchen nachhaltige Antworten auf die Bedrohungen der demokratischen Stabilität und auch Antworten auf die Bedrohung des Friedens auf dem europäischen Kontinent. Auf dem Gipfeltreffen von Reykjavik ignorierten die Staats- und Regierungschefs die Appelle der Parlamentarischen Versammlung nicht, nämlich so rasch wie möglich ein umfassendes Rechenschaftssystem einzurichten, um sicherzustellen, dass alle Verbrechen der Russischen Föderation richtig untersucht, verfolgt und geahndet werden. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass da Gerechtigkeit vonstattengeht. (Beifall bei der SPÖ sowie bei Abgeordneten von ÖVP, Grünen und NEOS.)
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der erste Rechtsstaatsmechanismus für die Folgen der russischen Aggression, ein Schadensregister, wurde auf dem Gipfel aus der Taufe gehoben. Heute ist dieses Schadensregister in Betrieb, es läuft und es gibt bereits Einzelklagen, die eingebracht werden. Die Versammlung kümmert sich aber natürlich auch noch um andere Dinge. Wir wollen dafür Sorge tragen, dass die Kinder wiederum in die Ukraine zurückkehren können, vor allem jene, die in die Russische Föderation, aber auch nach Belarus und in die besetzten Gebiete verschleppt wurden.
Es waren schreckliche Entwicklungen, jetzt geht es aber um den Wiederaufschwung, um den Wiederaufbau der Ukraine. Sie sollten sich einen Bericht zu Gemüte führen, den wir erstellt haben, er betrifft die Entwicklung der letzten zwei Jahre, und zwar im Detail. Es geht natürlich auch noch um andere große Herausforderungen, vor denen wir stehen: Klimawandel, Umweltschutz beziehungsweise spreche ich auch über das exponentielle Wachstum der Nutzung der KI in allen Lebensbereichen.
Unsere Versammlung ist ein Pionier im Europarat. Uns geht es um ein neues Denken, neue Ansätze im Bereich der Menschenrechtsthemen. Wir müssen unseren Rechtsrahmen gegebenenfalls anpassen und wir müssen multilaterale Kooperationsmechanismen einrichten, um gemeinsam die besten Lösungen zu finden.
Dann natürlich auch noch die rasche Ausbreitung der KI: Diesem Thema muss man sich stellen, das ist eine Priorität, die für mich als Präsidenten sehr wichtig ist. Es ist eine faszinierende neue Welt, vor der wir stehen. Ich zähle zu jenen, die meinen, dass es zwar Vorbehalte und auch einige Gründe, sich Sorgen zu machen, gibt, dass wir aber trotz allem gemeinsam darüber nachdenken sollten, wie sich denn die KI auf unser tägliches Leben und auf unsere demokratischen Erfahrungen auswirkt, und darüber, wie man die KI regulieren kann.
Das riesige Potenzial der KI sollte optimal genutzt werden, aber wir sollten uns von der künstlichen Intelligenz nicht instrumentalisieren lassen. Vor 100 Jahren meinte Alexis de Tocqueville – ich schließe an das an, was ich vorhin sagte, ich sprach über die Athener Agora und über die sogenannten Idioten –, dass die größte Bedrohung der Demokratie dann eintritt, wenn man nicht mehr teilnimmt, wenn man sich nur mehr privat um seine eigenen Dinge kümmert.
Ich spreche über die sozialen Netzwerke und die Algorithmen, die für viel Spaltung sorgen, beziehungsweise über die Echokammern, in denen man sich nur mit Gleichgesinnten aufhält. Diese Fragmentierung führt möglicherweise zu Radikalisierung und das führt möglicherweise zu Konflikten und Kriegen.
Das heißt, wir müssen hier ein Gleichgewicht schaffen. Einerseits müssen wir die Risiken abschwächen, müssen aber gleichzeitig natürlich auch die Vorteile der KI vollinhaltlich nutzen. Ich glaube, dass ein erster richtiger Schritt darin besteht, Diskussionsprozesse anzugehen. Da müssen alle Akteure eingebunden werden, also die Öffentlichkeit, der private Sektor, die NGOs und die Bürgerinnen und Bürger. Da geht es um die Entwicklung von Spielregeln.
Das Ministerkomitee soll hier ein rechtsverbindliches Dokument erstellen, und zwar zum Thema KI und Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Das war auch ein Appell der Versammlung, eine Initiative der Versammlung. Ich hoffe, dass Österreich gemeinsam mit anderen Mitgliedstaaten diesem Übereinkommen beitreten wird, wenn dieses Übereinkommen dann unterzeichnet werden kann, damit es in Kraft treten und damit auch in der Praxis weiterentwickelt werden kann.
Ich komme zum Schluss, meine Damen und Herren. Ich möchte noch meine eigenen Erfahrungen einbringen. Seitdem ich Mitglied der PV wurde, war ich zum Beispiel Vorsitzender des Migrationsausschusses und jetzt bin ich Präsident der PV des Europarates.
Der Europarat, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist eine relativ kleine Organisation im Vergleich zu anderen Organisationen, die wir auf internationaler Ebene kennen. Der Haushalt ist winzig im Vergleich zum Haushalt anderer europäischer Institutionen. Trotzdem meine ich, dass der Europarat sehr wohl sein Gewicht in die Waagschale werfen kann, und zwar in den Gebieten, in denen er über ein einzigartiges Mandat verfügt, auch über Fachkenntnis, eine moralische Autorität, und ich spreche auch über die Agilität und die Flexibilität des Europarates, die andere vielleicht nicht haben.
Ich bin überzeugt davon, dass der Europarat eine ganz klare Rolle spielen kann und zweck- und zielgerichtet in der internationalen Arena vorgehen kann. Der Europarat kann auf neue Herausforderungen reagieren, kann auch proaktive Schritte setzen und kann auch Neuland entsprechend bearbeiten – und zwar
weil wir eine solide Grundlage haben, das Vertrauen, die Kooperation mit den nationalen Regierungen und den nationalen Parlamenten. Das ist ein starkes Fundament.
Ich weiß, dass es natürlich auch Vorbehalte gibt, größere Vorbehalte. Natürlich sind wir nicht immer alle einer Meinung, und das ist auch gut so. Wenn wir immer der gleichen Meinung wären, dann wäre das natürlich kein gutes Zeichen für die Qualität unserer Demokratien. Ich werde mit großem Interesse zuhören. Ich freue mich schon auf die heute geäußerten Meinungen. Während meiner Amtszeit als Präsident der PVER möchte ich immer zuhören.
Mein Ziel besteht darin, etwas in die Tat umzusetzen, nämlich das, was meiner Meinung nach für uns echte Persönlichkeiten von Populisten unterscheidet. Führungspersonen sind jene, die in die Zukunft blicken, die bereit sind, ihr eigenes Handeln zu hinterfragen, und die sich und ihre Politik dabei auch verbessern. Jene, die nur den Massen zuhören, das sind einfach Populisten. Die Demokratie toleriert alle Stimmen. Die Geschichte zeichnet nur jene aus, die die Welt zu einem besseren Ort machen. – Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. (Allgemeiner Beifall.)
12.43
Präsident Ing. Norbert Hofer: Thank you, Mr. President, for your comment and your explanation.
Wir gehen nun in die Debatte über die Erklärung ein.
Zu Wort gelangt Herr Dr. Reinhold Lopatka. – Bitte schön, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Dr. Reinhold Lopatka (ÖVP): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ja, der Europarat feiert 75 Jahre, der Europarat sollte aber vor allem auch ein Projekt für die Jugend sein. Daher freut es mich, die 3. Klasse des Francisco Josephinums Wieselburg herzlich hier begrüßen zu dürfen. (Allgemeiner Beifall.)
Mich freut es, Herr Präsident Theodoros Rousopoulos, dass Sie mit der ersten Generalsekretärin des Europarates Despina Chatzivassiliou-Tsovilis zu uns gekommen sind, um mit uns diese 75 Jahre – ich sage es so, wie ich es sehe – durchaus zu feiern.
Österreich ist seit 1956 Mitglied des Europarates. Wesentlich war aber dann, dass wir 1958 die Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten übernommen haben – und nicht nur übernommen, sondern 1964 haben wir bei uns in Österreich die Konvention und die Zusatzprotokolle im Verfassungsrang in unsere Rechtsordnung implementiert. Damit haben wir uns dafür entschieden, dass Menschenrechte in unserem Land einen besonderen Stellenwert genießen.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in der Weiterentwicklung der Menschenrechte eine besondere Stellung. Den Richtern kommt große politische Bedeutung zu, weil sie damit natürlich massiven Einfluss auf die Rechtsetzung haben, und da möchte ich auch als Abgeordneter, als Parlamentarier anmerken: Umso sorgsamer müssen Richter in ihren Entscheidungen sein.
Die Menschenrechte sind nirgends so gut geschützt wie in Europa. Präsidentin Bures war dabei, als wir bei einem Österreicher waren, der bei der UNO bei diesem Thema an der Spitze steht, nämlich beim Menschenrechtskommissar Volker Türk in Genf. Nachdem er uns die triste Lage weltweit geschildert hat, was Menschenrechte betrifft, habe ich ihn gefragt: Na, gibt es nicht irgendwo einen Lichtblick? – Daraufhin hat er gemeint: Das ist der Europarat mit seinen Institutionen und auch mit einem eigenen Menschenrechtskommissar.
Was war der Beitrag Österreichs in diesen 75 Jahren? – Wir haben überdurchschnittlich viel beigetragen. Wir hatten aus Österreich drei Generalsekretäre, die langjährig gewirkt haben: Lujo Toncić-Sorinj, Franz Karasek und der Letzte, auch ehemaliger Abgeordneter aus unseren Reihen hier, Walter Schwimmer.
Aber wir hatten auch zwei Präsidenten der Parlamentarischen Versammlung, Karl Czernetz und Peter Schieder. Sein Sohn hat heute hier schon das Wort ergriffen. Auch das gibt es in Österreich: dass Söhne weitermachen, wo die Väter aufgehört haben.
Und ganz wichtig: Der Europarat ist auch eine Institution, die durchaus Verständnis für föderale Systeme hat. Der, der am längsten hier auf Europaebene, im Europarat gearbeitet hat, war Herwig van Staa. Er hat seinen Beitrag als Präsident des Kongresses der Gemeinden und Regionen geleistet.
Was ich damit sagen möchte: Österreich hat überdurchschnittlich viel durch starke Persönlichkeiten zur positiven Weiterentwicklung des Europarates beitragen können.
Neben der Förderung der Menschenrechte – und das halte ich für wichtig – hat sich der Europarat immer intensiv mit dem Schutz von Minderheiten auseinandergesetzt, auch was den notwendigen – notwendiger denn je in Tagen wie diesen – Kampf gegen Antisemitismus betrifft.
Der beste Beitrag, den Österreich immer leisten kann, ist ein kultureller – das sage ich mir. Die Europahymne, vor 200 Jahren von Ludwig van Beethoven in Baden bei Wien komponiert, war zuerst die Hymne des Europarates, jetzt ist sie die Hymne des gesamten europäischen Spektrums, der Europäischen Union. Es war auch ein Österreicher, der das eingespielt hat, ein ganz, ganz großer Dirigent, Herbert von Karajan.
Wir haben also einen bleibenden Beitrag mit österreichischer Prominenz und mit der Hymne. Der Europarat hat der Europäischen Union auch die Fahne gegeben, und der Europarat ist ganz wichtig dafür, dass Staaten, die noch nicht in der Europäischen Union sind, darauf vorbereitet werden. 47 Staaten sind im Europarat, leider erst 27 in der Europäischen Union. Auch dahin gehend hat der Europarat im Zusammenwirken mit der Europäischen Union auch in Zukunft
eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. – Danke. (Beifall bei ÖVP und Grünen sowie bei Abgeordneten von SPÖ und NEOS.)
12.48
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt nun Frau Präsidentin Doris Bures. – Bitte schön, Frau Präsidentin. (Abg. Leichtfried: Erste Rede!)
Abgeordnete Doris Bures (SPÖ): Meine sehr geehrten Damen und Herren! Hohes Haus! Sehr geehrter Herr Präsident Theodoros Rousopoulos! Ja, mit 75 Jahren mag der Europarat in Menschenjahren vielleicht alt erscheinen, doch um Ihre Landsfrau, die Griechin Nana Mouskouri, zu zitieren: „Man muss nicht leise sein, nur weil man alt ist“. (Beifall bei SPÖ, ÖVP und Grünen sowie bei Abgeordneten der NEOS.)
Ich denke, ganz das Gegenteil ist der Fall. Gerade der Europarat darf aktuell nicht leiser werden. Die Bedeutung des Europarates misst sich nämlich nicht in Menschenjahren, sondern in Menschenleben. 700 Millionen Menschen leben unter dem Schutz der Europäischen Menschenrechtskonvention. Hinzu kommen über 200 rechtlich bindende internationale Verträge, die vor Gewalt, Folter und Missbrauch schützen sollen.
Europa hat zwei verheerende Weltkriege mit Abermillionen Toten auf den Schlachtfeldern und in den Lagern, Faschismus und Nationalismus erlitten.
Europas Lehren daraus sind Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und die Solidarität zwischen Menschen und Nationen. (Beifall bei der SPÖ sowie bei Abgeordneten von ÖVP und Grünen.)
Herr Präsident, in diesem Geschichtsbewusstsein hat sich Österreich in der Zweiten Republik ganz bewusst für eine aktive, friedensorientierte Rolle in der Staatengemeinschaft entschieden. Das neutrale Österreich beheimatet in der Bundeshauptstadt Wien viele internationale Organisationen wie die OSZE oder die UNO. Auf diese Tradition der konstruktiven Konfliktlösung waren wir auch
stets stolz, und ich denke, dass wir uns gerade angesichts der internationalen Krisenherde auf diese Stärke der Tradition wieder besinnen und daran anknüpfen sollten. (Beifall bei der SPÖ sowie bei Abgeordneten von ÖVP und Grünen.)
Herr Präsident, vor fünf Jahren, im Juni 2019 sprach Ihre Vorgängerin Liliane Maury Pasquier anlässlich 70 Jahre Europarat auch im österreichischen Nationalrat. Rückblickend auf diesen Juni 2019 müssen wir heute feststellen: Niemand konnte erahnen oder vorhersehen, was alles in diesen fünf Jahren passieren sollte: eine Pandemie mit ihren menschlichen Tragödien und ihren sozialen und wirtschaftlichen Verwerfungen, Krieg in Europa, verschuldet durch den Angriff Russlands auf die Ukraine, Krieg im Nahen Osten, ausgelöst vom Terror der Hamas, rasant steigender Antisemitismus, Rassismus, aber auch Homophobie und immer mehr Angriffe auch auf Frauenrechte.
Demokratische Institutionen werden von innen und von außen infrage gestellt, um unsere Demokratien und unsere Rechtsstaatlichkeit zu destabilisieren. Wir könnten das erweitern: um unzählige Krisenherde, um die Teuerung, um Inflation, um den Klimawandel und viele weitere Aspekte. Und ja, all das stimmt zu Recht ganz viele Menschen pessimistisch und lässt sie auch an der Zukunft zweifeln.
Aber wissen Sie, wir haben in der Vergangenheit schon bewiesen, dass wir der Gegenwart nie ohnmächtig gegenübergestanden sind.
Wir wissen zu genau, dass die Zukunft eben in unseren Händen liegt. Wir können die Logik des Krieges durchbrechen und wir können sie durch die Logik des Friedens ersetzen.
Wir können dem Hass, der Feindseligkeit, der Spaltung der Gesellschaft mit Solidarität, mit Gerechtigkeit, mit Menschlichkeit entgegentreten (Beifall bei der SPÖ, bei Abgeordneten der ÖVP sowie der Abgeordneten Disoski und Krisper) und
wir können Frieden und Zusammenarbeit durch ganz konkrete, an den Lebensbedingungen der Menschen orientierte politische Maßnahmen verändern.
Wir brauchen wieder mehr Vertrauen – mehr Vertrauen in unsere demokratischen Institutionen, um eben Angriffe auf unsere liberalen Demokratien abzuwehren.
Da liegt viel in unseren Händen, viel, das wir wahrscheinlich alleine nicht leisten können. Deshalb gibt es eben auch den Europarat, der dazu einen Beitrag leisten kann.
Stärken wir die soziale Dimension! Nehmen wir auch in Europa und in unserem Land diese soziale Dimension wieder stärker in den Fokus – auf Basis wirtschaftlicher Innovationen, auf Basis des Wachstums.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, es geht um nicht mehr oder weniger als um mehr Gerechtigkeit in Österreich, in Europa. Und Gerechtigkeit ist keine Wohltat, Gerechtigkeit ist ein Recht – in Österreich und in Europa. – Vielen Dank. (Beifall bei der SPÖ, bei Abgeordneten von ÖVP und Grünen sowie der Abg. Krisper.)
12.54
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt nun Frau Abgeordnete Susanne Fürst. – Bitte schön, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete Dr. Susanne Fürst (FPÖ): Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Minister! Sehr geehrter Herr Präsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarates! Sehr geehrte Damen und Herren! Der Europarat wurde vor 75 Jahren als zwischenstaatliche Organisation gegründet, ausdrücklich nicht als supranationale Organisation. Dies betone ich deshalb, weil es einen ganz gravierenden Unterschied macht.
Zwischenstaatliche Organisation heißt Kooperation vieler Länder – Gott sei Dank –: Kooperation, Empfehlungen. Supranational heißt: Abgabe von Souveränität, Abgabe von nationalen Rechten an eine überstaatliche Organisation. Man hat sich 1949 und dann in den Fünfzigerjahren aktiv dagegen entschieden, und das gilt nach wie vor gemäß der Satzung, das hat sich nicht geändert.
Der Europarat ist mit seinen Organen, der Parlamentarischen Versammlung und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dessen Richter von Ihrem Organ bestellt werden, zu dieser Kooperation im Sinne der Friedenssicherung in Europa aufgerufen, im Sinne der Bewahrung – nach der Satzung, Wortlaut – unseres gemeinsamen europäischen Erbes, der Sitten der europäischen Völker als Quelle individueller und politischer Freiheit, unter Bewahrung der Rechtsstaatlichkeit und der pluralistischen Demokratie; wie Sie es, Herr Präsident, auch in Ihrem Eingangsstatement angesprochen haben.
Das sind schöne Ideen, das sind nicht nur Floskeln, und dafür sollten wir wirklich gemeinsam kämpfen, aber rechtsstaatlich kann es nur sein, wenn man sich an die Satzungen, an das Vereinbarte, auch an die Europäische Menschenrechtskonvention, die ja auch von Ihrer Versammlung beschlossen wurde, hält. Meiner Ansicht nach wird diese Satzung und werden diese Ziele aber nicht eingehalten, und da müssen Sie oder der Europarat sich den Vorwurf machen lassen, dass das Vertrauen in die Institutionen eben erodiert, wenn Vereinbarungen nicht eingehalten werden.
Es wird, insbesondere durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der da vorgeschoben wird, nun sehr wohl in die Souveränität der Mitgliedstaaten des Europarates eingegriffen. Er machte sich sozusagen ohne rechtliche Grundlage zur supranationalen Organisation.
Weil Sie den französischen Gelehrten Tocqueville angesprochen haben, einen großer Kämpfer für die Demokratie und für die Freiheit: Er hat eben auch die Gefahren der Demokratie gesehen, weil das Vertrauen in die Institutionen dann
geschmälert und zerstört wird, wenn man sich nicht an die rechtsstaatlichen Grundlagen hält. Er hat vor dem gewarnt, was jetzt eingetreten ist.
Ich sage es Ihnen mit nur ganz wenigen illustren Beispielen, einzelnen Beispielen, die aber hunderttausendfache Wirkungen in Europa haben:
Artikel 8 EMRK, wir kennen ihn alle, das Recht auf Privat- und Familienleben, gedacht in der Europäischen Menschenrechtskonvention in den Fünfzigerjahren, aber nach wie vor, als Schutz vor Zugriffen des Staates auf das Privatleben, das Familienleben, das Hausrecht, schützt vor willkürlichen Kindesabnahmen, vor Hausdurchsuchungen. Was macht eine Judikatur des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte in den letzten, ich sage einmal, zwei Jahrzehnten daraus?
Ein Beispiel: Ein nigerianischer Staatsbürger begeht in Großbritannien, in seinem Aufnahmeland, eine Reihe von schweren Verbrechen. Er ist viele Jahre in England im Gefängnis, anschließend möchte ihn Großbritannien abschieben, natürlich. Wer verbietet das Großbritannien? – Der Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, weil der nigerianische Staatsbürger in Nigeria, in seinem Herkunftsland kein Privat- und Familienleben mehr hat. Er ist eben viele Jahre in England im Gefängnis gesessen. Er ist in seinem Recht auf Privat- und Familienleben verletzt. Er bleibt in England, weil er da jetzt Anschluss gefunden hat. Das heißt, sein privates Interesse wiegt mehr als das öffentliche Interesse Englands, als das Selbstbestimmungsrecht des Mitgliedstaates des Europarates. – Es sind Judikate wie diese, die das Vertrauen in diese Institution erschüttern.
Auch ein somalischer verurteilter Terrorist konnte sich auf sein Privat- und Familienleben hier in Europa berufen, wurde nicht abgeschoben, außerdem weil er krank war und weil ihm in Somalia keine gleichwertige medizinische Behandlung gewährleistet werden konnte.
Das ist eine degenerierte Rechtsprechung. Da entwickelte der Europarat neue Rechte, welche ihm von den Mitgliedstaaten niemals gegeben wurden. Es ist
vom Wortlaut der EMRK nicht gedeckt. Da wird der Europäische Gerichtshof zum Gesetzgeber, was ihm nicht zusteht. Diese Regelungen stehen den nationalen Parlamenten zu, da werden die nationalen Verfassungen untergraben. Das steht dem Europarat aber nicht zu; wie gesagt: Er ist eine zwischenstaatliche Organisation, keine supranationale Organisation.
Der letzte Streich ist das Klimaschutzurteil gegen die Schweiz, das Sie, glaube ich, auch angesprochen haben. Da wird ein paar älteren Damen eingeredet, sie würden länger leben, wenn es in der Schweiz weniger heiße Tage gäbe. Das müsse man über eine Reduktion der CO2-Emissionen erreichen. Sie bekommen tatsächlich recht, dass die Schweiz da zu wenig gemacht hat! Die Schweiz macht – nur um auch ein bisschen auf die Logik und die Rationalität Bezug zu nehmen – ungefähr 0,1 oder 0,2 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen aus. Der EGMR hat aber die Schweiz tatsächlich verurteilt, weil sie im Klimaschutz zu wenig macht, und ein individuelles Recht abgeleitet, welches in der Europäischen Menschenrechtskonvention keine Grundlage findet und auch sonst keine rechtliche Grundlage hat. (Präsidentin Bures übernimmt den Vorsitz.)
Ich hoffe, dass Sie vielleicht darauf einwirken können, dass da wieder eine Trendumkehr stattfindet, denn das ist nicht am Boden der Rechtsstaatlichkeit, nicht am Boden der Demokratien – alles, wofür Sie als Europarat eigentlich stehen, ein so positives Organ eigentlich, das in den Fünfzigerjahren gegründet wurde und das man ja auch mit einem positiven Geist füllen könnte. So wird das Vertrauen aber zunichtegemacht.
Ich möchte Ihnen nach Straßburg mitgeben, dass der Europarat eben eine zwischenstaatliche Organisation ist, die für Frieden und Einigkeit eintritt, aber eben auch die Demokratien und die Souveränität der Mitgliedstaaten akzeptieren und respektieren muss. – Danke. (Beifall bei der FPÖ.)
13.01
Präsidentin Doris Bures: Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Meri Disoski. – Bitte.
13.01
Abgeordnete Mag. Meri Disoski (Grüne): Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuseherinnen und Zuseher! Sehr geehrter Herr Präsident Rousopoulos, vielen Dank für Ihren Besuch heute hier bei uns! Das Ziel des Europarates ist die Förderung von Demokratie, von Menschenrechten und von Rechtsstaatlichkeit in Europa und darüber hinaus. Mit diesem Anliegen haben Sie in uns starke und verlässliche Partnerinnen und Partner, denn so wie auch der Europarat stehen wir für eine pluralistische Demokratie ein.
Was heißt das? – Das ist eine Demokratie, in der es viele Stimmen gibt, in der unterschiedliche Perspektiven eingenommen werden, denn das ist der Nährboden für Offenheit, für Vielfalt und für Diversität und damit für all das, was unsere Gesellschaften ausmacht und auch stark macht.
Darum ist der Austausch – wie der heutige, Herr Präsident – insofern auch extrem wichtig und relevant, als es in Zeiten der erstarkenden Rechten und Rechtsextremen in Europa von essenzieller Bedeutung ist, dass die demokratischen Parteien wissen, was sie zu tun haben.
Die Aufgabe aller demokratischen Parteien ist es, felsenfest auf der Seite der Demokratie zu stehen. Die Aufgabe aller demokratischen Parteien ist es, felsenfest auf der Seite des Rechtsstaats zu stehen. Die Aufgabe aller demokratischen Parteien ist es auch, felsenfest auf der Seite der Menschenrechte zu stehen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Europarat ist eine sehr wichtige Institution für Rechtsstaatlichkeit, für Demokratie und für Menschenrechte. Als Institution verdeutlicht der Europarat also eine Gemeinschaft auf der Basis von rechtlich fundierten Werten. Das überträgt sich deckungsgleich auf unsere Sicht der aktuellen Herausforderungen.
Es ist nicht das Erstarken von Nationalstaaten oder das Heraufbeschwören von Grenzen, das uns in die Zukunft tragen wird, nicht die Verzwergung, wie sie von rechten und rechtsextremen Parteien propagiert wird. Das wird uns nicht in die Zukunft bringen. All das bringt uns höchstens zurück in die dunkelste Geschichte unseres Kontinents.
Das ist der Weg in die Zukunft: eine Gemeinschaft auf Basis von rechtlich fundierten Werten; eine starke Stimme, die die Menschenrechte hochhält und sich für ihre Einhaltung einsetzt. (Beifall bei den Grünen sowie der Abgeordneten Jeitler-Cincelli und Pfurtscheller.)
Sie haben darauf Bezug genommen, das wird angesichts des verbrecherischen Angriffskriegs Putins gegen die Ukraine einmal mehr deutlich, und auch das müssen wir uns heute vor Augen halten, wenn wir hier das 75-Jahr-Jubiläum feiern.
Wir hören relativierende Worte, auch aus diesem Hohen Haus. Wir hören auch hier, in unserem Parlament, eine laute, aber sehr kleingeistige Stimme schreien, die Fakenews verbreitet, die russische Kriegspropaganda verbreitet und die sich mit einer kompletten Verzerrung der Neutralität auf die Seite von Putin stellt.
Während all das passiert, während wir all diese relativierenden Worte aus dem Hohen Haus hören und hier eine Partei haben, die sich auf die Seite des Kriegstreibers stellt, ist es umso wichtiger, dass wir helle, starke und nachhaltige Stimmen für die Menschenrechte hören. Das ist eine Stimme, die gleicherweise auch für Demokratie und für den Rechtsstaat spricht, das möchte ich hier auch noch einmal betonen.
Ein Aspekt, den ich ganz anders als Kollegin Fürst sehe und den ich hier ebenfalls ansprechen möchte, sind die Klimaklagen – Sie (in Richtung Präsident Rousopoulos) haben selbst darauf Bezug genommen. Am 9. April erging ein erstmaliger Gerichtsbeschluss zur Frage des Klimawandels: Der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte anerkennt die Rolle des menschengemachten Klimawandels im Hinblick auf Leben, Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität.
Kollegin Fürst, das ist sicher keine „degenerierte Rechtsprechung“, wie Sie es formuliert haben, sondern richtungsweisend für anhängige und mögliche künftige Klimaklagen. (Beifall bei den Grünen. – Abg. Belakowitsch: Das ist absoluter Irrsinn!)
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, das Dreigestirn aus Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit ist die größte Errungenschaft, die wir je erkämpft haben. Diese Errungenschaft ist aber nicht naturgegeben. Wenn wir nicht wachsam sind – das sehen wir gerade jetzt –, können wir all das schnell verlieren. Auch in den vergangenen Generationen ist diese Herausforderung sehr deutlich zutage getreten. Wir leben in einer Zeit, in der diese Herausforderung auch kaum aktueller sein könnte.
Wir stehen vor einem Europa, das sich mit einer ständig erstarkenden Rechten konfrontiert sieht. Rechte und rechtsextreme Parteien in ganz Europa gehen auf Stimmenfang, und sie meinen es nicht gut mit unserem Kontinent. Sie meinen es nicht gut mit den Bürgerinnen und Bürgern. Wir werden deshalb nicht aufhören, für diese Errungenschaften weiterzukämpfen. Wir werden nicht aufhören, für Demokratie, für Menschenrechte und für Rechtsstaatlichkeit zu kämpfen, Seite an Seite mit allen demokratischen Parteien und Seite an Seite mit dem Europarat. (Beifall bei Grünen und ÖVP sowie des Abg. Matznetter.)
13.06
Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Stephanie Krisper. – Bitte. (Abg. Loacker: Gib ihnen Saures, Steffi!)
Abgeordnete Dr. Stephanie Krisper (NEOS): Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Minister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuseherinnen und Zuseher! Es ist eine große Freude, aufgrund des
Jubiläums des 75-jährigen Bestehens des Europarates in unserem Nationalrat den Anlass zu haben, in Ihrer Anwesenheit, Herr Präsident, die Arbeit und die Errungenschaften des Europarates zu feiern.
Der Europarat ist als ältester europäischer Staatenbund und als größte Menschenrechtsorganisation Europas eine beispiellose Institution. Seit 75 Jahren arbeitet er für Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, das heißt, für unsere europäischen Werte, die die Grundlage unseres Zusammenlebens sind.
Am bekanntesten ist Ihnen wohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte: ein einzigartiges Gericht, an das sich jede Bürgerin, jeder Bürger aus all den 46 Mitgliedstaaten des Europarates wenden kann, wenn er oder sie meint, dass die nationalen Gerichte seine oder ihre Menschenrechte nicht geschützt, sondern verletzt haben. Was ist das für eine tolle Errungenschaft, die man in dunklen Zeiten unserer Geschichte wahrlich nie für möglich gehalten hätte?!
Es gibt im Europarat aber auch – und das möchte ich hier kurz erklären – die Parlamentarische Versammlung, die ähnlich wie unser Parlament funktioniert, mit verschiedenen Parteienfamilien, die sich aus Abgeordneten aus allen 46 Mitgliedstaaten zusammensetzen und die, so wie wir, in Ausschüssen zu unterschiedlichen Themen zusammenarbeiten. Da bin ich schon beim Punkt: Im Gegensatz zu dem, was wir als Opposition hier erleben – nämlich dass fast 99 Prozent unserer Ideen, Vorschläge und Anträge weggeschoben und abgelehnt werden –, herrscht in diesen Ausschüssen im Europarat eine konstruktive Diskussionskultur. Dank dieser kann von jeder politischen Seite ein Bericht, eine Empfehlung oder Ähnliches erarbeitet werden und hat auch die Chance, angenommen zu werden.
Es ist schon frappierend für mich – im Vergleich zur nationalen Ebene in den letzten Jahren –, dass es, wenn ich in Straßburg, auf Europaratsebene, Menschenrechtsverletzungen benenne, für die Wahrung der Menschenrechte oder Rechtsstaatlichkeit Empfehlungen abgebe, dann Zustimmung gibt und die Texte angenommen werden. Es gibt dort ja auch nicht so viele Ausreden.
Letztlich stimmen dann auch Parteien sowohl vom linken als auch vom rechten Rand zu.
Nun kann man sagen: Na ja, das ist ja egal, der Europarat macht ja keine Gesetze, er produziert nur Text! Ich denke aber, dass in Wahrheit auch die populistischen Parteien wissen, was menschenrechtlich geboten wäre, und nur auf nationaler Ebene schärfere Töne wider besseres Wissen anstimmen, aus verantwortungslosem Kalkül heraus.
Das hört man nicht nur aus den Reihen der FPÖ – wie auch heute schon bei der Rede meiner Kollegin –, die die Menschenrechtskonvention an sich ja auch in Frage stellt und einen Austritt Österreichs aus der Menschenrechtskonvention befürworten würde, sondern auch aus den Reihen der konservativen Partei, der ÖVP, wenn zum Beispiel ihr Klubchef meint, dass er eine Überarbeitung der Menschenrechtskonvention befürworten würde, oder eine Ministerin – Ministerin Edtstadler – sagt, es bräuchte Urteile, die realitätsnahe seien – das mit Blick auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte. Da muss man schon sagen: Die Auslegung der Menschenrechtskonvention obliegt dem Gerichtshof und nicht einer Kollegin, nicht mir und auch nicht einer österreichischen Ministerin.
Apropos Menschenrechtsgerichtshof: Ich habe die Ehre, mit Petra Bayr im Ausschuss zu sitzen, der die Hearings zu den Kandidatinnen und Kandidaten macht, die Richterin, Richter am Menschenrechtsgerichtshof werden wollen, und auch da läuft es ganz anders – Gott sei Dank – als bei uns. Ich hatte ja das Vergnügen, bei den Diskussionen dabei zu sein, wer bei uns für die Kontrollkommission bestellt wird, die unseren Verfassungsschutz kontrollieren soll, und da wussten die alten drei Parteien sehr schnell, wer ihr Mitglied ist, egal wie gut andere sind. Es gab keine inhaltliche Diskussion über die Frage, wer der Beste für diese Position wäre.
In diesem Komitee wiederum gibt es aber Gott sei Dank einen Austausch von Argumenten über die Qualifikation der Kandidatinnen und Kandidaten, über die
Auswahlkriterien, die wir auch immer weiterentwickeln – da sind Verbesserungen immer möglich. Der Zugang ist einer, der den inhaltlichen Diskurs in den Fokus rückt.
Noch schnell in den Fokus möchte ich die Arbeit der Gremien des Europarates rücken, die es sonst noch gibt und die Empfehlungen auch Richtung Österreich aufgrund von kritischen Punkten aussprechen, die sie erarbeitet haben. Da gäbe es viele offene Punkte und entsprechende Maßnahmen – zur Stärkung der Frauenrechte, zur Verhütung von Folter und unmenschlicher Behandlung, gegen Korruption und gegen Menschenhandel –, bei denen Österreich in der Umsetzung säumig ist.
Insbesondere der letzte Bericht der Expertengruppe des Europarates gegen Korruption war sehr kritisch mit Österreich, und die Empfehlungen sind weiterhin zum großen Teil nicht umgesetzt. Deswegen würde ich schon sagen, auch wenn Herr Lopatka gelobt hat, dass wir als Österreich bei der musikalischen Hintergrundgestaltung des Europarates federführend mit dabei waren: Das kann es nicht gewesen sein! Wir sind Verpflichtungen eingegangen, die wir auch umzusetzen haben. (Präsidentin Bures gibt das Glockenzeichen.)
Dieser Tag böte den richtigen Anlass, um uns noch einmal unseren Verpflichtungen zu stellen, als Regierung diese Verpflichtungen wahrzunehmen und endlich in die Umsetzung der Empfehlungen zu kommen. Das wäre neben dem Beklatschen von Reden die wahre Wertschätzung gegenüber dem Europarat. – Vielen Dank. (Beifall bei den NEOS sowie bei Abgeordneten von SPÖ und Grünen.)
13.12
Präsidentin Doris Bures: Herr Präsident Theodoros Rousopoulos, mir wurde mitgeteilt, Sie würden sich jetzt noch zu einer kurzen Replik zu Wort melden. – Bitte, dann erteile ich Ihnen das Wort.
13.13
Präsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarates Theodoros Rousopoulos (in Übersetzung durch einen Simultandolmetscher): Frau Präsidentin! Ich habe schon sehr viel Zeit in Anspruch genommen, daher werde ich mich kurz fassen.
Ich möchte mich herzlich für diesen Erfahrungs- und Meinungsaustausch bedanken; danke auch, dass Sie den Europarat und die Arbeit, die wir leisten, erwähnt haben. Sie wissen vielleicht, dass es in den letzten zwei Tagen sehr interessante und wichtige Gespräche zu den Richterinnen und Richtern gab, dazu, wie man die Richter des EGMR wählen sollte. Ich habe bereits erwähnt, dass die österreichischen Abgeordneten einen aktiven Beitrag bei diesen Diskussionen leisten.
Dann wurde auch über Menschenrechte und ein gesundes Umfeld gesprochen. Der EGMR hat vor einigen Tagen zum Beispiel einen wichtigen Beschluss gefasst, nämlich dass es ein Menschenrecht auf eine gesunde Umwelt gibt, und das betrifft nicht nur alle europäischen Bürgerinnen und Bürger, sondern die Situation weltweit.
Ich möchte mich wie gesagt kurz fassen und möchte nur einige kurze Gedanken äußern. Wenn ich öffentlich spreche, sage ich oft, dass ich ein stolzer Grieche bin, weil mein Land das erste Land war, das aus dem Europarat ausgeschlossen wurde. Das überrascht viele Menschen, nämlich dass ich sage, dass ich stolz bin. Das war im Jahr 1969, es gab damals Diktatoren in Griechenland. Das zeigte doch ganz eindeutig, dass der Europarat für die Prinzipien eintritt, die für uns wichtig sind; drei Wörter: Demokratie, Menschenrechte und Rechtstaatlichkeit – das sind drei wichtige Begriffe. Es geht aber auch um die Würde, es geht um die Achtung und die Zusammenarbeit. (Beifall bei SPÖ, Grünen und NEOS sowie bei Abgeordneten der ÖVP.)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, etwas Interessantes ist passiert, als ich hierher trat: Dieses Podium hier kann gesenkt werden und kann auch angehoben
werden, wie man sieht (das Redner:innenpult zuerst nach unten und dann nach oben verstellend), das hängt vom Redner ab. Der Redner, die Rednerin kann sich diese Höhe selbst einstellen, aber alle ergreifen das Wort. Das ist ein Ort, an dem wir – wie ich auch in Straßburg im Jänner gesagt habe – Diskussionen führen; wir kämpfen aber nur mit Wörtern.
Ich nahm mit großer Freude an dieser Debatte teil, so wie auch im eigenen Land, in Griechenland. Es ist sehr wichtig, dass wir diese Aussprachen durchführen. Das ist ein Eckpfeiler der Demokratie und auch ein Beweis für die Demokratie.
Ich möchte die drei Wörter noch einmal erwähnen – ich glaube, dass diese Begriffe sehr wichtig sind –: Würde: Würde für alle, für jene, die diese Würde benötigen, Würde für jene, die meinen, dass ihnen nicht Gerechtigkeit widerfuhr; Achtung: Achtung gegenüber den Rechten, die Menschen haben; natürlich auch Zusammenarbeit: Zusammenarbeit zwischen uns, ungeachtet der Meinungen, die wir vertreten, ungeachtet der ideologischen Unterschiede. – Wenn wir auf diese Begriffe abstellen, können wir optimistisch in die Zukunft blicken.
Den Europarat gibt es seit 75 Jahren – gut. Er hat über all die Jahre bewiesen, dass er sehr wichtig ist. Die europäischen Staaten funktionieren demokratisch und sind zielgerichtet. Für mich ist es jedenfalls eine große Ehre, heute vor Ihnen im österreichischen Nationalrat gesprochen zu haben. – Danke schön, dass Sie mich eingeladen haben, Frau Präsidentin, danke schön, liebe Kolleginnen und Kollegen. (Allgemeiner Beifall.)
13.16
Präsidentin Doris Bures: Nun gelangt Frau Abgeordnete Carmen Jeitler-Cincelli zu Wort. – Bitte.
Abgeordnete Mag. Carmen Jeitler-Cincelli, BA (ÖVP): Frau Präsidentin! Geschätzter Herr Präsident Rousopoulos! Geschätzter Herr Minister! Ich
versuche immer, mit etwas Positivem zu beginnen, wo man eigentlich nicht viel Positives sieht. In diesem Fall möchte ich Susanne Fürst danken, und zwar dafür, dass sie, auch wenn wir nicht gleicher Meinung sind, in einer Sachlichkeit und in einer respektvollen Kultur ihre Sichtweise dargelegt hat.
Ich habe das heute in der vorangegangenen Diskussion – wir haben zum Thema Europa gesprochen – als ganz erschütternd empfunden. (Zwischenruf der Abg. Belakowitsch.) Es ist richtig unangenehm, diese Form, diese Respektlosigkeit. Was Sie jetzt gesagt haben, Würde und Respekt, um das geht es. Es war geringschätzend, entwürdigend, herabwürdigend, und dieser Stil der Kommunikation hat in diesem Haus eigentlich nichts verloren. (Abg. Belakowitsch: Das hat aber schon 2020 begonnen!) Wir sollten uns alle an der Nase nehmen, denn das, was da heute war und wie sich das angefühlt hat, ist genau das, was zu Konflikten führt, die darüber hinausgehen. (Beifall bei der ÖVP sowie des Abg. Scherak.)
Wir reden heute über eine der tragenden Säulen der europäischen Integration und Demokratie, und das ist der Europarat seit seiner Gründung 1949 zum Schutz der Menschenrechte, zur Förderung der Demokratie und zur Rechtsstaatlichkeit. Er ist die entscheidende Institution, mit den 47 Mitgliedstaaten, die einfach wesentlich mehr umfasst als unsere Länder der Europäischen Union. Er ist auch die Geburtsstätte unserer Menschenrechtskonvention, und das ist ein bahnbrechendes Dokument, da es maßgeblich alles zum Schutz der Menschenrechte auf unserem Kontinent geformt hat.
Neben dieser Menschenrechtspolitik spielt er allerdings auch eine entscheidende Rolle bei der Förderung der kulturellen Identität und der Vielfalt. Ich möchte besonders die Kulturaustauschprogramme hervorheben und ich möchte besonders die vielen Bildungsprojekte hervorheben, die zur Stärkung des Verständnisses und des Respekts der Länder untereinander dienen.
Da wir über Regionen reden: Es ist hier oben (in Richtung Galerie) eine Gruppe, die ich noch begrüßen möchte. Der Seniorenbund Traunkirchen hat hierher
gefunden. – Herzlich willkommen; schön, dass Sie nach Wien gekommen sind. (Beifall bei ÖVP, SPÖ und Grünen.)
Der Europarat hat eine zentrale Bedeutung in der Demokratisierung und der europäischen Integration der Länder des Westbalkans. Viele von euch wissen ja, ich bin Leiterin der parlamentarischen Freundschaftsgruppe für den Kosovo, und mir ist das ein riesengroßes Anliegen gewesen. Ich möchte auch jenen danken, die dabei mitgeholfen haben – es war gar nicht so einfach, dass wir noch nach Paris kommen konnten. Danke, Agnes, für dein Engagement, dass wir alle wirklich Seite an Seite zusammengearbeitet haben, um diesen riesigen Schritt für den Kosovo möglich zu machen.
Die Kosovaren sind uns wahnsinnig dankbar dafür. Es ist für sie der große Schritt in Richtung weitere Integration in die Europäische Union. Danke vielmals an alle, die federführend dabei waren und auch zusammengeholfen haben. (Beifall bei ÖVP, SPÖ und Grünen sowie des Abg. Scherak.)
Ja, der Kosovo ist da bereit, aber auch alle anderen Westbalkanländer sind bereit, riesengroße Schritte zu gehen. Der Europarat bietet dabei praktische Unterstützung und sehr viel Fachwissen an. Die Annäherung an die europäischen Normen und die aktive Teilnahme an diesen Institutionen des Europarates bereiten die Westbalkanländer auf diesen weiteren Schritt, auf die Anforderungen und die Verpflichtungen, die mit einer EU-Mitgliedschaft einhergehen würden, entsprechend vor. Diese Bedeutung als Wegbereiter und als Unterstützer auf dem Weg zur EU kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Danke vielmals auch für Ihr Engagement! Griechenland und Österreich arbeiten da auch zusammen – danke sehr.
An dieser Stelle möchte ich auch noch sagen: Noch einmal herzlich willkommen, Kosovo, im Europarat! Ja, es ist uns eine Freude, dass wir hier quasi gemeinsam neue Wege gehen können.
Reinhold Lopatka hat vorhin in seiner Rede schon 200 Jahre Europahymne, also die damalige Uraufführung von Beethovens 9. Sinfonie, erwähnt. Geschrieben wurde sie in meiner Heimatstadt Baden bei Wien. Hier eine kleine Werbeeinschaltung: Es gibt im Beethovenhaus gerade die Ausstellung dazu, die sehr, sehr sehenswert ist, mit den Originalbriefen, die Ludwig van Beethoven geschrieben hat. Jetzt ist endlich quasi dokumentiert, dass die Hymne wirklich dort fertig geschrieben worden ist. Es gibt nämlich einen Brief, den er von seiner Sommerfrische schreibt, in dem er über die Kuren schreibt und dass er gar nicht so viel Zeit hat, zur Arbeit zu kommen, aber dass er jetzt eben die letzten Takte, quasi die letzten Melodien schreibt, um diese Hymne dann zu vervollständigen. – Also ich kann empfehlen, dort hinzugehen.
Zu guter Letzt: In einer Zeit, in der die Prinzipien der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in vielen Teilen der Welt sehr unter Druck stehen, bleibt der Europarat als Plattform für den Dialog, für die Zusammenarbeit, als Kommunikationsplattform, er setzt konkrete Standards.
Doris Bures hat vorhin gesagt, wir müssen die Logik des Krieges durchbrechen. Ich glaube, so wie Sie vorhin zu uns gesprochen haben, ist es für uns alle Balsam für die Seele, denn die Sprache, die Wertschätzung, das, was Sie mitgeben, ist das, was wir in Europa brauchen – und nicht weiter dieses Getose. Danke, Mister Rousopoulos, für Ihr Kommen, für die Haltung, für diese Überlegtheit und die Unaufgeregtheit. Es ist gut und tut uns allen gut nach der vorhergegangenen Debatte. – Danke schön. (Beifall bei der ÖVP sowie bei Abgeordneten von SPÖ und Grünen.)
13.22
Präsidentin Doris Bures: Nun gelangt Frau Abgeordnete Petra Bayr zu Wort. – Bitte.
Abgeordnete Petra Bayr, MA MLS (SPÖ): Agapité Theódore! Agapití Déspina! Lieber Indrek, einer der drei Kandidaten für die Funktion des künftigen
Generalsekretärs des Europarates – nicht der Parlamentarischen Versammlung, sondern des gesamten Europarates –, mit dem einige von uns heute zu einem späteren Zeitpunkt noch die Möglichkeit haben werden, zu sprechen. Ich möchte aber auch den Pensionistenverband Ligist begrüßen, von dem 49 Leute heute hier anwesend sind und uns zuhören. Herzlich willkommen hier im österreichischen Parlament! (Beifall bei der SPÖ, bei Abgeordneten von ÖVP und Grünen sowie der Abgeordneten Belakowitsch und Krisper.)
Ja, 75 Jahre ist der Europarat alt und, wie wir gehört haben, nicht leise. In diesen 75 Jahren hat es ein Auf und Ab gegeben, und ich denke, momentan sind wir mit besonders vielen Herausforderungen konfrontiert – es ist erwähnt worden –: Wir haben Krieg in Europa. Wir haben aufgrund dessen auch sehr schnell Russland ausgeschlossen. Wir haben aber auch die Situation, dass Großbritannien oder die Tories in Großbritannien darüber nachdenken, die Konvention zu verlassen, weil sie mit Urteilen des Gerichtshofes nicht zufrieden sind. – Churchill würde sich im Grab umdrehen. – Wir haben ein Verfahren gegen Aserbaidschan wegen der Aktivitäten Aserbaidschans in Nagorny Karabach, seinen Menschenrechtsverletzungen dort, aber auch seinen nachweislich unfairen Wahlen. Wir haben ein Ausschlussverfahren gegen die Türkei aufgrund dessen, dass, obwohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte zweimal geurteilt hat, dass Osman Kavala freigelassen werden muss, die Türkei dem nach wie vor nicht nachgekommen ist.
Jetzt ist es bei all dem, was ich aufzähle, aber keine Lösung von Multilateralismus, zu sagen: Raus, raus, raus – mit all jenen, die böse sind, all jenen, die nicht so tun, wie wir es gerne hätten, wollen wir nichts mehr zu tun haben! – Ganz im Gegenteil, der Auftrag ist, weiterhin an einem Tisch zu sitzen, weiterhin zu versuchen, Probleme zu lösen und diese möglichst friedlich zu lösen.
Weil der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte angesprochen worden ist – und ich bin der Meinung, dass dieser wahrscheinlich eine unserer allerwichtigsten Institutionen ist, die den Schutz der Menschenrechte für 700 Millionen Bürgerinnen und Bürger in ganz Europa als letztinstanzliches Gericht garantiert –
: Ich glaube auch, dass es wahrscheinlich eine unserer allerwichtigsten Aufgaben als Parlamentarische Versammlung des Europarates ist, die Richterinnen und Richter zu wählen und dabei darauf zu achten, dass das wirklich Personen sind, die einerseits Wissen haben, Know-how haben, die andererseits aber auch respektiert werden und auch wirklich entsprechende Autorität haben, damit diesen letztinstanzlichen Urteilen, die ja oft letztinstanzliche nationalstaatliche Urteile aufheben, auch wirklich Autorität zuerkannt wird und diese in den Ländern auch wirklich anerkannt werden.
Du hast es erwähnt, Theódore, wir haben am Montag ein lange geplantes Treffen in Wien gehabt, bei dem wir versucht haben, die zwei Bodys, die zwei Einheiten, die mit dieser Wahl der Richter:innen befasst sind, zu synchronisieren, versucht haben, Meinungsverschiedenheiten darüber, wie man die Konvention in diesen Fragen der Qualifikation der Kandidat:innen interpretiert, zu synchronisieren. Ich glaube, das ist auch wirklich gelungen, und es freut mich sehr, dass das quasi als ein Wiener Treffen dazu in die Geschichte eingehen wird.
Bezüglich der Art und Weise, wie wir Richterinnen und Richter wählen, möchte ich dazusagen, dass wir da, verglichen mit anderen internationalen Gerichtshöfen, jetzt schon sehr vorbildlich sind, was Transparenz, was demokratische Beschlusslage, was Nichtpolitisierung dieser Verfahren betrifft. In dem Sinne, dass das Gute der Feind des Besseren ist, glaube ich aber, dass wir unsere Arbeit da noch weiter verbessern können und das auch tun. Es ist sehr fein, dass das gelungen ist. (Beifall bei der SPÖ sowie der Abg. Disoski.)
Um meine Rede mit Anmerkungen zum Thema Multilateralismus abzuschließen: Egal, ob es der Europarat ist, ob es die Europäische Union ist, ob es die Vereinten Nationen sind, wir sind nicht perfekt, all diese Strukturen sind nicht perfekt. Sie sind manchmal teuer, sie sind manchmal langsam, und sie schaffen es nicht immer, die Konflikte zu verhindern, die wir gerne verhindern wollen. Trotzdem ist es immer noch billiger und besser, zu versuchen, Konflikte am Tisch auszutragen, als dies auf dem Schlachtfeld zu tun, denn das ist jedenfalls das Teurere.
Sie sind außerdem die einzige Chance, die ich sehe, um globalen Herausforderungen zu begegnen, wie zum Beispiel der Gleichstellung der Geschlechter. Es freut mich zum Beispiel sehr, dass ich als damalige Vorsitzende des Gleichbehandlungsausschusses sehr aktiv daran beteiligt war, dass wir jetzt in der Parlamentarischen Versammlung eine Quotenregelung haben und es innerhalb von zwei Jahren geschafft haben, von einem Drittel Frauen auf fast 50 Prozent Frauen in der Parlamentarischen Versammlung zu kommen. (Beifall bei der SPÖ sowie bei Abgeordneten von ÖVP und Grünen.)
Ich glaube, es ist auch wichtig, dass sich die Bevölkerung Europas in der Parlamentarischen Versammlung widerspiegelt, aber es gibt natürlich auch noch andere Herausforderungen – die Klimakrise ist erwähnt worden, die künstliche Intelligenz. Wir werden die Ersten mit einer Konvention zur Frage künstliche Intelligenz und Menschenrechte sein. Das ist ein wirklich wichtiger Schritt, den der Europarat da macht. (Beifall bei Abgeordneten der SPÖ sowie der Abg. Krisper.)
Um zum Abschluss zu kommen: Freiheit, Frieden und Demokratie hängen untrennbar zusammen. Und wenn Sie ein Europa wollen – jetzt komme ich vom großen Europa des Europarates zum kleineren EU-Europa –, das demokratisch legitimiert ist, dann bitte ich Sie alle, die zusehen, am 9. Juni wirklich zur Wahl zu gehen und Ihre Zukunft und Ihre Hoffnungen zu wählen – und nicht irgendwelche Ängste, die geschürt werden. (Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordneten der ÖVP.)
13.28
Präsidentin Doris Bures: Zu Wort gemeldet ist nun Herr Abgeordneter Martin Graf. – Bitte.
Abgeordneter Mag. Dr. Martin Graf (FPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident Rousopoulos! Sehr geehrte Damen und Herren des Hohen Hauses! Sehr
geehrter Herr Bundesminister! Es freut mich, dass Sie auch dieser Debatte folgen.
Herr Präsident! Ich muss Ihnen einmal ein Lob aussprechen. Ich bin der Debatte jetzt aufmerksam gefolgt und Sie waren der erste oder eigentlich der einzige Redner, der an die Präambel gedacht hat, die vor 75 Jahren an den Beginn der Satzung des Europarates gestellt wurde, in der nämlich festgehalten ist, dass es ein Friedensprojekt ist. Niemand sonst hier – mit Ausnahme von Kollegin Bayr jetzt in ihrem letzten Satz – hat erwähnt, dass der Europarat an sich zur Festigung des Friedens, als Friedensprojekt – mithilfe der demokratischen, rechtsstaatlichen Mittel, der Menschenrechte und so weiter und so fort – gegründet wurde.
Ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten dieser Friedensgedanke zunehmend verloren geht. Wenn ich Diskussionen hier im Parlament oder auch im Europarat höre, dann habe ich den Eindruck, es herrscht schon eine Friedensmüdigkeit und niemand kämpft mehr wirklich für den Frieden, obwohl immer mehr Krieg auf unserem europäischen Boden stattfindet. Es ist ja nicht nur der Russlandkonflikt – ich möchte diesen nicht relativieren; jeder weiß, wer dort die Verantwortung zu tragen hat, und vieles andere mehr.
Wir haben aber nach wie vor auch ein Mitgliedsland wie die Türkei, die in benachbarten Regionen ungeniert Krieg führt, aber auch im Inland eine sehr große Minderheit, die Kurden, mit kriegerischen Mitteln bekämpft – nur um es einmal festzustellen. Oder: Zypern ist nach wie vor ein geteiltes Land, das von einem Staat besetzt ist, der Mitglied der europäischen Wertegemeinschaft, nämlich des Europarates ist. Und man vergisst das.
Ich bin lange genug in der Politik – (in Richtung Präsident Rousopoulos:) Sie haben schon die Klammer zu der Zeit vor dem Fall der Mauer gespannt – und erlaube mir, einen kurzen Rückblick zu machen: Wissen Sie, ich bin schon lange nicht nur in der österreichischen Politik, sondern als politisch tätiger Mensch unterwegs und will Ihnen da eine kleine Geschichte erzählen, wie ich in den Jahren 1988
und 1989 noch als einer der wenigen mit Freunden und Organisationen für den Fall der Mauer gekämpft habe. (Heiterkeit des Abg. Schallmeiner.) Da sind alle, wie man auf gut Wienerisch sagt, ruhig in der Stauden gehockt und Ähnliches mehr. Mit unseren Organisationen haben wir zum Beispiel – und es ist signifikant, wie sich Dinge auch ändern – anlässlich der neuerlichen Kreditvergabe an die DDR und damit Festigung dieses Unrechtsregimes einen Brief an Bundeskanzler Kohl geschrieben, er möge diese Art der Politik stoppen, weil sie in den Abgrund führt.
Im Juli 1989 hat Herr Bundeskanzler Kohl uns geantwortet. Und wissen Sie, was er geschrieben hat? – Wir sollen mit diesem rechtsextremen und revanchistischen Gedankengut aufhören und uns daran gewöhnen, dass es zwei deutsche Staaten gibt. Vier Monate später war er der Wiedervereinigungskanzler und wollte davon nichts mehr wissen. – Das ist nur ein kleiner Abschnitt aus der Geschichte.
Weil gerade Angehörige meiner Gesinnungsgemeinschaft immer als Rechtsextremisten und Putin-Versteher und Ähnliches bezeichnet werden, möchte ich da auch etwas aus dem Europarat aufgreifen: Im Jahr 2014, nach der Annexion der Krim, wurde Russland das Stimmrecht im Europarat zu Recht entzogen, es wurde suspendiert. Dann haben die Kräfte des politischen Establishments dafür gekämpft, Russland das Stimmrecht wieder zurückzugeben, allen voran die Sozialisten mit ihrem Fraktionsführer Schwabe – in der gleichen Fraktion sind auch die Grünen und die haben auch dafür gestimmt – und natürlich auch ganz stark die Volksparteien, an der Spitze auch Kollege Lopatka, man möchte es nicht glauben. (Abg. Eßl: Der war ja noch gar nicht dabei!) Sie haben es geschafft, dass 2019 Russland das Stimmrecht wieder gewährt wurde – mit dem Ergebnis, dass der Krieg weitergegangen ist. Die NEOS mit der liberalen Fraktion waren damals auch mehrheitlich dafür, muss man sagen – alles vergessen!
Heute geht man wieder los, und alle, die sich nach wie vor für Frieden einsetzen, sind Rechtsextremisten und Ähnliches (Abg. Michael Hammer: Ihr setzt euch für gar nix ein!) oder Rechte, die man bekämpfen muss, Populisten und vieles andere
mehr. Der Standort bestimmt oft den Standpunkt, möchte man da sagen. (Präsidentin Bures gibt das Glockenzeichen.)
Sehr geehrte Frau Präsident, man hat nur eine kurze Redezeit. Eines möchte ich an dieser Stelle noch sagen: Das politische Establishment sieht der großen Gefahr nicht ins Auge. Der politische Islam ist in Europa angekommen, wie wir überall sehen. (Präsidentin Bures gibt neuerlich das Glockenzeichen.) Er ist da, er weiß, was er will, und er ist gut organisiert. Seit Jahrzehnten wird diese Gefahr ignoriert und anstelle dessen wird die rechte Gefahr hochstilisiert. Ich glaube, das müssen wir ändern, nicht nur in Österreich - -
Präsidentin Doris Bures: Herr Abgeordneter, Sie müssen den Schlusssatz formulieren!
Abgeordneter Mag. Dr. Martin Graf (FPÖ) (fortsetzend): - -, sondern auch in Europa. – Danke. (Beifall bei der FPÖ.)
13.34
Präsidentin Doris Bures: Nun gelangt Frau Abgeordnete Agnes Sirkka Prammer zu Wort. – Bitte. (Abg. Eßl: Der Lopatka ist aber seit einem Jahr erst im Europarat! – Abg. Martin Graf – auf dem Weg zu seinem Sitzplatz –: Das hörts ihr nicht gerne! Das passt nicht in eure Erzählung!)
Abgeordnete Mag. Agnes Sirkka Prammer (Grüne): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! 1949 stand Europa vor Trümmern, und Europa als Gemeinschaft von Staaten hat erkannt, was diese Trümmer verursacht hat, nämlich Diktatur, Rassismus und Faschismus. Das hat uns in eine Situation gebracht, die viel Leid, viel Tod und viel Zerstörung in Europa hervorgebracht hat.
Das war der Gründungsgedanke. Das ist der Grund, warum die Staaten sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben: Das darf nicht mehr passieren!
Die Lösung dafür, dass so etwas nicht passiert, ist eine gemeinsame Zusammenarbeit, und zwar eine Zusammenarbeit im Sinne von Demokratie, von Rechtsstaatlichkeit und von Menschenrechten. (Beifall bei den Grünen.)
Dadurch hat sich Europa, haben sich die Staaten, hat sich aber auch die Staatengemeinschaft weiterentwickelt, hin zu einer weiteren Integration. Das ist gut so und es geht in die richtige Richtung, aber es ist keine Selbstverständlichkeit.
(In Richtung Präsident Rousopoulos:) Ich muss mich entschuldigen, die Reihen sind bei uns nicht immer so leer. Es liegt vielleicht ein bisschen an der Tageszeit, aber es kann auch gut daran liegen, dass man es für selbstverständlich hält, dass Europa funktioniert, dass wir in einer Gemeinschaft leben, in der wir die Werte teilen, in der wir die Werte der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit sowie der Menschenrechte teilen und in der wir einen Konsens haben, dass wir diese bewahren wollen.
Das ist aber nicht immer so, es ist nicht immer gleich, und es werden die Stimmen lauter, die auch andere Töne anschlagen – am Anfang feine, aber sie werden immer deklarierter. Dem muss man Einhalt gebieten, da muss man anfangen, und da muss man diejenigen Stimmen lauter werden lassen, die dagegenreden.
Ich muss meiner Kollegin in einem gewissen Sinne recht geben: Ja, es ist gut, wenn man hier sachlich diskutieren kann. Ich glaube aber, man muss sich für eine sachliche Diskussion nicht bedanken; ich denke, das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Wenn man genau zugehört hat: Ganz so sachlich war die Diskussion dann aber doch wieder nicht, denn von einer degenerierten Rechtsprechung zu reden ist aus meiner Sicht nicht sachlich, ganz im Gegenteil. (Beifall bei den Grünen sowie der Abgeordneten Krisper und Stark.)
Die Menschenrechte, und zwar jene Menschenrechte, zu denen wir uns alle verpflichtet fühlen, gelten universell. Das bedeutet, dass wir uns nicht aussuchen
können, wem wir sie gewähren und wem wir sie nicht gewähren. Das ist die Essenz, die Quintessenz dessen, was uns davor bewahrt, dass wir wieder in eine Situation kommen, in der Einzelne auf andere herabschauen, in der Einzelne denken, sie können andere herabwürdigen (Abg. Belakowitsch: Herabwürdigen ...!), in der Gruppen denken, sie wären wichtiger, sie wären besser als andere. Dafür ist das uneingeschränkte Bekenntnis zu den universellen Menschenrechten die Garantie.
Genauso verhält es sich mit der Rechtsstaatlichkeit. Die Rechtsstaatlichkeit ist ein Rahmen, zu dem wir uns verpflichten, den einzuhalten wir uns als reife Demokratie, als Mitglieder einer reifen Demokratie verpflichten. Der Rechtsstaat ist nicht etwas, das man einfach beliebig ändern kann, denn der Rechtsstaat gibt uns den Rahmen vor. Wenn wir diesen Rahmen verlassen oder wenn wir uns anschicken, an diesem Rahmen so sehr zu rütteln, dass er schief wird, dass er einzustürzen droht, dann ist das zu viel und dem muss man Einhalt gebieten.
Innerhalb des rechtsstaatlichen Rahmens ist vieles möglich, sollte alles möglich sein. Innerhalb dieses rechtsstaatlichen Rahmens kann man unterschiedliche Ansichten, kann man unterschiedliche Politikweisen, kann man unterschiedliche Richtungen wählen, aber dieser Rahmen darf nicht verlassen werden. (Beifall bei den Grünen.)
Das Gleiche gilt für die Demokratie. Die Demokratie muss vieles aushalten und die Demokratie hält auch vieles aus. Die Demokratie zu zerstören ist aber auch mit demokratischen Mitteln möglich, nämlich dann, wenn sich durch demokratische Mittel Strömungen durchsetzen, die genau diese Fundamente – den Rechtsstaat und die Menschenrechte – nicht mit dem notwendigen Respekt behandeln.
Dafür müssen wir uns einsetzen: dass das eben nicht passiert und dass wir alle gemeinsam mit beiden Beinen auf diesem festen Fundament stehenbleiben. – Danke sehr. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
13.39
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Nikolaus Scherak. – Bitte.
Abgeordneter Dr. Nikolaus Scherak, MA (NEOS): Frau Präsidentin! Herr Präsident! Herr Außenminister! Ich hatte von 2013 bis 2017 die Ehre, als Mitglied in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates zu wirken und dort mitzuarbeiten, und habe auch davor immer schon, auch schon während meines Studiums, ein großes Interesse an der oder eine große Leidenschaft für die Arbeit des Europarates gehabt.
Es war immer herausfordernd – und das liegt bei Institutionen, die sehr konsequent teilweise im Hintergrund arbeiten und nicht so nach außen wirken, leider in der Natur der Sache –, dass man den Menschen erklärt, was wir in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates denn tun und wieso diese Institution so wichtig ist.
Herr Präsident, ich glaube, Sie haben schon sehr gut dargelegt, was für unterschiedliche Handlungsfelder in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, aber auch beim EGMR bearbeitet werden, und ich glaube, dass es gerade in Zeiten wie diesen, in diesen herausfordernden Zeiten, in denen wir leben, so wichtig ist, dass wir gewisse Leitplanken haben, an denen wir uns orientieren können. Institutionen wie der Europarat, der seine Arbeit bereits seit 75 Jahren sehr konsequent und klar macht und vorantreibt, sind natürlich besonders gut dafür geeignet, dass man sich an ihnen orientiert.
Es ist insbesondere jetzt, in diesen Zeiten, vor dem Hintergrund, dass bald die Wahlen zum Europäischen Parlament stattfinden – wiewohl eine andere Organisation, aber man kann sagen, nahezu Schwesterorganisation; der Europarat wurde ja noch viel früher gegründet –, so wichtig, dass man sich überlegt und daran erinnert, wieso denn eine Institution wie der Europarat so relevant ist.
Man muss sich überlegen: So etwas Großartiges, dass ein Bürger eines Mitgliedstaates des Europarates die Möglichkeit hat, sich nach der Ausschöpfung des innerstaatlichen Instanzenzuges an ein übergeordnetes Gericht zu wenden und ganz höchstpersönlich seine Grund- und Freiheitsrechte einzumahnen und einzuklagen, gibt es nirgendwo anders auf der Welt! Das ist eine Errungenschaft, die in ihrer Dimension gar nicht fassbar ist, und wenn man es nicht schon längst erfunden hätte, dann sollte man es jetzt erfinden.
Das betrifft nicht nur Staaten, in denen demokratische Standards nicht sonderlich hochgehalten werden – es gibt ja leider Gottes auch Mitgliedstaaten der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, die es mit den Werten, auf die wir uns einigen, nicht immer so ernst nehmen –, es ist genauso für Österreich relevant. Es gibt viele Bürgerinnen und Bürger auch aus Österreich – es gab ganz viele medienrechtliche Fälle, bei denen es um die Frage der Meinungsäußerungsfreiheit ging –, die, weil sie nicht das Recht bekommen haben, von dem sie überzeugt waren, dass es ihnen zusteht, zum EGMR gegangen sind; und da hatten wir ein Gericht, das uns klare Leitlinien gibt, wie mit Grund- und Freiheitsrechten umzugehen ist.
Österreich ist auch noch besonders, weil wir die Europäische Menschenrechtskonvention im Verfassungsrang haben, sprich die österreichischen Höchstgerichte, der Verfassungsgerichtshof diese direkt anzuwenden haben. Dementsprechend ist es so wichtig, dass man diese Errungenschaft nicht als Selbstverständlichkeit nimmt, sondern immer wieder betont, wie relevant das ist; und es ist deswegen so wichtig, das zu betonen, weil wir uns in Zeiten wie diesen, in denen Extremisten und Populisten von links und rechts diese Grundwerte infrage stellen, natürlich daran erinnern sollten, woher denn diese Idee kam: Wir haben aus den Trümmern des Zweiten Weltkrieges zum Glück gelernt und uns darauf geeinigt, dass wir allen Menschen, die in Europa sind, hier grundlegende, fundamentale Menschenrechte garantieren wollen. Deswegen ist es auch nicht sinnvoll, wenn immer wieder, leider auch hier in Österreich, Diskussionen
aufkommen, dass man die Europäische Menschenrechtskonvention ja vielleicht überarbeiten sollte.
Nein, ich bin auch nicht immer mit allem einverstanden, wie Gerichtshöfe urteilen, aber es ist unsere Aufgabe, das zu respektieren; und nein, ich halte es nicht für sinnvoll, dass wir beginnen, über fundamentale Grund- und Menschenrechte Diskussionen zu führen und diese infrage zu stellen, denn es ist doch so gut, dass wir uns nach dem Zweiten Weltkrieg auf diese geeinigt haben. (Beifall bei den NEOS sowie bei Abgeordneten von SPÖ und Grünen.)
Gerade als Institution ist der Europarat deswegen so relevant und so wichtig, weil man an der konsequenten Arbeit sieht, dass die Parlamentarische Versammlung des Europarates den Mut hat, Dinge klar zu artikulieren und sich beispielsweise dem Aggressor Russland entgegenzustellen und zu sagen: Nein, du bist nicht mehr Teil unserer Wertegemeinschaft, du fliegst hier raus!
Genau das Gleiche gilt für andere Felder, auf denen der Europarat auch wesentliche Dinge macht, etwa bei Wahlbeobachtungen: Die Wahlbeobachtung in Serbien, die einerseits vom Europarat durchgeführt wurde, andererseits von der OSZE und vom Europäischen Parlament, hat dazu geführt, dass natürlich die Opposition dort gestärkt wurde, weil gezeigt wurde, dass Vucić die Wahlen zu fälschen versucht hat und sie gefälscht hat. Deswegen muss man diese Dinge immer wieder in den Vordergrund stellen und wir müssen uns daran erinnern.
Ich bin überzeugt davon, dass der Europarat die Möglichkeit hat, daran mitzuwirken – und ein wesentlicher Bestandteil davon ist –, dass wir in einem friedlichen Europa leben, dass wir in einem Europa leben, das Frieden sichert, dass wir in einem Europa leben, das unseren Wohlstand ermöglicht, und dass wir in einem Europa leben, das schützt. Insofern freue ich mich, dass Sie hier gewesen sind und diese Diskussion heute mit uns geführt haben. – Vielen Dank. (Beifall bei den NEOS sowie bei Abgeordneten von ÖVP, SPÖ und Grünen.)
13.44
Präsidentin Doris Bures: Zu Wort ist dazu nun niemand mehr gemeldet. Damit schließe ich auch diese Debatte.
Herr Präsident Rousopoulos, ich bedanke mich bei Ihnen dafür, dass Sie sich für diese wichtige Debatte im österreichischen Parlament Zeit genommen haben, und ich wünsche Ihnen für Ihre Amtszeit alles erdenklich Gute. – Vielen herzlichen Dank. (Allgemeiner Beifall.)
Bericht des Außenpolitischen Ausschusses über den Außen- und Europapolitischen Bericht 2022 der Bundesregierung (III-1151/2536 d.B.)
Präsidentin Doris Bures: Damit gelangen wir nun zum 2. Punkt unserer heutigen Tagesordnung.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Als Erste zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Susanne Fürst. – Bitte.
Abgeordnete Dr. Susanne Fürst (FPÖ): Frau Vorsitzende! Sehr geehrter Herr Minister! Sehr geehrte Damen und Herren! Wir sprechen jetzt über den Außen- und Europapolitischen Bericht des Außenministeriums für das Jahr 2022. Ich habe ihn mir angesehen. Ich denke, darin sollte erkennbar sein, welche Strategie Österreich in seiner Außen- und Europapolitik verfolgt. Der rote Faden sollte natürlich sein, dass die Interessen Österreichs, unseres Landes, und die Interessen der österreichischen Bevölkerung bei diesem Machtspiel, das Außenpolitik ja immer ist, und auch im nationalen und europäischen Denken, welches stattfinden sollte, an erster Stelle stehen – keine Emotionen, nicht bedingungslose Solidarität mit einem fremden Land oder Besserwisserei, sondern eben die Interessen Österreichs.
Das beherrschen eigentlich die meisten anderen Länder, die großen, aber auch kleinere. Bei Österreich sehe ich es nicht, denn es ist zulässig, aber eben auch geboten, wirklich immer ausdrücklich von den Interessen Österreichs zu sprechen. Es ist nicht egoistisch, sondern es ist auch international stabilisierend, wenn jedes Land die Interessen der eigenen Bevölkerung an die erste Stelle stellt, denn das Interesse an Frieden im eigenen Land bewirkt, dass sich das auch international friedensstiftend auswirkt. Das Interesse an der inneren und äußeren Sicherheit in Österreich strahlt positiv auf die Nachbarländer und auch international aus. Das Interesse am wirtschaftlichen Wohlstand der österreichischen Bevölkerung verbindet uns und wirkt international friedensstiftend.
Im Februar 2022 mussten wir den Ausbruch des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine erleben. Die Aufgabe der österreichischen Außenpolitik wäre natürlich gewesen, als Erstes zu fragen: Wie halte ich Österreich aus diesem Konflikt heraus?, Wie schütze ich die österreichische Bevölkerung vor negativen Auswirkungen durch den Krieg?, und dann natürlich: Was können wir als kleines, aber eben neutrales Land dazu beitragen, dass der Konflikt entschärft wird? Können wir es als Verhandlungsplatz anbieten? Was können wir in Österreich beitragen? Was können wir als Mitgliedsland der EU in Brüssel dazu beitragen, dass es zu einer Deeskalation kommt, nicht zu einer Ausweitung; dass man nicht bedingungslose Solidarität mit einer Seite erklärt (Abg. Leichtfried: Sondern mit der anderen Seite!), weil man dann sicher nichts Konstruktives mehr bewirken kann; und dass man auch bei den EU-Sanktionen an die Interessen der europäischen Bevölkerung denkt, diese nicht vollkommen hintanstellt und dann nach ungefähr einem Jahr erklärt: Na ja, die Sanktionen gegen Russland haben doch nicht ganz so gewirkt, wie wir das wollten, hier aber schon!?
Ich erinnere leider auch an den außenpolitischen Bauchfleck von Bundeskanzler Nehammer 2022, der internationale Schlagzeilen gemacht hat. Im Bericht findet er sich nicht wieder, was ich gut verstehen kann. Er fuhr nicht nur nach Kiew, sondern fuhr auch nach Moskau, um Präsident Putin zu treffen, nicht mit einem
konstruktiven, konkreten Vorschlag, wie man den Konflikt lösen könnte, sondern um Putin in die Augen zu schauen.
Er gab da ein CNN-Interview – international war wie gesagt wirklich Aufruhr – und meinte da: „I made the decision to go to Moscow, to look in President Putin’s eyes and confront him“. – Die Moderatorin fragt ihn, wie das war, wie Putin war: „Putin was very tough and clear in his messages.“ – Die nächste Frage: Was sagt Putin über den Kriegsverlauf, Kriegsverbrechen? – Na ja, „you know, It’s [...] Putin. In this position, he was not clear.“ – Okay, also das sind die internationalen Schlagzeilen, die den Auftritt unseres Bundeskanzlers in Russland wiedergegeben haben. (Heiterkeit der Rednerin.) Er ist danach für weitere Reisen oder dafür, dass er da konstruktiv wirkt, nicht mehr angefragt worden. Also so kann Österreich kein außenpolitisches Gewicht entwickeln – das ist natürlich sowieso schwierig für ein kleines Land, begrenzte Möglichkeiten –, aber so werden wir zu einer Lachnummer, und das hat auch nachgewirkt.
Israel, Gaza: Wir sind alle über diesen Angriff der Terrororganisation Hamas erschrocken. Auch da wieder: Eskalationsvermeidung wegen österreichischer Interessen. Ich denke, es wäre unsere verdammte Pflicht, dafür zu sorgen, dass der Konflikt wenigstens hier in Österreich nicht ausgelebt werden kann, dass wir nicht am Campus der Uni Wien im Alten AKH Sprüche wie: Free Palestine!, oder: From the River to the Sea!, hören. Nicht einmal das haben wir im Griff; auch die Zahlungen an diverse UN-Organisationen, die im Verdacht stehen, die Terrororganisation zu unterstützen, sollten wir besser kontrollieren.
Der Schwerpunkt, oberste Priorität ist die Bekämpfung, die Vermeidung der illegalen Einwanderung. Auch da war 2022 ein absolutes Spitzenjahr. Wir haben eine der höchsten Pro-Kopf-Belastungen in der Europäischen Union. Nationalen Grenzschutz machen wir nicht, aber es wird auch in Brüssel nicht eingefordert, endlich einmal für geschlossene Außengrenzen, wie es die EU-Verträge vorsehen, zu sorgen. Stattdessen macht man irgendwelche Rückführungs-
abkommen, durch die Milliarden an europäischen und österreichischen Steuergeldern an afrikanische Despoten ausgeschüttet werden. Kein Mensch weiß, was mit diesem Geld geschieht, aber damit wird sicher nicht die illegale Einwanderung bekämpft.
Auch wenn sich Bundeskanzler Nehammer – vielleicht sollten Sie, Herr Außenminister, ein bisschen mehr tätig werden – wieder damit rühmt, er habe eine Afrikastrategie und hätte da einen multidimensionalen Ansatz: Gegen die illegale Einwanderung wirkt das bisher nicht.
Nun wurde der Asyl- und Migrationspakt der EU beschlossen. Wir wissen alle: Das ist keine Lösung, sondern das soll jetzt vor der EU-Wahl die Wähler beruhigen.
Wir stehen dafür, die österreichische Bevölkerung an erste Stelle zu setzen und für die österreichischen Interessen zu kämpfen, weil das auch außenpolitisch und international konstruktiv wäre. (Beifall bei der FPÖ.)
13.52
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Georg Strasser. – Bitte.
Abgeordneter Dipl.-Ing. Georg Strasser (ÖVP): Frau Präsidentin! Geschätzter Herr Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Ich möchte mich zunächst beim Herrn Bundesminister und seinem Team für die konsequente und gute Arbeit bedanken. – Dein Beitrag und der Beitrag deines Hauses sind wichtig für die aktive Neutralitäts-, Sicherheits- und Außenpolitik. Wir stellen damit sicher, dass wir ein neutrales Land bleiben, dass wir ein vielfältiger und ein starker Teil in einem gemeinsamen Europa sind und dass Österreich und Europa ein Teil der westlichen Welt sind. Für dein Engagement und das Engagement deines Teams ein großes Dankeschön. (Beifall bei der ÖVP.)
Frau Kollegin Fürst von der FPÖ – einleitend, weil ich ein paar Themen auch Richtung FPÖ vorbereitet habe – hat einen gewissen Denkfehler gemacht, denn wenn sie sagt, dass das Streben nach den eigenen Interessen und ausschließlich nach den eigenen Interessen stabilisierend wirkt, dann irrt sie. – Frau Kollegin, ich glaube, Sie irren da. Sie sagen nämlich in der gleichen Argumentation, die Europäische Union ist säumig, wenn es um die Migration geht. Die Migrationsfragen werden wir nur im europäischen Kontext lösen können. Ich darf Sie darauf hinweisen, die Europäische Union ist auch ein gemeinsamer Arbeits- und Wirtschaftsraum. Auch diese Themen werden wir nur im internationalen Kontext, in einer starken Union ansprechen können.
Es ist aber schon interessant: Die FPÖ sagt: Ja, wir schützen die Heimat! – Ich möchte anhand einiger Fakten aufzeigen, dass das nicht Heimatschutz ist, sondern dass unser Schutz in Wahrheit gefährdet wird. Schauen wir ins Jahr 2016, als dieser Freundschaftsvertrag unterzeichnet wurde! Es wurde immer wieder kolportiert, den gebe es ja gar nicht mehr und so weiter. – Das Kündigungsschreiben ist noch nicht aufgetaucht, beziehungsweise die Schriftstücke, die es von 2018, 2019, 2020 gibt, belegen, dass Strache, dass Kickl, dass die FPÖ auch in Zukunft mit Russland sympathisieren werden, dass das für uns alle ein Problem darstellt und dass 30 Anträge im österreichischen Parlament, die quasi eine gewisse Russlandaffinität ableiten lassen, von Ihnen eingebracht wurden.
Daher ist es nicht so, dass Sie unsere Heimat schützen wollen, sondern Sie gefährden die Sicherheit in Österreich und Sie gefährden die Sicherheit in Europa, weil Russland und Sie in Wahrheit den Kontinent destabilisieren wollen. Das ist die falsche Richtung.
Zweiter Bereich: Sky Shield und die FPÖ als die Heimatschutzpartei. – Warum spricht man sich dann gegen diesen Raketenabwehrschirm aus? Das ist die große Frage, denn das ist – 2022/2023 beschlossen – ein Beitrag zu mehr Sicherheit in diesem Land – und die FPÖ hat diesen Pakt abgelehnt. (Abg. Steger: ... unsere
Neutralität schützen!) Auch da zeigt die FPÖ ihr wahres Gesicht: Nicht Heimatschutzpartei sollten Sie auf die Plakate schreiben, sondern Sie sollten draufschreiben, dass Sie Österreich und Europa destabilisieren wollen. Europa ist ja auch eine Sicherheitsunion – und das ist die Richtung, in die wir gehen wollen. (Abg. Steger: Neutralität ist Staatszielbestimmung! ...!)
Abschließend: die Allianzen der FPÖ in anderen europäischen Staaten. Was die FPÖ recht gut kann, das ist das internationale Vernetzen. Wir wissen, die Neue Rechte ist eine globale Bewegung. Die Russen haben es mittlerweile geschafft, nicht nur die FPÖ sozusagen in Europa, in Österreich zu infiltrieren, sondern wir haben die AfD in Deutschland als Beispiel und wir haben den Front National in Frankreich. (Abg. Kassegger: Der heißt Rassemblement National seit drei Jahren, du Europaexperte! – Abg. Steger: Selbst den Namen können Sie nicht richtig sagen! Der heißt Rassemblement National!) Das Gute ist ja, dass diese Fraktionen auch intern immer wieder zu streiten beginnen. Was sie aber können, das ist das Destabilisieren der österreichischen Systeme und das Destabilisieren der europäischen Systeme.
Noch einmal ein großes Dankeschön an den Herrn Minister – Ihre Arbeit, deine Arbeit ist ein Beitrag für Sicherheit, Wohlstand und sozialen Frieden in Österreich. Die Politik der FPÖ destabilisiert unser Land. Mit Unterstützung der Wählerinnen und Wähler werden wir das zu verhindern wissen. – Alles Gute und ein Glückauf! (Beifall bei der ÖVP.)
13.57
Präsidentin Doris Bures: Als Nächster zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Volker Reifenberger. – Bitte.
Abgeordneter Ing. Mag. Volker Reifenberger (FPÖ): Ja, Herr Kollege Strasser, allzu viel Unterstützung der Wählerinnen und Wähler werden Sie nicht mehr haben, wenn wir uns momentan die Umfragen so ansehen. Da kann ich Sie also
beruhigen. (Abg. Michael Hammer: Schauen wir es uns an, wenn es so weit ist! – Abg. Strasser: Hochmut kommt vor dem Fall!)
Eingangs möchte ich aber meiner Kritik Ausdruck verleihen, dass wir jetzt, im Mai 2024, über den Außen- und Europapolitischen Bericht aus dem Jahr 2022 sprechen und nicht über jenen aus dem Jahr 2023. Das ist in einer turbulenten und schnelllebigen Zeit wie dieser vollkommen grotesk. Das Ganze liegt nur daran, dass sich die Regierungsfraktionen nicht auf ein gemeinsames Wording einigen konnten. Das ist einfach nur mehr peinlich, Herr Außenminister. Wie in vielen anderen Bereichen, zum Beispiel betreffend die nicht fertige Sicherheitsstrategie – wo bleibt die übrigens? –, zeigt sich auch hier, dass in dieser Koalition nur mehr Stillstand herrscht, dass nichts mehr weitergeht. Gegenseitige Blockade, eine sogenannte Roulettekoalition: Rien ne va plus, nichts geht mehr.
Dass dieser Bericht heute hier im Hohen Haus überhaupt diskutiert werden kann, ist den Freiheitlichen zu verdanken, weil wir dies verlangt haben. Die Zuschauer müssen wissen, das ist ein parlamentarisches Minderheitsrecht. Andernfalls wäre dieser Bericht im Ausschuss enderledigt worden, wie das so schön heißt, also still und heimlich und abseits der breiten Öffentlichkeit.
Da im Berichtsjahr 2022 der Krieg zwischen Russland und der Ukraine begonnen hat, möchte ich diese Gelegenheit nützen, um auf die vollkommen verfehlte Außenpolitik unserer Bundesregierung hinzuweisen. – Herr Außenminister, Sie und Ihre Kollegen in der Bundesregierung haben es geschafft, dass Österreich im Ausland nicht mehr als neutraler Staat wahrgenommen wird. Wenn man sich nur selbst als neutral bezeichnet, aber einen sonst niemand mehr als neutral ansieht, dann ist das brandgefährlich.
Neutralität ist nur dann etwas wert, wenn sie zum einen wehrhaft ist und zum anderen auch glaubhaft gelebt wird. In beiden Punkten haben wir ein riesengroßes Problem. (Ruf bei der ÖVP: Das ist total widersprüchlich!) Sie haben
unsere Neutralität ausgehöhlt, nahezu abgeschafft, ohne jemals die Bevölkerung dazu zu befragen.
Für mich gibt es beim Thema Neutralität nur schwarz oder weiß: entweder konsequent neutral oder eben Teil eines Militärbündnisses, zum Beispiel der Nato, wobei wir Freiheitlichen aus politischen Gründen – nicht aus militärischen, aus politischen Gründen – ganz klar für die erste Variante, für die Variante einer konsequenten Neutralitätspolitik stehen. (Abg. Michael Hammer: Bösch war aber für die Nato! Das geht mit euch aber nicht!) Anstatt aber eine ehrliche Diskussion darüber zu führen, welche der beiden Richtungen Sie in der Bundesregierung politisch vertreten, versuchen Sie, sich irgendwo in der Mitte durchzulavieren, so im Graubereich, typisch österreichisch. So geht Neutralitätspolitik aber nicht, Herr Außenminister! Kreisky würde im Grab rotieren, wenn er Ihre Außenpolitik mitverfolgen könnte. (Beifall bei der FPÖ.)
Aber auch die Wähler sind sehr sensibel betreffend das Thema Neutralität, und das ist wohl auch mit ein Grund, warum die ÖVP derzeit in allen Meinungsumfragen einen Totalabsturz erlebt. Die Liste Ihrer neutralitätspolitischen Schandtaten ist lang: Abertausende Truppentransporte durch Österreich, unzählige Überflüge von militärischen Fluggeräten über Österreich, der Transport von ausländischem Kriegsgerät mitten durch unser Land, der beabsichtigte Beitritt zu Sky Shield – einem Projekt, das laut Eigendefinition der Stärkung der europäischen Säule der Luftabwehr der Nato dient –, die finanziellen Beiträge zur Europäischen Friedensfazilität, mit welcher Munition für die Ukraine beschafft wird, die finanzielle Unterstützung des Projekts Eumam, mit welchem ukrainische Soldaten von anderen EU-Ländern militärisch ausgebildet werden, das Eingehen einer Partnerschaft für militärische Zusammenarbeit mit der National Guard in Vermont, USA, das Mitmachen bei den einseitigen Wirtschaftssanktionen, also einem Wirtschaftskrieg gegen eine der beiden Kriegsparteien, und vieles mehr.
Diese Liste ließe sich noch lange fortsetzen, aber dazu reicht meine Redezeit nicht – Sie sehen es; und unser Ordner wird auch schon leicht nervös –,
erwähnen möchte ich aber noch eines: den Brief, den Österreich im Dezember an die Nato geschickt hat, nach dem wir anscheinend eine engere Kooperation mit der Nato anstreben. Davon haben wir im Parlament noch nichts gehört, das geht alles still und heimlich am Parlament und der Öffentlichkeit vorbei.
Das alles, diese verfehlte Außenpolitik, hat dazu geführt, dass Russland uns nicht mehr als neutralen Staat anerkennt und uns zu einem unfriendly state, also zu einem sogenannten unfreundlichen Staat, erklärt hat. (Abg. Ernst-Dziedzic: Das sehen Sie als Problem?) Das ist eine gefährliche Außenpolitik. – Herr Außenminister, Sie und Ihre Kriegstreiberkollegen in der Bundesregierung sind ein Sicherheitsrisiko für dieses Land – und sonst niemand. (Beifall bei der FPÖ. – Abg. Höfinger: Na, was ist denn das? Das ist ja unglaublich! Habt ihr den Putin schon einmal als Kriegstreiber bezeichnet? Das ist ja unglaublich! – Abg. Michael Hammer: Da rollt der Rubel wieder!)
14.02
Präsidentin Doris Bures: Zu einer tatsächlichen Berichtigung hat sich Herr Abgeordneter Stark zu Wort gemeldet. – Bitte.
Abgeordneter Christoph Stark (ÖVP): Frau Präsidentin! Hohes Haus! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Volker Reifenberger hat hier behauptet, die ÖVP habe die Neutralität abgeschafft.
Ich berichtige tatsächlich (Abg. Steger: Sie höhlen Sie aus!): Die ÖVP kann die Neutralität nicht abschaffen (Abg. Reifenberger: Nahezu abgeschafft, habe ich gesagt! Zuhören! – Abg. Bogner-Strauß: Was heißt: „Nahezu abgeschafft“?), dazu braucht es eine Zweidrittelmehrheit in diesem Hause, und auch das Volk ist mit einzubinden.
Lieber Kollege, Sie streuen damit nach wie vor giftigen Sand, den giftigen Sand der FPÖ in die Augen der Menschen in diesem Lande. (Beifall bei der ÖVP.)
14.02
Präsidentin Doris Bures: Nun gelangt Frau Abgeordnete Petra Bayr zu Wort. – Bitte.
Abgeordnete Petra Bayr, MA MLS (SPÖ): Frau Präsidentin! Herr Außenminister! Es ist Mitte Mai 2024 und wir diskutieren den Außenpolitischen Bericht 2022. Eigentlich könnten wir auch schon den Außenpolitischen Bericht 2023 diskutieren, würde ich meinen, aber lassen Sie mich trotzdem daraus zitieren: „Österreich war schon zu Zeiten des Kalten Krieges aufgrund seiner geopolitischen Lage und seines neutralen Status eine Plattform für internationalen Dialog. Diese Position konnte 1979 mit der Eröffnung des Internationalen Zentrums Wien (Vienna International Centre), auch UNO City genannt, gestärkt werden. Seither ist Wien neben New York, Genf und später Nairobi Hauptsitz der Vereinten Nationen“. – So weit, so gut.
Wir diskutieren – das ist auch gut so – sehr viel über Neutralität, dazu möchte ich dann auch gleich einen Antrag einbringen, weil unsere Neutralität, die eine militärische ist, uns etwa verbietet, uns an fremden Kriegen zu beteiligen, Truppen zu stationieren oder Militärbündnissen beizutreten. Sie ist eine sehr klare, die uns aber nicht daran hindert, unsere Neutralität wirklich aktiv zu leben, was wir auch in der Vergangenheit getan haben, indem wir mehrfach nichtständiges Mitglied des Sicherheitsrates gewesen sind, uns an über 100 Auslandseinsätzen mit internationalem Mandat beteiligt haben und auch Amtssitz von sehr vielen anderen internationalen Organisationen sind.
Es ist also durchaus möglich, uns als Plattform – und das meine ich jetzt nicht nur räumlich, sondern auch durchaus proaktiv – für Dialog und Verständigung anzubieten, gerade in Zeiten von Konflikten. Wir wissen und sehen, dass sich die Sicherheitslage in Europa mit Ende des Kalten Kriegs nicht unbedingt verbessert und die Anzahl der Kriege leider zugenommen hat. Gerade deswegen wird die Aufgabe für neutrale Staaten nicht weniger, sie hat sich nur grundlegend verändert. Gerade auch deswegen vermisse ich nach wie vor die österreichische
Sicherheitsstrategie schmerzlich, da die bestehende noch immer eine ist, die Russland als wichtigen Partner sieht. – Wo bleibt sie? Was hindert Sie daran, sich auf ein Energiekapitel zu einigen?
Ich verstehe nicht wirklich, warum wir da nicht weiterkommen und es keine Möglichkeit gibt, mit unserer Sicherheitsstrategie endlich auf dem Gipfel der Zeit zu sein. Deshalb möchte ich einen Entschließungsantrag einbringen, in dem es darum geht, im Rahmen unserer Neutralität diese wirklich engagiert auszuleben, zur Prävention und zur Lösung von Konflikten aktiv beizutragen, gute Dienste zu leisten und uns mit den Mitteln der Diplomatie in der Friedenssicherung zu engagieren. Auch wenn es um Abrüstungs- und Nichtverbreitungsfragen geht, müssen wir nach wie vor eine sehr, sehr wichtige Rolle einnehmen.
Ich zitiere:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Katharina Kucharowits, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Neutralität sichern, aktive Friedenspolitik betreiben“
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten, wird aufgefordert, Österreichs Neutralität mit allen zu Gebote stehenden Mitteln weiterhin zu verteidigen und dies auch auf allen Ebenen zu vertreten. Weiteres wird die Bundesregierung aufgefordert auf europäischer und internationaler Ebene aktive Friedenspolitik zu betreiben, sowie sich für eine weltweite Rüstungskontrolle und für ein Verbot aller Atomwaffen einzusetzen, um dem aktuellen ‚Wettrüsten‘ ein Ende zu setzen.“
*****
Es geht also darum, unsere Neutralität aktiv und proaktiv zu nutzen und einzusetzen. Mir würde jedes – wirklich jedes – Verständnis fehlen, wenn die
Regierungsparteien heute am Ende der Debatte nicht in der Lage wären, diesem Antrag zuzustimmen. – Danke sehr. (Beifall bei der SPÖ.)
14.06
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Katharina Kucharowits, Petra Bayr, MA, MLS, Robert Laimer,
Genossinnen und Genossen,
betreffend Neutralität sichern, aktive Friedenspolitik betreiben
eingebracht im Zuge der Debatte zu TOP 2/ Bericht des Außenpolitischen Ausschusses (2536 d.B.) über den Außen- und Europapolitischen Bericht 2022 der Bundesregierung
Die Neutralität Österreichs hat in den fast siebzig Jahren ihres Bestehens unter sich ändernden geopolitischen Umständen immer als wichtige Grundlage für die Außen- und Sicherheitspolitik gedient, sich bewährt und Österreichs Sicherheit garantiert. Darauf verweist auch der Außen- und Europapolitische Bericht 2022 der Bundesregierung: „Österreich war schon zu Zeiten des Kalten Krieges aufgrund seiner geopolitischen Lage und seines neutralen Status eine Plattform für internationalen Dialog. Diese Position konnte 1979 mit der Eröffnung des Internationalen Zentrums Wien (Vienna International Centre), auch UNO City genannt, gestärkt werden. Seither ist Wien neben New York, Genf und später Nairobi Hauptsitz der Vereinten Nationen (VN).“
Österreich beteiligt sich nicht an fremden Kriegen, stationiert keine fremden Truppen auf seinem Territorium und ist nicht Mitglied eines Militärbündnisses. Seit den 1960er Jahren ist Österreich als Mitglied in den Vereinten Nationen aktiv und wurde mehrmals als nichtständiges Mitglied in den Sicherheitsrat gewählt. Es beteiligte sich
an über 100 Auslandseinsätzen im Rahmen von VN, EU und NATO. Wien wurde Amtssitz der Vereinten Nationen, viele andere internationale Organisationen siedelten sich in Wien an, Gipfeltreffen an zahlreiche internationale Verhandlungen fanden statt. Österreich ist auch stark in der OSZE engagiert, die eine wichtige Plattform für Dialog und Verständigung in Konfliktzeiten bietet.
Weder während des ungarischen Volksaufstandes 1956, noch nach der Niederschlagung des Prager Frühlings in der ČSSR durch Truppen des Warschauer Paktes unter der Führung der Sowjetunion 1968 oder den Kriegen im Zusammenhang mit dem Zerfall Jugoslawiens 1991 bis 1999 kam es zu einer unmittelbaren und beabsichtigten militärischen Angriffsdrohung auf die Souveränität Österreichs.
Die Sicherheitslage in Europa hat sich nach dem Ende des Kalten Krieges nicht verbessert, und die Anzahl der Kriege und Konflikte hat zugenommen. Die Aufgaben für neutrale Staaten wurden nicht nur nicht weniger, sie haben sich grundlegend verändert.
Die neutralitätsgerechte Positionierung Österreichs innerhalb der GASP/GSVP dient weiterhin den außen- und sicherheitspolitischen Interessen Österreichs und schützt vor einer Beteiligung an militärischen Konflikten. Das neutrale Österreich hat im Rahmen der EU viele Handlungsmöglichkeiten und sollte diese auch nutzen.
Im Rahmen einer engagierten Neutralitätspolitik kann Österreich zur Prävention und Lösung von Konflikten beitragen und seine guten Dienste in den internationalen Beziehungen anbieten. In Krisenzeiten ist diese von höchster Bedeutung, da sie zur Friedenssicherung mit Mitteln der Diplomatie beiträgt.
Engagierte Neutralität ermöglicht es auch, im Abrüstungs- und Nichtverbreitungsbereich deutliche Akzente zu setzen.
Ebenso ist es, als neutrales Land, unsere Pflicht, Gesprächskanäle offen zu halten, um kriegerische Intentionen und kriegerisches Handeln zu unterbinden. Es gilt hier,
aktiver zu werden und innerhalb und außerhalb der europäischen Union eine Schlüsselrolle zu übernehmen und den Boden für etwaige Friedensverhandlungen durch aktives Anbieten einer vermittelnden Rolle Österreichs aufzubereiten.
Aus diesen Gründen stellen die unterzeichneten Abgeordneten folgenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten, wird aufgefordert, Österreichs Neutralität mit allen zu Gebote stehenden Mitteln weiterhin zu verteidigen und dies auch auf allen Ebenen zu vertreten. Weiteres wird die Bundesregierung aufgefordert auf europäischer und internationaler Ebene aktive Friedenspolitik zu betreiben, sowie sich für eine weltweite Rüstungskontrolle und für ein Verbot aller Atomwaffen einzusetzen, um dem aktuellen „Wettrüsten“ ein Ende zu setzen.“
*****
Präsidentin Doris Bures: Der Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht, steht daher auch mit in Verhandlung.
Frau Abgeordnete Petra Steger, Sie gelangen zu Wort. – Bitte.
Abgeordnete Petra Steger (FPÖ): Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Außenminister! Hohes Haus! Ich will mich auf ein wesentliches Thema dieses Außenpolitischen Berichtes aus dem Jahr 2022 konzentrieren, weil es erstens schon lange unerträglich ist, wie die Europäische Union und auch diese schwarz-grüne Bundesregierung, wie Sie, werte Kollegen hier herinnen, tatenlos zuschauen, wie wir seit Jahren massenweise von illegalen Migranten regelrecht
überrannt werden, und zweitens genau dieses Jahr 2022 das absolute Katastrophenjahr war, das sogar das Migrationskrisenjahr 2015 noch einmal übertroffen hat.
Sie beweisen jeden Tag aufs Neue, dass Ihnen die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher anscheinend vollkommen egal ist. Aus diesem Grund sagen wir: Es reicht! Vor allem sagen auch die Österreicherinnen und Österreicher, dass es ihnen reicht. Das sind vor allem diejenigen, die seit vielen, vielen Jahren die Leidtragenden Ihres Nichtstuns, Ihrer Untätigkeit und auch dieser unglaublichen Österreichvergessenheit sind.
Bis heute versagt die Europäische Union bei ihrer zentralen und wichtigsten Aufgabe, nämlich der Sicherheit, auf ganzer Linie. Bis heute ist die Europäische Union nicht in der Lage, für einen effektiven Außengrenzschutz zu sorgen. Noch immer kommen Millionen illegaler Migranten unkontrolliert über unsere Grenzen und damit auch Terroristen, Gefährder und Extremisten.
Die Auswirkungen dieser Politik können wir mittlerweile jeden Tag in ganz Österreich, aber vor allem auch in Wien sehen, wie zum Beispiel im 10. Bezirk, wo das Motto mittlerweile lautet: Meine tägliche Messerstecherei gib mir heute!, wo sich Frauen und Kinder schon lange nicht mehr trauen, nachts alleine auf die Straße zu gehen. Dafür tragen Sie die Verantwortung, werte Kollegen, dafür trägt diese Bundesregierung die Verantwortung und dafür tragen auch die anderen Parteien in diesem Haus die Verantwortung. (Beifall bei der FPÖ.)
Mittlerweile geht es jeden Tag mit der Sicherheit in unserem Land bergab und mit den Asylzahlen bergauf. (Abg. Stark: Das ist falsch!) Die EU samt Bundesregierung schaut zu und tut nichts (Abg. Stark: Das ist falsch!) – obwohl: Nichts stimmt nicht, ich muss mich korrigieren, werte ÖVP, Innenminister Karner absolviert medienwirksam einen Besuch am Keplerplatz mit dem Resultat, dass die Zahl der gewalttätigen Übergriffe nicht runtergeht, sondern sogar noch nach oben. (Beifall bei der FPÖ.) – Das ist das Resultat. Obwohl Sie angekündigt haben,
dass es mehr Polizisten geben soll, gibt es dort bis heute keinen einzigen Polizisten mehr. (Abg. Ernst-Dziedzic: Es geht um Außenpolitik!)
Stattdessen entwaffnen Sie lieber die eigene Bevölkerung und sorgen mit dem Familiennachzug sogar dafür, dass sich die Situation noch verschlimmert. Na, ich gratuliere zu diesen Maßnahmen, die Sie da zum Schutz der Österreicherinnen treffen!
Seit 2015 sind acht Millionen illegale Migranten nach Europa gekommen. Im letzten Jahr alleine war es eine Million, und der Großteil davon geht natürlich nach Österreich und Deutschland. Sie laden sie ja regelrecht zu uns ein. Im vergangenen Jahr allein waren es dank Schwarz-Grün in Österreich 80 000, und im Jahr davor – in diesem Katastrophenjahr 2022 – sogar über 110 000. (Abg. Bogner-Strauß: Die Rede haben wir heute schon einmal gehört!)
Zwei Drittel derer, die zu uns kommen, sind nicht schutzwürdig, und über 80 Prozent bleiben trotz negativen Asylbescheids bei uns. Jeder, der einmal den Fuß auf europäischen Boden gesetzt hat, bleibt für immer hier und ist nicht mehr hinauszubekommen. Das ist das Wesenselement, das ist der große Fehler dieses Systems.
Ihr Einsatz für Sicherheit schaut so aus, dass Sie dann in die Europäische Union fahren und dort auch noch im Liegen umfallen: Sie haben wieder einmal dem Asyl- und Migrationspakt zugestimmt, samt Flüchtlingsverteilung. Angeblich, laut Ihnen, ein absolutes No-Go: Wie viele Jahre haben Sie gesagt, dass es das mit Ihnen auf keinen Fall geben wird?
Ich zitiere – ich kann Ihnen auch mehrere Zitate vorlesen –: 2017, Bundeskanzler Kurz, ÖVP: „Verteilung von Migranten nach festen Quoten ist Irrweg“. 2021, Bundesministerin Edtstadler: Die Umverteilung sei nicht „lösungsbringend“. 2021 ist Bundeskanzler Nehammer gegen Italiens Forderung nach Umverteilung. 2022 sagt Nehammer, Österreich werde keine zusätzlichen Migranten über diesen Mechanismus aufnehmen und auch keinen finanziellen
Beitrag leisten. Innenminister Karner sagt noch im Mai 2023 – ich zitiere –: „Wir werden einer Pflichtquote bei der Verteilung von Flüchtlingen nicht zustimmen, denn Österreich hat bereits mehr als genug geleistet“. Ich könnte Ihnen noch hundert weitere Zitate von Ihnen vorlesen.
Zack, bum hat es gemacht, Sie sind wieder einmal umgefallen und haben entgegen all Ihrer vorherigen Versprechen dieser Zwangsverteilung in der Europäischen Union den Weg geebnet und damit wieder einmal bewiesen, dass man Ihnen kein Wort glauben kann, werte ÖVP. (Beifall bei der FPÖ.)
Statt eines echten Außengrenzschutzes, statt einer echten Schubumkehr, statt einer echten, klaren und unmissverständlichen Linie: No way!, statt einer Festung Europa, wie wir das fordern, gibt es weiterhin nur ein Verwalten der Massenmigration, ein Einzementieren des bisherigen Systems, eine Zwangsverteilung, im Zuge derer wir in Wahrheit nichts mehr mitzureden haben und in Zukunft nur noch auswählen können, ob wir eben Flüchtlinge aufnehmen oder zahlen müssen – 20 000 Euro pro abgelehntem Asylanten, noch dazu als Nettozahlerstaat, als ob wir noch nicht genug gezahlt hätten, als ob wir nicht schon genug Kosten auf Grundlage dieser falschen Politik in unserem System, in unserem Sozialsystem, in unserem Bildungssystem, in unserem Gesundheitssystem und in vielen weiteren Bereichen hätten!
Doch anstatt endlich die Außengrenzen zu schützen, schließt die Europäische Union einen unsinnigen Deal nach dem anderen mit unzuverlässigen Drittstaaten ab. Zuerst der Türkeideal, dann Tunesien und jetzt auch noch der Libanon: 1 Milliarde Euro wollen Sie dort hinschieben, und wieder einmal versenken Sie massenweise Geld, machen uns abhängig und erpressbar von irgendwelchen Drittstaaten, und die illegale Migration in unser Sozialsystem wird trotzdem munter weitergehen.
Aus diesem Grund sagen wir: Es reicht, es muss endlich Schluss sein mit diesen Milliardenausgaben für eine falsche Zuwanderungs- und Asylpolitik. Aus diesem Grund bringe ich auch folgenden Antrag ein:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Petra Steger, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Schaffung der Festung Europa und Beendigung der illegalen Migrationsströme“
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, sich vehement im Rahmen der Institutionen der Europäischen Union für einen lückenlosen und effizienten EU-Außengrenzschutz einzusetzen, um die Festung Europa zu schaffen und dadurch die illegale Massenmigration nach Europa endlich zu“ beenden.
*****
Sehr geehrte Damen und Herren, es ist für jeden offensichtlich, dass den anderen Parteien in diesem Land die Sicherheit in Österreich und Europa kein Anliegen ist, dass Sie mittlerweile das größte Sicherheitsrisiko sind.
Es ist zentrale und wichtigste Aufgabe der Europäischen Union und auch Österreichs, endlich für Sicherheit in diesem Land zu sorgen. Was es jetzt bräuchte, wäre die Festung Europa, und wenn Sie die nicht sicherstellen, dann kann ich Ihnen versprechen, dass wir spätestens im Herbst mit einem Volkskanzler Herbert Kickl die Festung Österreich sicherstellen werden. (Beifall bei der FPÖ. – Abg. Michael Hammer: Ja, super, Vokaki!)
14.13
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Petra Steger
und weiterer Abgeordneter
betreffend Schaffung der Festung Europa und Beendigung der illegalen Migrationsströme
eingebracht in der 262. Sitzung des Nationalrates, XXVII. GP, am 15. Mai 2024 im Zuge der Debatte zu TOP 2, Bericht des Außenpolitischen Ausschusses über den Außen- und Europapolitischen Bericht 2022 der Bundesregierung (III-1151/2536 d.B.)
Grenzenloses Totalversagen der Bundesregierung gegen die illegale Massenmigration
Insbesondere im Jahr 2022 hat sich offenbart, dass beschwichtigende Rhetorik allein nicht ausreicht, um eine erneute Migrationskrise von den Ausmaßen des Jahres 2015 zu verhindern. Hauptverantwortlich für die katastrophalen Entwicklungen im Migrationsbereich sind Vertreter der Österreichischen Volkspartei. Weder der Bundeskanzler noch der Innenminister haben die notwendigen Maßnahmen gesetzt, um auf nationaler und europäischer Ebene einem neuen Migrationsansturm entgegentreten zu können.
Und dieser Ansturm hat es in sich: Im Jahr 2022 explodierte erneut die Anzahl an Asylanträgen in den EU-Mitgliedstaaten, Norwegen und der Schweiz auf insgesamt 966.107, 2023 gar auf 1,14 Millionen Anträge.1 Interessanterweise ist nur an einer EU-Außengrenze Entspannung eingetreten, nämlich an der Ostgrenze zu Weißrussland. Eben hier haben allerdings mutige EU-Mitgliedstaaten, allen voran Polen, selbst das Heft in die Hand genommen und Grenzbarrieren von hunderten Kilometer Länge aufgebaut, um der illegalen Migration zu trotzen. An der Ostgrenze zu Weißrussland wurde der Beweis erbracht, dass physische Barrieren illegale Migrationsströme aufhalten können und Erpressungsversuche von Drittstaaten folgerichtig ins Leere laufen.
Die österreichische Bundesregierung hat bedauerlicherweise nichts aus der Migrationskrise von 2015 gelernt und schützt die österreichischen Grenzen in keiner Weise. Die Konsequenzen sind verheerend: Im Jahr 2022 wurden 112.272(!) Asylanträge in Österreich gestellt.2 Damit wurde sogar der Schreckenswert von 2015 mit 88.340 Asylanträgen übertroffen.
Es ist bezeichnend, dass im Außen- und Europapolitischen Bericht 2022 der Bundesregierung als „Ziel Österreichs […] eine wirksame Migrationssteuerung“3 angeführt wird. Das Ziel kann jedoch niemals die Steuerung der illegalen Migration, sondern muss die Beendigung derselben sein.
Es existiert kein nationaler Grenzschutz, ebenso wenig ein EU-Außengrenzschutz. Weder die bilateralen noch die EU-weiten Rückübernahmeabkommen werden ausgebaut. Die Bundesregierung unternimmt nichts gegen zigtausende illegale Migranten, welche nach Österreich kommen und sich hier illegal aufhalten. Die Rückführung abgelehnter Asylbewerber in ihre Herkunftsländer funktioniert nicht. Längst hätte die Europäische Union über ihre Visapolitik, ihre Entwicklungshilfe und über wirtschaftspolitische Hebel Druck auf wenig kooperationsbereite Länder ausüben können, um Migranten ohne Bleiberecht in ihre Herkunftsstaaten abzuschieben. Aber in diesem für die Zukunft Europas entscheidenden Bereich sind die EU-Institutionen vollkommen untätig.
Maßnahmenpaket gegen illegale Migration
Um die illegale Massenmigration nach Europa und Österreich in den Griff zu bekommen, sind schnellstmöglich effektive Maßnahmen zu ergreifen. Viel zu lange wurde vonseiten der Bundesregierung untätig dem Grenzsturm tausender Migranten nur zugeschaut.
Das Ziel muss es sein, die illegale Einwanderung zu stoppen – statt über die Verteilung von illegalen Einwanderern in der EU zu reden. Es hätte niemals so weit kommen dürfen, dass es in Österreich – wie bedauerlicherweise durch die Fehler der ÖVP nun Realität – um die Verwaltung illegaler Migration geht. Stattdessen hätte diese in der Vergangenheit verhindert werden sollen und muss in Zukunft unterbunden werden!
Fakt ist, dass die Verhinderung illegaler Migration kein Ding der Unmöglichkeit ist – Polen hat dies unter Beweis gestellt. Aber man muss Mut haben und den politischen Willen, zum Wohle der eigenen Bürger den Massenansturm von Migranten zu unterbinden – beides fehlt der ÖVP und folgerichtig der Regierung.
Notwendig für diese „No Way“-Politik und die Errichtung der Festung Europa sind ein echter und effizienter Grenzschutz, die Legalisierung von „Push-Backs“ an der Außengrenze der Europäischen Union und der Abschluss weiterer Rückübernahmeabkommen. Solange dieser EU-Außengrenzschutz nicht funktioniert, müssen die EU-Mitgliedstaaten nach eigenem Ermessen unbefristet Kontrollen an ihren nationalstaatlichen Grenzen durchführen können. Der aktive Transport von „Bootsflüchtlingen“ nach Europa ist zu unterbinden und eine Anlaufstelle für Gerettete aus Seenot in Afrika zu schaffen.
In diesem Zusammenhang stellen die unterfertigten Abgeordneten nachstehenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, sich vehement im Rahmen der Institutionen der Europäischen Union für einen lückenlosen und effizienten EU-Außengrenzschutz einzusetzen, um die Festung Europa zu schaffen und dadurch die illegale Massenmigration nach Europa endlich zu unterbinden.“
1 https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-asylantraege-110.html
2 BMI Asyl-Statistik 2022: 1
3 Außen- und Europapolitischer Bericht 2022 der Bundesregierung, S. 256
*****
Präsidentin Doris Bures: Der Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht. Statt „beenden“ steht „unterbinden“ im Entschließungsantrag – vielleicht für das Protokoll, noch eine kleine Änderung.
Bitte, Frau Abgeordnete Ewa Ernst-Dziedzic, Sie gelangen zu Wort.
14.13
Abgeordnete Dr. Ewa Ernst-Dziedzic (Grüne): Nach diesen kleinen Drohgebärden würde ich gerne wieder zur Außenpolitik zurückkommen. Frau Präsidentin! Herr Minister! Werte Kollegen, Kolleginnen und Gäste! Die Welt ist nicht nur sprichwörtlich aus den Fugen geraten, sondern die Konfliktherde in der Welt kommen tatsächlich nicht zur Ruhe.
Wir haben ja heute schon in der Aktuellen Europastunde mehrmals die Rolle der sogenannten Unruhestifter diskutiert, und tatsächlich müssen wir einen Blick darauf werfen, wer ihnen auch noch die Mauer macht, wer hier dieser sprichwörtliche Beitragstäter ist, wer Wladimir Putin beispielsweise in seinem Kriegswahn verteidigt – auch das haben wir heute diskutiert – und wer der Ukraine die Souveränität abspricht.
Wir haben auch schon erwähnt, dass in Georgien gestern ein wirklich sehr bedrohliches, für die demokratische Weltordnung bedrohliches Gesetz durchgeprügelt worden ist, gegen die Interessen der Bevölkerung. Wir haben es in Aserbaidschan mit Əliyev zu tun, der nicht nur eine ethnische Säuberung in Berg Karabach an den Armeniern zu verantworten hat, sondern der Armenien auch weiterhin mit militärischen Angriffen droht.
Wir haben es auch weiterhin mit Erdoğan zu tun, mit dem Präsidenten der Türkei, der weiterhin auch als Nato-Mitglied völkerrechtswidrige Angriffe auf kurdische Gebiete in Nordostsyrien fortführt.
Ich will gar nicht mehr auf den Sudan oder auf Myanmar eingehen, weil die Zeit nicht reicht, aber was mir auch wichtig zu erwähnen scheint, ist, dass China nicht zu vergessen ist. China droht nämlich Taiwan nicht nur weiterhin, sondern kann tatsächlich, wenn wir da nicht aufpassen, die Lieferketten kapern, sodass wir in Europa die Produktion und die Versorgung nicht sicherstellen können. Und ja, auch die USA müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, nach dem desaströsen Abzug aus Afghanistan tatsächlich viele Menschenleben gefährdet zu haben und
jetzt auch die Taliban ermöglicht zu haben, die, wie Sie wissen, genau wie das Mullahregime im Iran die eigene Bevölkerung ermorden und knebeln.
Wir können natürlich auch nicht über Außenpolitik sprechen, ohne den Nahen Osten und auch die dramatische Situation im Nahen Osten jetzt aktuell zu erwähnen. Noch einmal möchte ich hier natürlich klarstellen, dass der Angriff der Hamas-Terroristen vom letzten Oktober durch nichts, aber auch durch gar nichts zu rechtfertigen oder zu relativieren ist und dass der grassierende Antisemitismus, der seit dem 7. Oktober auch noch Fahrt aufgenommen hat, nicht nur erschreckend ist, sondern für uns alle in der Welt einen globalen Auftrag darstellt, nämlich das Existenzrecht Israels zu verteidigen.
Dabei ist aber – und das ist der schwierige Punkt an genau dieser Sache – auch Netanyahu zu benennen, der sicherlich bei Weitem kein Friedensstifter ist, wie wir wissen, und sein rechtsextremes Kabinett zeigt leider einmal mehr, dass mit Rechtsextremen kein Staat zu machen ist und wohl auch keine friedliche Zweistaatenlösung.
Aber ja, auch in Europa ist, wie eingangs erwähnt, unsere Sicherheit durch all diese Unruhestifter bedroht, auch innerhalb der Europäischen Union. Ich finde, dass nicht nur die friedliche Weltordnung dazu dient, unseren Wohlstand und den Frieden zu sichern, sondern dass umgekehrt eben das Chaos und das Zerstören dieser friedlichen Weltordnung jenen dient, die davon profitieren, dass Chaos ausbricht, und die haben wir heute schon mehrmals benannt.
Als eine, die sich seit über 20 Jahren mit Außenpolitik beschäftigt, weiß ich, wir können die Welt nicht retten, wir können lediglich benennen, wer die friedliche Weltordnung zerstört, wir müssen diese Zerstörer demokratisch abwählen, und wir dürfen sie nicht an die Hebel der Macht lassen.
In diesem Sinne ist es, denke ich, sehr, sehr wichtig, dass wir Frieden, Freiheit, Sicherheit durch eine wertebasierte Außenpolitik Österreichs vertreten. Das tun wir. Wir setzen sehr viele Aktivitäten gegen Atomwaffen, gegen automatisierte
Waffensysteme, für Friedensverhandlungen, und das darf bei dieser Debatte nicht untergehen: dass Österreich hier sehr wohl weiterhin eine sehr wichtige Rolle als neutraler Staat in dieser Weltordnung einnimmt. – Vielen Dank. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
14.18
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Helmut Brandstätter. – Bitte.
Abgeordneter Dr. Helmut Brandstätter (NEOS): Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuseherinnen und Zuseher! Ich beginne heute mit einem Buch: „Die Welt von morgen. Ein souveränes demokratisches Europa – und seine Feinde“ (das genannte Buch von Robert Menasse in die Höhe haltend) – über die Feinde werde ich gleich reden. „Die Welt von morgen“ erinnert natürlich an einen historischen Roman von Stefan Zweig, an eine Zeit, in der man geglaubt hat, dass sich alles besser entwickeln wird – und später ist man draufgekommen, das war nicht so.
Bei uns ist es ja so, dass wir inzwischen wissen, wo die Gefahren sind, dass wir die Gefahren erkennen müssen und dass wir dagegen aktiv auftreten müssen. Wir wissen aber auch, wer die Feinde sind: Das ist der Nationalismus, das beschreibt Menasse natürlich auch, es ist aber auch die Unfähigkeit, gemeinsam als Europa zu agieren. Menasse schreibt, Europa entwickelt sich fort – und das ist ja ein Doppelsinn: entwickelt sich weiter, aber entwickelt sich auch weg vom ursprünglichen Gedanken, und das ist dann, glaube ich, sehr gefährlich.
Ganz konkret – die Ukraine ist jetzt schon mehrfach angesprochen worden –, was mich wirklich schockiert, und ich weiß nicht, ob Sie vielleicht intern einmal darüber reden: Sie reden über alles Mögliche – die EU als Kriegstreiber, das muss man sich einfallen lassen –, aber ich habe von Ihnen noch nie ein Wort über die Menschen in der Ukraine gehört. Heute in der Früh beim Hergehen hat mich
eine Frau angesprochen. Sie hat gesagt, sie ist mit ihren zwei Kindern geflüchtet – der Mann ist natürlich zu Hause –, sie versucht, Kontakt zu haben. Sie hat Angst um ihre Verwandten, Angst um ihren Mann, Angst um ihre Eltern.
Das alles interessiert Sie überhaupt nicht, Ihnen gefällt es, dass Putin gerade ein anderes Land einnimmt. Wenn Sie sich ein bisschen schlaumachen oder zumindest mir zuhören würden, dann wüssten Sie auch, wie das mit den Friedensgesprächen ist. Im russischen Fernsehen treten Menschen, Politiker, sogenannte Moderatoren, sogenannte Philosophen – Freunde von Ihnen auch – auf, die sagen: Wir müssen jetzt eine Stadt nach der anderen zerstören, damit können wir die Ukraine einnehmen! – Ich wünsche Ihnen alles Gute, mit denen zu verhandeln.
Das Nächste aber ist Georgien, Herr Bundesminister – Georgien ist schon angesprochen worden –: Es gibt einen Brief von zwölf Außenministern, einen klaren Appell an die Regierung in Georgien. Warum gibt es keinen Appell von 27 Außenministern? Es ist wieder eine unfassbare Schwäche der Europäischen Union, dass wir nicht in der Lage sind, in einem Moment, in dem ein ganzes Volk betroffen ist – und es ist immerhin ein EU-Beitrittswerber –, gemeinsam aufzutreten. Das ist wirklich eine Schande!
Natürlich kommen die Gefahren unseres Europas auch von innen. Wir haben heute schon von der AfD gehört – Kollege Strasser, man kann es ein bisschen konkreter machen: In Polen ist ein Mann angeklagt, der von AfD-Abgeordnetem Krah als russischer Spion ins Europäische Parlament eingeschleust wurde. Ein anderer AfD-Abgeordneter hat nachweislich Geld von Russland genommen. Der Dritte erklärt, dass China ein wunderbares Land ist, alles andere als keine Demokratie, also eine wunderbare Demokratie.
Wir wissen, dass die Leute gekauft sind, und mit solchen Leuten sitzen Sie (in Richtung FPÖ) im Europäischen Parlament zusammen. Das ist eine Schande!
Ich muss aber auch noch zum Thema Iran kommen: Ich habe das Foto von Mahmoud Mehrabi mitgebracht (ein entsprechendes Foto in die Höhe haltend), und zwar weil seine Schwester heute hier in Wien war; Kollege Troch war auch dabei. Ich habe gesagt, dass wir gemeinsam appellieren werden – mehr können wir ja nicht machen –, aber es ist unfassbar, dass dort jeden Tag Menschen zum Tode verurteilt werden dafür, dass sie sagen, na ja, sie seien mit der Regierung nicht zufrieden. – Es ist unfassbar, und auch da fehlt die Einigkeit der Europäischen Union.
Es würde diesbezüglich aber schon ein Stück weit helfen, wenn es hier in Österreich Einigkeit darüber gäbe. Ich bin wirklich der Überzeugung, dass wir dieses Regime anders behandeln müssen. Die Revolutionsgarden sind ja nicht nur ein Terrorinstrument, sie sind auch ein Wirtschaftsinstrument der iranischen Regierung, und diese gehören auf die Terrorliste.
Deswegen bringe ich folgenden Entschließungsantrag ein:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Douglas Hoyos-Trauttmansdorff, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Vorlage der Österreichischen Sicherheitsstrategie an den Nationalrat“
Der Nationalrat wolle beschließen:
Die Bundesregierung, insbesondere die Bundesministerin für Landesverteidigung, wird aufgefordert, dem Nationalrat unverzüglich, spätestens jedoch bis zum 31. Mai 2024, den Entwurf zur Österreichischen Sicherheitsstrategie zur Debatte zu übermitteln.
*****
Auch das müssen wir endlich machen: Wir haben noch immer keine Sicherheitsstrategie. Wir haben jene von 2013, und Kollege Stögmüller hat im
Fernsehen erklärt, die ÖVP sei dagegen, weil sie das russische Gas weiterhin haben will. Also dass man in einer Regierung streitet, verstehe ich ja, aber dass man über Österreichs Sicherheit streitet, finde ich höchst bedauerlich.
Bitte, Herr Bundesminister, ich appelliere wirklich an Sie, reden Sie auch mit dem iranischen Botschafter! Wir können nicht dabei zuschauen, wie dort jeden Tag Menschen umgebracht werden. Wenn diese EU, das gemeinsame Europa, für uns etwas bedeutet, dann sind es gerade die Menschenrechte, und da dürfen wir auch die Glaubwürdigkeit nicht verlieren. – Danke. (Beifall bei den NEOS.)
14.23
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Douglas Hoyos-Trauttmansdorff, Kolleginnen und Kollegen
betreffend Vorlage der Österreichischen Sicherheitsstrategie an den Nationalrat
eingebracht im Zuge der Debatte in der 262. Sitzung des Nationalrats über den Außen- und Europapolitischer Bericht 2022 der Bundesregierung (III-1151/2536 d.B.) – TOP 2
Österreich bringt sich im Strategischen Kompass der Europäischen Union ein und hat sich für die Rapid Deployment Capacity 2025 freiwillig gemeldet. Die Vorbereitungen dafür haben bereits begonnen. Nun wird auch über eine engere Anlehnung an die NATO gesprochen. Auch dafür wird Planung vonnöten sein. Weiters hat das Verteidigungsministerium einen Beschaffungsplan 2032+ erarbeitet und trat der European Sky Shield Initiative bei. Großangelegte Beschaffungen mit dem höchsten Budget in der Geschichte des BMLV sollten von einer langfristigen Strategie getrieben sein.
Dieser Meinung war auch der Bundeskanzler, der letztes Jahr eine neue Österreichische Sicherheitsstrategie bis Ende 2023 versprach. Die Vorbereitungsarbeiten dazu fanden im Sommer und Herbst letzten Jahres statt, dann konnte sich die Koalition nicht auf eine gemeinsame Version einigen. Nun liegt die ÖSS auf Eis; Österreichs
Beschaffungsplan, die Teilnahme an der RDC, die Eingliederung in die europäische Raketenabwehr ESSI und die Annäherung an die NATO finden – zum Schaden der Sicherheit unseres Landes aber wohl auch zum finanziellen Schaden, der mit strategieloser Beschaffung einhergeht – ohne grundlegende Vision für die Verteidigung Österreichs statt.
Wenn die ÖSS nicht vor Ende dieser Gesetzgebungsperiode veröffentlicht wird, ist davon auszugehen, dass eine neue Regierung sie nicht übernimmt, sondern stattdessen von Grund auf neu ausarbeitet. Damit wäre die Arbeit des BMLV und der zugezogenen Expert:innen in dieser Sache ebenso verschwendet, wie die Zeit bis zur Erarbeitung der neuen Version. Die Vorlage des bestehenden Entwurfs hingegen erlaubt es dem Nationalrat, auf Basis der Grundsätze der bereits erarbeiteten Strategie die Debatte weiterzuführen und die Strategie zeitnahe fertigzustellen, und die Planung für ESSI, Beschaffungsplan 2032+, RDC und NATO Annäherung auf Basis einer langfristigen Vision fortzuführen.
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
"Die Bundesregierung, insbesondere die Bundesministerin für Landesverteidigung, wird aufgefordert, dem Nationalrat unverzüglich, spätestens jedoch bis 31. Mai 2024, den Entwurf der Österreichischen Sicherheitsstratege zur Debatte und Überarbeitung zu übermitteln."
*****
Präsidentin Doris Bures: Mit der Ergänzung, dass die Sicherheitsstrategie nicht nur zur Debatte, sondern auch zur Überarbeitung zu übermitteln ist, ist dieser Entschließungsantrag ordnungsgemäß eingebracht und steht auch mit in Verhandlung. (Abg. Brandstätter: Danke schön!)
Jetzt erteile ich Herrn Abgeordneten Martin Engelberg das Wort. – Bitte.
Abgeordneter Mag. Martin Engelberg (ÖVP): Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Hohes Haus! Außenpolitik ist Innenpolitik, Außenpolitik ist Innenpolitik ist Gesellschaftspolitik. Ich erinnere an dieser Stelle wieder einmal an die sehr klugen Worte des von mir sehr geschätzten früheren Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde, Paul Grosz, der einmal in einem Gespräch mit einem Bundeskanzler gesagt hat: Wissen Sie, Herr Bundeskanzler, wenn Sie wissen wollen, wie es einem Land morgen geht, dann schauen Sie sich an, wie es der jüdischen Gemeinde heute geht.
Ich glaube, dass Israel heute die jüdische Gemeinde der Welt ist. Schauen wir uns an, wie es Israel heute geht, dann wissen wir, was uns morgen oder zum Teil sogar schon heute blüht. Noch am gleichen Tag des schlimmsten Massakers an Juden seit dem Holocaust, als über 1 000 Menschen brutal ermordet, massakriert, vergewaltigt, geköpft wurden, wurde in den Straßen Europas gefeiert – auch am Ballhausplatz in Wien.
Israel hatte mit dem Einmarsch in den Gazastreifen noch gar nicht begonnen, als eine unglaubliche Verkehrung, eine unerhörte Verkehrung der Realitäten begonnen hat. Nicht die genozidale, verbrecherische Hamas, nein, Israel wird bezichtigt und angeklagt, einen Genozid zu begehen – Israel, das die Möglichkeit hätte, einen Genozid zu begehen, während die Hamas in ihrem Programm ganz klar von einem Genozidwunsch spricht und ihn begehen würde, wenn sie es könnte. In dieser vollkommenen Verkehrung wird aber Israel angeklagt, Genozid zu begehen, nicht die Islamisten. Israel wird vorgeworfen, ein Apartheidstaat zu sein – der einzigen funktionierenden Demokratie in dem ganzen Gebiet des Nahen Ostens.
Wir wissen doch ganz genau, dass Christen, Moslems und Juden in Israel gleichberechtigt leben. Ich war vor wenigen Monaten in Aserbaidschan zur Wahlbeobachtung und habe dort den israelischen Botschafter getroffen – er ist ein
Araber, ein arabischer Israeli. Oberste Richter in Israel sind Araber, sind Moslems, dienen in der Armee. Und wir lassen es zu, dass Israel der Apartheid beschuldigt wird.
Tel Aviv, wohl eine der liberalsten Städte, gerade im Umgang mit Schwulen und Lesben, soll befreit werden: Palestine shall be free from the river to the sea. Dort soll ein Palästina entstehen wie im Gazastreifen, wo Schwule und Lesben verfolgt werden, von den Dächern gestoßen werden, massakriert werden. Und dann sehen wir Transparente mit: Queers for Palestine!?
Wir westlichen Länder versuchen jetzt, Israel daran zu hindern, das Notwendige zu tun, nämlich die Hamas zu besiegen und zu zerstören und die noch immer verbliebenen Geiseln zu befreien. Natürlich geschieht da viel menschliches Leid, das ist doch keine Frage. Wer aber sind die Verantwortlichen dafür, außer der Hamas?
Wieso fordern wir einen Waffenstillstand? Den gab es. Der Gazastreifen wurde den Palästinensern 2005 übergeben. Es gab einen Waffenstillstand bis zum 7. Oktober. Wer ist also verantwortlich für das, was dort passiert?
Wäre jemand auf die Idee gekommen, die Alliierten nach der Landung in der Normandie zu stoppen und zu sagen: Okay, stopp!, Berlin wird nicht eingenommen, die Nazis werden nicht entmachtet!? Vor ein paar Jahren, als die internationale Gemeinschaft den Kampf gegen die Isis aufgenommen hat, wäre es uns da eingefallen, zu sagen: Okay, aber Mossul und Rakka werden nicht eingenommen!? In Mossul und in Rakka ist ein Vielfaches an Zivilisten umgekommen, ein Vielfaches von dem, was jetzt im Gazastreifen passiert.
Noch einmal: Es soll nicht das schreckliche Leid, das dort passiert, minimiert werden – überhaupt keine Frage, es bricht einem das Herz. Nur, wer ist daran schuld?
Es gibt jetzt europäische Länder, die die Hamas damit belohnen wollen, dass sie einen Staat Palästina, den es nicht gibt, anerkennen. Wie macht das Sinn? Es soll
also ein Staat Palästina anerkannt werden; wir reden auch von dieser Forderung, dieser Zweistaatenlösung.
Was wird denn passieren, wenn dort demokratische Wahlen stattfinden? Wer von diesen Leuten, die das fordern, hat sich schon einmal ein bissel im Westjordanland umgeschaut, ein bissel mit Leuten geredet? Die Hamas gewinnt dort haushoch die Wahlen. Dort wurde über Generationen eine Generation nach der anderen mit Hass auf Juden, auf Israel und auf die westliche Welt vergiftet. Glauben wir nur ja nicht, dass es da nur um Juden und Israel geht! Da geht es um uns alle.
Was lernen wir daraus? – Anschläge von Islamisten hat es ja auch in Europa schon gegeben, in Paris, Belgien. Und in einer völligen Verkehrung sollen wir also die Rassisten sein, sollen wir islamophob sein?
Mit unfassbaren finanziellen Mitteln wird die Unterwanderung unserer Universitäten und Institutionen von islamistischen Regimen betrieben. Ich war vor zwei Wochen in den USA und habe mir mit meinen eigenen Augen vor Ort ein Bild gemacht. Ich war am Campus in Harvard, ich war am Campus der Columbia University und auch auf einer anderen Universität. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, was sich dort abspielt: 10 Milliarden Dollar wurden in den letzten Jahren von islamistischen Ländern an amerikanische Universitäten gespendet, um dort die diversesten islamistischen, islamischen Lehrstühle einzurichten, islamistische Professoren einzusetzen – vor unseren Augen.
Natürlich gibt es dort, sagen wir, bestenfalls naive, vollkommen geschichtslose, ahnungslose Studenten, die sich da aufhetzen lassen, aber das, was ich dort gesehen habe, das ist eine ganz gut organisierte Gruppe von Aktivisten, die da dahinterstehen. Es ist fast unglaublich, wie spiegelbildlich an der Columbia University, an der Harvard University und letzte Woche in Wien genau das Gleiche passiert – als hätte man zentral die Zelte eingekauft, als hätte man zentral organisiert, welches Programm dort stattfindet. Ist uns nicht klar, was da passiert?
Ich weiß nicht, wer von Ihnen letzte Woche am Unicampus war, ich war dort, ich habe das gefilmt, ich habe mir das alles angeschaut. Das ist erstaunlich. Dort ist kein einziger Student dabei gewesen, es waren lauter Aktivisten. Professionell organisiert wurden innerhalb von Stunden die Zelte aufgestellt, gab es Essen, eine Lautsprecheranlage, ein Programm: Jetzt spricht der Professor, jetzt haben wir eine Tanzstunde – erstaunlich, vor unseren Augen!
Da geht es jetzt einmal um Israel, aber natürlich geht es um uns, um die westliche Welt. Es ist der Kampf dieser dunklen Mächte gegen unser Wertesystem, gegen Freiheit, Friede, Wohlstand, Gleichberechtigung der Religionen, Gleichberechtigung der Geschlechter, um den es hier geht. Heute ist es Israel, heute sind es schon zum Teil wir, morgen jedenfalls.
Ich will aber trotzdem mit Optimismus enden. Ich bin überzeugt davon, dass letztlich unsere westliche Wertegemeinschaft gegen diese dunklen Mächte, die unsere Zerstörung wünschen, obsiegen wird, und ich bin der österreichischen Bundesregierung, allen voran dem Bundeskanzler und dem Außenminister, für ihre sehr, sehr klare Haltung in dieser Sache dankbar, für die Solidarität mit Israel.
Ich bin auch – und das möchte ich hier auch ausdrücklich sagen; ich habe es ihm aber auch schon persönlich gesagt – dem Innenminister und auch der Polizei sehr dankbar, wie sie letzte Woche sehr umsichtig, aber doch entschlossen mit dieser Besetzung des Unicampus umgegangen sind und dass sie auch die Räumung durchgeführt haben.
Und – das soll hier auch nicht unerwähnt bleiben – ich bin natürlich auch sehr, sehr dankbar für diese ganz klare Haltung, was dieses verbrecherische Regime in Russland und den Angriffskrieg gegen die Ukraine betrifft. Wir können gar nicht anders, als auf der Seite der Ukraine und des internationalen Rechts zu stehen. Wir müssen mit größter Entschlossenheit diesen dunklen Mächten entgegentreten: der Hamas, dem Islamismus, den verbrecherischen Regimen Russlands und auch des Irans. Nehmen wir diese Herausforderung an – für uns und für die
nächsten Generationen! – Danke. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
14.33
Präsidentin Doris Bures: Nun ist Herr Abgeordneter Christoph Matznetter zu Wort gemeldet. – Bitte.
Abgeordneter Dr. Christoph Matznetter (SPÖ): Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Zuallererst möchte ich die 3. Klasse der NMS Admont begrüßen, die hier bei uns ist: Herzlich willkommen! (Beifall bei der SPÖ sowie bei Abgeordneten von ÖVP, FPÖ, Grünen und NEOS.)
Für die jungen Menschen ist es gut, wenn sie sehen, dass wir uns auch mit den Problemen der Weltlage beschäftigen.
Der Einwand kam schon: Der Außen- und Europapolitische Bericht 2022 ist ein bisschen spät dran. Vielleicht haben Sie es deswegen unterlassen, Herr Bundesminister, ein Vorwort zu schreiben.
Die Probleme haben sich mittlerweile noch viel stärker zugespitzt. Wir haben mit dem brutalen Angriffskrieg der Russischen Föderation auf die Ukraine am 24. Februar 2022 den Beginn gehabt. Wir mussten im Herbst 2023 leider eine Art ethnische Säuberung in Karabach hinnehmen, in deren Zuge 120 000 Menschen ihre seit Jahrhunderten – wahrscheinlich seit 1 000 Jahren – angestammte Heimat verlassen mussten.
An dieser Stelle sei nur angemerkt: Das Völkerrecht beantwortet nicht alles. Wir waren auch der Auffassung, es ist Teil Aserbaidschans, Aserbaidschan habe quasi das Recht, diese Region zurückzuerobern. Da merkt man aber schon, das fühlt sich nicht ganz richtig an.
Dann hatten wir diesen furchtbaren, barbarischen Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober des vergangenen Jahres, der eine Reaktion der Selbstverteidigung Israels ausgelöst hat, was uns jetzt seit mittlerweile bald sechs Monaten beschäftigt. – Welchen Kompass nehmen wir dann, meine Damen und Herren?
Präsident Rousopoulos hat uns ja darauf hingewiesen, er hat es zweimal wiederholt: An oberster Stelle muss die Würde stehen – aber das ist die Würde des Menschen und nicht von Staaten, auch nicht nur von einzelnen Gruppen. Wir müssen als oberste Maxime die UN-Charta der Menschenrechte und die Europäische Menschenrechtskonvention nehmen – dann kommt das Völkerrecht und dann kommen andere Dinge. Wenn wir diesen Grundsatz einhalten, können wir immer einen Maßstab anlegen, wie wir vorgehen.
Kollege Engelberg, ich verstehe die Betroffenheit, und wir haben die Fürchterlichkeit dieses Massakers erlebt, aber wir werden immer den gleichen Maßstab anzulegen haben – immer. Es macht wenig Sinn, die wenigen Institutionen, die wir haben, schlechtzumachen – die Vereinten Nationen, den Generalsekretär, den Internationalen Gerichtshof –, das macht keinen Sinn. Da werden noch mehr junge Menschen kommen, und da wird es auch nicht helfen, wenn Sie sie als professionelle Unruhestifter bezeichnen, damit werden wir keinen Dialog zusammenbringen. Das geht doch nur – und ich appelliere daran, weil das auch berührend ist – mit Verständigung.
Wir hatten zum Beispiel die Rede von Omri Boehm in Wien, der, vom Humanismus geprägt, uns wenigstens versucht zu sagen: Wie könnte das ausschauen, dass dort Menschen hoffentlich in einer Generation ohne Sprengstoffgürtel, Macheten und anderem miteinander leben können, getragen von einer Menschenliebe? – Und da muss ich nicht, selbst wenn es Freunde von mir sind, von denen hören: Wenn ich jünger wäre, täte ich Eier werfen! – Das ist keine Antwort darauf, sondern man muss sich mit der Idee auseinandersetzen.
Sie, Herr Kollege Engelberg, sagen, wir sollen keine Zweistaatenlösung machen. Ja warum hört man dann nicht Menschen wie Omri Boehm zu, der sagt: Warum
macht man nicht einen demokratischen Rechtsstaat, der ein Zusammenleben ermöglicht? Vielleicht ist dann die Chance vorhanden, dass die Zehn-, Neun-, Achtjährigen, die jetzt in Gaza überlebt haben, nicht jene sind, die fünf Jahre später einen Bus in die Luft sprengen.
Das ist eine Aufgabe, zu der wir als Österreicher einen Beitrag leisten können: eine aktive Neutralitätspolitik, die eine Friedenspolitik ist. Das ist das, was wir wollen. (Beifall bei der SPÖ.)
Kollege Brandstätter redet von der Verteidigung. – Ja, aber nicht als Österreich! Wir werden mit unserem Bundesheer – Frau Tanner und alle Offiziere, bitte um Entschuldigung! – niemandem Angst einjagen, nicht einmal einem, der etwas Böswilliges mit uns vorhat. Unsere Chance ist der Dialog, unsere Chance ist, die Menschenrechte aktiv zu vertreten, und unsere Chance ist, ehrliche Makler zu sein.
Ehrlich heißt aber auch, unseren Freunden, wenn etwas falsch gemacht wird, zu sagen: Das habt ihr falsch gemacht. Deswegen bin ich so dankbar für den Europarat, bin ich so dankbar für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, und wir werden dafür sorgen, dass in diesem Land wieder eine aktive Neutralitätspolitik betrieben wird, die ein Ziel hat: Frieden und Freiheit für die Menschen. (Beifall bei der SPÖ.)
Das geht auch nicht mit Kapitulation der Ukraine, das wissen wir schon, aber am Ende muss eine lebenswerte Welt stehen. Nur zu kapitulieren ist keine Freiheit und daher ungeeignet, keine Frage, daher: Solidarität mit der Ukraine, weil sie die Überfallenen sind.
Abschließend zur Neutralitätspolitik der FPÖ: Bitte lest einmal nach, was im Neutralitätsgesetz drinnen steht, und schaut euch auch den Artikel 23j der Bundesverfassung an, in dem steht, wie wir unsere Solidarität mit der Europäischen Union zu leben haben. Der Ministerin Verfassungsbruch vorzuwerfen und selbst nicht einmal einen Blick in die Verfassung zu machen, um zu wissen,
was es heißt, die Petersberger Beschlüsse der Union zu verfolgen, ist schon in sich ein bisschen kurios – das auch an Kollegin Steger gerichtet. – Vielen Dank, meine Damen und Herren. (Beifall bei der SPÖ.)
14.40
Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Faika El-Nagashi. – Bitte.
Abgeordnete Mag. Faika El-Nagashi (Grüne): Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrte Zusehende! Demokratie und Menschenrechte: Bei allen Kriegen und Konflikten, die aus unterschiedlichen Motiven und in verschiedenen Kontexten geführt werden, dürfen wir nicht vergessen, dass Menschenrechte als Erstes geopfert werden. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist der unschätzbar hohe Wert einer Außenpolitik, die Menschenrechte, Frauenrechte und Minderheitenrechte schützt und fördert.
Dazu zählen – ich möchte sie auch explizit benennen – das Recht auf Versammlung, die Versammlungsfreiheit, die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit. Diese Rechte werden nicht erst bei einem manifesten Konflikt, sondern bereits im Vorfeld von Konflikten ausgehöhlt und angegriffen, oder sie haben nie wirklich bestanden.
Demgegenüber braucht es sicherlich das Engagement in internationalen Foren und auf multilateraler Ebene, aber es braucht jedenfalls auch eine Verschränkung nicht nur mit Förderprogrammen, nicht nur mit Wirtschaftspolitik, in den Partnerschaften mit Drittstaaten und in der Außen- und auch in der Sicherheitspolitik.
Darüber hinaus braucht es aktives Handeln – aktiv und konsequent – bei Verfolgung aufgrund von Homosexualität wie in Saudi-Arabien, in Uganda oder im Iran; bei Verfolgung aufgrund der Religionszugehörigkeit, wie die Verfolgung der Bahai im Iran, die Verfolgung der Uiguren in China, die Verfolgung von
Musliminnen und Muslimen, von Christinnen und Christen und von Jüdinnen und Juden.
Es braucht die fortgesetzte Unterstützung von Frauen und Mädchen in Afghanistan, die einem Regime gegenüberstehen, das ihre Existenz verunmöglicht, aber es braucht auch die Unterstützung der Diaspora, die sich dafür einsetzt, dass es Zugang für Frauen und Mädchen zu Bildung und zu Gesundheit gibt. (Beifall bei den Grünen.)
Es braucht die Unterstützung der iranischen Zivilbevölkerung, die mit einer horrenden Frauenrechtssituation konfrontiert ist, die mit der Unterdrückung von Protesten konfrontiert ist, mit politischen Gefangenen, die zum Teil gefoltert werden, auch mit der Todesstrafe bedroht sind. Ich möchte dabei auch Toomaj Salehi erwähnen, für dessen Freilassung und die Aussetzung der Todesstrafe wir uns hier vor Kurzem parteiübergreifend eingesetzt haben.
Es braucht auch den Dialog mit Tibet: Dort stellt sich auch die Frage der Religionsfreiheit, aber auch die Frage eines nachhaltigen Mittelweges und einer friedlichen Zukunft.
Die Behandlung all dessen, all dieser Themen, ist nicht möglich ohne Mechanismen wie das globale EU-Menschenrechtssanktionsregime, aber auch den Ausbau beziehungsweise die Umsetzung der UN-Resolution 1325.
Es ist vorhin schon angesprochen worden: Die Haltung im Außen spiegelt auch das Innen wider, und wenn wir die außen- und innenpolitische Dimension nicht zusammen denken, dann verstehen wir nicht, wie wichtig die innenpolitische Haltung für unser glaubwürdiges und effektives Auftreten in der Außenpolitik ist. Das heißt, dass wir ebenso die Zivilgesellschaft stärken müssen, Menschenrechte und Demokratie im Inneren und im Innenpolitischen hochhalten müssen, wenn wir glaubwürdig und glaubhaft im außenpolitischen Bereich dafür eintreten wollen. (Beifall bei den Grünen.)
14.44
Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Henrike Brandstötter. – Bitte.
Abgeordnete Henrike Brandstötter (NEOS): Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher zu Hause und hier im Hohen Haus! Der Inbegriff des absurden Theaters „Warten auf Godot“ hat Konkurrenz bekommen: Wir warten auf die Afrikastrategie.
Diese Bundesregierung hat sich das Erarbeiten einer solchen Strategie auch ins Regierungsübereinkommen geschrieben, passiert ist dann sehr lange nichts. Im vorletzten Winter wurde angekündigt, dass diese Strategie im Frühjahr dann doch bald kommen wird – Karl Nehammer hat das auch im Rahmen einer Pressekonferenz so formuliert. Im April hieß es dann auch seitens des Bundesministers, dass diese Strategie vor dem Sommer kommen wird; vor dem Sommer hieß es, sie kommt im September; im September hieß es: vor Weihnachten; vor Weihnachten wurde dann gar kein Datum mehr gesagt, aber sie werde kommen; bei einer Pressekonferenz im März meinte der Herr Außenminister, man arbeite daran; und jetzt war in der Sitzung des Außenpolitischen Ausschusses keine Rede mehr davon, sondern – ich zitiere sinngemäß –: Das Erarbeiten einer Strategie macht nicht wahnsinnig viel Sinn, denn sobald man diese verschriftlicht hätte, wäre diese Strategie ja schon wieder obsolet und überholt.
Das bedeutet nichts anderes, als dass diese Bundesregierung betreffend die Afrikastrategie ohne Plan, ohne Ziele durch die Gegend irrlichtert, auch Besuche, Reisen auf den afrikanischen Kontinent macht, aber eigentlich gar nicht genau weiß, was sie dort tut. Das hat insofern auch besondere Brisanz, als die Afrikaagenden – allen voran die Entwicklungszusammenarbeit – auf sieben Ministerien aufgeteilt sind.
Jetzt möchte ich schon gerne darauf eingehen, warum man denn eigentlich eine Strategie braucht. Geopolitische Strategien haben im Wesentlichen zwei Funktionen: erstens einmal eine regierungsinterne Vergewisserung darüber, was
denn eigentlich die Ziele sind, was die Prioritäten sind, und – auch der Weg ist das Ziel – damit man eben untereinander in den Ministerien auch darüber spricht, wohin man denn eigentlich möchte; und natürlich wird auch die Frage der Kohärenz mitverhandelt.
Die zweite Funktion eines Strategiedokuments, das auch veröffentlicht wird, ist natürlich die Kommunikation der eigenen Politik nach außen, nicht zuletzt auch gegenüber afrikanischen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, die man trifft – vielleicht auch demnächst bei der Eröffnung unserer neuen Botschaft in Accra in Ghana.
Darüber hinaus gibt es natürlich noch weitere Gründe, warum man strategisch über Afrika nachdenken sollte. Nun ist der afrikanische Kontinent in den letzten Jahrzehnten auf der Prioritätenleiter nach oben geklettert, hat aber für uns natürlich nicht ganz die Relevanz wie beispielsweise China, betreffend das wir ebenfalls noch keine Strategie haben, die EU, Osteuropa, der Nahe Osten. Das sind schon Themen, mit denen wir auch sehr viel zu tun haben.
Insofern hat die Afrikapolitik sehr begrenzte zeitliche und finanzielle Ressourcen. Umso wichtiger ist es eben, dass man eine Strategie hat, eine Fokussierung, eine Prioritätensetzung, und diesen Kompass vermissen wir. Wir wollen ihn endlich sehen, und deshalb bringe ich folgenden Entschließungsantrag ein:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Henrike Brandstötter, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Vorlage des Entwurfs der Afrikastrategie an den Nationalrat“
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten, wird aufgefordert, dem Nationalrat unverzüglich, spätestens jedoch bis 31. Mai 2024, den Entwurf der im BMEIA bereits vorliegenden Afrikastrategie zur Debatte und Überarbeitung zu übermitteln.“
*****
Vielen Dank. (Beifall bei den NEOS.)
14.47
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Henrike Brandstötter, Kolleginnen und Kollegen
betreffend Vorlage des Entwurfs der Afrikastrategie an den Nationalrat
eingebracht im Zuge der Debatte in der 262. Sitzung des Nationalrats über den Außen- und Europapolitischer Bericht 2022 der Bundesregierung (III-1151/2536 d.B.) – TOP 2
Während der Bundeskanzler und verschiedene Regierungsmitglieder Afrikareisen unternehmen, auch um Informationen für die seit langem überfällige Afrikastrategie zu sammeln, können sich die Koalitionspartner anscheinend nicht auf eine Strategie einigen. Auf Nachfrage - oder auch auf Entschließungsanträge zur zeitnahen Veröffentlichung - antwortet Bundesminister Schallenberg routinemäßig und seit langer Zeit, die Strategie sei aus Sicht des BMEIA fertig und harre nur der Zustimmung des Koalitionspartners. Weder Geopolitik noch Wirtschaft können darauf warten. Österreich riskiert noch weiter zurückzufallen, als es das im Vergleich zu Staaten wie der Türkei, die massiv in Afrika politisch wie auch wirtschaftlich investieren, bereits der Fall ist.
Afrika ist einerseits Zukunfts- und Hoffnungskontinent, anderseits beschäftigt sich Europa zurzeit mehrheitlich mit Instabilität, Demokratieerosion und dem Einfluss Russlands und Chinas in Staaten, die auch von einer europäischen – oder österreichischen – Afrikastrategie abgedeckt werden sollten.
Wenn die Afrikastrategie nicht vor Ende dieser Gesetzgebungsperiode veröffentlicht wird, ist davon auszugehen, dass eine neue Regierung sie nicht übernimmt. Damit
wäre die Arbeit des BMEIA in dieser Sache verschwendet. Die Vorlage der Strategie erlaubt es dem Nationalrat, auf Basis der Grundsätze der bereits erarbeiteten Strategie die Debatte weiterzuführen und die Strategie zeitnahe fertigzustellen.
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten, wird aufgefordert, dem Nationalrat unverzüglich, spätestens jedoch bis 31. Mai 2024, den Entwurf der im BMEIA bereits vorliegenden Afrikastrategie zur Debatte und Überarbeitung zu übermitteln.“
*****
Präsidentin Doris Bures: Der Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht und steht auch mit in Verhandlung.
Nächster Redner: Herr Abgeordneter Nikolaus Berlakovich. – Bitte.
Abgeordneter Dipl.-Ing. Nikolaus Berlakovich (ÖVP): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Außenpolitische Bericht ist sehr umfassend und beleuchtet alle Politikbereiche der Innenpolitik, der Europapolitik, der Weltpolitik. Insbesondere der Region der Europäischen Union wird in diesem Bericht sehr breiter Raum gewidmet.
Ich möchte zu einem Politikbereich Stellung nehmen, nämlich zur Regionalpolitik der Europäischen Union. Diese ist ein wichtiger Pfeiler der Europäischen Union, ein intensiv bewirtschafteter Pfeiler, aber gleichzeitig einer, der in der Öffent-
lichkeit wenig diskutiert wird, deswegen sage ich das auch gerade vor der Europawahl und auch im Lichte dessen, dass die Europäische Union viel kritisiert wird. Hier aber, bei der Regionalpolitik der Europäischen Union, zeigt sich, wie wichtig dieses gemeinsame Europa ist.
Der Grundgedanke war von Anbeginn, zu sagen: Wir haben in Europa starke Regionen, wo es wirtschaftlich gut läuft, wo die Menschen Beschäftigung haben, wo der Wohlstand hoch ist; aber wir haben in der Europäischen Union genauso Regionen, die eben nicht so gut entwickelt sind, wo die Einkommen nicht so passen, wo Arbeitsplätze nicht so vorhanden sind, und das Ziel dieser Regionalpolitik der Europäischen Union ist, das Niveau der wirtschaftlich schwächeren Regionen heranzuführen, sie auf das Niveau der wirtschaftlich starken Regionen zu heben, mit dem Ziel, den Wohlstand in Europa zu sichern. Das ist sehr erfolgreich, und daher ist die Europäische Union diesbezüglich sehr wichtig.
Wir haben auch Studien, die belegen, dass es gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten – seinerzeit bei der Finanzkrise – die Regionalpolitik war, die mit sehr viel Geld erreicht hat, dass es nicht zu wirtschaftlichen Verwerfungen gekommen ist. Die Wirtschaft wäre damals um bis zu 45 Prozent eingebrochen – was aber nicht passiert ist, da es eben wirtschaftliche Impulse gegeben hat.
In Österreich hat das Wifo diese Regionalpolitik beleuchtet und hat auch hier in Österreich dargestellt, dass es in diesen Jahrzehnten, in denen wir Mitglied sind, wirtschaftlich starke Impulse für die Regionen in Österreich gegeben hat, dass Regionen wie eben das Waldviertel oder auch das Burgenland wirtschaftlich aufgeholt haben.
Ich darf am Beispiel des Burgenlands veranschaulichen, wie die Regionalpolitik funktioniert, nämlich wie es erfolgreich funktioniert, einer Region zu helfen, die einfach strukturell Nachteile hatte.
Das Burgenland ist 40 Jahre lang am Eisernen Vorhang gelegen, neben Ungarn und der Slowakei, kommunistisch verachtenden Regimen mit wirtschaftlich
schwieriger Situation. Das Burgenland konnte sich da nicht entwickeln, war ein starkes Pendlerland. Viele Menschen mussten ihren Arbeitsplatz anderswo suchen. Dann kam 1995 der EU-Beitritt, und die Zustimmungsrate der Menschen in Burgenland war für diesen Beitritt zur Europäischen Union eine sehr hohe, einerseits weil die Menschen im Burgenland Freude daran hatten, positiv motiviert waren, vom Rand Europas ins Zentrum zu kommen, aber gleichzeitig auch die Perspektive gesehen haben, dass es wirtschaftliche Unterstützung gibt.
Das Burgenland wurde damals als Ziel-1-Gebiet eingestuft. Ein Ziel-1-Gebiet ist eine Region, in der das Bruttoinlandsprodukt weniger als 75 Prozent des EU-Gemeinschaftsdurchschnitts ist, also sozusagen eine strukturschwache Region. Das war wichtig, denn das Ziel war dabei, dass man im Burgenland den Entwicklungsrückstand aufholt, dass das Burgenland zu einer zentraleuropäischen Region wird und dass eben auch diese regionalen Unterschiede abgebaut werden.
Heute kann man sagen, dass seit dem EU-Beitritt die wirtschaftliche Entwicklung im Burgenland eine Erfolgsgeschichte war. Es war eben von 1995 bis 2006 Ziel-1-Gebiet. Das bedeutet, mit viel Fördermitteln Chancen zu entwickeln. Ab 2006, 2007 begann das dann immer besser zu laufen, sodass das Burgenland dann nicht mehr Ziel-1-Gebiet war, sondern sogenannte Phasing-out-Region wurde, die aus dieser sehr intensiven Förderung ausgleitet. Ab 2014 wurde das Burgenland dann überhaupt zu einer Übergangsregion, weil man festgestellt hat, es läuft wirklich sehr gut. Letztendlich ist das Burgenland heute im Investitionsprogramm, das für ganz Österreich gilt, nämlich für Beschäftigung und Wachstum.
Das heißt, die eingesetzten Fördermittel der Europäischen Union und das Geld haben Arbeitsplätze geschaffen, haben den Wohlstand im Burgenland gesichert, weil insgesamt rund 35 000 Arbeitsplätze im Burgenland geschaffen und gesichert wurden. Das hat eine große Perspektive gegeben. Das ist der Punkt, warum dieses gemeinsame Europa so wichtig ist: weil es dem Burgenland, aber
auch anderswo, in anderen Regionen Chancen und Perspektiven gibt. – Herzlichen Dank. (Beifall bei Abgeordneten der ÖVP.)
14.52
Präsidentin Doris Bures: Nun ist Frau Abgeordnete Muna Duzdar zu Wort gemeldet. – Bitte.
Abgeordnete Mag. Muna Duzdar (SPÖ): Frau Präsidentin! Herr Außenminister! Liebe Zuseher und Zuseherinnen auf der Galerie! Es ist nicht möglich, den Außenpolitischen Bericht zu diskutieren, ohne Bezug auf den aktuellen Krieg im Nahen Osten zu nehmen – es haben auch schon einige Kolleginnen und Kollegen vor mir gemacht –, einen Krieg, der nun seit sieben Monaten läuft und in dem keine Perspektive auf ein Ende des Blutvergießens besteht.
Es ist ein israelischer Premierminister, ein Rechtspopulist, der mit Rechtsextremen in einer Regierung sitzt, der diesen Krieg in die Länge ziehen möchte, weil er weiß, dass das Ende dieses Krieges sein politisches Ende bedeuten würde. Ihm sind die vielen Tausend Opfer anscheinend egal: 1 200 israelische Opfer, die angesichts des Ausmaßes der Gewalt und der Zerstörung im Gazastreifen zusehend in Vergessenheit geraten, geschätzte 35 000 tote Palästinenser und Palästinenserinnen, von denen bisher nur 25 000 Menschen identifiziert werden konnten; unzählige, Tausende Tote, Frauen und Kinder, liegen in den Trümmern.
Damit ist nicht genug, sondern es gibt jetzt auch noch diesen Angriff der israelischen Armee auf Rafah, auf den größten Zufluchtsort im Gazastreifen. Die palästinensische Zivilbevölkerung weiß nicht mehr, wohin sie flüchten soll oder wo es noch einen sicheren Ort für sie gibt.
Herr Außenminister, ich habe von Ihnen bisher kein kritisches Wort dazu vernommen. Ich finde es bedauernswert, dass selbst der größte, engste Verbündete Israels, nämlich die Vereinigten Staaten von Amerika, uns in seiner
Kritik am militärischen Vorgehen Israels bereits überholt hat und ich noch immer kein kritisches Wort von Ihnen gehört habe. Sie haben in der letzten Sitzung des Außenpolitischen Ausschusses nochmals erklärt, warum Österreich gegen die UNO-Resolution in den Vereinten Nationen gestimmt hat. Sie haben gesagt, weil die Hamas nicht erwähnt worden sei. Wir haben Ihnen mehrfach erklärt, Herr Außenminister, dass der Begriff Terrororganisation erwähnt wurde und jeder weiß, wer mit Terrororganisation gemeint ist, und dass es bei dieser UNO-Resolution um einen Kompromiss und um den Schutz der zivilen Bevölkerung gegangen ist.
Herr Außenminister, wenn Sie der Meinung sind, dass Sie ja eh für den Waffenstillstand sind, dann würde ich Sie heute wirklich bitten und ersuchen: Sagen Sie das so in Ihrer Rede, sagen Sie, dass Sie einen sofortigen Waffenstillstand fordern, sagen Sie, dass Sie ein Ende des Sterbens fordern! Das habe ich bisher von Ihnen so, in dieser Deutlichkeit, noch nicht vernommen. Es reicht nämlich nicht aus, nur ein Posting abzusetzen. Das kann die reale Politik nicht ersetzen.
Herr Außenminister, es gibt einen klaren Bruch mit einer jahrzehntelang bewährten Nahostpolitik, die für großes Ansehen in der Welt gesorgt hat. Daher ersuche ich Sie, ich fordere Sie auf: Besinnen Sie sich zurück auf eine aktive Neutralitätspolitik, besinnen Sie sich zurück auf eine Politik der Vermittlung, des Dialogs und des Friedens und glauben Sie nicht, dass Sie proisraelisch sind, wenn Sie auf der Seite eines Rechtspopulisten stehen! Proisraelisch sind Sie dann, Herr Minister, wenn Sie auf der Seite der Tausenden Israelis stehen, die täglich für ein Ende des Krieges demonstrieren, die für einen Waffenstillstand und für die Freilassung der Geiseln demonstrieren. – Danke sehr. (Beifall bei der SPÖ sowie der Abg. El-Nagashi.)
14.56
Präsidentin Doris Bures: Nun ist Frau Abgeordnete Bettina Rausch-Amon zu Wort gemeldet. – Bitte.
14.57
Abgeordnete Mag. Bettina Rausch-Amon (ÖVP): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Gäste hier im Haus und alle Zuseherinnen und Zuseher vor den Bildschirmen! Für meinen Beitrag zum Außen- und Europapolitischen Bericht 2022 habe ich mir eigentlich einen anderen Schwerpunkt gesetzt, ich möchte aber in Replik auf Kollegin Duzdar schon noch zwei Gedanken anbringen, weil ich das nicht so stehen lassen kann.
Österreich auf internationaler Bühne, gerade was den Nahostkonflikt betrifft, Untätigkeit oder eine falsch verstandene Neutralität vorzuwerfen halte ich hier für nicht angebracht.
Jetzt kann man sagen, ich habe leicht reden, weil ich auch keine persönliche Verbindung in diese Region habe und Gott sei Dank auch keine persönliche Erfahrung mit dem unermesslichen Leid eines Krieges, mit der Notwendigkeit einer Flucht oder mit Vertreibung habe, ich glaube aber, wir haben es mit fundamental unterschiedlichen Dingen zu tun: Die israelische Armee kämpft – ja, leider Gottes mit Kollateralschäden; das Wort ist eigentlich hässlich, wenn es um tote Menschen geht, denn jeder Tote und jede Tote ist einer und ist eine zu viel; dieses Leid ist eines, das uns auch berührt, mich persönlich jedenfalls – und macht unter internationaler Beobachtung im Rahmen internationalen Rechts, ihres Selbstverteidigungsrechts Terrorzellen ausfindig, möchte Terroristen unschädlich machen, die uns alle bedrohen, bedrohen können – Kollege Engelberg hat das ausgeführt –, weil, und das ist der Unterschied, die Hamas, die letztendlich am Beginn dieser Misere, dieses Dramas steht, am 7. Oktober 2023 bewusst, vorsätzlich, willkürlich Zivilisten brutal vergewaltigt, verstümmelt, ermordet hat. Ich möchte das noch einmal festhalten: Darum geht es – um nicht mehr, aber auch um nicht weniger. (Beifall bei Abgeordneten der ÖVP.)
Zurück zum Außen- und Europapolitischen Bericht: Der Schwerpunkt, den ich bei der Debatte über diesen umfangreichen Bericht setzen möchte, ist Afrika.
Auch wenn Frau Kollegin Brandstötter kritisiert, dass eine verschriftliche Strategie nicht vorliegt, sind jedenfalls ich und viele meiner Kolleginnen und Kollegen der Meinung, die Strategie, die sie verschriftlicht vermisst, kann man, wenn man die Handlungen des Bundesministers, seines Teams, der Bundesregierung insgesamt beobachtet, nachverfolgt und die Berichte liest – auch jenen von 2022 –, wenn man so will, deduktiv ableiten. Das Vorgehen der Regierung in Sachen Afrika ist differenziert, weil unsere Interessen im globalen Kontext vielfältig sind und weil auch die Staaten und Regionen Afrikas vielfältig sind, auch was ihre Chancen und Herausforderungen betrifft.
Das Vorgehen ist engagiert, wie ich meine, und es ist zukunfts- und lösungsorientiert. Und Lösungen braucht es allemal für die großen Herausforderungen unserer Zeit, für die vielen Herausforderungen globalen Ausmaßes. Wie wir heute sehen, geht es um ein grundsätzliches Ringen um Frieden und Sicherheit in einer bipolaren Welt. Es geht um Schutz und Stärkung einer demokratischen Rechtsordnung, unseres liberalen Lebensmodells angesichts des Rückgangs von Demokratien weltweit. Zwei ganz konkrete Herausforderungen aber, die uns alle betreffen, egal welche Staatsform, welches Lebensmodell wir haben, sind Migration und Klimawandel.
Die Ursache für Migration, gerade aus Ländern, Regionen Afrikas, sind leider neben immer wieder auch lokal ausbrechenden Kriegen – ich nenne den Sudan als Beispiel – grundsätzlich sehr oft die wirtschaftliche Lage, die Lebensqualität, die Lebenschancen, die Sicherheitslage der Menschen, die sie zum Aufbruch zwingen oder jedenfalls einen Aufbruch Richtung Europa attraktiver erscheinen lassen. Wenn wir also wollen, dass Menschen Perspektiven vor Ort haben, dann muss der allgemeine Wohlstand in Afrika steigen, dann muss es Stabilität geben. Ich sehe, dass vitale und legitime Sicherheitsinteressen der österreichischen, auch der europäischen Bevölkerung letztlich Hand in Hand mit einer ethisch-humanistischen Verantwortung, die wir da haben, gehen. Das sind vordergründig oft Widersprüche, aber diese gilt es aus meiner Sicht konsequent aufzulösen – mit Zuversicht und im Dialog.
Perspektiven bedeuten nicht nur Sicherheit, Stabilität, sondern Perspektive heißt auch Wirtschaftswachstum und Wohlstand. Dazu vielleicht auch nur einen Gedanken: Wenn so manche Länder Afrikas ihren Wohlstand, ihr Wirtschaftswachstum mit demselben ökologischen Fußabdruck, Stichwort CO2-Ausstoß, wie wir bisher in Europa erreichen, dann haben wir ein Problem, aber ich sehe auch da viele Chancen. Afrikas Wirtschaft wächst am schnellsten auf der ganzen Welt, und wir sehen, sie überspringt dabei technologische Entwicklungsstufen, arbeitet mitunter wesentlich nachhaltiger.
Es gibt somit wechselseitiges Interesse an wirtschaftlichem und wissenschaftlichem Austausch über die Grenzen der Kontinente hinweg. Ein Beispiel dafür, das wir im Bericht lesen: 2022 gab es den sechsten EU-Afrika-Gipfel, bei dem die EU ein Investitionspaket in der Höhe von 150 Milliarden Euro bis 2027 zugesagt hat. Es geht um den Green Deal, um Digitalisierung, Schaffung von Arbeitsplätzen, aber auch um Good Governance und um Perspektiven für die Menschen.
Einen letzten Gedanken auch zum Thema Entwicklungszusammenarbeit, einem Thema, das natürlich immer wieder mit dem afrikanischen Kontinent in Verbindung gebracht wird: Es würde zu kurz greifen, würden wir in Afrika nur Entwicklungszusammenarbeit machen, es braucht in bestimmten Regionen auch sehr spezifisch unsere Unterstützung. Ich denke an Äthiopien, wo wir die ländliche Entwicklung unterstützen, humanitäre Hilfe über die Austrian Development Agency anbieten, oder ich denke an Burkina Faso, wo wir technisches Schulwesen und Berufsbildung unterstützen. Es ist unsere Verantwortung, dort zu unterstützen. Das hilft den Menschen vor Ort, trägt aber auch zur globalen Sicherheit bei.
Sie sehen also, Österreichs Vorgehen am afrikanischen Kontinent ist engagiert. Wir sind in gutem Austausch mit unseren afrikanischen Partnern. Wir brauchen Partner in einer sich rasch verändernden Welt und haben dort, denke ich, schon 2022 beste Voraussetzungen geschaffen, setzen das aber auch in den Jahren 2023, 2024 und so weiter fort.
Ich danke dem Außenminister dafür, seinem Team in Wien und auf der ganzen Welt, speziell auch auf dem afrikanischen Kontinent, und ich bin froh, wenn wir diesen Weg auch gemeinsam fortsetzen können. – Vielen Dank. (Beifall bei der ÖVP.)
15.03
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Robert Laimer. – Bitte.
Abgeordneter Robert Laimer (SPÖ): Frau Präsidentin! Herr Minister! Meine Damen und Herren! Liebe Zuseherinnen und Zuseher! Die Welt, in der wir leben, ist geprägt von Konflikten und Spannungen. Daher ist es unsere Pflicht, heute mehr denn je, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um sicherzustellen, dass Waffen nicht in falsche Hände gelangen. Durch strengere Exportkontrollen auf nationaler und europäischer Ebene können wir einen großen Schritt in Richtung internationale Stabilität und Sicherheit machen.
Darüber hinaus müssen wir den Einfluss der Rüstungslobbys auf unsere Regierungen und Entscheidungsträger:innen begrenzen. Es ist unannehmbar, dass Profitinteressen über das Wohl der Menschen gestellt werden. Wir müssen sicherstellen, dass unsere politischen Entscheidungen im Bereich der Rüstungspolitik transparent sind und ausschließlich einem Ziel dienen: Frieden und Sicherheit zu fördern.
Wir stehen nämlich an einem Scheideweg der Geschichte. Die erst vor wenigen Tagen stattgefundene Weltkonferenz – nicht zufällig in Wien – über autonome Waffensysteme hat eines gezeigt: wie rasant die Entwicklungen von autonomen Systemen künstlicher Intelligenz nicht nur im zivilen Bereich, sondern gerade auch im militärischen Bereich für weitreichende Auswirkungen sorgen. Autonome Waffensysteme haben das Potenzial, ohne menschliche Eingriffe Ziele auszuwählen und anzugreifen. Sie folgen Algorithmen. Österreich gehört zu jenen Staaten, die sich für ein rechtlich bindendes Instrument einsetzen, dass
autonome Waffensysteme ohne menschliche Kontrolle präventiv verboten werden.
Sehr geehrte Damen und Herren, es ist an der Zeit, dass wir als internationale Gemeinschaft gemeinsam handeln, um Entwicklungen und den Einsatz von autonomen Waffensystemen und generell auch von Kriegswaffen zu regulieren, und sicherstellen, dass menschliche Kontrolle und Ethik stets im Mittelpunkt stehen.
Es ist an der Zeit, dass wir als internationale Gemeinschaft anerkennen, dass die Sicherheit und das Wohlergehen aller Menschen untrennbar miteinander verbunden sind.
Es ist an der Zeit, dass wir die Notwendigkeit einer umfassenden Abrüstung erkennen und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Wir können nicht zulassen, dass die Bedrohung durch Kriegswaffen unsere Zukunft noch massiver bestimmt.
Es ist an der Zeit, dass wir uns gemeinsam für eine Welt einsetzen, die frei von der massiven Bedrohung durch Waffen ist, für eine Welt des Friedens, der Zusammenarbeit und des Respekts.
Meine Damen und Herren, es ist Zeit für Frieden. Machen wir etwas dafür, zeigen wir, was Österreich kann! Gerade heute, am 15. Mai, gedenken wir des Staatsvertrages. In meiner Heimatstadt Sankt Pölten wird der Tag des Staatsvertrages seit jeher mit dem niederösterreichischen Militärkommando mittels Festakt begangen, und darauf bin ich auch sehr stolz. Rüsten wir uns für die Zukunft, nicht für den Krieg! (Beifall bei der SPÖ.)
Dahin gehend bringe ich folgenden Antrag ein:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Robert Laimer, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Strengere Exportkontrollen für Kriegswaffen und effektive Reglementierung der Rüstungs-Lobbys“
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten, wird aufgefordert, die Kontrolle über den Export von Kriegswaffen, Kriegsfahrzeugen und Kriegsmunition auf nationaler Ebene zu verschärfen und sich auf europäischer Ebene auch für entsprechende Maßnahmen einzusetzen, um die missbräuchliche Verwendung dieser Waffen in internationalen Konflikten zu verhindern; dabei sollen insbesondere strengere Regeln für den Zugang von Vertretern der Rüstungsindustrie zu staatlichen Stellen eingeführt werden, um sicherzustellen, dass deren Interessen nicht über den Interessen der Republik Österreich sowie einer umfassenden Friedenspolitik gestellt werden.“
*****
Vielen Dank. (Beifall bei der SPÖ.)
15.07
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Robert Laimer,
Genossinnen und Genossen,
betreffend „Strengere Exportkontrollen für Kriegswaffen und effektive Reglementierung der Rüstungs-Lobbys“
eingebracht im Zuge der Debatte zu TOP 2/ Bericht des Außenpolitischen Ausschusses (2536 d.B.) über den Außen- und Europapolitischen Bericht 2022 der Bundesregierung (III-1151 d.B.)
Fragen der internationalen Abrüstung und Rüstungskontrolle werden im Außen- und Europapolitischen Bericht 2022 der Bundesregierung in einem eigenen Kapitel
angesprochen. Die Verschärfung der Exportkontrolle von Kriegswaffen, Kriegsfahrzeugen und Kriegsmunition sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene ist von entscheidender Bedeutung, um Missbrauch entgegenzuwirken und eine effiziente rechtsstaatliche Aufsicht über die Interessen der Lobbys der Rüstungsindustrie zu implementieren. Diese Maßnahme steht im Einklang mit dem Grundgedanken einer verantwortungsvollen und nachhaltigen Rüstungspolitik, die den Schutz von Menschenleben, die Förderung von Frieden und Stabilität sowie die Wahrung grundlegender Menschenrechte in den Vordergrund stellt.
Der Zugang von Vertreter:innen der Rüstungsindustrie zu Behörden, gewählten Mandatar:innen der Legislative sowie Entscheidungsträger:innen der Exekutive auf nationalstaatlicher und EU-Ebene muss strengeren gesetzlichen Regeln und öffentlichen Meldepflichten unterliegen. Dies dient dem Ziel, Transparenz zu gewährleisten und sicherzustellen, dass keine Interessenkonflikte oder unangemessenen Einflussnahmen die Entscheidungsprozesse im Bereich der Rüstungspolitik beeinträchtigen.
Es ist unabdingbar, dass Partikularinteressen einzelner rüstungspolitischer Vertreter:innen stets hinter friedlichen Konfliktlösungen und den Wünschen der Bevölkerung nach Frieden zurückstehen. Eine strikte und unabhängige Kontrolle der Exporte von Kriegswaffen und -gerät ist eine zentrale Säule für die Sicherstellung von internationaler Stabilität und Sicherheit.
Darüber hinaus führt eine restriktivere Exportkontrolle auch zu einer Stärkung des europäischen Zusammenhalts und zur Förderung einer gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Durch einheitliche Standards auf EU-Ebene wird eine effizientere Zusammenarbeit der Mitgliedsstaaten ermöglicht, wodurch die Wirksamkeit der Kontrollen weiter gesteigert wird.
Aus diesen Gründen stellen die unterzeichneten Abgeordneten folgenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten, wird aufgefordert, die Kontrolle über den Export von Kriegswaffen, Kriegsfahrzeugen und Kriegsmunition auf nationaler Ebene zu verschärfen und sich auf europäischer Ebene auch für entsprechende Maßnahmen einzusetzen, um die missbräuchliche Verwendung dieser Waffen in internationalen Konflikten zu verhindern; dabei sollen insbesondere strengere Regeln für den Zugang von Vertretern der Rüstungsindustrie zu staatlichen Stellen eingeführt werden, um sicherzustellen, dass deren Interessen nicht über den Interessen der Republik Österreich sowie einer umfassenden Friedenspolitik gestellt werden.“
*****
Präsidentin Doris Bures: Der Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht, steht mit in Verhandlung.
Nächster Redner: Herr Abgeordneter Nico Marchetti. – Bitte.
Abgeordneter Nico Marchetti (ÖVP): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Geschätzter Herr Außenminister! Ich möchte zuerst im Namen meiner Kollegin Andrea Holzner den Seniorenbund Uttendorf aus dem Bezirk Braunau herzlich bei uns im Hohen Haus begrüßen. (Allgemeiner Beifall.)
Es hat mich sehr gefreut, dass wir heute wirklich einen wesentlichen Teil der bisherigen Sitzung mit internationalen Fragen, mit Europafragen verbracht haben, aber ich möchte ergänzend zu den Debatten die Logik, dass wir die Argumente und die Stimmungen, die Parteien erzeugen, mit dem erhobenen Zeigefinger bekämpfen, ein bisschen durchbrechen, weil ich glaube, man muss auch einmal versuchen, den Sorgen und Ängsten der Menschen anders als eben mit dem erhobenen Zeigefinger zu begegnen.
Ich habe nämlich das Gefühl, dass eine Partei sich ein bisschen lustig über uns macht, wenn sie sagt, wir seien die Einheitspartei, also ÖVP, SPÖ, NEOS und
Grüne. Da frage ich mich halt schon, was das übersetzt heißt, worüber Sie sich da lustig machen. (Zwischenruf der Abg. Steger.) – Es ist nicht weniger als der Grundkonsens, den wir in dieser Zweiten Republik gepflegt haben, der zu all dem Wohlstand und allem, was wir bis heute erreicht haben, geführt hat. Das ist damit gemeint. (Beifall bei der ÖVP.)
Und was ist damit gemeint, wenn man diesen Grundkonsens nicht will? Wenn man sich lustig darüber macht, dass sich Parteien bei Themen überfraktionell einig sind, wenn man sich lustig darüber macht, dass man sich versteht, wenn man sich lustig darüber macht, wenn zwei EU-Abgeordnete unterschiedlicher Fraktionen einander freundlich begrüßen, dann frage ich mich: Was will man damit, was will man damit erreichen, was will man damit aussagen?
Ich muss sagen, die Sorge verstehe ich. Auch wenn man die Institutionen schätzt, auch wenn man sagt, die Europäische Union hat uns viel gebracht – Frieden, Wohlstand und so weiter–: Ich verstehe, dass Leute damit unzufrieden sind, zum Beispiel betreffend EU-Asyl- und Migrationspakt. Das hat zu lange gedauert. Ich bemerke in meinem Bezirk tagtäglich die Folgen davon. Es gibt Probleme, die nicht ausreichend gelöst sind. Da verstehe ich den Ärger. Da muss man nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommen, sondern man muss sagen: Okay, wie lösen wir es? (Abg. Belakowitsch: Na ja, ist ein bissl spät mit der Lösung!)
An diesem Punkt sage ich: Wenn es heißt, die Lösung sei eine Festung Österreich, kann ich sagen, dass das, was hier gezeichnet wird, ein Luftschloss Österreich ist. All die Fluchtbewegungen – Kollegin Rausch hat es gesagt – kommen ja von woher (Abg. Belakowitsch: Alle zu uns! Spannend!); da gibt es internationale Zusammenhänge, da gibt es komplexe Systeme, die ineinandergreifen müssen. Da denke ich mir halt: Minister Schallenberg, der sich mit Außenministern anderer Länder trifft, hat, glaube ich, ein Standing, er kann Dinge vereinbaren. Wenn andere, die keine Konzepte haben, dorthin fahren und irgendwelche Supersprüche, die am Biertisch funktionieren, machen, glaube ich nicht, dass wir zu Ergebnissen und zu Einigungen, die tatsächlich einen Nutzen haben, kommen.
Wenn man sich über den Grundkonsens der Zweiten Republik lustig macht: Was hat er den Leuten gebracht? – Wohlstand. Uns geht wirklich wesentlich besser als den Menschen vor vielen Jahrzehnten. Es geht uns besser. Ich habe die Vermutung, dass die Leute, die jetzt skeptisch sind und sich von solchen Bewegungen verführen lassen, eigentlich ja bewahren wollen, was sie an Wohlstand haben. (Zwischenruf der Abg. Belakowitsch.) Die wollen ja den Wohlstand nicht zerstören, und wir müssen ihnen klarmachen, dass sie dann aber auch nicht Abrissbirnen wählen dürfen, sondern Parteien, die wollen, dass der Wohlstand eben für sie bewahrt bleibt. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Belakowitsch: Also Sie sind nicht die Österreichische Volkspartei ...!)
Das geht nur mit unseren Konzepten, mit seriöser Politik, mit dem Ringen, Mehrheiten zu finden, und nicht damit, sich darüber lustig zu machen, wenn andere Parteien zusammenarbeiten und versuchen, etwas Gutes zu erreichen. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Belakowitsch: Das war alles, was er zu sagen hatte?)
15.11
Präsidentin Doris Bures: Nun hat sich Herr Bundesminister Alexander Schallenberg zu Wort gemeldet. –Bitte, Herr Minister.
Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten Mag. Alexander Schallenberg, LL.M.: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Sehr geehrte Besucher auf der Galerie und Zuseher! Ich hatte an sich nicht vor, das Wort zu ergreifen, aber, ganz offen, da ich hier vorhin von einer Abgeordneten den Vorwurf gehört habe, die österreichische Bundesregierung und ich selber hätten uns nie für einen Waffenstillstand im Nahen Osten eingesetzt, bin ich etwas verwundert, muss ich sagen, und das kann ich nicht schweigend stehen lassen.
Es ist ganz klar – und ich glaube, sinnerfassendes Zuhören ist erwartbar –, dass ich das immer wieder gesagt habe, sei es in Brüssel, in New York oder in Amman, in Ramallah, als ich im Nahen Osten zu Besuch war – ganz im Gegenteil.
Das Narrativ zur damaligen Abstimmung der UN-Generalversammlung, das man hier aufgreift, finde ich auch etwas erstaunlich. Ich habe diesbezüglich immer wieder klargestellt, dass das humanitäre Völkerrecht unverhandelbar ist. Es gilt immer, überall und für jeden; selbstverständlich auch für Israel und selbstverständlich auch im Gazastreifen, und da nehme ich mir kein Blatt vor den Mund. Ich habe das gestern in Ankara genauso wieder festgestellt und bei der Pressekonferenz auch klargestellt. Ich werde nächste Woche in Kairo und Riad sein und auch da Gespräche führen.
Was ich aber bei manchen Redebeiträgen etwas erstaunlich und eigentlich bedrückend finde: Es wird immer wieder unterschlagen, dass der Angriff der Hamas eigentlich nie geendet hat, dass immer noch Raketen fliegen. Es wird eine Täter-Opfer-Umkehr gemacht, indem vergessen wird, warum wir in dieser Lage sind: weil am 7. Oktober letzten Jahres eine Terrororganisation ein mittelalterliches Pogrom veranstaltet hat und über 1 200 Menschen umgebracht hat. Es traf Kinder, Säuglinge, es gab sexuelle Gewalt brutalster Art an Frauen.
Ich finde auch etwas bedrückend, dass in den öffentlichen Stellungnahmen unterschlagen wird, dass immer noch ein österreichischer Staatsbürger unter den Geiseln ist: Tal Shoham, Vater von zwei Kindern. Und ja, das habe ich gestern in Ankara – in einem Staat, der noch Beziehungen mit der Hamas hat – auch besprochen; und ja, wir versuchen, diesen Familienvater wieder rauszubringen. Ich glaube also, man sollte nicht auf einem Auge blind sein. Man sollte sehr vorsichtig sein, nicht in gewisse Narrativfallen hineinzutappen.
Erlauben Sie mir nach diesen vielen Redebeiträgen noch eine ganz grundsätzliche Bemerkung zur Neutralitätspolitik: Abgeordneter Matznetter hat ja ganz zu Recht auf das B-VG, auf die immerwährende Neutralität, Artikel 23j, verwiesen. Es ist aktive Neutralitätspolitik. Ich habe dann aber trotzdem auch von der SPÖ einige Äußerungen vernommen, die mir ein bisschen zu denken gegeben haben; von der FPÖ brauche ich in diesem Zusammenhang gar nicht zu reden. Neutralitätspolitik heißt nicht Gleichgültigkeit. Neutral heißt nicht egal. Das war nie
unsere Linie. (Beifall bei der ÖVP. – Ruf bei der SPÖ: Hat niemand gesagt! – Abg. Bayr: Auf was bezieht sich das?)
Ich sage immer wieder: Wenn Russland die Ukraine überfällt und die Grundprinzipien der UN-Charta, auf die wir uns nach dem Zweiten Weltkrieg geeinigt haben, nämlich insbesondere auch auf das Gewaltverbot, mit Füßen tritt, dann können wir nicht danebenstehen. Da geht es nämlich auch genau um Völkerrecht. (Abg. Bayr: Ach, echt?) Wenn eine Terrororganisation wie die Hamas Israel überfällt und mit – Abgeordneter Engelberg hat es klar gesagt – einer Genozidabsicht Menschen abschlachtet und das auch noch öffentlich sagt, dann können wir nicht danebenstehen. Wir werden aber auch nicht schweigen, wenn Freunde und Partner Völkerrecht verletzen, und das sagen wir auch öffentlich.
Was ich hier aber manchmal spüre – und genau in der Welt, in der wir uns jetzt befinden, mit dieser systemischen Auseinandersetzung, muss man sehr vorsichtig sein –: Bitte hüten wir uns vor einer moralischen Trittbrettfahrerei! Bitte verhalten wir uns als Staat nicht so wie ein Zeuge, der sieht, dass auf der Straße eine Person niedergeschlagen oder ausgeraubt wird oder ihr eine andere Form von Gewalt angetan wird, und dann sagt: Nein, das betrifft mich nicht, da gehe ich lieber weiter, da bin ich lieber neutral! – Das wird uns nicht sicherer machen. Selbstisolierung macht uns nicht sicherer, das ist ein großes Missverständnis der FPÖ. Sich in sein Schneckenhaus zurückzuziehen macht uns nicht sicherer, es wird uns nur verarmen und unsicher machen. – Danke sehr. (Beifall bei der ÖVP sowie der Abgeordneten Disoski, Maurer, Schellhorn und Scherak.)
15.15
Präsidentin Doris Bures: Nun ist Herr Abgeordneter Jörg Leichtfried zu Wort gemeldet. – Bitte. (Abg. Michael Hammer: Jörg Leichtgewicht!)
Abgeordneter Mag. Jörg Leichtfried (SPÖ): Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Sehr geehrte Damen und Herren! Es ist so ein Phänomen, dass es, wenn man Populisten und Populistinnen nicht allzu genau zuhört, manchmal
Sinn macht, was sie sagen. Wenn man aber genauer zuhört, ergeben sich schon erstaunliche Erkenntnisse. Ich habe heute bei Frau Kollegin Fürst und Herrn Kollegen Reifenberger sehr genau zugehört und möchte zu dem, was sie gesagt haben, etwas klarstellen.
Frau Kollegin Fürst hat gesagt, dass der Krieg zwischen Russland und der Ukraine ausgebrochen ist – als ob das so passiert wäre. Es ist aber ganz klar: Der ist nicht einfach ausgebrochen. Es gibt da einen Aggressor und einen Überfallenen. Es gibt einen Angreifer und einen, der sich wehrt. Es gibt einen Täter und ein Opfer. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu einem Kriegsausbruch, geschätzte Damen und Herren. (Beifall bei der SPÖ sowie bei Abgeordneten von ÖVP und Grünen.)
Kollege Reifenberger hat dann sogar noch Sanktionen für die Ukraine eingefordert. Ja soll der, der überfallen wird, dafür auch noch bestraft werden? Ist es das, was die FPÖ möchte, geschätzte Damen und Herren? Das ist nicht Neutralität. Was die FPÖ tut, ist Partei zu ergreifen, auf der Seite des Aggressors, und das ist eindeutig abzulehnen. (Beifall bei SPÖ und ÖVP sowie bei Abgeordneten der Grünen.)
Ich lese Ihnen jetzt Art. I Abs. 1 BVG 1955 in der geltenden Fassung vor: „Zum Zwecke der dauernden Behauptung seiner Unabhängigkeit nach außen und zum Zwecke der Unverletzlichkeit seines Gebietes erklärt Österreich aus freien Stücken seine immerwährende Neutralität.“ – Das ist der erste Satz des Bundesverfassungsgesetzes über unsere Neutralität. (Abg. Belakowitsch: Bitte das dem Bundeskanzler sagen!)
Mit Ihren Reden, mit Ihrem Abstimmungsverhalten, mit Ihren öffentlichen Äußerungen, mit Ihren Plakaten werden Sie der erste Totengräber der österreichischen Neutralität, geschätzte Damen und Herren. Das ist Ihr Vermächtnis aus dieser Zeit. – Danke schön. (Beifall bei der SPÖ. – Abg. Kassegger: So viel Blödsinn! – Abg. Belakowitsch: Zum Glück sehen das die Bürgerinnen und Bürger!)
15.18
Präsidentin Doris Bures: Nun ist Herr Abgeordneter Michael Schnedlitz zu Wort gemeldet. – Bitte. (Oh-Rufe bei der ÖVP. – Abg. Belakowitsch: Ein Raunen geht durch die Reihen!)
Abgeordneter Michael Schnedlitz (FPÖ): Sehr geehrte Damen und Herren! Ich trage ja nur etwas zum Verständnis bei (Ruf bei der ÖVP: Das hast aber noch nie zusammengebracht!), weil ich mir sicher bin, dass die Menschen auf der Galerie längst etwas verstanden haben, was für den Herrn Außenminister neben mir anscheinend zu kompliziert ist. (Neuerliche Zwischenrufe bei der ÖVP.)
Sehr geehrte Damen und Herren, wenn der Herr Außenminister versucht, es einfach zu erklären, wenn er sagt, Neutralität könne nicht bedeuten, dass man weitergeht und wegschaut, wenn sich zwei auf der Straße prügeln: Das machen wir nicht, sehr geehrte Damen und Herren! Das ist auch nicht das, was wir Freiheitliche verlangen. (Abg. Michael Hammer: Ihr prügelt mit! Ihr steigt noch drauf, genau!)
Wir machen aber auch etwas anderes nicht: Wir sind auch nicht – denn das sind auch bei diesem Punkt wieder einmal Sie alle von der Einheitspartei, von der ÖVP, von den Grünen, von den Roten, von den NEOS – der Meinung, dass man hingehen und dem einen ein Messer, eine Waffe in die Hand drücken und ihm Geld hinten reinstecken sollte – im Übrigen das Steuergeld der Menschen hier auf der Galerie –, damit die weiterstreiten und weiter in diesem Konflikt bleiben. Auch das, sehr geehrte Damen und Herren, ist nämlich keine kluge Lösung. (Beifall bei der FPÖ.)
Wir verstehen unter Neutralität etwas anderes. (Abg. Michael Hammer: Eine Rubel-roll-Rede! – Zwischenruf des Abg. Strasser.) Wir verstehen unter Neutralität, dass man zu den Streitenden hingeht und sagt: Stopp, hört auf mit diesem Konflikt! (Zwischenruf des Abg. Scherak.) Wir bieten euch einen Verhandlungstisch an! Kommt an den Verhandlungstisch und versucht so, einen Lösung zu finden!
Jeder, der da auf der Zuschauergalerie sitzt, versteht, dass das auch an Ihrem Beispiel, wenn sich zwei streiten (Abg. Scherak: Ich glaub’, wir schicken den Schnedlitz nach Russland!), die klügste und die logischste Lösung ist. Nur der Außenminister versteht das nicht. (Zwischenruf bei der ÖVP.) Warum verstehen Sie es nicht? – Weil Sie Marionetten der Kriegstreiber sind (Heiterkeit des Bundesministers Schallenberg), weil das nicht in den Plan der Nato passt (Beifall bei der FPÖ), weil das nicht in den Plan der Amerikaner passt und weil Sie weiter die Milliarden an Steuergeld brauchen, damit Sie diesen Abnutzungskrieg befeuern.
Und zahlen? Wer zahlt? – Nicht Sie mit Ihrem fürstlichen Gehalt, sondern wieder die Leute oben auf der Galerie. (Ruf: Wie viel hat der Kickl gekriegt, 25 000? – Abg. Kassegger: ... ihr nicht neutral seid!) Dann gehen Sie noch her und versuchen, die Menschen gleichzeitig für blöd zu verkaufen. (Beifall bei der FPÖ. – Abg. Schellhorn: Ein so ein ausgesprochener Blödsinn!)
Ich sage Ihnen in aller Deutlichkeit: Das werden sich die Menschen von Ihnen nicht gefallen lassen, weil sie die Nase voll davon haben, dass Sie da versuchen, ein A für ein X zu verkaufen und Ähnliches. Die alle müssen dafür bezahlen: für die Sanktionen, für die Kriegstreiberei, nicht nur für die Milliarden Euro, die Sie in die Ukraine schicken, sondern für all das, was ja dann schlussendlich in die Teuerung mündet; das heißt, die Menschen müssen das tagtäglich bezahlen.
Die Menschen haben es verstanden. Sie haben es nicht verstanden, weil Sie es wahrscheinlich nicht verstehen wollen. (Zwischenruf des Abg. Haubner.) Wahrscheinlich braucht es sozusagen umgangssprachlich eine gsunde Wählerwatschen bei den nächsten Wahlen. Vielleicht werden Sie dann klüger und vielleicht hören Sie dann auf mit den Spielchen, die Sie da auf dem Rücken der Bevölkerung austragen. (Beifall bei der FPÖ. – Zwischenrufe bei ÖVP und NEOS.)
15.21
Präsidentin Doris Bures: Für den Ausdruck „Marionetten der Kriegstreiber“ erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf, Herr Abgeordneter Schnedlitz. (Abg. Belakowitsch: Macht nix! Aber stimmen tut’s trotzdem!)
Präsidentin Doris Bures: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet, und daher schließe ich die Debatte.
Wünscht der Berichterstatter ein Schlusswort? (Abg. Leichtfried: Sie hörten den Sprecher Putins!) – Das ist nicht der Fall.
Dann kommen wir jetzt zu einer Reihe von Abstimmungen.
Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag des Außenpolitischen Ausschusses, den vorliegenden Bericht III-1151 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen.
Wer sich dafür ausspricht, den bitte ich um ein zustimmendes Zeichen. – Das ist mit Mehrheit so angenommen.
Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Katharina Kucharowits, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Neutralität sichern, aktive Friedenspolitik betreiben“.
Wer sich dafür ausspricht, den bitte ich um ein Zeichen. – Das ist abgelehnt. Das ist die Minderheit.
Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Petra Steger, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Schaffung der Festung Europa und Beendigung der illegalen Migrationsströme“.
Wer ist dafür? – Das ist die Minderheit, abgelehnt.
Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Douglas Hoyos-Trauttmansdorff, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Vorlage der Österreichischen Sicherheitsstrategie an den Nationalrat“.
Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen. – Das ist die Minderheit, abgelehnt.
Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Henrike Brandstötter, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Vorlage des Entwurfs der Afrikastrategie an den Nationalrat“.
Wer spricht sich dafür aus? – Das ist die Minderheit, abgelehnt.
Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Robert Laimer, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Strengere Exportkontrollen für Kriegswaffen und effektive Reglementierung der Rüstungs-Lobbys“.
Wer ist dafür? (Abg. Herr: Na was jetzt, FPÖ? Doch für die Rüstungslobby?) – Das ist die Minderheit, abgelehnt.
Bericht des Außenpolitischen Ausschusses über den Antrag 4000/A(E) der Abgeordneten Hermann Gahr, Mag. Selma Yildirim, Peter Wurm, Hermann Weratschnig, MBA MSc, Dr. Helmut Brandstätter, Kolleginnen und Kollegen betreffend gegenseitige Anerkennung von Fachhochschulabschlüssen zwischen Österreich und Italien zur weiteren Erleichterung für Studierende (2537 d.B.)
Präsidentin Doris Bures: Damit kommen wir nun zum 3. Punkt unserer heutigen Tagesordnung.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Erster Redner: Herr Abgeordneter Hermann Gahr. – Bitte.
15.24
Abgeordneter Hermann Gahr (ÖVP): Sehr geehrte Frau Präsident! Herr Bundesminister! Geschätzte Damen und Herren! Hohes Haus! Ich darf im Namen der Abgeordneten Irene Neumann-Hartberger die Volkstanzgruppe Payerbach-Reichenau begrüßen und ich darf ganz besonders den Seniorenbund aus Schwaz in Tirol mit Obmann Walter Egger begrüßen. (Beifall bei ÖVP, SPÖ und FPÖ sowie bei Abgeordneten der Grünen.)
Ich bringe folgenden Antrag ein; es geht dabei um die Anerkennung von Fachhochschulabschlüssen zwischen Österreich und Italien zur weiteren Erleichterung für Studierende:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Hermann Gahr, Mag. Selma Yildirim, Peter Wurm, Hermann Weratschnig, MBA MSc, Dr. Helmut Brandstätter, Kolleginnen und Kollegen betreffend „die Bewahrung und Entwicklung der Autonomie Südtirols“
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten, wird ersucht, nach entsprechender Abstimmung mit der Südtiroler Landesregierung diese bei der Wiederherstellung der seit Abgabe der Streitbeilegungserklärung 1992 verloren gegangenen Zuständigkeiten zu unterstützen, sofern diese Kompetenzübertragungen nicht auf Unionsrecht zurückzuführen sind.“
*****
Ich bedanke mich eingangs schon einmal dafür, dass es möglich war, diesen Entschließungsantrag über alle Parteien hinweg einzubringen.
Worum geht es bei diesem Antrag? – Bereits im Pariser Vertrag vom 5. September 1946 wurde vereinbart, dass Österreich und Italien, sage ich, nach einer
leidvollen Geschichte sich gegenseitig bei der Anerkennung von akademischen Titeln unterstützen und sich austauschen. Seit 2009 gibt es ein bilaterales Abkommen zwischen Österreich und Italien, was die Anerkennung von Studientiteln betrifft.
Worum geht es eigentlich? – Es geht eigentlich darum, dass es Erleichterungen gibt, dass wir schneller Studientitel anerkennen können, wenn junge Menschen studieren und ins Berufsleben eintreten. Ich bin vielfach von Südtiroler Studenten darauf angesprochen worden, dass es da Lücken gibt, und diese Lücken betreffen die Fachhochschulen. Mit diesem heutigen Antrag ersuchen wir den Herrn Bundesminister, uns dabei zu unterstützen, dass man auch ausgewählte Fachhochschulstudien anerkennt.
Es gibt ja aktuell in etwa 7 000 Südtiroler und Südtiroler, die in Österreich studieren, die dann wieder nach Südtirol zurückgehen oder sich auch hier weiter beruflich betätigen – und ich glaube, für diese Gruppe schaffen wir damit Erleichterungen und Verbesserungen.
Ich glaube, für die Zukunft geht es einfach auch darum, dass wir die Liste der Anerkennungen ausweiten. Im Jahre 2023 haben wir insgesamt sechs Bachelorstudien, zehn Masterstudien und zehn Master-of-Education-Studien anerkannt. Man sieht also, es wird da aktiv gearbeitet, es wird da zwischen Bildungs-/Wissenschafts- und Außenministerium abgestimmt, dass man Studientitel anerkennt. Es wird im Jahre 2024, Herr Bundesminister, wieder ein Expertenteam zusammentreten, und dabei wird das Thema Fachhochschulabschlüsse besprochen. Unser Ziel und unser Wunsch ist, dass wir diesbezüglich einfach die jungen Menschen unterstützen, dass sie keine komplizierten Verfahren haben und dass sie ihre Studientitel möglichst schnell ins Berufsleben mit einbringen können. – Vielen Dank. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
15.28
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Hermann Gahr, Mag. Selma Yildirim, Peter Wurm, Hermann Weratschnig, MBA MSc, Dr. Helmut Brandstätter, Kolleginnen und Kollegen
betreffend die Bewahrung und Entwicklung der Autonomie Südtirols
eingebracht im Zuge der Debatte in der 262. Sitzung des Nationalrates zu TOP 3 Bericht des Außenpolitischen Ausschusses über den Antrag 4000/A(E) der Abgeordneten Hermann Gahr, Mag. Selma Yildirim, Peter Wurm, Hermann Weratschnig, MBA MSc, Dr. Helmut Brandstätter, Kolleginnen und Kollegen betreffend gegenseitige Anerkennung von Fachhochschulabschlüssen zwischen Österreich und Italien zur weiteren Erleichterung für Studierende (2537 d.B.)
Die Beziehungen zwischen Österreich und Italien mit besonderem Augenmerk auf Südtirol werden auch im Bericht des Außenpolitischen Ausschusses über den Antrag 4000/A(E) der Abgeordneten Hermann Gahr, Mag. Selma Yildirim, Peter Wurm, Hermann Weratschnig, MBA MSc, Dr. Helmut Brandstätter, Kolleginnen und Kollegen betreffend gegenseitige Anerkennung von Fachhochschulabschlüssen zwischen Österreich und Italien zur weiteren Erleichterung für Studierende (2537 d.B.) thematisiert.
Im Jahr 2022 jährte sich das Inkrafttreten des Zweiten Autonomiestatuts zum 50. Mal, mit dem Südtirol zum eigentlichen Träger der Autonomie wurde. Am 20. Jänner 1972 ist dieses Statut in Kraft getreten und sichert seither dem Land weitreichende Gesetzgebungskompetenzen. Das Jahr 1972 ist somit der Beginn einer erfolgreichen Autonomiegeschichte, die nicht selbstverständlich war und bis heute auf europäischer und internationaler Ebene als besonderes Vorzeigemodell im Hinblick auf den Umgang mit Minderheiten gilt.
Am 11. Juni 2022 jährte sich auch der 30. Jahrestag der Streitbeilegung zwischen Österreich und Italien, mit welchem der vor den Vereinten Nationen aufgeworfene Südtirol-Streit formell beendet und die Entwicklung der dynamischen Autonomie in Südtirol vorangetrieben wurde. Wie im jüngsten Bericht des Außenministers an den
österreichischen Nationalrat betreffend die Südtirol Autonomieentwicklung festgehalten, ist und bleibt die Streitbeilegung zwischen der Republik Österreich und der Italienischen Republik in der Südtirol-Frage im Jahr 1992 ein Vorbild für die Lösung von Konflikten im Umgang mit Minderheiten. Die Streitbeilegung ist nunmehr gemeinsames Gut aller drei in Südtirol lebenden Sprachgruppen und eine Gewährleistung für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Südtirols.
Ein Rechtsgutachten von Esther Happacher vom Institut für Italienisches Recht sowie Walter Obwexer vom Institut für Europarecht und Völkerrecht der Universität Innsbruck aus dem Jahr 2017 im Auftrag der Südtiroler Landesregierung analysierte die Entwicklung der Autonomie Südtirols seit der Streitbeilegung 1992. Das Gutachten stellt fest, dass die Entwicklungen der Autonomie Südtirols seit der Streitbeilegung 1992 und der italienischen Verfassungsreform 2001 einerseits positive Erweiterungen der Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenzen Südtirols brachten, andererseits aber auch Verluste von im Autonomiepaket geregelten bzw. zugesicherten Zuständigkeiten zur Folge hatten.
Laut dem aktuellen Regierungsprogramm 2020 ist es „die gemeinsame Verantwortung Österreichs und Italiens, die eigenständige Entwicklung Südtirols zu garantieren und in enger Abstimmung mit den Vertreterinnen und Vertretern der deutsch- und ladinischsprachigen Volksgruppen die Autonomie in Südtirol weiterzuentwickeln“. Dies zeigt, dass der Minderheitenschutz und der Ausbau der Autonomie Südtirols ein wichtiges Anliegen Österreichs ist und versteht sich als Auftrag, dass Österreich seine Schutzfunktion wahrnimmt und die Südtiroler Landesregierung auch künftig dabei unterstützt, die Autonomie zu bewahren und anzupassen.
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten, wird ersucht, nach entsprechender Abstimmung mit der Südtiroler Landesregierung diese bei der Wiederherstellung der seit Abgabe der Streitbeilegungserklärung 1992 verloren gegangenen Zuständigkeiten zu unterstützen, sofern diese Kompetenzübertragungen nicht auf Unionsrecht zurückzuführen sind.“
*****
Präsidentin Doris Bures: Der Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht, steht mit in Verhandlung.
Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Selma Yildirim. – Bitte.
Abgeordnete Mag. Selma Yildirim (SPÖ): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Hohes Haus! Sehr geehrte Damen und Herren! Als Europa im Kleinen wird Südtirol, Tirol, das Trentino immer wieder erwähnt, weil es wirklich vorbildlich ist – nicht nur in Europa, sondern auch weltweit. (Ruf bei der FPÖ: Kriegerisch erobert!) Es ist völkerrechtlich einzigartig, wenn es um den Schutz von Minderheiten geht.
Sehr geehrter Herr Minister! Wir finden es immer wieder sehr aufklärend und interessant, wenn es Austausch zwischen Südtiroler Abgeordneten, Regierungsmitgliedern und Abgeordneten zum italienischen Parlament und dem österreichischen Nationalrat sowie dem Tiroler Landtag gibt. Es ist insofern bedeutsam, als ja diese Geschichte sehr spannend ist, es sich ja im Lichte der Europäischen Union hervorragend entwickelt und die Menschen das auch sehr schätzen.
Das, was mein Vorredner im Hinblick auf die bildungspolitische Entwicklung erwähnt hat, ist in Bezug auf die Regionalität genauso wichtig. Es gibt an der Universität Innsbruck ja wie bereits erwähnt das entsprechende Institut für Italienisches Recht. Die vielen Fachhochschulen, die es hauptsächlich in
Nordtirol gibt und die auch sehr gerne von Studierenden aus Südtirol in Anspruch genommen werden, ermöglichen diesen Menschen nicht nur eine Ausbildung in ihrer Muttersprache.
Diese kann dann, wenn sie nach Südtirol oder in verschiedene andere italienische Regionen zurückkehren wollen, unkompliziert eine Anrechnung finden, aber auch umgekehrt, wenn studierende Personen aus Österreich eine Ausbildung in Anspruch nehmen. Es ist eine Lücke, wenn Fachhochschulabschlüsse da einen sehr individuellen und sehr komplizierten, zeitaufwendigen und kostenaufwendigen Weg gehen.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade in Zeiten, in denen es nicht nur einen Austausch gibt, sondern auch der Fachkräftemangel herrscht und es wichtig wäre, in bestimmten Berufs- und Arbeitsfeldern rasch und unkompliziert zu gegenseitigen Anerkennungen zu kommen. Daher war es für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir diesen Antrag inhaltlich unterstützen und auch im Parlament unsere Zustimmung dazu erteilen werden. – Ich danke. (Beifall bei der SPÖ sowie des Abg. Gahr.)
15.30
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Peter Wurm. – Bitte.
Abgeordneter Peter Wurm (FPÖ): Frau Präsidentin! Herr Minister! Hohes Haus! Werte Zuseher! Der Antrag selber wird von uns auch angenommen, ihm wird zugestimmt. Er ist keine weltbewegende Geschichte, aber es ist eine gute Gelegenheit, heute auch wieder einmal über Südtirol und all das, was Südtirol von diesem Hohen Haus nicht bekommen hat, zu sprechen.
Wir als Freiheitliche kämpfen seit Jahrzehnten für Südtirol. Leider Gottes geht in dieser Angelegenheit nichts weiter. Man hat heute Vormittag sehr viel Verständnis von diesen Parteien hier im Hohen Haus zu allen internationalen
Angelegenheiten gehört, aber das Thema Südtirol, das uns selber als Österreich betrifft, schiebt man lieber zur Seite.
Dieses Selbstbestimmungsrecht, das Sie offensichtlich jedem garantieren wollen und für das Sie auch bereit sind, militärisch einzugreifen oder Geld zu geben, hat man Südtirol nie gewährt, bis heute nicht.
Südtirol ist von Österreich mehr oder weniger kriegerisch abgetrennt worden. Gott sei Dank hat es damals auch Freiheitskämpfer gegeben, die man heute aber auch nicht mehr erwähnen will. Auch die Begnadigung der Südtiroler Freiheitskämpfer steht nach wie vor aus. Der Minister hat das auch nicht zusammengebracht. Das schiebt man zur Seite, weil es offensichtlich ein bisschen peinlich ist. Sonst, bei anderen Ländern dieser Welt, ist man plötzlich für Selbstverteidigung offen, aber die Südtiroler Freiheitskämpfer (Ruf bei den Grünen: Terroristen!) werden unter den Tisch gekehrt, die eigene Geschichte will man nicht wahrhaben.
Auch die Schutzmachtfunktion Österreichs ist nach und nach verloren gegangen. Es ist jetzt sogar so weit, dass die Südtiroler, und zwar auch sogar die Kollegen der ÖVP, die von der SVP in Südtirol, euch von der ÖVP und den Minister auffordern, diese Schutzmachtfunktion bitte wieder aktiv einzubringen. (Heiterkeit des Abg. Schellhorn.)
Zur Sozialdemokratie: Man muss ja sagen, es hat ganz tolle Sozialdemokraten, wie einen Bruno Kreisky, gegeben. Da ist ja bei der Sozialdemokratie nichts mehr von diesem Verständnis, das ein Kreisky als Sozialdemokrat für Südtirol und die Geschichte Österreichs gehabt hat, übrig geblieben. Das heißt, da ist ganz, ganz viel verschwunden.
Auch diese berühmte Autonomie, von der Sie immer reden, die wie gesagt in erster Linie durch einen zivilen Widerstand der Bevölkerung in Südtirol erreicht wurde, hat sich sukzessive um die Hälfte reduziert. Auch da will die Südtiroler
Bevölkerung unsere Hilfestellung, dass wir hier im Parlament diese Autonomierechte wieder in Kraft setzen. Das können Sie alles nachlesen. (Abg. Schellhorn: Wo?)
Was wir seit Jahren fordern, ist die Doppelstaatsbürgerschaftsmöglichkeit für Südtiroler. Wir haben sie den Nachkommen der israelischen Gemeinde in Österreich natürlich ermöglicht, aber den Südtirolern haben wir sie nicht ermöglicht (Zwischenruf der Abg. Blimlinger), weil Sie Angst davor haben, dass vielleicht doch wesentlich mehr Südtiroler diese Doppelstaatsbürgerschaft in Anspruch nehmen, als Sie selber glauben. (Neuerlicher Zwischenruf der Abg. Blimlinger.)
Es gibt einige kleinere Dinge, die man noch weiterbringen sollte. Ein Thema betrifft zum Beispiel die Schützen. Es ist nach wie vor nicht möglich, als Nordtiroler Schütze mit der Waffe nach Südtirol zu fahren. Auch diese Kleinigkeit scheitert am Widerstand - - (Heiterkeit bei Abgeordneten der Grünen.) – Ja, Sie lachen darüber. Dass Sie das nicht verstehen, ist mir schon klar. Bei der ÖVP sollte es aber ein paar geben, die das Traditionswesen in Tirol noch verstehen und unterstützen. Wir verstehen es, wir unterstützen es und werden das auch weiterhin machen.
Wie gesagt: In diesem Südtirolausschuss ist in den letzten Jahren überhaupt nichts Konkretes zum Schutz der Südtiroler passiert. Man will das eben nicht wirklich öffentlich groß breittreten. (Präsident Sobotka übernimmt den Vorsitz.)
Was mich emotional jetzt seit vielen, vielen Jahren wirklich erschüttert – und ich habe es Minister Schallenberg persönlich gesagt; ich habe es auch Kanzler Nehammer und anderen, auch dem Innenminister, gesagt –, ist die Geschichte mit Frau Orian. Sie sollte mittlerweile jedem hier im Haus bekannt sein: eine 105-jährige Altösterreicherin, die den letzten Herzenswunsch hat, als österreichische Staatsbürgerin zu sterben und begraben zu werden.
Ich glaube, seit fünf Jahren kämpfen einige Personen in Südtirol und in Nordtirol dafür. Wir haben den Bundeskanzler, den Außenminister auf Knien darum gebeten. Man wird hin- und hergeschickt. Man will einfach, dass diese Frau stirbt, bevor Sie es entscheiden müssen.
Ich finde – und das sage ich Ihnen ganz deutlich, Herr Minister, auch heute noch einmal hier im Plenum –, Sie selbst in Ihrer Geschichte sollten sich wirklich in Grund und Boden genieren, wenn Sie es nicht zusammenbringen, einer anständigen Frau von 105 Jahren ihren letzten Lebenswunsch zu erfüllen.
Ich brauche Ihnen nicht die Beispiele aufzuzählen, wer aller in Österreich eine Doppelstaatsbürgerschaft bekommen hat. Es gibt auch einige mit Russlandbezug, das scheint keinen zu stören, aber eine Altösterreicherin, die als Katakombenlehrerin auch für Südtirol extrem viel getan hat, lässt man im Regen stehen. Ich finde das schlichtweg unter jeder Kritik, um nicht zu sagen, was ich nicht sagen darf.
Also ich geniere mich in Wahrheit wirklich für diese Bundesregierung. Ich geniere mich auch, Herr Minister, für Sie. Es wäre ein Leichtes gewesen, das im Ministerrat durchzubringen, dann bräuchte man nicht fünf Jahre darüber zu diskutieren. Es ist eine Schande für Österreich!
Ich versuche es noch einmal hier im Plenum. Ich bringe einen Entschließungsantrag ein:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft an Hermine Orian“
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, der letzten Katakombenlehrerin Südtirols und Tiroler-Freiheitskämpferin Hermine Orian ihren sehnlichsten Wunsch zu erfüllen und ihr die österreichische Staatsbürgerschaft zu verleihen.“
*****
Ich hoffe, Sie, liebe Kollegen von allen Fraktionen, haben so viel Emotion und so viel Herz, da zuzustimmen.
Das, glaube ich, müssen Sie mit Ihrem eigenen Gewissen ausmachen, ob Sie dieser 105-jährigen Frau wirklich allen Ernstes diese Doppelstaatsbürgerschaftsmöglichkeit verwehren wollen. Das ist eine Gewissensfrage, die Sie selber entscheiden können.
Als Erinnerung – ich glaube, viele haben es vergessen –: Sie alle hier sind – ich auch – nämlich nur darauf angelobt, nach dem eigenen Gewissen zu entscheiden. Sie müssen nur Ihrem Gewissen folgen. (Abg. Hörl: Habt ihr überhaupt eines?) Deshalb bitte ich Sie letztmalig, bevor die Frau gestorben ist, ihr diesen Herzenswunsch bitte zu erfüllen. Ich bitte um breite Zustimmung, damit diese Frau endlich ihren Herzenswunsch erfüllt bekommt. – Danke. (Beifall bei der FPÖ.)
15.37
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
des Abgeordneten Peter Wurm
und weiterer Abgeordneter
betreffend Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft an Hermine Orian
eingebracht in der 262. Sitzung des Nationalrates, XXVII. GP, am 15. Mai 2024 im Zuge der Debatte zu TOP 3, Bericht des Außenpolitischen Ausschusses über den Antrag 4000/A(E) der Abgeordneten Hermann Gahr, Mag. Selma Yildirim, Peter Wurm, Hermann Weratschnig, MBA MSc, Dr. Helmut Brandstätter, Kolleginnen und Kollegen betreffend gegenseitige Anerkennung von Fachhochschulabschlüssen
zwischen Österreich und Italien zur weiteren Erleichterung für Studierende (2537 d.B.)
Hermine Orian ist eine verdiente Tirolerin und Österreicherin, die dem Faschismus getrotzt und unter großem persönlichem Risiko dazu beigetragen hat, die deutsche Sprache und Kultur im südlichen Tirol zu erhalten. Ihr ganzes Leben hat Frau Orian – als Österreicherin geboren und mittlerweile 105 Jahre alt – dem Kampf für die Rechte der Südtiroler sowie dem Erhalt der kulturellen Identität Südtirols gewidmet. Als eine der letzten Überlebenden und Zeugin des Südtiroler Freiheitskampfes ist ihr Engagement und ihre Entschlossenheit für die Sache bemerkenswert. Ihr Antrag auf die österreichische Staatsbürgerschaft erfolgte aus tief verwurzelter Verbundenheit zu Österreich und hätte als Anerkennung für ihre jahrzehntelange Unterstützung der Südtiroler Autonomiebewegung gewährt werden sollen. Denn die letzte Katakombenlehrerin Südtirols hat nur noch einen frommen Wunsch:
Ich wurde als Österreicherin geboren und will als Österreicherin sterben.
Obwohl dieser Antrag schon vor langer Zeit gestellt wurde, hat die schwarz-grüne Bundesregierung es versäumt, angemessen zu reagieren. Vielmehr steht die bisherige Nicht-Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft an Frau Orian sinnbildlich für die langanhaltende Untätigkeit der schwarz-grünen Bundesregierung, wenn es um die Anliegen und Bedürfnisse der Südtiroler Bevölkerung geht. Die „Kronen Zeitung“ hält hierzu fest:
Die Republik Österreich versagt wieder einmal als Schutzmacht von Südtirol. Der österreichische Pass für eine 105-jährige Katakombenlehrerin rückt in weite Ferne, der Politik fehlt der Wille. Aber rechtlich sei vieles möglich. […] Die Verfassung sieht die Verleihung der Staatsbürgerschaft auch vor, wenn die Bundesregierung bestätigt, dass die Verleihung wegen der vom Fremden bereits erbrachten und von ihm noch zu erwartenden außerordentlichen Leistungen im besonderen Interesse der Republik Österreich liegt.1
Während andere Personen, wie beispielsweise ein 35-jähriger Fußballer, unter diesen Voraussetzungen kinderleicht die Staatsbürgerschaft erworben haben, blockiert die schwarz-grüne Bundesregierung den sehnlichsten Wunsch einer gebürtigen Österreicherin und Tiroler-Freiheitskämpferin.
Es ist an der Zeit, dass die Bundesregierung handelt und zeigt, dass sie die Verdienste einer außergewöhnlichen Südtirolerin zu schätzen weiß – und ihr mit gebotener Wertschätzung die österreichische Staatsbürgerschaft verleiht.
In diesem Zusammenhang stellen die unterfertigten Abgeordneten nachstehenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, der letzten Katakombenlehrerin Südtirols und Tiroler-Freiheitskämpferin Hermine Orian ihren sehnlichsten Wunsch zu erfüllen und ihr die österreichische Staatsbürgerschaft zu verleihen.“
1 https://www.krone.at/3371088
*****
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Angelobt sind wir auf unsere Verfassung, nicht auf das Gewissen – das will ich einmal klarstellen. (Abg. Wurm: Und Gewissen! Und Gewissen, Herr Präsident! Verfassung und Gewissen! – Abg. Michael Hammer: Das ist aber bei euch überhaupt nicht vorhanden!)
Der Entschließungsantrag ist ausreichend unterstützt und steht mit in Verhandlung, wenngleich wir – auch in Abstimmung mit Kollegin Bures – das auch in der Präsidiale diskutieren, weil der Zusammenhang ja kaum noch herstellbar ist. (Beifall bei Abgeordneten von ÖVP und Grünen.)
Als Nächster ist Abgeordneter Weratschnig zu Wort gemeldet. – Bitte.
15.38
Abgeordneter Hermann Weratschnig, MBA MSc (Grüne): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Minister! Werte Abgeordnete! Insbesondere möchte ich natürlich auch, sollte er noch da sein, meinen Gemeinderatskollegen aus Schwaz, Walter Egger, herzlich begrüßen! Kollege Wurm hat jetzt viel geredet, aber nicht über die zwei wesentlichen Punkte, die eigentlich auf der Tagesordnung stehen, nämlich – das Wichtigste – die Südtiroler Autonomie und deren Ausgestaltung und – ein wichtiger Punkt heute – die Anerkennung von Studienabschlüssen, von Fachhochschulabschlüssen, zwischen Italien und Österreich. Das hilft konkret den Leuten, das hilft den Studierenden. Das ist das Wesentliche, das wir heute verhandeln.
Es wurde schon von Kollegen Gahr darauf hingewiesen: Es gibt den Pariser Vertrag aus 1946. Da gibt es auch eine Vereinbarung, was die Anerkennung betrifft. Es gibt auch ein bilaterales Abkommen aus dem Jahr 2009, diese Bestrebungen weiterzuentwickeln, und es gibt eine Kommission, die alle paar Jahre tagt, die sich um genau diese Geschichte kümmert, nämlich um die Anerkennung von Abschlüssen. Oftmals sind das sehr komplizierte Nostrifizierungsverfahren. Wir erleichtern das mit diesem Antrag, wir ermöglichen.
Dazu gibt es Expert:innen, die sich genau anschauen, welche Abschlüsse laut dieser Kommission auf diese Liste kommen.
Das letzte Mal, 2022, waren es 26 Abschlüsse. Man muss sich vorstellen, in Tirol gibt es circa 260 Bachelorstudiengänge, die man absolvieren kann. Es ist also ein ganz wichtiger Schritt, dass wir mit diesem Antrag die zuständigen Minister mit dem klaren parlamentarischen Auftrag auf den Weg schicken, bei dieser Kommission das Thema immer mitzunehmen und die Anerkennung wichtiger Fachhochschulabschlüsse zu erweitern und zu erleichtern. Italien kennt ja an und für sich das System der Fachhochschulen nicht, deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man auch adäquate Möglichkeiten schafft.
Das Zweite ist das Thema Südtiroler Autonomie. Ich glaube, das ist eine Grundlage, das ist ein Grundpfeiler für Südtirol, das ist ein Grundpfeiler für die Zusammenarbeit von Österreich und Italien, Österreich und Südtirol, Tirol in der Europaregion. Es hat sich bewahrheitet, dass es viele Dinge gibt, die, glaube ich, in den letzten Jahren sehr gut gelaufen sind. Es wird in Zukunft Anstrengungen brauchen, genau diese Kompetenzverschiebungen, die es durch eine italienische Verfassungsreform 2001 gegeben hat, wieder weiterzuentwickeln, diese Verluste wieder aufzuzeigen und auf jeden Fall nach Südtirol zurückzubringen.
Es geht also darum, verlorene Rechte wieder herzustellen, natürlich im Rahmen der ausgestalteten Südtiroler Autonomie, aber auch auf Grundlage der Streitbeilegung 1992. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Stütze, es ist Ausdruck einer Selbstbestimmung, es ist Ausdruck unterschiedlicher, diverser Sprachkulturen und es ist vor allem Ausdruck eines funktionierenden Bildungssystems, das zwischen den Regionen in der Europaregion Tirol gelebt wird. (Beifall bei den Grünen.)
Mir fehlen von den Freiheitlichen genau jene Vorschläge, wie wir diese Europaregion Tirol weiterentwickeln. Ihr seid in der Vergangenheit gelandet und verharrt auch dort, aber wie wir das auf der Grundlage von europäischen Rechten, auf der Grundlage dieser Autonomie, auf der Grundlage der aktiven Arbeit in den Landtagen weiterentwickeln, dazu höre ich zu wenig. (Abg. Wurm: Wiedervereinigung!) Da gibt es viel Gestaltungsspielraum, da seid ihr gefragt. Geht mit, macht Vorschläge, und dann diskutieren wir darüber, statt in der Vergangenheit herumzujagen – ob mit Waffen oder ohne Waffen sei jetzt einmal dahingestellt.
Das muss ich auch noch sagen: Alle Schützen kommen nach Südtirol und zurück kommen sie auch wieder. (Abg. Wurm: Ohne Waffen! Ohne Waffen!) Es gibt also auch bei den Brauchtumsvereinen kein Problem, dass dieser Austausch nicht passiert. Der Austausch funktioniert, er wird gelebt. Ich wünsche dir, Herr Kollege, dass du diesen Austausch auch mitleben kannst.
Auf jeden Fall ist das ein guter Antrag: dass wir gerade für die Studierenden etwas tun und das vor allem auch für die Südtiroler Autonomie auch weiterentwickeln. – Danke. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
15.43
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Künsberg Sarre. – Bitte.
Abgeordnete Mag. Martina Künsberg Sarre (NEOS): Herr Präsident! Herr Minister! Es ist sehr erfreulich, dass wir einmal einen einstimmigen Beschluss im Bildungsbereich, im Wissenschaftsbereich haben. Es ist aus unserer Sicht ein sehr sinnvoller Antrag, den wir selbstverständlich unterstützen.
Die gegenseitige Anerkennung von Studienabschlüssen hat ja eine sehr lange Tradition. Für die Südtiroler Studierenden wird es leichter, in Österreich zu studieren, aber natürlich fördert es auch die gesamte Mobilität zwischen österreichischen und italienischen Studierenden.
Was wir aber besonders erfreulich finden, ist, dass wir das als einen Baustein für die Forderung sehen, die wir zur fünften Säule im europäischen Binnenmarkt gemacht haben, nämlich die europäische Bildungsfreizügigkeit als Grundfreiheit in der EU zu verankern.
Warum? – Weil grenzenlose Bildung selbstverständlich sein muss, Bildung ohne Grenzen, damit junge Leute, egal wo sie leben oder herkommen, überall in Europa in die Schule gehen können, studieren oder eine Ausbildung machen können. Das muss zur Normalität werden, denn Bildung ist ein Brückenbauer. Bildung ist wichtig für das Verständnis innerhalb und zwischen den Völkern. Wir sind jetzt schon von Konflikten, Krisen und Kriegen umgeben, und die EU ist das größte Friedensprojekt, das es jemals gegeben hat. Das müssen wir stärken, wir müssen die EU stärker machen.
Wenn wir ein starkes, demokratisches und geeintes Europa haben wollen, dann liegt für uns alle, aber insbesondere für unsere Kinder und Jugendlichen, die Zukunft in der Europäischen Union. (Beifall bei den NEOS.)
Bildung, Mobilität, der gegenseitige Austausch und das gegenseitige Akzeptieren, dass es selbstverständlich auch Unterschiede geben kann und gibt, sind ganz, ganz wichtig, viel wichtiger, als es noch vor ein paar Monaten gewesen ist. Deswegen freuen wir uns, Herr Minister, wenn Sie auch hier Initiativen setzen, dass die fünfte Grundfreiheit, nämlich Bildungsfreizügigkeit, möglichst rasch umgesetzt wird. (Beifall bei den NEOS.)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet.
Wünscht der Herr Berichterstatter ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall.
Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über die dem Ausschussbericht 2537 der Beilagen angeschlossene Entschließung betreffend „gegenseitige Anerkennung von Fachhochschulabschlüssen zwischen Österreich und Italien zur weiteren Erleichterung für Studierende“.
Wer dafür ist, den darf ich um ein dementsprechendes Zeichen bitten. – Danke, das ist einstimmig angenommen. (369/E)
Wir kommen nun zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Hermann Gahr, Mag. Selma Yildirim, Peter Wurm, Hermann Weratschnig, MBA, MSc und Dr. Helmut Brandstätter, Kolleginnen und Kollegen betreffend „die Bewahrung und Entwicklung der Autonomie Südtirols“.
Wer dafür ist, wird um ein Zeichen gebeten. – Das ist ebenfalls einstimmig angenommen. (370/E)
Wir kommen nun zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft an Hermine Orian“.
Wer dafür ist, bitte ich um ein Zeichen. – Das ist die Minderheit. Der Antrag ist daher abgelehnt. (Zwischenrufe bei FPÖ und ÖVP. – Präsident Sobotka gibt das Glockenzeichen.)
Bericht des Umweltausschusses über den Antrag 4001/A der Abgeordneten Johannes Schmuckenschlager, Dr. Astrid Rössler, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Emissionsgesetz-Luft 2018 geändert wird (2538 d.B.)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Wir kommen zum 4. Tagesordnungspunkt.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet. (Unruhe im Saal.) – Ich würde um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bitten. Man kann ja die Gespräche, die unbedingt notwendig sind, nach draußen legen. Hier herinnen sollte man dem Redner zuhören.
Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Keck. – Bitte.
Abgeordneter Dietmar Keck (SPÖ): Herr Präsident! Frau Bundesminister! Wir beschließen jetzt das Bundesgesetz, mit dem das Emissionsgesetz-Luft 2018 geändert wird. Was wird in diesem Gesetz geändert, meine Damen und Herren? – Zuständig für die Überwachung dieses Gesetzes und die Durchsetzung dieses Gesetzes ist zukünftig die Bezirkshauptmannschaft oder die Bezirksverwaltungsbehörde.
Wenn das kommt, stellen sich für uns natürlich viele, viele Fragen, wie zum Beispiel: Wer hat dieses Gesetz bis jetzt kontrolliert? Wer hat bis jetzt die Kontrollen gemacht? Das Emissionsgesetz-Luft ist ja 2018 beschlossen worden. Wer hat bis jetzt die Kontrollen gemacht? Darauf haben wir noch keine Antworten erhalten.
Wenn zukünftig die BH für die Überwachung zuständig ist: Steht dafür auch genügend Personal zur Verfügung? Wir wissen, dass die BHs personell unterbesetzt sind. Wenn jetzt wieder ein Aufgabenbereich dazukommt: Steht genügend Personal zur Verfügung, damit man die Überwachung wirklich so machen kann, wie es im Gesetz steht? Wie hoch soll auch die geplante Kontrolldichte sein? Wir wissen ja nicht, wie kontrolliert wird.
Dazu bringe ich auch ein Beispiel – denn die Kontrolle soll angemeldet werden, und das ist für mich wirklich die Farce bei diesem Gesetz –, da denke ich an die Lebensmittelkontrolleure: Wenn ein Lebensmittelkontrolleur etwas kontrollieren muss, ruft er, wenn es nach diesem Gesetz geht, drei Tage davor in dem Betrieb an und sagt: In drei Tagen komme ich kontrollieren. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. – Und wenn er nach drei Tagen kommt, ist natürlich alles in Ordnung, weil die alles wegbringen. Wenn wir ein Gesetz machen und wollen, dass es eingehalten wird, dass die Menschen, die etwas zu verantworten haben, das auch machen, dann macht es ja überhaupt keinen Sinn, diese Tage davor zu verständigen, dass eine Kontrolle kommt, damit sie das Ganze in Ordnung halten. (Zwischenruf des Abg. Höfinger.) Ich glaube nicht, dass das in Ordnung ist, dass die Bevölkerung Österreichs das so will.
Zusätzlich, wenn man sich das anschaut: Wir haben ein Vertragsverletzungsverfahren bezüglich der Ammoniakgrenzwerte; Sie wissen das, Frau Minister. Es gibt auch die Ammoniakreduktionsverordnung, die vorsieht, dass Gülle, Jauche et cetera spätestens 4 Stunden nach der Ausbringung einzuarbeiten sind. Jetzt komme ich wieder auf die Kontrollen zurück: Na, wenn der erfährt, dass eine Kontrolle kommt – weil sie angemeldet ist! –, dann kann er die noch ganz gach einarbeiten. (Abg. Höfinger: Dann ist es eh erledigt!) Wenn die Kontrolle nicht angemeldet ist, dann tut er nichts.
Ich frage: Wofür beschließen wir denn ein Gesetz, wenn die verständigt werden, dass sie kontrolliert werden, wenn sie irgendetwas gemacht haben, was dem Gesetz nicht entspricht? Das sind auch die Gründe, die ich jetzt genannt habe, wieso wir diesem Gesetz nicht zustimmen.
Wie wir gehört haben, kommt aber auch noch ein Entschließungsantrag bezüglich Transit in Tirol, den wir für sehr vernünftig halten, dem wir auch zustimmen werden.
Wie gesagt: Die Fragen, die ich hier gestellt habe, habe ich Ihnen auch im Ausschuss gestellt, aber keine Antworten erhalten. Ich hoffe, ich bekomme die Antworten heute. (Beifall bei der SPÖ.)
15.50
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Rössler. – Bitte.
Abgeordnete Dr. Astrid Rössler (Grüne): Herr Präsident! Sehr geschätzte Frau Bundesministerin! Hohes Haus! Geschätzte Besucherinnen und Besucher! Das Emissionsgesetz-Luft, von dem wir gerade reden, hat die Reduktion von Luftschadstoffen zum Ziel. Es dient damit dem Schutz von Mensch und Natur, denn nur in einer intakten Natur kann der Mensch gesund leben.
Saubere Luft, klares Wasser, gesunde Böden sind unsere Lebensgrundlagen, die wir nicht weiter übernutzen, ausbeuten oder gar zerstören dürfen. Die heutige Novelle zum Emissionsgesetz-Luft enthält zwei wichtige Änderungen: Zum einen wird ein direkter Bezug zur EU-Richtlinie verankert, der die nationalen Höchstmengen genau dieser Luftschadstoffe regelt, zum anderen – es ist angesprochen worden – wird jetzt eine gesetzliche Grundlage geschaffen, damit die Bezirksverwaltungsbehörden konkrete Kontrolltätigkeiten ausüben können.
Ich möchte bezogen auf meinen Vorredner, der diese Regelung kritisiert hat, erwähnen: Das ist ein ganz üblicher Vorgang, dass Kontrollen – außer bei Gefahr in Verzug – bei Betrieben vorab angekündigt werden. Das ist daher keine Sonderregelung, sondern entspricht der Praxis.
Das Emissionsgesetz-Luft ist vor allem ein weiteres Beispiel dafür, wie enorm wichtig eine gemeinsame europäische Umweltpolitik ist. Gerade Luftschadstoffe
sind grenzüberschreitend, umso wichtiger ist da natürlich auch eine gemeinsame europäische Regelung. Es ist ein Beispiel dafür, dass Umwelt und Gesundheit nur gemeinsam gedacht werden können, denn die Auswirkungen auf die Umwelt haben sehr oft auch schädliche Auswirkungen auf den Menschen.
Es geht konkret um die im Wesentlichen bekannten Schadstoffe Schwefeldioxid, Stickoxide, Ammoniak, Feinstaub und flüchtige organische Verbindungen. Welche Auswirkungen die Luftschadstoffe auf die menschliche Gesundheit und auf Ökosysteme haben, will ich nur kurz am Beispiel der Stickoxide skizzieren. Stickstoffdioxid, NO2, ist ein ätzendes Reizgas, es schädigt unmittelbar die Schleimhaut, das Gewebe im gesamten Atemtrakt und kann auch die Augen reizen. Die unmittelbare Wirkung sind Entzündungsreaktionen, in der Folge gibt es auch Akuteffekte – Atemnot, Husten, Bronchitis – und bei häufigerem Auftreten führt dies zu chronischen Atemwegserkrankungen, Lungenerkrankungen bis hin zur Lungenfunktionsminderung.
Warum erkläre ich das so ausführlich? – Das sind genau die Auswirkungen, an denen vulnerable Bevölkerungsgruppen – Kinder, deren Atemwege noch im Wachstum sind; Menschen, mit einer Disposition zu diesen Erkrankungen; ältere und belastete Menschen – leiden. Eine dauerhafte Luftschadstoffexposition ist der Grund für schwerwiegende chronische Erkrankungen.
Die mittelbaren Auswirkungen dieses Luftschadstoffs Stickstoffdioxid: Es ist Vorläufersubstanz von bodennahem Ozon, ebenfalls ein Reizgas und gesundheitsschädigend, aber auch eine Vorläufersubstanz von Feinstaub, auch da ist wiederum ein unmittelbarer Einfluss an der Entstehung von Atemwegserkrankungen bei Menschen markant feststellbar, es ist ein Schadstoff hinsichtlich der Pflanzen, mit schädlicher Auswirkung vor allem auf Blätter, vorzeitiges Altern und Kümmerwuchs bei Pflanzen, Überdüngung und Übersäuerung. Es gibt also vielfache Auswirkungen auf Mensch und Ökosysteme.
An diesem Beispiel zeigt sich auch, dass Wohlergehen von Mensch und Natur nur gemeinsam gedacht werden kann. Wem Umwelt und Natur egal sind, dem sind auch der Mensch und die Gesundheit der künftigen Generationen egal. Man kann es nur gemeinsam denken. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.) Es ist daher auch kurzsichtig, gerade jetzt auf europäischer Ebene das wichtige Renaturierungsgesetz nicht mit aller Kraft gemeinsam zu unterstützen.
Ich möchte von hier aus meinen Appell an alle neun Landeshauptleute von ÖVP und SPÖ richten: Bitte überdenken Sie Ihre Blockade und machen Sie den Weg frei, dass Österreich das wichtige Renaturierungsgesetz beschließen kann, dass Österreich mit dabei ist! Machen Sie den Weg frei für eine bessere Zukunft der nächsten Generationen! (Beifall bei den Grünen.)
15.54
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Schmuckenschlager. – Bitte.
Abgeordneter Johannes Schmuckenschlager (ÖVP): Herr Präsident! Geschätzte Frau Bundesministerin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Hohes Haus! Ich glaube, Luftschadstoffe, Emissionen sind ein ganz schwerwiegendes Thema in unserer hoch entwickelten, industrialisierten Gesellschaft. Wir haben schon vieles zeigen können, das Verbesserungen gebracht hat, wofür wir als Politik Rahmenbedingungen geschaffen haben und letztendlich mit der Durchführung und Ausführung ein Mehrwert für die Gesellschaft geschaffen wurde.
Ich möchte hier nur kurz auf das historische Thema FCKW eingehen: Da wurde doch gezeigt, welcher positive Effekt durch das Zurückdrängen der Anwendung dieses Treibgases erreicht wurde. Es gilt, diese Wege weiterzugehen und weiterzuentwickeln.
Ich glaube, wir haben gerade heute mit dieser Gesetzesmaterie eine gute Möglichkeit dazu. Einerseits ist die Ministerin ermächtigt, wenn wir
Schadstoffkriterien nicht einhalten, durch Verordnungen weitere Vorgaben zu setzen, auf der anderen Seite gibt es aber die Möglichkeit, über die Kontrolle durch die Bezirksverwaltungsbehörden zu schauen, wo wir Kontrolle halten können und wo wir diese Verbesserungen dann letztendlich auch umsetzen können.
Die Emittenten sind umfangreich, es betrifft verschiedenste Bereiche – ob es die produzierende Wirtschaft oder der Verkehr ist. Die Frage ist, ob es da und dort andere Möglichkeiten gibt. Selbst beim Hausbrand müssen wir – wenn wir uns die Heizungen, die Wärmequellen in den Haushalten ansehen – erkennen, dass wir dort Themen haben.
Selbst dort haben wir es aber auch geschafft, uns mit einer besseren Technologie bei Heizungen von den Verbrennungsöfen, von den Heizkesseln weiterzuentwickeln und vor allem in besonders gefährdeten Gebieten, die in Inversionslagen liegen – wie zum Beispiel die Stadt Graz –, Luftqualitätsverbesserungen durchzuführen.
Wesentlich in der Frage Transit ist, dass nicht die Menschen in unserer Bevölkerung die Leidtragenden der Emissionen, die wir uns letztendlich durch Verkehr einbringen, sind. Darum gibt es heute diesen weiteren Antrag, der dazukommen wird, damit wir wirklich auf die Gesundheit unserer Bevölkerung achtgeben und uns da auch weiterentwickeln.
Das ist keine Stopptaste, das heißt für die Wirtschaft auch nicht zurück, sondern das heißt gemeinsam einen Weg weiterzuentwickeln, den wir in Österreich Gott sei Dank bereits sehr, sehr gut und erfolgreich beschreiten konnten. (Beifall bei Abgeordneten der ÖVP.)
Ich möchte auch kurz auf das Renaturierungsgesetz der Europäischen Union eingehen: Ich bin der absoluten Überzeugung, dass wir diese gemeinsame Entwicklung – gerade was Umweltthemen, Klimathemen betrifft – auf europäischer Ebene brauchen. Ich bin auch der Überzeugung, dass die Idee
innerhalb der Europäischen Kommission, die Wege zu mehr Umweltschutz, zu mehr Klimaschutz zu gehen, die absolut richtige ist.
Nur: Genau dort, wo wir seitens der ÖVP sagen, mit diesem Renaturierungsgesetz können wir in der Anwendung nicht entsprechend umgehen – es ist uns sozusagen nicht möglich, das praktisch umzusetzen –, dürfen wir dann die Diskussion beginnen. Daher gibt es diese Blockade der Bundesländer, die letztendlich für die Durchführung verantwortlich sind.
Ich glaube, etwas ganz Wesentliches hat die ÖVP bei der Europawahl mit einem Slogan auch ganz klar auf den Punkt gebracht: „Europa besser machen“. Also die Frage der Zielrichtung ist eine absolut richtige: diese Wege gemeinsam zu gehen, aber in einer Form, die wir auch entsprechend umsetzen können. Wir sehen, dass momentan in mehreren Gesetzesmaterien die Umsetzung, die Praxistauglichkeit nicht immer gegeben ist – und damit blockieren wir uns natürlich.
Das heißt, wenn wir die eine oder andere Ambition etwas zurücknehmen, können wir die Gesellschaft mitnehmen und haben einen erfolgreichen Weg für Umwelt- und Klimaschutz in Europa und letztendlich für Umwelt- und Klimaschutz in Österreich und für unsere Bevölkerung. (Beifall bei Abgeordneten der ÖVP.)
15.59
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Bernhard. – Bitte sehr.
Abgeordneter Michael Bernhard (NEOS): Herr Präsident! Geschätzte Frau Ministerin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Wir sprechen über das Emissionsgesetz-Luft, und ich finde den Tagesordnungspunkt aus einem wesentlichen Grund sehr spannend.
Aktuell diskutieren wir ja sehr viel über Europa, über die Europäische Union und die Frage, wo Europa einen positiven Beitrag leisten kann. Dieses Gesetz ist ein
sehr schönes Beispiel dafür. Wir haben nämlich als Republik Österreich durch den Eintritt in die Europäische Union auch gelernt, gemeinsame europäische Standards zu setzen, zu verfolgen und zu erreichen. Gerade in der Umweltpolitik ist in Wirklichkeit wahnsinnig viel passiert, und das wird oft vergessen.
Im Diskurs heute, wenn man über die Klimapolitik und über Biodiversität spricht, hat man den Eindruck, dass sich alles immer nur verschlechtert. Dabei gibt es zwar natürlich viele Krisen, die wir erst meistern müssen, aber es gibt auch Krisen, die wir schon ein Stück weit gemeistert haben.
Wir sehen, da wir ja auch den Bericht gesehen haben, wie sich die einzelnen Schadstoffwerte verändert haben, und dass uns da auch schon sehr viel gelungen ist – nämlich dank der Europäischen Union, nicht weil wir als Österreich allein so großartige Ziele verfolgt haben.
Beispielsweise beim Schwefeldioxid ist es so, dass zwischen 1990 und 2022 die Emissionen um 85 Prozent reduziert wurden; die Emissionen von Stickstoffoxiden sind im gleichen Zeitraum um 47 Prozent weniger geworden, solche von flüchtigen organischen Verbindungen sind um 70 Prozent weniger geworden; und – das ist jetzt der letzte Punkt – selbst bei Ammoniak sind die Emissionen im gleichen Zeitraum um einige Prozentpunkte weniger geworden.
Wenn man nicht nur an der Oberfläche bleibt, sondern sich das im Detail anschaut und fragt: Wie ist denn das gelungen, dass wir diese Emissionen reduziert haben?, dann muss man feststellen: Es war nie ein Entweder-oder – entweder gehen alle auf die Regulierung oder alle setzen auf Technik und Technologie –, es war immer beides gemeinsam. Es war so, dass wir klare Standards gesetzt haben.
Wenn man nach den konkreten Ursachen fragt, muss man feststellen: Das ist gelungen, weil der Verbrennermotor deutlicher modernisiert wurde, weil ein Katalysator eingebaut worden ist, weil in der Industrie Entschwefelungsanlagen
eingebaut wurden, weil in den Haushalten nicht mehr mit Kohle geheizt wird, und auch aus vielen anderen Gründen.
Es gibt ganz viele Elemente, die wir auch aus der Vergangenheit mitnehmen können, Bereiche, wo wir als Österreich, als Gesellschaft und auch als Wirtschaft gelernt haben, mit Umweltkrisen beziehungsweise mit großen Belastungen für die Umwelt umzugehen, die auch eine Belastung für die Gesundheit waren, und wo wir auch Erfolge gefeiert haben.
Ich finde – und das hat auch Kollege Schmuckenschlager vorhin im Zusammenhang mit anderen aktuellen Debatten gesagt –, es ist auch unsere Rolle als Politiker und Politikerinnen, über die Erfolge in der Umweltpolitik zu reden. Anstatt so zu tun, als ob früher immer alles besser gewesen wäre, sollten wir öfter auch daran erinnern, dass wir als Gesellschaft manches wieder besser gemacht haben; dass wir deshalb auch die Zuversicht haben sollten, kooperativ als Politik und eben in einem gemeinsamen Europa – aus unserer Sicht in Vereinigten Staaten von Europa – eine Umweltpolitik zu machen, die für die nächsten Generationen hält, nämlich mit Technik, mit Technologie und auch mit kluger Regulierung dort, wo es keine anderen Möglichkeiten gibt. Genau dafür stehen wir NEOS. – Vielen Dank. (Beifall bei den NEOS.)
16.02
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Ich begrüße herzlich Frau Bundesministerin Gewessler. – Frau Bundesminister, Sie gelangen zu Wort.
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie Leonore Gewessler, BA: Herr Präsident! Werte Abgeordnete! Werte Zuseherinnen und Zuseher hier im Saal, aber auch zu Hause! Über die Wichtigkeit des Schutzes der Luftqualität, einer sauberen Luft, haben jetzt viele Vorrednerinnen und Vorredner schon gesprochen, und dem kann ich mich nur anschließen.
Da wir das gestern sehr intensiv diskutiert haben, auch auf europäischer Ebene, fällt mir ein Fallbeispiel in Österreich ein, eines neben vielen anderen: Fragen Sie die Menschen am Brenner, wie wichtig die Luftqualität ist und wie wichtig es ist, dass man etwas dafür tut!
Genau das macht auch eines der vielen Gesetze in diesem Bereich, nämlich das Emissionsgesetz-Luft. Wir novellieren es mit den vorliegenden Änderungen in zwei ganz konkreten Punkten: Erstens setzen wir damit schlicht und ergreifend EU-Recht um – die Wichtigkeit der europarechtlichen Bestimmungen hat soeben Abgeordneter Bernhard noch einmal hervorgehoben oder Abgeordnete Rössler davor – und schaffen den Rahmen für die Aktualisierung insbesondere der Emissionsberichterstattung.
Das Zweite ist – und da gehe ich auf die Fragen ein, die Abgeordneter Keck vorhin gestellt hat –: Wir wollen eine gesetzliche Grundlage für die Aufsichtstätigkeit der zuständigen Behörde – das ist die Bezirksverwaltungsbehörde in dem Fall – für die nach dem EG-L 2018 festgesetzten Ge- und Verbote schaffen. Das erfolgt nach dem Muster des Wasserrechtsgesetzes, ist also in einer Form, die sowohl die Behörde als auch die zu Kontrollierenden schon kennen.
Ich darf auf die Fragen des Abgeordneten Keck eingehen, und vielleicht bewegt diese Klärung der Dinge auch zur Zustimmung. Wie wurde bisher kontrolliert? – Bisher wurde auf Anzeigenbasis kontrolliert. Das heißt, wenn jemand eine Anzeige gemacht hat, hat eine Kontrolle stattgefunden. Mit dieser Bestimmung jetzt wollen wir ja genau diese Kontrolltätigkeit verbessern, sodass nämlich insbesondere die Managementmaßnahmen in der Ammoniakreduktionsverordnung – von Ihnen ja auch zitiert – auch tatsächlich kontrolliert werden können. Das heißt, genau das, was Sie fordern, schaffen wir jetzt mit dieser Bestimmung. Die Ammoniakreduktionsverordnung ist derzeit auch die einzige Gebots- und Verbotsverordnung auf Basis des EG-L.
Warum muss man das ankündigen? – Das ist bei allen Kontrollen so. Wir würden sonst in die Eigentumsfreiheit eingreifen. Auch da folgt die Bestimmung dem Muster des Wasserrechtsgesetzes.
Es heißt – und das ist das ist auch in der Gewerbeordnung so normiert –: „Der Betriebsinhaber oder dessen Stellvertreter ist spätestens beim Betreten des Betriebes oder der Lagerräume zu verständigen.“ Das heißt im Normalfall nicht, dass er drei Tage vorher eine Ankündigung bekommt, sondern in der Regel erfolgt das unmittelbar vor der Kontrolle, quasi: Hallo, ich bin hier, ich betrete deinen Grund, ich kontrolliere!
Die für diese Kontrollen zuständige Behörde ist die Bezirksverwaltungsbehörde – Sie haben es vorhin erwähnt. Wir haben da auch in der Umsetzung einen Vorteil: Die Gewässeraufsicht wird von derselben Behörde durchgeführt. Das heißt, da können wir diese Synergie nutzen: Im Rahmen einer Kontrolle zum Beispiel nach der Nitrat-Aktionsprogramm-Verordnung können dann auch die Vorgaben der Ammoniakreduktionsverordnung kontrolliert werden.
Es ist also sehr effizient geregelt, nach einem Muster, das wir schon kennen, und damit wird es wirklich erheblich zur Verbesserung der Luftqualität beitragen. Ich schaue jetzt in diese Richtung (in Richtung SPÖ weisend) in der Hoffnung, dass ich vielleicht auch Ihre Fraktion noch bewegen kann, mit zuzustimmen. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
Ein Wort sei mir noch erlaubt zur Wiederherstellung der Natur auf europäischer Ebene: Auch da darf ich noch einmal den Appell von Kollegin Rössler unterstreichen. Ich halte das für eines der wichtigsten Naturschutzgesetze auf europäischer Ebene.
Ich darf insbesondere die Abgeordneten hier im Hohen Haus, die – das muss unser aller Anspruch sein – auf Basis von Fakten und tatsächlichen Bestimmungen Politik machen und Gesetze kommentieren, ersuchen, sich noch einmal den Text anzuschauen und in diesem Sinn auf die Bundesländer einzuwirken. Es
gibt Zielsetzungen auf europäischer Ebene, aber wir haben einen großen Spielraum, diese Zielsetzungen mit Leben zu erfüllen. Das heißt, wir können die Form, in der wir das umsetzen, in Österreich bestimmen, nämlich über einen österreichischen Umsetzungsplan, den wir gemeinsam erarbeiten können. Das soll uns also wirklich kein Hindernis sein. Wir haben in vielen Fällen schon bewiesen, wie wir Umweltgesetzgebung und Naturschutzgesetzgebung gut umsetzen können, und das wird uns auch in diesem Fall gelingen.
Wer die Form mitbestimmen möchte, den darf ich bitten, dem Gesetz zuzustimmen und damit auch an der Form zu arbeiten. Das ist noch einmal ein Appell von meiner Seite. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
Herzlichen Dank, und ich darf auch meinerseits um Zustimmung zum Emissionsschutzgesetz-Luft bitten. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
16.07
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gelangt Abgeordneter Höfinger. – Bitte sehr.
Abgeordneter Johann Höfinger (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Frau Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Beim Begriff Emissionsschutzgesetz-Luft denken vermutlich manche automatisch an die produzierende Industrie, an produzierendes Gewerbe und so weiter. Dabei es ist es eigentlich ein Thema, das uns in allen Lebenslagen selbst und direkt betrifft, alle von uns, in jeglicher Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten.
Da geht es um Mobilität, aber auch darum, wie sich unsere moderne Gesellschaft entwickelt hat, was heute so alles trendig geworden ist, diverse Internetkanäle, Social-Media-Kanäle, die wir benutzen, denn damit werden im Hintergrund Emissionen freigesetzt. Es geht darum, wie oft wir klicken, um
etwas im Internet zu bestellen, darum, wie viele Pakete durch die Gegend geschickt werden. Das wird in dieser Diskussion oft und gern ausgeklammert, ist aber ein wesentlicher Teil davon, was wir hier zu besprechen und zu regulieren haben.
Natürlich geht es auch um den Bereich Landwirtschaft, der heute schon angesprochen wurde, aber wie gesagt: Es sollte uns zunächst bewusst gemacht werden, dass es um unser aller Lebensbereiche geht, wie wir sie tagtäglich gestalten.
Meine Vorredner, auch die Frau Bundesminister, haben es ausgeführt: Wir haben hier in diesen letzten Jahren – in Wirklichkeit sogar schon Jahrzehnten, denn dieses Thema wird schon sehr lange politisch begleitet – enorm viel geschafft. Es gab enorme Reduktionen von Ausstößen der verschiedensten Art, aber natürlich liegt noch ein weiter Weg vor uns; und in dieser Debatte geht es so wie auch in anderen Debatten darum, einen pragmatischen Zugang zu finden.
Bleiben wir bei diesem Thema aus der Landwirtschaft, das heute von Kollegen Keck angesprochen wurde: die Gülleausbringung. Heutzutage hat jeder Landwirt größtes Interesse daran, dass dieser wertvolle Nährstoff so rasch wie möglich in seinen Boden eingearbeitet wird. Das ist eigentlich die gute fachliche Praxis, die täglich angewandt wird. Da eine überbordende Kontrolleinrichtung einzuführen, das halte ich für völlig übertrieben, das passt überhaupt nicht mit der Praxis zusammen.
Das Zweite betrifft das Renaturierungsgesetz, das heute schon angesprochen wurde: Dieses Wort klingt ja so super. Wir wollen alles zurückdrehen, wie es vielleicht vor 50, 60, 70, 80 Jahren war. (Zwischenrufe bei den Grünen.) Ich bin voll dabei, wenn es darum geht, dass wir in einem ausgewogenen Verhältnis einzelne Maßnahmen immer wieder so abstimmen, dass sie zusammenpassen – zusammenpassen mit unserer Lebensweise, zusammenpassen mit einem Wirtschaftsstandort.
Ich sage Ihnen: Verbotsgesetze sind rasch ausgesprochen; aber was ist, wenn uns dann ein sektoraler Wirtschaftsbereich verloren geht? Schauen Sie nach Deutschland, was da passiert! Die Industrie zieht sich aus Deutschland zurück, da gehen Hunderttausende Arbeitsplätze verloren. (Abg. Rössler: ... Standortfaktoren! – Zwischenbemerkung von Bundesministerin Gewessler.)
Die Frau Bundesminister fragt, was das mit der Renaturierung zu tun hat: weil überbordende Vorschriften mit überbordenden Maßnahmen einfach dazu führen, dass sich produzierende Betriebe, Gewerbebetriebe aus einem Land zurückziehen. (Abg. Rössler: Ist ja nicht überbordend! Ganz im Gegenteil!) Ganz einfach, so ist das und so passiert das dort auch; und das darf uns nicht passieren. (Beifall bei der ÖVP. – Zwischenruf des Abg. Kassegger.)
Wir haben die Möglichkeit und die Zeit, nämlich gemeinsam Wirtschaftsweisen umzubauen, Hand in Hand. Ich denke, dann werden wir auch einen breiten Konsens finden, dann werden wir Arbeitsplätze sichern, dann werden wir einen guten Beitrag zum Klimaschutz leisten. – Vielen Dank. (Beifall und Bravoruf bei der ÖVP.)
16.11
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Hechenberger. – Bitte.
Abgeordneter Ing. Josef Hechenberger (ÖVP): Geschätzter Herr Präsident! Geschätzte Frau Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Zuseherinnen und Zuseher hier und auch zu Hause! Ich darf jetzt den Scheinwerfer etwas umschwenken und auf unsere transitbelastete und -geplagte Bevölkerung in Tirol lenken.
Ich darf mit einem Zitat beginnen, dem, was heute die „Dolomiten“ titeln, und zwar: „Die Transit-Bombe: EU rügt Österreich für Fahrverbote“. Ich muss sagen, an und für sich ist das schon ein starkes Stück, wenn man liest: Die EU-
Kommission hat im Streit um die Tiroler Antitransitmaßnahmen auf der Brennerstrecke Italien in vielen Punkt recht gegeben. – Für mich ist es unverständlich.
Ich denke, es ist aber auch wichtig, was da weiters steht: Zwar wird von einem Vertragsverletzungsverfahren abgesehen, doch Italien klagt Österreich vor dem Europäischen Gerichtshof. In einer Stellungnahme gab die Behörde der Kritik Italiens in markanten Bereichen recht. – Zitatende.
Für uns ist eines klar, geschätzte Damen und Herren: Es geht da nicht gegen den freien Warenverkehr, es geht um das Wohl und auch um die Gesundheit der Bevölkerung. Aus diesem Grund, denke ich, wurden diese Maßnahmen, die die Tiroler Landespolitik entsprechend vorangetrieben hat, zum Beispiel mit einem Nachtfahrverbot, mit Blockabfertigung, unverzichtbar. Es freut uns schon, dass uns auch der Abgeordnete zum Europäischen Parlament Herbert Dorfmann den Rücken stärkt, weil die Systeme sich auch in Südtirol spiegeln.
Wenn jetzt Minister Salvini glaubt, er muss klagen, dann werden wir das natürlich entsprechend zur Kenntnis nehmen und weiter dafür kämpfen, dass diese wichtigen Maßnahmen zukünftig aufrechtbleiben.
Eines, muss ich sagen, ist meiner Meinung schon unverständlich: Wir diskutieren in Europa Renaturierung, wir diskutieren Verbrenneraus, wir diskutieren verschiedene Maßnahmen zum Umweltschutz, aber gleichzeitig versucht man, den freien Warenverkehr durch Österreich und primär durch Tirol zu beschleunigen. Für uns als ÖVP heißt es klar: Europa, aber besser! (Beifall bei der ÖVP.)
Eines ist für mich inzwischen auch klar: Ich fahre fast täglich, wenn ich nicht in Wien bin, nach Innsbruck; da hat der Verkehr die letzten Jahre massiv zugenommen, und wenn ich mir anschaue, was die Bevölkerung im Inntal, aber auch im Wipptal mitmacht, dann sage ich, es ist wichtig, dass wir da entsprechende Zeichen setzen.
Wir haben heute diesen Entschließungsantrag eingebracht, leider kein Allparteienantrag. Vier Parteien stimmen diesem Entschließungsantrag zu, die FPÖ stimmt diesem Antrag nicht zu. Das verstehe ich nicht ganz, ehrlich gesagt. (Abg. Kassegger: Wir machen einen eigenen! – Abg. Hafenecker: Wart einmal ab!) – Der Tiroler Landtag, die freiheitlichen Abgeordneten im Tiroler Landtag stimmen genau diesem Antrag zu. Die FPÖ-Abgeordneten im Nationalrat stimmen dem Ganzen nicht zu. (Abg. Deimek: Woher weißt du das? Das ist falsch, was du sagst! Ist das vielleicht grüne Propaganda?! – Zwischenruf des Abg. Hafenecker.) Also für mich hat sich das noch nicht erschlossen.
Es ist ja überhaupt so, dass das Thema Verkehr und das Thema transitbelastete Bevölkerung im Inntal und im Wipptal für die FPÖ kein großes Thema ist, kein einziger Redner outet sich dazu.
Ich muss sagen: Wir kämpfen weiter! Das ist, denke ich, die klare Botschaft an die Tiroler Bevölkerung, denn immerhin sind es 2,5 Millionen Lkws, die drüberrollen. Es ist die meistbefahrene Nordsüdtangente beziehungsweise -verbindung. Wir werden alles dafür tun, dass die Lebensqualität im Inntal und im Wipptal erhalten bleibt. Das ist heute ein wichtiges Signal nach Brüssel, ein wichtiges Signal nach Rom, ein wichtiges Signal nach Berlin, dass wir diesen Entschluss beziehungsweise diesen Entschließungsantrag gemeinsam absegnen beziehungsweise abschicken. Wir kämpfen weiter für die Bevölkerung.
Frau Bundesminister, wir brauchen da Ihre Unterstützung, denn es geht um die Zukunft des Inntals und des Wipptals. In diesem Sinne: Wir haben viel Arbeit vor uns. Danke für die Unterstützung. Danke an die Klubs für die Vorbereitung. Letztendlich geht es um, wie schon gesagt, die Zukunft unserer leidgeplagten, transitgeplagten Bevölkerung. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
16.15
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Weratschnig. – Bitte.
16.15
Abgeordneter Hermann Weratschnig, MBA MSc (Grüne): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Bundesministerin! Liebe Abgeordnete! Vielleicht ganz zu Beginn: Eine intakte Natur ist die Grundlage jeglichen Wirtschaftens. Wenn wir uns die Lebensgrundlagen kaputtmachen, wenn wir keine Lebensgrundlagen mehr haben, dann reden wir auch nicht mehr über Betriebsstandorte, wer wo hinzieht, wo welche Betriebserweiterungen sind. Es ist eigentlich eine gemeinsame Aufgabe der Gesamtgesellschaft, der Wirtschaft, Naturräume zu sichern, Lebensgrundlagen zu sichern. (Beifall bei den Grünen.)
Insbesondere ist auch die Luftqualität ein Fundament für ein gutes, gesundes Leben. Wir sind dafür verantwortlich, die Luftqualität zu sichern. Die Luftqualitätsrichtlinie gibt die Grundlage für alle Nationalstaaten, die entsprechenden Maßnahmen umzusetzen, ob jetzt das Emissionsschutzgesetz oder auch Immissionsschutzgesetze.
In diesem Sinne ist es, glaube ich, ganz wichtig, dieses Thema aktuell zu behandeln – Herr Kollege Hechenberger hat es bereits erwähnt –: die Luftqualität und insbesondere die Luftqualität in Tirol entlang der Transitstrecken. Dazu gab es gestern eine Stellungnahme der Europäischen Kommission, die sehr durchwachsen ist.
Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass wir auf der Grundlage von europäischen Gesetzen auch unter Beweis stellen können, dass jegliche Einzelmaßnahme verhältnismäßig, angemessen ist und den Zielen, den europäischen Zielen wie auch den nationalen Zielen, entsprechen wird.
Dementsprechend möchte ich hier einen Entschließungsantrag einbringen:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Andreas Ottenschläger, Hermann Weratschnig, MBA MSc, Mag. Selma Yildirim, Dr. Johannes Margreiter, Kolleginnen und Kollegen
betreffend „Tiroler Bevölkerung schützen und die Tiroler Landesregierung unterstützen: Gesundheits- und Umweltschutz sowie Versorgungssicherheit in Tirol haben einen höheren Wert als die freie Fahrt für Millionen von Transit-LKW“
*****
Herr Präsident! Der Antrag wurde ordnungsgemäß, so hoffe ich, eingebracht und wurde auch verteilt und steht somit zur Debatte. (Heiterkeit bei den Grünen.)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Danke.
Abgeordneter Hermann Weratschnig, MBA MSc (fortsetzend): Das ist die Tiroler Selbstbestimmung, ja.
Trotzdem möchte ich ihn in den Grundzügen erläutern: Die wesentlichen Punkte des Antrages sind natürlich die Transitmaßnahmen, die in Tirol gesetzt wurden, nämlich das Nachtfahrverbot, das sektorale Fahrverbot, das Wochenendfahrverbot, das Thema Euroklassen. All diese Verbote, diese Beschränkungen, auf der Grundlage von europäischen Gesetzen und nationalen Gesetzen, sind unerlässlich für die Region und sind beispielhaft, glaube ich, auch für alle anderen Bundesländer, für alle Strecken, wo es diese Transitproblematik gibt.
Der zweite Punkt ist die Notwendigkeit, Dosierungen im Schwerverkehr durchzuführen, Blockabfertigung. Wir wissen, dass gerade Tirol ein Beispiel dafür ist: An 43 Tagen, 276 Stunden wurde da dosiert, um die Versorgungssicherheit im Inntal zu gewährleisten, die Daseinsvorsorge, dass die Rettung von A nach B kommt, dass die heimische Wirtschaft auch wirtschaften kann, dass all diese wichtigen Aufgaben im Leben erfüllt werden können; deshalb braucht es auch diese Dosierung und diese Blockabfertigung.
Weiter ist der Verweis ganz klar: der Verweis auf die europäischen Richtlinien und auch auf die Instrumente, die es gibt – ob es die Alpenkonvention ist, das Verkehrsprotokoll, das Weißbuch Verkehr und natürlich auch der Green Deal als
Grundlage und Maßnahme, das Ziel, nämlich die Verlagerung von der Straße auf die Schiene, auch operativ umzusetzen, auch diverse Fördermittel und andere Gelder zu lukrieren und gemeinsam in Europa diese Maßnahmen zu setzen.
Natürlich auch das Thema im Bereich Weißbuch Verkehr: Es geht einfach darum, dass es zukünftig auch verbindliche Regeln braucht, wenn wir davon sprechen, Verkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Daran arbeiten wir.
Es gibt da viele Beispiele: Frau Bundesministerin, gerade im Bereich der Abfalltransporte sind wir dieses Thema, glaube ich, angegangen – schwierig, aber umsetzbar, mit dementsprechend vielen Gesprächen und auch mit einem sehr starken Dialog mit der Wirtschaft. So sollte es auch europäisch laufen: Es braucht immer diesen starken Dialog.
Der letzte Punkt ist natürlich der Brennernordzulauf. Da ist die Aufgabe, den Brennerbasistunnel in Zukunft rasch zu versorgen, diese Hauptverkehrsachse, die bereitgestellt wird, dann auch als Alternative zu bespielen – das ist ein ganz wichtiger Bereich, der auch hier in diesen Antrag aufgenommen wurde.
An dieser Stelle darf ich den Parlamentsfraktionen für ihre Bemühungen danken, all jenen, die heute hier mitstimmen, auch im Namen der Bevölkerung, der – wie sie Herr Kollege Hechenberger auch schon genannt hat – transitgeplagten Bevölkerung entlang der Routen. Da gibt es zahlreiche Routen in Österreich, der Brenner ist beispielhaft, weil dort 2,5 Millionen LKWs im Jahr über die Brennerachse – über das Unterinntal an Innsbruck vorbei durch das Wipptal über den Brenner – fahren.
Das ist eine Belastung, das ist eine Aufgabe. Dieser Aufgabe werden wir uns stellen, und wir werden uns auch den Argumenten stellen, die hier geliefert wurden. Wir werden uns auch einem europäischen Dialog stellen, um diverse Alternativen auszuarbeiten, gerade was den Bahnverkehr betrifft. – In diesem Sinne: Danke für eine breite Zustimmung. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
16.22
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Andreas Ottenschläger, Hermann Weratschnig, MBA MSc, Ing. Josef Hechenberger, Mag. Selma Yildirim, Dr. Johannes Margreiter, Kolleginnen und Kollegen
betreffend Tiroler Bevölkerung schützen und die Tiroler Landesregierung unterstützen: Gesundheits- und Umweltschutz sowie Versorgungssicherheit in Tirol haben einen höheren Wert als die freie Fahrt für Millionen von Transit-LKW
eingebracht im Zuge der Debatte über TOP 4: Bericht des Umweltausschusses über den Antrag 4001/A der Abgeordneten Johannes Schmuckenschlager, Dr. Astrid Rössler, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Emissionsgesetz-Luft 2018 geändert wird (2538 d.B.)
Der Brennerkorridor ist die mit Abstand meistbefahrene Nord-Süd-Verbindung in den Alpen. Mittlerweile rollen jährlich mehr als 2,5 Millionen LKW über den Brenner. Die Tiroler Routenwahlstudie 2019 hat aufgezeigt, dass am Brenner insgesamt 33 Prozent und somit jährlich über 880.000 Lkw eine um mehr als 60 Kilometer kürzere Alternativroute über einen anderen alpenquerenden Pass gehabt hätten, aber die Route über den Brenner gewählt haben und damit als Umwegverkehr einzustufen sind. Nur 40 Prozent der Transit-LKW über den Brenner sind, wenn man dieses Kriterium heranzieht, am Bestweg unterwegs. Rund ein Fünftel aller LKW am Brennerkorridor hätten sogar eine um mehr als 120 Kilometer kürzere Alternativroute nehmen können.
Die Zunahme des Transitverkehrs ist unter anderem auf die im Vergleich zu anderen alpenüberquerenden Routen in der Schweiz oder Frankreich niedrigere Maut auf großen Teilen des Brennerkorridors (München – Verona) zurückzuführen.
Das enorme Verkehrsaufkommen bringt eine überaus große Belastung für die Bevölkerung, aber auch für die Umwelt in den Gemeinden entlang des
Brennerkorridors mit sich. Zudem ist die Belastungsgrenze für die Infrastruktur am Korridor nicht nur erreicht, sondern wird sogar überschritten. Die dringend notwendigen Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen auf der A 13 Brennerautobahn in den kommenden Jahren werden baustellenbedingt die Kapazitäten noch weiter reduzieren und damit die Belastung für die Bevölkerung erhöhen.
Die derzeit geltenden Maßnahmen in Umsetzung von Unionsrecht und innerstaatlichem Recht sind als „Notmaßnahmen“ daher unerlässlich, um die Gesundheit der Bevölkerung und die Umwelt zu schützen und die Verkehrs- und Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Ohne Aufrechterhaltung der bestehenden verkehrsbeschränkenden Maßnahmen ist auf dem gesamten Straßennetz im Tiroler Inntal und Wipptal – insbesondere im Großraum Innsbruck – ein Verkehrskollaps nicht mehr zu verhindern. Dies würde dazu führen, dass die Versorgungssicherheit der Tiroler Bevölkerung und auch der Gäste nicht mehr gewährleistet werden kann. Verstopfte Straßen würden das Durchkommen von Rettungs- und Einsatzfahrzeugen unmöglich machen, wodurch die Gesundheit der entlang der Verkehrsroute lebenden Bevölkerung, aber auch der dort urlaubenden Gäste massiv gefährdet würde. Zudem würde eine weitere Zunahme des Transitverkehrs und der damit verbundenen Stauerscheinungen zu enormen gesundheitlichen Belastungen durch die emittierten Abgase, Feinstaub und Lärm führen.
Da die Belastungsgrenze sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für die Infrastruktur erreicht ist, müssen sämtliche bestehende Maßnahmen weiterhin aufrechterhalten werden. Zudem würde ein Mehr an Verkehr alle umwelt- und klimapolitischen Maßnahmen sowie nationale und europäische Klimaschutzziele konterkarieren. Eine Aufweichung der Maßnahmen würde noch mehr Transitverkehr auf dem Brennerkorridor zur Folge haben, wodurch die Lebensqualität im Bundesland Tirol massiv eingeschränkt werden würde.
Neben der unbedingten Notwendigkeit für die Aufrechterhaltung aller Maßnahmen aus Gründen des Schutzes der Gesundheit und der Umwelt sowie der Aufrechterhaltung der Verkehrs- und Versorgungssicherheit stellen auch die Alpenkonvention samt Verkehrsprotokoll und das Weißbuch für Verkehr der Europäischen Union
Vorgaben dar, welche ein Aufweichen oder gar Abrücken von den derzeitigen verkehrsbeschränkenden Maßnahmen unmöglich machen. Die bevorstehende Verschärfung der Grenzwerte der EU-Luftqualitätsrichtlinie auf Basis der WHO-Leitlinien legitimiert die Beibehaltung aller die Gesundheit und Umwelt schützenden Verkehrsmaßnahmen in Tirol zusätzlich.
Im Sinne der Tiroler Bevölkerung, der Gäste in unserem Land, der Wirtschaft und des Umwelt- und Klimaschutzes sollen deshalb alle Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit und der Umwelt sowie zur Sicherstellung der Verkehrs- und Versorgungssicherheit weiterhin aufrechterhalten werden. Aus dem laufenden, von Italien eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich nach Art. 259 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und dem bevorstehenden Gang von Minister Salvini an den Europäischen Gerichtshof ergibt sich die dringliche Notwendigkeit einer entsprechenden Willensbekundung des Nationalrates. Die unterfertigenden Abgeordneten stellen daher folgenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird ersucht, die in Umsetzung von Unionsrecht und innerstaatlichem Recht verhängten verkehrsbeschränkenden Notmaßnahmen auf der Inntal- und Brennerautobahn in Tirol, die für den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung und der Umwelt vor Schadstoffen und Lärm, für die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit einer wichtigen europäischen Hauptverkehrsachse und für die Versorgungssicherheit im gesamten Land unerlässlich sind, gemeinsam mit dem Land Tirol weiterhin mit Nachdruck zu verteidigen, da ohne die Aufrechterhaltung der aus den vorgenannten Gründen gerechtfertigten Fahrverbote und Verkehrsbeschränkungen ein Verkehrskollaps auf einer zentralen Nord-Süd-Verbindung in der Europäischen Union unausweichlich ist.
Insbesondere mögen in diesem Sinn folgende Punkte mit Nachdruck gegenüber der Europäischen Kommission und den Nachbarstaaten vertreten werden:
1. Die geltenden verkehrsbeschränkenden Maßnahmen in Umsetzung von Unionsrecht und innerstaatlichem Recht im Land Tirol sind Notmaßnahmen zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung und der Umwelt und sind für den Erhalt der Infrastruktur, zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Nord-Süd-Verkehrsachse und zur Aufrechterhaltung der Versorgung der Gemeinden entlang dieser Verkehrsachse unerlässlich. Daher wird die Bundesregierung ersucht, an sämtlichen Maßnahmen festzuhalten und die Tiroler Landesregierung hierbei weiter zu unterstützen, jedenfalls sofern und soweit diese Maßnahmen nicht durch andere mindestens ebenso wirksame Maßnahmen ersetzt werden.
2. Die geltenden verkehrsbeschränkenden Maßnahmen in Tirol zur Regulierung des Schwerverkehrs auf der Inntal- und Brennerautobahn, welche im Einklang mit der Tiroler Landesregierung und dem Tiroler Landtag getroffen wurden, müssen daher aufrechterhalten werden. Dieser Standpunkt ist auch im von Italien eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich nach Art. 259 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union aufrecht zu erhalten.
3. Weiters wird die Bundesregierung ersucht, im Rahmen des Vertragsverletzungsverfahrens sämtliche rechtlichen Möglichkeiten zu nutzen, um die Tiroler Maßnahmen zu verteidigen. Dabei sollen insbesondere auch die Alpenkonvention samt Verkehrsprotokoll, das Weißbuch „Verkehr“ und der „Green Deal“ der Europäischen Kommission samt Klimaschutzzielen entsprechende Berücksichtigung finden.
4. Weiters wird die Bundesregierung ersucht, die Europäische Kommission aufzufordern, zeitnah wirkungsvolle Maßnahmen zur Umsetzung des Weißbuchs „Verkehr“ und insbesondere Maßnahmen ohne Schlupflöcher für die Verlagerung auf die Schiene umzusetzen.
5. Zudem wird die Bundesregierung ersucht, auf die Europäische Kommission sowie die Regierungen in Deutschland und Italien einzuwirken, um zeitnah die Einführung eines intelligenten Verkehrsmanagementsystems im Sinne der von Tirol, Bayern und Südtirol unterzeichneten „Kufsteiner Erklärung“ zu erreichen.
6. Schließlich wird die Bundesregierung ersucht, auf die Regierung in Deutschland einzuwirken, den Bau der erforderlichen Zulaufstrecken für den Brenner Basistunnel schnellstmöglich zu beschließen und mit der Umsetzung zu starten. Die Zulaufstrecken sind erforderlich, um die volle Kapazität des Brenner Basistunnels auszunutzen zu können und einen wichtigen Beitrag für die Verlagerung auf die Schiene zu leisten.“
*****
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Ich darf Abgeordnetem Weratschnig recht herzlich für die Arbeitskooperation danken. Ich darf trotzdem nochmals feststellen, dass der Entschließungsantrag ausreichend unterstützt ist, in den Grundzügen erläutert wurde, verteilt wurde und damit in Verhandlung steht.
Ich darf im Namen von Herrn Abgeordneten Sieber recht herzlich die Gruppe, die zum 50-jährigen Maturajubiläum aus dem Franziskanergymnasium in Bozen zu uns gekommen ist, begrüßen. Es ist ein schönes Zeichen, zum Maturajubiläum nach Wien ins Parlament zu kommen – herzlichen Dank. (Allgemeiner Beifall.)
Zu Wort gemeldet hat sich Frau Bundesminister Gewessler. – Bitte sehr.
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie Leonore Gewessler, BA: Herr Präsident! Werte Abgeordnete! Ich werde es sehr kurz halten, weil ich als erstes Danke sagen möchte: Ich möchte mich für diese Initiative bedanken, die noch einmal unterstreicht, wie geschlossen Österreich hinter diesen Maßnahmen steht. Ich bedauere, dass das jetzt kein Allparteienantrag ist, aber ich weiß, dass dieser Antrag für alle, die sich auf europäischer Ebene dafür einsetzen, dafür kämpfen, dass wir den Schutz der Bevölkerung und der Menschen in Tirol zu unserer Leitlinie und zur Politik machen, ein großer Rückenwind ist. Das gilt für mich als Ministerin, die für die Verkehrs- und Mobilitätsthemen zuständig ist, und das gilt genauso für Europaministerin Karoline Edtstadler, die die Prozessführung macht und dafür
zuständig ist. Wir brauchen diesen Rückenwind aus dem Parlament und wir freuen uns darüber.
Wir haben immer gesagt, der Schutz der Gesundheit und der Schutz der Sicherheit der Menschen in Tirol sind für uns nicht verhandelbar, aber wir waren und sind immer gesprächsbereit. Leider hat Matteo Salvini gestern ein weiteres Mal gezeigt: Er ist es nicht. Er hat angekündigt, dass er auf jeden Fall eine Klage gegen diese Maßnahmen einreichen wird.
Ich möchte auch an dieser Stelle noch einmal sagen: Die Tiroler Maßnahmen sind rechtskonform, sie sind richtig – die Gesundheit und das Leben sind für uns nicht verhandelbar. Wir stehen – und das ist das Signal, das Sie alle heute mit diesem Antrag unterstützen – da aufseiten der Tiroler Bevölkerung. Wir tun in diesem Verfahren, mit unserer Politik alles, um sie konsequent zu schützen, und ich bin überzeugt: Am Ende werden sich saubere Luft, die Verkehrssicherheit und die Gesundheit der Menschen in Tirol gegen die Profitinteressen der italienischen Frächterlobby durchsetzen.
Deswegen möchte ich sehr, sehr herzlich Danke für Ihre Unterstützung durch diesen – fast – gemeinsamen Antrag sagen. – Herzlichen Dank. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
16.25
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Hauser. – Bitte.
Abgeordneter Mag. Gerald Hauser (FPÖ): Herr Präsident! (Abg. Zorba: Die WHO ist schuld am Verkehr!) Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuhörer vor den Bildschirmen! Für die Freiheitliche Partei ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir auf der Seite der transitgeplagten Tiroler Bevölkerung stehen. (Ruf bei der ÖVP: Dann stimmts zu!)
Das war für uns nie eine Frage. Das war in der Vergangenheit nie eine Frage, und wir waren die Ersten – die Ersten, bitte! (Abg. Kucher: Nein, nein, nein, Buckeln vor dem Salvini! Ein Kniefall war das!) –, die immer auf der Seite der Tiroler Bevölkerung gestanden sind. (Beifall bei der FPÖ. – Abg. Litschauer: ... Verbrennungsmotor!) Selbstverständlich – no na net – unterstützen wir die transitgeplagte Bevölkerung. Das habe ich auch Kollegen Weratschnig und Kollegen Hechenberger mitgeteilt.
Bei der Frage freier Warenverkehr versus Gesundheit kann man ja nur auf der Seite der Bevölkerung, auf der Seite der Gesundheit stehen. Wer steht denn auf der Seite des freien Warenverkehrs? – Italien steht auf der Seite des freien Warenverkehrs und bedauerlicherweise auch die Europäische Kommission, die ja die Klage für Italien freigemacht hat. Im wahrsten Sinne des Wortes fährt die Europäische Kommission über die Tiroler Bevölkerung drüber. (Abg. Schallmeiner: ... Bruder im Geiste fährt über die Leute drüber!)
Das muss man überhaupt nicht verstehen: Für die Europäische Kommission ist der freie Warenverkehr interessanterweise wichtiger als die Gesundheit der Bevölkerung. Das ist ja schon eine Perversion an sich, und das lehnen wir deutlich und klar ab. (Beifall bei der FPÖ.)
Deswegen bringen wir auch einen eigenen Antrag ein, allerdings ohne Green Deal. Ich frage mich: Was hat der Green Deal mit dem Schutz der Tiroler Bevölkerung, mit der Gesundheit zu tun? – Geschätzter Herr Präsident, ich bringe einen Entschließungsantrag ein, der gleichlautend ist wie der Antrag, den die Kollegen Weratschnig und Hechenberger eingebracht haben. Wir haben nur das angehängte Konvolut Green Deal et cetera weggelassen.
Eines sollte auch euch klar sein: Der Green Deal führt dazu, dass Europa deindustrialisiert und Amerika reindustrialisiert wird (Abg. Schallmeiner: Na bitte, die Geschichte ...!), weil sich die Betriebe in Europa die Energiekosten nicht mehr leisten können. Wer will denn haben, dass bei uns arbeits- und energieintensive Betriebe wegziehen? Das kann doch niemand hier im Hohen Haus haben wollen,
deswegen: Raus mit dem Green Deal, den wir ablehnen, und rein mit dem Schutz der Bevölkerung!
Deswegen, Herr Präsident, stelle ich also unseren Antrag hier vor:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Tiroler Bevölkerung schützen und die Tiroler Landesregierung unterstützen:“ – Kollege Hechenberger, du bist halt doch kein Hellseher (Zwischenruf bei der ÖVP) – „Gesundheits- und Umweltschutz sowie Versorgungssicherheit in Tirol haben einen höheren Wert als die freie Fahrt für Millionen von Transit-LKW“
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, verhängten verkehrsbeschränkenden Notmaßnahmen auf der Inntal- und Brennerautobahn in Tirol, die für den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung und der Umwelt vor Schadstoffen und Lärm, für die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit einer wichtigen europäischen Hauptverkehrsachse und für die Versorgungssicherheit im gesamten Land unerlässlich sind, gemeinsam mit dem Land Tirol weiterhin mit Nachdruck zu verteidigen, da ohne die Aufrechterhaltung der aus den vorgenannten Gründen gerechtfertigten Fahrverbote und Verkehrsbeschränkungen ein Verkehrskollaps auf einer zentralen Nord-Süd-Verbindung in der Europäischen Union unausweichlich ist."
*****
Also ein klares Ja der Freiheitlichen Partei zum Schutz der Tiroler Bevölkerung und gegen den freien Warenverkehr – ein für alle Mal! (Beifall bei der FPÖ. – Abg. Litschauer: Gegen den Verbrennungsmotor, oder ...?)
16.29
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Peter Wurm, Christian Hafenecker, Gerald Hauser und weiterer Abgeordneter
betreffend Tiroler Bevölkerung schützen und die Tiroler Landesregierung unterstützen: Gesundheits- und Umweltschutz sowie Versorgungssicherheit in Tirol haben einen höheren Wert als die freie Fahrt für Millionen von Transit-LKW
eingebracht im Zuge der Debatte über TOP 4: Bericht des Umweltausschusses über den Antrag 4001/A der Abgeordneten Johannes Schmuckenschlager, Dr. Astrid Rössler, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Emissionsgesetz-Luft 2018 geändert wird (2538 d.B.)
Der Brennerkorridor ist die mit Abstand meistbefahrene Nord-Süd-Verbindung in den Alpen. Mittlerweile rollen jährlich mehr als 2,5 Millionen LKW über den Brenner. Die Tiroler Routenwahlstudie 2019 hat aufgezeigt, dass am Brenner insgesamt 33 Prozent und somit jährlich über 880.000 LKW eine um mehr als 60 Kilometer kürzere Alternativroute über einen anderen alpenquerenden Pass gehabt hätten, aber die Route über den Brenner gewählt haben und damit als Umwegverkehr einzustufen sind. Nur 40 Prozent der Transit-LKW über den Brenner sind, wenn man dieses Kriterium heranzieht, am Bestweg unterwegs. Rund ein Fünftel aller LKW am Brennerkorridor hätten sogar eine um mehr als 120 Kilometer kürzere Alternativroute nehmen können.
Die Zunahme des Transitverkehrs ist unter anderem auf die im Vergleich zu anderen alpenüberquerenden Routen in der Schweiz oder Frankreich niedrigere Maut auf großen Teilen des Brennerkorridors (München – Verona) zurückzuführen.
Das enorme Verkehrsaufkommen bringt eine überaus große Belastung für die Bevölkerung, aber auch für die Umwelt in den Gemeinden entlang des Brennerkorridors mit sich. Zudem ist die Belastungsgrenze für die Infrastruktur am Korridor nicht nur erreicht, sondern wird sogar überschritten. Die dringend notwendigen Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen auf der A 13 Brennerautobahn in den
kommenden Jahren werden baustellenbedingt die Kapazitäten noch weiter reduzieren und damit die Belastung für die Bevölkerung erhöhen.
Die derzeit geltenden Maßnahmen sind als „Notmaßnahmen“ daher unerlässlich, um die Gesundheit der Bevölkerung und die Umwelt zu schützen und die Verkehrs- und Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Ohne Aufrechterhaltung der bestehenden verkehrsbeschränkenden Maßnahmen ist auf dem gesamten Straßennetz im Tiroler Inntal und Wipptal – insbesondere im Großraum Innsbruck – ein Verkehrskollaps nicht mehr zu verhindern. Dies würde dazu führen, dass die Versorgungssicherheit der Tiroler Bevölkerung und auch der Gäste nicht mehr gewährleistet werden kann. Verstopfte Straßen würden das Durchkommen von Rettungs- und Einsatzfahrzeugen unmöglich machen, wodurch die Gesundheit der entlang der Verkehrsroute lebenden Bevölkerung, aber auch der dort urlaubenden Gäste massiv gefährdet würde. Zudem würde eine weitere Zunahme des Transitverkehrs und der damit verbundenen Stauerscheinungen zu enormen gesundheitlichen Belastungen durch die emittierten Abgase, Feinstaub und Lärm führen.
Da die Belastungsgrenze sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für die Infrastruktur erreicht ist, müssen sämtliche bestehende Maßnahmen weiterhin aufrechterhalten werden.
Im Sinne der Tiroler Bevölkerung, der Gäste in unserem Land, der Wirtschaft und des Umwelt- und Klimaschutzes sollen deshalb alle Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit und der Umwelt sowie zur Sicherstellung der Verkehrs- und Versorgungssicherheit weiterhin aufrechterhalten werden. Aus dem laufenden, von Italien eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich nach Art. 259 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und dem bevorstehenden Gang von Minister Salvini an den Europäischen Gerichtshof ergibt sich die dringliche Notwendigkeit einer entsprechenden Willensbekundung des Nationalrates.
Die unterfertigenden Abgeordneten stellen daher folgende
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, verhängten verkehrsbeschränkenden Notmaßnahmen auf der Inntal- und Brennerautobahn in Tirol, die für den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung und der Umwelt vor Schadstoffen und Lärm, für die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit einer wichtigen europäischen Hauptverkehrsachse und für die Versorgungssicherheit im gesamten Land unerlässlich sind, gemeinsam mit dem Land Tirol weiterhin mit Nachdruck zu verteidigen, da ohne die Aufrechterhaltung der aus den vorgenannten Gründen gerechtfertigten Fahrverbote und Verkehrsbeschränkungen ein Verkehrskollaps auf einer zentralen Nord-Süd-Verbindung in der Europäischen Union unausweichlich ist.“
*****
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Der Entschließungsantrag ist ausreichend unterstützt, ordnungsgemäß eingebracht und steht somit in Verhandlung.
Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Ottenschläger. – Bitte.
Abgeordneter Andreas Ottenschläger (ÖVP): Herr Präsident! Frau Bundesministerin! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Werte Zuseherinnen und Zuseher! Herr Kollege Hauser von der FPÖ hat mich jetzt dazu veranlasst, mich hierzu doch noch kurzfristig zu Wort zu melden.
Zum Ersten: Es ist tatsächlich schade, dass Sie nicht einmal diesem Antrag, den vier Parteien gemeinsam einbringen, zustimmen können, obwohl – obwohl! – die FPÖ im Tiroler Landtag diesen Formulierungen auch zugestimmt hat. (Abg. Hafenecker: Nein!) Es ist schon sehr bemerkenswert, dass Sie immer irgendwelche Ausreden finden, damit Sie nicht einmal einen Konsens mit uns finden können. Das bezeichnet sehr stark Ihre Politik. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
Zum Zweiten, weil wir ja heute hier schon über Europa debattiert haben: Es ist doch gut so, dass wir uns in einer gemeinsamen Europäischen Union befinden, in der wir die Möglichkeit haben, Konflikte mit unseren befreundeten Nachbarstaaten zivilisiert, so wie hier jetzt, auszufechten, nämlich vor einem Gericht. (Abg. Kassegger: Ja, dass wir verklagt werden!) Wir aus Österreich hätten nämlich genauso das Recht, wenn etwas für uns nicht in Ordnung scheint, dass wir dann vor ein Gericht gehen, und dort wird entschieden, wer recht hat. Das ist ein zivilisierter Umgang in einem gemeinsamen Europa. (Beifall bei ÖVP und Grünen. – Abg. Hafenecker: ... funktioniert! – Abg. Deimek: ... ist die Kommission schuld! An dem Punkt leidet ihr seit Anbeginn! 20 Prozent ...!)
Zum Dritten – inhaltlich noch ergänzend; was ja auch schon von meinen Tiroler Kollegen und der Frau Bundesministerin gesagt wurde – möchte ich schon betonen, dass es uns wichtig ist, dass wir – von der Bundesregierung, aber auch als Zeichen von uns im Nationalrat – die Maßnahmen für Tirol, für die Tiroler Bevölkerung weiterhin massiv unterstützen. Man darf das nicht unterschätzen, es ist ein wichtiges gemeinsames Signal.
Es geht aber auch – und das möchte ich ergänzen – um die Verkehrssicherheit, die wir gewährleisten müssen (Abg. Deimek: 95 Ausreden, wenn ... fehlt! Das ist das, was die ÖVP mitgestimmt hat, aber eigentlich nicht will! Das ist Feigheit!), und es geht auch darum, dass wir eine gewisse Planungssicherheit für die heimische Wirtschaft, für die Betriebe in Tirol – aber auch außerhalb Tirols – gewährleisten, denn es bringt nichts, wenn wir sozusagen nur verstopfte Straßen haben, Straßen, die dadurch massiv betroffen sind, weil wir zu viel Transitverkehr haben. (Abg. Deimek: Ihr seids für die Deindustrialisierung! Ihr habts das alles gemacht, nicht wir!) Wir brauchen Maßnahmen, damit auch die heimische Wirtschaft entsprechende Planungssicherheit hat, und deswegen stehen wir zu hundert Prozent hinter diesen Maßnahmen. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
16.32
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
Erklärung des Präsidenten anlässlich des Angriffs auf den slowakischen Regierungschef Robert Fico
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Bevor wir zur Abstimmung kommen, darf ich noch die Gelegenheit nutzen, darauf hinzuweisen, dass der slowakische Regierungschef, Robert Fico, am heutigen Tag nach einer Regierungssitzung angeschossen wurde.
In den vergangenen Wochen ist es auch in Europa immer wieder vorgekommen, dass Politiker tätlich angegriffen wurden, dass Politiker Ziel von gewalttätigen Übergriffen wurden. Ich denke, dass jede dieser Attacken auch vom österreichischen Parlament auf das Schärfste zu verurteilen ist und eine Attacke auf die Demokratie ist.
Ich glaube, dass ich in Ihrem Namen spreche, wenn ich sage, dass wir Robert Fico, der sich im Krankenhaus befindet, das Allerbeste zur Genesung wünschen, ihm eine baldige und vollständige Genesung wünschen. (Allgemeiner Beifall. – Abg. Michael Hammer: Das kommt von den Radikalinskis! Da haben wir auch ein paar da, die aufhussen und aufhetzen! – Abg. Kickl: Ein ganz ein Schlauer! – Abg. Michael Hammer: Vokaki!)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Wir kommen nun zur Abstimmung über den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 2538 der Beilagen.
Ich darf die Damen und Herren, die für diesen Gesetzentwurf sind, um ein Zeichen der Zustimmung ersuchen. – Das ist die Mehrheit, angenommen.
Wir kommen sogleich zur dritten Lesung.
Wer dies auch in dritter Lesung tut, wird um ein Zeichen der Zustimmung gebeten. – Das ist mit Mehrheit in dritter Lesung angenommen.
Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Andreas Ottenschläger, Hermann Weratschnig, Selma Yildirim und Johannes Margreiter, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Tiroler Bevölkerung schützen und die Tiroler Landesregierung unterstützen: Gesundheits- und Umweltschutz sowie Versorgungssicherheit in Tirol haben einen höheren Wert als die freie Fahrt für Millionen von Transit-LKW“.
Wer dafür ist, den bitte ich um ein entsprechendes Zeichen. – Das ist die Mehrheit, angenommen. (371/E)
Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Wurm, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Tiroler Bevölkerung schützen und die Tiroler Landesregierung unterstützen: Gesundheits- und Umweltschutz sowie Versorgungssicherheit in Tirol haben einen höheren Wert als die freie Fahrt für Millionen von Transit-LKW“.
Wer dafür ist, wird um ein Zeichen gebeten. – Das ist die Minderheit, abgelehnt.
Bericht des Umweltausschusses über den Antrag 4016/A der Abgeordneten Lukas Hammer, Johannes Schmuckenschlager, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Klimabonusgesetz geändert wird (2539 d.B.)
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Wir kommen zum 5. Tagesordnungspunkt.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Schmidt. – Sie haben das Wort, Frau Abgeordnete.
16.35
Abgeordnete MMag. Michaela Schmidt (SPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Frau Bundesministerin! Ich habe heute in der Früh die ÖVP-Finanzpolitik kritisiert, weil sie undurchsichtig und ungerecht ist, nur die Zielgruppe der Superreichen und der Konzerne bedient und damit das Steuergeld an die Falschen verteilt.
Wenn man sich den Klimabonus anschaut, dann sieht man, dass meine Kritik an der ÖVP doch ein bisschen zu kurz greift, weil man schon sagen muss: Es ist den Grünen anzulasten, wie der Klimabonus verteilt wird. Wir sind enttäuscht darüber, dass es auch diesmal keine Änderung bei dieser regionalen Lotterie gibt, die wir seit Jahren kritisieren. Das vorgelegte Klimabonusgesetz ist wieder einmal ein verzweifelter Versuch, die fehlende Bekämpfung der Teuerung dadurch zu überdecken, dass man Geld ausschüttet, dass man das Füllhorn öffnet.
In Zeiten einer selbst angefachten Rekordteuerung hätte die Bundesregierung die CO2-Steuer aussetzen müssen (Abg. Schnabel: Redets einmal mit der Kollegin Herr! – Abg. Schmuckenschlager: Das sagt ihr aber auch im Umweltausschuss anders! – Abg. Schnabel: Ja, redets mal mit der Kollegin Herr!), weil die Energiepreise ohnehin so hoch waren, dass sie bei denjenigen, die es sich leisten können, eh zu einer Lenkungswirkung geführt haben. Die hätten auch ohne die CO2-Steuer in Wärmepumpen, Pelletkessel und Fotovoltaikanlagen investiert. Das Problem ist aber, dass diejenigen, die es sich nicht leisten können, schon ohne die CO2-Steuer die größten Probleme gehabt haben, ihre Energierechnungen zu bezahlen – und die haben die CO2-Steuer noch obendrauf bekommen.
Dann wurde dieser Klimabonus hochgehalten und argumentiert, das mache ja nichts, man verteile das Geld ja ohnehin an die österreichische Bevölkerung zurück. Das stimmt zwar, aber die Frage ist: Wie? – Das Geld wird ziellos in einer regionalen Lotterie verteilt. (Abg. Schnabel: Statistik Austria ist kein Lotterieunternehmen!)
Man hat den Verdacht, dass es die oberste Prämisse war, einen Mechanismus zu finden, wie man die städtische Bevölkerung benachteiligt. Es ist nämlich vor allem die Bevölkerung in den – mehrheitlich sozialdemokratisch regierten – Städten, die weniger bekommt. (Abg. Schmuckenschlager: Da gibt’s mehr öffentlichen Verkehr! – Abg. Schnabel: Da gibt’s halt auch zum Beispiel eine U-Bahn! Am Land nicht!) Wiener:innen oder Salzburger:innen werden schlechter behandelt, und das, obwohl sie sich im Normalfall oder sehr oft tatsächlich ökologischer verhalten. (Beifall bei der SPÖ. – Abg. Himmelbauer: Habts was gegen die Landbevölkerung?!)
Ich darf daran erinnern, dass diese regionale Lotterie noch im Dezember hier, in diesem Parlament, von ÖVP-Bürgermeister:innen kritisiert wurde. Trotzdem hat man keinen Versuch unternommen, etwas zu verbessern. Statt sozialen Kriterien bleibt die Postleitzahl entscheidend dafür, wie viel man von diesem Geld zurückbekommt.
Der Klimabonus soll laut dem heute Morgen eingelangten Abänderungsantrag von maximal 220 auf 290 Euro erhöht werden. Das ist eine Steigerung von über 30 Prozent. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass auch die CO2-Steuer in dieser Größenordnung gestiegen ist – und das, obwohl die Inflation und die Energiepreise weiterhin im europäischen Spitzenfeld liegen.
Die Art und Weise, wie das passiert ist: Es wurde zuerst von Vizekanzler Kogler medial angekündigt – er hat ja 330 Euro versprochen, jetzt ist es ein bisschen weniger geworden –, aber im Ausschuss wollte man offensichtlich wieder nicht darüber diskutieren. Da hat man uns eine Trägerrakete präsentiert, ein „sowie“ in ein „und“ geändert und gesagt, ja, man müsse wieder irgendwelche Daten richten. Und heute Früh kriegen wir die Abänderungsanträge und erfahren aus den Medien, wie die Regierung damit weitermacht, das Geld zu verteilen.
Zusätzlich zum Klimabonus gibt es übrigens auch noch 200 Millionen Euro für die Landwirte, denn im Gegensatz zu den Mieter:innen und den Pendler:innen kann man es ihnen offensichtlich nicht zumuten, den CO2-Preis beim Agrardiesel
zu bezahlen. Das heißt, „Koste es, was es wolle“ bleibt weiterhin die Strategie der Regierung, und das, obwohl uns die Europäische Kommission heute mitgeteilt hat, dass auch sie davon ausgeht, dass wir das Budgetdefizit von 3 Prozent im heurigen Jahr nicht erreichen werden.
Liebe Bundesregierung, euer Versagen beim Bekämpfen der Teuerung werden die Wählerinnen und Wähler am Wahltag nicht vergessen haben, ganz egal, wie hoch der Klimabonus ist. Die nächste Regierung erbt neben der regionalen Lotterie auch ein katastrophales Budget, das die Sozialdemokratie dann wird richten müssen. – Danke. (Beifall bei der SPÖ.)
16.39
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Schwarz. – Bitte.
Abgeordneter Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA (Grüne): Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Ministerin! Hohes Haus! Liebe Zuseherinnen und Zuseher! Vielleicht erlauben Sie mir, kurz noch auf die Worte der Vorrednerin einzugehen. Die regionale Staffelung ist keine „Lotterie“, sondern an sehr klaren Kriterien ausgerichtet, die damit zu tun haben, wie einfach es ist, die Bedürfnisse des täglichen Bedarfs zu erfüllen.
Es kann sein, dass man in sehr entlegenen Regionen, zum Beispiel um zur Schule, zum Amt oder auch zum Kindergarten, zum Supermarkt zu kommen, auf das Auto – oder sonst irgendwie auf Fahrräder oder auf andere Transportmittel – angewiesen ist (Abg. Krainer: Aber das Heizen ist egal?) und nicht einfach um die Ecke gehen und dort diese Bedarfe decken kann. (Abg. Krainer: Ach so! Aber das Heizen ist egal? Also nur das Auto zählt? Ah, Autoförderung! Gut gemacht, Grüne!) Deshalb ist es schon sinnvoll, damit sich das Ganze auch ausgeht, dass es regional gestaffelt ist und, nach klaren Kriterien, für besonders entlegene Regionen entsprechend höher ist.
Das Zweite ist: Es stimmt natürlich, dass zum Teil – nicht sozusagen quer über die gesamte Bevölkerung, aber zum Teil – die städtische Bevölkerung ökologischer lebt als andere Teile der Bevölkerung am Land, aber deshalb zahlt man ja auch weniger aufgrund der CO2-Bepreisung ein. Das ist ja genau die Logik. (Abg. Krainer: Ah, mit Gas, wenn man mit Gas heizt, zahlt man weniger ein? Das ist interessant!) Und weil die anderen aufgrund der CO2-Bepreisung mehr einzahlen – wer weniger ökologisch lebt, zahlt mehr ein –, macht es schon Sinn, das zum Teil auch auszugleichen. (Abg. Krainer: Das macht total Sinn, es ist nur falsch!)
Ich möchte aber auf einen anderen Aspekt eingehen, nämlich dass ich in Gesprächen feststelle – und zum Teil hat das ja jetzt sozusagen bei der „Lotterie“ auch so durchgeklungen –, dass der Zusammenhang zwischen der CO2-Bepreisung und dem Klimabonus nicht immer erkannt wird. So haben beispielsweise Sie, indem Sie verneint haben oder quasi nicht anerkannt haben, dass Menschen in der Stadt weniger aufgrund der CO2-Bepreisung einzahlen, den Zusammenhang schon ein bissel aufgetrennt – in Wahrheit gehören diese zwei Dinge aber zusammen. Mich als jemand, der das mitverhandelt, mitkonzipiert hat, ärgert das ein bissel. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass wir jetzt beispielsweise den Klimabonus diskutieren, die CO2-Bepreisung aber erst unter Tagesordnungspunkt 11, und dementsprechend ist es auch immer wieder eine Herausforderung, diese zwei Dinge zusammenzubringen.
Ich habe deshalb beschlossen, dass ich jetzt quasi eine Rede zu beiden Tagesordnungspunkten halten werde, ich werde jetzt eben anfangen und das dann unter Tagesordnungspunkt 11 fortsetzen, um quasi zu verdeutlichen, wie diese zwei Dinge zusammengehören.
Zuerst noch einmal zurück zum Klimabonus: Warum ist dieser im Zusammenhang mit der CO2-Bepreisung so wichtig?
Das Erste ist: Man zahlt jetzt quasi zusätzliche Steuern dafür, wenn man fossile Energie nutzt und Emissionen verursacht, aber man weiß auch, was mit diesem
Geld passiert: Es wird nicht einfach irgendwo im Budget versickern, sondern es wird in Form des Klimabonus wieder zurückgezahlt – das ist ja schon einmal eine gute Sache.
Zweitens ist es grundsätzlich so, dass Menschen mit höherem Einkommen aus verschiedensten Gründen – das hat auch der Budgetdienst nachgewiesen – mehr aufgrund der CO2-Bepreisung einzahlen – sie fahren größere Autos, sie haben größere Häuser, sie sind vielleicht an Unternehmen beteiligt, die Emissionen verursachen –, aber über den Klimabonus, weil dieser nicht nach Einkommen gestaffelt ist, nur gleich viel herauskriegen wie die Menschen mit geringerem Einkommen. Deshalb hilft die CO2-Bepreisung dabei, den Umstieg Richtung klimaneutrale Alternativen für Menschen mit geringerem Einkommen zu erleichtern.
Drittens bleibt – obwohl fast für alle, insbesondere für Leute, die nicht überdurchschnittlich viel verdienen, mehr aus dem Klimabonus herauskommt, als sie aufgrund der CO2-Bepreisung eingezahlt haben – immer noch der Anreiz übrig, sich klimafreundlich zu verhalten, denn: Wenn ich fast keine Emissionen oder gar keine Emissionen verursache, bleibt mir der gesamte Klimabonus, in dem Fall jetzt die neuen 145 Euro, erhalten – und das ist natürlich ein großer Anreiz, Emissionen einzusparen. (Abg. Krainer: Ah? Und wie soll ein Mieter die Gasheizung loswerden?)
Damit das auch wirklich passiert, bringe ich einen Abänderungsantrag ein, der genau das zum Zweck hat, nämlich den Klimabonus entsprechend dem Anstieg der CO2-Bepreisung minus dem Effekt, den diese CO2-Bepreisung bereits gehabt hat – dass nämlich die Emissionen zurückgegangen sind, was ja eine großartige Sache ist –, im entsprechenden Ausmaß zu erhöhen, nämlich auf jetzt 145 Euro im Sockelbetrag.
Der entsprechende Abänderungsantrag von Kollegen Johannes Schmuckenschlager und mir sieht eben vor, dass diese Anpassung auf 145 Euro passiert, plus dass – um die Treffsicherheit noch einmal zu erhöhen – für Menschen mit besonders
hohem Einkommen auch ein Teil des Klimabonus besteuert, also über die Besteuerung wieder zurückgeliefert wird. Natürlich wäre es fair, das sozusagen pauschal an alle auszuzahlen, aber man kann auch gut dafür argumentieren, dass jene Leute, die eine steuerliche Bemessungsgrundlage von über 66 000 Euro haben – das Einkommen, wenn man auch die Sozialversicherungsbeiträge dazuzählt, ist dann noch wesentlich höher –, einen Teil davon wieder abgeben und nicht den gesamten Klimabonus brauchen. Das führt zu mehr Treffsicherheit. – Fortsetzung folgt. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
16.44
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Abänderungsantrag
der Abgeordneten Johannes Schmuckenschlager, Dr. Jakob Schwarz,
Kolleginnen und Kollegen
zum Bericht des Umweltausschusses über den Antrag 4016/A der Abgeordneten Lukas Hammer, Johannes Schmuckenschlager, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Klimabonusgesetz geändert wird (2539 d.B.) (TOP 5)
Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen:
Der eingangs bezeichnete Gesetzesantrag in der Fassung des Ausschussberichtes 2539 d.B. wird wie folgt geändert:
1. Die bisherige Ziffer 1 erhält die Ziffernbezeichnung "2.". Es wird folgende neue Ziffer 1 vorangestellt:
„1. In § 3 lautet Abs. 1:
„(1) Der einer Person für das Jahr 2024 auszuzahlende regionale Klimabonus besteht aus einem Sockelbetrag in Höhe von 145 Euro sowie dem Regionalausgleich gemäß § 4. Abs. 4 kommt für dieses Jahr bei der Festlegung der Höhe des Sockelbetrags nicht zur Anwendung. Der einer Person für die Jahre ab 2025 auszuzahlende regionale
Klimabonus besteht aus einem Sockelbetrag, der gemäß Abs. 4 festgelegt wird, sowie dem Regionalausgleich gemäß § 4. Der ermittelte Betrag ist auf volle fünf Euro aufzurunden.““
2. Nach der nunmehrigen Ziffer 2 wird folgende Ziffer 3 angefügt:
„3. In § 5 Abs. 1 lautet Z 7:
„7. vom Bundeskanzler: der (die) Familienname(n) und der (die) Vorname(n), Geburtsdatum und die internationale Kontonummer (IBAN) aller Personen, die eine Geldleistung aus der im § 44a BHG angeführten IKT Lösung beziehen oder empfangen, sowie Vor- und Familienname der Kontoinhaberin oder des Kontoinhabers, wenn diese Person von der die Geldleistung beziehenden Person abweicht.““
3. Nach der nunmehrigen Ziffer 3 wird folgende Ziffer 4 angefügt:
„4. In § 6 werden folgende Abs. 2 und 3 eingefügt:
„(2) Abweichend von Abs. 1 ist der regionale Klimabonus, der für das Kalenderjahr 2024 gewährt wird, im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung 2024 der Bemessungsgrundlage hinzuzurechnen, wenn das Einkommen (§ 2 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes 1988 – EStG 1988, BGBl. Nr. 400/1988) des Empfängers mehr als 66.612 Euro beträgt. § 3 Abs. 1 Z 37 EStG 1988 kommt insoweit nicht zur Anwendung. Bei lohnsteuerpflichtigen Einkünften ist in diesem Fall eine Veranlagung gemäß § 41 Abs. 1 EStG 1988 vorzunehmen.
(3) Für Personen, denen ein regionaler Klimabonus gemäß § 3 Abs. 1 ausbezahlt wurde, sind folgende Daten, soweit diese der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie vorliegen, bis spätestens Ende Februar des der Auszahlung folgenden Kalenderjahres elektronisch an den Bundesminister für Finanzen zu übermitteln: der (die) Familienname(n), der (die) Vorname(n), das Geburtsdatum, das verschlüsselte bereichsspezifische Personenkennzeichen (vbPK-SA) sowie das Jahr für das der Klimabonus gewährt wird.“
4. Nach der nunmehrigen Ziffer 4 wird folgende Ziffer 5 angefügt:
„5. Der bisherige § 6 Abs. 2 erhält die Absatzbezeichnung „4“.“
Begründung
Zu Z 1 (§ 3 Abs. 1)
Für das Jahr 2024 soll die Höhe des Klimabonus-Sockelbetrags im Klimabonusgesetz mit 145 Euro festgelegt werden. Die Bedeckung des über die Veranschlagung 2024 hinausgehenden Budgetbedarfs erfolgt auf Grundlage der im Artikel VI BFG 2024 festgelegten Überschreitungsermächtigung.
Zu Z 2 (§ 5 Abs. 1 Z 7)
Mit dieser Anpassung soll klargestellt werden, dass seitens des Bundeskanzlers auch Kontodaten von Personen, welche eine Geldleistung von nicht zum Bund gehörigen Organen beziehen und welche über die Bundesbesoldung abgewickelt werden, für die Auszahlung des Klimabonus übermittelt werden dürfen.
Zu Z 3 (§ 6 Abs. 2, 3 und 4)
In § 6 Abs. 1 war bereits bisher verankert, dass der regionale Klimabonus kein eigenes Einkommen darstellt. Dadurch wird insbesondere gewährleistet, dass er für Zuverdienstgrenzen, die z.B. im Zusammenhang mit der Familienbeihilfe, der Waisenpension oder dem Alleinverdiener- und Alleinerzieherabsetzbetrag vorgesehen sind, unbeachtlich bleibt. Um die soziale Treffsicherheit des regionalen Klimabonus zu gewährleisten, sieht Abs. 3 eine Ausnahme vom Grundsatz vor, dass dieser nicht als Einkommen gilt. Diese Ausnahme betrifft nur die Einkommensbesteuerung des Empfängers eines regionalen Klimabonus und stellt eine lex specialis zu § 2 Abs. 1 und Abs. 2 EStG 1988 dar, die die Steuerbemessungsgrundlage regeln.
Durch die Regelung soll eine einkommensabhängige Differenzierung im Förderausmaß herbeigeführt werden, indem an das für die Einkommensteuerveranlagung maßgebende Einkommen angeknüpft wird: Übersteigt das Einkommen gemäß § 2
Abs. 2 EStG 1988 des Jahres, für das der regionale Klimabonus gewährt wurde, den Betrag von 66.612 Euro, ist der regionale Klimabonus in diesem Jahr im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung der Einkommensteuerbemessungsgrundlage (Einkommen i.S.d. § 2 Abs. 2 EStG 1988) hinzuzurechnen. Die Grenze entspricht der Grenze, nach der gemäß § 33 Abs. 1 EStG 1988 im Jahr 2024 der (Grenz)Steuersatz von 48% anzuwenden ist.
Die Hinzurechnung zum Einkommen auf Grund dieser Sonderbestimmung berührt die Systematik des EStG 1988 nicht. Der regionale Klimabonus ist nach Maßstäben des EStG 1988 keiner Einkunftsart zuzuordnen, er hat auf die Ermittlung des Gesamtbetrages der Einkünfte und das Einkommen selbst daher keine Auswirkung; er wird lediglich nach der Ermittlung des Einkommens der Bemessungsgrundlage hinzugerechnet, wenn das nach den Maßstäben des EStG ermittelte Einkommen mehr als 66.612 Euro beträgt.
Die Hinzurechnung erfasst nur den regionalen Klimabonus für einen Empfänger gemäß § 3 Abs. 1; der regionale Klimabonus für Personen unter 18 Jahren bleibt jedenfalls steuerfrei.
Um sicherzustellen, dass auch ohne Bestehen einer Steuererklärungspflicht die Versteuerung erfolgen kann, soll für diesen Fall ein Pflichtveranlagungstatbestand verankert werden.
In Abs. 3 soll eine Verpflichtung zur Datenübermittlung an den Bundesminister für Finanzen vorgesehen werden. Auf Grundlage der übermittelten Daten kann bei Zutreffen der Voraussetzung des Abs. 2 (Einkommen übersteigt 66.612 Euro) der regionale Klimabonus automatisch im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung des Empfängers berücksichtigt werden.
Zu Z 4 (§ 6 Abs. 4)
Redaktionelle Anpassung.
*****
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Der Abänderungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht worden, ist ausreichend unterstützt und steht mit in Verhandlung.
Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Rauch. – Bitte.
Abgeordneter Walter Rauch (FPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Frau Bundesminister! Hohes Haus! Vorab darf ich im Auftrag von Kollegen Werner Herbert eine Delegation der FPÖ-Bezirksgruppe Gänserndorf unter der Führung von Dieter Dorner begrüßen. (Beifall bei der FPÖ sowie bei Abgeordneten von ÖVP und SPÖ.)
Ja, Herr Kollege Schwarz, Sie haben versucht, es zu erklären, aber das Ganze, wie Sie es darlegen, wird immer komplizierter. Sie, Frau Bundesminister, haben ja heute versucht, ein Wahlzuckerl für die Bevölkerung hier in Österreich für die EU-Wahl und auch schon für die kommende Nationalratswahl so à la longue vorzubereiten, indem Sie die erste Stufe von 110 auf 145 Euro und die letzte von 220 auf 290 Euro pro Jahr anheben.
Was bedeutet das aber gleichzeitig? – Der Finanzminister ist natürlich auch im Rücken und versucht natürlich auch dementsprechend wieder zu kompensieren. Das heißt, von jedem Euro, der da jetzt ausbezahlt wird, geht einmal mindestens ein Drittel zurück an den Finanzminister. Das ist eigentlich ein Behördenmonster, ein Bürokratiewahnsinn, den Sie da aufgebaut haben. (Beifall bei der FPÖ.)
Der nächste Punkt ist natürlich der: Dieser Klimabonus soll ja die CO2-Steuer kompensieren. Nur: Gleichzeitig steigt natürlich auch die CO2-Steuer exorbitant mit. Was heißt das im Umkehrschluss? – Die CO2-Steuer ist natürlich ein wesentlicher Inflationstreiber, die CO2-Steuer ist wirtschaftsfeindlich, die CO2-Steuer ist wettbewerbsfeindlich.
Angesichts all dieser Maßnahmen muss man sagen: Wir haben ja die höchsten Preise bei Energie, Strom, Diesel, Sprit – alles, was wir brauchen, ist ja exorbitant teurer als in anderen Staaten –, und zusätzlich fahren Sie noch mit einer Steuer hinein.
Und dann – damit schließen wir das Ganze gleich ab, denn da muss man ja zu zweit eine Pressekonferenz machen – müssen natürlich die Bauern auch ein bissel beruhigt werden. Da kommt Herr Bundesminister Totschnig – wer kennt den?, er ist ab und zu da –, und was machen wir? – Die Bauern kriegen extra noch einmal 300 Millionen Euro. Das heißt, im Schnitt sind das 20 Cent pro Liter Diesel, was die Bauern dadurch kompensiert bekommen. Das heißt, ich gebe der einen Reichshälfte ein bissel was, dann kriegt die andere ein bissel was. Im Endeffekt sind diese Maßnahmen, ist das, was Sie hier machen, derartig hanebüchen, dass sich am Ende des Tages niemand mehr auskennt.
Und was die Regionalisierung betrifft, Herr Kollege Schwarz: Ich rede nur von meiner Heimatgemeinde – die ein bekannter Tourismusort, ein Kurort ganz im Süden von Österreich ist – Bad Radkersburg. Der nächste Ort, Halbenrain, bekommt schon die nächste Stufe. (Abg. Schwarz: Ja, eh!) Wir haben die gleiche Infrastruktur, wir haben dieselben Einrichtungen. Also es ist für niemanden erklärbar, dass ich, wenn ich 500 Meter in die andere Richtung fahre, dann einen höheren Betrag kriege oder einen niedrigeren. Diese Regionalisierung ist für niemanden in Österreich erklärbar – außer für Sie, die Sie es zu erklären versuchen. (Abg. Schwarz: Das ist absolut erklärbar! Wir gehen einmal gemeinsam einkaufen und dann schauen wir, wie leicht das geht!)
Zu guter Letzt ist bei diesem Klimabonus natürlich auch ein Punkt: Wer alles bekommt ihn? Das ist ja auch so ein entscheidender Faktor: Wer alles kriegt diesen Klimabonus?, und diesbezüglich bringe ich folgenden Antrag ein:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Walter Rauch, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Abschaffung des Klimabonus für Asylwerber“
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung, insbesondere die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, wird aufgefordert dem
Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, die den Klimabonus für Asylwerber und insbesondere Personen in der Grundversorgung als zusätzlichen Pull-Faktor abschafft.“
*****
Was heißt das konkret? – Der Klimabonus wäre ja ursprünglich dazu da, die CO2-Steuer zu kompensieren. Diese Personen, die ich jetzt aufgezählt habe, sind in der Grundversorgung, die haben keinen zusätzlichen Aufwand. Die müssen einzig und allein 183 Tage, also mindestens sechs Monate, hier in Österreich sein.
Daher: Es ist einem Österreicher, einem Steuerzahler nicht zu erklären, dass der Klimabonus für Asylwerber ausgezahlt werden soll. Die andere Geschichte, die wir gehabt haben, war der Klimabonus für Personen, die in einer Justizanstalt sind, das haben wir dann Gott sei Dank abgeschafft. Die Asylwerber also weiterhin in dieser Form zu unterstützen, obwohl sie keinen Mehraufwand haben, ist in dieser Art und Weise nicht gerechtfertigt.
Insgesamt ist der Klimabonus abzulehnen, und ein wesentlicher Punkt ist vor allem: Die CO2-Steuer gehört weg. (Beifall bei der FPÖ.)
16.49
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
des Abgeordneten Rauch
und weiterer Abgeordneter
betreffend Abschaffung des Klimabonus für Asylwerber
eingebracht in der 262. Sitzung des Nationalrates im Zuge der Debatte zum Bericht des Umweltausschusses über den Antrag 4016/A der Abgeordneten Lukas Hammer, Johannes Schmuckenschlager, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Klimabonusgesetz geändert wird (2539 d.B.) (TOP 5).
Auch 2024 soll der gestaffelte Klimabonus wiederum an illegale Wirtschaftsmigranten und Scheinasylanten in der Grundversorgung ausbezahlt werden. Die Verhöhnung der Österreicher, die unter der Rekordteuerung leiden, wird von der Bundesregierung von ÖVP und Grünen auf die Spitze getrieben. Während vordergründig eine restriktive Asylpolitik inszeniert wird, schafft man einen europaweit einzigartigen Pull-Faktor der eine Schubumkehr in der Asyl- und Einwanderungspolitik verunmöglicht.
Häftlinge hingegen wurden erst auf Druck der FPÖ1 mit einer Novelle des Klimabonusgesetztes von der Geldleistung mit folgender Begründung ausgeschlossen:
Des Weiteren werden durch die Anpassung Personen die sich im jeweiligen Anspruchsjahr für mehr als 183 Tage in Haft befinden, vom Bezug des regionalen Klimabonus ausgeschlossen. Dies ist sachlich insofern gerechtfertigt, als für diese Personen angenommen werden kann, dass sie keiner bzw. nur einem Teil der Belastung durch die CO2-Bepreisung, für welche der regionale Klimabonus ja Kompensation leisten soll, ausgesetzt sind. Sohin werden Strafgefangene Personen gleichgestellt, die keine mehr als 183 Tage andauernde Hauptwohnsitzmeldung im Inland vorweisen können.2
Im Rahmen der Grundversorgung erhalten Asylwerber, Asylberechtigte, Vertriebene und andere aus rechtlichen oder faktischen Gründen nicht abschiebbare Menschen in ebenfalls Leistungen, welche auf die Deckung der täglichen Grundbedürfnisse ausgerichtet sind. Die Grundversorgung umfasst:
• Unterbringung in geeigneten Unterkünften unter Achtung der Menschenwürde und unter Beachtung der Familieneinheit
• Versorgung mit angemessener Verpflegung
• Gewährung eines monatlichen Taschengeldes für Personen in organisierten Unterkünften und für unbegleitete minderjährige Fremde, ausgenommen bei individueller Unterbringung gemäß Art. 9 Z 2
• Durchführung einer medizinischen Untersuchung im Bedarfsfall bei der Erstaufnahme nach den Vorgaben der gesundheitsbehördlichen Aufsicht
• Sicherung der Krankenversorgung im Sinne des ASVG durch Bezahlung der Krankenversicherungsbeiträge
• Gewährung allenfalls darüberhinausgehender notwendiger, durch die Krankenversicherung nicht abgedeckter Leistungen nach Einzelfallprüfung
• Maßnahmen für pflegebedürftige Personen
• Information, Beratung und soziale Betreuung der Fremden durch geeignetes Personal unter Einbeziehung von Dolmetschern zu deren Orientierung in Österreich und zur freiwilligen Rückkehr
• Übernahme von Transportkosten bei Überstellungen und behördlichen Ladungen
• Übernahme der für den Schulbesuch erforderlichen Fahrtkosten und Bereitstellung des Schulbedarfs für Schüler
• Maßnahmen zur Strukturierung des Tagesablaufes im Bedarfsfall
• Gewährung von Sach- oder Geldleistungen zur Erlangung der notwendigen Bekleidung
• Kostenübernahme eines ortsüblichen Begräbnisses oder eines Rückführungsbetrages in derselben Höhe und
• Gewährung von Rückkehrberatung, von Reisekosten sowie einer einmaligen Überbrückungshilfe bei freiwilliger Rückkehr in das Herkunftsland in besonderen Fällen.
Es gibt keinerlei sachliche Rechtfertigung dafür, Nicht-Österreichern in der Grundversorgung, die keinen Strom, keinen Treibstoff, keine Lebensmittel, nichts für Kleidung, keine Heizung, keine Krankenversicherung, keine Sozialversicherung und
keine Steuern zahlen müssen, einen Klimabonus zu schenken. Diese Personen werden über die Grundversorgung vom Steuerzahler vollumfänglich alimentiert.
Vor diesem Hintergrund ist die Auszahlung des Klimabonus für Personen in der Grundversorgung als zusätzlicher Pull-Faktor abzuschaffen. Dies ist sachlich in gleicher Weise wie die Häftlinge betreffend gerechtfertigt, zumal auch für diese Personen angenommen werden kann, dass sie keiner bzw. nur einem Teil der Belastung durch die CO2-Bepreisung, für welche der Klimabonus ja Kompensation leisten soll, ausgesetzt sind.
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung, insbesondere die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, wird aufgefordert dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, die den Klimabonus für Asylwerber und insbesondere Personen in der Grundversorgung als zusätzlichen Pull-Faktor abschafft.“
1 Vgl. Antrag der Abgeordneten Christian Lausch, Kolleginnen und Kollegen betreffend Klimabonus für verurteilte Straftäter inklusive Antragsservice abschaffen, https://www.parlament.gv.at/gegenstand/XXVII/A/3254.
2 Vgl. Bericht des Umweltausschusses über den Antrag 3428/A der Abgeordneten Johannes Schmuckenschlager, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über den regionalen Klimabonus (Klimabonusgesetz – KliBG) geändert wird, https://www.parlament.gv.at/gegenstand/XXVII/I/2071.
*****
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Der Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht und steht mit in Verhandlung.
Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Schnabel. – Bitte sehr, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Joachim Schnabel (ÖVP): Herr Präsident! Geschätzte Frau Ministerin! Hohes Haus! Werte Zuseherinnen und Zuseher hier auf der Galerie und vor den Monitoren! Wie schon meine Vorredner mehrfach ausgeführt haben, geht es jetzt um eine Änderung des Klimabonusgesetzes, mit der wir aufgrund der Anpassung der CO2-Bepreisung mehr oder weniger 1 : 1 auch den Klimabonus anheben, nämlich um genau 35 Euro auf 145 Euro im Sockelbetrag.
Wie kommt es eigentlich dazu, dass wir diesen Betrag anheben? – Einerseits wurde schon genannt, dass die CO2-Bepreisung auf 45 Euro pro Tonne CO2 angestiegen ist. Da muss man schon sagen, auch in Richtung der SPÖ und in Richtung der Freiheitlichen Partei: Das ist ja kein Alleingang Österreichs, das ist genau der gleiche Preis, den zum Beispiel auch die Bundesrepublik Deutschland hat. (Abg. Schnedlitz: Gratuliere! – Abg. Kassegger: Das ist ja gleich deppert!) Die Bundesrepublik Deutschland hat auch 45 Euro. (Abg. Schmidt: Die haben aber eine niedrigere Inflation! – Abg. Herr: ... Inflation niedriger!) Auch vielleicht zu den Freiheitlichen gesprochen: In der Schweiz ist er noch viel höher. (Abg. Schmidt: Da ist die Inflation noch niedriger! – Abg. Herr: ... eine noch niedrigere Inflation!) Das ist ja so ein Musterland, welches Sie immer zitieren. In der Schweiz liegt der Preis pro Tonne CO2 bei über 100 Euro. – Deswegen ist der Betrag gut angesetzt. Das war auch das, was wir immer gesagt haben: Mit einem Preis, der wirtschaftlich verträglich ist und der auch an die Menschen in Österreich rückverteilt wird, wollen wir die Menschen durch Anreize dazu mobilisieren, das Klima zu schonen.
Was ist aber auch noch gelungen? – Da muss ich schon Frau Kollegin Schmidt darauf hinweisen, dass im Umweltausschuss auch vonseiten der SPÖ immer ganz, ganz anders gesprochen wird. Sie sagen, wir sollen die CO2-Bepreisung
aussetzen. Frau Kollegin Herr, die in der ersten Reihe sitzt, fordert immer wieder etwas ganz anderes (Abg. Schmidt: Wir haben Entschließungsanträge eingebracht!), teilweise auch viel höhere Beträge (Abg. Herr: Das stimmt nicht! Noch nie!) und dass wir im Bereich des Umweltschutzes viel weiter gehen und massiv vorangehen sollen. – Das haben wir nicht getan, aus guten Gründen, damit es eben auch wirtschaftlich verträglich ist.
In Summe haben diese Maßnahmen, die es in den letzten Jahren gegeben hat, dazu geführt, dass der CO2-Ausstoß in Österreich auch im vergangenen Jahr um 5 Prozent gesunken ist. Wir sind jetzt erstmals seit 1990 beim CO2-Ausstoß in Österreich auf unter 70 Millionen Tonnen. In Summe sind es in den letzten 20 Jahren um 20 Prozent weniger CO2-Emissionen, und das ist, auch was das Klima und die Nachhaltigkeit betrifft, sehr, sehr wichtig. Da ist die ÖVP als einzige Partei über eine lange Etappe mit in der Regierung gewesen, und es zeigt sich auch, dass da die Maßnahmen wirken.
Was beschließen wir noch mit? – Eine Verwaltungsvereinfachung, also das sogenannte Bürokratiemonster läuft in vielen Bereichen automatisiert ab. Wir nutzen die Kraft der Digitalisierung in einem weiteren Register, um dementsprechend die automatische Auszahlung zu erreichen.
Was möchte ich aber unter diesem Tagesordnungspunkt noch erwähnen? – Es sind ja andere Gesetzesmaterien notwendig, um überhaupt zu einer Reduktion des CO2-Ausstoßes zu kommen. Um – und das sollte eigentlich am Ende das Ziel sein – keinen Klimabonus mehr auszahlen zu müssen, bedarf es weiterer Gesetzesmaterien. Einerseits bin ich froh, dass das Wasserstoffförderungsgesetz den Ministerrat passiert hat, damit wir, was die erneuerbare Energie betrifft, mit dem Wasserstoff dementsprechend wirklich gute Alternativen anbieten können. Auf der anderen Seite braucht es aber noch weitere Gesetzesmaterien, und die können die Regierungsparteien alleine nicht beschließen, da braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz, das
Elektrizitätswirtschaftsgesetz, um den Leitungsausbau im Stromsektor zu ermöglichen, oder auch – ganz wichtig – das Erneuerbares-Gas-Gesetz, das EGG, das auch eine Zweidrittelmehrheit braucht, wären notwendig, um eine CO2-Reduktion zu erreichen.
Liebe Freiheitliche Partei, Sie sagen immer, die Landwirtschaft ist Ihnen so wichtig. Ich verstehe nicht, warum Sie beim Erneuerbares-Gas-Gesetz nicht mitgehen, weil das vor allem für die Landwirtschaft schon ein Riesenthema ist: über die Landwirtschaft Biogas zu produzieren. Wenn es aber dann darum geht, unsere Energielandwirte zu unterstützen, dann ist Ihnen halt nicht das Biogas wichtig, sondern nur die Gazprom. Da ist es mit dem Patriotismus dann schnell vorbei und da gibt es dann keine Unterstützung Ihrerseits. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Schnedlitz: ... dann hätten es die Leute vielleicht verstanden!)
Geschätzte Damen und Herren! Mit dem Klimabonus, der angepasst wird, gibt es weitere Maßnahmen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Aus Sicht der ÖVP muss man sagen, es reicht nicht allein, Klimaschutz nur mit Herz zu machen, es braucht Klimaschutz mit Verstand: im Sinne des Generationenvertrages, auch was die Nachhaltigkeit betrifft, aber auch was den Wirtschaftsstandort betrifft, mit viel Wertschöpfung und Wohlstand – denn dann gibt es auch den dementsprechenden Sozialstaat dazu –, und auch über diese Nachhaltigkeit können wir den Staat Österreich absichern. – Danke. (Beifall bei der ÖVP.)
16.54
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Bernhard. – Bitte.
Abgeordneter Michael Bernhard (NEOS): Herr Präsident! Frau Ministerin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, wir diskutieren wieder einmal über den Klimabonus. Frau Ministerin, Sie wissen, wir sind keine Freunde und auch keine Freundinnen des Klimabonus. Warum ist das der Fall? – Ganz einfach: weil der Klimabonus am Ziel vorbeischießt.
Einerseits geht es nämlich um die CO2-Besteuerung. Da sind wir als NEOS dafür und sagen: Damit es einen Lenkungseffekt hat, muss ein vernünftiger CO2-Preis mittelfristig etabliert werden, der auch stärker zum wirtschaftlichen Umdenken anregt. Dafür gibt es nicht ein oder zwei Beispiele auf der Welt, sondern von China bis Mexiko mittlerweile 68 verschiedene CO2-Steuermodelle. Es ist also nicht etwas, was wir in Österreich jetzt gerade frisch erfunden haben.
Was ist aber das Problem in Kombination mit dem Klimabonus? – Der Klimabonus hat die Absicht gehabt, eine relativ grüne Politik zu verfolgen, nämlich eine Umverteilung – in welche Richtung auch immer, meistens irgendwie von links nach rechts und von oben nach unten; das meiste bekommt die Bürokratie –, der Effekt ist aber ein sehr negativer. Das eine ist: Zuerst erhöhen Sie die Abgabenlast, ohne woanders Steuern zu senken. Das heißt, etwas, was die Inflation durchaus ansteigen lässt, wird durch die CO2-Abgabe tatsächlich ein kleines Stück mitbefeuert – da hat die SPÖ durchaus recht.
Dann geben Sie über den Klimabonus den Bürgerinnen und Bürgern ein kleines Stück sozusagen – oder ein übergroßes Stück sogar – davon zurück und befeuern ein zweites Mal den Konsum. Das heißt, in einer Zeit, da Österreich innerhalb der Europäischen Union bereits eine viel zu hohe Inflation hat, ist es so, dass der Klimabonus dazu beiträgt, dass wir wiederum nicht ins richtige Feld vorrücken. Das ist ein Element, von dem Sie damals, als Sie das geplant haben, noch nicht wissen konnten, aber heute wirkt der Klimabonus tatsächlich so.
Unsere Kritik war von Anfang an, dass er zu kompliziert, zu bürokratisch ist, und Sie haben das Feld deutlich erweitert. Das Thema Regionalisierung wurde schon angesprochen: Wenn ich in Währing lebe, bekomme ich einen anderen Klimabonus, als wenn ich in Hernals lebe, und ich habe in beiden Fällen gleich weit zur U-Bahn-Station zu gehen. Es ist nicht mehr zu erklären, warum der Klimabonus an der einen Ecke anders als woanders ist. Die Kritik und die vielen Beispiele, die alle möglichen Abgeordneten schon vorgebracht haben, sollten das BMK durchaus auch anregen, diese Regionalisierung zu überdenken; denn wenn ein
Gesetz so viele Beispiele hervorbringt, bei denen man sagt: Das passt nicht!, dann braucht man eine andere Lösung, weil es dann halt nicht die richtige ist.
Sie haben jetzt eins draufgesetzt, nämlich die Einkommensteuer, und zwar wird bei 66 000 Euro Jahreseinkommen auch der Klimabonus dann entsprechend der vorgesehenen Einkommensteuer besteuert. Da könnte man sagen: Na ja, 66 000 Euro verdienen nicht viele, insofern wird es wenige betreffen, dann ist es auch fair! In diesem Jahr aber den Betrag bei 66 000 Euro festzulegen, ist ja nur das Einführen einer neuen Regel. Das führt erstens zu einer weiteren Bürokratie – ich muss jetzt noch einmal etwas anmelden, auch bei der Einkommensteuer –, und zweitens: Wer sagt denn, dass das nicht nächstes Jahr dann auf 45 000 oder auf 30 000 Euro reduziert wird? – Es ist in Bezug auf die Grundkritik, dass es zu kompliziert ist, dass es zu bürokratisch ist, ein weiteres Element, wenn Sie jetzt die Besteuerung hereinnehmen.
Im Übrigen bin ich sehr überrascht, dass die ÖVP da zustimmt, weil Sie gerade im Hinblick auf Ihr präferiertes Modell – dass Sie sagen, es gibt bei den Familien einen Hauptverdiener und eine Zusatzverdienerin – jetzt den Familien, die im Durchschnitt unter den 66 000 Euro pro Person liegen, sogar etwas vom Klimabonus wegnehmen. Ich weiß nicht, ob Sie das bei der Einbringung des Antrages verstanden haben, aber es ist tatsächlich etwas, was ein bisschen Ihren sonstigen Redebeiträgen entgegensteht, Herr Kollege Schmuckenschlager.
Jetzt komme ich noch zu einem dritten Punkt, der natürlich auch ungünstig ist. Auf der einen Seite reden wir über ein Gesetz, das die Inflation befeuert, auf der anderen Seite reden wir über ein Gesetz, das bürokratisch ist und das für sich genommen extrem viele Ungerechtigkeiten hat, bei dem irgendwie umverteilt wird, nach einer grünen Logik, die halt einfach nicht logisch ist – das muss man einfach auch einmal ganz klar so sagen –, und dann kommt ein dritter Punkt dazu, der das Ganze aus unserer Sicht noch weniger zustimmungswürdig macht: Wenn man nämlich fragt: Was ist denn budgetiert?
Wir hören ja immer: Was die CO2-Steuer an Einnahmen generiert, geben wir dann mit dem Klimabonus wieder aus. – Das stimmt nicht, oder es ist grüne Mathematik. Wenn man jetzt reingeht und fragt: Was ist denn im letzten Jahr eingenommen worden?, dann zeigt sich, dass es 843 Millionen Euro waren. Diese 843 Millionen Euro wurden bei den Ausgaben zu 1,4 Milliarden Euro. Man hat also 550 Millionen Euro mehr verteilt, als man überhaupt eingenommen hat. Das kann ein Klimaministerium sozusagen durchaus machen. Wenn man das als Kauffrau oder Kaufmann machen würde, hätte man ungefähr ein halbes Jahr, bevor man wiederum weg ist.
Jetzt kommt man zu dem Punkt: Wären es nur diese 550 Millionen Euro, wäre es ja schon schlimm genug. Die Steigerung des Ganzen ist aber das, was jetzt kommt. Der CO2-Preis – das wurde richtigerweise vorhin auch schon gesagt – steigt ungefähr um 38 Prozent, also steigt auch der Klimabonus um 38 Prozent. Die Erhöhung um diese 38 Prozent macht ungefähr 600 Millionen Euro aus. Diese 600 Millionen Euro müssten sich demnach ja im Budget 2024 finden. Der sehr wertvolle Budgetdienst hat ausgerechnet, dass nichts davon budgetiert ist. Neben den 550 Millionen Euro, die Sie verteilen, die Sie nicht eingenommen haben, sind die 600 Millionen Euro nicht budgetiert, sondern es werden, weil Sie eine Ermächtigungsverordnung erlassen können, Mittel aus den Rücklagen des BMK verwendet, um den Klimabonus zu finanzieren.
Dann ist natürlich einfach die Frage: Warum sind die NEOS gegen den Klimabonus? – Nicht, weil wir so fies sind, sondern weil wir gerne eine Klimapolitik hätten, die das Klima schützt, ohne die Menschen zu ärgern. Das ist relativ banal: Wir wollen etwas, was wirkt, was nicht bürokratisch ist, bei dem Sie eben nicht das eine Mal 550 Millionen Euro zu viel ausgeben und das andere Mal vergessen, 600 Millionen Euro zu budgetieren. Das ist 1 Milliarde Euro, die Sie einfach so mehr ausgeben, als Sie eingenommen haben, und mehr, als Sie erzielen. Diese 1 Milliarde Euro müssen Sie erst einmal durch Steuerleistung wieder verdienen, und da haben wir von den Grünen noch nie einen guten
Vorschlag gehört. Deswegen sind wir auch dagegen. (Beifall bei den NEOS. – Abg. Künsberg Sarre: Sehr gute Rede!)
17.00
Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Frau Bundesminister Gewessler. – Bitte sehr.
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie Leonore Gewessler, BA: Herr Präsident! Werte Abgeordnete! Werte Zuseherinnen und Zuseher! CO2-Bepreisung und Klimabonus sind das Herzstück der ökosozialen Steuerreform und sie stellen gemeinsam sicher, dass Menschen, die das Klima schützen, nicht nur einen Anreiz dazu haben, sondern auch finanziell davon profitieren und dass alle, die dem Klima schaden, auch einen entsprechenden Beitrag leisten. (Präsidentin Bures übernimmt den Vorsitz.)
Mit der ökosozialen Steuerreform haben wir den Klimaschutz wirklich als Rädchen im Steuersystem verankert und haben damit sichergestellt, dass die Zukunft unseres Planeten auch im Steuersystem mitgedacht wird, und zwar durchgängig. Und das, nachdem wir in Österreich 30 Jahre über den Klimaschutz und die CO2-Bepreisung geredet haben. Diese Bundesregierung hat es umgesetzt, hat es gemacht, und wir sehen jetzt: Es wirkt! (Beifall bei den Grünen.)
Im Jahr 2022 war das eine große Reform, eine umfassende Neuerung. Mittlerweile greifen diese Räder im Steuersystem aber schon gut ineinander, drehen sich, entwickeln sich weiter, genauso wie wir das immer vorgesehen haben: Der CO2-Preis steigt, und zwar planbar für alle, die Emissionen sinken Jahr für Jahr, und mit dem Klimabonus lohnt sich der Klimaschutz eben auch finanziell.
Der CO2-Preis ist wie geplant im heurigen Jahr gestiegen (Abg. Kassegger: Jetzt müssen wir nur noch die spannende Frage der Koordination klären!), die Summen wurden schon genannt, und vor diesem Hintergrund ist auch der Sockelbetrag
des Klimabonus von 110 Euro auf gerundet 145 Euro gestiegen, um auch die gestiegenen CO2-Preise mitzubedenken und auszugleichen.
Gleichzeitig – auch das ist schon erwähnt worden; das ist heuer eine Neuerung heuer – wird es das erste Mal so sein, dass der Klimabonus von Menschen, die besonders viel verdienen, also als Einzelperson ein steuerliches Jahreseinkommen von über 66 600 Euro haben, versteuert werden muss.
Die Lenkungswirkung zum Klimaschutz macht der Preis, aber der Klimabonus sorgt dafür, dass jenen, die sich umweltfreundlich verhalten, mehr im Börsl bleibt. Wir nehmen da natürlich Rücksicht auf unterschiedliche Lebensrealitäten. Diese sind ja vorhin sozusagen im Pingpong zwischen Redner und Plenum angesprochen worden.
Jeder und jede bekommt einen Sockelbetrag, natürlich auch alle, die mit Gas heizen. Was sich dann aber unterscheidet, ist, dass er auf unterschiedliche Realitäten in der regionalen infrastrukturellen Ausstattung Rücksicht nimmt. Dazu dient der regionale Ausgleich: Wir haben Menschen in Regionen mit gering verfügbarer Infrastruktur und schlechter Öffianbindung, die einen höheren Regionalausgleich bekommen, weil sie eben im Alltag, in der Realität oft aufs Auto angewiesen sind. Wir berücksichtigen so regionale Unterschiede in der Anbindung an den öffentlichen Verkehr und in der verfügbaren Infrastruktur – Schulen, Krankenhäuser et cetera –, und wir differenzieren da nicht nur in Wien, wir tun das auch in Kärnten und im Burgenland. Das machen auch nicht wir, sondern die Statistik Austria, und die ist da wirklich farbenblind, was die Parteizugehörigkeit der Landeshauptleute betrifft.
Wir haben inklusive des Regionalausgleichs heuer Auszahlungsstufen von 145, 195, 245 und 290 Euro. Wir haben die progressive Wirkung der CO2-Bepreisung, die ja schon angesprochen wurde, die zuletzt auch kritisiert, aber durch eine Analyse des Budgetdiensts auch bestätigt wurde: Der Median der Einkommensveränderung ist im obersten Dezil null und bis zu plus 0,9 Prozent
im untersten Dezil. Das heißt also, der Klimabonus wirkt wirklich auch sozial progressiv, und das ist gut.
Ein wesentlicher Bestandteil ist die antragslose Abwicklung, bei der Anspruchsberechtigte ohne eigenes Zutun den Klimabonus direkt und unkompliziert erhalten. Besonders schnell und kosteneffizient geht das mit der Überweisung. Wir haben 2023 bereits bei über 87 Prozent aller anspruchsberechtigten Personen direkt auf das Konto überwiesen. Wir wollen diese Überweisungsquote natürlich noch steigern. Derzeit können wir 1,2 Millionen Überweisungen pro Tag machen, können somit alle Überweisungen innerhalb von zwei Arbeitswochen abschließen. Das ist wirklich, sage ich jetzt, Österreichtempo, denn die Deutschen beneiden uns um dieses Tempo, bei den Überweisungen kriegen sie kein Deutschlandtempo zusammen.
Für den Klimabonus 2024 wollen wir das aber noch einmal steigern, und deswegen wird mit diesem Antrag auch die Datenbasis durch die Anbindung der Bundesbesoldung und die dort verfügbaren Kontodaten erweitert, damit eben noch mehr Menschen den Klimabonus einfach und unkompliziert per Überweisung erhalten.
Sie sehen also, die ökosoziale Steuerreform wirkt. Die CO2-Emissionen in Österreich sind gesunken, sie sind auf einem Rekordwert im positiven Sinn, nämlich so weit unten wie seit den detaillierten Aufzeichnungen seit 1990 noch nie. CO2-Bepreisung und Klimabonus gemeinsam wirken, Klimaschützen lohnt sich auch finanziell, und mit dem Anstieg der Bepreisung steigt eben auch der Klimabonus im Jahr 2024 auf 145 bis 290 Euro. Die Auszahlung – auch für alle, die uns zusehen – startet wie gewohnt nach dem Sommer, alles wie bekannt automatisch.
In diesem Sinn darf ich Sie bitten, dass wir zur noch besseren Abwicklung und zur Anpassung des Klimabonus 2024 heute hier eine breite Zustimmung finden. – Herzlichen Dank. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
17.06
Präsidentin Doris Bures: Nun gelangt Herr Abgeordneter Johannes Schmuckenschlager zu Wort. – Bitte.
Abgeordneter Johannes Schmuckenschlager (ÖVP): Frau Präsidentin! Frau Bundesministerin! Geschätzte Damen und Herren! Klimaschutz ist vor allem ein Thema der Verpflichtung über Generationen, und so freut es mich, dass ich die Mittelschule Söll in Tirol begrüßen darf, denn heute geht es um Ihre Zukunft – um die Zukunft der Kinder, die heute in diesem Land leben, aber auch um die Zukunft der folgenden Generationen. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
Diese Bundesregierung hat es sich zum Ziel gesetzt, CO2 zu reduzieren, weil CO2 der Haupttreiber für den Klimawandel ist, und wenn wir über CO2-Besteuerung reden, dann reden wir über ein Regelwerk, das wir in unser Steuersystem miteingebunden haben. Die höchste CO2-Steuer aber zahlen die Österreicherinnen und Österreicher tagtäglich in verschiedenster Form durch die Auswirkungen des Klimawandels, sei es im gesundheitlichen Bereich, sei es in der Frage der Wirtschaft, sei es in der Frage der Landwirtschaft – erst kürzlich mit den Frost- und Hagelschäden quer durch Österreich. (Abg. Schellhorn: Die Hagelversicherung ...! ... zahlt nur, wenn’s bewölkt ist!) Da sehen wir die Auswirkungen und die Schwierigkeiten!
Wir müssen da anpassen, aber auch unsere Verantwortung wahrnehmen, um zu reduzieren. Die Bundesregierung hat das sehr klargemacht. Sie hat gesagt, wir brauchen die ökosoziale Steuerreform und im gleichen Zug eine CO2-Bepreisung, so wie wir es in ganz Europa haben. Das ist kein Wunschkonzert, und wir sind sicher nicht für neue Steuern zu haben. Darum hat man auf der anderen Seite die Kompensation durch den Klimabonus geschaffen.
Über die Jahre, seit wir jetzt mit dem Klimabonus arbeiten, haben wir gesehen, dass wir da sehr, sehr erfolgreich unterwegs sind, dass wir aber auch
Anpassungen vornehmen müssen. So machen wir auch heute wieder eine Anpassung, damit es im administrativen Weg noch leichter ist.
Und ja, mit der jetzigen Erhöhung der CO2-Bepreisung haben wir auch wieder den Klimabonus angehoben. Das kann den einen gefallen, den anderen nicht. Wir sollten, und das wäre auch die Verantwortung der SPÖ, nicht nur in den Umweltfragen auf die CO2-Reduktion schauen, sondern es uns auch in der gesamten Frage nicht so leicht machen, dass wir in FPÖ-Style herausgehen (Abg. Holzleitner: Na geh!) und Stadt und Land gegeneinander ausspielen. Wenn es um den Klimabonus geht, sollten Sie sich nicht so klein machen.
Auch Sie haben Mitglieder in ländlichen Regionen, und genau dort soll es helfen, weil man dort eben nicht die Infrastruktur hat, dass man jeden Tag im Viertelstundentakt mit der U-Bahn fahren kann. Wir haben noch keine U-Bahn in Litschau, und das wird auch so schnell nicht kommen. Daher müssen wir schauen, wie wir die Bevölkerung bei diesen CO2-Einsparungsmaßnahmen mitnehmen können. (Beifall bei der ÖVP sowie des Abg. Litschauer.)
Das ist der ganze Ansatz! Auch die Thematik Arm und Reich trifft überhaupt nicht zu, denn dort, wo Besserverdiener den Klimabonus bekommen, sind sie jetzt in der Einkommensteuer auch pflichtig, einen Teil abzugeben. Das gefällt uns als ÖVP nicht – der Vorredner der NEOS hat es ja gesagt –, das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, aber es gehört halt ins demokratische Spektrum, dass man das am Ende des Tages auch mittragen muss, wenn man letztendlich einen Erfolg bringen will.
Ich glaube, das ist wichtig, denn wir können nicht so hanebüchen arbeiten wie die FPÖ, die hier am Rednerpult sagt: Jetzt habt ihr auf der anderen Seite für die Bauern den Agrardiesel, stimmt da zu! – Na ja, wenn es so einfach wäre! Da könnten aber auch Sie einmal zu den Bauern stehen und nicht nur in irgendwelchen Reden draußen Bauern verunsichern, sondern wenn es hier darum geht, abzustimmen, auch tatsächlich hinter den Bauern stehen. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
Wir sehen diese Anpassungen in vielen Bereichen der Gesellschaft, in denen es einfach notwendig ist, und am Ende des Tages sehen wir aber auch in der volkswirtschaftlichen Rechnung, dass es sinnvoll ist. Denn: Wozu sollen wir am Ende des Tages mit CO2-Strafzöllen, mit CO2-Strafzahlungen unser Geld ins Ausland transferieren, wenn wir vorher volkswirtschaftlich im Inland investieren können, unsere Bevölkerung entlasten können und gleichzeitig das Klima auch entsprechend verbessern? – Das ist, glaube ich, ein Auftrag, der absolut nachhaltig und generationengerecht ist. (Beifall und Bravoruf bei der ÖVP sowie Beifall bei Abgeordneten der Grünen. – Ruf: Heute haben wir Akkordarbeit!)
17.11
Präsidentin Doris Bures: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Michael Schnedlitz. – Bitte. (Abg. Leichtfried: Der kennt sich aber nicht aus!)
Abgeordneter Michael Schnedlitz (FPÖ): Frau Präsident! Frau Bundesminister! Wissen Sie, warum die Menschen vor allem von den Grünen und von Ihnen, Frau Ministerin, die Nase voll haben? – Das ist, weil Sie ihnen mit beiden Händen das Geld aus der Tasche ziehen – Stichwort: Klimakommunismus, CO2-Steuer, Strafsteuer – und dann glauben, Sie können sie mit Almosen, die noch dazu niemand nachvollziehen kann, vom Steuergeld der Bevölkerung bezahlt, irgendwie abspeisen. Zusätzlich nutzen Sie das dann natürlich noch, um für Illegale ein Körberlgeld aufzustellen, damit das Ganze auch Asylwerber bekommen. – Deshalb haben die Menschen die Nase voll von Ihnen.
Aber wissen Sie, was die Menschen richtig wütend macht? (Ruf bei der ÖVP: Deine Reden! – Abg. Leichtfried: Der Kickl!) Nicht nur, dass sie eh schon wegen Ihnen unter der Teuerung leiden, sondern dass Sie die Menschen dann auch noch demütigen. Wie auch jetzt, Frau Minister, sinngemäß in Ihrem Redebeitrag, indem Sie die Pendler, die Fleißigen in diesem Land und die Menschen, die auf das Auto angewiesen sind, als Klimaschädlinge hinstellen. – Das macht die Menschen ganz einfach wütend. (Abg. Schnabel: Das hat die SPÖ gesagt, nicht die
Frau Ministerin!) Es reicht nicht, dass Sie ihnen in die Tasche greifen, Sie müssen die Menschen dann auch noch demütigen.
Jetzt aber kommt es, sehr geehrte Damen und Herren, jetzt kommt es: Was machen Sie, während Sie die Autofahrer und die Fleißigen in diesem Land, die auf das Auto angewiesen sind, demütigen? – Sie tingeln mit dem Privatjet durch die Weltgeschichte, Sie machen das und fliegen mit dem Privatjet herum – aber das ist natürlich für das Klima vollkommen in Ordnung. (Ruf bei der ÖVP: Das ist notwendig!) Sehen Sie, wie verrückt das ist, sehr geehrte Damen und Herren? Deshalb können wir durchaus nachvollziehen, dass die Leute die Nase voll von Ihnen haben – mehr sogar noch: dass sie wütend auf Sie sind.
Sehr geehrte Damen und Herren! Wenn jemand das ausspricht, was ich jetzt ausspreche, was macht die Frau Minister dann? – Sie klagt ihn, so wie Sie mich geklagt haben, Frau Minister. Zur Erklärung: Die Frau Minister hat mich wegen übler Nachrede und natürlich, weil sie eine Entschädigung wollte, geklagt, da ich mir erlaubt habe, zu sagen, sie verbringe den Großteil des Jahres im Privatjet. (Abg. Voglauer: Na bitte! Jetzt reicht es! Auf Schienen, meinen Sie wohl! Auf Schienen!)
Sehr geehrte Damen und Herren! Gestern ist Post vom Gericht gekommen. Wissen Sie, welche Post gekommen ist? Ich weiß nicht, ob Sie sie schon geöffnet haben: Sie haben die Klage verloren, Frau Minister. – Nix üble Nachrede, nix mit Ihrer Entschädigung, da das Gericht festgestellt hat: Das stimmt ja, dass sie mit dem Privatjet unterwegs ist, also muss sie das Ganze auch aushalten.
Sehen Sie, wie lächerlich das ist? (Abg. Schallmeiner: Lächerlich bist du!) Deshalb, sehr geehrte Damen und Herren, haben die Menschen die Nase voll von Ihnen. (Beifall bei der FPÖ.) Sie selbst glauben, Sie sind etwas Besseres, Sie können die Bevölkerung schröpfen, und bei jedem, der die Wahrheit ausspricht, versuchen Sie dann, vor Gericht auch noch Kapital daraus zu schlagen.
Das ist eine Politik, die nicht mehr funktioniert, und deshalb sind die Umfragewerte so, wie sie derzeit stehen, und deshalb werden Sie auch bei den nächsten Wahlen die Rechnung präsentiert bekommen. (Beifall bei der FPÖ.)
17.14
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Martin Litschauer. – Bitte sehr. (Abg. Leichtfried: Der Herr Kollege Litschauer wird das jetzt erklären!)
Abgeordneter Ing. Martin Litschauer (Grüne): Sehr geehrte Frau Ministerin! Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Kollege Schnedlitz ist ein spezieller Fall, er hat gesagt, man braucht ja nur nach Russland zu fahren und Stopp zu schreien, dann ist der Krieg endlich aus. Ich leihe Ihnen ein Stoppschild. Fliegen Sie rüber, von mir aus auch im Privatjet, und beenden Sie diesen Krieg! (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
Russland hat nämlich die Preise in die Höhe getrieben, hat Gas und Öl als Waffe eingesetzt, und das hat die Preise nach oben getrieben. (Abg. Schnedlitz: ... Krieg gegeben! Wegen euren Sanktionen!) Das war euch egal, da gab es keinen Aufschrei, da war euch auch der kleine Mann egal. Bei eurem Klubchef, dem Oberkassierer, dem Volkskassierer, da spielt das alles keine Rolle. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
Ich weiß aber schon, worum es geht: Beim Klimabonus geht es in erster Linie darum, eine Neiddebatte zu führen. (Zwischenruf des Abg. Hafenecker.) Es wird diskutiert, welche Nachteile man irgendwo findet. Ich gebe Ihnen einen Rat: Gehen Sie zur Statistik Austria, sie hat das nämlich berechnet und kann Ihnen erklären, wie man zu diesen Unterschieden kommt. (Abg. Schnedlitz: Habt ihr keinen Besseren, der da dagegenhaltet?)
Ich höre auch in Wien: Wir vergessen, die verschiedenen Zahnräder gleichzeitig zu betrachten. In Deutschland wären sie heilfroh, wenn sie den Klimabonus schon beschlossen hätten; wenn sie erfahren, dass heuer schon zum dritten Mal
ausgezahlt wird, schlagen sie die Hände zusammen, weil sie es noch immer nicht zusammengebracht haben. (Beifall bei den Grünen.)
Was sie auch nicht zusammengebracht haben, ist ein Klimaticket wie in Österreich, mit dem man mit jedem Zug fahren kann. Das ist auch ein Thema, das den Unterschied ausmacht. Als wir das Klimaticket gemacht haben, kam von der SPÖ nicht der Aufschrei, dass das im Waldviertel nicht so gut funktioniert. Dass das Klimaticket in Wien viele Menschen bevorteilt, im Waldviertel jedoch nicht, dass das beim Klimabonus aber genau andersrum ist, ist, weil sich verschiedene Zahnräder im System ausgleichen – und da muss man mehrere Zahnräder auf einmal denken. (Beifall bei Grünen und ÖVP.)
Das macht eben eine Steuerreform aus, das ist auch eine Umverteilung. Es wird immer über die Tanktouristen geschimpft. – Die Tanktouristen zahlen mit in den Topf ein, aus dem wir alle dann wieder den Klimabonus bekommen. Das sind Systeme, die umverteilen, die auch von oben nach unten umverteilen. Die 10 Prozent der reichsten Österreicher verbrauchen pro Kopf sechsmal so viel Treibstoff wie die 10 Prozent der ärmsten; der Klimabonus wird aber pro Kopf ausbezahlt – das ist eine Umverteilung.
Um zum Abschluss zu kommen: der Agrardiesel. Im Prinzip ist das keine Literförderung, wir unterstützen damit die landwirtschaftliche Produktion über die Fläche, die bewirtschaftet werden muss. Man kann mit dem Elektrotraktor fahren, man kann aber auch mit Pflanzenöl fahren und bekommt diese Unterstützung. Da beschweren sich die Freiheitlichen immer, indem sie sagen, die Landwirte verdienen nichts; wenn man ihnen hilft, dann ist es aber nicht recht. (Beifall bei Grünen und ÖVP.)
Wenn man ihnen hilft, die Produktionskosten zu senken, um die Lebensmittel billiger zu machen, dann ist es nicht recht. Wir schreien zwar über die Teuerung und dass die Lebensmittel so teuer sind und dass alles teurer wird, aber wenn wir jetzt endlich Maßnahmen gegen die Teuerung setzen, dann ist es auch wieder nicht recht. Ich verstehe nicht, was das hier soll – Neiddebatten und
Diskussionen nach dem Motto: Wasch mich, aber mach mich nicht nass! (Beifall bei Grünen und ÖVP.)
Präsidentin Doris Bures: Zu Wort ist dazu nun niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
Der Herr Berichterstatter wünscht kein Schlusswort.
Damit gelangen wir zu den Abstimmungen.
Abstimmung über den Gesetzentwurf in 2539 der Beilagen.
Hierzu haben die Abgeordneten Johannes Schmuckenschlager, Jakob Schwarz, Kolleginnen und Kollegen einen Zusatz- beziehungsweise Abänderungsantrag eingebracht.
Ich werde daher zunächst über die vom erwähnten Zusatzantrag betroffenen Teile und schließlich über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes abstimmen lassen.
Die Abgeordneten Johannes Schmuckenschlager, Jakob Schwarz haben einen Zusatzantrag betreffend Umnummerierung der bisherigen Ziffer 1 und Einfügung neuer Ziffern 1, 3, 4 und 5 eingebracht.
Wer sich dafür ausspricht, den bitte ich um ein Zeichen. – Das ist mit Mehrheit so angenommen.
Schließlich kommen wir zur Abstimmung über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang in der Fassung des Ausschussberichtes.
Wer spricht sich dafür aus? – Das ist mit Mehrheit so angenommen.
Wir kommen sogleich zur dritten Lesung.
Wer dem die Zustimmung gibt, den ersuche ich um ein Zeichen. – Der Gesetzentwurf ist in dritter Lesung mit Mehrheit angenommen.
Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Walter Rauch, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Abschaffung des Klimabonus für Asylwerber“.
Wer ist für diesen Entschließungsantrag? – Das ist die Minderheit, abgelehnt.
Bericht des Umweltausschusses über den Bericht des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft betreffend Leistungen der Umweltförderungen im Bereich der Wasserwirtschaft 2017-2019 und 2020-2022 – Evaluierung des Bundes (III-1081/2540 d.B.)
Präsidentin Doris Bures: Damit kommen wir zum 6. Punkt der heutigen Tagesordnung.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Ich begrüße den Herrn Bundesminister in unserer Mitte und erteile gleich wieder Herrn Abgeordneten Martin Litschauer das Wort. – Bitte.
Abgeordneter Ing. Martin Litschauer (Grüne): Sehr geehrter Herr Minister! Frau Präsidentin! Wir haben hier einen sehr umfassenden Bericht vorliegen. Ich habe ihn mitgebracht (den Bericht in die Höhe haltend), damit man das einmal sieht. Für alle, die das interessant finden und sich näher informieren wollen: Unter III-1081 der Beilagen kann man das auch downloaden.
Ich bin auch Vizebürgermeister und zuständig für Kanal und Waser. Ich finde solche Berichte und solche Vergleiche immer sehr interessant, weil man damit schauen kann, wo die eigene Gemeinde in diesem Fachbereich steht. Gerade für
die Gemeinden sind die Förderungen, um die es in diesem Bericht geht, sehr wichtig.
Wir können in diesen 370 Seiten sehen, dass in der Wasserwirtschaft 5 900 Projekte mit 526 Millionen Euro gefördert worden sind und das fast 2 Milliarden Euro an Investments ausgelöst hat. Da wird in Österreich schon einiges umgesetzt.
Wir in Waidhofen haben davon auch profitiert. Wir durften ein Hochwasserschutzprojekt umsetzen. Wir haben entsiegelt, also quasi Landwirtschaft abgesiedelt, damit die Thaya mehr Platz kriegt. Auch das ist im Hochwasserschutz notwendig. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Maßnahme, denn durch den Klimawandel sind wir immer mehr gefordert, mit dem Hochwasser zurechtzukommen.
Wir müssen natürlich auch gegen den Klimawandel kämpfen, damit die HQ100-Gebiete in Österreich nicht wieder mehr werden und unseren Siedlungsraum noch mehr gefährden. Auch in dem Bereich gilt es, die Kosten einzudämmen. Ich sage hier einmal Danke, dass wir die Gemeinden so massiv unterstützen, denn die Gemeinden wären ohne diese Unterstützung aufgeschmissen. Hochwasserschutz wäre in den meisten Gemeinden ohne diese Unterstützung schlichtweg nicht möglich, daher ein Danke von meiner Seite.
Ich habe im Ausschuss schon kurz andiskutiert, was ich mir noch wünschen würde – ich habe es schon angedeutet, es sind ein paar Punkte, obwohl der Bericht sehr umfassend ist –: dass wir zusätzlich erfassen, welche Trinkwasserabgabepreise wir zum Beispiel bei diesen geförderten Projekten tatsächlich erreichen. Wir haben uns ja das Ziel gesetzt, dass Trinkwasser den Menschen in Österreich möglichst günstig zur Verfügung gestellt werden soll. Da würde ich gerne einmal sehen, wo wir da stehen. Welche Preise können da erzielt werden? Wie gut sind die Fördermittel angekommen, sodass die Preise möglichst niedrig sein können?
Die Trinkwasserversorgung wird in letzter Zeit immer mehr eine Herausforderung. Ich selber bin ja Stadtrat, wir haben vor Kurzem wieder eine Trinkwasserleitung saniert. 70 Prozent Preissteigerung bei einer Sanierung ist eine Herausforderung. Da müssen wir für jede Unterstützung, die wir kriegen, Danke sagen. Trotzdem ist es uns gelungen, die Wasserpreise noch stabil zu halten. Mich würde der Einsatz der Mittel trotzdem ein bisschen mehr interessieren. Vielleicht kann man das in Zukunft in dem Bericht sozusagen noch ein bisschen mehr darstellen, denn es gibt ja Gemeinden, die den Wasserpreis weitergeben, und es gibt Gemeinden, die bis zu 100 Prozent aufschlagen. Es wäre vielleicht einmal ganz interessant, zu analysieren, wie das wirkt.
Wir haben auch noch über die Wasserrahmenrichtlinie der EU und über das Thema Trinkwasserversorgung gesprochen. Auch wir im Waldviertel kämpfen damit, dass das Grundwasser teilweise weniger wird, dass es immer schwieriger wird, das Trinkwasser zu erfassen. Deswegen ist der Umgang damit sehr wichtig. Die EU-Wasserrahmenrichtlinie würde vorsehen, dass es Wassergebühren gibt, wenn zum Beispiel Landwirtschaft, Industrie oder ähnliche Akteure Wasser entnehmen.
Ich denke, irgendwann müssen wir uns über die Rahmenbedingungen äußern – mit Blick auf die Regionen, in denen der Grundwasserspiegel immer mehr sinkt und die Wasserentnahmen eindeutig zu hoch sind –, denn sonst kommen wir als Trinkwasserversorger wirklich in die Bredouille, da wir ständig mit neuen Brunnen nachrüsten müssen und das ganze System teurer wird, während andere gratis Wasser entnehmen. Ich glaube, das kann nicht die Zielrichtung sein.
Im Ausschuss wurde auch noch sehr viel anderes zum Thema Wasser diskutiert. Die SPÖ hat einige Anträge eingebracht, die wir dort diskutiert haben und die auch im Vorfeld schon medial diskutiert wurden. Was mir vor dem Ausschuss ein bisschen gefehlt hat, war, dass wir uns, wenn ihr schon Anträge einbringt, im Vorfeld vielleicht einmal austauschen, diskutieren. Da gab es irgendwie, finde ich, keine Kontaktaufnahme, kein Bemühen, tatsächlich etwas Gemeinsames auf den Weg zu bringen.
Ich denke, die Probleme sind uns mittlerweile bekannt. Wir arbeiten auch teilweise an Datenbanken. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wenn wir es aber ernst meinen, hier eine Lösung zu finden, dann würde ich mir schon erwarten, dass im Vorfeld ein Austausch stattfindet. Auch ich versuche ja, mit den anderen Fraktionen Kontakt aufzunehmen und zu schauen, ob wir gemeinsame Lösungen finden, bevor ich Themen aufbringe und Anträge einbringe. Das, muss ich sagen, habe ich leider Gottes ein bisschen vermisst. Vielleicht geht das in Zukunft ein bisschen besser. – Danke. (Beifall bei den Grünen. – Abg. Einwallner: Weißt du, wie oft wir das bei der Regierung vermissen?)
17.25
Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Julia Herr. – Bitte.
Abgeordnete Julia Elisabeth Herr (SPÖ): Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Minister! Auch ich darf heute über einen der größten Schätze sprechen, die wir in Österreich haben. (Ruf bei der ÖVP: Wasser!) – Es ist unser Wasser, richtig! Bingo! (Heiterkeit bei Abgeordneten der FPÖ.)
Es ist wortwörtlich Lebensgrundlage für uns alle, es ist lebensnotwendig. Auf unser Wasser sind wir in Österreich, glaube ich, zu Recht stolz. Der Punkt ist nur: Das ist nicht selbstverständlich. Auch da kommt es aufgrund der Klimakrise zu einigen Problemstellungen. Wir wissen, dass wir bis 2050 wahrscheinlich damit rechnen können, dass wir 20 Prozent weniger Grundwasser zur Verfügung haben werden. Wir wissen aber auch, dass wir aufgrund der Klimakrise einen höheren Bedarf an Wasser haben werden, nämlich um bis zu 15 Prozent bis 2050.
Jetzt kann sich jeder, der mitgerechnet hat – wir haben auf der einen Seite 20 Prozent weniger Grundwasser, auf der anderen Seite 15 Prozent mehr Bedarf an Wasser –, ausrechnen, dass Verteilungskonflikte auf uns zukommen könnten. Es könnten Nutzungskonflikte auf uns zukommen. Ich spreche absichtlich im
Konjunktiv – es könnte sein –, weil wir natürlich etwas dagegen tun können. Wir können heute schon aktiv werden. Es wäre sozusagen Politik mit Herz und Hirn, sich jetzt schon zu überlegen: Wie können wir denn unser Wasser schützen? (Beifall bei der SPÖ.)
Ganz konkret bringe ich dazu einen Antrag ein, denn, Herr Minister, wir müssen jetzt aktiv werden. Es ist nämlich schon Realität, es ist jetzt schon so, dass Bürgermeister beispielsweise entscheiden müssen, wofür das Wasser verwendet wird, wenn an einem heißen Sommertag alle gleichzeitig ihre Pools einlassen wollen und es plötzlich zu einer Knappheit kommt. Das ist jetzt schon Realität. Erstens muss bei so einem Wasserplan mit Herz und Hirn natürlich die Grundlage klar sein: Unser Wasser gehört uns allen! Trinkwasser ist nichts, das einigen wenigen gehören darf, die damit private Gewinne scheffeln. (Beifall bei der SPÖ.)
Das Grundwasser gehört uns allen und ist unsere Lebensgrundlage, die nicht käuflich sein darf. Das ist aber aktuell der Fall. Ich will nur ein ganz konkretes Beispiel aus unserem Nachbarland Deutschland, aus Lüneburg, erwähnen, wo genau das der Fall war. Dort hat Coca-Cola Wasser aus dem Grundwasser entnommen. Coca-Cola wollte dann noch mehr Wasser entnehmen, einen dritten Brunnen bohren, um das Wasser abzufüllen und zu verkaufen, um mit dem Wasser Geld zu machen. Auf der anderen Seite ist die regionale Bevölkerung gestanden, die sich Sorgen gemacht hat, weil der Grundwasserspiegel gesunken ist. Das ist ein Verteilungskonflikt. Wir sagen Nein zur Privatisierung von Wasser in Österreich und in der Europäischen Union! So etwas darf nicht passieren! (Beifall bei der SPÖ.)
Wenn Sie alle das auch so sehen – und das hoffe ich; ich hoffe auf Zustimmung –, dann stimmen Sie unserem Antrag bitte zu. Wir sind kurz vor der EU-Wahl, da können Sie zeigen, wofür Sie in der EU und in Österreich stehen.
Mein zweiter Punkt betrifft die Infrastruktur: Wenn wir sagen, wir wollen effizient mit unserem Grundwasser umgehen, brauchen wir dementsprechende
Wasserleitungen. Über ein Drittel unserer Wasserleitungen ist über 50 Jahre alt und deswegen renovierungsbedürftig. Das sagt auch der Rechnungshof. Er hat vorgerechnet, dass wir mindestens 600 Millionen Euro pro Jahr investieren müssen, damit wir kein Wasser verlieren.
Herr Minister, das Geld, das wir derzeit dafür abgestellt haben, reicht nicht. (Ruf bei der ÖVP: Das finanziert ja nicht nur der Bund, sondern auch die Kommunen!) Es bedeutet, dass wir weiterhin akzeptieren, dass wir 16 Prozent unseres Wassers in den Rohrnetzen verlieren, weil sie eben nicht im besten Zustand sind. (Abg. Schnabel: Weil der Bund nicht zu 100 Prozent ...!) Das können wir uns angesichts einer Klimakrise nicht erlauben, dass wir 16 Prozent unseres Wassers einfach verlieren, weil wir zu wenig in die Infrastruktur investieren. Wir müssen die Gelder verdoppeln – wir müssen! (Beifall bei der SPÖ.)
Der dritte Punkt: Eine kluge Wasserstrategie wäre es, natürlich jetzt schon zu sagen: Wir brauchen einen Plan, wie viel Wasser wir dem Grundwasser entnehmen! Herr Minister, wie viel Wasser entnimmt die Landwirtschaft dem Grundwasser? Wie viel die Industrie? Wie viel allgemein die Gewerbe? – Sie können es nicht sagen. Es gibt dazu nur Schätzungen. (Zwischenruf des Abg. Hörl.) Wir sind im Blindflug unterwegs und haben keine konkreten Daten, wie viel Grundwasser entnommen wird. (Abg. Schnabel: Im Wasserrechtsgesetz ist jeder Brunnen ...!) Das hält sogar eine Studie des Landwirtschaftsministeriums fest, die sagt, dass da Daten fehlen. Werden wir doch jetzt aktiv und beschaffen wir sie! Wir brauchen eine Übersicht, um Nutzungskonflikten vorbeugen zu können. In jedem österreichischen Haushalt läuft, wenn man die Wasserleitung aufdreht, ein Zähler mit, und man weiß, wie viel Wasser man verbraucht. Das gilt nicht für Industrie oder Landwirtschaft. Das müssen wir ändern. (Beifall bei der SPÖ. – Neuerlicher Zwischenruf des Abg. Hörl.)
Zwei weitere Punkte: Wir müssen endlich die Pestizide und das Nitrat in unserem Grundwasser reduzieren. Wir haben auch ein Recht auf gesundes Wasser, auf sauberes Wasser. Wir brauchen keine schädlichen Pestizide im Wasser, die wir durch das Trinken in unsere Körper aufnehmen.
Das ist bis vor den Obersten Gerichtshof gegangen, wo bestätigt wurde, dass die österreichische Bundesregierung zulässt, dass zu viel Nitrat in unserem Grundwasser landet. – Nein, wir wollen das nicht länger akzeptieren! (Beifall bei der SPÖ.)
Der letzte Punkt: Da geht es vor allem auch um soziale Gerechtigkeit, wenn wir über Wasser und über die Klimakrise sprechen, die auf uns zukommt. Wir brauchen auch Zugang zu Trinkwasser im öffentlichen Raum, wenn die Hitze kommt. Das ist belastend für ältere Menschen, für kranke Menschen, aber auch für Kinder, die da besonders schutzwürdig sind und in den heißen Sommermonaten einfach Wasser brauchen. Da gibt es eine EU-Richtlinie zum Thema Trinkwasser, die seit Monaten auf Umsetzung wartet. Wo ist die?
Wir müssen schauen, dass es ausreichend Wasser im öffentlichen Raum gibt und zum Beispiel auch das Glas Leitungswasser im Lokal nichts kostet. (Beifall bei der SPÖ. – Abg. Bogner-Strauß: Es geht ja ums Service und nicht ums Wasser! Um die Arbeit!) So etwas muss in einem der reichsten Länder der Welt möglich sein. (Beifall bei der SPÖ.)
Ich bringe daher folgenden Antrag ein:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Julia Elisabeth Herr, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Schutz der heimischen Wasserversorgung“
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, zum Schutz unserer Trinkwasserversorgung folgende Maßnahmen zu ergreifen:
- Bekenntnis zu Wasser als öffentlichem Gut und Ablehnung jeglicher Privatisierungsbestrebungen, egal ob auf nationaler oder europäischer Ebene;
- Verdoppelung der aktuellen Fördermittel zur Aufrechterhaltung und Erneuerung der überwiegend öffentlichen Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung;
- eine Wasserstrategie, die sicherstellt, dass wir 2050 genügend und sauberes Wasser haben;
- landwirtschaftliche Förderungen daran zu knüpfen, dass die Bewirtschaftung zu keinen Grundwasserverunreinigungen durch Nitrat und Pestizide führt;
- ein digitales Melderegister für tatsächliche Wasserentnahmen in Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft;
- Umsetzung der EU-Trinkwasser-Richtlinie um Bürger:innen besseren Zugang zu Trinkwasser zu gewähren;
- Einsatz für einen ‚Blue Deal‘ in der EU: für einen sorgsamen Wasserverbrauch, eine faire Verteilung der Wasserressourcen und mehr Investitionen in die Wasserinfrastruktur.“
*****
Vielen Dank. (Beifall bei der SPÖ.)
17.31
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Julia Herr,
Genossinnen und Genossen
betreffend Schutz der heimischen Wasserversorgung
eingebracht im Zuge der Debatte über den Bericht des Umweltausschusses über den Bericht des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft betreffend Leistungen der Umweltförderungen im Bereich der Wasserwirtschaft 2017-2019 und 2020-2022 – Evaluierung des Bundes (III-1081/2540 d.B.)
Österreichs Reichtum an sauberem Trinkwasser gehört zu den größten Schätzen unseres Landes. Doch auch bei uns macht sich die Erderhitzung bereits durch weniger Niederschläge und einen höheren Bewässerungsbedarf bemerkbar. Die Gletscher schmelzen, Wasserpegel sinken. Damit einher geht der Kampf um das Trinkwasser zwischen Konzernen, die das Geschäft ihres Lebens wittern, und der Bevölkerung, die ein Recht auf sichere und kostenlose Trinkwasserversorgung hat.
Neben dem Schutz vor Privatisierung braucht es dringend Förderungen für die Gemeinden zur Sanierung der Wasserleitungen und eine europaweite wie nationale Wasserstrategie. Wir müssen unser Wasser vor den Folgen der profitgetriebenen Erderhitzung schützen. Wasser ist für alle da. Es ist Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass die Trinkwasserversorgung gesichert ist.
Die Versorgung der Bevölkerung mit sauberem Trinkwasser ist vorrangig und muss ein öffentliches Gut bleiben. Selten zeigt sich die Notwendigkeit des Schutzes unseres Wohlfahrtsstaates so deutlich wie in der Frage, wie wir unsere Wasserversorgung schützen – vor den Auswirkungen der Erderhitzung ebenso wie vor der Profitgier privater Investoren.
In Zukunft werden wir aufgrund der Hitze weniger Grundwasser zur Verfügung haben, während gleichzeitig unser Wasserbedarf steigen wird. Wir müssen jetzt vorsorgen, um das beste Wasser auch in Zukunft zu garantieren und Nutzungskonflikten vorzubeugen. Dafür benötigen wir ausreichende Förderungen zur Sanierung der Wasserleitungen, den freien Zugang zu Wasser bei Hitze im öffentlichen Raum, verlässliche Daten zum Wasserverbrauch und eine Reduktion von Pestiziden und Nitraten in unserem Grundwasser.
Zuallererst braucht Österreich Investitionen in die Infrastruktur. Die heimischen Wasserleitungen sind in die Jahre gekommen. In Österreich liegt die durchschnittliche Wasserverlustquote bei rund 16 Prozent der ins Rohrnetz eingespeisten Wassermenge. Rund ein Drittel der öffentlichen Trinkwasserleitungen in Österreich (das sind ca. 26.000 km) sind älter als 50 Jahre.1 Diese Leitungen haben somit ein Alter erreicht, ab dem entsprechende Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind. Der Rechnungshof ging 2020 von einer Verdreifachung des Investitionsbedarfs bis zum Jahr 2030 aus, sodass allein für die Trinkwasserversorgung knapp 600 Millionen Euro pro Jahr benötigt werden. Dem steht das viel zu geringe Förderbudget des Bundes gegenüber: Im Jahr 2022 gab es für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 80 Millionen, im Jahr 2023 immerhin 130 Millionen (wegen einer Sondertranche für 2023/2024 in Höhe von 100 Mio. Euro), von 2024 bis 2028 sind regulär 100 Millionen Euro pro Jahr vorgesehen.
Was dringend fehlt, ist eine Wasserstrategie. Aufgrund der voranschreitenden Klimakrise steigt in der Landwirtschaft der Bedarf an Bewässerung. Alle verfügbaren wissenschaftlichen Szenarien weisen auf einen sich verschärfenden Konflikt bei der Trinkwassernutzung hin. Denn einerseits wird der jährliche Wasserbedarf in Österreich durch Bevölkerungswachstum und Klimaveränderung stark ansteigen – von derzeit 753 Millionen Kubikmeter Wasser auf bis zu 850 Millionen Kubikmeter im Jahr 2050. Gleichzeitig verschärft sich die Situation beim Grundwasser: Bis 2050 wird es in Österreich aufgrund der Klimakrise um bis zu 23 Prozent weniger Grundwasser geben, sagt eine Studie des Umweltbundesamtes. Hier ist die schwarz-grüne Regierung ebenfalls säumig. Younion _ Die Daseinsgewerkschaft und NGOs wie Greenpeace kritisieren, dass der „Trinkwassersicherungsplan“ des Landwirtschaftsministers „keine einzige konkrete Maßnahme [enthält], die die Situation tatsächlich verbessert“ und bezeichnen ihn als wirkungslosen „Papiertiger“.
Ein Problem ist auch die schlechte Datenlage. Denn nur mit verlässlichen Daten können Wassereinsparungen und vorausschauende Planungen vorgenommen werden und somit Nutzungskonflikten vorgebeugt werden. Die Feststellung, dass es keinen wirklichen Überblick über die Datenlage gibt, stammt direkt aus dem Bericht des
Landwirtschaftsministeriums „Wasserschatz Österreichs“: „Für die Landwirtschaft ist aufgrund der lückenhaften Datenlage die durchgeführte Abschätzung [des Wasserbedarfs] mit Unsicherheiten behaftet.“2 Der Rechnungshof empfiehlt daher ein digitales Melderegister für tatsächliche Wasserentnahmen einrichten3. Auch in der eigenen Klimawandelanpassungsstrategie der Bundesregierung wird der dringende Bedarf einer besseren Datenlage deutlich geäußert4.
Ein weiteres Problem stellt die Verunreinigung der Grundwasserkörper durch Nitrat, Pestizide und andere bedenkliche Stoffe (z.B. PFAS) dar. Hier sind Landwirtschaft und Industrie gefordert, Maßnahmen zu ergreifen, dass diese Verunreinigungen vermieden werden. Dem Landwirtschaftsminister stehen allein im heurigen Jahr 3,1 Milliarden Euro Budgetmittel zur Verfügung. Nitrat- und Pestizidverunreinigungen müssten bereits der Vergangenheit angehören, sie sind jedoch in intensiv landwirtschaftlich genutzten Regionen noch immer Realität.
Wie wenig sich die jetzige Regierung das Thema kümmert, zeigt sich auch am Umgang mit der EU-Trinkwasser-Richtlinie aus dem Jahr 2020: Mit öffentlichen Wasserspendern, insbesondere dort, wo es klimatisch notwendig ist und kostenlosem Leitungswasser in Restaurants sollte bundesweit der freie Zugang zu Trinkwasser verbessert werden – angesichts zunehmender Hitzeperioden eine wichtige gesundheitspolitische Maßnahme. Und es ist eine Möglichkeit Klimapolitik und soziale Gerechtigkeit zusammenzudenken, also Herz und Hirn, weil gerade die Hitze im Sommer vulnerable Gruppen (Ältere, Kranke oder Kinder) härter trifft und diese auf eine gute öffentliche Infrastruktur, die bei der Bewältigung klimabedingter Hitzeperioden hilft (Wasserspender und Abkühlungsmöglichkeiten), angewiesen sind.
Die Richtlinie sollte diesbezüglich innerhalb von zwei Jahren umgesetzt werden. Im Dezember 2022 kündigte der zuständige Konsumentenschutzminister an, dass es im ersten Halbjahr 2023 so weit sein werde. Passiert ist nichts.
Aus diesem Grund stellen die unterfertigten Abgeordneten nachstehenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, zum Schutz unserer Trinkwasserversorgung folgende Maßnahmen zu ergreifen:
• Bekenntnis zu Wasser als öffentlichem Gut und Ablehnung jeglicher Privatisierungsbestrebungen, egal ob auf nationaler oder europäischer Ebene;
• Verdoppelung der aktuellen Fördermittel zur Aufrechterhaltung und Erneuerung der überwiegend öffentlichen Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung;
• eine Wasserstrategie, die sicherstellt, dass wir 2050 genügend und sauberes Wasser haben;
• landwirtschaftliche Förderungen daran zu knüpfen, dass die Bewirtschaftung zu keinen Grundwasserverunreinigungen durch Nitrat und Pestizide führt;
• ein digitales Melderegister für tatsächliche Wasserentnahmen in Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft;
• Umsetzung der EU-Trinkwasser-Richtlinie um Bürger:innen besseren Zugang zu Trinkwasser zu gewähren;
• Einsatz für einen „Blue Deal“ in der EU: für einen sorgsamen Wasserverbrauch, eine faire Verteilung der Wasserressourcen und mehr Investitionen in die Wasserinfrastruktur.“
1 BMLRT: Leistungen der Umweltförderungen im Bereich der Wasserwirtschaft 2020-2022, S.17.
2 BMLRT: Wasserschatz Österreichs - Grundlagen für nachhaltige Nutzungen des Grundwassers, S.6.
3 Rechnungshof: Reihe BUND 2024/1, Reihe NIEDERÖSTERREICH 2024/1: Klimakrise – Herausforderungen für die Wasserwirtschaft in Niederösterreich; S. 12.
4 Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie: Die Österreichische Strategie zur Anpassung an den Klimawandel - Teil 2 – Aktionsplan Handlungsempfehlungen für die Umsetzung, S. 123.
*****
Präsidentin Doris Bures: Der Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht und steht mit in Verhandlung.
Nächster Redner: Herr Abgeordneter Alois Kainz. – Bitte.
Abgeordneter Alois Kainz (FPÖ): Frau Präsident! Herr Bundesminister! Geschätzte Damen und Herren! Werte Zuseher auf der Galerie! Weiters möchte ich die Schüler aus der HTL Weiz und aus der HTL Fürstenfeld begrüßen, unter der Leitung unseres ehemaligen Abgeordneten Dipl.-Ing. Christian Schandor. – Herzlich willkommen! (Allgemeiner Beifall.)
Wir Österreicher lieben unser Wasser, in welcher Form auch immer: in Flüssen, Seen, die unsere Landschaft prägen, als köstliches Trinkwasser, das aus den Wasserleitungen kommt. Natürlich braucht es dementsprechend auch eine gute, tolle Infrastruktur, und für eine Infrastruktur brauchen wir wiederum eine entsprechend große Förderung, dass das Wasser auch in einer gewissen Qualität gewährleistet und sichergestellt wird.
Wenig überraschend geht es bei diesem Thema also natürlich um gewaltige Summen und Fördergelder. Da hat der Rechnungshof geprüft, was alles anzupassen ist.
Allein in den Jahren 2020 bis 2022 wurden 526 Millionen Euro für 5 900 Projekte im Bereich Siedlungswasserwirtschaft, Hochwasserschutz und
Gewässerökologie unterstützt und gefördert. Das Positive an der großen, an der immensen Förderung ist, dass der wichtige Beitrag für den Ausbau und die Instandhaltung der Infrastruktur voranschreitet. In weiterer Folge wirkt sich das noch positiv darauf aus, dass Investitionen getätigt werden – es wurden Investitionen im Ausmaß von 1,95 Milliarden Euro getätigt und Tausende Arbeitsplätze zusätzlich gesichert.
Dieser Bericht wurde einstimmig im Umweltausschuss zur Kenntnis genommen, und dabei hätte man es bewenden lassen können, aber es braucht bei solch einer Thematik und bei solchen Summen viel mehr Strategie. Schon im Herbst haben wir an dieser Stelle über die Wasserkraft in Österreich gesprochen, und es wurde ein mögliches sehr dramatisches Bild für unsere Wasserversorgung gezeichnet.
Solche Warnsignale sind unbedingt ernst zu nehmen. Im Ernstfall geht es da um Menschenleben, um Krisensicherheit – diese ist gerade in einem solch sensiblen Bereich von höchster Wichtigkeit. Umso dringender ist es, dass wir dafür einen krisenfesten Plan haben. – Danke. (Beifall bei der FPÖ.)
17.34
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Nikolaus Berlakovich. – Bitte.
Abgeordneter Dipl.-Ing. Nikolaus Berlakovich (ÖVP): Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Hohes Haus! Wir diskutieren hier über den Bericht zur Verwendung der Mittel im Rahmen des Umweltförderungsgesetzes und des Wasserbautenförderungsgesetzes, und zwar über die Evaluierung dieser Förderungen nach ökologischen, ökonomischen und organisatorischen Aspekten.
Sie, Frau Kollegin Herr, verwenden diesen Bericht für eine reine Wahlkampfdebatte. So weit kann man Ihnen folgen und da wird Ihnen hier jeder recht
geben, Frau Kollegin Herr, wenn Sie sagen, dass unsere Sorge der Wasserversorgung gelten muss, dass wir ausreichend Wasser haben sollen und der Bevölkerung Wasser in Topqualität anbieten sollen. So weit wird das jeder hier unterschreiben – aber der Rest von dem, was Sie erzählt haben, ist Wahlkampf pur.
Sie stellen sich hierher und erzählen Dinge, und in Wahrheit verunsichern Sie die Bevölkerung in einem Megaausmaß. Sie erzählen erstens, dass die Bundesregierung zulässt, dass Nitrat ins Wasser kommt und dass Pestizide ins Wasser kommen. Wie können Sie so etwas behaupten? Wie können Sie so etwas ernsthaft behaupten? (Abg. Stöger: Weil es Gerichte festgestellt haben! – Abg. Herr: Das hat ein Gericht festgestellt! Der Oberste Gerichtshof!) Die Messungen der Wasserverbände ergeben, dass durch das Umweltprogramm, das es seit Jahrzehnten gibt, die Nitratwerte in vielen Messbrunnen zurückgehen. Jetzt wurde das neue Nitrataktionsprogramm gemacht – mit noch mehr Verschärfungen. Schauen Sie sich bitte die Programme an! (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Herr: Der Oberste Gerichtshof hat das festgestellt!)
Ein Bauer darf in einem gewissen Abstand zum Fließgewässer keinen Dünger, keinen Pflanzenschutz anwenden. (Ruf bei der SPÖ: O ja!) Streifen im Ausmaß von mehreren Metern entlang von sensiblen Zonen werden eingerichtet. (Abg. Krainer: Es geht ums Grundwasser, nicht um Fließgewässer!) Schauen Sie sich das bitte an! Sie reden von einer Klage, dass die Regierung verklagt wurde. Europa hat gesagt, die Wasserverbände müssen bei der Programmerstellung dabei sein, und nicht, was Sie da erzählt haben. Das stimmt ja nicht, was Sie da behauptet haben. (Beifall bei der ÖVP.)
Also verunsichern Sie nicht die Bevölkerung, indem Sie sagen, dass Nitrat und Pflanzenschutzmittel ins Wasser gehen! (Abg. Krainer: Niki, denk an die Bienen!) – Nein, Herr Kollege Krainer, Sie sind der Oberpolemisierer. Das ist ja fahrlässig, was hier gemacht wird. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Krainer: Denk nur an die Bienen!)
Auch das Nächste stimmt nicht: Auch wenn Sie so tun, als ob hier Wasser entnommen wird und niemand weiß, was genau passiert: Also wenn im Neusiedler Bezirk Bauern zur Lebensmittelerzeugung bewässern, sind die Grundwasserhorizonte genau festgelegt, bis wann sie bewässern dürfen. Da gibt es Marken, dann werden alle verständigt. Es darf nicht mehr bewässert werden, wenn zu wenig Wasser da wäre. Es herrscht hier nicht Wildwest, sondern es herrschen hier geordnete Systeme.
Auch dass Sie jetzt im Wahlkampf wieder versuchen, die Daseinsvorsorge, das Wasser hereinzuziehen – Wasser darf nicht privatisiert werden! –: Davon ist ja gar keine Rede bei uns! (Ruf bei der SPÖ: O ja!) Politik, jahrzehntelange Politik auch der ÖVP war es, der Bevölkerung Trinkwasser in ausreichender Menge, in Topqualität zu präsentieren, und das ist bisher gelungen und wird auch in Zukunft gelingen. Dafür setzen wir uns ein. (Beifall bei der ÖVP.)
Kollegin Herr stellt sich hierher und sagt, es werde zu wenig investiert, zu viel Wasser rinne aus den Leitungen raus. (Abg. Herr: 15 Prozent!) Dieser Bericht sagt, in der Siedlungswasserwirtschaft wurden in den Jahren 2020 bis 2022, in zwei Jahren, 4 134 Projekte genehmigt, mit 1,4 Milliarden Euro Investition – Bund, Land, Gemeinden – in Wasserleitungen und in Abwasserentsorgung. Da kann man sich doch nicht hierherstellen und sagen, nichts ist passiert. Das ist ja gut veranlagtes Steuergeld.
Ich war selbst als Landesrat und als Minister für diese Dinge zuständig. Das ist politisch erfüllend, wenn Bund, Länder und Gemeinden und auch die Europäische Union zusammenarbeiten und gemeinsam Projekte entwickeln, um eben Trinkwasser zu sichern und ordentliches Abwasser, reines Abwasser zu erzeugen. Da wurde in der Vergangenheit – und wird auch jetzt – sehr viel Geld reingelegt, und das zeigt eben auch dieser Bericht.
Daher ist mein Ersuchen, trotz Wahlkampf nicht die Menschen zu verunsichern. Dass wir alle aufpassen auf das Wasser, ist klar, aber es stimmt nicht, dass hier Chaos herrscht und dass man nicht sorgsam mit dem Wasser umgeht.
Jedenfalls: Siedlungswasserwirtschaft ist so ein sperriges Wort. Es geht bei der Siedlungswasserwirtschaft darum, dass die Wasserversorgung gesichert ist und die Abwasserentsorgung ebenfalls. Da ist Österreich im Übrigen technologisch Weltklasse. Österreichische Unternehmen machen weltweit Abwasserentsorgung, weil sie es technisch können wie niemand anderer: Umwelttechnologie ersten Ranges. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
Genauso bei der Gewässerökologie, also sozusagen bei den Fließgewässern, die renaturiert werden: Um enormes Geld werden bei Wasserkraftwerken Fischaufstiegshilfen gemacht, damit eben die Flüsse durchgängig sind. Das ist unser aller Steuergeld.
Es wird also sehr viel in die Ökologie investiert. Wir haben schon früh damit begonnen und das jetzt fortgesetzt, bis hin zum Hochwasserschutz. Es war immer das Ziel, Menschen zu schützen, Hab und Gut zu schützen, im alpinen Raum, aber auch im flachen Land, wo es auch zu Hochwässern kommt. Da werden Milliarden investiert, und das zeigt auch der Bericht, dass das sehr vorbildlich ist, sehr gut wirkt, plus auch eine Investition in den ländlichen Raum ist. Es investieren ja Gemeinden, Wasserversorger, Abwasserleitungsverbände, die alle das gemeinsame Ziel haben, Wasser für die Menschen zu sichern und ordentliches Abwasser zu erzeugen, das wieder der Natur zugeführt werden kann. – Danke schön. (Beifall und Bravorufe bei der ÖVP sowie Beifall bei Abgeordneten der Grünen.)
17.39
Präsidentin Doris Bures: Ich habe jetzt eine Wortmeldung zu einer tatsächlichen Berichtigung der Frau Abgeordneten Julia Herr. – Bitte. (Abg. Krainer: Niki, gut zuhören!)
Abgeordnete Julia Elisabeth Herr (SPÖ): Kollege Berlakovich hat soeben behauptet, ich würde sozusagen die Bevölkerung verunsichern, weil es ja gar
nicht die durch Gerichte bestätigte Feststellung gibt, dass die österreichische Bundesregierung zu viel Nitrat zulässt. – Das ist unrichtig.
Ich darf tatsächlich berichtigen: Der Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland hat das bis vor den Europäischen Gerichtshof gebracht. Dieser hat dann im EuGH-Urteil auch im Sinne des Grundwasserschutzes geurteilt. Da wird festgehalten, dass die Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie, welche in Österreich über das Aktionsprogramm Nitrat erfolgt, darauf abzielen muss, eine Belastung des Grundwassers mit mehr als 50 Milligramm pro Liter Nitrat zu verhindern oder zu beseitigen. (Abg. Berlakovich: Genau, ja! Das ist ja der Grundsatz! Das ist der Grundsatz, dass die Verbände mitreden! – Abg. Prinz: Das ist ja keine Urteilung! – Weitere Zwischenrufe bei der ÖVP.) Das wurde festgestellt, dass das von der Bundesregierung nicht eingehalten wurde, und somit war Ihr Sachverhalt unrichtig – bestätigt vom Europäischen Gerichtshof, der das ÖVP-geführte Ministerium aufgefordert hat (Abg. Berlakovich: Das ist der Grenzwert! Nein, nein, es wird nicht besser!), einzuhalten, dass diese Richtlinie endlich umgesetzt werden muss. (Beifall bei der SPÖ. – Abg. Prinz: Wenn man sich nicht auskennt, soll man nicht darüber reden!)
Des Weiteren hat Abgeordneter Berlakovich behauptet, ich hätte falsche Zahlen verwendet, was die Ressource Wasser betrifft, die wir in den Rohrnetzen verlieren.
Ich darf tatsächlich berichtigen: Das ist unwahr, ich habe hier den Rechnungshof zitiert (Abg. Berlakovich: Sie haben gesagt, es wird nichts investiert, und das stimmt nicht!), der die 16 Prozent, die wir verlieren, festgestellt hat. Das sind Zahlen des Rechnungshofes. – Vielen Dank. (Beifall bei der SPÖ.)
17.41
Präsidentin Doris Bures: Frau Abgeordnete, ob Zahlen richtig oder falsch sind, ist sozusagen eine politische Bewertung. Es ist der Sachverhalt, nämlich die Zahl, dem gegenüberzustellen, das Sie zu berichtigen haben. Eine falsche Zahl ist aber
kein Sachverhalt, der auch eine tatsächliche Berichtigung ermöglicht und nach sich zieht.
Nun gelangt Herr Abgeordneter Michael Bernhard in der Debatte zu Wort, und ich erteile es ihm.
Abgeordneter Michael Bernhard (NEOS): Frau Präsidentin! Herr Minister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Geschätzte Zuseherinnen und Zuseher! Ich bin der SPÖ dankbar, dass sie den Bericht ins Plenum gebracht hat, weil wir wirklich über die Frage diskutieren müssen: Wie schaut die Zukunft unseres Wassers aus? Das ist einmal ganz grundsätzlich vom Politischen her sehr unterstützenswert.
Wir teilen auch die Einschätzung, dass wir eine Strategie brauchen – nicht, weil uns das Wasser ausgehen wird. Das ist eine grundsätzlich gute Nachricht: Alle Studien, die wir haben, zeigen, dass es innerhalb Österreichs genug Grund- und Trinkwasser geben wird, auch bei einer sich verschärfenden Klimakrise, auch bei einem sich sozusagen erhöhenden Wasserbedarf, aber wir werden regional große Unterschiede haben. Wir werden Regionen haben, in denen es ausreichend und sogar weiterhin zu viel Wasser gibt, und wir werden Regionen haben, in denen es eine Knappheit gibt. Das heißt, wir müssen die Infrastruktur entsprechend anpassen, um diese Ressource auch richtig verteilen und richtig speichern zu können.
Dahin gehend gab es in der Vergangenheit keine ausreichenden Bemühungen, und auch die Wasserverbände und auch Infrastrukturunternehmen kommen auf uns als Politik zu und sagen: Da passiert nicht genug, wir sind einfach in einer Phase des Umbruchs und die Politik reagiert zu langsam.
Wofür wir als NEOS der SPÖ nicht dankbar sind, ist der zusätzliche Antrag, der eingebracht worden ist, denn da teile ich die Einschätzung meines ÖVP-
Vorredners, dass die Frage der Privatisierung des Wassers reines Wahlkampfgeplänkel ist.
Wir als NEOS haben in unserem Programm stehen, dass die erdfeste Infrastruktur niemals privatisiert werden darf, weil das natürlich in der Daseinsvorsorge wichtig ist. Ich habe auch von keinem anderen Abgeordneten, von keiner anderen Partei in den letzten Jahren irgendeinen Beitrag dahin gehend gehört, dass der- oder diejenige das Wasser privatisieren will. Abgesehen davon, dass es sehr viele Familien gibt, die noch eine eigene Quelle haben, oder dass es kleine Betriebe – einen Tischlereibetrieb, eine Schlosserei – gibt, die irgendwo einen Brunnen haben: die sind formal alle privat. (Abg. Sieber: Nicht „formal“, die sind privat!) Wenn wir jetzt solch einem Antrag zustimmen würden, würden wir eigentlich einer Enteignung von bäuerlichen Betrieben, die eine Quelle haben, oder von Einfamilienhäusern, die sich irgendwie anders versorgen, zustimmen. Da einfach nur mit einer Privatisierung, die keiner will, Panik zu machen, das ist eine SPÖ-Politik, die auch keiner will. Ja, das muss man schon ehrlicherweise sagen. (Beifall bei den NEOS, bei Abgeordneten der ÖVP sowie des Abg. Litschauer. – Abg. Herr: Passiert EU-weit!)
Frau Kollegin Herr, weil Sie sagen, es sei „EU-weit“: Sie haben ein deutsches Beispiel von einer Wasserentnahme gebracht, weil sie in Österreich keines gefunden haben. Sie sitzen aber jetzt hier im österreichischen Parlament (Abg. Herr: Ja, na und? – Abg. Strasser: Was ist „na und“? Das gibt’s ja nicht!) und versuchen hier, Angst zu schüren mit Dingen, die bei uns gar nicht passieren können. Gleichzeitig legen Sie uns aber einen Antrag zu einem Blue Deal vor. Blue Deal hört sich ja super an, ist wie Green Deal, wenn man sich dann aber anschaut, was in dem Blue Deal drinnen steht, dann sind das Elemente, die wesentlich gefährlicher für Österreich wären als eine Privatisierung, die Sie da gerade ansprechen.
Als Prinzip eins steht nämlich drinnen, dass wir alle unsere Politikbereiche der europäischen Wasserpolitik anpassen müssen – alle unsere Bereiche, auch die Landwirtschaft, auch die Industrie –, nicht dem österreichischen Bedarf, sondern
dem europäischen – das ist das Prinzip eins. Prinzip 13 ist, dass wir alle unsere Bemühungen auf die blaue Diplomatie legen sollen.
Das heißt, in der Frage dessen, welche Partei jetzt das österreichische Wasser außer Landes schaffen will, ist die SPÖ derzeit gerade die einzige, die etwas beantragt, was in diese Richtung geht, und wir als NEOS sind dafür nicht zu haben. (Beifall bei den NEOS, bei Abgeordneten der ÖVP sowie des Abg. Litschauer.)
Also weniger Populismus und ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit, wenn es um die Ressource Wasser geht, würde auch der Sozialdemokratie gut zu Gesicht stehen. – Vielen Dank. (Beifall bei den NEOS, bei Abgeordneten der ÖVP sowie des Abg. Litschauer.)
17.45
Präsidentin Doris Bures: Nun hat sich Herr Bundesminister Norbert Totschnig zu Wort gemeldet. – Bitte, Herr Minister.
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft Mag. Norbert Totschnig, MSc: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Hohes Haus! Geschätzte Damen und Herren! Wir sind uns alle einig, Wasser ist eine lebenswichtige und kostbare Ressource. Wir haben in Österreich wirklich die glückliche Situation, dass wir über einen sehr großen Wasserschatz verfügen, und gerade in der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung sind wir gut aufgestellt.
Schauen wir uns an, wie wir da organisiert sind: Wir haben über 5 500 Wasserversorgungsunternehmen, die rund 93 Prozent der Bevölkerung über das öffentliche Trinkwassernetz mit klarem Trinkwasser versorgen. Der Rest hat private Quellen. Dazu kommt, dass die Abwasserentsorgung und die Abwasserreinigung in circa 1 900 Kläranlagen erfolgt und wir einen Anschlussgrad von 96 Prozent haben – also auch dort sind wir sehr gut aufgestellt.
Wie ist das möglich? – Das Ganze ist das Ergebnis von jahrelangen, kontinuierlichen Investitionen des Landwirtschaftsministeriums in die Wasserinfrastruktur.
Schauen wir uns an, was in den letzten 20 Jahren passiert ist: Seit 2003 wurden 10 000 Kilometer neue Wasserleitungen verlegt, 2 400 neue Brunnen und 2 200 neue Quellfassungen wurden gebaut – das Ganze, um 760 000 Personen zusätzlich an das öffentliche Wasserversorgungsnetz anschließen zu können.
Es ist also, glaube ich, ganz offensichtlich, wie viel gelungen ist, aber gleichzeitig muss man sagen – völlig richtig, das ist angesprochen worden –: Wir haben angesichts des Klimawandels Herausforderungen, die wir bewältigen müssen. Zitiert worden ist die Wasserschatzstudie aus unserem Haus aus dem Jahr 2021: 11 bis 15 Prozent mehr Wasserbedarf bis 2050 wegen des Klimawandels, aber auch wegen des Bevölkerungszuwachses, den wir zu bewältigen haben.
Es sind auch Beispiele gekommen, die ich kurz anführen möchte: das Thema Wasserpreis: Wasser ist grundsätzlich gratis für alle in Österreich. Was bezahlt werden muss, ist die Zurverfügungstellung, der Betrieb der Wasserinfrastruktur; da gibt es natürlich Unterschiede, aber Wasser ist gratis.
Das zweite Thema – es ist angesprochen worden – ist die Frage: Wie viel Wasser wird verbraucht? – Es wird gerade daran gearbeitet, ein digitales Melderegister zu erstellen. Es gibt einen sehr intensiven Austausch mit den Bundesländern, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Wir arbeiten also daran, um auch dort eine Lücke zu schließen.
Ich möchte auf drei Schwerpunkte eingehen, die in Zusammenhang mit dem vorliegenden Bericht stehen. Der erste ist das Thema Siedlungswasserwirtschaft: Die Investitionen in die Wasserinfrastruktur sind wichtiger denn je – absolut richtig –, und die Voraussetzung dafür ist natürlich das Budget. Ich bin dem Finanzminister sehr dankbar, dass es bei den Finanzausgleichsverhandlungen gelungen ist, dass wir den Zusagerahmen für die Förderung von 80 auf 100 Millionen Euro erhöhen konnten.
Darüber hinaus gibt es noch etwas: Es ist wieder eine Sondertranche in der Höhe von 100 Millionen Euro für die Jahre 2025 bis 2026 genehmigt worden.
Wenn man also einen Vergleich anstellt: im Jahr 2021 80 Millionen Euro Zusagerahmen, im Jahr 2024 150 Millionen Euro; also eine Aufstockung des Rahmens plus zusätzliche Mittel, das entspricht ja fast einer Verdoppelung. Die Bundesregierung setzt hier ein ganz klares Zeichen, was sie will, nämlich Investitionen in die Wasserinfrastruktur forcieren und die Sicherung der Trinkwasserversorgung für Österreich. (Beifall bei der ÖVP sowie des Abg. Litschauer.)
Es ist das Thema alte Anlagen angesprochen worden – auch das ist richtig, auch da investieren wir. – Also erstens Abbauen des Förderrückstaus und zweitens natürlich auch Fokus auf die alten Anlagen, um da besser zu werden.
Darüber hinaus werden Investitionen in die Forschung gemacht, um eine effizientere Wassernutzung zu erreichen. Geforscht wird beispielsweise zu KI-unterstützter Leckageortung im Wassernetz oder der Nutzung alternativer Wasserressourcen für die Bewässerung. Insgesamt 3 Millionen Euro stellen wir da zur Verfügung.
Konsequent setzen wir auch den Trinkwassersicherungsplan um. Es ist gesagt worden, es gäbe keinen Plan: Es gibt einen Plan! Wir haben ihn letztes Jahr gemeinsam mit den Bundesländern erarbeitet – erstmalig, dass so etwas erarbeitet, entwickelt und vorgelegt wurde. Dafür danke ich den Bundesländern, dass das auch tatsächlich gelungen ist. Er ermöglicht es, dass wir, wenn Wasserknappheit besteht, rasch und koordiniert reagieren können, vorausschauend arbeiten und auch Prognosemodelle zusammen mit der Geosphere Austria erstellen können, womit die Prognosefähigkeit verbessert wird. (Beifall bei der ÖVP.)
Das nächste Thema ist der Hochwasserschutz – ein ganz wichtiges Thema. Wir sehen, da ist natürlich aufgrund des Klimawandels sehr vieles in Bewegung. Wir haben in den vergangenen fünf Jahren 1 Milliarde Euro aufgebracht, um die Bevölkerung und die Infrastruktur besser vor Hochwasser, Muren, Lawinen und Steinschlag zu schützen. Dadurch konnten fast 6 700 neue Schutzprojekte,
Sofortmaßnahmen, Instandsetzungsarbeiten sowie Planungsleistungen umgesetzt werden. Für den Hochwasserschutz stehen heuer und in den nächsten Jahren jährlich 124 Millionen Euro zur Verfügung. Damit schützen wir nicht nur die Menschen, sondern auch Gebäude wie Betriebe und leisten einen Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel.
Das nächste Thema ist Gewässerökologie. Das ist der dritte Bereich, der sehr wichtig ist und im Bericht auch dargestellt wird. Es ist uns ein wirkliches Anliegen, dass wir eine Verbesserung der Gewässerökologie erreichen. Durch gezielte Maßnahmen in den vergangenen Jahren konnte die Durchgängigkeit von Fließgewässern verbessert werden. Es gibt aber natürlich noch viel zu tun.
Flüsse und Bäche wurden in den vergangenen Jahrhunderten ständig verändert, um sie etwa für die Schifffahrt oder für die Energieerzeugung nutzbar zu machen. Um diese Gewässer in einen möglichst naturnahen Zustand zu überführen, brauchen wir Zeit und natürlich Geld. Und was ist passiert? – Mit dem dritten Gewässerbewirtschaftungsplan haben wir für die Jahre bis 2027 200 Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung gestellt, und das ist ein ganz klares und starkes Bekenntnis zur Ökologisierung unserer Gewässer.
Seit Beginn der Förderung konnten rund 830 Projekte mit Investitionskosten von rund 440 Millionen Euro genehmigt werden. Beispielsweise konnten damit mehr als 920 Querwerke für Fische wieder passierbar gemacht werden. Das ist schon eine ordentliche Anzahl. Das größte Renaturierungsprojekt Europas entsteht gerade in Vorarlberg am Alpenrhein. Mit dem Jahrhundertprojekt Rhesi – Rhesi steht für Rhein, Erholung, Sicherheit – wird zudem auch der Hochwasserschutz am Rhein auf ein 300-jähriges Ereignis ausgerichtet.
Ich freue mich, dass wir übermorgen, am Freitag, dem 17. Mai, den Start des Projektes durch die Unterzeichnung des Staatsvertrages mit der Schweiz offiziell bekannt geben können.
Ich komme zum Schluss: Die gesamten Förderleistungen des Landwirtschaftsministeriums, die in den Jahren 2017 bis 2022 in den Bereichen Trinkwasserversorgung, Abwasserentsorgung, Hochwasserschutz und Gewässerökologie erbracht worden sind, sind im Bericht im Detail dargestellt. Dabei lösten die zugesagten Förderungen rund 4 Milliarden Euro an umweltrelevanten Investitionen aus. Die heimische Wirtschaft haben wir damit gestärkt und Arbeitsplätze gesichert beziehungsweise neue geschaffen. Allein in den Jahren 2020 bis 2022 waren es 32 000 Beschäftigungsverhältnisse.
Die Bilanz kann sich sehen lassen. Wir ruhen uns aber auf der Bilanz nicht aus, sondern werden in Zukunft mit allen verfügbaren Fördermitteln sicherstellen, dass die Österreicherinnen und Österreicher jederzeit mit ausreichend Trinkwasser versorgt werden, vor Hochwasser geschützt werden und dass die Sauberkeit der Gewässer in Österreich gesichert wird. – Vielen Dank. (Beifall bei der ÖVP sowie des Abg. Litschauer.)
17.54
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Robert Laimer. – Bitte.
Abgeordneter Robert Laimer (SPÖ): Frau Präsidentin! Herr Minister! Damen und Herren! Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer! Vor der Wahl steht eine Ablehnung der Wasserprivatisierung natürlich außer Streit. Ich kann mich aber noch sehr gut an feuchte Träume auf Ibiza erinnern; ich kann mich sehr gut an die NEOS-Abgeordnete Angelika Mlinar erinnern, die das Wasser privatisieren wollte – das Archiv ist ein Hund. Aber es geht auch um Konzerne wie Nestlé, die in großen Mengen Wasser aufkaufen und so Ressourcen binden.
Meine Damen und Herren! Wasser ist das allerhöchste Gut. Wasser ist unsere Lebensgrundlage, doch trotz dieser fundamentalen Bedeutung von Wasser sehen wir es als zu selbstverständlich an. Wir drehen einfach die Wasserleitung auf, und das Wasser fließt: sauberes österreichisches Wasser. Die Sorglosigkeit
ist allerdings trügerisch, denn die Realität ist alarmierend, wie wir heute schon mehrmals besprochen haben. Unsere Wasserressourcen schrumpfen, sie sind durch Klimakrise, durch Verschmutzung, aber auch durch eine völlig unnötige Regierungsblockade bedroht. Auch die veraltete Wasserinfrastruktur trägt ihren Teil dazu bei, es kommt aufgrund alter Wasserleitungen zum sprichwörtlichen Wasserlassen.
Wir als SPÖ haben nicht ohne Grund in der letzten Sitzung des Umweltausschusses darauf gedrängt, das Thema der Wasserversorgung heute ins Plenum zu bekommen.
Die Klimakrise ist das Stichwort schlechthin: Wir warten in Österreich nach wie vor auf das versprochene und bislang fehlende Klimaschutzgesetz. Das wird nichts mehr in dieser Gesetzgebungsperiode.
Genauso warten wir auf die Sicherheitsstrategie, in der Wasser auch eine zentrale, eine fundamentale Bedeutung haben müsste. In der SPÖ-Sicherheitsstrategie ist das weiße Gold jedenfalls als schützenswertes und vorausschauend zu denkendes Gut enthalten, und das ist gut so.
Wir haben für eine Wasserstrategie plädiert, um die Wasserversorgung für die Zukunft, für die vielen kommenden Generationen sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass es neben dem Trinkwasser auch ausreichend Wasser für die Felder gibt. (Abg. Eßl: Haben wir! Haben wir!) Das wird insbesondere Sie interessieren, Herr Landwirtschaftsminister. (Abg. Eßl: Pflanzen brauchen auch Wasser!)
Es gibt allerdings nicht einmal einen Klimaplan in Österreich. Wir sind das einzige, das allereinzige Land in der EU, das keinen Klimaplan hat. Was kommt? – Ein Vertragsverletzungsverfahren droht schon in wenigen Tagen, das heißt im Juni.
Diese Uneinigkeit bei Ihnen ist ja fast schon so, wie wenn man sich im Nebel verirrt, liebe Regierungsparteien! (Abg. Strasser: Die Uneinigkeit der SPÖ!
Grüngasgesetz!) – Die SPÖ hätte schon längst einen Klimaplan, schon längst einen Energie- und Klimaplan. (Abg. Litschauer: Grüngas wäre ein Teil davon!)
Wir können es nicht länger ignorieren, dass selbst in einem Land wie Österreich, das de facto noch über sagenhafte Ressourcen verfügt, die Bedrohung zusehends real wird, und das merkt man auch in den Gemeinden sehr stark. Redet einmal mit euren Bürgermeistern, ihr habt sehr viele in der ÖVP! (Abg. Höfinger: Gott sei Dank!) – Ich hätte sagen sollen: Ihr habt sie noch.
Wasser ist ein grundlegendes Menschenrecht und muss für alle geschützt werden. Wasser darf niemals als Privileg gesehen werden. Dafür garantiert die Sozialdemokratie mit Herz und Hirn. – Vielen Dank. (Beifall bei der SPÖ.)
17.58
Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Martina Diesner-Wais. – Bitte.
Abgeordnete Martina Diesner-Wais (ÖVP): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Minister! Liebe Damen und Herren im Hohen Haus! Werte Zuseher vor Ort und vor den Fernsehgeräten! Der Sommer steht vor der Tür und für viele bedeutet das einen Sommerurlaub. Da können wir in Österreich glücklich sein, denn wir haben wirklich schöne Teiche und Seen mit bester Wasserqualität. Nicht nur in den Teichen und Seen haben wir sie, sondern auch aus jeder Wasserleitung fließt tolles Trinkwasser.
Wir haben reichliche Ressourcen an Quell- und Grundwasser. Es ist schon sehr oft angesprochen worden, dass sich das Klima verändert, und daher ist es umso wichtiger, dass wir verantwortungsvoll mit unserem Wasser umgehen und gezielte Investitionen in die Wasserinfrastruktur setzen, damit wir für die Zukunft vorsorgen.
Kollegin Herr und Kollege Laimer, mit populistischen Reden macht man nichts besser, sondern man schürt nur Angst, und es ist kein konstruktiver Beitrag. (Abg. Herr: Ich habe nur den Europäischen Gerichtshof und das Ministerium zitiert!)
Ich möchte unserem Herrn Bundesminister danken, denn Bundesminister Totschnig hat mit dem Grundwassermonitoring und dem Trinkwassersicherungsplan, den er bereits im letzten Jahr gemeinsam mit den Bundesländern und Wasserversorgern erarbeitet hat, dafür gesorgt, dass eine langfristige Trinkwasserversorgung für unsere Gemeinden gewährleistet wird.
Dieser Plan sieht eben Vorsorgemaßnahmen vor, auch Handlungsempfehlungen für Notfallszenarien und ein konkretes Fünfpunkteprogramm, wie man vorgehen soll, damit das Wasser in dieser guten Qualität für die Zukunft gesichert wird.
Lassen Sie mich das Fünfpunkteprogramm ansprechen. Dieses besteht – erstens – aus der Sensibilisierung der Bevölkerung, achtsam mit dem Wasser umzugehen, zweitens, dem Vernetzen von Daten betreffend das Grundwassermonitoring mit den zukünftigen Wetterprognosen (Abg. Herr: Dann beschließen wir es!), dem Ausbau der Infrastruktur – wie Sie das selbst angesprochen haben – und natürlich auch der Forschung, damit das Wasser effizient eingesetzt wird.
Ja, das Programm der Trinkwasserversorgung gibt Antworten auf die aktuellen Herausforderungen, ist proaktiv auf zukünftige Bedrohungen ausgerichtet und lässt eine nachhaltige Wasserpolitik stattfinden, damit man das Wasser für die Zukunft sichert.
Ich möchte darüber hinaus die Wasserleitungen ansprechen, da auch ich aus dem ländlichen Raum komme, wo die Wasserleitungen schon vor mehreren Jahrzehnten errichtet worden sind. Diese müssen jetzt wieder saniert werden, was unsere Gemeinden natürlich auch viel Geld kostet. Eine gute Unterstützung von Bundesseite ist auch weiterhin notwendig, damit die Wasserleitungen saniert werden können.
Ich möchte Ihnen, Herr Bundesminister, und auch Ihren Mitarbeitern herzlich Danke sagen. Wir haben es gesehen: Es gibt einen umfassenden Bericht, der wirklich toll ist und der zeigt, dass in den Jahren 2017 bis 2022 5 900 Projekte unterstützt worden sind und 526 Millionen Euro investiert wurden, was insgesamt Investitionen in Höhe von 1,95 Milliarden Euro ausgelöst hat, die umweltrelevant sind. Das ist nur durch die gute Zusammenarbeit von Ministerium, Gemeinden, Ländern und Wasserversorgern möglich gewesen.
So möchte ich Folgendes sagen: Es liegt an uns allen, dass wir zukünftig gutes Wasser haben, denn es gilt für jeden, dass er im täglichen Gebrauch einen sinnvollen Umgang pflegen soll – das gilt für den Alltag, aber auch für den Garten und für andere Dinge. Nutzen wir unser Wasser mit Bedacht, damit wir auch noch für unsere kommenden Generationen kostbares Wasser haben und das gewährleisten können. – Herzlichen Dank. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.)
18.02
Präsidentin Doris Bures: Nun gelangt Frau Abgeordnete Elisabeth Feichtinger zu Wort. – Bitte.
Abgeordnete Elisabeth Feichtinger, BEd BEd (SPÖ): Frau Präsidentin! Die Herren Minister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuseherinnen und Zuseher! Wasser ist Leben und Lebensqualität – das sieht man bei den internationalen Touristen, die zu uns nach Österreich kommen und immer wieder ganz begeistert sind, wenn sie ihr Wasser nicht abkochen müssen und es direkt aus der Wasserleitung trinken können, weil es eine so hohe Qualität hat.
Der Schutz unserer Trinkwasserversorgung geht uns alle an, und eines ist ganz sicher: Wir dürfen unser Wasser nicht verkaufen und sollen längerfristig denken! Das ist vielleicht kein aktuelles Thema, aber wir müssen vorsorgen, und das ist unser Job. Wir müssen schauen, dass nicht Unternehmen nach Österreich kommen, sich Quellen kaufen, das Wasser fesch in Flaschen abfüllen und uns
dann weiterverkaufen. Es ist wichtig, dass das Wasser ein unantastbares Gut ist und bleibt. (Beifall bei der SPÖ.)
Damit dieses Gut aber in Zeiten von Klimaveränderung, geringeren Niederschlägen und auch steigendem Wasserbedarf geschützt wird, braucht es natürlich eine Trinkwasserstrategie, und da müssen wir sicher sein, dass diese uns bis 2050 auch ausreichend sauberes Wasser garantiert. Daher braucht es das ganz, ganz dringend!
Wenn wir an Grundwasserressourcen denken, kommt natürlich auch schnell einmal die Landwirtschaft ins Spiel. Unsere Bäuerinnen und Bauern stehen vor großen Herausforderungen: Zum einen sollen sie natürlich qualitativ hochwertige Produkte auf den Markt bringen, andererseits sollen sie schauen, dass der Wasserverbrauch so weit wie möglich minimiert wird, und natürlich sollen auch keine Nitrate und Sonstiges ins Wasser kommen.
Die Frage ist: Wie gelingt dieser Spagat? – Unsere einzige Möglichkeit ist, dass wir die Verbindung zwischen Landwirtschaft und Wasserwirtschaft neu denken. Wir brauchen vor allem eine Politik, die sicherstellt, dass wir nicht nur darauf schauen, dass die Landwirtschaft eine hohe Produktion erreicht, sondern auch darauf, dass sie nachhaltig und vor allem auch wasserschonend produziert. Ein erster Schritt in diese richtige Richtung ist zum Beispiel, dass man Ökosystemdienstleistungen ins Fördersystem einfließen lässt und einbezieht. (Ruf bei der ÖVP: Haben wir!)
Grundwasserschutz und sauberes Wasser sind für uns natürlich auch ein klares Zeichen, dass wir diese Landwirtinnen und Landwirte dann finanziell unterstützen (Beifall des Abg. Hörl) und auch ein Zeichen setzen und sagen: Es ist gescheit, wenn das gemacht wird! – Danke, Herr Hörl, für den Applaus. (Abg. Strasser: Bravo, Elisabeth!)
Es ist essenziell, dass wir die Verschmutzung unseres Grundwassers durch Nitrate und Pestizide eindämmen und stoppen. (Ruf bei der ÖVP: Das machen wir!)
Wir wissen, dass intensive Landwirtschaft und intensiv genutzte Regionen zum Teil auch zu diesem Kippen führen. Wir müssen da wirklich gut aufpassen und einen kleinen Aktionsplan schnüren!
Ein digitales Melderegister ist der erste richtige Schritt in diese Richtung. Dieses Register soll die Wasserentnahmen regeln, dann sammeln wir darin die Daten und sehen, wie die Planungen ausschauen und die Wassereinsparungen sinnvoll genutzt werden, und da ist vor allem auch eine vorausschauende Bewirtschaftung unerlässlich.
Was wir nicht brauchen, ist eine Blackbox, wie wir sie aktuell in der Landwirtschaft haben, was die Wasserentnahme betrifft – ich habe diesbezüglich eine Anfrage gestellt. Wir können nur Daumen mal Pi sagen, wie viel Wasser in der Landwirtschaft aktuell tatsächlich genutzt wird, und daher braucht es dort klare Regeln und Rahmenbedingungen.
Daher ist der Antrag von Kollegin Julia Herr so essenziell und wesentlich: um zu zeigen, welche wichtigen politischen Schritte wir für die nächsten Jahre und Jahrzehnte setzen müssen. (Abg. Eßl: Das machen wir alles schon!) Ich würde mich freuen, wenn wir alle es überparteilich schaffen, diesem Antrag die Zustimmung zu geben (Beifall bei der SPÖ), denn wir wissen: Wasser ist Leben, ist unsere Zukunft, und es ist unsere Pflicht, dass wir dieses Leben schützen (Abg. Eßl: Das machen wir alles schon!) und für die nächsten Jahre und Jahrzehnte sicherstellen, dass alle genug Wasser haben – egal, welchen Background sie haben. (Beifall bei der SPÖ.)
18.06
Präsidentin Doris Bures: Als nächster Redner gelangt Herr Abgeordneter Franz Hörl zu Wort. – Bitte.
Abgeordneter Franz Hörl (ÖVP): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Die Herren Minister! Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen! Meine Kollegen hier im
Parlament! Sehr geehrter Herr Minister, 400 Seiten in zwei Berichten, das zeigt eigentlich die umfangreiche Tätigkeit, die Sie gerade vorhin ja selbst geschildert haben, die der Bund für das Wasser – für die Reinhaltung des Wassers, bei der Siedlungswasserwirtschaft, bei der Gewässerökologie und beim Hochwasserschutz – erbringt.
Frau Feichtinger hat als alte Bürgermeisterin (Heiterkeit der Abgeordneten Feichtinger und Scharzenberger) natürlich eine ganz andere Beziehung zum Wasser. Sie kommt ja auch aus einem Seengebiet und sie weiß natürlich auch, dass es ohne Wasser kein Leben gibt und Österreich reich an diesem Schatz ist. Es gibt also keinen Grund, hier Panik zu verbreiten, Frau Herr. Wir haben genug Wasser – wir verbrauchen ungefähr 3 bis 4 Prozent des Wassers; der Großteil des Wassers bleibt ohnehin im Kreislauf.
Ohne Wasser gibt es kein Leben, aber auf der anderen Seite bildet Wasser auch eine Gefahr für Leib und Leben, nämlich im Hochwasserbereich, bei Überflutungen, bei Muren und so weiter, und natürlich auch im festen Aggregatzustand – den ich eigentlich sehr liebe, nämlich den Schnee – in Form von Lawinenabgängen und Eisstürzen. Sie verzeihen mir, dass ich gerade den Schnee hier hervorhebe, der natürlich auch Grundlage für unsere Wirtschaft ist.
Ich denke, Reichtum verpflichtet – Wasserreichtum ganz besonders (Heiterkeit bei ÖVP und SPÖ) – zum besonders sorgfältigen Umgang mit dieser Ressource.
Für die Reinheit unserer Gewässer wurde und wird sehr viel getan. Als langjähriger Bürgermeister einer Berggemeinde weiß ich, dass im Westen Österreichs ein Großteil der Bauernhöfe, aber vor allen Dingen alle Skihütten in den Skigebieten bereits an einer zentralen Kanalanlage hängen und das Wasser auch entsprechend gereinigt wird.
Wenn wir beispielsweise mein Heimattal, das Zillertal im Bezirk Schwaz, hernehmen: Da gibt es ein Kanalsystem, das vom Tuxer Gletscher auf 3 000 Meter Seehöhe quer durch Österreich bis an die bayerische Grenze geht und in dem
das Wasser schließlich in der zentralen Kläranlage in Strass gereinigt wird. Dadurch kann man eigentlich das Wasser aus dem Ziller und auch aus dem Achensee trinken.
Aus dem Bericht geht hervor, dass zwischen 2017 und 2022 4 000 Kanalkilometer mit 260 Millionen Euro gefördert wurden und damit eine Wertschöpfung von 1,4 Milliarden Euro erzielt werden konnte.
Im Bericht sieht man, dass mehr und mehr Geld für die Sanierung der bestehenden Kanalanlagen verwendet wird, und das zeigt auch deutlich, wie hoch das Niveau ist, wie großflächig der hohe Erschließungsgrad über die Fläche Österreichs in den letzten 40 Jahren zunehmend für reine Flüsse und Gewässer gesorgt hat.
Der Herr Minister hat es bereits gesagt: 93 Prozent unserer Gebäude sind an das Kanalnetz angeschlossen. Ich glaube, darauf können wir sehr stolz sein, insbesondere wenn wir sehen, was in anderen Ländern los ist. Ich bin gespannt, ob bei der in wenigen Wochen stattfindenden Olympiade in Paris der Schwimmwettbewerb auf der Seine überhaupt ausgetragen werden kann – ob die Wasserqualität der Seine so weit ist, dass man das den Sportlern zumuten kann. Bei den traditionellen Ruderwettbewerben der Universitäten Oxford und Cambridge in London auf der Themse wurde heuer jedenfalls erstmals darauf verzichtet, den Bootsführer der siegreichen Mannschaft in die Themse zu werfen, weil sie offenbar doch etwas giftig ist.
Wir Österreicher können also stolz auf den ökologischen Zustand unserer Gewässer zwischen Bodensee und Neusiedler See sein.
2017 bis 2022 wurden 12 000 Projekte mit einem Volumen von 1,2 Milliarden Euro gefördert, also auch ein enormer wirtschaftlicher Effekt. Beeindruckend ist auch die Anzahl der dadurch entstandenen Arbeitsplätze: 32 000, also annähernd so viele, wie wir Polizisten in diesem Land beschäftigen.
An dieser Stelle danke ich allen Bürgermeistern und kommunalen Verantwortungsträgern, die die Last der Baustellen, deren Organisation und die ordnungsgemäßen Vergaben tragen.
Für Hochwasserschutzprojekte gab der Bund im Berichtszeitraum 680 Millionen Euro aus, auch da bereits ein Viertel für die Instandhaltung bestehender Bauwerke an Wildbächen und Lawinenverbauungen. Das ist natürlich für mich als Bewohner einer Bergregion von eminenter Wichtigkeit.
Ich danke Ihnen, Herr Bundesminister, dass Sie gerade im vergangenen Jahr in Tirol das höchste Budget, 53 Millionen Euro, zur Verfügung gestellt haben, damit die Wildbach- und Lawinenverbauung dort auch ihren Aufgaben nachkommen kann. Etwas mehr als die Hälfte davon zahlt der Bund, den Rest bezahlen die Gemeinden, Interessenten und natürlich das Land.
Im Inntal entstehen soeben eine der größten Retentionsflächen und Schutzbauten. Mit Blick auf die Flut im Jahr 2005 soll in den Wasserverbänden Unteres Unterinntal und Mittleres Unterinntal auf 360 Hektar Hochwasserschutz entsprechend errichtet werden, damit auch da dem Hochwasser Einhalt geboten werden kann. – Danke sehr, Herr Bundesminister, dass Sie das übernommen haben und dass Sie gemeinsam mit den Gemeinden in den nächsten Jahren da sehr, sehr viel Geld investieren werden. Das hilft der Sicherheit Tirols enorm.
Weil am 9. Juni Wahlen sind, darf ich – im Herzen ein Tiroler, ein begeisterter Österreicher, vom Hirn und Hausverstand her ein Europäer – Ihnen sagen: Gehen Sie wählen! Es ist nicht egal, wer dort sitzt. (Beifall bei der ÖVP.)
18.11
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Nikolaus Prinz. – Bitte.
Abgeordneter Nikolaus Prinz (ÖVP): Geschätzte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Herren Bundesminister! Meine Damen und Herren! Ich darf ganz kurz einmal mit
dem Bereich der Umweltförderungen und der Siedlungswasserwirtschaft anfangen. Es sind ja zwei Berichte: 2017 bis 2019 und 2020 bis 2022. Wenn man sich die Summen, die von den Betreibern allein im Bereich der Abwasserversorgung investiert wurden, anschaut, sieht man, es sind fast 1 500 Millionen Euro, also 1,5 Milliarden Euro, investiert worden. Die Fördersumme, der Förderbarwert lag bei 271 Millionen Euro, das ist auch eine gewaltige Summe. Im Bereich der Wasserversorgungsanlagen waren es für denselben Zeitraum, wenn man es zusammenrechnet, 1 151 Millionen Euro, die investiert worden sind, also gut 1 Milliarde Euro; und die Fördersumme hat 176 Millionen Euro ausgemacht. Man sieht, das sind große Beträge; und das sind wirklich sehr wertvolle Gelder.
Herr Bundesminister, danke, dass es beim Finanzausgleich gelungen ist – es ist schon angesprochen worden –, dass man eine jährliche Erhöhung auf 100 Millionen Euro hat. Vor allem kann man aber auch mit der Sondertranche für die Jahre 2025, 2026, mit diesen 100 Millionen Euro, in Wirklichkeit einen großen Rückstand abbauen.
Es sind einfach auch die Kosten gestiegen. Mit der höheren Summe an Förderungen kann man auch da etwas abdecken, was für die Betreiber der Anlagen sehr wichtig ist.
Wenn man sich den Bericht anschaut, sieht man, dass bei den Projekten im Bereich Kanal rund ein Drittel in Richtung Sanierung geht, im Bereich Wasserleitung gehen schon fast 40 Prozent Richtung Sanierung. Das hängt natürlich auch mit dem Alter zusammen. Insgesamt sind diese Förderungen für die Betreiber – das sind in erster Linie die Kommunen, also Gemeinden und Städte, und Genossenschaften – wertvolle Gelder, und natürlich hat das einen Einfluss auf die Tarifgestaltung, denn wenn es keine Förderungen gäbe, müssten ja die Infrastrukturkosten allein von den Nutzern entsprechend gezahlt werden – das würde einen wesentlichen Unterschied machen.
An dieser Stelle richte ich ein herzliches Danke nicht nur an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ministerium für den Bericht, sondern auch an jene der Kommunalkredit für die ganze Abwicklung. Es ist sehr viel Arbeit dahinter, einerseits bei der Kommunalkredit, wo es tatsächlich um die Abwicklung geht, andererseits natürlich auch bei den Gemeinden, Städten, den Betreibern und natürlich den Projektanten, denn ohne Projektanten gibt es solche Projekte nicht. Es hängt da also relativ viel zusammen, und das muss Hand in Hand gehen. Danke für die Arbeit, die da dahintersteht.
Auch ein Satz dazu – Franz Hörl, mein Vorredner, hat es angesprochen –, da in unserer Gemeinde im ersten Quartal ein Projekt der WLV, der Wildbach- und Lawinenverbauung, mit rund 200 000 Euro abgewickelt worden ist: Auch das ist in Wirklichkeit für die Bevölkerung und die Kommunen eine sehr, sehr wertvolle Arbeit. Auch da gilt: Danke für die gute Arbeit, die da in den Regionen geleistet wird. (Beifall bei der ÖVP sowie der Abgeordneten Litschauer und Schwarz.)
Es ist schon klar festgehalten worden, dass Trinkwasser grundsätzlich nichts kostet, also gratis ist. Das, was zu zahlen ist, sind Infrastrukturkosten in zweifacher Hinsicht: Das eine sind ganz klar die Leitungskosten, also womit man das Leitungsnetz betreibt. Das ist beim Trinkwasser oder beim Kanal nicht anders als – von mir aus – beim Stromnetz. Und natürlich ist es schon auch so, dass jemand dort, wo der Brunnen ist oder die Quellen sind, Auflagen einzuhalten hat. Denken wir an Quellschutzgebiete. Als praktizierender Bauer oder als Grundeigentümer, der das auch bewirtschaftet – und die Bewirtschaftung ist die wichtigste Voraussetzung, dass nichts Falsches ins Grundwasser geht – hat man entsprechende Auflagen, und Aufwendungen dafür sind abzudecken.
Wenn man über die Kanalgebühr oder vielleicht über die Wassergebühr diskutiert, sollten wir halt einmal vergleichen: Was kostet denn ein Packerl Zigaretten und was kosten 1 000 Liter Wasser, oder was bezahlt man für 1 000 Liter, also 1 Kubikmeter, Abwasser? Oder vergleichen wir von mir aus statt mit einem Packerl Zigaretten mit 1 Liter Bier! Dann wissen wir, dass das alles sehr, sehr bescheiden ist. Da diskutieren wir aber natürlich gleich darüber, dass das nichts
kosten darf, weil das ja kein Genussmittel ist – wenn ich das so salopp sagen darf.
Auch viele Kleinkläranlagen werden von privaten Hausbesitzern betrieben, und auch das macht gewaltig viel Arbeit, das sollte man nicht unterschätzen. Wer eine eigene Wasserversorgungsanlage hat, weiß, die kostet auch relativ viel Geld.
Da sind mir schon ein paar Bemerkungen, Frau Kollegin Herr, zu Ihrer Rede erlaubt, zum einen, was das Urteil betrifft, das scheinbare Urteil (Abg. Herr: Was heißt „scheinbare“?): Da ist es eigentlich nur darum gegangen, ob die Wasserversorgungsbetreiber, die Anlagenbetreiber und die Kommunen in der Gestaltung mitreden dürfen. – Ja, das dürfen sie. (Abg. Herr: Sicher!) Das ist sozusagen dabei rausgekommen, hat aber mit dem Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat überhaupt nichts zu tun, den gibt es schon seit ewigen Zeiten. Solange ich politisch aktiv bin, gibt es diesen Grenzwert.
Vielleicht muss man sich das genau anschauen. Ich empfehle nur, Fachlektüre zu lesen oder sich mit Leuten zu beschäftigen, die dort schon lange daheim sind: Bei Lysimeterproben zum Beispiel von Hausbrunnen sind dort, wo eine „luckerte“ – unter Anführungszeichen –, eine undichte Senkgrube war, die Nitratwerte am höchsten – alles im privaten Bereich zum Beispiel. Ich bitte also, da ein bisschen sorgsam umzugehen. (Abg. Herr: Was hat das eine mit dem anderen zu tun?)
Zur Entnahme von Wasser nur noch Folgendes: Wenn ich aus dem Grundwasser Wasser entnehme, brauche ich eine wasserrechtliche Bewilligung. Ganz ehrlich gesagt: Warum soll ich mir für mein Wasser daheim – Sie können gerne einmal bei mir vorbeikommen, Frau Kollegin, und sich das mit der Trinkwasserversorgung anschauen – einen Zähler einbauen? – Das rinnt von der Quelle, wobei der Nachbar dankenswerterweise – das sage ich auch dazu – duldet, dass ich auf seinem Grund das Wasser entnehmen darf, in einen Zwischenbehälter. Alles, was wir im Haus nicht verbrauchen, rinnt sozusagen gleich wieder hinaus und geht wieder ins Grundwasser. Das ist eine ganz normale Geschichte, also da
brauche ich wirklich keinen Zähler. Bei Wasserversorgungsanlagen ist man da in Wirklichkeit sehr dahinter.
Die Landwirtschaft macht sehr, sehr viel. Das ist keine Blackbox, Frau Kollegin Feichtinger. Man sollte sich anschauen, was das Umweltprogramm betrifft und was nachhaltige Bewirtschaftung in Österreich durch die bäuerlichen Familienbetriebe bedeutet, und nicht Verunsicherung betreiben. Wasser ist ein wertvolles Gut und braucht einen sorgsamen Umgang. (Beifall bei der ÖVP.)
Präsidentin Doris Bures: Zu Wort ist dazu nun niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
Wünscht der Herr Berichterstatter ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall.
Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag des Umweltausschusses, den vorliegenden Bericht III-1081 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen.
Wer sich dafür ausspricht, den bitte ich um ein Zeichen. – Der Bericht ist einstimmig zur Kenntnis genommen.
Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Julia Herr, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Schutz der heimischen Wasserversorgung“.
Wer spricht sich dafür aus? – Das ist die Minderheit, abgelehnt.
Bericht des Finanzausschusses über die Regierungsvorlage (2502 d.B.): Bundesgesetz, mit dem das Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz und das Postmarktgesetz geändert werden (2541 d.B.)
Präsidentin Doris Bures: Damit kommen wir zum 7. Punkt unserer Tagesordnung.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Ich begrüße Herrn Bundesminister Martin Kocher im Hohen Haus und erteile Herrn Abgeordneten Franz Leonhard Eßl als Erstredner das Wort. – Bitte.
Abgeordneter Franz Leonhard Eßl (ÖVP): Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Bevor ich zum Tagesordnungspunkt komme, darf ich die ÖVP-Ortsgruppe Burgkirchen aus dem Bezirk Braunau im Namen meiner Kollegin Andrea Holzner recht herzlich begrüßen. (Beifall bei der ÖVP sowie bei Abgeordneten von SPÖ, FPÖ, Grünen und NEOS.)
Die Frau Präsidentin hat es schon erwähnt: Unter diesem Tagesordnungspunkt diskutieren wir die Änderung von zwei Gesetzen. Zuerst möchte ich mich dem Postmarktgesetz widmen. Worum geht es bei dieser Gesetzesänderung? – In Österreich werden Briefsendungen aus dem Inland innerhalb einer gewissen Frist zugestellt. Das ist bei uns in Österreich zum Beispiel bei dem als nationale Prioritysendung eingestuften Standardbrief der Einlieferungstag plus ein Tag.
Diese Frist nimmt der Weltpostverein auch als Maßstab für Sendungen aus dem Ausland, und wenn bei diesen Sendungen die Zustellung länger dauert, sieht sich die Österreichische Post AG als Universaldienstleister mit Forderungen nach Strafzahlungen seitens des Weltpostvereins konfrontiert. Andere Länder haben wesentlich längere Fristen. In Dänemark zum Beispiel gilt für das Referenzprodukt: Einlieferungstag plus fünf Tage; in Frankreich: Einlieferungstag plus drei Tage; in Finnland: Einlieferungstag plus vier Tage. (Abg. Loacker: Finnland ist ein bisschen größer!) Diese Länder haben auch keine Sorgen wegen Strafzahlungen.
Deshalb ändern wir heute die für Österreich gültige internationale Frist, und diese wird dann als Maßstab für Sendungen aus dem Ausland angewandt. Für Sendungen aus dem Inland ändert sich dadurch nichts, weder was die Fristen noch was die Tarife betrifft.
Davon abgesehen darf ich doch von der Post AG einmahnen, den Versorgungsauftrag als Universaldienstleister flächendeckend konsequent durchzuführen. Gerade in den ländlichen Gebieten kam es in den letzten Monaten, in der letzten Zeit immer wieder dazu, dass Sendungen zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt, mit Verzögerungen in Zustellung gekommen sind. Wir schaffen heute für die Post AG bessere Rahmenbedingungen, wir erwarten aber von der Post AG auch eine Verbesserung der Leistungen für die Bürger und Bürgerinnen unseres Landes.
Zum zweiten Punkt, dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz, darf ich auch noch einige Worte sagen. Wer hat sich nicht schon öfters darüber geärgert, dass bei Handys verschiedener Hersteller die Ladekabel nicht kompatibel sind, nicht zu jedem Gerät passen? Teilweise braucht man für das Nachfolgeprodukt ein und desselben Herstellers bereits ein anderes Ladekabel. Seit Jahren pochen wir auf eine Änderung, auf eine einheitliche Lösung. Nun werden bestimmte Funkanlagen mit kabelgebundenen Ladefunktionen EU-weit harmonisiert. Davon umfasst sind Mobiltelefone, Tablets, Notebooks mit Zubehör, Digitalkameras und Ähnliches. Die neuen Vorschriften sollen ab 28. Dezember 2024 gelten. Für Laptops brauchen die Hersteller eine längere Vorlaufzeit; dafür gilt die neue Richtlinie ab 28.4.2026.
Zudem wird noch die Möglichkeit für Verbraucher und Endnutzer geschaffen, Geräte ohne Ladekabel zu erwerben. Damit der Käufer informiert ist, ob das Produkt mit Ladenetzteil ausgestattet ist oder nicht, ist ein klarer Aufdruck oder ein Aufkleber an der Verpackung anzubringen.
Mit dieser Richtlinie gelingt es nicht nur, eine vereinfachte Handhabung zu erwirken, sondern es gelingt auch, Kosten zu sparen und die Umwelt zu schützen, weil Ressourcen gespart werden.
Meine geschätzten Damen und Herren, wenn es auch nur ein kleiner Teilbereich ist, die Europäische Union beweist damit, dass bei entsprechendem Einsatz vernünftige Maßnahmen durchgesetzt und umgesetzt werden können. Deshalb
ist es nicht egal, wer in Europa das Sagen hat. Bei der Wahl zum Europäischen Parlament am 9. Juni können Sie mitbestimmen, ob jene stärker werden, die Europa zerstören wollen – Blickrichtung FPÖ –, oder ob jene Stimmen gewinnen und gestärkt werden sollen, die Europa stärken wollen – Blickrichtung Kollege Lopatka (Abg. Hoyos-Trauttmansdorff: Der aber nicht da ist!) und ÖVP –, ganz nach dem Motto: Europa, aber besser! (Beifall bei der ÖVP.)
18.24
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Max Lercher. – Bitte.
Abgeordneter Maximilian Lercher (SPÖ): Geschätzte Frau Präsidentin! Herr Minister! Kolleginnen und Kollegen! Das war jetzt ein flammender Appell für Reinhold Lopatka. Das Gute ist, Reinhold ist ein Steirer; ansonsten würde ich bei dieser Europawahl nicht die ÖVP wählen. Aber sei’s drum!
Wahlansprachen hatten wir heute schon genug, daher: Ich glaube, jetzt passiert etwas Gutes, indem nämlich hinsichtlich der alltäglichen kleinen Sorgen wirklich etwas weitergeht, und das ist zu begrüßen. Wer kennt es nicht, das große Problem mit der Suche nach dem Ladekabel? Meistens, wenn man eines braucht, findet man niemanden, der das gleiche hat. Alois Schroll stellt eines für viele unserer Fraktion zur Verfügung – vielen Dank dafür an dieser Stelle. (Heiterkeit und Beifall bei der SPÖ. – Abg. Zarits – erheitert –: Energiesprecher!) – Der Energiesprecher, ja, das passt eigentlich ganz gut. In Zukunft wird das allen Kolleginnen und Kollegen möglich sein.
Zur Verringerung der alltäglichen Sorgen ist diese Anpassung tatsächlich etwas Gutes. Es ist eine Harmonisierung, von der lange gesprochen wurde und die jetzt umgesetzt wird. Auch wir vonseiten der Sozialdemokratie begrüßen das sehr. Ich denke, in vielen Punkten kritisieren wir Europa immer zu Recht, in einigen Punkten zu Unrecht, aber wenn wie heute etwas Gutes passiert, soll man das
auch erwähnen – das stärkt, glaube ich, das Vertrauen –, und das ist hier der Fall. (Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordneten der ÖVP.)
Kollege Eßl hat die Fristen schon genannt, das ist gut. Im nächsten Jahr beginnt es bei den Handys, bei den Smartphones bis hin zu den Tablets und dann geht es weiter mit den Laptops. USB-C soll der EU-Standard werden, und das ist, glaube ich, der richtige Schritt.
In Bezug auf Artikel 2, Änderung des Postmarktgesetzes, gibt es von uns grundsätzlich auch nichts zu beklagen, wir gehen davon aus, dass es besser wird. Die Post AG soll aber – und das ist die Anmerkung –, wenn sie Spielraum bekommt, den auch an die Konsumentinnen und Konsumenten und vor allem an ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weitergeben. Ganz allgemein gesprochen sollte uns, glaube ich, stärker bewusst werden, dass die Post AG noch im Eigentum der Republik steht und viele Maßnahmen in der Vergangenheit, von der Liberalisierung bis hin zu den Schließungen der Kleinpostämter draußen am Land, falsch waren.
Ich glaube, wir haben dort einen Betrieb, der mittlerweile viel Gewinn erwirtschaftet, aber: Was da oder dort vielleicht früher einmal zu viel war, ist heute zu wenig! Wenn ich an die Arbeitsbedingungen bei den Zustellerinnen und Zustellern denke, dann muss ich sagen, wir haben dort Aufholbedarf. Wenn etwas besser wird, dann soll in diesen Bereich investiert werden, weil die Beschäftigten dort ein Aushängeschild für ganz Österreich sind und den maßgeblichen Anteil zur Qualität und zur Kundenzufriedenheit beitragen. Das, glaube ich, ist in unser aller Sinne, dass wir das auch verlangen, weil die Post immer noch einen öffentlichen Auftrag hat, den sie auch wahrnehmen muss – nicht nur: reine Profitmaximierung. – Vielen Dank. (Beifall bei der SPÖ.)
18.27
Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Ulrike Fischer. – Bitte.
18.28
Abgeordnete Mag. Ulrike Fischer (Grüne): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Minister! Sehr geehrte Verbraucherinnen und Verbraucher! Ich habe jetzt nur mitgenommen, was ich tagtäglich brauche, weil ich sonst den Inhalt zweier Schubladen hätte mitnehmen müssen. Das (einige unterschiedliche Ladekabel in die Höhe haltend) ist mein täglicher Kabelsalat. Grüner Salat ist gesund, Kabelsalat nicht, weil er jährlich 11 000 Tonnen Elektroschrott verursacht – 11 000 Tonnen Elektroschrott!
250 Millionen Euro werden jährlich in der Europäischen Union für unnötige Ladekabel ausgegeben. Wieso unnötig? – Weil es in Wirklichkeit seit zehn Jahren möglich ist, einheitliche Kabel zur Verfügung zu stellen, aber das mit der Industrie, mit den Konzernen zu verhandeln, dafür hat es Zeit gebraucht. Heute ist es endlich möglich, ein Gesetz für ein einheitliches Ladegerät zu beschließen, und das ist gut so. (Beifall bei den Grünen. – Abg. Tomaselli: Jawohl!)
Es gibt eine Partei, die uns das nicht gönnt, dass wir uns das Leben einfacher machen, dass wir uns das Leben zukunftsorientierter machen, dass wir den Green Deal in Europa durchsetzen, für eine Reparaturfreundlichkeit, für ein Ökodesign, für ein einfaches USB-C-Kabel, dass wir – der Kollege vor mir hat es gesagt – ein Ladegerät haben, das wir für das Tablet, für das Handy, für die Kamera, für die Kopfhörer, eben für alle elektrischen Geräte verwenden können. Diese Partei ist heute herausgegangen und hat gesagt: Harmonisierung, EU-Richtlinien – das ist Ökokommunismus. Sie sprechen von einem EU-Wahnsinn, ich spreche von einer Errungenschaft, dass wir es schaffen, auf EU-Ebene gemeinsame Verordnungen, Richtlinien umzusetzen, die Sinn machen. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
Ein einziges Ladegerät für alle unsere Sachen, die wir tagtäglich brauchen. Das ist gut und wichtig so. Wir Verbraucherinnen und Verbraucher brauchen auch die nötige Information dazu und auch das leisten wir mit diesem Gesetz. Auf einem Etikett kann ich erkennen, ob ich mein neues Handy mit meinem alten
Ladekabel verwenden kann. Was mache ich, wenn ich drei Ladegeräte zu Hause habe und nicht weiß, ob sich das mit dem Schnellladen ausgeht? All diese Informationen müssen in Zukunft auf einem Etikett angebracht werden. Gibt es keine Verbraucherinformation auf der Verpackung, weil es ohne Verpackung verkauft wird, dann müssen sie am entsprechenden Handy oder Gerät drauf sein. Auch das ist eine wirklich gute Errungenschaft. Verbraucherinnen, Verbraucher bekommen Information.
Es ist ein gutes Gesetz, das wir heute beschließen, und ich würde mich sehr freuen, wenn die Freiheitlichen sich an der Diskussion beteiligen. (Abg. Kassegger: Wir stimmen eh zu!) Sie sind ja bisher zu diesem Tagesordnungspunkt nicht eingemeldet, weil Ihnen die Europäische Union ja nicht wichtig ist. Nur, Leute, man kann Politik nicht nur in Österreich machen. (Abg. Tomaselli: Jawohl!) Wir leben in einer Zeit, in der alles im Internet passiert, und wir müssen europäisch einheitliche Regelungen schaffen. Was wir heute machen, ist richtig und gut. (Beifall bei Grünen und ÖVP.)
Wenn die Europäische Kommission sagt: Wir begrüßen die politische Einigung und ein einheitliches Ladegerät in der EU!, dann sollte die FPÖ nicht von EU-Wahnsinn sprechen, sondern sollte einmal in sich gehen und überlegen, ob es nicht sinnvolle Regelungen gibt, die Verbraucherinnen und Verbrauchern das Leben einfacher machen: das Recht auf Reparatur, das Recht auf Ersatzteile, das Recht auf ein einfaches USB-C-Kabel. Dieses (ein Kabel in die Höhe haltend) ist jetzt kein einfaches, aber es wird noch bessere, kürzere geben; (ein weiteres Kabel in die Höhe haltend) dieses hier zum Beispiel. (Zwischenruf des Abg. Lausch.)
Sie sehen, mit dem Kabelsalat kennt man sich dann gar nicht mehr aus. Aber das wird hoffentlich alles Geschichte sein, wenn wir das heute umsetzen, und wenn wir es schaffen, es in allen 27 EU-Ländern umzusetzen. Es braucht aber uns alle gemeinsam, und da würde ich die FPÖ einladen, ihren Teil beizutragen und aufzuhören, irgendwas zu sagen und nicht mitzuarbeiten. (Beifall bei den Grünen sowie bei Abgeordneten der ÖVP.)
11 Tonnen Elektroschrott sind keine Peanuts. Wenn wir die Umwelt schützen wollen, dann beschließen wir heute dieses Gesetz. – Danke. (Beifall bei den Grünen sowie bei Abgeordneten der ÖVP.)
18.32
Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Gerald Loacker. – Bitte. (Zwischenruf des Abg. Obernosterer.)
Abgeordneter Mag. Gerald Loacker (NEOS): Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Bundesminister! So launig wie Kollegin Fischer kann ich das nicht wiedergeben, aber ein paar Takte zum Postmarktgesetz: Eigentlich müsste nach dem Postmarktgesetz periodisch die Zweckmäßigkeit, die Wirtschaftlichkeit und die Versorgungsqualität der Zustellung durch die Österreichische Post überprüft werden. Im Ausschuss – Herr Minister, Sie können nichts dafür, denn Sie repräsentieren heute den abwesenden Finanzminister – konnte die Frage nach dieser periodischen Überprüfung aber nicht beantwortet werden, und der Rechnungshof hat moniert, dass diese nicht stattfindet. Dass Ministerien bei uns immer wieder den Rechnungshof ignorieren, ist eine traurige Tatsache.
Mit dem Gesetz, das heute kommt, soll für die Österreichische Post AG ein Level-Playing-Field bei der Zustellung von Poststücken aus dem Ausland geschaffen werden. Da ja auch andere Anbieter, nicht nur die Post, hier auf dem Markt sind, sollen die gleichen Regeln gelten. Das ist gut und wichtig und es bietet auch die Gelegenheit, ein bisschen zurückzuschauen, was uns die Europäische Union gebracht hat.
Die älteren Jahrgänge hier, zu denen ich mich inzwischen auch zählen darf, können sich noch an das Postmonopol erinnern, nicht? Da hat es einfach nur die Post gegeben und nichts anderes. Wenn Sie einen Telefonanschluss wollten, dann haben Sie einmal gemütlich drei Monate gewartet, bis jemand von der Post- und Telegrafenverwaltung sich zu Ihnen bequemt hat und Ihnen vielleicht
einen Viertelanschluss installiert hat. (Abg. Doppelbauer: So alt bist du jetzt auch nicht!)
Damals haben Sie für eine Telefonminute im Festnetz von Wien nach Bregenz 6,67 Schilling bezahlt, ungefähr 50 Cent. Niemand würde heute, 30 Jahre danach, für eine Festnetzminute 50 Cent zahlen. Da sieht man, was uns die Europäische Union, was uns die Marktwirtschaft und was uns der Wettbewerb gebracht haben, nämlich auch eine Post, die sich um den Kunden bemühen muss. (Beifall bei NEOS und Grünen. – Abg. Fischer: Gute Rede!)
18.34
Präsidentin Doris Bures: Frau Abgeordnete Angela Baumgartner, Sie gelangen zu Wort. – Bitte.
Abgeordnete Angela Baumgartner (ÖVP): Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Minister! Liebe Zuseherinnen und Zuseher! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte heute über eine Gesetzesnovelle sprechen, die auf den ersten Blick sehr trocken wirkt, auf den zweiten Blick aber eher nicht mehr, da sie relevante Änderungen für die Konsumentinnen und Konsumenten bringt.
Von meinen Vorrednern wurde schon sehr viel dazu gesagt. Es ist eine kleine Novelle mit einer, wie ich meine, doch ein bisschen größeren Wirkung. Es geht um das Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz. Dieses legt fest, dass ab dem 28. Dezember 2024 alle Smartphones, Digitalkameras, Kopfhörer, Tablets und Videospielkonsolen über ein einheitliches Ladeanschlusssystem verfügen müssen. Diese Vorschrift, die auf einer seit Langem diskutierten EU-Richtlinie basiert, wird ab dem 28. April 2026 auch auf Notebooks ausgeweitet.
Die unterschiedlichen Ladeanschlüsse, Ladegeräte bei Mobiltelefonen, bei Tablets, bei Kopfhörern und anderen Elektronikgeräten sind nicht nur für uns sehr nervig, sondern auch der EU schon lange ein Dorn im Auge. Seit mehr als
zehn Jahren wurde daher auf EU-Ebene daran gearbeitet, die Hersteller dazu zu bringen, eine einheitliche Technologie zu verwenden. Die nun umgesetzte EU-Richtlinie kämpft gegen den Kabelsalat und den Elektroschrott. Sie stellt sicher, dass die Geräte auch ohne Ladegeräte erworben werden können, und wir nicht gezwungen sind, mit den verschiedensten Anschlüssen zu jonglieren.
Die Vereinheitlichung bei den Ladeanschlüssen ist sowohl aus Sicht der Konsumentinnen und Konsumenten, als auch aus Umweltschutzgründen wirklich sehr begrüßenswert. Es folgen daraus Vereinfachungen und nutzerfreundliche Handhabungen. Das ist ein kontinuierlicher Prozess, den es auch weiterhin in Europa zu verfolgen gilt. Europa ist gut, es muss noch besser werden, und das geht nur mit Ihrer Unterstützung für die ÖVP bei den Europawahlen. – Danke schön. (Beifall bei der ÖVP.)
Präsidentin Doris Bures: Zu Wort ist dazu nun niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
Wünscht der Herr Berichterstatter ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall.
Damit kommen wir zur Abstimmung über den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 2502 der Beilagen.
Wer diesem die Zustimmung gibt, den ersuche ich um ein entsprechendes Zeichen. – Das ist einstimmig so angenommen.
Wir kommen sogleich zur dritten Lesung.
Der Gesetzentwurf ist in dritter Lesung einstimmig angenommen.
Bericht des Finanzausschusses über die Regierungsvorlage (2509 d.B.): Bundesgesetz über die Erhöhung der Quote Österreichs beim Internationalen Währungsfonds (IWF-Quotenerhöhungsgesetz 2024) (2542 d.B.)
Präsidentin Doris Bures: Wir kommen zum 8. Punkt der Tagesordnung.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Erster Redner: Herr Abgeordneter Rudolf Taschner. – Bitte.
Abgeordneter Mag. Dr. Rudolf Taschner (ÖVP): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Hohes Haus! Erlauben Sie mir, dass ich vor Eingang in das eigentliche Thema meinen Schock zum Ausdruck bringe. Robert Fico ist wirklich schwer verletzt, lebensgefährlich verletzt.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist in der Nähe von unserem Lande passiert, und ich bin dem Geschick sehr dankbar, dass wir hier in einem Parlament sind, wo wirklich heftigst gestritten wird, sogar bis zu Ordnungsrufen hin gestritten wird, aber wo mit Worten gestritten wird. Es möge so bleiben, dass hier immer mit Worten gestritten wird, auch wenn es ganz heftig ist, es soll immer mit Worten sein. Wir wünschen Robert Fico natürlich alles erdenklich Gute und dass er bald genesen wird. (Beifall bei ÖVP, SPÖ, Grünen und NEOS sowie bei Abgeordneten der FPÖ.)
Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Internationale Währungsfonds ist nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges installiert worden, um einen Rettungsschirm zu schaffen, der dafür sorgen soll, dass man, wenn Staaten nahe der Verwerfung sind – was ja früher der Fall gewesen ist –, eine letzte Möglichkeit hat, dass diese Staaten mit Geld versorgt werden. Das ist eine Organisation, die unter dem Schutzschild der Vereinten Nationen steht, und dieser Internationale Währungsfonds wird mit Geldern beschickt, die aus den 190 Mitgliedstaaten kommen.
Am meisten wird er – auch schon aus historischen Gründen – von den Vereinigten Staaten von Amerika mit etwas über 17 Prozent finanziell unterstützt; danach kommen Deutschland, Japan und China mit um die 6 Prozent. Man zahlt Quoten ein und hat dann einen Stimmanteil, und die Schweiz hat
einen Stimmanteil von etwa 1,2 Prozent. Österreich, das ungefähr gleich groß ist, hat allerdings nur einen Stimmanteil von 0,83 Prozent – aber diesen Stimmanteil wollen wir natürlich behalten, denn er dient ja dazu, dass man mitstimmen kann, ob tatsächlich Gelder ausgeschüttet werden sollen. Darum ist es auch notwendig, dass wir die Quote erhöhen, und diese Erhöhung der Quote wird jetzt fast einstimmig beschlossen. Ich weiß nicht, warum die Freiheitliche Partei sich dagegen ausspricht, aber es ist eine wichtige Organisation, die als letzter Rettungsschirm dient.
Ich erlaube mir, zwei Gedanken daran anzuschließen: Es ist nämlich überhaupt nicht lustig, wenn man als Staat den Internationalen Währungsfonds in Anspruch nehmen muss. Das ist die letzte Möglichkeit, wenn es keinen anderen Geldgeber mehr gibt; und wenn man dann beim Internationalen Währungsfonds um Gelder ansucht, dann gibt es eine gewisse – so nennt man das – Konditionalität. Das heißt, man muss dann bestimmte Auflagen erfüllen, die sehr, sehr schmerzhaft sind und den Wohlstand in dem jeweiligen Staat stark betreffen.
Mögen wir davon entfernt sein, dass uns das trifft! Es könnte nämlich passieren, es ist nicht ausgeschlossen. (Ruf bei der SPÖ: Wenn ihr so weitermacht!) Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist zum Beispiel so, dass jetzt gerade in der Vorwahlzeit gesagt wird: Ja, wir werden jetzt weiter Geld ausgeben! – Geld ausgeben, das gar nicht da ist. Wenn wir dann in einer Situation sind, in der die Schulden zu hoch sind und wir beim Internationalen Währungsfonds anrufen müssen, wäre das schrecklich; wenn wir zum Beispiel, wie der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei es vorschlägt, wieder Staatsbetriebe einführen. Er stellt sich vor, dafür 20 Milliarden Euro einzusetzen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren auf der Galerie, diese 20 Milliarden Euro, sagt er, kommen dann von den Superreichen, aber glauben Sie mir – und Herr Krainer wird mir das vielleicht auch bestätigen (Zwischenruf bei der SPÖ) –: Die Superreichen laufen sehr schnell davon. Wenn er die 20 Milliarden Euro haben möchte, dann sind wir und Sie alle auf der Galerie plötzlich superreich geworden, denn dann geht das Geld dort weg – oder aber, was das größere Pech
wäre, wir verarmen mit diesem staatlichen Unsinn tatsächlich so stark, dass wir dann zum Internationalen Währungsfonds gehen müssten, und das wäre fürchterlich.
Der andere Punkt, den ich erwähnen möchte, ist ein demokratiepolitischer Gedanke, der mir gekommen ist: Wenn wir Geld aufnehmen, dann könnte das unter Umständen bis zu einem undemokratischen Akt in folgender Hinsicht führen: Demokratie bedeutet ja, dass wir Entscheidungen treffen und diejenigen, die von den Entscheidungen betroffen sind, dann wählen und erklären: Ja, das war in Ordnung!, oder: Das war nicht in Ordnung! Wenn wir aber auf Teufel komm raus Schulden aufnehmen, dann treffen wir Entscheidungen für Leute, die noch gar nicht auf der Welt sind. (Abg. Kassegger: Sagen S’ das dem Herrn Finanzminister! Ja, sagen S’ das dem Herrn Finanzminister! Vollkommen richtig, dem Magnus Brunner sagen!) Das ist eine Entscheidung, die dann eigentlich völlig undemokratisch ist. Dessen müssen wir uns bewusst sein. (Zwischenrufe bei den NEOS.) Das heißt, die Lösung besteht nicht darin, dass wir diese Gelder en masse aufnehmen, sondern darin, dass wir die Produktivität steigern. (Abg. Kassegger: Richtig, das tun Sie aber alles nicht!) Das muss auch das Ziel der künftigen Regierung sein, dass dafür gesorgt wird.
Nur so kommen wir aus diesem Schlamassel heraus, und ich glaube, wenn Sie auf Leistung, auf Sicherheit und auf die Familie, die ja eigentlich der Kern dessen ist, dass wir eine gute Gesellschaft haben, setzen – und das sind die drei Punkte, die im Österreichplan stehen, Herr Kollege Kassegger, das wissen Sie –, dann haben wir die Chance (Abg. Kassegger: Ja, aber das ist ja nur Papier, Sie produzieren Papier!), dass wir in eine stabile und eine gute Zukunft schreiten. Das ist das Ziel, und dann werden wir den Internationalen Währungsfonds mit unseren Quoten beschicken, aber niemals beim Internationalen Währungsfonds ansuchen müssen, dass wir von ihm Kapital beziehen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen. (Beifall bei der ÖVP.)
18.44
Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Petra Bayr. – Bitte.
Abgeordnete Petra Bayr, MA MLS (SPÖ): Frau Präsidentin! Herr Minister! Finanzpolitik ist wahrscheinlich eines der Paradebeispiele dafür, dass man Politik über den Tellerrand hinaus denkt, dass man sie international denkt. Das IWF-Quotenerhöhungsgesetz ist noch einmal aufgrund dessen, dass Währungspolitik ja nicht abgekoppelt irgendwo passieren kann, ein gutes Beispiel dafür, wie internationale Zusammenarbeit funktionieren sollte.
Globale Steuerpolitik, denke ich, ist auch ein Thema, bei dem internationale Zusammenarbeit von Anfang an sehr wichtig ist. Wir wollen alle – wir schreiben es in Resolutionen und sonst wohin –, dass alle Länder in der Lage sind, genügend eigene Steuereinnahmen zu haben, um soziale Infrastruktur und damit Daseinsvorsorge zu finanzieren, die für alle gleichermaßen zugänglich ist, vollkommen unabhängig davon, ob jemand arm oder reicht ist, ob man eine Kreditkarte hat oder nicht.
Wir wollen alle, dass man Steuersümpfe trockenlegt. Wir wollen alle, dass man es vermeidet, dass Gewinne an der Steuer vorbei irgendwo andershin steuerschonend in Schlupflöcher oder -oasen – oder viel eher Sümpfe – verschoben werden; und wenn man sich anschaut, wo das passiert, dann ist es vor allem auf der OECD-Ebene, wo von Anfang an die Industrieländer dabei sind und sich mehr oder weniger ihre Regeln im Interesse des Nordens ausgemacht haben, aber den Süden im Großen und Ganzen vergessen haben.
Wir hatten letzte oder vorletzte Woche eine Aussprache mit dem Weltbankvizedirektor Axel van Trotsenburg, der gesagt hat, wenn er seine regionalen Regeln durchsetzen will, dann gründet er eine regionale Bank, macht seine Spielregeln, verfestigt seine Interessen und wird dann global – dann haben alle anderen, die nachher dazukommen, weniger zu sagen.
Darum finde ich es so unglaublich wichtig, dass wir, wenn wir uns über eine internationale Finanzarchitektur den Kopf zerbrechen, auch wirklich die UNO ins Auge nehmen und versuchen, auf UN-Ebene von Beginn an alle miteinzubeziehen, um Regeln zu schaffen, von denen dann auch alle gleichermaßen profitieren und nicht einige sich etwas in die Säcke stecken und andere durch die Finger schauen. Das heißt ja, dass die Menschen dieser Länder durch die Finger schauen. (Zwischenrufe bei den NEOS.) Ich wollte im Finanzausschuss einen Antrag dazu einbringen, und der wurde, wie so vieles andere, vertagt.
Genauso vertagt worden ist – und das ist ein anderes Beispiel – ein Antrag, bei dem es darum ginge, dass der Zoll auch eine wichtige Rolle zu spielen hat: dann, wenn das Lieferkettengesetz implementiert wird, das auf europäischer Ebene ja quasi fertig ist. Da hat der Finanzminister kurzerhand sogar abgestritten, dass der Zoll etwas mit seinem Ministerium zu tun hat; das hat er dann eh wieder zurückgenommen. Ich denke aber, genau jetzt wäre eigentlich die Zeit, zu schauen, wie man auf europäischer, auf EU-europäischer Ebene zusammenarbeiten kann, um ein Lieferkettengesetz dann möglichst sinnvoll und schnell zu implementieren, und da gibt es Institutionen wie den Zoll, die eine wichtige Rolle dabei zu spielen haben. Steuerpolitik, Finanzpolitik, aber auch Lieferketten- und damit Rohstoffpolitik sind wahrscheinlich ein gutes Beispiel, wie internationale Zusammenarbeit sinnvoll funktionieren kann. – Danke vielmals. (Beifall bei der SPÖ.)
18.48
Präsidentin Doris Bures: Zu einer tatsächlichen Berichtigung hat sich Abgeordneter Jan Krainer zu Wort gemeldet. – Bitte.
Abgeordneter Kai Jan Krainer (SPÖ): Abgeordneter Taschner hat soeben vom Rednerpult aus behauptet, dass die Sozialdemokraten mit ihrem Herz- und Hirnprogramm die 20 Milliarden Euro für den Transformationsfonds aus einer Vermögens- oder Millionärssteuer finanzieren wollen. – Das ist falsch.
Ich berichtige tatsächlich: Wir wollen ihn durch Dividenden von Beteiligungen finanzieren, weil wir das Geld von einer Millionärssteuer schon brauchen (Ruf bei der ÖVP: ... Wortmeldung und keine tatsächliche Berichtigung!), um das Gesundheitssystem zu reparieren, das Sie gemeinsam mit den Freiheitlichen kaputtgemacht haben. – Vielen Dank. (Beifall bei der SPÖ.)
18.49
Präsidentin Doris Bures: Nun ist Herr Abgeordneter Jakob Schwarz zu Wort gemeldet. – Bitte.
Abgeordneter Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA (Grüne): Frau Präsidentin! Sehr geehrter Minister! Hohes Haus! Liebe Zuseherinnen und Zuseher! Ich möchte zuerst im Namen unserer Wissenschaftssprecherin Eva Blimlinger die Leiter der Zentralen Informatikdienste der Universitäten begrüßen, wenn sie noch im Saal sind – willkommen hier im Parlament! (allgemeiner Beifall) –, und kurz auf den Tagesordnungspunkt eingehen.
Der Gouverneursrat des IWF hat zur Erhöhung der finanziellen Stabilität des IWF beschlossen, die Quoten zu erhöhen – für alle gleich. In dem Fall geht es also nicht darum, wie sich das Verhältnis zwischen den Industrieländern und den sich industrialisierenden Ländern verändert, sondern man kann sagen, in Summe geht es um eine Erhöhung der Eigenmittel und eine geringere Abhängigkeit von Fremdmitteln.
Interessanterweise – ich glaube, die FPÖ stimmt dagegen – ist es aber so, dass Österreich von dieser Maßnahme mittelfristig sogar profitieren könnte, weil der relative Anteil bei diesen Eigenmitteln geringer als bei den anderen ist und man sich da entsprechend etwas sparen könnte.
Ich finde, von diesen Krisen, in denen der IWF dann oft als Lender of Last Resort einspringt, sind oft wirklich nicht besonders finanzstarke Länder betroffen. Insofern ist es wichtig, dass es diese Institution gibt.
Beim IWF stellt man im Vergleich zur Weltbank schon auch fest, dass die Erkenntnis, dass zum Beispiel der Klimawandel eine zentrale Herausforderung ist, schon sehr weit gereift ist und das auch bei seinen Maßnahmen berücksichtigt wird. Insofern ist das auch aus dieser Perspektive unterstützenswert.
Ich bitte also um Zustimmung. Vielleicht schaffen es ja auch die Freiheitlichen. – Vielen Dank. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
18.50
Präsidentin Doris Bures: Nun gelangt Frau Abgeordnete Karin Doppelbauer zu Wort. – Bitte.
Abgeordnete Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer (NEOS): Frau Präsidentin! Herr Minister! Wir können es kurz machen: Wir stimmen diesem Gesetz auch zu. Wir sehen da auch viele Vorteile, weil es letztendlich uns als exportorientiertem Land natürlich nur recht sein kann, wenn es ein globales Finanzsicherheitsnetz gibt, das durch den IWF abgesichert wird.
Ja, der österreichische Beitrag wird erhöht. Das ist aber auch notwendig. Viele Jahre hat sich nichts getan. Es wird sich auch nicht sehr aufs Budget auswirken.
Wie Sie wissen, werden diese Gelder von den nationalen Notenbanken zur Verfügung gestellt. Da werden wir – auch das wissen Sie – in den nächsten Jahren sowieso nicht viel Rendite beziehungsweise Dividende für die Republik erwarten können. Also auch das ist alles gut.
Ein kurzer Ausflug vielleicht auch noch zu Kollegen Taschner, weil ich jetzt doch ein wenig schmunzeln musste, als ich gehört habe, dass es darum geht, dass gespart werden muss und dass Leistung sich auszahlt: Meine Damen und Herren, ich glaube, Sie kennen alle das Budget von diesem Jahr, 2024. Die Bundesregierung geht in ein Defizit von über 20 Milliarden Euro allein in diesem Jahr. Da würde man sich ja tatsächlich wünschen, dass es eine übergeordnete Stelle
gibt, die einmal darauf schaut und die Reformen wirklich einfordert und dieses ständige Geldausgeben mit der Gießkanne stoppt.
Deswegen – wir haben heute einen großen Europatag – würden wir als NEOS ja auch vorschlagen, dass das europäische System des ESM in einen europäischen Währungsfonds weiterentwickelt wird, der als unabhängige Institution dann dem Europäischen Stabilitätsmechanismus nachfolgen sollte, damit die EU-Länder infolge einer notwendigen Entschuldung unterstützt werden können beziehungsweise auch Reformen, wie sie ja sehr stark und sehr heftig vom IWF im Augenblick gemacht werden, in Europa gemacht werden könnten. Das würden wir tatsächlich sehr positiv sehen.
Vielleicht auch noch ein Punkt, den wir in diesem Zusammenhang auch sehr positiv sehen würden: Wie wir alle wissen, sind andere Länder, wie zum Beispiel China, im Augenblick sehr stark unterwegs, um Infrastruktur in anderen Ländern – in Europa, aber sehr stark vor allem auch in Afrika – zu unterstützen. Wenn wir so etwas wie einen europäischen Währungsfonds hätten, dann wäre es möglich, als Europa starke Punkte zu setzen und China ein wenig das Wasser abzugraben. – Vielen Dank. (Beifall bei den NEOS.)
Präsidentin Doris Bures: Zu Wort ist dazu nun niemand mehr gemeldet. Damit ist die Debatte geschlossen.
Wünscht der Herr Berichterstatter ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 2509 der Beilagen.
Wer dem die Zustimmung gibt, den ersuche ich um ein entsprechendes Zeichen. – Das ist mit Mehrheit so angenommen.
Wir kommen sogleich zur dritten Lesung.
Der Gesetzentwurf ist in dritter Lesung mit Mehrheit angenommen.
9. Punkt
Bericht des Finanzausschusses über die Regierungsvorlage (2510 d.B.): Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeordnung 1994, das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz und die Bundesabgabenordnung geändert werden (Grace-Period – Gesetz) (2543 d.B.)
Präsidentin Doris Bures: Wir kommen zum 9. Punkt der Tagesordnung.
Auf eine mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.
Herr Abgeordneter Christoph Matznetter gelangt zu Wort. – Bitte.
Abgeordneter Dr. Christoph Matznetter (SPÖ): Frau Präsidentin! Herr Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Jetzt haben wir schon leere Plätze, aber falls noch jemand zuhört: Schönen frühen Abend! Wir haben uns ja im Ausschuss bemüht, bei dem Grace-Period – Gesetz auch die positiven Dinge zu sehen.
Leider ist das, was die Regierungsparteien uns vorlegen, ein bisschen holprig. Ich meine, die Vorschriften im Bereich der Bundesabgabenordnung sind ein netter Versuch: Probieren wir etwas aus, sozusagen eine begleitende Beteiligung durch das Finanzamt während dieser Zeit des Betriebsübergangs!, warum dann aber gleich jede Außenprüfung gesetzlich verboten wird, erschließt sich mir nicht, weil es ja sein könnte, dass man einen Vorgang hat, bei dem ein genaueres Ansehen notwendig ist – aber gut.
Im Bereich der Gewerbeordnung, was die Betriebsanlagengenehmigungen betrifft, haben wir wirklich ein Thema, weil wir natürlich Betriebe haben, die zum Teil seit Jahren, Jahrzehnten bestehen und die Folgen der neuen Betriebsanlagengenehmigung zu enormen Kosten führen können. Da soll es eine kleine Erleichterung bei der Beschreibung der Anlagen geben. Das ist alles ein wenig wenig – um es einmal so zu sagen.
Der dritte Punkt ist: Im Bereich des Arbeitnehmer:innenschutzes kommt es zu einer Verschlechterung, die uns das Zustimmen schwierig macht. Dass erst im Nachhinein die Sicherheitsvertrauensperson genannt werden muss, dass nicht mehr in regelmäßigen Abständen die entsprechenden Fallbesprechungen stattfinden: Dass diese Kritik der AK im Begutachtungsverfahren nicht ernst genommen wurde, ist bedauerlich, und das macht es uns leider nicht möglich, dem Gesetz heute zuzustimmen.
Statt diesem holprigen Irgendetwas hätte man ja größere Dinge angehen können. Wir haben uns vorgestellt, dass man auf der Gesetzgebungsseite wirklich einen Schub macht, dass man Dinge zurücknimmt, die falsch gelaufen sind, und gleichzeitig dafür sorgt, dass der Staat wieder genug Geld und weniger Verschuldung hat und sinnvolle Maßnahmen macht.
Ich bringe daher, Frau Präsidentin, einen Entschließungsantrag ein:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Steuergerechtigkeit für Arbeitnehmer:innen und Pensionist:innen“
„Die Bundesregierung, insbesondere der Finanzminister wird aufgefordert, dem Nationalrat ehebaldigst ein Gesetzespaket für eine echte strukturelle Steuerreform vorzulegen, mit welcher höhere Steuern auf leistungslose Einkommen auf Kapital und Vermögen durch
- eine Rücknahme der KÖSt-Senkung,
- effektive Maßnahmen gegen Gewinnverschiebungen,
- die Abschöpfung von krisenbedingten Übergewinnen,
- die Einführung einer Millionärsabgabe sowie einer Erbschafts- und Schenkungssteuer für Millionenerbschaften ab 1 Mio. €, wobei ein zusätzlicher Freibetrag für das Eigenheim in Höhe von 1,5 Mio. € vorzusehen ist, und
- das Schließen von Steuerschlupflöchern
eingehoben werden, um im Gegenzug die Steuern auf Arbeitseinkommen und Pensionen senken zu können.“
*****
Das wäre eine echte strukturelle Reform, die den Grundsatz: Leistung muss sich lohnen! umfasst (Zwischenruf des Abg. Schellhorn) und vielleicht auch die vielen hier anwesenden nicht Volksvertreter, sondern Millionärsvertreter – ich höre schon Stimmen bei den NEOS – sich besinnen lassen würde.
Der Bezug der Abgeordneten hier wird von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern bezahlt, nicht von unseren Milliardären und Millionären. (Abg. Schellhorn: Und die Parteienförderung?) Vielleicht schreiben Sie sich das ins Stammbuch, Herr Kollege, kommen Ihrer Aufgabe als Mandatar der Volksinteressen nach und stimmen da zu! – Vielen Dank, meine Damen und Herren. (Beifall bei der SPÖ.)
18.58
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Kai Jan Krainer
Genossinnen und Genossen
betreffend: Steuergerechtigkeit für Arbeitnehmer:innen und Pensionist:innen
eingebracht in der 262. Sitzung des Nationalrates im Zuge der Debatte zu Top 9 Bericht des Finanzausschusses über die Regierungsvorlage (2510 d.B.): Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeordnung 1994, das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz und die Bundesabgabenordnung geändert werden (Grace-Period – Gesetz) (2543 d.B.)
Begründung
Mit dem Grace-Period-Gesetz wird für Familienunternehmen und KMU bei Unternehmensübergaben von der Finanzverwaltung die Möglichkeit geschaffen, durch eine begleitende Prüfung der Steuersachverhalte durch die Finanz, Rechtssicherheit für die Unternehmen in der Beurteilung steuerlicher Sachverhalte zu schaffen. Zweifelsohne sind Steuerprüfungen ein Element, um Steuergerechtigkeit herzustellen. Dabei geht es nicht nur darum, Zweifelsfragen bei der steuerlichen Veranlagung von Familienunternehmen zu klären, sondern vor allem darum, dass es keine Toleranz für Steuerbetrüger geben darf, um die vielen steuerehrlichen Bürger:innen und Familienunternehmen/KMUs zu schützen. Eine Arbeitsgruppe im Finanzministerium hat analysiert, dass rund 70% der Privatstiftungen in Österreich noch nicht geprüft wurden.1 Unsere Steuergesetze müssen einfacher und weniger gestaltungsanfällig gemacht werden, denn es müssen auch unerwünschte Steuergestaltungen, die legal sind, aber die Steuern für diejenigen, die sich teure Berater leisten können und damit ihre Steuern reduzieren, verhindert werden. Die bestehenden Steuern müssen daher effizienter eingehoben und Steuerschlupflöcher geschlossen werden. Das bedeutet auch, dass Österreich auf EU-Ebene für effektive Maßnahmen gegen internationale Gewinnverschiebungen eintreten muss.
Bei der Frage der Steuergerechtigkeit geht es aber nicht nur darum, Familienunternehmen bzw. KMUs zu prüfen, sondern es ist auch die Frage zu stellen, welchen Anteil natürliche Personen als Arbeitnehmer:innen und Pensionist:innen am Gesamtsteueraufkommen leisten, denn rd. 80 Prozent des Steueraufkommens stammen aus der Besteuerung von Arbeit und Konsum. Wertsteigerungen bei der Umwidmung von Grundstücken haben nichts mit Leistung, sondern nur mit einem Umwidmungsvorgang zu tun - sie sollen durch eine Umwidmungssteuer abgeschöpft werden. Statt eine Millionärssteuer auf Vermögen und Erbschaften der Reichsten einzuführen, hat die ÖVP/Grünen-Bundesregierung den Körperschaftsteuersatz von 25% auf 23% gesenkt und damit ein Milliarden-Steuergeschenk an Großkonzerne und Unternehmen verteilt. Die Abgeltung der kalten Progression in der Einkommen-/Lohnsteuer zahlen sich die Arbeitnehmer:innen und Pensionist:innen durch zuvor höhere
Steuerzahlungen infolge Anhebung der Löhne und Pensionen selber. Der SPÖ-Vorschlag einer Millionärssteuer trifft ausschließlich Nettovermögen, die über 1 Mio. € liegen, zusätzlich ist das bewohnte Eigenheim durch einen Freibetrag von bis zu 1,5 Mio. € ausgenommen. Dasselbe bei einer Erbschafts- und Schenkungssteuer, bei der nur Millionenerbschaften besteuert werden, das weitergegebene Eigenheim an Lebensgefährt:in oder Kinder aber steuerfrei bleibt. Eine echte strukturelle Steuerreform muss den Steueranteil von Arbeit am Gesamtabgabenaufkommen verringern und den Anteil von Steuern auf leistungslose Einkommen aus Kapital und Millionenvermögen erhöhen. Wenn Millionenvermögen und Millionenerbschaften einen gerechten Beitrag leisten, werden 98% der Österreichinnen und Österreicher weniger Steuern zahlen.
Durch die fehlende Gegenfinanzierung der Krisenmaßnahmen in den vergangenen Jahren hat der ÖVP-Finanzminister im vergangenen Oktober ein Budget vorgelegt, mit dem das Defizit des Jahres 2023 auch im Jahr 2024 mit -2,7% des BIP fortgeschrieben wird, und es wird bis 2027 auch nicht sinken.2 Der Fiskalrat sieht in seiner Schnellschätzung vom April 2024 die Maastricht-Defizitobergrenze von 3% gefährdet, denn das Defizit könnte für 2024 und 2025 auf über 3% des BIP steigen, auch die Schuldenquote wird sich erhöhen3, womit keine budgetären Spielräume mehr vorhanden sind.
Aus diesen Gründen stellen die unterfertigten Abgeordneten nachstehenden
Entschließungsantrag
„Die Bundesregierung, insbesondere der Finanzminister wird aufgefordert, dem Nationalrat ehebaldigst ein Gesetzespaket für eine echte strukturelle Steuerreform vorzulegen, mit welcher höhere Steuern auf leistungslose Einkommen auf Kapital und Vermögen durch
- eine Rücknahme der KÖSt-Senkung,
- effektive Maßnahmen gegen Gewinnverschiebungen,
- die Abschöpfung von krisenbedingten Übergewinnen,
- die Einführung einer Millionärsabgabe sowie einer Erbschafts- und Schenkungssteuer für Millionenerbschaften ab 1 Mio. €, wobei ein zusätzlicher Freibetrag für das Eigenheim in Höhe von 1,5 Mio. € vorzusehen ist, und
- das Schließen von Steuerschlupflöchern
eingehoben werden, um im Gegenzug die Steuern auf Arbeitseinkommen und Pensionen senken zu können.“
1 s. https://www.derstandard.at/story/3000000219026/wie-steuerpruefer-die-superreichen-ins-visier-nahmen
2 https://fiskalrat.at/dam/jcr:f987e479-a56b-40a2-ba88-de6de767bee2/2024_04_Pressetext_Schnellsch%C3%A4tzung_FISK-B%C3%BCro.pdf
3 https://fiskalrat.at/dam/jcr:f987e479-a56b-40a2-ba88-de6de767bee2/2024_04_Pressetext_Schnellsch%C3%A4tzung_FISK-B%C3%BCro.pdf
*****
Präsidentin Doris Bures: Der Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht, steht daher auch mit in Verhandlung.
Nächster Redner: Herr Abgeordneter Peter Haubner. – Bitte.
Abgeordneter Peter Haubner (ÖVP): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Geschätzter Herr Minister! Meine werten Kolleginnen und Kollegen! Geschätzte Damen und Herren! Österreich ist ein Land der kleinen und mittelständischen Unternehmer und damit natürlich ein Land von Familienbetrieben.
Wenn wir uns die KMU-Statistik genau anschauen, dann sehen wir, dass fast zwei Drittel der KMUs Familienbetriebe sind. Deshalb ist uns dieses Gesetz so wichtig, weil wir die Familienbetriebe bei der Betriebsübergabe unterstützen wollen.
Alle, die selbst ein Unternehmen haben – es gibt einige hier herinnen; auch wir zu Hause haben eines –, wissen ja, dass man überlegt: Okay, wie können wir den Betrieb in der Familie weitergeben? Da sind das natürlich Erleichterungen und auch Maßnahmen, die zu einer gewissen Art von Rechts- und Planungssicherheit beitragen. (Präsident Hofer übernimmt den Vorsitz.)
Wir wollen also diese Betriebsübergaben in der Familie erleichtern. Konkret wollen wir folgende Maßnahmen setzen: Einerseits sollen die Familienbetriebe und die Klein- und Mittelbetriebe bei der Unternehmensübertragung von der Finanz begleitet und noch unüberprüfte Zeiträume beleuchtet werden.
Das ist ein wesentlicher Punkt, denn das gibt wieder eine gewisse Art von Rechtssicherheit. So können sich Vater und Mutter, die ihren Betrieb an die Kinder übergeben wollen, durch die Prüfung sicher sein, dass ihr Unternehmen aus steuerlicher Hinsicht auch sicher ist. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor.
Geprüft werden sollen vom Finanzamt auf Antrag auch die letzten drei Jahre – und das innerhalb von maximal neun Monaten, damit diese Sicherheit auch entsprechend gegeben werden kann.
Wir haben dieses Gesetz auch so geplant, dass wir es im Jahre 2028 evaluieren, weil es natürlich einmal ein erster Schritt ist. Es wird sicher noch das eine oder andere folgen. In dieser Beziehung soll es eben auch um ein paar Maßnahmen gehen, die es erleichtern sollen und die nicht mehr Zeitgemäßes betreffen. Zum Beispiel fällt die nicht mehr zeitgemäße Verpflichtung weg, bei der Gewerbeanmeldung einen Firmenbuchauszug vorlegen zu müssen.
Es ist die Änderung des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes angeführt worden: Da sollen aber nicht irgendwelche Sicherheitsstandards abgeschafft werden,
sondern es soll einfach Erleichterungen für die Betriebe, für die Übernehmer in der Phase der Übernahme geben, damit man einfach in diesen ersten zwei Jahren auch ein paar Erleichterungen bekommt.
Ich denke, wir haben mit diesem Maßnahmenpaket die richtige Form gefunden, dass wir einerseits Planungs- und Rechtssicherheit für die Unternehmerinnen und Unternehmer, die übergeben, aber auch für jene, die übernehmen, schaffen, andererseits wollen wir natürlich ein paar Rechtsvorschriften als Begleitinstrumente in der Übergangsphase einsetzen – dem dient dieses Gesetz.
Unsere Ziele waren also: zum Ersten die Schaffung von Rechtssicherheit im Bereich von Steuern für Unternehmen bei der Übergabe im Familienverband, zum Zweiten die Verwaltungsvereinfachung bei Betriebsübergaben im Gewerbebereich und zum Dritten die Entbürokratisierung und Kostensenkung im Bereich des Arbeitnehmerschutzgesetzes – dieses erfüllen wir. Ich ersuche Sie um Zustimmung.
Herr Kollege Christoph Matznetter, als Unternehmervertreter – ich weiß, du bist natürlich auch ein Volksvertreter –, es wäre eine große Freude, wenn auch die SPÖ diesem Gesetz zustimmen könnte. – Danke vielmals. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Matznetter: Ich hab’ ja Martin Kocher einmal gefragt, ob er einen All-in-Vertrag mit ihm gemacht hat!)
19.02
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt Frau Abgeordnete Mag.a Selma Yildirim. – Bitte schön, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete Mag. Selma Yildirim (SPÖ): Herr Präsident! Herr Minister! Hohes Haus! Sehr geehrte Damen und Herren! Die vorliegende Regierungsvorlage zur Änderung der Gewerbeordnung, der Bundesabgabenordung und des Arbeitneh-
merInnenschutzgesetzes ist grundsätzlich zu begrüßen, wären da nicht Bestimmungen drinnen, die wir als Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitnehmer:innen nicht nachvollziehen können.
Mein Vorredner, Herr Abgeordneter Haubner, hat von einer Zahl gesprochen: Zwei Drittel der Klein- und Mittelbetriebe sind in Familienhand. – Das mag sein, aber ich glaube, wir alle wissen, wie die demografische Entwicklung ist. Wir erwarten in den nächsten vier, fünf Jahren, vielleicht in einem Zeitraum von zehn Jahren wirklich sehr viele Betriebsübergaben.
Mutter und Vater, die Sie so anschaulich darstellen, wären doch froh, wenn sie während dieser Betriebsübergabe, die auf Antrag durchaus sinnvoll von Finanzbediensteten betreut werden kann, auch wüssten, dass sie ihren Kindern oder jenen, die diese Betriebe übernehmen, auch die Möglichkeit geben, ihren Fürsorgepflichten gegenüber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nachzukommen.
Das verstehen wir nicht. Das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz regelt beziehungsweise agiert ja mehr oder weniger unterstützend auch für die Betriebe, wenn es um die Sicherheit von Arbeitnehmer:innen geht. Warum soll ein Arbeitsschutzausschuss, der wirklich nur assistierend und unterstützend sein soll, erst innerhalb von zwei Jahren einberufen werden? Das ist nicht nachvollziehbar. Das wäre ja eigentlich eine zusätzliche Servicierung der Unternehmerinnen und der Unternehmer. Das ist mit ein Grund, warum wir dieser Regierungsvorlage nicht unsere Zustimmung geben.
Eine andere Sache ist: Das Ganze ist natürlich auch mit mehr Arbeitsaufwand in den Finanzämtern oder Dienststellen des Finanzamtes Österreich verbunden. Ich merke immer öfter, weil wir eben so eine Kurve haben, die nach unten geht, dass die Offensive fehlt, wenn es bei der Rekrutierung von neuen Bediensteten für die Finanzverwaltung Schwierigkeiten gibt, qualifiziertes Personal zu finden. Wir brauchen eine attraktivere Struktur innerhalb der Finanzverwaltung, mehr Motivation und mehr Unterstützung.
Das bedeutet zwangsläufig: Die Planstellen müssen neu berechnet, neu evaluiert werden, an die neuen Herausforderungen und die vielen zusätzlichen Herausforderungen, die auf die Finanzbediensteten natürlich mit dieser Regierungsvorlage auch zusteuern werden, angepasst werden.
Mein Appell ist, dabei auch auf die Finanzbediensteten zu schauen. Vielleicht können Sie das Ihrem Regierungskollegen Finanzminister Brunner sagen, Herr Minister Kocher. In diesem Sinne habe ich erläutert, warum wir bei der Vorlage nicht mitgehen können. (Beifall bei der SPÖ.)
19.05
Präsident Ing. Norbert Hofer: Nächster Redner ist nun MMag. DDr. Hubert Fuchs. – Bitte schön, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter MMag. DDr. Hubert Fuchs (FPÖ): Sehr geehrter Präsident! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Hohes Haus! Im Ministerratsvortrag vom 19. Oktober 2021, der diesem Gesetz zugrunde liegt, haben die Bundesminister Schramböck, auch Sie, Herr Bundesminister Kocher, und Blümel folgendes Problem zu Recht erkannt – ich darf hier aus dem Ministerratsvortrag zitieren –:
„In den nächsten fünf Jahren stehen tausende (Familien-)Unternehmen [...] vor einer potenziellen Übergabe. [...] Vor diesem Hintergrund sollen insbesondere auch für den Betriebsübernehmer Erleichterungen geschaffen werden.“
Mittlerweile sind seit diesem Ministerratsvortrag mehr als zweieinhalb Jahre vergangen, und erst heute behandeln wir diese Vorlage im Plenum – sehr zum Leidwesen der Tausenden Familienunternehmen, die aufgrund der Entscheidungsschwäche dieser schwarz-grünen Bundesregierung nicht mehr von diesem Bundesgesetz profitieren können.
Tausende Familienunternehmen zahlen drauf, nur weil Schwarz-Grün für eine Einigung mehr als zweieinhalb Jahre braucht. Und obwohl man mehr als zweieinhalb Jahre für dieses Bundesgesetz gebraucht hat, ist dieses Bundesgesetz
kein großer Wurf, sondern der kleinste gemeinsame Nenner. (Beifall bei der FPÖ.)
Die Änderungen in der Gewerbeordnung sind positiv zu sehen, allerdings hätte man viel mehr machen können. Dazu hat aber der Mut gefehlt.
Nun zur Bundesabgabenordnung: Die Änderungen in der Bundesabgabenordnung sehen die Möglichkeit der Begleitung einer Unternehmensübertragung durch das Finanzamt Österreich einschließlich einer Außenprüfung vor. Bei den Änderungen in der Bundesabgabenordnung hätte ich mir aber viel mehr erwartet, insbesondere hinsichtlich des Anwendungsbereichs.
Wir wissen, dass 45 Prozent der Unternehmensübergaben nicht im Familienverband, sondern extern stattfinden. Diese externen Unternehmensübergaben sind aber von vornherein vom Anwendungsbereich der BAO ausgeschlossen.
Nächster Kritikpunkt: Bei den begünstigten Unternehmensübergaben im Familienverband, also bei den verbleibenden 55 Prozent, sind bedauerlicherweise nicht alle Rechtsformen umfasst. Nur Einzelunternehmen und Personengesellschaften sind von der Begünstigung umfasst, aber nicht Kapitalgesellschaften wie zum Beispiel die GmbH. Es darf aber keinen Unterschied machen, ob ein Einzelunternehmen im Familienverband übergeben wird oder eine GmbH, bei der eben ein Gesellschafter 100 Prozent der Anteile hält. (Beifall bei der FPÖ.)
Beides ist absolut gleichwertig, beides muss begünstigt sein. Es gibt überhaupt keinen sachlichen Grund, dass man die GmbH benachteiligt.
Eigenartigerweise waren Kapitalgesellschaften im Ministerialentwurf aus 2021 sehr wohl noch enthalten, jetzt sind sie es bedauerlicherweise nicht mehr. Da verwundert es auch nicht, dass von den Tausenden bevorstehenden Unternehmensübergaben lediglich rund 500 pro Jahr von der in der Bundesabgabenordnung vorgesehenen Begleitung durch das Finanzamt Österreich Gebrauch machen werden.
Die Begleitung einer Unternehmensübertragung beinhaltet ja auch eine freiwillige Betriebsprüfung. Diese soll nach dem Gesetzentwurf tunlichst innerhalb von drei Monaten beginnen und tunlichst innerhalb von sechs Monaten abgeschlossen werden. Warum verwendet man hier aber diesen unverbindlichen Begriff, nämlich „tunlichst“?
Ich darf die Frage gleich selbst beantworten, und Frau Kollegin Yildirim hat auch schon in diese Richtung argumentiert: Na, weil die Finanzverwaltung gar keine Kapazitäten für die Vollziehung dieses Bundesgesetzes hat.
Das ist auch der Grund, warum im Rahmen der Prüfung keine Lohnsteuerprüfung vorgesehen ist, was aber sehr wichtig wäre, und das ist auch der Grund, warum der Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes so sehr eingeschränkt ist.
Im Übrigen stelle ich mir überhaupt die Frage, wer sich bei Unternehmensübergaben im Familienverband, wo ja die Steuerproblematiken innerhalb der Familie sowohl beim Übergeber als auch beim Übernehmer bekannt sind, freiwillig einer Betriebsprüfung unterzieht. Fast jede Betriebsprüfung kostet Geld, Betriebsprüfungen mit einem Nullergebnis sind eher die Ausnahme. Bei externen Übergaben würde ein Recht auf Betriebsprüfung wirklich Sinn machen, aber nicht so sehr bei Übergaben innerhalb des Familienverbandes.
Noch ein letzter Kritikpunkt: Es gibt überhaupt keinen sachlichen Grund, für die Bezeichnung dieses Bundesgesetzes einen englischen Ausdruck zu wählen. Es gibt genügend deutsche Ausdrucksweisen, die man da verwenden könnte.
Wir werden diesem Bundesgesetz aber dennoch unsere Zustimmung erteilen, da es ein erster Schritt in die richtige Richtung ist, dem aber noch viele, viele Schritte folgen müssen. – Vielen Dank. (Beifall bei der FPÖ.)
19.11
Präsident Ing. Norbert Hofer: Nächste Rednerin ist Dr.in Elisabeth Götze. – Bitte, Frau Abgeordnete.
19.11
Abgeordnete Dr. Elisabeth Götze (Grüne): Herr Vorsitzender! Sehr geehrter Herr Minister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuseherinnen und Zuseher, auf der Galerie sehe ich noch einige, und zu Hause! Ende letzten Jahres haben wir ein großes Paket gemeinsam beschlossen, das Start-up-Paket, in dem es um Neugründungen, um Unternehmensgründungen gegangen ist.
Ich freue mich sehr, an dieser Stelle sagen zu können, dass es bereits 200 Unternehmen, die als flexible Kapitalgesellschaft gegründet wurden, gibt, es ist also ein Erfolgsmodell. In diesem Zusammenhang ist ja viel Weiteres für Start-ups, für Unternehmensneugründungen passiert. Jetzt bewegen wir uns an das Ende des Lebenszyklus eines Unternehmens: Was passiert, wenn ein Unternehmer, eine Unternehmerin übergeben möchte?
Wir wissen, es gibt da gewisse Hürden (Zwischenruf des Abg. Matznetter), gewisse Schwierigkeiten, daher wollen wir heute mit einem Gesetzespaket diese Betriebsübergaben erleichtern. Warum? – Weil es wirklich ein großes Thema ist, das mit dem demografischen Wandel auch immer dringlicher wird. Wir wissen, dass in den nächsten Jahren noch viel mehr Unternehmensübergaben anstehen, als es in den vergangenen Jahren waren. Wir reden von etwa 25 000 Unternehmen in den kommenden fünf Jahren in ganz unterschiedlichen Bereichen – vom Handel über Produktion, Tourismus, Gastro bis zu Gesundheitsdienstleistungen. Viele sind Familienbetriebe – das wurde schon angesprochen –, wobei die Übergabe innerhalb der Familien leicht zurückgeht. Es sind aktuell aber noch immer rund 55 Prozent dieser Betriebe, die innerhalb der Familie übergeben werden, und 45 Prozent an Externe außerhalb der Familie.
Also noch einmal die Frage: Wie können wir das erleichtern? – Mit diesem Gesetzespaket. Ich begrüße, dass es auch Vorschläge gibt, wie man das noch erweitern kann, aber ich glaube, es ist ein wichtiger erster Schritt, zu sagen: Betriebsanlagengenehmigungen werden dahin gehend erleichtert, dass nicht jede einzelne Maschine angeführt werden muss, sondern ein Rahmen
vorgegeben ist, innerhalb dessen sich das Unternehmen bewegt. (Beifall bei Abgeordneten der Grünen.)
Daher sind, das halte ich für wichtig, auch Modernisierungen innerhalb dieses Rahmens möglich. Das ist ja etwas, was der neue Unternehmer, die neue Unternehmerin oft sehr rasch machen möchte. Es ist also ein wichtiger Punkt. Das gilt übrigens für alle Unternehmer:innen, nicht nur für Übergaben innerhalb der Familie.
Der zweite Punkt, den ich herausgreifen möchte, ist das Steuerthema. Gerade im Bereich der Steuern ist es für viele, die ein Unternehmen übernehmen, oft mit Unsicherheiten verbunden: Gibt es da noch Altlasten? Wie schaut es da genau aus? Da gibt es den Vorschlag, dass man diese Übergabe steuerlich begleitet, also in Form von Beratung. Auch das halte ich für einen sinnvollen Schritt, um Unvorhergesehenes, Überraschungen zu vermeiden. Insofern ist es, glaube ich, eine gute Sache.
Wenn sich jetzt einige denken: Interessant, ich könnte ein Unternehmen übernehmen, wie komme ich denn zu interessanten Angeboten? – Da kann ich die Unternehmensbörse der Wirtschaftskammer empfehlen. Ich habe es heute überprüft, da sind zum Beispiel momentan mehr als 800 Unternehmen sozusagen am Markt, also zur Übergabe angeboten, und es gibt auch eine Reihe von Interessierten, die sozusagen Interesse haben, ein Unternehmen zu übernehmen.
Es ist also ein wichtiger Schritt zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes. Wir brauchen die Unternehmen und wir brauchen die Arbeitsplätze. Eine Motivation für die Übergabe oder Übernahme ist ja, Arbeitsplätze zu erhalten, und auch: Das Lebenswerk soll weiter bestehen. – Ich bitte um breite Zustimmung. – Danke. (Beifall bei den Grünen sowie des Abg. Obernosterer.)
19.15
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt nun Mag. Gerald Loacker. – Bitte schön, Herr Abgeordneter.
19.15
Abgeordneter Mag. Gerald Loacker (NEOS): Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Hohes Haus! Weitestgehend kann ich mich dem anschließen, was Kollege Hubert Fuchs gesagt hat: Es sind sehr viele gute kleine Dinge in dieser Gesetzesvorlage, viele kleine, die größer sein könnten. Selbst dieses Kleine ist aber zweieinhalb Jahre da gelegen, bis wir es hierher ins Parlament bekommen haben – klein und langsam.
Und: Es soll Betriebsübergaben leichter machen. – Schön, es wird leichter, für die Betroffenen einfacher. Was mich da fasziniert, wenn man es sich anschaut: Ursprünglich war im Entwurf von Ministerin Schramböck vorgesehen, dass es dafür in der Finanz 92 Vollzeitbeschäftigte zusätzlich braucht. Also: Es wird einfacher und wir brauchen 92 Leute mehr. Jetzt, im neuen Entwurf, brauchen wir nur noch 58 Leute mehr, da müssen die 58 ein bisschen mehr rudern, als die 92 gerudert hätten.
Ich habe aber immer noch nicht verstanden, warum wir mehr Mitarbeiter bei der Finanz brauchen, wenn es einfacher wird. (Beifall bei den NEOS.)
19.16
Präsident Ing. Norbert Hofer: Herr Abgeordneter, ich glaube, Sie wollten einen Antrag einbringen. (Abg. Loacker: Den habe ich nicht mit! – Allgemeine Heiterkeit.) – Gut.
Dann bitte ich Kollegen Gabriel Obernosterer ans Rednerpult. – Bitte, Herr Abgeordneter. (Ruf: ... soll der Obernosterer einbringen! – Ruf bei der ÖVP: So weit geht die Freundschaft ja doch nicht! – Heiterkeit bei der ÖVP.)
Abgeordneter Gabriel Obernosterer (ÖVP): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr verehrten Damen und Herren auf der Galerie und zu Hause vor den Bildschirmen! Ich glaube, meine Vorredner haben zu diesem Gesetz schon sehr viel gesagt, aber noch einmal
zusammenfassend: Wir wissen, dass Österreich wirklich das Land der kleinen und mittleren Unternehmen ist – 150 000 Betriebe in Österreich sind Familienbetriebe –, und wir wissen, dass in den nächsten Jahren jeder zehnte dieser Betriebe zur Übergabe innerhalb der Familie steht.
Worum geht es noch einmal? – Es geht einfach darum, die Rahmenbedingungen für die Klein- und Mittelbetriebe zu verbessern und Bürokratie und Hürden abzubauen. Da möchte ich mich jetzt wirklich auch bei den Oppositionsparteien – bei den NEOS und bei den Freiheitlichen – bedanken, dass sie da mitstimmen. Das Gesetz kann also nicht so schlecht sein, sonst würdet ihr nicht mitstimmen. Natürlich kann man nicht alles von A bis Z loben, das ist mir schon klar, das kann man als Oppositionspartei nicht, aber trotzdem ein Danke, dass ihr da mitstimmt.
Etwas vonseiten der SPÖ ist für mich aber eigentlich unverständlich: Kollege Matznetter ist Vizepräsident der Wirtschaftskammer (Abg. Hörl: Ist eh schon ein Fehler!), in der Wirtschaftskammer werden einstimmige Beschlüsse gefasst, Bürokratie abzubauen, wir machen hier ein Gesetz, mit dem Bürokratie abgebaut wird, und dann geht Herr Matznetter her und sagt: Da können wir nicht mitstimmen, denn das lassen wir uns nicht gefallen (Abg. Hörl: Weil er den Babler gefragt hat!), dass jetzt die Bürokratie auch noch abgebaut wird! – Also ihr steht ja wirklich nur für Steuererhöhung und Bürokratieaufbau. Also wirklich, Herr Matznetter, wie werden Sie das in der Kammer das nächste Mal erklären? (Beifall bei der ÖVP.)
Diese Hilfestellungen und Begleitungen bei einer Übergabe sind klar. (Abg. Michael Hammer: Kucher, müsst euch auf die Füße stellen!) Worum geht es da, wogegen ist die SPÖ eigentlich? (Abg. Michael Hammer: Nicht Babler-Kommunismus!) Ich habe zu Hause einen Vater-Mutter-Sohn-Betrieb übernommen, er ist inzwischen größer geworden, die Kinder führen ihn, und ich kenne den Betrieb. Ob es ein großes Hotel oder ein kleines Gasthaus ist, die Bürokratie ist im Grunde genommen überall die gleiche. Jedes Mal, wenn wir über die kleinen Gasthäuser reden, sagen wir: Lasst die Leute bitte arbeiten und weniger Bürokratie machen, denn ein Wirt oder eine Wirtin kann das nebenbei nicht tun!
Wisst ihr, was ein kleiner Wirt genauso wie ein großer braucht? – HACCP, einen Hygienebeauftragten, einen Liftbeauftragten – sobald ein dritter Stock da ist, muss natürlich der Lift auch da sein –, einen Feuerschutzbeauftragten, einen Erste-Hilfe-Beauftragten, einen Umweltbeauftragten, damit man weiß, wie man die Abfälle und das alles beseitigt, und auch einen Sicherheitsbeauftragten.
Wenn jetzt ein Junger den Betrieb übernimmt, sagt man: Schauen wir, dass die nächsten zwei Jahre nicht alle diese Prüfer kommen und den Jungen sekkieren und prüfen, sondern schauen wir, dass in den nächsten zwei Jahren halbwegs Ordnung ist; wenn etwas fehlt, schauen wir, dass sie im Grunde genommen eine Hilfestellung haben – ob das von der Abgabenbehörde ist oder ob das von der Kontrollbehörde ist.
Leute, das ist einmal ein gewisser Abbau, und dass ihr von der SPÖ da dagegen seid: Leute, auch wenn ich in diesem Haus viel verstehe – oft stehe ich auch wirklich neben den Schuhen –, das verstehe ich einfach nicht mehr. (Beifall des Abg. Hörl.)
Super – danke, dass das Gesetz gemacht wird, Herr Bundesminister! Ich bedanke mich auch bei den Oppositionsparteien – bei den NEOS und bei den Freiheitlichen –, dass ihr da mitstimmt.
Eines sage ich auch immer dazu: Wenn das evaluiert wird, dann dürfen wir nicht schlechter werden, dann müssen wir besser werden. Wenn wir die kleinen Familienbetriebe in diesem Land, die das Rückgrat sind, erhalten wollen, dann haben wir mit Bürokratie- und Auflagenabbau sehr viel zu tun, denn sonst werden wir die Betriebe nicht halten können. – Danke schön. (Beifall bei der ÖVP sowie der Abg. Fischer.)
19.21
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Maximilian Linder. – Bitte schön, Herr Abgeordneter.
19.21
Abgeordneter Maximilian Linder (FPÖ): Herr Präsident! Herr Minister! Geschätzte Kolleginnen, geschätzte Kollegen! Gabi Obernosterer, zum Thema Bürokratieabbau: Wir haben gestern beim Senat der Wirtschaft eine interessante Diskussionsrunde gehabt. Dort habe ich das auch gesagt: Wir haben einfach Bürokratie, die für Kleinbetriebe fast nicht mehr zu schaffen ist. Ich habe aber eines dazugesagt, da das auch deine Kollegen bestätigt haben: Ihr sitzt fünf Jahre in der Regierung und ihr habt mehr an Bürokratie gemacht und nicht weniger. (Beifall bei der FPÖ. – Abg. Schellhorn: 37 Jahre sitzen sie drin!) Das, was heute hier passiert, ist ein kleiner Teil, aber nicht wirklich das, was man sich erwartet.
Zum Grace-Period – Gesetz: Ja, wir haben – Kollege Fuchs hat es schon gesagt – einen englischen Ausdruck. Eine der Stellungnahmen hat darauf hingewiesen: Man hat gesagt, man hätte auch einen deutschen Ausdruck dafür finden können – aber na ja, soll so sein.
Die Zahlen für die Betriebsübergaben: Wir haben rund 157 000 Familienbetriebe, 10 Prozent stehen in den nächsten zwei bis drei Jahren zur Übergabe an. Das ist heute schon mehrfach erwähnt worden – auch die Erleichterungen: die Möglichkeit der Steuerprüfung, zusätzliche Beratung vom Finanzamt im Zuge dieser Steuerprüfung, damit die Sicherheit für die Übernehmer gegeben ist, der Entfall der Vorlage des Firmenbuchauszuges. Diese Dinge passen, aber 3 Millionen Euro Mehrkosten für Personal beim Finanzamt Österreich: Meine Damen und Herren, wir reden jeden Tag vom teuren Staat, wir reden jeden Tag davon, dass wir die Verwaltung ausdehnen. Das ist nichts anderes! (Abg. Stark: Die Lohnkosten steigen! – Abg. Hörl: Ihr seids ja dafür, Max! – Abg. Michael Hammer: Das ist er nicht gewöhnt, dass sie einmal dafür sind!)
Das Zweite: „tunlichst innerhalb von drei Monaten“ Beginn und „tunlichst innerhalb von sechs Monaten“ Abschluss der Prüfung. Das „tunlichst“ ist genau das: Dann bist du in einer Prüfung drinnen, die Übergaben werden verzögert, die
Übergabe hinausgeschoben. Warum hat man da nicht klare Fristen gesetzt? Wenn in sechs Monaten die Prüfung nicht abgeschlossen ist, ist der Betrieb reingewaschen. Das wäre eine Lösung gewesen, damit auch das Amt unter Druck kommt und nicht sagen kann: Ja, tunlichst! , und dann kann man die Übergabe ganz normal um ein halbes Jahr oder Jahr verlängern und hinauszögern.
Genügend Personal spielt wahrscheinlich genau da mit hinein. Ich habe jetzt zweimal die Möglichkeit gehabt, mit Steuerberatern zu reden, die beide sagen, die Betriebsprüfung funktioniert im Moment nicht – auch wenn das vielleicht für einen zu Prüfenden eine gute Lösung ist. Er hat mir von zwei Fällen erzählt, in denen die Prüfer überhaupt nicht in der Lage sind, eine Belegprüfung durchzuführen, weil sie einfach hinten und vorne mit der Arbeit nicht nachkommen. Deshalb bin ich überzeugt davon, dass das Personal nicht vorhanden sein wird, um diese Prüfungen durchzuführen.
Ich persönlich bin da bei Kollegen Fuchs: Freiwillig würde ich mich keiner Prüfung unterziehen – nicht, weil ich etwas zu verstecken habe, sondern weil ich als Unternehmer schon mehrfach Prüfungen miterlebt habe. (Abg. Michael Hammer: Dann schauen wir uns mal dem Kickl seine Firmen an! – Abg. Lindinger: ... Gagenkaiser! – Abg. Michael Hammer: Seine Treuhandverträge, die gehören einmal angeschaut!)
Wie läuft so eine Prüfung ab? – Der kommt ganz normal und sagt: Na ja, wir reden einmal über den Eigenanteil, über den Eigenverbrauch. Können wir den ein bisschen höher ansetzen? – Das ist eine Verhandlungsbasis, und da gehst du nie mehr mit null heraus. Du hast eine Zahlung, das wissen wir. (Abg. Obernosterer: ... hast zu wenig ...! – Abg. Michael Hammer: Nach Moskau, oder wo?) Das ist gar nicht böswillig, dass du irgendetwas unterschlagen willst oder etwas gedreht hast, sondern weil es bei einer Prüfung einfach ganz normal so läuft.
Deshalb halte ich es damit: Ich vertraue meinem Steuerberater, dass ich meine Buchhaltung korrekt gemacht habe, und deswegen bin ich in der Lage, den
Betrieb zu übergeben, ohne das Finanzamt einzuschalten. – Danke. (Beifall bei der FPÖ. – Abg. Obernosterer: Muss er ja nicht!)
19.24
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Peter Wurm. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Peter Wurm (FPÖ): Herr Präsident! (Abg. Hörl: Vergiss nicht, dass ihr dafür seid!) Herr Minister! Hohes Haus! Werte Zuseher! Wir erleben seit Jahren eine Digitalisierungsoffensive. Wir hatten ja bis vor Kurzem sogar einen eigenen Digitalisierungsstaatssekretär, den, glaube ich, die meisten eh schon vergessen haben.
Auf der anderen Seite erleben wir aber einen Bürokratiewahnsinn, der eigentlich jedes Jahr zunimmt. Eine Erleichterung wie angekündigt für die Betriebe, aber auch für die Bürger findet in Wahrheit nicht statt, sondern ganz im Gegenteil, man kommt als Bürger und Unternehmer eigentlich in immer mehr Aufgabenstellungen hinein.
Da wir jetzt Minister Kocher hier haben, der sich ja bei der Nationalbank als Gouverneur beworben hat, sollte man vielleicht in diesem Zusammenhang das Thema digital-analog noch einmal ausführlich diskutieren. Sie wissen es: Wir als Freiheitliche stehen auf dem Standpunkt, dass wir sowohl als Bürger als auch als Unternehmer durchaus das Recht auf ein analoges Leben haben sollten. Dieses Recht wird im Prinzip von Jahr zu Jahr kleiner und kleiner und kleiner, und am Ende des Tages werden wir dort landen – wie man in China schon sieht –, dass man eigentlich nur mehr ein QR-Code, eine Nummer ist und der jeweilige Staatschef dann dementsprechend die Bürger durch Knopfdruck ein- und abschalten kann.
Weil wir Minister Kocher hier haben, der eben wie gesagt Gouverneur der Nationalbank werden will, sollte man vielleicht auch über den digitalen Euro sprechen, der im Allgemeingebrauch noch nicht bei jedem angekommen ist – bei den
Bürgern nicht, aber vielleicht auch im Nationalrat nicht bei allen Kollegen. (Ruf bei der ÖVP: Weil es den nicht gibt!)
Vielleicht zur Erinnerung: Ende 2027 – und das ist relativ bald, Kolleginnen und Kollegen, in drei Jahren – werden wir den digitalen Euro haben, in den sowohl die Betriebe als selbstverständlich auch alle Bürger hineingezwungen werden. Wir warnen jetzt schon seit Jahren vor der Entwicklung, dass wir uns hier in Österreich immer weiter davon entfernen, freie Bürger zu sein. Wir werden immer mehr zu gläsernen Konsumenten. Damit gehen die Freiheit und auch das liberale, demokratische Leben zugrunde. Offensichtlich sind es nur wir Freiheitliche, die das wie gesagt seit Jahren entsprechend thematisieren. (Abg. Michael Hammer: Vorsicht, der Lampenschirm fällt herunter!)
Es poppt dann immer wieder vonseiten der ÖVP auf. Ich meine, auch Bundeskanzler Nehammer, wer sich erinnert, hat letztes Jahr im Herbst gesagt, dass es eine Bargeld-Taskforce gibt. – Die ist bis heute niemals zusammengetreten, man hört auch nichts mehr darüber. (Abg. Michael Hammer: Das Bargeld in der Sporttasche im Auto, da seids Experten! Bis nach Wien werden die Bargelder geführt! – Abg. Lindinger: Der Gagenkaiser!)
Dann ist interessant: Auch die Sozialdemokratie mit Babler hat plötzlich dieses Thema entdeckt, dass da eben sehr, sehr viele durch den Rost fallen. Ältere Menschen fallen da aus dem Leben heraus, aber auch sonstige soziale Schichten, die vielleicht mit der digitalen Welt nicht mitkönnen.
Wir haben jetzt schon unzählige Anträge zu diesem Thema eingebracht, ähnlich wie heute am Vormittag. Es gibt halt die vier Systemparteien – ÖVP, SPÖ, Grüne, NEOS, das ist halt so –, die sich bei diesem Thema einhängen, und dann gibt es die Freiheitlichen, die als Einzige noch für die Bürger, für Freiheit und Demokratie stehen. (Abg. Hörl: Ah geh!) Wir werden diesen Kampf auch nicht aufgeben. (Abg. Loacker: ... Geschirr noch mit der Hand ab!) Wir werden weiterkämpfen, um eben – ich sage das ganz deutlich – den Bürgern in Österreich auch ein analoges Leben auf allen Ebenen zu ermöglichen – ein analoges Leben. Dazu
gehört selbstverständlich das Recht auf Bargeldverwendung, Herr zukünftiger Gouverneur der Nationalbank. (Abg. Michael Hammer: Ihr habts eh ein analoges Leben, null und eins, mehr habts nicht! – Abg. Litschauer: ... habts in Niederösterreich die Heizkesselförderung abgeschafft!)
Dazu gehört aber auch, Kolleginnen und Kollegen, dass ich den Handwerkerbonus analog erledigen darf. Dazu gehört auch, dass ich auch als Pensionist vielleicht noch einen Ansprechpartner in der Bank habe und mich nicht selber zum Terminal stellen und die Arbeit der Bank erledigen muss.
Da gibt es also ganz, ganz viele Dinge, die sich im täglichen Leben (Abg. Schallmeiner: ... Fünfziger!) – wer nachdenkt, wird draufkommen – in eine Richtung entwickeln: Ich sage bewusst: Richtung China. (Abg. Michael Hammer: Das sind eh eure Freunde, von der AfD und von euch, die Chinesen!) In letzter Konsequenz geht es darum – das hört keiner gerne, ich setze mir gerne den Aluhut auf –, die Bürger digital zu überwachen (Abg. Michael Hammer: Zu dem habts eh eure Spione!), zu kontrollieren und dementsprechend auch in ihr persönliches Leben einzugreifen.
Deshalb bringe ich abschließend einen sehr, sehr wichtigen Entschließungsantrag ein (Abg. Michael Hammer: Hat den der Ott geschrieben, der Egisto?), wieder einmal die Nagelprobe für die vier Parteien – für diese Einheitspartei –, die Systemparteien, ob sie erkannt haben, dass es für die Bürger in Österreich in eine negative Richtung geht. Das ist ein Antrag, mit dem wir in eine positive Richtung gehen könnten, also bin ich gespannt, wer da mitgehen kann.
Ich darf den Entschließungsantrag vorlesen:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Recht auf analoge Inanspruchnahme und Teilhabe an den Dienstleistungen der Verwaltung und der Daseinsvorsorge“
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung, insbesondere der Bundeskanzler und der Bundesminister für Finanzen, wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, die folgende Inhalte umfasst:
- Recht auf analoge Inanspruchnahme und Teilhabe für die Bürger an allen Dienstleistungen der Verwaltung, Justiz und der Daseinsvorsorge ohne technische und kommunikative Barrieren
- Analoge und digitale Manuduktionspflicht bei der Inanspruchnahme und Teilhabe an allen Dienstleistungen der Verwaltung, Justiz und der Daseinsvorsorge ohne technische und kommunikative Barrieren mit Gültigkeit für Gebietskörperschaften bzw. ausgegliederte Organisationseinheiten und einschlägige Unternehmen
- Analoges und digitales Interventionsrecht für Eingaben, Anträge sowie Rechtsmittel für die Bürger
- Bankgebührenbefreiung für den gesamten Zahlungsverkehr mit Verwaltung und Justiz für die Bürger“
*****
Wir fordern seit vielen, vielen Jahren – und es wird von Jahr zu Jahr dringender – ein Recht für uns Österreicherinnen und Österreicher auf ein analoges Leben – wer es will. Wer sich digital selbst in diese Geschichte hineinmanövrieren will, kann das gerne machen. Ich als Bürger sage Ihnen, ich möchte ein Recht auf ein analoges Leben haben, ohne auf eine Nummer oder einen QR-Code reduziert zu werden. – Danke. (Beifall bei der FPÖ. – Rufe und Gegenrufe zwischen Abgeordneten von ÖVP und FPÖ.)
19.32
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Peter Wurm, Dr. Dagmar Belakowitsch
und weiterer Abgeordneter
betreffend Recht auf analoge Inanspruchnahme und Teilhabe an den Dienstleistungen der Verwaltung und der Daseinsvorsorge
eingebracht im Zuge der Debatte zu Top 9.) Bericht des Finanzausschusses über die Regierungsvorlage (2510 d.B.): Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeordnung 1994, das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz und die Bundesabgabenordnung geändert werden (Grace-Period – Gesetz) (2543 d.B.) in der 262. Sitzung des Nationalrats am 15. Mai 2024.
Immer wieder kommt es zu Verwaltungsvereinfachungen bzw. zur Adaptierung bestehender Bundesnormen. Dies sollte aber keine Einbahnstraße in Richtung Digitalisierung sein, die auf Rechtsstaatlichkeit, Bürgernähe und Unmittelbarkeit des Verwaltungshandelns keine Rücksicht mehr nimmt.
Aktuell wird die Digitalisierung in der österreichischen Verwaltung und im Zugang zu öffentlichen Leistungen und Förderungen als die allein selig machende Innovation und als das einzig adäquate Mittel eines effizienten Staatswesens der Gegenwart und Zukunft dargestellt.
Die Schlagwortkombinationen sind:
• Digitalisierung der Gesellschaft
• Digitalisierung der Verwaltung
• Digitalisierung der Wirtschaft
Damit scheint für den Verwaltungsstaat alles gesagt und erledigt. Dass hier Unmittelbarkeit und Bürgernahe und damit auch der Zugang zum Rechtsstaat für die Bürger als Normadressaten vielfach auf der Strecke bleiben, blenden die
Propagandisten von „E-Governement“ auf ihrer technologiegetriebenen gesellschaftspolitischen Einbahnstraße aus.
Der Zugang zum Rechtstaat und die Möglichkeit, Sozialleistungen und Wirtschaftsförderungen oder Genehmigungen der Verwaltung auch analog und persönlich in Anspruch zu nehmen, werden immer weiter zurückgedrängt. Die Rechts- und Hilfesuchenden werden auf anonyme Internetangebote und nur mehr telefonisch oder per E-Mail erreichbare Service-Auskunftsstellen verwiesen.
Darunter leidet die Qualität der Beziehung der Bürger zu ihrem Staat und dessen Dienstleistungen. Ähnliches gilt für die Angebote der Daseinsvorsorge und weiterer gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Grundbedürfnisse.
Die Konsequenz ist eine fortgesetzte Entfremdung der Bürger und eine Ausgrenzung all jener, die durch ihr Alter oder ihren gesundheitlichen Zustand sich mit den digitalen Zugängen bei der Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse immer schwerer tun.
Was es jetzt braucht, ist die Formulierung und die Durchsetzung des Rechts auf die Inanspruchnahme und Teilhabe an den Dienstleistungen der Verwaltung und an der Daseinsvorsorge. Dazu bedarf es einer Garantie des Staates, dass der einzelne auch unabhängig von Besitz und Gebrauch elektronischer Gerätschaften sein Recht auf den Zugang zu allen Verwaltungsdienstleistungen wie Sozialleistungen und Wirtschaftsförderungen sowie Genehmigungen der Verwaltung hat, der unmittelbare Zugang zur Justiz und damit dem Rechtsstaat garantiert wird und die Angebote der Daseinsvorsorge ebenfalls für alle direkt verfügbar sind.
Daseinsvorsorge als dritte Säule neben Verwaltung und Justiz
Um zu erläutern, wie wichtig auch der Zugang zur Daseinsvorsorge für die Bürger ist, sollen hier einige Punkte erläutert werden. Die Daseinsvorsorge umfasst die Bereitstellung und die Sicherung des allgemeinen und diskriminierungsfreien Zugangs zu existentiellen Gütern und Leistungen für alle Bürger auf der Grundlage definierter qualitativer und quantitativer Standards. Welche Güter und Leistungen als existentiell notwendig anzusehen sind, ist durch demokratische Entscheidungen in
einem modernen Sozial-, Verwaltungs- und Wirtschaftsstaat festzulegen und weiterzuentwickeln.
In einen allgemeinen Kanon dieser existentiellen Leistungen gehören für uns aktuell:
• Abwasserentsorgung/Wasserversorgung,
• Bildung,
• Brand- und Katastrophenschutz incl. Rettungswesen,
• Elektrizitätsversorgung,
• Friedhöfe/Krematorien,
• Gasversorgung,
• Geld- und Kreditversorgung,
• Gewerbliche und hoheitliche Entsorgung/Kreislaufwirtschaft,
• Gesundheit (Krankenhäuser, ambulante Versorgung, Vor- und Nachsorge, Pflege, permanente Verfügbarkeit von lebenswichtigen Produkten wie Arzneimittel und Medizinprodukte für den Seuchen- und Katastrophenschutz, intensivmedizinische Ausrüstungen usw. auch unter extremen Umständen wie denen einer Pandemie),
• Kultur,
• Öffentliche Sicherheit
• Justiz,
• Post,
• Straßenreinigung,
• Telekommunikation/Internet,
• Verkehrs- und Beförderungswesen (Schienen, Straßen, Wasserstraßen, Luftverkehr),
• Wohnungswirtschaft.
Diese Aufzählung ist nicht abschließend und kann nach Maßgabe der jeweiligen sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen und des Lagebilds ergänzt werden.
Manuduktionspflicht als zentrale Grundlage
Um das Recht auf analoge Inanspruchnahme und Teilhabe an den Dienstleistungen der Verwaltung und der Daseinsvorsorge zu garantieren, müssen für die Umsetzung gegenüber den Bürgern zentrale Grundlagen geschaffen werden. Eine dieser Grundlagen ist die Manuduktionspflicht.
Als Manuduktionspflicht definiert man die gesetzlich angeordnete Informations-, Anleitungs-, Belehrungs- und Aufklärungspflicht eines Betroffenen über seine Rechte. Diese Manuduktionspflicht kann sowohl öffentlich-rechtliche als auch privatrechtliche Einrichtungen und dort tätige Organwalter treffen. Sie hängt unmittelbar mit dem Recht des Betroffenen auf Information und Transparenz zusammen.
Mit der rechtlichen Verpflichtung von staatlichen Behörden und Unternehmen der Daseinsvorsorge zur Manuduktion soll jedem von einer Maßnahme betroffenen und in der Hierarchie der Über- und Unterordnung als schützenswert qualifizierten Rechtssubjekt die Möglichkeit eingeräumt werden, seine Rechte und Pflichten zu wahren. Auf dieser Grundlage soll die eigenen Rechtsposition eingeschätzt werden, um dann auch entsprechend zu reagieren.
Im Gegensatz zur Informationspflicht ist die Manuduktionspflicht weitaus umfangreicher und bedeutet für öffentlich-rechtliche als auch privatrechtliche Einrichtungen und dort tätige Organwalter eine entsprechend qualifizierte Reaktion auf die vorgebrachten Anliegen.
Diese Manuduktionspflicht muss in einem modernen Sozial-, Verwaltungs- und Wirtschaftsstaat von allen Gebietskörperschaften und Einrichtungen der Daseinsversorgung angeboten werden – und zwar sowohl analog wie digital.
Interventionsrecht als weitere zentrale Grundlage
Mit der Manuduktionspflicht korrespondiert untrennbar das Interventionsrecht für die Bürger. Jeder Bürger muss die Möglichkeit erhalten, sich nicht nur unmittelbar und persönlich analog über seine Rechte und Pflichten bei allen Gebietskörperschaften und Einrichtungen der Daseinsvorsorge zu informieren, sondern auf dieser Grundlage auch unmittelbar und persönlich zu intervenieren, d.h. seine Eingaben, Anträge, Rechtsmittel usw. physisch vorzulegen.
Bankgebührenbefreiung für alle Zahlungen an den Verwaltungsstaat
Der Rechtsverkehr mit den Behörden darf nicht an sozialen und finanziellen Hürden scheitern. Deshalb muss für den Zahlungsverkehr mit Justiz und Verwaltung eine gesetzliche Bankgebührenbefreiung eingeführt und umgesetzt werden. Das bedeutet eine Bankgebührenbefreiung für den gesamten Zahlungsverkehr mit Verwaltung und Justiz für die Bürger.
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung, insbesondere der Bundeskanzler und der Bundesminister für Finanzen, wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, die folgende Inhalte umfasst:
• Recht auf analoge Inanspruchnahme und Teilhabe für die Bürger an allen Dienstleistungen der Verwaltung, Justiz und der Daseinsvorsorge ohne technische und kommunikative Barrieren
• Analoge und digitale Manuduktionspflicht bei der Inanspruchnahme und Teilhabe an allen Dienstleistungen der Verwaltung, Justiz und der Daseinsvorsorge ohne technische und kommunikative Barrieren mit Gültigkeit für Gebietskörperschaften bzw. ausgegliederte Organisationseinheiten und einschlägige Unternehmen
• Analoges und digitales Interventionsrecht für Eingaben, Anträge sowie Rechtsmittel für die Bürger
• Bankgebührenbefreiung für den gesamten Zahlungsverkehr mit Verwaltung und Justiz für die Bürger“
*****
Präsident Ing. Norbert Hofer: Der Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht und steht somit auch in Verhandlung.
Zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Michael Bernhard, zum Behufe des Einbringens eines Antrages, nehme ich an. – Bitte.
Abgeordneter Michael Bernhard (NEOS): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss. Deswegen darf ich die Rede meines Kollegen Loacker fortführen. Wir möchten gerne einen positiven Beitrag zur Entlastung der Unternehmerinnen und Unternehmer liefern.
Bekanntlich hat ja Wirtschaftskammerpräsident Mahrer angekündigt, er würde gerne die Kammerumlage 2 ein Stück weit reduzieren – 35 Millionen Euro waren damals das, was kommuniziert worden ist. Die Kammerumlage 2 ist ja 1979 ursprünglich nur temporär eingeführt worden, mit dem Ausblick, dass das bald wieder ein Ende hat.
Wir denken, dass nach 44 Jahren das Ende schon zur rechten Zeit kommen würde. Es geht um insgesamt 433 Millionen Euro, die aus unserer Sicht den
Unternehmerinnen und Unternehmern heute völlig zu Unrecht abgeknöpft werden, weil es eben nicht mehr zeitlich befristet ist.
Daher darf ich jetzt den Antrag einbringen:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Entlastungsversprechen einfach umsetzen: Abschaffung der Kammerumlage 2“
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft, wird aufgefordert, bis 1. September 2024 eine Regierungsvorlage vorzulegen, mit der die Kammerumlage 2 abgeschafft wird, womit die Lohnnebenkosten gesenkt und Unternehmer und Unternehmerinnen nachhaltig entlastet werden.“
*****
(Beifall bei den NEOS.)
Herr Bundesminister Kocher, helfen Sie doch den Unternehmerinnen und Unternehmern, senken Sie die Lohnnebenkosten! Die Kammer hat alleine nicht die Kraft, diese Abschaffung durchzuführen. Es braucht den Herrn Bundesminister und dieses Parlament, damit wir diesen Schritt endlich gehen. – Vielen Dank. (Beifall bei den NEOS.)
19.34
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Michael Bernhard, Kolleginnen und Kollegen
betreffend Entlastungsversprechen einfach umsetzen: Abschaffung der Kammerumlage 2
eingebracht im Zuge der Debatte in der 262. Sitzung des Nationalrats über Grace-Period – Gesetz (2543 d.B.) – TOP 9
Viele Expert:innen verweisen darauf, dass die Abgaben auf Löhne und Gehälter in Österreich zu hoch sind. Aktuell lastet die Finanzierung der Wirtschaftskammer in Form der Kammerumlage 2 zu großen Teilen auf den Schultern der Arbeitnehmer:innen. Es ist weder logisch noch fair, dass die Leistung der Arbeitnehmer:innen die Basis für die Wirtschaftskammerfinanzierung bildet. Die Abschaffung der Kammerumlage 2 bewirkt eine nachhaltige Entlastung der österreichischen Unternehmen in Höhe von mehreren hunderten Millionen jedes Jahr, laut WKO-Voranschlag 433 Mio. EUR allein im Jahr 2024. Dies wäre ein machbarer, erster Schritt, um in Richtung einer Senkung der Lohnnebenkosten um jährlich 0,5 Prozentpunkte zu kommen. Den Ausfall der Einnahmen soll die Wirtschaftskammern, die über Rücklagen in Höhe von 2 Milliarden Euro verfügen, dazu motivieren, durch umfassende Reformen effizientere Strukturen aufzubauen und den verschwenderischen Lebensstil der Kammerfunktionäre endlich zu beenden.
Die Kammerumlage 2 wurde 1979 als vorübergehende Unterstützungsmaßnahme für bedürftige Kleinstunternehmer:innen eingeführt. Mittlerweile sind es selbst die Kleinstunternehmen, die hauptsächlich unter den Auswirkungen der Kammerumlage 2 leiden. Ursprünglich war die Einhebung auf einen begrenzten Zeitraum ausgelegt, jedoch auch 44 Jahre später existiert sie noch immer und die Geldspeicher der Wirtschaftskammer aus der Kammerumlage 2 füllen sich jährlich reichlich. Die Höhe variiert, aufgrund der Tatsache, dass die Kammerumlage 2 sich aus einem Bundeskammer-Anteil von derzeit 0,14 % sowie unterschiedlich festgelegten Anteilen der Landeskammern zusammengesetzt ist. Insgesamt betragen die Sätze für die Kammerumlage 2 von 0,34 % in Oberösterreich bis 0,42 % im Burgenland. Die jährlich steigenden Löhne der Arbeitnehmer:innen:innen führen auch zu jährlich steigenden Einnahmen für die Wirtschaftskammer.
Die Wirtschaftskammern nehmen den heimischen Betrieben damit jedes Jahr hunderte Millionen inflationsangepasst weg. Laut WKO-Rechnungsabschlüssen waren es im Jahr 2022 immerhin 410 Mio. Euro, bei Gesamteinnahmen von 1,28 Mrd. Euro. Konservative Prognosen der Wirtschaftskammern gehen davon aus, dass die Belastung durch die Kammerumlage 2 im Jahr 2024 auf 433 Mio. Euro steigen wird. Die Wirtschaftskammern hätten 2024 somit ohne Einnahmen aus der Kammerumlage 2 rund 880 Mio. Euro an Gesamteinnahmen. Nicht zu vernachlässigen ist die unglaubliche Summe von rund 2 Milliarden Euro an Rücklagen. Dieses Vermögen reicht aus, um die dadurch entstehenden Ausfälle mittelfristig abzufedern.
Wirtschaftskammer-Präsident Mahrer fordert immer wieder eine Entlastung durch die Senkung der Lohnnebenkosten, hat jedoch im Jahr 2022 lediglich eine Mini-Entlastung von 35 Mio. Euro geschafft. Eine Abschaffung der Kammerumlage 2 würde für Unternehmen in Österreich immerhin eine jährliche Entlastung bei den der Lohnnebenkosten von bis zu 0,42 Prozentpunkten bedeuten. Gleichzeitig sollen die Wirtschaftskammern dies als Anlass für eine umfassende Strukturreform nutzen, um endlich effizientere und damit sparsamere Strukturen zu implementieren.
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft, wird aufgefordert, bis 1. September 2024 eine Regierungsvorlage vorzulegen, mit der die Kammerumlage 2 abgeschafft wird, womit die Lohnnebenkosten gesenkt und Unternehmer und Unternehmerinnen nachhaltig entlastet werden.“
Präsident Ing. Norbert Hofer: Der Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht. Er steht somit auch in Verhandlung.
Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
Wünscht der Herr Berichterstatter ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 2510 der Beilagen.
Ich ersuche jene Damen und Herren, die für diesen Gesetzentwurf sind, um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist mehrheitlich angenommen.
Wir kommen gleich zur dritten Lesung.
Ich bitte jene Damen und Herren, die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, um ein diesbezügliches Zeichen. – Das ist die Mehrheit. Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung angenommen.
Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Steuergerechtigkeit für Arbeitnehmer:innen und Pensionist: innen“.
Ich bitte jene Damen und Herren, die für den Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt.
Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Recht auf analoge Inanspruchnahme und Teilhabe an den Dienstleistungen der Verwaltung und der Daseinsvorsorge“. (Rufe und Gegenrufe zwischen den Abgeordneten Wurm und Krainer.)
Ich bitte jene Damen und Herren, die für diesen Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt.
Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Entlastungsversprechen einfach umsetzen: Abschaffung der Kammerumlage 2“.
Ich bitte jene Damen und Herren, die für diesen Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt.
Bericht des Finanzausschusses über den Antrag 4014/A der Abgeordneten Peter Haubner, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Finanzausgleichsgesetz 2024 geändert wird (2544 d.B.)
Präsident Ing. Norbert Hofer: Wir kommen nun zum 10. Punkt der Tagesordnung.
Es wurde auf eine mündliche Berichterstattung verzichtet.
Zu Wort gelangt nun Herr Klubobmann Philipp Kucher. – Bitte, Herr Klubobmann.
Abgeordneter Philip Kucher (SPÖ): Herr Präsident! Geschätzter Herr Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich wollte es etwas ruhiger angehen, aber Gabriel Obernosterer hat sich ja beim letzten Tagesordnungspunkt fast ein bisschen in Rage geredet. Es war ein bisschen eine Mischung aus einem jungen Wolfgang Schüssel und einer Maggie Thatcher aus dem Kärntner Lesachtal. Er hat da Brandreden über die Wirtschaftskompetenz der ÖVP gehalten. Franz Hörl hat fast Tränen in den Augen gehabt, hat das wirklich auch geglaubt. Gerald Loacker hat sogar vergessen, seinen Antrag einzubringen, weil es geheißen hat: Wir werden die Wirtschaft entfesseln!
Wenn wir uns die Performance der ÖVP im Bereich der Bekämpfung der Teuerung der letzten Jahre anschauen (Abg. Michael Hammer: Es geht um den Finanzausgleich!), dann passt natürlich die Entwicklung Österreichs nicht ganz zu den Fakten und zur angeblichen Wirtschaftskompetenz der ÖVP. Um das noch
einmal kurz auch vor dem Hintergrund des Budgets in Österreich zu thematisieren: Wir haben es geschafft, 18 Monate in Folge die höchste Inflationsrate in ganz Westeuropa zu haben – die höchste Inflationsrate in ganz Westeuropa!
Die Regierung feiert sich dafür, dass sie am allermeisten Geld ausgegeben hat, aber wir sind als die Schlechtesten durch diese Krise gekommen, und das ist dramatisch für die breite Masse der Bevölkerung, für die Pensionistin, die vielleicht jetzt heute am Abend noch im Supermarkt gestanden ist, was eingekauft hat, die mehr zahlt als andere, für die Menschen, die hohe Heizkosten tragen müssen oder die explodierenden Mieten in Österreich. Das ist die Gemengelage, die uns die ÖVP in Österreich eingebrockt hat.
Das ist nicht nur dramatisch für die breite Masse der Bevölkerung, es ist natürlich auch eine Katastrophe für das österreichische Budget – mehr als 20 Milliarden Euro Defizit. Das ist eine Katastrophe auch für den Wirtschaftsstandort Österreich, weil wir deutlich schlechter durch diese Krise gekommen sind.
Ich verstehe in dieser Gemengelage – schlechtes Management dieser Krise, Milliardenschulden –, dass der Finanzminister dann nicht unbedingt sparsam unterwegs ist – eh nicht mit seinem eigenen Geld, sondern mit dem Steuergeld der Bürger – und sich irgendwie überlegt hat: Kann man nicht marketingtechnisch in einem nahenden Wahlkampf irgendetwas platzieren, das noch super klingt? Ihm ist dann eingefallen: Da hat es ja damals zwei Spezialisten gegeben, Hartinger-Klein, die gemeinsam mit Herbert Kickl auch so einen Marketinggag produziert hat, nämlich eine Patientenmilliarde. (Zwischenruf bei der FPÖ.)
Dann hat sich der Finanzminister gedacht, was unter Hartinger-Klein funktioniert hat, das müssen wir jetzt noch einmal machen: Wir machen jetzt eine Wohnbaumilliarde in Österreich! – Da hat sich die Regierung doch jetzt monatelang für eine Wohnbaumilliarde gefeiert. (Abg. Hörl: Clever, oder?! – Ruf bei der ÖVP: Ja!) – Clever? Franz Hörl kommt auch ein bisschen aus dem Marketing. Man soll nur die eigenen Schmähs nicht glauben (Abg. Michael
Hammer: Aber die Roten in der Steiermark haben es schon beschlossen! In der Steiermark gibt es sie!), sonst geht es dir so wie Hartinger-Klein, die gesagt hat, das war alles nur ein Schmäh.
Gehen wir zu den Fakten zurück (Abg. Michael Hammer: Ja, Steiermark!): Diese Wohnbaumilliarde – und das ist schon ein Kunststück (Abg. Lindinger: Die Kollegen in der Steiermark fragen! Das ist eigentlich eine gute Idee!), das musst du erst schaffen – ist ein Wohnbaupaket, das es schafft, dass keine einzige Miete in Österreich gesenkt wird – keine einzige Miete! Kein einziger Häuslbauer in Österreich hat da auch nur irgendetwas davon. (Abg. Michael Hammer: Ja gegen die Wiener Mafia kann man nicht an! – Ruf bei der ÖVP: Da kennt ihr das Paket aber schlecht!) Im Gegenteil, ihr habt es handwerklich so schlecht gemacht, dass sich bis heute in Österreich niemand auskennt (Abg. Michael Hammer: In der Sozialdemokratie vielleicht! – Ruf bei der ÖVP: Ich glaube, ich darf das Wohnbaupaket noch mal neu vorstellen!) und die Menschen in Wahrheit jetzt eher gezögert haben, ob sie noch bereit sind, in ein Häusl zu investieren.
Ich möchte das jetzt ganz konkret machen. (Abg. Schroll: Die kennen sich ja selber nicht aus!) Da gibt es zum Beispiel das Versprechen eines Zinssatzes von 1,5 Prozent, wenn du ein Häusl für 200 000 Euro bauen willst. Das Pech ist nur, dass du das Ganze nur drei, vier Jahre kriegst.
Der Finanzminister erzählt das ja hier im Hohen Haus immer wieder, wie wichtig die Finanzbildung ist. Jetzt möchte ich nur ein paar Fragen stellen. Wer ist denn in der Lage, 200 000 Euro für ein Häusl innerhalb von drei bis vier Jahren zurückzuzahlen? Das kann sich nicht einmal Herbert Kickl leisten, der, wie man heute in der Zeitung gelesen hat, über 22 000 Euro im Monat kassiert. (Abg. Zarits: 24! Nicht einmal da kennst du dich aus!) Sogar der wird sich schwertun, in drei, vier Jahren 200 000 Euro auf die Seite zu legen.
Jetzt erklärt mir bitte, ob die Leute, die sich ein Haus auf 30, 40 Jahre finanzieren, sich nicht die Frage stellen: Was ist denn danach, nach diesen drei, vier Jahren mit 1,5 Prozent Zinsen? Was mache ich denn danach? Was wird mich das
alles kosten? Diese Frage ist ja bis heute nicht einmal beantwortet worden. (Abg. Hörl: Wieder ÖVP wählen, weil wir verlängern das dann!) – Das also zur Finanzbildung und zur Wirtschaftskompetenz auch der ÖVP, wie ihr in diesem Zusammenhang umgegangen seid. (Beifall bei der SPÖ. – Ruf bei der ÖVP: Lei, lei!)
Ein Punkt, der mir wirklich nahegeht, weil es 500 000 Haushalte in Österreich betrifft, ist: Eine Million Menschen, die jetzt einen Häuslbauerkredit laufen haben – das sind ganz normale Mittelstandsfamilien, in denen beide aufstehen und fleißig arbeiten gehen –, müssen auf einmal, innerhalb weniger Monate, 500, 600 Euro mehr für den Kredit zahlen, und für die tut ihr gar nichts. Für die tut ihr gar nichts – und auf der anderen Seite erleben wir, dass die österreichischen Banken, nachdem sie jahrelang durchschnittlich 6 Milliarden Euro Gewinn gemacht haben, in diesem Jahr 14 Milliarden Euro Gewinn machen.
Ich möchte noch ein paar konkrete Beispiele heraussuchen – schaut euch nur die Bilanzgewinne aus dem letzten Jahr an! –: Bei gleichem Umsatz werden 380 Prozent Gewinnsteigerung in einem Jahr verzeichnet. Ist das die Regel? Ist das branchenüblich? Liebe ÖVP mit eurer Wirtschaftskompetenz, wie viele Fliesenlegerbetriebe, die 380 Prozent Gewinn in einem Jahr machen, kennt ihr? Wie viele Handwerksbetriebe, die 380 Prozent Gewinn machen, gibt es in Österreich?
Das heißt, auf Kosten der breiten Masse der Bevölkerung, die ihre Häuslbauerkredite nicht mehr zurückzahlen können, und auch der Pensionistinnen und Pensionisten, die für die paar Euro, die sie am Sparbuch haben, keine Zinsen bekommen haben, haben die Banken Milliardengewinne gemacht. Und das Schlimme ist, das kann passieren – aber da darf man nicht zuschauen! (Beifall bei der SPÖ.)
Noch besser wäre, man verhindert das Ganze. Dazu hat es von der SPÖ Vorschläge gegeben, aber es gab keinen einzigen konkreten Vorschlag der ÖVP, was wir machen können.
Das sind ganz normale Familien in Österreich, die heute vor dem Schlafengehen nicht mehr wissen, ob sie sich das Häuschen noch leisten können. (Abg. Michael Hammer: Die schlafen jetzt eh schon bei der Rede!) Und dann reden wir von 14 Milliarden Euro Gewinn, und ihr schaut da genauso zu. Die Leute verlieren unter Umständen ihr Eigenheim – ihr macht gar nichts (Abg. Baumgartner: Das stimmt nicht!) –, während die Gewinne explodieren. Franz Hörl, 380 Prozent Gewinn in einem Jahr, ist das branchenüblich? Wir erklärst du denn das den kleinen Betrieben in Tirol? Und du schaust zu, du tust gar nichts. Die zahlen drauf! Die Pensionistin mit dem Sparbuch zahlt drauf. Es ist die Aufgabe der Politik, in diesem Bereich auch gegenzusteuern! (Beifall bei der SPÖ.)
Um das, was wir als SPÖ fordern, ganz konkret zu machen: Wir brauchen in Österreich eine Mietpreisbremse. Ein Viertel der Leute können sich in unserem Land das Wohnen kaum noch leisten. Mietpreissteigerungen von 25 Prozent innerhalb von zwei Jahren – fühlt euch einmal hinein in die Familien, was das heißt, wenn du die Miete zahlen musst und nicht mehr weißt, wie, und nicht weit hüpfen kannst. Das sind ganz normale Menschen in Österreich, die doch ein Recht haben, sich das Wohnen leisten zu können.
Lassen wir dann bitte auch die Häuslbauer in Österreich nicht im Stich und schauen wir, dass wir zumindest einen Bruchteil der Übergewinne der Banken abschöpfen und den Menschen in Österreich ihr Eigenheim in Zukunft garantieren können. (Ruf bei der ÖVP: Lei, lei!) Das ist eine Frage der Gerechtigkeit, und wir im Parlament haben die Möglichkeit, da gegenzusteuern – statt angesichts von 14 Milliarden Euro auf der einen Seite einfach nur zuzuschauen. Fühlt in euch hinein und erklärt euren Betrieben vor Ort 380 Prozent Gewinn in einem Jahr, während andere Menschen ihr Häuschen verlieren. Es ist unsere Aufgabe, da gegenzusteuern und etwas zu tun – und nicht wie im Bereich der Energiekonzerne zuzuschauen und zu sagen, dass man ordentlich abschöpfen wird, dass man 4 Milliarden Euro abschöpfen wird, und dann werden es nur ein paar Hundert Millionen Euro.
Das wäre unsere gemeinsame Aufgabe. Es hat eh nicht gut funktioniert – wir sind schlechter durch die Krise gekommen als alle anderen Staaten in Westeuropa. (Abg. Michael Hammer: So ein Blödsinn! So ein Blödsinn! – Abg. Zarits: ... Blödsinn!) Werden wir wenigstens jetzt munter und tun wir etwas, um die Menschen in Österreich zu unterstützen! (Beifall bei der SPÖ. – Abg. Michael Hammer: Ich tät einmal nach Deutschland schauen zu deinen Genossen! – Abg. Kucher – auf dem Weg zu seinem Sitzplatz –: Wie hoch ist dort die Inflationsrate? – Abg. Michael Hammer: Ja, der Herr Scholz, der hat alles obigewirtschaftet! – Ruf bei der ÖVP: Wie hoch ist die Inflationsrate? 3,5 Prozent! – Abg. Michael Hammer: Die deutschen Sozis haben alles obidraht, und uns mit! – Ruf: ... Frechheit! – Abg. Michael Hammer: Ja, ist ja so!)
19.43
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt Abgeordneter Andreas Ottenschläger. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Andreas Ottenschläger (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Bundesminister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Werte Zuseherinnen und Zuseher! Ich glaube, wenn eines meiner Kinder ein solches Referat gehalten hätte wie Sie gerade, Herr Klubobmann Kucher, dann würde es ein Nicht genügend wegen Themenverfehlung bekommen, und ich sage Ihnen auch, warum. (Beifall bei der ÖVP.)
Wir diskutieren hier einen Antrag, den Sie übrigens fast überhaupt nicht erwähnt haben. (Abg. Kucher: Das kommt schon noch! – Abg. Michael Hammer: Ach so, redest du noch einmal?) Sie argumentieren, Sie bringen das Thema Inflation – das ist Ihr gutes Recht und es ist auch ein wichtiges Thema, das die Menschen betrifft –, aber Sie sagen halt immer nur die halben Fakten, oder das, was Sie sagen, ist mitunter eigentlich faktenfrei. Sie erwähnen zum Beispiel nicht, dass Österreich, die österreichische Bevölkerung im Schnitt die zweithöchste Kaufkraft in Europa nach Luxemburg hat. (Abg. Kucher: Das ist ja ein Schmäh!) Das
sollte man in diesem Zusammenhang auch einmal erwähnen. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Lindinger: Genau!)
Jetzt möchte ich schon auch einmal auf das eigentliche Thema zu sprechen kommen (Abg. Kucher: Die Häuslbauerkredite!) – denn sonst hätte ich auch eine Themenverfehlung (Abg. Krainer: Wenn die Kaufkraft so hoch wäre, wie Sie behaupten, müssten wir ja nicht ...! – Ruf bei der ÖVP: Du hast deine Chance schon gehabt heute, Krainer, ...!) –: Wir reden über das Thema Wohnbaupaket, und ich möchte schon darauf hinweisen, dass wir viele Gespräche geführt haben, und wie Sie von der SPÖ vielleicht auch wissen, hat es auch sehr konstruktive Gespräche zwischen den Sozialpartnern gegeben, die auch viele Punkte formuliert und an die Regierungsparteien gerichtet haben, und von diesen Punkten sind sehr viele auch in dem Wohnbaupaket umgesetzt worden – das sollte man auch erwähnen. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Michael Hammer: Die Arbeiterkammer gehört ja nicht zu ihnen!)
Und was war die Zielsetzung dahinter? Was ist eigentlich die Zielsetzung, das, worum es bei diesem Paket geht? – Das finde ich sehr bemerkenswert, dass Sie das mit keinem Wort erwähnen. (Abg. Krainer: 33 Tage in Kraft und schon in der Werkstatt zum Reparieren!) Die Zielsetzung von diesem Paket war, die Bauwirtschaft zu unterstützen und, damit einhergehend, viele Arbeitsplätze, Tausende Arbeitsplätze in Österreich. Es ist wirklich bemerkenswert, dass Sie als SPÖ-Vertreter das in diesem Zusammenhang überhaupt nicht erwähnen – und das sei, meine Damen und Herren, an dieser Stelle einmal festgestellt. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Michael Hammer: Die sind eher für die Arbeitslosen, sowieso!)
Jetzt komme ich zum Antrag selber: Es geht darum, dass wir praktikable Lösungen auch für die Länder finden, wobei es unter anderem auch darum geht, dass eben die gestützten Kredite – das heißt, jene mit 1,5 Prozent Verzinsung bis zu maximal 200 000 Euro – in Umsetzung kommen, dass Darlehen erhältlich sind, damit es eben einerseits etwas zur Eigentumsbildung gibt und andererseits auch, damit einhergehend, die Bauwirtschaft angekurbelt wird, weil es, wie ich
es schon erwähnt habe, zumindest uns ein großes Anliegen ist, dass wir die Arbeitsplätze in diesem Bereich in Österreich sichern.
Ich glaube, es gibt etliche gute Vorschläge beziehungsweise schon in Umsetzung befindliche Maßnahmen, die wir hier im Hohen Haus, unter anderem im Übrigen auch mit Ihren Stimmen, beschlossen haben, die auch auf den Sozialpartnergesprächen fußen, im Rahmen derer wir neben dieser Maßnahme der günstigen Kredite auch Geld zur Verfügung stellen, damit mehr geförderter Wohnraum errichtet wird, damit wir Geld in die Sanierungen von bestehenden Objekten investieren – auch ein wichtiger Punkt – und auf diese Weise eben mehrere Fliegen auf einen Schlag haben, nämlich auf der einen Seite die Bauwirtschaft anzukurbeln, auf der anderen Seite die Qualität der bestehenden geförderten Wohnungen zu verbessern, auch ökologisch zu verbessern, und zusätzlichen leistbaren Wohnraum zu schaffen.
Das sind die wahren Hintergründe, das, worum es eigentlich geht, und ich würde Sie ersuchen, in dieser Debatte auch dazu Stellung zu nehmen. Ich hoffe schon sehr, dass die SPÖ grundsätzlich weiter dahintersteht, dass wir dafür Sorge tragen wollen, dass wir Arbeitsplätze in diesem Land erhalten. (Beifall bei der ÖVP.)
19.47
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gemeldet ist nun Frau Dipl.-Ing.in Karin Doppelbauer. – Bitte schön, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer (NEOS): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Hohes Haus! Ich habe dem, was von der SPÖ und von der ÖVP gekommen ist, jetzt sehr interessiert zugehört, und tatsächlich, glaube ich, kann man dieses gesamte Paket noch aus einem dritten Blickwinkel betrachten, weil wir, wenn wir uns dieses Wohnbauförderungspaket im Detail anschauen, ehrlich gesagt finden, dass es ein weiterer Mosaikstein von einer sehr, sehr schlechten Idee ist, die damit nach wie vor weitergetrieben wird.
Ich möchte damit starten, festzuhalten, dass am Anfang tatsächlich ein guter Punkt dabei war. Da hieß es, wir wollen zwei Dinge erreichen – das hat auch Kollege Ottenschläger gerade gesagt –: Wir wollen auf der einen Seite dafür sorgen, dass die Konjunktur angekurbelt wird, und auf der anderen Seite, dass es mehr leistbaren Wohnraum gibt. Das sind Dinge, die wir als NEOS natürlich auch unterschreiben.
Jetzt hat sich aber das Wifo das Paket genauer angeschaut und sagt, angesichts der aktuellen Konjunkturprognose von 2024 und 2025 wird dieses Paket nicht wirklich viel bringen. Das heißt, die Konjunktur wird damit nicht in dem Ausmaß angekurbelt werden, wie wir es eigentlich brauchen würden. Heute haben wir ja wieder die Zahlen gesehen: dass eigentlich das Wachstum in der gesamten Europäischen Union gerade von der Kommission nach oben korrigiert wurde; der einzige Ausreißer, traurig und allein, ist Österreich, wo es nach unten korrigiert worden ist.
Deswegen wäre es ja prinzipiell eine gute Idee gewesen, aber laut Wifo wird dieses Konjunkturpaket nichts dazu beitragen. Es gibt angebliche Effekte im Jahr 2026, und dann passiert genau das, was wir in letzter Zeit schon so oft gesehen und als NEOS sehr stark kritisiert haben: dass Sie Geld mit der Gießkanne ausgeben, das zur Teuerung beiträgt! Das wird genau mit diesem Wohnbaupaket auch wieder passieren, und wir sind nicht die Einzigen, die das erwarten. (Beifall bei den NEOS.)
Da bin ich halt auch bei der SPÖ: Da wird der Ruf nach mehr Geld, nach mehr Geld, nach mehr Geld immer lauter. (Abg. Kucher: Nein!) – Noch einmal: Das Anliegen teilen wir. Tatsächlich muss man sich aber schon anschauen, wenn man jetzt beispielsweise auch wieder beim Handwerkerbonus zustimmt, dass selbst die Handwerker sagen: He, Leute, das ist alles ein bisschen übertrieben! Was wird denn mit dem Handwerkerbonus passieren? – Na ja, die Preise werden steigen und das heizt die Inflation an. Das ist das Kernproblem. (Abg. Kucher: Aber was ist mit den Krediten und den Übergewinnen?) – Tatsächlich ist das das gleiche Thema. Wenn wir schon von Zufallsgewinnen sprechen – es sind nicht
Übergewinne, sondern Zufallsgewinne –: Da hätte man halt auch in der Energiepolitik sehr viel mehr machen können (Abg. Kollross: Ja eh!), und da wären wir uns tatsächlich auch einig gewesen. (Abg. Kucher: Wenn das der Loacker hört!)
Wir haben im März davor gewarnt, dass in diesem Riesenpaket mit dem Geld, das da in die Hand genommen wird – zusätzliches Steuergeld –, sehr sorglos umgegangen wird. Warum sagen wir das? – Was da passiert, ist: Es wird zusätzliches Steuergeld genommen, und das haut man dann als Zweckzuschuss wieder den Ländern hin. Das ist einfach die Kernkritik, die wir an diesem ganzen Paket haben.
Warum ist das so? – Auf der einen Seite: Wir werden die Maastrichtkriterien heuer nicht erreichen, 3 Prozent werden wir überschreiten, das heißt, das Budget ist mit dieser Maßnahme wirklich mehr als angegriffen.
Der zweite Punkt, der mindestens genauso wichtig ist, ist tatsächlich der, dass die Länder ja eigentlich genügend Geld zur Verfügung hätten, um den Wohnbau anzutreiben. Wir wissen alle, Wohnbau ist Ländersache. Wir wissen auch, dass in den letzten Jahren, und das sagen halt die Zahlen, die Länder sehr viel weniger für den Wohnbau ausgegeben haben, als sie eigentlich hätten sollen. So ist sind die Zahlen: Zwischen 2011 und 2022 sind die Ausgaben der Länder für Wohnbau von 2,7 Milliarden Euro auf 1,9 Milliarden Euro zurückgegangen. (Ruf: Nicht alle!) Im selben Zeitraum haben sich die Einnahmen aus der Wohnbauförderung von 840 Millionen Euro auf 1,3 Milliarden Euro erhöht.
Das heißt, was machen Sie jetzt? – Sie nehmen frisches Steuergeld in die Hand, das Sie jetzt den Ländern zum Fraß vorwerfen, die ihre eigenen Gelder, die sie haben, ja nicht einmal ausnützen, nicht einmal für das, was sie eigentlich damit tun sollten, verwenden, nämlich die Wohnungen zu bauen, die sie bauen sollten. Sie geben denen zusätzliches Geld und belohnen somit dieses schludrige Verfahren der Landesfürstinnen und der Landesfürsten, und das kann aus unserer Sicht wirklich nicht die Zukunft sein. (Beifall bei den NEOS.)
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie sich das Paket anschauen. Aus unserer Sicht muss ich sagen, Sie schütten halt wieder einmal Steuergeld mit der Gießkanne auf ein Problem. Sie geben wieder Geld aus, das Sie noch nicht verdient haben. Das ist alles auf Pump, und damit ist es aus unserer Sicht den nächsten Generationen gegenüber unverantwortlich, wie Sie da mit dem Steuergeld umgehen. (Beifall bei den NEOS. – Abg. Kollross: Ich glaub’, der Haselsteiner sagt was anderes! – Abg. Scherak: Soll er!)
19.52
Präsident Ing. Norbert Hofer: Nächster Redner ist Maximilian Linder. – Bitte schön, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Maximilian Linder (FPÖ): Herr Präsident! Herr Minister! Geschätzte Kolleginnen, geschätzte Kollegen! Grundsätzlich werden wir von der FPÖ dem Gesetz zustimmen. (Ruf bei der ÖVP: Na, siehst du! Weil es ein gescheites ist!) Es sind aber doch einige Punkte, die uns trotzdem ein bissel etwas zum Nachdenken geben, oder auch Kritikpunkte, die wir da auf den Tisch legen, ins Plenum bringen wollen.
Die Zweckzuschüsse für den Wohnbau – Wohnraum schaffen und die Bauoffensive – von rund 780 Millionen Euro sind absolut daran gebunden, dass mehr Wohnungen geschaffen werden, dass man von 2024 bis 2026 mehr Wohnungen im Vergleich zu 2022 und 2023 errichten muss.
Die Bauoffensive ist etwas ganz Wichtiges. Was ich aber jetzt aus der Praxis heraus sagen muss, wenn ich unsere Gemeinden mit dem gemeinnützigen Wohnbau im Gegendtal hernehme: Wir haben alle das Problem, dass im gemeinnützigen Wohnbau sehr viele Wohnungen leer stehen, zum einen, weil die Wohnungen zum Teil dringendst saniert gehören, und zum Zweiten, weil die Mieten einfach zu hoch sind.
Lieber Philip Kucher, es sind halt auch die sozialistischen oder sozialistisch geführten Wohnbaugenossenschaften, die Millionenrücklagen haben und bei den Mieten, bei den Verwaltungskosten enorm aufgeschlagen haben, wodurch unsere Wohnungen leer stehen. Es gibt heute die Situation, dass man in Villach billiger eine Wohnung bekommt als bei uns im Land. Wir haben Einheiten mit sechs oder neun Wohnungen, in Villach sind es 25, 30 und 40 Wohnungen, dadurch ist es billiger, und wir haben die Schwierigkeit, dass die Bevölkerung bei uns, obwohl wir zentral liegen, obwohl wir eine gute Infrastruktur haben (Abg. Matznetter: ... Bürgermeister!), sagt: Wenn ich für dieselbe Wohnung in Villach um einen Hunderter weniger zahle, gehe ich dorthin! – Da sind die Probleme und da haben auch die Wohnbaugenossenschaften eine Verpflichtung.
Eigentlich hätte man auch beim Gesetz vielleicht noch mehr auf die Sanierung und auf die Mietpreise gehen müssen. Ich glaube einfach, dass damit mehr getan worden wäre, vor allem für den ländlichen Raum mehr getan worden wäre.
Die Bauoffensive ist gut. Wir werden dem zustimmen, aber trotzdem sollten wir in Zukunft darauf achten, dass die Mieten gesenkt werden und die Wohnbaugenossenschaften in die Pflicht genommen werden. – Danke. (Beifall bei der FPÖ.)
19.55
Präsident Ing. Norbert Hofer: Nächster Redner ist Abgeordneter Kai Jan Krainer. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Kai Jan Krainer (SPÖ): Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich wurde gefragt, wieso eigentlich Herr Kocher und nicht Herr Brunner auf der Regierungsbank sitzt. Das ist relativ einfach: Herr Brunner weilt, glaube ich, in Armenien, und Herr Kocher ist heute Finanzminister. Er ist auch Wirtschaftsminister. (Abg. Totter: Der Herr Kocher ist ...! – Weitere Zwischenrufe bei der ÖVP.)
Er hat sich auch als OeNB-Präsident beworben – Entschuldigung, als Gouverneur natürlich, als OeNB-Gouverneur. (In Richtung Bundesminister Kocher:) Da werden Sie ja bald ein Vorstellungsgespräch bei Herrn Mahrer haben. Herr Mahrer ist der Präsident der OeNB, aber gleichzeitig auch der Präsident der WKO. Da stellt sich natürlich die Frage, in welcher Eigenschaft Sie dann eigentlich mit ihm reden, weil Sie sich einerseits beim OeNB-Mahrer bewerben, andererseits haben Sie aber die Rechtsaufsicht über den WKO-Mahrer. (Zwischenrufe bei der ÖVP.)
Jetzt nur eine Frage: Wo findet denn eigentlich das Bewerbungsgespräch statt? (Ruf bei der ÖVP: Zur Tagesordnung! – Abg. Schmuckenschlager: Zur Sache! – Weitere Rufe bei der ÖVP: Herr Präsident, zur Sache!) Das findet in der WKO statt. Also das wird für Sie sehr schwierig sein, zu wissen, welchen Hut Sie aufhaben. (Ruf bei der ÖVP: Was hat das mit der Tagesordnung zu tun? Hör auf, dir da solche Sorgen zu machen! – Weitere Zwischenrufe bei der ÖVP.)
Ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht ganz, ich verstehe es wirklich nicht. (Rufe bei der ÖVP: Eh klar, dass du es nicht verstehst! ... wenn man nicht so gescheit ist wie der Minister!) Es ist total okay, dass Sie sich bewerben. Es ist total okay, dass Sie sich als Gouverneur bewerben, aber dann – bitte – müssen Sie eigentlich Ihr Ministeramt zurücklegen (Widerspruch bei der ÖVP), nämlich auch aus dem Grund, weil Sie dann selber darüber abstimmen, ob Sie das werden oder jemand anderer. (Ruf bei der ÖVP: Wenn man es nicht versteht, dann sollte man es sich erklären lassen!) Das ist eine klassische Unvereinbarkeit, wenn man selber wählt, ob man eine Funktion bekommt oder nicht. – Ehrlich gesagt, ich verstehe das einfach nicht. (Beifall bei der SPÖ sowie der Abg. Doppelbauer. – Widerspruch bei der ÖVP.)
Ich komme für die ÖVP aber gern zur Sache. Wir reden hier über ein Wohnbaupaket, das die Länder umsetzen sollen. Man muss dazusagen: Das ist jetzt, glaube ich, 33 Tage in Kraft – 35 Tage, so circa – und ist schon wieder in der Reparaturwerkstatt. Wir müssen also jetzt ein Gesetz reparieren, das nicht einmal zwei Monate alt ist. (Abg. Kollross: ... Reparaturbonus!)
Man merkt, wie hervorragend diese Regierung arbeitet. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen einen Neuwagen und nach einem Monat muss er schon das erste Mal in die Werkstatt! (Zwischenruf der Abg. Tomaselli.) Ich sage Ihnen, er wird noch einmal in die Werkstatt müssen, weil Sie mit den Ländern noch immer nicht vernünftig gesprochen haben, wie das umgesetzt werden soll. Sie können es in den „Salzburger Nachrichten“ lesen, Sie können es überall lesen, dass die Wohnbaureferenten der Länder sagen: Dieses Gesetz funktioniert nicht!
Sie reparieren jetzt wieder nur einen Teil. Ich weiß es nicht, Sie sind ja für den Reparaturbonus zuständig: Kriegen die Abgeordneten vielleicht einen Reparaturbonus oder so, wenn wir da permanent die Gesetze reparieren? (Heiterkeit des Abg. Schroll.)
Wenn wir gerade über den Reparaturbonus reden, das gehört ja auch zu den Dingen, die man nicht versteht: Den Reparaturbonus genauso wie das Supersparbuch bei der Oebfa bekommt man ausschließlich digital und das Supersparbuch überhaupt nur über die ID Austria. Zwei Drittel der Österreicherinnen und Österreicher haben keinen Zugang dazu – das ist ein staatliches Programm, eine staatliche Förderung –, und ein Drittel hat keinen Zugang zum Reparaturbonus. Wir haben schon öfters gesagt: Bitte, es muss doch auch einen Weg geben, wie man den Reparaturbonus nicht über ein Smartphone oder übers Internet beantragt, sondern den muss doch auch jeder bekommen, der kein Handy hat oder das nicht gut bedienen kann! – Wir reden da über ein Drittel der Bevölkerung.
Wir reden da vor allem von der älteren Generation. Das können viele sehr gut, aber manche halt auch nicht, und das kann doch nicht sein, dass die von derartigen Leistungen ausgeschlossen werden. Deswegen bringen wir einen Antrag ein, dass das eben ermöglicht werden soll, damit nicht ein Drittel oder zwei Drittel der Bevölkerung von derartigen Leistungen ausgeschlossen werden.
Deswegen darf ich jetzt folgenden Antrag einbringen:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Recht auf analoges Leben“
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung – insbesondere der Bundesminister für Finanzen sowie der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit –“, das sind zwei Personen, heute eine, „wird aufgefordert, in den Richtlinien zum Handwerkerbonus sowie dem Zugang zum Bundesschatz sowie bei allen anderen Amtswegen, die aktuell nur über die ID Austria oder digital zugänglich sind, sicherzustellen, dass Personen, die über kein Smart-Phone bzw. Internetzugang verfügen, auch Zugang zu diesen erhalten. Dies sollte entweder über einen Antrag auf der Gemeinde – unter entsprechend personeller Bedeckung durch den Bund –“ , der verursacht das ja auch, „sichergestellt werden, oder durch die Möglichkeit, den Handwerkerbonus direkt auf der Rechnung abzuziehen und vom ausführenden Betrieb abrechnen zu lassen.“
*****
Es geht einfach darum: Hören Sie auf, die ältere Generation zu diskriminieren! Diese muss genauso wie alle anderen in diesem Land einen Zugang zum Handwerkerbonus und zu anderen Leistungen des Staates haben. – Vielen Dank. (Beifall bei der SPÖ.)
20.00
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Kai Jan Krainer,
Genossinnen und Genossen
betreffend Recht auf analoges Leben
eingebracht im Zuge der Debatte zum Bericht des Finanzausschusses über den Antrag 4014/A der Abgeordneten Peter Haubner, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Finanzausgleichsgesetz 2024 geändert wird (2544 d.B.) (Top 10)
Der Handwerkerbonus dient der Unterstützung der schwachen Baukonjunktur und der Sicherung der Beschäftigung. Natürlich hat das Instrument Schwächen, wie etwa einige Mitnahmeeffekte, die zu erwarten sind. Auf der anderen Seite wird Schwarzarbeit bekämpft und Baukosten bzw. Sanierungsarbeiten werden für die Betroffenen in Zeiten der Rekordteuerung leichter erschwinglich.
Die Initiative ist grundsätzlich unterstützenswert. Es ist jedoch absolut inakzeptabel, wie die Abwicklung des Bonus über die Richtlinie gestaltet werden soll. Es soll vorgesehen werden, dass der Handwerkerbonus ausschließlich online zu beantragen ist - entweder über die ID-Austria oder über das Hochladen eines Lichtbildausweises.
Wir wissen, dass viele - insbesondere ältere - Personen über diese technischen Möglichkeiten heute nicht verfügen. 2,5 Mio. Menschen nutzen derzeit die ID-Austria. Das sind nur knapp 1/3 aller Menschen (Personen über 14 Jahre). 2/3 benutzen die ID-Austria derzeit nicht. Man kann davon ausgehen, dass unter diesen Bedingungen 80 bis 90 % der älteren Menschen nicht ohne Hilfe von Kindern und Enkelkindern auf die staatliche Förderung zugreifen können.
Bei allem Verständnis für die Notwendigkeit von moderner Verwaltung: Es ist respektlos Förderprogramme - insbesondere, wenn sie für einen sehr breiten Adressat:innenkreis konzipiert werden - so aufzusetzen, dass erhebliche Teile der Gesellschaft davon ausgeschlossen werden. Insgesamt sind alle Amtswege so zu gestalten, dass Bürger:innen auch analog Dienstleistungen der Gesellschaft abrufen können!
Es geht um die Absicherung des Zugangs von Menschen, die kein Smartphone besitzen oder keinen Zugang zum Internet haben, beziehungsweise alleine die ID
Austria nicht bedienen können, was insbesondere für ältere Menschen schwierig sein kann. Die jetzt gewählte Vorgangsweise zur Beantragung ist also eine eklatante Diskriminierung älterer Menschen, die verhindert werden muss. Gemeindebundpräsident Johannes Pressl (ÖVP) hat dazu, dem Vorschlag der SPÖ folgend, aufhorchen lassen, den Zugang auch über die Gemeindeämter möglich zu machen.
Dieselbe Problematik findet sich auch beim Zugang zum Bundesschatz, dem Sparprodukt des Bundes, der ebenso nur über die ID Austria zugänglich gemacht werden soll und damit 2/3 der Menschen in Österreich ausschließt. Zur Anlage finanzieller Mittel im Bundesschatz schreibt die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) auf ihrer Seite dazu folgendes:
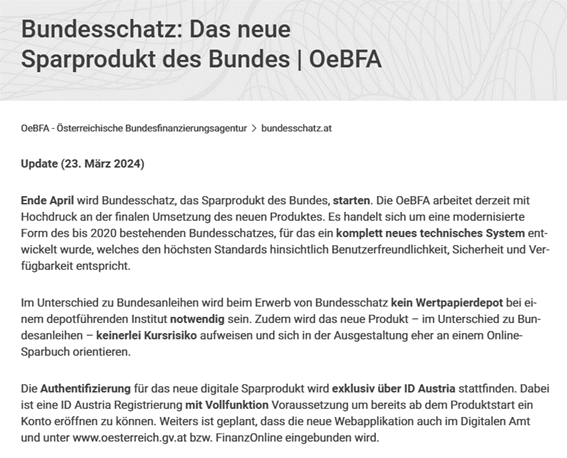
Dabei hat dieses Vorgehen System, wie die Regelungen bei der Förderung zum Heizungstausch oder auch zum Reparaturbonus nahelegen, wie auch von Senior:innenvertreter:innen kritisiert wurde. Insofern ist davon auszugehen, dass es
sich bei der erneuten Einschränkung bei der Beantragung für den Handwerkerbonus und den Bundesschatz vor allem um eine Maßnahme handelt, um die ID Austria zu jenem Erfolg zu machen, der politisch von der Bundesregierung gewünscht ist, sich aber wegen mangelhafter politischer Umsetzung nicht durchgesetzt hat. Das passiert auf dem Rücken vorwiegend älterer Menschen, die das System jahrelang am Laufen gehalten haben. Das ist nicht hinzunehmen.
Zudem haben die Regierungsfraktionen ÖVP und Grüne im Bundesrat – im Angesicht der eklatanten Schwächen ihres Gesetzesvorschlags – einen Entschließungsantrag an ihre eigene Bundesregierung gerichtet, in dem sie darum ersuchen, „[…] Lösungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der Beantragung von diversen Förderungen, aber z.B. auch für Online-Geldanlageprodukte des Bundes, zu prüfen […]“. Das ist Beweis genug, dass das beschlossene Gesetz lückenhaft ist und somit nicht in unveränderter Form beibehalten werden kann.
Zur sofortigen Behebung dieser Lücken ist eine Abwicklung über die Gemeinden ein sinnvoller Schritt! Die Gemeinden dürfen mit dieser zusätzlichen Aufgabe keinesfalls alleine gelassen werden. Deshalb soll der Bund zum Beispiel auch unter Zuhilfenahme von Beschäftigungsprojekten für eine personelle Bedeckung zu sorgen. Das wäre Politik mit Herz und Hirn.
Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher folgenden
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung – insbesondere der Bundesminister für Finanzen sowie der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit – wird aufgefordert, in den Richtlinien zum Handwerkerbonus sowie dem Zugang zum Bundesschatz sowie bei allen anderen Amtswegen, die aktuell nur über die ID Austria oder digital zugänglich sind, sicherzustellen, dass Personen, die über kein Smart-Phone bzw. Internetzugang verfügen, auch Zugang zu diesen erhalten. Dies sollte entweder über einen Antrag auf der
Gemeinde - unter entsprechend personeller Bedeckung durch den Bund – sichergestellt werden oder durch die Möglichkeit, den Handwerkerbonus direkt auf der Rechnung abzuziehen und vom ausführenden Betrieb abrechnen zu lassen."
*****
Präsident Ing. Norbert Hofer: Der Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht und steht somit auch mit in Verhandlung.
Zu Wort gemeldet ist Mag. Nina Tomaselli. – Bitte schön, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete Mag. Nina Tomaselli (Grüne): Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist ein bissl schwierig, dieser Diskussion und dieser Debatte zu folgen. Wir haben jetzt einen Ausflug zur OeNB-Personalbestellung gemacht, dann kamen wir noch kurz beim Reparaturbonus, beim Handwerkerbonus vorbei. Das, was Kollege Kucher bezüglich Mietpreisbremse und Wohnbaukreditzinsen erwähnt hat, gehört zumindest zum Themenpark, aber ich sage es Ihnen: Nichts davon hat eigentlich hier Platz und passt zu diesem Tagesordnungspunkt. Wir sprechen hier über das 1 Milliarde Euro schwere Wohnbaupaket, meine sehr geehrten Damen und Herren! (Beifall bei Grünen und ÖVP. – Abg. Stöger: Über das Finanzausgleichsgesetz sprechen wir!)
Was mich an Ihrer Haltung auch sehr ärgert, ist schon: sich immer, insbesondere wenn es um den Wohnbau geht, hierherzustellen und zu sagen, na was die Bundesregierung nicht alles zu machen hat und was die Bundesregierung nicht alles zu verantworten hat. (Zwischenruf des Abg. Matznetter.) Vielleicht kehren Sie einmal vor der eigenen Haustüre! Ich habe Ihnen jetzt monatelang, jahrelang zuhören müssen: Mietpreisbremse, Mietpreisbremse! (Neuerlicher Zwischenruf des Abg. Matznetter.) – Was haben Sie in Wien gemacht? – Gar nichts! (Abg. Krainer: Natürlich! Gemeindebau! Zwei Jahre!) Erst zu später Stunde; Sie haben zwei Erhöhungen mitgemacht und dann erst die Mietpreisbremse eingeführt!
(Beifall bei Abgeordneten der Grünen.) Zwei Erhöhungen, zwei Erhöhungen! (Abg. Krainer: Ja! Und zwei Jahre!)
Fakt ist auch – und da gebe ich Kollegin Doppelbauer schon recht –: Für den Wohnbau, für die Wohnbauförderung sind eigentlich die Länder zuständig, haben die Länder Einnahmen (Abg. Kucher: Wo ist denn die Mietpreisbremse? Wo ist die Mietpreisbremse?), und Tatsache ist: Sie geben sie nicht aus! Und wer ist da ganz vorne mit dabei? – Na, die SPÖ-Bundesländer.
In Wien: Ein Drittel der Wohnbauförderungseinnahmen, das sind 200 Millionen Euro, gehen irgendwo im Budget unter, werden aber nicht für den Wohnbau ausgegeben. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP.)
Absoluter Rekordhalter: das Bundesland Burgenland: 70 Prozent aller Wohnbauförderungseinnahmen im normalen Budget! 70 Prozent! Ja! (Zwischenruf des Abg. Egger.)
Und das sage ich Ihnen auch, Kollegin Doppelbauer, das ärgert mich auch massiv – was haben Sie gesagt? –: die Schludrigkeit der Landesfürsten. – Meinen Sie da auch Ihre ehemalige Kollegin in Salzburg als Wohnbaulandesrätin? Die hat nämlich in den letzten drei Jahren im Durchschnitt 110 Millionen Euro einfach ins normale Budget verschoben. Das ist ja doch Tatsache. (Beifall bei den Grünen.)
So, und jetzt gehen wir als Bund her – klar, das wäre eigentlich nicht unsere Aufgabe, aber wir nehmen die Verantwortung wahr, weil es uns wichtig ist, auch die Baukonjunktur zu retten –, nehmen frisches Geld in die Hand und geben es den Bundesländern. – Es wundert mich sehr, Herr Kollege Krainer, dass Sie plötzlich hier der Bundesländersprecher sind. – Die sagen: Oh Gott, es ist aber schwierig, das Ganze umzusetzen!
Das ist es gar nicht, es ist simple as it is. Die Bundesländer kriegen diese zusätzlichen Mittel für zusätzlichen Wohnbau. Ich sehe da überhaupt keine Schwierigkeiten. Das Gejammere aus den Bundesländern kennen Sie ausreichend. Wenn man ehrlich ist, hätten die am liebsten, dass man Ihnen die
Milliarde hinwirft und sie gar keine Bedingungen einhalten müssen. Das wollen wir als Bundesregierung aber diesmal genau nicht. (Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der ÖVP. – Abg. Krainer: Deswegen ist jetzt gerade die Additionalität bei den Zuschüssen gefallen!)
Letztlich ist das ein gutes Wohnbaupaket. Es ist ein ausgewogenes Wohnbaupaket. (Abg. Krainer: Es fliegt nicht!) Es garantiert langfristig leistbares Wohnen, es garantiert einen Ökoboost; und von Wohnbaupolitikern wie Ihnen, die mit 100 000 Euro Eigenheimbonus einfach einmal so herumwerfen wollen, lassen wir uns ganz ungerne beraten. – Vielen Dank. (Beifall bei den Grünen. – Abg. Krainer: Es funktioniert das nicht! ... heute das erste Mal repariert werden! Wir sehen uns im Juliplenum bei der nächsten Reparatur!)
20.04
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Christian Oxonitsch. – Bitte schön, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Christian Oxonitsch (SPÖ): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Ich muss ja zugeben, ich bin schon ein bisschen überrascht, dass dieses Marketingpaket, Wohnbaupaket, der Marketingschmäh scheinbar bei Kollegin Tomaselli tatsächlich so reingeht. – Ich habe jetzt fast den Eindruck gehabt, du glaubst es wirklich. Also du glaubst ja wirklich, dass man in der Lage ist, 1 Milliarde Euro über diese Systematik irgendwie innerhalb von zwei Jahren auf die Reihe zu kriegen.
Da gibt es acht Bundesländer; die Steiermark ist anscheinend vergattert worden, die hat jetzt irgendeinen Marketinggag mit dem Herrn Bundeskanzler machen müssen (Ruf bei der ÖVP: Hallo!), den er präsentiert hat: Sie schaffen das locker! (Abg. Lindinger: Na siehst du!) – Schauen wir es uns einmal an. Das Problem bei diesem Paket ist ja: Wir werden weder vor der Wahl (Zwischenruf der Abg. Tomaselli) noch zu einem anderen Zeitpunkt überprüfen können, ob das funktioniert. Und ich sage Ihnen, es wird nicht funktionieren, weil diejenigen, die
tatsächlich etwas davon verstehen, die in den Bundesländern tagtäglich damit arbeiten, die Wohnbaulandesräte - - Im Übrigen ist auch spannend, dass die FPÖ da zustimmt, obwohl es ja gerade vom Wohnbaulandesrat in Oberösterreich massive Kritik gibt, aber sei’s drum.
Freuen können wir uns nur in zwei Jahren, wenn man dann nachfragt – aber davon haben weder Mieterinnen und Mieter noch die Bauwirtschaft etwas – und draufkommen wird: Die Milliarde ist wieder nicht eingetreten, so wie es bei der Gesundheitsmilliarde ein Schmäh war, sehr geehrte Damen und Herren! Kollege Kucher hat schon darauf hingewiesen. (Zwischenruf des Abg. Schnabel.)
Da muss man schon sagen: Ich finde es eigentlich auch grundsätzlich bedenklich, dass wir derzeit über den Finanzausgleich reden – da gibt es jetzt eine Änderung, Kollege Krainer hat darauf hingewiesen; vor etwa 30 Tagen – und man gerade da nicht den Dialog mit den Ländern sucht. (Abg. Egger: Herr Kollege, das stimmt ja nicht!) Da kann man sich ja genau das Know-how, wie solch ein Paket funktionieren kann, holen. Man hat es nicht getan, und dahinter kann man eigentlich nur eine Strategie sehen: weil man am Ende des Tages eigentlich gar nicht will, dass das Geld ausgegeben wird, und die Länder das gar nicht abholen, aber jetzt, ein paar Monate vor einer Wahl, hat man einen Marketingschmäh, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Ein Punkt, auf den ich auch besonders hinweisen möchte, ist – man weiß von der ÖVP auch, dass sie durchaus ein historisch belastetes Verhältnis zum Gemeindebau hat –: Es ist ja völlig unverständlich, warum der kommunale Wohnbau von diesem Wohnbaupaket nicht umfasst ist. (Ruf bei der ÖVP: Das stimmt so nicht!) Gerade das ist ein ganz wesentlicher Bereich der Daseinsvorsorge. Die Gemeindebauten sind ein wesentlicher Bereich der Daseinsvorsorge. Sie sind nicht berücksichtigt.
Im Vergleich dazu sind die gewerblichen Bauträger, die durchaus mit einer entsprechenden Förderung dort bauen, wo es aber ja immer eine Gewinnabsicht, eine Gewinnoptimierung gibt, von diesem Paket umfasst. Aus diesem Grund,
meine sehr geehrten Damen und Herren, stellen wir einen entsprechenden Antrag:
Abänderungsantrag
der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen
zum Bericht des Finanzausschusses über den Antrag 4014/A
Der Nationalrat wolle in 2. Lesung beschließen:
Der oben bezeichnete Antrag (4014/A / 2544 d. B.) wird wie folgt geändert:
1. Die bisherige Novellierungsanordnung zu § 29a Abs. 11 und Abs. 12 erhält die Ziffernbezeichnung 3 und davor werden folgende Ziffern 1 und 2 eingefügt:
„1. In § 29a Abs. 1 lautet der zweite Satz wie folgt:
„Von diesem Betrag entfallen 780 Millionen Euro auf die Förderung der Errichtung durch gemeinnützige Bauvereinigungen, gewerbliche Bauträger oder kommunalen Wohnbau und 220 Millionen Euro auf die Förderung der Sanierung von Mietwohnungen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen durch gemeinnützige Bauvereinigungen oder kommunalen Wohnbau, jeweils im verdichteten und mehrgeschoßigen Wohnbau, jedoch ohne eingeschoßige Reihenhäuser.“
2. In § 29a Abs. 2 wird die Wortfolge „bis zu einem Ausmaß von 50 % von diesem Land im jeweils folgenden Jahr“ durch die Wortfolge „bis zu einem Ausmaß von 100 % von diesem Land in den nächsten darauffolgenden zwei Jahren“ ersetzt.“
*****
Wenn man sich das anschaut, stellt man fest, mit dem Paket leisten Sie eigentlich nur eine Vorgabe und eine zukünftige Systematik: Die Länder sollen sich vor dem Finanzausgleich bei den Bauleistungen immer ein bissl zurückhalten. Der Steuerungseffekt geht also eigentlich in die völlig falsche Richtung.
Machen wir ein paar Jahre weniger, dann haben wir vielleicht bei einem neuen Wohnbaupaket mehr davon! Ich glaube, es ist wichtig, dass jetzt viel gebaut wird, dass rasch viel gebaut wird. Dieses Rasch dauert aber auch seine Zeit, denn gerade im städtischen Bereich – ich glaube, so ist es auch zu sehen – ist das durchaus ein etwas größerer Aufwand als in kleinen Gemeinden. Da geht es aber anscheinend einmal mehr darum, die Städte zu bestrafen. – Danke schön. (Beifall bei der SPÖ.)
20.08
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Abänderungsantrag
der Abgeordneten Kai Jan Krainer,
Genossinnen und Genossen
zum Bericht des Finanzausschusses über den Antrag 4014/A der Abgeordneten Peter Haubner, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Finanzausgleichsgesetz 2024 geändert wird (2544 d.B.) (Top 10)
Der Nationalrat wolle in 2. Lesung beschließen:
Der oben bezeichnete Antrag (4014/A / 2544 d.B.) wird wie folgt geändert:
1. Die bisherige Novellierungsanordnung zu § 29a As. 11 und Abs. 12 erhält die Ziffernbezeichnung 3 und davor werden folgende Ziffern 1 und 2 eingefügt:
„1. In § 29a Abs. 1 lautet der zweite Satz wie folgt:
„Von diesem Betrag entfallen 780 Millionen Euro auf die Förderung der Errichtung durch gemeinnützige Bauvereinigungen, gewerbliche Bauträger oder kommunalen Wohnbau und 220 Millionen Euro auf die Förderung der Sanierung von Mietwohnungen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen durch gemeinnützige
Bauvereinigungen oder kommunalen Wohnbau, jeweils im verdichteten und mehrgeschoßigen Wohnbau, jedoch ohne eingeschoßige Reihenhäuser.“
2. In § 29a Abs. 2 wird die Wortfolge „bis zu einem Ausmaß von 50 % von diesem Land im jeweils folgenden Jahr“ durch die Wortfolge „bis zu einem Ausmaß von 100 % von diesem Land in den nächsten darauffolgenden zwei Jahren“ ersetzt.“
Begründung
Zu Z 1 (§ 29a Abs. 1 FAG 2024):
Gemäß § 29a Abs. 1 FAG 2024 idF des BGBl. I Nr. 32/2024 gewährt der Bund den Ländern einen Zuschuss für die Errichtung und Sanierung von Wohnraum. Da der kommunale Wohnbau einen essenziellen Bestandteil der Daseinsvorsorge einer Gemeinde darstellt, soll die Möglichkeit von Zweckzuschüssen des Bundes auch diesem Bereich zu Gute kommen.
Zu Z 2 (§ 29a Abs. 2 FAG 2024):
Im Sinne der Intention des Gesetzgebers, dass Fördermittel zu leistbarem Wohnraum und zu einer Konjunkturbelebung in der Bauwirtschaft beitragen sollen, wird eine Übertragbarkeit der Fördermittel in die Folgejahre – jedenfalls aber bis zum Ende der aktuellen Finanzausgleichsperiode – zu 100 Prozent ermöglicht, zumal Bauvorhaben oft durch unbeeinflussbare externe Faktoren Verzögerungen unterliegen können.
*****
Präsident Ing. Norbert Hofer: Der Abänderungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht, er steht somit auch mit in Verhandlung.
Zu Wort gemeldet ist nun Ing. Klaus Lindinger. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Ing. Klaus Lindinger, BSc (ÖVP): Herr Präsident! Geschätzter Herr Minister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer!
Wenn die Kollegen Krainer und Oxonitsch sich hier herausstellen und sagen, dieses Paket ist zu wenig oder sie kennen sich nicht aus (Abg. Krainer: Hat weder der eine noch der andere gesagt!), dann muss ich sagen: Lasst euch das Paket einmal ein bissl erklären! – Kollege Krainer, ich erkläre dir das ganze Wohnbaupaket dann gleich noch einmal, dass auch du es verstehst. (Zwischenruf des Abg. Oxonitsch.)
Zum Reparaturbonus – du hast vorhin die ID Austria angesprochen –: Ja, wir haben eine Umsetzung oder Einreichung über die ID Austria, und das dürfen wir den Menschen zumuten. All jene Menschen, die das nicht schaffen, bekommen die Unterstützung entweder von der Firma, die diesen Reparaturbonus umsetzt, oder – und da kann ich als Bürgermeister einer kleinen Gemeinde auch aus Erfahrung sprechen – in den Gemeinden. Dort wird den Menschen nämlich direkt vor Ort geholfen. Somit können wir das alles umsetzen und die Leute können den Reparaturbonus beantragen. (Beifall bei der ÖVP.)
Aber nun zum Wohnbaupaket: Wer sich nicht auskennt, soll sich nicht hier herausstellen und falsche Behauptungen äußern. Es geht beim Wohnbaupaket um drei große Punkte. Punkt eins ist die Schaffung von neuen Wohnungen, Miet- oder Eigentumswohnungen, und die Sanierung von Wohnungen. Da haben wir ganz klar aufgelegt, dass die Länder diese Wohnungen zusätzlich bauen müssen, die sind verantwortlich. Das ist ganz klar geregelt. Es freut mich, dass unsere Jugendstaatssekretärin sich da starkmacht, wir da etwas für die Jugend leisten, und unser Bundeskanzler Karl Nehammer hat das auch im Österreichplan bereits gefordert. Wir kommen hier jetzt mit diesem Wohnbaupaket bereits in die erste Umsetzung, dass wir Eigentum schaffen, dass wir Sanierungen bestmöglich unterstützen.
Beim zweiten Punkt, Herr Kollege, geht es bei der Schaffung von Eigentum, beim Kauf von Eigentum um die Abschaffung von Nebengebühren. Es geht um die Eintragungsgebühr ins Grundbuch, es geht um die Eintragungsgebühr des Pfandrechts. Diese Nebengebühren fallen ganz klar weg. Das ist Unterstützung für all jene, die sich Eigentum schaffen wollen. (Beifall bei der ÖVP.)
Beim dritten Punkt, den ich anspreche – und da kommen wir auch zu dem Gesetzespaket, zu der Änderung im Finanzausgleichsgesetz –, geht es darum, einen niedrigen Kreditzinssatz in der Höhe von 1,5 Prozent für ein maximales Volumen von 200 000 Euro zu schaffen. Und ja, die Bundesländer haben da die Umsetzung zu organisieren, zu beschließen. Gott sei Dank hat die Steiermark als erstes Bundesland jetzt auch beschlossen, dass wir diesbezüglich zu einer schnellstmöglichen Umsetzung kommen. (Beifall bei Abgeordneten der ÖVP.) Ich darf alle Bundesländer, im Speziellen die roten Bundesländer auffordern (Zwischenruf des Abg. Oxonitsch), diesem guten Beispiel zu folgen und schnellstmöglich eine Umsetzung zu beschließen, denn das kommt all jenen, die sich Eigentum schaffen wollen, die ein Haus bauen wollen, die sich eine Eigentumswohnung kaufen wollen, zugute.
Ganz persönlich – es ist auch Oberösterreich angesprochen worden –: Ja, Landesrat Haimbuchner in Oberösterreich ist gefordert, das umzusetzen. Das kommt den Jungen, den Familien zugute.
Es ist der Handwerkerbonus angesprochen worden. Ja, der Handwerkerbonus ist auch ein Instrument, mit dem wir den Menschen in Österreich bei den Handwerksleistungen unter die Arme greifen und zugleich in einer schwierigen Situation in der Bauwirtschaft auch die Arbeitsplätze absichern. Da geht es um bis zu 10 000 Euro, die förderfähig sind, mit einem Fördersatz von 20 Prozent, die relativ einfach mit Antrag ab 15. Juli für Arbeitsstundenleistungen eingereicht werden können, die ab 1. März dieses Jahres – ja, rückwirkend – bereits getätigt worden sind. Das ist eine Unterstützung für alle Handwerker:innen, aber vor allem für die Arbeitsplätze bei uns in Österreich. (Beifall bei der ÖVP sowie der Abgeordneten Disoski und Fischer.)
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf abschließend, weil es ja die letzte Plenarsitzungswoche vor der EU-Wahl ist, noch einmal alle Personen auffordern: Es darf und soll uns nicht egal sein, wer die nächsten fünf Jahre unser Österreich in Brüssel vertritt. Darum: Bitte geht am 9. Juni wählen! (Zwischenruf des Abg. Scherak.) Macht euch schlau, welche Kräfte positiv –
positiv! – für eine gute Entwicklung in der Europäischen Union, für die Zukunft der Europäischen Union einstehen!
Ich darf, weil wir immer von den schlechten Dingen reden, eines schon in Erinnerung rufen: Es gibt eine gemeinsame Währung, es gibt Reisefreiheit innerhalb von Schengen. Es gibt das Erasmus-Programm, das viele Jugendliche in Österreich nutzen, nicht zuletzt das Friedensprojekt. Ich glaube, meine sehr geehrten Damen und Herren und liebe Kollegen, wir sollten auch die vielen positiven Punkte – nicht alle, viele positive Punkte –, die uns Europa und die gemeinsame Europäische Union bringen, hernehmen. Wir sollten daran arbeiten, Europa besser zu entwickeln. Dafür stehen wir als Volkspartei und dafür stehen unsere Kandidaten mit Reinhold Lopatka an der Spitze. Wir bitten um Unterstützung. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Scherak: Oberösterreich ...!)
20.14
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt Abgeordneter Mag. Philipp Schrangl. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Mag. Philipp Schrangl (FPÖ): Meine sehr verehrten Damen und Herren im Haus und zu Hause vor den Fernsehgeräten! Es waren jetzt viele Abgeordnete hier heraußen, die gemeint haben, sie müssen dieses Wohnbaupaket allen anderen erklären. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade, denn vor allem die Abgeordneten der Regierungsparteien sind anscheinend wirklich auf Ihren totalen Marketingschmäh hereingefallen, und ich glaube auch, dass Sie wahnsinnig viel mehr Geld für diese Marketingmaschinerie ausgegeben haben als für dieses Wohnbaupaket selbst. (Abg. Steinacker: Das glaubst aber nur du!)
Was ich schon ein bisschen befremdlich finde – leider ist jetzt der Herr Finanzminister nicht hier –: Ich habe ihn im Ausschuss gefragt, ob er denn überhaupt Kontakt mit den Menschen aufgenommen hat, die dieses Wohnbaupaket der Bundesregierung in den Ländern umsetzen müssen. Wir haben jetzt schon oft gehört, die Bundesländer sind verantwortlich für die
Wohnbauförderung und - - (Abg. Michael Hammer: Ihr sabotiert aber – so wie der Haimbuchner!) – Nein, das ist ein kompletter Blödsinn. (Abg. Michael Hammer: Ja, sicher! Das ist eine reine Parteipolitik! Es ist aber so!) Schau, das ist typisch: Die ÖVP schreit und hat eigentlich leider überhaupt keine Ahnung. (Abg. Michael Hammer: Das ist vollkommen fahrlässig! Kann nur im Bierzelt schreien! Mehr geht nicht!)
Man muss einmal ganz klar sagen: Ihr unterstützt mit diesem Wohnbaupaket die Länder, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Da fragt bitte euren eigenen Finanzreferenten Thomas Stelzer in Oberösterreich, wie denn das so ist. Es sollen zusätzlich Wohnungen errichtet werden. Oberösterreich hat vor zwei Jahren schon angefangen, die Wohnbauförderung zu erhöhen, damit eben dieser Ausfall in der Wohnbauförderung nicht gegeben ist. Die haben in den letzten zwei Jahren durchschnittlich 934 Wohnungen gefördert und fertiggestellt. Wie sollen die in Oberösterreich jetzt quasi noch mehr Wohnungen bauen? Ihr unterstützt mit diesem Wohnbaupaket Länder, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Das ist Niederösterreich und das ist auch die Steiermark.
Und – die SPÖ hat das vollkommen richtig gesagt –: Mit diesem Wohnbaupaket wird auch keine Planungssicherheit, wie ihr es den Menschen suggeriert, geschaffen, weil eben diese Unterstützung nur bis 2027 gelten soll. Dass diese Unterstützung nur bis 2027 möglich ist, das ist völlig lebensfremd, und das weiß auch jeder Häuslbauer. (Abg. Michael Hammer: Dann soll er das Wohnbauressort hergeben, der Haimbuchner ...!)
Wir stimmen diesem Paket heute zu, und zwar aus zwei Gründen: erstens, weil wir auch dafür sind, dass die Nebengebühren endlich einmal gesenkt werden. Leider geschieht das wieder einmal nicht so, wie es die ÖVP uns und vor allem dem Bürger versprochen hat, dass nämlich auch die Grunderwerbsteuer ausgesetzt wird. Nein! Natürlich verspricht die ÖVP wieder so viel, hält aber am Ende wenig.
Man muss auch eines in Richtung SPÖ sagen: Die Gemeinde Wien hat die Mieterhöhungen in den letzten zwei Jahren vollumfänglich umgesetzt. Im Gemeindebau sind 8,6 Prozent Erhöhung im Richtwert und 24 Prozent im Kategoriemietzins erfolgt. Und jetzt hier nach noch mehr Geld zu schreien, das finde ich etwas befremdlich. (Abg. Krainer: Das hat überhaupt keiner getan! Wovon reden Sie? Die Mieten sind im Gemeindebau ausgesetzt worden letztes Jahr, in zwei Jahren!)
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir halten fest: Leider bleibt von dieser Wohnbaumilliarde nicht das übrig, was uns die Regierung versprochen hat, aber wir haben gezeigt: Dort, wo Freiheitliche in der Verantwortung sind, findet tatsächlich geförderter Wohnbau für die Österreicherinnen und Österreicher statt. – Danke schön. (Beifall bei der FPÖ.)
20.18
Präsident Ing. Norbert Hofer: Nächster Redner ist Herr Abgeordneter Lukas Brandweiner. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Lukas Brandweiner (ÖVP): Herr Präsident! Geschätzter Herr Bundesminister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuseherinnen und Zuseher zu Hause vor den Bildschirmen! Wenn man Kollegen Kucher so zuhört, könnte man meinen, Österreich ist das Armenhaus Europas. Das ärgert mich mittlerweile. Sie wissen, dass es nicht so ist, und ich bitte Sie wirklich, mit diesen falschen Fakten aufzuhören. Arbeiten wir gemeinsam an einer positiven Entwicklung! Nehmen Sie sich vielleicht ein Beispiel an Ihren steirischen Kollegen, denn immerhin hat die SPÖ Steiermark die Umsetzung dort mitgestaltet. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Schrangl: Wie viele Wohnungen hat die Steiermark in den letzten drei Jahren ...?)
Viele junge Menschen wünschen sich ein Eigenheim, das freut uns sehr, das belegen auch viele Studien. Wenn ich im Waldviertel unterwegs bin, wird mir
das auch immer wieder bestätigt. Ich bin sehr dankbar, dass unsere Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm sich da wirklich stark für Verbesserungen eingesetzt hat (Abg. Schroll: Die paar Monate kann sie noch hackeln!), aber auch Bundeskanzler Karl Nehammer hat das klar in den Österreichplan geschrieben: Wir wollen die Eigentumsquote von 48 Prozent auf 60 Prozent erhöhen. Mit diesem Wohnbaupaket sind wir auf dem richtigen Weg. (Beifall bei der ÖVP.)
Ein zentrales Thema in der Eigentumsbildung sind natürlich Immobilienkredite; da unterstützen wir eben als Bund die Länder, meine Vorredner haben es schon angesprochen. So sollen Privatpersonen in ihrem Heimatbundesland ein günstigeres Wohnbaudarlehen in Höhe von maximal 200 000 Euro beantragen können. Bis 2028 soll die Zinsdifferenz bis auf 1,5 Prozent abgegolten werden, und diese Differenz schießt der Bund – das beschließen wir als Parlament – zu.
Eine Bedingung für die Abholung war allerdings, dass die Länder eine Zusätzlichkeit hätten nachweisen müssen, das heißt, sie hätten die Förderung nur für jene Kredite bekommen, die über dem Durchschnitt der Jahre 2022 und 2023 liegen. Entgegen der Behauptung, dass die Länder nicht eingebunden wurden oder wir nicht miteinander reden, sage ich Ihnen, dass es natürlich Gespräche mit den Ländern gegeben hat – in den letzten Wochen sogar sehr intensive – und sie reklamiert haben, dass das ein Problem werden könnte. Daher haben wir heute diese Änderung vorliegen. Ich kann nur alle darum bitten, zuzustimmen, damit dem Beispiel Steiermark auch die anderen Bundesländer folgen. (Beifall bei der ÖVP.)
Um sicherzustellen, dass das Geld wirklich bei den Häuslbauern ankommt, wird es auf der Homepage des Bundesministeriums für Finanzen eine Datenbank geben, über die die Länder ihre Berichte abgeben. Sie sehen, wir stehen für höchstmögliche Transparenz und sorgen dafür, dass das Geld wirklich ankommt.
Ich möchte mich bei den Experten, die da eingebunden waren, sehr herzlich bedanken, allen voran auch bei unserer niederösterreichischen Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die sich da stark eingebracht hat. Ich habe erst
heute wieder mit ihr telefoniert, auch Niederösterreich ist natürlich im Endspurt. Ich hoffe, dass mein Heimatbundesland bald in Umsetzung geht und dass sich die jungen Menschen nicht nur bei uns im Waldviertel, sondern in ganz Österreich wieder den Traum von den eigenen vier Wänden verwirklichen können. – Vielen Dank. (Beifall bei der ÖVP.)
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen.
Wünscht der Herr Berichterstatter ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall.
Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf in 2544 der Beilagen.
Hiezu haben die Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen einen Zusatz- beziehungsweise Abänderungsantrag eingebracht.
Ich werde daher zunächst über die vom erwähnten Zusatz- beziehungsweise Abänderungsantrag betroffenen Teile und schließlich über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes abstimmen lassen.
Die Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen haben einen Zusatz- beziehungsweise Abänderungsantrag betreffend Nummerierung der Novellierungsanordnung sowie Einfügung neuer Ziffern 1 und 2 eingebracht.
Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist die Minderheit, der Antrag ist abgelehnt.
Wir kommen sogleich zur Abstimmung über diesen Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung des Ausschussberichtes.
Ich ersuche jene Mitglieder des Hohen Hauses, die hierfür sind, um ein zustimmendes Zeichen. – Das ist mehrheitlich angenommen.
Wir kommen schließlich zur Abstimmung über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang in der Fassung des Ausschussberichtes.
Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. – Auch das ist mehrheitlich angenommen.
Wir kommen zur dritten Lesung.
Ich bitte jene Damen und Herren, die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, um ein diesbezügliches Zeichen. – Das ist die Mehrheit. Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung angenommen.
Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Recht auf analoges Leben“.
Ich bitte jene Damen und Herren, die für diesen Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt.
Bericht des Finanzausschusses über den Antrag 4015/A der Abgeordneten Peter Haubner, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Nationale Emissionszertifikatehandelsgesetz 2022 geändert wird (2545 d.B.)
Präsident Ing. Norbert Hofer: Wir kommen nun zum 11. Punkt der Tagesordnung.
Es wurde auf eine mündliche Berichterstattung verzichtet.
Zu Wort gelangt MMag.a Michaela Schmidt. – Bitte, Frau Abgeordnete.
20.24
Abgeordnete MMag. Michaela Schmidt (SPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzter Herr Minister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte daran erinnern, wie das Emissionszertifikategesetz zwei im November letzten Jahres zustande gekommen ist. Damals wurde kurz vor Sitzungsende ein über 60-seitiger Initiativantrag eingebracht. Die Vorgehensweise hatte zur Folge, dass weder eine Folgenabschätzung vorlag noch eine ordentliche Begutachtung stattgefunden hat.
Ich habe damals prognostiziert, dass durch diese stümperhafte Vorgehensweise geradezu vorprogrammiert ist, dass es bei der Umsetzung zu Problemen kommen wird. (Abg. Michael Hammer: Hellseherin!) Nun haben wir heute, rund fünf Monate später, dasselbe Spiel beim Emissionszertifikategesetz eins und dem Klimabonus.
Dieses beinhaltet wieder zahlreiche, umfangreiche Änderungen und hat große budgetäre Auswirkungen: Es sind 600 Millionen Euro für den Klimabonus und 200 Millionen Euro für die Entlastung von Agrardiesel vorgesehen. Wieder haben wir den Abänderungsantrag erst kurz vor der Sitzung – heute Früh – zugeschickt bekommen. Es waren also wieder keine Diskussionen im Ausschuss, keine Begutachtungen oder Rückfragen möglich. Egal ob ETS1 oder ETS2, die respektlose Vorgehensweise gegenüber dem Parlament ist immer die gleiche. So geht man nicht mit Oppositionsparteien um, liebe Bundesregierung! (Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordneten der NEOS.)
So erfahren wir eher beiläufig aus den Medien, dass der Treibstoff für die Bauern nun mit insgesamt 200 Millionen Euro subventioniert werden soll – mit dem interessanten Argument, dass eine allfällige CO2-Bepreisung in diesem Sektor sowieso keinen Lenkungseffekt habe, die CO2-Bepreisung stelle nur eine zusätzliche Belastung für die Bauern und Bäuerinnen dar. (Abg. Kassegger: Stimmt nicht nur für die Bauern, stimmt ganz allgemein! Null Lenkungseffekt!)
Liebe ÖVP, das gilt nicht nur für die Bauern und Bäuerinnen, sondern auch für die Mieterinnen und Mieter, die mit Gas heizen müssen und sich ihr Heizungssystem nicht aussuchen können. Das gilt vor allem für die Pendlerinnen und Pendler, die keine öffentlichen Verkehrsmittel vor der Haustüre haben. Bei denen war die Bundesregierung in Zeiten von Rekordteuerung bekanntlich nicht dazu bereit, die CO2-Steuer auszusetzen.
Abschließend möchte ich mich noch bei den Kolleginnen und Kollegen der ÖVP entschuldigen. Ich habe ihnen heute in der Früh vorgeworfen, die ÖVP begünstige nur die Superreichen und die Großkonzerne. Ganz offensichtlich habe ich die Bauern vergessen. (Beifall bei der SPÖ. – Abg. Michael Hammer: Das war sehr entbehrlich! – Ruf bei der ÖVP: Das war einfach naiv! – Abg. Michael Hammer: Ja!)
20.26
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Peter Haubner. – Bitte, Herr Abgeordneter. (Abg. Hörl: Peter, zeig’s ihr!)
Abgeordneter Peter Haubner (ÖVP): Sehr geehrter Herr Bundesminister! Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ja, das Nationale Emissionszertifikatehandelsgesetz hat natürlich wichtige Ziele und die dürfen wir nicht außer Acht lassen. Es geht vor allem darum, dass wir bürokratische Mehrbelastungen für die nationale und europäische CO2-Bepreisung für die Betriebe, die davon betroffen sind, verhindern beziehungsweise minimieren wollen.
Diese nationale CO2-Bepreisung im Rahmen des Nationalen Emissionszertifikatehandelsgesetzes ist ja schon seit 1.10.2022 in Kraft. Seither versucht die Wirtschaft, auf die Umsetzung der im Gesetz vorgesehenen Entlastungsmaßnahmen für Carbonleakage und Härtefälle aufmerksam zu machen. Aufgrund der mangelnden beihilferechtlichen Genehmigungen durch die Europäische Kommission konnten diese Entlastungsmaßnahmen bisher nicht umgesetzt werden.
Um die abwanderungsgefährdeten Unternehmen zu schützen und beihilferechtliche Voraussetzungen zu schaffen, um den Vorgaben der Europäischen Kommission zu entsprechen, brauchen wir nun dringend eine Anpassung dieses Gesetzes. Mit diesem Gesetzentwurf soll nun eine beihilfenkonforme Entlastung verankert werden. Dafür ist sogar eine Ausweitung der Anspruchsberechtigten vorgesehen: Anstelle von Carbonleakagesektoren, anstatt bloß die abwanderungsgefährdeten Betriebe, wie ursprünglich intendiert, sind nun auch die energieintensiven Betriebe anspruchsberechtigt. Damit wird eine notwendige Standortmaßnahme in ohnehin herausfordernden Zeiten umgesetzt. Dafür stehen die entsprechenden finanziellen Mittel zur Verfügung, Frau Kollegin. (Beifall bei Abgeordneten der ÖVP.)
Wir müssen bedenken, dass wir im internationalen Wettbewerb sind. Da haben wir natürlich mit unserem Nachbarn Deutschland einen Partner beziehungsweise einen Konkurrenten, mit dem wir uns vergleichen können. Die Höhe des CO2-Preises liegt sowohl in Deutschland als auch in Österreich bei 45 Euro pro Tonne. Mit dieser Änderung des Emissionszertifikatehandelsgesetzes soll also eine bürokratische Mehrfachbelastung von Betrieben, die von der nationalen und von der europäischen CO2-Bepreisung betroffen sind, verhindert werden.
Dazu bringe ich einen Abänderungsantrag ein, den ich kurz in den Eckpunkten erläutern möchte. (Abg. Krainer: Neun Seiten Normtext!)
Das ist der Antrag der Abgeordneten Haubner, Schwarz, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Nationale Emissionszertifikatehandelsgesetz 2022 geändert wird, 4015/A in 2545 der Beilagen, TOP 11. (Abg. Krainer: Wir sind gespannt auf die Eckpunkte!)
In den Schwerpunkten, Herr Kollege (Abg. Krainer: Ich passe auf, ja!), geht es darum, dass wir einerseits die Sicherstellung einer Überleitung in das europäische Emissionshandelssystem gewährleisten wollen, das die beihilfenkonforme Anpassung der bisherigen Entlastungsmaßnahmen betreffend Carbonleakage und Härtefälle abfedern soll.
Ab 1. Jänner 2027 startet dann die Bepreisungsphase des neuen ETS2 mit der Auktionierung und dem Handel der neuen ETS2-Zertifikate. Wir wollen einen Mehraufwand betreffend die Beitragspflichten für die Unternehmen verhindern, dass die Anforderungen des NEHG an das EU-ETS2 angepasst werden sowie eine Adaptierung der Entlastungsmaßahmen.
Der Antrag ist verteilt worden und liegt heute hier auf. (Ruf bei der SPÖ: Großartig! – Abg. Krainer: Das war circa ein Drittel der Kernpunkte! Wo sind die anderen zwei Drittel?)
Wir setzen uns eben für den Standort ein und schauen damit, dass die Unternehmen und Arbeitsplätze in unserem Land bleiben. Dazu soll auch dieser Antrag dienen. – Danke. (Beifall bei der ÖVP.)
20.30
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Abänderungsantrag
der Abgeordneten Peter Haubner, Mag. Dr. Jakob Schwarz,
Kolleginnen und Kollegen,
zum Antrag der Abgeordneten Peter Haubner, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA, Kolleginnen und Kollegen, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Nationale Emissionszertifikatehandelsgesetz 2022 geändert wird (4015/A idF AB 2545 d.B.) (Top 11)
Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen:
Der im Titel bezeichnete Antrag (4015/A) in der Fassung des Ausschussberichtes (2545 d.B.) wird wie folgt geändert:
I. Ziffer 1 lautet wie folgt:
„1. In § 1 wird jeweils die Wortfolge „EU-Emissionshandel“ durch die Wortfolge „EU ETS I“ ersetzt und nach der Wortfolge „nationales Handelssystem mit Treibhausgasemissionszertifikaten in Stufen eingeführt“ die Wortfolge samt Satzzeichen „, welches ab dem Jahr 2027 in das europäische System des EU ETS II überführt werden soll“ eingefügt.“
II. Ziffer 3 lautet wie folgt:
„3. § 3 wird wie folgt geändert:
a) Abs. 1 Z 1 und 2 lauten:
„1. „Energieträger“ bis zum 31. Dezember 2024 alle fossilen Mineralöle, Kraft- und Heizstoffe, Erdgase und Kohle, die in Anlage 1 zu diesem Gesetz festgelegt werden, wobei für Angaben in Liter § 3 Abs. 4 MinStG 2022 und für Angaben in Kubikmeter § 5 Abs. 3 des Erdgasabgabegesetzes sinngemäß gelten. Ab dem 1. Jänner 2025 alle Energieerzeugnisse, die in Anlage 3 zu diesem Gesetz festgelegt werden;
2. „Treibhausgasemission“ die Menge Kohlenstoffdioxid, die bei Verbrennung einer festgelegten Menge von Energieträgern nach Anlage 1 freigesetzt und dem Handelsteilnehmer infolge des Inverkehrbringens zugerechnet wird, bei Energieerzeugnissen nach Anlage 3 sind die Treibhausgasemissionen nach IPCC-Leitlinien zu ermitteln;“
b) In Abs. 1 Z 3 entfällt der Wortteil „äquivalente“.
c) Abs. 1 Z 8 lautet:
„8. „EU ETS I“ das unionsweite System zur Erfassung und Begrenzung von Treibhausgasemissionen, geregelt durch die Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Union und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG, ABl. Nr. L 275 vom 25.10.2003 S. 32, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2023/959/EU, ABl. Nr. L 130 vom 10.05.2023 S. 134, ausgenommen Kapitel IVa der Richtlinie 2003/87/EG sowie die innerstaatliche Umsetzung
im 8. Abschnitt des Emissionszertifikategesetzes 2011 – EZG 2011, BGBl. I Nr. 118/2011 in der Fassung BGBI. I Nr. 196/2023;“
d) In Abs. 1 wird am Ende der Z 11 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und es werden nach der Z 11 folgende Z 12, 13 und 14 angefügt:
„12. „EU ETS II“ das europäische Emissionshandelssystem für den Gebäude- und den Straßenverkehrssektor sowie für andere Sektoren gemäß Kapitel IVa der Richtlinie 2003/87/EG sowie die innerstaatliche Umsetzung im 8. Abschnitt des Emissionszertifikategesetzes 2011 – EZG 2011, BGBl. I Nr. 118/2011 in der Fassung BGBI. I Nr. 196/2023;
13. „IPCC-Leitlinien“ die Richtlinien zur nationalen Treibhausgas-Berichterstattung von 2006 des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) oder spätere Aktualisierungen dieser Leitlinien;
14. „AGVO“ Verordnung (EU) 651/2014 vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, ABl. Nr. L 187 vom 26.06.2014 S. 1, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2023/1315, ABl. Nr. L 167 S. 1.““
III. Ziffer 4 wird wie folgt geändert:
a) § 6 Abs. 7 lautet:
„(7) Übermittelt ein Handelsteilnehmer eine Emissionsmeldung gemäß § 41 EZG 2011 samt Prüfgutachten einer unabhängigen Prüfeinrichtung, kann diese von der zuständigen Behörde als Treibhausgasemissionsbericht samt Prüfgutachten einer unabhängigen Prüfeinrichtung für dieses Bundesgesetz anerkannt werden, sofern durch den Handelsteilnehmer Abweichungen zwischen beiden Gesetzen, durch nicht berücksichtigte Mengen an Energieträgern oder einer Befreiung gemäß §§ 22 und 23 unterliegenden Mengen an Energieträgern im Rahmen des Treibhausgasemissionsberichts gemäß § 41 EZG 2011 bekannt gegeben wurden.“
b) § 7 Abs. 6 lautet:
„(6) Der Bundesminister für Finanzen kann im Einvernehmen mit der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie durch Verordnung nähere Vorschriften in Bezug auf den Überwachungsplan erlassen.“
IV. Ziffer 6 lautet wie folgt:
„6. § 9 lautet:
„§ 9. Der nationale Emissionszertifikatehandel beginnt mit 1. Oktober 2022 und endet mit Überleitung in das EU ETS II mit 31. Dezember 2026 oder mit 31. Dezember 2027, sofern in Einklang mit § 37 Abs. 6 EZG 2011 die Verpflichtung zur Abgabe von Emissionszertifikaten um ein Jahr verschoben wird. Er wird in zwei Phasen unterteilt:
1. Einführungsphase ab dem 1. Oktober 2022 bis zum 31. Dezember 2024
2. Überführungsphase ab dem 1. Jänner 2025““
V. Die bisherige Novellierungsanordnung „7“ wird mit „19.“ beziffert und lautet wie folgt:
„19. § 22 wird wie folgt geändert:
a) In Abs. 1 entfällt im ersten Satz die Wortfolge „in der Fixpreisphase gemäß § 9 Z 1“ und in Z 15 tritt an die Stelle des Verweises „§ 3 Abs. 2 Z 3“ der Verweis § 3 Abs. 3.
b) In Abs. 2 wird die Wortfolge samt Satzzeichen „, sofern keine pauschale Vergütung vorgesehen ist. Für Erdgas hat eine Aufschlüsselung zwischen der vom Antragsteller selbst bezogenen Menge an Erdgas und Erdgas, welches von den zurechenbaren diplomatischen oder konsularischen Vertretern bezogen worden ist, zu erfolgen. Die Berechnung der Höhe“ durch die Wortfolge samt Satzzeichen „. Als Berechnungs-
grundlage für die Inanspruchnahme der Befreiung für Erdgas ist immer jene Jahresabrechnung heranzuziehen, welche im jeweiligen Kalenderjahr endet. Diplomatische oder konsularische Vertreter können Erdgas nur in Form einer pauschalen Rückvergütung erhalten. Die Auszahlung“ ersetzt.“
VI. Vor der Ziffer 19 wird die folgende Ziffer 7 eingefügt:
„7. Die Überschrift zu § 10 lautet:
„Ausgabewert von nationalen Emissionszertifikaten““
VII. Die bisherigen Novellierungsanordnungen „8, 9, 10 und 11“ werden mit „26, 27, 28 und 30“ beziffert und lauten wie folgt:
„26. In § 29 wird folgender Abs. 5 angefügt:
„(5) Bei der Überprüfung von Anträgen kann sich die zuständige Behörde der Einrichtungen der Finanzverwaltung gemäß § 49 BAO im Rahmen ihres jeweiligen gesetzmäßigen Wirkungsbereiches gemäß Art. 22 Bundes-Verfassungsgesetz, BGBl. Nr. 1/1930, in der Fassung BGBl. I Nr. 5/2024 bedienen.“
27. § 30 samt Überschrift lautet:
„Gebührenbefreiung
§ 30. (1) Die durch dieses Bundesgesetz unmittelbar veranlassten Schriften und Amtshandlungen sind von den Stempel- und Rechtsgebühren und den Verwaltungsabgaben des Bundes befreit.
(2) Kosten, die der zuständigen Behörde durch die Beiziehung des Umweltbundesamtes erwachsen, sind dem Handelsteilnehmer durch Bescheid vorzuschreiben.“
28. In § 32 Abs. 1 entfallen die Wortfolge „und in der Marktphase gemäß § 9 Z 2 in Höhe von 125 Euro“ und der Wortteil „äquivalent“.
30. § 34 wird wie folgt geändert:
a) Abs. 2 lautet:
„(2) Die §§ 20 und 25 bis 27 sowie Anlage 2 treten mit Ablauf des Tages, an dem die beihilferechtlichen Voraussetzungen vollständig erfüllt sind, frühestens jedoch mit 1. April 2022 in Kraft. Liegen die Voraussetzungen nach dem 1. Oktober 2022 vor, treten die §§ 20 und 25 bis 27 rückwirkend mit Ablauf des 30. September 2022 in Kraft. § 22 Abs. 1 Z 15 tritt gemäß § 8 Abs. 5 Erdgasabgabegesetz am ersten Tag des zweitfolgenden Monats nach der Erfüllung EU-rechtlicher Verpflichtungen in Kraft.“
b) In Abs. 4 wird der Verweis „Anlage 1 und 2“ durch den Verweis „Anlage 1 und 2“ ersetzt.
c) Dem Abs. 5 wird folgender Abs. 6 angefügt:
„(6) § 1, § 2 Abs. 1, § 3 Abs. 1 Z 1, 2, 3, 8, 12, 13 und 14, §§ 4 bis 7 samt Überschriften, § 8, § 9, die Überschrift des § 10, § 12 Abs. 1, § 13 Abs. 4 und 5, § 14 Abs. 1 Z 1, § 15 Abs. 4, die Überschrift des 5. Abschnittes, § 16 Abs. 1 und 2, § 17 samt Überschrift, § 18, § 19 samt Überschrift, § 20 Abs. 1 samt Überschrift, § 22 Abs. 1 und 2, § 23 Abs. 1, § 28, § 29 Abs. 5, § 30 samt Überschrift, § 32 Abs. 1, § 33 Abs. 2 und 3, § 34 Abs. 2 und 4 sowie die Anlagen 1 und 3, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2023, treten mit 1. Juni 2024 in Kraft.““
VIII. Vor Ziffer 19 werden folgende Ziffern 8 bis 18 eingefügt:
„8. § 12 Abs. 1 lautet:
„(1) Handelsteilnehmer können nationale Emissionszertifikate für ein Kalenderjahr ab Bekanntgabe des Bescheides über den vereinfachten Treibhausgasemissionsbericht dieses Kalenderjahres bis zum Ablauf eines Monates ab Bekanntgabe des Bescheides bei der zuständigen Behörde erwerben oder im Falle der Nichtverwendung zurückgeben.“
9. In § 13 erhält der bisherige Abs. 4 die Absatzbezeichnung „(5)“ und nach dem Abs. 3 wird folgender Abs. 4 eingefügt:
„(4) Netzbetreiber als Haftende gemäß § 4 Abs. 2 Erdgasabgabegesetz, die in der Einführungsphase Handelsteilnehmer sind, müssen den Lieferern von Erdgas bis spätestens 15. August 2024 mitteilen, dass mit dem Beginn der Überführungsphase am 1. Jänner 2025 die Netzbetreiber nicht mehr anstelle der Lieferer des Erdgases als Handelsteilnehmer gelten.“
10. In § 14 Abs. 1 Z 1 wird die Wortfolge „des NEHG 2022“ durch die Wortfolge „dieses Bundesgesetzes“ ersetzt.
11. In § 15 Abs. 4 wird der Verweis „§ 6 Abs. 4“ durch „§ 6 Abs. 5“ ersetzt.
12. Die Überschrift des 5. Abschnitts lautet:
„Überführungsphase“
13. § 16 Abs. 1 und 2 lauten:
„(1) Handelsteilnehmer können nationale Emissionszertifikate für ein Kalenderjahr ab Bekanntgabe des Bescheids über den Treibhausgasemissionsbericht dieses Kalenderjahrs im Folgejahr bis zum Ablauf eines Monates ab Bekanntgabe des Bescheides bei der zuständigen Behörde erwerben oder im Falle der Nichtverwendung zurückgeben.
(2) Nationale Emissionszertifikate sind einem Kalenderjahr zugeordnet, welches sich nach dem Ausgabewert gemäß § 10 Abs. 1 richtet. Sie können nur für Treibhausgasemissionen dieses Kalenderjahres abgegeben werden.“
14. § 17 samt Überschrift lautet:
„Nationales Emissionszertifikatehandelsregister
§ 17. (1) Als nationales Emissionszertifikatehandelsregister in der Überführungsphase gilt die Gesamtheit aller Konten von Handelsteilnehmern im Register gemäß § 43 EZG 2011.
(2) Liegt für einen Handelsteilnehmer am 1. Mai 2024 eine aufrechte Registrierung jedoch kein genehmigter Überwachungsplan (§ 7) vor oder fehlen Angaben gemäß § 4
Abs. 2 und beabsichtigt er nach dem 1. Jänner 2025 Energieträger in Verkehr zu bringen, hat er bei der zuständigen Behörde bis zum 30. August 2024 einen Überwachungsplan oder die Angaben nachzureichen; dabei sind § 4 und 7 sinngemäß anzuwenden. Die zuständige Behörde hat die im Nationalen Emissionszertifikatehandel Informationssystem erfassten Daten bis 1. Juni 2024 als Vorlage für einen Antrag auf Registrierung (§ 4) bereitzustellen. Der Handelsteilnehmer hat die Daten zu prüfen, fehlende Daten zu ergänzen und anschließend den vervollständigten Antrag auf Registrierung bis zum 30. August 2024 einzureichen, es sei denn, die zuständige Behörde hat für diese Einreichung eine andere Frist gesetzt.“
15. § 18 samt Überschrift lautet:
„Vorauszahlungen in der Überführungsphase
§ 18. (1) Handelsteilnehmer haben in der Überführungsphase Vorauszahlungen zu entrichten. Auf Basis des Überwachungsplans gemäß § 7 Abs. 1 ist die Höhe der Vorauszahlungen jährlich zu ermitteln. Die Vorauszahlung für ein Kalenderjahr ergibt sich aus der Höhe der zu erwartenden Treibhausgasemissionen gemäß § 7 Abs. 1 und dem Ausgabewert von nationalen Emissionszertifikaten im jeweiligen Kalenderjahr nach § 10 Abs. 1. § 217 BAO ist nicht anwendbar.
(2) Die Vorauszahlungen sind zu je einem Viertel bis zum 15. Juni, 15. September und 15. Dezember des betreffenden Kalenderjahres und bis zum 15. März des Folgejahres durch die zuständige Behörde vorzuschreiben. Die ermittelte Vorauszahlung für das Kalendervierteljahr ist bis zum Ablauf eines Monats ab Vorschreibung durch die zuständige Behörde durch den Handelsteilnehmer zu entrichten.
(3) Erweist sich die Höhe der Vorauszahlungen als voraussichtlich nicht richtig, kann gemäß § 201 BAO die Höhe der Vorauszahlungen abgeändert werden. Der Antrag kann längstens bis zur Abgabe des Treibhausgasemissionsberichts (§ 6) gestellt werden.“
16. Die Abschnittsbezeichnung und Abschnittsüberschrift des 6. Abschnittes entfallen.
17. Es entfällt die Überschrift des § 19 und § 19 lautet:
„§ 19. Die Überführungsphase wird bis zum 31. Dezember jenes Jahres fortgesetzt, das vor dem Jahr liegt, für welches Emissionszertifikate gemäß dem 8. Abschnitt EZG 2011 abgegeben werden müssen. Der Ausgabewert für nationale Emissionszertifikate beträgt im Fall der Fortsetzung den in § 10 für das Jahr 2025 festgesetzten Wert. Die Bestimmungen der Überführungsphase sind in der letztgültigen Fassung weiterhin anzuwenden.“
18. § 20 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift lautet:
„Berücksichtigung des EU ETS I“
b) Abs. 1 lautet:
„(1) Zur Vermeidung von Doppelbelastungen sind Handelsteilnehmer in Bezug auf Energieträger, die zu Heizzwecken verwendet und an Unternehmen geliefert werden, deren Anlagen dem Geltungsbereich des EZG 2011 unterliegen, von der Verpflichtung zur Abgabe von nationalen Emissionszertifikaten gemäß §§ 11, 14 und 15 befreit. Die Befreiung gilt für jene Treibhausgasemissionen, für die sowohl eine Verpflichtung zur Abgabe von nationalen Emissionszertifikaten als auch zur Abgabe von Emissionszertifikaten nach EZG 2011 besteht. Abweichend davon sind von der Befreiung auch jene Treibhausgasemissionen aus Energieträgern, die zu Heizzwecken verwendet werden, erfasst, für die gemäß Art. 12 Abs. 3a und 3b der Richtlinie 2003/87/EG keine Verpflichtung zur Abgabe von Emissionszertifikaten nach EZG 2011 besteht.““
IX. Nach Ziffer 19 werden folgende Ziffern 20 bis 25 angefügt:
„20. In § 23 Abs. 1 entfällt die Wortfolge „in der Fixpreisphase gemäß § 9 Z 1“.
21. § 24 wird wie folgt geändert:
a) Abs. 2 lautet:
„(2) Die Gewährung der Entlastungsmaßnahmen gemäß §§ 25 und 26 erfolgt im Rahmen der budgetären Obergrenzen. Es steht dabei jeweils maximal der in der nachstehenden Tabelle enthaltene Betrag pro Entlastungsmaßnahme für ein Kalenderjahr zur Verfügung:
2022 2023 2024 2025
Land- und Forstwirtschaft 7,5 Mio. Euro 31 Mio. Euro 43 Mio. Euro 53 Mio. Euro
Energieintensive Betriebe und Carbon Leakage 75 Mio. Euro 186 Mio. Euro 225 Mio. Euro 250 Mio. Euro
Übersteigen die insgesamt für eine Entlastungsmaßnahme gemäß §§ 25 und 26 und für das Kalenderjahr beantragten Entlastungssummen den oben genannten Betrag, wird den Antragstellern der zu vergütende Betrag aliquot bis zu einem Gesamtbetrag der Entlastung von der oben genannten Summe gekürzt.“
b) Der bisherige Abs. 5 erhält die Absatzbezeichnung „(6)“ und es wird folgender Abs. 5 eingefügt:
„(5) Die Gewährung der Entlastungsmaßnahmen ist ausgeschlossen für
1. Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß den Leitlinien der Europäischen Kommission für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten (ABl. C 249 vom 31.7.2014, S. 1) und
2. Unternehmen, die einer Rückforderungsanordnung aufgrund einer früheren Kommissionsentscheidung zur Feststellung der Rechtswidrigkeit oder Unvereinbarkeit einer Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt gemäß Kapitel III der Verordnung (EU) 2015/1589 des Rates vom 13. Juli 2015 über besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 248 vom 24.9.2015, S. 9) nicht Folge geleistet haben.“
22. § 25 wird wie folgt geändert:
a) Abs. 1 wird nach der Wortfolge „gemäß Anlage 1“ die Wortfolge „oder Anlage 3“ eingefügt.
b) In Abs. 3 wird der Betrag „10,50“ durch den Betrag „9,75“ ersetzt.
23. § 26 samt Überschrift lautet:
„Energieintensive Betriebe und Carbon Leakage
§ 26. (1) Energieintensive Betriebe können zur Vermeidung von Carbon Leakage, Erhaltung der grenzüberschreitenden Wettbewerbsfähigkeit oder zur Vermeidung von besonderen Härtefällen bei der zuständigen Behörde für ein Kalenderjahr (Wirtschaftsjahr) einen Antrag auf anteilige Entlastung der Mehrbelastung stellen. Die Höhe der gewährten Entlastung wird von der zuständigen Behörde unter Berücksichtigung einer allfälligen Aliquotierung gemäß § 24 Abs. 2 NEHG 2022 durch Bescheid festgestellt. Der Bescheid ist unter der Auflage zu erlassen, dass die erforderliche Reinvestition (Abs. 9) nachgewiesen wird.
(2) Ein energieintensiver Betrieb liegt vor, wenn die entrichteten Energieabgaben und Kosten der nationalen Emissionszertifikate für die in Anlage 1 genannten Energieträger, die für Heizzwecke verwendet wurden, für ein Kalenderjahr (Wirtschaftsjahr) 0,5 Prozent des Unterschiedsbetrages zwischen
1. Umsätzen im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 und 2 des Umsatzsteuergesetzes 1994 – UStG 1994, BGBl. Nr. 663/1994 in der Fassung BGBl. I Nr. 201/2023 und
2. Umsätzen im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 und 2 des UStG 1994, die an das Unternehmen erbracht werden,
übersteigen (Nettoproduktionswert).
(3) Als Umsätze im Sinne von Abs. 2 Z 2 gelten auch Umsätze, die, wären sie im Inland erbracht worden, Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 und 2 des UStG 1994 wären und im Zusammenhang mit steuerbaren Umsätzen stehen.
(4) Der umsatzsteuerliche Betriebsbegriff des Bundesgesetzes über die Vergütung von Energieabgaben (Energieabgabenvergütungsgesetz, BGBl. Nr. 201/1996), ist sinngemäß anwendbar. Ist ein selbstständiger Teilbetrieb des Entlastungsmaßnahmenteilnehmers entlastungsfähig, ist zur Ermittlung der entlastungsfähigen Menge an Energieträgern jene Menge an Energieträgern heranzuziehen, die für diesen Teilbetrieb bezogen wurden. Die Menge an Energieträgern, die weder dem entlastungsfähigen Teilbetrieb, noch den übrigen Teilbetrieben zuzuordnen ist (insbesondere Verwaltungsräumlichkeiten), ist anhand des Verhältnisses der Treibhausgasemissionen aus Energieträgern des entlastungsfähigen Teilbetriebs zu den Treibhausgasemissionen aus Energieträgern (abzüglich jenen der nicht zuordenbaren Mengen) der nicht entlastungsfähigen Teilbetriebe des Entlastungsmaßnahmenteilnehmers aufzuteilen.
(5) Entlastungsfähig sind jene Mengen an Energieträgern, die für Heizzwecke verwendet wurden und auf Grund das vorliegende Bundesgesetz endgültig belastet wurden. Nicht entlastungsfähig sind jedenfalls jene Mengen an Energieträgern, die keiner endgültigen Belastung des vorliegenden Bundesgesetzes unterlagen, insbesondere
1. für die eine Befreiung nach dem 7. Abschnitt dieses Bundesgesetz in Anspruch genommen wird,
2. die durch den Betrieb weitergegeben oder
3. die vor dem 1. Oktober 2022 in den Verkehr gebracht wurden.
Für jeden Betrieb oder Teilbetrieb ist die Höhe der Entlastung gesondert zu ermitteln.
(6) Energieintensiven Betrieben wird die Mehrbelastung (§ 24 Abs. 1) zu 45 Prozent entlastet. Für die Ermittlung der Mehrbelastung ist die entlastungsfähige Menge an Energieträgern mit dem Emissionsfaktor gemäß Anlage 1 und dem Ausgabewert des Kalenderjahres der Lieferung der Energieträger zu multiplizieren. Die Mehrbelastung ermittelt sich exklusive der Umsatzsteuer, welche für die verwendeten Energieträger entrichtet wurde.
(7) Für Betriebe, die einem Wirtschaftszweig oder Teil eines Wirtschaftszweiges gemäß Anlage 2 zugeordnet sind, erhöht sich das Ausmaß der Entlastung gemäß § 26 Abs. 6 auf den in Anlage 2 angegebenen Prozentsatz.
1. Liegt eine Klassifikation der Wirtschaftstätigkeit der Bundesanstalt „Statistik Österreich“ für den Betrieb vor, ist diese für die Zuordnung zu einem Wirtschaftszweig zu verwenden, sofern keine falsche Klassifikation vorgenommen wurde. Liegt keine Klassifikation der Wirtschaftstätigkeit vor, ist die Zuordnung zu einem Wirtschaftszweig nach NACE-Klassifikation anhand des wirtschaftlichen Schwerpunktes durch den Betrieb gemäß der Methodik der Statistik Austria nachzuweisen.
2. Die Zuordnung eines Betriebes zu einem Teilwirtschaftszweig, definiert als Kategorie der PRODCOM-Klassifikation, ist durch den Betrieb anhand der Methodik der Statistik Austria nachzuweisen.
Die Statistik Austria hat der zuständigen Behörde auf Anfrage Daten über die Zuordnung des antragstellenden Unternehmens zu einem Wirtschaftszweig oder Teilwirtschaftszweig zur Verfügung zu stellen.
(8) Ist ein Wirtschaftszweig nicht in Anlage 2 angeführt, hat unter Maßgabe der Z 1 bis 4 eine nachträgliche Anerkennung als entlastungsfähiger Wirtschaftszweig zu erfolgen. Wird die nachträgliche Anerkennung durch ein betroffenes Unternehmen oder eine gesetzliche Interessenvertretung angeregt, haben diese zur Feststellung der Carbon Leakage Gefährdung den nationalen Carbon Leakage Indikator (NCLI) zu ermitteln und samt den zugrundeliegenden Daten und Berechnungen bekanntzugeben und auf Aufforderung nachzuweisen. Die Anregung ist bei der zuständigen Behörde einzureichen.
Der Bundesminister für Finanzen hat im Einvernehmen mit der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Z 2 bis 4 die nachträgliche Anerkennung als entlastungsfähiger Wirtschaftszweig festzustellen und im Bundesgesetzblatt kundzumachen. Die
Anerkennung gilt ab jenem Kalenderjahr, ab dem eine entsprechende Carbon Leakage Gefährdung nachgewiesen wird.
1. Der NCLI ergibt sich aus dem Produkt der Handelsintensität und der Emissionsintensität eines Wirtschaftszweiges.
2. Bei der Handelsintensität handelt es sich um den Quotienten aus
– den Exporten in Euro zuzüglich der Importe in Euro und
– dem Umsatz in Euro zuzüglich der Importe in Euro
des jeweiligen Wirtschaftszweiges.
3. Bei der Emissionsintensität handelt es sich um den Quotienten aus
– den Treibhausgasemissionen in kg CO2e aus Energieträgern laut Anlage 1 des NEHG 2022 und
– der Bruttowertschöpfung in Euro
des jeweiligen Wirtschaftszweiges.
4. Als entlastungsfähig ist ein Wirtschaftszweig bei einem NCLI von über 0,2 anzuerkennen. Der Kompensationsgrad beträgt abhängig von der Emissionsintensität:
Emissionsintensität (kg CO2e pro Euro Bruttowertschöpfung) Kompensationsgrad
bis zu 0,3 65 %
mehr als 0,3 bis zu 0,6 70 %
mehr als 0,6 bis zu 0,9 75 %
mehr als 0,9 bis zu 1,2 80 %
mehr als 1,2 bis zu 1,5 85 %
mehr als 1,5 bis zu 1,8 90 %
mehr als 1,8 95 %
5. Die Statistik Austria hat der zuständigen Behörde auf Anfrage Daten zur Berechnung der Handels- und Emissionsintensität zur Verfügung zu stellen. Dies gilt auch für personen- und unternehmensbezogene Daten im Sinne des § 17 Bundesstatistikgesetz 2000, BGBl. I Nr. 163/1999 in der Fassung BGBl. I Nr. 185/2022.
(9) Die gewährte Entlastung ist zu mindestens 80 Prozent in Klimaschutzmaßnahmen innerhalb des betreffenden Betriebs oder Teilbetriebs, etwa zur Umsetzung von anrechenbaren Energieeffizienzmaßnahmen gemäß Bundes-Energieeffizienzgesetz – EEffG, BGBl. I Nr. 72/2014 in der jeweils geltenden Fassung , zu investieren (Reinvestition). Davon abweichend beträgt der Anteil in der Einführungsphase 50 Prozent.
1. Mittlere und große Unternehmen gemäß EEffG sowie Unternehmen mit einem durchschnittlichen jährlichen Energieverbrauch von mehr als 10 Terajoule, in den vorgegangenen 3 Jahren die eine Entlastung erhalten, sind zur Durchführung eines Energieaudits oder zur Einrichtung eines anerkannten Managementsystems jeweils gemäß dem 3. Abschnitt des 3. Teiles des EEffG, verpflichtet.
2. Klimaschutzmaßnahmen sind jene Maßnahmen, die innerhalb des Betriebs oder Teilbetriebs zu einer Verringerung des Ausstoßes von Treibhausgasen oder zur Verringerung des Energieverbrauchs führen. Maßnahmen die zu einer Erhöhung des Treibhausgasausstoßes führen sind ausgeschlossen. Dies ist durch schlüssige Begründung darzulegen.
3. Der Betrieb oder Teilbetrieb hat der zuständigen Behörde die Umsetzung der getroffenen Klimaschutzmaßnahmen regelmäßig nachzuweisen. Als Mindestanforderung für die umzusetzenden Klimaschutzmaßnahmen sind jene Empfehlungen aus einem Energieaudit- oder Managementsystem-Berichtes umzusetzen, die sich innerhalb einer Frist von drei Jahren amortisieren, und die
Umsetzungskosten insgesamt nicht höher sind als die gewährte Entlastung. Kann der Nachweis nicht erbracht werden, hat es die gewährte Entlastung zu refundieren.
4. Der Nachweis über die Erfüllung des Investitionserfordernisses hat innerhalb von 12 Monaten ab Auszahlung zu erfolgen. Erstreckt sich die Umsetzung eine Klimaschutzmaßnahme über einen längeren Zeitraum, kann die Frist bis zum Nachweis der Umsetzung der Klimaschutzmaßnahme auf Antrag verlängert werden. Sofern eine Klimaschutzmaßnahme das geforderte Reinvestitionserfordernis überschreiten, kann diese auf spätere Reinvestitionserfordernisse aus gewährten Entlastungen angerechnet werden.
5. Wird die Reinvestition nicht innerhalb der gesetzten Frist nachgewiesen, ist die Entlastung zurückzuzahlen. Die zurückbezahlten Entlastungen entfalten keine Wirkungen auf eine allfällig gekürzte Entlastungssumme gemäß § 24 Abs. 2 NEHG 2022 und führen zu keiner Erhöhung der Budgetobergrenzen der Folgejahre.
(10) Der Antrag für die Entlastungsmaßnahme für „Energieintensive Betriebe und Carbon Leakage“ ist für das vorangegangene Kalenderjahr (Wirtschaftsjahr) ab 1. Mai des Folgejahres bis zum 30. Juni des Folgejahres bei der zuständigen Behörde elektronisch einzubringen. Abweichend davon, kann im Jahr 2024 ab 1. Oktober 2024 bis zum 30. November 2024 der Antrag für 2022 und 2023 eingebracht werden.
1. Nach Einlangen aller Anträge hat die zuständige Behörde die Gesamtsumme der Vergütung zu ermitteln und gegebenenfalls eine aliquote Kürzung der auszuzahlenden Beträge zur Einhaltung der Obergrenze (§ 24 Abs. 2) durchzuführen. Nach dem Ende des Antragszeitraumes können keine Anträge mehr für ein Kalenderjahr (Wirtschaftsjahr) gestellt werden. Unvollständige Anträge sind nicht zu berücksichtigen.
2. Der Antrag auf Entlastung ist von einem Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Bilanzbuchhalter sowohl auf die formelle als auch inhaltliche Richtigkeit der Angaben zu prüfen.
3. Der Antrag hat insbesondere folgende Angaben zu enthalten:
– Angabe der gewünschten Entlastungsmaßnahme;
– Name und Anschrift des Antragstellers (Entlastungsmaßnahmenteilnehmer);
– der Betrieb oder Teilbetrieb, für den eine Entlastung beantragt wird
– Nachweis der Antragsberechtigung der Entlastungsmaßnahme;
– Zuordnung zu einem Wirtschafts- oder Teilwirtschaftszweig und
– der Prüfvermerk eines Steuerberaters, Wirtschaftsprüfers oder Bilanzbuchhalters.
(11) Die Gebarung der Entlastungssumme für Zwecke des NEHG 2022 ist im Sinne des § 213 Abs. 2 Bundesabgabenordnung – BAO, BGBl. Nr. 194/1961 in der Fassung BGBl. I Nr. 201/2023 gesondert von anderen Abgaben zu verbuchen.
(12) Der Bundesminister für Finanzen kann im Einvernehmen mit der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie die nähere Ausgestaltung der Entlastung, insbesondere zur Festlegung der Kriterien zur Beurteilung einer nachträglichen Anerkennung als beihilfeberechtigten Wirtschaftszweig, der Ermittlung der Emissionsmenge sowie die Berücksichtigung der Maßnahmen nach dem EEffG und die Investition der finanziellen Entlastung in Klimaschutzmaßnahmen, Kriterien für die Anerkennung von Klimaschutzmaßnahmen und deren Berichtslegung durch Verordnung regeln. Die Festlegung der Kriterien für eine nachträgliche Anerkennung gemäß Abs. 8 hat unter Maßgabe der unionsrechtlichen Vorgaben für die Zuteilung von Gratiszertifikaten, insbesondere nach Art. 10b der Richtlinie 2003/87/EG, zu erfolgen.“
24. § 27 samt Überschrift lautet:
„Beihilfenrechtliche Transparenzbestimmung
§ 27. (1) Die Entlastungsmaßnahmen des 8. Abschnittes sind auf Art. 44 AGVO gestützt und basieren im Falle des
– § 25 auf Art. 8;
– § 26 auf Art. 17
der Richtlinie 2003/96/EG vom 27.10.2003 zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom, ABl. L 283 vom 30.10.2003 S. 51 (Energiebesteuerungsrichtlinie).
(2) Der Bundesminister für Finanzen stellt die Erfüllung der beihilferechtlichen Anforderungen, insbesondere die Veröffentlichung nach Art. 9 der AGVO sowie die Berichterstattung an die Europäische Kommission nach Art. 11 der AGVO, in geeigneter Form sicher. Eine externe Stelle (§ 24 Abs. 3) ist zur Bereitstellung der notwendigen Daten verpflichtet, sofern ihr nicht die Erfüllung der beihilferechtlichen Anforderungen übertragen wurde.“
25. § 28 wird wie folgt geändert:
a) In Abs. 1 entfällt die Wortfolge „im Zeitraum der Fixpreisphase gemäß § 9 Z 1“.
b) Abs. 2 entfällt und der bisherige Abs. 3 erhält die Absatzbezeichnung „(2)“.“
X. Nach Ziffer 28 und vor Ziffer 30 wird folgende Ziffer 29 eingefügt:
„29. In § 33 entfällt der Abs. 2 und der bisherige Abs. 3 erhält die Absatzbezeichnung „(2)“.“
XI. Nach Ziffer 30 werden folgende Ziffern 31 bis 33 angefügt:
„31. Die Überschrift der Anlage 1 lautet:
„Anlage 1
Energieträger in der Einführungsphase““
32. In der Anlage 1 wird nach der Wortfolge „Folgende Stoffe gelten als Energieträger im Sinne des § 3 Abs. 1 Z 1“ die Wortfolge „in der Einführungsphase“ eingefügt.
33. Nach Anlage 2 wird folgende Anlage 3 samt Überschrift angefügt:
„Anlage 3
Als Energieträger in der Überführungsphase gelten folgende Energieerzeugnisse
a) der KN-Codes 1507 bis 1518, die als Heiz- oder Kraftstoff verwendet werden;
b) der KN-Codes 2701, 2702 und 2704 bis 2715;
c) der KN-Codes 2901 bis 2902;
d) des KN-Codes 2905 11 00, die nicht von synthetischer Herkunft sind und die als Heiz- oder Kraftstoff verwendet werden;
e) des KN-Codes 3403;
f) des KN-Codes 3811;
g) des KN-Codes 3817;
h) des KN-Codes 3824 90 99, die als Heiz- oder Kraftstoff verwendet werden.
Zusätzlich zu den in der Tabelle genannten Brennstoffen gelten alle anderen Energieerzeugnisse, die als Kraft- oder Heizstoff wie die Energieerzeugnisse gemäß a) – h) zum Verkauf angeboten oder als solche verwendet werden als Energieerzeugnisse.““
Begründung
Die Richtlinie (EU) 2023/959 vom 10. Mai 2023 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Union und des Beschlusses (EU) 2015/1814 über die Einrichtung und Anwendung einer Marktstabilitätsreserve für das System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Union sieht die Einführung eines neuen eigenständigen Emissionshandelssystems (EU ETS II) für die Sektoren Gebäude, Verkehr sowie für Unternehmen, die nicht dem EU ETS I unterliegen (insbesondere Industrie und Stromerzeugung) vor. Die Vorgaben dieser Richtlinie werden durch eine Änderung des Emissionszertifikategesetzes 2011 – EZG 2011, BGBl. I Nr. 118/2011, durch das BGBl. I Nr. 196/2023 umgesetzt. Dadurch werden Änderungen des Nationalen Emissionszertifikatehandelsgesetzes 2022 – NEHG 2022, BGBl. I Nr. 10/2022 notwendig, weil bei dessen Einführung bereits eine Überführung in ein allfälliges europäisches Handelssystem für die umfassten Sektoren in Aussicht gestellt wurde. Mit dieser Novelle des NEHG 2022 sollen die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, das NEHG 2022 in den EU ETS II zu überführen und diese Überführung für die betroffenen Handelsteilnehmer verwaltungsarm und reibungslos sicherzustellen.
Im Zuge der ökosozialen Steuerreform und der Einführung einer nationalen Bepreisung von Treibhausgasemissionen wurden im 8. Abschnitt des NEHG 2022 drei Entlastungsmaßnahmen für verschiedene betroffene Unternehmen implementiert. Da es sich bei diesen Maßnahmen um Beihilfen handelt, war nach ursprünglicher Einschätzung für die rechtskonforme Anwendung der Entlastungsmaßnahmen eine beihilferechtliche Genehmigung der Europäischen Kommission (DG COMP) erforderlich. Im Rahmen des beihilferechtlichen Verfahrens wurde nach eingehender Prüfung und Einbeziehung der DG TAXUD die Rechtsansicht von der Europäischen Kommission entwickelt, dass für die beihilferechtliche Beurteilung der Entlastungsmaßnahmen im NEHG 2022 der beihilferechtlichen Referenzrahmen der Energiebesteuerungsrichtlinie – ETD (2003/96 EG) einschlägig sei. Um die notwendige Konformität mit der ETD herzustellen, sind Anpassungen der
Entlastungmaßnahmen erforderlich, die mit der vorliegenden Novelle umgesetzt werden sollen.
Die Carbon Leakage Regelung soll mit der Härtefallregelung verschmolzen werden und – ähnlich der bereits bestehenden und bewährten Energieabgabenvergütung (Energieabgabenvergütungsgesetz, BGBl. Nr. 201/1996) – energieintensiven Betrieben offenstehen. Durch das Aufsetzen auf das bereits bestehende System der Energieabgabenvergütung sollen die Maßnahmen wesentlich vereinfacht und gleichzeitig die Unionsrechtskonformität sichergestellt werden. Um den rechtlichen Anforderungen der ETD zu genügen, soll diese angepasste Maßnahme nur für Energieträger zur Verfügung stehen, die für Heizzwecke verwendet werden.
Zu Z 1 (§ 1):
Ziel der Novelle soll die Überführung der nationalen CO2-Bepreisung, geregelt im NEHG 2022, in das neue europäische Emissionshandelssystem für den Gebäude- und Straßenverkehrssektor sowie für andere Sektoren (EU ETS II) sein. In § 1 soll klargestellt werden, dass die Überführung in das europäische System, welches im EZG 2011 durch die Novelle BGBl. I Nr. 196/2023 national umgesetzt wurde, ab dem Jahr 2027 erfolgen soll. Ab dem Jahr 2025 sollen dazu bereits die Berichtspflichten des NEHG 2022 an jene des EU ETS II angeglichen werden, um einen verwaltungseffizienten gleichzeitigen Vollzug des NEHG 2022 und des EZG 2011 sicherzustellen. Hintergrund für die Angleichung ist der Start der ersten Berichtspflichten durch den EU ETS II ab dem Jahr 2025.
Zum besseren Verständnis und um eine klare Abgrenzung zwischen den zwei europäischen Emissionshandelssystemen vorzunehmen, soll nun sprachlich zwischen „EU ETS I“ und „EU ETS II“ unterschieden werden.
Zu Z 3 (§ 3 Abs. 1 Z 1, 2, 3, 8, 12, 13 und 14):
In § 3 sollen durch die Novelle Anpassungen und zusätzliche Begriffsdefinitionen, welche sich aus dem EU ETS II und dem europäischen Beihilferecht ergeben, ergänzt
werden. Außerdem soll der Begriff „Energieträger“ ab dem Jahr 2025 an den Energieträgerbegriff des EU ETS II angeglichen werden.
Zu Z 4 a und b (§ 6 Abs. 7 und § 7 Abs. 6):
Hier soll ein Redaktionsversehen korrigiert werden.
Zu Z 6 (§ 9):
Durch die Novelle sollen auch die Handelsphasen des NEHG 2022 auf jene des EU ETS II abgestimmt werden. Die Einführungsphase soll bis zum 31. Dezember 2024 verlängert werden. Ab dem 1. Jänner 2025 soll eine Überführungsphase für das NEHG 2022 vorgesehen werden. In der Überführungsphase sollen die Berichtspflichten mit jenen des EU ETS II gleichgeschalten werden, um zu verhindern, dass Handelsteilnehmer ein Doppelreporting machen müssen. Ab dem Jahr 2027 soll die nationale CO2-Bepreisung durch den EU ETS II ersetzt werden. Sollte durch die Europäische Kommission eine einjährige Verschiebung des EU ETS II inklusive der erstmaligen Abgabe der Emissionszertifikate erfolgen, soll die Überleitung in das EU ETS II System mit 31. Dezember 2027 stattfinden.
Zu Z 7 (§ 10):
Durch die Novelle soll sich die Überschrift des § 10 nicht mehr nur auf die Einführungsphase beziehen.
Zu Z 8 (§ 12):
Die Frist für den Erwerb und Rückgabe von nationalen Emissionszertifikaten soll künftig in der Einführungsphase bis zum Ablauf eines Monates ab Bekanntgabe des Bescheides erfolgen.
Zu Z 9 (§ 13):
Mit der Überführungsphase sollen Netzbetreiber als Haftende gemäß § 4 Abs. 2 Erdgasabgabegesetz nicht mehr als Handelsteilnehmer im NEHG 2022 gelten, um einen Gleichklang mit dem EZG 2011 sicherzustellen. Um einen reibungslosen
Übergang sicherzustellen, sollen Netzbetreiber bis spätestens 15. August 2024 die Lieferer des Erdgases über den Übergang der Handelsteilnehmereigenschaft informieren.
Zu Z 10 (§ 14):
Es soll eine sprachliche Anpassung vorgenommen werden.
Zu Z 11 (§ 15):
In § 15 Abs. 4 soll der Verweis angepasst werden.
Zu Z 12 (5. Abschnitt):
Durch die Novelle soll die Überschrift an die neue Struktur des EU ETS II herangeführt werden.
Z 13 (§ 16):
Der Erwerb und die Rückgabe von nationalen Emissionszertifikaten soll ab Bekanntgabe des Bescheides über den Treibhausgasemissionsbericht des jeweiligen Kalenderjahres bis zum 31. Mai des Folgejahres bei der zuständigen Behörde möglich sein und damit an die Fristen des EU ETS II angeglichen werden.
Es soll verhindert werden, dass nationale Emissionszertifikate zu einem niedrigeren Ausgabewert auf Vorrat erworben werden können. Deshalb können nationale Emissionszertifikate nur für jenes Kalenderjahr abgegeben werden, in denen der festgelegte Ausgabewert gemäß § 10 Abs. 1 dem Ausgabewert des nationalen Emissionszertifikates entspricht.
Zu Z 14 (§ 17):
Durch die Novelle soll als nationales Emissionshandelsregister in der Übergangsphase die Gesamtheit aller Konten von Handelsteilnehmern im Register nach § 43 EZG 2011 gelten. Dadurch soll das NEHG 2011 an die Konten des EU ETS II anknüpfen, wodurch die doppelte Kontoführung vermieden werden soll.
In Abs. 2 soll festgelegt werden, dass bereits registrierte Handelsteilnehmer, die noch keinen genehmigten Überwachungsplan nach EU ETS II haben, der zuständigen Behörde bis zum 30. August 2024 einen Überwachungsplan vorlegen müssen. Dabei soll jedoch eine vereinfachte Antragstellung wie in § 37 Abs. 3 EZG 2011 zur Anwendung kommen. Demzufolge soll eine vereinfachte Antragstellung für Genehmigungen für Handelsteilnehmer ermöglicht werden, die bereits am 1. Mai 2024 als Handelsteilnehmer im Sinne des NEHG 2022 bei der zuständigen Behörde registriert sind. Um dies zu gewährleisten, soll die zuständige Behörde die bereits vorhandenen Daten nutzen, um automationsunterstützt eine Vorlage für den Antrag auf Erteilung der Genehmigung für die im NEHG registrierten Handelsteilnehmer zu erstellen. Diese Vorlage soll in Folge von den Handelsteilnehmern geprüft und abgegeben werden können. Auf diese Weise soll zusätzlicher administrativer Aufwand sowohl für die zuständige Behörde als auch für die Handelsteilnehmer verhindert werden.
Zu Z 15 (§ 18):
Wie auch bisher soll es auch in der Überführungsphase des NEHG unterjährige Zahlungen geben. Um den Verwaltungsaufwand möglichst gering zu halten, soll die Höhe der Vorauszahlungen automationsunterstützt aus den selbst erklärten Überwachungsplänen und den erwarteten Treibhausgasemissionen der Handelsteilnehmer abgeleitet werden. Geplant ist es, die Vorauszahlungen ausschließlich elektronisch über NEIS abzuwickeln sind. Die Vorauszahlungen sollen vierteljährlich erfolgen und von der zuständigen Behörde vorgeschrieben werden. Sofern sich die Höhe der Vorauszahlungen als voraussichtlich unrichtig herausstellt, weil sich die erwarteten Treibhausgasemissionen unterjährig ändern, kann auf Antrag des Handelsteilnehmers oder durch die zuständige Behörde, die Höhe der Vorauszahlungen abgeändert werden.
Zu Z 16 und Z 17 (§ 19):
In § 19 soll klargestellt werden, dass die Überführungsphase bis zum 31. Dezember jenes Jahres fortgesetzt wird, welches vor dem Jahr liegt, für welches Emissionszertifikate gemäß dem 8. Abschnitt des EZG 2011 abgegeben werden müssen. Im
Fall der Fortsetzung soll der Ausgabewert für nationale Emissionszertifikate den in § 10 für das Jahr 2025 festgelegten Wert betragen.
Zu Z 18 (§ 20 Abs. 1):
In § 20 soll klargestellt werden, dass die Befreiung für die Vermeidung der Doppelbelastung nur für Energieträger zur Verfügung steht, die zu Heizzwecken verwendet werden. Dadurch wird sichergestellt, dass nur jene Mengen an Energieträgern, die in EU ETS Anlagen verwendet und der CO2-Bepreisung durch den EU ETS unterliegen, von der Befreiung umfasst sind. Mit dem letzten Satz soll festgelegt werden, dass keine Verpflichtung zur Abgabe von nationalen Emissionszertifikaten nach EZG 2011 für jene Treibhausgasemissionen besteht, für die Art. 12 Abs. 3a ans 3b der Richtlinie 2003/87/EG (Carbon Capture und Storage sowie Carbon Capture and Utilization) anwendbar ist.
Zu Z 19 lit. a, Z 20, Z 22 lit. a, Z 24, Z 25, Z 27, Z 28 und Z 29 (§ 22 Abs. 1, § 23, § 25 Abs. 1, § 27, § 28, § 30, § 32 und § 33):
Aufgrund der geplanten Anpassung der Handelsphasen und der Angleichung an den EU ETS II sollen Verweise auf die bisherigen Handelsphasen und obsolete Regelungen entfallen.
Zu Z 19 lit. b (§ 22 Abs. 2):
In § 22 Abs. 2 soll klargestellt werden, dass als Grundlage für die Berechnung der Befreiung für Erdgas jene Abrechnungen heranzuziehen sind, welche im jeweiligen Kalenderjahr enden. Zudem sollen Diplomatische oder konsularische Vertreter aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung zukünftig die Befreiung für Erdgas nur in Form einer pauschalen Vergütung erhalten. Ausländische Vertretungsbehörden und internationale Einrichtungen sollen allerdings auch weiterhin von der pauschalen Vergütung ausgenommen sein.
Zu Z 21 (§ 24):
In § 24 Abs. 2 soll eine begriffliche Anpassung für die neuen adaptierten Entlastungsmaßnahmen erfolgen. So soll „Carbon Leakage“ auf „Energieintensive Betriebe und Carbon Leakage“ angepasst werden.
Außerdem sollen die Obergrenzen an die Änderungen im NEHG angepasst werden und die für den Vollzug vorgesehene Zurückbehaltung von Geldmitteln zur Abwicklung von Rechtsmittelverfahren berücksichtigt werden. Dadurch soll es zu keiner Erhöhung der ursprünglichen Budgetmittel, sondern zu einer Umverteilung kommen.
Darüber hinaus soll in § 24 geregelt werden, welche Unternehmen von der Inanspruchnahme der Entlastungen dieses Bundesgesetzes ausgeschlossen sind. Im Sinne des Unionsrechts soll es sich dabei um Unternehmen handeln, die bereits in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken sowie um Unternehmen, die einer Rückforderungsanordnung aufgrund einer Kommissionsentscheidung unterliegen.
Zu Z 22 lit. b (§ 25 Abs. 3):
In § 25 Abs. 3 soll die Änderung der Entlastungssumme pro Liter Gasöl an die Anpassung des Ausgabewertes für Nationale Emissionszertifikate für das Jahr 2023 angeglichen werden (siehe BGBl. II Nr. 460/2022 zur Auslösung des Preisstabilitätsmechanismus gem. § 10 Abs. 3 NEHG 2022).
Zu Z 23 (§ 26):
Durch die Novelle sollen die Carbon Leakage und Härtefall Entlastungsmaßnahme zusammengeführt und angepasst werden. Die neu geschaffene Maßnahme soll zukünftig nicht mehr nur jenen Betrieben offenstehen, die in einem Wirtschaftszweig nach Anlage 2 tätig sind, sondern zusätzlich an die bekannte Systematik der Energieabgabenvergütung angeknüpft werden. Dadurch soll die Inanspruchnahme der Entlastungsmaßnahme für alle energieintensiven Betriebe möglich sein wobei aufgrund der ETD nur Energieträger erfasst sein sollen, die zu Heizzwecken (insbesondere Prozesswärme und Raumheizung) verwendet werden. In diesen Fällen soll 45 Prozent der Mehrbelastung durch das NEHG 2022 entlastet werden. Für
energieintensive Betriebe, die in einem Carbon Leakage gefährdeten Wirtschaftszweig nach Anlage 2 tätig sind, soll sich das Ausmaß der Entlastung auf zwischen 65 und 95 Prozent erhöhen.
In unionsrechtskonformer Auslegung, soll gemäß Abs. 2 der Kreis der Anspruchsberechtigten auf energieintensive Betrieb im Sinne des Artikel 17 der ETD eingeschränkt sein. Dazu soll bei der Bestimmung eines energieintensiven Betriebs auf den Nettoproduktionswert abgestellt werden. Für die Berechnung des Nettoproduktionswerts soll sinngemäß § 1 Abs. 1 des Energieabgabenvergütungsgesetzes BGBl. I Nr. 201/1996 in der Fassung BGBl. I Nr. 46/2022 angewendet werden. Ein energieintensiver Betrieb soll demnach vorliegen, wenn die entrichteten Energieabgaben und Kosten der nationalen Emissionszertifikate für die in Anlage 1 genannten Energieträger, die für Heizzwecke verwendet wurden, für ein Kalenderjahr (Wirtschaftsjahr) 0,5 Prozent des Nettoproduktionswerts übersteigen. Für die Berechnung des Nettoproduktionswertes soll an die Leistungsbegriffe der Umsatzsteuer angeknüpft werden. Zudem soll durch Abs. 3 klargestellt werden, dass auch ausländische Umsätze in die Berechnung miteinzubeziehen sind.
Abs. 4 soll den von der Bestimmung verwendeten Betriebsbegriff näher definieren. Demzufolge soll, wie beim Energieabgabenvergütungsgesetz, der umsatzsteuerliche Betriebsbegriff angewendet werden. Dadurch soll am bewährten System der Energieabgabenvergütung angeknüpft werden. Sofern nicht ein ganzer Betrieb entlastungsfähig ist, soll die Entlastung für selbstständige Teilbetriebe anwendbar sein. Dabei soll jene Menge an Energieträgern entlastungsfähig sein, die für diesen Teilbetrieb bezogen wurde. Die Menge an Energieträgern, die weder dem entlastungsfähigen Teilbetrieb, noch den übrigen Teilbetrieben alleine zuzuordnen ist (insbesondere Verwaltungsräumlichkeiten), soll anhand des Verhältnisses der Treibhausgasemissionen aus Energieträgern des entlastungsfähigen Teilbetriebs zu jenen der nicht entlastungsfähigen Teilbetrieben aufgeteilt werden.
In Abs. 5 soll klargestellt werden, dass nur jene Energieträger entlastungsfähig sind, die zu Heizzwecken verwendet werden. Nicht entlastungsfähig sollen jene Energieträger sein, für die eine Befreiung nach dem 7. Abschnitt dieses Bundesgesetzes in Anspruch
genommen wurde oder die vor dem 1. Oktober 2022 in den freien Verkehr gebracht wurden.
Die Mehrbelastung durch das NEHG 2022 soll für energieintensive Betriebe gemäß Abs. 6 grundsätzlich zu 45 Prozent entlastet werden. Für die Ermittlung der Höhe der Entlastung soll die Menge der Treibhausgase, die bei der Verwendung der entlastungsfähigen Energieträger entstehen, mit dem Ausgabewert für das betroffene Kalenderjahr multipliziert werden.
In Abs. 7 soll festgelegt werden, dass Betriebe die in einem Wirtschaftszweig oder Teil eines Wirtschaftszweigs gemäß Anlage 2 zugeordnet sind, ein höheres Ausmaß der Entlastung zusteht. In Abs. 7 sollen vor allem die näheren Bestimmungen zur Einordnung eines Betriebs zu einem (Teil-)Wirtschaftszweig geregelt werden. Maßgeblich soll zunächst die zeitlich überwiegende Zuordnung im jeweiligen Betrachtungszeitraum sein. Die Einordnung eines Betriebs zu einen (Teil-)Wirtschaftszweig soll „zweistufig“ erfolgen. Zunächst soll geprüft werden, ob der Betrieb in seiner Gesamtheit einem (Teil-)Wirtschaftszweig zugeordnet werden kann. Hat der Betrieb seinen wirtschaftlichen Schwerpunkt in einem Wirtschaftszweig, der von der Carbon Leakage-Regelung erfasst ist, soll die Entlastung für den ganzen Betrieb in Anspruch genommen werden können.
Maßgeblich für den wirtschaftlichen Schwerpunkt in einem Wirtschaftszweig soll die Einordnung nach NACE sein. Diese soll durch den Betrieb mittels der Methode der Statistik Austria bestimmt und nachgewiesen werden – im Zweifel soll hier die Klassifikation der Wirtschaftstätigkeit der Statistik Austria maßgebend sein. Für die Zuordnung zu einem Teilwirtschaftszeig soll die PRODCOM-Klassifikation gemäß der Methodik der Statistik Austria anzuwenden sein.
In Abs. 8 soll geregelt werden, wie das Verfahren rund um die nachträgliche Anerkennung von Wirtschaftszweigen abläuft. Zunächst soll dabei klargestellt werden, dass eine solche nachträgliche Anerkennung, nur für Wirtschaftszweige und nicht für Teilwirtschaftszweige möglich ist.
Maßgebend für die Aufnahme als Wirtschaftszweig in die Anlage 2 des NEHG 2022 soll der Carbon Leakage Indikator (NCLI), der aus Handelsintensität (HI) und Emissionsintensität (EI) besteht, von über 0,2 sein.
Zur Berechnung dieser Faktoren sollen dabei die Daten des gesamten Wirtschaftszweiges nach NACE sein, die durch verschiedene Methoden der Statistik Austria berechnet werden sollen. Anhand der Ergebnisse bei der Ermittlung der Emissionsintensität soll dem aufzunehmenden Wirtschaftszweig auch ein Kompensationsgrad zugewiesen werden.
Bei der Ermittlung der Handels- und Emissionsintensität soll der Durchschnitt der Daten der dem Antrag letztverfügbaren drei Wirtschaftsjahre zu verwenden sein. Dabei sollen die verwendeten Daten einen übereinstimmenden Abdeckungsgrad des betrachteten Sektors in Höhe von mindestens 90% für den gleichen Zeitraum aufweisen und bei eigenständiger Berechnung auf der gleichen darunterliegenden Stichprobe beruhen.
Diese Intensitäten sollen sich wie folgt berechnen:
HI=(Exporte [€]+Importe [€])/(Umsatz [€]+Importe [€] )
Maßgebend sollen alle Exporte und Importe des jeweiligen Wirtschaftszweiges zwischen Österreich und anderen Staaten sein. Zur Berechnung der Höhe der Exporte und Importe sollen Daten der Statistik Austria aus der „Außenhandel nach Unternehmensmerkmalen (TEC)“ Statistik zu verwenden sein. Sollten für einen Wirtschaftszweig keine Daten vorliegen oder nicht aufbereitet werden können oder diese der Geheimhaltung unterliegen, soll zur eigenständigen Berechnung die Methode der Statistik Austria zur Erstellung der „Außenhandel nach Unternehmensmerkmalen (TEC)“ Statistik herangezogen werden.
Maßgebend ist der Umsatz des Wirtschaftszweiges. Zur Berechnung der Höhe des Umsatzes sollen Daten der Statistik Austria aus der der „Konjunkturerhebung im Produzierenden Bereich“ Statistik verwendet werden. Sollten für einen Wirtschaftszweig keine Daten vorliegen oder nicht aufbereitet werden können oder diese der
Geheimhaltung unterliegen, soll zur eigenständigen Berechnung die Methode der Statistik Austria zur Erstellung der „Konjunkturerhebung im Produzierenden Bereich“ Statistik herangezogen werden.
"EI=" ("Treibhausgasemissionen in kg CO2 aus Energieträgern der Anlage 1 des NEHG 2022")/"Bruttowertschöpfung [€]"
Zur Berechnung der Höhe der Treibhausgasemissionen sollen die Daten der Statistik Austria aus der „Gütereinsatz“ Statistik und die entsprechenden Emissionswerte laut Anlage 1 des NEHG 2022 verwendet werden. Sollten für einen Wirtschaftszweig keine Daten vorliegen oder nicht aufbereitet werden können oder diese der Geheimhaltung unterliegen, soll zur eigenständigen Berechnung die Methode der Statistik Austria zur Erstellung der „Gütereinsatz“ Statistik herangezogen werden.
Zur Berechnung der Höhe der Bruttowertschöpfung sollen Daten der Statistik Austria aus der „Leistungs- und Strukturerhebung“ Statistik und die entsprechenden Emissionswerte laut Anlage 1 des NEHG 2022 verwendet werden. Sollten für einen Wirtschaftszweig keine Daten vorliegen oder nicht aufbereitet werden können oder diese der Geheimhaltung unterliegen, soll zur eigenständigen Berechnung die Methode der Statistik Austria zur Erstellung der „Leistungs- und Strukturerhebung“ Statistik herangezogen werden.
Das Reinvestitionserfordernis in Klimaschutzmaßnahmen soll in Abs. 9 geregelt werden. Das Reinvestitionserfordernis soll bei mindestens 80 Prozent liegen. In der Einführungsphase soll das Reinvestitionserfordernis bei 50 Prozent liegen. Der Betrieb soll daher, nach Erhalt der Entlastungssumme, regelmäßig eine gewisse Reinvestition in Klimaschutzmaßnahmen nachweisen müssen.
Unternehmen mit einem durchschnittlichen jährlichen Energieverbrauch von mehr als 10 Terajoule in den vorgegangenen 3 Jahren, die eine Entlastung erhalten, sollen im Sinne des 3. Abschnittes des 3. Teiles des EEffG verpflichtet sein, ein Energieaudit durchzuführen oder ein anerkanntes Managementsystem einzurichten. Es soll erforderlich sein, dass Empfehlungen aus einem Energieaudit- oder Managementsystembericht umgesetzt werden müssen, die sich innerhalb von drei Jahren amortisieren.
Dabei sollen die Umsetzungskosten insgesamt nicht höher sein müssen als die gewährte Entlastung.
Betriebe sollen die Erfüllung des Investitionserfordernisses innerhalb von 12 Monaten ab der Auszahlung nachweisen. Eine Verlängerung der Frist, soll auf Antrag bei der zuständigen Behörde möglich sein, wenn ein Betrieb eine größere Klimaschutzmaßnahme plant, deren Durchführung sich über mehrere Betrachtungszeiträume erstrecken wird. Eine solche Verlängerung soll ebenfalls begründet werden. Wird der Nachweis der Reinvestition nicht nachgewiesen, soll der Betrieb seine Entlastung wieder zurückbezahlen müssen.
Führt der Betrieb eine Klimaschutzmaßnahme durch, die das notwendige Reinvestitionsmaß überschreitet, soll er hier die Möglichkeit erhalten, diese auch für nachfolgende Reinvestitionserfordernisse, etwa bei Inanspruchnahme einer Entlastung in späteren Jahren, nutzen zu können.
In Abs. 10 soll das Antragsverfahren der Entlastungmaßnahme näher erläutert werden. Der Entlastungsantrag für das vorangegangene Kalenderjahr ist in dem Zeitfenster vom 1. Mai bis zum 30. Juni des Folgejahres bei der zuständigen Behörde elektronisch über das Nationale Emissionszertifikatehandel Informationssystem – NEIS zu stellen. Abweichend davon soll von 1. Oktober 2024 bis zum 30. November 2024 der Entlastungsantrag für die Jahre 2022 und 2023 möglich sein.
Zu Z 24 (§ 27):
Die gegenständlichen Entlastungsmaßnahmen des 8. Abschnittes sind auf Art. 44 AGVO gestützt und basieren auf verschiedene Regelungen der Richtlinie 2003/96/EG vom 27.10.2003 zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom, ABl. L 283 vom 30.10.2003 S. 51 (Energiebesteuerungsrichtlinie). In Abs. 2 soll sichergestellt werden, dass die durch die AGVO geforderten Veröffentlichungs- bzw. Berichtserstattungsbestimmungen vorgesehen werden.
Zu Z 26 (§ 29 Abs. 5):
Bei der Überprüfung von Anträgen soll sich die zuständige Behörde der Einrichtungen der Finanzverwaltung gemäß § 49 BAO bedienen können. Dies soll unter anderem die Probenziehung und die Laboranalyse von Energieträgern erleichtern.
Zu Z 30 (§ 34):
In § 34 soll die Bestimmung bezüglich des Inkrafttretens der Entlastungsmaßnahmen angepasst werden. So sollen die Regelungen mit Ablauf jenes Tages in Kraft treten, wenn die beihilferechtlichen Voraussetzungen vollständig erfüllt sind. Da die neu novellierten Entlastungsmaßnahmen auf Art. 44 AGVO gestützt sein sollen, soll die Erfüllung der dort normierten Vorgaben zur Wahrung der Publizität durch Kundmachung im BGBl. II kundgemacht werden. Dadurch soll für alle Rechtsunterworfenen ermöglicht werden, dass formelle in Kraft treten der Bestimmungen nachvollziehen zu können. Unverändert der bisherigen Rechtslage sollen die Entlastungsmaßnahmen für Sachverhalte ab dem Jahr 2022 rückwirkend in Anspruch genommen werden können. Außerdem soll ein Redaktionsversehen in Abs. 4 korrigiert werden.
Zu Z 31 und 32 (Anlage 1):
Die Heranziehung von Anlage 1 soll auf die Einführungsphase beschränkt werden. In der Überführungsphase soll stattdessen Anlage 3 angewendet werden.
Zu Z 33 (Anlage 3):
Durch die Aufnahme von Anlage 3 im NEHG 2022 soll ein Gleichklang mit Anlage 12 des EZG 2011 für die Übergangsphase geschaffen werden. Anlage 3 soll enthalten, welche Brennstoffe vom Anwendungsbereich des NEHG 2022 in der Überführungsphase erfasst sein sollen. Als Brennstoffe iSd NEHG 2022 sollen demnach Energieträger gemäß Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie 2003/96/EG gelten.
*****
Präsident Ing. Norbert Hofer: Der Abänderungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht. Er steht somit auch in Verhandlung.
Zu Wort gelangt jetzt MMMag. Dr. Axel Kassegger. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter MMMag. Dr. Axel Kassegger (FPÖ): Ja, wir werden diesem Gesetz grundsätzlich nicht zustimmen. Ich werde auch erläutern, warum. Der Herr Minister ist ja auch nicht nur ausgebildeter, sondern absoluter Experte, Professor, Volkswirt, ehemaliger Leiter des IHS. Ich stelle jetzt die Hypothese oder die Behauptung auf, Sie müssen da viele Dinge, die Sie inhaltlich nicht gut finden können, gutheißen und gute Miene zum bösen Spiel machen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie als Volkswirt diese Vorgehensweise gutheißen, die sich ja permanent so darstellt, dass zuerst einmal belastet wird beziehungsweise dass die Regierung beziehungsweise die Kommission der Wirtschaft und der Bevölkerung ins Knie schießt und in einem weiteren Schritt dann die Subventionsmaßnahmen greifen, also Salben, sündteure Salben, verabreicht werden.
Diese Systematik kennen wir bereits von der Coronapolitik: zuerst die Unternehmen zusperren und dann um 60 Milliarden Euro sozusagen Salben verteilen – eine ähnliche Systematik und Logik. Das verstehe ich darunter, dass Sie damit ein Problem haben müssen, denn das ist ja die Systematik eines planwirtschaftlich denkenden Menschen, der einer Ideologie nachläuft, und diese Ideologie lautet: Wir retten die Welt, indem Europa aufhört, Treibhausgase zu emittieren.
Wir wissen, wir emittieren 8 Prozent der Treibhausgase und gehen zumindest als leuchtendes Beispiel voran. Das Problem ist nur, dass sich die übrige Welt nicht daran hält und nicht mitgeht. Diese Planwirtschaft nach der Methode zuerst ins Knie schießen und dann mit Milliardenbeträgen helfen führt im Ergebnis zu Folgendem – Kollege Taschner hat es heute schon in einer anderen Diskussion gesagt –: Es ist unverantwortlich den nächsten Generationen gegenüber, Budgetdefizite in Milliardenhöhe zu produzieren – vollkommen richtig.
Der Herr Finanzminister ist heute leider nicht da. ÖVP-Finanzminister Brunner ist der Inhaber des Rekords, des absoluten Negativrekords, des größten Jahresbudgetdefizites in der Geschichte der Zweiten Republik – also irgendwie habe ich da jetzt eine kleine Wort-Bild-Schere, was die Wirtschaftskompetenz der ÖVP betrifft.
Auch im Zertifikatehandel dasselbe Muster: Wir belasten die Unternehmen auf der einen Seite und auf der anderen Seite wird dann ausgeschüttet, geholfen – über den Klimabonus, das haben wir heute schon gehört, der ist ja „das Herzstück der ökosozialen Steuerreform“, Zitat Frau Bundesminister Gewessler, weil es wirkt, weil wir die Emissionen verringert haben. Jetzt stelle ich einmal die rhetorische Frage: Könnte das vielleicht damit zu tun haben, dass wir unsere Industriebetriebe und unsere europäische Industrie mit dieser Planwirtschaft zerstören? – Frage. Das könnte vielleicht auch sein – wenn man über Ursache-Wirkung-Zusammenhänge wirklich ernsthaft nachdenkt.
Also diesen ganzen Zertifikatehandel, der ja jetzt ausgedehnt werden soll, lehnen wir ab. Es sind ja bisher rund 10 000 große Industrieunternehmen betroffen. Der Zertifikatehandel soll auf Seeverkehr, Luftverkehr, Straßenverkehr und auch auf die Gebäude ausgedehnt werden. Das heißt, diese Planwirtschaft, diese milliardenteure Planwirtschaft, soll noch ausgedehnt werden. Das lehnen wir ab. Das Ziel, wie gesagt, ist: null CO2-Emissionen im kleinen Europa. Wir haben es heute schon gehört: 5 Prozent der Weltlandfläche, 15 Prozent – noch! – des GDPs – noch, sage ich, denn wenn wir so weitertun, und das ist jetzt wirklich nicht zum Spaßen, wenn wir als Europa so weitertun, dann werden wir im globalen Wettbewerb, und in dem befinden wir uns und zu dem bekennen wir uns auch, nicht bestehen. Insoweit ist es auch nicht ganz logisch, dass wir sagen, ja, wir bekämpfen das Carbonleakage jetzt mit Zöllen. Das ist eigentlich für eine exportorientierte Nation, wie es Österreich ist – und das ist auch gut so –, einem klugen Schachzug diametral entgegengesetzt. Abgesehen davon ist das eine weitere Belastung, wiederum inflationstreibend, und zum anderen ist ja mit
Gegenmaßnahmen zu rechnen, die ja dann wieder unsere exportorientierte Wirtschaft betreffen.
Also das ist alles nicht zu Ende gedacht. Das ist Planwirtschaft at its worst, würde ich fast sagen, und das ist durch die Österreichische Volkspartei als ehemalige Wirtschaftspartei schwer erklärbar. Jetzt könnte man sagen, das ist die Idee der Grünen gewesen. – Nein! In der Europäischen Kommission ist Frau Ursula von der Leyen, Mitglied der Europäischen Volkspartei, und das ist ja deren Baby, würde ich sagen: Fit for 55 et cetera.
Wir sind ernsthaft in Sorge – nicht nur in Sorge, wir sind uns dessen gewiss –, dass dieser Weg für die europäische Wirtschaft einen Irrweg darstellt. Wir sehen es ja auch an der deutschen Wirtschaft. Wir sehen es ja jetzt schon an den Inflationszahlen, dass wir die Inflation nicht in den Griff bekommen und die Zahl der Konkurse steigt. Wir haben heute wieder gelesen: AT&S muss 1 000 Leute freisetzen. Das fängt ja schon an, beziehungsweise wir sind ja mittendrin.
Der Vergleich mit Deutschland mag vielleicht stimmen, aber das ist ja kein Vergleich. Ich vergleiche mich doch nicht mit dem Schlechtesten, mit der Ampelregierung. (Abg. Gödl: Und was sagst du zu Osram Premstätten? Was sagst du zu Osram Premstätten? Du bist aus dem Wahlkreis! Du bist aus dem Wahlkreis, du könntest ein bissel mehr Überblick haben!) – Bitte? (Abg. Gödl: Du bist aus dem Wahlkreis Graz, Graz-Umgebung! Du könntest ein bissel einen besseren Überblick haben! Was sagst du zu Osram Premstätten in dem Zuge?) – Ja. (Abg. Gödl: Ja?) – Ja, das ist eine Ausnahme. (Abg. Gödl: Na das ist keine Ausnahme! – Ruf bei der FPÖ: 600 Millionen Euro!) Was sage ich zu AT&S? (Abg. Gödl: Das ist, weil du nie im Wahlkreis unterwegs bist! Darum hast du keine Ahnung von unserer Wirtschaftsentwicklung! Das ist es! – Weiterer Ruf bei der ÖVP: Ja, genau! – Beifall bei der ÖVP. – Heiterkeit des Redners.) Der Kollege sagt, ich habe keine Ahnung von unserer Wirtschaftsentwicklung. (Abg. Gödl: Na, du bist nirgends unterwegs! Das ist mir - -! Er war fünf Jahre nie im Wahlkreis, wirklich!) – Ich lese aber die Zeitung.
(Abg. Gödl: Er ist einer der Politiker, die sieht man fünf Jahre nie im Wahlkreis!) Ich lese aber die Zeitung. Kollege Gödl ist ein bisschen aufgeregt, weil er auch im Wahlkreis Graz und Umgebung unterwegs ist. (Abg. Gödl: Dann reden wir das nachher!) Nützt aber nichts: Ihre Wirtschaftspolitik ist keine Wirtschaftspolitik, das ist eine Planwirtschaft, die die Inflation natürlich weiter antreibt. (Abg. Gödl: Du bist nie unterwegs, nie! Du bist in Südamerika und überall, aber nie im Wahlkreis!)
Ein Vergleich mit Deutschland bringt auch nichts. Wir sind da in vielen Bereichen gleich schlecht, und in einem Bereich sind wir noch schlechter, nämlich in jenem der Unterstützung der energieintensiven Industrie. Da sind wir weiter beim Pflaster: Zuerst wird sozusagen ins Knie geschossen, mit Zertifikatsverpflichtungen in Millionenhöhe, und dann kommt aber das Pflaster nicht, in dem Fall das Strompreiskosten-Ausgleichsgesetz; Sie lassen die österreichische Industrie im Regen stehen, in der Ungewissheit stehen.
Die Deutschen haben das jetzt zumindest bis 2030 von der Perspektive her verlängert, aber Sie schlafen in der Pendeluhr. Auch da gibt es eine Aufforderung der oberösterreichischen Landesregierung (Abg. Schallmeiner: Der oberösterreichischen Landesregierung?) – und ich zitiere hier –: In der Begründung mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und hohen Zertifikatspreisen im europäischen Emissionshandelssystem sind Österreichs Bevölkerung und seine Wirtschaft weiterhin mit gestiegenen Stromkosten konfrontiert. – Zitatende.
Aus diesem Grund muss man hier helfen, Sie tun es aber nicht. Sie wissen das ja ganz genau. Es wird auch, glaube ich, noch ein Antrag, ein Fristsetzungsantrag von Kollegin Doppelbauer gestellt werden. Also schauen Sie bitte, dass Sie wenigstens hier in die Bewegung kommen und unserer österreichischen Industrie eine entsprechende Perspektive und Sicherheit geben. (Beifall bei der FPÖ. – Abg. Litschauer: Oberösterreich hat noch kein Windradl zugelassen! – Ruf bei der FPÖ: Starke Rede!)
20.38
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt nun Mag. Dr. Jakob Schwarz. – Bitte, Herr Abgeordneter.
Abgeordneter Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA (Grüne): Jetzt zu Tagesordnungspunkt 11: Es gibt nämlich noch eine zweite erfreuliche Maßnahme oder sozusagen eine Entwicklung beim Klimabonus. Der wäre jetzt nämlich auf 150 Euro angestiegen, wenn nicht die Emissionen entsprechend im Zeitraum um 5 Prozent zurückgegangen wären. Das hat dazu geführt, dass jetzt bei der CO2-Bepreisung weniger Volumen eingenommen wurde und sich entsprechend nur 145 Euro als Klimabonus ausgegangen sind.
Das ist ein Teilerfolg der Klimapolitik dieser Bundesregierung, nicht nur auf die CO2-Bepreisung zurückzuführen, aber auf die ganze Reihe, den ganzen Instrumentenkoffer, der zur Anwendung gekommen ist. (Abg. Matznetter: ... einen warmen Winter!) Das hat dazu geführt, dass nach Jahrzehnten, von 1990 bis kurz vor Antritt dieser Bundesregierung, in denen die Emissionen durchgängig immer ungefähr bei 80 Millionen Tonnen waren, seit diese Bundesregierung mit einer ambitionierten Klimapolitik arbeitet – dazu zählt auch diese CO2-Bepreisung –, die Emissionen runtergegangen sind, auf jetzt mittlerweile 67 Millionen Tonnen, das heißt, es gibt eine dramatische Reduktion der CO2-Emissionen.
Klimaforscher:innen und Wirtschaftsexpert:innen sind sich darin einig, dass es für eine wirkungsvolle Klimapolitik immer auch eine CO2-Bepreisung braucht. Die Emissionen müssen einen Preis haben, sonst ist natürlich überhaupt kein Anreiz gegeben, diese zu reduzieren. Ihr macht halt immer einen Abbieger, wenn es dann wirklich um ernsthafte Klimapolitik geht. (Beifall bei den Grünen.) Da gibt es immer irgendeinen Grund, warum dieses nicht geht und warum jenes nicht geht. Ein Grund lässt sich immer finden, aber das Klima ist bei euch halt nicht in der ersten Reihe; das ist so.
Umgekehrt ist es natürlich erfreulich, dass der Emissionshandel jetzt quasi auch auf europäischer Ebene auf jene Sektoren ausgeweitet wird, die wir hier in der
österreichischen CO2-Bepreisung schon drin haben, nämlich auf das kleine Gewerbe, die Landwirtschaft, den Verkehr und die Gebäude. Das zeigt auch, dass das grundsätzlich erfolgreich ist. Ökosoziale Steuerreform goes Europe, sage ich dazu. Ich bin sehr erfreut, dass das so klappt. (Beifall bei den Grünen.)
Damit sind mit ETS1 und ETS2 75 Prozent der Emissionen im Emissionshandel abgedeckt und werden quasi dementsprechend mit einem harten Deckel bearbeitet.
In Richtung Axel Kassegger: Also dass ihr mit dem Klimaschutz nicht viel am Hut habt, das kann ich ja nachvollziehen, aber eine CO2-Bepreisung, einen Emissionshandel als „Planwirtschaft“ zu bezeichnen, das ist schon äußerst abenteuerlich (Abg. Kassegger: Na was denn? Das sind ja alles planwirtschaftliche Vorgaben!), das ist ja quasi die parademarktwirtschaftliche Maßnahme zum Klimaschutz. Man muss ja nicht dafür sein, es gibt Leute, die dagegen sind, aber mit Planwirtschaft hat das überhaupt nichts zu tun. (Beifall bei den Grünen.)
Diese Überführung vom österreichischen auf den europäischen Emissionshandel führt auch dazu, dass es jetzt diese Novelle braucht, die dafür sorgen soll, dass es eben nicht zu Doppelbelastungen, zu übermäßigen Berichtspflichten und so weiter kommt und dass auch die Verwaltungskosten nicht überschießend sind.
Das funktioniert: Es gibt im ETS2 auch einen Preisstabilisierungsmechanismus, der dazu beiträgt, dass, wenn die Energiepreise besonders hoch sind, die entsprechende CO2-Bepreisung etwas geringer ausfällt, damit es zu keinen Schocks bei den Energiepreisen für die Haushalte kommt. Es gibt einen Transparenzmechanismus, der dafür sorgt, dass die Energiekonzerne diese Erhöhungen nicht einfach quasi ein bisschen stärker durchführen als notwendig und dann auf Kosten der Haushalte höhere Gewinne erwirtschaften.
Ein Verhandlungserfolg der europäischen Grünen ist, dass die Einnahmen aus dieser europäischen CO2-Bepreisung im ETS2 für Klimaschutzmaßnahmen verwendet werden sollen (Beifall bei den Grünen), was großartig ist, und es wird
einen Klimasozialfonds geben. Das heißt, auch da steckt wieder die Intention dahinter, die Dinge nicht einfach nur teurer zu machen, wie es vielleicht die NEOS machen wollten, sondern dass es auch Unterstützung für jene Menschen gibt, denen es halt schwerer fällt, beispielsweise eine Heizung zu tauschen oder Ähnliches. Dafür gibt es auch über 80 Milliarden Euro in sechs Jahren. (Beifall bei den Grünen sowie der Abg. Bogner-Strauß.)
Der Nachteil dieser Rückverteilung ist, glaube ich, auch klar: Es sind mehrere Kanäle, ähnlich wie bei der deutschen CO2-Bepreisung. Es ist nicht so leicht nachvollziehbar, wie das Geld, das quasi durch diese CO2-Bepreisung eingenommen wird, dann wieder zurückfließt. Da komme ich wieder zurück zum Klimabonus – das ist halt der große Vorteil von unserem Klimabonus –: Es ist einfach klar, das Geld wird da eingenommen und geht über den Klimabonus wieder zurück; das ist sehr transparent und auch sehr einfach nachvollziehbar. (Beifall bei den Grünen sowie der Abg. Bogner-Strauß.)
Ich bitte also um Unterstützung für diese wirkungsvolle Maßnahme, vor allem von all jenen, die den Klimaschutz wirklich ernst nehmen. – Danke. (Beifall bei den Grünen sowie der Abg. Bogner-Strauß.)
20.43
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt nun Frau Dipl.-Ing.in Karin Doppelbauer. – Bitte, Frau Abgeordnete.
Abgeordnete Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer (NEOS): Herr Präsident! Herr Minister! Ich spreche jetzt auch noch einmal zum Emissionshandelssystem, das ja vom nationalen System auf die europäische Ebene gehoben werden soll. Und ja, wir NEOS hätten prinzipiell auch sehr viel Gutes darin gesehen, weil es aus unserer Sicht wirklich gut ist, wenn eben ein Zertifikatshandel gegeben ist, mit dem man einen genauen Plan für die Unternehmen hat, die wissen: jedes Jahr 5 Prozent weniger – aus unserer Sicht ein marktkonformes Tool, um da eben auch effizient zu wirken und tatsächlich auch die Klimaziele zu erreichen. Noch
dazu geht es um einen europaweiten Handel mit Zertifikaten – auch das finden wir sehr gut, weil es da natürlich dann auch zu einer Vereinheitlichung der Systeme in ganz Europa kommt.
Wir hätten dem auch sehr, sehr gerne zugestimmt, haben uns aber dann eines Besseren belehren lassen. Das ist natürlich wieder heute Nacht um Mitternacht passiert, als dann ein 15-seitiger Abänderungsantrag dahergekommen ist, in dem ein vollkommen neues nationales Kompensationssystem drinnen ist. Die Dinge wurden tatsächlich offenbar abgetauscht – wahrscheinlich Klimabonus gegen Agrardiesel, I don’t know, oder beides wird in dem Fall kommen. So kann man aus unserer Sicht parlamentarisch einfach nicht arbeiten. (Beifall bei den NEOS.)
Wir hatten letzte Woche eine Ausschusssitzung, da hätte man das durchaus schon diskutieren können, aber da war davon überhaupt keine Rede. Es gab im Ausschuss schon ein Abänderungsantrag, bei dem wir noch mitgegangen sind, weil wir ja konstruktiv sein wollen, aber noch einmal: Mit diesem zusätzlichen Paket, das Sie da geschickt haben, können wir jetzt unsere Zustimmung nicht geben.
Wofür Sie aber wahnsinnig viel Zeit gehabt hätten, liebe ÖVP und liebe Grüne, wofür Sie wirklich viel, viel Zeit gehabt hätten, ist, sich mit dem SAG, dem Strompreiskosten-Ausgleichsgesetz, wie es so sperrig heißt, also der Strompreiskompensation für Industrieunternehmen, zu beschäftigen. Wir haben dazu seit letztem Jahr einen Antrag im Ausschuss liegen, den Sie bis jetzt ja durchaus immer gerne mit uns diskutieren, aber Sie tun eben nichts.
Das ist schon ein wenig fahrlässig, weil die Industrie und die Betriebe, die im internationalen Wettbewerb stehen, es echt brauchen würden, dass Sie sie da unterstützen. Das sind Unternehmen, die standorttechnische Nachteile haben, denn wie wir wissen, ist das SAG ja ein europäisches Instrument der Union, um Unternehmen zu unterstützen, die elektrifizieren oder eben schon elektrifiziert haben und höhere Strompreise haben. Denen helfen Sie nicht. Das sind genau jene Unternehmen, die Sie haben wollen. Die tun etwas, die elektrifizieren, die sind hier in Österreich daheim, und die wollen tatsächlich nur die gleichen fairen
Bedingungen, wie sie die restlichen Länder in Europa haben. Wie gesagt, die meisten europäischen Länder haben das bis 2030 umgesetzt, und Sie sitzen hier und rühren sich nicht.
Das finden wir sehr bedenklich. Ich glaube, Sie tragen politisches Hickhack auf dem Rücken der Unternehmerinnen und Unternehmer aus, und das ist in dieser Zeit richtig fahrlässig. Wenn Sie hier also etwas tun wollen – Sie hatten genug Zeit, sich vorzubereiten –, dann bitte ich Sie sehr, stimmen Sie auch heute unserem Antrag zu, den wir jetzt ja auch stellen werden.
Wir werden ihn im nächsten Ausschuss wieder aufs Tapet bringen. Wir NEOS werden nämlich nicht aufgeben, wir wollen, dass Sie der Industrie und den Betrieben helfen, um in Österreich in der Zukunft erfolgreich wirtschaften zu können. (Beifall bei den NEOS.)
20.46
Präsident Ing. Norbert Hofer: Nächster Redner ist Herr Abgeordneter Kai Jan Krainer. – Bitte, Herr Abgeordneter. (Ruf bei der ÖVP: Na geh!)
Abgeordneter Kai Jan Krainer (SPÖ): Heute ist etwas sehr Wichtiges passiert – also der heutige Finanzminister ist so lethargisch wie der andere; ich weiß nicht, was Sie (in Richtung Bundesminister Kocher) auf der Regierungsbank hier machen, ob Sie sich für die OeNB vorbereiten –, heute ist schon etwas Wichtiges passiert, denn wir haben heute im Zuge des Europäischen Semesters von der Europäischen Kommission quasi unser Zeugnis bekommen.
Wir sind eh schon die Schlechtesten bei der Inflation und so weiter, aber neu ist, dass wir einen Blauen Brief bekommen haben. Wir haben heute aufgrund unserer Budgetpolitik einen Blauen Brief bekommen. Wir sind eines von vier Ländern in der Europäischen Union, zu denen die Europäische Kommission sagt: Ihr habt euer Budget nicht im Griff! Ihr habt euer Budget nicht im Griff! (Ruf bei der ÖVP: Gott sei Dank haben wir dich!) Heute haben wir den Brief bekommen.
Was machen wir jetzt im Nationalrat, nämlich heute durch den Abänderungsantrag? – 300 Millionen Euro da – war nicht budgetiert –, 600 Millionen Euro dort – ist nicht budgetiert. (Abg. Zarits: Schaut euch eure Anträge an! – Ruf bei der ÖVP: Seid wann seids ihr gegen das Geldausgeben?) Gegenfinanzierung: keine Rede. Wir erhöhen heute mit diesem Tagesordnungspunkt das Budget, das wir ohnehin nicht im Griff haben, noch einmal um einige Hundert Millionen Euro. Das geht so nicht weiter, ehrlich gesagt! (Beifall bei der SPÖ sowie des Abg. Scherak. – Zwischenrufe bei der ÖVP.)
Das Budget ist vollkommen aus dem Ruder gelaufen. Im ersten Quartal haben wir in diesem Land ein Rekorddefizit von 8,1 Milliarden Euro gemacht. Noch nie haben wir solch ein Defizit in einem Quartal gemacht. In schlechten Jahren waren es am Ende des Jahres 8,1 Milliarden Euro, wenn ich jetzt Covid weglasse – in schlechten Jahren! Wir machen das im ersten Quartal; das sind 2 Milliarden Euro Einmaleffekte, aber 6 Milliarden Euro sind strukturell. Ehrlich gesagt werden wir heuer auf 25 Milliarden Budgetdefizit in Euro kommen. Das ist eine Horrorzahl!
Wenn Sie sich anschauen, was uns die Europäische Kommission geschickt hat: Es gibt eine Zahl, die noch schlimmer ist, das ist das sogenannte strukturelle Defizit. Wenn man die Konjunktur rausrechnet – weil wir ganz schlecht bei der Konjunktur sind –, wenn man das rausrechnet: Letztes Jahr sind es minus 2,4 Prozent, heuer minus 2,5 Prozent, nächstes Jahr minus 2,7 Prozent. Das strukturelle Defizit ist in der Zwischenzeit fast so hoch wie das Maastrichtdefizit. (Abg. Egger: Gott sei Dank habt ihr den Babler!) Ehrlich gesagt sind die Budgetzahlen wie eine Nachricht aus der Hölle. Bitte, wann wacht ihr endlich auf und hört auf, das Geld zu verbrennen? (Beifall bei der SPÖ sowie der Abgeordneten Künsberg Sarre und Scherak.)
Ich meine, ihr habt offenbar schon aufgegeben. Vollkommen egal, wer hier als Finanzminister sitzen wird – Herr Kocher wird es nicht sein, Herr Brunner wohl auch nicht –, er ist eine arme Sau. Er muss diesen wahninnigen Saustall, den Sie hier hinterlassen, aufräumen.
So eine Budgetpolitik, wie es sie jetzt gegeben hat, hat es in den letzten 22 Jahren nicht gegeben! (Abg. Wöginger: Geh hör auf! Hör doch auf! Gib doch eine Ruh’! – Weitere Zwischenrufe bei der ÖVP.) Ich bin seit 22 Jahren im Budgetausschuss – im Gegensatz zu dir, Kollege Wöginger! Das sind Zahlen aus der Hölle! Jeder Tag, an dem Sie noch in der Regierung sind, ist dramatisch für die Zukunft dieses Landes. (Abg. Wöginger: Sozialisten können nicht rechnen! Geh hinein und setz dich nieder!)
Sie haben fertig! Es wäre gut, wenn Sie aufhören, das Geld zu verbrennen. – Danke schön. (Beifall bei der SPÖ sowie bei Abgeordneten von FPÖ und NEOS. – Rufe und Gegenrufe zwischen Abgeordneten von ÖVP und SPÖ.)
Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. (Abg. Krainer: Das sind Zahlen aus der Hölle! – Abg. Wöginger: Gib eine Ruh’! So ein Blödsinn! – Abg. Matznetter – in Richtung ÖVP –: Sagen Sie einmal Entschuldigung! – Weitere Rufe und Gegenrufe zwischen Abgeordneten von ÖVP und SPÖ.)
Wünscht der Herr Berichterstatter ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall.
Wir gelangen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf in 2545 der Beilagen.
Hiezu haben die Abgeordneten Peter Haubner, Mag. Dr. Jakob Schwarz, Kolleginnen und Kollegen einen Zusatz- beziehungsweise Abänderungsantrag eingebracht.
Ich werde daher zunächst über die vom erwähnten Zusatz- beziehungsweise Abänderungsantrag betroffenen Teile und schließlich über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes abstimmen lassen.
Die Abgeordneten Peter Haubner, Mag. Dr. Jakob Schwarz, Kolleginnen und Kollegen haben einen Zusatz- beziehungsweise Abänderungsantrag betreffend Änderung der Ziffern 1, 3, 4 und 6, Umnummerierung und Änderung der
ursprünglichen Ziffern 7 bis 11 sowie Einfügung neuer Ziffern 7 bis 18, 20 bis 25, 29, 31 bis 33 eingebracht.
Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist mehrheitlich angenommen.
Wir kommen schließlich zur Abstimmung über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang in der Fassung des Ausschussberichtes.
Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. – Auch das ist mehrheitlich angenommen.
Wir kommen zur dritten Lesung.
Ich bitte jene Damen und Herren, die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, um ein diesbezügliches Zeichen. – Das ist die Mehrheit. Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung angenommen.
Die Tagesordnung ist erschöpft.
Präsident Ing. Norbert Hofer: Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über den Antrag der Abgeordneten Doppelbauer, dem Ausschuss für Wirtschaft, Industrie und Energie zur Berichterstattung über den Antrag 3582/A(E) eine Frist bis 7. Juni 2024 zu setzen.
Ich bitte jene Damen und Herren, die für den Fristsetzungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt.
Präsident Ing. Norbert Hofer: Ich gebe bekannt, dass in der heutigen Sitzung die Selbständigen Anträge 4017/A bis 4048/A(E) eingebracht worden sind.
Verlangen im Sinne des § 99 Abs. 2 GOG-NR
Präsident Ing. Norbert Hofer: Weiters gebe ich bekannt, dass im Zusammenhang mit dem Selbständigen Antrag 4017/A auf Durchführung eines besonderen Aktes der Gebarungsüberprüfung durch den Rechnungshof, und zwar betreffend „den Präventionsmechanismen um Spionagevorfälle im Bundesministerium für Inneres, im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten sowie im Bundesministerium für Landesverteidigung zu verhindern“, ein ausreichend unterstütztes Verlangen gemäß § 99 Abs. 2 der Geschäftsordnung gestellt wurde.
Da die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind, ist diese Gebarungsüberprüfung auch ohne Beschluss des Nationalrates durchzuführen.
*****
Die nächste Sitzung des Nationalrates, die geschäftsordnungsmäßige Mitteilungen und Zuweisungen betreffen wird, berufe ich für 20.53 Uhr – das ist gleich im Anschluss an diese Sitzung – ein.
Diese Sitzung ist geschlossen.
Schluss der Sitzung: 20.53 Uhr
|
Impressum: Parlamentsdirektion 1017 Wien
|